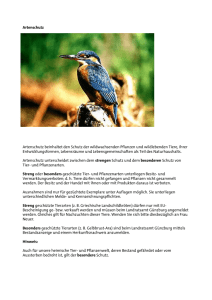Versöhnung mit der Wildnis
Werbung
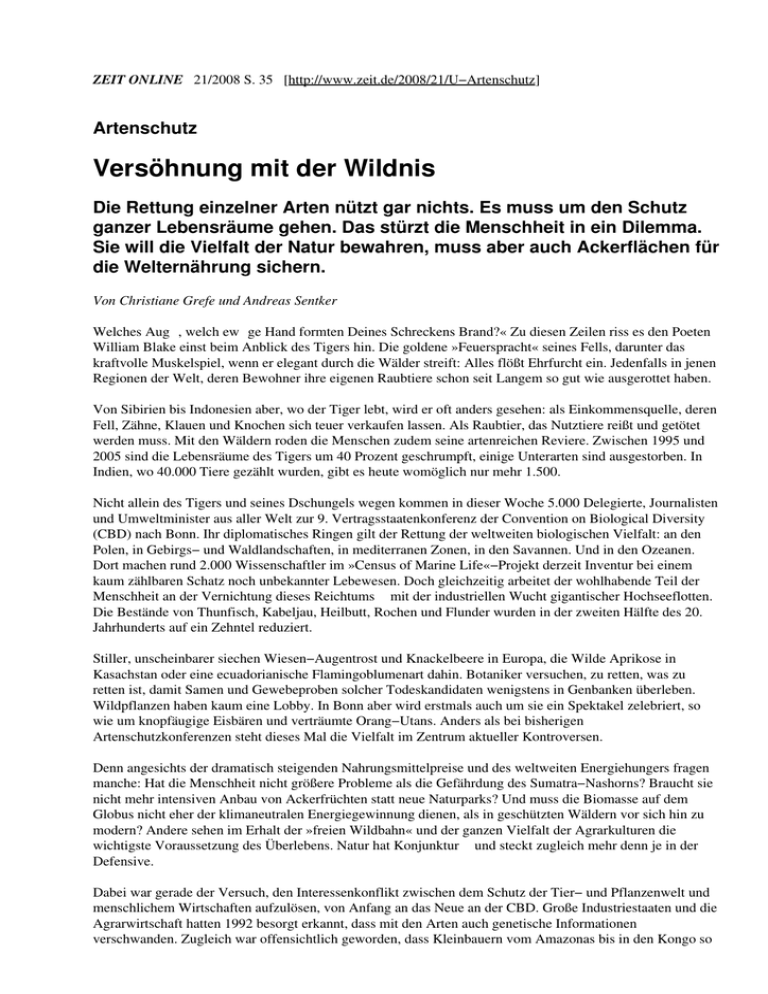
ZEIT ONLINE 21/2008 S. 35 [http://www.zeit.de/2008/21/U−Artenschutz] Artenschutz Versöhnung mit der Wildnis Die Rettung einzelner Arten nützt gar nichts. Es muss um den Schutz ganzer Lebensräume gehen. Das stürzt die Menschheit in ein Dilemma. Sie will die Vielfalt der Natur bewahren, muss aber auch Ackerflächen für die Welternährung sichern. Von Christiane Grefe und Andreas Sentker Welches Aug , welch ew ge Hand formten Deines Schreckens Brand?« Zu diesen Zeilen riss es den Poeten William Blake einst beim Anblick des Tigers hin. Die goldene »Feuerspracht« seines Fells, darunter das kraftvolle Muskelspiel, wenn er elegant durch die Wälder streift: Alles flößt Ehrfurcht ein. Jedenfalls in jenen Regionen der Welt, deren Bewohner ihre eigenen Raubtiere schon seit Langem so gut wie ausgerottet haben. Von Sibirien bis Indonesien aber, wo der Tiger lebt, wird er oft anders gesehen: als Einkommensquelle, deren Fell, Zähne, Klauen und Knochen sich teuer verkaufen lassen. Als Raubtier, das Nutztiere reißt und getötet werden muss. Mit den Wäldern roden die Menschen zudem seine artenreichen Reviere. Zwischen 1995 und 2005 sind die Lebensräume des Tigers um 40 Prozent geschrumpft, einige Unterarten sind ausgestorben. In Indien, wo 40.000 Tiere gezählt wurden, gibt es heute womöglich nur mehr 1.500. Nicht allein des Tigers und seines Dschungels wegen kommen in dieser Woche 5.000 Delegierte, Journalisten und Umweltminister aus aller Welt zur 9. Vertragsstaatenkonferenz der Convention on Biological Diversity (CBD) nach Bonn. Ihr diplomatisches Ringen gilt der Rettung der weltweiten biologischen Vielfalt: an den Polen, in Gebirgs− und Waldlandschaften, in mediterranen Zonen, in den Savannen. Und in den Ozeanen. Dort machen rund 2.000 Wissenschaftler im »Census of Marine Life«−Projekt derzeit Inventur bei einem kaum zählbaren Schatz noch unbekannter Lebewesen. Doch gleichzeitig arbeitet der wohlhabende Teil der Menschheit an der Vernichtung dieses Reichtums mit der industriellen Wucht gigantischer Hochseeflotten. Die Bestände von Thunfisch, Kabeljau, Heilbutt, Rochen und Flunder wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf ein Zehntel reduziert. Stiller, unscheinbarer siechen Wiesen−Augentrost und Knackelbeere in Europa, die Wilde Aprikose in Kasachstan oder eine ecuadorianische Flamingoblumenart dahin. Botaniker versuchen, zu retten, was zu retten ist, damit Samen und Gewebeproben solcher Todeskandidaten wenigstens in Genbanken überleben. Wildpflanzen haben kaum eine Lobby. In Bonn aber wird erstmals auch um sie ein Spektakel zelebriert, so wie um knopfäugige Eisbären und verträumte Orang−Utans. Anders als bei bisherigen Artenschutzkonferenzen steht dieses Mal die Vielfalt im Zentrum aktueller Kontroversen. Denn angesichts der dramatisch steigenden Nahrungsmittelpreise und des weltweiten Energiehungers fragen manche: Hat die Menschheit nicht größere Probleme als die Gefährdung des Sumatra−Nashorns? Braucht sie nicht mehr intensiven Anbau von Ackerfrüchten statt neue Naturparks? Und muss die Biomasse auf dem Globus nicht eher der klimaneutralen Energiegewinnung dienen, als in geschützten Wäldern vor sich hin zu modern? Andere sehen im Erhalt der »freien Wildbahn« und der ganzen Vielfalt der Agrarkulturen die wichtigste Voraussetzung des Überlebens. Natur hat Konjunktur und steckt zugleich mehr denn je in der Defensive. Dabei war gerade der Versuch, den Interessenkonflikt zwischen dem Schutz der Tier− und Pflanzenwelt und menschlichem Wirtschaften aufzulösen, von Anfang an das Neue an der CBD. Große Industriestaaten und die Agrarwirtschaft hatten 1992 besorgt erkannt, dass mit den Arten auch genetische Informationen verschwanden. Zugleich war offensichtlich geworden, dass Kleinbauern vom Amazonas bis in den Kongo so lange wertvolle Bäume für Land und Holz schlagen, wie sie keine anderen Energie− und Einkommensquellen haben; dass indische Ureinwohner den Tiger weiter vergiften, solange er in stacheldrahtbewehrten Reservaten geschützt wird, aus denen man sie selbst vertreibt. Der Naturschutz würde keine Anhänger finden, folgerten seine Protagonisten, wenn er die Bedürfnisse der Einheimischen nach Entwicklung ignoriere. Nicht der Gorilla muss geschützt werden, sondern sein Lebensraum Fortan sollte nicht mehr der einzelne Weißkopfgeier oder Gorilla im Fokus stehen, sondern der Lebensraum für Mensch und Tier. Mit diesem Paradigmenwechsel ging die Verpflichtung einher, ein dichtes Netz von Schutzgebieten zu schaffen und den Schwund der Arten bis zum Jahr 2010 signifikant zu senken. Doch stattdessen hat sich ihr Verlust seither noch beschleunigt. 1,75 Millionen Spezies sind auf der Welt beschrieben, davon 400.000 Pflanzen, 5.500 Säugetiere, 9.800 Vögel, eine Million Insekten. Die große Mehrheit aber ist noch unerforscht. Entsprechend unterschiedlich sind die Angaben, wie viele Arten jeden Tag verschwinden: 70, sagt Edward O. Wilson, der Doyen der Biologen; die G8−Umweltminister rechnen mit 150. Die Tendenz ist eindeutig. Mehr als 16.000 Arten stehen auf der Roten Liste der Internationalen Naturschutzunion (IUCN). Ein Drittel aller Amphibien gilt als bedroht, jede achte Vogel− und jede vierte Säugetierart, bis zu 100.000 Wildpflanzenarten. So ist die Enttäuschung nach 16 Jahren CBD groß: »Der innovative Ansatz, die Natur nachhaltig zu nutzen und zu schützen, muss seine Wirksamkeit leider erst noch unter Beweis stellen«, sagt Barbara Unmüßig von der Heinrich−Böll−Stiftung. Allzu oft gerät das Ziel, ökologische und ökonomische Interessen zu vereinen, ins Hintertreffen, wenn Straßen, Minen und Pipelines gebaut werden, Städte und Industriezonen sich ausbreiten oder Agrarunternehmen nach Flächen für den Anbau von Futtermitteln und Biomasse suchen. Mit den Urwäldern ist inzwischen die Menschheit selbst gefährdet. Denn sie speichern auf natürliche Weise das Klimagas CO2. Fallen die Bäume, steigt die globale Temperatur. Nicht nur auf diese ursächliche Weise hängen Klimaschutz und Artenschutz eng zusammen, sondern auch bei den Folgen: Mit dem Klimawandel wird sich der Artenschwund dramatisch zuspitzen. Manche Biologen vertrauen zwar wie der Münchner Evolutionsbiologe Josef Reichholf auf die evolutionäre Anpassung der Lebenswelt. Die Forscher des Weltklimarates IPCC sehen im Falle einer Temperaturerhöhung von 2,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts jedoch die Auslöschung eines Drittels der Arten voraus. »Wir verlieren die Schlacht!« Um ihren Appell zu bekräftigen, verwendet Monique Barbut, Direktorin der Global Environment Facility, die den internationalen Artenschutz finanziert, nicht einmal mehr den Konjunktiv. Um endlich einen Durchbruch beim Handeln zu erzielen, versuchen Umweltpolitiker, den Nicholas−Stern−Effekt nachzuahmen. Der britische Wirtschaftswissenschaftler hatte 2006 die ökonomischen Kosten des Klimawandels berechnet und mit seiner Botschaft, dass Nichtstun teurer sei als Handeln, in Politik und Wirtschaft einen zuvor unerreichten Bewusstseinswandel erzielt. Eine ähnliche Wirkung erhoffen sich EU−Umweltkommissar Stavros Dimas und Bundesumweltminister Sigmar Gabriel jetzt von einer Expertengruppe um Pavan Sukhdev. Der Manager der Deutschen Bank in London und Direktor des »Green Accounting for Indian States«−Projektes in Delhi soll die globalen volkswirtschaftlichen Schäden des Artenschwunds erheben. Keine leichte Aufgabe, reicht doch die Leistungsbilanz der biologischen Vielfalt von der Regeneration der Böden bis zur Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufs, von der Kühlung des Weltklimas bis zu Arbeitsplätzen in der Agrarindustrie. Wie berechnet man die Kreativität der Evolution, das Vorbild der Natur für neue Technologien in der Bionik oder die Bedeutung noch unbekannter Tiere und Gewächse für die Medizin? Und dann: Ist es nicht ein Teil des Problems, die Natur nur mehr unter dem Blickwinkel ihres Nutzens zu bewerten? Pavan Sukhdev meint: »Die ökonomische Argumentation ist leider die einzige, die zieht.« Doch Zweifel sind angebracht. 1997 veröffentlichte die Zeitschrift Nature eine Studie, in der die Leistungen der Biosphäre mit 16 bis 54 Billionen Dollar berechnet wurden; im selben Jahr lag das gesamte globale Bruttosozialprodukt bei rund 18 Billionen Dollar. Die Zahlen haben niemanden davon abgehalten, kurzfristigen Gewinnen auf Kosten der Artenvielfalt hinterherzujagen. Wie schwierig indes Nutzen und Schützen in Einklang zu bringen sind, zeigt das Beispiel Borneo. Die Regenwälder der drittgrößten Insel der Welt zählen zu den artenreichsten Regionen der Erde. Einst war das Land vollständig von Urwald bedeckt, doch allein zwischen 1985 und 2005 wurden nach einer Studie der Weltbank durchschnittlich 850.000 Hektar Wald abgeholzt. Gegenwärtig fallen zwei Millionen Hektar Wald im Jahr paradoxerweise auch im Dienst des europäischen Umweltgewissens. Auf den gerodeten Flächen sollen Palmen wachsen für mehr Biosprit im Tank. Im malaysischen Teil Borneos versucht man nun den Ausgleich aller Interessen. Dort legen drei Holzkonzerne auf Brachland gewaltige Akazienplantagen an. Das »Grand Perfect s Planted Forest Project« ist mit seiner Fläche von 490.000 Hektar eines der größten Experimente dieser Art. Die schnell wachsenden Akazien werden bereits nach sieben Jahren abgeholzt. Die jährliche Ernte von 3,5 Millionen Tonnen Holz, vor allem für die Papier− und Kartonagenproduktion, soll den Druck auf die bestehenden Urwälder senken. Neben den Aufforstungsflächen, auf denen drei Millionen neue Setzlinge im Monat gepflanzt werden, bleiben Schutzgebiete stehen auf einem Drittel des Grundes. Auch die einheimische Bevölkerung bekommt Flächen für den Anbau ausgewiesen. So arbeiten Holzfäller, Artenschützer und Einheimische zusammen. Ein Fall von Win−win−win? Hilft die Akazie Mensch und Natur, oder ist sie bloß ein Ökofeigenblatt? Umweltschützer bezweifeln das. Zwar sind Akazienwälder artenreicher als die öden Ölpalmenplantagen, die anderswo auf Borneo den Wald verdrängt haben. Und möglicherweise simuliert das Patchwork aus ursprünglichem und aufgeforstetem Wald einen größeren Lebensraum als die Urwaldflecken allein. Die biologische Bestandsaufnahme zeigt jedoch, dass es Gewinner und Verlierer des Projektes gibt: Frösche, Ratten, Hörnchen und einige Fleischfresser fühlen sich offenbar wohl im Schatten der Bäume. Die Vielfalt der Vögel, Echsen, Schlangen und Fledermäuse aber schrumpft. Zudem geht die Fähigkeit der ursprünglichen Wälder, Wasser zu speichern, verloren. Das Gegenteil ist zu beobachten: Akazien saugen das Wasser regelrecht auf, der Pegel sinkt. Sind Plantagen also eine Lösung oder höchstens das kleinere Übel? Sind sie ein Abholzungsprojekt mit Ökofeigenblatt oder die Versöhnung von Mensch und Natur? Darunter stellt man sich im Periyar−Nationalpark zum Schutz des Tigers im indischen Bundesstaat Kerala anderes vor. Dort erhält sanfter Tourismus den Wald und schafft zugleich Einkommen. Ehemalige Wilderer arbeiten als Ranger und Parkwächter. Noch mal anders agiert die ökologisch gesinnte Regierung des brasilianischen Bundesstaats Amazonas. Sie hat die Zona Franca Verde, eine grüne Freihandelszone, eingerichtet. Behutsam wird der Wald als Geldquelle erschlossen, teilweise unter der Regie der indianischen Bevölkerung: mit Dokumentar− und Tierfilmproduktionen, der Ausbildung in nachhaltiger Forstwirtschaft, der Überwachung von Schutzgebieten oder dem Verkauf von Konzessionen für die Vermarktung von Duftstoffen, Medikamenten, exotischen Früchten und Fischen. Trotz solcher Vorzeigeprojekte steht Brasilien wegen neuer Verluste im Kreuzfeuer. Naturschützer und Entwicklungsorganisationen behaupten, dreimal so viel Regenwald wie im Vorjahr sei im ersten Quartal dieses Jahres gefällt worden, um Flächen für Sojamonokulturen zu gewinnen. Zugleich werde der Anbau existenzieller Nahrungspflanzen wie Bohnen und Reis verdrängt, und zwar zugunsten von Zuckerrohrplantagen für die Produktion von Bioethanol auch für Lieferungen nach Deutschland. Gerade hat Sigmar Gabriel ein entsprechendes Kooperationsabkommen mit Brasilien ausgehandelt. Das Umweltministerium beruft sich darauf, dass nur sozial und ökologisch zertifizierter Biosprit importiert werden dürfe. Solche Zertifikate aber lehnt Brasiliens Regierung als Handelshemmnis ab. Nicht nur wegen der Verteidigung seiner Exportinteressen zählte das Land bei den CBD−Verhandlungen bisher zu den Blockierern, sondern auch, weil es die Wachstumsinteressen der Entwicklungsländer verteidigt. Zugeständnisse beim Schutz der Wälder dürften am Ende nur durch hohe finanzielle Transferzusagen zu erreichen sein. »Die meisten Länder mit hoher Artenvielfalt haben nicht das Geld, sie zu schützen«, sagt Kolumbiens Vizepräsident Francisco Santos Calderón. Um etwa ein Drittel wurden die Schutzgebiete seit 1992 ausgeweitet, auf knapp 12 Prozent der globalen Fläche. Die Finanzierung des Schutzes aber stagniert bei rund 10 Milliarden Euro im Jahr, die zudem zu 90 Prozent in den Industrienationen selbst ausgegeben werden. Naturschützer fordern, die Investitionen in die Schutzgebiete zu verdreifachen. Die Bundesregierung hat dazu die Initiative »Life Web« ins Leben gerufen. »Pragmatisch und unbürokratisch« sollen dabei nach Vorstellung des Umweltministeriums Entwicklungsländer wie bei einer Tauschbörse Naturräume benennen, die sie zu schützen bereit wären die Geberländer sollen Finanzierungsangebote unterbreiten. Mit dieser Form des freiwilligen und daher unverbindlichen Ausgleichs wird es nicht getan sein. Der Flächenangriff auf Meere und Wälder ist eine direkte Konsequenz des Konsums in Industrienationen, deren Vorbild zunehmend auch Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien folgen. Immer mehr Menschen wollen Auto fahren und Fleisch essen. Das Naturschutzplädoyer Meena Ramans, der Präsidentin der globalen Umweltorganisation Friends of the Earth aus Malaysia, klingt daher so: »Ihr müsst einfacher leben, damit andere einfach nur leben können.« Mitarbeit: Dirk Asendorpf und Hans Schuh Versöhnung mit der Wildnis Zum Thema DIE ZEIT 21/2008: Die Patentierung der Natur Artenschutz lohnt sich. Pflanzen und Tiere liefern Wirkstoffe für Arzneimittel. Die Entwicklungsländer wehren sich gegen die Beutezüge der Pharmaindustrie [http://www.zeit.de/2008/21/U−Biopiraterie] ZEIT ONLINE /2008: Artenschutz Im Mai berät die UN−Naturschutzkonferenz in Bonn, wie sich die biologische Vielfalt erhalten lässt. Ein Themenspezial zur aktuellen Debatte und zu den Hintergründen. [http://www.zeit.de/themen/wissen/wissenschaft/artenschutz/index] DIE ZEIT, 15.05.2008 Nr. 21