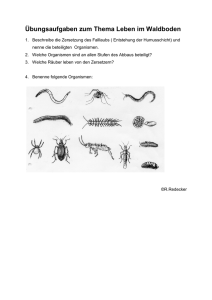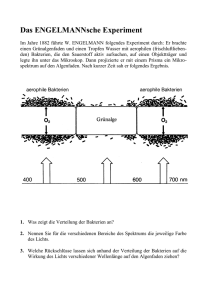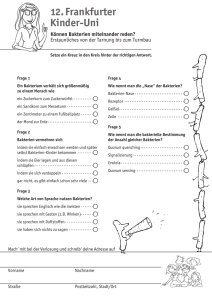Untitled - dtv Verlag
Werbung

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de Monik a Offenberger Sy m bio s e Sym Warum Bündnisse fürs Leben in der Natur so erfolgreich sind Mit 16 farbigen Abbildungen Deutscher Taschenbuch Verlag Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich. Originalausgabe 2014 Deutscher Taschenbuch Verlag © 2014 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten. Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen Umschlaggestaltung: Katharina Netolitzky unter Verwendung eines Fotos von OKAPIA/Thomas Dressler/imagebroker Gesetzt aus der Minion Pro 10,5/13˙ Satz: Greiner & Reichel, Köln Druck und Bindung: Kösel, Krugzell Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany . ISBN 978-3-423-26055-8 Inhalt Vorwort: Niemand ist eine Insel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allianzen zwischen artfremden Organismen vermehren die Vielfalt der Lebensformen auf unserem Planeten 7 I Oasen in der Finsternis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bakterien bilden in der lichtlosen Tiefsee ­Fundamente für ­artenreiche Ökosysteme ohne Beteiligung grüner Pflanzen II Sklaven, Partner und Schmarotzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Der Begriff Symbiose wurde 1878 von einem Botaniker erdacht und bezeichnet das Zusammenleben von Organismen unterschiedlicher Arten III Das Feuer des Lebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mitochondrien haben sich vor Milliarden Jahren aus Bakterien entwickelt und besorgen noch heute als Untermieter in unseren Körperzellen das Atmen IV Grüne Mischwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Korallen bilden gigantische Riffe im Meer und machen sich dabei wie zahlreiche andere Tiere die Fotosynthe­ seleistung ihrer grünen Mitbewohner zunutze V Gemeinsam an Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pilze haben den ersten Pflanzen den Boden bereitet und garantieren bis heute das Überleben aller bedeutenden Vegetationsformen unserer Erde VI Hirten und Gärtner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ameisen betrieben schon Zigmillionen Jahre vor dem Menschen Viehzucht und Landwirtschaft und beherrschen seither sämtliche Land-Ökosysteme VII Gibst du mir, so geb ich dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Organismen aus allen Reichen der Lebewesen schmieden mit einem oder mehreren Partnern Allianzen zum gegenseitigen Nutzen VIII Wir sind besiedelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Mikroben leben zu Milliarden auf und in unserem Körper und bestimmen wesentlich unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden mit IX Arzneien, Dünger, Pflanzenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Symbiosen liegen allen lebenswichtigen Ressourcen des Menschen zugrunde und stellen zahlreiche Wirtschaftsgüter bereit X Wir sind Symbionten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Die Symbioseforschung wird durch moderne Techniken vorangetrieben und führt zu einem neuen und umfassenden Bild des Lebens und der menschlichen Natur Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Bildnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Vorwort: Niemand ist eine Insel Die Idee zu diesem Buch entstand in einem kleinen Park mitten in München, nicht weit von meiner Wohnung. Da gibt es eine Wiese voller Klee und Löwenzahn, gesäumt von Hollerbüschen und mächtigen Kastanienbäumen. Ab und zu gehe ich dort spazieren und mache meine Beobachtungen. Denn so unscheinbar sich diese »städtische Grünfläche« zunächst ausnimmt, so vielseitig sind ihre Bewohner: Wacholderdrosseln hasten übers Gras und ziehen Würmer aus der Erde. Kleiber suchen die Baumstämme nach Maden ab. Kohlmeisen zerpicken Kastanienblätter, um an die Raupen der Miniermotten zu kommen. Manchmal schaut sogar ein Grünspecht vorbei und macht sich über die allgegenwärtigen Ameisen her. Man kann den Eindruck gewinnen, auf diesem harmlosen Flecken Erde bestehe das Leben hauptsächlich aus Fressen und Gefressen werden. Jedes Tierchen ist auf das ­eigene Wohl bedacht und setzt seine Interessen auf Kosten anderer durch. Es gilt das Gesetz des Stärkeren, Schnelleren, Leistungsfähigeren. Diese Sicht auf das Leben geht zurück auf den großen Natur­ forscher Charles Darwin. Seine Erkenntnisse über die Mechanismen der Evolution sind heute mehr denn je von seriösen Wissen­schaftlern aller Disziplinen akzeptiert. Was der Brite zum Überleben der Tauglichsten und zur Kraft der natürlichen Selektion geschrieben hat, erweist sich auch als gültig für die seiner­zeit noch unbekannte Welt der Gene und Moleküle. Und doch ist Darwins Credo nur die halbe Wahrheit. Oder eine Sache des Blickwinkels: Denn beim zweiten Hinsehen zeigen sich viele Parkbewohner von einer anderen Seite. Etwa die Ameisen. Stimmt, sie werden vom Specht gefressen und stürzen sich ihrerseits auf allerlei Raupen, Maden und was sonst noch als Mahlzeit 7 infrage kommt. Auch die Blattläuse im Hollerbusch könnten sie ohne weiteres überwältigen – indes, sie tun es nicht. Stattdessen behandeln sie die wehrlosen Pflanzensauger geradezu fürsorglich und halten ihnen sogar deren ärgsten Feinde – allen voran die stets hungrigen Marienkäfer – vom Leib. Im Gegenzug überlassen die Blattläuse ihren Leibwächtern ein zuckerhaltiges Sekret. Süßigkeiten als Lohn für Personenschutz: Dieser »Deal« ist für beide Seiten ein Gewinn. Einen ähnlichen Handel treiben Bienen und Hummeln mit Hollerbusch und Kastanienbaum: Die Insekten finden in den üppigen Blüten dieser und vieler anderer Pflanzen reichlich Nektar. Beim Trinken erledigen sie ganz nebenbei deren Bestäubung und stellen somit sicher, dass sie zu Beeren, Kastanien und sonstigen Früchten heranreifen. Dies sind nur zwei Beispiele unter vielen. Tauschgeschäfte und Zusammenschlüsse zwischen verschiedenen Arten sind in der belebten Natur kein seltenes Phänomen. Diese Erkenntnis ist erst allmählich in unser Bewusstsein vorgedrungen, und sie hält auch nur zögerlich Eingang in Hörsäle, Klassenzimmer und Feuilletons. Sie weiterzugeben ist das Anliegen dieses Buches. Denn tatsächlich sind nützliche Allianzen in der Natur nicht die Ausnahme, sondern die Regel: Sie werden zwischen allen möglichen Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroben geschlossen. Die wenigsten Gemeinschaften lassen sich freilich so leicht beobachten wie jene der Ameisen und Blattläuse. Eine Vielzahl fein austarierter Lebensbündnisse spielt sich im Verborgenen ab: Der Klee auf meiner kleinen Wiese beherbergt in seinen Wurzelknöllchen Bakterien, die ihn mit Stickstoff aus der Luft versorgen. Auch alle anderen Pflanzen im Park sind auf Gedeih und Verderb an geeignete Nährstofflieferanten angewiesen: Dutzende Arten von Pilzen umgarnen die Wurzeln von Löwenzahn, Hollerbusch und Kastanie und tauschen unterirdisch Mineralsalze gegen Kohlenhydrate ein. Die Flechten am Baumstamm sind regelrechte Mischwesen aus Pilzen und Algen und können nur gemeinsam in luftiger Höhe überleben: Der Pilz schützt die Algen vor dem Vertrock­ nen und beansprucht als Gegenleistung wertvolle Nährstoffe. 8 Solche Partnerschaften zum gegenseitigen Nutzen sind so verschieden wie die Lebewesen, von denen sie gebildet werden. Sie umfassen zwei oder mehr Partner und reichen von lockeren Tauschbeziehungen zwischen ansonsten unabhängigen Organismen über den regelmäßigen, aber nicht zwingend notwendigen Austausch von Dienstbarkeiten bis hin zu obligatorischen Verbänden, deren Partner alleine nicht mehr lebensfähig sind. Manche Allianzen sind lose wie jene zwischen den Blütenpflanzen und ihren fliegenden Pollenboten. In anderen Fällen bilden die Partner eine dauerhaft enge Gemeinschaft oder es lebt gar ­einer im Körper des anderen wie die Knöllchenbakterien im Klee; dann spricht man von einer Symbiose. Dieses Kunstwort aus dem griechischen »syn« (zusammen) und »bios« (Leben) wurde vor 135 Jahren von einem Botaniker namens Anton de Bary geschaffen und sorgt seither unter Experten für heftige Diskussionen. Einen kurzen Rückblick über die Anfänge der Symbioseforschung und ihre wechselvolle Geschichte gibt das 2. Kapitel »Sklaven, Partner und Schmarotzer« dieses Buches. Es zeigt eindrucksvoll, wie sehr die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wissenschaftliche Erkenntnis prägen. Doch zunächst begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise: zu den heißen Quellen am Grunde des Ostpazifiks. Dort unten, 2000 Meter tief unter der Wasseroberfläche, haben Wissenschaftler erst vor wenigen Jahrzehnten eine spektakuläre Entdeckung gemacht: Mit dem U-Boot »Alvin« tauchte ein Team von Geologen in die bizarre Welt der Unterwassergeysire alias Schwarze Raucher ab. Die Forscher hatten nur eine vage Vorstellung von diesem unwirtlichen Ort ohne jegliches Sonnenlicht. Und fanden, was sie dort am allerwenigsten erwartet hatten: ­einen Zoo unbekannter Tiere, darunter skurrile Röhrenwürmer mit blutroten Kiemenbüscheln, fahle Yetikrabben und räuberische Meeresschnecken. Das Fundament für diese Oasen in der Finsternis bilden spezielle Mikroorganismen, die mit ihren erstaunlichen Stoffwechselleistungen sich selbst und ihre Wirtstiere am Leben erhalten. Sie folgen damit demselben Grundsatz wie all 9 die anderen Partnerschaften und Allianzen, die in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden: Organismen aus unterschiedlichen Arten tun sich zusammen und profitieren wechselseitig von den Fähigkeiten des anderen. Gemeinsam können sich die Bündnispartner in kurzer Zeit gänzlich neue Eigenschaften aneignen und dadurch knappe Ressourcen effektiver nutzen, widrigen Umweltbedingungen trotzen oder sich diverser Gefahren erwehren. Anders ausgedrückt: Sie betreiben Evolution. Denn das Prinzip der wechselseitigen Ergänzung ist ein entscheidender Motor für die Entwicklung neuer Lebensformen. »Symbiogenese« hat es Professorin Lynn Margulis, die bedeutendste Symbioseforscherin unserer Zeit – genannt und als kraftvollen Mechanismus der Evolution erkannt. Mit ihrem provokanten Bekenntnis nahm die 2011 verstorbene amerikanische Wissenschaftlerin der Darwinschen Sicht seine Ausschließlichkeit, ohne sie dabei grundsätzlich infrage zu stellen. Der geniale Naturforscher lehrt uns, dass sich Lebewesen durch das Wechselspiel stets neuer Merkmalsvarianten und deren natürliche Auslese mit der Zeit verändern. Dieser Erklärungsversuch ist heute allgemein anerkannt. Und doch lässt er viele Fragen offen. Zwar hat Darwin sein berühmtes Hauptwerk mit dem Titel ›Über die Entstehung der Arten‹ versehen. Doch eine umfassende Antwort auf diese alles entscheidenden Frage bleibt er uns schuldig. Umso mehr überzeugt der Ansatz der Symbiogenese, den Lynn Margulis auf der Basis verschiedener Vordenker zeit ihres Lebens propagiert und weiterentwickelt hat. Mit Fleiß und Scharfsinn hat sie den Beweis erbracht, dass Tier- und Pflanzenzellen – und folglich alle mehrzelligen Lebewesen bis hin zum Homo sapiens – ursprünglich durch Symbiose entstanden sind. Diese einst heftig umstrittene Theorie ist heute in die biologischen Lehrbücher eingegangen. Sie lässt die Evolution des Lebens in einem neuen Licht erscheinen und erhellt auch die Herkunft des Menschen. Um unsere Ursprünge zu ergründen, suchen wir im 3. Kapitel dieses Buches nach dem »Feuer des Lebens«. Dazu 10 dringen wir tief in unseren Körper ein, bis ins Innerste der Zellen. Dort nämlich verbergen sich kleine Heizkraftwerke namens Mitochondrien: Sie halten uns warm, indem sie Nährstoffe verbrennen. Diese unverzichtbaren Zellbestandteile stammen von einst eigenständigen Organismen ab, die in der Frühzeit des Lebens, vor rund eineinhalb Milliarden Jahren, von einem archaischen Einzeller verschluckt und anschließend gezähmt worden sind. Seither bewohnen sie als sogenannte »Endosymbionten« die Zellen sämtlicher höherer Organismen und halten sie durch einen erstaunlichen Vorgang namens Atmung am Leben. Ein weiterer Meilenstein der Evolution ist die Fotosynthese, sprich: die Nutzung des Sonnenlichts zum Aufbau von Biomasse. Die komplexen biochemischen Prozesse dahinter schreiben wir gewöhnlich den grünen Pflanzen zu. Tatsächlich aber wurden auch sie einst von Bakterien entwickelt – die ebenso wie die Vorfahren der Mitochondrien von anderen Zellen einverleibt wurden und sich darin allmählich zu Chloroplasten gewandelt haben. Als solche leben sie in den grünen Zellen der Algen und Pflanzen weiter. Sie sind also an sich schon Chimären aus einst eigenständigen Lebensformen, doch viele Pflanzen haben noch zusätzliche Bündnisse mit Bakterien, Pilzen oder Tieren geschlossen. So ist auch das größte Bauwerk der Welt entstanden, das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens, von dem im 4. Kapitel die Rede ist. Es verdankt sich dem Zusammenschluss zwischen Tieren und Algen: Über die Fotosynthese können die Algen Biomasse produzieren und zugleich die Kalkproduktion der Korallentiere optimieren. Die gewaltigen Riffe, die aus diesen »Grünen Mischwesen« entstehen, ernähren die reichhaltigste Lebensgemeinschaft unseres Planeten und bilden einen »hot spot« der Biodiversität. Die Besiedlung des Festlands ist Thema des 5. Kapitels. Der Schritt vom Meer aufs trockene Land machte neue Bauprinzipien und Versorgungsstrukturen erforderlich. Er gelang abermals dank der gebündelten Anstrengungen grundverschiedener Organismen, die ihre speziellen Fähigkeiten in den Dienst eines 11 gemeinsamen Ganzen stellten: Vor rund 500 Millionen Jahren formierten sich Pilze mit Algen zu einer vollkommen neuen Lebensform, den Flechten. Sie trotzten nicht nur der Trockenheit. Es gelang ihnen zudem, mit speziellen Säuren die lebenswichtigen Mineralien aus dem blanken Fels zu lösen und so den ersten Pflanzen buchstäblich den Boden zu bereiten. Diese Pflanzenpioniere ließen sich bei ihrem Marsch an Land von bestimmten Pilzen helfen, und bis heute sind die sogenannten Mykorrhizapilze unentbehrlich für die Wälder und Grasländer unsere Erde. Somit basieren alle großen Ökosysteme unseres Planeten auf Symbiosen. Das 6. Kapitel gehört den Ameisen. Diese faszinierenden Insekten übertreffen an Individuenzahlen und Biomasse alle anderen Tiere zusammengenommen und dominieren die Wälder, Steppen und Wiesen auf allen Kontinenten. Auch ihr Erfolgsrezept heißt Kooperation – sowohl mit ihresgleichen, als auch mit andersartigen Organismen: Jede der schätzungsweise 25 000 verschiedenen Ameisenarten führt ein soziales Leben in arbeitsteilig organisierten Staaten. Zusätzlich unterhalten viele Arten Symbiosen und andere Partnerschaften mit Bakterien, Pilzen, Pflanzen oder Schmetterlingen und pflanzensaugenden Insekten. Wanderhirtenameisen ernähren sich ausschließlich von der »Milch« ihrer Läuse und ziehen wie Nomaden auf der Suche nach den besten Weidegründen mit ihren »Kühen« umher. Blattschneiderameisen legen unterirdische Pilzgärten an, die sie düngen, jäten und abernten. Damit haben sie die Landwirtschaft erfunden, lange bevor es die ersten Menschen gab. Neben Insekten gehen auch Fische und Vögel, Echsen und Säugetiere mehr oder weniger enge Bündnisse mit anderen Tieren ein. Das 7. Kapitel stellt eine Fülle solcher Zweckgemeinschaften vor: Zu ihnen zählt der bekannte Clownfisch in der Seeanemone (Bild 12). Oder verschiedene Vögel, die in den Hautfalten von Büffeln oder Giraffen nach Insektenmaden stochern und so ganz nebenbei die Körperhygiene der großen Weidetiere sicherstellen. Tatsächlich pflegt auch der Mensch vielfältige Beziehungen zu 12 anderen Organismen. Wir halten Nutztiere und pflanzen Obst und Gemüse, um uns zu ernähren. Außerdem sind wir selbst Lebensraum für ein Heer von Mikroorganismen: Milliarden von Bakterien bewohnen Haut und Haare, Mund und Magen, Darm und Geschlechtsorgane. Wir sind besiedelt! Viele dieser winzigen Wesen tragen maßgeblich zu unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit bei. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über unsere stillen Mitbewohner sind im 8. Kapitel zusammengefasst. Welchen Nutzen wir auch für andere Bereiche aus einem tieferen Einblick in das Wesen von Symbiosen ziehen können, ist Thema des 9. Kapitels. Symbiosen halten alle lebenswichtigen Ressourcen für unsere Existenz bereit. Mit Verstand eingesetzt, können Allianzen aus verschiedenen Lebewesen den Ertrag in Land- und Forstwirtschaft erheblich steigern und so die wachsende Erdbevölkerung ernähren. Außerdem bilden sie ein schier unendliches Reservoir an biologisch aktiven Wirkstoffen, mit denen wir Krankheiten behandeln und unser Wohlbefinden fördern können. Im 10. und letzten Kapitel wird klar, dass das gesamte Leben auf unserer Erde durch Symbiosen gestaltet worden ist. Wir sind Symbionten in einer symbiotischen Welt. I OASEN IN DER FINSTERNIS »Alvin« ist alles andere als eine Luxusjacht. Das U-Boot, Jahrgang 1964, ist für drei Personen ausgelegt – und dabei gerade mal sieben Meter lang. Es gehört der US-Navy und wird betrieben vom WHOI, dem Ozeanographischen Institut in Woods Hole, Massachusetts. Besondere Kennzeichen: 16 Tonnen schwer, umhüllt mit einer fünf Zentimeter dicken Titanschicht, Sichtfenster aus neun Zentimeter starkem Kunststoff, Atemluft für drei Tage. Diese Ausstattung macht »Alvin« trotz mancher Unbequemlichkeit zu einem begehrten Gefährt. Denn es kann 4500 Meter tief tauchen und seine Insassen in Regionen bringen, die kein Mensch zuvor gesehen hat. Im April 1966 konnte dank ›Alvin‹ eine Wasserstoffbombe aus dem Mittelmeer geborgen werden, die wenige Wochen zuvor bei der Explosion eines amerikanischen B52-Bombers nahe der spanischen Küstenstadt Palomares versunken war. 1977 ­sollte das U-Boot einen weiteren Coup landen, diesmal im Dienste der Wissenschaft: Damals nahm ein Team von Geologen, Chemikern und Archäologen aus verschiedenen Forschungsinstituten mit »Alvins« Mutterschiff Kurs auf die Galapagos-Inseln. In dieser Region des Ostpazifiks findet der Meeresboden keine Ruhe. Die Erdkruste zerfällt hier in drei Platten, die pro Jahr mehrere Zentimeter in verschiedene Richtungen voneinander wegstreben. Dabei reißen Gräben und Spalten auf, durch die sich die heißen Eingeweide der Erde ergießen. Magma quillt hervor, erstarrt im kalten Meerwasser und türmt sich über eine Länge von mehreren hundert Kilometern zu einem riesigen Unterwassergebirge auf. Diesen Höllenschlund am zerrissenen Meeresgrund wollten sich die Geologen aus nächster Nähe ansehen. Als Erste zwängten sich Jerry von Andel von der Oregon State Universität und sein 15 Doktorand Jack Corliss in das kleine U-Boot. Pilot Jack Donnelly ließ das Gefährt immer tiefer abtauchen. »Alvins« Scheinwerfer frästen Lichtschneisen in die absolute Finsternis. Messsonden erfassten die Beschaffenheit des Seewassers: Temperatur, pH, chemische Bestandteile. Immer weiter hinab glitt das Boot durch die endlose Wasserwüste. In 2400 Metern Tiefe stieß die Crew schließlich auf felsigen Grund. Dort tat sich eine gespenstische Landschaft auf: Schlanke Röhren ragten mehrere Meter weit in die Höhe, wie Fabrikschlote, aber verzweigt, mit langen Fahnen aus einer Art schwarzem Rauch. Ein Name drängte sich auf: Schwarze Raucher (Bild 1). Die rauchenden Schlote gehören zu einer besonderen Art der sogenannten Hydrothermalquellen. Es sind Fontänen aus ex­ trem heißer Flüssigkeit, angereichert mit großen Mengen von schwefel- und stickstoffhaltigen Mineralien sowie Schwermetallen wie Arsen, Blei, Cadmium, Eisen, Gold, Kupfer, Mangan, Nickel und Zink. Die Unterwassergeysire entstehen, wenn kaltes Meereswasser in die rissige Erdkruste eindringt und sich am heißen Gestein aus dem Erdinneren erhitzt. Normalerweise wird Wasser ab hundert Grad zu Dampf. Doch unter dem gewaltigen Druck der Wassermassen bleibt die giftige Brühe noch mit 500 Grad Celsius flüssig. Weil sie leichter ist als das kalte und deshalb dichtere Seewasser, schießt sie direkt aus dem heißen Meeresboden nach oben. Und wenn sie reich an Eisensalzen ist, färbt sie das Seewasser schwarz. Der Fund war spektakulär, aber nicht unerwartet. Er bestätigte nur, was Theorien und Modelle über die Spreizungszonen an den Nahtstellen der Erdplatten voraussagten. Die eigentliche Überraschung stand den Forschern noch bevor. Denn plötzlich tauchten im Licht der Scheinwerfer Gebilde auf, die wie Muschelschalen aussahen. Da hätten sich wohl die Kumpels von der Navy ein feines Abendessen geleistet und die Reste über Bord gehen lassen, witzelte Jack Corliss. Das Lachen verging ihm, als er sich die Dinger genauer ansah: Es waren tatsächlich Muscheln. Sie waren ungewöhnlich groß, manche über dreißig Zentimeter. Und sie 16 lebten! Doch das war erst der Anfang. Am folgenden Tag wagte sich Bob Ballard, Unterwasserarchäologe am WHOI, in die Tiefe. Auch er fand die Muscheln. Dazu Seeanemonen. Und nie gesehene wurmartige Wesen in weißen Röhren, die beinahe zwei Meter in die Höhe ragten und an ihrem Ende purpurrote federartige Auswüchse in die heißen Quellen reckten. Sie wiegten sich im Wasser wie Blumen im Wind. Die Taucher waren in dieser nassen, lichtlosen Wüste auf eine Oase des Lebens gestoßen. Und so benannten sie ihre Entdeckung nach dem biblischen Garten Eden. Die Geologen konnten es nicht glauben. Waren das wirklich Tiere? Und wenn ja, wie konnten sie hier leben? In dieser Tiefe herrscht absolute Dunkelheit, Tiere aber brauchen Licht. Denn wie wir ernähren sie sich von anderen Lebewesen, sprich: von organischem Material, sei es lebend oder tot oder schon in seine Bestandteile zerlegt. Solches organische Material muss aus einfachen anorganischen Substanzen zusammengebaut werden, das können nur Pflanzen, Algen oder bestimmte Mikroben. Nur sie haben das nötige Blattgrün oder ähnlich komplexe ­Biomoleküle, die über die Fotosynthese aus Kohlendioxid und Wasser verschiedene Kohlenhydrate – und damit Biomasse – aufbauen können. Die Forscher nahmen Proben von den eigenartigen Wesen, zu denen das U-Boot sie geleitet hatte. Da das Mutterschiff keine Konservierungsmittel an Bord hatte, mussten eben Wodka und Gin aus der Bar herhalten. Ein Journalist erwähnte die Funde in einem seiner Exkursionsberichte. »Wir erfuhren von den Tieren erst durch die Presse«, erinnert sich Fred Grassle, damals Meeresbiologe in Woods Hole, und weiter: »Wir waren überrascht. Das widersprach allem, was wir damals über die Tiefsee ­wussten«. Nach der sensationellen Entdeckung bemühten sich Biologen aus aller Welt, das Rätsel der Unterwasseroasen zu lösen. Wie können diese Tiere ohne eine Lichtquelle leben? Wovon ernähren sie sich? Zunächst untersuchten sie die riesigen Würmer und gaben ihnen den Namen Riftia pachyptila (Bild 2). Die weitläufigen Verwandten der Regenwürmer leben ausschließlich an Hydrothermalquellen, in selbst gebauten Röhren aus verhärtetem 17 Eiweiß und Chitin, die sie niemals verlassen. Eine genaue Betrachtung ihres Körpers ergab, dass sie weder Mund, noch Darm oder After haben. Schnell wurde klar, dass sich Riftia-Würmer nicht selbst ernähren können. Vielmehr werden sie ernährt: von Schwefelbakterien, die in ihrer Leibeshöhle leben. Dort besiedeln die Mikroben in gewaltigen Mengen ein schlauchförmiges Organ. Knapp zehn Milliarden dieser winzigen Untermieter fanden die Forscher in jedem Gramm von Riftias Eingeweiden. Die Mikroorganismen haben die nötige Enzymausstattung, um von dem zu leben, was die Hydrothermalquellen bieten: Schwefelwasserstoff und seine gelöste Form, Sulfid. Das Gas mit dem Geruch nach faulen Eiern wandeln sie mit Sauerstoff in Sulfat um und gewinnen dabei chemische Energie. Und diese Energie benutzen sie dann, um Kohlendioxid zu Kohlenhydraten zusammenzubauen. »Chemosynthese« heißt der Prozess, der letztlich zum gleichen Ergebnis führt wie die Fotosynthese, aber kein Licht benötigt. Einen Teil der Kohlenhydrate verbrauchen die Bakterien selbst, vom Rest ernähren sich ihre Wirte. Die Röhrenwürmer sind also vollkommen von den Bakterien abhängig. Und umgekehrt: Die Bakterien kommen nur mithilfe der Riftia-Würmer an ihren Lebensquell, denn die Tiere suchen gezielt jene heißen Wassersäulen auf, die den für Mikroben lebenswichtigen Schwefelwasserstoff enthalten und filtern ihn mit ihren büschelförmigen roten Kiemen heraus. Deren Farbe erinnert nicht von ungefähr an Blut: Tatsächlich enthalten sie eine Art Hämoglobin, das unserem Blutfarbstoff ähnelt. Neben Sauerstoff nimmt es auch Sulfid auf und transportiert es zu den Bakterien. So bilden diese ungleichen Partner ein gemeinsames Ganzes. Keiner der beiden könnte in der lebensfeindlichen Dunkelheit existieren. Als Verbündete aber zaubern sie blühende Ökosysteme auf den lichtlosen Meeresgrund. Das Geheimnis dieser phantastischen Erfolgsgeschichte heißt: Symbiose. Riftia ist keineswegs der bizarrste Bewohner der Schwarzen Raucher. Inzwischen haben Biologen über 300 verschiedene Tierarten beschrieben, die an den heißen Unterwasserquel18 len ihr Auskommen finden. Zum Beispiel den Pompejiwurm: Er lebt in seiner dünnen Röhre an den rund achtzig Grad heißen Außenwänden der Schwarzen Raucher. Das gut zehn Zentimeter lange Tier wird ebenfalls von symbiotischen Bakterien gefüttert; allerdings trägt es seine Ernährer nicht im Körperinneren, sondern auf dem Rücken. Oder augenlose Yetikrabben mit zehn Zentimeter langen Scheren, die von dicht stehenden federartigen Borsten bedeckt sind und massenhaft Bakterien beherbergen. Von diesen Mikroben ernährt sich der Krebs; damit sie wachsen und gedeihen, hält er seine Arme so nah wie möglich an die mineralreichen Quellen. Oder die im Indischen Ozean entdeckte Schuppenfußschnecke: Ihre harte Schale enthält eine stark magnetische, seltene Eisenverbindung namens Greigit, die sie vor den kräftigen Zähnen räuberischer Schnecken schützt und extrem hohem Druck von bis zu 250 Atmosphären standhält. Das ungewöhnlich robuste Material dieses Schneckenpanzers weckt nun Begehrlichkeiten beim amerikanischen Militär. Je mehr Hydrothermalfelder überall in den Weltmeeren erforscht und je intensiver sie untersucht werden, umso mehr wird auch über ihre lichtlosen Ökosysteme bekannt. So stach etwa im Winter 2011/12 das britische Forschungsschiff »James Clark Ross« Richtung Antarktis in See. Sein Ziel: die Heißwasserquellen der Schottischen See, 200 Seemeilen südöstlich der Insel Südgeorgien. Mit an Bord war Professor Alex Rogers von der Universität Oxford. Mit einem ferngesteuerten U-Boot suchte er den Meeresboden ab und förderte zahlreiche unbekannte Tiere zutage: zum Beispiel eine neue Art von Yetikrabben und eine vormals unbekannte Entenmuschel, die Bakterienkolonien auf ihrem Filterapparat zu kultivieren scheint. Neben diesen symbiotisch lebenden Tieren entdeckte Rogers erstmals auch räuberische Seesterne und sogar Kraken. »Fast alle Arten und Gattungen, die wir gefunden haben, sind neu«, so das Fazit des Biologen. »Jede Expedition bringt neue Erkenntnisse«, betont auch Professor Nicole Dubilier. Die Meeresbiologin ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen und 19 leitet die Arbeitsgruppe Symbiose. Seit 2005 fährt sie mit den deutschen Forschungsschiffen »Maria S. Merian« und »Meteor« auf den Atlantik. Ihr Ziel ist der Mittelatlantische Rücken, einige hundert Kilometer westlich der Azoren. Das gigantische Unterwassergebirge zieht sich über 20 000 Kilometer lang in NordSüd-Richtung über den Meeresgrund und wird gesäumt von ausgedehnten Hydrothermalfeldern, darunter »Lucky ­Strike«, das bislang größte seiner Art. Nicole Dubilier konzentriert sich auf ein Feld namens Logatchev. Ähnlich wie in den Tiefen des Indischen und Pazifischen Ozeans lebt auch hier eine vielfältige Lebensgemeinschaft. Besonders zahlreich ist eine Tiefseemuschel namens Bathymodiolus puteoserpentis, deren Kiemen von symbiotischen Bakterien besiedelt sind. Die Mikroben leben im Inneren der Kiemenzellen und versorgen ihren Wirt via Chemosynthese mit Energie und Kohlenhydraten – genau wie die Untermieter der Riftia-Würmer und Yetikrabben. Allerdings nutzen sie dazu einen besonderen Trick. »Bisher waren nur zwei Quellen bekannt, aus denen Bakterien via Chemosynthese energiereiche Kohlenstoffverbindungen herstellen: Schwefelwasserstoff und Methan«, erklärt Nicole Dubilier: »Wir haben eine dritte Quelle entdeckt, nämlich reinen Wasserstoff.« Dieses Gas gibt es in den Logatchev Hydrothermalquellen reichlich – das hatte Dubiliers Kollege Thomas Pape vom Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen in flüssigen Proben aus Schwarzen Rauchern nachgewiesen. »Ich dachte mir, wenn da solche Mengen Wasserstoff sind, dann wäre es doch sinnvoll, das als Energiequelle zu verwenden«, erinnert sich ­Nicole Dubilier und beschreibt ein ebenso simples wie aufschlussreiches Experiment: »Wir haben einfach ein Stück Muschelkieme mitsamt seinen Bakterien in ein gasdichtes Glasfläschchen getan und einen Tag lang den Wasserstoff gemessen. Nach 24 Stunden war deutlich weniger da als vorher. Das konnten nur die Bakterien verbraucht haben, denn nur sie – und nicht die Muscheln – können Wasserstoff oxidieren und dadurch Energie gewinnen.« Möglich macht das ein besonderes Enzym na20