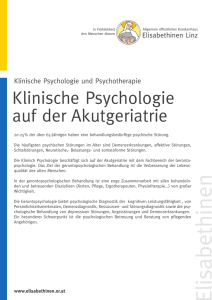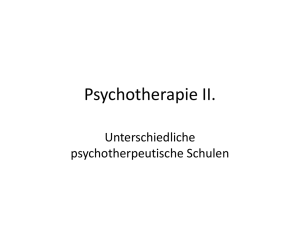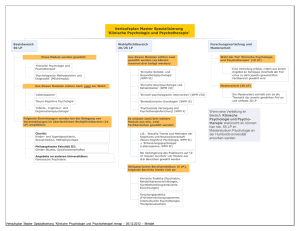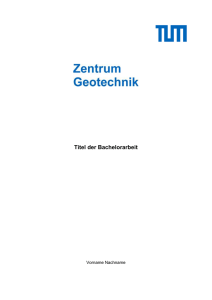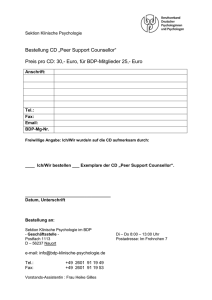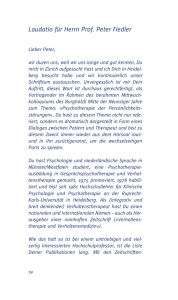Dowload Posterabstracts - Workshop Kongress 2011 Berlin
Werbung

Postersession 1 Do 02.06.11 von 11:00-12:30 Uhr A 01 Allgemeine Wirkfaktoren, Kompetenz und Adhärenz in der Kognitiven Therapie der Sozialen Phobie bei Jugendlichen – Ergebnisse zur Reliabilität einer neu entwickelten Ratingskala Lena Kristin Krebs (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Judith Schmidt-Schwieger (Goethe Universität Frankfurt am Main) Sarah Werner (Goethe Universität Frankfurt am Main) Dr. Regina Steil (Goethe Universität Frankfurt am Main) Prof. Dr. Ulrich Stangier (Goethe Universität Frankfurt am Main) Abstract: Einleitung: Die Untersuchung von Prozessvariablen und deren Verbindung zu den allgemeinen Wirkfaktoren nach Grawe ist eine der wichtigsten Forschungsvorhaben, um zu verstehen, wie und wann Psychotherapie wirkt. Im Gegensatz zur Erwachsenenpsychotherapieforschung steht die Untersuchung allgemeiner Wirkfaktoren und spezifischer Therapeutenvariablen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie noch am Anfang. Therapeutische Kompetenz und Adhärenz als spezifische Faktoren, die den Behandlungserfolg beeinflussen, sind vielfach kritisch diskutiert. Bemängelt wurde häufig eine zu geringe Interrater-Reliabilität der hierfür verwendeten Skalen. Methode: Es wurde die Kompetenzskala für Kognitive Therapie der Sozialen Phobie an das Jugendalter adaptiert. Diese erfasst sowohl allgemeine therapeutische Fähigkeiten (z.B. Klarheit der Kommunikation) als auch prozessurale und strategische Fähigkeiten (z.B. Vermittlung Therapierational). Mit der Kompetenzskala wurden in Erwachsenenstudien für die Gesamtskala ICCs zwischen .73 und .88 erreicht (v. Consbruch, Clark & Stangier, in press). In Vorbereitung einer BMBF-geförderten randomisierten multizentrischen Studie zur Behandlung der Sozialen Phobie im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter (14-20 Jahre), in welcher unter anderen die Wirksamkeit der Kognitiven Therapie der Sozialen Phobie untersucht wird (vgl. Steil, Matulis, Schreiber & Stangier, in press) wurden 15 Pilottherapiesitzungen von 3 unabhängigen geschulten Ratern hinsichtlich allgemeiner Wirkfaktoren (z.B. Ressourcenaktivierung, Allianz), Kompetenz und Adhärenz bewertet. Die Interrater-Reliatbilität wurde als ICC (Shrout & Fleiss, 1979) errechnet. Ergebnisse: Es werden erste Ergebnisse zu Interrater-Reliabilität der einzelnen Items sowie der Gesamtskalen berichtet. A 02 Überhöhte Verantwortlichkeit, Metakognition und unrealistischer Pessimismus bei Zwangserkrankungen Reinhard Pietrowsky (Universität Düsseldorf, Institut für Experimentelle Psychologie) Daniela Bertram (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Helen Niemeyer (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Überhöhte Verantwortlichkeit und dysfunktionale metakognitive Überzeugungen werden in ihrer Priorität für die Zwangsstörung kontrovers diskutiert. Bei dem dritten zwangsrelevanten Konstrukt, „Overestimation of threat“, besteht Forschungsbedarf hinsichtlich seiner Subfacetten. Es wird anhand des Paradigmas des unrealistischen Optimismus im direkten und indirekten Vergleich erfasst, und Zusammenhänge zu Verantwortlichkeit und Metakognition werden untersucht. Methode: 34 Zwangspatienten (OCI-R, YBOCS-SR) und 34 gesunde Kontrollpersonen werden anhand der Responsibility and Interpersonal Behavior Attitute Scale (RIBAQ) und des Obsessive Beliefs Questionnaires (OBQ) bezüglich Verantwortlichkeit und Metakognition untersucht. Zur Erfassung des Unrealistischen Optimismus wird der gleichnamige Fragebogen (UO) verwendet. Ergebnisse: Verantwortlichkeit und Metakognitionen sind bei Zwangspatienten erwartungsgemäß signifikant höherer ausgeprägt. Beide korrelieren hochsignifikant mit der Zwangssymptomatik. Eine hierarchische Regressionsanalyse ergab, dass Verantwortlichkeit über Metakognition hinaus einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung leistet und beide gemeinsam 45% der Zwangssymptomatik vorhersagen. Der unrealistische Optimismus respektive Pessimismus zeigt sich im indirekten Vergleich nur abgeschwächt: Zwangspatienten sind hinsichtlich des Eintretens positiver Ereignisse pessimistisch, Gesunde in Bezug auf das Eintreten negativer Ereignisse optimistisch. Zwang korreliert mit der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit positiver Ereignisse für die eigene Person hochsignifikant negativ und für negative Ereignissen positiv, während er mit der Einschätzung für andere Personen nicht zusammenhängt. Zwischen Verantwortlichkeit sowie Metakognition und den einzelnen Komponenten des Bias finden sich nicht durchgängig signifikante Zusammenhänge. Bei Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit im direkten Vergleich zeigt sich erwartungsgemäß kein Bias. Diskussion: Erwartungsgemäß hängen alle drei Konstrukte mit der Zwangssymptomatik zusammen. Verantwortlichkeit leistet über Metakognition hinaus einen Beitrag zur Vorhersage der Zwangssymptomatik. Der unrealistische Bias wird durch die Zusammenhänge zwischen Zwang und der Selbsteinschätzung moderiert. Schlussfolgerungen: Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich des unrealistischen Optimismus respektive Pessimismus. A 03 Beeinflusst das SKID die Wirksamkeit eines internetbasierten Selbsthilfeprogramms für Soziale Angststörungen? Kasra Keshavarz (Freie Universität Berlin) Johanna Böttcher (Freie Universität Berlin) Thomas Berger (Universität Bern) Babette Renneberg (Freie Universität Berlin) Abstract: Fragestellung Meta-Analysen zu internetbasierten Behandlungen von Angststörungen weisen darauf hin, dass Programme, die regelmäßigen Therapeutenkontakt vorsehen, erfolgreicher sind als reine Selbsthilfeprogramme. Die Rolle von telefonisch oder persönlich durchgeführten diagnostischen Gesprächen am Anfang der Therapie ist bisher noch ungeklärt. In der vorliegenden Untersuchung wurde deshalb am Beispiel eines internetbasierten Selbsthilfeprogramms zur Behandlung Sozialer Angststörungen untersucht, ob ein telefonisch durchgeführtes, diagnostisches Interview den Erfolg des Programms positiv beeinflusst. Zusätzlich wurden die Auswirkungen des Interviews auf die Therapeutische Allianz, die Glaubwürdigkeit und die Erwartungen der Klienten als vermittelnde Größen für den Erfolg des Programms untersucht. Methode Im Rahmen einer randomisierten Kontrollgruppenuntersuchung nahmen N=112 Personen mit sozialen Ängsten an einem zehnwöchigen Selbsthilfeprogramm im Internet teil. Die Interviewgruppe (IG: N=56) wurde vor Beginn des Programms zusätzlich telefonisch mit dem Strukturierten Klinischen Interview für DSM-IV befragt. Die Erhebung der sozialängstlichen Symptomatik und der Mediatormaße erfolgte via Online-Befragungen aller Teilnehmer vor und nach der Behandlung sowie 4 Monate später. Ergebnisse Sowohl die Interviewgruppe als auch die Vergleichsgruppe profitierte hinsichtlich ihrer primären Symptomatik von dem Selbsthilfeprogramm (IG: p<0.001, d=1.10, VG: p<0.001, d=0.88). Es zeigte sich hingegen kein Effekt der Gruppenzugehörigkeit (p=0.28, 2=0.011). Es konnte auch kein indirekter, über die Mediatorvariablen vermittelter Effekt des Interviews auf die Symptomreduktion gefunden werden. Die Mediatorvariablen korrelierten jedoch signifikant mit der Symptomreduktion (r=0.28–0.46; p<0.01). Diskussion Ein anfängliches diagnostisches Interview scheint sich nicht unmittelbar auf die Wirksamkeit internetbasierter Selbsthilfeprogramme auszuwirken. Die Ergebnisse einschließlich der Katamnese werden diskutiert. Schlussfolgerungen für die Praxis und für die weitere Erforschung internetbasierter Behandlungen werden vorgestellt. A 04 Computergestützte Beeinflussung der Aufmerksamkeitsverzerrung bei Angststörungen - eine Übersicht Maxie von Auer (Christoph-Dornier-Stiftung Bremen) Karolin Neubauer (Christoph-Dornier-Stiftung Münster) Eileen Murray (Christoph-Dornier-Stiftung Münster) Franz Petermann (Universität Bremen) Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Sylvia Helbig-Lang (Universität Bremen) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Verschiedene Studien belegen, dass Personen mit Angststörungen verzerrte Aufmerksamkeitsmuster bei der Verarbeitung bedrohlicher Reize (Attention Bias) aufweisen. In jüngster Zeit wurden vor diesem Hintergrund computerbasierte Trainings entwickelt, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeitsausrichtung zu modifizieren. Es wurde ein systematisches Review durchgeführt, um die Effekte dieser Aufmerksamkeitstrainings auf Angstsymptome im Erwachsenenalter zu evaluieren. Methode: Es wurde eine systematische Literatursuche in der Datenbank „Web of Science“ durchgeführt. Zusätzlich wurden die Referenzen passender Arbeiten hinsichtlich weiterer relevanter Studien durchgesehen. Eingeschlossen wurden empirische Studien, die a) eine Modifikation der Aufmerksamkeitsausrichtung anstrebten - im Gegensatz zur reinen Messung des Attention Bias -, b) Erwachsene untersuchten sowie c) einen Bezug zu Ängstlichkeit oder Angststörungen aufwiesen. Ergebnisse: Es konnten 13 Studien identifiziert werden, die den Einschlusskriterien entsprachen. Die vorwiegend an nicht-klinischen Stichproben gewonnenen Erkenntnisse zeigen konsistent, dass bereits ein einmaliges Aufmerksamkeitstraining zu einer Reduktion selbstberichteter und beobachteter Angstreaktionen führen kann. Evidenz für die Wirksamkeit von Aufmerksamkeitstrainings in klinischen Stichproben liegt für die Soziale Phobie und die Generalisierte Angststörung vor. Bislang ist noch wenig über Moderatoren der Trainingseffektivität bekannt, wobei einzelne Hinweise vorliegen, dass die Wirksamkeit des Trainings mit der Art der untersuchten Ängste schwankt. Diskussion: Die bisherigen Befunde zeigen fast ausnahmslos, dass Aufmerksamkeitstrainings zu einer Modifikation der Aufmerksamkeitslenkung und damit verbunden zu einer Reduktion vorliegender Angstsymptome beitragen können. Über die Wirkmechanismen und Moderatoren der Wirksamkeit dieser Trainings ist jedoch noch wenig bekannt. Schlussfolgerungen: Insgesamt verweisen die vorliegenden Studien auf ein hohes Potential von Aufmerksamkeitstrainings in der Modifikation klinischer und subklinischer Ängste, insbesondere da sie schnell und einfach anwendbar sind. Wie und in welchem Umfang diese Trainings in die Versorgung von Patienten mit psychischen Störungen implementiert werden können, muss jedoch in weiteren Studien untersucht werden. A 05 Erfassung subtiler Sicherheitsverhaltenweisen bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie: Evaluation einer deutschen Version der Texas Safety Maneuver Scale Sylvia Helbig-Lang (Universität Bremen) Thomas Lang (Christoph-Dornier-Stiftung Bremen) Franz Petermann (Universität Bremen) Andrew T. Gloster (Technische Universität Dresden) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Subtiles Sicherheitsverhalten wird in kognitiv-verhaltenstherapeutischen Konzeptionen der Panikstörung und Agoraphobie als wesentlicher aufrecht erhaltender Faktor angesehen. Studien zeigen, dass das Unterbinden dieser Verhaltensweisen zum Erfolg der Expositionstherapie beiträgt. Die Identifikation relevanter Verhaltensweisen ist bislang aufgrund fehlender Verfahren schwierig. Die Texas Safety Maneuver Scale (TSMS; Kamphuis & Telch, 1998) ist das erste Verfahren, das gezielt diese Messintention verfolgt. Die vorliegende Untersuchung zielt auf eine erste Überprüfung der psychometrischen Güte einer deutschen Übersetzung der TSMS. Methode: 276 Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie, die an einer BMBF-geförderten kontrollierten Therapiestudie (Paniknetz) teilnahmen, wurde eine deutsche Übersetzung der TSMS zusammen mit weiteren störungsspezifischen Verfahren (ASI, PAS, AKV, BDI) vorgelegt. Neben einer explorativen Faktorenanalyse und Reliabilitätsanalysen wurden Korrelationen zur Untersuchung der Konstruktvalidität berechnet. Ergebnisse: Verschiedene Extraktionskriterien legten eine 5-Faktorenstruktur der TSMS nahe, aus der inhaltlich folgende Subskalen abgeleitet wurden: „Situative Vermeidung“, „interozeptive Vermeidung“, „Gebrauch von Sicherheitssignalen und Sicherheitsverhalten“, „Ablenkung“ und „Entspannungsverfahren“. Die interne Konsistenz der Gesamtskala lag mit einem Cronbach alpha von .89 in einem guten Bereich. Korrelationsanalysen erbrachten ausreichend Hinweise für die diskriminante und konvergente Validität der TSMS und ihrer Subskalen. Diskussion: Eine erste Evaluation der deutschen Übersetzung der TSMS erbrachte zufriedenstellende Ergebnisse, die mit den Befunden der englischen Version weitgehend übereinstimmen. Schlussfolgerungen: Mit der TSMS liegt ein nützliches Instrument zur Erfassung von Sicherheitsverhalten bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie vor, das insbesondere für die Therapieplanung wichtige Informationen liefert. A 06 Interaktionelle Probleme in der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Patienten mit Zwangsstörungen Rüdiger Spielberg (Humboldt-Universität zu Berlin) Schulte, Elise (Humboldt-Universität zu Berlin) Kathmann, Norbert (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Die Pilotstudie untersucht das Auftreten interaktioneller Probleme in der Therapie von Zwangspatienten mit und ohne komorbide Persönlichkeitsstörung im Rahmen einer verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Spezialambulanz für Zwangsstörungen. Theoretischer Hintergrund ist das Modell der doppelten Handlungsregulation von Rainer Sachse (2001), das davon ausgeht, dass Symptomatik im Rahmen einer Persönlichkeitsstörung sich in einer Vielzahl von beobachtbaren Verhaltensweisen („Spielverhalten“) im Rahmen der Patient-TherapeutInteraktion zeigt, beispielsweise in Form sogenannter interaktioneller Vermeidungsstrategien wie Relativieren oder Bagatellisieren. Diese Strategien können die Informationsgewinnung und Zielentwicklung im therapeutischen Prozess erheblich erschweren. Es wird vorhergesagt, dass die Untersuchungsgruppe mit komorbider Persönlichkeitsstörung derartige Verhaltensweisen ausgeprägter zeigt als die Kontrollgruppe nicht komorbider Zwangspatienten. Darüber hinaus wird ein Zusammenhang von interaktionellen Strategien mit einer geringeren Verbesserung der Achse-I Symptomatik im Vergleich zur Kontrollgruppe, gemessen am Y-BOCS Rückgang, vorhergesagt. Methode Als abhängiges Maß im Rahmen von Kovarianzanalysen wird die Bochumer Bearbeitungs- und Beziehungsskala (BBBS, Sachse, 1997) verwendet. Diese wurde von den behandelnden Therapeuten jeweils unmittelbar nach zwei Therapiesitzungen im festgelegten Untersuchungszeitraum ausgefüllt. Ergebnisse Es zeigt sich ein signifikanter Gruppenunterschied in der erwarteten Richtung bei den Skalen 4 (Vermeidungsstrategien), 6 (Therapeutische Beziehung) und 7 (Images und Appelle) und dem Gesamtscore der BBBS. Darüber hinaus ließ sich als Maß der Therapiebeinträchtigung ein korrelativer Zusammenhang der Y-BOCS-Veränderungen im Therapieverlauf und der Skalen 4 und 7 (Vermeidungsstrategien und Images/Appelle) zeigen. Alle Skalen waren zudem negativ korreliert mit den Therapeutenurteilen über die Qualität der Therapiesitzungen. Diskussion/Schlussfolgerungen Es wurden deutliche Hinweise gefunden, dass mehrere der von Sachse formulierten interaktionellen Problemsituationen auch in lege artis durchgeführten Verhaltenstherapien bei Zwangspatienten präsent sind, insbesondere bei Vorliegen einer komorbiden Persönlichkeitsstörung. Implikationen für weitere Forschung und die Gestaltung des therapeutischen Prozesses werden diskutiert. A 07 Klaustrophobie in virtueller Realität: Der Einfluss perzeptueller Umweltreize und furchtbezogener Informationen auf die Furchtreaktion Henrik Peperkorn (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) Georg W. Alpers (Universität Mannheim) Andreas Mühlberger (Lehrstuhl für Psychologie I – Arbeitsbereich Interventionspsychologie, Institut für Psychologie, Universität Würzburg) Abstract: Spezifische perzeptuelle Umweltreize oder Informationen können phobische Reaktionen auslösen. Diese unterschiedlichen Auslösebedingungen sind jedoch bis heute nicht direkt verglichen worden. In dieser Studie wird virtuelle Realität genutzt, um perzeptuelle Umweltreize und die Informationen über diese kontrolliert zu manipulieren. Damit soll geklärt werden, welche unterschiedlichen Muster selbstberichteter und psychophysiologischer Furchtreaktionen sie hervorrufen. Es wird erwartet, dass perzeptuelle phobiespezifische Umweltreize – die virtuelle Repräsentation einer geschlossenen Kammer – starke physiologische Furchtreaktionen auslöst. Zusätzliche verbale Information darüber, ob die phobiespezifische Situation – sich in Realität in einer verschlossenen Kammer zu befinden – tatsächlich vorhanden ist, sollte vor allem den zeitlichen Verlauf der Furchtreaktionen modulieren. Solche Information bei nicht phobiespezifischem perzeptuellem Input – die virtuelle Repräsentation einer geöffneten Kammer – sollte über kortikale Informationsverarbeitungsprozesse ebenfalls Furcht auslösen, aber mit schwächeren physiologischen Furchtreaktionen einhergehen. In einem unabhängigen Versuchsplan wurden den Probanden (N=30) entweder perzeptuelle phobiespezifische Umweltreize, verbale Informationen über die phobiespezifische Situation ohne entsprechende perzeptuelle Reize oder eine Kombination aus phobiespezifischen perzeptuellen Reizen und Informationen für die Dauer von 5 x 5 Minuten dargeboten. Erste Ergebnisse weisen auf eine wesentliche Bedeutung perzeptueller Umweltreize für initiale Furchtreaktionen bei Klaustrophobie hin. Perzeption einer Situation ist dabei wichtiger als das kognitive Wissen über die reale Situation. Die Kombination aus furchtrelevanter Information und der Präsentation furchtrelevanter perzeptueller Reize löst besonders intensive und langanhaltende Furchtreaktionen aus. Die Ergebnisse entsprechen Befunden aus einer vorhergehenden Untersuchung zu perzeptuellen Umweltreizen und furchtbezogenen Information bei Spinnenphobie. Virtuelle Realität ist eine sinnvolle Methode zur Induktion von Furchtreaktionen und der Aktivierung des Furchtnetzwerkes. Weitere Forschung bezüglich Mechanismen der Aktivierung von Furcht ist notwendig. A 08 Korrelate des Aufmerksamkeitsbias bei Sozialer Phobie Karolin Neubauer (Christoph-Dornier-Stiftung Münster) Hanna Ronge (Universität Bremen) Maxie von Auer (Christoph-Dornier-Stiftung Bremen) Eileen Murray (Christoph-Dornier-Stiftung Münster) Franz Petermann (Universität Bremen) Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Sylvia Helbig-Lang (Universität Bremen) Abstract: Theoretischer Hintergrund und Fragestellung: Studien zeigen, dass Personen mit Sozialer Phobie verzerrte Aufmerksamkeitsmuster (attentional bias) im Sinne einer bevorzugten Verarbeitung sozial bedrohlicher Informationen aufweisen. Kognitive Erklärungsmodelle postulieren, dass dieser Bias eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Störung spielt. Bislang liegen nur wenige empirische Befunde zu Zusammenhängen zwischen sozialphobischer Symptomatik und der Ausprägung der Aufmerksamkeitsverzerrung vor. Die vorliegende Arbeit untersucht die Verteilung des Bias und seine Zusammenhänge zur Symptomausprägung und Schwere der Sozialen Phobie in einer klinischen Stichprobe. Methode: 33 Probanden mit Sozialer Phobie wurden mit einem diagnostischen Interview (SKID) und den Symptomfragebögen SPS/SIAS, LSAS, SPE, SPK, SKV, DFS sowie dem BDI untersucht. Die Ausprägung des Aufmerksamkeitsbias wurde mittels eines dot probe Paradigmas unter Verwendung von Gesichtern mit unterschiedlichem emotionalem Ausdruck (Ekel vs. Neutral) gemessen. Ergebnisse: In der untersuchten Stichprobe war der Aufmerksamkeitsbias-Score normalverteilt. Es zeigten sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede und keine Assoziationen zum Alter der Teilnehmer. Darüber hinaus zeigten sich keinerlei signifikante Zusammenhänge mit sozialphobischen Symptomen, der Schwere der Sozialen Phobie, dem Ausmaß sozialphobischer Vermeidung, dysfunktionaler Selbstaufmerksamkeit oder Depressivität. Diskussion: Obgleich Studien zur Modifikation des Aufmerksamkeitsbias bei Personen mit Sozialer Phobie einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Aufmerksamkeitsbias und der Stärke der sozialphobischen Symptomatik nahelegen, konnte dieser in der untersuchten Stichprobe nicht gezeigt werden. Möglicherweise unterscheiden sich verschiedene Subgruppen hinsichtlich der Ausprägung der Symptomatik. Schlussfolgerungen: Obwohl die Bedeutung von Aufmerksamkeitsverzerrungen für die Aufrechterhaltung von Angststörungen als gut belegt gilt, bleibt fraglich, in welchem Zusammenhang diese zur Ausprägung der Symptomatik stehen. A 09 Nachdenken ohne Lösungschance – Die pathologische Form der Sorgen Stefan Schmalholz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) Stefan Uhmann (Technische Universität Dresden) Jürgen Hoyer (Technische Universität Dresden) Abstract: Dienen Sorgen der Bereitstellung kognitiver Ressourcen und damit der Problemlösung? Oder stehen sie im Dienste der Vermeidung emotionaler Erfahrungen, wobei die Sorgen die Vermeidungsfunktion gerade dann gut erfüllen, wenn sie eben nicht mit lösbaren Problemen zu tun haben? Wir nehmen an, dass beides möglich ist und sich Sorgen mit konkretem Problembezug und Sorgen ohne Bezug zu lösbaren Problemen in ihren psychologischen Funktionen und Effekten valide unterscheiden lassen. Wir untersuchten dies in zwei Fragebogenstudien. In Studie 1 (N = 162) schätzten die Probanden die subjektive Lösbarkeit von verschiedenen hypothetischen Problemszenarien ein. Mittels verschiedener Skalen, unter anderem dem Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II, Gloster et al., submitted), wurden potentielle Prädiktoren für die subjektive Lösbarkeit analysiert. In Studie 2 (vorläufiges N = 162, angestrebtes N > 300) wird mittels Regressionsanalysen untersucht, ob der Zusammenhang zwischen Sorgen (Worry Domains Questionnaire, WDQ) und Symptomen (Symptom-Checkliste, SCL-9; Allgemeine Depressionsskala, ADS) durch die subjektive Lösbarkeit der im WDQ angegebenen Probleme moderiert wird. In Studie 1 zeigt sich, dass Probleme desto eher als lösbar eingeschätzt werden und die Sorgenintensität desto geringer ist, je höher die psychologische Flexibilität (Hayes) des Probanden ausgeprägt ist. Zwischenergebnisse zu Studie 2 zeigen, dass die Einschätzung eines Sorgenthemas als „lösbar“ in erwarteter Richtung den Zusammenhang zwischen Sorgenintensität und kognitivemotionalen Symptomen moderiert: Sorgen korrelieren nur dann deutlich positiv mit klinischen Symptomen, wenn sie sich auf subjektiv unlösbare Probleme beziehen. Die Ergebnisse tragen zur Theorie der Sorgen und anderer Formen repetitiven Denkens bei und können bisherige inkonsistente Befunde erklären. Sie begründen Perspektiven für verbesserte Interventionen bei chronischen, unkontrollierbaren Sorgen. A 10 Reviktimisierung: Ein bio-psycho-soziales Vulnerabilitätsmodell Estelle Bockers (Freie Universität Berlin) Christine Knaevelsrud (Freie Universität Berlin, Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin) Abstract: 1. Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Personen, die in ihrer Kindheit interpersonellen Traumatisierungen ausgesetzt waren, haben im Erwachsenenalter ein signifikant erhöhtes Risiko erneut traumatisiert zu werden. Trotz der hohen Prävalenz von Traumatisierungen in der Kindheit und Reviktimisierungen im Erwachsenenalter sind die psychologischen Mechanismen, die Reviktimisierungen zu Grunde liegen bisher nicht ausreichend geklärt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung aktueller Theorien und der empirischen Befundlage zu Reviktimisierung sowie die Ableitung eines integrativen bio-psycho-sozialen Modells der Reviktimisierung. 2. Methode Zunächst wurde eine systematische Literaturanalyse über die Datenbankensysteme NCBI/PubMed, MEDLINE und PsychInfo durchgeführt. Desweiteren wurden Autoren angeschrieben, die zum Thema Reviktimisierung forschen, um Zugang zu weiteren aktuellen Studien zu erhalten. 3. Ergebnisse Verschiedene Theorien fokussieren neurophysiologische posttraumatische Veränderungen, andere integrieren psychische und soziale Faktoren. Faktoren, die aufgrund empirischer Studien mit Reviktimisierung assoziiert werden, sind insbesondere das Vorliegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung, Dissoziation, Risikoreiches Verhalten, Defizite in der Risikoerkennung und Risikoreaktion sowie emotionale Beeinträchtigung und geringe Selbstwirksamkeitserwartungen. Mit der Entwicklung eines bio-psychosozialen Modells lassen sich bisherige Modellversuche und aktuelle Studienergebnisse integrieren. 4. Diskussion/Schlussfolgerungen Sowohl physiologische Prozesse, psychische Traumafolgen als auch soziale Faktoren, sowie Interaktionen innerhalb dieser drei Ebenen scheinen die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reviktimisierung zu beeinflussen. Für zukünftige Forschung wäre ein Fokus auf die Überprüfung des bio-psycho-sozialen Modells der Reviktimisierung wünschenswert. A 11 Subjektive Bewertung phobierelevanter Geräusche Antje B.M. Gerdes (Universität Mannheim) Michael M. Plichta (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Dorothea Gareis (Universität Mannheim) Lisa Liebke (Universität Mannheim) Georg W. Alpers (Universität Mannheim) Abstract: Während emotionale Reaktionen von Personen mit spezifischen Phobien auf phobierelevante Bilder häufig untersucht wurden, existieren bisher kaum Befunde zur Wirkung phobierelevanter Geräusche. Emotionale Information wird aber häufig durch auditorische Reize vermittelt. Im Gegensatz zu visuellen Reizen erreicht auditorische Information den Empfänger auch über lange Distanzen und kann unabhängig von der Ausrichtung der räumlichen Aufmerksamkeit verarbeitet werden. Somit ist es plausibel, dass neben visueller auch auditorische Information bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von spezifischen Phobien eine Rolle spielen könnte. Um die Wirkung phobierelevanter auditorischer Information systematisch untersuchen zu können, wurden zunächst gesunden Versuchspersonen eine neue Serie von phobierelevanten Geräuschen (z. B. Hundebellen, Zahnbehandlungsgeräusche) präsentiert. Die subjektive Bewertung (Valenz, Arousal) und die Erkennensleistung wurden erfasst und mit Reaktionen auf eine standardisierte Serie von emotionalen Geräuschen verglichen (International Affective Digitized Sound System (IADS) von Bradley and Lang, 1999) . Der Einfluss möglicher physikalischer Unterschiedlichkeit der Geräusche (spektro-temporale Charakteristika) wird exploriert. Zusätzlich wurde die allgemeine Ängstlichkeit, Angst vor Hunden und Angst vor Zahnbehandlungen mittels Fragebögen erfasst. Erwartet wird, dass die phobierelevanten Geräusche von gesunden Versuchspersonen hinsichtlich Valenz und Arousal vergleichbar zu phobieirrelevanten unangenehmen Geräuschen bewerten werden. Zusätzlich wird ein Zusammenhang zwischen den Valenz- und Arousalbewertungen und dem Ausmaß spezifischer Angst erwartet. Implikationen für spezifische Phobien werden diskutiert. A 12 Towards a clearer understanding of how situational exposure works Andrew White (Universität Mannheim) Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Dieter Kleinböhl (Universität Mannheim) Thomas Lang (Christoph-Dornier-Stiftung Bremen) Alfons O. Hamm (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Georg W. Alpers (Universität Mannheim) Abstract: Theoretical background / Question Situational exposure is a core component of Cognitive Behaviour Therapy (CBT) for panic disorder (PD) with agoraphobia. In the current study, we use ambulatory assessment of heart rate, anxiety, and panic symptoms, as well as position to clarify the mechanisms of change during exposure. Specifically, whether initial fear activation during exposure predicts treatment outcome. This accords with the Emotional Processing Theory (Foa & Kozak, 1986) which has achieved some support (Alpers & Sell, 2008), and also been met with criticism (Baker et al., 2010; Craske et al., 2008). As behavioural avoidance is a hallmark symptom of PD, we monitor position during homework exposure tasks to gauge progress and examine the extent to which fear and avoidance are synchronous. Method Data were collected as part of a clinical study conducted across several treatment centres in Germany (Panic Net). Patients with PD with agoraphobia were randomised to one of two CBT conditions: standard in vivo exposure or fear augmented exposure. Physiological activation (HR) and location (GPS coordinates) were collected during exposure using a commercial sports monitor. Self-reported anxiety was collected with a handheld computer (ecological momentary assessment, EMA). Standardised clinical instruments were administered pre- and post-treatment to determine therapeutic outcome. Results Methodological issues and preliminary results are outlined; HR and EMA data are segmented into three epochs (before, during and after exposure exercises) and linear regression is used to describe the relationship between initial HR during exposure and treatment outcome. GPS data are decomposed to reveal homework compliance (total distance travelled) and behavioural avoidance. Treatment related changes were calculated using pre to post change scores on clinical instruments. Discussion and Conclusions Results are discussed with a view to describing changes in the emotional processing of fear during and across exposure sessions. Possibilities for refinement of exposure tasks will be discussed. A 13 Unterschiede zwischen Spinnenängstlichen und Blut-, Spritzen- und Verletzungsängstlichen in der frühen Informationsverarbeitung von angstrelevanten und aversiven Bildern Anke Haberkamp (TU Kaiserslautern) Kathrin Niederprüm (TU Kaiserslautern) Nicole Reinert (TU Kaiserslautern) Marie Salzmann (TU Kaiserslautern) Thomas Schmidt (TU Kaiserslautern) Abstract: Aktuelle Studien zeigen, dass aversive und angst-relevante Reize im Vergleich zu neutralen Stimuli besonders schnell verarbeitet werden (z.B. Öhman et al., 2001; Rinck & Becker, 2006). Soweit uns bekannt ist, gibt es jedoch keine Studie zur frühen Informationsverarbeitung (innerhalb der ersten halben Sekunde) angstrelevanter Bilder bei Phobikern. Um diese frühe Verarbeitung erfassen zu können, führten wir zwei "Response Priming"-Experimente durch; jeweils mit einer Kontroll- und einer Experimentalgruppe (Exp. 1: Spinnenängstliche, Exp. 2: Blut-, Spritzen- und Verletzungsängstliche). Im ersten Experiment wurde den Probanden in jedem Durchgang in schneller Abfolge ein Prime und ein nachfolgender Zielreiz (Target) präsentiert, der den Prime maskierte. Beide Reize wurden zufällig aus einer von vier Bildkategorien gezogen (Spinnen, Schlangen, Blumen, Pilze). Die Aufgabe der Probanden war es, die Targets so schnell wie möglich zu erkennen und zu kategorisieren. Es gab zwei Klassifikationsaufgaben: entweder Spinnen und Schlangen sollten von Blumen und Pilzen diskriminiert werden (Tier vs. Nicht-Tier Aufgabe) oder Spinnen und Pilze von Schlangen und Blumen (Spinne vs. Schlange Aufgabe). Alle Probanden zeigten starke und reliable Primingeffekte, die mit Abstand schnellsten Reaktionszeiten erzielten aber spinnenängstliche Probanden bei der Antwort auf Spinnentargets. Wir argumentieren, dass die Verarbeitungsvorteile der Spinnenängstlichen dabei weniger auf emotionalen Reaktionen unter Beteiligung der Amygdala beruhen, sondern wahrscheinlich vielmehr auf perzeptuelle Lerneffekte zurückzuführen sind. Allgemein zeigen Spinnenphobiker im Gegensatz zu Blut-, Spritzen- und Verletzungphobikern andere physiologischen Reaktionen: konfrontiert mit angst-relevanten Stimuli neigen sie zu einer parasympathischen Aktivierung, die mit einem Abfall von Blutdruck und Herzfrequenz assoziiert ist und mit Ohnmachtsanfällen einhergehen kann. Deshalb verglichen wir in dem zweiten Experiment, äquivalent zu dem ersten, eine Kontrollgruppe mit einer Gruppe von Blut-, Spritzen- und Verletzungsängstlichen. Die Ergebnisse werden hinsichtlich der kognitiven Unterschiede in der frühen Informationsverarbeitung von angst-relevanten Bildern bei beiden Gruppen von Ängstlichen ausführlich diskutiert. A 14 Der Zusammenhang zwischen autobiographischem Gedächtnis und prospektiver Simulation bei der Depression Stefan Uhmann (Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung. Defizite im Abruf aus dem autobiographischen Gedächtnis (AG) sind für die Depression gut belegt. Auf Inhalte des AG wird bei der Simulation und Planung prospektiver Handlungen zurückgegriffen. Es liegt daher nahe zu prüfen, ob Defizite bei der prospektiven Simulation und Planung, z.B. beim sozialen Problemlösen, auf die Defizite beim Abruf aus dem AG zurückgeführt werden können. Methode. Die präsentierten Daten basieren auf einer Pilotstudie. Darin wird für eine nicht-klinische Stichprobe (N = 15), die depressive Symptome angibt, geprüft, ob Defizite beim Abruf aus dem AG (gemessen mit dem AMT) mit Defiziten beim prospektiven Simulieren und Planen (Simulationsaufgabe) korrespondieren. Als Moderatoren werden die Selbstkonzeptnähe der abgerufenen bzw. simulierten Inhalte und induzierte Stimmung betrachtet. Ergebnisse. Regressions- und Varianzanalysen zu folgenden statistischen Hypothesen werden präsentiert: Defizite im AMT korrelieren positiv mit Defiziten in prospektiven Simulationsaufgaben, wenn die Inhalte selbstkonzeptnah sind. Außerdem ist der Zusammenhang stärker, wenn negative Stimmung induziert wird. Diskussion. Die Pilotstudie bildet die Grundlage für eine geplante klinische Studie. Der Zusammenhang zwischen Defiziten im Abruf aus dem AG und prospektiven Simulations- und Planungsprozessen würde die Grundlage liefern, um Interventionen abzuleiten. Diese versprechen durch das Training von AG-Abruf, Elaboration und Planungsprozessen unmittelbar Defiziten z.B. beim sozialen Problemlösen entgegenzuwirken. Dies verspräche wiederum eine effektive Methode um der Aufrechterhaltung depressiver Störungen entgegenzuwirken. A 15 Effektivität und Effizienz von Stepped Care für Patienten mit Depression: Hintergrund, Zielsetzungen und Design eines Modellprojektes zu einer leitliniengerechten, integrierten Versorgung Birgit Watzke ([email protected]) Rainer Richter (Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)) Claudia Lehmann (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Maya Steinmann (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Martin Haerter (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf) Abstract: Hintergrund. Das Gesamtprojekt „Gesundheitsmetropole Hamburg – Netzwerk Psychische Gesundheit“, das im Rahmen der BMBF-Initiative „Gesundheitsregionen der Zukunft“ seit Januar 2011 elf wissenschaftliche Projekte zu Aufklärung, Diagnostik und Therapie verschiedener psychischer Störungen über eine Laufzeit von vier Jahren durchführt (Fördervolumen 8 Mio. plus 8 Mio. Eigenmittel), beinhaltet auch ein Projekt zur umfassenden Versorgung von Patienten mit Depression: Ziel dieses Depressionsprojektes ist es, ein Stepped Care-Modell (SCM) mit Behandlungsoptionen unterschiedlicher Intensität (watchful waiting, Bibliotherapie, computergestützte psychotherapeutische Unterstützung, psychotherapeutische Telefonunterstützung; ambulante Psycho- oder/und Pharmakotherapie; (teil-)stationäre Psycho- oder/und Pharmakotherapie) für Patienten mit leichter, mittelgradiger und schwerer Depression in Hamburg zu implementieren und zu evaluieren. Dabei soll überprüft werden, ob die Einführung des SCM im Sinne einer leitliniengerechten integrierten Behandlung (mit Bezugnahme auf die S3-Leitlinie/Nationalen Versorgungsleitlinie Depression) die Behandlungswege optimiert und die Versorgung verbessert und effizienter gestaltet. Methode. Im Anschluss an die aktuell laufende Projektphase der Implementierung des Stepped Cares, in der ein multiprofessionelles Netzwerk mit ambulanten, teilstationären und stationären Behandlern aufgebaut wird, wird eine randomisierte kontrollierte Interventionsstudie als prospektive Mehrzeitpunktbefragung einer konsekutiven Stichprobe depressiver Patienten (N=860) der teilnehmenden Praxen und Einrichtungen durchgeführt. Es wird eine Cluster-Randomisierung auf Ebene der Praxen vorgenommen. Patienten mit SCM werden mit Patienten der Regelversorgung (TAU) hinsichtlich des Behandlungserfolges (primäres Outcome: Reduktion der depressiven Symptomatik) innerhalb eines 1-Jahreszeitraumes verglichen. Das Poster stellt die Ausgangslage, die Zielsetzungen, das Design sowie die aktuellen und die anstehenden Arbeitsschritte des Projektes zur Diskussion vor. Besonders relevant - sowohl unter klinischen als auch gesundheitspolitischen Gesichtspunkten - erscheinen hierbei die beim Stepped Care vorgesehenen niedrigschwelligen psychotherapeutischen bzw. klinisch psychologischen Behandlungselemente (u.a. eMentalHealth, s.o.) und die damit verbundene Fragestellung nach einer adäquaten Indikationsstellung für diese Behandlungsoptionen. A 16 Eine Frage der Balance? Berufliches Gratifikationserleben, berufliche Selbst-Wertschätzung und Depressivität bei einer klinischen Stichprobe Vera Bauernschmitt (Ludwig-Maximilians-Universität München) Stefan Koch (Schön Klinik Roseneck für Psychosomatische Medizin) Dirk Lehr (Philipps-Universität Marburg) Andreas Hillert (Schön Klinik Roseneck für Psychosomatische Medizin) Abstract: Theorie: Anhand des Modells der berufl. Gratifikationskrise (Siegrist, 1996) konnte international mehrfach ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei Imbalance von berufl. Engagement und berufl. Gratifikationserleben (ERI) nachgewiesen werden. Ziel dieser Studie war es, erstmals an einer berufl. heterogenen klinischen Stichprobe Zusammenhänge zwischen ERI gesamt bzw. für einzelne Belohnungskomponenten (Arbeitsplatzsicherheit, Wertschätzung, Status) mit Depressivität (ADS-K) zu untersuchen. In einer Studie an Lehrern (Lehr, 2007) war ein Mangel an externer Wertschätzung der bedeutsamste Risikofaktor. Daher wurde in dieser Studie erstmalig berufsgruppenübergreifend untersucht, ob Kompetenzen berufl. Selbst-Wertschätzung (OSAS) gesundheitsprotektiv wirken. Methode: In einer Querschnittserhebung wurden 120 berufstätige Patienten einer psychosomatischen Klinik (60% Angestellte, 40% Beamte) befragt. Erhoben wurden ERI, OSAS und ADS-K. Zur Überprüfung der Hypothesen wurden schrittweise multiple Regressionsanalysen durchgeführt. Ergebnisse: Das ERI-Gesamtmodell korrelierte substanziell mit ADS-K (R²=11%). Ein Ungleichgewicht von Engagement und Arbeitsplatzsicherheit (β=.32) hing am höchsten mit ADS-K zusammen. Die berufl. Selbst-Wertschätzung klärte einen inkrementellen Varianzanteil auf (DeltaR²=3%). Diskussion: Die gesundheitliche Bedeutung berufl. Gratifikationserlebens, speziell der Belohnungskomponente Arbeitsplatzsicherheit, konnte bestätigt werden. Bemerkenswerterweise ergaben sich keine Unterschiede in Abhängigkeit von objektiven Arbeitsmerkmalen. Berufl. SelbstWertschätzung (z.B. Kommunikation über Erfolg im Beruf) hatte bzgl. Depressivität eine protektive Funktion. Schlussfolgerung: Berufl. Gratifikationskrisen und mangelnde berufl. Selbstwertschätzung stehen in Zusammenhang mit Depressivität. Die vorliegenden Ergebnisse legen nahe, dass bei hoher psychischer Belastung objektive Arbeitsplatzmerkmale (z.B. Beamtenstatus) weniger entscheidend sind. Negative subjektive Erwerbsprognosen aufgrund der psychischen Erkrankung und ein Mangel an selbstwertförderlichen Kompetenzen sind bedeutsamer. Frühzeitig begonnene berufsbezogene Interventionen sollten einer wechselseitigen Verstärkung von Gratifikationskrise und Depressivität entgegen wirken. Berufl. Gratifikationserleben, insb. berufl. Selbst-Wertschätzung eröffnen wertvolle Interventionsmöglichkeiten. Längsschnittstudien und eine Bewährung des ERI-Modells in berufsbezogenen Gruppeninterventionen stehen aus. A 18 Anwendungshäufigkeiten diagnostischer Verfahren in der klinischpsychologischen Forschung und Psychotherapie-Forschung im deutschsprachigen Bereich. Saskia Naescher (ZPID) Hans Bauer (ZPID) Dr. Gabriel Schui (ZPID) Prof. Dr. Günter Krampen (ZPID) Abstract: Fragestellung In Anwendungs- und Forschungspraxis von Klinischer Psychologie und Psychotherapie ist die Verwendung diagnostischer und evaluativer Hilfsmittel unabdingbar. Befragungen von Praktikern haben wiederholt gezeigt, dass neben freien diagnostischen Erhebungen vor allem Breitbandverfahren der Persönlichkeitsdiagnostik und projektive Verfahren eingesetzt werden. Es stellen sich die Fragen, (1.) welche diagnostischen und evaluativen Verfahren in der deutschsprachigen klinischpsychologischen und Psychotherapie-Forschung wie häufig genutzt werden und (2.) ob es Unterschiede in den Nutzungshäufigkeiten diagnostischer Verfahren zwischen der klinischpsychologischen Anwendungs- und Forschungspraxis gibt. Untersucht wird zudem, ob die angestiegene englischsprachige Publikation klinisch-psychologischer Befunde zu einer Zunahme in der Verwendung aus dem Englischen übernommener diagnostischer Verfahren und Abnahme von eigenständigen deutschsprachigen Testentwicklungen geführt hat. Methoden Bibliometrische Daten zur Verwendung diagnostischer Verfahren in der klinisch-psychologischen und Psychotherapie-Forschung im deutschsprachigen Bereich wurden anhand der in der Datenbank PSYNDEX dokumentierten Fachpublikationen erhoben. Zusätzlich erfasst wurden die Publikationsjahre und -sprache (Englisch vs. Deutsch), die Testherkunft (international vs. deutsch) sowie inhaltliche Testcharakteristika. Für Vergleiche wurden die Ergebnisse mehrerer Praktikerbefragungen zur Verwendung von Testverfahren aggregiert. Ergebnisse Die Befunde deuten auf Unterschiede in der Verwendung diagnostischer und evaluativer Hilfsmittel in der Anwendungs- und Forschungspraxis hin. In den Rangreihen der spezifischen Testverfahren existieren nur wenige Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede in der Testverwendung zwischen klinischpsychologischer Forschung und Psychotherapieforschung sind geringer. Verwendungshäufigkeiten spezifischer Testverfahren in der Forschung variieren mit Herkunft, Publikationssprache und Publikationsjahr. Diskussion und Schlussfolgerungen Die Unterschiede in der Nutzung diagnostischer und evaluativer Testverfahren weisen darauf, dass der Transfer von der Forschungs- zur Anwendungspraxis in der klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen Aus-, Fort- und Weiterbildung der weiteren Optimierung bedarf. Die internationale Sichtbarkeit deutschsprachiger klinisch-psychologischer Testentwicklungen sollte durch mehr einschlägige englischsprachige Publikationen erhöht werden. A 19 Das Osnabrücker Compliance Inventar. Vorstellung eines neu entwickelten Compliance-Instruments Nina Rexin (Universität Osnabrück) Linda Pruß (Universität Osnabrück) Karl H. Wiedl (Universität Osnabrück) Henning Schöttke (Universität Osnabrück) Manuel Waldorf (Universität Osnabrück) Abstract: Hintergrund/Fragestellung: Non-Compliance ist eine der wichtigsten Ursachen für Rezidive von Patienten mit Schizophrenie-Diagnosen und daraus erwachsende individuelle und ökonomische Kosten. Die Erforschung des Konstruktes ist daher von großer Bedeutung, gestaltet sich jedoch aufgrund von heterogenen Definitionskriterien und Messmethoden schwierig. Ziel der aktuellen Studie ist die Entwicklung und Überprüfung eines ökonomischen und validen Compliance-Fragebogens. Hier soll eine erste psychometrische Analyse des Osnabrücker Compliance-Inventars (OCI) vorgestellt werden. Methode: Nach Sichtung existierender deutschsprachiger Compliance-Instrumente wurde das OCI mit neun Items zu den theoretisch bedeutsamen Facetten Freiwilligkeit, Motivation und Zuverlässigkeit der Behandlungsteilname konstruiert. Es liegt als Patienten- und Fremdbeurteilungsversion vor. An 99 Patienten mit Diagnosen aus dem Schizophrenie-Spektrum wurden beide Varianten des Instrumentes sowie Daten zu Symptomatik (PANSS), Krankheitseinsicht (SUMD), therapeutischer Beziehung (STAR), Einstellungen gegenüber Medikamenten (BMQ) und subjektive Krankheitskonzepte (IPQS) erhoben. Ergebnisse: Das OCI weist gute Konsistenzen und Trennschärfen sowie eine akzeptable RetestReliabilität (n = 20) auf. Erste Belege für seine externe Validität ergeben sich aus signifikanten Zusammenhängen zu den erhobenen Kriterien, wobei sich ein deutlich differentielles Zusammenhangsmuster der Versionen zeigt. Patientenurteile erfolgen demzufolge stärker aus einer auf Behandlungssituation und Krankheitsverlauf fokussierenden Perspektive, während Fremdeinschätzungen auf aktuellen Verhaltensweisen und Symptomatik des Patienten basieren. Die Konvergenz der Urteile fällt entsprechend gering aus, Krankheitseinsicht ist jedoch mit beiden Versionen assoziiert. Diskussion: Das OCI genügt den psychometrischen Ansprüchen an die indirekte Erfassung von Compliance. Die differentielle Validität und geringe Interkorrelation der Versionen deuten darauf hin, dass sich Behandlungsexperten und Patienten hinsichtlich ihrer Perspektiven bzw. der Beurteilungsgrundlagen der Compliance unterscheiden. Eine Validierung an einer direkten Messung von Compliance steht aus. Schlussfolgerungen: Das OCI erwies sich als reliables und ökonomisches Instrument, das zudem theoretisch bedeutungsvolle Zusammenhänge mit behandlungsrelevanten Variablen aufwies. Es bildet somit die Grundlage zur weiteren Erforschung von Compliance im deutschsprachigen Raum. A 20 Die Entschlüsselung interpersonellen Verhaltens: Zusammenhänge des Impact Message Inventory (IMI) mit Persönlichkeitsvariablen und nonverbalem Verhalten Almut Rudolph (TU Chemnitz) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung. Der interpersonale Stil wird definiert als die zeitlich und transsituativ stabile Tendenz im offenen und verdeckten interpersonalen Verhalten. Dabei wird angenommen, dass jeder Akteur versucht, beim Interaktionspartner eine Bestätigung seiner Selbstdefinition hervorzurufen und auf diese Weise Sicherheit zu gewinnen – durch verbale und nonverbale Kommunikation. Der Impact Message Inventory ist ein Fremdbeurteilungsfragebogen, mit dessen Hilfe der interpersonale Stil einer Person durch den Interaktionspartner erfasst werden kann. Das interpersonale Verhalten wird im interpersonellen Circumplex abgebildet, welches acht Faktoren auf den Dimensionen Affiliation (freundlich-feindselig) und Kontrolle (dominant-unterwürfig) umfasst. Diese Studie geht der Frage nach, welche Informationen die Interaktionspartner für die Beurteilung des interpersonalen Stils nutzen. Im Detail soll überprüft werden, ob sich die Beziehungsaspekte der Persönlichkeitsmerkmale im nonverbalen Verhalten widerspiegeln. Methode. Die Probanden wurden im Rahmen einer Laborstudie videografiert. Zunächst wurde in einer standardisierten Situation das Verhalten der Probanden hinsichtlich nonverbalen kontrollierten Verhaltens (Illustratoren, Körperhaltung, Sprachintensität) und nonverbalen spontanen Verhaltens (Adaptoren wie Mund- und Handbewegungen) in Anlehnung an Ekman und Friesen (1969) kodiert. Dann wurde der interpersonale Stil der Probanden durch unabhängige Beurteiler mit dem Impact Message Inventory ermittelt. Zusammenhänge der IMI Faktoren mit nonverbalen Verhalten wurden untersucht. Ergebnisse. Die internen Konsistenzen der IMI Skalen sind sehr gut, die Beobachterüberstimmung ist zufriedenstellend. Es finden sich Zusammenhänge der Affiliationsdimension des IMI mit spontanem Verhalten, nicht aber mit kontrolliertem Verhalten und der Dominanzdimension des IMI mit kontrolliertem Verhalten, nicht aber mit spontanem Verhalten. Diskussion. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass bei der Beurteilung des interpersonalen Stils nonverbales Verhalten genutzt wird. Dabei scheinen spontanes und kontrolliertes Verhalten unterschiedliche Vorhersagekraft für die Dimensionen des IMI zu haben. Schlussfolgerungen. Die detaillierte Untersuchung der Art und Weise wie Menschen Affiliation und Kontrolle in ihren Interaktionen ausdrücken, kann einen bedeutenden Beitrag für das Verständnis interpersonellen Verhaltens haben. A 21 Die Joystickmethode zur Echtzeiterhebung Interpersonaler Mikroprozesse in der Psychotherapie David Altenstein (Universität Zürich) Christoph Casper (Universität Jena) Martin Grosse Holtforth (Universität Zürich) Abstract: Hintergrund: Der positive Zusammenhang zwischen der Qualität der Therapiebeziehung und dem Therapieerfolg zählt zu den stabilsten Befunden der Psychotherapieforschung. In Ermangelung geeigneter Erhebungsmethoden haben sich jedoch wenige Studien mit der Frage beschäftigt, welche interpersonalen Mikroprozesse zur Bildung dieser speziellen Beziehung beitragen. Das Interpersonale Zirkumplex-Modell (Wiggins, 1982) beschreibt interpersonales Verhalten anhand der beiden voneinander unabhängigen Variablen Affilitation und Dominanz. Sadler et al.’s (2009) JoystickMethode erlaubt die synchrone Echtzeiterfassung dieser beiden Variablen und ermöglicht die Überprüfung differenzierter Interaktionshypothesen (u. a. Komplementarität). In unserer laufenden Studie setzen wir das aus der sozialpsychologischen Grundlagenforschung stammende Instrument ein, um zu ergründen, welche spezifischen Interaktionsmuster die emotionale Verarbeitung in der Therapie bei Depression begünstigen. Methode: 21 PatientInnen und 13 TherapeutInnen nahmen an einer unkontrollierten Vorstudie der Expositionsbasierten Kognitiven Therapie bei Depression (EBCT-R; Grosse Holtforth et al., in revision; Hayes et al., 2005, 2007) teil. Da wir im Vorfeld zeigen konnten, dass das erreichte Maximalniveau an kognitiv-emotionaler Verarbeitung in der mittleren Behandlungsphase mit dem Therapieerfolg korreliert, wurde aus jeder Therapie diejene Sitzung zur Videoanalyse ausgewählt, die den höchsten Verarbeitungswert aufwies. Vier trainierte MasterstudentInnen erfassten die interpersonalen Prozesse in diesen Sitzungen mit Hilfe der Joystick-Methode in Echtzeit sowie mittels der etablierten Checklist of Psychotherapy Transactions (CLOPT; Kiesler, 1984). Ergebnisse: Es werden Ergebnisse zur Interraterreliabilität sowie zur konvergenten Validität der Joystickmethode präsentiert. Zudem werden vorläufige Ergebnisse zur Überprüfung spezifischer Komplementaritätsannahmen präsentiert. Diskussion: Die Ergebnisse werden bezüglich Einsetzbarkeit der Joystickmethode im Psychotherapiekontext, adäquater Methoden zur Datenanalyse und zukünftiger Forschung diskutiert. A 22 Evaluation eines Fragebogens zu belastenden Sozialerfahrungen in der Peergroup Lisa Sansen (Universität Bielefeld, Christoph-Dornier-Stiftung Bielefeld) Abstract: Emotionaler Missbrauch und emotionale Vernachlässigung sowie Ablehnungserfahrungen spielen eine bedeutsame Rolle für die Entwicklung sozialer Ängste (Aune & Stiles, 2009; Simon et al., 2009). Zur Erfassung dieser negativen sozialen Erfahrungen liegen bislang kaum geeignete Fragebögen vor. Der Childhood Trauma Questionnaire (CTQ von Bernstein und Fink, 1998) stellt ein Messinstrument dar, mit dem retrospektiv emotionaler, physischer und sexueller Missbrauch sowie emotionale und physische Vernachlässigung im familiären Umfeld erfasst werden können. Für die Erhebung aversiver sozialer Erfahrungen in der Peergroup gibt es bislang kein deutschsprachiges Verfahren. Ziel der vorliegenden Studie war es, einen Fragebogen zur Erfassung negativer Sozialerfahrungen innerhalb der Peergroup zu entwickeln und zu validieren. Die Entwicklung des FBS erfolgte anhand inhaltlicher Überlegungen. Es wurden 22 kurze Beschreibungen aversiver sozialer Situationen generiert (z. B. „Andere Kinder und Jugendliche haben mich von ihren Spielen und Aktivitäten ausgeschlossen“ oder „In der Schule wollte niemand neben mir sitzen“). Für jede Situation soll angegeben werden, ob diese in der Kindheit und/oder Jugend erlebt worden ist. Um individuelle Testwerte einordnen zu können, wurde im Rahmen einer Onlinestudie an mehr als 1000 Probanden ein erstes Bezugssystems für die Ergebnisse des Fragebogens ermittelt. Eine Validierung erfolgte mit verschiedenen normierten und validierten Verfahren (z. B. CTQ, BSI). Desweiteren sollen Vergleichswerte des FBS für verschiedene klinische Stichproben (u. a. Patienten mit sozialer Phobie, Depression, Borderlinestörung) und eine nicht-klinische Stichprobe präsentiert werden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein enger Zusammenhang zwischen den mit dem FBS erfassten Erlebnissen und sozialen Ängsten besteht. Der FBS scheint über den CTQ hinaus zu einer Varianzaufklärung bzgl. sozialer Ängste beizutragen. A 23 5HTTLPR and general condition influence experimentally induced negative affect and trait worry in healthy individuals – evidence for a diathesis-stress interaction Erik Müller (Philipps-Universität Marburg) Gerhard Stemmler (Philipps-Universität Marburg) Jürgen Hennig (Justus-Liebig-Universität Gießen) Jan Wacker (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Introduction: The short (s-) allele of the 5HTTLPR polymorphism has been linked to Generalized Anxiety Disorder, characterized by excessive worrying (EW), and Depression, especially in individuals exposed to high levels of stress. Here, we tested whether the s-allele would also predict trait EW and experimentally induced negative affect (NA) in healthy individuals, especially if they are currently experiencing a poor general condition (GC). Methods: N = 201 healthy males were genotyped for 5HTTLPR, phenotyped for EW using the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) and gave a rating of their current GC. To induce NA, participants performed several laboratory tasks and then received feedback that they performed too poorly to receive a previously announced bonus payment. Before and after the feedback NA was assessed. Results: Among individuals with clinically relevant PSWQ values, s-vs. l-carriers showed significantly greater variance of PSWQ-scores and a relatively higher frequency of very high PSWQvalues indicative of trait EW. Further, in individuals with poor but not with good GC, the s-allele predicted enhanced experimental induction of NA with failure feedback. Importantly, s- vs. l-carriers did not differ in their mean PSWQ or NA values per se. Discussion: The disproportionate number of s-carriers among excessive worriers despite no genotype effects on mean PSWQ scores indicates that the s-allele is only a vulnerability factor for EW under special circumstances (while it could be protective in other situations). The interaction of GC and 5HTTLPR on NA suggests that the short allele may increase vulnerability for EW and NA in a healthy population with poor GC. Conclusion: The present findings replicate prior studies that the s-allele of the 5HTTLPR polymorphism predicts elevated risk for EW and NA, especially in individuals currently exposed to suboptimal GC. A 24 Akzeptieren oder Verändern - Von welcher Emotionsregulationskompetenz profitieren depressive Patienten? Judith Kowalsky (Philipps-Universität Marburg) David Ebert (Philipps-Universität Marburg) Alexandra Dippel (Dr. Ebel Fachkliniken - Vogelsbergklinik) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Defizite im Bereich der Emotionsregulation werden mit der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Erkrankungen in Verbindung gebracht. Depressive Patienten scheinen einerseits deutliche Schwierigkeiten beim effektiven Verändern negativer Emotionen zu haben (Ehring et al., 2008), zum anderen stellen auch das Bewerten von Emotionen als „inakzeptabel“ und der daraus folgende Versuch, sie zu unterdrücken, offenbar problematische Aspekte im Rahmen affektiver Erkrankungen dar (Campbell-Sills et al., 2006). Ziel der Studie ist es, die Emotionsregulationskompetenzen (ERK) der a) Akzeptanz, b) Veränderung und c) deren Kombination zu untersuchen. Es sollen sowohl Effekte auf die Schwere der depressiven Symptomatik als auch den kurz- und langfristigen Erfolg einer stationären Depressionsbehandlung nachgewiesen werden. Dabei werden die Kompetenzen im Allgemeinen, aber auch emotionsspezifisch, beispielsweise bezogen auf Traurigkeit, Angst oder Ärger, betrachtet. Methode: Bei 200 stationär-verhaltenstherapeutisch behandelten Patienten mit depressiver Symptomatik (depressive Episode, rezidivierende depressive Störung) wurden ERK (mittels Fragebögen zur Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen, SEK27: Berking & Znoj, 2008; SEK-ES: Ebert et al., in Revision) sowie Depressivität (mittels BDI, HEALTH-49-Depressivität, PANAS-negativer Affekt) erfasst. Berechnet wurden 1. Korrelationen beider Variablen zu Therapiebeginn, 2. Korrelationen der Veränderungswerte und 3. die ERK als mögliche Prädiktoren für Katamnesewerte (3- und 12-Monats-Follow-Up). Ergebnisse: Die Ergebnisse der Korrelations- und Regressionsanalysen werden vorgestellt. Diskussion: Es wird diskutiert, inwiefern die Akzeptanz negativer Emotionen bzw. deren gezielte Veränderung im Rahmen der Therapie depressiver Erkrankungen wichtige therapeutische Ansatzpunkte darstellen. A 25 Der Zusammenhang von emotionaler Erschöpfung und Strategien der Emotionsregulation bei hoher Arbeitsintensität am Beispiel von Klinikärztinnen und –ärzten Tobias Stächele (Biologische und Differentielle Psychologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Kerstin Ensinger (Arbeits- und Organisationspsychologie, Universität Freiburg) Heinz Schüpbach (Hochschule für Angewandte Psychologie, Olten) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Emotionale Erschöpfung - als Indikator für das Risiko eines Burnout-Syndroms - wird durch zu hohe Arbeitsintensität wesentlich mitbestimmt. Bekannt ist auch, dass der Einsatz dysfunktionaler Emotionsregulationsstrategien emotionale Erschöpfung erhöhen kann. Ziel der Studie ist es diese Befunde zu verbinden und bei KlinikärztInnen zu untersuchen. Es wird erwartet, dass die Arbeitsintensität einen direkten Einfluss auf emotionale Erschöpfung hat und zudem indirekt über die Auswahl der Emotionsregulationsstrategie auf emotionale Erschöpfung wirkt. Methode: Die Daten wurden schriftlich per Fragebogen in einem Universitätsklinikum erhoben (N=397, Rücklaufquote: 34%). Der Fragebogen wurde aus erprobten Skalen zur Tätigkeitsanalyse, Emotionsregulation und emotionalen Erschöpfung zusammengestellt und an die Tätigkeit von Klinikärzten angepasst. Alle Skalen zeigen zufriedenstellende bis hohe Reliabilitätswerte. Ergebnisse und Diskussion: Die erwartet hohe Arbeitsintensität zeigt sich in einer langen Arbeitszeit (M=53,1 h/Woche, SD=12,4) und in sehr hohem erlebtem Zeitdruck, die emotionale Erschöpfung ist erhöht (M=2,9. SD=1,1). Erwartete Zusammenhänge zwischen Arbeitsintensität und emotionaler Erschöpfung werden deutlich (Zeitdruck: r=.46, p<0.001). Die Zusammenhänge von surface acting mit Zeitdruck (r=.13, p<0.05) und mit emotionaler Erschöpfung (r=.25, p<0.001) sind bedeutsam. Erste Analysen mittels multiplen Regressionsanalysen zeigen, dass die Vorhersage emotionaler Erschöpfung durch Zeitdruck (β=.42, p<0.001) und surface acting (β=.20, p<0.001) 24,0% der Varianz aufklären. Der inkrementelle Zuwachs der Varianzaufklärung durch surface acting beträgt 3,8% (p<0.001). Weitere Analysen mit Strukturgleichungsmodellen werden momentan durchgeführt. Schlussfolgerungen: Für die Erklärung emotionaler Erschöpfung von Klinikärzten sind sowohl Aspekte der Arbeitssituation als auch Strategien der Emotionsregulation bedeutsam. Bei Ärzten mit hoher Arbeitsintensität steigt die Wahrscheinlichkeit surface acting einzusetzen, um die eigenen Emotionen im Kontakt mit Patienten zu regulieren und weiterhin angemessen interagieren zu können. Damit wird ersichtlich, dass die Arbeitsintensität nicht nur direkt auf emotionale Erschöpfung wirkt, sondern hoher Zeitdruck darüber hinaus den Einsatz emotionaler Regulationsstrategien beeinflusst und somit in zweifacher Hinsicht an der Entstehung emotionaler Erschöpfung beteiligt ist. A 26 Einfluss des COMT Val158Met Polymorphismus auf neuronale Korrelate der Emotionsverarbeitung Kathrin Gschwendtner (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) Yvonne Wanning (Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Würzburg) Andreas Reif (Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Würzburg) Martin J. Herrmann (Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Würzburg) Abstract: Catechol-O-Methyltransferase (COMT) ist ein Enzym, welches am Abbau von Dopamin, Epinephrin und Norepinephrin beteiligt ist. Für dieses Enzym existiert ein Einzelnukleotoidpolymorphismus (Val158Met), bei dem Valin (Val) durch Methionin (Met) ausgetauscht wird. Es wurde festgestellt, dass diese Substitution durch Met zu einem thermolabileren Enzym führt und damit der Dopaminabbau reduziert ist (Lotta et al., 1995). Das Met-Allel wird mit verstärkten Auftreten von z.B. Angststörungen (Enoch, Xu, Ferro, Harris, & Goldman, 2003) und Zwangserkrankungen (Pooley, Fineberg, & Harrison, 2007) in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse sind jedoch inkonsistent. Was sich jedoch in mehreren Studien ergab, ist eine erhöhte Reaktivität auf emotional negative Reize. So zeigten sich bei Met-Allel-Trägern im fMRT eine erhöhte Aktivierung im Präfrontalkortex und in limbischen Strukturen (Smolka et al., 2005), eine höhere Startle-Reaktion (Montag et al., 2008) sowie eine höhere EPN (Early Posterior Negativity; Herrmann et al., 2009) bei der Präsentation von negativen Reizen. Andererseits ergab sich für Met-Allel-Träger ein Vorteil bei kognitiven Aufgaben wie dem N-Back-Task (Goldberg et al., 2003) oder dem Wisconsin-Card-Sorting Test (Egan et al., 2001). In dieser EEG-Studie sollten Versuchspersonen stratifiziert für Val158Met positive, negative und neutrale IAPS-Bilder entweder passiv betrachten oder Bilder einer bestimmten Valenz zählen, um dadurch gezielt die Aufmerksamkeit auf diese Valenzgruppe zu richten (Schupp et al., 2007). In der LPP (Late Positive Potential) zeigte sich beim passiven Betrachten eine Interaktion zwischen Val158Met und der Valenz der Bilder. Bei homozygoten Met-Allel-Trägern ist die LPP bei negativen Bildern höher als bei positiven Bildern. Sobald die Aufmerksamkeit jedoch gezielt auf Valenzkategorien gelenkt wird, interagiert die Valenz der Bilder nicht mehr mit dem Genotyp. Unerwarteterweise hatte der Genotyp keinen Effekt auf die aufmerksamkeitsbezogenen Aspekte der Aufgabe. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die erhöhte Reaktivität der Met-Allel-Träger auf negative Reize als Bottom-Up-Prozess auftritt und z.B. durch eine Aufmerksamkeitslenkung beeinflussbar ist. Das COMT-Gen bleibt somit ein Risikogen für affektive Erkrankungen- doch nur in Verbindung mit dysfunktionalen kognitiven Prozessen. A 27 Emotions/Abstraktionsmuster in der Control-Mastery Theorie: eine Untersuchung mit dem Therapeutischen Zyklusmodell Valentina Gandini (Universität Ulm) Abstract: Diese aktuelle Studie ist eine erste Untersuchung der Control-Mastery Theorie (Weiss&Sampson, 1986) durch das Therapeutische Zyklusmodell (TCM) und die Resonating Mind Theorie (Mergenthaler, 1996; 2008). Die Control Mastery Theorie unterscheidet sich von der Psychodynamischen Interpretation und sieht die Möglichkeit durch den Prozess des Testing, Angst zu reduzieren und nach dem Test die Einsicht des Patienten zu fördern. Die Realisierung dieser Arbeit folgte einer ersten Phase des Trainings und der Analyse eines einzelnen Falles (Diane) nach den Regeln der Control Mastery Theory sowie des Schreibens eines Handbuchs zur Durchführung von Segmentierungen und Ratings der Verbatimprotokolle. Danach folgte eine zweite Phase, wo Dianes Fall (15 Verbatimprotokolle) mit der CM Software analysiert wurde. Zum ersten Mal wurde nach objektiven Kriterien eine Segmentierung und ein Rating eines Falles nach der Control Mastery Theory durchgeführt. Es wurde eine andere Methode der Analyse, das Therapeutische Zyklusmodell, an den 15 Sitzungen angewendet. Dabei erhält man durch das TCM Begriffsanhäufungen in den Bereichen Emotions/Abstraktionsmuster (EAP) sowohl vor, während als auch nach dem Testing. Dadurch erhielten wir eine größeren Einblick in das Konzept von Test und Passing Test. Die Ergebnisse konnten nicht die Hypothesen über die Einsicht der Patientin durch den Testing Prozess bestätigen. Dafür zeigten sich eine signifikant geringere Konzentration von Angst in der Sprache der Patientin nach dem Testing. A 28 Emotionsregulation in der stationären Therapie psychischer Störungen Anna Radkovsky (Philipps-Universität Marburg) David Daniel Ebert (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Niels Bergemann (Schön Klinik Bad Arolsen) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Defizite in der Emotionsregulation gelten als wichtiger ursächlicher und aufrechterhaltender Faktor für depressive Störungen. In der diesbezüglichen Forschung dominieren in diesem Bereich allerdings querschnittliche Befunde, die kausale Schlussfolgerungen bzgl. möglicher Kausalitätsrichtungen nicht zulassen. Vor diesem Hintergrund wurden in der vorzustellenden Studie Emotionsregulation und Depressivität per Fragebogen zu mehreren Zeitpunkten jeweils im wöchentlichen Abstand im Verlauf einer stationären verhaltenstherapeutischen Depressionstherapie bei 84 Patienten erfasst. Unter Einsatz moderner Strukturgleichungsverfahren zur Analyse von Längsschnittdaten (Latent Difference Score Structural Models; McArdle, 2001) wurden dann wechselseitige prospektive Zusammenhänge zwischen Emotionsregulation und Depressivität analysiert. Die Ergebnisse werden auf dem Poster vorgestellt und diskutiert. A 29 Emotionsregulation und die Auswirkungen auf implizite und explizite Ängstlichkeit Christiane Bohn (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Franziska Schreiber (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Kristin Kusche (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Johannes Graser (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Ulrich Stangier (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Verschiedene Strategien der Emotionsregulation beeinflussen die Entstehung, Intensität, Dauer und Ausdruck von Emotionen. Bisher gibt es nur wenige Studien, die den Zusammenhang von bestimmten Emotionsregulationsstilen mit psychischen Erkrankungen untersuchen. Trotz kontroverser Ergebnisse wurde der Einsatz von Emotionsunterdrückung mit negativem Affekt, mangelhafter sozialer Anpassung und eingeschränkten Wohlbefinden in Verbindung gebracht (Gross & John, 2003). Hingegen zeigte sich die Akzeptanz von Emotionen in akzeptanzbasierten verhaltenstherapeutischen Ansätzen erfolgreich (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Ziel der Studie ist es, die Auswirkungen der unterschiedlichen Stile Akzeptanz und Unterdrücken zur Emotionsregulation auf die explizite und erstmals auch auf implizite Ängstlichkeit der Probanden in einer Stresssituation zu überprüfen. Methode: 60 hoch versus niedrig ängstliche Studenten wurde ein Stil zur Emotionsregulation (Unterdrücken vs. Akzeptieren) zugewiesen. Anschließend wurde eine Stimmungsinduktion angewendet (eine Rede halten), um die situative Ängstlichkeit der Probanden zu erhöhen. Verwendete Maße waren dabei sowohl explizit (State Trait Anxiety Inventory, Affective Style Questionnaire) als auch implizit (Affect Misattribution Procedure). Ergebnisse: Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Strategie des Unterdrückens von Emotionen nach einer Stimmungsinduktion bei den Teilnehmern explizit und implizit zu höheren Angstwerten führt. Weitere Ergebnisse hinsichtlich expliziter und impliziter Maße werden vorgestellt. Diskussion: Die Ergebnisse unterstützen bisherige Studien, die zeigen, dass sich der jeweilige Emotionsregulationsstil auf die Ängstlichkeit der Probanden in einer Stresssituation auswirkt. Besonders hervorzuheben ist, dass nicht nur explizite Selbstbeurteilungsinstrumente sondern auch ein implizites Verfahren zur Erfassung der Ängstlichkeit eingesetzt wurden. Weitere Studien sind notwendig, um die vorliegenden Ergebnisse an klinischen Stichproben replizieren und damit das Wissen über die Wirkmechanismen von maladaptiven Emotionsregulationsstilen bei psychischen Störungen erweitern zu können. A 30 „Irre“ gut erziehen! Planung und Dissemination eines Erziehungstrainings für Eltern mit einer psychischen Erkrankung- Erste Ergebnisse Katharina Günther (TU Braunschweig) Olga Propp (Technische Universtität Braunschweig, Institut für Psychologie) Miriam Müller (Technische Universität Braunschweig, Institut für Psychologie) Kurt Hahlweg (Technische Universität Braunschweig, Institut für Psychologie) Abstract: Familiäre Risikofaktoren wie eine ungünstige Eltern-Kind-Beziehung, eine unsichere Mutter-KindBindung, dysfunktionale Disziplinierungen, elterliche Beziehungsprobleme und Psychopathologie erhöhen das Risiko für kindliche emotionale und Verhaltensstörungen. Über Elterntrainings zur Steigerung der Erziehungskompetenzen kann Einfluss auf die kindliche Entwicklung genommen werden. Es gibt evidenzbasierte Programme, die effektive Präventions- und Interventionsstrategien enthalten, um sowohl die kindliche als auch die elterliche Gesundheit zu erhalten bzw. zu fördern. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die alters- und entwicklungsadäquate Informationsvermittlung und Aufklärung über die Erkrankung und Behandlung des erkrankten Elternteils einen spezifischen Schutzfaktor für die gesunde psychische Entwicklung des Kindes darstellt. Die Verbreitung solcher Maßnahmen ist allerdings gering und die Rekrutierung von Eltern schwierig. Es gibt kaum Studien, die Effektivität und Dissemination solcher Interventionen untersuchen. Die folgende Studie soll helfen diese Lücke zu schließen. Es soll untersucht werden welche Auswirkungen das in der Studie untersuchte Präventionsprogramm auf die psychische Gesundheit von Eltern und Kindern hat und welche Hürden bei der Implementierung zu beachten sind. Eine Stichprobe von 17 psychisch kranken Eltern nahm im Rahmen eines Pilotprojekts an einem Erziehungstraining teil. Es handelt sich dabei um das Triple P-Gruppentraining der Ebene 4 erweitert um eine zusätzliche Sitzung mit psychoedukativen Elementen und konkreten Tipps, wie die Kinder über die elterliche psychische Erkrankung informiert werden können. Es wurden Fragebögen zur Erfassung des Erziehungsverhaltens, der erzieherischen Selbstwirksamkeit, psychischen Gesundheit, Lebens- und Partnerschaftszufriedenheit der Eltern und der Teilnehmerzufriedenheit sowie zu Verhaltens- und emotionalen Auffälligkeiten der Kinder eingesetzt. Erste Ergebnisse werden auf dem Kongress präsentiert. Implikationen für die Umsetzung von präventiven Angeboten in Bezug auf die Entwicklung von Kindern psychisch kranker Eltern werden abgeleitet und diskutiert. A 31 Geschwisterbeziehungen von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen: Belastung oder Chance? Joel Nißlein (Freie Universität Berlin) Charlotte Rosenbach (Freie Universität Berlin) Sabine Lange (Charité Universitätsmedizin Berlin Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters) Ulrike Lehmkuhl (Charité Universitätsmedizin Berlin Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters) Abstract: Theorie und Fragestellung: Erste qualitative Studien zu Geschwisterbeziehungen von Kindern mit psychischen Störungen zeigten überwiegend rivalisierende und konfliktreiche Beziehungsmuster. Dabei wurde ausschließlich die Fremdbeurteilung durch Eltern oder Therapeuten untersucht. Eine differenzierte Untersuchung des Ressourcen- und Risikopotenzials von Geschwisterbeziehungen steht bisher noch aus. Ziel der Studie ist es, die selbsteingeschätzte Geschwisterqualität zu untersuchen und die Einschätzung von Kindern mit psychischen Störungen mit der einer gesunden Kontrollgruppe (KG) zu vergleichen. Zudem wurden Unterschiede zwischen den einzelnen Störungsbildern und Effekte von Variablen der Geschwisterkonstellation überprüft. Methode: 38 sich in stationärer Behandlung befindende Kinder und 155 SchülerInnen (KG) nahmen an der Studie teil. Die Stichproben wurden hinsichtlich Alter, Alterskonstellation der Geschwister und Geschlecht parallelisiert. Eingesetzt wurden der Geschwisterbeziehungs-Fragebogen (GBF-KJ) sowie der SDQ zur Erfassung der psychischen Gesundheit. Ergebnisse: Kinder mit psychischen Störungen erleben unabhängig von Störungsbild und Variablen der Geschwisterkonstellation ihre Geschwisterbeziehung nicht als belasteter im Vergleich zu gesunden Kindern. Die klinische Stichprobe bewertete ihre Geschwisterbeziehungen sogar als weniger konfliktreich als die KG. Alter und Geschlecht hatten keinen Einfluss auf die Einschätzung der Geschwisterbeziehung. Diskussion: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Geschwisterbeziehungen der klinischen Stichprobe subjektiv weniger problematisch eingeschätzt werden als bisher durch Aussagen von Eltern und Therapeuten angenommen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass Geschwisterbeziehungen als spezifische Ressource innerhalb einer häufig destabilisierten und belasteten Umgebung wirken können. Geschwisterbindungen gewinnen u.U. besonders in kritischen Lebensphasen (z.B. Klinikaufenthalt) an individueller Bedeutung. Schlussfolgerungen: Geschwisterbeziehungen stellen eine potentielle Ressource dar, die auch therapeutisch genutzt werden kann. Zudem sollte überprüft werden, in wieweit es Unterschiede in der Fremd- und Selbstbeurteilung von Geschwisterbeziehungen gibt und welche Faktoren dafür verantwortlich sind. A 32 Leistungen von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (AD[H]S) im HAWIK-IV Steffen Schmidtendorf (Universität Bielefeld) Norbert Christmann (Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Norbert Christmann) Nina Heinrichs (Universität Bielefeld) Abstract: Hintergrund: In Untersuchungen mit den englischsprachigen Wechsler-Skalen konnten bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsstörung konsistent Schwächen im Gruppen-Intelligenzprofil nachgewiesen werden. Diese betreffen die Bereiche Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit. In einer der wenigen deutschen Studie zu diesem Thema von Hellwig-Brida, Daseking, Petermann und Goldbeck (2010) wurden Defizite in beiden Indices des deutschen HAWIK-IV, jedoch nicht bei der gesamten Gruppe (N=85), sondern nur bei der Teilgruppe des vorwiegend unaufmerksamen Subtyps (n=33) festgestellt. Fragestellung: Die vorliegende Untersuchung soll nun zur Replikation und Erweiterung dieser deutschen Befunde beitragen, indem eine größere Stichprobe von Kindern mit ICD-10 Diagnosen einbezogen wird. Findet sich dann ein spezifisches Intelligenzprofil bei allen Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S, das sich unterscheidet von Kindern mit anderen psychischen Störungen? Methode: Im Zuge einer retrospektiven Aktenanalyse wurden die Leistungen im HAWIKIV von N=433 Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S im Vergleich zur Norm untersucht. Die Unabhängigkeit des Profils von häufig auftretenden Komorbiditäten sowie die Spezifität gegenüber anderen psychischen Störungen wurden geprüft. Dafür wurde eine Teilgruppe der Kinder mit AD(H)S, bei denen keine komorbiden Störungen vorlagen (n=212) mit den Normwerten und einer klinischen Kontrollgruppe (N=52) verglichen. Ergebnisse: Wie erwartet, zeigte sich eine signifikant schlechtere Leistung in den Indizes Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit, sowohl in der Gesamtstichprobe aller AD(H)S-Kinder als auch in der um komorbide Störungen bereinigten Teilstichprobe von AD(H)S-Kindern. Weitere Ergebnisse werden auf dem Poster vorgestellt, unter anderem die Spezifität dieser Befunde im Vergleich zu einer klinischen Kontrollstichprobe. Diskussion: Die ersten Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass AD(H)S auf Gruppenebene mit Defiziten in den Bereichen Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit assoziiert ist. A 33 Neurofeedback bei ADHS – eine randomisierte, kontrollierte Therapiestudie Verena Reh (Philipps-Universität Marburg) Martin Schmidt (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Hanna Christiansen (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Hintergrund: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) ist eine der häufigsten kinder- und jugendpsychiatrischen Störungen. Die Behandlung erfolgt meist mittels Psychostimulanzien, trotz 30% non-responder Raten sowie diversen Nebenwirkungen. Zudem konnten anhaltende positive Effekte von medikamentöser Therapie hinsichtlich schulischer Leistungen, sozialer und interpersoneller Fertigkeiten nicht konsistent nachgewiesen werden. Verhaltenstherapie und insbesondere Neurofeedback sind gut erforschte Behandlungsalternativen. Bislang gibt es keine Versorgungsstudie, die Neurofeedback mit einem bewährten verhaltenstherapeutischen Verfahren im ambulanten Einzelsetting vergleicht. Methode: Nach umfassender Eingangsdiagnostik sollen 92 ADHS Kinder randomisiert zugeteilt werden auf entweder Neurofeedback (NF; n=46) oder eine verhaltenstherapeutische Intervention, basierend auf dem Selbstmanagementtraining (SM; n=46) nach Lauth und Schlottke. Beide Behandlungen umfassen 30 Sitzungen. Zusätzlich erfolgt in beiden Gruppen die Behandlung komorbider Probleme in 6 Sitzungen. Die Eltern werden ebenfalls auf zwei Behandlungsgruppen randomisiert, in denen acht begleitende Gruppentherapiesitzungen stattfinden. In der ersten Elterninterventionsgruppe liegt der Schwerpunkt auf Psychoedukation (PE), in der zweiten Elterngruppe wird neben PE eine Intervention zur Förderung sozialer Unterstützung durchgeführt. Ergebnisse: Primary Endpoints sind die Conners 3rd Skalen für Eltern und Lehrer sowie Veränderungen in neuropsychologischen Parametern. Zusätzlich werden Lebensqualität, Global Assessment of Functioning, Expressed Emotion, Soziale Unterstützung, Selbstkonzept, Veränderungen der Medikation sowie Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Behandlung erfasst. Die Messungen erfolgen vor Beginn der Therapie, Verlaufsmessung nach 24 Sitzungen sowie nach Ende der Therapie. Follow-Up Messungen sind 6 und 12 Monate nach Beendigung der Therapie geplant. Diskussion: Aufgrund der bisherigen Studienlage ist ein Rückgang ADHS Kernsymptomatik in beiden Behandlungsgruppen zu erwarten, wobei wir mit einer höheren langfristigen Wirksamkeit der NF Behandlung rechnen. Zusätzlich erwarten wir eine Verbesserung der Lebensqualität, der sozialen Unterstützung und des Selbstkonzeptes, sowie einen Rückgang komorbider Probleme und möglicher Medikation. A 34 Veränderungen in der initialen Therapiephase bei Jugendlichen mit Bulimia nervosa Katharina Pöppel (Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Eva Vonderlin (Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Annette Stefini (Universitätsklinikum Heidelberg) Hinrich Bents (Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Günter Reich (Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universität Göttingen) Klaus-Thomas Kronmüller (Universitätsklinikum Heidelberg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Bulimische Essstörungen sind bei Jugendlichen weit verbreitet. Studien mit Erwachsenen sprechen der initialen Behandlungsphase eine prädiktive Bedeutung für den Therapieerfolg zu. Solche Befunde können jedoch nicht ungeprüft auf junge Patientinnen übertragen werden. Ziel dieser Untersuchung ist es deshalb, Veränderungen in frühen Therapieabschnitten bei weiblichen Jugendlichen zu betrachten. Neben der essstörungsspezifischen Symptomentwicklung werden auch der Einfluss komorbider Störungen analysiert. Methode: 31 bulimische Patientinnen (16-21 Jahre) aus einer längschnittlichen, randomisiert-kontrollierten Therapiestudie (kognitive Verhaltenstherapie, psychodynamische Therapie in Heidelberg und Göttingen) wurden zu Therapiebeginn und zu T15 untersucht. Diagnose und Komorbidität wurden auf Grundlage des SKID 1 Interviews vergeben. Die essstörungsspezifische Symptomatik wurde über Experten- (EDE) und Selbstbeurteilung (EDE-Q) erhoben. Statistische Auswertungen erfolgten mittels multivariater Varianzanalysen mit Messwiederholung. Ergebnisse: Hinsichtlich Essanfällen, Kompensations- und Diätverhalten, essensbezogene Befürchtungen und Figursorgen konnten signifikante Verbesserungen nachgewiesen werden. Gewichtssorgen nahmen nur geringfügig ab. Bezüglich komorbider Symptomatiken ließen sich keine Effekte auf den Therapieverlauf feststellen. Diskussion: Die Ergebnisse machen deutlich, dass der initialen Therapiephase eine besondere Bedeutung zukommt. Zeigen sich bereits hier deutliche symptomatische Verbesserungen, kann dies potentiell ein Prädiktor für eine günstige Prognose sein. Weitere Datenanalysen nach Abschluss der Therapien werden dies prüfen. Da die Studie weitere Zwischenmessungen mit zusätzlichen Instrumenten zur allgemeinen psychischen Belastung umfasst, werden genauere Verlaufsuntersuchungen folgen. Interessant wird insbesondere eine vergleichende Auswertung der angewandten Therapieverfahren sein, was jedoch erst nach Abschluss aller Behandlungen möglich sein wird. Schlussfolgerungen: Eine ausführliche sudden-gain-Forschung hinsichtlich der spezifische Symptomatik der Bulimia nervosa bringt wichtige Erkenntnisse. Insbesondere bei Adoleszenten sind weitere Therapiestudien erforderlich. Die enorme Bedeutung früher Behandlungsabschnitte ist in der Praxis zu beachten. A 35 Wie spielen psychisch kranke Kinder? Zusammenhänge und differenzielle Effekte von psychischen Auffälligkeiten im Vor- und Grundschulalter und dem Spielverhalten Johanna Maxwill (Universität Bielefeld) Nina Heinrichs (Universität Bielefeld) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Das kindliche Spiel ist eine zentrale Tätigkeit des Kindesalters. Gerade bei jüngeren Kindern, wo ein Selbstbericht noch nicht erhoben werden kann, bietet sich das Spiel als Quelle diagnostischer Informationen an. Allerdings gibt es bislang kaum standardisierte spieldiagnostische Verfahren, die reliable und valide Auskunft geben über die Beeinträchtigungen und Unterschiede im Spiel bei psychisch kranken im Vergleich zu psychisch gesunden Kindern. Methode: In der vorliegenden Studie wurden die Spielfähigkeit und die Spielzeugpräferenzen von 52 Kindern im Alter von drei bis acht Jahren in einer standardisierten Einzel-Spielsituation untersucht. Die Stichprobe setzte sich aus Kindern mit internalisierenden Auffälligkeiten, Kindern mit externalisierenden Auffälligkeiten und psychisch gesunden Kindern zusammen. Mit Hilfe eines Kodiersystems ließen sich verschiedene Indikatoren für die Spielfähigkeit eines Kindes (z.B. Ausmaß an Nichtspielverhalten) ermitteln sowie die kindlichen Spielzeugpräferenzen erfassen. Ergebnisse: Erwartungsgemäß zeigten psychisch auffällige Kinder in allen berücksichtigten Indikatoren eine geringere Spielfähigkeit als psychisch unauffällige Kinder. Unterschiede zwischen internalisierend auffälligen und externalisierend auffälligen Kindern ließen sich nicht in der Spielfähigkeit, aber im Spielprozess (vermehrte Aktivitäts- und Spielzeugwechsel externalisierend auffälliger Kinder) und in den kindlichen Spielzeugpräferenzen finden. Beide Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausmaßes der Beschäftigung mit Fantasiethemen (Kampf, Urwelt und Märchen), die mehr von expansiv auffälligen Kindern präferiert werden. Diskussion: Weitere Ergebnisse werden in der Posterpräsentation dargestellt. Die Bedeutung dieser Befunde für die Klinische Kinderpsychologie wird diskutiert. A 36 Zusammenhang zwischen der Einstellung zu körperlicher Bestrafung in der Erziehung und der psychischen Belastung von Eltern Eva Dirks (Universität Bielefeld) Nina Heinrichs (Universität Bielefeld) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Kindesmisshandlung in der Familie spielt sowohl in der Forschung als auch in der Öffentlichkeit eine große Rolle. Gewalt in der Erziehung bringt auf Seiten der Kinder erhebliche psychosoziale Folgen mit sich. Mehr als die Hälfte der Eltern gibt an, leichte körperliche Strafen in der Erziehung einzusetzen. Im Widerspruch hierzu steht, dass der Großteil der gewaltbelasteten Eltern ihre Kinder gewaltfrei erziehen möchte. Noch unklar ist, ob körperliche Bestrafung von einigen Eltern für ein schnelles und effektives Mittel im Umgang mit Problemverhalten gehalten wird oder ob Gewaltanwendung in der Erziehung eher durch Überforderung, Stress und Hilflosigkeit begründet ist. Fragestellung: Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen der Einstellung der Eltern zu Disziplinierung und Erziehungsrechten sowie zur Anwendung von körperlicher Bestrafung und der berichteten Wahrscheinlichkeit des Einsatzes dieser Erziehungsstrategien. Wir nehmen an, dass dieser Zusammenhang durch die psychische Belastung der Eltern moderiert wird. Methode: 850 Eltern von Kindern zwischen 0 und 10 Jahren beantworteten im Rahmen eines internetbasierten International Parenting Survey (IPS) in Deutschland Fragen zu Erziehung, Elternrechten und der eigenen psychischen Belastung (mit Hilfe des K-10). Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Eltern eine sehr klare Einstellung gegen den Einsatz von körperlicher Bestrafung haben. Je stärker Eltern psychisch belastet sind, desto wahrscheinlicher würden sie jedoch körperliche Bestrafung einsetzen. Auch hängt die Einstellung zu Disziplinierung damit zusammen, ob sie bei Problemverhalten unangemessene Erziehungsstrategien anwenden würden. Schlussfolgerung/Diskussion: Alle Eltern positionieren sich klar gegen die Anwendung von körperlicher Bestrafung in der Erziehung, gleichwohl sie bei breiteren Fragen zu dem Verhältnis von staatlicher und privater Verantwortlichkeit für Erziehung deutlich schwächere Position beziehen. Die Ergebnisse zur psychischen Belastung legen nahe, dass die Mehrheit der Eltern körperliche Gewaltanwendung in der Erziehung nicht aus Überzeugung, sondern u.a. aufgrund eigener psychischer Belastung anwendet. A 37 Autismus-Spektrum-Erkrankungen im Erwachsenenalter: Psychotherapeutische Ansätze Barbara Alm (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Esther Sobanski (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Abstract: Autismus-Spektrum-Erkrankungen mit kognitiver Begabung im Normbereich werden häufig erstmals im Erwachsenenalter diagnostiziert und gehen mit sozialen Interaktions- und Kommunikationsstörungen einher. Auch Probleme mit der Selbstakzeptanz zeigen sich dadurch in nicht unerheblichem Mass. Daraus ergibt sich für diese Patientengruppe ein besonderer Bedarf an therapeutischen Interventionen. Eine Literaturrecherche ergab, dass spezifische Therapiekonzepte für Kinder- und Jugendliche, nicht jedoch für Erwachsene etabliert sind. Vorgestellt werden ausgehend von der spezifischen Asperger-Kernsymptomatik mit Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten (z.B. Blickkontakt halten, Unfähigkeit zum Small-Talk), Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und Auftreten von stereotypen Verhaltensmustern, Ansätzte für sinnvolle spezifische Therapieschritte. Diese können u.a. bestehen im Besprechen sozialer Wahrnehmungen, Erkennen von Gefühlen bei anderen, Fähigkeit zur sozialen Kontaktaunahme, Verstehen von nonverbaler Kommunikation und Ausüben von Small-Talk. Ferner Training von Problemlösefähigkeit (immer wieder Einüben von alternativen Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen, da die Fähigkeit zur Generalisierung fehlt), Alltagsstrukturierung und Förderung der Selbstakzeptanz. Überlegungen zu Unterschieden in der therapeutischen Kommunikation mit Asperger-Spektrum Patienten im Vergleich zu anderen Patientengruppen werden dargestellt. Da Autismus nicht ursächlich behandelbar ist,wird als übergeordnetes psychotherapeutisches Ziel die Entwicklung eines erweiterten Verhaltensrepertoires gesehen, das dem einzelnen Patienten bestmöglich entspricht. A 38 Die Wirkung von Therapeutenmerkmalen auf die therapeutische Allegiance Denise Ginzburg (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Christiane Bohn (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Franziska Schreiber (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Ulrich Stangier (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Leykin und DeRubeis (2009) haben im Kontext von Therapievergleichsstudien gezeigt, dass die Verbundenheit der Studienleiter (PI) zu einer therapeutischen Orientierung (Allegiance) zu Verzerrungen der Therapieergebnisse führen kann. Es ist wahrscheinlich, dass Allegiance-Effekte auch bei Psychotherapeuten auftreten und den therapeutischen Prozess beeinflussen. Die vorliegende Studie geht erstmals der Frage nach, inwieweit die Allegiance der Therapeuten abhängig ist von spezifischen Therapeutenvariablen wie Stand der Ausbildung oder Teilnahme an Forschungstherapien. Dabei werden sowohl explizite als auch implizite Maße verwendet. Um die implizite Allegiance von Therapeuten gegenüber der Verhaltenstherapie zu erfassen wird die affektive Fehlattributions-Prozedur (AMP; Payne et al., 2005) eingesetzt. Methode: 40 Therapeuten in Ausbildung mit verhaltenstherapeutischer Orientierung wurden zu ihrer Einstellung zur Verhaltenstherapie untersucht. Dabei wurde mittels der Affect Misattribution Procedure (AMP; Payne et al. 2005) die Valenz zu verhaltenstherapeutischen, psychoanalytischen, sowie positiven und negativen und Begriffen erfasst. Die Erfassung der expliziten Allegiance zu Verhaltenstherapie wurde mit dem Fragebogen zu Behandlungserwartungen (Heimberg et al., 1997) untersucht. Außerdem wurden Therapeutenmerkmale Stand der Ausbildung, Therapieerfahrung in Jahren, und aktive Mitarbeit an manualisierten Forschungstherapien erfragt. Ergebnisse: Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass Therapeuten mit mehr Therapieerfahrung (in Jahren) eine höhere Allegiance haben als Therapeuten zu Beginn ihrer Ausbildung. Therapeuten, die sich aktiv an Studientherapien beteiligen weisen sowohl implizit als auch explizit eine höhere Allegiance auf, als Therapeuten, die nicht an Studientherapien teilnehmen. Weitere Ergebnisse hinsichtlich expliziter und impliziter Maße werden vorgestellt. Diskussion: Die Erfassung der therapeutischen Allegiance sowie deren Wirkmechanismen wurde bislang in der Psychotherapieforschung nicht untersucht. Um das Wissen über Wirkmechanismen der Allegiance zu erweitern sind Studien nötig, die diesen Prozess mit dem Therapeoutcome von Therapeuten verknüpfen. A 39 Subgruppen in Subgruppen: Zur Vorhersage von Psychotherapieverläufen mit differenziellen und adaptiven NächsteNachbarn-Verfahren. André Bittermann (Universität Trier) Wolfgang Lutz (Universität Trier) Abstract: Fragestellung: Für die Vorhersage des Psychotherapieverlaufs eines neuen Patienten ist die Repräsentativität der zu Grunde liegenden Referenzgruppe ein wichtiger Faktor. Da selbst innerhalb der Gruppe der hinsichtlich Ausgangscharakteristika ähnlichsten Fälle („Nächste Nachbarn“) eine Heterogenität in Veränderungsmustern vorliegen kann, wurde in dieser Studie ein weiterer Schritt in Richtung Patientenspezifität unternommen: Die Identifikation von Subgruppen innerhalb von Subgruppen kann zu differenziellen probabilistischen Vorhersagen beitragen. Methode: Untersucht wurden die Verläufe im Brief Symptom Inventory (BSI) von rund 700 Fällen aus dem Modellprojekt "Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psychotherapie“ der Techniker Krankenkasse. Zunächst wurden für jeden Fall die „Nächsten Nachbarn“ bestimmt. Anschließend wurden die beobachteten Verlaufsmuster innerhalb dieser Subgruppe den Kategorien „keine Veränderung/Verschlechterung“ oder „Verbesserung“ zugeordnet. Schließlich wurden mit Wachstumsmodellen differenzielle probabilistische Vorhersagen getroffen. Ergebnisse: Es konnten Subgruppen innerhalb der Subgruppen identifiziert werden. Das differenzielle „Nächste Nachbarn“-Verfahren konnte mit klassischen „Expected Treatment Response“-Ansätzen verglichen werden. Adaptives Modellieren konnte die Vorhersagegüte noch steigern. Diskussion: Die in dieser Studie präsentierte Methode ermöglicht zwei differenzielle Vorhersagen zum Psychotherapieverlauf eines neuen Patienten, welche probabilistisch auf den ähnlichsten Fällen basieren. Möglichkeiten und Einschränkungen werden diskutiert. Schlussfolgerungen: Patientenorientierte Versorgungsforschung kann eine Qualitätssicherung in der Psychotherapie unterstützen. Der Vergleich des beobachteten mit einem vorhergesagten Verlauf kann dazu beitragen, mögliche Misserfolge rechtzeitig zu erkennen und Grundlage einer adaptiven Indikation im Psychotherapieprozess darstellen. A 40 Unterschiede in Symptombelastung und Persönlichkeitsmerkmalen zwischen ambulanten Psychotherapiepatienten mit und ohne komorbide Störungen Thomas Huckert (Universität Trier) Günter Krampen (Universität Trier) Petra Hank (Universität Trier) Abstract: Randomisierte kontrollierte Studien gelten in der Psychotherapieforschung als „Goldstandart“ zur Überprüfung der Effektivität psychotherapeutischer Verfahren. Zumeist werden sie an homogenen Patientengruppen, die lediglich die Diagnosekriterien für eine einzelne psychische Störung erfüllen, durchgeführt. In der psychotherapeutischen Anwendungspraxis werden allerdings vielmals Patienten behandelt, die die Kriterien für mehr als eine psychische Störung erfüllen (Komorbidität). Aus diesem Grund wurde an einer Stichprobe von 77 ambulanten Psychotherapiepatienten untersucht, ob sich Patienten mit und ohne komorbide Störungen in Symptombelastung und Persönlichkeitsmerkmalen unterscheiden. Symptombelastung und Persönlichkeitsmerkmale wurden zum Zeitpunkt des Ersttermins mit Selbstbeurteilungsfragebögen erfasst, Diagnosen anhand eines strukturierten klinischen Interviews gestellt. Bei 48 Patienten wurde lediglich eine psychische Störung diagnostiziert, 29 Patienten erhielten zwei bis drei Diagnosen. Die Gruppen unterscheiden sich signifikant hinsichtlich Symptombelastung und Persönlichkeitsmerkmalen. Patienten mit komorbiden Störungen weisen eine höher ausgeprägte allgemeine psychische Symptombelastung auf als Patienten mit Einzeldiagnosen. Darüber hinaus schätzen sie retrospektiv die Veränderung ihrer Symptombelastung in der Wartezeit zwischen Anmeldung und Ersttermin als negativer ein. Weiterhin zeigen Patienten mit komorbiden Störungen ein geringer ausgeprägtes Selbstkonzept eigener Fähigkeiten, stärker ausgeprägte fatalistisch externale Kontrollüberzeugungen und mehr Hoffnungslosigkeit. Außerdem sind das soziale Vertrauen und die Hartnäckigkeit der Zielverfolgung bei Patienten mit komorbiden Störungen geringer ausgeprägt. In ihrer normativen GeschlechtsrollenOrientierung sind Patienten mit komorbiden Störungen traditioneller eingestellt als Patienten mit Einzeldiagnosen. Die Ergebnisse verdeutlichen das Problem der eingeschränkten externen Validität kontrollierter Psychotherapiestudien mit homogenen Patientengruppen ohne komorbide Störungen. Ferner sprechen sie für eine differenzierte Berücksichtigung von Komorbidität im Rahmen psychotherapeutischer Wirksamkeitsstudien sowie der psychotherapeutischen Versorgungsforschung. A 41 Zur Bedeutung von Fertigkeiten für die Therapieplanung - Ergebnisse zu Psychopathologie und Setting Mareike Stumpenhorst (Philipps-Universität Marburg ) Tobias Fehlinger (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: In der Therapieplanung enthaltene therapeutische Interventionen umfassen meist sowohl störungsspezifische als auch transdiagnostische Aspekte. Zu Letzteren zählen unter anderem auch Interventionen zur Reduktion spezifischer Fertigkeitsdefizite, wie beispielsweise der Förderung sozialer Kompetenzen. Es finden sich bislang jedoch kaum gemeinsame Betrachtungen mehrerer Fertigkeiten und deren Zusammenhänge zur Psychopathologie sowie zur Art des Settings. Informationen hierzu scheinen jedoch besonders für eine differenzierte Therapieplanung relevant. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher ein systematischer Vergleich mehrerer, simultan erfasster Fertigkeiten bezüglich Psychopathologie (Monodiagnose vs. Multisymptomatik) und Setting (ambulant vs. stationär). Methode: Eingesetzt wurde ein strukturiertes Interview, welches fünf Fertigkeiten (Problemlösen, Soziale Kompetenz, Stressbewältigung, Emotionsregulation, Entspannungsfähigkeit) und zwei Selbstbezogene Facetten (Selbstwirksamkeit, Selbstwert) simultan erfasst. Es wurde einer Stichprobe von N = 302 Patienten unterschiedlicher Psychopathologie in verschiedenen Settings (Ambulant, Stationär) vorgegeben. Ergebnisse: Multivariate Analysen ergaben signifikante Unterschiede in den Fertigkeiten zwischen Patienten mit klinischer Multisymptomatik und solchen mit nur einer Diagnose (λ = .93, F(7,284) = 3.135, p < .01). Es zeigten sich jedoch kaum Unterschiede in den Fertigkeiten zwischen ambulanten und stationären Patienten, wenn für soziodemographische Variablen kontrolliert wurde (λ = .94, F(7,277) = 2.451, p < .05). Einzig in der Fertigkeit Stressbewältigung unterscheiden sich die beiden Gruppen zu Therapiebeginn. Die einzelnen Analysen zeigten zudem, dass es vor allem quantitative (Fertigkeitslevel) und weniger qualitative Unterschiede (unterschiedliche Fertigkeitsprofile) zwischen den Gruppen zu geben scheint. Diskussion: Die Befunde deuten darauf hin, dass bei Patienten mit klinischer Multisymptomatik Fertigkeitsdefizite – unabhängig vom Setting - stärker in den Vordergrund treten. Die gemeinsame Erfassung und gezielte Berücksichtigung von Fertigkeiten bei der Therapieplanung scheint somit sinnvoll. A 42 Zur Erfassung der beruflichen Vertrauenstrias im Kontext der Klinischen Psychologie Anja Kochlik (Universität Trier) Volker Köllner (Bliestal Kliniken, Blieskastel) Günter Krampen (Universität Trier) Abstract: Die Arbeitstätigkeit beeinflusst das Selbstwertgefühl, die Selbstachtung und die Selbstwirksamkeit. Damit sie positive Wirkungen entfalten kann, ist ein gewisses Maß an Vertrauen am Arbeitsplatz unerlässlich. Ansonsten können verschiedene Arbeitsstressoren zur Entwicklung einer psychischen Störung führen. Um verschiedene Vertrauensbereiche am Arbeitsplatz erfassen zu können, wurden in Anlehnung an das Modell der Vertrauenstrias von Krampen drei Skalen entwickelt. Die Skala „Soziales Vertrauen in Kollegen und Vorgesetzte (SVKV)“ erfasst die Faktoren „Vertrauen in die Kollegen“, „Vertrauen in die Vorgesetzten“ und „Allgemeines soziales Vertrauen am Arbeitsplatz“. Die Skala „Vertrauen in die berufliche Zukunft (VBZ)“ wurde konstruiert, um die Hoffnungslosigkeit vs. das Zukunftsvertrauen im beruflichen Kontext zu erfassen. Die Skala „Berufliches Selbstvertrauen (BSV) erhebt auf drei Primärskalen das Selbstkonzept beruflicher Fähigkeiten, die internale sowie die externale Kontrollüberzeugung. Selbstkonzept und internale Kontrollüberzeugung bilden zusammen die Sekundärskala berufliche Selbstwirksamkeit. Durch eine exploratorische Faktorenanalyse konnten die Faktorenstrukturen von SVKV und VBZ bestätigt werden. Die theoretisch angenommene Struktur des BSV ließ sich hinsichtlich der Primär- skalen nicht hinreichend bestätigen. Allerdings lässt sich die angenommene Sekundärskala gut interpretieren. Die Schwierigkeit der Items umfasst bei allen Skalen eine ausreichende Spannweite. Bei den BSV-Skalen liegen die Trennschärfen im niedrigen bis hohen Bereich, die Items für die Einzelskalen haben höhere Trennschärfen als für die Gesamtskala. Die interne Konsistenz der Skalen ist gut bis sehr gut (α = .80 - .90). Für den SVKV liegen alle Trennschärfekoeffizienten im mittleren bis hohen Bereich, die interne Konsistenz der Skalen ist hoch (α = .90 - .93). Auch im VBZ liegen die Trennschärfen im mittleren bis hohen Bereich, die interne Konsistenz ist bei dieser Skala ebenfalls hoch ausgeprägt (α = .93). Alle Skalen eignen sich zur Erfassung der beruflichen Vertrauenstrias, so dass die Ergebnisse im therapeutischen Kontext verwendet werden können. A 43 "Wenn Du wüsstest, wie's mir geht!" Übereinstimmung von Selbstund Fremdeinschätzung der Funktionsfähigkeit und Lebensqualität nach einer Hirnschädigung. Sarah Zwick (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Anna Künemund (Philipps-Universität Marburg) Nico Conrad (Philipps-Universität Marburg) Bettina Döring (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Cornelia Exner (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Kognitive und psychopathologische Veränderungen nach einer Hirnschädigung können zu Einschränkungen der Urteilsfähigkeit führen, sodass Patienten ihre Defizite und Ressourcen nicht mehr richtig einschätzen können, was generell an der Validität von Selbstaussagen hirngeschädigter Patienten zur Funktionsfähigkeit zweifeln lässt. Die funktionale Relevanz kognitiver Einschränkungen wird häufig von objektiven Leistungstestergebnissen abgeleitet, wobei dem Aspekt der subjektiv wahrgenommenen Einschränkungen auf die Lebensqualität wenig Beachtung geschenkt wird. Methode: Bei 43 ambulanten Patienten mit erworbener Hirnschädigung in der postakuten Rehabilitationsphase wurde die kognitive Leistungsfähigkeit mit standardisierten neuropsychologischen Testverfahren zu den Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutiven Funktionen erhoben. Weiterhin wurden die subjektiv wahrgenommenen kognitiven Beeinträchtigungen mithilfe der Aachener Funktionsfähigkeitsitembank (AFIB) sowie einem Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (QOLIBRI) durch den betroffenen Patienten selbst und einen nahen Angehörigen eingeschätzt. Es wurden Regressionsmodelle sowohl für die Selbst- als auch die Fremdeinschätzung der Lebensqualität berechnet. Ergebnisse: Patienten und Angehörige stimmen in ihrer Einschätzung der Lebensqualität bezüglich der kognitiven Leistungsfähigkeit überein. Sowohl für die vom Patienten wahrgenommene Lebensqualität als auch für die durch Angehörige beurteilte Lebensqualität erwiesen sich die Zeitspanne seit der Schädigung und die subjektive kognitive Funktionsfähigkeit (AFIB) als signifikante Prädiktoren mit vergleichbarer Varianzaufklärung. Die objektiv über Testverfahren erhobenen kognitiven Aggregate leisteten in keinem der beiden Modelle einen weiteren signifikanten Beitrag zur Vorhersag der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Diskussion: Die wichtigsten Prädiktoren für die gesundheitsbezogene Lebensqualität aus Sicht von Patienten mit erworbener Hirnschädigung und ihrer Angehörigen sind die Schädigungsdauer sowie die Einschätzung der kognitiven Fähigkeiten im Alltag, unabhängig von objektiven Testergebnissen. Schlussfolgerung: Für die Behandlung stellen die Ergebnisse die Bedeutung einer individualisierten Therapie heraus, die sich an den subjektiv empfundenen kognitiven Einbußen orientieren sollte. A 44 Attributionen von Körpersymptomen bei Hypochondrie Julia Neng (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Florian Weck (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Ulrich Stangier (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Abstract: Hintergrund: Die Fehlinterpretation körperlicher Symptome als ernsthafte Krankheit ist Hauptmerkmal der Hypochondrie. Die Zuschreibung von Ursachen zu Körpersymptomen hat einen bedeutsamen Einfluss auf den Umgang mit ihnen. Symptomattributionen können das körperliche Wohlbefinden, die Entscheidung, einen Arzt zu konsultieren, sowie die Akzeptanz ärztlicher Aussagen und Empfehlungen beeinflussen und spielen somit eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Hypochondrie. Bisherige Untersuchungen fanden bei Personen mit hypochondrischen Ängsten einen auf körperliche Erkrankungen ausgerichteten Attributionsstil. Ungeklärt ist jedoch, ob sich dieser Attributionsstil auch für Patienten mit der Diagnose einer Hypochondrie finden lässt. Methode: 30 Patienten mit Hypochondrischer Störung (DSM-IV) und 30 gesunden Probanden wurden 9 alltägliche Körperempfindungen aus dem Symptom Interpretation Questionnaire (Robbins & Kirmayer, 1991) vorgelegt („Wenn meine Hand zittern würde, würde ich wahrscheinlich denken, das ist weil:“). Sie hatten die Aufgabe, mögliche Ursachen für die Symptome frei zu assoziieren. Anhand der erhobenen Attributionen wurde eine induktive Kategorienbildung vorgenommen, die anschließend theoriegeleitet generalisiert und zusammengefasst wurde. Ergebnisse: Die induktive Kategorienbildung ließ sich im Wesentlichen auf die in vorherigen Studien postulierten Attributionsstile „normalisierend“, „somatisierend“ und „psychologisch“ reduzieren, wobei die Kategorie „somatisierend“ weiter eingeteilt wurde in leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass hypochondrische Patienten signifikant seltener normalisierend attribuieren und Symptomen häufiger mittelschwere und schwere Erkrankungen zuschreiben als gesunde Kontrollprobanden. In der Häufigkeit der Verwendung psychologischer Attributionen und somatischer Attributionen, die sich auf Krankheiten leichten Schweregrades bezogen, fanden sich keine Unterschiede. Diskussion: Durch die vorliegende Studie konnte gezeigt werden, dass mit der Hypochondrischen Störung ein symptombezogener Attributionsstil einhergeht, der körperliche Symptome primär mit mittelschweren und schweren Erkrankungen in Verbindung bringt. Normalisierende Attributionen werden demgegenüber weitgehend außer Acht gelassen. Schlussfolgerung: Die Bedeutung der in der kognitiven Verhaltenstherapie praktizierten Bearbeitung von Symptomattributionen wird durch die gefundenen Ergebnisse bekräftigt. A 45 Aufmerksamkeitsallokation und kognitive Kontrollprozesse bei Präsentation nahrungs-assoziierter Reize: Gemeinsamkeiten zwischen Adipositas und abhängigem Verhalten? Sabine Loeber (Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Martin Grosshans ([email protected]) Christian Vollmert ([email protected]) Sabine Vollstädt-Klein ([email protected]) Falk Kiefer ([email protected]) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Bei Adipositas handelt es sich um eine Erkrankung mit steigender Prävalenz in den westlichen Industriestaaten und oftmals schwerwiegenden körperlichen und psychischen Begleiterkrankungen. In den vergangenen Jahren wird zunehmend diskutiert, ob das Essverhalten adipöser Patienten mit süchtigem Verhalten vergleichbar ist. In der vorliegenden Untersuchung wurden zwei zentrale Mechanismen abhängigen Verhaltens untersucht. Es sollte geklärt werden, ob bei adipösen Patienten eine automatische Fokussierung auf nahrungs-assoziierte Reize vorliegt, und eine Beeinträchtigung inhibitorischer Kontrollprozesse bei Konfrontation mit nahrungsassoiierten Reizen Methode: Untersucht wurden 20 adipöse Patienten und 20 hinsichtlich Alter und Geschlecht gematchte normal-gewichtige Kontrollprobanden. Es wurde eine visuelle Dot-probe Aufgabe mit nahrungs-assoziierten Bildern und ein Go/no-go Paradigma mit nahrungs-assoziierten Wörtern und Objektwörtern appliziert. Ferner wurden mittels dem Fragebogen zum Essverhalten (FEV) subjektive Daten zum Essverhalten erhoben. Ergebnisse: Entgegen unseren Erwartungen zeigten im Go/No-go Paradigma alle Probanden schnellere Reaktionszeiten bei nahrungs-assoziierten im Vergleich zu Objektwörtern als Go-Stimulus. Auch begingen alle Probanden mehr Kommissionsfehler (falsche Reaktionen) wenn nahrungsassoziierte Wörter als No-go-Stimulus dienten. Es zeigten sich keine Hinweise auf eine stärkere Beeinträchtigung adipöser Patienten, auch wenn sich die beiden Gruppen im FEV signifikant voneinander unterschieden und adipöse Patienten einen stärkere Orientierung des Essverhaltens an externen Reizen berichteten. Überraschenderweise zeigte sich bei keiner der Untersuchungsgruppen eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf nahrungs-assoziierte Bilder. Diskussion: Nahrungs-assozierte Reize scheinen sowohl bei normal-gewichtigen als auch adipösen Probanden eine stärkere Annäherungsmotivation auszulösen. Entgegen den Ergebnissen zur Aufmerksamkeitsfokussierung auf substanz-assoziierte Reize bei abhängigen Patienten, scheint dies bei nahrungsassoziierten Reizen von geringerer Bedeutung zu sein. Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse unterstützen nicht die Hypothese, dass es Gemeinsamkeiten von Adipositas und abhängigem Verhalten gibt. A 46 Dysfunktionale Kognitionen bei Tinnituspatienten: Validierung des Tinnitus Cognitions Questionnaire (T-Cog) Isabell Schweda (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Dr. Maria Kleinstäuber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Kristine Tausch (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Dr. Cornelia Weise (Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sweden) Prof. Dr. Gerhard Andersson (Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sweden) Prof. Dr. Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Gemäß am aktuellen Forschungsstand orientierter, neurophysiologischer Erklärungsansätze stellen negative Bewertungsprozesse entscheidende Komponenten in der Entstehung und Aufrechterhaltung eines dekompensierten Tinnitus dar. Sie sind wichtige Ansatzpunkte der psychotherapeutischen Behandlung. Bisher liegt noch kein deutschsprachiges Instrument zur Erfassung tinnitusspezifischer, dysfunktionaler Kognitionen vor. In der vorliegenden Studie soll daher die psychometrische Qualität des Tinnitus Cognitions Questionnaire (T-Cog) überprüft werden. Methode: Im Rahmen zweier randomisiert-kontrollierter Therapiestudien wurden 252 Patienten mit chronischem Tinnitus, der mit einer zumindest milden Tinnitusbelastung einherging, untersucht. Mittels Faktorenund Itemanalysen wurde die Struktur des Fragebogens, basierend auf zum Studienbeginn erhobenen Daten, überprüft. Reliabilitätsberechnungen sowie die Analyse konvergenter und diskriminanter Zusammenhänge mit anderen Messinstrumenten dienten zur Validierung des Instruments. Ergebnisse: Eine unrotierte, explorative Faktorenanalyse ergibt nach Ausschluss von Doppelladungen eine 25 Items umfassende Gesamtskala (Cronbach’s α = .89) mit zweifaktorieller Struktur: „Tinnitusbezogenes katastrophisierendes Denken“ (17 Items, Cronbach’s α = .88) und "Tinnitusbezogene Vermeidungskognitionen“ (8 Items, Cronbach’s α = .76). Die erste Subskala weist erwartungsgemäß hohe Korrelationen mit Maßen der Tinnitusbelastung (r = .58 - .66, p < .001), Depressivität (r = .53, p < .001) Ängstlichkeit (r = .58, p < .001) und Tinnitusakzeptanz (r = -.63, p < .001) auf. Für die zweite Subskala zeigte sich ein vergleichbares Korrelationsmuster. Beide Skalen ergeben Nullkorrelationen zur Angstsensitivität. Betroffene mit moderater bis schwergradiger Tinnitusbelastung zeigen signifikant höhere Ausprägungen in den dysfunktionalen Kognitionen als Betroffene mit milder Belastung (p < .001). Diskussion: Die Ergebnisse belegen eine gute bis zufriedenstellende interne Konsistenz der T-Cog-Gesamtskala sowie beider Subskalen. Konvergente und diskriminante Korrelationen sprechen für die Konstruktvalidität des Fragebogens. Schlussfolgerungen: Mit dem T-Cog liegt ein valides Instrument zur Erfassung dysfunktionaler tinnitusbezogener Kognitionen vor, das zukünftig als Veränderungsmaß in der Tinnitustherapie und -forschung eingesetzt werden kann. A 47 Einfluss komorbider psychischer Störungen auf die Wirksamkeit der psychologischen Behandlung bei chronischem Tinnitus Daniela Ivansic-Blau (Universität Koblenz-Landau) Dorota Reis (Universität Koblenz-Landau) Annette Schröder (Universität Koblenz-Landau) Abstract: Zahlreiche Untersuchungen (z.B. Sullivan et al. 1988, Hiller und Goebel 1992, Zöger et al. 2001) belegen, dass Tinnitus oft mit psychischen Störungen einhergeht. Dabei variiert die Prävalenz der psychischen Störungen bei den untersuchten Tinnitusbetroffenen zwischen 50% und 78%, wobei depressive, Angst- und somatoforme Störungen am häufigsten auftreten. Vor dem Hintergrund dieser bedeutsamen Komorbidität gibt es auffallend wenige Arbeiten, die den Einfluss komorbider psychischer Störungen auf die Wirksamkeit der psychologischen Behandlung bei chronischem Tinnitus untersuchen. In einer Studie von Zachriat (2003) wurde festgestellt, dass die Tinnitusbelastung (gemessen mit TF) nicht durch das Vorhandensein anderer psychischer Störungen beeinflusst wird. Darüber hinaus zeigten sich auch keine Unterschiede in den Prä-Post-Differenzen der Tinnitusbelastung in Abhängigkeit von der Anzahl komorbider Diagnosen. Diese Ergebnisse stehen in Widerspruch zu der Annahme, dass die Therapiewirksamkeit durch komorbide Störungen negativ beeinflusst wird. Für die Evaluation zweier ambulanter psychologischer Tinnitus-Therapien (12-wöchige PTT und 4wöchige KPTT) wurden neben den Maßen für subjektive Tinnitusbelastung (die subjektiv wahrgenommene Lautheit des Tinnitus, die Dauer der Tinnituswahrnehmung, Schlafqualität, Stimmung, Coping und Kontrollüberzeugung) auch die psychischen Störungen bei 90 Tinnitusbetroffenen mit dem Mini-DIPS erhoben. Insgesamt wiesen 41 (45.55%) Probanden mindestens eine komorbide psychiatrische Störung auf. In den meisten Fällen handelte es sich um affektive Störungen (N = 31) und neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (N = 18). Die Patienten mit einem dekompensierten Tinnitus weisen dabei gegenüber den Patienten mit einem kompensierten Tinnitus fast doppelt so oft eine komorbide psychiatrische Störung auf (62.07% vs. 37.7%). Die Ergebnisse der multivariaten Gruppenvergleiche zeigen, dass hinsichtlich aller Ausprägungen der subjektiven Tinnitusbelastung sowohl vor dem Therapiebeginn als auch in den Prä-PostVeränderungen keine Unterschiede zwischen den Patienten mit und ohne komorbide psychiatrische Störung bestehen. Die Ergebnisse bestätigen somit die Untersuchung von Zachriat (2003). Komorbide Störungen erhöhen nicht die tinnitusspezifische Beeinträchtigung und stellen keinen Prädiktor für den Therapieerfolg dar. Auf Implikationen für die therapeutische Praxis wird eingegangen. A 48 Exterozeptionsfähigkeit für somatosensorische Reize am Beispiel taktiler Wahrnehmungsprozesse bei Patienten mit Hypochondrie Maribel Kölpin (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Susann Krautwurst (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Anna Katzer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Michael Witthöft (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Hintergrund: Kognitiv-behaviorale Modelle der Hypochondrie postulieren eine sensiblere Verarbeitung somatosensorischer Reize. Empirische Belege dafür stehen aber noch aus. Auf Basis eines von Lloyd et al. (2008) entwickelten Paradigmas untersucht diese Studie die alternative Hypothese, dass Patienten mit Hypochondrie im Vergleich zu Kontrollpersonen vermehrt zu illusorischen taktilen Wahrnehmungen neigen. Methode: In einer noch laufenden Studie wurden bisher 40 Probanden (19 Personen mit Hypochondrie und 21 Kontrollpersonen) untersucht. Im Anschluss an die Ermittlung einer individuellen Wahrnehmungsschwelle wurden allen Teilnehmern Vibrationsimpulse nahe der Wahrnehmungsschwelle appliziert, die in der Hälfte der Durchgänge zufällig mit einem Lichtreiz gepaart waren. Weiterhin wurden beide Reize (Licht und Vibration) randomisiert nur in jeweils der Hälfte der Durchgänge dargeboten, so dass die Provokation illusorischer Empfindungen in Durchgängen mit Lichtreiz aber ohne auslösenden Vibrationsreiz ermöglicht wird. Ergebnisse: Die Auswertung der bisherigen Daten zeigt im Einklang mit den Befunden von Lloyd et al. (2008) einen signifikanten Haupteffekt des Faktors Lichtreiz, der sich unter den statistischen Maßen der Signalentdeckungstheorie sowohl auf die Antworttendenz c (t(39)=-2.21; p=.033; Cohen’s d=-0.30), als auch auf die Trefferquote (t(39)=-2.40; p=.021; Cohen’s d=-0.28) auswirkt. Demnach zeigen die Teilnehmer unter der Versuchsbedingung mit kombiniertem Lichtreiz ein liberaleres Antwortverhalten. Diese erfolgreiche Induktion illusorischer Wahrnehmungen ist jedoch bei beiden experimentellen Gruppen vergleichbar. Auch die Fähigkeit, leichte taktile Reize zu detektieren, unterscheidet sich nicht zwischen den Gruppen. Diskussion: Sollten sich die aktuellen Befunde im Rahmen der weiteren Datenerhebung bestätigen, könnte dies als Hinweis für eine Abgrenzung der Hypochondrie von anderen symptombezogenen somatoformen Störungen gewertet werden, da bei letzterer Störungsgruppe Auffälligkeiten im Rahmen des verwendeten Paradigmas bereits gezeigt werden konnten. A 49 Gruppentherapie versus Internetbasiertes Selbsthilfetraining bei chronischem Tinnitus: Behandlungspräferenzen und Erfolgserwartungen Kristine Tausch (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Maria Kleinstäuber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Isabell Schweda (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Cornelia Weise (Universität Linköping) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Viktor Kaldo (Karolinska Institutet Stockholm) Vendela Zetterqvist Westin (Universität Linköping) Gerhard Andersson (Universität Linköping) Abstract: Theoretischer Hintergrund Als mögliche Lösung der Unterversorgung an ambulanten Therapiemöglichkeiten bei dekompensiertem Tinnitus wurden internetbasierte Selbsthilfetrainings entwickelt. Erfolgserwartungen und Behandlungspräferenzen spielen eine wichtige Rolle für die Akzeptanz solcher neuen Interventionsansätze. Die vorliegende Studie befasst sich daher mit der Frage, ob sich Erfolgserwartungen seitens der Patienten hinsichtlich konventioneller Gruppentherapie und einem internetbasierten Selbsthilfetraining unterscheiden und welche Behandlung präferiert wird. Methode Die Datenerhebung fand im Rahmen einer randomisiert kontrollierten Therapiestudie statt, an der im Zeitraum von einem Jahr insgesamt N = 127 Personen teilnahmen. Die Behandlungspräferenz, Erfolgserwartungen, demografische Variablen, Tinnituscharakteristika und Tinnitusbelastung wurden vor der Randomisierung bezüglich der Interventionsgruppen erfasst. Zur Auswertung dienten varianzund regressionsanalytische Methoden. Ergebnisse Es zeigte sich eine Präferenz für die Gruppentherapie im Vergleich zum Internettraining (Chi²(1) = 11.31, p < .01, w = 0.36), wobei 33% der Teilnehmer keine Präferenz („egal“) äußerten. Die Präferenz hing weder mit demografischen Variablen (z.B. Alter, Geschlecht), eingeschätzter Praktikabilität, Tinnituscharakteristika, noch der Tinnitusbelastung zum Studienbeginn zusammen (p > .05). Hinsichtlich der Erfolgserwartung wurde die Gruppentherapie als überlegen eingeschätzt (t(252) = 3.05, p < .01, d = 0.38). Ferner schätzen Personen, die eine Präferenz äußerten, die präferierte Behandlung als erfolgsversprechender ein (F(2,247) = 19.58, p < .01, Eta² = .14). Diskussion Es zeigten sich signifikante Unterschiede in der Erfolgserwartung und Präferenz hinsichtlich der beiden Therapiekonzepte, wobei die Einschätzung der Erfolgserwartung in die erwartete Richtung zeigte (pro Gruppentherapie). Vermutlich sorgt die zunehmende Allgegenwärtigkeit des Internet dafür, dass ein Drittel der Teilnehmer keine Präferenz äußern, was eine zukünftige Alltagsintegration internetbasierter Programme vereinfachen könnte. Schlussfolgerungen A priori wird das Internettraining als weniger erfolgsversprechend eingeschätzt als konventionelle Gruppentherapie. Konsequenz sollte eine vermehrte Aufklärung von internetskeptischen Tinnitusbetroffenen sein, um die Erwartungshaltung zu modifizieren und eine Alltagsintegration internetbasierter Programme zu vereinfachen. A 50 Interozeptionsfähigkeit für somatosensorische Reize am Beispiel der Wahrnehmung von unspezifischen phasischen Veränderungen der Hautleitfähigkeit bei Patienten mit Hypochondrie Susann Krautwurst (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Maribel Kölpin (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Prof. Dr. Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Prof. Dr. Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Dr. Michael Witthöft (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Fragestellung: Kognitiv-behaviorale Erklärungsmodelle der Hypochondrie postulieren, dass Patienten mit Krankheitsangst alltägliche körperliche Prozesse sensibler und intensiver wahrnehmen und mit höherer Wahrscheinlichkeit als Zeichen einer ernsthaften Erkrankung fehlinterpretieren. Belege für diesen Mechanismus der somatosensorischen Verstärkung konnten bislang meist nur mit Fragebogenuntersuchungen gefunden werden. Auf experimenteller Ebene ergab sich bislang kein Indikator einer verbesserten Interozeptionsfähigkeit bei Hypochondrie. Ziel der Studie ist daher die Erprobung eines neuen Interozeptionsparadigmas, das kürzlich im Rahmen der Forschung zur Generalisierten Angststörung (GAS) entwickelt wurde (Andor, Gerlach & Rist, 2008). Methode: Anhand eines experimentellen Paradigmas zur Messung von Spontanfluktuationen der Hautleitfähigkeit (SFH) wurde die Interozeptionsfähigkeit bezüglich SFH bei 28 Proban-den (15 Patienten mit Hypochondrie und 13 Kontrollpersonen) untersucht. Innerhalb des SFH-Paradigmas wurden 20 akustische Signale randomisiert präsentiert: 10 ausgelöst durch den Onset von SFH, 10 nach Phasen von 20 Sekunden stabilem Hautleitwert. Die Auswertung der Detektionsleistung erfolgte auf Ebene der Signalentdeckungstheorie mithilfe des Diskriminationsparameters d´ und dem Maß der Antworttendenz C. Ergebnisse: Patienten mit der Diagnose Hypochondrie zeigten erwartungskonform eine bessere Interozeptionsfähigkeit bei der Detektion von SFH (d´ = .84) im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen (d´ = -0.07) (Gruppenvergleich: t(26) = -2,60, p < 0.05, d = 1.02). Hinsichtlich eines Antwortbias lagen keine signifikanten Gruppenunterschiede vor (t(26) = -0.51, p = 0.62, d = 0.19). Diskussion: Die Ergebnisse belegen eine bessere Wahrnehmungsleistung von SFH bei Patienten mit Hypochondrie. Vergleichbare Ergebnisse bezüglich der Detektion von SFH konnten für Patienten mit GAS bereits bestätigt werden. Schlussfolgerungen: Diese vergleichbaren Ergebnisse sprechen für die konzeptuelle Nähe der beiden Störungsbilder. Folgestudien sollten untersuchen, ob die Fähigkeit, SFH zu detektieren, an der Entstehung und Aufrechterhaltung von gesundheitsbezogenen Sorgenprozessen beteiligt ist. A 51 Komorbidität Somatoformer Störungen mit Angst und Depression Stephanie Körber (Unversitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung) Natalie Steinbrecher (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Dirk Frieser (salus Klinik, Friedrichsdorf) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund / Fragstellung: Im Rahmen der Überarbeitung der diagnostischen Kriterien für Somatoforme Störungen (SFS) für DSM-V und ICD-11 ist einer der Haupt-Kritikpunkten an der bisherigen Klassifikation die teilweise starke Überlappung mit depressiven oder Angststörungen, weshalb manche Autoren eine Verlagerung der SFS unter die depressiven oder Angststörungen fordern. Andere betonen den eigenständigen Charakter von SFS und plädieren für ihre Beibehaltung. Die vorliegende Studie analysiert Komorbiditätsraten zwischen somatoformen, depressiven und Angststörungen sowie Unterschiede in der allgemeinen Psychopathologie zwischen Patienten dieser verschiedenen Störungsgruppen. Methode: Eine stratifizierte Stichprobe von 308 Hausarztpatienten (Alter MW=47,2; 71,4% weiblich) wurde mittels IDCL Checklisten zu psychischen Störungen (12-Monats-Prävalenz) befragt. SFS wurden durch Erhebung von Körperbeschwerden sowie deren Beurteilung durch den jeweiligen Hausarzt (somatisch vs. somatoform) erfasst. Allgemeine Psychopathologie wurde mit dem Brief Symptom Inventory erfasst. Ergebnisse: Von allen Patienten mit einer SFS hatten 56,8% nur diese Diagnose, 33,1% eine, 7,5% zwei und 2,7% drei oder mehr komorbide Diagnosen. Unter diesen waren Depressionen (27,6%) und Angststörungen (20,3%) die häufigsten. Patienten mit SFS zeigten eine vergleichbare Psychopathologie wie Patienten mit einer Angststörung und eine signifikant stärker ausgeprägte Psychopathologie als Patienten ohne somatoforme / Angst- / depressive Störung (p≤,01). Depressive Patienten zeigten im BSI signifikant höhere Werte als Patienten mit SFS (p≤,01). Patienten mit sowohl depressiver als auch somatoformer Störung waren nicht mehr belastet als Patienten mit nur einer depressiven Störung. Diskussion: Unsere Studie zeigt Hinweise auf eine gewisse Unabhängigkeit von SFS von anderen psychischen Störungen. Patienten mit komorbider somatoformer und depressiver Störung sind jedoch nicht zwangsläufig stärker psychopathologisch belastet als Patienten mit nur einer depressiven Störung. Dies ist möglicherweise auch durch einen Überlagerungseffekt zu erklären. Es erscheint gerechtfertigt, die Kategorie der SFS auch in den kommenden Klassifikationssystemen beizubehalten. Schlussfolgerung: SFS sollten als unabhängige Störungskategorie neben Angst- und depressiven Störungen beibehalten werden. A 52 Lebensziel Intimität bei Krebspatienten -Welche Rolle spielen Krankheitsstatus und Partnerschaft? Franziska Schuricht (Philipps-Universität Marburg) Martina Bodenbenner (Philipps-Universität Marburg) Nico Conrad (Philipps-Universität Marburg) Ulf Seifart (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Cornelia Exner (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Ein zentraler Ansatzpunkt vieler psychoonkologischer Interventionen besteht heute darin, den Patienten bei der Erarbeitung einer Bedeutung der Krebserkrankung zu unterstützen. So konnten etwa Wunsch und Fähigkeit, Lebensziele erfolgreich anzupassen, mit einer besseren Krankheitsbewältigung und höheren Lebensqualität in Verbindung gebracht werden. Vor dem Hintergrund einer onkologischen Erkrankung scheint der Lebenszielbereich Intimität, definiert als das Streben nach vertrauensvollen Bindungen zu anderen Menschen, eine besondere Rolle zu spielen. Ziel der aktuellen Studie war es, die Bedeutung von Intimität in Abhängigkeit der Faktoren Krankheitsstatus und partnerschaftliches Lebensverhältnis näher zu betrachten. Methode In einer querschnittlichen Fragebogenuntersuchung beurteilten 64 Patienten einer onkologischen Rehabilitationsklinik den Lebenszielbereich Intimität nach den Kriterien „Wichtigkeit“ und „Erfolg“ und machten weiterhin Angaben zu ihrem subjektiven Wohlbefinden und ihrer Lebensqualität. Ergebnisse Vor allem ersterkrankte Patienten schreiben dem Ziel Intimität eine hohe Bedeutung zu. Liegt eine Rezidiv- oder onkologische Mehrfacherkrankung vor, werden sowohl Wichtigkeit als auch Erfolg insbesondere von allein lebenden Patienten deutlich niedriger beurteilt. Patienten, welche in einer festen Partnerschaft leben, zeigen unabhängig vom Erkrankungsstatus geringere Diskrepanzen der Wichtigkeit und des Erfolgs von Intimität. Geringere Diskrepanzen gehen mit einem gesteigerten subjektiven Wohlbefinden einher, welches wiederum mit einer höheren Lebensqualität in Verbindung steht. Die niedrigste Lebensqualität weisen rezidiv- oder mehrfach erkrankte Patienten auf, welche in keiner festen Partnerschaft leben. Diskussion Patienten mit einer Mehrfach- oder Rezidiverkrankung beurteilen das Ziel Intimität als weniger wichtig und sehen sich weniger erfolgreich bei dessen Umsetzung. Vor allem bei allein stehenden Patienten könnte dies dem aktiven Bemühen um intime Bindungen entgegenwirken. Die hierdurch ebenso unterbundenen funktionalen Aspekte enger sozialer Beziehungen könnten einen Erklärungsansatz für die beeinträchtigte Lebensqualität dieser Patientengruppe bieten. Schlussfolgerungen Die psychotherapeutische Unterstützung bei der erfolgreichen Umsetzung des Lebenszielbereichs Intimität scheint insbesondere bei allein stehenden Patienten mit einer Mehrfach- oder Rezidiverkrankung an Bedeutung zu gewinnen. A 53 Risikofaktoren bei funktionellen somatischen Syndromen in einer Schweizer Studierendenstichprobe Susanne Fischer (Philipps-Universität Marburg) PD Dr. Jens Gaab (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Prof. Dr. Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Prof. Dr. Urs M. Nater (Lichtenbergprofessur für Klinische Biopsychologie, Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund Funktionelle somatische Syndrome (FSS), wie z.B. das chronische Erschöpfungssyndrom oder das Reizdarmsyndrom, sind dadurch gekennzeichnet, dass für umschriebene körperliche Symptome keine eindeutige organische Ursache gefunden werden kann. Trotz hoher Prävalenzraten in der Allgemeinbevölkerung gibt es wenige Hinweise auf die Ätiologie und Pathophysiologie von FSS. In unserer Studie untersuchten wir die Frage, inwiefern unterschiedliche Aspekte von Stress sowie weitere Risikofaktoren bei Personen mit FSS eine Rolle spielen. Methoden Die Zielsetzung der vorliegenden Studie bestand in einer Überprüfung verschiedener Komponenten eines Diathese-Stress-Modells zur Beschreibung von FSS in einer Schweizer Studierendenstichprobe. Hierzu wurde eine elektronische Version eines Fragebogens zur Erfassung von 17 FSS (FSSQ; Kappeler & Gaab, 2005) erstellt. Stress wurde dabei multidimensional erhoben, u.a. mittels Erfragung von traumatischen Kindheitserlebnissen und habitueller Stärke der emotionalen Stressreaktion (Stressreaktivität) in unterschiedlichen Kontexten. Gleichzeitig wurden Ausprägungen weiterer Risikofaktoren wie z.B. Persönlichkeitsvariablen mittels standardisierter Fragebogen gemessen. Ergebnisse Insgesamt füllten 3054 Studierende den Online-Fragebogen komplett aus. Für mindestens ein FSS erfüllten 290 Teilnehmer (9.5%) die Kriterien. Diese Gruppe unterschied sich von den gesunden Studierenden bezüglich nahezu aller erhobenen Risiko- und protektiven Faktoren signifikant. Prädiktiv für eine Zuordnung zu der Untersuchungsgruppe mit mindestens einem FSS waren insbesondere stressbezogene Faktoren wie eine erhöhte Stressreaktivität bei sozialen Konflikten (OR=1.54; p<.05) bzw. einer generell reduzierten Erholungsfähigkeit nach belastenden Situationen (OR=1.47; p<.05) und eine körperliche Vernachlässigung durch die primären Bezugspersonen im Kindesalter (OR=1.08; p<.05) sowie hohe Ausprägungen in dispositioneller Offenheit (OR=1.22; p<.001) und weibliches Geschlecht (OR=2.30; p<.001). Diskussion Funktionelle somatische Syndrome scheinen bei Studierenden ein relativ weit verbreitetes Phänomen zu sein. Unterschiedliche Risikofaktoren vermochten die Ausprägung von FSS vorherzusagen. Die Resultate weisen auf eine hohe Relevanz von Stressfaktoren hin. Stressbezogene Interventionen für Betroffene scheinen in diesem Zusammenhang besonders indiziert zu sein. A 54 Schmerzbezogenes Katastrophisieren: Die Rolle früher Stresserfahrungen Ann-Kristin Manhart (Justus-Liebig-Universität Gießen) Christine C. Jung (Justus-Liebig-Universität Gießen) Christina Bogdanski (Justus-Liebig-Universität Gießen) Christiane Hermann (Justus-Liebig-Universität Gießen) Abstract: Theorie: Traumatische Erfahrungen in der Kindheit werden als ein möglicher Vulnerabilitätsfaktor für die Entwicklung chronischer Schmerzen diskutiert. Ein möglicher zugrundeliegender kognitiver Faktor könnte eine erworbene Neigung zum schmerzbezogenen Katastrophisieren sein, da dieses als ein gut dokumentierter Risikofaktor für die Schmerzchronifizierung gilt. Im Unterschied zu Studien, die sich auf die Auswirkungen von körperlichem/sexuellen Missbrauch als traumatische Kindheitserfahrung beschränkt haben, werden in der vorliegenden Studie speziell die Auswirkungen emotionalen Missbrauchs in der Kindheit untersucht. Methode: Mit Hilfe des Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) wurden Personen mit frühen Stresserfahrungen unter den Studierenden der JLU Gießen identifiziert. Insgesamt nahmen 45 Personen mit frühen Stresserfahrungen teil, davon gaben 36 Personen emotionalen Missbrauch an, 3 Teilnehmer berichteten körperlichen/sexuellen Missbrauch und 6 Probanden hatten sowohl körperlichen/sexuellen als auch emotionalen Missbrauch in der Kindheit erlebt. In die Auswertung wurden jedoch nur die Personen einbezogen, die ausschließlich emotionalen Missbrauch erfahren hatten. Außerdem nahmen 46 Studierende, die nach Alter und Geschlecht parallelisiert waren und keine traumatischen Kindheitserfahrungen angaben, an der Befragung teil. Ergebnisse: Verglichen mit Probanden ohne frühe Stresserfahrungen neigten Personen mit emotionalem Missbrauch signifikant stärker zu körperlichen Beschwerden sowie zu schmerzbezogenem Katastrophisieren, insbesondere bezüglich Hilflosigkeit und Magnifikation. Sie gaben jedoch nicht signifikant mehr Schmerzbeschwerden an. Ferner setzen Personen mit emotionaler Traumatisierung generell signifikant häufiger Katastrophisieren als Copingstrategie im Umgang mit Belastungen ein. Sie berichteten schließlich signifikant mehr Stress und depressive Symptome als Personen ohne emotionalen Missbrauch in der Kindheit. Diskussion/Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass Personen mit emotionaler Traumatisierung in der Kindheit ein erhöhtes schmerzbezogenes Katastrophisieren aufweisen, und zwar unabhängig von aktuellen Schmerzerfahrungen. Möglicherweise spiegelt dies eine generelle Neigung wider, auf Belastungen mit Katastrophisieren zu reagieren. Dieses erhöhte schmerzbezogene Katastrophisieren, speziell die in diesem Zusammenhang wahrgenommene Hilflosigkeit, könnte ein Vulnerabilitätsfaktor für eine spätere Chronifizierung von Schmerzen sein. A 55 Subjektives Angsterleben bei Patienten mit Chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung Natalie Altmann (Philipps-Universität Marburg) Kerstin Kühl (Philipps-Universität Marburg) Klaus Kenn (Schön Klinik) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Die Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) stellt eine schwere, chronisch-progrediente Erkrankung dar, die mit Beeinträchtigungen der körperlichen Leistungsfähigkeit, Dyspnoe und Atemnot einhergeht. Depressivität und Angst gehören zu den häufigsten komorbiden psychischen Symptomen und führen zu subjektiver Beeinträchtigung, häufigeren Arztbesuchen und haben Einfluss auf die Lebensqualität. Die Erfassung realistischer krankheitsbezogener Ängste bei COPD-Patienten und subjektiver Angstsymptome bzw. Kognitionen unabhängig von kategorialer Diagnostik wurde bislang vernachlässigt. Diese Studie hat zum Ziel, das subjektive Angsterleben auf Symptomebene bei COPD-Patienten zu untersuchen. Mittels des COPD-Angstfragebogens (CAF) wurden bei 96 COPD-Patienten (GOLD III/IV; M=61.3 Jahre, SD=8.7) krankheitsspezifische Ängste erfasst. Zudem wurden Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung von körperbezogenen Ängsten, Kognitionen, Lebensqualität und Depressivität als auch klinische Interviews zur allgemeinen Psychopathologie durchgeführt. Als objektive Parameter wurde eine Lungenfunktionsdiagnostik (Einsekundekapazität; M=37.3, SD=11.4) und ein 6-Minuten-Gehtest (M=293, SD=144) durchgeführt. Insgesamt zeigte sich eine signifikante negative Korrelation zwischen der Angst vor körperlicher Aktivität, dem Gehtest und der Einsekundenkapazität. Krankheitsspezifische Ängste korrelierten negativ mit der Lebensqualität. Patienten mit Panikattacken in der Vergangenheit berichteten signifikant stärkere Angst vor körperlicher Aktivität und Progredienzangst als Patienten ohne Panikattacken. Patienten mit COPD-Schweregrad IV zeigten signifikant mehr Angstsymptome und angstbezogene Kognitionen als Patienten mit Schweregrad III, unabhängig von den Diagnosen der klinischen Interviews. Die Anzahl der Angstsymptome korrelierte mit der subjektiven Beeinträchtigung. Es wurde deutlich, dass Angst vor körperlicher Aktivität bei COPD-Patienten mit einer schlechteren Leistung in den objektiv erhobenen Maßen zusammenhängt. Es sollte untersucht werden, ob durch die Angst vor körperlicher Aktivität ein Schon- und Vermeidungsverhalten entsteht, was langfristig zur Abnahme des körperlichen Trainingszustandes führt. Zusätzlich scheinen Patienten mit Panikattacken unter größeren Ängsten zu leiden. Insgesamt zeigte sich die Relevanz der krankheitsspezifischen Ängste bei COPD-Patienten und die Untersuchung der Ängste und Kognitionen auf Symptomebene unabhängig von kategorialer psychischer Di A 56 Viel hilft (nicht) viel. Zur Rolle der sozialen Unterstützung bei Fibromyalgie-Patientinnen Dorota Reis (Universität Koblenz-Landau) Annette Schröder (Universität Koblenz-Landau) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Fibromyalgie (FMS) gehört zu den komplexen chronischen Schmerzsyndromen, über deren Ursachen noch immer wenig bekannt ist. In den aktuellen multikausalen Erklärungsmodellen spielen neben neurobiologischen auch psychosoziale Faktoren eine wichtige Rolle. So gilt neben Ängstlichkeit, Depression und katastrophisierendem Denken auch soziale Unterstützung als chronifizierendes Merkmal, das die Symptome der FMS fördert oder perpetuiert (Kröner-Herwig, 2007; Thieme, Turk & Flor, 2004). Methode: Untersucht wurden 162 ambulante Patientinnen, die vorzugsweise aus Selbsthilfegruppen rekrutiert wurden. Ziel der vorliegenden Studie war es zu untersuchen, inwieweit verschiedene Bewältigungsstrategien (erfasst mit CSQ-D) und soziale Unterstützung (erfasst mit MPI) einen Mediator für die subjektiv wahrgenommene psychosoziale Belastung bei FMS (operationalisiert mit FIQ-D und HADS-D) darstellen. Erwartet wurde ein differenzieller Effekt der sozialen Unterstützung: Hohe soziale Unterstützung durch Partner sollte mit hohen Angstwerten und niedriger Depressivität einhergehen. Die Auswertung erfolgte über ein lineares Strukturgleichungsmodell. Ergebnisse: Dysfunktionales Coping, insbesondere Katastrophisieren, trägt zur Erhöhung der Gesamtbelastung bei, während religiöse Bewältigungsstrategien einen entlastenden Effekt haben. Entgegen unserer Erwartung konnte allerdings bei hoher Zuwendung vonseiten des Partners eine Minderung der Depressivität nachgewiesen werden, während die ablenkende Form der sozialen Unterstützung auf Depression und die psychosoziale Beeinträchtigung keinen Einfluss hatte. Diskussion: Die Ergebnisse bestätigen nur zum Teil den bisherigen Forschungsstand. Insbesondere konnte der negative Einfluss der sozialen Unterstützung bei FMS-Patientinnen nicht gefunden werden. Vielmehr reduzierte zuwendende Unterstützung deren Depressivität. Inwieweit die durchweg hohen Angst- und Depressionswerte der Patientinnen die Generalisierbarkeit der Resultate einschränken, soll diskutiert werden. Weitere Forschung sollte zudem klären, inwieweit die Effekte der sozialen Unterstützung über die Zeit hinweg stabil bleiben. A 57 Psychische Beschwerden bei Multipler Sklerose Andreas Dinkel (Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München) Constanze Hausteiner (Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München) Muna Hoshi (Neurologische Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München) Bernhard Hemmer (Neurologische Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar, TU München) Peter Henningsen (Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Multiple Sklerose (MS) ist eine progrediente Erkrankung mit unterschiedlichen Verlaufsformen. MS geht häufig mit Depressivität und Angstsymptomen sowie körpernahen Beschwerden wie Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue) einher. Angaben zu krankheitsspezifischen Beschwerden wie Progredienzangst fehlen bislang. In dieser Studie sollte daher die Prävalenz allgemeiner und spezifischer Beschwerden sowie das Interesse an einer spezifischen psychotherapeutischen Behandlung untersucht werden. Methode: In einer Querschnittstudie wurden 59 Patienten einer universitären MS-Ambulanz befragt. Die Patienten waren im Mittel 37 Jahre alt (SD = 11), 83 % waren weiblich. Zum Einsatz kamen die Screening-Form des Patient Health Questionnaire (PHQ-4) zur Erfassung von Depressivität und Angst, die Fatigue Severity Scale (FSS) sowie die Kurzform des Progredienzangstfragebogens (PA-FKF); ferner wurde nach dem Interesse an einer spezifischen psychotherapeutischen Behandlung von Progredienzangst gefragt. Ergebnisse: Die Prävalenz von Depressivität und Angst betrug 24.1 % bzw. 25.9 %. Eine klinisch relevante Ausprägung von Fatigue bestand bei 67.8 % der Patienten. Die Prävalenz dysfunktionaler Progredienzangst betrug 16.7 %. Progredienzangst korrelierte r = .30 (p < .05) mit Depressivität, r = .55 (p < .001) mit Angst und r = .37 (p < .01) mit Fatigue. 61 % der Patienten gaben an, Interesse an einer psychotherapeutischen Behandlung der Progredienzangst zu haben. Diskussion: Patienten mit MS leiden unter verschiedenen psychischen Beschwerden, von denen Fatigue eine herausgehobene Stellung einnimmt. Die Prävalenz dysfunktionaler Progredienzangst war demgegenüber deutlich niedriger ausgeprägt, wenngleich ein nicht unerheblicher Teil der Patienten hiervon in hohem Maße betroffen ist, was sich in einem hohen Anteil an Patienten mit Interesse an einer psychotherapeutischen Behandlung von Progredienzangst widerspiegelt. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse unterstreichen den Bedarf an spezifischen psychotherapeutischen Behandlungsangeboten für Patienten mit Multipler Sklerose. A 58 Bewältigungsverhalten in virtuellen Notfallsituationen. Brunna Tuschen-Caffier (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Birgit Kleim (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Christian Becker-Asano (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Dali Sun (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Bernhard Nebel (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Corinna Scheel (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Notfallsituationen sind Extremsituationen von existenzieller Bedrohung, die bei den betroffenen Menschen mit Todesangst, Panik, Schock, Desorientierung, Dissoziation und anderen psychischen Extremreaktionen einhergehen können. Im Zusammenhang mit der Intensität der beteiligten Emotionen kann planvolles, rationales und lösungsorientiertes Handeln eingeschränkt sein. Des Weiteren wird es bei der psychischen Verarbeitung der erlebten Traumata auf eine angemessene Bewältigung der erlebten Emotionen ankommen, um Traumafolgeerscheinungen bis hin zu Traumafolgestörungen zu verhindern. Von großer Relevanz ist, welche Verhaltensweisen und Emotionsregulationsstrategien während des belastenden Erlebnisses am vorteilhaftesten sind. Eine besondere Herausforderung ist hierbei die Entwicklung von Untersuchungs-Szenarien zur Simulation von Notfallsituationen, anhand derer der Umgang mit akutem Stress in solchen Situationen untersucht werden kann. . Methode: In dem Forschungsprojekt wurde in Zusammenarbeit zwischen Experten aus der Informatik und Psychologie ein Notfallszenario entwickelt (Tiefgaragenbrand), mit Hilfe dessen typische Aspekte einer solchen Notfallsituation virtuell unter Nutzung eines Head Mounted Displays dargeboten werden. . Als abhängige Variablen werden psychophysiologische (Herzrate, Hautleitfähigkeit, Respiration) und subjektive Parameter (z. B. Emotionsregulationsstrategien, Dissoziation, Angst) sowie Leistungsmaße zur Güte der Problemlösung (z.B. Reaktionszeiten, Adäquatheit der gewählten Mittel zur Problemlösung) erhoben. Ergebnisse: Vorläufige Befunde deuten darauf hin, dass das Untersuchungsparadigma für die Simulation von Notfallsituationen geeignet ist und dass sich Erkenntnisse über die Effizienz spezifischer Coping-Stile gewinnen lassen. Diskussion: Die Befunde werden mit Blick auf die Brauchbarkeit von VR-Technologien als Untersuchungsinstrument für Bewältigungsverhalten in Notfallsituationen diskutiert. Schlussfolgerungen: Als Ausblick werden weitere Anwendungsmöglichkeiten der VR-Technologie (z.B. für Präventions- und Trainingsmassnahmen) diskutiert. A 59 Geschlechtsrollenorientierung, Equity and Partnerschaftsqualität Jana Campbell (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) cand. lic. phil. Melanie Linder (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) cand. lic. phil. Lisa Steppacher (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Prof. Dr. Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Abstract: Theoretischer Hintergrund Das Ziel der Studie besteht darin, die Relevanz der normativen Geschlechtsrollenorientierung und der in der Beziehung erlebten Ausgewogenheit für die Qualität der partnerschaftlichen Beziehung zu erforschen. Methode 27 heterosexuelle Paare bearbeiteten (1) den Fragebogen zur normativen Geschlechtsrollenorientierung (NGRO; Athenstaedt, 2000), (2) den Partnerschaftsfragebogen (Hahlweg, 1996) und (3) die Skalen zur Erfassung von Equity in Partnerschaften (Rohmann & Bierhoff, 2007). Anhand der NGRO-Werte beider Partner wurden die Paare in zwei Gruppen unterteilt: Gruppe 1 (Paare, bei denen der Partner stärker traditionell-orientiert ist als die Partnerin, N=16) und Gruppe 2 (Paare mit einer stärker traditionell-orientierten Partnerin, N=11). Ergebnisse Die NGRO-Werte der Partner korrelieren stark miteinander (r=.64, p<.001). Frauen mit einem stärker traditionellen Partner sind zufriedener mit ihrer Beziehung (t(25)=2.85, p<.01) und erleben mehr Zärtlichkeit (t(25)=3.89, p<.01), als traditionellere Frauen mit einem moderner ausgerichteten Partner. Bei Männern fanden sich keine signifikanten Unterschiede. Obwohl die Männer in beiden Gruppen eine relative Unterlegenheit bzgl. der eigenen Attraktivität angeben (t(26)=5.67, p<.001), schätzen sich modernere Männer als noch weniger attraktiv im Vergleich zu ihren Partnerinnen ein als traditionellere Männer (t(25)=-2.21, p<.05). Die NGRO des Mannes konnte als signifikanter Prädiktor für sein Erleben von emotionaler Ausgewogenheit in der Beziehung definiert werden. Diskussion Die NGRO-Differenz zwischen den Partnern scheint stärker die Beziehungszufriedenheit der Frauen zu beeinflussen als diejenige der Männer. Die Rollenkonformität der Männer im Sinne einer traditionellen GRO könnte möglicherweise den Partnerinnen Stabilität und Sicherheit vermitteln. Darüber hinaus könnte sie für die Männer mit der Wahrnehmung assoziiert sein, weniger emotionale Beiträge zu leisten und weniger attraktiv zu sein, vermutlich weil beide Attribute aus der traditionellen Sicht als Frauendomänen gelten. Schlussfolgerungen Vor dem Hintergrund der Bedeutsamkeit partnerschaftlicher Qualität für die psychische Gesundheit scheinen NGRO-Differenzen stärker die Beziehungszufriedenheit der Frauen zu beeinflussen, aber für die Männer mit Veränderungen im Equity Erleben assoziiert zu sein. A 60 Ist vermindertes Lernen durch Bestrafung ein Risikofaktor für die Entstehung bipolarer Störungen? Erste Hinweise einer Studie zu Hypomaner Persönlichkeit Janine Heissler (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Philipp Kanske (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Sandra Schönfelder (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Julia Linke (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Michèle Wessa (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Bisherige Forschungsergebnisse weisen auf ein verändertes Lernen durch Belohnung und Bestrafung bei Patienten mit einer Bipolaren Störung (BS) hin. Ob dies eine Folge der Erkrankung oder ein Risikofaktor für die Entstehung einer BS darstellt ist bisher nicht klar. Die Untersuchung dieser veränderten Lernprozesse bei gesunden Personen mit einem erhöhten Risiko für BS, ist deshalb unabdingbar. In der vorliegenden Studie wurde dieses Risiko über das Konstrukt der Hypomanen Persönlichkeit (HP) operationalisiert, welche in früheren Studien mit einem erhöhten Risiko für BS assoziiert wurde. Methoden: Achtzehn Personen mit und 19 Personen ohne HP bearbeiteten ein probabilistisches Lernparadigma, welches ermöglicht, zu unterscheiden, ob Personen eher durch Belohnung oder Bestrafung lernen. In der Akquisitionsphase lernten die Probanden durch positives und negatives Feedback, welcher Stimulus eines Stimuluspaares häufiger belohnt oder bestraft wurde. Über alle dargebotenen Stimuluspaare hinweg gab es einen am häufigsten belohnten Stimulus (A) und einen am häufigsten bestraften Stimulus (B). In der anschließenden Abrufphase wurden alle Stimuli neu kombiniert und ohne Feedback dargeboten. Die Wahl des am häufigsten belohnten Symbols A lässt auf Lernen durch Belohnung schließen, die Vermeidung des am häufigsten bestraften Symbols B dagegen auf Lernen durch Bestrafung. Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen eine vergleichbare Lernleistung beider Gruppen in der Akquisitionsphase. In der Abrufphase vermieden beide Gruppen häufiger das am seltensten belohnte Symbol B und schätzten das negative Feedback signifikant unangenehmer ein. Der Gruppenvergleich zeigte jedoch, dass Probanden mit HP schlechter durch Bestrafung lernen als Probanden ohne HP. Diskussion: Obwohl beide Gruppen offensichtlich besser durch Bestrafung als Belohnung lernen, zeigt die vorliegende Studie, dass Personen mit HP schlechter durch Bestrafung lernen als Personen ohne HP, was nicht auf eine allgemeine Beeinträchtigung im Lernen zurückführbar ist. Schlussfolgerung: Schlechteres Lernen durch negatives Feedback, wie es auch bei der BS beobachtet werden kann, könnte ein Risikofaktor für die Entstehung einer BS darstellen. A 61 Klinische Psychologie und Psychotherapie in Internationalen Organisationen Angelika Groterath (Hochschule Darmstadt) Abstract: 1. Fragestellung/Theoretischer Hintergrund: Die Frage, ob sich die Klinische Psychologie und die Psychotherapie in Internationalen Organisationen, insbesondere in Organisationen des UN-Systems und in Internationalen Nongovernmental Organizations (NGOs), im Kontext von Globalisierung und Internationalisierung bewähren, wird drängender. Die Autorin, selbst Klinische Psychologin und Psychotherapeutin, hat 20 Jahre in und mit Internationalen Organisationen gearbeitet, oft als Pionierin, und hat ihre Erfahrungen wie auch die vieler KollegInnen in einer Forschungsarbeit ausgewertet. 2. Methode: Daten, die der Auswertung zugrunde lagen, waren UN-Dokumente, eigene auch ethnographische Notizen und Protokolle aus internationaler Berufstätigkeit, eigens für die Forschungsarbeit erstellte Textbeiträge von KollegInnen, die in Internationalen Organisationen arbeiten, Unterlagen vom 6th Career Development Roundtable der Internationalen Organisationen von 2009 wie auch quantitative Daten des BMZ über Beschäftigung und Förderung junger Deutscher in Internationalen Organisationen. Unter methodischen Gesichtspunkten handelt es sich um eine Pionierstudie, die nur bedingt systematisch sein kann, zu unterschiedlich sind die vorliegenden Daten, zu schwierig einzuschätzen ist ihre Repräsentativität. 3. Ergebnisse: Ein Einblick in die Datenlage ermöglicht gleichwohl eine Einschätzung der Beschäftigungslage bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten von PsychologInnen und PsychotherapeutInnen in Internationalen Organisationen. Die Nachfrage nach psychologischem KnowHow in Internationalen Organisationen steigt seit zwanzig Jahren kontinuierlich an, was seinen Grund allerdings eher in dem geänderten Bedarf dieser Organisationen denn in nachhaltiger internationaler Entwicklung der zur Diskussion stehenden Fächer hat. Die meisten internationalen Jobs sind generic jobs; und diejenigen, die auch für PsychologInnen ausgeschrieben werden, werden noch selten auch durch PsychologInnen besetzt. 4. Diskussion: Die Psychologie ist gehalten, ihre eigene Verwurzelung in europäischer bzw. westlicher Kultur zu refelektieren und sich der Kooperation mit anderen Disziplinen zu öffnen, um auf internationalem Parkett die Rolle spielen zu können, die sinnvoll wäre – und die Welt auch weiterbringen könnte. 5. Ein internationales Upgrading der Curricula und eine Beteiligung der Klinischen Psychologie an interdisziplinären Masterstudiengängen wäre erforderlich. A 62 Ambivalenzmessung bei Bulimia und Anorexia Nervosa: die deutschsprachige Pros and Cons of Eating Disorders Scale (P-CED) Ruth von Brachel (Ruhr-Universität Bochum) Katrin Hötzel (Ruhr-Universität Bochum) Aileen Dörries (Ruhr-Universität Bochum) Katharina Striegler (Ruhr-Universität Bochum) Karsten Braks (Klinik am Korso) Thomas Huber (Klinik am Korso) Silja Vocks (Ruhr-Universität Bochum) Abstract: Hintergrund: Frauen mit Anorexia und Bulimia Nervosa zeigen oft eine ambivalente Haltung gegenüber einer Veränderung ihrer Essstörungssymptomatik. Zur Quantifizierung dieser Ambivalenz wurde die Pros and Cons of Eating Disorders Scale (P-CED, Serpell et al., 2004; Gale et al., 2006) entwickelt, die acht unterschiedliche positive Funktionen (z.B. ein sicheres Gefühl) und sechs negative Aspekte (z.B. Schuldgefühle) der Essstörung erfasst. In der vorliegenden Studie wurden die psychometrischen Eigenschaften der deutschen P-CED an zwei unabhängigen Stichproben untersucht. Methode: Gütekriterien wie die Interne Konsistenz, Test-Retest-Reliabilität, Veränderungssensitivität sowie konvergente und diskriminante Validität wurden in zwei Stichproben mit Frauen mit Anorexia und Bulimia Nervosa untersucht, welche aus 55 Frauen in stationärer Behandlung sowie aus 76 Frauen mit Essstörungssymptomen bestanden, die sich im Internet selbst zur Studie angemeldet hatten. Die Frauen in stationärer Behandlung füllten die P-CED und den Eating Disorder ExaminationQuestionnaire (EDE-Q) zum Aufnahmezeitpunkt aus. Probandinnen der zweiten Stichprobe füllten die P-CED und den EDE-Q zweimal im Abstand von acht Wochen aus. Während dieser Zeit erhielten 48 von ihnen eine kurze Online-Intervention, während die anderen 28 keinerlei Behandlung erhielten. Ergebnisse: In beiden Stichproben fanden sich gute Interne Konsistenzen für alle Subskalen (mittleres Cronbachs alpha =.78). Alle Korrelationen zur Erfassung der Test-Retest-Reliabilität waren signifikant (r =.49 bis r =.87). Signifikante Veränderungen auf fast allen Subskalen nach der Online Intervention indizieren eine gute Veränderungssensitivität. Außerdem fanden sich signifikante Korrelationen zwischen der P-CED und dem EDE-Q sowie dem Body Mass Index. Die Ergebnisse zeigen außerdem signifikante Unterschiede zwischen Frauen mit Anorexie und Bulimie auf einigen Subskalen, wobei Frauen mit Anorexie höhere Werte für subjektive Vor- und niedrigere Werte für Nachteile ihrer Störung erreichen als Frauen mit Bulimie. Schlussfolgerung:. Die deutsche Fassung der P-CED ist ein reliables und valides Instrument zur Erfassung der Ambivalenz hinsichtlich der Essstörung und eignet sich somit sowohl für die Forschung als auch für die Praxis. A 63 Konstruktion eines Fragebogens zur Erfassung orthorektischen Ernährungsverhaltens Friederike Barthels (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Eva van Ledden (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Christoph Usbeck (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Reinhard Pietrowsky (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Abstract: Theoretischer Hintergrund: 1997 prägte Steven Bratman den Begriff der „Orthorexia nervosa“ als eine extreme Form gesundheitsbewussten Ernährungsverhaltens. Nach Bratman ist orthorektisches Verhalten durch eine pathologische Fixierung auf biologisch reine, von chemischen Zusatzstoffen freie Nahrung, eine ständige gedankliche Beschäftigung mit gesunder Ernährung und Rigidität bezüglich selbst aufgestellter Ernährungsregeln gekennzeichnet. Klinisch relevante Folgen können neben subjektivem Leid auch Mangelernährung und soziale Isolation sein. Es ist bis jetzt unklar, ob das von Bratman beschriebene Ernährungsverhalten eine Erweiterung der bisher bekannten Essstörungen darstellen könnte, dem Zwangsspektrum zuzuordnen ist oder lediglich eine besonders gesundheitsbewusste Ernährungsweise kennzeichnet. Zur Erfassung orthorektischen Verhaltens existieren bisher nur der von Bratmann erstellte „Orthorexia Self-Test“ und die darauf basierende Erweiterung „Ortho-15“ (Donini et al., 2005) als Screening-Instrumente. Ziel der vorliegenden Studie war die Konstruktion eines standardisierten Fragebogens zur (mehrdimensionalen) Erfassung eines Ernährungsverhaltens, welches als orthorektisches Verhalten beschrieben werden kann. Methode: Ein ursprünglich 190 Aussagen umfassender Itempool wurde in einer Online-Befragung einer Stichprobe von 303 Probanden vorgelegt. Die Itemselektion erfolgte anhand der Analyse von Itemschwierigkeiten und Trennschärfe sowie der Ladung auf den extrahierten Faktoren. Durchgeführt wurden Hauptkomponentenanalysen mit Varimax-Rotation. Ergebnisse: Der vorgestellte Fragebogen umfasst 21 Items, welche die Ernährungsweise auf den Dimensionen „orthorektisches Verhalten“, „Zufuhr von Mineralstoffen“ und „Vermeidung von Zusatzstoffen“ erfasst. Diese drei Komponenten erklären 60 % der Varianz. Chronbachs Alpha liegt bei .914, die Inter-Item-Korrelationen variieren zwischen .083 und .704 und die Trennschärfe der Skala liegt zwischen .466 und .676. Diskussion: Die Ergebnisse legen ein dreidimensionales Konstrukt orthorektischen Verhaltens nahe. Der entwickelte Fragebogen zur Erfassung eines Ernährungsverhaltens in Richtung der von Bratman beschriebenen Orthorexie besitzt gute testpsychologische Eigenschaften. Weitere Studien sollten die Validierung an anderweitig erhobenem orthorektischen Verhalten und die Bestimmung eines Cut-OffWertes beeinhalten. A 64 Psychopathologisches Assessment von Ess- und Gewichtsstörungen im Kindes- und Jugendalter: Das Eating Disorder Examination für Kinder Claudia Ruf (Klinische Psychologie, Universität Fribourg) Arne Bürger (Psychiatrie Mainz) Petra Warschburger (Institut Beratungspsychologie Potsdam) Julia Czaja (Philipps-Universität Marburg) Kristina Spenner (Philipps-Universität Marburg) Anne Brauhardt (Klinische Psychologie, Universität Fribourg) Anja Hilbert (Klinische Psychologie, Universität Fribourg) Abstract: Bei Erwachsenen gilt das halb-strukturierte Essstörungsinterview Eating Disorder Examination als aktueller „Gold Standard“ in der Essstörungsdiagnostik. Die vorliegende Studie evaluiert die deutschsprachige Übersetzung der Kinderversion (ChEDE) dieses Interviews. Insgesamt N = 352 Kinder und Jugendliche mit Anorexia Nervosa, „Binge-Eating“-Störung, „Loss of Control-Eating“, Übergewicht und Adipositas, sowie nicht-klinische und chronisch kranke Kontrollprobanden wurden mit dem ChEDE sowie mit weiteren Selbstbeurteilungsfragebögen zu Essund Gewichtsstörungen untersucht. Exzellente Interrater-Reliabilitäten und adäquate interne Konsistenzen der ChEDE-Indikatoren sowie moderate Stabilitäten konnten über einen Zeitraum von 7.5 Monaten nachgewiesen werden. Die ChEDE-Indikatoren korrelierten signifikant mit konzeptuell verwandten Fragebögen und diskriminierten zwischen verschiedenen Typen von Ess- und Gewichtsstörungen und den Kontrollgruppen. Die Faktorenstruktur umfasste die Faktoren Gewichts/Figur Sorgen, Esssorgen und Zügelung und reproduzierte somit teilweise die Struktur der englischen Originalversion. Die Itemstatistiken waren mehrheitlich akzeptabel. Die Erfassung der spezifischen Essstörungspsychopathologie mit der deutschen Übersetzung des ChEDE erwies sich insgesamt als reliabel und valide. Die Änderungssensitivität des Instruments sollte in einer Therapiestudie überprüft werden. A 65 Emotional Salient Stimuli Interfere With Cognitive Task Processing in Criminal Offenders with Borderline Personality Disorder Lars Schulze (FU Berlin) Kristin Prehn (FU Berlin) Christoph Berger (Universität Rostock) Gregor Domes (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Sabine Herpertz (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) Abstract: Objective: In the present study, we aimed to investigate the influence of concurrently presented emotional stimuli on cognitive task processing in violent criminal offenders primarily characterized by affective instability. Methods: Fifteen criminal offenders with borderline personality disorder (BPD) and 17 healthy controls underwent functional magnetic resonance imaging (fMRI) while performing a working memory task with low and high working memory load. In the background of the task, we presented emotionally neutral, low or high salient social scenes. Results: Both groups did not differ in general task performance and neural representation of working memory processes, if no emotional salient stimuli were presented.However, in BPD subjects compared to healthy controls the presence of emotionally high salient pictures in the background of the task led to delayed responses and enhanced activation of the left amygdala independent of working memory load. Conclusions: These results support the assumption that enhanced reactivity to emotionally salient stimuli interferes with executive control in affective instable individuals and might be an important factor in the understanding of aggressive and violent behaviour in criminal offenders with BPD. A 66 Kognitive und Bildgebende Untersuchungen schizotyper Persönlichkeit Ulrich Ettinger (LMU München) Abstract: Schizotypie ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das durch subklinische Ausprägungen von SchizophrenieSymptomen gekennzeichnet ist und mit psychometrischen Fragebögen erfasst werden kann. In diesem Vortrag stelle ich neue Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe zu Untersuchungen der kognitiven und bildgebenden Korrelate dieses Persönlichkeitsmerkmals vor. Experimentalpsychologische Untersuchungen zeigen, dass erhöhte Schizotypie-Werte mit schlechterer Leistung in Paradigmen der Exekutivfunktionen einhergehen. So findet sich in einer Untersuchung an gesunden Probanden ein Zusammenhang mit verminderter kognitiver Adaptivität nach Versuchsdurchgängen mit hoher Anforderung an kognitive Kontrolle in einer modifizierten Stroop-Aufgabe. Des Weiteren zeigen Probanden mit erhöhten Schizotypie-Werten in zwei Studien schlechtere Inhibitionsleistung in einem Antisakkaden-Paradigma. Die neuronale Signatur dieses okulomotorischen Defizits weist auf reduzierte Aktivierung im Striatum, Cerebellum, Thalamus, und visuellem Kortex hin. Diese Areale weisen auch bei Schizophrenie funktionelle und strukturelle Veränderungen auf. Strukturelle magnetresonanztomographische Daten stärken die Annahme neurokognitiver Ähnlichkeit von Schizotypie und Schizophrenie: höhere Schizotypie-Werte sind bei gesunden Probanden mit Volumensminderungen in Frontal- und Temporalkortex assoziiert, ähnlich den neuroanatomischen Befunden bei Schizophrenie. Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass die Schizotypie ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das den klinischen Symptomen der Schizophrenie phänomenologisch ähnelt und auch auf kognitiver und neuronaler Ebene signifikante Überlappung aufweist. A 67 Standardisierte Erfassung von Persönlichkeitsstörungen in der qualifizierten Entzugsbehandlung alkoholabhängiger Patienten mit der Standardised Assessment of Personality Abbreviated Scale (SAPAS) Angela Buchholz (Universitätsklinikum Freiburg, Lehrbereich Allgemeinmedizin) Deborah Kaiser (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Jeanette Röhrig (Universitätsklinikum Freiburg, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie) Berner, Michael (Universitätsklinikum Freiburg, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie) Abstract: Hintergrund: In klinischen Studien zu komorbiden Persönlichkeitsstörungen bei alkoholabhängigen Patienten werden Prävalenzen zwischen 24% und 59% berichtet. Zudem kann sich das zusätzliche Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung sich negativ auf den Behandlungserfolg alkoholabhängiger Patienten auswirken. Dennoch wird im Rahmen der Behandlung der Alkoholabhängigkeit häufig keine standardisierte Achse–II Diagnostik durchgeführt- vor allem aus Zeitmangel. Fragestellung: In dieser Arbeit soll daher geprüft werden, ob die Standardised Assessment of Personality Abbreviated Scale (SAPAS), ein Kurzfragebogen, als Case-Finding Instrument im qualifizierten Entzug Alkoholabhängiger ausreichend valide Hinweise auf das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung liefern kann. Methode: Für die Studie wurden alkoholabhängige Patienten, die sich nach Abschluss der körperlichen Entgiftung in qualifizierter Entzugsbehandlung befanden, mit der SAPAS befragt. Zusätzlich bearbeiteten die Patienten den Screeningfragebogen des SKID-II. Bei Überschreiten der Cut-off Werte wurde im Abstand von max. einer Woche ein SKID-II Interview durchgeführt. Ergebnisse: Daten von insgesamt 50 Patienten wurden in die Auswertung einbezogen (Alter M = 49,8; SD = 9,2), davon waren 35 (70%) männlichen Geschlechts. Fünf Patienten erfüllten die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung. Es ergaben sich Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Maßen zur Feststellung von Persönlichkeitsstörungen bzw. –akzentuierungen. Diskussion: Trotz der kleinen Stichprobe liefert die Studie erste Hinweise auf Integrationsmöglichkeiten der Erfassung von Persönlichkeitsstörungen bzw. –akzentuierungen im stationären qualifizierten Entzug bei Alkoholabhängigen. Postersession 2 Do 02.06.11 von 16:30-18:00 Uhr B 01 Apathie und Motivationsregulation kognitiv beeinträchtigter älterer Menschen und das Belastungserleben ihrer Angehörigen Simon Forstmeier (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Moyra Mortby (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Livia Pfeifer (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Andreas Maercker (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Abstract: Nicht-kognitive Symptome sind bereits bei leichten kognitiven Beeinträchtigungen (mild cognitive impairment, MCI) und leichter Alzheimer-Demenz (AD) vorhanden. Zu den häufigsten gehört Apathie, die mit einem schnelleren kognitiven Abbau und einer reduzierten Lebensqualität des Patienten, einer grösseren Belastung des Angehörigen sowie höheren Kosten der Pflege assoziiert ist. In dieser Studie wird untersucht (1) welche Variablen Apathie vorhersagen und (2) welche Rolle Apathie in der Erklärung des Belastungserlebens des Angehörigen spielt. Da Apathie eine motivationale Dysfunktion darstellt, wird vermutet, dass Motivationsregulation Apathie vorhersagt und den vermuteten Zusammenhang zwischen Apathie und Belastungserleben mediiert. In einer Stichprobe von 60 Personen mit MCI oder leichter AD wurden die Apathy Evaluation Scale, Geriatrische Depressionsskala, Bayer Activities of Daily Living (ADL), Mini-Mental-Status-Test (MMST), Skala Motivationsregulation des Selbststeuerungsinventars sowie der Fragebogen zur Sozialen Unterstützung eingesetzt. Das Belastungserleben des Angehörigen wurde mit dem Zarit Burden Inventar erhoben. Mehr Apathiesymptome gingen einher mit niedrigerer Motivationsregulation, höherer Depressivität, mehr ADL-Einschränkungen und weniger sozialer Unterstützung. In einer Regressionsanalyse blieben Motivationsregulation und soziale Unterstützung unabhängige Prädiktoren von Apathie. In einer weiteren Regressionsanalyse wurde das Belastungserleben des Angehörigen durch Apathie sowie den kognitiven Status des Patienten vorhergesagt, nicht aber durch Depressivität und ADL. Schliesslich weist eine Mediatoranalyse daraufhin, dass Motivationsregulation des Patienten den Zusammenhang zwischen Apathie und Belastungserleben mediiert. Motivationsregulation ist ein wichtiger Prädiktor von Apathie bei Personen mit kognitiver Beeinträchtigung und mediiert den Einfluss von Apathie auf das Belastungserleben des Angehörigen. Eine Begrenzung der Studie ist der querschnittliche Charakter. Die Stichprobe wird über mehrere Jahre hinweg begleitet, so dass bald längsschnittliche Ergebnisse zu der Fragestellung vorliegen. Eine Förderung motivationaler Fähigkeiten sollte angestrebt werden, um sowohl die ApathieSymptomatik des Patienten als auch die Belastung des Angehörigen zu reduzieren. Möglicherweise ist der Aufbau von Motivationsregulation ein Wirkmechanismus von Aktivitätenaufbau und Wochenstrukturierung in der Verhaltenstherapie bei Frühdemenz. B 02 Belohnungsaufschub bei Personen mit Mild Cognitive Impairment, leichter Alzheimer-Demenz und kognitiv nicht-beeinträchtigten Kontrollpersonen Reinhard Drobetz (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Andreas Maercker (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Simon Forstmeier (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Abstract: 1. Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Belohnungsaufschub (BA) wird definiert als Präferenz für spätere, bessere statt unmittelbar verfügbare, geringere Belohnungen (z.B. Geldsparen statt Spontankäufe). Besagtes Konstrukt wird unter die Exekutivfunktionen subsumiert, die mit dementiellen Erkrankungen abbauen. Studienbefunden zufolge ist BA ein signifikanter Prädiktor u.a. für kognitive und Gesundheitsvariablen. Dennoch liegen wenige bis gar keine Befunde für BA im höheren Alter und bei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen vor. Die Studie untersuchte Zusammenhänge und Einflussfaktoren von BA. 2. Methode Die Stichprobe besteht 60 aus Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen - Mild Cognitive Impairment (MCI) und leichte Alzheimer-Demenz (AD) - und 120 kognitiv nicht-beeinträchtigten Kontrollpersonen (alle ≥ 60 Jahre). Zahlreiche kognitive Tests und Fragebögen kamen zum Einsatz. BA wurde mit dem neuen experimentellen Belohnungsaufschub-Test für Erwachsene (BAT-E) von Forstmeier, Drobetz und Maercker gemessen, bei dem Esswaren, Geld und Zeitschriften angeboten werden. 3. Ergebnisse Die kognitiv nicht-beeinträchtigten Personen konnten im Vergleich zu den Personen mit MCI und leichter AD Esswaren signifikant besser aufschieben. Ein umgekehrtes Bild zeigte sich bei Geld, das kognitiv beeinträchtigte Personen signifikant weniger aufschoben. Außerdem korreliert niedriger BA signifikant mit Apathie. BA ist zudem signifikanter Prädiktor der psychischen, aber nicht der körperlichen Gesundheit von betreuenden Angehörigen. 4. Diskussion Die BA-Unterschiede zwischen klinischer und nicht-klinischer Gruppe unterstreichen bisherige Befunde, wonach Essen als Primärverstärker besonders sensitiv gegenüber Selbstkontrolldefiziten ist. Der Zusammenhang zwischen BA und psychischer Gesundheit der Angehörigen könnte dadurch erklärt werden, dass hohe Selbstkontrolle positive Auswirkungen auf Beziehungen hat und mit weniger psychopathologischen Symptomen einhergeht. 5. Schlussfolgerungen Die Fähigkeit, Primärverstärker aufzuschieben, scheint wie andere Exekutivfunktionen im Zuge dementieller Erkrankungen abzunehmen. Abstraktere Sekundärverstärker dürften für Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen hingegen weniger Relevanz besitzen. Die Untersuchung von BA ist gerade aus klinisch-psychologischer Sicht von Wichtigkeit, da BA ein protektiver Faktor ist. Zukünftige Studien könnten Interventionen, die der BA-Erhöhung dienen, entwickeln und evaluieren. B 03 Bewertung eines psychotherapeutischen Gruppenprogramms für Angehörige von Demenzerkrankten aus Expertensicht Tanja Kalytta (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Gabriele Wilz (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Abstract: Theoretischer Hintergrund: In diesem Beitrag wird die Bewertung einer auf kognitiv-behavioralen Therapieprinzipien basierenden manualisierten Gruppenintervention für Angehörige von Demenzerkrankten (Wilz et al., 2001) aus Expertensicht dargestellt. Dies ist von besonderer Relevanz, da nach aktuellem Kenntnisstand keine Befunde zur Bewertung von Angehörigengruppen für Demenzerkrankte durch Therapeuten vorliegen. Methode: Im Rahmen einer prospektiven, kontrollierten Interventionsstudie wurde untersucht, ob die 10monatige Intervention eine positive Wirkung auf den Umgang mit dem Erkrankten hat. Die Bewertung der Intervention erfolgte aus Angehörigen- und Expertenperspektive (Gruppenleitung). Die Stichprobe umfasst acht Therapeutinnen mit insgesamt elf Angehörigengruppen. Sowohl einzelne Interventionselemente (Psychoedukation, Problemlösen und Kognitive Umstrukturierung) als auch organisatorische Aspekte der Intervention wurden mittels leitfadengestützter Interviews und quantitativer Evaluationsbögen (STEP, Krampen, 2002) aus Therapeutensicht analysiert. Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) ausgewertet. Die Ergebnisse des Evaluationsbogens zur Zufriedenheit mit dem Gruppenprogramm aus Experten- (N=8) und Angehörigensicht (N=78) wurden gegenübergestellt. Ergebnisse: Die Experten sehen drei Haupteffekte der Intervention bei den Angehörigen: Zum einen die Förderung der Akzeptanz der Erkrankung, zum anderen die Klärung eigener Bedürfnisse und schließlich einen veränderten Umgang mit dem Erkrankten. Die erlebte Zufriedenheit mit der Intervention ist kongruent mit den Beurteilungen der Angehörigen, wenngleich die Experten die Intervention etwas positiver bewerten. Die Notwendigkeit einer Betreuungsgruppe für die Erkrankten wurde von den Experten gewürdigt, wenngleich die Angehörigen diese nur in geringem Umfang nutzten. Diskussion und Schlussfolgerungen: Die Evaluation der Expertenbefragung zeigt ebenso wie die Befragung der Angehörigen, dass die Intervention positiv auf die Akzeptanz der Erkrankung, die Achtung eigener Bedürfnisse und den Umgang mit dem Erkrankten wirkt. Damit werden das therapeutische Setting ebenso wie die Therapieinhalte und -methoden in doppelter Hinsicht bestätigt. In weiteren Studien sollten Implementierungsmöglichkeiten in der Versorgungslandschaft erprobt werden, einschließlich Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung der Betreuungsgruppe für die Erkrankten. B 04 Die Relevanz psychotherapeutischer Adhärenz und Kompetenz für den Therapieerfolg einer kognitiven-behavioralen Telefontherapie bei Angehörigen Demenzerkrankter. Denise Schinköthe (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Gabriele Wilz (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen gelten als wirksam bei der Behandlung von psychischen und physischen Belastungen bei betreuenden Angehörigen von Demenzerkrankten. Um zu verstehen, wie die Behandlung wirkt und von welchen Techniken die Angehörigen besonders profitieren, wurden Unterschiede im therapeutischen Vorgehen untersucht. Methode: 50 zufällig ausgewählte aufgezeichnete telefonische Therapiesitzungen wurden durch zwei trainierte und unabhängige Beurteilerpaare hinsichtlich der therapeutischen Kompetenz und Adhärenz beurteilt. Zur Erfassung der therapeutischen Kompetenz wurde eine erweiterte Form der deutschen Version der Cognitive Therapy Scale (Weck, Hautzinger, Heidenreich & Stangier, 2010) und zur Bestimmung der Adhärenz eine eigens konzipierte Skala verwendet. Weiterhin lagen auch die Selbsteinschätzungen der Therapeuten vor. Die primären Erfolgskriterien der Studie stellten eine Verbesserung des subjektiven psychischen (ADS) und physischen (GBB-24) Befindens, sowie der Lebensqualität (WHOQOL-Bref) dar. Ergebnisse: Die Beurteilerübereinstimmungen für Adhärenz und Kompetenz waren gut bis sehr gut. Erste Ergebnisse zeigen, dass adhärent und kompetent durchgeführte Therapien vor allem mit einer Verbesserung der subjektiven körperlichen Beschwerden (GBB, Adhärenz= r=.53; Kompetenz r=.55) bei den Angehörigen zusammenhängen, wobei hier vor allem das manualtreue und kompetente Aufgeben von Hausaufgaben und die Umsetzung psychoedukativer Elemente mit dem Therapieerfolg in Verbindung zu stehen scheinen. Eine kompetente Durchführung der Therapie weist ebenfalls auf eine Verbesserung der Lebensqualität (WHOQOL-Bref; r=.44) hin. Besonders der kompetente Einsatz spezifischer Einzeltechniken wie Kognitives Umstrukturieren (r=.42), Aktivitätsaufbau (r=.61), Trauerarbeit (r=.59) und der Einsatz von Hausaufgaben (r=.67) stehen in engem Zusammenhang mit dem Therapieerfolg. Für das Erfolgsmaß depressive Symptome (ADS) wurden nur mit den Selbsteinschätzungen der Therapeuten Zusammenhänge gefunden (Adhärenz: r=.55; Kompetenz in der Technik Kognitives Umstrukturieren: r=.75). Weiterhin ergab sich ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der Angehörigen mit der Intervention und der Höhe der Manualtreue (r=.35). Diskussion: Klinische Implikationen der Erfassung therapeutischer Adhärenz und Kompetenz für Psychotherapiestudien und die tägliche Praxis werden diskutiert. B 05 Wirksamkeit neuropsychologisch fundierter Verhaltenstherapie bei leichtgradiger Alzheimerkrankheit: Moderatoranalysen zur Reduktion depressiver Symptome durch das KORDIAL-Programm Katja Werheid (Humboldt-Universität zu Berlin) Stefanie Baron ([email protected]) Angelika Thöne-Otto ([email protected]) Alexander Kurz ([email protected]) Abstract: 1. Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Depressionen kommen bei etwa einem Drittel der Patienten mit leichtgradiger Alzheimerkrankheit vor und sind somit die häufigste psychische Begleiterscheinung im Frühstadium. Frühere Studien konnten zeigen, dass erfolgreiche Depressionsbehandlung auch das Fortschreiten der Alzheimerkrankheit verzögert. Über differenzielle Indikationen für Psychotherapie in dieser Patientengruppe ist bislang jedoch nur wenig bekannt. Im Rahmen der KORDIAL-Therapiestudie wurde die Wirksamkeit eines dreimonatigen neuropsychologisch-verhaltenstherapeutischen Behandlungsprogramms bei leichtgradiger Alzheimerkrankheit bezogen auf eine Reihe von Kriterien evaluiert. In den hier berichteten Moderatoranalysen wurde speziell die Reduktion der depressiven Symptomatik in den Blick genommen. Untersucht wurde die Frage, inwieweit sich in dieser Gruppe demografische Merkmale und kognitiver Status auf die Reduktion depressiver Symptome auswirken. 2. Methode: In die Auswertung gingen die Daten von 201 Teilnehmern der KORDIAL-Studie ein, die in einem randomisierten Parallelgruppendesign der Interventionsgruppe (n=99) oder Kontrollgruppe mit ärztlicher Standardbehandlung (n=102) angehörten. Der Einfluss demografischer Merkmale und kognitiver Testleistung auf die Veränderungen in der Geriatrischen Depressionsskala (GDS) vom Präzu Post-Test und 6-Monats-Follow up wurde mittels Kovarianzanalysen geprüft. 3. Ergebnisse: Die Auswertung ergab einen signifikanten Effekt des Faktors Geschlecht auf die Veränderung der GDS-Werte in der Interventionsgruppe, sowohl im Post-Test als auch im 6-MonatsFollow up. Das Kordial-Programm reduzierte bei weiblichen, nicht jedoch bei männlichen Patienten der Interventionsgruppe die depressive Symptomatik signifikant. 4. Diskussion und Schlussfolgerungen: Weibliche Patientinnen konnten von dem neuropsychologischverhaltenstherapeutischen Behandlungsprogramm in Bezug auf die Reduktion depressiver Symptome mehr profitieren als männliche. Zukünftige Studien sollten Geschlechtsunterschiede in der Wirksamkeit von Psychotherapie bei leichtgradiger Alzheimerkrankheit, sowie deren Zusammenhang mit speziellen Inhalten und Methoden der Therapie oder mit spezifischen Merkmalen der behandelten Alterskohorte näher untersuchen. B 06 Ein mehrfaktorielles Modell der Veränderungsmotivation in der Behandlung der Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie Petra Maria Ivert (Schön Klinik Roseneck für Psyschosomatische Medizin) Johannes Mander (Universität Tübingen) Edgar Geissner (Schön Klinik Roseneck für Psyschosomatische Medizin) Abstract: Frühere Studien und klinische Beobachtungen im Kontext stationärer Psychotherapie von Angststörungen zeigten, dass es im Therapieverlauf der Agoraphobie mit und ohne Panikstörung trotz empirisch überprüfter Behandlungsprogramme bei etwa einem Drittel der Patienten zu ungünstigen Therapieverläufen kommt. Wir haben daher Überlegungen angestellt, inwieweit dabei verschiedene motivationale Faktoren eine Rolle spielen. An einer Stichprobe von 193 Patienten untersuchten wir zu vier Messzeitpunkten - bei Anmeldung, bei Aufnahme und bei Therapieende, sowie katamnestisch sechs Monate nach Therapieende und Entlassung aus der Klinik - die Ausprägung der Angstsymptomatik. Weiterhin analysierten wir zu den entsprechenden Messzeitpunkten motivationale Dimensionen der Veränderung eines Problemverhaltens beziehungsweise der Aufrechterhaltung von neu erworbenen funktionalen Verhaltensweisen. Skalenanalysen ergaben drei Subskalen der initiierenden Veränderungsmotivation (Problemexternalisierung, Initiales Problembewusstsein, Konkrete Handlungsabsicht) und drei Subskalen der Aufrechterhaltungsmotivation (Lernen, Aufrechterhalten, Zuversicht). Korrelative und regressionsanalytische Befunde dienten der Validierung. Die Lösung wurde mittels eines Strukturgleichungsansatzes (AMOS) mit sehr guten Ergebnissen reanalysiert. Es konnten Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der Motivationsmerkmale und der Ausprägung der Angstsymptomatik zu den verschiedenen Messzeitpunkten gefunden werden. Die Ergebnisse zeigen die hohe Relevanz motivationaler Veränderungsprozesse und gezielter Interventionen zur Motivationsförderung in der Therapie von Angstpatienten. B 07 Einfluss der Untersucherpräferenz auf das Ergebnis in Psychotherapievergleichsstudien bei posttraumatischer Belastungsstörung: Eine Metaanalyse Thomas Munder (Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Heike Gerger (Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Sven Trelle (Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz und ) Jürgen Barth (Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Abstract: Hintergrund: Die Untersucherpräferenz oder Researcher Allegiance (RA) gilt als Störfaktor in Psychotherapievergleichstudien. In mehreren Metaanalysen konnte ein Zusammenhang zwischen RA und Studienergebnis nachgewiesen werden. Dabei zeigten präferierte Therapien grössere Effekte als nicht-präferierte Therapien. Weitgehend ungeklärt ist die Frage, inwieweit der belegte korrelative Zusammenhang zwischen RA und Studienergebnis auf einen Einfluss von RA zurückzuführen ist und ob dieser angenommene Einfluss über die Qualität der Studien vermittelt wird. Ziel der vorliegenden Untersuchung war einerseits die Bestätigung des in anderen Populationen belegten Zusammenhangs von RA und Therapieergebnis in Therapievergleichsstudien bei posttraumtischer Belastungsstörung (PTSD). Andererseits wurde geprüft, inwieweit die Studienqualität den Zusammenhang von RA und Studienergebnis moderiert. Methode: Es wurden Studien berücksichtigt, die die Wirksamkeit von mindestens zwei Psychotherapien für PTSD in einem randomisierten Design untersuchten. RA, relevante Aspekte der Studienqualität und die PTSD-Symptomatik zu Therapieende wurden unabhängig von zwei Personen erfasst. Zur metaanalytischen Prüfung des Zusammenhangs von RA und Studienergebnis sowie der Moderationsannahme wurden Metaregressionen mit Simulationen durchgeführt. Ergebnisse: 30 Studien erfüllten die Einschlusskriterien und berichteten über N = 44 Therapievergleiche. Präferierte Therapien zeigten deutlich grössere Effekte als nicht-präferierte Therapien (d = .42, p = .001, I2 = 44.3%). Der Zusammenhang zwischen RA und Studienergebnis war stärker in Vergleichen mit geringerer Studienqualität (d = 0.56, p = .002, I2 = 48.5%), im Unterschied zu Vergleichen mit höherer Studienqualität (d = 0.23, p = .124, I2 = 22.2%). Diskussion und Schlussfolgerung: Die vorliegenden Untersuchung bestätigt den Zusammenhang zwischen RA und dem Studienergebnis. Der höhere Zusammenhang in Studien mit geringer Studienqualität weist zudem darauf hin, dass der Zusammenhang als Ausdruck eines Störeinflusses von RA zu interpretieren ist. B 08 Entscheidungen bei Sozialer Angst: Vermeidung ärgerlicher Gesichter bei Ungewissheit Andre Pittig (Universität Mannheim) Georg W. Alpers (Universität Mannheim) Abstract: Viele Studien weisen auf eine kognitive Verzerrung bezüglich angstauslösender Reize bei verschiedenen Angststörungen hin. Jedoch haben bisher wenige Studien untersucht, ob sich diese Verzerrung auch in höheren kognitiven Funktionen wie dem Entscheidungsverhalten ausdrückt. Daher untersucht die vorliegende Studie den Effekt von aufgaben-irrelevanten Gesichtern mit unterschiedlich emotionalem Ausdruck auf das Entscheidungsverhalten von 40 Personen mit unterschiedlichem Ausmaß sozialer Angst. Entscheidungsverhalten wurde durch eine experimentelle Kartenspielaufgabe (eine modifizierte Version der Iowa Gambling Task) simuliert, bei der in einer anfangs ungewissen Situation die Konsequenzen der Entscheidungen stetig zurückgemeldet werden. Wir haben nun untersucht, ob aufgaben-irrelevante emotionale Gesichter auf den Kartenstapeln diese Entscheidung beeinflussen. Selbstberichtete Vermeidung sozialer Reize und Situationen sagte in der Anfangsphase ein vermeidendes Entscheidungsverhalten in der Aufgabe vorher. Die Vermeidung ärgerlicher Gesichter war hierbei mit höheren Kosten in der Aufgabe verbunden. Dieser Effekt zeigte sich unabhängig von Intelligenz, generellerem risikohaften Entscheidungsverhalten, sowie selbstberichteter depressiver Stimmung und Trait-Angst. Jedoch verringerte sich dieser Effekt über die Zeit und es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen selbstberichteter Vermeidung und Entscheidungen im späteren Verlauf der Aufgabe. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass bei sozialer Angst Vermeidungsverhalten bei einer Ungewissheit über mögliche Konsequenzen besonders ausgeprägt ist, aber durch den Erwerb expliziten Wissens abgeschwächt werden kann. B 09 Lernprozesse in Bezug auf panikrelevantes Verhalten in Familien mit Müttern mit und ohne Panikstörung Jiske Houweling (Université de Lausanne) Simone Munsch (Université de Lausanne) Silvia Schneider (Ruhr-Universität Bochum) Abstract: Theoretischer Hintergrund In Anlehung an das “triple vulnerability” Modell zur Entstehung von Angst (Barlow, 2002), tragen spezifische psychologische Bedingungen zur Entwicklung einer Panikstörung bei. Diese spezifische Faktoren beinhalten frühe Lernerfahrungen bezüglich des Umgangs mit körperlichen Empfindungen in angstauslösenden Situationen basierend auf Beobachtungen des elterlichen Verhaltens (Bouton, Mineka and Barlow, 2001). Ziel Die vorliegende Studie beinhaltet eine vergleichende Untersuchung der Lernprozesse mit panikrelevantem Verhalten in Familien mit Müttern mit bzw. ohne Panikstörung. Folglich wurde untersucht, ob Mütter mit vs. ohne Panik bzw. Väter unterschiedlich auf ihre eigenen und die Paniksymptome ihrer Kinder reagierten. Methode Die Stichprobe bestand aus 86 Müttern und deren Partner sowie deren Kinder in der Adoleszenz. Achtundzwanzig der 86 Mütter wiesen aktuell eine Pankistörung auf. Lernprozesse zu panikrelevanten Verhaltensweisen wurden anhand eines Eltern-Kind Fragebogens erhoben. Dabei wurden Kinder, Mütter und Väter im Hinblick auf das elterliche Verhalten (Verstärkung, Ermutigung, Bestraffung, Miteinbeziehung) beim Erleben eigener sowie im Falle von Paniksymptomen der Kinder befragt. Resultate Die Ergebnisse zeigten, dass Mütter mit Panikstörungen eher dazu tendierten, ihre Kinder im Erleben von Paniksymptomen zu verstärken, sie einzubeziehen oder zu bestrafen als Mütter ohne Panikstörungen. Allerdings unterschieden Partner von Müttern mit bzw. ohne Panikstörung sich nicht hinsichtlich ihrer eigenen Erfahrung von Paniksymptomen. Die Reaktion der Eltern auf das Erleben von Paniksymptomen ihrer Kinder wurden nicht durch den mütterlichen Panikstatus beeinflusst. Diskussion und Schlussfolgerungen Die vorliegende Studie weist darauf hin, dass der Einbezug der Mütter ihrer Kinder in das eigene Panikverhalten im Sinne der mütterlichen Verstärkung und Modellierung einen Einfluss auf das Erleben und die Verarbeitung von somatischen Symptomen haben könnte. Überdauernde Modellierung möglichen dysfunktionalen Verhaltens im Kindesalter könnte ein Risikofaktor für die Entwicklung der Panikstörung im Erwachsenenalter darstellen (Ehlers, 1993). B 11 Wie moduliert soziale Ängstlichkeit Interaktionsverhalten unter Stress? Bernadette von Dawans (Biologische und Differentielle Psychologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Urs Fischbacher (Universität Konstanz) Clemens Kirschbaum (Technische Universität Dresden) Ernst Fehr (Universität Zürich) Markus Heinrichs (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Abstract: Während die negativen Auswirkungen von chronischem Stress auf Gesundheit und soziale Interaktionen gut untersucht sind, sind die zugrundeliegenden Mechanismen akuter Stresseffekte auf soziales Interaktionsverhalten kaum bekannt. Verhalten sich Menschen als Reaktion auf Stress eher im Sinne eines ‚Fight-or-Flight‘-Verhaltens oder zeigen sie sich prosozial im Sinne eines ‚Tend-and- Befriend‘-Verhaltens? Wird dieses Verhalten wiederum vom Ausmaß der sozialen Ängstlichkeit moduliert? In einer randomisierten Studie wurden 67 gesunde Probanden randomisiert der Stress(n=34) bzw. Kontroll-Bedingung (n= 33) des neu entwickelten „Trier Social Stress Test for Groups“ (von Dawans, Kirschbaum, & Heinrichs, 2010) ausgesetzt. Über den Fragebogen „Liebowitz Soziale Angst Skala“ (Liebowitz, 1987) wurde die soziale Ängstlichkeit der Probanden erhoben. Um soziales Verhalten zu untersuchen wurde ein Paradigma aus der Verhaltensökonomie eingesetzt, welches Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Teilen, Neid, Bestrafung und Risiko misst. Die Stress-Induktion führte zu dem erwarteten signifikanten Anstieg psychobiologischer Stressparameter (Cortisol, Herzrate, psychologische Stressreaktionen) im Vergleich zur Kontrollgruppe. Unter Stress zeigten die Probanden über die verschiedenen Spielanordnungen hinweg signifikant mehr prosoziales Verhalten. In der Stressbedingung war dabei ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen sozialer Ängstlichkeit und prosozialem Verhalten zu beobachten. Die Ergebnisse bestätigen die Tendenz zu prosozialem Verhalten im Sinne des „Tend-and-Befriend“-Konzepts als direkte Reaktion auf psychosozialen Stress. Dabei zeigen vor allem Probanden mit niedriger sozialer Ängstlichkeit verstärkt prosoziales Verhalten nach Stress. Weitere Studien müssen diesen Befund anhand von klinischen Stichproben überprüfen. Eine weitere Reduktion von prosozialem Annäherungsverhalten durch Stress bei Patienten mit sozialer Phobie oder eventuell sogar gesteigertes antisoziales Verhalten müsste dann als möglicher aufrechterhaltender Faktor diskutiert werden. B 12 Erhöhte intrinsische Konnektivität des orbitofrontalen Cortex bei Patienten mit Zwangsstörung Jan Beucke (Humboldt-Universität zu Berlin) Christian Kaufmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Jorge Sepulcre (Harvard University) Tanveer Talukar (Dartmouth College) Tanja Endrass (Humboldt-Universität zu Berlin) Norbert Kathmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Hintergrund: Neurobiologische Modelle der Zwangsstörung betonen eine Dysfunktion in neuronalen Schleifen cortikaler und subkortikaler Hirnareale, in welchen dem orbitofronalen Cortex (OFC), einer Hirnstruktur die gleichsam mit behavioraler Flexibilität assoziiert ist und bei Zwangspatienten während Symptomprovokation erhöhte Aktivität zeigt, eine zentrale Rolle zugeordnet wird. In der aktuellen Studie wurde anhand von funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) und einer Methode zur Berechnung der intrinsischen Konnektivität des Gehirns überprüft, ob Hirnareale, und insbesondere der orbitofrontale Cortex, bei Patienten mit Zwangsstörung im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden unter Ruhebedingungen stärker oder schwächer verknüpft sind. Methode: 46 Zwangspatienten und 46 Kontrollprobanden wurden mittels fMRT unter Ruhebedingungen untersucht. Die Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich Alter, Geschlecht und Intelligenz. Für jeden Versuchsteilnehmer wurde die intrinsische Konnektivität des gesamten Gehirns berechnet, indem die Signalzeitreihe jeder einzelnen Hirnregion mit den Signalzeitreihen jeweils aller anderen Hirnregionen korreliert wurde. So wurden für jeden Probanden Hirnregionen bestimmt, die stärker und schwächer mit dem Rest des Gehirns verknüpft sind. Anschließend wurde die Stärke dieser Verknüpfungen mittels T-Tests für unabhängige Stichproben zwischen den beiden Gruppen verglichen. Ergebnisse: Drei Regionen im orbitofrontalen Cortex zeigten eine erhöhte Verknüpfung mit dem Rest des Gehirns bei Zwangspatienten im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden. Darüber hinaus zeigten sich erhöhte Konnektivität mit superioren temporalen und präzentralen Arealen. Zwangspatienten zeigten weniger Konnektivität in posterior cingulären Cortex und ventromedial präfrontalen Hirnregionen. Diskussion: Die erhöhte Konnektivität des orbitofrontalen Cortex bei Patienten mit Zwangsstörung ist konsistent mit der existierenden Literatur und erweitert sie durch den Hinweis, dass sich die erhöhte Konnektivität des orbitofrontalen Cortex bei Zwangspatienten nicht nur auf subkortikale, sondern auch auf cortikale Areale bezieht. Darüber hinaus legt der aktuelle Befund vor dem Hintergrund von Ergebnissen, die orbitofrontale Aktivität als potentiellen Endophänotyp der Zwangsstörung vorgeschlagen haben, die Untersuchung der intrinsischen Konnektivität des orbitofrontalen Cortex bei Angehörigen von Patienten mit Zwangsstörung nahe. B 13 ZAK - Zwänge Aktiv Konfrontieren. Schritte der Entwicklung einer internetgestützten Behandlung von Zwangsstörungen. Nirmal Herbst (Uniklinik Freiburg) Ulrich Voderholzer (Schön Klinik Roseneck für Psyschosomatische Medizin) Christine Knaevelsrud (Freie Universität Berlin) Nicola Stelzer (Uniklinik Freiburg) Christoph Nissen (Uniklinik Freiburg) Anne Katrin Külz (Uniklinik Freiburg) Abstract: Hintergrund: Trotz der hohen Prävalenz von Zwangsstörungen und der einhergehenden sowohl individuellen als auch sozialökonomischen Belastungen kommt der überwiegenden Mehrheit der Betroffenen nach wie vor keine adäquate Behandlung zu. Neben versorgungsbedingten Engpässen, sind vor allem unzureichende Qualifikationen bezüglich störungsspezifischer Therapiemaßnahmen bei Zwängen auf Therapeutenseite, sowie scham- und krankheitsbedingte Einschränkungen auf Patientenseite aufzuführen. Internetgestützte Psychotherapie könnte diesen Defiziten begegnen und so die herkömmliche Face-to-Face-Psychotherapie in bester Weise ergänzen: als ortsunabhängige, niederschwellige Unterstützung durch qualifizierte Therapeuten. Die bisher laut Untersuchungen effektivste Behandlungsstrategie – die Reizkonfrontation mit Reaktionsmanagement („Exposition“) – ist ohne individuelle therapeutische Unterstützung nur sehr schwer anwendbar. Bisherige medienbasierte Behandlungsansätze für Zwangsstörungen sind jedoch nahezu ausschließlich automatisierte Selbsthilfeprogramme ohne therapeutische Interaktion. Studienziel: Ziel des vorliegenden DFG-Projekts ist die Entwicklung und kritische Evaluation einer internetgestützten Behandlung mit therapeutischer Interaktion, welche insbesondere auch die Technik der Reizkonfrontation mit Reaktionsmanagement beinhaltet. Methode: Vierzig Patienten mit Zwangsstörung (Intention-to-Treat-Stichprobe) werden im Rahmen einer randomisierten Studie für je 14 Sitzungen mit einer internetbasierten Psychotherapie störungsspezifisch behandelt. In einem Within-Subjects-Design erhalten alle Teilnehmenden eine psychotherapeutische Behandlung, es erfolgt eine randomisierte Zuteilung zu Therapie- oder WarteKontrollgruppe. Die Behandlung wird mittels ausführlicher Prozess- und Abschlussdiagnostik mit etablierten Messinstrumenten evaluiert. Diskussion: Die Studie zielt darauf ab, durch die Implementierung eines internetgestützten Therapiekonzepts für Zwangserkrankungen einen wesentlichen Beitrag zur Besserung der bislang unbefriedigenden Vorsorgungssituation zu leisten. B 14 Besonderheiten des Schamerleben bei Frauen mit BorderlinePersönlichkeitsstörung Corinna Scheel (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Oliver Tüscher (Universitätsklinikum Mainz) Brunna Tuschen-Caffier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie) Klaus Lieb (Universitätsklinikum Mainz) Gitta Jacob (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist charakterisiert durch intensives emotionales Erleben. Dabei spielt, neben anderen Emotionen, Scham eine wichtige Rolle. Rüsch (2007) konnte bei BPS-Patientinnen in impliziten Assoziationstests und im Selbstbericht die Hypothese einer erhöhten Schamneigung bestätigen. In dieser Studie werden Intensität und Verlauf des Erlebens von Scham bei BPS-Patientinnen, gesunden und depressiven Frauen verglichen. Erwartet wird bei den BPS-Patientinnen ein längeres und intensiveres Schamerleben als bei den gesunden Kontrollprobandinnen. Bei Depressiven vermuten wir ebenfalls intensive Schamwerte, jedoch einen schnelleren Abfall der Intensität als bei BPS-Patientinnen. Methode: Zunächst wurde bei allen Teilnehmerinnen eine ausführliche Achse I und II Diagnostik durchgeführt, bei den BPS-Patientinnen zusätzlich eine Schweregradeinschätzung. Danach wurde anhand einer am PC auditiv dargebotenen Kurzgeschichte bei den Probandinnen Scham induziert. Vor der Induktion, direkt danach, sowie nach 3, 6 und 8 Minuten wurden die Teilnehmerinnen gebeten, ihre momentanen Emotionen (Scham, Ärger, Angst, Traurigkeit, Freude, Genervtheit, Langeweile) einzuschätzen. Psychometrische Daten zu Dissoziation, Depressivität und Scham wurden erhoben. Die Auswertung erfolgte anhand von Varianzanalysen mit Messwiederholung und T-Tests mittels SPSS. Ergebnisse: Die BPS-Gruppe der zeigte bereits vor der Induktion ein erhöhte Werte für Scham gegenüber beiden Gruppe. Weder BPSPatientinnen noch Depressive unterscheiden sich signifikant von den Gesunden bezüglich des Verlaufs des Schamerlebens. BPS-Patientinnen zeigen signifikant andere Zeitverläufe bezüglich Ärger und Traurigkeit nach Schaminduktion. Diskussion: Eine erhöhte Schamneigung bei BPS wird von unserer Arbeit unterstützt. Der Einfluss der Schaminduktion auf Ärger und Traurigkeit erscheint besonders interessant. Der zum Ende des Experiments erhöhte Ärgerwert könnte einen Anstieg von Anspannung nach sich ziehen. Ein solcher Mechanismus könnte selbstverletzendes Verhalten begünstigen, was schon mit Scham in Zusammenhang gebracht wurde. Schlussfolgerung: Weitere Hinweise für die spezielle Bedeutung von Scham für BPS ergeben sich. Insbesondere scheint hier eine genauere Betrachtung des Einflusses vom Scham auf andere Emotionen interessant. B 15 Dialektisch-behaviorale Therapie für Frauen mit BorderlinePersönlichkeitsstörung und Anoraxia nervosa bzw. Bulimia nervosa, die von vorhergehenden Behandlungen nicht profitierten Christoph Kröger (TU Braunschweig) Sören Kliem (TU Braunschweig) Valerija Sipos (Universität Schleswig-Holstein, Campus Lübeck) Ruediger Arnold (Universität Schleswig-Holstein, Campus Lübeck) Tanja Schunert (Universität Schleswig-Holstein, Campus Lübeck) Ulrich Schweiger (Universität Schleswig-Holstein, Campus Lübeck) Hans Reinecker (Universität Bamberg) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung. Eine adaptierte Form der dialektisch behavioralen Therapie (DBT) für Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) und Essstörung (ES) zeigte sich in Fallstudien auch wirksam hinsichtlich essstörungsbezogener Beschwerden. Methode. Frauen mit BPS, 9 mit komorbider Anorexia nervosa und 15 mit Bulimia nervosa, die bereits von essstörungsspezifischen, stationären Behandlungen nicht profitiert haben, wurden in einem stationären DBT-Programm mit zusätzlichem Modul für Essstörung drei Monate konsekutiv behandelt. Diagnostische Erhebungen erfolgten vor und nach der Behandlung sowie 15 Monate später. Ergebnisses. Die Teilnehmerinnen erfüllten durchschnittlich zwei ES und mehrere andere psychische Störungen in ihrem bisherigen Leben. Keine brach die Behandlung ab. Bei der Nachbefragung lag die Remissionsrate für AN bei 33% und für BN bei 54%. Allerdings wechselten 44% der Frauen mit AN zur BN. Das durchschnittliche Gewicht der Frauen mit AN war signifikant gestiegen; die Essattacken der Frauen mit BN waren signifikant reduziert. In Selbstbeurteilungsmaßen waren die allgemeine Symptombelastung und die essstörungsbezogenen Beschwerden 15 Monaten nach der Behandlung verringert. Diskussion. Remissionsraten und weiterhin bestehende essstörungsbezogene Beschwerden weisen daraufhin, dass die Behandlung modifiziert werden sollte. Schlussfolgerung. Die Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass ein ergänztes DBT-Programm erfolgreich bei Frauen mit BPS und komorbider ES sein kann, die bislang nicht von Behandlungen profitiert haben. B 16 Die Krankheitskosten von Patienten mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung ein Jahr vor und während des ersten Therapiejahres einer ambulanten Dialektisch Behavioralen Therapie Till Wagner (Humboldt-Universität zu Berlin) Dieter Gieb (Humboldt-Universität zu Berlin) Claudia Dambacher (Humboldt-Universität zu Berlin) Stefan Röpke (Charité-Universitätsmedizin Berlin) Babette Renneberg (Freie Universität Berlin) Christian Stiglmayr (Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaftliche Psychotherapie) Thomas Fydrich (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Patienten mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) beanspruchen das Gesundheitssystem überproportional häufig und verursachen ersten Untersuchungen zufolge enorme direkte Kosten. Gleichzeitig gibt es bislang nur eine Studie aus den Niederlanden, in der neben den direkten Kosten auch die indirekten Kosten der BPS erfasst wurden. Ebenso existieren trotz der guten empirischen Basis für die klinische Wirksamkeit der Dialektisch Behavioralen Therapie (DBT) kaum Studien zur Effizienz der DBT. In der vorliegenden Untersuchung wurden die Kosten von Patienten mit einer BPS entsprechend den Empfehlungen aktueller, gesundheitsökonomischer Leitlinien (Graf von der Schulenburg et al., 2008) aus einer gesellschaftlichen Perspektive erfasst. Darüber hinaus wurde untersucht, ob die Kosten während einer ambulanten DBT reduziert werden können. Hierzu konnten im Rahmen der Berliner Borderline Versorgungsstudie (BBV) bislang 30 Patienten mit einer BPS rekrutiert werden. Die Messungen fanden zu Beginn sowie alle vier Monate während des ersten Behandlungsjahres statt. Die direkten medizinischen, die direkten nicht - medizinischen sowie die indirekten Kosten wurden retrospektiv mit einem eigens entwickelten Fragebogen erfasst. Den ersten Ergebnissen zufolge verursachen die untersuchten BPS-Patienten sowohl hohe direkte als auch hohe indirekte Kosten. Verglichen mit dem Jahr vor der Therapie sind die Kosten während des Therapiejahres um etwa 13.000 Euro geringer. Für jeden in die DBT investierten Euro können etwa zwei Euros eingespart werden. Während sich vor allem im stationären Bereich eine starke Kostenreduktion zeigt, bleiben die indirekten Kosten über den untersuchten Zeitraum nahezu unverändert. Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass BPS-Patienten deutlich höhere gesellschaftliche Kosten als andere Patienten mit psychischen Störungen, wie z.B. mit einer Major Depression verursachen. Zudem stellen die Ergebnisse deutliche Hinweise für die Effizienz der ambulanten DBT dar. Aus therapeutischer Sicht sollten Bemühungen zur beruflichen Integration der Patienten im Verlauf der Therapie weiter verstärkt werden. B 17 Schematherapie in Gruppen für Patienten mit BorderlinePersönlichkeitsstörung Gitta Jacob (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Arnoud Arntz (Maastricht University) Joan Farrell (Indiana University School of Medicine, Indianapolis) Abstract: Für Schematherapie (ST) als Einzeltherapie zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) gibt es mittlerweile mehrere positive Studien. Eine neue Entwicklung ist die Anwendung der ST bei BPS in Gruppen. Da ein Schwerpunkt der ST auf dem Lernen gesunder Bindungsbeziehungen liegt, erscheint das Gruppensetting hier besonders angemessen, da es eine Vielzahl von Beziehungen zu Peers anbietet. Dadurch kann einerseits das Erleben von Sicherheit in verschiedenen interpersonellen Kontexten gelernt, andererseits auch funktionales Beziehungsverhalten geübt werden. Zudem kann die Gruppe bei emotionsfokussierenden Methoden, die einen Schwerpunkt in der ST bilden, unterstützend und verstärkend wirken. Da eine erste randomisiert-kontrollierte Studie sowie darauf aufbauende weitere Pilotstudien sehr gute Ergebnisse zeigten, wird aktuell ein großer internationaler RCT zur Wirksamkeit und Kosteneffektivität der ST bei BPS in Gruppen durchgeführt (Studienleitung A. Arntz & J. Farrell; PI für die deutschen Zentren G. Jacob). In dem Vortrag wird das Konzept der ST bei BPS in Gruppen vorgestellt. Die bisher vorliegenden ersten Befunde aus RCT und verschiedenen Pilotstudien werden vorgetragen. Das Design des internationalen RCT wird vorgestellt und erste eigene klinische Erfahrungen mit der Studientherapie berichtet. B 18 Absichtsbildung und Absichtsumsetzung im Alltag depressiver Patienten Lena Krämer (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie) Miriam Rüsch (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie) Almut Helmes (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie) Jürgen Bengel (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie) Abstract: Hintergrund. Gesundheitspsychologische Modelle der Verhaltensänderung (z.B. der Health Action Process Approach, HAPA, Schwarzer, 2008) unterscheiden zwischen motivationalen Prozessen der Absichtsbildung und volitionalen Prozessen der Absichtsumsetzung. Die vorliegende qualitative Studie ist erster Teil eines Forschungsprogramms, das sich mit der Frage beschäftigt, ob sich die Unterscheidung in Motivation und Volition auf das Verständnis von alltäglichen Aktivitätseinschränkungen depressiver Patienten übertragen lässt. Methode. Neun depressive Patienten einer Ambulanz für Psychotherapie wurden anhand eines problemzentrierten Interviews befragt, welche Gründe sie als maßgeblich für ihre Aktivitätseinschränkungen erlebten. Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte orientiert an die Prinzipien der Grounded Theory in einem mehrstufigen Prozess der Kodierung und Kategorienbildung. Anhand eines gemischt deduktiv-induktiven Vorgehens wurde überprüft, inwiefern sich die Aussagen der Patienten den einzelnen Komponenten des HAPA zuordnen ließen. Ergebnisse. Die Schilderungen der Patienten konnten anhand der generierten Kodes und Kategorien in Schwierigkeiten bei der Absichtsbildung und Schwierigkeiten bei der Absichtsumsetzung unterteilt werden. Die Teilnehmer ließen sich vier verschiedenen Patiententypen zuordnen: Patienten des motivationalen Typs führten ihre Inaktivität in erster Linie auf geringe Verhaltensabsichten zurück (aufgrund starker negativer, bzw. fehlender positiver Konsequenzerwartungen). Patienten des volitionalen Typs litten vermehrt unter Schwierigkeiten der Absichtsumsetzung (aufgrund großer Ablenkbarkeit durch situative Barrieren wie Lustlosigkeit oder Schmerzen). Diskussion. Das ursprünglich aus der Gesundheitspsychologie stammende HAPA-Modell erwies sich als geeignete Heuristik für das Verständnis der berichteten Aktivitätseinschränkungen. Die qualitative Auswertung der Daten zeigt, dass Patiententypen mit unterschiedlichen Aktivitätsschwierigkeiten differenziert werden können. Für die therapeutische Praxis ergibt sich die Notwendigkeit, einzelfallbasiert zwischen motivationalen und volitionalen Defiziten zu unterscheiden und eine entsprechende Therapieplanung einzuleiten. Bereits bestehende Interventionen zur Änderung des Gesundheitsverhaltens könnten hierbei Modell stehen. Insgesamt zeigt sich, dass Theoriemodelle aus der Gesundheitspsychologie einen wichtigen Beitrag für die Klinische Psychologie leisten können. B 19 Aspekte von Vermeidung bei Depression Timo Brockmeyer (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) Martin Grosse Holtforth (Universität Zürich) Johannes Zimmermann (Universität Kassel) Nils Pfeiffer (Universität Heidelberg) Hinrich Bents (Universität Heidelberg) Annette Kämmerer (Universität Heidelberg) Hans-Christoph Friederich (Universität Heidelberg) Abstract: Hintergrund: Vermeidung kann als ein möglicher Risikofaktor für Depression angesehen werden, dem bisher wenig Aufmerksamkeit durch empirische Forschung zugekommen ist (Dobson & Dozois, 2008). Dabei kann zwischen behavioraler, kognitiver und emotionaler Vermeidung unterschieden werden (Moore & Garland, 2003). Rumination wird zudem als eine Form von Vermeidung diskutiert (Giorgio et al. 2010). Zentrale Fragestellungen der Studie waren, inwiefern sich diese drei Aspekte von Vermeidung in einer klinischen Stichprobe depressiver Patienten zeigen lassen, inwiefern diese störungsspezifisch sind, sich zu einem übergeordneten Faktor zusammenfassen lassen, mit Rumination assoziiert sind und depressive Symptome vorhersagen. Methode: In einer naturalistischen, querschnittlichen Untersuchung wurden 24 Patienten mit Major Depression, 20 Patienten mit Angststörung und 27 Gesunde Kontrollpersonen untersucht. Zur Anwendung kamen dabei u.a. folgende Instrumente: Fragebogen zur Analyse motivationaler Schemata, Kognitiv-Behaviorale Vermeidungs-Skalen, Fragebogen zur Ambivalenz bzgl. Emotionsausdruck, Difficulties in Emotion Regulation Scale, Response Style Questionnaire. Ergebnisse: Depressive Patienten zeigten stärker ausgeprägte behaviorale, kognitive und emotionale Vermeidung als Gesunde. Im Vergleich zu Angstpatienten zeigten Depressive jedoch nur höhere Werte hinsichtlich behavioraler und kognitiver Vermeidung. Faktorenanalytisch ließen sich alle genannten Aspekte depressiver Vermeidung zu einem übergeordneten Faktor zusammenfassen. Innerhalb der Gruppe der depressiven Patienten korrelierten behaviorale und kognitive Vermeidung mit Rumination. Vermeidung stellte über Rumination hinaus einen eigenständigen Prädiktor für den Schweregrad depressiver Symptome dar. Diskussion: Die Ergebnisse sind vereinbar mit der Annahme, dass Vermeidung eine wichtige Rolle bei Entstehung und Aufrechterhaltung der Depression spielt. Zukünftige Forschung sollte längsschnittliche Designs und die Erfassung objektiverer Daten beinhalten. Schlussfolgerungen: Ausgeprägte Vermeidung relevanter affektiver und kognitiver Inhalte erschwert möglicherweise den Therapieprozess und erfordert ein Anpassen herkömmlicher kognitiver und behavioraler Interventionen. B 20 Effekte transkranieller Gleichstromstimulation auf die kognitive Kontrolle: Lässt sich die kognitive Kontrolle depressiver Patienten verbessern? Larissa Wolkenstein (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Christian Plewnia (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Eine defizitäre kognitive Kontrolle ist eines der zentralen Merkmale der Depression. Verschiedene Studien belegen, dass depressive Störungen unter anderem durch eine Hypoaktivierung des dorsolateralen präfrontalen Cortex (DLPFC) gekennzeichnet sind. Diese Hypoaktivierung des DLPFC stellt vermutlich eine neurophysiologische Grundlage exekutiver Defizite Depressiver dar, wie z.B. der Schwierigkeit die Perseveration negativen Affekts zu überwinden. Sie liefert also eine mögliche Erklärung für die verringerte Fähigkeit depressiver Patienten kognitive Kontrolle auszuüben. Das Ziel dieser Studie besteht darin, die Aktivierung des DLPFC sowohl bei gesunden Personen als auch bei depressiven Patienten mittels transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) gezielt zu steigern, um zu untersuchen, inwiefern dies einen positiven Einfluss auf die kognitive Kontrolle der Probanden ausübt. Methode: In einem randomisierten, doppelverblindeten Crossover-Design wird der Effekt einer einmaligen anodalen tDCS des linken DLPFC auf die kognitive Kontrolle 16 depressiver Patienten und 16 nach Alter, Geschlecht und Bildung gematchter Kontrollprobanden untersucht. Zur Untersuchung der kognitiven Kontrolle wird eine Delayed-Response Working Memory Task (DWM) eingesetzt. Während der Verzögerungsphase der DWM werden Bilder präsentiert, die in ihrer Valenz variieren. Ergebnisse: Vorläufige Analysen ergaben, dass sich die kognitive Kontrolle depressiver Patienten durch die anodale tDCS des linken DLPFC im Vergleich zu einer sham-Stimulation verbessern lässt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn negative Distraktoren in der Verzögerungsphase der DWM präsentiert werden. Die endgültigen Resultate werden jedoch vor Ort präsentiert und diskutiert. Diskussion: Der Stichprobenumfang dieser Studie ist noch relativ gering. Entsprechend sollten Anschlussstudien größere Stichproben anstreben. Schlussfolgerungen: Diese vorläufigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass die tDCS ein geeignetes Mittel darstellen könnte, interferierende Effekte negativer Stimuli bei depressiven Patienten zu reduzieren. Es stellt sich die Frage, inwiefern dieser Effekt auch in kognitiven Trainings nutzbar gemacht werden könnte. Zudem ist es denkbar, dass die Modulierbarkeit der kognitiven Kontrolle mittels tDCS einen Moderator für einen späteren Therapieerfolg darstellt. B 21 Erste Ergebnisse der Studie “Depressionsbehandlung im Alter – Lebensrückblicksintervention mit ergänzendem Einsatz von Computermodulen“ Barbara Preschl (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Birgit Wagner (Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie) Simon Forstmeier (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Andreas Maercker (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Abstract: 1. Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Interventionen im Bereich „e-mental health“ kommen zunehmend auch bei älteren Menschen zum Einsatz und zeigen gute Ergebnisse, beispielsweise im Bereich Depression. Dieses Anwendungsgebiet hat gerade bei älteren Populationen eine hohe Relevanz, da eine leichte bis mittelschwere Form der Depression im Alter weit verbreitet und in der Folge mit hohen Gesundheitskosten verbunden ist. 2. Methode In einer randomisierten Kontrollgruppenstudie (Warteliste) an der Universität Zürich behandeln wir ältere Menschen ab 65 Jahren die an einer leichten bis mittelschweren Form der Depression leiden in einer kombinierten Form aus face-to-face Treffen (6 Sitzungen) und ergänzendem Einsatz spezifischer Computermodule. Die Intervention findet ihre Begründung in neuen Erkenntnissen aus der Lebensrückblicksforschung und der computerisierten Stimmungsinduktion. Ziel ist eine Reduktion der depressiven Symptome durch Induktion positiver Erinnerungen und Emotionen. 3. Ergebnisse Eine Pilotstudie mit N = 3 Personen zeigte eine Reduktion depressiver Symptome (BDI-II), sowie einen Anstieg an Lebensqualität (WHO-5). Erste Ergebnisse der Hautpstudie mit N = 20 Personen werden berichtet. 4. Diskussion Erste Analysen zeigen Ergebnisse in die erwartete Richtung, was Hinweise darauf gibt, dass eine kombinierte Form der Lebensrückblicksintervention mit ergänzendem Einsatz von Computermodulen zu einer Reduktion depressiver Symptome führt. Erfahrungen mit dem therapeutischen Konzept und Setting sowie mit der Akzeptanz der Computermodule werden diskutiert. 5. Schlussfolgerungen Interventionen im Bereich „e-mental health“ könnten eine wirkungsvolle und kostengünstige Behandlungsform für Depression im Alter darstellen. B 22 Evaluation des Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) als eine stationäre störungsspezifische Psychotherapie für schwer chronisch depressive Patienten Eva-Lotta Brakemeier (Uniklinik Freiburg) Vera Engel (Uniklinik Freiburg) Teresa Schmidt (Uniklinik Freiburg) Elisabeth Schramm (Uniklinik Freiburg) Martin Hautzinger (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Mathias Berger (Uniklinik Freiburg) Claus Normann (Uniklinik Freiburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund Die bisher einzige störungsspezifische Psychotherapie für chronische Depression CBASP erzielte in einigen randomisiert-kontrollierten Studien hohe Responseraten bei ambulanten chronisch depressiven Patienten. Bei der chronischen Depression handelt es sich jedoch um eine häufig besonders schwere und resistente Störung, die in Deutschland oft stationär behandelt wird. Die Autoren entwickelten daher auf der Basis der ambulanten CBASPTherapie ein neues multidisziplinäres stationäres CBASP-Konzept, in dem schwer chronisch depressive Patienten in Einzel- und Gruppentherapien über drei Monate behandelt werden. Selbsthilfegruppen und Fresh-up Kurse wurden zur Rückfallprophylaxe integriert. Methode In einer laufenden offenen Pilotstudie werden Prä- Post-Messungen, Prozessanalysen sowie Katamnese-Erhebungen (6 und 12 Monate nach Entlassung) durchgeführt. Zu allen Messzeitpunkten wird die fremd- und selbstbeurteilte Depressivität sowie die Lebensqualität der Patienten erfasst. Außerdem werden CBASP-bezogene Fragebögen eingesetzt. Die Zufriedenheit mit der stationären Behandlung wird überprüft und alle Bausteine einzeln evaluiert. Schließlich wird eine Grunddiagnostik der Persönlichkeit, früher Traumatisierungen und interpersoneller Probleme zu Behandlungsbeginn durchgeführt, um mögliche Prädiktoren eines Ansprechens zu identifizieren. Ergebnisse Erste Pilotdaten (Brakemeier et al., in press) weisen darauf hin, dass das Konzept sehr gut durchführbar ist und von Patienten hoch akzeptiert wird. Alle Patienten profitieren vom Konzept, wobei 60% eine Response und 40% eine Remission erreichen und die Effektstärken sehr hoch ausfallen. Auch die Rückfallraten sind niedrig, wobei vereinzelte Rückfälle durch stationäre CBASP fresh-up Kurse aufgefangen werden konnten. Diskussion Im Juni 2011 können Daten von 40 Patienten präsentiert werden, wobei insbesondere untersucht wird, ob spezifische Prädiktoren eines Ansprechens existieren. Schlußfolgerung Nach den vielversprechenden Ergebnissen der Pilotstudie planen wir die Durchführung einer randomisiert-kontrollierten Studie mit vier Behandlungsgruppen. Das Ziel dieser Forschung besteht darin, ein nachweislich effektives stationäres störungsspezifisches Konzept für schwer chronisch Depressive zur Verfügung zu stellen, wovon die Betroffenen, deren Behandelnde, aber auch das Gesundheitssystem durch Senkung der Behandlungskosten profitieren könnten. B 23 Evaluation einer kognitiv- achtsamkeitsbasierten Gruppenpsychotherapie bei depressiven Störungen Anette Elisabeth Hennighausen (Rehabilitationszentrum am Sprudelhof Bad-Nauheim) E. Hennighausen (Philipps-Universität Marburg) B.K. Bock (Rehabilitationszentrum am Sprudelhof Bad-Nauheim) G. Schilling (Rehabilitationszentrum am Sprudelhof Bad-Nauheim) Abstract: Einleitung Im Rahmen einer stationären psychosomatischen Rehabilitationsbehandlung wurde eine kognitivachtsamkeitsbasierte Gruppenpsychotherapie für depressiv erkrankte Patienten entwickelt, deren Ziel die Förderung der Eigenverantwortung sowie der Aufbau von Bewältigungsstrategien ist. Diese indikative Gruppe sollte das bestehende Therapie- und Behandlungskonzept der Klinik erweitern. In einem Experimental- Kontrollgruppendesign (treatment as usual) wurde überprüft, welche Auswirkungen die zusätzliche Teilnahme an der Gruppentherapie auf die Depressivität sowie weitere psychopathologische Parameter hat und inwieweit diese Effekte diagnosespezifisch sind. Methode Im Rahmen des multimodalen Therapiekonzeptes richtet sich das standardisierte offene Gruppentherapieprogramm (max. 8 Teilnehmer, 6 Termine in 3 Wochen) an Patienten mit einer depressiven Störung. Die Grundstruktur des Programms enthält neben Ansätzen aus der kognitiven Therapie nach A. Beck auch achtsamkeitsbasierte Module (MBSR). Gemeinsam mit den Patienten wird eine achtsame Haltung gegenüber Gedanken, Gefühlen und dem körperlichen Empfinden entwickelt, wobei diesen mit einer akzeptierenden und offenen Haltung begegnet wird. Die Ausrichtung auf die „Hier-und-Jetzt-Erfahrung“ des gegenwärtigen Augenblicks ist dabei zentral. Als Prä-Postdiagnostik füllten insgesamt 40 Patienten beider Gruppen die SCL-90-R, den BDI sowie den Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA) aus. Als Persönlichkeitsparameter wurde der TCI erhoben. Als Fremdbeurteilungsinventar wurde im Hinblick auf das Ausmaß der depressiven Symptomatik die BRMS sowie der SKID I durchgeführt. Es wurden 2x2 Varianzanalysen mit Messwiederholung (ANOVA) und zur statistischen Prüfung t-Tests für abhängige Stichproben durchgeführt. Ergebnisse: Insgesamt weisen die Befunde, in Übereinstimmung mit der Literatur darauf hin, dass die neu entwickelte kognitiv-achtsamkeitsbasierte Gruppenpsychotherapie im Rehabilitationskontext eine wirkungsvolle Behandlungsmethode nur bei Patienten mit rezidivierenden depressiven Störungen darstellt. Bei Patienten mit einer Dysthymia, einer einmaligen (unipolaren) depressiven Episode oder im Rahmen einer Anpassungsstörung zeigte die Gruppenbehandlung dagegen keinen zusätzlichen Gewinn. Bei dieser Patientengruppe erweist sich das bestehende Therapie- und Behandlungskonzept der Klinik als ausreichend. Die Gruppenbehandlung wurde fest in das multimodale Therapiekonzept aufgenommen. B 24 Multizentrische und naturalistische Evaluation einer störungsspezifischen stationären Gruppentherapie für chronisch depressive Patienten Rebecca Strunk (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Brunna Tuschen-Caffier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie) Eva-Lotta Brakemeier (Universitätsklinikum Freiburg, Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Die CBASP-Gruppe DO! basiert auf dem Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, das von James McCullough ursprünglich für die ambulante Einzeltherapie chronisch depressiver Patienten entwickelt und bereits erfolgreich evaluiert wurde. Da einige Patienten so schwer und therapieresistent erkrankt sind, daß sie stationär behandelt werden müssen, wurde CBASP für den stationären Kontext modifiziert, wobei insbesondere die Gruppentherapie DO! (desired outcome) neu entwickelt und bereits in einigen Kliniken in Deutschland implementiert wurde. Methode: Zur erstmaligen Überprüfung der potentiellen Wirksamkeit und Umsetzbarkeit dieser CBASP-Gruppentherapie erfolgte eine Evaluation im Rahmen einer naturalistischen multizentrischen Studie in fünf psychiatrischen Kliniken. Durch ein offenes Prä-Post-Design wurde bei einer Patientenstichprobe (n = 29) die fremd- und selbstbeurteilte Depressivität und die wahrgenommene Lebensqualität erhoben sowie eine Befragung zur Bewertung von Inhalten und Umsetzungsbedingungen der Gruppe durchgeführt. Auch die Gruppentherapeuten (n = 10) der Studienzentren bewerteten die Gruppe. Zusätzliche explorative Untersuchungen bezogen sich auf den Einfluss von Traumatisierungen, Persönlichkeitsstörungen und Motivation der Patienten. Ergebnisse: Als Hauptergebnis gilt es festzuhalten, dass sich die Depressivitätswerte und die wahrgenommene Lebensqualität der Patienten nach Teilnahme an zehn Sitzungen der CBASP-Gruppe signifikant verbesserten. Sowohl Patienten als auch Therapeuten bewerteten das gesamte Konzept als gut oder sehr gut. Die organisatorischen Durchführungsbedingungen ließen sich aus Sicht der Patienten hinsichtlich der Sitzungsfrequenz noch optimieren. In den explorativen Untersuchungen ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen Motivation der Patienten und potentieller Wirksamkeit der CBASP-Gruppe. Diskussion: Bedingt durch das offene, nicht randomisiert-kontrollierte Studiendesign sind die Ergebnisse dieser Studie nur eingeschränkt generalisierbar. Dennoch weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die CBASP-Gruppentherapie DO! ein potentiell wirksames, gut umsetzbares Konzept ist, welches auch von den Gruppentherapeuten hoch akzeptiert wird. Schlussfolgerungen: Aus den Ergebnissen dieser Studie lassen sich Vorschläge für eine Optimierung der Gruppentherapie sowie für eine geplante randomisiert-kontrollierte Evaluation der CBASPGruppe ableiten. B 25 Online-basierte Transferförderung nach stationärer Depressionstherapie (OTF-D). Konzept und Design einer MulticenterStudie in fünf Kliniken und drei Versorgungssettings. Wiebke Hannig (Philipps-Universität Marburg) David Ebert (Philipps-Universität Marburg) Florian Scholz (Philipps-Universität Marburg) Doris Erbe (Philipps-Universität Marburg) Heleen Riper (Universität Amsterdam) Pim Cuijpers (Universität Amsterdam) Niels Bergemann (Schön Klinik Bad Arolsen) Thilo Kircher (Universitätsklinikum Gießen und Marburg) Martin Hautzinger (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Die stationäre Depressionstherapie ist nachgewiesenermaßen effektiv. Angesichts des hohen Rezidivrisikos depressiver Störungen stellt sich die Aufgabe, die im Schonraum der stationären Therapie erzielten Behandlungserfolge auch in die Lebenswelt des Patienten zu transferieren. Vor dem Hintergrund der steigenden Alltagsrelevanz des Internets und der mittlerweile vielfach nachgewiesenen Wirksamkeit online-basierter psychotherapeutischer Interventionen in der Behandlung depressiver Störungen stellt eine online-gestützte Step-Down-Intervention einen vielversprechenden Behandlungsansatz zur langfristigen Stabilisierung der stationären Therapieerfolge dar. Ziel der Studie ist die Evaluation einer auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen Prinzipien beruhenden und störungsspezifisch ausgerichteten online-basierten Transferförderungsintervention nach stationärer Depressionstherapie (OTF-D). Methode: In einer multizentrischen, dreiarmigen, prospektiven, randomisiert-kontrollierten Studie (k = 5; N = 522) sollen die Effekte von OTF-D mit denen einer aktiven Kontrollbedingung (inhaltsunspezifischer, supportiver Internetchat) und denen der poststationären Routineversorgungsmaßnahmen (TAU) verglichen werden. Die Wirksamkeit der Behandlungsbedingungen im Hinblick auf Rezidivsymptomatik sowie die Kosteneffektivität werden zur 6- und 12-Monatskatamnese überprüft. Um Wirkmechanismen beurteilen zu können, werden über die Behandlungsdauer hochfrequente Verlaufsmessungen durchgeführt. Zur Klärung des Einsatzbereiches von OTF-D erfolgt die Evaluation in den in Deutschland stationär versorgungsrelevanten Behandlungssettings Akut-Psychosomatik, Psychosomatische Rehabilitation und Psychiatrie. Ergebnisse: Konzept und Design der Studie werden vorgestellt. Diskussion: Die vorgestellte Studie ist nach unserem Wissen die weltweit erste auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen Prinzipien aufgebaute störungsspezifische Step-Down-Intervention nach stationärer Depressionstherapie. Schlussfolgerung: Es wird erwartet, dass im Rahmen der Studie eine in die Routineversorgung integrierbare Intervention entwickelt werden kann, mit der sich die Nachhaltigkeit stationärer Depressionstherapie effektiv und effizient steigern lässt. B 26 Selbststeuerungskompetenzen als Prädiktoren für langfristigen Therapieerfolg nach stationärer Depressionstherapie Florian Scholz (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) David Ebert (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Hintergrund: Depressionen sind weit verbreitet und beeinträchtigen erheblich die Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen. Wie viele Studien belegen, können diese Beeinträchtigungen durch stationäre, psychotherapeutische Akuttherapien reduziert werden. Allerdings sind stationär erzielte Therapieerfolge langfristig häufig nicht stabil. Daher ist die Identifikation von Prädiktoren des Symptomverlaufes nach einer erfolgreichen Therapie von besonderem Interesse. Das Ziel dieser Studie ist, Selbststeuerungskompetenzen erstmalig als Prädiktoren des Symptomverlaufes nach einer stationären Therapie von depressiven Störungen zu untersuchen. Selbststeuerungskompetenzen erhöhen im Allgemeinen die Wahrscheinlichkeit, die Intensität und die Ausdauer, mit der Absichten in konkretes Handeln umgesetzt werden. So könnten bessere Selbststeuerungskompetenzen Patienten nach einer stationären Therapie dabei helfen, neues Verhalten leichter im Alltag umzusetzen und so den Therapieerfolg langfristig stabilisieren. Methode: Untersucht wurden 298 Patienten einer Fachklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, die aufgrund einer Major Depression stationär behandelt wurden. Selbststeuerung (SSI-K3, Kuhl & Fuhrmann, 2004) und Depressivität (HEALTH-49-Dep, Rabung et al., 2009) wurden bei stationärer Aufnahme (t1), zur Entlassung (t2), sowie drei (t3) und zwölf Monate (t4) nach Entlassung erhoben. Anhand multipler Regression wurde der Einfluss von Selbststeuerung (t2) auf Depressivität (t3, t4) unter Kontrolle bestehender Residualsymptome (t2) berechnet. Ergebnisse: Folgende Prädiktoren sagten niedrigere Depressionswerte für t3 vorher: Selbstgespür, Absichten umsetzten, Initiative und angstfreie Zielsetzung. Für t4 (N=231) sagte Selbstbestimmung niedrigere Depressionswerte vorher. Diskussion: Selbststeuerungsmaße sagten, über den Einfluss von Residualsymptomen hinaus, drei und zwölf Monate nach der stationären Therapie signifikant niedrigere Depressionswerte vorher. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass (a) mittelfristig andere Selbststeuerungsmaße wirken als langfristig, und (b) nicht alle Selbststeuerungsmaße gleichermaßen prädiktiven Wert besitzen. Schlussfolgerung: Im Rahmen dieser Studie wurde, unseres Wissens nach, erstmalig der Einfluss von Selbststeuerungskompetenzen auf den Symptomverlauf nach einer stationären Therapie depressiver Störungen untersucht. Zukünftige Studien sollten die Generalisierbarkeit der Befunde in unabhängigen Studien prüfen. B 27 Affektive Misattribution durch krankheitsangstrelevante Bilder und der Zusammenhang mit Emotionsregulationsstrategien und Krankheitsängstlichkeit Fabian Jasper (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Michael Witthöft (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Die Affective-Misattribution-Procedure (AMP; Payne et al., 2005) kombiniert die Präzision und Kontrolle klassischer Experimente mit der Augenscheinvalidität projektiver Verfahren. Wir wandten dieses Verfahren erstmalig mit krankheitsrelevanten Bildstimuli an und prüften Zusammenhänge zu Fragebogenmaßen. Wir erwarteten Zusammenhänge mit maladaptiven Emotionsregulationsstrategien und (affektiver) Krankheitsängstlichkeit. Methode Es wurden in schneller Abfolge ein Zielreiz (mit Instruktion, ihn zu ignorieren) und ein nachfolgender neutraler Stimulus (chinesisches Schriftzeichen) präsentiert, mit der Aufforderung, nur die Valenz des Schriftzeichens (angenehm /unangenehm) zu bewerten. Als traditioneller AMP-Index diente die Differenz der Prozentzahl angenehm Urteile von neutralen und negativen (Krankheitsangstrelevanz) Stimuli. Die Stimulusbedeutung wurde durch einem zweiten Index mit Trials ohne Prime, anstelle neutralem Prime, untersucht. Ergebnisse Es absolvierten 104 Studenten die AMP. Neben einem Haupteffekt des Prime-Typs (eta² = .05, p < .01) zeigte sich, dass die Kombination zweier Krankheitsangstskalen (Behavioral, Kognitiv) und zweier Emotionsregulationsstrategien(Rumination, Katastrophisierung) substantielle und unabhängige Zusammenhänge mit den AMP-Indizes aufwiesen (R² = .16, p < .01). Die Ergebnisse waren unabhängig von Affektivität (PANAS), die als Kontrollvariable fungierte. Der traditionelle AMPIndex wies größtenteils minimal höhere (p > .05), jedoch gleichgerichtete Zusammenhänge auf, zeigte jedoch eine geringere Reliabilität (α = .59 versus α = .75). Diskussion Die größtenteils unbewusste affektive Evaluation und Misattribution krankheitsrelevanter Reize könnte ein Grund für die häufige Entwicklung ruminativer Tendenzen bei krankheitsängstlichen Personen sein. Ferner weist affektive Misattribution direkte Zusammenhänge zu Krankheitsängstlichkeit auf und könnte eines der Kernmerkmale der Störung darstellen. Schlussfolgerungen Die AMP lässt sich auf die Domäne der Krankheitsangst anwenden und ist auch ohne neutrale PrimeKategorie sinnvoll einsetzbar. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von maladaptiven Emotionsregulationsstrategien, die auch in zahlreichen Modellen zur Ätiopathogenese der Hypochondrie eine große Rolle spielen. Eine Replikation der Ergebnisse bei an Hypochondrie Erkrankten wäre wünschenswert. Demnach wäre auch die Prüfung des Therapiefortschritts mittels AMP vielversprechend. B 28 Emotionsregulation und Wahn – Experimentelle Evidenz für Defizite bei der regulativen Neubewertung von bedrohlichen Reizen und sozialer Zurückweisung Stefan Westermann (Philipps-Universität Marburg) Tania M. Lincoln (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Korrelative und experimentelle Befunde weisen auf Defizite bei der Emotionsregulation (ER) bei Wahn hin. Spezifische ER-Strategien wie Neubewertung (reappraisal) oder Unterdrückung des Gefühlsausdrucks (suppression) wurden jedoch bisher bei Wahn nicht erforscht. Die vorliegende Studienreihe überprüft experimentell die Annahmen, dass (1) Neubewertung von Situationen bei erhöhter Wahnneigung aufgrund von kognitiven Biases und bestehender Wahnideen beeinträchtigt ist, während (2) die Unterdrückung des Ausdrucks unbeeinträchtigt ist. Die Fragestellung wurde in zwei unabhängigen, subklinischen Stichproben (N=88, N=116) beleuchtet. In Studie 1 war es die Aufgabe der niedrig und hoch Wahn-anfälligen Versuchspersonen, durch aversive Bilder ausgelöste Angst mithilfe von Neubewertung oder Unterdrückung zu regulieren. In Studie 2 wurde mittels einer virtuellen Ballspielaufgabe untersucht, inwiefern sich soziale Frustration durch Ausgeschlossen-werden in Abhängigkeit von Wahnneigung und habitueller Anwendung der beiden ER-Strategien auf das Auftreten wahnhafter Gedanken auswirkt. Die Wechselwirkung von Wahnneigung und ER-Strategie in Bezug auf den ER-Erfolg war in Studie 1 signifikant (F(2,140)=3.25, p=0.04), was auf ein Defizit bei der Anwendung von Neubewertung bei erhöhter Wahnneigung zurückging (p=0.01). In Studie 2 war wie erwartet ein Anstieg im Wahnerleben bei sozialem Ausschluss zu beobachten, wenn Neubewertung habituell eingesetzt wurde und eine erhöhte Wahnneigung vorlag (F(2,116)=3.08, p=0.05). Die Unterdrückung des Gefühlsausdrucks war in beiden Studien von Wahn unabhängig. Beide Studien deuten auf spezifische Schwierigkeiten bei der Anwendung der Strategie Neubewertung bei Wahn hin. Da diese Strategie in anderen Psychopathologien als adaptiv gilt, stellen die vorliegenden Defizite eine kritische Einschränkung des ER-Repertoires von Patienten mit Wahn dar. Als mögliche zugrundeliegende Mechanismen des Defizits werden bestehende paranoide Überzeugungen, interpersonelle Schemata und kognitive Verzerrungen diskutiert. Zusammenfassend scheint die generell günstige ER-Strategie Neubewertung von Menschen mit Wahnneigung nicht erfolgreich anwendbar zu sein, sodass eine gescheiterte Neubewertung Wahn sogar steigern kann. Für die klinische Praxis kann dies bedeuten, dass ER in individuellen Störungsmodellen berücksichtigt werden sollte und ER-Trainings bei Wahn nützlich sein könnten. B 29 Entwicklung eines klinischen Fragebogens zur Regulation von negativen Affekten Anne Scherer (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Markus Pawelzik (EOS-Klinik Münster) Maren Böcker (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Claus Vögele (INSIDE Research Centre, Université du Luxembourg) Siegfried Gauggel (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Thomas Forkmann (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Abstract: Theoretischer Hintergrund In der klinischen Praxis zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur Emotionsregulation und zum Auftreten von psychischen Störungen. Bislang gibt es allerdings kein Messinstrument, das ein breites und auch klinisch relevantes Spektrum an Emotionsregulationsstrategien erfasst. Mit der Entwicklung des Negative Affect Repair Questionnaire (NARQ) wurde daher das Ziel verfolgt, ein Instrument zu entwickeln, das die gut erforschten kognitiven Emotionsregulationsstrategien „Reappraisal“ und „Suppression“ (Gross & John, 2003) gemeinsam mit einer Skala zu verhaltensbezogenen Emotionsregulationsstrategien erfasst. Methode Insgesamt 684 Studenten (Alter M=23.3, SD=3.5; 53.6% Frauen) und 372 Patienten einer psychotherapeutischen Klinik (KLIN; Alter M=36.0, SD=14.6; 71.2% Frauen) füllten einen Fragebogen mit 55 Items zur Emotionsregulation aus. Die Studentenstichprobe wurde zur Kreuzvalidierung in zwei analoge Hälften geteilt (SST1/SST2). Anhand der drei Stichproben wurden konfirmatorische Faktorenanalysen mit den drei Faktoren „Neuorientierung“, „Gefühlsausdruck“ und „Risikoverhalten“ berechnet. Als Maße für die Modellpassung wurden der Tucker-Lewis-Index (TLI) und der Root-Mean-Square-Error of Approximation (RMSEA) berechnet. Zusätzlich wurde Cronbachs Alpha für alle Subskalen bestimmt. Ergebnisse Für eine Kurzversion mit insgesamt 17 Items lag der TLI für die drei Stichproben SST1, SST2 und KLIN bei .958, .939 und .960. Der RMSEA erzielte Werte von .064, .067 und .076. Der Faktor „Neuorientierung“ erreichte ein Alpha von .722, der Faktor „Gefühlsausdruck“ .794 und der Faktor „Risikoverhalten“ .719. Die Faktorladungen aller Items waren gut. Diskussion Die Faktorenstruktur des NARQ zeigte in allen Stichproben gute Fit-Indices, auch Cronbachs Alpha ist für alle Skalen akzeptabel. Die Kurzversion enthält fünf Items auf den Skalen „Neuorientierung“ und „Gefühlsausdruck“ und sieben auf der Skala „Risikoverhalten“. Schlussfolgerungen Mit dem NARQ liegt ein neues Instrument vor, das einerseits die beiden gut erforschten Emotionsregulationsstrategien „Neuorientierung“ und „Gefühlsausdruck“ mit neuen, verhaltensnahen Itemformulierungen erfasst. Andererseits können mit der neuen Skala „Risikoverhalten“ gleichzeitig besonders im klinischen Kontext problematische Verhaltensweisen zur Emotionsregulation erfasst werden. Dies kann die Einbeziehung dieser Strategien in die klinische Arbeit, etwa durch Objektivierung von Veränderungen erleichtern. B 30 Intrusionen: Die entscheidende Variable in emotionalen Kaskaden und dysreguliertem Verhalten?! Noelle Loch (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Dr. Michael Witthöft (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Prof. Dr. Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: In ihrem Emotional Cascade Model (ECM) postulieren Selby und Kollegen (2008), dass sich Menschen häufig dysregulierten Verhaltenweisen wie Binge Eating, exzessivem Alkoholkonsum oder sozialem Rückversicherungsverhalten „bedienen“, um intensive, unangenehme Gefühlszustände zu beenden. Sie gehen davon aus, dass diese Zustände durch einen sich selbstverstärkenden Teufelskreis aus negativem Affekt, dem dysfuntkionalen Versuch, diesen mit Rumination zu bewältigen und negativen emotionalen Gedanken entstehen und schließlich in dysfunktionale behaviorale Emotionsregulationsversuche resultieren. In einer randomisiert erhobenen Bevölkerungsstichprobe (N = 414) replizierten wir nicht nur das original ECM unter Kontrolle aktueller Depressivität in einem Strukturgleichungsmodellansatz, sondern erweiterten es um Intrusionen als Mediator zwischen Rumination und dysreguliertem Verhalten. Wir konnten das ursprüngliche Modell bestätigen und fanden eine vollständige Mediation von Intrusionen für den Effekt von Rumination auf eine Vielzahl dyregulierten Verhaltensweisen (Alkoholkonsum als Coping, Binge Eating, Ärgerausdruck, soziales und ärztliches Rückversicherungsverhalten und Dringlichkeit/Impulsives Handeln; r: Rumination ~ Behaviorale Dysregulation: .16; r: Rumination ~ Intrusionen: .77; Intrusionen ~ Behaviorale Dysregulation: .68), die alle hoch auf einen Faktor zweiter Ordnung luden (Faktorladungen: .39-.88; p ≤ .001). Diese Effekte blieben auch unter der Kontrolle aktueller Depressivität aussagekräftig und signifikant (r: Rumination ~ Behaviorale Dysregulation: .16; r: Rumination ~ Intrusionen: .37; Intrusionen ~ Behaviorale Dysregulation: .68). Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Emotionale Kaskaden, wie oben beschrieben, nur bzw. besonders dann auftreten, denn sowohl eine Tendenz zu Rumination als auch Intrusionen vorliegen. Rumination reflektiert dabei wie (negativ, wiederholend, unflexibel) Personen denken/kognitiv reagieren, Intrusionen wie viel/worüber sie es tun: Je mehr negative Intrusionen vorliegen, desto intensiver ist der negative Effekt von Rumination und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für behaviorale Dysregulation. Künftige Psychotherapieansätze sollten diese Interaktion besonders bei Störungen, bei denen sowohl Intrusionen als auch Rumination eine zentrale Rolle spielen (z.B. Zwangsstörungen, Generalisierte Angststörungen), berücksichtigen. B 31 Ressourcentagebuch: Verbesserung der Emotionsregulation bei Psychotherapiepatienten. Anne Katrin Risch (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Gabriele Wilz (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Abstract: Einleitung: Seit Pennebakers (1989) Intervention zum expressiven Schreiben (ES), haben zahlreiche Studien die psychologischen und physiologischen Effekte des ES untersucht. Neben einer kurzfristigen Stimmungsverschlechterung, fanden viele Studien positive Langzeiteffekte auf die Stimmung, Lebenszufriedenheit oder die physische Gesundheit. Wortanalysen führten zu der Idee, dass auch das Schreiben über positive Aspekte des Lebens günstige Effekte auf Stimmung, Lebenszufriedenheit, Glückempfindens haben und eine Reduktion depressiver Symptome bewirken könnte. Obwohl positives Schreiben viel versprechende Effekte bei gesunden und subklinisch depressiven Personengruppen zeigte, gibt es keine Studie an Patienten mit diagnostizierten psychischen Störungen. Das Ziel unserer Pilotstudie war es daher, die Effekte eines Ressourcentagebuchs auf die Stimmung, die Emotionsregulation und die Ressourcenrealisierung bei einer Gruppe von Psychotherapiepatienten zu untersuchen. Methode: Im Anschluss an eine stationäre psychotherapeutische Behandlung wurden N = 41 Patienten mit den Primärdiagnosen Depression (58%), Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion (35%) oder Somatisierungsstörung (7%) randomisiert entweder der Interventionsbedingung (Ressourcentagebuch; N = 21) oder der Kontrollgruppe (nur Diagnostik, keine Schreibintervention; N = 20) zugeordnet. Die Interventionsgruppe schrieb über vier Wochen, drei Tage pro Woche für ca. 20 Minuten, zu spezifischen ressourcenaktivierenden Fragen (z.B. Momente des Glücks in der letzten Woche). Präund Postmessungen fanden in beiden Gruppen mit einem Abstand von fünf Wochen statt. Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Stimmungsverbesserung nach jeder Schreibsitzung. Zudem verbesserten vier Wochen positiven Schreibens im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant den Gebrauch der adaptive Emotionsregulationsstrategie „Neubewertung“ und den Umgang mit täglichen Belastungen. Diskussion/Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Pilotstudie weisen darauf hin, dass das Schreiben eines Ressourcentagebuchs im Anschluss an eine psychotherapeutische Behandlung eine effektive Intervention zur Verbesserung der Stimmung, der Emotionsregulation und des Umgangs mit täglichen Belastungen darstellen könnte. Die meisten Patienten der Pilotstudie wiesen eine depressive Symptomatik auf. Daher, sowie aufgrund der einfachen und ökonomischen Durchführbarkeit der Schreibintervention sollten künftige Studien die Schreibintervention auch B 32 Adipositas im Kindes- und Jugendalter: Welche Rolle spielt die mütterliche Steuerung? Katja Kröller (Universität Potsdam) Annekatrin Hudjetz (Universität Potsdam; Department Psychologie) Ivonne Döring (Universität Potsdam; Department Psychologie) Petra Warschburger (Institut Beratungspsychologie Potsdam) Abstract: Fragestellung: Empirische Untersuchungen konnten zeigen, dass die elterliche Steuerung in der Essenssituation Einfluss auf die kindliche Ernährung und die Entwicklung von Übergewicht hat. Während sich für jüngere Kinder insbesondere ein restriktives und belohnendes Verhalten der Eltern als problematisch erwiesen hat, ist der elterliche Einfluss auf die Ernährung älterer und bereits übergewichtiger noch weitgehend unklar. Zielstellung war die dementsprechende Untersuchung dieses Zusammenhangs. Methodik: Die Daten sind Teil einer laufenden RCT-Längsschnittstudie (EPOC). Zu Beginn einer stationären Rehabilitationsmaßnahme konnten bislang die Daten von 449 Müttern mit adipösen Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren gewonnen werden. Die Kinder wurden bei ihrer Ankunft gemessen und gewogen. Des Weiteren gaben die Mütter Auskunft über ihr Steuerungsverhalten in der Essenssituation (ISS) und schätzten ebenso wie die Kinder selbst die Ernährungsgewohnheiten ihrer Kinder ein (FFQ). Ergebnisse: Im Vergleich zu den Müttern einer normalgewichtigen Stichprobe gaben die Mütter adipöser Kinder an, ihre Kinder häufiger restriktiv und weniger eigenverantwortlich zu steuern. Ein Strukturgleichungsmodell zum Zusammenhang zwischen mütterlicher Steuerung und kindlicher Ernährung unter Berücksichtigung gewichtsbezogener und demographischer Faktoren zeigt, dass sowohl ein restriktiver wie auch ein eigenverantwortlicher Steuerungsstil positiv mit dem kindlichen Verzehr problematischer Lebensmittel assoziiert ist. Das mütterliche Vorbildverhalten sowie der seltene Einsatz von Essen als Belohnung stehen dagegen mit einem erhöhten kindlichen Verzehr gesunder Lebensmittel in Zusammenhang. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse unterstreichen, dass die mütterliche Steuerung auch bei bereits schulpflichtigen Kindern noch Einfluss auf deren Ernährung hat. Ein Vergleich zu Müttern normalgewichtiger Kinder zeigt weiterhin, dass Mütter adipöser Kinder jedoch zu eher problematischen Strategien, wie dem Verbot von Lebensmitteln, greifen. Daher ist es dringend geboten, Eltern über die Wirkung ihrer Steuerungsstrategien aufzuklären sowie angemessene Strategien zu vermitteln. B 33 Akzeptanz und Wirksamkeit des Triple P-Gruppentrainings in einer deutschen Kinder- und Jugendpsychiarie Ann-Katrin Job (Technische Universität Braunschweig) Dr. Wolfgang Briegel (Kinder- und Jugendpsychiatrie des Leopoldina Krankenhauses Schweinfurt ) Prof. Dr. Kurt Hahlweg (Technische Universität Braunschweig, Institut für Psychologie) Abstract: Zahlreiche internationale Studien haben gezeigt, dass das Gruppentraining des Triple P (Positive Parenting Program) einen signifikanten Einfluss auf die elterliche Erziehungskompetenz sowie auf die Reduktion kindlicher Verhaltensprobleme hat. Es existieren Belege für die Wirksamkeit des Elterntrainings im Rahmen von universeller, selektiver und indizierter Prävention. Ob das Training auch bei Eltern, deren Kinder an einer psychischen Störung leiden und in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt werden, effektiv eingesetzt werden kann, wurde bisher nicht ausreichend untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Akzeptanz und der Effektivität des Triple P-Gruppentrainings als elternzentrierte Maßnahme in einer deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Insgesamt nahmen 40 Familien – 40 Mütter und 13 Väter – an der Studie teil. Von den Kindern wurden zu Beginn des Kurses 23 ambulant, 14 tagesklinisch und vier vollstationär behandelt. Ihre primären Diagnosen waren eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung bzw. eine Störung des Sozialverhaltens. Direkt nach der Intervention, sowie sechs Monate später berichteten sowohl die Mütter als auch die Väter von einer signifikanten Reduktion dysfunktionaler Erziehungsstrategien (Intra-Gruppen-Effektstärke (ES) = 1,15 für Mütter und ES = 0,74 für Väter) und einer Erhöhung der elterlichen Erziehungskompetenz (ES = 0.74/1.11). Weiterhin gaben sie weniger Konflikte mit ihrem Partner bezüglich ihrer Elternschaft an (ES = 1.03/0.80). In Bezug auf ihr Kind berichteten beide von einer signifikanten Reduktion internalisierender (ES = 0.74/1.09) und externalisierender Verhaltensstörungen (ES = 0.89/0.91), als auch von Verhaltensauffälligkeiten insgesamt (ES = 0.93/1.15). Im Hinblick auf die Akzeptanz des Elterntrainings waren die Bewertungen vergleichbar mit den Ergebnissen früherer Präventionsstudien. Diskutiert werden die Ergebnisse im Hinblick auf ihre Grenzen und Konsequenzen für die klinische Arbeit und weitere Forschung. B 34 Exposition als Therapie der Wahl? Schmerzexposition bei Kindern mit chronischen Schmerzen Tanja Hechler (Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke) Michael Dobe (Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke) Uta Damschen (Vest) Markus Blankenburg (Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke) Sandra Schroeder (Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke) Joachim Kosfelder (Fachhochschule Düsseldorf) Boris Zernikow (Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke) Abstract: Kinder mit schwer beeinträchtigenden chronischen Schmerzen leiden sowohl unter generellen als auch unter schmerzspezifischen Ängsten. Während im Erwachsenenbereich Expositionsstrategien bei Patienten mit muskuloskeletalen Schmerzen etabliert sind, werden expositionsbasierte Therapien bei Kindern selten eingesetzt. Zudem mangelt es an Studien, die die Wirksamkeit dieser Therapien bei Kindern untersucht haben. Die Schmerzprovokation (eine Exposition in sensu, während derer sich die Kinder eine Steigerung ihrer Schmerzen vorstellen) stellt eine erste expositionsbasierte Therapiestrategie dar. Sie ist eine adjunktive Therapie i.R. der multimodalen stationären Schmerztherapie. Im vorliegenden Beitrag wird die Schmerzprovokation detailliert erläutert. Zudem werden erste Ergebnisse zur Wirksamkeit der Schmerzprovokation, die i.R. einer gematchten FallKontroll-Studie gewonnen wurden, präsentiert. Ziel des Beitrags ist es, expositionsbasierte Strategien für chronisch schmerzkranke Kinder auf der Basis der Gemeinsamkeiten zwischen chronischem Schmerz und Ängsten kritisch zu beleuchten. B 35 Gemeinsamkeiten und Unterschiede mütterlicher, väterlicher und kindlicher Ernährung und Bewegung Annekatrin Hudjetz (Universität Potsdam; Department Psychologie) Petra Warschburger (Universität Potsdam; Department Psychologie) Abstract: Fragestellung Eine ausgewogene Ernährung und ein gesundes Ausmaß an Bewegung sind die Hauptsäulen jeder Adipositas-Therapie. Gerade bei der kindlichen Adipositas ist hierbei auch das Vorbildverhalten der Eltern entscheidend. Inwieweit es tatsächlich Gemeinsamkeiten zwischen mütterlichem, väterlichem und kindlichem Ernährungs- und Bewegungsverhalten gibt, soll in vorliegender Studie betrachtet werden. Zudem werden potentielle Moderatorvariablen auf ihre Wirkung hin analysiert. Methodik Als Teil einer laufenden RCT-Längsschnittstudie (EPOC) wurden bislang 179 Eltern-Kind-Triaden zu ihren Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten befragt. Des Weiteren machten die 7- bis 13jährigen Kinder Angaben zu der Qualität der Beziehung zu Mutter und Vater, während die Eltern zusätzlich Fragen zu der gemeinsam verbrachten Zeit und der Ähnlichkeit mit ihrem Kind beantworteten. Die Befragung fand als Fragebogenstudie vor Beginn einer stationären Rehabilitation statt. Ergebnisse Es lassen sich Zusammenhänge sowohl zwischen Kind und Mutter als auch zwischen Kind und Vater hinsichtlich des Konsums problematischer und gesunder Nahrungsmittel finden. Im Bewegungsbereich fallen die Gemeinsamkeiten vergleichsweise geringer aus. Je mehr Zeit Eltern mit ihrem Kind verbringen, desto größer sind auch die Zusammenhänge zwischen der kindlichen und elterlichen Ernährung resp. Bewegung, wobei diese Beziehung zusätzlich durch die gemeinsam verbrachte Zeit und die wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen Kind und Elternteil beeinflusst wird. Die kindliche problematische sowie gesunde Ernährung lässt sich durch mütterliche und väterliche Ernährung sowie soziodemographische Angaben regressionsanalytisch vorhersagen. Schlussfolgerung Eltern und Kinder haben zu einem großen Teil sehr ähnliche Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. Aufgrund der querschnittlichen Analyse können noch keine Kausal- Aussagen getroffen werden, jedoch liegt eine Interpretation im Sinne einer Einflussnahme der Eltern auf ihre Kinder zumindest nahe. Bei der anstehenden Betrachtung der 6-Monats-Katamnese soll die Richtung der Effekte empirisch überprüft werden. Zusammenfassend lassen die Übereinstimmungen die Schlussfolgerung zu, dass sowohl Mütter als auch Väter verstärkt in die Veränderung der kindlichen Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten einbezogen werden sollten. B 36 Liebend gern erziehen. Die Effektivität einer Vortragsreihe über Positive Erziehung für Eltern. Tanja Zimmermann (Technische Universität Braunschweig) Abstract: Theoretischer Hintergrund. Obwohl ca. 30% der Eltern von emotionalen oder Verhaltensproblemen ihrer Kinder berichten, nehmen nur wenige psychotherapeutische Hilfe oder Elternberatung in Anspruch. Ein Grund könnte darin liegen, dass die Schwelle für die Teilnahme an Erziehungsangeboten wie z.B. Elternkursen zu hoch ist. Das Triple P Programm als Public Health Ansatz konzentriert sich darauf, Eltern ein Unterstützungssystem für Erziehung auf mehreren Ebenen zu bieten, welches in unterschiedlichen Settings zugänglich gemacht wird, wie z.B. im Rahmen einer Vortragsreihe. Methode. Im Rahmen einer Effectiveness-Studie nahmen N = 183 Eltern an der Triple P Vortragsreihe teil. Die Vortragsreihe ist eine Serie von drei 90minütigen Vorträgen über Positive Erziehung für Gruppen von Eltern mit Kindern bis ca. 12 Jahre. Die Vorträge geben interessierten Eltern eine Einführung in die Prinzipien der Positiven Erziehung (selektive Prävention). Eltern lernen, wie sie diese nutzen können, um ihre Kinder dabei zu unterstützen, wichtige Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben und wie es ihnen gelingt, deren Gesundheit, Entwicklung und Wohlbefinden in optimaler Weise zu fördern. Eltern füllten sowohl vor als auch nach der Vortragsreihe eine Reihe von Fragebögen zu kindlichem Verhalten, Erziehung und elterlichem Stress sowie partnerschaftlicher Zufriedenheit aus. Ergebnisse. Teilnehmende Eltern berichten nach der Vortragsreihe über weniger emotionale und Verhaltensprobleme ihrer Kinder, weniger dysfunktionales Erziehungsverhalten, weniger Depression und Stress und eine Verbesserung der partnerschaftlichen Zufriedenheit. Zudem zeigte sich eine hohe Zufriedenheit der Eltern mit den Inhalten und dem Format der Vortragsreihe. Diskussion. Die Vortragsreihe ist somit eine effektive Interventionsvariante, um kindliches Problemverhalten zu reduzieren und die elterliche Erziehungskompetenz zu stärken. Schlussfolgerungen. Die Vortragsreihe ist eine kosteneffektive Maßnahme, Eltern in ihrer Erziehung zu unterstützen und aufgrund der breiten Erreichbarkeit einer Vielzahl von Eltern zugänglich zu machen. B 37 Mütterliche Lebensqualität – Einflussfaktoren und Auswirkungen Petra Warschburger (Universität Potsdam) Ivonne Döring (Universität Potsdam; Department Psychologie) Annekatrin Hudjetz (Universität Potsdam; Department Psychologie) Katja Kröller (Universität Potsdam; Department Psychologie) Abstract: Fragestellung Eltern sind die zentralen Ansprechpartner, um langfristig eine gesunde Ernährung und Bewegung im kindlichen Alltag zu gewährleisten. Ziel der Analyse war es, die psychosozialen Einflüsse auf das Ausmaß mütterlicher Unterstützung zu untersuchen und dabei auch die Lebensqualität der Mütter ins Blickfeld zu rücken. Methodik Im Rahmen einer laufenden RCT-Längsschnittstudie (EPOC) zur Wirksamkeit eines Elterntrainings wurden 449 Mütter, deren 7-13jähriges Kind wegen Adipositas in einer Rehaklinik behandelt wurde, befragt. Die Kinder wurden bei Ihrer Ankunft gemessen und gewogen. Die Mütter füllten ein Fragebogenpaket aus, das u.a. Angaben zur Lebensqualität (KID-KINDL) und Verhaltensauffälligkeiten (SDQ) des Kindes sowie zur ihrer Lebensqualität (SF12), ihrem Selbstwirksamkeitserleben (SWE-ADI-E) und der Unterstützung des Kindes (selbstkonstruiert) umfasste. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen. Ergebnisse Sowohl der Familienstand der Mutter als auch ihr Gewichtsstatus beeinflusst ihre Lebensqualität. Eine zentralere Rolle spielt aber die Einschätzung der kindlichen Lebensqualität: eine höhere kindliche Lebensqualität geht auch mit einer höheren mütterlichen Lebensqualität einher. Weitere Ergebnisse zeigen, dass die Lebensqualität der Mutter mit einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung sowie einer vermehrten Unterstützung ihres Kindes assoziiert ist. Schlussfolgerung Unsere Ergebnisse zeigen, dass die mütterliche Unterstützung vor allem von ihrer eigenen psychischen Befindlichkeit abhängt. Elterntrainings sollten daher auch die psychosoziale Befindlichkeit der Mütter mit berücksichtigen, um eine angemessene Unterstützung der Kinder zu erzielen. B 38 Zusammenhänge zwischen elterlicher Erziehungskontrolle und Verhaltensauffälligkeiten bzw. Delinquenz bei Schülern Julia Lotz (Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Johann Haffner (Kinder- und Jugendpsychiatrie Universitätsklinikum Heidelberg) Eva Vonderlin (Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Peter Parzer (Kinder- und Jugendpsychiatrie Universitätsklinikum Heidelberg) Franz Resch (Kinder- und Jugendpsychiatrie Universitätsklinikum Heidelberg) Abstract: Theoretischer Hintergrund Externale Verhaltensstörungen treten im Kindes- und Jugendalter häufig auf (10-18%). Früh auffällige Kinder haben ein besonderes Risiko für problematische Entwicklungsverläufe, aggressives und gewalttätiges Verhalten setzt sich oft bis ins Erwachsenenalter fort. Erziehungseinstellungen beeinflussen die Entwicklung von Verhaltensstörungen und Delinquenz. In dieser Studie werden differenzielle Zusammenhänge zwischen Erziehungskontrolle und oppositionellem Verhalten, Hyperaktivität, Gewalthäufigkeit und delinquentem Verhalten untersucht. Methode 299 Schülerinnen und Schüler (10-14 Jahre) aus Heidelberger Haupt- und Realschulen, sowie deren Eltern erhielten den Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-D). Die Festlegung der Cut-offWerte für Verhaltensauffälligkeiten erfolgte nach Goodman. Kindliche Gewalthäufigkeit wurde im Selbstbericht durch zwei zusätzliche Items, Delinquenz durch fünf Items der Self-Reported Delinquency Scale erhoben. Sieben Fragen dienten der Erfassung elterlicher Kontrolle (Monitoring, klare Regeln, Konsequenzen bei Regelverstoß, mindestens eine tägliche gemeinsame Mahlzeit, unbeaufsichtigte Zeit alleine zu Hause, Kontrolle der Fernsehinhalte). Die Auswertung erfolgte mittels schrittweiser Regression. Ergebnisse Bei über 20% der Schüler/innen werden aus Schüler- und Elternsicht Verhaltensaufälligkeiten berichtet. Elterliche und kindliche Urteile unterscheiden sich erheblich. Die folgenden Zusammenhänge bestehen aus Eltern- und Kindsicht, sind jedoch höher bei ausschließlicher Verwendung von Schülerdaten. Höhere elterliche Kontrolle ist mit weniger Verhaltensproblemen, Hyperaktivität, Gewalt und Delinquenz der Kinder assoziiert. Kindliche Verhaltensmerkmale werden am besten durch das elterliche Monitoring vorhergesagt. Für Verhaltensprobleme zeigt sich die größte Varianzaufklärung, für Gewalthäufigkeit die geringste. Diskussion An Haupt- und Realschulen finden sich vermehrt Verhaltensaufälligkeiten und Delinquenz. Prävalenzraten und prognostische Güte sind abhängig von der Datenquelle. Elterliches Monitoring scheint einen wesentlichen Einfluss auf Verhaltensstörungen zu haben. Schlussfolgerungen: Zur Früherfassung von externalem Problemverhalten und familiären Risikofaktoren eignen sich Screeningverfahren. Die Eltern sollten in Prävention und Frühintervention kindlicher Verhaltensstörungen einbezogen werden, die Erhöhung des Monitorings ist wichtigstes Interventionsziel. B 39 Prädiktion des Behandlungserfolgs von Somatoformen Störungen Robert Mestel (HELIOS Klinik Bad Grönenbach) Benjamin Stahl (Universität Koblenz-Landau) Jens Heider (Universität Koblenz-Landau) Annette Schröder (Universität Koblenz-Landau) Jochen von Wahlert (HELIOS Klinik Bad Grönenbach) Abstract: Hintergrund Somatoforme Störungen sind für betroffene Patienten eine schwere Belastung und verursachen enorme Gesundheitskosten. Dennoch ist das Störungsbild angesichts seiner Relevanz relativ wenig beforscht, vor allem in Bezug auf tiefenpsychologische stationäre Behandlung liegen wenig Befunde vor. In der vorliegenden Arbeit wird der Therapieerfolg von Patienten mit der Diagnose einer somatoformen Störung untersucht, mit dem Ziel der Identifikation von relevanten patientenseitigen Prädiktoren. Fragestellung: Das Anliegen dieser Untersuchung war, den Einfluss der möglichen Prädiktoren Bindungsstil, komorbide Persönlichkeitsstörungen, Symptomschwere, Symptomdauer, Bildung, Alter und Geschlecht auf den Behandlungserfolg zu überprüfen. Methode N=1343 stationär behandelte Patienten einer psychosomatischen Rehaklinik mit integrativem vorwiegend psychodynamisch-humanistischem Konzept mit einer somatoformen Störung als Hauptoder Nebendiagnose wurden in dieser längsschnittlichen Post-Hoc-Analyse mit zwei Messzeitpunkten zu Beginn (Prä-Messung) und am Ende (Postmessung) ihres Klinikaufenthalts mit der SymptomCheckliste-90-R, der Somatisierungsskala der SCL und dem Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (VEV) untersucht. Der Einfluss der genannten Prädiktoren auf diese drei Indikatoren des Therapieerfolgs wurde einzeln überprüft und hinsichtlich der statistischen Signifikanz und der Effektstärken bewertet. Ergebnisse Der Bindungsstil, das Vorliegen einer komorbiden Persönlichkeitsstörung und die Symptomschwere konnten als Prädiktoren mit kleinen bis mittleren Effekten bestätigt werden, die Symptomdauer wider Erwarten nicht. Für die Faktoren Bildung, Alter und Geschlecht wurde vorhergesagt, dass kein Einfluss besteht. Das Alter hatte entgegen der Hypothese einen - allerdings sehr geringen - Einfluss, während Bildung und Geschlecht als Prädiktoren hypothesenkonform verworfen werden konnten. Diskussion Der Befund, dass die Symptomdauer der somatoformen Beschwerden keinen Einfluss zeigt, könnte durch die zu unreliable Messung im Sinne eines klinischen Alltagsratings erklärt werden. Ein großes Interpretationsproblem stellt die Konfundierung der somatoformen Störung mit schwerwiegenden Diagnosen (z. B. Borderline Störung) dar, was z. B. erklärt, warum jüngere Patienten schlechtere Therapieerfolge, gemessen mit Post-Test-Massen wie dem VEV-K erreichen. B 40 Screening Somatoformer Beschwerden (SOMS): Eine Beleuchtung veränderungsdiagnostischer Aspekte Richard Göllner (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Jens Heider (Universität Koblenz-Landau) Annette Schröder (Universität Koblenz-Landau) Abstract: Somatoforme Beschwerden, d.h. Körperbeschwerden, die nicht vollständig durch organische oder pathophysiologische Faktoren erklärt werden können, gleichzeitig aber zu einem bedeutsamen Leiden oder einer Beeinträchtigung in wichtigen Bereichen des alltäglichen Lebens führen, gehören, neben Angst-, Sucht- und affektiven Störungen, zu den häufigsten psychischen Störungen und sind zudem aus sozialökonomischer Sicht von großer Bedeutung. Die Veränderungsmessung somatoformer Beschwerden erfolgt im deutschen Sprachraum häufig mittels des Screening für Somatoforme Störungen (SOMS, Rief et al., 1997). Dieses enthält alle 53 körperlichen Symptome, die für die Diagnostik der Somatisierungsstörung nach DSM-IV und ICD-10 sowie für die somatoforme autonome Funktionsstörung des ICD-10 relevant sind. Bisher weitgehend unklar ist jedoch, inwieweit der SOMS einem ökonomischen und veränderungssensitiven Instrumente zur Evaluation von Therapieeffekten in der klinischen Forschung und Praxis entspricht. Ziel des Beitrages ist es daher, die Item- und Skaleneigenschaften des SOMS zu überprüfen. Grundlage der Analysen sind Daten aus einer Psychotherapieambulanz (n = 1219) sowie einer randomisierten Kontrollgruppenstudie (n = 135) (REF). Vor dem Hintergrund psychometrisch fundierter Kriterien der Veränderungsdiagnostik wird eine Kurzfassung validiert und diskutiert. B 41 Lebensziele und Subjektives Wohlbefinden. Ein Vergleich zwischen onkologischen und neurologischen Patienten in der Rehabilitation Pia von Blanckenburg (Philipps-Universität Marburg) Martina Bodenbenner (Philipps-Universität Marburg) Nico Conrad (Philipps-Universität Marburg) Ulf Seifart (Rehabilitationsklinik Sonnenblick, Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Cornelia Exner (Philipps-Universität Marburg) Abstract: 1. Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Durch schwerwiegende Krankheiten wie Krebs oder erworbene Hirnschädigungen können Lebensziele und Lebenskonzepte von Patienten grundlegend erschüttert werden. Der Einbezug von individuellen Lebenszielen in die Psychotherapie hat relevante positive Auswirkungen auf die Therapiemotivation. In dieser Studie werden onkologische und neurologische Patienten in der Rehabilitation hinsichtlich der Wichtigkeit von Lebenszielen, dem Erfolg im Erreichen dieser Ziele und den Diskrepanzen zwischen Wichtigkeit und Erfolg verglichen. Außerdem wird untersucht, inwieweit sich die Lebenszieldiskrepanzen bei beiden Patientengruppen als Prädiktoren des subjektiven Wohlbefindens auswirken und welchen Lebenszielbereichen hier die größte Bedeutung zukommt. 2. Methode In einer querschnittlichen Fragebogenuntersuchung wurden 130 Patienten in vier neuropsychologischen Rehabilitationseinrichtungen sowie 64 Patienten in einer onkologischen Rehabilitationsklinik zu ihrem subjektiven Wohlbefinden und sechs verschiedenen Lebenszielen befragt. 3. Ergebnisse Onkologische Patienten schätzen die Lebensziele Macht und Leistung als weniger wichtig ein als Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen und sehen sich weniger erfolgreich im Bereich Leistung. Die wahrgenommenen Diskrepanzen sind bei beiden Patientengruppen in allen Lebenszielbereichen größer als in der gesunden Normstichprobe, zwischen den Patientengruppen zeigen sich keine Unterschiede. Bei beiden Patientengruppen zeigt sich die allgemeine Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Erfolg in den Lebenszielen als Prädiktor für das subjektive Wohlbefinden. Dabei stellt die Diskrepanz in dem Lebenszielbereich „Intimität“ den einflussreichsten Prädiktor dar. 4. Diskussion Insgesamt ähneln sich Patientengruppen in der onkologischen und neuropsychologischen Rehabilitation hinsichtlich Wichtigkeit, Erfolg und deren Diskrepanzen in den Lebenszielen. Psychotherapeutische Interventionen sollten die Bearbeitung von Lebenszielen integrieren um das subjektive Wohlbefinden zu erhöhen. Eine Verringerung der Lebenszieldiskrepanzen könnte nach dem dualen Prozessmodell durch eine assimilative oder durch eine akkomodative Strategie erfolgen. 5. Schlussfolgerungen Schwerwiegende Krankheiten wie Krebs und Hirnschädigungen scheinen sich auf Lebenszieldiskrepanzen ähnlich auszuwirken und diese in beiden Fällen einen negativen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden auszuüben. B 42 Umgang mit störungsspezifischen Gedanken bei Körperdysmorpher Störung im Vergleich zu Essstörungen Ines Kollei (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) Alexandra Martin (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung: Psychotherapieforschung) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Belastende und schwer zu kontrollierende Gedanken spielen sowohl bei der Körperdysmorphen Störung (KDS) als auch bei den Essstörungen eine wichtige Rolle. Bislang gibt es zwei Studien, die die KDS mit den Essstörungen vergleichen (Rosen & Ramirez, 1998; Hrabosky et al., 2009). In diesen Studien wurden vorwiegend Körperbildaspekte untersucht. Ziel unserer Studie ist es, KDS und Essstörungen auch hinsichtlich kognitiver Produkte und Prozesse zu untersuchen. Methode: Es wurden 4 Vergleichsgruppen befragt (KDS n=29, Anorexia Nervosa n=28, Bulimia Nervosa n=28 und eine gesunde Kontrollgruppe n=27). Zur Diagnosestellung wurden die SKID-Module für KDS und Essstörungen, sowie das Mini-Dips eingesetzt. Anhand der „Yale Brown Obsessive Compulsive Scale“ (YBOCS) modifiziert für KDS und Essstörungen wurde der Schweregrad störungsspezifischer Gedanken erfragt. Mit dem „Thought Control QuestionnaireRevised“ (TCQ-R) wurde der Umgang mit belastenden Gedanken erhoben. Ergebnisse: Hinsichtlich des Schweregrads der störungsspezifischen Gedanken (z.B. Dauer, Belastung, Beeinträchtigung) zeigten sich keine Unterschiede zwischen KDS und Essstörungen. Im Umgang mit den belastenden Gedanken zeigte sich, dass Patienten mit einer Essstörung häufiger von bestrafenden Strategien Gebrauch machten. Patienten mit einer KDS dagegen lenkten sich von belastenden Gedanken weniger häufig ab und leisteten weniger Widerstand. Im Vergleich der klinischen Gruppen mit der gesunden Kontrollgruppe zeigten sich keine Unterschiede im Gebrauch von funktionalen Strategien (z.B. „reappraisal“), die klinischen Gruppen setzten jedoch häufiger dysfunktionale Strategien (z.B. „worry“, „confrontation“) ein. Diskussion: Der Vergleich zwischen KDS und Essstörungen verweist auf einen ähnlichen Schweregrad belastender, wenig kontrollierbarer Gedanken. Zudem findet sich bei KDS und Essstörungen ein großteils ähnlicher Umgang mit diesen Gedanken. Eine geringere Ausprägung des Widerstands gegenüber belastenden Gedanken bei KDS spricht für eine stärkere Beeinträchtigung in diesem Bereich. Schlussfolgerung: Sowohl Patienten mit einer KDS als auch mit einer Essstörung beschäftigen sich oft mehrere Stunden täglich mit belastenden, schwer kontrollierbaren Gedanken. Therapeutisch sollte vor allem Wert auf einen Abbau dysfunktionaler Strategien im Umgang mit diesen Gedanken gelegt werden. B 43 Vergleich subjektiver Krankheitsannahmen von Patienten mit und ohne somatoforme Störung Natalie Steinbrecher (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: In der primärärztlichen Versorgung stellen somatoforme Störungen die häufigste psychische Störung dar. Diese Patientengruppe wird nicht zuletzt aufgrund des Festhaltens am organischen Krankheitskonzept in ihrer Behandlung als schwierig angesehen. In der Forschungsliteratur konnte diese Aussage bislang nicht eindeutig belegt werden. Diese Studie widmet sich der Frage, inwiefern somatoforme Patienten andersartige Krankheitsannahmen und – attributionen im Vergleich zu anderen Patienten aufweisen. Methode: Es wurden die subjektiven Krankheitsannahmen von 85 Hausarzt-Patienten mit somatoformer Störung mit denen von 199 Patienten ohne somatoforme Diagnose unter der Kontrolle von Geschlecht, Alter, Symptombelastung (PHQ-15) und komorbider affektiver oder Angststörung verglichen. Psychische Störungen wurden mittels Internationaler Diagnose Checklisten (IDCL), die subjektiven Krankheitsannahmen und -attributionen mittels Brief Illness Perception Questionnaire (IPQ) und Subjektivem Krankheitskonzept erfasst. Ergebnisse: Es konnten keine Unterschiede hinsichtlich der Krankheitsattributionen zwischen beiden Gruppen gefunden werden. Sowohl Patienten mit als auch ohne eine somatoforme Störung machten insbesondere die psychologischen Faktoren (M=10,6; F=0,001, n.s.) gefolgt von organischen Ursachen (M=7,8; F=0,9; n.s.), Stress (M=7,5; F=0,75; n.s.) und Vulnerabilität (M=6,02; F=0,11; n.s.) für ihre Erkrankung verantwortlich. Allerdings nahmen somatoforme Patienten ihre Erkrankung im IPQ als bedrohlicher war: sie erlebten die Konsequenzen ihrer Erkrankung als beeinträchtigender (T=6,8; p≤0,001) und machten sich mehr Sorgen darüber (T=5,2; p≤0,001). Diskussion: Konträr zu bisherigen Forschungsergebnissen konnte wir keinen Anhalt für höhere organische Attribution körperlicher Beschwerden finden. Somatoforme Pat. machen zum größten Teil psychologische Faktoren für die Entstehung der Krankheit verantwortlich. Ihre Sicht ist nicht ausschließlich auf psychologische oder organische Verursachung eingeschränkt, sondern berücksichtigt auch andere Faktoren. Damit ziehen somatoforme Pat. – nicht anders als Pat. ohne somatoforme Diagnose – ein multikausales Erklärungsmodell heran. Trotz dieser Ähnlichkeit weisen somatoforme Pat. stärkere Beeinträchtigungswerte sowohl auf behavioralen als auch emotionalkognitiven Ebene auf. Schlussfolgerungen: Somatoforme Patienten verfügen über ein multidimensionales Krankheitskonzept. B 44 BRIA: Brückenintervention in der Anästhesiologie - Erste Ergebnisse zur Behandlung von operativen Patienten mit psychischen Beschwerden Léonie F. Lange (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Claudia Spies (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Edith Weiss-Gerlach (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Tim Neumann (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Sascha Tafelski (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Maria Lößner (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Jakob Hein (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Universitätsmedizin Berlin) Nina Seiferth (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Universitätsmedizin Berlin) Andreas Heinz (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Universitätsmedizin Berlin) Heide Glaesmer (Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie) Elmar Brähler (Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie) Henning Krampe (Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) Abstract: Hintergrund: Obwohl die Prävalenz komorbider psychischer Störungen bei operativen Patienten sehr hoch ist, werden diese Störungen im klinischen Alltag oft weder erfasst, noch wird den Patienten ein Behandlungsangebot gemacht. BRIA, die Brückenintervention in der Anästhesiologie, soll diese Lücken im Versorgungssystem schließen. Methode: BRIA besteht aus 2 Teilen: Einem computergestützten psychiatrischen Screening und der psychotherapeutischen Intervention. (1) Das Screening wird allen Patienten, die in den Anästhesieambulanzen der Klinik für Anästhesiologie- Charité Universitätsmedizin Berlin ihr Prämedikationsgespräch erhalten, angeboten. Das Screening setzt sich aus standardisierten und normierten Fragebögen zusammen. Nach dem Screening erhält jeder Patient eine auf ihn zugeschnittene, automatisch generierte, schriftliche Rückmeldung über seine Ergebnisse. (2) Zudem erhalten alle Patienten das Angebot psychotherapeutischer Gespräche. Ziele dieser Intervention sind psychische Entlastung und Vermittlung in bestehende Therapie-Netzwerke. Ergebnisse: Von den 4568 in die Studie eingeschlossenen Patienten zeigten 58,4% eine behandlungsrelevante Belastung. 21,2% hatten sowohl psychische als auch Suchtprobleme, 19,7% hatten ausschließlich Suchtprobleme und 24,9% hatten ausschließlich psychische Probleme. 26% der psychisch belasteten Patienten äußerten einen Wunsch nach psychotherapeutischen Gesprächen. Insgesamt nahmen 144 Patienten längere Therapiekontakte in Anspruch. Die häufigsten Störungen waren Depressionen, Anpassungsstörungen und Suchtkrankheiten. 37,5% Patienten wurden erfolgreich in bestehende Therapie-Netzwerke vermittelt, 36,8% Patienten wiesen am Ende der Therapie verbessertes Befinden auf und 7,6% machten ihre bestehende Therapie weiter. Diskussion: Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein großer Anteil der Patienten in den Anästhesieambulanzen psychisch belastet ist und viele Patienten erfolgreich therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass BRIA eine effiziente Schnittstelle zwischen Anästhesiologie und psychosozialen Netzwerken bilden kann. B 45 Der Effekt von Ängstlichkeit auf die kardiovaskuläre Stressreaktivität während der Schwangerschaft Pearl Ghaemmaghami (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Sara Dainese (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Roberto La Marca (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Andrea Kündig (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Roland Zimmermann (Klinik für Geburtshilfe, Universitätsspital Zürich) Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Abstract: Übermässiger Stress während der Schwangerschaft gilt als ein Risikofaktor für die psychische und physische Gesundheit der Mutter und die Entwicklung des Kindes vor und nach der Geburt. Medizinische Untersuchungen während der Schwangerschaft, wie zum Beispiel die Durchführung einer Fruchtwasserpunktion, werden meist als stressvoll erlebt. Nicht selten empfinden die schwangeren Frauen erhöhte Angst und Ungewissheit bezüglich des Wohlergehens ihres ungeborenen Kindes und auch Angst vor den Schmerzen durch die Punktion. Die Reaktionen auf die Fruchtwasserpunktion können somit auch als Indikator für die generelle Stressreaktivität während der Schwangerschaft betrachtet werden. Das Ziel der vorliegenden Studie war, die mütterliche kardiovaskuläre Stressreaktion auf eine Fruchtwasserpunktion und den Einfluss von allgemeiner Ängstlichkeit zu untersuchen. Bei 36 gesunden, schwangeren Frauen (Alter: M = 37.5 Jahre; SD = 3.9) im zweiten Trimester der Schwangerschaft (Schwangerschaftswoche: M = 15.9, SD = 0.7) wurde vor und nach einer Fruchtwasserpunktion wiederholt die Herzrate (HR) erhoben sowie die Herzratenvariabilität (HRV) berechnet. Aus der HRV wurden spektralanalytisch High Frequency (HF; ein Indikator für die parasympathische Aktivität), Low Frequency (LF; ein Indikator für die sympathische und parasympathische Aktivität) und das LF/HF-Verhältnis (ein Indikator für sympathovagale Balance) bestimmt. Nach der Mittleilung des Resultates der Fruchtwasserpunktion (M = 2.8 Wochen später, SD = 1.1) wurden die schwangeren Frauen erneut während einer Ruhebedingung untersucht. Die generelle Ängstlichkeit wurde mittels Fragebogen (STAI-trait; Laux et al., 1981) gemessen. Die HR und das LF/HF-Verhältnis während der Fruchtwasserpunktion waren signifikant höher als während der Ruhebedingung (p<.001 bzw. p<.01). Die HF und LF zeigten hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen. Höhere Ängstlichkeit ging zudem mit einem erhöhten Anstieg der Herzratenreaktivität einher (r=.42, p = 0.35). Die Resultate weisen darauf hin, dass invasive medizinische Untersuchungen eine sympathikotone Stressreaktion hervorrufen, was generelle gesundheitliche Implikationen für die schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind haben könnte. Zudem geht eine stärker ausgeprägte Ängstlichkeit mit einer erhöhten Stressreaktion einher, welche durch eine psychologische Intervention reduziert werden könnte. B 46 Frauen im Mammographiescreening: Untersuchung zu Befindlichkeit und Belastungen im Rahmen des Brustkrebsfrüherkennungsprogrammes Petra Georgiewa (Charité Universitätsmedizin Berlin Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters) Annika Michall (Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen) Burghard F.Klapp (Charité Universitätsmedizin Berlin (CCM), Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik) Martina Rauchfuß (Charité Universitätsmedizin Berlin (CCM) Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Brustzentrum Charité) Abstract: Fragestellung: Die vorliegende Studie untersucht Befindlichkeiten und Belastungen von Teilnehmerinnen des Brustkrebsfrüherkennungsprogramms. Dazu wurden Daten zur Ausprägung von personalen Ressourcen und Belastungen erhoben. Es interessierten interindividuelle Unterschiede des mit der Untersuchung verbundenen Belastungsgrades und welche personalen Ressourcen sich zur Vorhersage der Belastungsbewältigung eignen. Methoden: Befragt wurden 181 Frauen im Alter von 50-69 Jahren (M= 58,08; SD= 5,340) vor der Mammographie. Die Teilnehmerinnen füllten einen aus den Instrumenten SWOP, STOA, PSQ-20, GAD-7 sowie PHQ-D zusammengestellten Fragebogen aus. Auch soziodemografische und studienbezogene Daten wurden in die Analysen einbezogen. Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass erste Belastungsreaktionen bereits vor der Erstuntersuchung des Screeningprogramms in einem nicht unerheblichen Ausmaß auftreten, vorrangig im Bereich Stresserleben. Psychische Belastungen zeigen sich signifikant höher als in der Normstichprobe. Das Empfinden von Anspannung und Anforderungen gleicht sogar dem von Brustkrebspatientinnen 1-2 Tage nach deren operativem Eingriff und stellt sich als überdurchschnittlich hoch dar. Nachgewiesen werden konnte zudem, dass ein junges Lebensalter, ein geringer Bildungsstand sowie eine gering ausgeprägte soziale Unterstützung wesentliche Einflüsse auf die empfundenen Belastungen darstellen. Dabei zeigen sich die deutlichsten Veränderungen im Bereich des Stress- und Angsterlebens. Für einen Anteil von 38,7% der Befragten konnte eine unterschwellige Depressivität nachgewiesen werden. Bezüglich der untersuchten personalen Ressourcen erwies sich ein ausgeprägter Optimismus als protektiver Faktor. Zusammenfassung: In der Untersuchungspopulation zeigen sich insgesamt zwar erhöhte, aber nicht interventionsbedürftige Werte psychischer Belastungen. Dennoch wird deutlich, dass einige Zielgruppen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen und damit die Notwendigkeit von Betreuungsangebote zumindest für einen Teil der Befragten. Speziell angepasste Interventionen können das Erleben von Angst, Stress und Depressivität vermindern und so zum Erhalt der Lebensqualität beitragen. B 47 Moderatoren des Therapieerfolges einer transdiagnostischen webbasierten Rehabilitations-Nachsorge (W-RENA). Sekundäranalysen einer randomisiert-kontrollierten Studie David Ebert (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Torsten Tarnowski (Leuphana Universität Lüneburg) Manuela Pflicht (Dr. Ebel Fachkliniken - Vogelsbergklinik) Sarah Eggenwirth (Dr. Ebel Fachkliniken - Vogelsbergklinik) Alexandra Dippel (Dr. Ebel Fachkliniken - Vogelsbergklinik) Mario Gollwitzer (Philipps-Universität Marburg) Bernhard Sieland (Leuphana Universität Lüneburg) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Verschiedene Studien belegen, dass direkt im Anschluss an eine stationäre Psychotherapie durchgeführte internetbasierte Step-Down-Interventionen die langfristige Stabilität der erzielten Therapie-Erfolge erhöhen können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings wenig darüber bekannt, für welche Patienten solche Interventionen besonders geeignet scheinen und für welche eher weniger. Ziel der aktuellen Studie ist es daher erstmalig Moderatoren des Therapieerfolges im Rahmen einer transdiagnostischen internet-basierten Step-Down-Intervention zu identifizieren. Methode: Auf Basis von Daten einer randomisiert kontrollierten Studie zur Überprüfung der Effektivität einer webbasierten Rehabilitationsnachsorge (W-RENA, Ebert et al., in Vorbereitung) nach stationärer Psychotherapie wurden Sekundäranalysen zur Identifikation von Faktoren durchgeführt, die die Effekte der Intervention im Vergleich zu Maßnahmen der poststationären Routineversorgung (TAU) moderieren. Psychopathologischer Symptomatik und potentielle Moderatoren wurden bei N=400 Patienten zu stationärer Aufnahme (t1), Entlassung/Beginn W-RENA (t2), drei und 12 Monate nach Entlassung (t3, t4) erhoben. Zur Identifikation signifikanter Interaktionen zwischen BaselineVariablen, Behandlungsbedingung und Therapieerfolg wurden Analysen von Mehrebenen-Modellen der Veränderungsmessung durchgeführt. Potentielle Moderatoren waren: Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Computerkompetenzen, Diagnose, komorbide Persönlichkeitsstörung, Krankheitsdauer, Residual-Symptome, reliable Veränderungen, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerungsfähigkeiten und Psychotherapiemotivation. Ergebnisse: Teilnehmer mit einem niedrigen Bildungsstand und Teilnehmer mit reliablen Veränderungen während des stationären Aufenthaltes hatten eine größere Wahrscheinlichkeit von W-RENA zu profitieren als Teilnehmer mit einem hohen Bildungsstand (beta = -0.37, p = .02, t = -2.28, 95% KI = -0.69 bis -0.53) bzw. keinen reliablen Veränderungen (beta = -0.23; p = .04; t = -2.3, 95% KI = -0.45 bis -0.02). Keine der anderen Variablen moderierte Unterschiede in Veränderungen von t2 zu t3 oder von t2 zu t4. Diskussion: Die durchgeführte Studie untersuchte erstmalig Moderatoren für ein internet-basiertes Step-Down-Konzept nach einer Psychotherapie. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse legen nahe, dass transdiagnostische internet¬-basierte Step-Down-Interventionen ähnlich effektiv für Patienten mit verschiedensten Charakteristika sein können. B 48 Pränataldiagnostik im zweiten Trimenon: Das Stress-Coping der Schwangeren Sara Dainese (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) lic. phil. Pearl Ghaemmaghami (Psychologisches Institut der Universität Zürich, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Prof. Dr. Roland Zimmermann (Universitätsspital Zürich, Abteilung für Geburtshilfe) Prof. Dr. Ulrike Ehlert (Psychologisches Institut der Universität Zürich, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Die Ergebnisse aktueller Studien verweisen auf einen Zusammenhang zwischen Stress in der Schwangerschaft, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen sowie vermindertem psychophysiologischem Wohlbefinden von Mutter und Kind nach der Geburt. Pränataldiagnostik stellt für schwangere Frauen einen grossen Stressfaktor dar. Der Zweck dieser Studie war, die Modulation dieser Belastung durch verschiedene Bewältigungsstrategien zu erheben. Methode Vierzig im zweiten Trimester schwangere Frauen, bei denen eine Amniozentese (AZ, Fruchtwasseruntersuchung) durchgeführt wurde, wurden bezüglich ihrer subjektiven psychischen Belastung durch die Untersuchung und das Warten auf die Resultate und ihrer Copingstrategien untersucht. Die subjektive Belastung wurde anhand von visuellen Analogskalen erhoben, aus denen ein kumulativer Belastungsscore für die Amniozentese, für die Wartezeit auf das Untersuchungsergebnis und für eine Kontrollbedingung (2 Wochen nach der AZ) errechnet wurde. Die Bewältigungsstrategien wurden mit dem Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) erhoben. Ergebnisse Die Untersuchungsbedingung wurde von den Schwangeren als signifikant belastender empfunden als die Kontrollbedingung (p<.001), mit grösster subjektiver Belastung kurz vor der Punktion. Die Frauen erlebten das Warten auf das Resultat signifikant belastender als die Untersuchung selbst (p<.01). Regressionsanalytisch fand sich ein prädiktiver Wert von emotional orientiertem Coping für die Belastung während der Amniozentese (11.9% Varianzaufklärung). Vermeidungsorientiertes Coping hingegen erklärte 17.5% der Varianz des Belastungsempfindens bezüglich des Wartens auf das Resultat der Untersuchung. Eine höhere Ausprägung des Copingstils stand dabei jeweils für eine stärkere subjektive Belastung (im Belastungsscore und auf Item-Ebene). Diskussion Die Studie hat gezeigt, dass die Fruchtwasseruntersuchung für Schwangere psychisch belastend ist, wobei das Warten auf das Resultat deutlich belastender zu sein scheint als die Untersuchung selbst. Diese Belastung wird durch unterschiedliche Arten des Stress-Coping moduliert. Schlussfolgerung Pränataldiagnostische Massnahmen stellen für schwangere Frauen eine grosse Belastung dar. Aufgrund des Zusammenhangs von pränatelem Stress und prä-, peri- und postnatalen Komplikationen stellt dass bessere Verständnis von Stressreaktivität und Coping in der Schwangerschaft ein wichtiges Forschungsgebiet dar. B 49 Soziale Unterstützung und individuelle Gesundheit im Schweizer Haushalt Panel (SHP) Corinne Spörri (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Beate Ditzen (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Abstract: Hintergrund: Enge soziale Beziehungen sind mit Gesundheit und der Lebensdauer assoziiert (House, Landis, & Umberson, 1988), ein Effekt der vermutlich über die Wahrnehmung sozialer Unterstützung vermittelt wird (Burman & Margolin, 1992). Der Zusammenhang zwischen tatsächlich erhaltener sozialer Unterstützung und Gesundheitsparametern ist allerdings ambivalent oder sogar negativ (Ditzen & Heinrichs, 2007). Dies liegt möglicherweise auch am Einfluss der medizinischen Situation auf Bedürfnis nach Unterstützung. Methoden: Daten aus zwei Kohorten (2008 und 2009) des Schweizer Haushalt Panels (SHP) zu selbst berichteter praktischer und emotionaler Unterstützung wurden untersucht. Die Analysen wurden beschränkt auf Personen in einer Partnerschaft, die mindestens 21 Jahre alt waren (M= 51.16, SA= 14.07), und deren Beziehungsstatus sich von 2008 bis 2009 nicht geändert hatte. Daten von 3871 Personen (1794 davon Männer) wurden untersucht, Geschlecht, Alter und der Gesundheitsstatus 2008 gingen als Kontrollvariablen in die Analysen ein. Ergebnisse: Praktische Unterstützung war negativ mit dem selbst eingeschätzten Gesundheitsstatus assoziiert (sign. auf dem 10% Niveau; Beta= -.032, p= .088), auch wenn für den Gesundheitsstatus zum vorherigen Messzeitpunkt kontrolliert wurde. Emotionale Unterstützung hingegen war positiv mit der Gesundheit assoziiert (Beta= .097, p<.001), dieser Zusammenhang wurde durch die Emotion Freude und geringere Traurigkeit vermittelt (Sobel Test: Chi2 Freude = 7.80, Chi2 Traurigkeit = 5.14). Diskussion: Auch wenn die vorliegenden Effekte sehr klein sind, weisen sie auf einen positiven Einfluss von emotionaler, nicht allerdings von praktischer Unterstützung, auf die Gesundheit hin. Literatur: Burman, B., & Margolin, G. (1992). Analysis of the association between marital relationships and health problems: An interactional perspective. Psychological Bulletin, 112(1), 39-63. Ditzen, B., & Heinrichs, M. (2007). Psychobiologische Mechanismen sozialer Unterstuetzung. Zeitschrift fur Gesundheitspsychologie, 15(4), 143-157. House, J. S., Landis, K. R., & Umberson, D. (1988). Social relationships and health. Science, 241(4865), 540-545. Anmerkung: Diese Studie basiert auf Daten aus dem Schweizer Haushalt Panel (SHP). B 50 Subjektive Krankheitsannahmen und kognitiv-perzeptuelle Faktoren bei nicht-kardialem Brustschmerz Stefanie Krille (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung: Psychotherapieforschung) Stephanie Körber (Unversitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung) Kerstin Nowy (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung: Psychotherapieforschung) Alexandra Martin (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung: Psychotherapieforschung) Abstract: Theoretischer Hintergrund Brustschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden in der Primärversorgung. Bei etwa der Hälfte aller Brustschmerzpatienten kann jedoch keine kardiale oder gar keine somatische Ursache gefunden werden (nicht-kardialer Brustschmerz). Die wenigen vorliegenden Studien zeigen bei dieser Patientengruppe eine erhöhte somatische Aufmerksamkeitsfokussierung, erhöhte Angstsensitivität und bedrohliche Krankheitsannahmen und Sorgen. Fragestellung Unterscheiden sich Brustschmerzpatienten mit vs. ohne kardiale Beschwerdeverursachung voneinander in subjektiven Krankheitsannahmen, Schmerzcharakteristika und kognitiv-perzeptuellen Faktoren? Methode 141 nicht kardial vorerkrankte Personen mit Brustschmerzen wurden anhand der Ergebnisse der Koronarangiografie bzw. Computertomografie klassifiziert in Patienten mit nicht-kardialen (NCCP) vs. kardialen (CCP) Brustschmerzen und schriftlich befragt zu Schmerzcharakteristika (Häufigkeit, Intensität, Beeinträchtigung), Sorgen, Krankheitsannahmen (IPQ-Brief), somatischer Aufmerksamkeitsfokussierung (SSAS) und Angstsensitivität (ASI-3). Merkmalsausprägungen in beiden Patientengruppen wurden univariat verglichen. Die Grup-penzugehörigkeit wurde multivariat (logistische Regressionsanalysen) geprüft. Ergebnisse NCCP-Patienten waren eher weiblich (p<0,05) und jünger (54 vs. 60 Jahre, p<0,01). Bei vergleichbaren Schmerzcharakteristika zeigten sich auf univariater Ebene keine signifikanten Gruppenunterschiede in den psychologischen Variablen. In der multivariaten Überprüfung zeigten sich neben Alter (Exp(B)=0,9, p<0,01) und Geschlecht (Exp(B)=17,9, p<0,01) auch geringere Emotionale Repräsentanz (IPQ; Exp(B)=0,7, p<0,05), geringere Angstsensitivität (Exp(B)=0,9, p<0,01) und erhöhte somatische Aufmerksamkeitsfokussierung (Exp(B)=1,2, p<0,05) als signifikante Prädiktoren der Zugehörigkeit zur Gruppe NCCP. Diskussion Vergleiche von Personen mit nicht-kardialen vs. kardialen Brustschmerzen erbrachten entgegen unseren Erwartungen nur wenige Unterschiede. Die Bedeutung psychischer und kognitiv-perzeptueller Faktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung nicht-kardialer Brustschmerzen wird diskutiert. Schlussfolgerungen Obwohl wir in den psychologischen Merkmalen keine Unterschiede zwischen NCCP- und CCPPatienten fanden, werden v.a. kognitiv-perzeptuelle Prozesse als wichtig hinsichtlich der Aufrechterhaltung organisch unklarer Körperbeschwerden erachtet und in psychologischen Interventionen adressiert. B 51 Tabakkontrolle und Tabakentwöhnung im Netz Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen (DNRfK) - Ergebnisse einer Totalerhebung Stephan Mühlig (TU Chemnitz) Christa Rustler (DNRfK) Manja Nehrkorn (DNRfK) Grit Teumer (TU Chemnitz) Eileen Bothen (TU Chemnitz) Anja Neumann-Thiele (TU Chemnitz) Abstract: HINTERGRUND: Nach dem Kodex des ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services verpflichten sich die teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen, in der eigenen Institution und in der Region aktiv zur Reduzierung des Tabakkonsums beizutragen (Verhältnis- und Verhaltensprävention). Im Rahmen eines Modellprojektes des BMG zum Aufbau eines Netzes Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen wurde der Kodex konsekutiv implementiert. METHODE: Die Mitgliederbefragung (N=181) erfolgte in Form eines Online-Fragebogens (51 Items), der sich u.a. auf folgende Inhaltsaspekte bezog: Akzeptanz auf Seiten der Mitarbeiter und Patienten, Stand der Umsetzung der tabakpolitischen Maßnahmen, Art der eingesetzten Entwöhnungsangebote, Fach- und Spezialqualifikation der Entwöhnungsanbieter, Beurteilung des Zertifizierungsprozesses und weitere Unterstützungsbedürfnisse. ERGEBNISSE: Von N=181 Mitgliedseinrichtungen beteiligten sich n=121 an der Studie (Ausschöpfungsquote: 67,4%). Zum Stichtag waren 17% der Kliniken silber-zertifiziert, weitere 43% haben das bronze-Zertifikat erhalten und 40% sind noch nicht zertifiziert. Eine einzige Klinik ist in diesem Jahr für den Gold-Standard nominiert worden. Die Mitgliedschaft im DNRfK wird weit überwiegend als nützlich angesehen (z.B. Informationsgewinnung: 86%; Öffentlichkeitswirkung: 70%). An der Umsetzung der RauchfreiPolitik sind fast alle Berufsgruppen beteiligt. Es werden unterschiedliche Entwöhnungsmaßnahmen angeboten (Motivierende Gesprächsführung: 47%; Kurzintervention: 45%; individuelle Therapiegespräche: 45%), in 63% der Kliniken mit medikamentöser Unterstützung. Die Durchführung der Entwöhnungsnterventionen obliegt primär Ärzten (63%), Pflegepersonal (51%) und Psychologen (51%), erfolgt allerdings nur in 36% der Kliniken leitlinienorientiert. DISKUSSION + SCHLUSSFOLGERUNGEN: Der Kodex wird weitestgehend akzeptiert und konsequent umgesetzt. Defizite bestehen noch hinsichtlich Evidenzbasierung, Train-the-Trainer-Qualifikationen und Nachkontrollen. B 52 Vermehrt gezügeltes Essverhalten bei postmenopausalen Frauen Suzana Drobnjak (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Semra Atsiz (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Brunna Tuschen-Caffier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie) Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Abstract: Theoretischer Hintergrund Die Forschung zu Essverhalten bezieht sich mehrheitlich auf Frauen bis 35 Jahre. Forschungsbefunde zu älteren Frauen fehlen weitgehend, obwohl aus der medizinischen Literatur bekannt ist, dass Frauen im Verlauf des Klimakteriums an Gewicht zu nehmen. Es stellt sich die Frage, ob dieser normale physiologische Vorgang das Essverhalten von postmenopausalen Frauen dahingehend beeinflusst, dass sie ihre Nahrungsaufnahme reduzieren, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Auch ist fraglich, ob postmenopausale Frauen ihr Selbstwertgefühl anders beschreiben als prämenopausale Frauen. Ziel dieser Studie war einerseits zu erfassen, ob sich das Essverhalten von prä-und postmenopausalen Frauen unterscheidet und andererseits, ob der Selbstwert bei prä-und postmenopausalen Frauen mit dem Essverhalten zusammenhängt. Methoden Im Rahmen einer online Erhebung wurden verschiedene standardisierte Fragebögen eingesetzt. Das Essverhalten wurde mittels einer validierten deutschen Version des „Eating Disorder ExaminationQuestionnaire“ (EDE-Q; Fairburn & Beglin, 1994) erfasst. Der EDE-Q beinhaltet die Subskalen gezügeltes Essverhalten, essbezogene Sorgen, Gewichtssorgen und Figursorgen. Die Selbstwerteinschätzung erfolgte anhand des Fragebogens zum Selbstwertgefühl (SES; Rosenberg, 1965). Insgesamt haben 610 Frauen im Alter zwischen 40 und 77 Jahren die Befragung vollständig durchgeführt. Als prämenopausal (N=321) wurden Frauen definiert, deren letzte Menstruation weniger als zwei Monate zurücklag, als postmenopausal (N=255), wenn die Menstruation länger als 12 Monate zurücklag. Ergebnisse Postmenopausale Frauen zeigen signifikant höhere Werte in der Subskala gezügeltes Essverhalten (t=2.6, p=.010) als prämenopausale Frauen. Zusätzlich sind die Werte des SES bei den postmenopausalen Frauen tiefer (t=2.1, p=.030). Bei postmenopausalen Frauen korreliert der Selbstwert mit der Skala des gezügelten Essverhaltens höher (r=-.301, p=.000) als bei prämenopausalen Frauen (r=-.219, p=.000). Diskussion Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das vermehrt gezügelte Essverhalten in einem Zusammenhang mit der Menopause stehen könnte. Der Selbstwert könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Schlussfolgerungen Die Ergebnisse weisen auf weiteren Forschungsbedarf beim Essverhalten von Frauen im mittleren Alter hin. B 53 Diagnosestellung, Komorbidität und Belastungsschwere im Modellvorhaben der Techniker Krankenkasse Katharina Köck (Universität Trier) Wolfgang Lutz (Universität Trier) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Studien zur Komorbidität psychischer Störungen beschränken sich oft auf spezifische Störungskombinationen und untersuchen jeweils nur ausgesuchte Zielbereiche der hervorgerufenen Belastung. Aufgrund der zahlreichen Einzelbefunde ist es schwierig, zusammenfassende Aussagen über den Zusammenhang zwischen Diagnosen und damit verbundener Belastung zu treffen. Im Rahmen eines Qualitätsmonitoring-Projektes in der ambulanten Psychotherapie wurde ein breites Spektrum an Einschlussdiagnosen definiert. Untersucht wurde, ob Unterschiede bzgl. der Art der Diagnosestellung zu qualitativ und quantitativ unterschiedlichen Diagnosen führen, ob sich bestimmte Muster von Diagnosekombinationen herausbilden und in welchem Zusammenhang bestimmte Störungskombinationen mit der Belastung zu Therapiebeginn stehen. Methode: Es wurden Odds Ratio für das Vorhandensein bestimmter Störungen in IG (Einsatz von IDCL-Checklisten, Hiller et al., 2004) und KG (keine Vorgaben zur Art der Diagnostik) berechnet. Mit Hilfe von Latent Class Analysen wurden Muster gemeinsam auftretender Störungen identifiziert. Komorbiditätsgruppen wurden darüber hinaus auf Unterschiede in selbst- und fremdberichteter Belastung (BSI, IIP, SF-12, GAF, störungsspezifische Instrumente) untersucht. Ergebnisse: Unter Anwendung von Diagnosechecklisten wurden eine Reihe von Störungen bedeutend häufiger, Anpassungsstörungen hingegen seltener diagnostiziert. Es ergeben sich fünf Diagnoseklassen, in denen sich die Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe widerspiegeln. Als einziger bedeutsamer positiver Zusammenhang resultiert die Kombination aus Persönlichkeits- und rezidivierender depressiver Störung. Größere Eingangsbelastung unter Komorbidität, insbesondere mit Persönlichkeitsstörung, wird in verschiedenen allgemeinen Maßen gefunden. Diese Unterschiede spiegeln sich jedoch nicht in der störungsspezifischen Belastung (AKV, BDI). Schlussfolgerungen: Komorbidität ist stark abhängig von der Diagnosestellung. In der untersuchten Stichprobe finden sich keine eindeutigen Muster von Mehrfachdiagnosen. Komorbide Patienten sind tendenziell belasteter in einer Reihe von Maßen, hohe störungsspezifische Belastung geht aber nicht zwangsläufig mit Komorbidität einher. B 54 Die Rolle des Lebenssinns bei psychischen Erkrankungen und in der psychotherapeutischen Behandlung Jana Volkert (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf) Holger Schulz (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Anna Levke Brütt (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Sylke Andreas (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Abstract: Theoretischer Hintergrund/ Fragestellung Die Wichtigkeit und Zufriedenheit mit dem Grad der Sinnerfüllung im Leben hat in letzter Zeit zunehmende Aufmerksamkeit in der klinischen Psychologie und Psychotherapieforschung gewonnen. Empirische Studien konnten zeigen, dass der Lebenssinn mit psychologischen Beschwerden assoziiert ist. Zum Beispiel wurde ein Zusammenhang zwischen dem Lebenssinn, der Depression, der Angsterkrankung, und einem geringerem Therapiebedarf gefunden. Das Ziel dieser Studie war den Lebenssinn im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen und Symptomschwere, sowie im Verlauf psychotherapeutischer Behandlung zu untersuchen. Methode Zweihundertzwanzig stationäre Patienten mit vorwiegend depressiven Störungen und Angststörungen wurden konsekutiv in einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Klinik zwischen März und Dezember 2009 rekrutiert. Die Patienten wurden zu 3 Messzeitpunkten- Aufnahme, Entlassung und 6 Monatskatamnese- untersucht. Der Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE) wurde eingesetzt, um die spezifischen Inhalte, die Wichtigkeit des und Zufriedenheit mit dem Lebenssinn zu erfassen. Weitere Instrumente zur Messung des Behandlungsoutcome wurden eingesetzt, z.B. Health49. Für die Auswertung wurden Multivariate Varianzanalysen mit Messwiederholung, mit dem Lebenssinn als abhängige Variable, eingesetzt. Ergebnisse Patienten mit einer psychischen Erkrankung berichten signifikant höhere Sinnerfüllung als die gesunde Kontrollgruppe. Sinnerfüllung ist negativ korreliert mit depressiven Symptomen, Selbstwirksamkeit, Aktivitäten und Partizipation und Sozialer Unterstützung. Ein positiver Zusammenhang besteht zwischen dem Grad der Sinnerfüllung und der Lebensqualität. Die Zufriedenheit mit und Wichtigkeit des Lebenssinns nimmt im Behandlungsverlauf zu und ist auch zum Katamnesezeitpunkt stabil. Diskussion Die Ergebnisse stehen im Einklang mit früheren Befunden, insofern als dass psychische Erkrankungen mit einem geringeren Lebenssinn assoziiert sind. Des Weiteren nimmt der Lebenssinn im Verlauf einer psychotherapeutischen Behandlung, sowie mit abnehmenden psychischen Beschwerden, zu. Es bestehen jedoch keine diagnosespezifischen Unterschiede in Bezug auf den Lebenssinn. Schlussfolgerungen Zusammenfassend deuten die Ergebnisse daraufhin, dass die psychotherapeutische Behandlung von einer Einbeziehung des Lebenssinns profitieren und diese aktiv als eine Ressource der Patienten in der Behandlung einsetzen könnte. B 55 Einsatz von Rache-Phantasien beim imaginativen Überschreiben: Heilsam oder gefährlich? Laura Seebauer (Uniklinikum Freiburg) Gitta Jacob (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Abstract: Hintergrund: Imagery Rescripting (ImRS) ist eine therapeutische Interventionstechnik, bei der emotionale Probleme in Verbindung zu inneren Vorstellungsbildern gebracht und entsprechend der zugrunde liegenden Bedürfnisse verändert werden. Der positive Einfluss auf das emotionale Erleben ist wissenschaftlich gut belegt, weshalb ImRS in der Verhaltenstherapie zunehmend eingesetzt wird. Die klinische Erfahrung insb. mit Patienten mit Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen zeigt, dass dabei häufig der Wunsch nach Ausagieren von Rache in der Imagination geäußert wird. Therapeutisch ist unklar, welche Konsequenzen phantasierte Rache hat. Einerseits lässt sich argumentieren, dass phantasierte Aggression zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für offen ausgelebte Aggression führt, andererseits kann phantasierte Aggression den Selbstwert und das Beziehungserleben stabilisieren und so Ärger und Aggression reduzieren. Ziel dieser Pilotstudie ist es, sich dieser Fragestellung zu nähern um im weiteren Verlauf Handlungsempfehlungen für die Praxis geben zu können. Methode: Untersucht wurden Unterschiede in der Wirkung von ImRS mit und ohne Rache-Instruktion auf ausgewählte Emotionsparameter (z.B. Hilflosigkeit, Zufriedenheit, Traurigkeit) und die Herzrate (HR) der Probanden sowie selbstberichtete Aggressivität in der folgenden Woche. Die Stichprobe besteht aus gesunden, studentischen Probanden (N = 80). Mit jedem Probanden wurde zunächst ein emotionsaktivierendes, biografisches Ärger-Interview durchgeführt, und im Anschluss randomisiert eine von 4 Imaginations-Bedingungen zur Bearbeitung der aktivierten Emotionen angeleitet: 1. ImRS + Rache, 2. ImRs ohne Rache, sowie zwei Kontrollbedingungen: 3. Positive Imagination, 4. Neutrale Imagination. Die Messungen erfolgten vor und nach dem Ärger Interview, sowie nach der Intervention und in einer follow-up Befragung nach einer Woche. Ergebnisse: Beide ImRS Bedingungen wurden bei der Bearbeitung der Ärger-Situation als hilfreich bewertet. Es wurden sehr unterschiedliche Rachemodalitäten gewählt (körperlich, verbal, sozial etc.). Die psychometrischen und physiologischen Daten werden aktuell ausgewertet, im Vortrag werden erste Ergebnisse präsentiert und diskutiert. B 57 Herausforderungen in der Qualitätssicherung klinischer Studien zu psychotherapeutischen Interventionen Jana Hoffmann (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf) Levente Kriston (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Ingo Zobel (Universitätsklinikum Freiburg, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie) Elisabeth Schramm (Universitätsklinikum Freiburg, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie) Martin Härter (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf) Abstract: THEORETISCHER HINTERGRUND/FRAGESTELLUNG: Internationale Gesundheitsorganisationen haben Richtlinien zur Qualitätssicherung klinischer Studien zu pharmakotherapeutischen Interventionen entwickelt. Diese Vorschriften sichern die Homogenität der Qualitätsmaßnahmen und stoßen auf breite Akzeptanz. Bei der Durchführung von Psychotherapiestudien sind Studienleiter mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Ziel des Beitrages ist die Darstellung der Besonderheiten der Qualitätssicherung dieser Psychotherapiestudien. METHODE: Anhand einer Literaturrecherche und als Ergebnis von Expertendiskussionen im Rahmen einer aktuell laufenden Studie zum Vergleich zweier Psychotherapieverfahren, werden wesentliche Unterschiede zu der Qualitätssicherung pharmakologischer Studien dargestellt und Lösungsversuche aufgezeigt. ERGEBNISSE: Besondere Unterschiede zwischen psycho- und pharmakotherapeutischen Studien zeigen sich im Rekrutierungsstadium durch die begrenzte Anzahl der verfügbaren Therapeuten und den Einsatz von Wartelisten. Weiterhin ist die Häufigkeit der psychotherapeutischen Interventionen in der Praxis schwer zu standardisieren. Auch die Verblindung von Outcome-Ratern ist eine Besonderheit, da diese als Kollegen alltäglichen Kontakt zu den nicht-verblindeten Therapeuten haben. Ebenso ist die Verfahrenstreue der Therapeuten ein wesentlicher Unterschied, welche nicht nur regelmäßig überprüft, sondern durch die Verwendung von Therapiemanualen und Supervisionen standardisiert werden soll. Auch die Beziehung zwischen Therapeut und Patient spielt in Psychotherapiestudien eine andere Rolle, da sie nicht klar von der Psychotherapie als zu evaluierende Intervention zu trennen ist. Weiterhin existieren bisher keine allgemein akzeptierten Instrumente zur Erfassung von Nebenwirkungen von Psychotherapieverfahren. Schließlich kann bei der statistischen Analyse die Berücksichtigung von Therapeuteneffekten ein wichtiger Unterschied zu pharmakotherapeutischen Studien sein. DISKUSSION: Die Qualitätssicherung von Psychotherapiestudien stellt uns vor große Herausforderungen. Für die besonderen Anforderungen dieser Studien existieren bisher ad-hoc Lösungen, die jeweils für konkrete Studien entwickelt werden. SCHLUSSFOLGERUNGEN: Ein Konsens zwischen Experten der Psychotherapieforschung bezüglich Maßnahmen zur Qualitätssicherung wäre wünschenswert, um die Qualität und Vergleichbarkeit von klinischen Studien zu Psychotherapieverfahren zu erhöhen. B 58 Ist die Verwendung von Erste-Person-Singular Pronomina ein Marker für Psychopathologie? Ergebnisse aus psychodynamischen Interviews mit stationär behandelten Patienten Johannes Zimmermann (Universität Kassel) Markus Wolf (Universitätsklinikum Heidelberg) Henning Schauenburg (Universitätsklinikum Heidelberg) Manfred Cierpka (Universitätsklinikum Heidelberg) Stefanie Hammer (Universität Koblenz-Landau) Matthias Hunn (Universität Koblenz-Landau) Astrid Bock (Universität Innsbruck) Doris Peham (Universität Innsbruck) Cord Benecke (Universität Kassel) Abstract: Hintergrund: Personen unterscheiden sich in der Häufigkeit, mit der sie Erste-Person-Singular Pronomina wie „ich“, „mir“ und „mich“ verwenden. Studien an nicht-klinischen Stichproben zeigen, dass diese Unterschiede relativ stabil sind und positiv mit klinisch relevanten Merkmalen wie Depressivität und Neurotizismus zusammenhängen. Ziel der Untersuchung ist es, die psychopathologischen Implikationen dieser Variable in klinischen Stichproben zu untersuchen. In zwei Studien wird geprüft, inwiefern der Gebrauch von Erste-Person-Singular Pronomina (a) mit dem Ausmaß der Persönlichkeitspathologie zusammenhängt und (b) eine chronifizierende Symptomentwicklung vorhersagt. Methode: Teilstudie 1 basiert auf einer diagnostisch gemischten Stichprobe von 74 Patienten in stationärer Behandlung. Mit den Patienten wurde zu Behandlungsbeginn ein Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV (SKID-I und II) sowie ein halbstrukturiertes Interview gemäß der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2) durchgeführt. Die OPD-Interviews wurden auf Video aufgezeichnet, transkribiert und hinsichtlich der relativen Häufigkeit von ErstePerson-Singular Pronomina ausgewertet. Teilstudie 2 basiert auf einer Stichprobe von 19 stationär behandelten, depressiven Patienten, mit denen ebenfalls SKID und OPD-Interviews durchgeführt wurden. Zusätzlich schätzten die Patienten zu Beginn und (im Mittel) acht Monate nach Behandlungsende ihre depressiven Symptome mit dem Beck-Depressions-Inventar (BDI) ein. Ergebnisse: In Teilstudie 1 korrelierte der Pronominagebrauch bei sieben der zwölf DSM-IVPersönlichkeitsstörungen substanziell mit der Anzahl der erfüllten Kriterien gemäß SKID-II. In Teilstudie 2 sagte die Variable das Ausmaß depressiver Symptome zum Katamnesezeitpunkt vorher. Dieser Effekt war auch nach statistischer Kontrolle der Depressivität zu Behandlungsbeginn signifikant. Diskussion: Die Ergebnisse bestätigen die psychopathologische Relevanz des Gebrauchs von ErstePerson-Singular Pronomina. Die Messung ihrer relativen Häufigkeit in diagnostischen Interviews bietet einen innovativen und non-reaktiven Zugang zur Erfassung einer vulnerablen Persönlichkeitsstruktur. Zukünftige Studien sollten die involvierten Prozesse aufdecken sowie ihre Veränderbarkeit durch Psychotherapie untersuchen. Schlussfolgerung: Der Gebrauch von Erste-Person-Singular Pronomina in psychodynamischen Interviews ist ein klinisch relevanter Marker für eine vulnerable Persönlichkeitsstruktur. B 59 Kombinationen von Internet-basierter Interventionen und klassischer Psychotherapie. Ein systematisches Review. Doris Erbe (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) David Ebert (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) PD Dr. Dr. Niels Bergemann (Schön Klinik Bad Arolsen) Prof. Dr. Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Zahlreiche Studien belegen inzwischen das große Potenzial internetbasierter Interventionen als ein Element in der Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen. Konzepte, die klassische face-to-face-Psychotherapie und Internet-basierte Interventionen kombinieren, könnten die Vorteile beider Therapieformen optimal verknüpfen. Im Rahmen der hier vorgestellten Studie sollen erstmalig eine Übersicht über bestehende Konzepte erstellt und der aktuelle empirische Erkenntnisstand zur Wirksamkeit in einem systematischen Review aufbereitet werden. Fragestellung: Welche Konzepte hinsichtlich der Kombination von Internet- und klassischer Psychotherapie existieren bisher? Welche Störungsbilder werden behandelt? Welche Ziele werden verfolgt? Wie ist der aktuelle empirische Erkenntnisstand? Methode: Ein systematisches Review, in dem mittels systematischer Suche in relevanten Datenbanken entsprechende Artikel identifiziert wurden. Ergebnisse: Es konnten 21 Studien ermittelt werden, von denen jedoch nicht alle im Rahmen randomisierter kontrollierter Studien den Erfolg der Konzepte prüfen. Die am häufigsten behandelten Störungen sind Depressionen und Angststörungen, andere beziehen sich auf Gesundheitsverhalten (z.B. Übergewicht, Rauchen, Alkoholmissbrauch). Angestrebte Ziele sind z.B., bisher in klassischer Psychotherapie erreichte Erfolge aufrecht zu erhalten, routinehafte Teile der klassischen Psychotherapie ans Internet zu delegieren und dadurch wertvolle Therapiezeit zu sparen, zu einem frühen Zeitpunkt niederschwellige Hilfe anzubieten oder bisherige Erfolgsquoten durch zusätzliche Elemente zu verbessern. Diskussion: in den meisten Studien zeigt sich eine gute Wirksamkeit, jedoch bleibt noch unklar, bei welchen Patienten die weniger ressourcenaufwändige Therapie über das Internet ausreicht und welche zusätzliche „Face-to-Face“-Kontakte benötigen. Lediglich eine Studie beschäftigt sich damit und kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem Patienten mit größerer Schwere und Chronizität der Symptomatik von einer Kombination beider Therapiekonzepte profitieren. Schlussfolgerungen: Kombinationen aus klassischer und Internet-Therapie können zahlreiche Vorteile haben. Weitere Untersuchungen, insbesondere hinsichtlich patientenspezifischer Prädiktoren bzgl. der Notwendigkeit von Face-to-Face-Kontakten sind erforderlich. B 60 Prädiktive Überlegenheit von Einzelinterviews über Gruppenassessments in der Auswahl von Psychotherapiekandidaten – Empirische Ergebnisse Henning Schöttke (Universität Osnabrück) Julia Eversmann (Universität Osnabrück) Abstract: Fragestellung: Naturalistische Psychotherapiestudien zeigen, dass es Unterschiede in der Wirksamkeit von Psychotherapien gibt, die sich in Teilen auf das Talent von Therapeuten zurückführen lassen (Okishii, et al., 2003). Basierend auf der Annahme, dass interpersonale Basiskompetenzen als Teil eines solchen Talentes angesehen werden (Orlinsky, et al. ,2005), wurde ein Verfahren zur Erfassung der „Therapierelevanten interpersonellen Verhaltensweisen (TRIB; Eversmann et al., 2011) für die Auswahl zur Psychotherapieausbildung entwickelt. Die Reliabilität und die prädiktive Validität dieser Methoden sind Gegenstand der Untersuchung. Methode: 106 Psychologen zu Beginn ihrer Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten wurden hinsichtlich ihres interpersonalen Verhaltens in einer Gruppendiskussion durch acht unabhängige Supervisoren und in einem sich anschließenden Interview beurteilt (TRIB-Beobachtung + TRIB-Interview, Eversmann & Schöttke, 2008). Für die Operationalisierung des Ausbildungserfolges wurden ca. 5 Jahre später neben den Noten der Approbationsprüfung, Leistungsmerkmalen der praktischen Ausbildung und Peerratings zur Kooperation erhoben. Ergebnisse: Beide TRIB-Skalen können mit einer guten Beobachterübereinstimmung durchgeführt werden. Beide Verfahren korrelieren in moderater Höhe untereinander und sind mit den Verläufen und den Ergebnissen von Ausbildungstherapien sowie mit Drop-out-Raten und den Approbationszensuren assoziiert. Zusammenhänge mit der Ergebnisqualität der Therapieverläufe im SCL 90 R und den Fragebogen zur Therapieevaluation können nicht nachgewiesen werden (FEP, Lutz et al.2009). Diskussion: Die Erfassung von therapierelevanter interpersoneller Verhaltensweisen können ein einem Gruppenassessement oder Einzelinterviews reliabel erfasst werden. Beide Skalen prädizieren Merkmale des Ausbildungserfolges in vergleichbarer Höhe, jedoch ist keine Skala der anderen in der Prädiktionsfähigkeit überlegen. Schlussfolgerung: Merkmale psychotherapeutischen Handelns und der Ausbildungserfolg in Psychologischer Psychotherapie lassen mittels der Beobachtung von oder eines Interviews zu therapierelevanten interpersonellen Verhaltensweisen vorhersagen. Entscheidungen für ein Auswahlverfahren als Gruppenassessment oder in Form eines Einzelinterview lassen sich auf der bisherigen empirischen Datenbasis nicht treffen. B 61 Zur Vorhersage von Therapieverschlechterung in einer verhaltenstherapeutischen Hochschulambulanz Nicole Nelson (Psychologisches Institut, Poliklinische Institutsambulanz für Psychotherapie, Universität Mainz) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Fragestellung: Ungünstige Therapieverläufe wurden bisher selten untersucht und es ist wenig über Therapieverschlechterungen im naturalistischen Setting bekannt. Daher beschäftigt sich die vorliegende Studie mit der Häufigkeit und der Vorhersage von Therapieverschlechterung. Methode: Untersucht wurde die Therapieverschlechterung im Brief Symptom Inventory (BSI) bei einer Stichprobe von 1390 Patienten der Mainzer Hochschulambulanz. Bei der Berechnung der Therapieverschlechterung (klinisch bedeutsame Verschlechterung definiert anhand des Reliable Change Index (RCI)) handelt es sich um Prä-Post-Analysen im Rahmen eines Intention-to-treatAnsatzes. Therapieabbrecher und -completer werden differenziert. Ergebnisse: In der Gesamtstichprobe wurde eine Therapieverschlechterung bei 3,1% (N=43) festgestellt.Bei der Betrachtung einzelner diagnostischer Gruppen ergaben sich für Borderline-Persönlichkeitsstörungen 7,5% Therapieverschlechterung, für unipolare Depressionen 3,5%, für Angststörungen 3,3%, für andere Persönlichkeitsstörungen (ohne Borderline) 2,8% und für somatoforme Störungen 1,3% Therapieverschlechterung. Die Wahrscheinlichkeit einer Therapieverschlechterung bei BorderlinePersönlichkeitsstörung war etwa sechsmal (OR=6,04) so hoch wie bei einer somatoformen Störung und etwa doppelt so hoch ist wie bei einer unipolaren Depression (OR=2,18) oder Angststörung (OR=2,26). Bei Einbezug einzelner störungsspezifischer Subskalen des BSI in die Berechnung der Verschlechterung ergaben sich vergleichbare Ergebnisse. Bei ca. zwei Drittel der Patienten traten die entscheidenden Therapieverschlechterungen erst nach der 25. Therapiesitzung auf. Diskussion: Die vorliegenden Ergebnisse geben einen ersten Einblick in die Häufigkeit von Therapieverschlechterung im naturalistischen Setting. Da die Ergebnisse sowohl bei Berechnung mit dem GSI als auch bei Einbezug störungsspezifischer Subskalen ähnlich sind, kann von einer hohen Stabilität ausgegangen werden. Interessant wäre ein Vergleich der hier dargestellten Ergebnisse mit denen störungsspezifischer Outcome-Maße.Hier sollten weitere Analysen folgen. Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen, dass die Häufigkeiten zwischen den Störungsbildern deutlich variieren. Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung stellen offenbar die kritischste klinische Gruppe dar. Darüber hinaus zeigt sich, dass es eher im späteren Therapieverlauf zu Therapieverschlechterung kommt. Dieses überraschende Ergebnis sollte näher untersucht werden. B 62 Zusammenhang zwischen Symptomverlauf und langfristigem Erfolg in der stationären Psychotherapie Hanne Melchior (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Holger Schulz (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Levente Kriston (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Kerstin Hofreuter-Gätgens (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf) Anika Hergert (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Corinna Bergelt (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Matthias Morfeld (Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften, Hochschule Magdeburg Stendal) Uwe Koch (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Birgit Watzke (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Abstract: Theoretischer Hintergrund Die stationäre Behandlung psychischer Erkrankungen wurde in den letzten Jahren deutlich verkürzt, wobei die Veränderung der Symptomatik im zeitlichen Verlauf der Behandlung bislang wenig untersucht wurde. Ziel der Arbeit war es zu untersuchen, ob und welche Patientensubgruppen mit unterschiedlichen Symptomverläufen sich identifizieren lassen und in welchem Zusammenhang diese mit dem langfristigen Behandlungsergebnis stehen. Methode In einer prospektiven Untersuchung einer konsekutiven Patientenstichprobe dreier stationärer Fachkliniken wurde das primäre Outcome „Symptombelastung“ zur Aufnahme (t0), wöchentlich im Behandlungsverlauf, zur Entlassung (t1) sowie zum 6-Monats-Follow-Up (t2) erhoben. Mittels latenter Wachstumskurvenanalysen (Growth Mixture Modelling) wurden Patientengruppen mit jeweils homogenen Symptomverläufen gebildet. Die identifizierten Gruppen wurden hinsichtlich des langfristigen Therapieerfolgs mittels Kovarianzanalyse verglichen. Ergebnisse Bei einer Stichprobe von 576 Patienten (unipolare Depression: 67%, Anpassungsstörung: 18%, Angststörung: 18%, Essstörung: 17%) resultierten vier Patientengruppen mit differenziellen Symptomverläufen. Neben der größten Gruppe mit mittlerer Ausgangsbelastung und stetiger Verbesserung (Linear Response; 71%) zeichnen sich die anderen drei Gruppen durch hohe Ausgangsbelastungen und die folgenden Verläufe aus: frühe Verbesserung (Early Response; 9%), verzögerte Verbesserung (Delayed Response; 5%) und keine Verbesserung (Non-Response; 11%). Im Zusammenhang mit dem langfristigen Outcome zeigt sich, dass Patienten mit einer Early Response am stärksten langfristig von der Behandlung profitieren (t0-t2 Effektstärke Cohen’s d=1.64), wohingegen die verbleibenden Gruppen deutlich geringere Effekte erzielen (Non-Response: d=0.36; Linear Response: d=0.46, Delayed Response: d=0.60). Die kovarianzanalytischen Auswertungen zeigen signifikante Unterschiede zwischen den Verlaufsgruppen in der Symptombelastung zu t2 bei statistischer Kontrolle der Ausgangsbelastung (p<.001; Eta²=.165). Diskussion Symptomverlauf und Outcome hängen deutlich miteinander zusammen. Die Kenntnis von distinkten Therapieverläufen ermöglicht eine frühzeitige Identifikation von prognostisch günstigen und ungünstigen Verläufen und bietet somit eine empirische Basis für die Anpassung von Behandlungsprozessen. Methodische Aspekte der Studie ebenso wie mögliche klinische Implikationen der Ergebnisse werden diskutiert. B 63 Beginn des Substanzkonsums und Migration: ein Vergleich von Spätaussiedlern, Immigranten aus Nicht-EU-Ländern und Deutschen ohne Migrationshintergrund. Michael Odenwald (Universität Konstanz) Judith Stöckel (Universität Konstanz) Veronika Müller (Universität Konstanz) Ramona Hoffmann (Universität Konstanz) Wolfgang Höcker (Zentrum für Psychiatrie Reichenau) Abstract: Studienergebnisse deuten auf einen Zusammenhang von Suchtentwicklung bei Migranten und gesellschaftlichen Anpassungsschwierigkeiten im Sinne einer Phase der kritischen Integration oder eines Wegfalls von protektiven Faktoren hin. In einer Gruppenvergleichsstudie im Suchthilfeverbund Konstanz untersuchten wir Unterschiede zwischen zwei Patientengruppen mit und Deutschen ohne Migrationshintergrund hinsichtlich der Suchtentwicklung. In einem Matched-Pair-Design wurden jeweils 30 Dreierpaare von männlichen Suchtpatienten rekrutiert: Russlanddeutsche, Personen aus Nicht-EU Staaten (v.a. Türkei) und Deutsche ohne Migrationshintergrund. Die Dreierpaare hatten jeweils das gleiche Alter, die gleiche Hauptdroge und wurden in der gleichen Einrichtung behandelt; 16 Dreierpaare waren Opiatpatienten und 14 Alkoholpatienten. Mittels des European Addiction Severity Index wurde die Suchtentwicklung retrospektiv erfasst. Zusätzlich wurden Therapieerfahrung, Psychopathologie und Stresserfahrungen erhoben. Der Gruppenvergleich erfolgte mittels ANOVA mit Messwiederholungen, Regressionsmodelle wurden zur Vorhersage von Stationen der Suchtentwicklung herangezogen. Problematischer Alkoholkonsum begann bei beiden Migrantengruppen später als bei Deutschen (p<.05). Russlanddeutsche hatten jedoch vor der Migration bereits ein problematisches Konsummuster, andere Migranten erst danach. Im Gegensatz dazu begann der problematische Drogenkonsum bei Opiatpatienten bei allen Gruppen im gleichen Alter und bei beiden Migrantengruppen nach der Migration. Die ersten Schritte der Suchtentwicklung wurden von russlanddeutschen Opiatpatienten langsamer durchschritten als bei den anderen beiden Gruppen (p<.05). Der Übergang vom regelmäßigem zu i.v. Konsum verlief aber bei Russlanddeutschen schneller. Die Erstbehandlungen war jeweils bei den drei Gruppen im gleichen Alter. Die Interaktion von Stress- und Migrationserfahrung war ein statistischer Prädiktor für den Beginn des regelmäßigen Konsums der Hauptdroge. Die Studie stützt die Hypothese, dass Suchtverläufe sich zwischen Deutschen und Migrantengruppen unterscheiden. Hinsichtlich illegaler Drogen wird die Hypothese weiter gestützt, dass fehlgeschlagene Anpassungsprozesse nach der Migration mit der Entstehung der Drogenproblematik zusammenhängen. Im Gegensatz dazu gibt es beim problematischen Alkoholkonsum möglicherweise migrationsbezogene Selektionseffekte. Weitere Studien sollten generationsspezifische Effekte bei Migranten untersuchen. B 65 Bindungsangst als wichtiger Faktor für den Prozess und den Nutzen von Dyadischem Coping Nathalie Meuwly (Universität Zürich) Guy Bodenmann (Universität Zürich) Janine Germann (Universität Zürich) Beate Ditzen (Universität Zürich) Markus Heinrichs (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Vor allem im Kontext von paarexternem Stress ist Dyadisches Coping eine wichtige Ressource und bekannt für stressmindernde Effekte. Unterstützung suchen beim Partner ist ein Merkmal sicherer Bindung. Unsichere Bindung hingegen, ist verbunden mit dysfunktionalen Gedanken und Verhalten gegenüber der Bindungsfigur. Das Ziel der folgenden Studie war es, unter standardisierten Bedingungen die Effekte von Bindungsangst und Bindungsvermeidung auf den Prozess des Dyadischen Copings zu untersuchen. Methoden: 198 Paaren wurden randomisiert auf drei experimentelle Gruppen aufgeteilt: (a) die Frau, (b) der Mann oder (c) beide Partner mussten den Trier Social Stress Test (TSST; Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 1993) absolvieren. In einer unstrukturierten Wartephase nach der Stressinduktion hatten die Paare die Möglichkeit den Stress gemeinsam zu bewältigen. Diese Interaktion wurde videographiert und das Verhalten anschließend kodiert. Ergebnisse: Im Experiment gestresste Personen erholten sich schneller vom Stress, je mehr positive Unterstützung sie von ihrem Partner erhielten. Dieser positive Effekt von Dyadischem Coping auf die biologische Stresserholung war jedoch für hoch bindungsängstliche Frauen reduziert. Zudem zeichneten sich diese Frauen durch eine oberflächlichere Stresskommunikation aus. Auf Seiten des unterstützenden Partners war hohe Bindungsangst der Frauen mit einer niedrigeren Unterstützungsqualität verbunden. Männer hingegen, gewährten umso mehr emotionsbezogene Unterstützung, je höher ihre selbstberichtete Bindungsangst war. Bindungsvermeidung hatte insgesamt wenig Effekte auf den Prozess des Dyadischen Copings nach dem TSST. Diskussion/Schlussfolgerungen: Im Kontext von paarexternem Stress scheint vor allem für Frauen eine hohe Bindungsangst die positiven Effekte von Dyadischem Coping einzuschränken. Eine Möglichkeit der Berücksichtigung dieses Aspekts für die Paartherapie wird diskutiert. B 66 Das (merkwürdige) Blickverhalten von Psychopathen bei der Betrachtung von Gesichtsausdrücken Hedwig Eisenbarth (Universität Regensburg) Sarah Spanner (Universität Regensburg) Bernd Körber (Universität Regensburg) Abstract: Bisherige Untersuchungen haben mehrfach gezeigt, dass hoch psychopathische Menschen in der Verarbeitung von emotionalen Gesichtsausdrücken beeinträchtigt sind. Dies zeigt sich in einer schlechteren Kategorisierungsleistung und in einer reduzierten physiologischen Aktivität. Bei anderen Störungen, die mit einer schlechteren Emotionserkennung bei Gesichtsausdrücken verbunden sind, wie Schizophrenie oder Autismus, wurde ein abweichendes Betrachtungsverhalten bei emotionalen Gesichtsausdrücken gefunden. Daher wurde für die vorliegende Studie angenommen, dass sich hoch psychopathische Studenten von gering psychopatischen Studenten hinsichtlich ihres Betrachtungsverhaltens unterscheiden. 14 hoch und 14 gering psychopathische Studenten wurden aus einer Stichprobe von 500 Studenten anhand von PPI-R Werten ausgewählt. Mit einem Infrarot-Kamera-System wurden die Augenbewegungen der Probanden während zwei verschiedenen Aufgaben aufgezeichnet: Eine Suchaufgabe, in der die Probanden in einem Kreis noch neutralen Gesichtsausdrücken einen emotionalen Gesichtsausdruck finden müssen, sowie eine Free-viewing-Aufgabe, in der die Probanden frei Bilder von Gesichtsausdrücken explorieren konnten. In der Suchaufgabe zeigten sich Gruppenunterschiede hinsichtlich der Suchzeit für ängstliche Gesichter, sowie behaviorale Unterschiede. In der Free-viewing Aufgabe ergaben sich Gruppenunterschiede in der Anzahl der Fixationswechsel, die auf ein weniger effektives Betrachtungsverhalten schließen lässt. Zusätzlich ergaben sich Zusammenhänge zwischen den Blickbewegungen und der Bewertung der Bilder hinsichtlich Arousal. Damit ergaben sich nicht die erwarteten Gruppenunterschiede im Scanverhalten, wie sie bei hoch psychopathischen Kindern gefunden wurden. Allerdings konnten wir Hinweise für eine verringerte Ablenkbarkeit durch emotionale Gesichtsausdrücke finden, die mit bisherigen Befunden zur Verarbeitung von Gesichtsausdrücken bei psychopathischen Personen übereinstimmen. Die entsprechenden Gruppenunterschiede in der studentischen Stichprobe könnten die Basis für weitere Unterschiede in hoch psychopathischen Maßregelvollzugspatienten sein. B 67 Erhöhte Aktivität im orbitofrontalen Kortex bei Patienten mit bipolarer Störung und deren Verwandten ersten Grades: Hinweise auf einen neuen Endophänotypen Julia Linke (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Andrea V King (Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Marcella Rietschel (Abteilung für genetische Epidemiologie, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Jana Strohmaier (Abteilung für genetische Epidemiologie, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Michael G Hennerici (Neurologische Klinik, Universitätsklinikum, Mannheim) Achim Gass (Neurologische Klinik, Universitätsklinikum, Mannheim) Michèle Wessa (Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Abstract: Theoretischer Hintergrund Bei Patienten mit bipolarer Störung (BS) wurde unabhängig von der aktuellen Stimmung bei verschiedenen kognitiven und emotionalen Aufgaben eine erhöhte Aktivität des orbitofrontalen Kortex beobachtet, was vermuten lässt, dass es sich hierbei um einen Endophänotypen der BS handeln könnte. Der orbitofrontale Kortex ist relevant für das Erlernen von Belohnungskontingenzen und der entsprechenden Anpassung des Verhaltens, so dass negative Konsequenzen minimiert werden. Beeinträchtigungen dieser Fähigkeit wurden bei Patienten mit BS auf Verhaltensebene ebenfalls unabhängig von der aktuellen Stimmung beobachtet. Methoden Wir untersuchten 19 euthyme Patienten mit BS, 22 gesunde Verwandte ersten Grades von Patienten mit BS und 41 gesunde Kontrollen in deren Verwandtschaft ersten Grades keine psychotischen oder affektiven Störungen auftraten. Alle Teilnehmer bearbeiteten eine probabilistische Lernaufgabe, bei der sich die Belohnungskontingenzen wiederholt ändern, während einer funktionellen Messung im Magnetresonanztomographen. Ergebnisse Im Vergleich zur parallelisierten Kontrollgruppe zeigten Patienten mit BS signifikant höhere Aktivität im medialen und lateralen orbitofrontalen Kortex und der rechten Amygdala, wenn sich die Belohnungskontingenzen änderten. Gesunde Verwandte ersten Grades von Patienten mit BS zeigten ebenfalls eine signifikant erhöhte Aktivität im medialen orbitofrontalen Kortex und der rechten Amygdala, bei sich verändernden Belohnungskontingenzen. Auf Verhaltensebene wurden keine Unterschiede zwischen den Gruppen beobachtet. Diskussion Eine Anpassung an sich veränderte Belohnungskontingenzen ist sowohl bei euthymen Patienten mit BS als auch bei gesunden Verwandten mit BS nur durch erhöhte neuronale Aktivität im medialen orbitofrontalen Kortex möglich. Es wird vermutet, dass in Krankheitsphasen diese kompensatorische Aktivität nicht mehr ausreicht, da dann eventuell weit reichende neuronale Netzwerke betroffen sind, was dann zu Auffälligkeiten auf der Verhaltensebene führt. Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass erhöhte Aktivität im medialen orbitofrontalen Kortex ein Endophänotyp der BS ist. Die weitergehende Untersuchung genetischer und Umweltfaktoren, die mit diesem Endophänotypen assoziiert sind, kann unser Ätiologieverständnis der BS entscheidend verbessern. B 68 Frequenz vs. Intensität: was sollte man als verbalen Anker in Fragebögen nutzen? Julia Krabbe (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie RWTH Aachen) Siegfried Gauggel (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Verena Vorhold (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Thomas Forkmann (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Depression als psychische Erkrankung wird nach den gängigen Klassifikationssystemen durch die Frequenz und Intensität der auftretenden Symptome charakterisiert. In klinischen Fragebögen finden sich aber nur Fragen nach einem der beiden Aspekte. Unklar ist, wie gut Patienten in der Lage sind, hierbei verwendete unscharfe Frequenz- oder Intensitätswörter zu differenzieren und inwieweit es Unterschiede zwischen beiden Skalierungen gibt. Methode Vierundvierzig Patienten, die an einer depressiven Störung litten, nahmen an der Studie teil (Alter M=39.1, SD=15.2, 68.2% Frauen). Alle Patienten füllten bei Beginn und eine Woche später das BeckDepressionsinventar, die Symptomcheckliste und den Wortschatztest sowie Listen mit Frequenz- bzw. Intensitätsbegriffen aus, die hinsichtlich ihrer wahrgenommenen Zeitabdeckung bzw. Intensität beurteilt werden sollten. Die Datenanalyse erfolgte mittels T-Tests und Effektstärken d inkl. Konfidenzintervallen (KI) nach Cohen. Ergebnisse Die Retest-Stabilität der Frequenzwörterbeurteilung war sowohl auf Einzelitemebene als auch im Vergleich der gemittelten Standardabweichungen im 1-Wochenintervall größer als die der Intensitätswörter (dFrequenz=.03, KI-.39–.45; dIntensität=.41, KI.00–.83). In der Frequenzskalierung konnten Patienten maximal vier verschiedene Wörter zuverlässig differenzieren (Kriterium: Abstand 1 Standardabweichung), in der Intensitätsskalierung nur drei. Die Übereinstimmung der Patienten auf dem Einzelitem änderte sich für die Frequenz nicht über die Zeit, bei der Intensität war eine Tendenz der zeitlichen Instabilität zu erkennen. Diskussion Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Patienten höchstens drei verschiedene Intensitäts- oder vier Frequenzwörter in einer gemeinsamen Skala differenzieren können. Die subjektive Bedeutung von Frequenzwörtern scheint zudem zeitlich stabiler zu sein als die von Intensitätswörtern. Frequenzskalierte Selbstbeurteilungsinstrumente scheinen demnach solchen mit einer Intensitätsskalierung vorzuziehen zu sein. Schlussfolgerungen Bei der zukünftigen Entwicklung klinischer Selbstbeurteilungsinstrumente sollte berücksichtigt werden, dass Patienten Schwierigkeiten damit haben können, unscharfe Zeit- bzw. Intensitätswörter, wie sie häufig als verbale Anker verwendet werden, voneinander zu differenzieren. Zukünftige Studien sollten untersuchen, inwieweit es diesbezügliche Unterschiede zwischen verschiedenen Störungsgruppen gibt. B 69 Körperbild bei Männern Ina Beintner (Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden) Katharina Liebscher (Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden) Abstract: Hintergrund: Es gibt Hinweise darauf, dass Körperschemastörungen vermehrt auch bei Männern auftreten. Diese Körperschemastörungen können ein klinisch bedeutsames Ausmaß annehmen (Muscle Dysmorphia). Betroffene nehmen sich als nicht muskulös genug wahr, trainieren exzessiv, weisen ein gestörtes Essverhalten auf und sind im sozialen und beruflichen Bereich beeinträchtigt. Zusätzlich besteht ein erhöhtes Risiko für Substanzmissbrauch (anabole Steroide). Bisher wurden Körperschemastörungen bei Männern vor allem in den USA und in Großbritannien untersucht. Für den deutschen Sprachraum liegen bisher keine systematischen Studien vor. Ziele: In einer explorativen Studie wurde untersucht, inwiefern Körperschemastörungen bei Männern auch im deutschen Sprachraum auftreten und mit welchen Verhaltensweisen und Merkmalen sie assoziiert sind. Methode: Untersucht wurden Männer, die verschiedene Sportarten betreiben sowie Männer, die nicht regelmäßig Sport treiben. Erhoben wurden Sportverhalten, Körperschemastörungen, Essverhalten, Substanzkonsum, allgemeine Psychopathologie sowie Persönlichkeitsvariablen. Ergebnisse: Insgesamt waren in der deutschen Stichprobe Körperschemastörungen im Mittel geringer ausgeprägt als in den Stichproben amerikanischer Untersuchungen. Kraftsportler berichteten mehr Body Checking und hatten ein höheres Streben nach Muskelmasse als Männer, die andere Sportarten ausüben. Das Körperbild von Männern scheint 2 Dimensionen zu haben: Zufriedenheit mit Figur und Gewicht allgemein und Zufriedenheit mit der Muskelmasse. Geringere Zufriedenheit mit Figur und Gewicht allgemein geht einher mit gezügeltem Essverhalten und essensbezogenen Sorgen, Body Checking, höherem Perfektionismus und niedrigerem Selbstwertgefühl sowie weniger getriebenem Krafttraining. Geringere Zufriedenheit mit der Muskelmasse geht einher mit getriebenem Krafttraining, Body Checking und weniger gezügeltem Essverhalten. Probanden, die Symptome der Muscle Dysmorphia zeigen, berichten mehr Body Checking, mehr getriebenes Sporttreiben, größere Auffälligkeiten in ernährungs- und körperbezogenen Einstellungen, ein höheres Streben nach Muskelmasse, eine höhere Belastung mit allgemeinen psychopathologischen Symptomen, ein geringeres Selbstwertgefühl und höheren Perfektionismus. Diskussion: Die Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, dass Körperschemastörungen bei Männern mit dysfunktionalen Verhaltensweisen und einer höheren allgemeinen psychopathologischen Symptombelastung einhergehen. B 71 Gefühlskalt und apathisch? - Empathiefähigkeit und emotionale Defizite bei psychopathischen Menschen Katharina Anna Fuchs (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) Georg W. Alpers (Universität Mannheim) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Eine bedeutsame Charaktereigenschaft psychopathischer Menschen ist der abgeflachte Affekt und eine verringerte Reagibilität im Hinblick auf emotionale Reize. Weiter weisen sie Störungen im Sozialverhalten sowie eine gering ausgeprägte Empathiefähigkeit auf, was sich in Problemen der Perspektivenübernahme oder des Mitgefühls äußert. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Einschränkungen in der Emotionalität und Empathiefähigkeit bei psychopathischen Menschen für deren Straftaten und aggressiv-gleichgültiges Verhalten gegenüber anderen Menschen verantwortlich sind. Diese Studie ist die erste, die emotionale und empathische Fähigkeiten parallel an einer psychopathischen Stichprobe untersucht. Methode: Zwei Gruppen von Strafgefangenen (Qualifikationskurs und Sexualstraftäter) wurden mittels der deutschsprachigen Version des Psychopathy Personality Inventory (PPI-R; Alpers & Eisenbarth, 2008) bezüglich ihrer psychopathischen Ausprägungen untersucht. Die emotionalen Fähigkeiten wurden mit dem FEEL-Test (Kessler et al., 2002) erhoben. Um zwischen der affektiven und kognitiven Komponente der Empathie zu unterscheiden, wurde der computer-basierte Multifaceted Empathy Test (MET; Dziobek et al., 2009) verwendet. Ergebnisse: Die größten Schwierigkeiten zeigen sich in der korrekten Identifikation der Emotion Angst. Am besten erkannt wurde die Emotion Ärger. Im Gruppenvergleich sind signifikante Differenzen in der korrekten Recognition der Emotion Freude nachweisbar. Kontrastierend zu bisherigen Ergebnissen weisen die Insassen aus dem Qualifikationskurs signifikant negative Korrelationen zwischen Psychopathie und der kognitiven Komponente der Empathie auf. In der Gruppe der Sexualstraftäter besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Psychopathie und negativ emotionaler Empathie. Diskussion: Ärger ist bei Straftätern eine dominante Emotion, was häufig zu einer Missinterpretation positiver Emotionen als Ärger führt. Ferner unterstreichen die Ergebnisse die postulierten Defizite psychopathischer Personen in emotionaler Empathie. Allerdings verdeutlichen sie auch, dass die Annahme, Psychopathen erzielen höhere Werte auf der kognitiven Komponente der Empathie nur partiell zu bestätigen ist, da auch empathische Fähigkeiten im Bereich der emotionalen Empathie nachweisbar sind. Schlussfolgerungen: Die Defizite in emotionalen und empathischen Fähigkeiten sind dementsprechend nicht so klar umrissen wie in der Theorie angenommen. B 72 Kann die Mentalisierungsfähigkeit bei Patienten mit psychischen Erkrankungen über ein Selbsteinschätzungsinstrument erfasst werden? Maria Hausberg (Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Holger Schulz (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Theo Piegler (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Bethesda Allgemeines Krankenhaus Bergedorf) Claas Happach (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Bethesda Allgemeines Krankenhaus Bergedorf) Michael Klöpper (Arbeitsgemeinschaft für integrative Psychoanalyse, Psychotherapie & Psychosomatik Hamburg e.V.) Anna Levke Brütt (nstitut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Isa Sammet (Psychiatrische Klinik Münsterlingen) Sylke Andreas (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Abstract: Das von Fonagy und Kollegen (1997) beschriebene Konzept der Mentalisierung gewinnt für die Behandlung psychischer Erkrankungen stetig an Bedeutung. Die Wirksamkeit der mentalisierungsbasierten Behandlung (MBT) konnte insbesondere für Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung nachgewiesen werden. Zur Überprüfung der Effektivität der MBT wird bislang die „Reflective Self Functioning Scale“ eingesetzt, die erlaubt die reflexive Funktion auf der Basis eines ausführlichen Interviews mit dem Patienten zu beurteilen. Es existiert jedoch noch kein therapiespezifisches, zeitökonomisches Instrument, welches die Mentalisierungsfähigkeit aus Patientenperspektive selbst erfassen würde. Zielsetzung der Studie ist es deswegen, ein Selbsteinschätzungsinstrument zur Mentalisierungsfähigkeit zu entwickeln und zu validieren. In einem mehrstufigen, expertengestützten und konsensbasiertem Vorgehen wurde ein Fragebogen mit 40 Items entwickelt. In einer ersten Studie an N=97 stationären Patienten (Psychiatrie) wurde mittels Hauptkomponentenanalyse die Faktorenstruktur des Instrumentes entwickelt und anschließend an einer weiteren Stichprobe von N=337 Patienten (Psychosomatik) konfirmatorisch getestet. Neben dem Mentalisierungsfragebogen wurden noch weitere Skalen in der Studie eingesetzt (z.B. SymptomChecklist-14, Liste Pathogener Überzeugungen, Skalen zum Erleben von Emotionen). Es konnte eine stabile 4-Faktorenstruktur gefunden werden (aufgeklärte Varianz 59%, alpha zwischen 0,62 und 0,72), zudem zeigten sich signifikante Korrelationen des Mentalisierungsfragebogens mit verwandten Skalen. Zwischen Patienten mit und ohne Selbstverletzendem Verhalten und solchen mit und ohne Suizidversuch in der Vergangenheit vermag der Fragebogen zu diskriminieren, dies trifft auch auf weitere relevante Kriterien (z.B. Bindungstyp) zu. Der Stichprobenumfang und die Charakteristika (z.B. Patientenmerkmale) der Konstruktionsstichprobe sollten bei der Interpretation der Ergebnisse kritisch berücksichtigt werden. In einem weiteren Schritt sollte die Faktorenstruktur des Fragebogens an einer größeren, klinisch heterogenen Stichprobe überprüft und eine externe Validierung der Skala anhand von Therapeutenurteilen erfolgen. Das entwickelte Selbstbeurteilungsinstrument kann insgesamt als praktikabel, reliabel und valide angesehen werden, wobei eine erneute Überprüfung auf der Basis einer breitbreiteren Datengrundlage wünschenswert wäre. B 73 Effekte von Nahrungsdeprivation auf die Wahrnehmung interner Körpersignale, autonom-nervöse Aktivität und Gefühle: Implikationen für Essstörungen Beate M. Herbert (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Forschungsabteilung, Universitätsklinik Tübingen, Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Abstract: 1.Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Eine veränderte Körperwahrnehmung wird als wesentlicher Faktor bei Genese und Aufrechterhaltung von Essstörungen diskutiert. Insbesondere eine inadäquate Perzeption interner Körpersignale (Interozeption), v.a. der Hungerwahrnehmung aber auch anderer interozeptiver Reize, wurden im Gefolge von Essstörungen dokumentiert. Ungeklärt ist inwieweit diese Symptome in Reaktion auf Nahrungsdeprivation assoziiert mit psychophysiologischen Veränderungen bei vorab gesunden Personen induzierbar sind. Bisherige Forschung demonstriert die Relevanz interozeptiver Wahrnehmung für die Emotionswahrnehmung und –verarbeitung sowie kognitive Prozesse und die der Interozeption zugrunde liegenden zentralnervösen Mechanismen. Basierend darauf war das Hauptanliegen der Studie die Untersuchung von Auswirkungen von Nahrungsdeprivation bei gesunden jungen Frauen auf Veränderungen der interozeptiven Wahrnehmung, inklusive des Hungererlebens, in Interaktion mit Veränderungen autonom-nervöser Aktivierung und dem subjektiven Erleben. 2.Methode: Interozeptive Sensitivität wurde anhand eines Kardiozeptionstests vor und nach 24stündigen, kontrollierten Fastens bei 20 gesunden Frauen untersucht. Subjektives Hungerleben, autonom-nervöse kardiale Aktivität, kardiodynamische Veränderungen (Impedanzkardiographie) und subjektive Ratings des Befindens wurden examiniert. 3.Ergebnisse: Es zeigt sich eine Sensitivierung der interozeptiven, kardialen Wahrnehmung. Diese ist positiv mit der Intensität des Hungererlebens sowie mit der Zunahme an sympathischer Aktivierung und kardiodynamischen Veränderungen assoziiert. Hungererleben, negatives Befinden sowie negatives Erleben interozeptiver Reize sind invers mit der vagalen Aktivität korreliert. 4.Diskussion: Kurzfristige Nahrungsdeprivation induziert eine über autonom-nervöse Veränderungen vermittelte Intensivierung der interozeptiven Wahrnehmung, die nicht auf Hunger beschränkt ist, jedoch mit dieser Modalität positiv assoziiert ist. Die individuelle autonom-nervöse Aktivierung erwies sich als selbst-regulatorisch wichtiger Indikator für die Bewertung interozeptiver Signale sowie des subjektiven Befindens. 5.Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse werden im Rahmen aktueller Modelle zur Bedeutung interozeptiver Körperwahrnehmung bei Essstörungen diskutiert und im Hinblick auf Veränderungen bei chronischem Fasten beleuchtet. Die eruierten Effekte sind zudem von Bedeutung für die Aufrechterhaltung von binge eating. B 74 Persönlichkeitsstörungen und Drogenkonsum Martin Steppan (Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Klinische Praktiker berichten von „typischen“ Persönlichkeitsstörungen bei Drogenabhängigen und umgekehrt. Obwohl einige Untersuchungen hierzu vorliegen, gibt es dazu keine ätiologischen Erkenntnisse. Dabei kommen zwei Haupthypothesen in Frage: (1) psychologisch: a) verschiedene Substanzen eignen sich in unterschiedlichem Maße zur Selbstmedikation von „Symptomen“ der Persönlichkeitsstörungen und komorbider Störungen; b) verschiedene Persönlichkeitsstörungen lassen sich als Extremvarianten allgemeiner Persönlichkeitsdimensionen auffassen, die einen neurobiologisch oder attributionstheoretisch fundierten Zusammenhang mit dem hedonischen Erleben (z.B. Eysenck’sche Drogenpostulat) einer Substanz aufweisen oder c) die Probierwahrscheinlichkeit erhöhen (z.B Sensation Seeking) (2) milieutheoretisch: gewisse Persönlichkeitsstörungen könnten durch Selbstselektion, Erziehungsstil, Genetik, Modelllernen in verschiedenen Milieus gehäuft auftreten, wodurch sekundär die Substanzaffinität bedingt wird. Fragestellung: Auf Basis von Routinedaten der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS), in der jährlich diagnostische Daten von über 300.000 Personen dokumentiert werden, wurde untersucht, ob sich (I) Zusammenhänge zwischen Substanz-bezogenen Störungen (operationalisiert durch eine entsprechende Diagnose) und Persönlichkeitsstörungen (analog ICD-10) replizieren lassen; (II) welches ätiologische Modell (psychologisch versus milieutheoretisch) dafür am plausibelsten ist; (III) ob diese Befunde mit Expertenmeinungen übereinstimmen. Methode: In der untersuchten Datenbank der DSHS (2004-2009) wurden (I) Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsstörung und Substanz-bezogener Störung anhand binär-logistischer Regression überprüft; (II) mithilfe von Pfadmodellen wurde die unterschiedlichen ätiologischen Hypothesen hinsichtlich ihrer Anpassungsgüte überprüft;; (III) eine Expertenbefragung bei 100 Einrichtungen der Suchthilfe wurde durchgeführt. Milieu wurde durch Schulausbildung, Erwerbsstatus und Migrationsstatus operationalisiert. Daten zu den Big Five wurden für auf Basis einer Metaanalyse imputiert. Ergebnisse / Diskussion / Schlussfolgerungen: (a) unterschiedliche Drogenaffinitäten der einzelnen Persönlichkeitsstörungen konnten repliziert werden, wobei Cluster C (OR=6.5) und A (OR=2.9) häufig mit Alkohol-bezogenen Störungen und Cluster B mit illegalen Drogen assoziiert sind (höchstes OR für Opiate=2.0); (b) Milieutheoretische Erklärungen sind unwahrscheinlich, während Big Five (besonders Verträglichkeit; ΔR² bis zu 16%) Erklärungswert für die unterschiedliche Drogenaffinität der Persönlichkeitsstörungen aufweisen; (c) Experten schätzen Zusammenhänge signifikant richtig ein (r=.47**), wobei manche Zusammenhangsmuster unterschätzt werden (z.B. schizoide PS und Alkoholabhängigkeit). B 75 Prävalenz der exzessiven Nutzung von Online-Rollenspielen: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Suchtberatern, Klinikern und Therapeuten Frank Meyer (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Johanna Pauls (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Reinhard Pietrowsky (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Abstract: Das Phänomen der exzessiven Nutzung von sog. Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMOPRGs) hat die Diskussion um die klinische Relevanz des Symptomkomplexes der Internet- und Computerspielsucht in den vergangenen Jahren verschärft. Demographische Untersuchungen zum Nutzungsverhalten weisen für Nutzer von Online-Rollenspielen ein zum Teil erhebliches Gefährdungspotential aus. Durch das Fehlen einheitlicher Diagnosekriterien werden Prävalenzschätzungen jedoch erschwert und schwanken je nach untersuchter Stichprobe zwischen <1% und >30% (Petersen, Weymann, Schelb, Thiel & Thomasius, 2009; Shaw & Black, 2008). Unklar ist auch inwieweit diese Schätzungen eine Entsprechung in der klini-schen Praxis finden, d.h. Betroffene tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mit dem Ziel einer repräsentativen Befragung wurde eine bundesweite Anfrage an Beratungsstellen und Kliniken gerichtet und durch eine randomisierte Stichprobe von 500 niedergelassenen Therapeuten ergänzt. Die Ziehung erfolgte auf Landes-ebene unter Berücksichtigung der Zulassungszahlen der Psychotherapeutenkammern sowie der Bevölkerungsdichte der Bundesländer. Durch persönliche Kontaktaufnahme und Erklärung des Studienhintergrunds (Telefon, Email, Postweg) konnte eine selektive Rückantwort themeninteressierter Spezialisten weitgehend vermieden werden. Die eigentliche Datensammlung erfolgte mittels eines Online-Fragebogens. Neben demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Berufsfeld, therapeutische Ausrichtung) wurden Einstellungen zum potentiellen Störungsbild sowie Angaben zu Prävalenz und Umgang im beruflichen Alltag (u.a. Häufigkeit, diagnostisches Vorgehen, Therapieansätze) differenziert erfasst. 550 Datensätze gingen in die Auswertung ein. Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass Internet- und Computerspielsucht von einer deutlichen Mehrheit der Befragten als klinisches Problem betrachtet wird. 77% geben an, der Symptomatik im Praxisalltag bereits begegnet zu sein, wobei 45% in mindestens einem Fall eine Klassifikation als Primärstörung gerechtfertigt sahen. Die höchste Relevanz besitzt der Subtyp der Computerspielsucht. Der Schwerpunkt der Betroffenen liegt in der Altersgruppe der 20 bis 30-Jährigen. Eine Hochrechnung der Patientenzahlen wird im Kontext bestehender Prävalenzschätzungen diskutiert. B 76 Interventionen zur Verbesserung des Zugangs zu professioneller Hilfe bei psychischen Folgen interpersoneller Traumatisierung Viola Schreiber (Schoen-Klinik Roseneck) Andreas Maercker (Psychopathologie und Klinische Intervention, Universität Zürich) Babette Renneberg (Freie Universität Berlin) Abstract: Ein bedeutender Anteil der Überlebenden interpersoneller Traumatisierung nimmt nie professionelle Hilfe für psychische Probleme in Anspruch. Der individuelle Prozess des Hilfesuchens wird von Barrieren wie auch Promotoren beeinflusst, welche im Hilfssystem selbst, in den gesellschaftlich dominierenden Einstellungen und dem öffentlichen Wissen verwurzelt sind. Damit professionelle Hilfe für psychische Probleme für all jene verfügbar und offen ist, welche sie brauchen und wünschen, müssen Interventionen entwickelt werden, welche die Barrieren abbauen und die Promotoren stärken. In einem offenen Frageformat wurden Überlebende interpersoneller Gewalt wie auch professionelle Helfer, die mit dieser Population arbeiten, nach ihren Erfahrungen und Ideen gefragt, was Betroffenen den Zugang zu professioneller Hilfe erleichtern würde. Die Antworten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Die herausgearbeiteten Interventionen wurden unter Zuhilfenahme eines integrativen Modells zur Inanspruchnahme professioneller Hilfe nach Traumatisierung gebündelt und Hauptstrategien abgeleitet. Die Teilnehmer empfahlen eine große Bandbreite an Interventionen, wobei der Schwerpunkt auf Faktoren des Hilfssystems lag. Für diese wurden auch die Interventionsstrategien mit der größten Praxisnähe abgeleitet: Diagnostik, Informationen und Edukation; Netzwerkarbeit und Überweisung sowie Stärkung der Ressourcen und Gewährleistung von Sensitivität und Sorge für besondere Bedürfnisse. Einige der Interventionen können bereits von isolierten Anbietern im Hilfssysem umgesetzt werden. Nachhaltige Bemühungen zur Verbesserung des Zugangs zu professioneller Hilfe nach interpersoneller Traumatisierung müssen jedoch verschiedene Strategien aufeinander abstimmen, um der Vielzahl der Einflussfaktoren auf den Prozess des Hilfesuchens gerecht zu werden. B 77 Ist eine hohe allgemeine Lebendigkeit des Vorstellungsvermögens ein Risikofaktor für intrusive traumabezogene Erinnerungen? Eine Analogstudie Abstract: Theoretischer Hintergrund: Traumatische Erlebnisse können zur Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen. Eines der Kernmerkmale der PTBS sind intrusive Erinnerungen an das traumatische Erleben. Diese Studie ging der Frage nach, ob Menschen, die eine hohe allgemeine Lebendigkeit des Vorstellungsvermögens aufweisen, ein höheres Risiko für die Entwicklung intrusiver Erinnerungen nach einem belastendes Erlebnis haben. Die Ergebnisse könnten erste Aussagen zur Rolle der pretraumatischen Lebendigkeit des Vorstellungsvermögens bei der Entwicklung von PTBS erlauben. Methode: 67 Studienteilnehmern wurde ein belastender Film (Analogstressor) dargeboten und sie füllten davor bzw. danach u.a. Fragebögen zu Affekt, Vorstellungsvermögen, und peritraumatischem Verarbeitungsstil aus. Desweiteren wurden während der Sitzung sowie an den fünf darauf folgenden Tagen filmbezogene Intrusionen mit Hilfe eines Fragebogens erfasst. Ergebnisse: Die berichtete allgemeine Lebendigkeit des Vorstellungsvermögens vor dem Analogstressor korrelierte signifikant positiv zusammen mit der Anzahl, Lebendigkeit sowie Belastung durch intrusive Erinnerungen an den Analogstressor sowohl während der Sitzung als auch an den fünf darauffolgenden Tagen. Ähnliche Ergebnisse wurden auch hinsichtlich des peritraumatischen perzeptuellen Verarbeitungsstils gefunden. Diskussion und Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein erhöhtes allgemeines Vorstellungsvermögen einen Risikofaktor für die Bearbeitung von belastenden Erlebnissen darstellen könnte. Postersession 3 Fr 03.06.11 von 16:30-18:00 Uhr C 01 „Ich spüre ganz genau, wie mein Herz schlägt!“ Herzratenwahrnehmung bei sozialer Angst Barbara Cludius (Justus-Liebig-Universität Gießen) Stephan Stevens (Justus-Liebig-Universität Gießen) Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Anna Silkens (Justus-Liebig-Universität Gießen) Michelle G. Craske (University of California) Christiane Hermann (Justus-Liebig-Universität Gießen) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Eine genauere Wahrnehmung somatischer Empfindungen, als TraitEigenschaft oder situativ durch erhöhte Selbstaufmerksamkeit bedingt, könnte gemäß kognitiver Modelle der Sozialen Phobie den Erwerb und die Aufrechterhaltung sozialer Angst begünstigen (Clark und Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997). Bislang wurde die interozeptive Sensitivität bei Personen mit sozialer Angst nicht systematisch überprüft. Fragestellung: In dieser Studie wurde die Herzratenwahrnehmung in Abhängigkeit der Ausprägung sozialer Ängstlichkeit gemessen. Außerdem wurde interozeptive Sensitivität in Ruhe sowie nach Induktion situativer Angst durch¬geführt. Es wurde erwartet, dass hochsozialängstliche Probanden akkurater in ihrer Herzratenwahrnehmung sind als niedrigsozialängstliche, insbesondere bei Angstinduktion und der damit einhergehenden Aufmerksamkeitsverlagerung und kognitiven Verzerrung. . Methode: In einer Baselinephase und während der Antizipation einer öffentlichen Rede schätzten 48 hoch- und niedrigsozialängstliche Teilnehmer (eingeteilt nach Ausprägung auf der „Skala Angst vor Negativer Bewertung“) ihre Herzrate mit der Mental–Tracking-Aufgabe von Schandry (1981) ein. Gleichzeitig wurde die Herzrate mittels EKG erfasst. Ergebnisse: Die hochsozialängstlichen Teilnehmer waren in Ruhe und während Antizipation der Rede akkurater in ihrer Herzratenwahrnehmung als die niedrigsozialängstlichen. In beiden Gruppen war die Antizipationsphase mit einem signifikanten Angstanstieg verbunden, der bei den Hochsozialängstlichen wie erwartet signifikant stärker war. Die Angstinduktion hatte allerdings in beiden Gruppen keinen Einfluss auf die Wahrnehmungsgenauigkeit. Ca. 90% der Probanden, die gemäß dem Kriterium des geringsten Unterschieds zwischen tatsächlichen und gezählten Herzschlägen als akkurat wahrnehmend klassifiziert wurden, waren hochsozialängstlich. Diskussion und Schlussfolgerung: Im Vergleich zu niedrigsozialängstlichen Personen verfügen Hochsozialängstliche über eine genauere Herzratenwahrnehmung und zwar nicht nur in Angst auslösenden Situationen. Diese Befunde stimmen mit früheren Beobachtungen überein, dass es sich bei interozeptiver Sensitivität um einen vergleichsweise situationsunabhängigen und überdauernden Trait handelt. Eine bessere interozeptive Sensitivität könnte dazu führen, dass soziale Situationen schneller als bedrohlich erlebt werden und somit zur Entwicklung und Aufrechterhaltung pathologischer sozialer Angst beitragen. C 02 Abruf des Löschungsgedächtnisses bei Zahnbehandlungsphobikern Karin Elsesser (Bergische Universität Wuppertal) Andrè Wannemüller (Bergische Universität Wuppertal) Peter Jöhren (Zahnmedizinische Tagesklinik Bochum) Gudrun Sartory (Bergische Universität Wuppertal) Abstract: Hintergrund: Partielle Rückfälle nach erfolgreicher Behandlung mit Reizkonfrontation (RK) werden in aktuellen lerntheoretischen Modellen in Zusammenhang mit Kontextfaktoren diskutiert. In einem neuen Kontext ist demzufolge der Abruf von Assoziationen aus der Therapie (phobischer Reiz – keine Gefahr) nicht stimmig und die ursprüngliche Assoziation (phobischer Reiz – Gefahr) wird wieder verhaltenswirksam. Ein aktiver Abruf des Löschungskontextes bei relevanter Stimuluskonstellation sollte zur Angstreduktion und damit Aufrechterhaltung des Therapieerfolges beitragen. Methode: 72 Zahnbehandlungsphobiker wurden mit RK behandelt. Bei der Nachuntersuchung erhielt je die Hälfte der Patienten die Aufforderung sich die Habituationssituation der RK-Sitzung bzw. eine Kontrollvorstellung (Ereignisse des aktuellen Tages) in Erinnerung zu rufen. Es wurden physiologische, behaviorale und subjektive Maße der Angst erhoben. Ergebnisse: Die Patienten zeigten nach der RK einen deutlichen Rückgang der phobischen Angst. Bei der Nachuntersuchung ging der Abruf des Löschungsgedächtnisses partiell mit weniger ausgeprägtem Vermeidungsverhalten einher als der Abruf der Kontrollvorstellung. Zudem konnte gezeigt werden, dass das Ausmaß der Angstreduktion unmittelbar nach der RK und die Einhaltung von Zahnarztterminen in der Folgezeit in negativem Zusammenhang mit dysfunktionalen Kognitionen steht. Die Befunde liefern Hinweise zur Frage der differentiellen Therapieindikation. C 03 Übermut tut selten gut ?! Sind externalisierende Störungen ein Risikofaktor für Angststörungen? Susanne Knappe (Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden) Katja Beesdo-Baum (Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden) Roselind Lieb (Universität Basel) Hans-Ulrich Wittchen (Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden) Abstract: Die vielfach beschriebene Komorbidität von Angststörungen (AS) untereinander, zu depressiven und Substanzstörungen prägt unser Verständnis über ihre Struktur, Ätiologie und Nosologie maßgeblich. Interessanterweise werden Komorbiditäten zwischen -überwiegend im Kindes- und Jugendalter einsetzenden- Angststörungen und ebenfalls früh beginnenden externalisierenden Störungen (ADHD, Störungen des Sozialverhaltens, Oppositionelles Trotzverhalten) weniger systematisch untersucht. Häufigkeiten früher externalisierender Störungen bei Personen mit und ohne AS, die zeitlichen Beziehungen zueinander, und Prädiktoren ihres gemeinsamen Auftretens sollen daher ermittelt werden. Für 1053 Jugendliche der prospektiv-longitudinalen EDSP-Studie wurden AS und andere psychische Störungen sowie putative Risikofaktoren zu Baseline und in 3 Folgewellen mittels M-CIDI erhoben. Eltern-Interviews lieferten Angaben zu Kernsymptomen und Erstauftretensalter externalisierender Störungen. Regressions- und Kaplan-Meier-Analysen bilden quer- und längsschnittliche Assoziationen zwischen den Störungsbildern sowie mögliche Risikofaktoren ab. Unter Befragten mit einer AS zeigten 8.3% Kernsymptome einer externalisierenden Störung (vs. 6.3% ohne AS). Außer für Spezifische Phobien waren ADHD (OR zwischen 5.0-10.1, p<0.05), Störungen des Sozialverhaltens (1.9-9.5, p<0.05) und Oppositionelles Trotzverhalten (5.5-18.9, p<0.05) mit AS (Soziale Phobie, Agoraphobie, Panikstörung, Generalisierte AS, Zwangsstörung) assoziiert, auch nach Kontrolle für Geschlecht und komorbide depressive Störungen. Zumeist (71.1%) gingen externalisierende den AS voraus; prospektiv bestand eine Risikoerhöhung für inzidente AS bei vorausgehenden externalisierenden Störungen. Die Ergebnisse illustrieren eine bemerkenswerte Komorbidität zwischen AS und externalisierenden Störungen im Kindes- und Jugendalter. Möglicherweise sind externalisierende Störungen mit ungünstigen Bewertungen der Umwelt verbunden, und prädisponieren derart für nachfolgende AS. Auch können externalisierende Verhaltensweisen einen Versuch darstellen, Kontrolle über eine ängstigende Umwelt herzustellen. Für AS bestehen trotz ihrer Behandelbarkeit noch immer geringe Behandlungsraten; wertvoll erscheint es daher, externalisierende Verhaltensweisen als Indikator für nachfolgende AS und damit für eine frühzeitige Diagnose zu betrachten, wenn aufgrund des störenden externalisierenden Verhaltens eher/häufiger eine Versorgungseinrichtung aufgesucht wird. C 04 Der Einfluss der Genetik: Modulation der Angstreaktion bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie in Abhängigkeit von Risikogenvarianten. Jan Richter (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Christiane A. Melzig (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Alfons O. Hamm (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Eine geschätzte Heritabilität zwischen 40 und 50% belegen eine hohe genetische Vulnerabilität der Panikstörung. Dennoch lieferten die Analysen spezifischer genetischer Korrelate bisher keine eindeutigen Befunde. Die funktionale Analyse der genetischen Modulation der multimodalen Angstreaktionen innerhalb von Angst-Provokations-Test bietet eine Möglichkeit, den Einfluss genetischer Faktoren auf das Angsterleben gezielt zu untersuchen. Methode: In einer multizentrischen Studie wird aktuell der Einfluss von identifizierten Risikogenen auf die unmittelbaren psychophysiologischen Angstreaktionen von 345 Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie während eines standardisierten Verhaltenstests analysiert. Dieser beinhaltete nach einer 10-minütigen Antizipationsphase die Konfrontation mit einem kleinen, engen und von außen verschlossenen Raum über max. 10 Minuten, gefolgt von einer abschließenden 8-minütigen Erholungsphase. Eine multimodale Messung der Angst erfolgte dabei über die Abfrage der Intensität des subjektiven Erlebens von Angst und Paniksymptomen, der Beobachtung angstassoziierten Verhaltens (Vermeidung und Flucht) sowie einer kontinuierlichen Registrierung der Herzrate als Indikator der autonomen Erregung. Ergebnisse: Erste Analysen bestätigen eine Modulation der Angstreaktionen in Abhängigkeit spezifischer Risikogene. Träger des Risikoallels eines Polymorphismus des Neuropeptid-S-RezeptorGens zeigten beispielhaft eine mit aktuellen Tiermodellen vereinbare allgemein erhöhte autonome Erregung. In Verbindung mit dem durch die Konfrontation verursachten reizgebundenen Anstieg der Erregung führte der Niveauunterschied zum Erleben intensiverer Paniksymptome. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit des Erlebens neuer Panikattacken. Auch ein genetischer Einfluss auf die Verhaltensebene konnte nachgewiesen werden. Das Risikoallel eines Polymorphismus des Serotonin1A-Rezeptor-Gens war verbunden mit einer erhöhten Fluchtrate trotz vergleichbarem subjektivem Angsterleben. Diskussion und Schlussfolgerung: Diese Befunde bestätigen den genetischen Einfluss auf die unmittelbare Angstreaktion von Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie innerhalb eines standardisierten Verhaltenstests. Deren Implikationen für biologische und lerntheoretische Modelle der Panikstörungen werden diskutiert. Die Studie ist Teil des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsnetzwerkes Panikstörung (BMBF, DM3-FNEU02). C 05 Effect of Multiple Context Exposure Therapy on Renewal Phenomena youssef Shiban (Lehrstuhl für Psychologie I – Arbeitsbereich Interventionspsychologie, Institut für Psychologie, Universität Würzburg) Paul Pauli (Lehrstuhl für Psychologie I – Arbeitsbereich Interventionspsychologie, Institut für Psychologie, Universität Würzburg) Andreas Mühlberger (Lehrstuhl für Psychologie I – Arbeitsbereich Interventionspsychologie, Institut für Psychologie, Universität Würzburg) Abstract: Renewal of fear is one form of relapse accruing as a result of encounter with a feared object in a different context than the one the exposure therapy originally took place. In the current study we intended to demonstrate that, conducting exposure sessions in multiple contexts reduces renewal. In a virtual reality therapy-analogue experiment, extinction of fear of spiders was tested in a group of spider-phobic participants. Participants were randomly allocated to one of two groups: in the single context exposure group the exposure sessions consisted of four presentations of one virtual spider in a single virtual room, whereas in the multiple context exposure group, the sessions consisted of four exposures to the spider in four different virtual contexts. The procedure was followed by a test, in which the virtual spider was presented in a novel virtual context. Virtual reality exposure proved to be effective. As reflected in subjective ratings and a behavior assessment test, fear of spiders was significantly reduced in both groups within and between the exposures. As hypothesized, when participants were confronted with the virtual spider in a novel test context, renewal was observed in the single context group, but not in the multiple context group. These results support existing evidence for context dependence of extinction of fear and strongly suggest that the use of multiple contexts during extinction improves the generalizability of extinction in humans. Consequentially we would recommend the application of multiple context exposures in a clinical setting to reduce the likelihood of renewal. C 06 Entstehungsbedingungen initialer Panikattacken Jan Philip Stender (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Christiane A. Melzig (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Kristin Fenske (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Alfons O. Hamm (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Abstract: Hintergrund: 15-20% der Allgemeinbevölkerung erleben mindestens einmal einen Angstanfall, eine Angstattacke oder Panikattacke. Nur ein Bruchteil dieser Personen entwickelt in Folge dieser Panikattacke eine Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie. In der epidemiologischen Forschung werden verschiedene Faktoren als mögliche Bedingungen für das Auftreten einer initialen Panikattacke und in der Folge für die Ausbildung einer Panikstörung diskutiert. Zu diesen gehören u. a. die Schwere der initialen Panikattacke, kritische Lebensereignisse, subjektiv vorhandene Belastungen sowie bestehende psychische Erkrankungen. Methode: Im Rahmen einer epidemiologischen Studie in Vorpommern (SHIP) konnten 319 Personen mit initialen Panikattacken identifiziert und mit einem strukturierten Interview zur Erfassung der Charakteristika, Umstände und Reaktionen auf die initiale Panikattacke (IPA) befragt werden. Zusätzlich wurden sie mittels des Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI) untersucht und kritische Lebensereignisse strukturiert erfasst. Ergebnisse: Es konnten 58 Personen mit Angstanfällen, 99 mit Limited Symptom Attacks, 88 mit Panikattacken und 74 mit Panikstörung identifiziert werden. Generell waren diese Personen im Vorfeld des Anfalls bereits stärker durch komorbide psychische Erkrankungen und eine höhere Anzahl kritischer Lebensereignisse belastet als Personen einer parallelisierten Kontrollgruppe. Unter allen Personen mit Angstanfällen zeigte sich, dass insbesondere Personen, die eine Panikstörung entwickelten, im Vorfeld der initialen Panikattacke subjektiv stärker belastet waren, mehr komorbide psychische Erkrankungen hatten und mehr kritische Lebensereignisse erfuhren. Zudem erlebten sie verglichen mit Personen mit Panikattacken aber ohne Panikstörung symptomatisch schwerere initiale Panikattacken. Diskussion: Das Erleben eines Angstanfalls oder einer Panikattacke scheint ein Marker erhöhter psychischer Belastung zu sein. Die Höhe der Belastungen sowie die Charakteristik der initialen Panikattacke können wichtige Bedingungsfaktoren für die Entstehung einer Panikstörung sein. Ein möglicher dysfunktionaler Reaktionsstil sowie genetische Faktoren müssen in weiteren Analysen ebenfalls berücksichtigt werden. Schlussfolgerungen: Die Betrachtung der Belastungen im Vorfeld initialer Panikattacken stellt ein wichtiges Bestimmungsstück der Ursachen für das Erleben von Panikattacken sowie der Entwicklung gravierender Psychopathologie dar. C 07 Fühlen Sie sich jetzt besser als vor der Therapie? Direkte Veränderungsmessung nach einer Therapiestudie zur Errötungsangst Anke Heinrich (Technische Universität Dresden) Samia Chaker (Technische Universität Dresden) Jürgen Hoyer (Technische Universität Dresden) Abstract: Theorie: In den meisten Therapiestudien wird Veränderung über Mittelwertveränderungen störungsspezifischer Fragebögen oder über den diagnostischen Status erhoben. Dabei bleibt häufig unklar, was genau sich für die Teilnehmer verändert hat. In einer randomisierten kontrollierten Therapiestudie zur Behandlung der Errötungsangst mittels intensiver Gruppentherapie erfüllten 71% der Teilnehmer zur 6-Monats-Katamnese die Diagnosekriterien für die Soziale Angststörung nicht mehr. Es wird untersucht, ob sich die positiven Ergebnisse auch mittels direkter Veränderungsmessung erfassen lassen. Methode: Von n = 54 Teilnehmern der Therapiestudie zur Behandlung der Errötungsangst mittels intensiver Gruppentherapie liegen zur 12-Monats-Katamnese Daten des „Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens“ (VEV-R-2001, Zielke & Kopf-Mehnert, 2001) und der Selbsteinschätzung mittels Clinical Global Impression Scale - Change (CIPS, 2005). vor. Weiterhin wurden die Teilnehmer um Einschätzungen gebeten, was für sie in der Therapie besonders hilfreich und wichtig gewesen ist. Ergebnisse: Die Auswertung des VEV-R-2001 erbrachte bei 28% der Teilnehmer „keine Veränderung“, bei 9% „deutliche Verbesserungen“, bei 15% „starke Verbesserung“ und bei 48% „sehr starke Verbesserung“, eine Verschlechterung ergab sich bei keinem Teilnehmer. Die Selbsteinschätzung der Teilnehmer zeigt ein anderes Bild: nur 2% schätzen sich als „unverändert“ ein, 30% als „etwas gebessert“, 39% als „deutlich gebessert“ und 28% als „sehr deutlich gebessert“. Die Korrelation zwischen Selbsteinschätzung und dem Ergebnis der direkten Veränderungsmessung ist mit r = 0,36 mit p < 0,05 signifikant, aber nur moderat. Es finden sich keine Korrelationen zu soziodemographischen Variablen oder der Erfolgserwartung zu Therapiebeginn. Diskussion: Sowohl die störungsspezifischen Fragebögen, als auch die Therapieerfolgsmessung über das direkte Veränderungserleben, sowie die Selbsteinschätzung der Teilnehmer zeigen, dass die intensive Gruppentherapie zur Behandlung der Errötungsangst zu sehr positiven Ergebnissen führt. Die Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und Fragebogenerfassung der direkten Veränderungsmessung belegt jedoch die Bedeutung der Methodenvarianz und zeigt wie wichtig es ist, Therapieerfolg auf mehreren Ebenen zu operationalisieren. C 08 Körperdysmorphe Störung und soziale Phobie – so nah und doch so fern. Phänomenologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Anja Grocholewski (Universität Bielefeld) Nina Heinrichs (Universität Bielefeld) Abstract: Theoretischer Hintergrund/ Fragestellung: Die Körperdysmorphe Störung (KDS) und die Soziale Phobie (SP) zeigen zwar große Überlappung (Angst vor negativer Bewertung, hohe Komorbidität untereinander), heben sich aber andererseits deutlich voneinander ab (z.B. bezüglich komorbider Zwangssymptome; Aufmerksamkeitsfokus). Fragestellung: Wir erwarten keine Unterschiede hinsichtlich des Ausmaßes depressiver Symptome, globaler psychischer Belastung und globalem Selbstwert. Personen mit einer SP sollten ein höheres Ausmaß an sozialer Angst empfinden als KDS-Patienten, aber dafür ihr äußeres Erscheinungsbildes als weniger relevant erachten. Die einzigen zwischen SP und KDS differenzierenden Merkmale sind vermutlich das Ausmaß an kognitiver und motivationaler Verzerrung sowie Zwangssymptome bezüglich des eigenen Äußeren: hier erwarten wir unauffällige Werte für SP und klinisch auffällige Werte für KDS. Methoden: Von 40 Teilnehmern (n= 20 Personen mit KDS, n= 20 Personen mit SP) wurden unterschiedliche Selbstberichtsmaße (BDI; BSI; RSE; SPS/ SIAS; Appearance Schemas Inventory-Revised, ASI-R) ausgefüllt. Ferner wurde die für die KDS modifizierte Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (BDD-YBOCS) als Interview durchgeführt. Ergebnisse: Beide Gruppen erzielen in BDI, BSI, RSE und SPS/ SIAS Werte im klinischen Bereich. KDS und SP unterscheiden sich nicht bedeutsam hinsichtlich depressiver Symptome, globaler psychischer Belastung und Selbstwert. In Bezug auf soziale Ängste fand sich kein Unterschied hinsichtlich der Angst in Leistungssituationen, aber in Bezug auf Interaktionssituationen zeigten die Personen mit SP bedeutsam mehr Furcht als KDS-Patienten. Personen mit KDS messen darüber hinaus dem Erscheinungsbild eine extrem hohe Bedeutung zu, investieren mehr in ihr Aussehen und zeigen mehr aussehensbezogene Zwangssymptome. Diskussion/ Schlussfolgerung: Es zeigen sich spezifische Unterschiede in der Beschaffenheit der sozialen Ängste und der Standards hinsichtlich des Erscheinungsbildes. Personen mit einer SP zeigen im Vergleich zu Teilnehmern mit einer KDS mehr Furcht vor Interaktionssituationen. Die Gruppen sind am besten zu unterscheiden anhand der BDD-YBOCS. Für die klinische Praxis könnte ableitbar sein, dass bei hoher sozialer Angst ein Screening für KDS durchgeführt werden sollte. C 09 Selektive Erinnerungseffekte bei Patienten mit Hypochondrie, anderen somatoformen Störungen und Panikstörung - Experimentelle Überprüfung mittels Wiedererkennungsaufgabe Maria Gropalis (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Michael Witthöft (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Gaby Bleichhardt (Philipps-Universität Marburg) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Fragestellung: Eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Hypochondrie spielen veränderte Informationsverarbeitungsprozesse: Betroffene neigen dazu, ihre Aufmerksamkeit selektiv auf krankheitsrelevante Informationen zu richten und diese auch besser zu erinnern. Hierdurch kommt es zur verstärkten Wahrnehmung von harmlosen körperlichen Veränderungen oder zuvor nicht beachteten körperlichen Merkmalen, die als pathologisch interpretiert werden. Methode: Um selektive Erinnerungseffekte bei Hypochondrie objektiv messbar zu machen, wurde eine Wort-Wiedererkennungsaufgabe eingesetzt. 123 Patienten einer Hochschulambulanz aus drei Störungsgruppen (Hypochondrie: N = 35; andere somatoforme Störungen: N=30, Panikstörung: N=26) und 32 Kontrollpersonen (KG) wurden mittels einer Wiedererkennungsaufgabe bezüglich krankheitsrelevanter Wörter und neutraler Stimuli untersucht. Die vorherige Durchführung eines emotionalen Stroop-Tests diente als Enkodierungsphase. Ergebnisse: Hypochondrische Patienten zeigten nicht nur bezüglich krankheitsrelevanter Stimuli, sondern auch hinsichtlich neutraler Wörter eine bessere Erinnerungsleistung (Parameter d′) im Vergleich zu Patienten mit anderen somatoformen Störungen (d = 0.50 - 0.71) und der KG (d = 0.62 0.85), unterschieden sich jedoch nicht signifikant von Patienten mit einer Panikstörung (p > .10). Hinsichtlich eines Antwortbias (Parameter C) zugunsten krankheitsrelevanter Stimuli lagen keine signifikanten Gruppenunterschiede vor (F(3, 119) = 1.86, p = .14, ηp² = .04). Diskussion: Die Ergebnisse weisen auf eine vertiefte verbale Informationsverarbeitung bei Patienten mit Hypochondrie hin. Diese Ergebnisse decken sich mit Untersuchungen, die eine habituelle Neigung zur Rumination bei Krankheitsängstlichen gefunden haben. Personen mit erhöhter Krankheitsangst scheinen demnach nicht nur dysfunktionale Überzeugungen über Krankheit und Gesundheit zu haben, sie neigen auch dazu, sich vor allem durch Grübeln mit negativen Emotionen und Stresserleben auseinanderzusetzen. Schlussfolgerungen: Möglicherweise dient dieser primär verbale ruminative kognitive Verarbeitungsstil dazu, auftretende intrusive bildhafte Vorstellungen zu unterdrücken. Der Einsatz korrigierender imaginativer Verfahren („Imagery Rescripting“) könnte eine sinnvolle Ergänzung der kognitiv-behavioralen Behandlung darstellen. C 10 Soziale Angst: Impliziter und expliziter Selbstwert nach Stimmungsinduktion Franziska Schreiber (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Christiane Bohn (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Pia Bornefeld-Ettmann (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Severin Hennemann (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Ulrich Stangier (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Regina Steil (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Abstract: Theoretischer Hintergrund. Nach dem kognitiven Modell der Sozialen Phobie von Clark und Wells (1995) werden bei sozial ängstlichen Personen dysfunktionale Annahmen gegenüber dem Selbst erst durch die Antizipation einer sozialen Situation aktiviert. Sie gelten demnach als instabil im Vergleich zu stabilen Grundannahmen bei Depression. Laut Tanner et al. (2006) gibt es wenig empirische Evidenz dafür, dass dysfunktionale Annahmen gegenüber dem Selbst erst bei sozialer Bedrohung aktiviert werden. In dieser Studie soll daher implizit (Affect Misattribution Procedure, AMP, Payne et al., 2005; IAT, Greenwald et al., 1998) und explizit das Selbstwertgefühl bei gering versus hoch sozial ängstlichen Studierenden nach einer Stimmungsinduktion untersucht werden. Die AMP gilt als valides Verfahren zur impliziten Einstellungsmessung und wurde für die Untersuchung zur Selbstwerterfassung adaptiert. Dabei wird die emotionale Einschätzung (positiv vs. negativ) von neutralen chinesischen Schriftzeichen durch vorhergehende (selbstbezogene, positive, negative) Primes beeinflusst. Es wird erwartet, dass nach Induktion von sozialer Bedrohung in der AMP hoch sozial ängstliche Studierende das Schriftzeichen nach der Präsentation selbstbezogener Primes im Vergleich zu positiven Primes negativer bewerten als niedrig sozial ängstliche Probanden. Methode. 20 hoch und 40 niedrig sozial ängstliche Studierende (SPAI, Fydrich, 2002) wurden rekrutiert. Die Induktion von sozialer Bedrohung erfolgte über die Ankündigung, dass eine Rede per Video aufgezeichnet werde. Davor und danach wurden die AMP und der IAT eingesetzt. Es folgten explizite Maße (Fragebogen zu sozialphobischen Einstellungen, Fragebogen zu sozialphobischen Kognitionen, Rosenberg Selbstwertskala, Kontrolle von Depression: BDI-II). Zur Kontrolle von Messwiederholungs- und Zeiteffekten durchliefen 20 niedrig ängstliche Studierende die Prozedur ohne Stimmungsinduktion. Ergebnisse. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass hoch sozial ängstliche Studierende die Schriftzeichen nach selbstbezogenen im Vergleich zu positiven Primes negativer bewerten als niedrig sozial ängstliche Studierende. Assoziationen zwischen impliziten und expliziten Maßen werden vorgestellt. Diskussion. Die Befunde werden diskutiert und die Implikationen für weitere experimentelle Studien mittels impliziter Methoden verdeutlicht. Tanner, R. J., Stopa, L., De Houwer, J. (2006). Implicit views of the self in social anxiety. Behav Res Ther, 44, 1397–1409. C 11 Spezifische selektive Aufmerksamkeitsallokation auf krankheitsbezogene Wortstimuli bei Patienten mit Hypochondrie Tobias Müller (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Julia Ofer (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Michael Witthöft (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Daniela Mier (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Carsten Diener (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Peter Kirsch (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Fred Rist (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) Josef Bailer (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Abstract: In kognitiv-behavioralen Modellen der Hypochondrie spielt die selektive Aufmerksamkeitsallokation eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung (Warwick & Salkovskis, 1990). Bislang gibt es jedoch nur wenig Studien, die sich mit der Bedeutung dieses Aufmerksamkeitsbias bei Patienten mit Hypochondrie beschäftigt haben (Martinez & Belloch, 2004; van den Heuvel et al., 2005). Beide Studien konnten im emotionalen Stroop-Test (EST) einen Aufmerksamkeitsbias für krankheitsbezogene Wörter im Vergleich zur Kontrollgruppe aufzeigen. In Anlehnung an diese Ergebnisse erwarten wir einen selektiven Aufmerksamkeitsbias (EST-Effekt) bei krankheitsbezogenen Wörtern bei hypochondrischen Patienten (HYG) im Vergleich zu einer psychisch unauffälligen Kontrollgruppe (KG). Zur Überprüfung der Spezifität dieses Effekts vergleichen wir die HYG mit einer depressiven Kontrollgruppe (DKG). Die Aufmerksamkeitsprozesse werden mittels des emotionalen Stroop-Paradigmas erfasst. Sowohl körperliche Beschwerden als auch Krankheiten dienen als verbale Stimuli. Die Stichprobe besteht derzeit aus 45 Patienten mit Hypochondrie ohne aktuelle komorbide affektive Störung, 50 gesunden Kontrollpersonen und 13 Patienten mit Depression. Das N der DKG wird in den nächsten Wochen aber noch erheblich anwachsen, sodass bis zum Kongress eine hinreichend große Analysestichprobe vorliegen wird. Erste Auswertungen zum EST fielen weitgehend hypothesenkonform aus: Patienten mit Hypochondrie zeigen im Vergleich zur KG bei den Krankheitswörter (p = .02) und Beschwerdewörtern (p = .04) einen stärkeren Interferenzeffekt. Im Vergleich zur DKG zeigt die HYG diesen Effekt im Trend bei den Beschwerdewörtern (p = .06) und nicht bei Krankheitswörtern (p = .19). Kein Unterschied zeigte sich zwischen KG und DKG in beiden Wortkategorien. Diese vorläufigen Ergebnisse geben Hinweise auf eine spezifische selektive Aufmerksamkeitsallokation bei Patienten mit Hypochondrie. C 12 The Westphal-Paradigm and its clinical application - Neural correlates of panic disorder and agoraphobia before and after cognitivebehavioral therapy André Wittmann (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Campus Charité Mitte, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany) Florian Schlagenhauf (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Campus Charité Mitte, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany) Anne Guhn (Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Würzburg, Würzburg, Germany) Meline Stoy (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Campus Charité Mitte, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany) Thomas Fydrich (Institute of Psychology, Psychotherapy and Somatopsychology, HumboldtUniversität Berlin, Berlin, Germany) Lydia Fehm (Institute of Psychology, Psychotherapy and Somatopsychology, Humboldt-Universität Berlin, Berlin, Germany) Bettina Pfleiderer (Department of Clinical Radiology, Westfälische-Wilhelms-Universität Münster, Münster, Germany) Alexander Gerlach (Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy, Universität zu Köln, Köln, Germany) Ulrike Lueken (Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany) Tilo Kircher (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Philipps-Universität Marburg, Marburg, Germany) Isabelle Reinhardt (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Universitätsklinikum Aachen, Aachen, Germany) Hans-Ulrich Wittchen (Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany) Andreas Ströhle (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Campus Charité Mitte, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany) Abstract: Introduction: Agoraphobia (with and without panic disorder) is a highly prevalent and disabling anxiety disorder. Characterization of neural processes in relevant brain regions provoked by agoraphobia-specific cues by functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) holds promise for a better understanding of core mechanism relevant for novel treatment approaches. We developed a fMRI paradigm – the WestphalParadigm – with agoraphobia-specific stimuli, tested it in a pilot study, and used the paradigm in patients with panic disorder and agoraphobia. Methods: The “Westphal-Paradigm” consists of cued and uncued agoraphobic and neutral pictures, available in two parallel sets (each contains 96 agoraphobic and neutral pictures) for repeated measurement designs. Reliability, criterion and construct validity of the picture sets were established in a pilot study and subsequently applied in 77 patients suffering from panic disorder with agoraphobia and matched healthy controls before and after a standardized cognitive-behavioral therapy within a multicenter fMRI study. Results: FMRI data revealed higher activations in areas associated with the fear circuit including amygdala, insula and hippocampal areas which were sensitive to intervention in patients compared to controls. Conclusions: The paradigm reliably produces behavioral and fMRI patterns in response to agoraphobia-specific stimuli. Preliminary results underscore the role of amygdala, parahippocampal cortex and insula in the processing of agoraphobic stimuli. To our knowledge this is the first fMRI paradigm with these properties. This paradigm can be used to further characterize the functional neuroanatomy of panic disorder and agoraphobia and might be useful to contribute data to the differentiation of panic disorder and agoraphobia as related, but conceptually different clinical disorders. C 13 Zusammenhänge zwischen Krankheitsangst und Zwanghaftigkeit Clara Dittmann (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Noelle Loch (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Michael Witthöft (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) Abstract: Theorie: Die Diskussion zur diagnostischen Einordnung von Krankheitsangst bzw. Hypochondrie als somatoforme- oder Angststörung ist vermehrt in das Zentrum klinisch-psychologischer Forschung gerückt. Ähnlichkeiten zu Angststörungen werden insbesondere in behavioralen Aspekte der Krankheitsangst vermutet, wie Checking-behavior und Doctor-shopping, die der kurzfristigen Reduktion von Angst dienen und damit Ähnlichkeiten zu neutralisierenden Verhaltensweisen bei der Zwangsstörung aufweisen. Auch auf kognitiver Ebene, insbesondere bezüglich der Bewertung und des Umgangs mit intrusiven Gedanken, werden Zusammenhänge angenommen. Diese phänomenologische Nähe zwischen Krankheitsangst und Zwangsstörungen wurde in der vorliegenden Studie psychometrisch untersucht. Methode: Es wurde eine postalische Fragebogenbatterie mit dem Multidemsional Inventory of Hypochondriacal Traits (MIHT, Witthöft, Haaf, Rist & Bailer, 2010) zur Erfassung multipler Krankheitsangstdimensionen und dem Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R, Gönner, Ecker & Leonhart, 2007) zur Messung von Zwanghaftigkeit an einer randomisierten Bevölkerungsstichprobe (N = 418) und einer überwiegend studentischen Stichprobe (N = 146) eingesetzt. Die vorliegenden Daten wurden mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen analysiert. Ergebnisse: Auf latenter Ebene ergab sich ein starker Zusammenhang (r = .54 - .61) zwischen den Gesamtfaktoren Krankheitsangst und Zwangssymptomatik. Hinsichtlich der Subskalen zeigten sich besonders in den kognitiven Aspekten starke Zusammenhänge (r = .24 - .51), was die Annahme stützt, dass Krankheitsangst und Zwanghaftigkeit ähnliche kognitive Mechanismen zu Grunde liegen. Trotz der starken Heterogenität von Zwangshandlungen und Kontrollverhalten sowie der unterschiedlichen Operationalisierung der Verhaltensebene der beiden Fragebögen, fielen auch die Zusammenhänge zwischen den 5 erfassten Zwangshandlungstypen und der behavioralen Ebene von Krankheitsangst gering bis stark aus (r = .10 - .47). Diskussion: Diese Ergebnisse stützen die Theorie, dass angstbezogene intrusive Gedanken und ähnliche kognitive und behaviorale Bewältigungsstrategien eine zentrale Rolle bei beiden Störungsbildern spielen. Die Ergebnisse waren für beide Stichproben vergleichbar und untermauern die inhaltliche Nähe von Krankheitsangst und Zwanghaftigkeit. Befunde wie diese sollten bei der nosologischen Einordnung von Krankheitsangst bzw. Hypochondrie in Zukunft berücksichtigt werden. C 14 Auditive Neuigkeitsverabeitung bei Zwangspatienten in unterschiedlichen emotionalen Kontexten Moritz Ischebeck (Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland) Tanja Endrass (Humboldt-Universität zu Berlin) Daniela Simon (Humboldt-Universität zu Berlin) Norbert Kathmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Kognitive Modelle der Angststörungen legen nahe dass Patienten mit Angststörungen eine verstärkte Aufmerksamkeitszuwendung zu potentiellen Gefahrenreizen zeigen, welche zur Entstehung und Aufrechterhaltung von diesen Störungen beiträgt. In dieser Studie wurde untersucht, ob Zwangspatienten eine verstärkte Aufmerksamkeitszuwendung zu neuen und damit potentiell gefährlichen Reizen zeigen. Zusätzlich zu einem neutralen Kontext, wurde die Auswirkung eines negativen emotionalen Kontexts untersucht. Methoden: 20 Zwangspatienten und 20 Kontrollpersonen führten eine visuelle Erkennungsaufgabe durch, währenddessen sie aufgabenirrelevante unitäre neue Töne und Standardtöne hörten. Die ereigniskorrelierten Potentiale zu den neuen Tönen (novelty P3 Amplitude) wurden mittels eine Elektroenzephalogramms aufgezeichnet und anschließend ausgewertet. Ergebnisse: Die neuen Töne lösten bei den Patienten eine erhöhte Gehirnaktivität (größere novelty P3 Amplituden) aus. Dieses Ergebnis zeigte sich unabhängig von dem emotionalen Kontext. Diskussion: Die größeren novelty P3 Amplituden bei Patienten sprechen für stärkere unbewusste Aufmerksamkeitszuwendung zu neuen Reizen. Dies wird durch die Neuigkeit der Reize an sich ausgelöst und ist nicht durch eine potentielle Bedrohung moderiert. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Zwangspatienten potentiellen Gefahrenreizen verstärkt Aufmerksamkeit zuwenden. C 15 Dysfunktionale Kognitionen und Therapieerfolg bei Patienten mit einer Zwangsstörung Andrea Ertle (Humboldt-Universität zu Berlin) ManuelaKraus (Humboldt-Universität zu Berlin) Karina Wahl (Universität Lübeck) Andreas Kordon (Universität Lübeck) Abstract: Hintergrund: Dysfunktionale Kognitionen stellen das zentrale Konstrukt im kognitiv-behavioralen Modell zur Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung der Zwangsstörung dar. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Studie zwei Fragestellungen: Hängt das initiale Ausmaß dysfunktionaler Kognitionen mit dem Ausmaß der Zwangssymptomatik zu Therapieende zusammen? Hängt der Rückgang der dysfunktionalen Kognitionen mit dem Ausmaß der Zwangssymptomatik zu Therapieabschluss zusammen? Methode: In einer Längsschnittstudie beantworten N = 46 Patienten mit einer Zwangsstörung vor und nach einer kognitiven Verhaltenstherapie Fragebögen zu Zwangssymptomatik (OCI-R), Depressivität (BDI) sowie zwangsrelevanten, dysfunktionalen Kognitionen (OBQ). Ergebnisse: Sowohl Zwangssymptomatik, Depressivität als auch dysfunktionale Kognitionen nehmen im Therapieverlauf ab. Im Gegensatz zur anfänglichen Ausprägung dysfunktionaler Kognitionen sind die Eingangswerte in den beiden Belastungsmaßen Prädiktoren für das Ausmaß der Zwangssymptomatik nach Therapieabschluss. Je stärker dysfunktionale Kognitionen im Therapieverlauf abnehmen, desto geringer ist die Ausprägung der Zwangssymptomatik nach Therapieabschluss. Schlussfolgerung: Die Befunde unterstützen die Annahmen des kognitiv-behavioralen Modells der Zwangsstörung. C 16 Erfassung von Metakognitionen bei Zwang - eine Validierungsstudie für den deutschen Sprachraum Jana Hansmeier (Philipps-Universität Marburg) Cornelia Exner (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Julia Glombiewski (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Kognitive Therapie und Expositionen mit Reaktionsverhinderung stellen bei Zwangsstörungen die effektivsten Behandlungsformen dar. Dennoch weisen die meisten Patienten nach erfolgreicher Therapie noch Restsymptome auf. Die metakognitive Therapie nach Wells (1997) stellt einen neuen Ansatz dar, bei dem die Veränderung von metakognitiven Annahmen und Kontrollprozessen im Mittelpunkt der Behandlung steht. Erste Pilotstudien konnten bei metakognitiver Behandlung von Zwangskranken beachtliche Effektstärken und Verbesserungsraten nachweisen. Kontrollierte Therapiestudien stehen aber noch aus. In vorherigen Studien wurden zudem signifikante Zusammenhänge zwischen metakognitiven Variablen und Zwangssymptomatik aufgezeigt. Dabei wurde besonders die Rolle von (1) Gedanken-Fusions-Annahmen über die Bedeutung und Macht von Gedanken, (2) Annahmen über die Notwendigkeit, Rituale auszuführen und (3) Kriterien zur Beendigung von Ritualen betont. Für zukünftige Forschung zum metakognitiven Ansatz ist eine Evaluation deutscher Versionen spezifischer metakognitiver Fragebögen erforderlich. Ziel dieser Studie war es, Struktur und psychometrische Eigenschaften deutscher Versionen des Thought Fusion Inventory (TFI), der Thought Action Fusion Scale (TAF-scale), des Beliefs about Rituals Inventory (BARI) und des Stop Signals Questionnaire (SSQ) zu untersuchen. Methode: Deutsche Versionen dieser Fragebögen wurden jeweils mittels des Rückübersetzungsverfahrens generiert und in Rücksprache mit dem Originalautor korrigiert. Es wurden Daten an einer nicht-klinischen Stichprobe (n=150) mittels Online-Version sowie an einer Patientenstichprobe (n=30) mittels Paper-Pencil-Version erhoben. Neben den metakognitiven Fragebögen wurden weitere Messinstrumente u.a. zur Erfassung von Zwangssymptomatik, allgemeinen metakognitiven Annahmen und zwangstypischen kognitiven Verzerrungen eingesetzt. Ergebnisse: Die Faktorstrukturen der Originalinstrumente konnten weitgehend bestätigt werden. Die Fragebögen weisen zufriedenstellende Kennwerte für interne Konsistenzen, Retest-Reliabilitäten, konvergenten und diskriminanten sowie Kriteriumsvaliditäten auf. Diskussion/Schlussfolgerung: Die Ergebnisse unterstützen die Verwendbarkeit von TFI, TAF-scale, BARI und SSQ für den deutschen Sprachraum und erlauben den Einsatz in noch ausstehenden Studien zur Wirksamkeit und Wirkweise metakognitiver Therapie und zur weiteren Erforschung der Rolle von Metakognitionen bei Zwangsstörungen. C 17 Neuronale Korrelate der Symptomprovokation bei Patienten mit Waschzwängen im Vergleich mit gesunden Kontrollen. Ali Baioui (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Juliane Lange (Bender Institute of Neuroimaging, Justus-Liebig-Universität Giessen) Dieter Vaitl (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Rudolf Stark (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Abstract: Symptomprovokation ist eine vergleichsweise direkte und störungsnahe Methode zur Erforschung der neuronalen Korrelate psychischer Störungen. In aktuellen fMRT-Symptomprovokationsstudien zur Zwangsstörung werden Bilder verwendet, die einen Drang zur Ritualausführung auslösen sollen. Hierfür können entweder standardisierte (z.B. MOCSS; Mataix-Cols et al., 2009) oder individualisierte Stimulussets eingesetzt werden. Diese können auch von jedem Patienten selbst fotografiert werden (Schienle et al., 2005), was der Einzigartigkeit von Zwangsauslösern im Besonderen Rechnung trägt. Die Vorteile beider Methoden liegen auf der Hand; ein direkter Vergleich fehlte jedoch bisher. Des Weiteren wurden in bisherigen Studien meist mehrere Subtypen der Störung gemeinsam untersucht. In der vorliegenden Studie erstellten 19 Patienten mit Waschzwängen je eine individuelle Hierarchie ihrer Zwangsauslöser, die sie anschließend als Instruktion zur fotografischen Erstellung eines individuellen und intensitätsgraduierten Stimulussets verwendeten. Zusätzlich wurde die Intensität von standardisierten Stimuli (MOCSS und IAPS) bewertet. Somit entstanden für jeden Patienten personalisierte Sets aus zwangsrelevanten und zwangsneutralen individuellen und standardisierten Stimuli. Die Patienten und eine Gruppe gematchter, gesunder Kontrollprobanden durchliefen anschließend ein fMRT-Symptomprovokationsexperiment mit diesen Stimulussets. Innerhalb der Patientengruppe zeigten individuelle und standardisierte Symptomprovokation divergente Hirnaktivierungsmuster. Individuelle Symptomprovokation ging mit verstärkter Hirnaktivität in zwangs- (v.a. Basalganglien, OFC, Thalamus) und ekelrelevanten (Insula) Regionen einher; dies bestätigte sich auch in Korrelationsanalysen (Hierarchiestufe & Hirnaktivität). Im Gruppenvergleich zeigten sich v.a. Unterschiede in der Aktivität der Basalganglien. Die Befunde zur standardisierten Symptomprovokation zeigten hierzu keine Schnittmenge, replizierten jedoch teilweise Befunde aus MOCSS-Studien (Cingulum, medial-temporaler G., ventromedial-präfrontaler C.). Die in dieser Studie eingesetzte Methode ermöglicht das kontrollierte Erstellen hochgradig individualisierter Stimuli. Diese führen im Gegensatz zu den standardisierten Stimuli zu Ergebnissen, die mit neurobiologischen Modellen zur Ätiologie der Zwangsstörung übereinstimmen. Die vorliegende Studie bestätigt die Bedeutung der Individualität von Zwängen auf neurophysiologischer Ebene. C 18 Willkürliche Verhaltensinitiierung als Endophänotyp für Zwangsstörungen? Benedikt Reuter (Humboldt-Universität zu Berlin) Lisa Kloft (Humboldt-Universität zu Berlin) Anja Riesel (Humboldt-Universität zu Berlin) Norbert Kathmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Patienten mit Zwangsstörungen zeigen eine Reihe neurokognitiver Auffälligkeiten, die als Vulnerabilitätsfaktoren diskutiert werden. Häufig sind die zur Untersuchung verwendeten Aufgaben oder Tests jedoch zu komplex für eine Spezifizierung der gestörten Funktion. Dagegen wurde kürzlich gezeigt, dass sich mittels experimenteller Variation von Augenbewegungsaufgaben eine spezifische Störung der willkürlichen Initiierung von Verhalten nachweisen lässt. Unklar ist bislang, ob es sich bei dieser Funktionsstörung um einen Endophänotypen (ein Merkmal, das auch bei bislang nicht erkrankten Personen mit genetisch bedingt erhöhtem Erkrankungsrisiko auftritt) handelt. Um diese Frage zu beantworten sollten in einem ersten Schritt Patienten mit Zwangsstörung, gesunde Kontrollprobanden und nicht erkrankte erstgradig Verwandte von Patienten mit Zwangsstörung (Risikoträger) Aufgaben mit willkürlichen und reizgeleiteten Augenbewegungen durchführen. Vorläufige Ergebnisse mit jeweils 27 Probanden pro Gruppe weisen darauf hin, dass die Sakkadenlatenzen in Bedingungen mit willkürlichen Augenbewegungen bei Patienten und Risikoträgern größer waren als bei gesunden Kontrollprobanden. Wie erwartet, zeigten sich bei reizgeleiteten Augenbewegungen keine Gruppenunterschiede. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die spezifisch verlangsamten Latenzen willkürlicher Sakkaden ein Indikator für eine genetisch bedingte Vulnerabilität für Zwangsstörungen sind. Die Bedeutung der zugrundeliegenden Funktionsstörung für die Entstehungsmechanismen von Zwangssymptomen muss in zukünftigen Studien geklärt werden. C 19 „Kommt ein Lachen nicht mehr an?“ – Depressionsschweregrad beeinflusst elektrophysiologische Korrelate des Negativity Bias bei der Bewertung positiver Gesichter Andrea Figura (Humboldt-Universität zu Berlin) Jan-Philipp Klein (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité – Universitätsmedizin Berlin ) Norbert Kathmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Isabella Heuser (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité – Universitätsmedizin Berlin ) Prof. Dr. Katja Werheid (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Ein „Negativity Bias” bei Major Depression (MD), eine negativ verzerrte, stimmungskongruente Verarbeitung emotionaler Informationen, wurde in zahlreichen Forschungsarbeiten nachgewiesen. Nur selten wurden hierbei behaviorale Einschätzungen parallel zu neurofunktionalen Parametern erhoben. Fragestellungen: Untersucht wurde, ob der Negativity Bias (1) auf frühen oder späten Informationsverarbeitungsstufen einsetzt, (2) ob er sich in einer verstärkten Verarbeitung negativer Reize oder in einer verminderten Verarbeitung positiver Reize zeigt, und (3) ob er mit dem Schweregrad der depressiven Symptomatik korreliert. Methode: Ereigniskorrelierte Hirnpotentiale (EKPs) wurden aufgezeichnet, während MD-Patienten mit mittelgradiger (n = 14; BDI-II 22.5) und schwerer Symptomatik (n = 14; BDI-II 41.3) sowie gesunde Kontrollprobanden (n = 28; BDI-II 2.9) positive, negative und neutrale Gesichtsausdrücke hinsichtlich ihrer Valenz auf siebenstufigen Ratingskalen einschätzten. Valenzratings und aus Vorarbeiten bekannte emotionssensitive EKP-Komponenten wurden anhand von ANOVAs mit Messwiederholung in einem 3(Gruppe) x 3(Emotion) -faktoriellen mixed between-within Design ausgewertet. Ergebnisse: Elektrophysiologisch zeigten die Kontrollprobanden wie erwartet erhöhte Amplituden des Late Positive Potential (LPP; 350-850 ms) für positive und negative relativ zu neutralen Gesichtern. Beide MD-Subgruppen wichen von diesem Muster ab. Patienten mit mittelgradiger MD zeigten erhöhte LPP-Amplituden für negative relativ zu neutralen Gesichtern, aber keine Unterschiede zwischen positiven und neutralen Gesichtern. Die Patienten mit schwerer MD zeigten keine Unterschiede zwischen negativen und neutralen Gesichtern, während die LPP-Amplituden für positive Gesichter sogar reduziert waren. Für frühere EKP-Komponenten ergaben sich keine Gruppenunterschiede. Die Valenzratings fielen bei Patienten mit schwerer MD insgesamt negativer aus als bei den Kontrollprobanden. Schlussfolgerungen: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Negativity Bias bei MD verbunden ist mit einer verminderten Verarbeitung stimmungsinkongruenter Reize auf späteren Informationsverarbeitungsstufen, d.h. eher bei der Evaluation als bei basaler Verarbeitung oder Detektion emotionaler Reize. Der Schweregrad der Depression beeinflusst die Emotionsverarbeitung auf neuronaler Ebene: eine schwer depressive Symptomatik geht mit reduzierter Verarbeitung positiver sozialer Signale einher. C 20 Depressives Grübeln: Effektivität eines kognitivverhaltenstherapeutischen Gruppenprogramms Tobias Teismann (Ruhr-Universität Bochum) Ruth von Brachel (Ruhr-Universität Bochum) Sven Hanning (Ruhr-Universität Bochum) Matthias Grillenberger (Ruhr-Universität Bochum) Lisa Hebermehl (Ruhr-Universität Bochum) Ulrike Willutzki (Ruhr-Universität Bochum) Abstract: Hintergrund: Eine grüblerische Auseinandersetzung gilt als Vulnerabilitätsfaktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Darüber hinaus finden sich erste Hinweise, dass depressives Grübeln assoziiert ist mit einer verzögerten Therapieansprache (u.a. Jones et al., 2008). Gleichwohl gibt es bislang nur wenige dezidierte Ansätze zur Behandlung depressiven Grübelns. In einer randomisiert-kontrollierten Studie wurde ein kognitivverhaltenstherapeutisches Interventionsprogramm (Teismann et al., in Vorbereitung)evaluiert, welches metakognitive (Wells, 2009) und operante Strategien (Martell et al., 2010) zur Modifikation depressiven Grübelns beinhaltet.. Methode: Bislang wurden 60 depressive Patienten randomisiert einer Behandlungs- oder einer Wartekontrollgruppe zugeordnet. Die Behandlung erfolgte im Gruppenformat und umfasste insgesamt 11 wöchentliche Sitzungen (à 100 Minuten). Den Patienten der Wartekontrollgruppe wurde nach einer Wartezeit von 3 Monaten eine Be¬hand¬lung angeboten. In die Studie aufgenommen wurden Patienten, die an einer teilremittierten depressiven Episode litten und einen BDI-II Wert ≥ 9 aufwiesen. Ergebnisse: Unter der Behandlung kam es zu bedeutsamen Ver¬besserun¬gen depressiven Grübelns, positiver Metakognitionen bezüglich des Grübelns, sowie depressiver und allgemeiner Symptombelastung. Darüber hinaus gaben die Patienten an, signifikant mehr Kontrolle über Grübeleien erworben zu haben. Insgesamt schätzten die Patienten den Nutzen der Behandlung retrospektiv als sehr hoch ein. In der Wartekontrollgruppe fanden sich über den dreimonatigen Wartezeitraum hinweg keinerlei bedeutsame Veränderungen. Schlussfolgerung: Insgesamt profitierten die Patienten auf kognitiver und emotionaler Ebene deutlich vom gruppentherapeu¬ti¬schen Angebot. Die ersten Auswertungen erscheinen somit ermutigend, gleichwohl bleibt die Gesamtauswertung – insbesondere im Hinblick auf die längerfristigen Effekte – abzuwarten. C 21 Ein Vergleich der prädiktiven Validität verschiedener Masse zu kognitiver Vulnerabilität für Depression Tobias Krieger (Universität Zürich) Martin Grosse Holtforth (Universität Zürich) Abstract: Einleitung: Das Konzept der kognitiven Vulnerabilität für Depression geht davon aus, dass dysfunktionale kognitive Strukturen die Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Verarbeitungsprozesse beeinflussen. Diese dysfunktionalen kognitiven Strukturen spielen bei der Entstehung, der Aufrechterhaltung als auch bei der Wiederkehr depressiver Episoden eine zentrale Rolle. Ziel der vorliegenden Studie war es, verschiedene Masse für kognitive Vulnerabilität bei Depression, welche sich bereits als spezifisch und sensibel für Depressionen gezeigt haben, bezüglich ihrer prädiktiven Validität zu untersuchen. Methode: Eine Stichprobe bestehend aus 175 nicht-klinischen Probanden wurden in einem longitudinalen Design untersucht. Zum ersten Messzeitpunkt wurden neben der Depressivität verschiedene Masse zu kognitiver Vulnerabilität für Depression erhoben. Zum zweiten Messzeitpunkt acht Wochen später wurde erneut die Depressivität als auch der erlebte Stress während des Intervalls erhoben. Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Masse für kognitive Vulnerabilität unterschiedliche prädiktiv für die Veränderung der Depressivität über das Zwei-Monats-Intervall waren. Insbesondere die Masse bezüglich selbstkritischem Leistungsstreben und motivationaler Vermeidung zeigten sich als besonders prädiktiv. Diskussion: Diskutiert werden sowohl die theoretischen Implikationen der Studienergebnisse als auch ihre Bedeutung für die klinische Praxis und die zukünftige Forschung. Schlussfolgerungen: Für die Einschätzung der Auftretenswahrscheinlichkeit als auch für die Erfolgsbeurteilung von Depressions-Interventionen sollten Vulnerabilitätsmasse mit gegebener prädiktiver Validität verwendet werden. C 22 Einfluss eines türkischen Migrationshintergrunds auf das Erkennen einer Depression. Dominik Uelsmann (Institute of Psychology, Psychotherapy and Somatopsychology, HumboldtUniversität Berlin, Berlin, Germany) Kirsten Baschin (Humboldt-Universität zu Berlin) Birsen Inci (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Es besteht ein breiter Konsens über eine ungünstige Nutzung des Versorgungssystems in Deutschland durch Betroffene von psychischen Störungen mit türkischem Migrationshintergrund (Machleidt et al., 2007). Befunde im Rahmen der Versorgungsforschung generell konnten zeigen, dass das Erkennen des Vorliegens einer psychischen Störung die Wahrnehmung des Behandlungsbedarfs (Arkar & Eker, 2010) und die Wahrscheinlichkeit einer zweckmäßigen Wahl des Hilfeangebots (Wright et al., 2007) erhöht. Das fehlende Erkennen einer psychischen Störung konnte dabei mit einer verzögerten Inanspruchnahme in Zusammenhang gebracht werden (Thompson et al., 2004). Als Teil einer größeren Studie zur „Mental Health Literacy“ (Jorm, 2000) vergleicht diese Arbeit, als erste im deutschsprachigen Raum, Personen mit und ohne türkischen Migrationshintergrund im Erkennen einer Depression anhand einer Fallvignette. Methode In Allgemeinarztpraxen Berlins wurde wartenden Personen mit (N=189) und ohne (N=150) türkischem Migrationshintergrund eine Fallvignette mit der Schilderung einer depressiven Episode vorgelegt. Die Probanden wurden gebeten das Problem der fiktiven Person zu benennen und Fragebögen zu soziodemographischen und –ökonomischen Faktoren zu beantworten. Alle Materialien wurden in deutscher und türkischer Sprache von bilingualen Testleitern angeboten. Mittels logistischer Regression wird untersucht welchen unabhängigen Beitrag der Migrationshintergrund zur Aufklärung der Erkennensrate leisten kann. Ergebnisse Der Migrationshintergrund leistet neben Geschlecht und Bildungsstatus einen signifikanten Beitrag zur Erklärung des Erkennens einer Depression. Als „Risikofaktoren“ des nicht Erkennens wurden männliches Geschlecht, geringer Bildungsstatus und türkischer Migrationshintergrund identifiziert. Diskussion Neben den hier untersuchten Variablen könnte der Akkulturationsstatus der Personen mit türkischem Migrationshintergrund weiteres Erklärungspotential bieten. In Folgeanalysen des Datensatzes der Gesamtstudie wird dies ebenso untersucht, wie der Einfluss der Erkennensrate auf das antizipierte Inanspruchnahmeverhalten. Schlussfolgerungen Weitergehende Schlussfolgerungen in Bezug auf Zielgruppe und Gestalt möglicher psychosozialer Interventionen zur Verbesserung des Inanspruchnahmeverhaltens, können erst nach eingehenden Analysen des Gesamtdatensatzes gezogen werden. C 23 Kortikales Korrelat gelernter Hilflosigkeit bei Depression: Replizierbarkeit und prädiktive Bedeutung für den Symptomverlauf Christine Kühner (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Carsten Diener (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Bettina Ubl (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Herta Flor (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Untersuchungen zeigen, dass Kontrollverlust während aversiver instrumenteller Konditionierung mit erhöhter frontokortikaler Erregung, gemessen als Postimperative Negative Variation (PINV) im EEG, einhergeht. In einem operanten Konditionierungsexperiment (S1S2 Paradigma, Vermeidung eines unangenehmen elektrischen Reizes) mit initialer Kontrolle, Kontrollverlust und Wiedererlangung von Kontrolle fanden wir, dass die frontale PINV Aktivierung bei unmedizierten Depressiven mit Majorer Depression oder Dysthymie gegenüber Gesunden unter Kontrollverlust und Wiedererlangung der Kontrolle erhöht war. Ziel der vorliegenden Studie war es zu untersuchen, ob sich diese Befunde in einer Zweituntersuchung sechs Monate nach Erstuntersuchung (T2) im Querschnitt replizieren ließen und ob die individuelle frontale PINV unter variierender Kontrollierbarkeit, gemessen zur Baseline (T1) prädiktive Bedeutung für den Symptomverlauf über sechs Monate besitzt. Methode: Von ursprünglich 50 Studienteilnehmern (T1) wurden 39 nachuntersucht, von denen bei 32 Personen (17 Depressive, 15 Kontrollen) auswertbare EEG-Daten zu T2 vorlagen. Ergebnisse: Während beide Gruppen vergleichbare frontale kortikale Aktivierung unter initialer Kontrolle und Kontrollverlust zeigten, war die frontale PINV unter Wiedererlangung der Kontrolle in der depressiven Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe, wie zu T1, signifikant erhöht. Auch war das Ausmaß der PINV in der Patientengruppe wieder substanziell mit aktueller Depressivität korreliert, nach Kontrolle der Depressivitätswerte waren keine Gruppenunterschiede mehr eruierbar. Longitudinalanalysen zeigten darüber hinaus, dass die frontale PINV-Aktivierung unter variierender Kontrolle zu T1 keine Prädiktion der Depressionsschwere und des Diagnosenstatus zu T2 ermöglichte. Diskussion und Schlussfolgerungen: Wir schließen daraus, dass es sich bei der erhöhten kortikalen Aktivierung Depressiver in der Phase der Wiedererlangung von Kontrolle um eine charakteristische, replizierbare kognitive Auffälligkeit handelt. Diese kennzeichnet jedoch eher eine state- als eine traitKomponente generalisierter Hilflosigkeit bei depressiven Personen, die sich unter Remission zurückbildet. Literatur Kuehner C*, Diener C*, Ubl B, Flor H (2010). Reproducibility and predictive value of the PostImperative Negative Variation during aversive instrumental learning in depression. Psychological Medicine. Epub ahead of print.*Equal contrib C 24 Pro-inflammatorische Zytokine und experimenteller Schmerz bei Depression Frank Euteneuer (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Markus J Schwarz (Ludwig-Maximilians-Universität München) Anika Hennings (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Sabine Riemer (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Theresa Stapf (Ludwig-Maximilians-Universität München) Verena Selberdinger (Ludwig-Maximilians-Universität München) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Hintergrund: Erhöhte Konzentrationen pro-inflammatorischer Zytokine(entzündungsassoziierte Immunparameter) sind sowohl für die Pathophysiologie der Depression, als auch für Veränderungen der Schmerzentstehung- und Wahrnehmung von Bedeutung. Pro-inflammatorische Zytokine induzieren Krankheitsverhalten, eine Konstellation von Symptomen, die in hohem Maße mit depressiver Symptomatik überlappt. Eine Komponente des Krankheitsverhaltens ist erhöhte Schmerzempfindlichkeit, wobei im Tiermodell verschiedene neurobiologische Mechanismen für eine zytokin-vermittelten Schmerzbeeinflussung aufgezeigt werden konnten. Da Depression häufig mit Schmerz assoziiert ist, sollten in der vorliegenden Studie potentielle Zusammenhänge zwischen proinflammatorischen Zytokinen und der Schmerzschwelle bei Patienten mit Depression untersucht werden. Methode: Bei 37 Patienten mit Major Depression (DSM-IV) und 48 gesunden Kontrollprobanden wurden Druckschmerzschwellen und Plasmakonzentrationen der pro-inflammatorischen Zytokine Tumor Nekrose Faktor (TNF)-alpha und Interleukin (IL)-6 bestimmt. Ergebnisse: Im Vergleich zur Kontrollgruppe, wurden bei Patienten mit Depression erhöhte TNFalpha Konzentrationen und erniedrigte Schmerzschwellen (erhöhte Schmerzempfindlichkeit) gefunden. Hierbei zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen TNF-alpha und Schmerzempfindlichkeit bei depressiven Frauen, jedoch nicht bei depressiven Männern. Diskussion: Die vorliegenden Befunde zeigen einen potentiellen Zusammenhang zwischen immunologischen Veränderungen und Schmerz bei Depression auf. Das Fehlen dieses Zusammenhangs bei Männern weist auf schmerzassoziierte psychoneuroimmunologische Geschlechtsunterschiede hin. C 25 Einfluss von habitueller Emotionsregulation auf neuronale Korrelate sozialer Konditionierung Andrea Hermann (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Tanja Pejic (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Dieter Vaitl (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Rudolf Stark (Bender Institute of Neuroimaging, Justus Liebig Universität Giessen) Abstract: Für die Entstehung sozialer Ängste spielen negative Lernprozesse im Sinne einer sozialen „Traumatisierung“ eine bedeutsame Rolle. Bisherige Studien konnten zeigen, dass insbesondere die Amygdala ein wichtiges neurobiologisches Korrelat solcher Konditionierungsprozesse bei gesunden Probanden darstellt. Die habituelle Anwendung von funktionalen Emotionsregulationsstrategien wie z.B. der Neubewertung („Reappraisal“) kann im Sinne eines protektiven Faktors einen großen Einfluss auf solche Lernprozesse haben. Ziel dieser Studie war es, den Zusammenhang der habituellen Anwendung von „Reappraisal“ mit neuronalen Korrelaten sozialer Konditionierung zu untersuchen. Im Rahmen einer funktionellen Magnetresonanztomographie-Untersuchung wurde mit 41 gesunden Probanden ein differentielles sozial-relevantes Konditionierungsparadigma (Akquisitions- und Extinktionsphase an Tag 1; Abruf der Extinktion am Folgetag) durchgeführt. Bilder von jeweils zwei Frauen und zwei Männern mit neutralen Gesichtsausdrücken dienten als konditionierte Stimuli (CS+ und CS-), während kurze Filmausschnitte der jeweiligen Personen mit kritischen Kommentaren als unkonditionierte Stimuli verwendet wurden. Zu mehreren Zeitpunkten wurden affektive Bewertungen der konditionierten Stimuli vorgenommen (evaluative Konditionierung). Zusätzlich wurde mittels eines Fragebogens die habituelle Anwendung von „Reappraisal“ erfasst. Es zeigte sich Aktivierung der linken Amygdala sowohl während der Akquisitions- als auch während der Extinktionsphase. Eine häufigere Anwendung von „Reappraisal“ im Alltag ging während der Akquisition mit einer verminderten Aktivierung in der rechten Amygdala, im rechten Hippocampus und in der rechten Insula einher. Diese Ergebnisse zeigen, dass habituelle Emotionsregulation in einem deutlichen Zusammenhang mit dem Erwerb sozial-relevanter emotionaler Reaktionen steht. Die zugrundeliegenden neurobiologischen Korrelate geben erste Hinweise darauf wie der Einfluss solcher Emotionsregulationsfähigkeiten auf störungsrelevante Lernprozesse auf neuronaler Ebene vermittelt werden könnte. Die Resultate dieser Studie deuten auf die wichtige Rolle von allgemeinen Emotionsregulationsfähigkeiten für die Entstehung und Veränderung psychischer Störungen wie z.B. der Sozialen Angststörung hin. Eine gezielte Stärkung dieser Fähigkeiten im Rahmen präventiver oder therapeutischer Interventionen kann somit möglicherweise zu erhöhter Resilienz bzw. größerem Therapieerfolg führen. C 26 Emotionsregulation und Essverhalten bei Menschen mit Adipositas Sebastian Kohlmann (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf) Stefan Westermann (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Fachbereich Psychologie, Universität Marburg) Bettina Hamann (Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Würzburg) Karl-Heinz Schulz (Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Winfried Rief (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Fachbereich Psychologie, Universität Marburg) Abstract: Hintergrund Adipositas zählt zu den bedeutendsten Gesundheitsproblemen in der westlichen Welt. Dieser Krankheit zugrundeliegendes pathologisches Essverhalten ist multifaktoriell bedingt, wobei Emotionen eine wesentliche Rolle spielen. Inwieweit die Regulation von Emotionen relevant ist, wurde unseres Wissens bisher noch nicht bei Adipositas untersucht. Methode Mittels gezielter Internetumfrage über Adipositasforen konnten N=215 Probanden (Body-MassIndex[BMI]=41.05±12.82) bezüglich verschiedener Emotions-Regulations-Strategien [ERS] (Difficulities in Emotion Regulation Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Emotion Regulation Questionnaire) und Essverhalten (Eating Disorder Examination Questionnaire, Fragebogen zum Essverhalten) befragt werden. Als potentielle Kovariaten wurden allgemeine Psychopathologie, genetisches Risiko und sozioökonomischer Status erhoben. Explorative Regressionsanalysen dienten der Identifikation von Emotionsregulations-Defiziten und –ressourcen. Ergebnisse Probanden mit Adipositas (BMI>30; n=165) gaben an, im letzten Monat mehr Essanfälle gehabt zu haben als Kontrollprobanden (MW=7.4±9.47 vs. 3.28±6.85;p<.001). Nach Kontrolle von Alter, Geschlecht, BMI, genetischem Risiko und Depression war die Häufigkeit von Essanfällen direkt mit kognitiven ERS (‚Selbstbeschuldigung’ (β=.18, T=2.76, p=.06), ‚Positive Neubewertung’ (β=-.14, T=2.18, p=.03)) und Defiziten in allgemeinen ERS (‚Mangel an Emotionswahrnehmung’ (β=.22, T=3.28, p=001)‚ ‚Nicht-Akzeptieren von Emotionen’ (β=.19, T=2.91, p=.004)) assoziiert. Zudem wurde die Häufigkeit von Essanfällen mit der ERS ‚Unterdrücken des emotionalen Ausdrucks’ (β=.39, T=6.17, p<.001) vorhergesagt. Diskussion Die Studie unterstützt die Annahme, dass Adipositas durch pathologisches Essverhalten in Form von Essanfällen mitbedingt ist. Darüber hinaus zeigen die Befunde, dass das Konzept Emotionsregulation für das Verständnis von Essanfällen hilfreich sein kann: Menschen mit Essanfällen schenken Emotionen weniger Beachtung, akzeptieren unangenehme Gefühle weniger und versuchen vermehrt diese zu verbergen. Im Umgang mit Gefühlen schreiben sich Menschen mit Essanfällen häufiger Schuld zu. Es fällt ihnen vermutlich schwerer, erlebte problematische Situationen positiv neu zu bewerten. Schlussfolgerungen Die Rolle von Emotionsregulation bei Menschen mit Adipositas sollte weiter untersucht werden. Menschen mit Adipositas und Essanfällen könnten von Emotionsregulationtrainings profitieren. C 27 Emotionsregulation, Stimmung und Stress Resilienz: Eine e-Diary Studie Jonas Steil (Fakultät für Psychologie, Universität Basel) Raphael Ditzler (Fakultät für Psychologie, Universität Basel) Jennifer Heuschling (Fakultät für Psychologie, Universität Basel) Monique Pfaltz (Fakultät für Psychologie, Universität Basel) Birgit Kleim (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Emotionsregulation wird definiert als all jene Prozesse, durch welche Individuen beeinflussen, welche Emotionen sie haben, wann sie diese haben und wie sie ihre Emotionen erleben und ausdrücken (e.g., Gross, 2002), wobei man viele verschiedene Strategien unterscheiden kann. Wie genau regulieren Menschen ihre Emotionen im Alltag und wie hängen individuelle Unterschiede in solchen Emotionsregulationsstrategien mit Stimmung und mit StressResilienz zusammen? Auf Basis bisheriger, meist retrospektiver Studien, wurden zahlreiche Vorhersagen bzgl. der Wirkung verschiedener, tendenziell eher adaptiver (Cognitive Reappraisal) bzw. maladaptiver Emotionsregulationsstrategien (Unterdrückung des Emotionsausdrucks) auf Stimmung und Trait-Resilienz postuliert. Methoden: Probanden (N= 48 Studierende) erfassten über den Zeitraum von einer Woche mit Hilfe eines elektronischen Tagebuchs (eDiary) (i) welche positiven und negativen Emotionen sie im Alltag haben, und (ii) wie sie diese regulieren. Emotionen und Emotionsregulation wurden fünf Mal am Tag erhoben. Zusätzlich wurde jeden Abend die Stimmung(Positive and Negative Symptom Scale) erfasst. Darüber hinaus wurde Stress-Resilienz über einen Trait-Fragebogen erfasst (Connor Davidson Resilience Scale). Datenauswertung erfolgte mit Mixed Models in SPSS 16.0. Ergebnisse: Es konnte ein kohärentes Bild der Emotionsregulation im täglichen Leben gezeichnet und die sich daraus ergebenden Zusammenhänge mit Stimmung und Stress-Resilienz beleuchtet werden. Als häufigste positive Emotionen im Alltag wurden Freude und Zufriedenheit, als häufigste negative Emotionen Kummer und Zorn. Die Dysfunktionalität von Emotionsunterdrückung bei negativen Emotionen, sowie die Funktionalität des Versuchs positiven Emotionen zu erhalten konnten bestätigt werden. Beide Regulationsstrategien hingen in der erwarteten Richtung mit Stimmung, sowie mit Trait-Resilienz zusammen. Diskussion und Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie zeigt auf welche Emotionen und Emotionsregulationsregulationsstrategien im Alltag gesunder Menschen angewendet werden. Die Art und Weise wie Menschen ihre Emotionen regulieren, und die individuellen Unterschiede erlauben wertvolle Vorhersagen über Stimmung und Stress-Resilienz. Unsere Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Präventions- und Interventionsprogrammen zur Förderung von Stress-Resilienz. C 28 Emotionsspezifische Regulationsdefizite bei psychischen Störungen? Yasemin Cal (Philipps-Universität Marburg) David Ebert (Philipps-Universität Marburg) Alexandra Dippel (Vogelsbergklinik für Psychotherapie und Psychosomatik) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Defizite in Emotionsregulationskompetenzen werden mit Entstehung und Aufrechterhaltung einer Vielzahl psychischer Störungen in Verbindung gebracht. Ein systematischer Vergleich verschiedener Störungen bzgl. dieser Defizite wird jedoch dadurch erschwert, dass die aktuell verfügbaren Studien jeweils auf wenige Störungsbilder fokussieren und sich untereinander in Bezug auf die Art der untersuchten Kompetenzen und die eingesetzten Operationalisierungsmethoden unterscheiden. Cal, Ebert, Dippel & Berking (2010) konnten erstmalig nachgewiesenermaßen bedeutsame Emotionsregulationskompetenzen mit vergleichbarer Methode bei verschiedenen Störungen erfassen und dabei kaum Unterschiede in den Emotionsregulationskompetenzen zwischen verschiedenen Störungsbildern aufzeigen. Wenig ist jedoch darüber bekannt, inwieweit Emotionsregulationskompetenzen und -defizite bei verschiedenen psychischen Störungen emotionsspezifisch variieren oder emotionsübergreifender Natur sind. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der Studie, Emotionsregulationskompetenzen mit vergleichbaren Methoden bei verschiedenen Störungen emotionsspezifisch zu erfassen und systematisch zu vergleichen. Methode: Bei 1000 stationär-verhaltenstherapeutisch behandelten Patienten wurden emotionale Kompetenzen emotionsspezifisch mittels Fragebogen erfasst und in Beziehung zu den ICD-10-Diagnosen der Patienten gesetzt. Ergebnisse: Innerhalb einzelner Störungsbilder konnten kaum bedeutsame Unterschiede im Umgang mit verschiedenen Emotionen nachgewiesen werden. Es zeigen sich jedoch emotionsübergreifende Unterschiede in der Ausprägung von Emotionsregulationskompetenzen zwischen verschiedenen Störungsbildern. So weisen beispielsweise Patienten mit somatoformen Störungen und Anpassungsstörungen gegenüber Patienten mit depressiven Störungen, posttraumatischen Belastungsstörungen und sozialer Phobie einen insgesamt konstruktiveren Umgang mit Emotionen auf. Diskussion: Defizite in Emotionsregulationskompetenzen lassen sich als transdiagnostisch relevanter Faktor verstehen. Die Befunde stehen im Einklang mit der vorhergehenden Untersuchung und stützen weiter die Relevanz von transdiagnostisch-orientierten Interventionen zur störungs- und emotionsübergreifenden Förderung emotionaler Kompetenzen. C 29 Self-regulation, inhibition and cardiac autonomic balance Claus Vögele (Universität Luxemburg) Stefan Sütterlin (Universität Luxemburg) Abstract: Self-regulation is an important psychological process by which people seek to exert control over their thoughts, their feelings, their impulses and appetites, and their task performances. The human capacity for self-regulation appears to be much more extensive than what is found in other animals, which may suggest that the evolutionary pressures that guided the selection of traits that make up human nature, such as participation in cultural groups, found self-regulation to be especially adaptive and powerful. If so, then self-regulation may be one of the most distinctive human traits. Even if human beings are capable of more self-regulation than other animals, however, their capacity is far less than what many would regard as ideal, and self-regulation failures are central to the majority of health problems that plague individuals in modern societies. How does self-regulation operate? At present, there are a number of models attempting to explicate self-regulatory processes, most prominently the limited-resources-model, which suggests that selfregulation relies on a limited resource, akin to energy or strength, which it uses to interrupt the stream of behaviour and alter it. When this limited strength has been used, the person falls into a state of ego depletion, during which further efforts at self-regulation are less than normally successful. The empirical evidence for this limited-resources-model of self-regulation is, however, scarce and based on studies with weak methodological designs. Furthermore, related concepts and processes such as “neurovisceral integration” “frontal inhibition”, and “interoception” have not been considered in previous self-regulation research; yet these concepts are clearly relevant, and theoretical considerations and some empirical results suggest one-sided or reciprocal influences between these systems on psychophysiological, neuropsychological and behavioural levels. The current talk will present results from a series of laboratory-based psychophysiological investigations of central nervous system and peripheral processes concomitant with self-regulatory processes, in both healthy and clinical populations with self-regulatory deficits. C 30 Umgang mit positiven Emotionen und Depression Marta Filipek (Philipps-Universität Marburg) David Ebert (Philipps-Universität Marburg) Matthias Berking (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass Defizite in allgemeinen Emotionsregulationskompetenzen in Zusammenhang mit der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Symptomatik stehen (Berking, 2010). Bisherige Studien fokussieren allerdings ausschließlich auf Emotionsregulationsstrategien, die sich auf den Umgang mit negativen Emotionen beziehen. Ziel der aktuellen Studie ist es erstmalig Zusammenhänge zwischen dem Konstruktiven Umgang mit positiven Emotionen, der Häufigkeit positiver Emotionen und depressiver Symptomatik zu untersuchen. Dabei wurden die Hypothesen getestet, dass der Umgang mit positiven Emotionen unabhängig von der Intensität dieser Emotionen mit der depressiven Symptomatik assoziiert ist und dass dieser Zusammenhang teilweise über die Häufigkeit positiver Emotionen mediiert wird. Methode: An einer Stichprobe von N = 900 Personen, die die Kriterien einer unipolaren Depression erfüllten, wurde mit Hilfe standardisierter Selbstauskunftsverfahren der Umgang mit positiven Emotionen (SEK-ES, Ebert et al., submitted), die Intensität und Häufigkeit von positiven Emotionen (SEK-ES; PANAS, Watson et al., 1988) sowie die Ausgeprägtheit der depressiven Symptomatik (BDI, Hautzinger et al., 1994) erfasst. Zur Überprüfung der angenommen Zusammenhänge wurden um Bootstrapping-Verfahren (Shrout et al., 2002) erweiterte Mediationsanalysen nach Baron und Kenney (1986) auf Basis linearer Regression durchgeführt. Ergebnisse: Der konstruktive Umgang mit positiven Emotionen steht im Zusammenhang mit depressiver Symptomatik auch wenn die Intensität der positiven Emotionen statistisch kontrolliert wird (c= -.43). Dieser Zusammenhang wird partiell durch die Häufigkeit positiver Emotionen mediiert (c'= -.21). Diskussion: Die querschnittlichen Ergebnisse stehen im Einklang mit der Annahme, dass der konstruktive Umgang mit positiven Emotionen sich zum Einen über die Verstärkung der Häufigkeit positiver Emotionen auf depressive Symptomatik auswirkt, zum Andern aber auch direkt im Zusammengang mit der Symptomstärke steht. Sollte diese Annahme auch in Studien mit multiplen Messzeitpunkten, welche den Einsatz von spezifischen Verfahren zur Identifikation kausaler Zusammenhänge in Längsschnittsstudien (vgl. z.B. McArdle, 2001) bestätigt werden, sollte der Umgang mit positiven Emotionen auch als therapeutischer Ansatzpunkt in der Therapie depressiver Störungen gesehen werden. C 31 Verändert kognitive Verhaltenstherapie die Emotionsregulation depressiver Patienten? Thomas Forkmann (Institut für Medizinische Psychologie/ Soziologie, Aachen) Anne Scherer (Institut für Medizinische Psychologie/ Soziologie, Aachen) Markus Pawelzik (EOS-Klinik Münster) Maren Böcker (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Siegfried Gauggel (Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) Abstract: Theoretischer Hintergrund Emotionsregulationsstrategien können einen erheblichen Einfluss auf das psychische Befinden und die Lebenszufriedenheit haben. Berking et al. (2008) entwickelten deshalb ein spezifisches Training emotionaler Kompetenzen, das positive Effekte auf das Befinden einer gemischten Gruppe psychisch Kranker zeigte. Es ist allerdings unklar, welche Emotionsregulationsstrategien von depressiven Patienten eingesetzt werden, ob kognitive Verhaltenstherapie (KVT), die kein spezielles Emotionsregulationstraining enthält, die Emotionsregulation Depressiver dennoch verändert und inwieweit dies mit einer Reduktion der Symptomatik einhergeht. Methode Vierundvierzig Patienten einer Psychotherapie-Klinik, die an einer depressiven Störung litten und im Beck-Depressionsinventar (BDI) einen Wert >11 erzielten, nahmen freiwillig an der Studie teil (Alter M=36.4, SD=13.4; 63.6% Frauen, Aufenthaltsdauer M=59 Tage, SD=39). Alle Patienten füllten bei Beginn und Ende der Therapie den Emotion Regulation Questionnaire (ERQ, Gross & John, 2003), der die Strategien „Expressive Suppression“ und „Cognitive Reappraisal“ misst, das BDI, und die Symptomcheckliste (SCL90-R, Derogatis, 1992) aus. Die Diagnose wurde mittels eines diagnostischen Interviews gesichert. Die Datenanalyse erfolgte mittels Korrelationsanalysen, Kovarianzanalysen und Effektstärken (partielles η2). Ergebnisse Die depressive Symptomatik der Patienten war nach der Behandlung deutlich gebessert (η2= 0.06 bis 0.15). Bei 59.1% konnte eine Remission der Depression festgestellt werden. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Patienten nach der Behandlung weniger Expressive Suppression einsetzten (η2=0.15), Cognitive Reappraisal blieb jedoch stabil (η2=0.00). Expressive Suppression war mit der Verbesserung der Stimmung signifikant korreliert. Diskussion Die Studie gibt Hinweise darauf, dass sich nach einer KVT nur Expressive Suppression, nicht aber kognitive Emotionsregulationsstrategien verändern. Diese selektive Veränderung könnte dadurch erklärt werden, dass Expressive Suppression verhaltensnäher ist, und es daher Patienten leichter fallen könnte, hier zügig eine Veränderung zu erzielen. Schlussfolgerungen Die Studie zeigt, dass bei depressiven Patienten Emotionsregulationsstrategien mit psychischem Befinden assoziiert sind. Weitere diesbezügliche Forschung ist wünschenswert. Denkbar erscheint, dass die Integration eines gezielten Emotionsregulationstrainings in die Therapie positive Effekte erzielt. C 32 "Nicht nur, was du sagst, sondern auch wie du es sagst ... " - Der Einfluss emotionaler Erregung auf die langfristige Effektivität eines partnerschaftlichen Präventionsprogramms Sarah Weusthoff (TU Braunschweig) Brian Baucom (University of Southern California) David Atkins (University of Washington) Kurt Hahlweg (TU Braunschweig ) Abstract: 1Theoretischer Hintergrund / Fragestellung Kommunikationsregeln und deren Anwendung sind der Hauptinhalt verhaltenstherapeutischer partnerschaftlicher Prävention und werden als zentraler Veränderungsmechanismus angesehen. Die positiven Effekte auf partnerschaftliche Stabilität und Qualität sind empirisch gut belegt, und auch die subjektive Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Intervention ist sehr hoch. Dennoch erinnern die meisten Teilnehmer nur noch einen Bruchteil der erlernten Kommunikationsregeln. Die Ursachen hierfür sind unbekannt. Methode Die vor der Intervention (EPL – Ein partnerschaftliches Lernprogramm) auf Video aufgezeichneten Konfliktdiskussionen wurden hinsichtlich stimmlicher Erregungsparameter (Sprachgrundfrequenz f0) analysiert. Über hierarchisch-lineare Modellierung wurde der Zusammenhang dieser Werte mit der Anzahl erinnerter Kommunikationsregeln 11 Jahre nach der Teilnahme am EPL ausgewertet. Ergebnisse Höhere stimmliche Erregung vor dem EPL steht in Zusammenhang mit einer geringeren Zahl erinnerter Kommunikationsregeln 11 Jahre nach der Intervention. Auch männliches Geschlecht führte zu einer geringeren Erinnerungsleistung. Diskussion Eine erhöhte Sprachgrundfrequenz wirkt sich negativ auf die langfristige Wirksamkeit eines partnerschaftlichen Präventionsprogramms aus. Nicht nur worüber und in welcher Form Partner miteinander sprechen, scheint wichtig zu sein, sondern auch wie man einander Dinge sagt. Unklar bleibt jedoch, an welcher Stelle des Gedächtnisprozess f0 einen Einfluss hat. Schlussfolgerungen Auf der Suche nach Wirkmechanismen in verschiedenen psychotherapeutischen Bereichen scheint die f0 ein vielversprechender Kandidat zu sein. Sie kann ökonomisch erhoben werden, ist direkt in den Kommunikationsprozess zwischen den Partnern einbezogen und steht in engem Zusammenhang mit gut etablierten psychophysiologischen Prädiktoren für partnerschaftliche Qualität und Stabilität wie Herzrate oder Blutdruck. C 33 Familie + Beruf = Stress? Elterliche Stressbewältigung an der Schnittstelle von Familie und Beruf anhand einer Familienintervention Doreen Hartung (TU Braunschweig) Franziska Lups (TU Braunschweig) Kurt Hahlweg (TU Braunschweig) Abstract: Für viele erwerbstätige Eltern ist es eine Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Anhand dieser randomisiert-kontrollierten Studie wurde ein Training evaluiert (Workplace Triple P), das Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen soll. Das Training hat zum Ziel, dysfunktionales Erziehungsverhalten zu reduzieren, individuellen und berufsbezogenen Stress zu verringern und die elterliche und berufliche Selbstwirksamkeit zu steigern. Zusätzlich wurde überprüft, welche Rolle die durch das Training induzierten Veränderungen im dysfunktionalen Erziehungsverhalten bzw. der elterlichen Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Stressbewältigung an der Schnittstelle von Familie und Beruf spielen. Als Stichprobe dienten berufstätige Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren einer Experimental- und Wartelistenkontrollgruppe (N = 97 Eltern; 74 Mütter, 23 Väter; n [EG] = 42; n [KG] = 55). Berichten der Eltern zufolge waren alle teilnehmenden Kinder während des gesamten Untersuchungszeitraums im Mittel verhaltensunauffällig. Im Vergleich zu Eltern der KG berichteten Eltern, die sofort am Training teilnehmen konnten, ein signifikant verbessertes Erziehungsverhalten, eine signifikante individuelle und berufliche Stressreduktion sowie eine Steigerung der Selbstwirksamkeit im Familienund Berufsleben. Mediatoranalysen belegen, dass der stressreduzierende Effekt des Trainings auf die Veränderungen im dysfunktionalen Erziehungsverhalten zurückzuführen ist. Workplace Triple P leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur erfolgreichen Stressbewältigung an der Schnittstelle von Familie und Beruf. Unter Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung von Familienfreundlichkeit kann diese Intervention sowohl in einem kommunalen Rahmen als auch arbeitsplatzbasiert angeboten werden. Zusätzlich unterstützen diese Ergebnisse die Bedeutung von Elterntrainings, in denen konkrete Erziehungs- und Stressmanagementfertigkeiten geübt und im Alltag umgesetzt werden, um positive Veränderungen im Familien- und Berufsleben zu erzielen. C 34 FAMOS - Familien Optimal Stärken - Modellprojekt zur flächendeckendenden Implementierung von Präventionsprogrammen Inga Frantz (Universität Bielefeld) Nina Heinrichs (Universität Bielefeld) Abstract: 1. Theoretischer Hintergrund/Fragestellung 15 - 20% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland weisen psychische Auffälligkeiten auf, die meisten davon bleiben unbehandelt. Unter den Risikofaktoren für psychische Störungen ist das Erziehungsverhalten am leichtesten zu beeinflussen. An dieser Stelle setzt das FAMOS-Projekt durch die flächendeckende Implementierung der evidenzbasierten Präventionsprogramme Entwicklungsförderung in Familien: Eltern- und Kindtraining (EFFEKT), Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP) und Positive Parenting Program (Triple P) an. Bis Ende des Jahres 2011 soll über 50% der Familien in Paderborn mit Kindern zwischen 0 und 12 Jahren die Teilnahme an einem der Präventions- oder frühen Interventionsprogramme ermöglicht werden. Wir vermuten, dass zusammen mit einer begleitenden Werbekampagne, dieses Angebot die Bekanntheit und die Teilnahmerate an Präventionsprogrammen signifikant erhöht. Gleichzeitig sollen Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern reduziert werden. 2. Methode Es werden jährliche Telefonbefragungen bei einer Zufallsstichprobe von 10% aller Familien mit Kindern unter 13 Jahren in der Interventionsstadt Paderborn sowie der Kontrollstadt Recklinghausen durchgeführt. In diesen werden unter anderem Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern sowie die Bekanntheit und die bisherige Teilnahme an einem Eltern- bzw. Kindtraining erfasst. 3. Ergebnisse In der noch bis Ende März 2011 laufenden Baselineerhebung konnten bisher 545 Familien befragt werden. Dargestellt werden Ergebnisse zur Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitsbezogener Lebensqualität sowie TV- und PC-Konsum. Die Bekanntheit von Präventionsprogrammen bei den befragten Eltern ist unterschiedlich, sie reicht in Abhängigkeit vom Programm von 0% bis 76%. Die Teilnahmeraten, insbesondere an evidenzbasierten Eltern- bzw. Kindtrainings sind mit 3% sehr gering. 4. Diskussion Die gefundenen Prävalenzen von kindlichen Verhaltensauffälligkeiten entsprechen denen einer repräsentativen deutschen Gesamtstichprobe (KIGGS-Studie). Die einzuführenden Programme sind zur Baselineerhebung in der Zielpopulation wenig bekannt und kaum genutzt. 5. Schlussfolgerungen Die Präventionsforschung hat im letzten Jahrzehnt deutlich an Relevanz zugenommen. Die Dissemination effektiver Programme in der Praxis hinkt jedoch noch deutlich hinterher. C 35 Partnerschaft und Demenz: Paarkommunikation und Depressivität pflegender Ehefrauen Melanie Braun (Psychologisches Institut Universität Zürich) Belen Vazquez (Psychologisches Insitut der Universität Zürich) Urte Scholz (Psychologisches Institut der Universität Zürich) Rainer Hornung (Psychologisches Institut der Universität Zürich) Mike Martin (Psychologisches Institut der Universität Zürich) Abstract: Aus der aktuellen Paarforschung ist bekannt, dass zwischen der psychischen Gesundheit und der Kommunikation der Partner deutliche Zusammenhänge bestehen (z. B. Backenstrass et al., 2007; Ditzen, Hahlweg, Fehm-Wolfsdorf, & Baucom, 2010). Diese Follow-up-Studie fokussiert auf den dyadischen Austausch bei Ehepaaren, bei denen der Partner an einer Demenzerkrankung leidet und die Partnerin die Pflege übernimmt. Die Demenzliteratur belegt, dass die familiäre und insbesondere die eheliche Demenzpflege mit verschiedenen negativen Auswirkungen verbunden sind (z. B. Depressive Störungen, Medikamentenabusus). Die vorliegende Studie untersucht, wie Kommunikationsqualität bei betroffenen Paaren mit der psychischen Gesundheit, bzw. der Depressivität der Pflegepersonen zusammenhängt. An drei Erhebungszeitpunkten fand eine objektive videobasierte Erfassung der Paarkommunikation von Paaren mit einem demenzkranken Ehemann statt. Die Bestimmung der Kommunikationsqualität (positiv, neutral, negativ) erfolgte mit dem Rapid Marital Interaction Coding System. Zusätzlich wurden über Selbstberichtsdaten u. a. die Depressivität der Partner erfasst. 37 Dyaden nahmen an der Baseline-Untersuchung teil. Es folgten zwei Nacherhebungen nach jeweils sechs Monaten. Neben deskriptiven Auswertungen, kamen nicht-sequentielle und sequentielle Analysen zur Anwendung. Die Ergebnisse zeigen, dass die pflegenden Ehefrauen ausgeprägte depressive Symptome aufweisen, die im Zeitverlauf tendenziell zunahmen. Pflegepersonen, deren Partner viel positive Paarkommunikation zeigten, erlitten weniger depressive Symptome. Ausserdem hing die positive reziproke Kommunikation mit der psychischen Gesundheit der Ehefrauen zusammen. Positive Reziprozität bedeutet, dass zwischen der positiven Kommunikation der Partner eine Abhängigkeit besteht. Zu allen Erhebungszeitpunkten ergaben sich negative Korrelationen zwischen dem Ausmass der positiven reziproken Paarkommunikation und der Depressivität. Auch wenn aufgrund der korrelativen Analysen keine kausalen Interpretationen legitim sind, scheint nicht nur die Kommunikationsqualität, sondern insbesondere die Reziprozität des Austauschs bedeutsam zu sein. Eine Förderung der positiven Kommunikation zur Aufrechterhaltung, bzw. Erleichterung des reziproken Austauschs kann eine sinnvolle Intervention zur Steigerung des Wohlbefindens betroffener Paare darstellen. Desweiteren verdeutlicht diese Untersuchung den potentiellen Erkenntnisgewinn durch sequentielle Daten. C 36 Auswirkungen des multimodalen Schlaftrainings „KiSS“ für Kinder auf die Schlafeffizienz der Eltern Barbara Schwerdtle (Lehrstuhl für Psychologie I – Arbeitsbereich Interventionspsychologie, Institut für Psychologie, Universität Würzburg) Andrea Kübler (Lehrstuhl für Psychologie I – Arbeitsbereich Interventionspsychologie, Institut für Psychologie, Universität Würzburg) Angelika A. Schlarb (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Fachbereich Psychologie, Universität Tübingen) Abstract: Fragestellung: Schlafstörungen im Kindesalter sind weit verbreitet und gehen mit einer verringerten Schlafeffizienz einher. Darüber hinaus zeigen auch die Eltern betroffener Kinder Beeinträchtigungen ihres Schlafes. In vorausgehenden Studien konnte gezeigt werden, dass sich die kindliche Schlafeffizienz durch das multimodale Trainingsprogramm „KiSS“ verbessern lässt. Dieser Effekt war in einer Wartekontrollgruppe weniger stark. Die Schlafeffizienz der Väter ist durch die kindliche Schlafstörung weniger stark verringert, als die der Mütter. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie sich die Schlafeffizienz der Kinder und deren Eltern kurz- und langfristig nach dem Schlaftraining „KiSS“ verändern. Methode: 38 Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren wurden in Tübingen und Würzburg mit dem Schlaftraining „KiSS“ behandelt. Die Schlafeffizienz wurde mittels Schlaftagebüchern für die Eltern und Kinder erfasst. Messungen fanden vor dem Training, direkt nach dem Training, sowie zu einem 3-, 6,- und 12-Monats-Follow-Up statt. Ergebnisse: Die Schlafeffizienz der Kinder und der Mütter verbesserte sich nach dem Training. Die Effekte blieben bis zum 12-Monats-follow-up konstant. Die Schlafeffizienz der Väter lag bereits zu Beginn über der Schlafeffizienz der Mütter und verbesserte sich während des Trainings und der Nacherhebungen nicht signifikant. Diskussion: Es konnte erneut gezeigt werden, dass sich die Schlafeffizienz von Kindern mit Schlafstörungen durch „KiSS“ signifikant verbessert. In der vorliegenden Stichprobe waren auch Kinder mit komorbiden Störungen, was auf eine gute externe Validität von „KiSS“ hindeutet. Väter sind durch die Schlafstörung des Kindes in ihrer Schlafeffizienz kaum beeinträchtigt und zeigen daher auch keine Verbesserung durch das Training. Die verringerte Schlafeffizienz der Mütter könnte auf die in Teilen immer noch klassische Rollenverteilung innerhalb der Familien zurückzuführen sein. So sind es meist die Mütter, die sich am Abend und in der Nacht um das Kind kümmern. Dies kann durch verzögertes Einschlafen und mehrfache Schlafunterbrechung zu einer verringerten Schlafeffizienz führen. Schlussfolgerungen: Durch das multimodale Schlaftraining „KiSS“ können neben Verbesserungen im Schlaf der Kinder auch positive Effekte auf den Schlaf der Mütter erzielt werden. C 37 „Alles halb so schlimm?!" – Nebenwirkungen von Psychotherapie Inga Ladwig (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Yvonne Nestoriuc (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung Während die Wirksamkeit vieler psychotherapeutischer Interventionen als belegt gelten kann, ist über potentielle negative Effekte von Psychotherapie noch wenig bekannt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Verschlechterungen bei ca. 5-10% der Patienten auftreten und andere Folgeprobleme von Psychotherapie auftreten können. Diese Studie widmet sich der Frage ob und in welchen Bereichen des persönlichen Erlebens unangenehme Nebenwirkungen während oder nach einer Psychotherapie auftreten. Methode Der „Fragebogen zur balancierten Psychotherapie Evaluation“ (FBP) wurde mit Hilfe eines renommiertes Expertengremiums entwickelt. Er erfasst erlebte Veränderungen über ein bipolares Itemformat in den Bereichen: Symptome; Partnerschaft, Freunde und Familie; Therapeutische Beziehung; Arbeitsplatz; Stigmatisierung) und deren Attribution auf die Psychotherapie, sowie zusätzlich Eckdaten der zurückliegenden Psychotherapie, persönliche Erwartungen und soziodemografische Variablen. Die Rekrutierung ehemaliger Psychotherapiepatienten für die internetbasierten Pilottestung erfolgte über einschlägige Internet-Foren (z.B. Panik-attacken.de und abserver.de). Ergebnisse Im Zeitraum von 11/2010 bis 01/2011 nahmen n=200 Personen an der Untersuchung teil. Itemanalysen ergaben eine zufriedenstellende Reliabilität (α=0,923). Die meisten Nebenwirkungen erlebten die Befragten in der Beziehung zu ihrem Therapeuten/in – 76% gaben hier negative Erfahrungen an. Schwerwiegendere Schädigungen wie sexuelle Belästigung (n=5) und Bruch der Schweigepflicht (n=16) hatten eine geringe Inzidenz. Ein höheres Ausmaß an erlebten Nebenwirkungen korreliert mit vorherigem Therapieabbruch, andere Therapieversuche in der Vergangenheit, Therapeutenwechsel und stationären Aufenthalten. Diskussion Von den 200 Befragten gaben nur 5 Personen keinerlei Verschlechterungen während oder nach der Psychotherapie an, was die Relevanz des Themas verdeutlicht. Ein Großteil der Nebenwirkungen findet sich innerhalb des therapeutischen Settings – hier scheint ein Risikofaktor für Verschlechterungen zu liegen. Die erlebten negativen Veränderungen traten unabhängig von Therapieschule und durchgeführten Interventionen auf. Schlussfolgerungen Verschlechterungen und Schädigungen durch Psychotherapie treten auf, können mit dem FBP reliabel erfasst werden und sollten in einem nächsten Schritt hinsichtlich möglicher Prädiktoren in verschiedenen Settings und Populationen untersuch C 38 Beeinflussen Kosten-Nutzenerwartungen den Therapieerfolg? Martin Klimitsch (Universität Koblenz-Landau) Jens Heider (Universität Koblenz-Landau) Anette Schröder (Universität Koblenz-Landau) Abstract: Theoretischer Hintergrund Eine 2007 veröffentlichte Studie der australischen Forscher McEvoy & Nathan kam zu dem Ergebnis, dass der Therapieerfolg von der Änderungsbereitschaft der Patienten beeinflusst wird. Befragt wurden 248 Patienten nach ihrer Kosten- und Nutzeneinschätzung bezüglich einer Verhaltensänderung. Die größten Behandlungserfolg erzielte die Gruppe der „Ambivalenten“, die sich der Kosten und Nutzen einer Verhaltensänderung gleichermaßen bewusst waren. Unterschiede konnten auch bei weiteren Konstrukten wie Erfolgserwartung, Selbstwirksamkeit und Bereitschaft zur Mitarbeit, festgestellt werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, diese Ergebnisse zu replizieren und gleichzeitig die methodischen Einschränkungen der Studie zu berücksichtigen. Methode Im Rahmen der laufenden EXPECT- Studie der Universität Koblenz - Landau wurden Kosten und Nutzenerwartungen von ambulanten Psychotherapiepatienten (N= 148, Stand Feb. 2011) der Universitätsambulanz zu drei Messzeitpunkten erfasst (vor dem Erstgespräch; nach der Probatorik; nach der 10. Therapiestunde). Die Kosten-Nutzenerwartungen wurden, wie auch bei McEvoy & Nathan (2007) mittels zweier unipolarer Skalen gemessen. Darüber hinaus wurde die Erfolgserwartung (PATHEV), Selbstwirksamkeitserwartung, Passivität (TBW-K) und die Symptombelastung (SCL-90-R) erfasst. Die erhobenen Daten wurden varianzanalytisch ausgewertet. Ergebnisse In Anlehnung an die Untersuchung von McEvoy & Nathan (2007) war es möglich, vier „Patiententypen“ zu identifizieren. „Optimisten“, die nur von Vorteilen ausgehen, „Ambivalente“, die sich der Vor- und Nachteilen bewusst sind, „Indifferente“, die weder Vor-noch Nachteile erwarten und „Pessimisten“, für die die Nachteile überwiegen. Aktuell werden die Daten hinsichtlich der Unterschiede zwischen diesen vier Patientengruppen ausgewertet. Diskussion Diskutiert wird, ob Patienten, die Kosten- und Nutzenerwartungen angeben, andere Einstellungsmerkmale aufweisen und langfristig ein besseres Behandlungsergebnis erzielen. C 39 Neurophysiological correlates of motivational incongruence: an exploratory study Maria Stein (Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie, Bern) Rebekka Frei (Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie, Bern) Yvonne Egenolf (Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Bern) Franz Caspar (Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Bern) Thomas Dierks (Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie, Bern) Thomas Koenig (Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie, Bern) Abstract: Theoretical Background: The construct of motivational incongruence is defined by insufficient realization of a person’s motivational goals. If these motivational goals imply the presence of desirable experiences, dissatisfaction leads to approach incongruence, if the goals imply the avoidance of aversive experience, dissatisfaction leads to avoidance incongruence. Motivational incongruence can be validly assessed with the incongruence questionnaire and has been shown to correlate with other clinically important parameters, as for example subjective well-being and psychopathological symptoms (Grosse Holtforth & Grawe, 2003). It is thus well conceivable that such a construct, tightly related to psychological functioning, should be reflected in the tonic activity of the brain systems, as it can be assessed with resting state electroencephalography (EEG). Method: The present study therefore for the first time investigates a potential correlation between motivational incongruence and tonic brain activity: 20 healthy subjects completed the INC-questionnaires and the subjects’ resting brain activity was measured with 70-channel EEG. After preprocessing, the data of the EEG frequency bands was correlated with the INC data in a Topographical Analysis of Covariance (TANCOVA), generators of significant correlations were additionally analyzed with sLORTEA. Results: We found a significant correlation between the Alpha2-Frequency band (10-12.5 Hz) and approach incongruence: The higher the approach incongruence of a person, the smaller the Alpha2-power in occipital regions. Generators for this effect were located in the inferior frontal gyrus (slightly left lateralized), superior temporal gyrus (bilateral), Insula (bilateral) and Cuneus. Discussion: The findings suggest that motivational incongruence is reflected in brain systems related to mental arousal and affective symptoms (e.g. Jones et al, 2010; Jacobs & Snyder, 1996). Conclusion: A neurophysiological signature of motivational approach incongruence can thus be observed even in a healthy sample with only limited variance of INK-values. In a next step, the analyses shall be extended to a patient sample. C 40 Sind erfahrene Therapeuten wirklich die bessere Wahl? Linda Klein (Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Hinrich Bents (Zentrum für Psychologische Psychotherapie, Psychologisches Institut Universität Heidelberg) Abstract: Psychotherapieausbildung wird in Deutschland seit nunmehr über 10 Jahren durch das so genannte Psychotherapeutengesetz geregelt. Die Ausbildung sowie damit zusammenhängende Therapeutenvariablen haben bisher trotz gegenteiliger Interessensbekundungen (vgl. BänningerHuber, 2001) erstaunlich wenig Forschungsbemühen auf sich gezogen (Strauß & Freyberger, 2009). Bisherige Untersuchungen zum Einfluss von Erfahrung auf den Therapieoutcome sind sehr heterogen, die Ergebnisse äußerst inkonsistent. Ziel der vorgestellten klinischen Studie im naturalistischen Setting soll es sein, den Einfluss der Erfahrung des Therapeuten auf Therapieverlauf und -ergebnis von Richtlinienorientierten kognitiven Verhaltenstherapien zu untersuchen. Es wird ein Vergleich angestellt zwischen psychotherapeutischen Ausbildungskandidaten, die nach erfolgreichem Abschluss der Zwischenprüfung erste eigene Therapien durchführen und approbierten Therapeuten, die in vergleichbarem Kontext ausgebildet wurden sowie mit ähnlichen Patienten arbeiten, aber bereits einige Jahre therapeutischer Erfahrung vorzuweisen haben. Es wird vermutet, dass die Erfahrung des Therapeuten positiven Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis von Psychotherapien nimmt. Zudem wird untersucht, ob der Zusammenhang zwischen Erfahrung des Therapeuten und Therapieverlauf moderiert wird durch die Schwere der Störung des Patienten. Mediierende Einflüsse des therapeutischen Vorgehens wie z. B. die Orientierung an Therapiemanualen oder die Ausgestaltung der therapeutischen Beziehung werden diskutiert. Deskriptive Analysen sowie varianzanalytische Auswertungen geben Hinweise auf einen differentiellen Einfluss von therapeutischer Erfahrung auf den Verlauf und das Ergebnis psychotherapeutischer Behandlung. Bänninger-Huber, E. (2001). Von der Erfolgsforschung zur Prozessforschung - und wieder zurück? Zum aktuellen Stand der Psychotherapieforschung im deutschsprachigen Raum. Psychotherapeut, 46(5), 348-352. Strauß, B. & Freyberger, H.J. (2009). Schwerpunktheft zum Thema Ausbildungsforschung in der Psychotherapie. Ergebnisse des Forschungsgutachtens. Psychotherapeut, 54(6), 409-410. C 41 Wahrgenommene Kosten und Nutzen von Verhaltensänderungen in der ambulanten Psychotherapie Alexis Paulus (Universität Koblenz-Landau) Martin Klimitsch (Universität Koblenz-Landau) Jens Heider (Universität Koblenz-Landau) Anette Schröder (Universität Koblenz-Landau) Abstract: Theoretischer Hintergrund Patientenerwartungen wurden in der Therapieforschung schon vielfach untersucht, jedoch kaum in Form von Kosten- und Nutzenerwartungen bzgl. Verhaltensänderungen. Einer australischen Studie zufolge (McEvoy & Nathan, 2007) zeigen Patienten, die mehr Nutzen erwarten, weniger Symptombesserung als Patienten, die genauso viele Nutzen- wie Kostenerwartungen haben, also ambivalent sind. Jedoch wurden die Erwartungen in dieser Studie nicht inhaltlich untersucht. Methode Im Rahmen der EXPECT- Studie der Universität Koblenz - Landau wurden Kosten und Nutzenerwartungen von Psychotherapiepatienten (N= 134) der Universitätsambulanz vor der ersten Psychotherapiesitzung erfasst. Anhand zweier unipolarer Skalen wurde gemessen, ob Kosten- und Nutzenerwartungen bestehen. Zusätzlich wurden mittels einer offenen Befragung jeweils bis zu drei konkrete Erwartungsaussagen erfasst. Ergebnisse Insgesamt wurden 396 Erwartungsaussagen (164 Kosten/ 232 Nutzen) analysiert. In einem ersten Schritt wurde das Kategoriensystem von zwei Ratern auf Übereinstimmung geprüft. Hierbei ergaben sich sehr gute bis gute Übereinstimmungswerte (Cohen's Kappa= 0.82 auf der Hauptkategorienebene und 0.73 auf Kategorienebene). In einem weiteren Schritt wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen den Erwartungen und weiteren Patientenmerkmalen (Diagnose und Therapievorerfahrung) besteht. Außerdem wurde geprüft, ob „ambivalente“ Patienten (viele Kosten und viele Nutzen) andere Erwartungen nennen als beispielsweise Patienten, die mehr Nutzen als Kosten wahrnehmen. Diskussion Die Ergebnisse eröffnen die Möglichkeit, den motivationalen Zustand der Patienten vor Beginn der Therapie inhaltlich zu beschreiben und die darin liegenden motivationalen Konflikte in Form von Ambivalenzen näher darzustellen und zu verdeutlichen. Dies scheint deshalb sinnvoll, da davon ausgegangen wird, dass die Bearbeitung von Ambivalenzen in der Psychotherapie eine immer größere Rolle spielt. C 42 Zur Versorgungssituation im Bereich der stationären neuropsychologischen Therapie – eine bundesweiten Klinikbefragung Stephan Mühlig (TU Chemnitz) Manuela Look (TU Chemnitz) Anne Kolbe (TU Chemnitz) Anja Neumann-Thiele (TU Chemnitz) Armin Scheurich (Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)) Abstract: HINTERGRUND: In Deutschland wird die Anzahl von Patienten mit Indikation für eine stationäre neurologische Therapie auf >500.000 p.a. geschätzt. Dem stehen bundesweit lediglich einige hundert Klinische Psychologen bzw. Psychologische Psychotherapeuten (PPT) mit neuropsychologischer Spezialqualifikation gegenüber. Fragestellungen: Welche Patienten mit welchen Merkmalen und Störungsbildern werden in der stationären neurologischen Versorgungspraxis von Neuropsychologen mit welcher Fach- und Spezialqualifikation und mit welchen Interventionsverfahren behandelt? METHODE: Totalerhebung aller stationären neurologisch-neuropsychologischen Einrichtungen in Deutschland mittels je zwei Fragebögen zu folgenden Themenbereichen: a) Klinikfragebogen (20 Items): Klinikmerkmale, Organisation der Neuropsychologie, strukturelle Bedingungen, Einweisungsprozesse; Therapeutenfragebogen (27 Items): Therapeutencharakteristika, Behandlungsmerkmale, Patientencharakteristika. Stichprobe: Auswertungsstichprobe N=165 Kliniken (Ausschöpfungsquote: 52,5%) mit n=298 Therapeutenfragebögen. ERGEBNISSE: In den meisten befragten Kliniken arbeiten 1-5 Neuropsychologen. Die häufigsten primären Störungsbilder sind cerebrovaskuläre Erkrankungen, gefolgt von degenerativen Hirnerkrankungen und Schädel-HirnTraumata. Unter den behandelten Funktionsstörungen dominieren Defizite bei Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen. Die meisten Patienten weisen eine psychische Komorbidität auf (meist affektive Störungen). Neuropsychologische Therapeuten besitzen überwiegend (54%) die Approbation als PPT (davon: 59% Fachkunde VT) und i.d.R. das Weiterbildungszertifikat „Klinische Neuropsychologie“ der GNP. Die weitaus häufigste Tätigkeit bildet die neuropsychologische Diagnostik (75% täglich), gefolgt von Psychotherapie mit neuropsychologischem Fokus (43%) und spezifischen neuropsychologischen Interventionsformen wie Restitution/Funktionstrainings (38,1%), Kompensation (34,2%). In der Selbstbeurteilung der Therapeuten werden die Therapieziele meist erreicht. DISKUSSION + SCHLUSSFOLGERUNGEN: In neurologischen Kliniken und Fachabteilungen werden im Regelfall Psychologen mit neuropsychologischer Spezialqualifikation beschäftigt, die aber nur gut zur Hälfte die Approbation zum Psychologischen Psychotherapeuten besitzen. Sie sind dominierend mit diagnostischen Aufgaben betraut, während psychotherapeutische oder neuropsychologische Therapieangebote noch als ausbaufähig betrachtet werden können. C 43 Differentielle Zusammenhänge neurokognitiver Funktionen mit Anerkennung und Zuschreibung psychischer Beeinträchtigungen bei Schizophrenie Manuel Waldorf (Universität Osnabrück) Linda Pruß (Universität Osnabrück) Henning Schöttke (Universität Osnabrück) Karl H. Wiedl (Universität Osnabrück) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Eine reduzierte Krankheitseinsicht von Menschen mit SchizophrenieDiagnosen wird häufig als Ausdruck neurokognitiver Defizite gewertet. Als einsichtsbegrenzende Faktoren wurden Exekutivfunktionen und verbales Gedächtnis ausgemacht. Ein Manko bisheriger Arbeiten ist allerdings die geringe Erfassungsbreite und fehlende Ausdifferenzierung von Einsicht und Kognition. Ausgehend von dieser Kritik wurde vorhergesagt, dass die allgemeine Bewusstheit psychischer Beeinträchtigungen, nicht aber die Anerkennung der spezifischen psychischen Erkrankung oder der Behandlungsnotwendigkeit akzentuiert mit exekutiven Funktionen korreliert sein würde. Methode: 112 Patienten mit Schizophrenie-Diagnosen wurden mit der mehrdimensionalen Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD) und einer kognitiven Testbatterie untersucht, deren Zusammenstellung sich am MATRICS-Konsens orientierte (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia). Berücksichtigt wurden prämorbide Intelligenz (Wortschatztest WST), Problemlösen und Exekutivfunktionen (Wisconsin Card Sorting Test WCST sowie dynamische Prätest-Training-Posttest-Darbietung: Wiedl, 1992), verbale Merk- und Lernfähigkeit (California Verbal Learning Test CVLT) und Verarbeitungsgeschwindigkeit (Trail Making Test A). Ergebnis: Erwartungskonform korrelierten Exekutivfunktionen (dynamischer WCST) moderat mit allgemeiner Problembewusstheit (r = .31, p < .01). Eine diesbezügliche Überlegenheit über das verbale Gedächtnis konnte allerdings nicht bestätigt werden (r = .31, p < .01). Beide Domänen korrelierten schwach mit Einsicht i. S. der Übernahme des psychiatrischen Krankheitsmodells. Es zeigte sich kein Zusammenhang mit der Bewusstheit von Behandlungsbedürftigkeit. Verarbeitungsgeschwindigkeit und Wortschatz hatten kaum Erklärungswert. Diskussion: Die Bedeutung von Exekutivfunktionen und verbalem Gedächtnis für Einsicht konnte bestätigt werden. Diese bezieht sich jedoch nur auf die allgemeine Reflexion psychischer Probleme. Bei zunehmender Spezifität der Einsichtsaspekte kann ein steigender Einfluss non-kognitiver Faktoren angenommen werden. Schlussfolgerung: Die Verwendung globaler Einsichtsmaße kann spezifische, hier sichtbare Zusammenhangsmuster verschleiern. Ein vielversprechender Ansatz besteht in der Entwicklung mehrfaktoriell-hierarchischer Modelle der Einsichtsgenese, die zwischen reflexiven und attributiven Einsichtsfacetten unterscheiden. C 44 Ist eingeschränkte Symptombewusstheit bei Schizophrenie lediglich Ausdruck neurokognitiver Defizite? Linda Pruß (Universität Osnabrück) Karl H. Wiedl (Universität Osnabrück) Henning Schöttke (Universität Osnabrück) Manuel Waldorf (Universität Osnabrück) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Die Befundlage zur Entstehung von Krankheitseinsicht bei Patienten mit Schizophrenie-Diagnosen ist widersprüchlich. Dies geht vermutlich auf die Vermischung unterschiedlicher Aspekte von Krankheitseinsicht in frühen theoretischen Modellen (z. B. David, 1990) zurück. Eine differentielle Konzeptualisierung und Erforschung der Facetten von Einsicht ist daher für eine weiterführende Untersuchung ihrer Ursachen erforderlich. In der aktuellen Studie soll der Aspekt der Symptombewusstheit in Bezug auf seine Bedingungen untersucht werden. Aufbauend auf dem Modell von Lincoln et al. (2007) wird die Annahme überprüft, dass Symptombewusstheit allein durch neurokognitive Variablen vorhergesagt werden kann. Methode: 105 Patienten wurden mit der Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD) und der Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) befragt und bearbeiteten den Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV). Weiterhin wurde eine neurokognitive Testbatterie, die sich am MATRICS-Konsens (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) orientiert, darunter Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Wortschatztest (WST), California Verbal Learning Test (CVLT) und Trail Making Test (TMT-A), eingesetzt. Ergebnis: Keine der neurokognitiven Variablen korrelierte signifikant mit Symptombewusstheit. Entgegen der Vorhersage erwiesen sich ausschließlich klinische und Coping-Variablen als signifikante Prädiktoren der Symptombewusstheit. Diskussion: Die von uns berichteten Ergebnisse stehen in einem erklärungsbedürftigen Widerspruch zu früheren Arbeiten. Methodische Abweichungen zu relevanten anderen Studien sind nicht erkennbar; auch die Orientierung an den MATRICS-Domänen unterstützt die Validität der Befunde. Es ist daher zu überlegen, ob neurokognitive Bedingungen evtl. erst bei Einsichtsfacetten höherer kognitiver Komplexität (z. B. der Übernahme eines psychiatrischen Krankheitsmodells oder der Symptomattribution) wirksam sind. Motivationale Merkmale der Patienten können hingegen bereits auf der Ebene basaler Einsichtsfacetten wirksam sein und sollten neben klinischen und neurokognitiven Variablen analytisch und klinisch-praktisch berücksichtigt werden. Schlussfolgerung: Monokausal-neurokognitive Erklärungen von Defiziten der Symptombewusstheit müssen auf den Prüfstand gestellt werden, auch in diesem Bereich sind multifaktorielle Verursachungsmodelle zu bedenken. C 45 Schnelles Schlussfolgern und bedrohliche Blicke fremder Menschen: Zusammenhänge zwischen der Tendenz schizophrener Patienten, voreilige Schlussfolgerungen zu treffen, der Wahrnehmung emotionaler Gesichter als bedrohlich und Verfolgungswahn Stephanie Mehl ([email protected]) Michael Wagner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Wolfgang Wölwer (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Martin Landsberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) Christopher Hautmann (Universitätsklinikum Köln) Farahnaz Klöhn-Sagatoislam (Philipps-Universität Marburg) Stefan Klingberg (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Aktuelle kognitiv-behaviorale Erklärungsmodelle wahnhafter Überzeugungen berücksichtigen einerseits spezifische sozial-kognitive Auffälligkeiten (voreiliges Schlussfolgern, externalisierenden Attributionsstil, Beeinträchtigungen in der sog. „Theory of Mind“- Fähigkeit), andererseits auch emotionale Faktoren (negative Selbst- und Fremdschemata, Angst). In den theoretischen Modellen wird angenommen, dass die Prozesse die Entstehung und Aufrechterhaltung von positiven Symptomen und Wahnüberzeugungen mediieren. Zahlreiche Befunde deuten an, dass insbesondere der Tendenz von Patienten mit Schizophrenie, voreilige Schlussfolgerungen zu treffen (Jumping to conclusions bias (JTC), eine wichtige Rolle in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Wahn zugestanden werden sollte. Aktuell ist jedoch unklar, inwiefern JTC mit emotionalen Prozessen wie z.B. Angstsymptomen und einem starken Bedrohungsgefühl interagiert und somit die Entstehung und Aufrechterhaltung paranoider Wahnüberzeugungen fördert. Methoden: In der vorliegenden Untersuchung wurden Patienten mit schizophrenen Störungen (n = 233) mit psychopathologischen Interviews, der Fische- Aufgabe zur Untersuchung des JTC-Bias (Moritz & Woodward, 2010) und dem Pictures of Facial Affect Task (PFA, Ekman & Friesen, 1976), der Emotionserkennung sowie ein Rating der wahrgenommenen Bedrohlichkeit der emotionalen Gesichtsausdrücke beinhaltet, untersucht. Die Patienten wurden in die BMBF-geförderte Positive – Studie zur randomisiert-kontrollierten Überprüfung der Wirksamkeit kognitiver Verhaltenstherapie im Vergleich zu supportiver Therapie bei persistierenden Positivsymptomen der Schizophrenie aufgenommen. Ergebnisse: Der JTC– Bias sowie die Wahrnehmung von emotionalen Gesichtsausdrücken als bedrohlich standen in multiplen linearen Regressionsanalysen in einem positiven Zusammenhang mit (Verfolgungs)-wahn und der Belastung durch Wahnüberzeugungen. Die Interaktion zwischen dem JTC-Bias und der Tendenz, emotionale Gesichtsausdrücke als bedrohlich wahrzunehmen, klärte ebenfalls einen spezifischen Anteil der Varianz in Verfolgungswahn auf. Diskussion: Die vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass KVT bei schizophrenen Patienten sich verstärkt der Modifikation sozial-kognitiver Verarbeitungsstile wie der Tendenz, schnelle Schlussfolgerungen zu treffen, sowie der Überprüfung der Wahrnehmung perzeptiver Reize als bedrohlich zuwenden sollten. C 46 Sleep and problem solving in schizophrenia Muniarajan Ramakrishnan (Bergische Universität Wuppertal) Reinhard Pietrowsky (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) Gudrun Sartory (Bergische Universität Wuppertal) Abstract: Background: There is evidence of problem solving processes being improved by sleep. Problem solving as well as sleep have been shown to be impaired in schizophrenia. The present study aimed at investigating relationships between the two domains. Methods: Twenty-two schizophrenia patients (mean age 41.1 years) and 13 healthy controls (37.4 years) took part. Participants underwent a day- and a night-time condition following learning, separated by a week, with half of them being allocated to the night or the day condition first, in a balanced design. Initially, neuro-psychological tests were administered. Problem solving was assessed with the Computerized Tower of London Test (ToL), consisting of 15 tasks with increasing difficulty. Scores are number of solved tasks and total time taken. The test was administered prior to sleep or wakefulness, respectively and again after 8 hours. After a ‘habituation’ night in the sleep laboratory, whole night polysomnography was recorded during the night-time condition. Sleep EEG was analysed according to Rechtschaffen und Kales (1968). Results and discussion: Compared to control participants, schizophrenia patients were impaired in their performance of the neuropsychological tests and took longer to complete the ToL. Both groups improved at the second testing occasion. There was no advantage to the night compared to the day-time condition in either group. There were no significant group differences with regard to sleep parameters. Correlations with sleep parameters revealed a significant positive correlation between number of solved tasks and number of K-complexes in case of the patients and a negative correlation between total time and number of sleep spindles in controls. The results indicate different modes of problem solving associated to sleep in schizophrenics and healthy controls. C 47 Warum so langsam? Ein Defizit der selektiven Aufmerksamkeit oder der willentlichen Handlungskontrolle bei Patienten mit Schizophrenie? David Möllers (Humboldt-Universität zu Berlin) Benedikt Reuter (Humboldt-Universität zu Berlin) Stephanie Lüdeking (Humboldt-Universität zu Berlin) Marion Lautenschlager (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Universitätsmedizin Berlin) Jürgen Gallinat (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Universitätsmedizin Berlin) Norbert Kathmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Erhöhte Reaktionszeiten sind ein üblicher Befund bei Patienten mit Schizophrenie sowohl bei Wahlreaktionen als auch bei Einfachreaktionen. Da Reaktionszeiten allerdings verschiedene Prozesse wie z.B. die Reizwahrnehmung & -auswahl, Reaktionsauswahl, motorische Programmierung, periphere Muskelaktivität u.a. umfassen, bleibt trotz intensiver Forschung bis heute unklar, in welchem dieser Bereiche Patienten mit Schizophrenie ein Defizit aufweisen. Ein kürzlich veröffentlichter Befund legt nahe, dass die Latenz des lateralisierten Bereitschaftspotenzials gemessen nach Stimulus Onset (S-LRP) bei Schizophrenen gegenüber psychisch Gesunden erhöht ist, was für eine verzögerte Reaktionsauswahl bzw. -initiierung spricht. Unklar bleibt dabei jedoch auch hier, ob auch andere Teilprozesse wie z.B. die selektive Aufmerksamkeit betroffen sind. Ziel dieser Studie ist es, durch unter Nutzung erreigniskorrelierter Potenziale eine Dissoziierung dieser Prozesse zu erreichen und hierdurch Klarheit zu schaffen. Neben dem S-LRP als Marker für Handlungsinitiierung gilt die N2 posterior contralateral als Marker für den Ablauf selektiver Aufmerksamkeitsprozesse. Für unsere Studie wurde eine PraamstraWahlreaktionsaufgabe so modifiziert, dass beide Potenziale in nur einer Aufgabe evoziert werden und mittels Elektroenzephalogramm an 20 Patienten mit Schizophrenie und 20 gesunde Kontrollen gemessen werden konnten. Unsere Ergebnisse sprechen für erhöhte Reaktionszeiten und erhöhte Latenzen des S-LRP bei Patienten mit Schizophrenie. Es zeigt sich aber auch eine leicht erhöhte Latenz der N2pc, diese jedoch erklärt nicht die Reaktionszeitverlängerung. Die Ergebnisse unserer Studie legen damit nahe, dass es sich bei der erhöhten Reaktionszeit der Patienten mit Schizophrenie um ein Defizit im Bereich der Handlungsinitiierung handelt, wobei auch Prozesse der willentlichen Aufmerksamkeitsverschiebung betroffen sein könnten. Diese Arbeit wurde gefördert durch Gelder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Projekts RE 2869/1-1. C 48 Welche Patientenmerkmale beeinflussen die frühe therapeutische Beziehung in der Behandlung von Schizophrenie? Esther Jung (Philipps-Universität Marburg) Martin Wiesjahn (Philipps-Universität Marburg) Tania M. Lincoln (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Die Therapiebeziehung ist ein wichtiger Wirkfaktor in der Psychotherapie und zeigt konsistent Zusammenhänge mit dem Therapieerfolg. Verschiedene Patienten- und Therapeutenvariablen beeinflussen die Qualität der therapeutischen Beziehung. Forschungsergebnisse bei Schizophrenie weisen darauf hin, dass die Stärke der Negativsymptomatik und das soziale Funktionsniveau zu Beginn der Therapie die Beziehung beeinflussen. Ziel dieser Untersuchung war es, diese Ergebnisse zu replizieren und zu überprüfen, ob weitere psychosespezifische und allgemeinere Patientenmerkmale die frühe Therapiebeziehung beeinflussen. Methode: Im Rahmen einer Therapiestudie zur Kognitiven Verhaltenstherapie bei Schizophrenie wurden N=80 Patienten mit psychotischen Störungen ambulant behandelt. Vor der Therapie wurden Patientenmerkmale anhand von Selbst- und Fremdratings erhoben (PANSS, GAF, SCL, RFS, CDSS, BDI). Die Therapiebeziehung wurde nach jeder Sitzung von Patienten und Therapeuten mit dem Stundenbogen für die Allgemeine und Differentielle Einzelpsychotherapie (STEP: Krampen, 2002) eingeschätzt. In die Analysen gingen 59 Patienten- und 60 Therapeutenbögen der ersten fünf Sitzungen ein. Ergebnisse: Die Übereinstimmung zwischen Patienten und Therapeutenratings schwankte stark zwischen den Messzeitpunkten. Korrelationen zwischen den Baselinevariablen und der Therapiebeziehung (MW Sitzungen 1-5) wurden getrennt für Patienten und Therapeuten berechnet. Es zeigten sich signifikante negative Korrelationen zwischen der Negativsymptomatik (PANSS-N) und der durch Patienten und Therapeuten eingeschätzten Beziehung. Die Patienteneinschätzung korrelierte zudem negativ mit allgemeinerer Psychopathologie (PANSS-G) und Depressivität (CDSS) sowie positiv mit dem Funktionsniveau (GAF). Regressionsanalysen zeigten die Negativsymptomatik als einzigen signifikanten Prädiktor für Patienten- und Therapeutenratings der Therapiebeziehung. Diskussion: Stärker ausgeprägte Negativsymptomatik zu Beginn der Therapie geht mit einer tendenziell niedrigeren wahrgenommenen Qualität der frühen therapeutischen Beziehung einher. Dieses Ergebnis ist konsistent mit vorherigen Studien. Einflüsse weiterer Baslienvariablen trugen nicht zusätzlich zur Erklärung von Unterschieden in der Beziehung bei. Der Aufbau der therapeutischen Beziehung sollte daher bei Patienten mit ausgeprägter Negativsymptomatik besonders fokussiert werden. C 49 Kognitive Verhaltenstherapie bei Psychosen (CBT-p) – Vorstellung einer geplanten Studie zur Therapieprozessforschung Martin Wiesjahn (Philipps-Universität Marburg) Esther Jung (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Tania M. Lincoln (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen haben sich bei der Behandlung von psychotischen Störungen als wirksam erwiesen. Unklar ist jedoch, wann sich Veränderungen der Symptomatik im Therapieverlauf zeigen und was diese bewirkt. Ziel dieser Studie ist daher die Beantwortung folgender Fragen: (1) Gibt es Merkmale, deren Veränderung im Verlauf der Therapie die Symptomreduktion vorhersagen, im Sinne von Wirkfaktoren (z.B. therapeutische Beziehung, Kontrollerleben in Bezug auf die Symptome, dysfunktionale selbstabwertende Kognitionen, Metakognitionen über die Symptome und soziale Unterstützung)? (2) Lassen sich Muster in den Therapieverläufen identifizieren und vorhersagen? (3) Gibt es in Bezug auf Wirkfaktoren und Verläufe Unterschiede zwischen Patienten, die an einer psychotischen Störung leiden, und Patienten mit anderen Störungsbildern? (4) Gibt es in Bezug auf die Wirkfaktoren und die Verläufe Unterschiede zwischen Patienten, die antipsychotische Medikamente einnehmen, und solchen ohne Medikation? Methode: Es sollen N=75 Patienten in das Projekt aufgenommen werden. Die Stichprobe soll 50 Patienten mit Schizophrenie beinhalten, dabei auch unmedizierte Patienten. Als Vergleichsgruppe dienen 25 Patienten mit einem möglichst repräsentativen Diagnosespektrum für die ambulante psychotherapeutische Behandlung. Das therapeutische Vorgehen in der Schizophreniegruppe erfolgt nach dem Ansatz von Lincoln (2006). Bei der Vergleichsgruppe wird kognitive Verhaltenstherapie in der ambulanten Standardversorgung durchgeführt werden. Neben der Symptomerhebung am Anfang und am Ende der Therapie (u.a. PANSS, CAPE, CDSS) werden zu mehreren weiteren Zeitpunkten mögliche Wirkfaktoren erfasst (u.a. therapeutische Beziehung: HAQ; dysfunktionale Kognitionen: DAS; soziale Unterstützung: F-sozU; Kontrollerleben: IPQ-S). Zudem wird die Symptomatik über individuelle Stundenbögen nach jeder Therapiesitzung erhoben. Die Daten sollen u.a. mit hierarchisch-linearen Modellen ausgewertet werden. Ergebnisse: Nach dem positiven Ethikvotum hat die Datenerhebung bereits begonnen. Auch erste unmedizierte Patienten konnten in das Projekt aufgenommen werden. Diskussion: Insbesondere über die Verlaufsmessung der individuellen Symptomatik werden differenzierte Erkenntnisse über Therapieverläufe und Wirkzusammenhänge in der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schizophrenie erwartet. Der Abschluss des Projekts ist für Anfang 2013 geplant; erste Ergebnisse ab Ende 2011. C 50 „Mir geht’s zu gut.“ – Vermindert positive Emotionalität das Erleben von Empathie bei Schmerz? Judith Ruckmann (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Fachbereich Psychologie, Universität Marburg) Maren Bodden (Klinik für Neurologie, Fachbereich Medizin, Philipps-Universität Marburg) Richard Dodel (Klinik für Neurologie, Fachbereich Medizin, Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Fachbereich Psychologie, Universität Marburg) Abstract: Die vorliegende Studie untersucht den Einfluss von Gruppenzugehörigkeit und Affekt auf das Empathieerleben bei Schmerz. Die Fähigkeit, sich in mentale und emotionale Zustände anderer Personen hineinzuversetzen, wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Zum Einen Beobachtervariablen (Aufmerksamkeit, Empathie als Trait, Reduktion von Empathiefähigkeit bei verschiedenen psychischen Störungen), aber auch Merkmale des Beobachteten (Gruppenzugehörigkeit, gezeigte Emotion) sowie Situationsvariablen wirken sich auf das Ausmaß an empathischem Verhalten aus. In die Untersuchung wurden 45 gesunde Probanden eingeschlossen. Sie durchliefen eine Fragebogenbatterie (PANAS, BDI, SPF) sowie eine Gruppenmanipulation i.S. eines Minimal-GroupParadigmas. Anschließend wurde den Probanden ein Bilderparadigma dargeboten. Abgebildet waren entweder Hände oder Füße in neutralen und schmerzhaften Situationen. Es wurde angezeigt, ob es sich bei den Personen auf den Fotos um Mitglieder der Ingroup oder der Outgroup handelt. Die Teilnehmer waren instruiert, sich in die Personen auf dem Bild hineinzuversetzen, und die Schmerzstärke der Person auf dem Bild auf einer visuellen Analogskala zu raten. Bezogen auf den Affekt des Beobachters wurden die inversen Korrelationen zwischen der PositivSkala des PANAS mit den Ratings der Bedingung „Schmerz“ sowohl für die Ingroup als auch für die Outgroup signifikant. Trotz erfolgreicher Gruppenmanipulation zeigten sich im Vergleich zwischen In-und Outgroup keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Schmerzratings. Die Korrelationen zwischen den übrigen Fragebogenmaßen mit den Schmerzratings wurden nicht signifikant. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass das Empathieerleben durch die Stimmung der beobachtenden Person beeinflusst werden könnte. Ist der Affekt kongruent zu dem, was das Gegenüber erlebt, z.B. Schmerz – negativ, Freude –positiv, ist das Empathieerleben für den Betrachter einfacher, als wenn sich eine Inkongruenz zwischen Grundstimmung des Betrachters und betrachteter Emotion ergibt. Um diesen Zusammenhang näher zu beleuchten, sollte zukünftige Forschung eine differenziertere Herangehensweise wählen: Denkbar wäre ein Vergleich von Schmerzempathie und Empathie bei verschiedenen Grundemotionen oder eine Induktion von positiver bzw. negativer Stimmung und deren Effekt auf Empathie zu messen. C 51 Bewegungsangst – eine Phobie bei chronischen Rückenschmerzen? Jenny Riecke (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Sebastian Holzapfel (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Prof. Dr. Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Dr. Julia Glombiewski (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Abstract: Theorie: Das Fear Avoidance Modell von Vlaeyen et al. (1995) steht seit einem Jahrzehnt im Fokus der psychologischen Forschung zu chronischen Rückenschmerzen. In diesem Modell führt Bewegungsangst zu Vermeidungsverhalten und trägt so zur Aufrechterhaltung von chronischen Schmerzen bei. Somit eröffnet sich theoretisch die Möglichkeit, Schmerzpatienten mit Expositionstherapie zu behandeln. Wie von Norton & Asmundson (2003) kritisiert steht ein Nachweis phobiespezifischer physiologischer Korrelate dieser Bewegungsangst bislang jedoch aus. Fragestellung: Es sollten zentrale Annahmen des Modells überprüft werden, wobei der Fokus besonders auf physiologischen und subjektiven Angstaspekten während der Induktion von Bewegungsangst lag. Methode: Zur Prüfung des Modells wurden chronische Rückenschmerzpatienten mit hoher (n=47) und niedriger (n=45) Bewegungsangst sowie gesunde Probanden (n=35) untersucht. Zur Induktion von Bewegungsangst kündigten wir unseren Probanden an, dass drei individuell stark gefürchtete Bewegungen auszuführen seien. Affektive, behaviorale und kognitive Modellvariablen wurden über Fragebögen TSK, FABQ, PASS, HADS, PCS, PDI, ASI erfasst. Hautleitwert (EDA) und Muskelspannung (EMG) dienten als physiologische Angstindikatoren. State-Angst vor Bewegung wurde mit einer VAS erfasst. Ergebnisse: Es fanden sich signifikante Zusammenhänge zwischen Katastrophisierung, Bewegungsangst, Depression und Beeinträchtigung (r=.319 bis r=.676). Im Vergleich zur Baseline waren sowohl Muskelspannung (η2 = .194) als auch Hautleitwert (η2 = .802) bei allen Schmerzpatienten erhöht. Während der Angstinduktion zeigten sich hypothesenkonform signifikante Unterschiede zwischen hochängstlichen und weniger ängstlichen Schmerzpatienten in der State-Angst (t(92) = 2.77, p = .007). Es ergaben sich allerdings keine Zusammenhänge zwischen subjektiven Angstmaßen und den physiologischen Maßen EMG und EDA. Diskussion: Das Fear-Avoidance Modell konnte weitgehend bestätigt werden. Die Ergebnisse legen allerdings nahe, dass es sich bei der Bewegungsangst weniger um eine Phobie mit physiologischen Komponenten als vielmehr um eine Angst mit Schwerpunkt auf kognitiven (Katastrophisierung) und behavioralen (Vermeidung) Komponenten handelt. Der Fokus der Expositionsbehandlung sollte nicht auf Habituation ausgerichtet sein sondern darauf, Vermeidungsmuster zu durchbrechen und auf diesem Wege die kognitiven Annahmen bezüglich der Schädlichkeit von Bewegungen zu modifizieren. C 52 Die Suche nach der goldenen Strategie zur Schmerzbewältigung: experimentelle Befunde. Annika Kohl (Philipps-Universität Marburg) Anja Rabus (Philipps-Universität Marburg) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Julia Anna Glombiewski (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Akzeptanzbasierte Interventionen werden zunehmend in verhaltenstherapeutische Programme zur Behandlung chronischer Schmerzen integriert. In experimentellen Studien zeigte sich zum Teil eine Überlegenheit von akzeptanzbasierten Instruktionen gegenüber Instruktionen zur Ablenkung oder Unterdrückung in Bezug auf Schmerztoleranz. Hinsichtlich Schmerzintensität zeigte sich eher eine Überlegenheit von ablenkungsbasierten Instruktionen gegenüber akzeptanzbasierten. Es liegen keine Ergebnisse hinsichtlich eines Vergleichs zwischen akzeptanzbasierten Instruktionen und solchen zur kognitiven Umstrukturierung vor. Diese Arbeit soll differentielle Einflüsse dreier Strategien (Akzeptanz, Umstrukturierung, Ablenkung) auf Schmerztoleranz und -Intensität untersuchen. Bei 109 Studentinnen wurden innerhalb eines gemischten 3x2x2 Designs Schmerzen mithilfe einer Thermode induziert. Der Zwischensubjektfaktor umfasste die drei Strategien. Die Messwiederholungsfaktoren bezogen sich auf die Zeitpunkte vor und nach der Instruktionsdarbietung sowie auf die Reizart (Hitze vs. Kälte). Wir berechneten mithilfe von SPSS ANCOVAs mit den Kovariaten ‚Instruktionsanwendung‘ und ‚1.Messzeitpunkt‘ für normalverteilte Daten und den Kruskal-Wallis-Test für nicht normalverteilte Variablen. Die Schmerztoleranz wurde durch die Temperatur bei Abbruch des Reizes durch die Versuchsperson operationalisiert. Die Schmerzintensität wurde nach jedem Durchgang und nach jeder Reizart mit Hilfe der visuellen Analogskala ermittelt. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der einzelnen Instruktionen auf Schmerztoleranz. Für die Schmerzintensität zeigte sich, dass Studentinnen, die sich während der zweiten Hitzereizdarbietung ablenkten, über geringere Schmerzintensitäten berichteten als Versuchspersonen, die den Schmerz akzeptierten. Die Ergebnisse stehen in Einklang mit berichteten Befunden anderer Studien. Die Überlegenheit von akzeptanzbasierten Instruktionen bezüglich Schmerztoleranz wurde zwar in einzelnen Studien gefunden, konnte von uns meta-analytisch jedoch nicht belegt werden. Die Überlegenheit von Ablenkung hinsichtlich der Schmerzintensität steht in Einklang mit Aussagen der Akzeptanz-und Commitment Therapie. Die Instruktion zur kognitiven Umstrukturierung erwies sich als ebenso wirksam wie die anderen Strategien. Wichtiger als die Frage nach ‚einer goldenen Strategie‘ scheint die Suche nach möglichen Moderatoren. Die Validierung der Ergebnisse an einer klinischen Stichprobe steht noch C 53 Schmerzmodulation durch Bilder des Partners Katrin Damm (Justus-Liebig-Universität Gießen) Annina Klapper (Justus-Liebig-Universität Gießen) Christiane Hermann (Justus-Liebig-Universität Gießen) Abstract: Theoretischer Hintergrund und Fragestellung Studien belegen den Einfluss persönlich relevanter Personen auf die Schmerzwahrnehmung. Dabei ist die Richtung der schmerzmodulierenden Wirkung uneinheitlich und die zugrundeliegenden Wirkmechanismen ungeklärt. Die schmerzverstärkende Wirkung könnte auf operante Konditionierung zurückgeführt werden. Für die schmerzsenkende Wirkung wird, neben Ablenkung und sozialer Unterstützung, durch den Partner ausgelöster positiver Affekt diskutiert. Ziel dieser Studie ist es den Einfluss des Partners vor dem Hintergrund des Emotional Control of Nozizeption Paradigmas zu überprüfen, das eine schmerzmodulierende Wirkung durch affektive Bilder beschreibt (Rhudy, 2008). Es wird angenommen, dass das Bild des Partners die wahrgenommene Schmerzstärke im Vergleich zu neutralen fremden Personen reduziert. Methode 27 gesunde, weibliche Probanden bekamen Bilder von fröhlichen, neutralen und wütenden Gesichtern sowie von ihrem Partner (neutraler Gesichtsausdruck) gezeigt. Während dessen wurden tonische Hitzereize mittlerer Schmerzintensität über eine Thermode am Handballen appliziert. Die Probanden schätzten dreimal während der tonischen Reizung die Schmerzintensität und am Ende jedes Hitzereizes die Valenz und das Arousal der zuvor gesehenen Bilder ein. Ergebnisse Die Bilder des Partners werden als aufregender als alle anderen Bildkategorien beurteilt. Sie werden vergleichbar angenehm wie lächelnde Gesichter von fremden Personen und angenehmer als neutrale oder wütende Gesichter eingeschätzt. Die Schmerzintensität wird nach dem Betrachten des Partnerbildes signifikant niedriger im Vergleich zu allen anderen Bildkategorien beurteilt. In einer schrittweisen Regression erklärt das durch den Partner ausgelöste Arousal 30% der Varianz in der modulatorischen Wirkung. Die Valenz trägt darüber hinaus nicht signifikant zur Varianzaufklärung bei, genauso wenig wie Angaben zur sozialen Unterstützung oder zur Beziehungszufriedenheit. Diskussion Die schmerzsenkende Wirkung des Partners lässt sich durch eine unmittelbare Modulation des Affektes in der schmerzauslösenden Situation erklären. Die stärkere modulatorische Wirkung der Partnerbilder durch höheres Arousal ist konsistent mit der Vorhersage des ECON-Paradigmas. Schlussfolgerungen Die schmerzsenkende Wirkung wird besser durch den in der Situation ausgelösten Affekt als durch allgemeine Variablen der Beziehungsqualität erklärt. C 54 Die Messung von Kommunikationspräferenzen chronischer Schmerzpatienten im Klinikalltag Erika Schmidt (Uniklinikum Freiburg) Lukas Gramm (Uniklinikum Freiburg) Erik Farin (Uniklinikum Freiburg) Abstract: Theorie: Der Interventionserfolg bei chronischen Schmerzpatienten kann von einer gelungenen Patient-Behandler-Kommunikation abhängen, zu der gehört, dass der Behandler die kommunikationsbezogenen Präferenzen des Patienten, z.B. im Hinblick auf die Beteiligung an Entscheidungsprozessen oder die Thematisierung psychosozialer Probleme, berücksichtigt. Mit dem KOPRA-Fragebogen liegt ein patientenorientiertes und theoriebasiertes Instrument zur Erfassung patientenseitiger Kommunikationspräferenzen vor. In diesem Beitrag wird von der Retest-Reliabilität dieses Fragebogens berichtet und ein computerbasiertes Rückmeldeprogramm (KOPRA-Programm) vorgestellt, mit dem der Behandler eine automatisierte Auswertung zu den Patientenpräferenzen erhält. Die Entwicklung erfolgte im Rahmen eines vom BMBF geförderten Forschungsprojekts. Methodik: Der KOPRA-Bogen erfasst Präferenzen aus vier Bereichen: 1. Patientenpartizipation und Patientenorientierung, 2. Effektive und offene Kommunikation, 3. Emotional unterstützende Kommunikation und 4. Kommunikation über persönliche Verhältnisse. Bei den 76 teilnehmenden Patienten mit chronischen Rückenschmerzen ist der Altersmittelwert bei 52 Jahren (SD=7,3) und 66% sind weiblich. Die Stabilität der Kommunikationspräferenzen wurde mit dem Intra-KlassenKorrelationskoeffizienten (ICC) überprüft. Ergebnisse: In der Gesamtstichprobe liegen die ICC zwischen .61 und .76. Der höchste Wert wurde innerhalb der Skala „Kommunikation über persönliche Verhältnisse“ gemessen. Die ICC sind in der weiblichen, höher gebildeten oder älteren Teilstichprobe größer als in den jeweiligen Vergleichsgruppen. Alle Subgruppen zeigen in der „Kommunikation über persönliche Verhältnisse“ den geringsten ICC-Unterschied. Die Möglichkeiten des KOPRA-Programms werden anhand verschiedener Auswertungsoptionen verdeutlicht. Es lassen sich z.B. Patientenprioritäten abbilden und die individuellen Präferenzwerte mit Normwerten vergleichen. Diskussion: Alle Reliabilitäten der Gesamtstichprobe sind als substantiell (.61-.80) zu werten. Innerhalb der Subgruppenwerte sind über 60% der ICC im substantiellen Bereich und 25% werden als zufriedenstellend (.41-.60) eingestuft. Der KOPRA-Bogen ist in der Lage Kommunikationspräferenzen bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen reliabel zu erfassen. Zugleich steht mit der lokalen sowie online Version eine praktikable Anwendung für den Klinikalltag zur Verfügung. KOPRA-Fragebogen und –Programm sind kostenfrei verfügbar. C 55 Außertherapeutische Unterstützung als Prädiktor des Therapieerfolgs in der psychosomatischen Rehabilitation Holger Munz (Universität Trier) Detlef Dusi (Median Klinik Moselhöhe, Bernkastel-Kues) Josef Hecker (Median Klinik Moselhöhe, Bernkastel-Kues) Günter Krampen (Universität Trier) Abstract: Bei der Vorhersage des Therapieerfolgs spielen neben allgemeinen Wirkfaktoren, spezifischen psychotherapeutischen Techniken und Erwartungseffekten auch außertherapeutische Veränderungen eine Rolle (vgl. Lambert und Barley, 2002). Ziel der vorliegenden Studie ist, einige Faktoren, die diese außertherapeutische Veränderung bedingen, zu erfassen und deren Vorhersagewert auf den Therapieerfolg zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde in einer Stichprobe von 75 Patienten einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik zu Behandlungsbeginn auf einer aus 15 Items bestehenden, neu konstruierten Skala verschiedene Facetten der außertherapeutischen Unterstützung im Alltag (durch Partner, Freunde, Ratgeberliteratur, Selbsthilfegruppen, Sport etc.) erfasst. Zu Behandlungsabschluss wurden bei den Patienten zudem die von ihnen wahrgenommene Unterstützung durch Mitpatienten bei der Bewältigung ihrer Probleme während des Aufenthaltes über drei Items und verschiedene Therapieerfolgsmaße (Skalenwert des Veränderungsfragebogens zum Entspannungserleben und Befinden VFE-PT, Ausmaß der Therapiezielerreichung, Einschätzung der Symptomverbesserung durch den Therapeuten, Zufriedenheit mit der Behandlung) erhoben. Bei der Berechnung multipler Regressionen resultierten unter Verwendung der einzelnen Items der außertherapeutischen Unterstützung (einschließlich der Unterstützung durch Mitpatienten) als Prädiktoren und dem Ausmaß der Therapiezielerreichung sowie des VFE-PT-Skalenwerts als Kriterien signifikante Ergebnisse. Dabei konnten 26% bzw. 23% der Kriteriumsvarianz aufgeklärt werden. Unter Verwendung der aus den einzelnen Items aggregierten Skalen der außertherapeutischen Unterstützung im Alltag und der Unterstützung durch Mitpatienten als Prädiktoren und dem Ausmaß der Therapiezielerreichung sowie einem aus drei Items berechneten Index für den Therapieerfolg als Kriterien resultierten signifikante multiple Regressionen, in denen 22% bzw. 14% der Kriteriumsvarianz aufgeklärt werden. Die Ergebnisse veranschaulichen deutlich den Vorhersagewert der außertherapeutischen Unterstützung im Alltag und der Unterstützung durch Mitpatienten während des Klinikaufenthaltes auf den Therapieerfolg. C 56 Interozeptionsleistung bei somatoformen Störungen mittels Heartbeat-Detection-Paradigma Manuela Schaefer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Witthöft, Michael (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Hiller, Wolfgang (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie) Egloff, Boris (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Fragestellung: Kognitiv-behaviorale Störungsmodelle postulieren eine veränderte Wahrnehmung und eine Fehlinterpretation körpereigener Reize als wichtige Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung somatoformer Beschwerden. Bisher wurden jedoch nur unzureichend experimentelle Belege für diese veränderten Wahrnehmungsprozesse erbracht. Methode: Um die Interozeption bei Patienten mit somatoformen Störungen (SFS) messbar zu machen, wurde das „Schandry-Paradigma“ eingesetzt: In drei Zeitintervallen sollten die Probanden ihre Herzschläge zählen, ohne dabei den Puls zu erfassen. Die Abweichung von den mittels Elektrokardiogramm gemessenen Herzschlägen gilt dabei als Interozeptionsindex. Es wurden bisher 21 Patienten mit SFS (nach DSM-IV) sowie 19 in Alter und Geschlecht gematchte Kontrollpersonen (KG) untersucht. Ergebnisse: Patienten mit SFS zeigten im Vergleich zur KG keine veränderte Interozeptionsleistung (t(39)=.628; p=.534, d=.202). Innerhalb der Gruppe mit SFS zeigt sich jedoch ein negativer Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung des Herzschlages und dem Summenscore im Screening für Somatoforme Störungen (SOMS-2) (ρ=-.482, p=.023), welcher in der KG nicht zu finden ist (ρ=.039, p=.879). Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung des Herzschlages bei Patienten mit SFS im Vergleich zur KG nicht generell verändert ist. Je mehr Beschwerden Patienten jedoch erleben, desto schlechter können sie den eigenen Herzschlag wahrnehmen. Zu vermuten wäre, dass diese Patienten zwar eine ähnliche Sensitivität für Körperprozesse aufweisen wie die KG, dabei aber stärker auf andere Körperbereiche fokussieren, so dass sie sich nicht auf den Herzschlag konzentrieren können. Schlussfolgerungen: Für zukünftige Studien stellt sich die Frage, ob die Interozeptionsleistung bei SFS allgemein keine signifikante Rolle einnimmt, evtl. symptomspezifisch ist oder ob die Wahrnehmung anderer Modalitäten (bspw. Magen-Mobilität, Muskelspannung) im Vergleich zu einer KG verändert ist. C 57 Inverser Zusammenhang zwischen vagaler Funktion und Cortisol Aufwach-Reaktion bei gesunden Frauen, nicht aber bei Patientinnen mit einem Reizdarmsyndrom Roberto La Marca (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Ulrike Kübler (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Kerstin Suarez-Hitz (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Abstract: Cortisol steigt bekanntlich als Reaktion auf Stress und auf das Aufwachen (CAR) an. Wir konnten im Vorfeld zeigen, dass die Funktion des Nervus vagus invers mit der Stressreaktion von Cortisol assoziiert ist (La Marca et al., 2010). Das Ziel der vorliegenden Studie war es nun, den Zusammenhang zwischen der vagalen Funktion und der CAR zu untersuchen. Insgesamt 74 Frauen mit und ohne Diagnose eines Reizdarmsyndroms (IBS) (N(gesunde Kontrollen)=19; N(IBS-C, mit Verstopfung)=13; N(IBS-D, mit Durchfall)=22; N(IBS-M, Mischtyp)=20) wurden gebeten, in der ersten Stunde nach dem Aufwachen zuhause wiederholt Speichelproben zu sammeln, um später die Cortisol-Konzentration bestimmen zu lassen. Die vagale Funktion wurde hingegen im Labor durch die Applikation eines Kältereizes am Gesicht (Cold Face Test) untersucht, wobei die Latenz bis zur maximalen Bradykardie bestimmt wurde (CFTLatenz). Die Cortisol-Konzentration stieg nach dem Aufwachen signifikant an (p<.001), mit Ausnahme der IBS-C Gruppe. Der CFT hingegen resultierte in einer signifikanten Abnahme der Herzrate (p<.001), wobei die maximale Bradykardie im Mittel nach 35 Sekunden erreicht wurde. Lineare Regressionsmodelle ergaben, dass die CFTLatenz als unabhängige Variable signifikant die CAR vorhersagte (12.4% Varianzaufklärung; β=.307, p=.019). Dieser Zusammenhang war allerdings nur bei der gesunden Kontrollgruppe, nicht aber bei den IBS Gruppen zu beobachten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gute vagale Funktion mit einer reduzierten CAR einhergehen. Somit unterstützt dieser Befund die Annahme einer inversen Beziehung zwischen dem vagalen System und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse (HHNA). Diese Beziehung lag allerdings nur bei den gesunden Probandinnen vor, womit unsere Befunde auf eine Entkoppelung der beiden physiologischen Systeme bei IBS Patientinnen hindeuten. C 58 Ist Hyperakusis mit Angst und Vermeidung assoziiert? Lena Bläsing (Georg-August-Universität Göttingen) Birgit Kröner-Herwig (Georg-August-Universität Göttingen) Abstract: Theoretischer Hintergrund Menschen, die sich als geräuschüberempfindlich beschreiben (häufig Tinnitusbetroffene), tendieren zu Geräuschvermeidung. Dies könnte, insbesondere bei hochängstlichen Menschen, zu einem Teufelskreis aus Vermeidung und verstärkter Sensitivierung mit erheblicher Beeinträchtigung der Alltagsaktivitäten und Lebensqualität führen (Schaaf & Nelting, 2003). Ziel dieser Studie ist die Zusammenhangsanalyse von Hyperakusis, Geräuschvermeidung und Ängstlichkeit anhand von Selbstbeschreibungs- und Verhaltensdaten. Methode Es wurden je 30 Tinnituspatienten mit und ohne Hyperakusis sowie eine gesunde (gematchte) Kontrollgruppe untersucht. Ängstlichkeit, Tinnitus- und Hyperakusisbelastung wurden mittels psychometrisch evaluierter Fragebögen erfasst. Weiterhin wurde ein Vermeidungsfragebogen konstruiert und in einem Vortest evaluiert. In einem Laborexperiment wurden die Probanden einem Testton unterschiedlicher Lautstärke aber intersubjektiv konstanter Unbehaglichkeit ausgesetzt und die Zeit bis zum Abbruch der Beschallung durch die Testperson erfasst. Ergebnisse Tinnituspatienten mit Hyperakusis unterschieden sich signifikant von den anderen Gruppen in der geräuschbezogenen Vermeidung. Dies zeigte sich in höheren Werten im Vermeidungsfragebogen und behavioral in geringeren Zeiten bis zum Abbruch des Testtones. Tinnituspatienten mit Hyperakusis zeigten signifikant höhere Ängstlichkeit (Beck-Angst-Inventar) als Probanden ohne Hyperakusis. Insgesamt zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen Ängstlichkeit und den Vermeidungsfragebogenwerten (r = .57), allerdings nicht signifikant zwischen Ängstlichkeit und dem behavioralen Vermeidungsmaß (r = -.21). Es zeigte sich ein hoher Zusammenhang zwischen den Vermeidungsfragebogenwerten und dem Geräuschüberempfindlichkeitsfragebogen (r = .80). Diese Beziehung wurde moderiert durch Ängstlichkeit. Diskussion Die Studie zeigt, dass Vermeidung (Selbstbericht, behaviorale Erfassung) mit Hyperakusis assoziiert ist. Zudem zeigt sich ein Zusammenhang zwischen selbstberichteter Vermeidung und Hyperakusis, welcher von der Ängstlichkeit des Patienten beeinflusst wird. Schlussfolgerungen Unter der Annahme, dass Vermeidung eine Rolle bei der Belastung durch Hyperakusis spielt und Ängstlichkeit ein moderierender Faktor ist, könnte Konfrontation ein Erfolg versprechendes Therapiemodul bei der Behandlung der Hyperakusis sein. C 59 Messung affektmodulierter Aufmerksamkeitsprozesse bei somatoformen Störungen mittels Dot-Probe-Paradigma Kathrin Riebel (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Boris Egloff (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Michael Witthöft (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Fragestellung: Kognitiv-behaviorale Störungsmodelle postulieren eine erhöhte und selektive Aufmerksamkeit hinsichtlich störungsrelevanter Reize als wichtige Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung somatoformer Beschwerden. Bisher wurden jedoch nur unzureichend experimentelle Belege, meist an nichtklinischen Stichproben, für diese veränderten Informationsverarbeitungsprozesse erbracht. Methode: Um Aufmerksamkeitsprozesse bei Patienten mit somatoformen Störungen (SFD) messbar zu machen, wurde ein Dot-Probe-Paradigma eingesetzt. Als Stimuli dienten Bilder mit Krankheitsbezug und neutrale Bilder, die sowohl mit einer Präsentationszeit von 175 ms als auch 500 ms dargeboten wurden. Neben den 23 Patienten mit SFD (nach DSM-IV) wurden 18 in Alter und Geschlecht gematchte Kontrollpersonen (CG) untersucht. Ergebnisse: Patienten mit SFD zeigten im Gegensatz zur CG bei der frühen Verarbeitung der Stimuli (175ms) erhöhte Vigilanz gegenüber krankheitsbezogenen Bildern (t(39)=-1,97, p=.056, d=0.64). Bei den späten Aufmerksamkeitsprozessen (500ms) hingegen zeigte die Patientengruppe Schwierigkeiten, sich von krankheitsbezogenen Stimuli zu lösen (t(39)=-1,98, p=.055, d=0.65). Diskussion: Die Ergebnisse bestätigen das Vorliegen selektiver Informationsverarbeitungsprozesse bei Patienten mit somatoformen Störungen. Bei sehr kurzen Präsentationszeiten nahe der Wahrnehmungsschwelle, welche frühe Informationsverarbeitungsprozesse abbilden, zeigen die Patienten eine erhöhte Vigilanz für krankheitsrelevantes Bildmaterial, die im Sinne einer beschleunigten Orientierungsreaktion gedeutet werden könnte. Bei längeren Präsentationszeiten hingegen, sind die Patienten durch das krankheitsrelevante Bildmaterial in ihrer Reaktionszeit beeinträchtigt. Dies deutet darauf hin, dass Patienten mit somatoformen Störungen bei der Verarbeitung krankheitsrelevanten Bildmaterials ein Annäherungs-Vermeidungs-Muster zeigen, welches sich bei Personen ohne SFD nicht zeigt. Schlussfolgerungen: Nachdem mit dieser Studie erstmalig veränderte Aufmerksamkeitsallokationsprozesse bei Patienten mit SFD experimentell innerhalb des Dot-ProbeParadigmas aufgezeigt werden konnten, stellt sich für zukünftige Studien die Frage, ob eine experimentelle Modifikation dieses Aufmerksamkeitsbias ähnlich günstige therapeutische Effekte haben könnte, wie dies kürzlich für den Bereich der Angststörungen nachgewiesen wurde. Die Untersuchung von Effekten einer Bias-Modifikation ist daher in einer Folgestudie geplant. C 60 Somatoforme Störungen bei türkischstämmigen und deutschen Patienten: Unterscheiden sich die Patientengruppen hinsichtlich Symptomatik, subjektiver Krankheitstheorie und Bewältigungsstrategien? Mareike Bircheneder (Universität Koblenz-Landau) Prof. Dr. Jan Kizilhan (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Dr. Jens Heider (Psychotherapeutische Universitätsambulanz, Landau) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Somatoforme Störungen gehören in der Allgemeinbevölkerung zu den am weitesten verbreiteten psychischen Störungen; insbesondere bei türkischstämmigen Migranten zeigen sich hohe Prävalenzraten (z.B. Mösko et al., 2008). Aufgrund der zunehmenden Multikulturalität unserer Gesellschaft besteht ein großer Bedarf an Erkenntnissen darüber, ob sich die Krankheitskonzepte von Patienten verschiedener Kulturen unterscheiden. In der vorliegenden Studie wurden daher Unterschiede zwischen deutschen und türkischstämmigen Patienten mit einer somatoformen Störung in Bezug auf deren subjektive Krankheitstheorien, deren Bewältigungsstrategien sowie deren somatoforme Symptomatik untersucht. Der Einfluss konfundierender Drittvariablen wie Alter, Bildung oder Akkulturationsgrad wurde kontrolliert. Methode: 38 türkischstämmige und 32 deutsche Patienten einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik mit der Erst- oder Zweitdiagnose einer somatoformen Störung nach ICD-10 wurden in die Untersuchung aufgenommen und zu Beginn der Behandlung gebeten, eine Fragebogenbatterie auszufüllen. Zur Erfassung der somatoformen Symptomatik wurde das Screening für Somatoforme Störungen (SOMS-2) vorgelegt. Die subjektiven Krankheitstheorien wurden mit dem Illness Perception Questionnaire (IPQ-R), die Bewältigungsstrategien der Patienten mit dem COPE erhoben. Zudem wurde bei den türkischstämmigen Patienten die Frankfurter Akkulturationsskala (FRAKK-R) zur Bestimmung des Akkulturationsgrad eingesetzt. Die Instrumente wurden jeweils in einer deutschen oder türkischsprachigen Version vorgelegt. Ergebnisse: Multiple hierarchische Regressionsanalysen konnten unter Kontrolle von Bildung, Geschlecht und Akkulturation signifikante Unterschiede zwischen deutschen und türkischstämmigen Patienten in Anzahl und Art somatoformer Symptome, in der Tendenz zur externalen Ursachenzuschreibung, in der Ausprägung des Kontrollerleben und der emotionalen Repräsentation der Erkrankung zeigen. Außerdem wurden von türkischstämmigen Patienten emotionsbezogene Bewältigungsstrategien wie religiöses Coping, Verleugnen und Umdeuten häufiger eingesetzt. Diskussion: Es zeigten sich auch unter Kontrolle des Akkulturationsgrades bedeutsame kulturelle Unterschiede zwischen deutschen und türkischstämmigen somatoformen Patienten in den subjektiven Krankeitskonzepten. Deren Berücksichtigung kann einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung therapeutischer Angebote für türkischstämmige Migranten leisten. C 61 Wirksamkeit einer kognitiv-behavioralen Kurzzeittherapie bei multiplen somatoformen Körperbeschwerden Ann Christin Krämer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Maria Kleinstäuber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Wolfgang Hiller (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Medizinisch nicht erklärte Körperbeschwerden sind weit verbreitet und gehen bei den Betroffenen häufig mit ausgeprägten Einschränkungen im Funktionsniveau, sowie hohen Komorbiditätsraten einher. Obwohl psychotherapeutische Behandlungen als wirksam gelten, gibt es bisher kaum manualisierte, kognitivverhaltenstherapeutische Behandlungskonzepte. Ziel dieser Studie stellt daher die Evaluation einer kognitiv-behavioralen Kurzzeittherapie bei multiplen somatoformen Beschwerden (KVT) dar. Methode: Bisher wurden 76 Patienten in die Studie eingeschlossen. Die Patienten werden entweder einer 20-stündigen manualisierten KVT (n=37) oder einer Wartekontrollgruppe (WKG; n=39) zugeordnet. Die Studienbedingungen werden nach Alter, Geschlecht und Ausmaß der Beschwerden parallelisiert. Die Datenerhebung findet sowohl unmittelbar vor als auch nach der letzten Sitzung statt. Eine 1-Jahres Katamnese ist geplant. Als Outcome-Maße dienen das Ausmaß körperlicher Beschwerden, Krankheitssorgen und -verhaltensweisen, Depressivität, allgemeine Psychopathologie und die Lebensqualität. Ergebnisse: Die Vorauswertung der bisher verfügbaren vollständigen Datensätze (nWKG=17; nKVT=9) ergab moderate Zwischengruppen-Effekte hinsichtlich der Depressivität (d=0.66) sowie der Krankheitssorgen und –verhaltensweisen (d=0.61). Bezüglich verschiedener Dimensionen der Lebenszufriedenheit konnten kleine bis moderate Effektstärken (d=0.18 - d=0.73) nachgewiesen werden. Hinsichtlich des Ausmaßes körperlicher Beschwerden (d=0.33), sowie der allgemeinen Psychopathologie (d=0.38) konnten bisher nur kleine Zwischengruppen-Effekte identifiziert werden. Diskussion: Die kleinen Effektstärken dieser Voruntersuchung hinsichtlich der körperlichen Beschwerden stehen im Einklang mit Ergebnissen der bisherigen Forschung zur Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Interventionen bei somatoformen Beschwerden. Im Vergleich zu metaanalytischen Befunden fallen jedoch die Effektstärken zu Krankheitssorgen und Depressivität deutlich höher aus. Schlussfolgerungen: Aufgrund der noch kleinen Stichprobengröße können die Ergebnisse nur mit Vorsicht interpretiert werden. Sie ermöglichen allerdings erste Anhaltspunkte hinsichtlich der Wirksamkeit einer manualisierten kognitiv-behavioralen Kurzzeitherapie, die spezifisch für die Behandlung multipler somatoformer Beschwerden im ambulanten Setting entwickelt wurde. C 62 ZEIGT SICH DER EFFEKT VON STRESS AUCH BEI MAKROPHAGEN? Ulrike Kübler (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Miho Sakai (Nanotechnologie ETH ) Petra H. Wirtz (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Andreas Stemmer (Nanotechnologie EHT) Ulrike Ehlert (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Zürich) Abstract: Der Einfluss von akutem mentalem Stress auf zirkulierende Leukozyten wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen. Über stress-bedingte Veränderungen der in das perivaskuläre Gewebe transmigrierten Leukozyten ist hingegen wenig bekannt. Insbesondere die aus dem Blut rekrutierten und zu Makrophagen differenzierten Monozyten spielen bei Prozessen wie der Pathogenabwehr und Wundheilung eine zentrale Rolle. Jüngsten Studien zufolge geht eine verminderte Makrophagenaktivität mit einer verzögerten Wundheilung einher. In der vorliegenden Studie wurde erstmals der Effekt eines akuten mentalen Stressors auf die phagozytäre Aktivität humaner Makrophagen untersucht. Insgesamt wurden 40 gesunde männliche Probanden im Alter von 20 bis 50 Jahren randomisiert einer Experimental- (n=24) oder Wartekontrollgruppe (n=16) zugeteilt. Während die Probanden der Experimentalgruppe an einem 15-minütigen akuten mentalen Stresstest, bestehend aus öffentlicher Rede und Kopfrechnen teilnahmen, verblieben die Probanden der Wartekontrollgruppe in einer Ruhebedingung. Die Blutentnahme zur Gewinnung der Monozyten fand unmittelbar vor sowie 1 und 60 Minuten nach Stressinduktion statt. Die Bestimmung der phagozytären Aktivität erfolgte ex vivo durch eine kolorimetrische Methode. Die Stressreaktivität wurde über die Erhebung des Blutdrucks erfasst. Erwartungsgemäss stiegen die Blutdruckwerte bei der Experimentalgruppe während des Stresstests signifikant an (p<.001). Verglichen mit der Wartekontrollgruppe zeigte sich bei der Experimentalgruppe unmittelbar nach der Stressinduktion eine signifikant verringerte phagozytäre Markophagenaktivität (p<.01 ). Obgleich auch 60 Minuten nach Stressinduktion ein Trend einer stress-bedingten Verringerung der Markophagenaktivität zu erkennen war, erreichte dieser Gruppenunterschied keine statistische Signifikanz (p=.158). Diese Befunde deuten auf einen supprimierenden Effekt von akutem mentalem Stress auf die phagozytäre Aktivität humaner Makrophagen hin und lassen sich damit in eine Liste aktueller Untersuchungen reihen, die von einer verzögerten Wundheilung unter mentalem Stress berichten. Diskutiert werden die Ergebnisse vornehmlich vor dem Hintergrund von Wundheilungsprozessen. C 63 Abstinenz assoziierte Hirnveränderungen bei alkoholabhängigen Patienten Martina Kirsch (Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Anne Richter (Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Traute Demirakca (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Karl Mann (Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Falk Kiefer (Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim) Abstract: Hintergrund: Chronischer Alkoholkonsum führt häufig zu Volumenminderungen in der grauen (GM) und weißen Substanz (WM) des Gehirns. Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren konnten zeigen, dass diese Degenerationen teilweise reversibel sind. Nach acht monatiger Abstinenz sind signifikante Strukturzuwächse in Bereichen der Temporallappen, im Hirnstamm, im Thalamus, im anteriorem Cingulum, im Kleinhirn, in der Insula und in subcortikalen Strukturen der WM beschrieben. (Cardenas et al., 2007, NeuroImage). Agartz et al. (2003, NeuroImage) fand bereits nach 3 Wochen Abstinenz eine signifikante Erholung der WM. In der hier vorliegenden Untersuchung wurde versucht, diese Regeneration nach drei Wochen qualifizierter Entzugsbehandlung mit Hilfe der Voxel basierten Morphometrie (VBM) nachzuweisen. Desweiteren wurde untersucht, ob klinische Merkmale mit den abstinenzbedingten Hirnveränderungen assoziiert sind. Methode: 73 abstinente stationäre oder teilstationäre alkoholabhängige Patienten wurden in einem Abstand von 3 Wochen zweimal mittels strukturellem MRT (3 T Siemens Trio) untersucht. Die erste Messung erfolgte zwischen dem 5 bis 21 Tage nach dem letzten alkoholischen Getränk. Um Veränderungen über die Zeit zu finden, wurden die modulierten GM und WM Segmente von T1 und T2 mit paarweisen T-Tests verglichen. Um den Einfluss der klinischen Merkmale zu finden, wurden Differenzbilder (T1-T2) mit den entsprechenden Variablen korreliert. Die untersuchten klinischen Merkmale waren Abhängigkeitsdauer, kumulierte Trinkmenge der letzten 90 Tage vor dem Entzug, Gamma GT, Rauchstatus und verschiedene klinische Fragebögen. Ergebnisse: Mit paarweisen T-Tests konnten nach 3 Wochen Abstinenz sowohl für die WM (primär im corpus callosum) als auch die GM (primär temporal) signifikante Volumenzuwächse gefunden werden. Diese Veränderungen zeigten sich unabhängig von klinischen Merkmalen. Diskussion und Schlussfolgerungen: Mit der VBM Methode konnten frühere Ergebnisse repliziert werden, die eine schnelle Erholung der alkoholassoziierten Hirnveränderungen in der GM und WM während einer abstinenten Phase gefunden haben. Die Veränderungen scheinen in erster Linie durch die Abstinenz bedingt und werden nicht substantiell durch klinische Merkmale der Patienten beeinflusst. C 64 Internetsucht und ihre Behandlung: Eine erste Metaanalyse Alexander Winkler (Philipps-Universität Marburg) Beate Dörsing (Philipps-Universität Marburg) Yuhui Shen (Philipps-Universität Marburg) Prof. Dr. Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Dr. Julia Glombiewski (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Das Internet als Massenmedium ist ein relativ neues Phänomen. Umso erstaunlicher ist sein gigantischer Einfluss auf unser aller Leben. Mit der Implementierung des Internets hielt ein neues Störungsbild Einzug in die psychologische Forschung und Praxis: Die Internetsucht. Es gibt noch wenig hochwertige und etablierte diagnostische Instrumente und keine evidenzbasierte Empfehlung zur Behandlung dieser Störung. Bisher gibt es keine Veröffentlichung, die Forschungsergebnisse zu psychologischen und pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten mit meta-analytischen Methoden integriert. Methoden: Um diese Forschungslücke zu schließen und die Effektivität von Interventionen bei Onlinesucht zu bestimmen, miteinander zu vergleichen und Moderatoren zu identifizieren, wurden in einer umfangreichen Suche in PsycINFO, PSYNDEX, MEDLINE, anderen Datenbanken, sowie einer zusätzlichen manuelle Suche in relevanten Journals und Literaturlisten 716 Studien identifiziert. 16 Studien erfüllten alle Einschlusskriterien. Effektstärken (Hedge‘s g) wurden für pre-post Unterschiede sowie pre-follow-up Unterschiede kontrollierter sowie unkontrollierter Studien berechnet. Die Effektstärken zu den Konstrukten Onlinesucht-Status, mentaler Gesundheitszustand, im Internet verbrachte Zeit, Depression und Angst wurden jeweils mithilfe eines random effects Models integriert. Ergebnisse: Es zeigt sich, dass psychologische und pharmakologische Interventionen bei Internetsucht hoch effektiv sind (Onlinesucht-Status: g = 1.73 für psychologische Interventionen, g = 1.26 für pharmakologische Interventionen; mentaler Gesundheitszustand: g = 0.86 für psychologische Interventionen, g = 1.03 für pharmakologische Interventionen). Die Effekte werden unter anderem durch die Art der Behandlung, den Anteil der am Versuch teilnehmenden Frauen und den Kulturkreis moderiert. Diskussion: Die Aussagekraft der vorliegenden Metaanalyse ist durch einen Mangel an qualitativ hochwertigen Studien zum Thema eingeschränkt. Die Methoden zur Prüfung des Publikationsbias liefern inkonsistente Ergebnisse, die Stichproben sind in der Regel klein und Follow-up-Daten sowie kontrollierte Studien liegen nur in wenigen Fällen vor. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse repräsentieren aufgrund der sehr umfangreichen Literatursuche den aktuellen Forschungsstand, decken Forschungslücken auf und liefern erste Erkenntnisse für eine evidenzbasierte Behandlung von Internetsucht. C 65 Macht Alkohol es leichter? - Auswirkungen von Alkohol bei Patienten mit sozialer Phobie in einer Redesituation Trisha Bantin (Justus-Liebig-Universität Gießen) Alexander L. Gerlach (Universität zu Köln) Christiane Hermann (Justus-Liebig-Universität Gießen) Stephan Stevens (Justus-Liebig-Universität Gießen) Abstract: Theoretischer Hintergrund/Fragestellung: Das Risiko für Alkoholmissbrauch oder –abhängigkeit ist bei Personen mit sozialer Phobie (SP) im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung mehrfach erhöht. Betroffene geben oft an, Alkohol als Selbstmedikation einzusetzen. Nach Annahme der Selbstmedikationshypothese knüpfen die Patienten eine anxiolytische Wirkung an den Konsum von Alkohol. Ein wesentlicher Faktor, der zur Aufrechterhaltung der SP beiträgt, ist die erhöhte Selbstaufmerksamkeit der Patienten. Ziel der Studie war es zu überprüfen, ob Alkohol in einer Redesituation die Angst beeinflusst und möglicherweise die Aufmerksamkeitsverzerrung reduziert. Methode: An der Studie nahmen bislang 42 Patienten mit SP teil (Diagnostik mittels SKID-I und II). Die Probanden wurden in eine Alkohol-, Placebo- oder Orangensaftbedingung aufgeteilt. Innerhalb der Alkoholbedingung wurde ein Atemalkoholgehalt von 0,7 Promille angestrebt. In der Placebobedingung wurde den Probanden ein vermeintlicher Blutalkoholwert von 0,4-0,5 Promille rückgemeldet. Die Probanden schätzten zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Redesituation ihre Angst, Nervosität, Anspannung, Kognitionen und die subjektive Performanz sowie den Promillewert ein. Ergebnisse: Die Alkoholisierung (anflutende Werte über die Untersuchung hinweg) und die Manipulation der Placebogruppe waren erfolgreich. Die Ergebnisse bestätigten eine anxiolytische Wirkung von Alkohol. So waren die Patienten mit SP in der Alkoholbedingung speziell im Vergleich zur Kontrollbedingung signifikant weniger ängstlich, nervös und angespannt. Die Alkoholgruppe zeigte außerdem eine reduzierte Selbstaufmerksamkeit. Auf kognitiver Ebene zeigten die Patienten nach der Rede in der Placebo- und Kontrollbedingung eine Abnahme positiver Kognitionen, wohingegen die Alkoholgruppe keine Veränderung aufwies. Bezogen auf die soziale Performanz ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Bedingungen. Die Angstreaktion in der Placebo- und Kontrollbedingung war vergleichbar. Diskussion/Schlussfolgerung: Alkohol führt bei Personen mit SP zu einer deutlich verminderten Angstreaktion, dieser Effekt ist vermutlich primär pharmakologisch vermittelt. Die reine Wirkungserwartung (Placebobedingung) führte nicht zu einer vergleichbaren Angstreduktion. Die anxiolytische Wirkung von Alkohol und insbesondere die Verringerung der Selbstaufmerksamkeit in der sozialen Situation können negativ verstärkend wirken und so zur Entwicklung einer Alkoholproblematik beitragen. C 66 Reliabilität und Faktorenstruktur der deutschen Version des Internet Addiction Tests (IAT) Antonia Barke (Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, GEMI, Georg-AugustUniversität Göttingen) Nele Nyenhuis (Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, GEMI, Georg-AugustUniversität Göttingen) Birgit Kröner-Herwig (Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie, GEMI, GeorgAugust-Universität Göttingen) Abstract: Hintergrund: Bei der Internetsucht handelt es sich um ein junges Forschungsgebiet, in dem es standardisierter Instrumente zur Erfassung der Symptomatik bedarf. Ein im Englischen häufig gebrauchter Fragebogen ist der Internet Addiction Test (IAT). Der aus 20 Items bestehende Fragebogen erfasst angelehnt an die substanzbezogenen Süchte Aspekte wie Verlust der Kontrolle über die Nutzung, negative Folgen der Internetnutzung, Versuche, die Nutzung einzuschränken oder Verheimlichung der Nutzungsdauer. Eine deutsche Validierung fehlt bisher. Methode: Eine Online-Stichprobe (n = 925, Alter: 24.3 ± 7.9 Jahre, 51.1% Frauen) füllte eine Internetversion des IAT aus und eine auf dem Campus der Universität Göttingen rekrutierte Studierenden-Stichprobe (n = 909, Alter: 23.6 ± 3.0 Jahre, 53.9% Frauen) eine Paper-Pencil-Version. Beide Stichproben gaben außerdem an, wie lange sie in einer durchschnittlichen Woche privat das Internet nutzen. In getrennten Analysen wurden die Split-Half Reliabilität, interne Konsistenz (Cronbach’s α) sowie Item-Trennschärfen berechnet. Zur Bestimmung der Faktorenstruktur wurde eine Faktorenanalyse mit Hauptkomponentenanalyse und Varimax-Rotation eingesetzt. Ergebnisse: Für die Online-Stichprobe betrug die Split-Half-Reliabilität r = .93, die interne Konsistenz α = .92. Die Trennschärfen lagen zwischen .26 und .69 (mittlere Trennschärfe: .58). Die Faktorenanalyse ergab 2 Faktoren, die gemeinsam 49.6% der Varianz aufklärten. Für die Studierenden-Stichprobe betrug die Split-Half-Reliabilität r = .90, die interne Konsistenz α = .90 und die Trennschärfen bewegten sich zwischen .30 und .64 (mittlere Trennschärfe: .52). Die Faktorenanalyse ergab 2 Faktoren mit 43.5% Varianzaufklärung. Der IAT-Gesamtwert korrelierte mit der in einer durchschnittlichen Woche zu privaten Zwecken im Internet verbrachten Zeit zu r = .35 (Studierendenstichprobe), bzw. r = .39 (Online-Stichprobe). Diskussion: Die deutsche Version des IAT weist in verschiedenen Stichproben eine sehr gute interne Konsistenz und Split-Half Reliabilität sowie zufriedenstellende Item-Trennschärfen auf. Die Faktorenanalyse ergibt unabhängig von der Stichprobe eine stabile 2-Faktorenlösung. Schlussfolgerung: Die deutsche Version des IAT kann zur Erfassung der Internetsucht in Online- und Offlinestichproben eingesetzt werden. C 67 Substanzgebrauch und -missbrauch bei Patienten mit ClusterKopfschmerz Yvonne Paelecke-Habermann (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) Tim Jürgens (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Ralf Lürding (Universität Regensburg) Andrea Lindwurm (Universität Regensburg) Thomas Dresler (Universität Essen) Karsten Henkel (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) Elke Leinisch (Universität Regensburg) Charly Gaul (Universität Essen) Abstract: Hintergrund: Es wird vermutet, dass orexinerge Neuone im Hypothalamus (HOr) eine wichtige Rolle bei der Pathophysiologie des Cluster-Kopfschmerzes (CH) spielen (Holland & Goadsby, 2009). HOrProjektionen zum ventralen tegmentalen Areal und Nucleus accumbens sind zudem an der Verarbeitung von Belohnungsreizen, insbesondere Nahrung und Drogen, sowie bei drogenassoziierten Lern- und Gedächtnisprozessen beteiligt (Harris & Aston-Jones, 2006). Entsprechend konnten einige Studien bei CH-Pat. einen erhöhten Substanzgebrauch verschiedener Drogen zeigen (z.B. Kudrow, 1974; Manzoni, 1999). Die Ergebnisse dbzgl. sind jedoch uneinheitlich (z.B. Schürks et al., 2006). Darüberhinaus wird in der Studie der Einfluss von suchtassoziierten Persönlichkeitsmerkmalen (“reward dependence”, RD) und individuellen Einschränkungen durch den CH auf den erhöhten Substanzgebrauch dieser Pat. untersucht. Methode: Multizentrische Studie Probanden: Testung von Pat. mit chronischem CH (n=27), episodischem CH in der aktiven (n=26) und inaktiven Phase (n=22), Migräne-Pat. (n=24) und gesunden Probanden (n=31). Maße: Sozialdaten, Headache Disability Inventory (HDI), Fagerstroem Nicotine Dependence Test (FTND), Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Caffeine Questionnaire (CQ), Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ), Screening zum Gebrauch illegaler Drogen (SID). Statistische Analysen: Chi2-Test, ANOVA, multiple Regression. Ergebnisse: CH-Pat. konsumierten signifikant mehr Kaffee und Zigaretten als Migräne-Pat. und Kontrollprobanden. Unter den CH-Pat. fanden sich häufiger mittlere/schwere Nikotinabhängigkeit (FTND>5) und riskanter Alkoholkonsum (AUDIT>4). Die Häufigkeit des Konsums illegaler Drogen unterschied sich nicht. CH prädizierte das Ausmaß an Kaffee- und Nikotinkonsum, nicht jedoch an Alkoholkonsum. RD und Einschränkungen durch den Kopfschmerz lieferten keinen Erklärungsbeitrag. Diskussion und Schlussfolgerungen: Erhöhter Konsum von Kaffee und Zigaretten sowie schwere Tabakabhängigkeit scheinen spezifisch mit CH assoziiert. Alkohol und illegale Drogen, die CH-Attacken verursachen können, werden von CH-Pat. im Mittel nicht häufiger konsumiert. Innerhalb der alkoholkonsumierenden Pat. finden sich mehr Ch-Pat. mit riskantem Alkoholkonsum. Dies könnte bedeuten, dass CH-Pat. ein erhöhtes Risiko für substanzbezogene Störungen aufweisen, die attackeninduzierende Eigenschaft bestimmter Substanzen jedoch einen Teil der Pat. schützt. C 68 Prävalenz psychischer Störungen bei Nachwuchs-Leistungssportlern Jürgen Hoyer (TU Dresden) Stefan Schmalholz (Universität Bamberg) Wanja Wolff (Universität Konstanz) Ralf Brand (Universität Potsdam) Abstract: Leistungssport scheint mit einem geringen Risiko psychischer Störungen assoziiert zu sein: Junge Leistungssportler haben schon früh Erfolge erlebt und dürften über hohe Selbstwirksamkeitserwartung und Resilienz verfügen. Andererseits sind manche Sportarten mit spezifischen Risiken für psychische Störungen (z.B. Essstörungen) verbunden. Ferner könnten die mit dem Leistungssport verbundenen Belastungen oder der Erfolgsdruck als Risikofaktoren wirksam werden. Empirische Ergebnisse zur Frage, wie häufig psychische Störungen bei jungen Leistungssportlern tatsächlich sind, fehlen fast völlig. Im Rahmen einer repräsentativen Befragung von Nachwuchsleistungssportlerinnen und –sportlern, die an den Eliteschulen des Sports (EdS) im Land Brandenburg unterrichtet werden, haben wir deshalb die Häufigkeit von Symptomen psychischer Störungen mit Screeningverfahren analysiert. Unsere Ergebnisse bündeln die Daten von 84,1% aller in Brandenburg an EdS unterrichteten Nachwuchsleistungssportler (786 noch aktive und 80 aus Leistungsgründen gerade ausgeschiedene jugendliche Leistungssportler). Als Vergleichsgruppe wurden 432 Schüler von zwei Regelschulen akquiriert. Der Altersbereich aller Schüler lag bei 12 bis 15 Jahren. Es wurden ein 18-Item Screening Verfahren für psychische Störungen (Composite International Diagnostic-Screener, CID-S, Wittchen et al., 1998) und ein Maß für die habituelle Befindlichkeit (Mehrdimensionaler Befindlichkeitsfragebogen; Steyer, Schwenkmezger, Notz & Eid, 1997) eingesetzt. Bei weiblichen (nicht aber bei männlichen) jugendlichen Leistungssportlern waren Symptome psychischer Störungen am geringsten ausgeprägt. Demgegenüber fanden sich die meisten Symptome bei der Gruppe der ehemaligen Leistungssportler; dies galt bei männlichen Ex-Sportlern jedoch nur für den Bereich Substanzmissbrauch. Bei jungen Leistungssportlern zeigt sich außerdem eine insgesamt erhöhte Müdigkeit. Die Ergebnisse zeigen: Selbst wenn sie höheren Belastungen ausgesetzt sind (Müdigkeit), sind jugendliche Leistungssportler im Mittel psychisch gesünder als ihre sportlich weniger erfolgreichen Altersgenossen. Dieses Bild kehrt sich aber um, wenn es um ehemalige Leistungssportler geht, die realisieren müssen, dass es mit der erträumten Sportkarriere nichts wird. Bei dieser Subgruppe könnten Präventionsmaßnahmen sinnvoll sein. C 69 Screening von Persönlichkeitsstörungen: Untersuchung der Diagnostischen Effizienz der Standardized Assessment of Personality Abbreviated - Scale (SAPAS) Anja Söchtig (Technische Universität Braunschweig) Christoph Kröger (TU Braunschweig) Abstract: Theoretischer Hintergrund/ Fragestellung. Bei etwa 31% der ambulanten Patienten wird eine Persönlichkeitsstörung (PS) diagnostiziert. Bleiben die PS in der Behandlung unberücksichtigt, wurde wiederholt von einem geringeren Therapieerfolg berichtet. Außerdem sind PS mit hohen direkten und indirekten Kosten assoziiert. Diese Aspekte verdeutlichen den Bedarf an geeigneten Screeninginstrumenten zur Identifizierung von PS. Wichtige Kriterien für solche Instrumente sind eine geringe Itemanzahl sowie eine möglichst hohe Sensitivität bei zufriedenstellender Spezifität, um eine ökonomische Anwendbarkeit zu gewährleisten. Zudem sollte eine Stichprobe erhoben werden, in der die in der Literatur angegebene Basisrate von etwa 30% und die prozentualen Häufigkeiten der einzelnen PS realisiert werden. Ziel unserer Studie war es, die Anwendbarkeit der SAPAS in einer Stichprobe ambulanter Patienten zu überprüfen. Methode. Die diagnostische Effizienz der SAPAS wurde mit einer Receiver - Operating - Characteristic - Analyse an einer Stichprobe von N=230 ermittelt. Ergebnisse. 66 Patienten (29%) erfüllten die Kriterien irgendeiner PS. Die diskriminatorische Fähigkeit des Instrumentes ist als gering zu bewerten (AUC=.67). Der favorisierte Cut - Off - Wert von 3.5 bei einem Youden - Index von .26 lieferte eine Sensitivität von .80 und eine Spezifität von .46. Diskussion. Entgegen den vorhergehenden Studien mit Stichproben aus stationären und ambulanten Settings mit hohen Basisraten um 50% liegen die Kennwerte in dieser Stichprobe nicht im zufriedenstellenden Bereich. Deshalb ist von einer Anwendung des Instrumentes im ambulanten Setting abzuraten. Schlussfolgerungen. Die Untersuchung veranschaulicht, wie essentiell es ist, eine Stichprobe zu Grunde zu legen, die für das Anwendungsfeld repräsentativ ist. Möglicherweise erlaubt das heterogene Konstrukt der PS auch ein störungsübergreifendes Screening nicht, da einzelne PS besser identifiziert werden. C 71 Soziodemographische Charakteristika und Inanspruchnahmeverhalten bei türkischen Migranten Kirsten Baschin (Humboldt-Universität zu Berlin) Dominik Ülsmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Thomas Fydrich (Humboldt-Universität zu Berlin) Abstract: Hintergrund: Trotz bislang mangelnder Befundlage ist die Einschätzung weit verbreitet, dass das Inanspruchnahmeverhalten von psychotherapeutischen/psychiatrischen Versorgungsstrukturen durch Migranten oftmals unzureichend und inadäquat ist. Ziel der Studie war es das antizipierte Hilfesuchverhalten (Kirchenvertreter, Vertreter der Parapsychologie, Naturheiler, Psychiater/Psychotherapeut, Notfallstellen, Familie und Freunde) im Fall einer psychischen Erkrankung von türkischen Migranten in Berlin zu untersuchen. Darüber hinaus wurde der Fokus auf mögliche Zusammenhänge von verschiedenen soziodemographischen Charakteristika (Geschlecht, Migrationsstatus, Akkulturationsstatus, Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsstatus, sozioökonomischer Status, Land, in dem die Schule besucht wurde) der türkischen Migranten mit einer adäquaten antizipierten Inanspruchnahme professioneller Versorgungsstrukturen gelegt. Methode: Mittels eines Fragebogenverfahrens wurden in Wartezimmern verschiedener Berliner Allgemeinärzte Daten von insgesamt 339 Probanden ohne und mit türkischem Migrationshintergrund erhoben. Die Probanden sollten, nachdem Sie eine Fallvignette einer depressiven Patientin gelesen hatten, angeben mit welcher Wahrscheinlichkeit sie sich selbst bei ähnlichen Symptomen hilfesuchend an verschiedene Personen und Institutionen wenden würden. Ergebnisse: Die Ergebnisse bezüglich der Inanspruchnahmepräferenzen sowie möglichen soziodemographischen Faktoren, die mit dieser Wahl in Zusammenhang stehen, werden für die Stichprobe der Personen mit türkischem Migrationshintergrund auf dem Poster vorgestellt und diskutiert. Diskussion und Schlussfolgerung: Das Erlangen von Informationen über spezifische Inanspruchnahmepräferenzen von Personen mit Migrationshintergrund sind unabkömmlich um einen möglichen Verbesserungsbedarf des Hilfesuchverhaltens von Personen mit Migrationshintergrund zu identifizieren. Das Wissen darüber, welche soziodemographischen Charakteristika mit einer inadäquaten Inanspruchnahme professioneller Strukturen in Verbindung stehen, könnte dafür verwendet werden relevante Zielgruppen für zukünftige Interventionsmaßnahmen zur Verbesserung der Nutzung professioneller Versorgungsstrukturen zu bestimmen. C 72 Therapieprogramm für Anpassungsstörungen (TAPS): Theoretische und empirische Fundierungen eines Interventionsprogramms Anja Kusel (Universität Leipzig) Raik Hallensleben (Psychotherapie Praxis Weißenfels) Konrad Reschke (Universität Leipzig, Institut für Psychologie, Lehrstuhl für Klinische Psychologie ) Abstract: ABSTRACT Problemstellung Jeder Mensch verarbeitet kritische Lebensereignisse und Krisen unterschiedlich. Manche sehen darin eine Herausforderung. Andere bewerten sie als unüberwindbare Hindernisse und entwickeln verschiedene, den Alltag einschränkende Symptome. Diese Art der maladaptiven Belastungsverarbeitung kann in einer Anpassungsstörung resultieren. Eine theoretisch und empirisch fundierte Behandlungsmethode bietet das Therapieprogramm für Anpassungsstörungen (TAPS), das nach einer inhaltlichen und methodischen Überarbeitung neue Interventionen für die Bewältigung kritischer Lebensereignisse integriert (u.a. MBSR, Schematherapie, Positive Psychologie). Aufbau und Struktur Das kognitiv-behaviorale Therapieprogramm TAPS besteht aus 10 Sitzungen, mit einen strategischen Therapiekonzept mit den Therapiestufen "Verstehen", "Akzeptieren", "Planen" und "Realisieren". Das theoretische Rahmenkonzept und ein Überblick über die Übungen werden vorgestellt. Evaluation Das Programm in mehreren Studien evaluiert. Ausgewählte Ergebnisse werden im Poster vorgestellt. Das Therapieprogramm wird von Patienten hochgradig akzeptiert und ist positiv evaluiert und zeigt effektstarke Veränderungen in Erlebens- und Verhaltensparametern, die für konstruktive Neuanpassung relevant sind. Fazit Das TAPS kann als neue therapeutische Methode im Einzel- und Gruppensetting angewandt werden und existiert als Therapeutenhandbuch mit Begleitmaterial für Patienten. Literatur Reschke, K. & Teichmann, K. (2008). Entwicklung und Evaluation eines kognitiv-behavioralen Therapieprogramms für Patienten mit Anpassungsstörung. Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie, 2 (2), S. 97 – 102. C 73 Traumatische Lebensereignisse als Prädiktor für psychische Störungen – Untersuchung an einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe Nikola Stenzel (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Elmar Brähler (Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie) Heide Glaesmer (Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie) Alexandra Martin (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung: Psychotherapieforschung) Ricarda Mewes (Philipps-Universität Marburg, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie) Winfried Rief (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Hintergrund: Traumatische Lebensereignisse gelten als gesicherter Risikofaktor für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung (z.B. Maercker et al., 2008). Darüber hinaus zeigten Perkonigg et al. (2000), dass traumatische Lebensereignisse ein Risikofaktor für die Entwicklung verschiedener psychischer Störungen sind. In ihrer Studie erhöhte sich zudem das Risiko eine weitere Störung zu entwickeln, wenn die Personen eine PTSD-Diagnose bekommen hatten. Ziel der vorliegenden Studie war es, zu untersuchen, ob der Einfluss aktueller und länger zurückliegender traumatischer Lebensereignisse auf verschiedene Störungen durch die aktuelle Traumatisierungssymptomatik mediiert ist. Dies wurde an einer populationsbasierten Stichprobe untersucht. Methode: In einer repräsentativen Stichprobe (N = 2415; 54% w; MAlter = 48.0) wurden anhand des Münchner Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI, Perkonigg et al., 2000) traumatische Lebensereignisse erfasst. Zur Erfassung der Traumatisierungssymptomatik wurde die Posttraumatic Stress Diagnostic Scale vorgegeben (PDS, Ehlers et al., 1996). Zusätzlich wurden Teile des Patient Health Questionnaire (PHQ, Löwe et al., 2002) vorgegeben um depressive Symptomatik, Somatisierung und Ängstlichkeit zu erfassen. Anhand von Mediationsanalysen wurde der Einfluss traumatischer Lebensereignisse auf die depressive-, somatisierungs- und Angstsymptomatik untersucht. Das Ausmaß der aktuellen Traumatisierungssymptomatik wurde als Mediator verwendet. Ergebnisse: Das Vorliegen traumatischer Lebensereignisse sagte depressive-, somatisierungs- und Angstsymptomatik vorher (β = .28** - .34**). Dieser Effekt zeigt sich auch, wenn nur Lebensereignisse herangezogen wurden, die 10 Jahre oder länger zurücklagen (β = .24** - .31**). Des Weiteren ergab sich eine partielle Mediation durch die aktuelle Traumatisierungssymptomatik der Personen. Diskussion: Auch über 10 Jahre zurückliegende traumatische Lebensereignisse haben einen Einfluss auf das Vorliegen der aktuellen psychischen Symptomatik der Personen. Dieser ist zum Teil über die aktuelle Traumatisierungssymptomatik mediiert. Offen bleibt an dieser Stelle, welche Variablen die Vulnerabilität für andere Störungen vermitteln. Ein Aspekt könnten z.B. durch das Trauma entstandene dysfunktionale Überzeugungen sein (Steil & Ehlers, 2000). Schlussfolgerung: Die Erkenntnisse sollten in der Behandlung von Personen, die traumatischen Erlebnissen ausgesetzt waren berücksichtigt werden. C 74 Langzeiteffekte in der klinischen Behandlung beruflichen Belastungserlebens: Kontrollierte Evaluation eines berufsbezogenen Gruppentherapieprogramms (7-Jahres-Follow-up) Verena Schaaf (Schön Klinik Roseneck für Psyschosomatische Medizin) Stefan Koch (Schön Klinik Roseneck für Psychosomatische Medizin) Andreas Hillert (Schön Klinik Roseneck für Psychosomatische Medizin) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Bislang wurde beruflichem Stress für die Entwicklung psychischer Störungen kaum Bedeutung beigemessen. Über Langzeiteffekte berufsbezogener Interventionen ist wenig bekannt. Die vorliegende Erhebung ergänzt eine Längsschnittuntersuchung spezifischer Effekte eines berufsbezogenen Gruppentherapieprogramms (Stressbewältigung am Arbeitsplatz, Koch et al., 2007) um arbeits- und gesundheitsbezogene Effekte 7 Jahren nach stationärer Behandlung (n=340). Methode: Erhoben wurden die Erwerbssituation, subjektive Einschätzungen beruflicher Belastung und Bewältigungsressourcen sowie gesundheitsbezogene Merkmale, bei Aufnahme und Entlassung sowie Follow-up 3- bzw. 12 Monate und 7 Jahre nach Entlassung. Die Gruppenzuordnung erfolgte nach einem Zeitstichprobenplan (Kontrollgruppe, n=209; Interventionsgruppe, n=131). Ergebnisse: Im 7-Jahres Follow-up (Rücklauf: 61%) lag eine Zunahme von Frühberentungen (+20%) und eine signifikante Reduktion der Arbeitsunfähigkeit (-6 Tage pro Jahr) vor. Positive mittlere bis hohe Effektstärken belegen langfristige berufsbezogene Behandlungseffekte. AVEMGesundheitstypen (Typ G und Typ S) nahmen langfristig zu (+15%). Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe beschränkten sich auf einzelne Zufriedenheitsmaße. Multiple Regressionsanalysen zur Identifikation von Prädiktoren eines erfolgreichen beruflichen Wiederstiegs bzw. einer frühzeitigen Berentung ergaben einen geringen Vorhersagewert der erhobenen soziodemographischen, klinischen und beruflichen Maße. Diskussion: In der querschnittlichen Betrachtung fallen die Unterschiede zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe geringer aus. Da beide Gruppen ein ähnlich umfangreiches Therapieangebot erhielten, war zu vermuten, dass die Effektstärken des zusätzlichen berufsbezogenen Gruppentherapieprogramms (8 Stunden à 100 Minuten) im kleinen bis mittleren Bereich anzuordnen sind. 7 Jahre nach Entlassung bleibt eine signifikante Verbesserung in wesentlichen Zielkriterien festzustellen, welche in gesundheitsbezogenen Merkmalen höher ausfallen als in beruflichen Merkmalen. Schlussfolgerung: Arbeitnehmer mit psychischen Störungen haben ein anhaltend erhöhtes Risiko, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. In der Entwicklung valider klinischer Maße beruflichen Behandlungserfolgs zeichnet sich dringend Forschungsbedarf ab. Die vorliegende Studie dient als Wegweiser für die Weiterentwicklung berufsbezogener Interventionen. C 75 Differenzielle Effektivität psychologischer Interventionen bei sexuellen Funktionsstörungen: Eine Metaanalyse Sarah Frühauf (Institut für Sozial-und Präventivmedizin, Bern) Heike Gerger (Institut für Sozial-und Präventivmedizin, Bern) Thomas Munder (Institut für Sozial-und Präventivmedizin, Bern) Hannah Schmidt (Institut für Sozial-und Präventivmedizin, Bern) Jürgen Barth (Institut für Sozial-und Präventivmedizin, Bern) Abstract: Abstract Theoretischer Hintergrund: Sexuelle Funktionsstörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung und gehen meist mit starkem Leidensdruck sowie Partnerschaftsproblemen einher. Effektivitätsstudien zu psychologischen Interventionen existieren, unterscheiden sich jedoch stark im Hinblick auf die untersuchten Stichproben, Interventionsarten, Ergebnismaße sowie die methodische Qualität. Eine integrierende systematische Übersichtsarbeit dieser Studien fehlte bisher. Ziel dieser Arbeit ist deshalb, Forschern und Praktikern einen aktuellen Überblick zur Forschungslage der einzelnen Interventionen zu bieten. In einem zweiten Schritt wird mittels Metaanalyse untersucht, ob sich einzelne Interventionen in ihrer Effektivität unterscheiden. Methoden: Studien wurden in einer systematischen Suche in elektronischen Datenbanken identifiziert und nach Einschlusskriterien geprüft (randomisiertes Design, publiziert zwischen 1980 und 2009). Daten wurden von zwei unabhängigen Beurteilern extrahiert. Dabei wurden 10 Interventionen unterschieden (z.B. Sexualtherapie, Paartherapie). Als Ergebnissmaße wurden Symptomreduktion und Partnerschaftszufriedenheit untersucht. Die statistische Analyse erfolgte mittels Random-EffectsMetaanalysen in STATA. Ergebnisse: Es wurden k=38 Studien eingeschlossen. Folgende Interventionen wurden untersucht: Sexualtherapie (k=13), sexuelles Fertigkeitstraining (k=9), kognitive Verhaltenstherapie (k=5), Paartherapie (k=4), systematische Desensibilisierung (k=4), verschiedene Kombinationsbehandlungen (k=11), andere psychologische Interventionen (k=8). Vorläufige Ergebnisse belegen die generelle Wirksamkeit der psychologischen Interventionen auf beiden erhobenen Ergebnismassen. Ergebnisse zur differenziellen Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen werden bei der Konferenz präsentiert. Diskussion und Schlussfolgerungen: Psychologische Interventionen bei sexuellen Funktionsstörungen verbessern sowohl die Sympotomatik als auch mit ihr assoziierte Partnerschaftsprobleme. Die Ergebnisse zur differenziellen Effektivität der verschiedenen Interventionen werden hinsichtlich ihrer Implikationen für die weitere Forschung und die Behandlungspraxis diskutiert. C 76 Eine Metaanalyse über die vergleichende Effektivität von psychologischer Intervention und Sildenafil bei erektiler Dysfunktion Hannah Maren Schmidt (Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Thomas Munder (Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Heike Gerger (Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Sarah Frühauf (Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Jürgen Barth (Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern, Schweiz) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Die erektile Dysfunktion gehört zu den häufigsten sexuellen Funktionsstörungen bei Männern. Sie ist oft mit hohem Leidensdruck, schlechtem psychischen Befinden und geringer Partnerschaftsqualität verbunden. Als Behandlungsmöglichkeiten erster Wahl gelten Phosphodiesterase-5-Hemmer (PH). Aber auch verschiedene psychologische Interventionen (PI) haben sich als wirksam erwiesen. Ziel dieses systematischen Reviews mit Meta-Analyse ist eine Übersicht über die vergleichende Wirksamkeit von PH und PI hinsichtlich Symptomreduktion, sexueller Zufriedenheit und Zufriedenheit der Partnerin. Methode: Mittels systematischer Literatursuche wurden randomisierte Studien (RCTs) bis einschließlich 2009 identifiziert, welche PH, PI sowie deren Kombination direkt miteinander verglichen haben. Daten wurden von zwei unabhängigen Beurteilern extrahiert. Effektstärken wurden mittels STATA in einer Meta-Analyse mit Random Effects-Modell aggregiert. Des Weiteren wurden Patienten- und Studiencharakteristika sowie die Finanzierungsquelle erfasst. Ergebnisse: Es wurden fünf RCTs in die Analyse eingeschlossen. Vorläufige Ergebnisse belegen die generelle Wirksamkeit von PI und PH. Alle eingeschlossenen Studien weisen zudem auf eine Überlegenheit einer Kombinationsbehandlung gegenüber PH alleine hin. Resultate bezüglich des potenziellen Einflusses der Moderatoren werden bei der Konferenz berichtet. Diskussion und Schlussfolgerung: Die geringe Datenbasis zur vergleichenden Wirksamkeit von PI und PH bei erektiler Dysfunktion erschwert die eindeutige Interpretation. Vor allem die Kombination der zwei untersuchten Behandlungsansätze erscheint jedoch vielversprechend im Hinblick auf Symptomreduktion. Praktiker und Praktikerinnen sollten über die positiven Effekte von PI informiert sein und vermehrt eine Kombinationsbehandlung in Betracht ziehen. C 77 Persönliche Reifung und Lebensziele nach erworbenen Hirnschädigungen Anna Künemund (Philipps-Universität Marburg) Christina Rakel (Philipps-Universität Marburg) Nico Conrad (Philipps-Universität Marburg) Bettina Döring (Philipps-Universität Marburg) Cornelia Exner (Philipps-Universität Marburg) Abstract: Theoretischer Hintergrund: Erworbene Hirnschädigungen und nachfolgende Beeinträchtigungen können die Lebensplanung der Betroffenen massiv erschüttern und die Erreichbarkeit wichtiger Lebensziele behindern. Inwieweit Patienten trotz negativer Folgen auch über positive Veränderungen i.S. persönlicher Reifung (posttraumatic growth) aufgrund der Auseinandersetzung mit einer erworbenen Hirnschädigung berichten und welchen Einfluss die langfristige Anpassung an nicht realisierbare, wichtige Lebensziele bei der Entstehung persönlicher Reifung hat, ist bisher nicht untersucht. Methode: Bei 40 Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen wurden Lebensziele (GOALS), die Integration des Erkrankungsereignisses in die Identität (Zentralität) (CES), selbstwahrgenommene Bedrohung, Lebensqualität (WHOQOL-Bref) und persönliche Reifung (PPR) längsschnittlich erfasst. Die erste Datenerhebung (T1) fand während der Behandlung in einer neurologischen Rehabilitationsklinik statt. Die zweite Datenerhebung (T2) erfolge durchschnittlich 19 Monate nach der ersten Befragung. Ergebnisse: Patienten berichten zu T2 über persönliche Reifung aufgrund der Hirnschädigung (M=56,07; SD=21,36) und weisen vergleichbare Werte persönlicher Reifung wie andere Patientengruppen (Brustkrebs, Herzerkrankungen) auf. Zu beiden Messzeitpunkten ist Intimität das wichtigste Lebensziel für die Patienten. Wichtigkeitseinschätzungen der Lebensziele bleiben über die beiden Messzeitpunkte hinweg stabil. Die Einschätzung der Realisierbarkeit verschlechtert sich signifikant (p=.005). Die gemittelte Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Realisierbarkeit nimmt über die Zeit hinweg signifikant zu. Die Prädiktoren Alter (β=.250), Zentralität (β=.549) sowie die Veränderung der über alle Lebensziele gemittelten Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Erreichbarkeit (T2-T1) zwischen den Messzeitpunkten (β=-.275) klären 44,7% der Varianz persönlicher Reifung auf. Persönliche Reifung ist positiv korreliert mit der allgemeinen Lebensqualität (r=.360) sowie der Lebensqualität in sozialen Beziehungen (r=.377) zu T2. Diskussion: Die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Wichtigkeit und Realisierbarkeit von Lebenszielen nimmt bei Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen über die Zeit hinweg zu. Eine Reduktion dieser Diskrepanz geht mit erhöhter persönlicher Reifung einher. Schlussfolgerung: Die Therapie von Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen sollte auch auf eine Reduktion erlebter Diskrepanzen in Lebenszielen abzielen. C 78 Explizite Lebensziele bei Patientinnen mit Anorexia und Bulimia Nervosa Katrin Hötzel (Ruhr-Universität Bochum) Johannes Michalak (Ruhr-Universität Bochum) Katharina Striegler (Ruhr-Universität Bochum) Aileen Dörries (Ruhr-Universität Bochum) Karsten Braks (Klinik am Korso) Thomas Huber (Klinik am Korso) Silja Vocks (Ruhr-Universität Bochum) Abstract: Theoretischer Hintergrund / Fragestellung: Insbesondere Patientinnen mit Essstörungen sind zumeist bezüglich einer Psychotherapie ambivalent, da bei Anorexia und Bulimia Nervosa der Punkt „Gewichtszunahme“ häufig mit anderen Lebenszielen in Konflikt steht. Die Lebensziele von Patientinnen mit Essstörungen könnten aus diesem Grund von besonderer Relevanz für die psychotherapeutische Behandlung sein. Die aktuelle Forschungslage lässt allerdings bisher keine Rückschlüsse darüber zu, welche Ziele im Leben von Frauen mit Anorexia und Bulimia Nervosa von Bedeutung sind. Ziel dieser Studie war daher die Untersuchung von expliziten Zielen bei Patientinnen mit Essstörungen. Methode: Psychotherapiepatientinnen mit Anorexia (n = 27) und Bulimia Nervosa (n = 20) im stationären Setting sowie n = 56 gesunde Frauen gleichen Alters bearbeiteten eine idiographischorientierte Frage zu Lebenszielen, die sie im hohen Alter gern erreicht haben würden, eine Zielliste zur Wichtigkeit vorgegebener Zielbereiche, die Striving Instrumentality Matrix zur Erfassung von Zielkonflikten sowie die Kurzversion des Inkongruenzfragebogens. Ergebnisse: Patientinnen mit Anorexia und Bulimia Nervosa verfolgten im Wesentlichen die gleichen Ziele im Leben wie gesunde Personen und bewerteten die Zielbereiche als ebenso wichtig. Obwohl die Patientinnen mit Essstörungen ihren Zielen eine höhere Instrumentalität zuschrieben als die Kontrollprobandinnen (p<.001), wiesen sie deutliche Defizite in der Umsetzung motivationaler Ziele auf (p<.001). Schlussfolgerungen / Diskussion: Basierend auf den Ergebnissen erscheint es sinnvoll, die Realisierung von Zielen stärker in der Behandlung von Essstörungen zu fördern. C 79 Integrative psychodynamisch-verhaltenstherapeutische stationäre Psychotherapie bei Patientinnen mit Essstörungen Silke Snelinski (HELIOS Klinik Bad Grönenbach) Dr. Jochen von Wahlert (HELIOS Klinik Bad Grönenbach) Dr. Robert Mestel (HELIOS Klinik Bad Grönenbach) Abstract: Konzept: Behandelt werden an der HELIOS Klinik Bad Grönenbach in der Station 2C Patientinnen mit Bulimia Nervosa (27,8%; Prävalenzen für Haupt- oder Kodiagnosen 2008), Binge Eating Störung (10,7%), Anorexia Nervosa (12,1%) ab BMI 15 und nicht näher bezeichneter Esstörung (30%). Zudem wiesen 37,1% eine Adipositas (E66.x) auf. Als Kodiagnosen liegen v. a. Depressionen vor. Der erste Schritt in der Therapie ist die Symptomaufgabe. Mit verhaltenstherapeutischen Elementen (Protokollierung, Ess-Struktur, Genesungsvertrag etc.) wird das Essverhalten beobachtet, verändert und kontrolliert. Unterstützt wird die Symptomaufgabe durch festgelegte Essensregeln am sogenannten „Genießertisch“ Ziele am Genießertisch sind Gewöhnung an drei geregelte Mahlzeiten und normale Essensmengen Bewusstes und langsames Essen, um das Essen wieder zu genießen Zusätzlich zum Genießertisch wird im therapeutischen Vertrag die Arbeitsbasis definiert. Auf welches Verhalten wird verzichtet, in welchen Situationen ist es bisher aufgetreten und welche Strategien lassen sich ableiten, um Rückfälle zu vermeiden. In der psychotherapeutischen Arbeit (Gruppen und Einzel) wird das Augenmerk auf Hintergründe der Erkrankung, welche Lebenssituationen haben die Essstörung begünstigt, was trägt zur Aufrechterhaltung der Problematik bei, gelegt. Unterstützend wirken die ernährungstherapeutischen Angebote. Dazu gehört die Ernährungsgruppe, das Esstraining (gemeinsames Kochen) und die Essnachsorge (Planen, Einkaufen, Zubereiten von Mahlzeiten). In der Woche treffen sich die Patienten zur Stationsgruppe (3x), Vertragsgruppe, Ernährungsgruppe, Esstraining, Essnachsorge (nach Bedarf), sowie einem Einzelgespräch. Zusätzlich sind Körpertherapie, Ergotherapie, Sporttherapie, kognitive Depressionsgruppe, Achtsamkeitstraining, Genussgruppe nach Verordnung möglich. Therapieergebnisse: Es ergeben sich überdurchschnittlich gute Therapieergebnisse im Verhältnis zu anderen Patientengruppen der Klinik. 81,4% erreichten im VEV-K (Veränderungsfragebogen) signifikant verbesserte Werte über 115 (M= 135,2, SD: 25,4), die Effektstärken (prä-post) lagen bei d=.81 (SCL-90-R GSI), d= .95 (EDI-2 Schlankheitsstreben) und d= 1,08 (EDI-2 Bulimie). C 80 Kognitive, affektive und psychophysiologische Veränderungen während der Figurexposition bei Frauen mit Bulimia Nervosa Monika Trentowska (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Jennifer Svaldi (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Jens Blechert (Stanford University) Brunna Tuschen-Caffier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Abstract: Hintergrund: Der Fokus moderner kognitiv-behavioraler Essstörungstherapien liegt nicht nur auf der Behandlung von Essproblemen sondern auch auf der Behandlung der Körperbildstörung. In diesem Kontext gehört die Figurexposition zu einer wirkungsvollen Intervention. Das zugrundeliegende Therapierational postuliert Habituationsprozesse negativer Emotionen und Veränderungen der körperbezogenen Kognitionen während der Expositionsbehandlung. Bisherige Befunde beruhen auf Daten aus 1-2 Expositionssitzungen und weisen kognitiv-affektive Veränderungen bei Personen mit Essstörungen nach. Jedoch wurden im Vergleich zu gesunden Personen kaum Veränderungen auf psychophysiologischer Ebene gefunden. Unklar bleibt, welche Veränderungsprozesse in einem Körperbildtraining mit mehreren Expositionssitzungen stattfinden. Ziel dieser Untersuchung war es, die kognitiven, affektiven und psychophysiologischen Veränderungen in einem Körperbildtraining mit wiederholter Figurkonfrontation in den einzelnen Sitzungen und im Verlauf bei Frauen mit Bulimia Nervosa (BN) zu untersuchen. Methode: 13 Frauen mit BN und 13 gesunde Frauen (HC) nahmen an einem Körperbildtraining mit 6 Spiegelexpositionssitzungen teil. Zu Trainingsbeginn, nach 3 Sitzungen und zum Trainingsende wurden die Teilnehmerinnen in standardisierten Sitzungen wiederholt mit einem Film ihres eigenen Körpers konfrontiert. Während der standardisierten Sitzungen wurden kognitive, affektive und psychophysiologische Daten erhoben. Begleitend wurden den Teilnehmerinnen wiederholt Fragebögen zur Psychopathologie vorgelegt. Ergebnisse: In beiden Gruppen nehmen negative Emotionen und Kognitionen von standardisierter Sitzung zur standardisierten Sitzung ab. Veränderungen innerhalb der Sitzung treten vor allem in der ersten standardisierten Sitzung auf. Die BN-Gruppe unterscheidet sich durchgängig in dem Ausmaß der Emotionen und Kognitionen von der HC-Gruppe. Zusätzlich nimmt in der BN-Gruppe die körperbezogene Psychopathologie signifikant ab. Erste Analysen psychophysiologischer Daten werden berichtet und in Beziehung zu den subjektiven, kognitiv-affektiven Daten gestellt. Diskussion: Die Befunde weisen vor allem auf Veränderungen von Expositionssitzung zu Expositionssitzung hin und somit auf die Wichtigkeit von mehrfachen Wiederholungen der Konfrontationsübungen. Innerhalb der Konfrontationsbehandlung kommt es zusätzlich zu einer Verbesserung der körperbezogenen Psychopathologie.