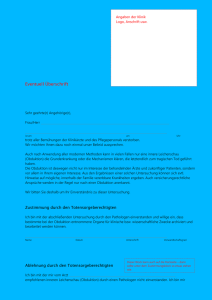Vortrag Sperhake: Helfen oder ermitteln - ein
Werbung

Helfen und Ermitteln beim Plötzlichen Säuglingstod – ein Widerspruch? Jan Sperhake Wenn ein Baby plötzlich und unerwartet verstirbt, ist dies für die Eltern und andere Familienangehörige ein schwerer Schicksalsschlag. Das Ausmaß der mittel- und langfristigen psychischen Traumatisierung der Hinterbliebenen hängt von vielen, individuell ganz unterschiedlichen Faktoren ab, nicht zuletzt aber auch von den Vorgängen, die sich unmittelbar um den Zeitpunkt des Todes des geliebten Kindes abspielen. Keine Mutter und kein Vater sind vorbereitet auf das, was ihnen im Zusammenhang mit dem Plötzlichen Säuglingstod (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) widerfährt. Ganz unterschiedliche Berufsgruppen kommen bei einem SIDS-Fall bereits in den ersten Stunden nach dem Tod zum Einsatz. Je nach Funktion und persönlichem Engagement können diese Personen dazu beitragen, dass den Eltern ein würdevoller Abschied und der Einstieg in die Trauerarbeit erleichtert werden. Es kann aber auch dazu kommen, dass bei wenig einfühlsamer Handlungsweise von professionellen Helfern oder Ermittlern unnötig Schmerz verstärkt und psychische Wunden vertieft werden. Zu berücksichtigen ist, dass sich auch Menschen, die beim SIDS von Berufs wegen akut zum Einsatz kommen, häufig in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, auf die sie nur unzureichend vorbereitet sind. Hilflosigkeit, inadäquates Verhalten und Kälte den Eltern gegenüber können Folgen dieser besonderen psychischen Belastung sein. Welche Personen kommen normalerweise zum Einsatz? In den meisten Fällen betätigen Eltern, die ihr Kind leblos auffinden, den Notruf 112. Rettungsteam und Notarzt erscheinen gemeinsam vor Ort und haben, solange der Tod des Kindes nicht feststeht, einen kinderärztlichen Notfall zu versorgen. Es ist verständlich, dass in einer Wiederbelebungssituation nur unzureichend auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen werden kann. Daher ist es begrüßenswert, wenn schon sehr frühzeitig Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams (z.B. vom DRK) oder die Notfallseelsorge vor Ort erscheinen, was immer häufiger von den Rettungsleitstellen veranlasst wird (zu einem späteren Zeitpunkt kann auch die betreuende Hebamme eine wichtige Funktion im Rahmen der Krisenintervention spielen). Nun ist es beim SIDS nicht die Regel, dass das Baby in einem Zustand vorgefunden wird, in dem es potenziell wiederbelebungsfähig ist. Viel häufiger bestehen schon bei Auffinden des Kindes durch die Eltern sichere Todeszeichen (Leichenflecke, Leichenstarre), bei deren Vorliegen Reanimationsversuche ausnahmslos erfolglos verlaufen. Hier sollten die Notärzte die Sinnlosigkeit einer Reanimation erkennen und den Eltern die Todesnachricht überbringen. Dass nicht selten auch bei Vorliegen von sicheren Todeszeichen reanimiert wird, wird manchmal mit einer „sozialen Indikation“ zur Reanimation begründet. Vielleicht spiegelt sich hier das Gefühl der Hilflosigkeit bei dem Notarzt in dem Bedürfnis wider, nicht „mit leeren Händen“ dastehen zu müssen, weil die Eltern Rettungsmaßnahmen erwarten. Ob dieses Vorgehen hilfreich ist, muss in Zweifel gezogen werden. Durch das Einleiten/Fortsetzen der Reanimation bei einem toten Kind werden bei den Eltern falsche Hoffnungen geweckt. In Einzelfällen könnten Schuldgefühle verstärkt werden, die sich nach SIDS-Fällen gerade bei Müttern oft einstellen („da der Notarzt noch alles versucht, hätte ich das Kind vielleicht retten können, wenn ich in der Wartezeit besser reanimiert hätte“). Auch der überstürzte Abtransport des toten Kindes mit dem Rettungswagen in eine Klinik kann in Einzelfällen als Versuch der Retter interpretiert werden, sich einer belastenden Situation zu entziehen. Hierdurch wird den Eltern die Möglichkeit eines würdevollen Abschiedes in der eigenen Wohnung genommen. Wenn medizinisch noch Hoffnung besteht, muss selbstverständlich alles getan werden was erforderlich ist. SIDS-Fälle müssen von den Ärzten, die den Tod feststellen, wie ungeklärte Todesfälle behandelt werden, woraus sich eine Meldepflicht an die Polizei ergibt. Diese Maßnahme ruft bei den Hinterbliebenen, die sich nichts vorzuwerfen haben, verständlicherweise Irritationen hervor. Es ist Aufgabe des Arztes, den Eltern die Notwendigkeit einer polizeilichen Ermittlung als Standardprozedur verständlich zu machen. Ganz deutlich muss den Eltern vermittelt werden, dass kein spezieller Argwohn gegen sie besteht (es sei denn, dass es sich ganz offensichtlich um ein Tötungsdelikt handelt), sondern dass es sich bei der Einleitung von Ermittlungen um eine von der Gesellschaft gewünschte Maßnahme im Sinne der Rechtssicherheit handelt. Die Polizei muss schon von Amts wegen die potenzielle Möglichkeit eines nichtnatürlichen Todes in Erwägung ziehen. Dennoch wird sie es meist mit natürlichen Todesfällen zu tun haben, so dass ein „Generalverdacht“ völlig unberechtigt ist. Ob der scheinbare Widerspruch zwischen berufsbedingtem Misstrauen und menschlicher Anteilnahme zur weiteren Eskalation der Krisensituation führt oder ob es gelingt, den Eltern das Aufklärungsbedürfnis des Staates transparent und begreiflich zu machen, hängt davon ab, über wie viel soziale Kompetenz, Erfahrung und Vorkenntnisse die ermittelnden Beamten verfügen. Bemerkungen wie „Die Leiche ist beschlagnahmt!“ mögen zwar inhaltlich korrekt sein, tragen jedoch kaum dazu bei, die Eltern mitfühlend in den notwendigen Prozess der Todesermittlung einzubeziehen. Schulungsmaßnahmen für die Polizei führen nachhaltig zu einer Verbesserung der Situation. Wir erleben im Raum Hamburg, dass die Polizeibeamten durchaus rücksichtsvoll auf diese Grenzsituation eingehen und den Eltern einfühlsam begegnen. Gelegentlich wird ein Rechtsmediziner von der Polizei zum Ort des Geschehens gerufen. Eine sorgfältige Untersuchung der Schlafumgebung trägt in Einzelfällen ganz entscheidend zum Verständnis des Todesfalles bei. Die Eltern fühlen sich ernst genommen, wenn nach der gesundheitlichen Entwicklung des Kindes, den Schlaf- und den Pflegegewohnheiten gefragt wird. Auch über die Möglichkeit und den Sinn einer postmortalen Untersuchung des Babys sollte möglichst schon frühzeitig gesprochen werden, was sowohl durch den Notarzt als auch durch die Polizei erfolgen kann. Obgleich die Klärung der Todesart (natürlich vs. nicht-natürlich) aus ermittlungstechnischer Sicht das vordringlichste Ziel einer rechtsmedizinischen Obduktion ist, bleibt die Aufklärung der medizinischen Todesursache und der zum Zeitpunkt des Todes bestehenden Krankheiten eine Hauptaufgabe jeder Obduktion. Die Kenntnis der Todesursache, die bei plötzlichen Todesfällen im Säuglingsalter nicht immer SIDS sein muss, ist für die Eltern in der Regel von großer Bedeutung. Studien zeigen, dass die Trauerbewältigung langfristig besser gelingt, wenn eine Obduktion durchgeführt wurde. Eine Obduktion muss nicht angeordnet werden, so dass die Untersuchungsraten von Region zu Region ganz unterschiedlich sind und etwa zwischen 20% und 100% schwanken. (die äußere Leichenschau reicht aber keinesfalls aus, um Fragen nach der Todesursache zu beantworten!). Auf der anderen Seite quälen sich Eltern, deren verstorbenes Baby nicht untersucht wurde, häufig jahre- wenn nicht jahrzehntelang mit offenen Fragen und Schuldgefühlen. Durch die Polizei wird ein Bestatter beauftragt, den kindlichen Leichnam aus der Wohnung abzuholen (für alle weiteren Dienstleistungen, die im Rahmen der Bestattung notwendig werden, können die Eltern selbstverständlich einen Bestatter ihrer Wahl beauftragen). Dies sollte nicht überstürzt geschehen. Aus rechtsmedizinischer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, dass den Eltern ausreichend Raum für ein Abschiednehmen im eigenen häuslichen Umfeld geboten wird. Dazu gehört auch, dass die Eltern und Verwandten das Kind auf den Arm nehmen dürfen, wozu man sie durchaus ermutigen sollte. Ob dies eine halbe Stunde oder drei Stunden dauert, hängt in erster Linie von den weiteren polizeilichen Maßnahmen ab. Eine Hausaufbahrung über mehrere Tage ist im Rahmen einer Todesermittlung aber nicht möglich. Auf die wichtige Rolle der Krisenintervention bzw. der Notfallseelsorge wurde bereits eingegangen. Es sollte sichergestellt sein, dass es wenigstens eine Person gibt, die eine Stütze für die Eltern sein kann und mit ihnen zusammen die akute Trauer aushält. Dies können auch Angehörige oder die Hebamme sein. Auch für den Zeitraum nach Abholung des Kindes durch den Bestatter sollten die Eltern nicht allein gelassen werden, es sei denn, sie wünschen dies ausdrücklich und scheinen psychisch ausreichend stabil zu sein. Die Untersuchung des Kindes mit Obduktion sollte möglichst rasch erfolgen, um eine optimale Befunderhebung zu gewährleisten. Es gibt in Bezug auf Art und Umfang einer Obduktion (Synonyma: Sektion, Autopsie, Leichenöffnung, innere Leichenschau) viele falsche Vorstellungen und Ängste. Im Wesentlichen handelt es sich bei einer Obduktion um eine relativ große Operation nach dem Tode. Eröffnet werden Kopf-, Brust- und Bauchhöhle, um die wichtigen Organe untersuchen zu können. Nach der Untersuchung werden die Organe bis auf kleine Proben für die Mikroskopie wieder in den Leichnam zurückgelegt. In der Regel werden Körperflüssigkeiten und Abstriche für Laboruntersuchungen zurückbehalten. In Ausnahmefällen müssen ganze Organe (z.B. Gehirn oder Herz) für weitergehende Untersuchungen aufbewahrt werden. Pathologen und Rechtsmediziner mussten erst lernen, dass es für die Eltern sehr wichtig sein kann, über das Ausmaß dieser Untersuchungen genau im Bilde zu sein. Nachbestattungen von Organen und Organteilen nach Abschluss der Zusatzuntersuchungen werden mitunter gewünscht und sind prinzipiell möglich. Wie nach einer Operation am Lebenden wird der Leichnam nach der Obduktion mit Hautnähten verschlossen. Eine Aufbahrung ist in aller Regel auch nach Obduktion möglich, jedoch sollten die Eltern darauf vorbereitet sein, dass das Einsetzen von natürlichen Leichenveränderungen – ob mit oder ohne Obduktion - nur bedingt aufzuhalten ist. In aller Regel wird der Leichnam unmittelbar nach der Obduktion zur Bestattung freigegeben und kann vom Bestatter abgeholt werden. Grundsätzlich sind Todesermittlungsverfahren geheim. Je nach Sektionsergebnis kann es die Staatsanwaltschaft dennoch zulassen, dass die Eltern über Ergebnisse und Zwischenergebnisse der Untersuchungen informiert werden. Hierbei muss unterstrichen werden, dass das Informationsbedürfnis der Eltern absolut legitim ist und nicht aus rein formalen Gründen missachtet werden sollte. Es ist durchaus umstritten und von Fall zu Fall abzuwägen, wie weitgehend man Eltern über Sektionsergebnisse informieren kann. Das unkommentierte Zusenden des Sektionsprotokolles dürfte in der Regel eher zu Verstörung und Verunsicherung als zur Beruhigung beitragen. Sektionsprotokolle gerichtlicher Obduktionen beschreiben sehr detailliert und anschaulich den Ablauf der Obduktion, so dass die Lektüre für die Eltern eine große Belastung wäre. Vorzuziehen ist das persönliche Gespräch mit dem Rechtsmediziner oder Pathologen, der die Untersuchung durchgeführt hat. Der Transparenz sind bei nicht-natürlichen Todesfällen naturgemäß enge Grenzen gesetzt. Von Anfang an haben die Hinterbliebenen die Möglichkeit für ihre ganz speziellen Nöte und Probleme Hilfe in der Selbsthilfe zu suchen. Die Gemeinsame Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod (GEPS) Deutschland e.V. unterstützt betroffene Eltern mit seinem Bundesverband und den Landesverbänden in vielfacher Hinsicht. Auch bei Verwaiste Eltern e.V. finden Betroffene Selbsthilfegruppen und andere kompetente Ansprechpartner. Helfen und Ermitteln – ein Widerspruch? Nein! Wenn sich alle Beteiligten innerhalb ihres professionellen Rahmens menschlich verhalten und wenn die legitimen Bedürfnisse der Eltern wahrgenommen werden, kann der Spagat zwischen Empathie und Todesermittlung gelingen. Autor: Dr. med. Jan Sperhake, Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. [email protected] Der Text ist auch als Manuskript für die Deutsche Hebammenzeitschrift eingereicht worden. Nachdruckrechte liegen beim Verlag!