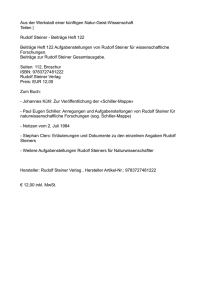Historische Literatur, 5. Band - 2007 - Heft 3 - Humboldt
Werbung

Band 5 2007 Heft 3 HistLit Historische Literatur www.steiner-verlag.de Band 5 · 2007 · Heft 3 Juli – September Franz Steiner Verlag Franz Steiner Verlag Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult Historische Literatur ISSN 1611-9509 Veröffentlichungen von Clio-online, Nr. 1 Außereuropäische Geschichte Außereuropäische Geschichte Besier, Gerhard; Lindemann, Gerhard: Im Namen der Freiheit. Die amerikanische Mission. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006. ISBN: 3-525-36734-1; 415 S. Rezensiert von: Jan C. Behrends, FedorLynen-Stipendiat der Alexander-vonHumboldt-Stiftung, Department of History, University of Chicago In seinem Gedicht „Der anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy“ karikierte der Dichter Bertolt Brecht 1947 diejenigen geschlagenen Deutschen und umgedrehten Nazis, die sich nun zur „amerikanischen“ Idee der Freiheit bekannten: „Blut und Dreck in Wahlverwandtschaft Zog das durch die deutsche Landschaft Rülpste, kotzte, stank und schrie: Freiheit und Democracy!“ Der Blick zurück in den frühen Kalten Krieg verdeutlicht, wie ambivalent und schillernd der Freiheitsbegriff in der politischen Sprache Deutschlands besetzt war. Brecht hielt ihn nicht nur für unzeitgemäß, sondern versuchte hier, seine Verfechter moralisch zu diskreditieren. Da sie den Freiheitsbegriff fünfzig Jahre nach Brechts Gedicht keineswegs für anachronistisch halten, haben die Dresdner Theologen Gerhard Besier und Gerhard Lindemann den Pfad der Diktaturforschung verlassen, um sich der Geschichte der Freiheit zu widmen. Was liegt da näher als die amerikanische Geschichte zu betrachten – schließlich sind „freedom“ und „liberty“ seit dem 18. Jahrhundert Kernbestand amerikanischer Selbstbeschreibung. Eingangs beklagen sie dann auch, dass sich die deutsche Historiographie bisher zu wenig mit der Geschichte der Freiheit hierzulande beschäftigt habe. Durch den Blick auf die USA wollen sie dazu beitragen, die „Freiheitsforschung“ als Teil der Kulturwissenschaft in Deutschland zu etablieren. Wohl um das Anliegen des Buches offensiv zu untermauern, sind ihm zwei kämpferische Zitate von Karl Popper und George W. Bush zum Siegszug der Freiheit in 434 den Vereinigten Staaten vorangestellt. So eingestimmt, nehmen die Autoren den Leser mit auf die Reise durch drei Jahrhunderte amerikanischer Geschichte – von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart des „Krieges gegen den Terror“. Das Buch gliedert sich in zwölf Kapitel, die den etablierten Zäsuren amerikanischer Geschichte folgen. Die einzelnen Abschnitte erklären das Leben in den Kolonien, die Entstehung der Vereinigten Staaten, die Erschließung des Westens und den Weg in den Bürgerkrieg, die Industrialisierung und die Sozialreformen der klassischen Moderne und widmen sich schließlich dem inneren Wandel und der Außenpolitik der USA im 20. Jahrhundert. Die Erzählung der Ereignisse streift dabei immer wieder die Entwicklung des Freiheitsbegriffes in den USA: Sie berichtet von der liberty bell in Philadelphia und den liberty trees der amerikanischen Revolution mit ihrem Schlachtruf „liberty or death“, vom rassistischen Freiheitsverständnis des Südens und der Freiheitspropaganda des Ersten Weltkrieges, bis hin zu den Forderungen des civil rights movements und dem consumer freedom der wohlhabenden Nachkriegsgeneration. Doch das Freiheitsthema ist nur ein Strang des Buches. Vornehmlich handelt es sich um eine Geschichte der amerikanischen Republik und ihrer Gesellschaft, die hier gerafft erzählt wird. Chronologisch stringent und überwiegend flüssig geschrieben ist die Darstellung insbesondere für Einsteiger in die amerikanische Geschichte gut geeignet. Diejenigen, die sich bereits mit der amerikanischen Moderne befasst haben, werden hingegen weder auf der Ebene der Fakten noch der Deutungen viel Neues erfahren. Letztlich leidet „Im Namen der Freiheit“ darunter, dass die Verfasser sich nicht entschieden haben, ob sie sich mit der amerikanischen Freiheitstradition auseinandersetzen möchten oder für den deutschen Markt eine Geschichte der USA verfassen wollen. Das Ergebnis dieses Versäumnisses ist zwar eine lesbare Darstellung der Entwicklung der Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart P. Birle u.a. (Hrsg.): Hemisphärische Konstruktionen der Amerikas Vereinigten Staaten – es löst jedoch den eingangs von den Autoren formulierten Anspruch kaum ein. Zu häufig verlieren sie sich zwischen den Fakten und in der Erklärung von Institutionen und Traditionen der USA; eine systematische Auseinandersetzung mit einem spezifisch amerikanischen Freiheitsverständnis – die auch den systematischen Vergleich mit anders geprägten europäischen Traditionen verlangt hätte – findet kaum statt. Erst im letzten Kapitel kommen die Verfasser auf konkurrierende Freiheitsvorstellungen zurück. Als Charakteristikum der USA nennen sie dabei, dass verschiedene Freiheitsvorstellungen sich stets ausbalanciert hätten. Ihre Erklärung der amerikanischen Freiheitskultur kommt allerdings nicht ohne Allgemeinplätze aus: so sprechen sie vom „unbändigen Freiheitswillen“ als movens amerikanischer Kultur und bescheinigen ihren Bürgern einen „unverbesserlichen, stets auf die Zukunft hin fokussierten Optimismus“ (S. 285). Es ist bedauerlich, dass die Autoren das Wechselspiel zwischen amerikanischen Freiheitsvorstellungen und den totalitären Ordnungen des 20. Jahrhunderts nur in Ansätzen diskutieren. Schließlich entstanden die Freiheitsdiskurse der Neuen Welt immer auch in der Auseinandersetzung mit konkurrierenden Vorstellungen in Europa. Stattdessen haftet dem Buch ein didaktischer Unterton an, so dass das Gefühl entsteht, dass es als Aufklärungsschrift für ein antiamerikanisches Publikum konzipiert wurde. Dies mag hierzulande, wo legitime Kritik an den USA nicht selten in zügelloses Ressentiment umschlägt, nicht ganz unbegründet sein. Doch eine Zeit, die ohne den plakativen Antiamerikanismus Bertolt Brechts auskommen möchte, sollte nicht in den Americana Norman Rockwells Zuflucht suchen. HistLit 2007-3-041 / Jan C. Behrends über Besier, Gerhard; Lindemann, Gerhard: Im Namen der Freiheit. Die amerikanische Mission. Göttingen 2006. In: H-Soz-u-Kult 17.07.2007. Birle, Peter; Braig, Marianne; Ette, Ottmar; Ingenschay, Dieter (Hrsg.): Hemisphärische Konstruktionen der Amerikas. Frankfurt: Vervuert Verlag 2006. ISBN: 3-86527-283-5; 170 S. 2007-3-089 Rezensiert von: Frank Mattheis, Zentrum für Höhere Studien der Universität Leipzig Interdisziplinarität und Transregionalität sind Attribute, denen bei der Konzipierung von Studiengängen und Forschungsprojekten immer häufiger eine zentrale Rolle zugewiesen wird. Diese Entwicklung ist ob der Zunahme globalperspektivischer Wissenschaftsansätze sehr erfreulich. Sie macht allerdings auch eine genaue Betrachtung notwendig, um zu unterscheiden, wo lediglich unabhängige Themen eklektisch unter einen Denkmantel gezwängt werden und wo tatsächlich ein Mehrwert durch neue Perspektiven entsteht. Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer gleichnamigen Ringvorlesung des Forschungsverbundes Lateinamerika BerlinBrandenburg im Sommersemester 2004. Er erhebt den Anspruch, in einem interdisziplinären Kontext die konstruierten Grenzen der westlichen Hemisphäre als dynamisch und vielschichtig zu begreifen. Die Autorinnen und Autoren, jeweils drei aus der Politikwissenschaft und drei aus der Philologie, versuchen so, einige der zahlreichen Prozesse von Identitätskonstruktion zu beleuchten und in einen globalen Rahmen zu stellen. Zunächst beschäftigt sich Ottmar Ette mit der wissenschaftlichen Annäherung Alexander von Humboldts an die westliche Hemisphäre. Ette hebt anhand zahlreicher Primärquellen die transregionale Komponente der Humboldtschen Erfassung Amerikas hervor und zeigt sich beeindruckt von seinen zahlreichen Kategorisierungen, die den Doppelkontinent intern gliedern, ihn als Neue Welt in einem globalen Kontext abgrenzen. Die natur- und sozialwissenschaftlichen Aufteilungen bezeichnen eine Reihe von unterschiedlichen Räumen, die sich überschneiden und mit jeder neuen fachlichen Betrachtung vernetzt werden. Die berechtigte Euphorie Ettes für die aufeinander aufbauenden Perspektivwechsel und Verknüpfungen erzeugen jedoch einige Redundanzen und Längen, die mitunter eine kritische Auseinandersetzung mit dem „preußischen Gelehrten“ (S. 29) vermissen lassen. Ohne Ausführung bleibt leider der Hinweis auf Transfermöglichkeiten für die heutige Verbundforschung. Zwar greifen die folgenden Autoren seinen Vorschlag auf, Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 435 Außereuropäische Geschichte aber dennoch hätte hier eine knappere Analyse der Werke Humboldts zugunsten von Anknüpfungspunkten für einzelne Fachgebiete einen deutlicheren Mehrwert für den Leser schaffen können. Im folgenden Kapitel nehmen sich Marianne Braig und Christian Baur zunächst der verschiedenen Konzeptionen der Eliten zum Raumverständnis Amerikas im 19. Jahrhundert an. Hierbei wird deutlich, dass politische Entwürfe zum Selbstverständnis der Amerikaner sich über das Verhältnis zu Europa definierten. Dies galt auch dann noch, als mit dem Aufstieg der USA zum Regionalhegemon eine kontinentale Einheit unmöglich und für den Süden der Kulturkreis Lateinamerika konstruiert wurde. Erfreulich sind insbesondere die Ansätze, die abwechselnd passive und aktive Rolle Europas bei der lateinamerikanischen Identitätssuche dieser Zeit zu verknüpfen. Im zweiten Teil dieses Kapitels gehen Braig und Baur der Frage nach, welche Rolle Mexiko im Kontext aktueller Kultur- und Sicherheitsentwürfe spielt. Dieser zeitliche Sprung von fast 90 Jahren kommt etwas abrupt und setzt die Zweiteilung des Kontinents in ein völlig anderes Umfeld, in dem Europa wiederum gänzlich abwesend ist. Nichtsdestotrotz wird veranschaulicht, dass es nicht ein Mexiko, sondern eine ganze Reihe unterschiedlicher „Mexikos“ gibt, deren (soziale und/oder kulturelle) Grenzziehungen jeweils anders verlaufen und damit eine ungeheure Dynamik jenseits der des Nationalstaates entwickeln. Braig und Baur weisen hierbei auf den obsoleten Charakter allzu klarer Abgrenzungskonzepte hin, da die Entstehung von transkulturellen Netzwerken eine zunehmende Durchlässigkeit bedingt. Inspiriert durch Ettes Vorschlag versucht sich auch Dieter Ingenschay an einer hemisphärischen Betrachtung Amerikas als Konstruktion. Gegenstand seiner Untersuchung ist der AIDS-Diskurs in der homosexuellen Literatur Lateinamerikas, die er in einen gesamtamerikanischen beziehungsweise globalen Zusammenhang stellt. Er führt die Ausgrenzung Homosexueller in Lateinamerika auf die diskursive Verknüpfung von Rassismus und Diskriminierung sodomitischer Praktiken während der Kolonisation zurück. 436 Auch die literarische Auseinandersetzung mit AIDS in Lateinamerika wurde zunächst von außen bestimmt, insbesondere durch den dominanten US-Diskurs, der den Zusammenhang zwischen Homosexualität und AIDS festigte, an dem sich auch Ingenschay orientiert. Je deutlicher jedoch die Disparitäten zwischen Homosexuellen in den USA und in Lateinamerika hervortreten, desto mehr wächst im Süden die postkoloniale Erkenntnis, keineswegs der im Norden konstruierten „gay culture“ zuzugehören. Auf dieser Basis versucht die lateinamerikanische Literatur, eigene Perspektiven zu entwickeln. Ingenschay weist darauf hin, dass sich diese auf den USDiskurs beziehen und sich somit erst in einer hemisphärischen Betrachtung entfalten können. Daraus lässt sich die wichtige Erkenntnis gewinnen, dass der AIDS-Diskurs in Lateinamerika auch bei seiner Emanzipation einer Auseinandersetzung mit dem US-Diskurs bedarf, um sich selbst neu zu definieren. Ebenfalls mit dem hemisphärischen Blick auf einen Literaturprozess beschäftigt sich Monika Walter. Sie behandelt die testimoniale Erzählpraxis in Lateinamerika und Europa. Der europäische postmoderne „témoignage“ entstand mit den narrativen Zeugnissen der zunächst französischen HolocaustLiteratur. Er hebt die Singularität des Holocausts hervor und verweist auf die ethische Verantwortung des Individuums. Aufgrund der Erfahrungen aus den kolonialen Genoziden ist das lateinamerikanische „testimonio“ weiter gefasst und wird in der Auseinandersetzung zwischen kreolischer Elite und marginalisierten Indios eingesetzt. Daraus entsteht auch ein konkretes Streben nach Solidarität und sozialer Neuordnung. Walter verdeutlicht die unterschiedlichen Entwicklungen der beiden Erzählformen, aber auch deren Berührungspunkte. Ein solcher Vergleich wird erst durch eine hemisphärische Perspektive möglich, welche die gegensätzliche Betrachtung von Zentrum und Peripherie hinter sich lässt und Gemeinsamkeiten freilegt. Im letzten Abschnitt widmet sich Peter Birle den Zyklen der brasilianischen Außenpolitik seit seiner Unabhängigkeit. Das bis in die 1970er-Jahre dominante Paradigma einer Allianz mit den USA führt Birle auf die Entscheidung Brasiliens zurück, mit der auf- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart N. Böttcher u.a. (Hrsg.): Los buenos, los malos y los feos strebenden Hegemonialmacht zu kooperieren, um wirtschaftliche und politische Vorteile zu erlangen. Zum Paradigmenwechsel kam es erst mit der Demokratisierung in den 1980er-Jahren. Das Scheitern des interamerikanischen Systems und die komplementären wirtschaftlichen Beziehungen zu Lateinamerika ermöglichten eine lateinamerikanische Kooperation, die in den 1990er-Jahren im MERCOSUR institutionalisiert wurde. Birle macht allerdings deutlich, dass eine endgültige Überwindung des lateinamerikanischen Partikularismus noch in weiter Ferne liegt. Brasilien tut sich schwer damit, Entscheidungskompetenzen abzutreten, während im restlichen Lateinamerika weiterhin die Angst vor einem Subimperialismus besteht. Die Grenzen, die Brasilien in der Hemisphäre zieht, bleiben verschwommen, insbesondere in Bezug auf Mittel- und Nordamerika. Insgesamt zeichnet Birle die Geschichte der außenpolitischen Beziehungen Brasiliens als Nullsummenspiel, in dem sich eine Kooperation mit den USA oder Lateinamerika stets diametral gegenüberstanden. Die neuerliche Zuwendung Brasiliens zu seinen Nachbarn birgt demnach ein hemisphärisches Dilemma, für das auch Birle keine Lösung sieht. Für eine hemisphärische Betrachtung lesen sich seine Ausführungen allerdings mitunter zu Brasilien-zentrisch. Speziell die Fremdbilder Brasiliens, die eingangs als ein Grundpfeiler der Außenpolitik erwähnt werden, finden für die Gegenwart wenig Beachtung. Dennoch bietet Birle eine hervorragende Skizze eines Landes, das noch immer seinen Platz in der Hemisphäre sucht. Alles in allem wird der Anspruch des Sammelbandes, die Facetten hemisphärischer Konstruktionen zu beleuchten, erfüllt. Der Leser muss zwar besonders bei Birles Abschnitt mit der Lupe nach dem Begriff hemisphärisch suchen, aber die Belege, dass die Literaturund Politikwissenschaften von den Betrachtungen der Dynamik dieser Konstruktionen profitieren, bieten einen roten Faden. Darüber hinaus ist der Band aber auch als ein Appell an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen zu verstehen, die sich mit einigen der zahlreichen Konstruktionen Amerikas befassen. Nur durch Wissensaustausch und Kooperation kann die angestreb- 2007-3-019 te Verbundforschung ihre multidisziplinäre Perspektive erreichen. Gerade Wissenschaftler aus Lateinamerika könnten hier beitragen und auch profitieren. Das Bewusstsein, dass die westliche Hemisphäre ein vielschichtiges Gebilde mit zahlreichen Grenzziehungen ist, dürfte auch ein Beitrag zur Globalisierungsforschung sein, da statische Kategorisierungen abgelegt und Pluralitäten in den Vordergrund gestellt werden. Die im Band vorgestellte Herangehensweise erinnert daher zu Recht an den multi-fokalen und integrativen Ansatz der Globalgeschichte und in der Tat bleibt der Leser am Ende unsicher, ob der hemisphärische Ansatz nicht doch vor allem Teil einer global-lokalen Perspektive ist. HistLit 2007-3-089 / Frank Mattheis über Birle, Peter; Braig, Marianne; Ette, Ottmar; Ingenschay, Dieter (Hrsg.): Hemisphärische Konstruktionen der Amerikas. Frankfurt 2006. In: HSoz-u-Kult 03.08.2007. Böttcher, Nikolaus; Galaor, Isabel; Hausberger, Bernd (Hrsg.): Los buenos, los malos y los feos. Poder y resistencia en América Latina. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag 2005. ISBN: 84-8489-191-7; 512 S. Rezensiert von: Jan Suter, Basel Der spanische Titel des Sammelbandes ist natürlich eine Anspielung auf Sergio Leones Western „The Good, the Bad and the Ugly“ und verweist so darauf, dass es hier nicht allein um das Referieren verschiedener Macht- und Konfliktverhältnisse geht, sondern ebenso auch um ihre Einordnung in einen gesellschafts- und mentalitätsgeschichtlichen Kontext: etwa die Gegenüberstellung Zivilisation – Barbarei, die für den gesellschaftlichen Diskurs zu Rebellionen, Revolutionen und Widerstandsbewegungen in Lateinamerika häufig den Bezugsrahmen gebildet hat. Der Band ist das Ergebnis eines schon 2002 in Berlin abgehaltenen Symposiums zum – sehr weit gefassten – Thema Macht und Widerstand in Lateinamerika. Er vereinigt Beiträge der, wie die Herausgeber schreiben, „jungen und weniger jungen TeilnehmerInnen“ des Symposiums. Neben der Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 437 Außereuropäische Geschichte deutschen ist die jüngere Lateinamerikanistik der Schweiz sehr gut vertreten, aber auch einige internationale „celebrities“ des Faches, etwa der Mexiko-Historiker Friedrich Katz aus Chicago. Hinzu kommen Beiträger aus Israel, Frankreich und Kolumbien. HistorikerInnen, EthnologInnen und SoziologInnen beleuchten die Problemstellung aus den Blickwinkeln ihrer verschiedenen Disziplinen variantenreich und mit viel Detailwissen zu ihrem teilweise für Nicht-Lateinamerikanisten exotisch anmutenden jeweiligen Forschungsgegenständen. Die Einführung der Herausgeber hebt auf das Problem der Suche nach Kontexten von Macht und Widerstand ab und argumentiert also auch methodenkritisch. In den folgenden Beiträgen werden Fragen nach Macht und Machtausübung in beachtlicher thematischer, chronologischer und geographischer Breite gestellt, wobei Mexiko einen Schwerpunkt bildet. Die einleitende Sektion „Widerstehen, um zu erobern“ wird angeführt von einem Beitrag von Miriam Lang, die sich mit dem Feminismus in Mexiko in jüngster Zeit befasst. Ihr folgt Ingrid Kummels mit einem Aufsatz über den Einfluss von Ärzten und Missionaren auf Peyote-Heilungszeremonien bei den Rarámuri der mexikanischen Tarahumara-Wüste. Die zweite Abteilung „Erinnerung und Diskurs“ bringt unter anderem Essays zur peruanischen und mexikanischen Kolonialgeschichte im 16. Jahrhundert (Karoline Noack bzw. Amos Megged) sowie Untersuchungen politischer Widerstandsbewegungen in Brasilien zu Ende des 19. Jahrhunderts (Dawid Danilo Bartelt). „Ethnizität und Identität“, so die Bezeichnung des dritten Teils des Bandes, vereinigt Stücke vor allem zu indigenistisch orientierten Widerstandsbewegungen, etwa bei den Kruso’b Yukatans (Wolfgang Gabbert) im 19. Jahrhundert oder der zapotekischen Potestbewegung COCEI in Oaxaca in den 1980er-Jahren (Stephan Scheuzger). Den Schluss bildet der Abschnitt „Repression, Revolution und täglicher Widerstand“, unter anderem mit einem Beitrag zum Alltagswiderstand im kolonialen Lateinamerika zwischen 1500 und 1810 (Hermes Tovar Pinzón) und eine Betrachtung der neuesten politischen Geschichte Perus und der Guerillaorganisation Sendero Luminoso („Leuchtender Pfad“) von 438 Ulrich Mücke. Mit diesem kurzen Überblick ist die thematische Breite angedeutet, die der im Übrigen ansprechend gestaltete und sorgfältig redigierte Sammelband abzudecken versucht. Offensichtlich wendet er sich in erster Linie an ein sehr interessiertes Fachpublikum – nicht zuletzt auch, weil den fünf Beiträgen in englischer Sprache 16 auf spanisch verfasste (inklusive der Einleitung) gegenüberstehen. Man kann diese Publikation damit also auch als einen Versuch des Dialogs mit der internationalen, das heißt der nord- und südamerikanischen Lateinamerikaforschung sehen, der durch vielerlei institutionelle Hindernisse, aber auch häufig vorhandenes gegenseitiges Desinteresse stark eingeschränkt wird. Gerade für die Lateinamerikanistik des deutschsprachigen Europa sind solche Anstrengungen unverzichtbar und deshalb sehr zu begrüßen. Man nimmt dabei allerdings billigend in Kauf, dass die wissenschaftliche Produktion zu Lateinamerika in solche „internationalistische“ Publikationen und eher „binnenwissenschaftliche“, das heißt zwangsweise auf deutsch verfasste Monographien und Sammelbände (Dissertationen aufgrund universitärer Vorschriften, bzw. andere Publikationen infolge Vorgaben durch Förderungsinstitutionen) auseinander fällt. Ebenso ergibt sich durch die Zusammenstellung von derart verschiedenartigen Ansätzen, Themen, geographischen Spezialisierungen und Methoden im Zeichen von Interdisziplinarität und dem Anspruch, Verallgemeinerungen und Ungenauigkeiten möglichst zu vermeiden, eine methodische Schwierigkeit: Entweder, man verzichtet für Publikationen wie die vorliegende auf ein Oberthema, um die spezialisierte Forschung der BeiträgerInnen nicht unnötig thematisch zu beugen. Oder aber, und dieser Weg wurde hier gewählt, das Oberthema wird sehr allgemein gefasst. Doch damit ist die Gefahr verbunden, dass allgemeine Erkenntnisse im Hinblick auf das Oberthema durch die Beiträge nicht wirklich zu gewinnen sind. Ein derart globales Thema wie „Macht und Widerstand in Lateinamerika“, so der Untertitel des Bandes, kann vielleicht in der Diskussion eines Symposiums vor dem Hintergrund der präsentierten Forschung angegangen werden; im Sammelband Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart S. Carreras u.a. (Hrsg.): Preußen und Lateinamerika müsste jedoch zumindest durch die Herausgeber der Versuch einer Synthese unternommen werden, die die Fäden der einzelnen Beiträge zu einem Muster verknüpft und noch einmal auf die in der Einleitung geäußerten Erkenntnisinteressen abhebt. In „Los buenos, los malos y los feos“ bleibt dieser Versuch einer Synthese aus, es gibt kein zusammenfassendes oder abschließendes Kapitel. Trotz dieser Schwäche bleibt der Band nichtsdestoweniger eine lesenswerte Sammlung, aber eben nur eine Sammlung, von Schlaglichtern auf einzelne Aspekte des Komplexes Macht / Widerstand in Lateinamerika, die notgedrungen etwas disparat erscheinen muss. HistLit 2007-3-019 / Jan Suter über Böttcher, Nikolaus; Galaor, Isabel; Hausberger, Bernd (Hrsg.): Los buenos, los malos y los feos. Poder y resistencia en América Latina. Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult 09.07.2007. Carreras, Sandra; Maihold, Günther (Hrsg.): Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von Kommerz, Macht und Kultur. Münster: LIT Verlag 2004. ISBN: 3-8258-6306-9; 328 S. Rezensiert von: Barbara Vogel, Historisches Seminar, Universität Hamburg Das Buch veröffentlicht die Ergebnisse eines Kolloquiums im Ibero-Amerikanischen Institut Preußischer Kulturbesitz Berlin aus dem Jahre 2003, das – wie es im Vorwort treffend heißt – „Schlaglichter“ (S. 8) auf die Beziehungen zwischen Preußen und verschiedenen lateinamerikanischen Staaten und Regionen (Karibik, Argentinien, Chile, Brasilien, Mexiko) wirft. „Kommerz, Macht und Kultur“ können dabei als Stichworte verstanden werden, unter denen sich die verschiedenen Aspekte und Themenfelder der Beiträge addieren lassen. Das avisierte „Spannungsfeld“ zwischen diesen Wirklichkeit konstituierenden Bereichen bleibt allerdings mehr Andeutung als Perspektive der Analysen – kein Wunder beim heutigen Stand der vergleichenden Geschichtsforschung zu diesem Gegenstand. Da auf dem Kolloquium fast ausschließlich Lateinamerika-Spezialisten versammelt waren, richtete sich deren Interesse 2007-3-163 stark auf den Referenzpartner Preußen; über „die Verhaltensmuster in Lateinamerika“ erfahren die Leser weniger. Die Themenvielfalt sowie die einzelnen Beiträge weisen über bloße bilaterale Beziehungsgeschichte hinaus. Zeitlich reicht das Spektrum vom späten 17. Jahrhundert, als die Kurmark Brandenburg unter dem Großen Kurfürsten handels- und kolonialpolitisch in der Karibik Fuß zu fassen versuchte, bis zum späten 20. Jahrhundert, das im Beitrag über preußisch-deutsche Militärberater in Chile gestreift wird. Das bedeutendste Beziehungsfeld bildet offensichtlich der „Kommerz“, was gewiss dem Forschungsstand geschuldet ist. Das Interesse von Kaufleuten und Wirtschaftsexperten gab wichtige Impulse für die Kontaktaufnahme. Vier von zehn Beiträgen und fast die Hälfte des Seitenumfangs widmen sich den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen von Preußen ausgehend zu verschiedenen lateinamerikanischen Staaten und Regionen. Gernot Lennert schildert das Kolonialexperiment des Großen Kurfürsten in der Karibik, das heute fast als Kuriosum erscheint, wenn man es nicht als Beispiel für die Aufbruchstimmung in Europa nach dem desaströsen Dreißigjährigen Krieg deuten will. Dass in Preußen dann der Verzicht auf eine Zuckerinsel leichter verschmerzt werden konnte, weil hier zwei Generationen später (1747) die Zuckergewinnung aus Rüben entdeckt wurde, verführt dazu, den Bogen zu interkulturellen Begegnungen zu schlagen. Bernd Schröters Beitrag über die Anfänge der preußischen Diplomatie in Südamerika, insbesondere in Brasilien, zeigt ebenfalls die wachsende Bedeutung der Handelsinteressen für die europäischen Staaten, ging es doch um die Etablierung von Konsulaten. Der geringe Erfolg dieser frühen Bemühungen am Anfang des 19. Jahrhunderts sagt offenbar mehr über die Rivalität der europäischen Mächte aus denn über Defizite der Kommunikation zwischen Preußen und den Lateinamerikanern. Michael Zeuskes Aufsatz über preußische Handels- und Konsularbeziehungen zu „Westindien“ sprengt mit über siebzig Seiten alle einem Kolloquiumsbeitrag angemessenen Formate. Zeuskes Darstellung der Organisierung des Atlantikhandels, besonders wichtig die „Rheinisch-Westindische Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 439 Außereuropäische Geschichte Compagnie“ von 1821, berücksichtigt kenntnisreich die wirtschaftliche Umbruchssituation in Preußen, das mit den 1815 hinzugewonnenen Rheinprovinzen eine große wirtschaftliche und gesellschaftliche Heterogenität zu bewältigen hatte. Seine These, dass die Industrialisierung in Preußen ohne den transnationalen Handel, der auf Textil-, das heißt vornehmlich Leinenexporten basierte, nicht zu verstehen sei (S. 150), verdient allerdings eine Relativierung. Zeuske schildert die divergierende Entwicklung im protoindustriellen Leinengewerbe zwischen Deindustrialisierung und Industrialisierung überzeugend und anschaulich. Aber die Industrialisierung in Preußen ist nicht durch das Textilgewerbe induziert, sondern durch Kohle und Eisen. Sein Fazit lautet, Preußen sei eine „sekundäre Großmacht in Westindien“, gewesen, die durch pragmatische Wirtschaftspolitik Erfolge erzielt habe. Zu betonen wäre, dass es schwere Verwerfungen zwischen den liberalen Beamten in den Wirtschaftsressorts und der überwiegend strikt konservativen Bürokratie gab (S. 214f.). Walther L. Bernecker, der ebenfalls die Handelspolitik untersucht, vornehmlich auf Mexiko orientiert, kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen: Auch er zeigt die Vorreiterrolle des preußischen Westens, hebt die Bedeutung der Textilprodukte und die unaufhaltsame Verdrängung des Leinens durch die Baumwolle hervor. Und auch bei ihm wird die Auseinandersetzung zwischen der legitimistischen Außenpolitik und dem handelspolitischen Liberalismus deutlich (S. 221). Zwei Beiträge gehören in den militärischen Bereich: Gerhard Wiechmann schildert die ersten Flottenexpeditionen unter Leitung des preußischen Prinzen Adalbert nach Westindien. Die von Nationalgefühl inspirierte Flottenbegeisterung während der Revolution von 1848/49, Abenteuerlust nach der großen weiten Welt und preußische Handelsinteressen wirkten dabei zusammen. Preußische Segelschiffe beteiligten sich auch an den lateinamerikanischen Kriegen kurz nach der Jahrhundertmitte. Ob man den Ausdruck der „Kanonenbootpolitik“, der gewöhnlich mit dem politisch gefährlichen und dramatischen Panthersprung nach Agadir vom Juli 1911 assoziiert wird, für diese Expeditionen verwenden sollte, ist fragwürdig. Stefan Rinke verfolgt 440 die Geschichte und die Nachgeschichte der preußischen Militärberater in Chile im späten Kaiserreich. Die direkte Kooperation beendete der Erste Weltkrieg; nur kurz wiederbelebt in den späten 1920er-Jahren. Rinke geht seinen militärpolitischen Gegenstand als ein Beispiel für Kulturtransfer an, und insofern legt er Wert auf die habituellen Auswirkungen preußischer Beratung auf das chilenische Militär, auf dessen Professionalisierung und Militärkultur. Zugleich warnt er vor zu leichtfertigen Parallelen: „Eine Pickelhaube macht noch keinen Preußen“ (S. 262). Vier Beiträge lassen sich dem Stichwort Kultur zuordnen. Marcelo Caruso fragt nach dem Einfluss des preußischen Schulwesens, insbesondere der Volksschule, auf argentinische Schulreformen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem dann aber unter Saavedra Lamas um 1916. Er kommt allerdings zu einem eher negativen Befund. Den Vorbildcharakter Preußens propagierten nämlich gerade die politischen Kräfte in Argentinien, die im Begriff standen, ihre Macht zu verlieren (S. 303). Insgesamt wurde für Argentinien der Einfluss Frankreichs wichtiger (S. 289). Ulrike Schmieder untersucht die Lateinamerikabilder in der preußischen und deutschen Publizistik vom späten 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie gibt für die Leser des Bandes als erste den Anstoß, über die sich wandelnde Namensgebung für den lateinamerikanischen Kontinent in der deutschen Wahrnehmung nachzudenken. Zugleich kann sie zeigen, wie sehr die Zunahme an Informationen dazu beitrug, von Ahnungslosigkeit und Ressentiment geprägte Bilder zu revidieren. Eine merkliche Zäsur setzten in dieser Hinsicht die Berichte Alexander von Humboldts. Freundlichere Bilder schufen dann die Handelsbeziehungen; vermehrt publizierte Reiseberichte trugen ebenfalls zu größerer Differenzierung bei. Die politischen Gegensätze in den deutschen Bundesstaaten färbten die Urteile über Lateinamerika ein. Denn die dortigen Unabhängigkeitsbewegungen entzweiten in Deutschland die Verfechter des Legitimitätsprinzips der Heiligen Allianz und ihre liberalen Gegner, die Freiheitsbewegungen in und außerhalb Europas begrüßten. Die Beiträge von Ette und Carreras exemplifizieren jeweils an einer Person Entstehung, Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart Sammelrez: Geschichte Indiens und seiner Historiografie(n) Formen und Fernwirkungen kultureller Annäherung: Otmar Ette zeichnet das Wirken Alexander von Humboldts und seiner Forschungsexpertise in Preußen nach, während sich die Herausgeberin des Bandes Sandra Carreras dem argentinischen Stifter der Quesada Bibliothek als Gründungskern des Berliner Ibero-Amerikanischen Institut widmet, um den Hintergründen der Schenkung nachzugehen – der Preuße von Humboldt als Kosmopolit ein Vermittler der lateinamerikanischen Kultur in Europa um 1800 und der Argentinier Quesada als ein Bewunderer deutscher Wissenschaft und deutschen Gelehrtentums im ausgehenden 19. Jahrhundert. In der preußischen Geschichtsschreibung ist der Name Humboldt vornehmlich mit Wilhelm verbunden, dem preußischen Beamten, Diplomaten und treibender Kraft bei der Gründung der Berliner Universität im Jahre 1810. Alexander ist Wilhelms jüngerer Bruder, der überall außerhalb Preußens größeren Ruhm genießt, der in seiner Heimat und, wie Ette zeigt, bei seinem Bruder dagegen im Verdacht stand, mehr Weltbürger als Deutscher zu sein, was in der spezifischen Ausformung des deutschen Nationalismus an Vaterlandsverrat grenzte. Die 82.000 Bände umfassende Quesada Bibliothek mit sozial- und geisteswissenschaftlicher Ausrichtung, nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin transferiert, entstand aus der Sammelleidenschaft Ernesto Quesadas, geboren 1858, und zuvor seines Vaters. Quesada, studierter Jurist und vorübergehend auch in der Justiz tätig, verstand sich als Akademiker. Nach der Entpflichtung von seinem Lehrstuhl für Soziologie im Jahre 1921 lebte er bis zu seinem Tode in der Schweiz. Die Liebe zu Preußen als der deutschen Führungsmacht datiert schon aus seinem kurzzeitigen Schulbesuch in Dresden. Er war ein Verehrer Bismarcks. Der Vortrag, den Quesada 1898 über Bismarck hielt und aus dem Sandra Carreras zitiert, gibt ein kleines eindrucksvolles Beispiel für den Erkenntniswert von Kulturvergleichen. Quesada beobachtete aus der Schweiz mit Ingrimm die Namensgebung für das 1930 eingeweihte IberoAmerikanische Institut, weil er dadurch die lateinamerikanischen Republiken in die „Gefolgschaft“ Spaniens und Portugals herabgewürdigt sah (S. 319). 2007-3-039 Den Veranstaltern des Kolloquiums ging es darum, das Spektrum aufzuzeigen, „das die Referenz auf Preußen zur Legitimation von Verhaltensmustern in Lateinamerika ausmacht“ (S. 8). Angesichts des Forschungsstands kann es sich nur um einen Zwischenbericht handeln. Wie von den Herausgebern erhofft kann der Band zu weiterem Forschen einladen. Bedauerlich ist, dass dem Band keine problemorientierte Einführung vorangestellt ist, in der die Erkenntnisfortschritte, die in der Beziehungsgeschichte oder dem Kulturtransfer zwischen ausgerechnet Preußen und Lateinamerika liegen, erörtert werden. HistLit 2007-3-163 / Barbara Vogel über Carreras, Sandra; Maihold, Günther (Hrsg.): Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von Kommerz, Macht und Kultur. Münster 2004. In: H-Soz-u-Kult 03.09.2007. Sammelrez: Geschichte Indiens und seiner Historiografie(n) Conermann, Stephan: Das Mogulreich. Geschichte und Kultur des muslimischen Indien. München: C.H. Beck Verlag 2006. ISBN: 3-40653603-4; 128 S. Conermann, Stephan (Hrsg.): Die muslimische Sicht (13. bis 18. Jahrhundert). Frankfurt: Humanities Online 2002. ISBN: 3-934157-22-X; 350 S. Gottlob, Michael (Hrsg.): Historisches Denken im modernen Südasien (1876 bis heute). Frankfurt: Humanities Online 2002. ISBN: 3-93415723-8; 474 S. Rezensiert von: Michael Mann, FernUniversität Hagen Ausdruck eines seit geraumer Zeit wachsenden Eindrucks der Globalisierung in den europäischen und nordamerikanischen Geschichtswissenschaften ist das zunehmende Interesse an außereuropäischen Regionen, ihren Gesellschaften und ihrer Geschichte. Global History als jüngstes Interessengebiet von HistorikerInnen dürfte sicherlich der deutlichste Niederschlag sein. Doch auch auf dem Gebiet der Historiografiegeschichte tut sich Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 441 Außereuropäische Geschichte jüngst etwas. Galt Geschichte und ihre Schreibung bisher als eine Domäne des Westens, so wurde im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte zur Kenntnis genommen, dass es in vielen anderen Weltregionen eine teilweise beachtliche historiografische Tradition gegeben hat und bis heute gibt. Das gilt insbesondere für Südasien bzw. den indischen Subkontinent. Gerade an ihm hatten europäische Historiker das kulturell-zivilisatorische Andere schon im 18. Jahrhundert mit Hilfe einer angeblich fehlenden Geschichtsschreibung ausfindig gemacht. Generell – so die Auffassung bis in die jüngste Vergangenheit und bei manch einem Indologen bis in die Gegenwart – mangele es Indern an historischem Bewusstsein, weshalb sie auch nicht historisch denken können. Dem orientalistischen Konstrukt (im Sinne Edward Saids) versucht seit den späten 1990er-Jahren ein engagierter Kreis deutscher Südasien-Historiker entgegen zu wirken, eingebunden in eine Reihe, die den ambitionierten Titel „Geschichtsdenken der Kulturen – Eine kommentierte Dokumentation“ trägt. Abgedeckt werden sollen Südasien, China und die islamischen Kernländer. Von den drei Bänden zu Südasien liegen bislang zwei vor, die hier besprochen werden. Den ersten Band der chronologischen Ordnung soll Georg Berkemer zu der hinduistischen, jainistischen und buddhistischen Historiografie noch liefern. Dem schließt sich als zweiter der Band zur „muslimischen Sicht“ an, gemeint ist die Historiografie aus der Feder muslimischer Geschichtsschreiber, gefolgt vom dritten Band zur Geschichtsschreibung im „modernen Südasien“, genau von 1786 bis in die Gegenwart. Besonderes Verdienst der Reihe ist es, dass sie zahlreiche zentrale Texte der südasiatischen Historiografie und ihre Autoren in einer umfangreichen Einleitung nicht nur historisch verortet, sondern sie in Auszügen übersetzt und damit einem breiteren, gleichwohl akademischen Lesepublikum zugänglich macht. In seiner Einleitung zum Band „Die muslimische Sicht“ (S. 9-87) hebt Stephan Conermann auf das „normative muslimische ’Historische Denken’“ ab. Gemeint ist ein historisch-ideologischer Überbau, der durch den Islam religiös vorgegeben ist und Ge- 442 schichte damit in einen heilsgeschichtlichen Interpretationskontext stellt. Dieser ist Reform orientiert im Sinne einer Rückbesinnung auf die ideale Gemeinschaft aller Muslime (umma) zu Zeiten des Propheten Muhammad. Aus diesem Grund wird Geschichte zu einer moralischen Instanz, die Sinn stiftend im Dienste von Religion und Recht steht. Geschichte, vor allem als das vorbildliche Leben historischer Helden, wird zu einer Leitlinie, an der sich Herrscher im Guten orientieren sollen. In seinem Herrschaftsgebiet hat ein guter Herrscher den Wohlstand der Gesellschaft zu mehren, Schaden von ihr zu wenden und freigiebig zu sein. Geschichte beziehungsweise der Geschichtsschreibung kommt folglich eine didaktische Funktion zu, wenn idealisierte Herrschergestalten zum moralischen Maßstab politisch korrekten Handelns werden. Und der Historiker ist der Gelehrte, der aus den Beispielen, die die Geschichte bereit hält, die beste und relevante Auswahl trifft. Conermann macht in der muslimischen Perspektive fünf verschiedene historiografische Diskurse aus (S. 26-31): 1. die imperiale Sicht des Delhi-Sultanats (1206-1526), gefolgt vom Mogul-Reich (1526-1858), 2. den britischen Kolonialismus (1858-1947), 3. den indologischen Orientalismus, der eigentlich ein Bestandteil des Kolonialismus ist, freilich in Europa seine Blüten triebt, 4. indische Erneuerungsbewegungen und beginnende nationale Geschichtsschreibung sowie 5. den Kommunalismus. In der Tat scheint sich dieses Raster für die Geschichte der Historiografie in Südasien zu etablieren, auch wenn mancherlei Kritik daran zu üben ist. Anfangen kann man beim „Kommunalismus“, der unglücklichen Übersetzung von „communalism“. Der Begriff bezieht sich auf die Gemeinschaften von Hindus und Muslimen (gelegentlich werden auch die Sikhs bedacht) und die Konflikt(potenzial)e, die zwischen den einzelnen Religionsgemeinschaften auftreten können. Historiografisch vielleicht ungewollt, wird hiermit indes ein Erbe der kolonialen Vergangenheit fortgeführt, nämlich die Gesellschaften Südasiens primär nach religiösen Kategorien zu ordnen und sie allein als religiöse Gemeinschaften definiert zu sehen. „Communalism“ scheint jedoch eher ein (instrumentalisierbares) Politikum zu sein, als Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart Sammelrez: Geschichte Indiens und seiner Historiografie(n) dass er den Alltag im gegenwärtigen Südasien bestimmt. Im nächsten Abschnitt der Einleitung nimmt Conermann eine sinnvolle historische Kontextualisierung vor. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die gegenseitige Beeinflussung sanskritisch-brahmanischer Historiografie und der indo-persischen Geschichtsschreibung. Keinesfalls hat die Historiografie zwei parallele Entwicklungen genommen, wie Conermann anhand des aktuellen Stands der Forschung aufzeigen kann. Freilich steckt diese noch in den Anfängen, und vor allem gälte es eine stärkere Vernetzung und Verzahnung indologischer und islamwissenschaftlicher Kompetenz zu erwirken, mit entsprechend neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Probleme der Islamisierung der Randzonen Südasiens (Panjab und Bengalen) stellt Conermann anhand Bengalens dar und betont die inklusivistischen wie interaktiven Momente bei den Konversionen zum Islam. Ab dem 15. Jahrhundert entstanden neue Formen unterschiedlicher lokaler Traditionen, die sich zunehmend von der großen Tradition des arabischen und von der Scharia geprägten Islam entfernten, so Conermann. Reformen im Islam des 17. Jahrhundert sowie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert waren in Südasien daher stets auf die Reinigung von synkretistischen Elementen und neuer Einheitlichkeit ausgerichtet, die sich freilich an dem alten Konzept von der ehemaligen Einheit der Muslime orientierte. Bevor die südasiatisch-muslimische Historiografie behandelt wird, erörtert Conermann ausführlich die arabische sowie die persische Historiografietradition (S. 45-67). War die erste als sprachliche Trägerin des offenbarten Wortes auf ein religiöses Prokrustes-Bett gefesselt, war die zweite, bald komplementär zum Arabischen, von dieser „Bürde“ befreit und konnte daher auch andere, säkulare Formen der Historiografie entwickeln. Auf den verbleibenden 16 Seiten werden schließlich die Zeugnisse der südasiatisch-muslimischen Historiografie vorgestellt. Abgesehen davon, dass der Umfang angesichts des Themas sicherlich sehr knapp bemessen ist, fällt auf, dass es sich vielfach um eine literaturgeschichtliche und weniger um eine historiografiegeschichtliche Analyse handelt. Biswei- 2007-3-039 len ist beides nicht recht auseinander zu halten. Zudem wird die Darstellung in das Korsett des „normativen muslimischen ’historischen Denkens’“ geschnürt, das sämtliche Geschichtsschreibung und ihre literarischen Genres als statisch erscheinen lässt – vom 13. bis zum 19. Jahrhundert stets die selben Produkte, die kaum Neuerungen aufweisen. Vielleicht wäre es dem Thema angemessen gewesen, hier stärker die Abweichungen und Brüche zu betonen, als vielleicht unbeabsichtigt die Unveränderlichkeit hervorzustreichen. Ähnliche Kritik ist auch an dem kleinen Bändchen zum Mogul-Reich zu äußern. Zum einen ist es ein unmittelbares Derivat des eben besprochenen Bandes, was sich unter anderem an bisweilen identischen Formulierungen zeigt, aber auch an der stark literaturgeschichtlichen Darstellung erkennbar ist. Von der Geschichte des Mogul-Reiches erfährt das Lesepublikum relativ wenig. Die wirtschaftliche Entwicklung von dreihundert Jahren wird auf gerade einmal acht Seiten abgehandelt und dabei nehmen die sicherlich bis Mitte des 18. Jahrhunderts peripheren europäischen Handelsgesellschaften eine prominente Stellung ein. Überhaupt verwundert, dass die Geschichte des Mogul-Reiches mit der britischen Kolonialherrschaft fortgesetzt wird, beginnend mit Robert Clive und der Schlacht bei Plassey 1757 und endend mit dem 1877 ausgerufenen „Kaiserreich Indien“, als ob die Geschichte des imperialen Indien als Einheitsstaat erst unter der britischen Krone seine Vollendung gefunden hätte und, polemisch zugespitzt, das gegenwärtige Indien nur eine weitere degenerative Erscheinung partikularistischer Interessen ist. Sicherlich unbeabsichtigt setzt Conermann damit die Tradition kolonialer Historiografie fort, die eben genau dieses Legitimationskonstrukt historisch herleitete und zur allein gültigen Geschichtsschreibung Südasiens erklärte. In die gleiche Richtung geht auch die Kritik, die an Gottlobs Band und seiner Periodisierung geübt werden muss. Warum das „moderne Südasien“ ausgerechnet mit den historiografischen Aktivitäten der Briten einsetzt, ist nicht nachzuvollziehen, ebenso wenig, warum die „Moderne“ überhaupt mit der britischen Kolonialherrschaft synchron gesetzt wird. Gottlob wird ebenfalls Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 443 Außereuropäische Geschichte zum unfreiwilligen Opfer britischer Kolonialgeschichtsschreibung, die die Periodisierung von der „klassischen“ (hinduistischen) Geschichte, der „mittelalterlichen“ (muslimischen) Geschichte und der „modernen“ (britischen) Geschichte überhaupt erst postuliert hat. Zu fragen wäre hier, wann und wie wirkungsmächtig die britisch-europäischen Geschichtswissenschaften auf die indische Geschichtsschreibung war und ob dies an allen Orten des Subkontinents respektive Britisch-Indiens spürbar war, kurz: ob in Zeit und Raum eine omnipräsente Historiografie britisch-akademischer Provenienz anzutreffen war bzw. ob die Erzeugnisse indischer Geschichtsschreibung stets einen „nationalen“ Charakter besaßen. Wenn dem nicht so ist, dann schließt sich die Frage nach anderen historiografischen Traditionen an und nicht nur einzelnen Zeugnissen (vgl. S. 98107), die parallel existierten, abgedrängt und überdeckt waren. In diesem wie auch im Band von Conermann macht sich das Fehlen des ersten Bandes von Berkemer schmerzlich bemerkbar, hätte er doch solch offene Fragen zumindest teilweise klären helfen können. Abgesehen von dieser Kritik legt Gottlob eine überaus kenntnisreiche und wohl recherchierte Einleitung vor (S. 19-145), die alle wichtigen Stationen, Texte und Autoren der südasiatischen Historiografie seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert mit sprachlicher und stilistischer Eleganz vorstellt. Die Mehrheit der Autoren waren indes keine Historiker im Sinne von Geschichtswissenschaftlern. Viele religiöse Reformer und politische Agitatoren, Schriftsteller und Zeitungsreporter, Nationalisten und Politiker stellten, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend, eine Agenda für eine indische Geschichtsschreibung auf. Britisch-kolonialer Historiografie, die das Geschichtsbild vom Verfall und Zerfall konstruiert hatte, setzten hindu-nationalistische Autoren bald das Konstrukt einer glanzvollen alten Kultur und ihrer Wiederbelebung entgegen, während muslimische Literaten und Philosophen nach den 1920er-Jahren Geschichte als Ressource für einen islamisch begründeten Nationalstaat entdeckten. Der Geschichtsschreibung in den Nachfolgestaaten BritischIndiens ist ein eigener großer Abschnitt gewidmet (S. 110-145), in dem aktuelle Fragen 444 und Probleme wie Geschichte als Nationalgeschichtsschreibung, das geerbte und internalisierte koloniale Geschichtsparadigma und die Fragmentierung der südasiatischen Geschichte thematisiert werden. Beide Bände besitzen die gemeinsame Schwäche, dass sie, in bester Absicht, einen Beitrag zum besseren Verständnis außereuropäischer Länder und Kulturen leisten wollen, doch mit der Periodisierung einerseits und der Aufteilung in eine religiös definierte „indische“ Gesellschaft andererseits eher stereotype Bilder weiter transportieren, als sie zu dekonstruieren. Daran ändert wenig, dass Conermann auf das Problem hinweist und die gegenseitige historiografische Beeinflussung gelegentlich betont. Nach Foucault und Said sind die Autoren freilich nur Opfer des „orientalistischen Diskurses“, aus dem auszubrechen, wie zu lesen, fast unmöglich erscheint. Andererseits muss freimütig zugestanden werden, dass beide Werke nicht nur eine Menge Literatur verarbeiten und aufbereiten und das Lesepublikum in ein unbekanntes und höchst schwieriges Feld einführen, sondern auch mit einer ganz wesentlichen Stereotype aufräumen, nämlich der, Südasien habe kein historisches Bewusstsein, was an seinen entweder fehlenden (auf Seiten der Hindus) oder kaum vorhandenen (auf Seiten der Muslime) historiografischen Zeugnissen ablesbar sei. Unbestreitbar liegt in dieser Dekonstruktion das größte Verdienst der beiden voluminösen Bücher. Ein Anfang ist folglich gemacht, bleibt abzuwarten, was die künftige Forschung zur Historiografiegeschichte zum indischen Subkontinent leisten wird. HistLit 2007-3-039 / Michael Mann über Conermann, Stephan: Das Mogulreich. Geschichte und Kultur des muslimischen Indien. München 2006. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2007. HistLit 2007-3-039 / Michael Mann über Conermann, Stephan (Hrsg.): Die muslimische Sicht (13. bis 18. Jahrhundert). Frankfurt 2002. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2007. HistLit 2007-3-039 / Michael Mann über Gottlob, Michael (Hrsg.): Historisches Denken im modernen Südasien (1876 bis heute). Frankfurt 2002. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2007. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart D.T. Courtwright: Sky as frontier Courtwright, David T.: Sky as Frontier. Adventure, Aviation, and Empire. College Station: Texas A&M University Press 2006. ISBN: 1-58544-384-0; 284 S. Rezensiert von: Anke Ortlepp, Deutsches Historisches Institut, Washington In seinem jüngsten Buch „Sky as Frontier“ erzählt der Historiker David T. Courtwright die Geschichte der amerikanischen Luft- und Raumfahrt als Aufbruch zu neuen Grenzen, als Beginn eines Zeitalters der Dreidimensionalität. Während das von Frederick Jackson Turner entwickelte frontier-Paradigma in anderen Teilbereichen der amerikanischen Geschichte längst an Faszination verloren hat, ja vor allem von Vertretern der New Western History als anglozentrische Verklärung der Besiedlungsgeschichte des Westens entlarvt worden ist, macht Courtwright den Begriff unverhofft fruchtbar.1 Seine Untersuchung der Ambitionen, Mechanismen und Ziele einer himmelwärts gerichteten amerikanischen Expansionspolitik bettet er ein in technik-, kultur- und wirtschaftshistorische Diskussionen und knüpft an Überlegungen an, die Geschichte der Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert als die Herausbildung eines modernen Imperiums zu verstehen.2 Damit bietet Courtwright eine erfrischend neue Lesart von amerikanischer Luft- und Raumfahrtgeschichte. Den ersten Teil seines Buches („The Age of Pioneers“) gliedert Courtwright in fünf Kapitel. Im ersten legt er sein Verständnis von frontier dar. Er nutzt den Begriff „as an organizational idea for the history of aviation and 1 Vgl. Faragher, John Mack; Turner, Frederick Jackson, Rereading Frederick Jackson Turner. „The Significance of the Frontier in American History“ and Other Essays, New Haven 1999; Faragher, John Mack; Hine, Robert V., The American West. A New Interpretive History, New Haven 2000; Limerick, Patricia N., Something in the Soil. Legacies and Reckonings in the New West, New York 2000. 2 Maier, Charles S., Among Empires. American Ascendancy and Its Predecessors, Cambridge 2006 (rezensiert von Anne Friedrichs: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de /rezensionen/type=rezbuecher&id=8121>); de Grazia, Victoria, Irresistible Empire. America’s Advance Through Twentieth-Century Europe, Cambridge 2005 (rezensiert von Kaspar Maase: <http://hsozkult. geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-4-144>). 2007-3-165 space“, wobei es ihm um die Beschreibung sozialer Prozesses geht (S. 8). Im Folgenden unterscheidet er verschiedene frontier-Typen, lotet die Vergleichbarkeit von Raum und Zeit als frontier-Dimensionen sowie die Synergieeffekte aus, die sich aus der gleichzeitigen Erschließung verschiedener Siedlungsgrenzen ergeben: So habe vor allem die Vehemenz, mit der auch im 20. Jahrhundert Landerschließung und -entwicklung in einem Land von der Größe der USA vorangetrieben worden seien, zu den herausragenden technischen Errungenschaften in der Luftfahrtindustrie geführt und eine vollständige Erschließung des amerikanischen Luftraums nach sich gezogen, da allein das Flugzeug jeden Winkel des Landes erreichbar machte. Kapitel 2 rekapituliert die Erfolge und Misserfolge der Flugpioniere Wilbur und Orville Wright sowie ihrer Konkurrenten Glenn Curtiss und Tony Fokker, bevor Courtwright im dritten Kapitel die Bedeutung des Ersten Weltkrieges für die Entwicklung amerikanischer (und europäischer) Flugzeugtechnologien umreißt. In diesem Krieg, der über weite Strecken ein Stellungskrieg gewesen sei, habe die Verfügbarkeit einer hochgerüsteten Luftwaffe, die sich die USA erst zulegen mussten, entscheidende strategische Vorteile gebracht. Zudem habe der Krieg ein internationales Nachdenken darüber ausgelöst, wem Luftraum gehöre und wie auf internationaler und nationaler Ebene der Zugang dazu zu regeln sei. Courtwright zeigt auch, dass der Entwicklungsschub, den die amerikanische Flugzeugindustrie während des Krieges vollzog, bei Kriegsende ein abruptes Ende nahm, da Regierungsaufträge ausblieben, die Forschung weiterhin ermöglich hätten. Da alternative Finanzierungsquellen fehlten, ging die Flugzeugproduktion binnen dreier Jahre von 21.000 im Herbst 1918 auf 263 Flugzeuge im Frühjahr 1922 zurück (S. 46). Mehr Glück schienen viele Piloten zu haben, die auf Karrieren als Kunstflieger umsattelten und mit Flugshows zu einer wachsenden Flugbegeisterung in der Bevölkerung beitrugen. Erst die Nutzbarmachung des Flugzeugs zum Transport von Post in den 1920er-Jahren, um die es im vierten Kapitel geht, führte zur wirtschaftlichen Erholung der Flugzeug- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 445 Außereuropäische Geschichte industrie.3 Fluggesellschaften wie United Airlines und Pan American Airways (Pan Am) entstanden, die neben Post auch zunehmend zahlende Passagiere beförderten. Einen entscheidenden Anstoß, so argumentiert Courtwright im fünften Kapitel, habe die zivile Passagierluftfahrt schließlich durch die Atlantiküberquerung Charles Lindberghs im Jahr 1927 erfahren. Er habe in allen Teilen der USA erfolgreich Werbung für das Flugzeug als Transportmittel gemacht und gleichzeitig mit seinen und Anne Morrow Lindberghs Erkundungsreisen für Pan Am den Grundstein für ein Netz von Flugstrecken gelegt, das weit über die Vereinigten Staaten hinausreichte. Auch der zweite Teil des Buches („The Age of Mass Experience“) gliedert sich in fünf Unterkapitel. In Kapitel sechs skizziert Courtwright die Entwicklung der Flugreiseindustrie und ihrer kulturellen Erscheinungsformen bis zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Während Ende der 1920er-Jahre viele Amerikaner der zivilen Passagierluftfahrt weiterhin skeptisch gegenüberstanden, überwanden im Verlauf der 1930er-Jahre vor allem Besserverdienende und Geschäftsreisende ihre Flugangst und nutzten das sich schnell vergrößernde Angebot an Linienflügen. Gefördert durch eine amerikanische Bundesregierung, die Subventionen und Exklusivnutzungsrechte für Streckenabschnitte vergab, bauten amerikanische Fluggesellschaften ihre Streckennetze aus, investierten in neueste Technologie und entwickelten ihr Angebot an Serviceleistungen. American Airlines präsentierte 1929 erstmalig einen Spielfilm während eines Fluges, United Airlines stellte als erste Fluggesellschaft Stewardessen zur Betreuung ihrer Fluggäste ein. Der Zweite Weltkrieg, um den es in Kapitel 7 geht, habe diese Entwicklung nur für wenige Jahre unterbrochen, so Courtwright. Zugleich sei die Expansion der Nachkriegsjahre ohne diesen Krieg nicht vorstellbar, der einen weiteren technischen Entwicklungsschub gebracht, zum Ausbau der inneramerikanischen Infrastruktur geführt sowie Millionen Amerikaner an Einsatzzielen oder auf dem Weg dorthin mit dem Flugzeug vertraut gemacht habe. Deshalb sei das 3 Die erste Luftpostverbindung zwischen Washington und New York wurde am 15. Mai 1918 eingerichtet. 446 Fliegen in den Nachkriegsjahrzehnten (Kap. 8 und 9) zum „routine stuff“ geworden (S. 132), die frontier-Gesellschaft der frühen Jahre zu einer heterogenen Masse von Vielfliegern. Courtwright beleuchtet die Professionalisierung der Ausbildung von Piloten und Flugbegleitern sowie neue Kommunikationsformen zwischen Piloten und Fluglotsen als Voraussetzungen, ohne die ein erhöhtes Flugund Passagieraufkommen nicht zu bewältigen waren. Zudem reißt er an, wie sich mit Einführung der Düsenflugzeuge das Flugreiseerlebnis veränderte: Druckregulierte Kabinen, kleine Fenster und größere Reisehöhen schafften Distanz zum überflogenen Territorium und generierten Langeweile, worauf die Fluggesellschaften mit Unterhaltungsprogrammen reagierten. Courtwright zeigt, dass der Ausbau der Beförderungskapazitäten, vor allem durch die Einführung der Boeing 747 in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren, sinkende Preise sowie die Erweiterung der internationalen Streckennetze mit einem enormen Anstieg der Passagierzahlen einhergingen.4 Menschen der unterschiedlichsten sozialen und ökonomischen Hintergründe nutzten das Flugzeug nun ebenso wie alte und junge Amerikaner, Männer und Frauen. Diese Entwicklung sei erst durch die Energiekrise und vor allem die Deregulierungsmaßnahmen des Jahres 1978 vorübergehend ins Stocken geraten. Courtwright beschließt diesen Teil seines Buches mit einer Betrachtung amerikanischer Raumfahrtprogramme (Kap. 10), die sich nach der Eroberung des amerikanischen Luftraums durch das Flugzeug der Erkundung des Weltraums als „final frontier“ zuwandten. Im letzten Teil („The Significance of Air and Space in American History“) geht Courtwright schließlich der Frage nach, welche Bedeutung einer „sky frontier expansion, defined broadly as the growing activity in and above the atmosphere“, beizumessen sei, wenn man „the nation’s character and development“ verstehen wolle (S. 196). Zum einen habe diese Form der Expansion die amerikanische Nation schneller zusammenwachsen lassen, als Eisenbahn und Auto dies per Land4 Während im Jahr 1950 17,3 Millionen Passagiere mit dem Flugzeug reisten, waren es 1970 bereits 153,2 Millionen, und im Jahr 1990 lag ihre Zahl bei 456,7 Millionen. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart M. Davis: Planet der Slums weg vermocht hätten; sie habe zudem zum wirtschaftlichen Boom amerikanischer Regionen wie des sunbelt beigetragen. Zum anderen, so Courtwright, bewirkte die räumliche Expansion die Entstehung eines virtuellen Imperiums, das die weltweite Zirkulation von Menschen und Waren ohne die Last einer kolonialen Infrastruktur möglich machte. Als Schattenseiten erhöhter Mobilität und wirtschaftlicher Kontakte hätten allerdings Menschenhandel, Drogenschmuggel sowie die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu gelten. Courtwright schließt seine Ausführungen mit einem vergleichenden Blick auf die Bedeutung von air power in den militärischen Konflikten der Nachkriegszeit sowie einigen Bemerkungen zur Bedeutung von Terrorakten für die Entwicklung der zivilen Luftfahrt im 21. Jahrhundert. David T. Courtwright stellt viele bekannte Entwicklungen in spannende neue Zusammenhänge und legt mit „Sky as Frontier“ ein Buch vor, dessen Lektüre wärmstens zu empfehlen ist. HistLit 2007-3-165 / Anke Ortlepp über Courtwright, David T.: Sky as Frontier. Adventure, Aviation, and Empire. College Station 2006. In: H-Soz-u-Kult 03.09.2007. Davis, Mike: Planet der Slums. Aus dem Englischen von Ingrid Scherf. Berlin: Assoziation A 2007. ISBN: 978-3-935936-56-9; 248 S. Rezensiert von: Christof Parnreiter, Institut für Geographie, Universität Hamburg Mike Davis, Professor für Geschichte an der University of California, Irvine, hat mit „Planet der Slums“ ein Buch vorgelegt, in dem er mehrere Themen seiner bisherigen Veröffentlichungen zusammenführt. „Planet der Slums“ handelt von Städten und ihren BewohnerInnen, von Unterentwicklung und Ausbeutung sowie von katastrophalen Zuständen aller Art. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist insofern gut gewählt, als der weltweite Verstädterungsgrad gerade um die 50 Prozent oszilliert – was es Davis erlaubt, eine „urbane Wende“ zu konstatieren, die in ihrer historischen Bedeutung vergleichbar sei 2007-3-079 mit der neolithischen Wende oder der industriellen Revolution. Das Buch ist in neun Kapitel gegliedert, die sich allerdings einer klaren Inhaltsbeschreibung entziehen, weil Davis nicht um eine systematische Aufarbeitung bestimmter Themenblöcke bemüht ist. Vielmehr hat er, inspiriert durch den UN-Report „The Challenge of Slums – Global Report on Human Settlements 2003“1 , eine politisch engagierte Streitschrift vorgelegt, in der er dagegen anschreibt, dass die Welt zunehmend „verslumt“. Damit meint Davis zwei ineinandergreifende Prozesse: dass erstens das gesamte zukünftige Wachstum der Menschheit in Städten des globalen Südens stattfinden wird, und dass zweitens diese Städte „weitgehend ohne Industrialisierung, schlimmer noch, ohne jegliche Entwicklung“ wachsen werden (Klappentext). Der Slum, das ist für Davis die Endstation, für eine Milliarde oder mehr Menschen ein realer Ort des Lebens und Sterbens und zugleich Sinnbild für die durch Kolonialismus, Kapitalismus und jüngst Strukturanpassungsprogramme ausgelöste Verarmung weiter Teile der Welt. Der Slum, das ist „eine Zone der Verbannung, ein neues Babylon“ (S. 210). Davis wird von seinen LeserInnen geschätzt, weil er gerade kein distanzierter und allzu differenzierender Beobachter ist, sondern ein wortgewaltiger, parteiischer Ankläger von Unrecht. Mit „Planet der Slums“ bestätigt er diesen Ruf. Auf Basis einer beachtlichen Menge an wissenschaftlicher Literatur, die für das Buch verarbeitet wurde, dokumentiert Davis den „Verrat des Staates“ an den Armen. Nirgendwo (außer vielleicht in China) kümmerten sich die untersuchten Staaten um sozialen Wohnbau oder städtische Infrastrukturen. Schuld am staatlichen Rückzug tragen, und auch hier kann sich Davis auf eine breite Literaturbasis berufen, Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank, die mit Strukturanpassungsprogrammen dafür sorgten, dass „Slums zur unausweichlichen Zukunft nicht nur für arme Migranten vom Land wurden, sondern auch für Millionen alteingesessener Stadtbewohner“ (S. 160). 1 <http://www.unhabitat.org/pmss /getElectronicVersion.asp?nr=1156&alt=1> (25.7.2007). Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 447 Außereuropäische Geschichte Kenntnisreich entlarvt er die bei linken Architekten, NGOs und Weltbank gleichermaßen beliebte Vorstellung, Slums seien Orte der Selbsthilfe und der Beginn einer sozialen Aufwärtsmobilität. Zu verlangen, dass sich die Armen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, sei nicht nur zynisch. Obendrein blieben die Selbsthilfeprogramme Illusion, denn: „Immobilienmärkte haben [. . . ] die Slums zurückerobert, und obwohl sich der Mythos von heroischen Besetzern und kostenlosem Land hartnäckig hält, werden die städtischen Armen immer mehr zu Vasallen der Landbesitzer und Immobilienmakler.“ (S. 69) Davis geißelt die Politik der Slumräumungen als Klassenkampf von oben und zeigt an zahlreichen Beispielen die dahinter stehende Ansicht der Regierenden, Slumbewohner2 seien „Schmutz“ und „menschlicher Ballast“ (S. 111). Und schließlich räumt Davis, gestützt auf zahlreiche Studien, auf mit den „Mythen der Informalität“. In der Empfehlung des peruanischen Geschäftsmannes Hernando de Soto, Informalität zur Norm des Arbeitslebens zu machen3 , sieht Davis „schlicht das Schmiermittel auf der Fahrt in die Hobbes’sche Hölle“ (S. 193). Das Eigenartige an Davis’ Buch ist, dass es trotz seines Engagements und der Detailliertheit nicht überzeugt. Das liegt nicht daran, dass das Buch außer der sehr dichten Kompilation von Daten und Fallbeispielen kaum Neues bietet – wissenschaftliche Studien gekonnt für ein Massenpublikum aufzubereiten ist ein durchaus ehrenwertes Vorhaben.4 Das Problem an Davis’ Buch ist erstens die geringe analytische Schärfe, der allzu grobe Kamm, über den seine Geschichten geschoren werden. Die Fallbeispiele sind anekdotisch aneinandergereiht, ein Potpourri von Missständen und Grausamkeiten aus aller Welt, de2 Die deutsche Übersetzung kennt ausschließlich die männliche Form der in den Slums wohnenden Menschen. 3 De Soto, Hernando, The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World, London 1989 (und öfter). 4 Aus dem Spektrum der wissenschaftlichen Arbeiten sei hier nur verwiesen auf: Roberts, Bryan, The Making of Citizens. Cities of Peasant Revisited, London 1995; Ribbeck, Eckhart, Die informelle Moderne. Spontanes Bauen in Mexiko-Stadt, Heidelberg 2002; Parnreiter, Christof, Historische Geographien, verräumlichte Geschichte. Mexico City und das mexikanische Städtenetz von der Industrialisierung bis zur Globalisierung, Stuttgart 2007 (erscheint Ende September). 448 ren Zweck es nicht ist, ein abwägendes und gerade deshalb überzeugendes Argument zu entwickeln. Davis’ Empirie dient der bloßen Untermalung seiner apokalyptischen Darstellung der Städte des Südens. Nur selten findet man einen relativierenden Einwurf – etwa dahingehend, dass Mexico City und Lima, Johannesburg und Lagos, Manila und Shanghai nicht so einfach in eine Aufzählung gepresst werden können. Häufig wird hingegen die Differenziertheit dem Bedürfnis nach plakativen Superlativen geopfert. So lässt Davis in seiner Übersichtstabelle zu den größten „Megaslums“ (!) der Welt in Mexico City einen solchen „Megaslum“ mit vier Millionen EinwohnerInnen entstehen, den er aus 18 (!) Bezirken formt. Manche davon, wie Nezahualcóyotl, sind in den 1950er-Jahren als informelle Siedlung entstanden und gelten heute zu Recht als konsolidiert (beispielsweise haben 95 Prozent der 1,4 Millionen BewohnerInnen Nezas sowohl Kanalanschluss als auch Fließwasser in der Wohnung oder am Grundstück), während andere erst ab den 1980er-Jahren errichtet wurden. Aber selbst hier passt Davis’ von der UN übernommene Definition von Slum nicht – immerhin haben beispielsweise in Chalco über 80 Prozent der BewohnerInnen unmittelbaren Zugang zu Kanalisation und Fließwasser. Der zweite Grund, warum das Buch einen äußert schalen Eindruck hinterlässt, ist Davis’ Sprache. War er immer schon ein Grenzgänger zum Journalismus, so bedient sich Davis in „Planet der Slums“ gern der negativen und gewalttätigen Superlative. Vom vorangestellten Motto („Slum, Semi-Slum und Superslum [. . . ] dazu haben sich die Städte entwickelt“) bis zum letzten Absatz („Nacht für Nacht rattern Kampfhubschrauber [. . . ] über den engen Gassen der Slumviertel. [. . . ] Jeden Morgen antworten die Slums mit Selbstmordattentaten.“) zieht sich das Skandalisieren der Slums, und gleich manchen JournalistInnen, die nicht an Aufklärung oder Analyse interessiert sind, sondern an der Sensationslüsternheit, bezeichnet Davis Bombay oder Nairobi als „stinkende Kotberge“ (S. 145). Er lässt Bevölkerung und Städte ebenso häufig „explodieren“ wie die Bomben in Bagdad, spricht vom „Urknall der städtischen Armut“ und malt die „Invasion der armen Leute“ oder Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart B. Díaz del Castillo u.a. (Hrsg.): Historia verdadera de la conquista die „Anstürme der Armut“ an die Wand (S. 161, S. 106, S. 159). Schlimmer noch, Davis setzt häufig biologistische Metaphern ein, beispielsweise wenn er von der „riesige[n] Amöbe Mexiko-Stadt“ schreibt, „die sich schon Toluca einverleibt hat“ (S. 11). Als Naturgewalt scheinen ihm auch die vom Land kommenden MigrantInnen zu gelten – sie werden als „Bauernflut“ und „Sintflut“ bezeichnet (S. 16, S. 60). Weil Sprache Wirklichkeiten nicht nur abbildet, sondern auch schafft, steht Davis’ Sprache seinem emanzipatorischen Anliegen diametral gegenüber. Ungeachtet der inhaltlichen Anklage, die Kolonialismus und Kapitalismus, IWF und Weltbank trifft, erzeugt und reproduziert Davis mit seiner Sprache Bilder, die dem rechten Diskurs über „ungesunde Verstädterung“ und städtische Pathologien gleichen. Ja, etwas flüchtigen LeserInnen des Buches mag nicht in Erinnerung bleiben, dass Davis zahlreiche wissenschaftliche Studien und aktuelle Daten zitiert, um zu zeigen, dass die (neue) städtische Armut von den „brutalen Verwerfungen der neoliberalen Globalisierung“ (S. 183) herrührt, sondern bloß das Bild der „wuchernden Städte“ (S. 13). So besteht die Gefahr, dass der malthusianische Pessimismus, den Davis an anderen kritisiert, durch sein eigenes Buch befördert wird. Dass die SlumbewohnerInnen bei allem Elend und aller Ausbeutung, die Davis zu Recht attackiert, auch handelnde Subjekte sind, die Strategien zum Umgang mit der Not entwickeln, welche sich nicht mit „Kriminalität“, „Prostitution“ oder „religiöse[m] Wahn“ abtun lassen, davon schreibt Davis kaum. Und so ertappt man sich bei der Frage, ob Davis das Fragezeichen in einer der Kapitelüberschriften („Eine überschüssige Menschheit?“) bloß aus rhetorischen Gründen gesetzt hat. HistLit 2007-3-079 / Christof Parnreiter über Davis, Mike: Planet der Slums. Aus dem Englischen von Ingrid Scherf. Berlin 2007. In: H-Sozu-Kult 01.08.2007. 2007-3-032 Díaz del Castillo, Bernal; Barbón Rodríguez, José Antonio (Hrsg.): Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Manuscrito Guatemala. México, D.F.: El Colegio de México 2005. ISBN: 968-12-1196-0; IX, 864, 1084 S. Rezensiert von: Felix Hinz, Institut für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte, Universität zu Köln Das vermutlich bedeutendste Einzelereignis der europäischen Expansion in Amerika war die Eroberung der Stadt Tenochtitlán-Mexiko unter der Führung von Hernán Cortés in den Jahren 1519-21, denn es markiert den Schnittpunkt zweier Welten und Epochen. In diesem langjährigen Krieg gegen die Mexica (Azteken) verstand es Cortés, sich der Unterstützung zahlreicher indianischer Verbündeter (Totonaken, Tlaxcaltecen und andere) zu versichern, ohne die er seine militärischen und politischen Ziele nicht hätte erreichen können. Dank umfassender Bemühungen während der letzten Jahrzehnte verfügen wir inzwischen über eine große Bandbreite an Quellen für die Erforschung dieser Ereignisse. Aber die Chronik des Bernal Díaz del Castillo, die „Wahrhaftige Geschichte der Eroberung Neu-Spaniens“ gilt neben den Cortés-Berichten an Kaiser Karl V. und dem 12. Buch der „Allgemeinen Geschichte der Dinge Neu-Spaniens“ von Sahagún weithin als die wichtigste erzählende Einzelquelle zu diesen Geschehnissen. Trotz ihrer Bedeutung lag sie aber bisher nicht in einer Form vor, die den Anforderungen an eine moderne kritische Edition entspricht. Dass diese Lücke nun durch José Antonio Barbón Rodríguez geschlossen wurde, ist eine kleine wissenschaftliche Sensation. Die Ausgabe wurde in lebenslanger Kleinarbeit vorbereitet und konnte in diesem Umfang nur dadurch zur Veröffentlichung gebracht werden, dass die beiden wichtigsten mexikanischen Bildungsinstitutionen, nämlich der Colegio de México (Colmex) und die Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), wie auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hierbei kooperierten. Als Cortés seine Unternehmung mit der Landung an der mittelamerikanischen Küste begann, sagte er sich vom königlichen Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 449 Außereuropäische Geschichte Statthalter auf Kuba los und handelte damit praktisch auf eigene Rechnung. Andere Conquistadorenführer waren schon für weniger hingerichtet worden.1 Cortés stand also unter erheblichem Erfolgs- und Rechtfertigungsdruck, von dem seine schon erwähnten Berichte an Karl V., die schon während des Kriegszuges entstanden, ein beredtes Zeugnis ablegen. Doch seine Version des Geschehens blieb nicht unwidersprochen: Insbesondere Fray Bartolomé de Las Casas erhob schwerste Vorwürfe. Die Eroberungen in Las Indias (Amerika) und also auch diejenige Mexikos, so der Dominikaner, seien „niederträchtig, tyrannisch und hinsichtlich jeden Rechts – natürlich, göttlich und menschlich – verdammt, abscheulich und verflucht“.2 Um ihren Ruf am spanischen Hof hiergegen zu verteidigen und sich ihren Anteil an der Beute zu sichern3 , schrieben außer Cortés noch einige weitere Conquistadoren Mexikos ihre „Erinnerungen“ nieder: Erhalten haben sich die kurzen Schriften der Hauptleute Bernardino Vázquez de Tapia, Andrés de Tapia sowie des später in den geistlichen Stand getretenen Fray Francisco de Aguilar OP. Die Chronik des Bernal Díaz del Castillo stellt in diesem Rahmen einen besonderen Fall dar. Zum einen übertrifft sie die übrigen Conquistadoren-Berichte bei Weitem an Umfang und Anschaulichkeit. Zum anderen und für die Beurteilung des Quellenwertes erheblicher: Sie ist zugleich die Augenzeugenchronik, die mit dem größten zeitlichen Abstand zum Geschehen entstand, nämlich erst 57 Jahre später. Erst im hohen Alter von über 70 Jahren – als kaum einer der Conquistadoren Mexikos mehr lebte - entschloss sich Díaz del Castillo zu schreiben und erschuf ein geradezu „homerisches“ Werk über menschliche Größe und Schwäche.4 Als er die Feder nieder1 Beispielsweise 1514 Exekution Vasco Núñez de Balboas durch Pedrarias Dávila, dem Statthalter von Tierra Firme, mit dessen Flotte vermutlich auch Bernal Díaz del Castillo in die Neue Welt kam. 2 Las Casas, Bartolomé de, Obras completas, hrsg. von Ramón Hernández, Lorenzo Galmés u.a., Madrid 198898 (14 Bd.e), Bd. 10: „Tratados de 1552“, 1992, S. 32 (Übersetzung FH). 3 Meist erhofften sie sich eine Encomienda, d.h. die Verfügungsgewalt über eine festgelegte Anzahl Indianer bestimmter Orte. 4 Ramíres Cabañas, Introducción, in: Díaz del Castillo, Bernal: Historia verdadera de la Nueva España, hrsg. von Joaquín Ramíres Cabañas, México 1939 (2 450 legte, lebten nur noch vier seiner ehemaligen Kameraden. War dies ein Zufall, oder wollte Díaz del Castillo es ausnutzen, dass seiner Darstellung nun kaum noch jemand würde widersprechen können? Keiner der anderen Berichte erwähnt je seinen Namen, während er wiederum behauptet, bei allen wichtigen (und vielen unwichtigen) Ereignissen dabeigewesen zu sein. Ähnliche Merkwürdigkeiten kulminieren letztlich in der spannenden Frage: War Bernal Díaz der, für den er sich ausgibt? Ist seine Historia verdadera tatsächlich so wahrhaftig – oder ein geniales Konglomerat aus Geschichte und autobiografischer Fiktion? Als Bernal Díaz seine Chronik 1568 beendet hatte, herrschten unter König Philipp II. Zeiten publizistischer Repression. Er selbst gibt vor, den Bericht nur für seine unmittelbaren Nachkommen verfasst zu haben. Der erste Druck erschien jedenfalls erst 1632, also lange nach dem Tod des greisen Autors. Erhalten haben sich aus der Zeit bis dahin mehrere Manuskripte seines Werks, von denen das Ms. Remón durch gewisse Interpolationen von Merzedariermönchen die Bedeutung des Feldpriesters Olmedo aufwertet, der dem selben Orden angehörte. Das Ms. Guatemala hingegen gilt allgemein als das authentischste und scheint weitgehend von Bernal Díaz´ eigener Hand geschrieben. Es ist daher eben dieses Ms. Guatemala, auf das sich die meisten neueren Ausgaben aus gutem Grund stützen. Ein großes Publikationsproblem bestand von Anfang an im Umfang der Historia verdadera: Obwohl aufgrund der fesselnden Schreibweise und des packenden Gegenstands zahlreiche populäre Editionen erschienen (sogar auf deutsch5 ), sind diese meist gekürzt. Die letzten wissenschaftlich nennenswerten waren diejenige von Joaquín Ramíres Cabañas (México, Editorial Pedro Robredo, Bd.e), Bd. 1, 1939, 24. Facsimile unter (abgerufen am 09.06.2007): Band 1: http://www.cervantesvirtual.com/servlet /SirveObras/01715418982365098550035/index.htm und Band 2: http://www.cervantesvirtual.com/servlet /SirveObras/05819511922437539832268/index.htm. 5 Die neueste Übersetzung ist: Díaz del Castillo, Bernal: Die Eroberung von Mexiko, hrsg. u. bearbeitet von Georg A. Narciß, Frankfurt am Main, 6. Auflage 1988. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart B. Díaz del Castillo u.a. (Hrsg.): Historia verdadera de la conquista 19396 ) und Carmelo Sáenz de Santa María (Madrid, CSIC, 19827 ), die sich bereits „edición crítica“ nennt, es aber eigentlich nicht ist. Sie hat gleichwohl eine Stärke: Sie bietet nämlich zweispaltig einerseits eine „wiederhergestellte“ Urfassung des Ms. Remón und andererseits das Ms. Guatemala. Weicht letzteres von ersterem ab, so ist die entsprechende Passage kursiv gedruckt. Ferner ist die Vorstudie dieser Ausgabe zu loben, die sehr übersichtlich, knapp und klar die Geschichte der verschiedenen Manuskripte und Editionen darlegt. Aber es gibt eben auch noch weitere Manuskripte, und eine wirklich kritische Ausgabe dieses zentralen Werks zur Eroberung Mexikos in einem Band stand bisher noch aus. Diese schmerzliche Lücke vermochte Barbón Rodríguez mit seiner meisterlichen Neuausgabe auf der Grundlage des Ms. Guatemala nun endlich zu schließen. Was die vorherigen Editionen trotz ihrer sonstigen Vorzüge an wissenschaftlicher Akribie zu wünschen übrig ließen, macht Barbón nun mehr als wett. Er bietet nicht nur den bisher fehlenden kritischen Apparat auf Grundlage des Ms. Guatemala (S. 1-848), sondern auch eine Studie zur Biografie des Bernal Díaz del Castillo (S. 3-41), eine sehr ausführliche zu den Manuskripten inklusive Facsimileproben (S. 43-111), zur Grammatik (113-141), zur Einordnung in den historiografischen Kontext (S. 143-230) und zu Indigenismen in der Sprache des Díaz del Castillo (S. 231-251). Doch damit nicht genug: Das anschließende Glossar (S. 253-489) mit ausführlichen Erklärungen und Verweisen sucht auch in kritischen Ausgaben seinesgleichen. Dasselbe gilt für das folgende umfangreiche Personen- (S. 493-724) und Ortsregister (S. 725-814). Da Bernal Díaz in seiner Darstellung vor allem die Leistungen der Mannschaften betont, ist seine Historia verdadera die erste Adresse, wenn man Einzelschicksale und Details über sonst fast nirgends erwähnte Teilnehmer der Conquista Mexikos sucht – eine regelrechte Fundgrube. Barbón nennt stets Kapitelangaben wie Seiten und gibt unbeeindruckt von dem teilweise erheblichen Mehraufwand die Zusammenfassung der unter den Verweisen zu finden6 Vgl. Anmerkung 4. 7 Díaz del Castillo, Bernal: Historia verdadera de la Nue- va España, hrsg. von Carmelo Sáenz de Santa María, Madrid 1982. 2007-3-032 den Informationen.8 Indianer werden gesondert aufgeführt, was bei entsprechenden Fragestellungen sehr hilfreich sein kann, da ihre Namen nach der christlichen Taufe oft denen der Conquistadoren verwirrend ähnelten oder sogar völlig glichen. Anschließend bietet Barbón im vorliegenden Band noch die Transkriptionen von Dokumenten zu Bernal Díaz del Castillo und seinen Nachkommen (S. 815-1064). All diese durch eine einem Lebenswerk gleichkommende Fleißarbeit geschaffenen Zusammenstellungen werden zweifellos den folgenden Historikergenerationen zur Conquista Mexikos eine reichhaltige und verlässlich erarbeitete Quelle sein. In seiner Studie zur Lebensgeschichte des Bernal Díaz del Castillo greift Barbón ein umfangreiches und für das Verständnis des Werks wichtiges Thema auf. Und hier gelingt es ihm, Bernal Díaz erstmals eine wirklich bedeutende biografische Lüge nachzuweisen: Es stimmt nämlich nicht, dass er an der Expedition unter Grijalva 1518, die unmittelbar vor Cortés die Küste Mexikos erkundete, teilgenommen hat (S. 12), wie er behauptet (cap. VIII-XVI , S. 25-40). Das ist eine bedeutsame Entdeckung, die beweist, dass der Historia verdadera nicht so bedingungslos zu trauen ist, wie Historiker dies bislang oft tun. Leider problematisiert Barbón diese Entdeckung nicht weitergehend – was ihn freilich sehr gut zu weiteren 500 (gewiss spannenden) Seiten verführt haben könnte, die den Rahmen dieser bereits hochambitionierten Ausgabe vermutlich endgültig gesprengt hätten. Er lenkt hiermit aber die Aufmerksamkeit wieder auf alte, wichtige Forschungsfragen, z. B.: Warum hat ausgerechnet Bernal den Brief der Truppe an den Kaiser nicht unterschrieben wie praktisch alle anderen Conquistadoren, und behauptet trotzdem, es getan zu haben?9 Und 8 Eine Kostprobe: „Solís Casquete, Pedro CLXXIV.............634-08 CLXXIX.............662-02 CCV....................780-02 Soldado de Cortés. En la expedición a las Hibueras se le ahogó el caballo por lo cual ´hazía bramuras ... e maldeçía a Cortés e su viaje´. ´Era algo arrebataquistiones; murió de su muerte en Guatimala´.“ (S. 671) 9 Carta del ejército de Cortés al emperador (Okt.1520), in: Martínez, José Luis (Hg.), Documentos cortesianos, México D.F. 1992-93 (3 Bd.e), Bd. 1, 1993, 156-163; Díaz Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 451 Außereuropäische Geschichte schließlich, provokant: War er überhaupt ein Augenzeuge der Conquista?10 Fazit: Die umfassende aber dennoch peinlich genaue Arbeitsweise ebenso wie die scharfsinnigen Studien der Neuausgabe der Historia verdadera verlangen uneingeschränkten Respekt. Dass dieses Kompendium von insgesamt über 1900 Seiten, dank Dünndruck in einem einzigen festen Band, nur etwas mehr als 100 Euro kostet, muss für den Interessierten als Glücksfall betrachtet werden. Schade nur, dass die Distribution, vermutlich als Resultat aus dem Gemeinschaftsunternehmen so vieler verschiedener Institutionen, zu verhindern droht, dass dieses Werk die Verbreitung in den Universitätsund Privatbibliotheken findet, die sie ohne jeden Zweifel verdient hat. Die zweispaltige Präsentation von Sáenz de Santa María wird weiterhin nützlich sein, doch die übrigen Editionen der Historia verdadera sind nun wissenschaftlich obsolet geworden. Hut ab und danke für diese prachtvolle Ausgabe, Herr Barbón! HistLit 2007-3-032 / Felix Hinz über Díaz del Castillo, Bernal; Barbón Rodríguez, José Antonio (Hrsg.): Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Manuscrito Guatemala. México, D.F. 2005. In: H-Soz-u-Kult 12.07.2007. García, María Elena: Making Indigenous Citizens. Identity, Education, and Multicultural Development in Peru. Stanford: Stanford University Press 2005. ISBN: 0-8047-5014-9; 213 S. Rezensiert von: Ulrich Mücke, Historisches Seminar, Universität Hamburg del Castillo: Historia verdadera, cap. LIV, 2005, 132.) del Castillo wäre nicht der Einzige, der sich eine Conquistadoren-Biografie angedichtet hat: Ein bekannter Fall ist der angebliche Augenzeugenbericht eines „anonymen Conquistadors“, der mit großer Wahrscheinlichkeit vom Venezianer Alonso de Ulloa geschrieben wurde, der nie in Mexiko gewesen ist. (Vgl. Gómez de Orozco, Federico, in: ’Conquistador anónimo’, Relación de algunas cosas de la Nueva España, hrsg. von Jorge Gurría Lacroix, México D.F. 1961 2431). - Viele der sich zu Díaz del Castillo ergebenen Fragen stellt: Brooks, Francis J., Motucuzoma Xocoyotl, Hernán Cortés, and Bernal Díaz del Castillo: The construction of an arrest, in: Hispanic American Historical Review 75, 2 (1995), 149-183. 10 Díaz 452 Ganz im Gegensatz zu den Träumen und Hoffnungen der Modernisierungstheoretiker der 1960er- und 1970er-Jahre ist das „Indianische“ nicht aus den Gesellschaften Mesoamerikas und der Anden verschwunden, sondern spielt für die Artikulation politischer und sozialer Interessen eine wachsende Rolle. Dies ist en détail für Mexiko, Guatemala, Ecuador und Bolivien beschrieben worden. Peru dagegen scheint in diesem Kontext eine Ausnahme zu bilden. Hier haben sich lediglich auf lokaler Ebene starke Indianerorganisationen gebildet, während in der nationalen Politik solche ethnischen Bündnisse keine größere Rolle spielen. María Elena García nimmt in ihrem Buch diesen Sachverhalt zum Ausgangspunkt, um danach zu fragen, wie und ob sich indianische Bewegungen in Peru finden lassen. Das zentrale Argument ihres Buches lautet, dass sich die These von Perus Ausnahmestellung (insbesondere im Vergleich zu den Nachbarländern Bolivien und Ekuador) nicht aufrecht erhalten lässt, wenn man den Fokus von der nationalen Ebene auf die lokale und transnationale verlagert. Empirisch beschäftigt sich García vor allem mit der lokalen Ebene und hier speziell mit zwei Gemeinden in der Nähe von Cuzco, der alten inkaischen Hauptstadt, welche heute vor allem vom Tourismus lebt. Auseinandersetzungen über Schulerziehung und Sprachunterricht dienen ihr als Beispiele, anhand derer sie die Existenz indianischer Bewegungen auch für Peru nachzuweisen versucht. Sieht man von Einleitung und Zusammenfassung ab, gliedert sich das Buch in fünf Kapitel. Die ersten beiden bieten historische Abrisse mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zum einen wird die Geschichte der Jahre seit 1980 beschrieben, in denen die indianische Bevölkerung in besonderer Weise dem Terror des Staates und der Guerillaorganisation des „Leuchtenden Pfades“ ausgesetzt war. Gerade dieser Terror, so argumentieren einige Autoren, habe verhindert, dass sich in Peru am Ende des 20. Jahrhunderts eine starke indianische Bewegung habe formieren können. Das zweite einleitende Kapitel beschreibt die Geschichte vom „Indigenismo“ der 1920er-Jahre zur „Interculturalidad“ der 1990er-Jahre. Während mit „Indi- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart I. L. Garcia-Bryce: Lima’s Artisans and Nation Building in Peru genismo“ der mittlerweile recht kritisch betrachtete städtische Diskurs über die Landbevölkerung bezeichnet wird, versteht Elena García unter „Interculturalidad“ nicht nur das Nebeneinander verschiedener Kulturen, sondern ihr Miteinander, das sich durch gegenseitigen Respekt und Unterstützung auszeichne. „Interculturalidad“ ist also die Utopie von einem besseren Peru, wobei nicht immer ganz klar ist, inwieweit García meint, dieses bessere Peru sei schon in Ansätzen vorhanden. Die drei zentralen Kapitel des Buches umfassen zusammengenommen keine 80 Seiten. Hier wird zunächst die These des Widerstandes auf Gemeindeebene (Kap. 3), dann die Auseinandersetzung von Indianern mit Nichtregierungsorganisationen und dem Staat (ebenfalls auf Gemeindeebene – Kap. 4) und die Einbindung von Indianern auf transnationaler Ebene vor allem durch Intellektuelle (Kap. 5) diskutiert. Empirisch stark ist dabei vor allem die Beschreibung der lokalen Ebene. Hier werden von lokalen Akteuren eigene Positionen in Auseinandersetzung mit überlokalen Einrichtungen und Akteuren formuliert. Die transnationale Einbindung indianischer Bewegungen wird dagegen weniger plausibel begründet, beschäftigt sich García hier doch mit Personen, die nur bedingt als „indianisch“ bezeichnet werden können bzw. sich selbst so bezeichnen. Garcías Überlegung, indianische Bewegungen nicht auf der nationalen, sondern der lokalen Ebene zu suchen, ist originell und kann tatsächlich die These von der peruanischen Ausnahme in Frage stellen. García gelingt es allerdings kaum, ihr Hauptziel zu erreichen, nämlich zu zeigen, dass solche lokalen indianischen Bewegungen existieren. Statt dessen verdeutlicht sie, dass auf Gemeindeebene Interessen von Gemeindeangehörigen formuliert werden. Inwiefern sich diese aber als „Indianer“ definieren und dies tun, um ihre Interessen zu befördern, bleibt unklar. Es könnte sich sogar als unmöglich erweisen, einen solchen Nachweis von lokalen indianischen Bewegungen zu führen, weil die Vorstellung von „Indianertum“ eben eine überlokale ist. Der Versuch Garcías zu zeigen, dass Peru sich in spezifischer Form in die Entwicklungen einreihen lässt, welche in Mexiko, Guatemala, 2007-3-047 Ekuador und Bolivien der letzten Jahrzehnte beobachtet werden können, ist daher nur teilweise gelungen.1 Der Ertrag des Buches besteht daher vor allem darin, am Beispiel Perus danach zu fragen, was denn überhaupt unter indianischen Bewegungen verstanden werden kann. HistLit 2007-3-037 / Ulrich Mücke über García, María Elena: Making Indigenous Citizens. Identity, Education, and Multicultural Development in Peru. Stanford 2005. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2007. Garcia-Bryce, Inigo L.: Crafting the Republic. Lima’s Artisans and Nation Building in Peru, 18211879. Albuquerque: University of New Mexico Press 2004. ISBN: 0-8263-3392-3; 220 S. Rezensiert von: Thomas Krüggeler, Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), Bonn This book on urban Lima during some critical decades of the nineteenth century represents another study that concentrates on the development of civic society, political culture, and nation building in early-republican Peru. With his focus on artisans as part of a middle sector of the urban society, Garcia-Bryce presents a valuable addition to the chain of books published in recent years.1 The author describes the transformation Lima artisans experienced from the late-colonial period, when 1 Für überzeugendere Antworten auf diese Frage vgl.: Büschges, Christian; Pfaff-Czarnecka, Johanna (Hrsg.), Die Ethnisierung des Politischen. Identitätspolitiken in Lateinamerika, Asien und den USA, Frankfurt am Main 2007. 1 Among others I should mention: Mc Evoy, Carmen, La Utopia Republicana. Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana (1871 – 1919), Lima 1997; Thurner, Mark, From Two Republics to One Divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham 1997; Parker, David, The Idea of the Middle Class. White Collar Workers and Peruvian Society, 1900-1950, University Park 1998; Chambers, Sarah C., From Subjects to Citizens. Honor, Gender, and Politics in Arqeuipa, Peru 1780 – 1854, University Park 1999; Walker, Charles F., Smoldering Ashes. Cuzco and the Creation of Republican Peru, Durham 1999; de Losada, Cristóbal Aljovín, Caudillos y Constituciones. Peru 1821 – 1845, Lima 2000, and Mücke, Ulrich, Political Culture in Nineteenth-century Peru. The Rise of the Partido Civil, Pittsburgh 2004. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 453 Außereuropäische Geschichte they were organized in guilds and – at least more affluent masters – had a thorough corporate social identity, to political players of the second half of the nineteenth century, who had adapted to republican principles and the liberal discourse. The presentation of this process of political and social transformation is not entirely new, but the author does an excellent job in applying recently developed theoretical considerations and his own research on the racially and economically rather diverse artisan sector of a major Latin American city. According to Garcia-Bryce by the 1870s Lima artisans were organized in numerous mutualaid-societies and political associations, which made them a key political player of the urban society. Traditionally labour historians paid little attention to artisans, and even less to master craftsmen. For them labour history began only with industrialization and the emergence of trade unions and it was closely linked to class struggle. This book does not only bridge the period between the times of pre-industrial urban artisan production and the 1870s when the industrial age emerged gradually in Latin America, it also makes a major contribution by linking labour history to more recent trends in political and social history (emphasis on nation building, civil society, forms of political participation, etc.) and by turning artisans into influential political players of post-colonial Latin American cities. GarciaBryce argues that artisans actively and forcefully adapted to post-colonial republican rule and even to the liberal discourse that gained strength in the early 1850s. Artisans did not only manage to adapt to political and economic change, partially due to their organizational strength, they turned into a powerful force in the political arena of Lima. For GarciaBryce Lima artisans show, how significant were what he calls „urban middle sectors“ for the process of nineteenth-century nation building in Peru. Chapter one of this study concentrates on Lima artisans during the late-colonial period, when they were organized in guilds and brotherhoods. At that time the Bourbon Reforms brought more state control over their organizations and a first light wave of liberal threats to their corporate identity. Guilds did 454 not disappear with Independence. As shown in chapter two, guilds lose their political and economic significance only gradually and somewhat parallel to artisans’ unsuccessful protectionist demands. The first three decades of the Republican period were particularly difficult for craftsmen, because the process of leaving behind corporate ideas and coming to terms with the liberal discourse of the 1850s meant a major challenge to them. The book demonstrates this transition and shows how craftsmen learnt to address Congress and to appeal to public opinion. Craftsmen understood that at the peak of the guano boom, simple protectionist demands would hardly find open ears in Lima. In chapter three and four – in my view the key chapters of this study – the author traces very nicely the transition of artisans into respectable citizens particularly since the 1850s. He argues that the liberal notion of turning the popular sector into productive workers and responsible citizens coincided with the artisans’ demand for government support and access to education. For that reason politicians did not only establish trade schools, they even organized national trade exhibitions, of which artisans eagerly took advantage to demonstrate their skills and to underpin their respectability. Politicians were aware of artisans’ important role as supporters and craftsmen knew how to take advantage of that power. Since the 1860s mainly master artisans were organized in mutual aid societies, which served as a place to strengthen their common identity and as their platform of public representation at the same time. Still, artisan societies did only represent a certain part of the entire artisans’ sector. Poor craftsmen and journeymen clearly drifted towards the emerging working class. In the fifth chapter the author addresses the issue of Lima artisans and social class. He argues that during the 1870s the artisans’ press starts to define artisans as part of the working class. However, this class is by no means revolutionary. On the contrary, artisans carefully avoid to create any sort of social conflict, instead they portrayed themselves as being prepared to contribute to the education of the plebeian sector and to the progress of the Peruvian nation. Garcia-Bryce presents a thorough study Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart W. O. Gardner: Avertising Tower which is solidly based on archival evidence and on clearly stated theoretical considerations. It is perfectly comprehensible and justified to finish this study in 1879 with the War of the Pacific. The author succeeds in presenting Lima artisans as important political players particularly of the second half of the nineteenth century. The result of his research is that in fact he does not only present the history of Lima artisans, instead he gives excellent insights into the urban political culture of the Peruvian capital. However, in a sense, it leaves the reader with a number of questions: What happens to the respectable artisans of Lima during the early-twentieth century? Do they turn into entrepreneurs? Do they maintain their level of respectability? Perhaps a future book will answer these questions and continue where Garcia-Bryce left us with his study. HistLit 2007-3-047 / Thomas Krüggeler über Garcia-Bryce, Inigo L.: Crafting the Republic. Lima’s Artisans and Nation Building in Peru, 1821-1879. Albuquerque 2004. In: H-Soz-uKult 19.07.2007. Gardner, William O.: Advertising Tower: Japanese Modernism and Modernity in the 1920s. Cambridge: Harvard University Press 2006. ISBN: 978-067402129-7; 349 S. Rezensiert von: Marco Gerbig-Fabel Der US-amerikanische Kulturwissenschaftler William O. Gardner legt mit seiner Arbeit „Advertising Tower. Japanese Modernism and Modernity in the 1920s“ eine beeindruckende, über die engen Fächergrenzen der Japan- bzw. Ostasienwissenschaften hinaus bedeutsame kulturgeschichtliche bzw. kulturwissenschaftliche Analyse der japanischen Moderne vor. Gardner positioniert seine Arbeit dabei am Kreuzungspunkt dreier, einander überlagernder Forschungsfelder: der modernen japanischen (Kultur-)Geschichte, der Mediengeschichte sowie der transnationalen bzw. globalen Geschichte und spiegelt so zentrale gegenwärtig in der Diskussion befindliche kulturwissenschaftliche Themen- und Fragestellungen. Dadurch gelingt es ihm, sei- 2007-3-143 ne ansonsten eher oder möglicherweise sogar ausschließlich der modernen japanischen Geschichtsschreibung zugeordneten Analyse der japanischen Avantgarde bzw. des japanischen Modernismus – gemeint ist jene literarische „Schule“, welche die Subjektivität der Wahrnehmung in den Mittelpunkt stellt – über enge disziplinäre Grenzen hinaus interessant und anschlussfähig zu machen. Im Mittelpunkt der gut zweihundert Seiten umfassenden Analyse Gardners steht das literarische Werk des japanischen Avantgardisten Hagiwara Kyôjirô (1899-1938) sowie der – von Gardner dem japanischen Modernismus zugerechneten –Dichterin Hayashi Fumiko (1903-1951). Ausgehend von der These, dass die Themen und formalen Strategien dieser beiden Autoren auf besondere Weise die sozialen und medialen Transformationsprozesse im Japan der 1920er-Jahre spiegeln, beschreibt und analysiert Gardner die Arbeiten der beiden Künstler zugleich als Produkt und Zeugnis einer spezifisch japanischen Modernität. Seine Analyse kreist dabei um die Begriffe bzw. Denkfiguren des „Modernen“ (jap. modan) sowie jenen der „Massen“ (jap. taishû), deren (Be-)Deutungen seiner Meinung nach nicht nur die Arbeiten der beiden erwähnten Autoren durchziehen, sondern zudem auf historisch spezifische Weise die grundlegende Transformation Japans und vor allem Tokyos nach dem großen KantôErdbeben vom 1. September 1923 beleuchten. Gardner deutet dieses verheerende Erdbeben, das weite Teile der japanischen Hauptstadt zerstörte und mehr als einhunderttausend Todesopfer forderte, dabei nicht als Zäsur, sondern vielmehr als einen Moment der Beschleunigung und Verdichtung, durch den zahlreiche Entwicklungen, die in den frühen 1920er-Jahre ihren Anfang nahmen massiv forciert wurden. Mit dieser Deutung distanziert sich Gardner auf wohltuende Weise von jenen in erster Linie nationalgeschichtlichen Interpretationsstrategien, welche die so genannte TaishôZeit (1912-1926) und mit ihr die Geschichte der japanischen Moderne als die Geschichte einer – globalgeschichtlich singulären – japanischen Modernität entwerfen. Unter Bezug auf die Arbeiten von u.a. Dipesh Chakrabarty gelingt es Gardner auf diese Wei- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 455 Außereuropäische Geschichte se nicht nur, seine exemplarische Untersuchung und Diskussion der japanischen Avantgarde bzw. des japanischen Modernismus von den etablierten historiographischen Deutungsmustern abzusetzen. Durch den Verweis auf aktuelle Diskussionen aus dem Umfeld der transnationalen Geschichtsschreibung, der Mediengeschichtsschreibung sowie einer neuen ostasiatischen Geschichtsschreibung verortet Gardner seine Untersuchung darüber hinaus in einem explizit globalen bzw. transnationalen Bezugsrahmen. So ist die Geschichte der japanischen Moderne für ihn notwendigerweise als Teil transnational konfigurierter Kommunikations- und Ereigniszusammenhängen zu denken und daher auch ihre Erforschung und Diskussion mittels interpretativer Apparaturen zu leisten, die nicht von vornherein den vermeintlichen Ausnahmecharakter der japanischen Moderne behaupten bzw. festschreiben. Ausgehend von dieser theoretischmethodischen Kontextualisierung positioniert Gardner seine Untersuchung innerhalb eines internationalen kulturwissenschaftlichen Diskussionszusammenhangs, der seit einiger Zeit das Verhältnis von Medialität und Historizität oder die Beziehung von Modernität und Transnationalität – und dies häufig in einer interdisziplinären Perspektive – in den Blick zu nehmen versucht. Er belegt damit auf eindrucksvolle Weise nicht nur seine eingehende Kenntnis aktueller kulturwissenschaftlicher Theorien und Methoden, sondern führt dem Leser darüber hinaus die Anschlussfähigkeit einer neuen – von vornherein am Kreuzungspunkt verschiedener kulturwissenschaftlicher Diskussionen positionierten – ostasiatischen Kulturgeschichtsschreibung vor Augen. Einen weiteren Distinktionsgewinn erzielt Gardner dadurch, dass er das seiner Untersuchung zugrunde liegende Materialsample nicht als historischen Beleg an sich, sondern als mediale Spur eines historisch spezifischen Kommunikations- und Transformationsprozesses beschreibt und analysiert. Vor dem Hintergrund der medialen und (transport-)technischen Revolution des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts konzentriert Gardner seine Untersuchung auf die Identifikation jener Techniken und Prozeduren, wel- 456 che die Transformation – vor allem der japanischen Hauptstadt – in den 1920er-Jahren realisierten und repräsentierten. Ausgehend von einer Arbeit Hagiwaras aus dem Jahr 1925 richtet Gardner seinen Blick auf jene medialen Apparaturen, diskursiven Formationen und sozialen Verwerfungen, welche die Transformation Tokyos, vor allem nach den verheerenden Zerstörungen des Kantô-Erdbebens von 1923, prägten. Gardner folgt dabei der Hypothese, dass die avantgardistischen bzw. modernistischen Arbeiten Hagiwaras und Hayashis nicht als Nachahmungen westlicher Vorläufer oder Vorbilder zu deuten sind, sondern als aktive Reaktion auf die massiven Veränderungen im Bereich der (Massen-)Medien und der (Massen-)Kommunikation, des (öffentlichen) Transports und der (urbanen) Architektur, sowie des (Massen-)Konsums und der (Massen-)Unterhaltung. Er interpretiert die Arbeiten Hagiwaras und Hayashis damit nicht als literatur- bzw. kulturgeschichtlichen Beleg für die Transformation der japanischen Hauptstadt als solches, sondern als kommunikationsgeschichtliche Indikatoren für die sich – vor allem ab 1923 – in kürzester Zeit vollziehende soziale und (massen-)mediale Transformation Tokyos und dies nicht nur in Bezug auf Tokyo selbst, sondern ebenso in Bezug auf dessen urbane und koloniale Peripherie. Gardner rekonstruiert und analysiert damit auf exemplarische Weise die Formen und Funktionen eines zeitspezifischen Medienensembles, welches durch die Expansion der Print-, Film- und Musikindustrie sowie dem Auftreten des Radios als einem neuen (potenziellen Massen-)Medium gekennzeichnet war. Gardner ist mit seiner exemplarischen, kulturgeschichtlichen Analyse der japanischen Avantgarde bzw. des japanischen Modernismus ein theoretisch und methodisch fundierter Beitrag zur Geschichte der japanischen Moderne gelungen. Indem er sich und seine Materialien von den etablierten historiographischen Deutungsmuster und Kategorien der Taishô-Zeit distanziert und sich weigert, die japanische Moderne als Modernisierung bzw. Verwestlichung zu denken, gelingt ihm eine emanzipierte und von eurozentrischen Interpretationsstrategien abrückende Unter- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart Ph. Gassert u.a.: Kleine Geschichte der USA 2007-3-177 suchung und Diskussion japanischer Modernintät. Durch die Berücksichtigung und Bezugnahme auf aktuelle kulturwissenschaftliche Methoden, Theorien und Diskussionen gelingt es ihm jene – wie sich mit Bezug auf Ernst Bloch argumentieren ließe – Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in den Blick zu nehmen, welche das Phänomen der Modernität in ihrem Kern und damit über regionale, kulturelle und nationale Grenzen hinweg auszeichnet und auf diese Weise – jenseits nationalgeschichtlicher Normierungen – die Möglichkeit zur Eröffnung interdisziplinärer Perspektiven schafft. Geschichtswissenschaft unterrepräsentiert ist, kann man den neuen Band nur begrüßen. Die Autoren wollen auch explizit „historische Orientierung“ (S. 11) für ein Gegenwartsinteresse an den USA bieten. Der Band ist sehr einleuchtend in vier Teile gegliedert: die Epoche von der ersten permanenten Besiedlung durch die Engländer 1607 bis zur Verschärfung der Konflikte zwischen Mutterland und Kolonien 1763, die Revolutionszeit 1763 bis 1800, das 19. Jahrhundert sowie das 20. und 21. Jahrhundert. Die ersten beiden Teile stammen aus der Feder von Mark Häberlein, das 19. Jahrhundert von Michael Wala und die Zeit bis zur Gegenwart von Philipp Gassert. Damit sind alle Teile von Spezialisten verfasst. Sehr begrüßenswert ist, dass der Zeit von 1607 bis 1800 genauso viel Platz eingeräumt wurde wie den beiden späteren Epochen, da in der Zeit der Besiedlung und der Gründung der amerikanischen Republik viele Weichen für die Entwicklung der USA gestellt wurden. Der Schwerpunkt des Bandes liegt im Allgemeinen auf der (Außen)Politik. Es sind jedoch leichte Unterschiede zwischen den Autoren festzustellen. Mark Häberlein legt viel Wert auf Sozial- und Regionalgeschichte sowie die Einwanderung, Michael Wala betont die Außenpolitik, während Philipp Gassert ein Drittel seiner Unterkapitel der Kulturgeschichte im weiteren Sinne widmet. Dennoch handelt es sich um einen sehr einheitlichen Text, bei dessen Lektüre man sich der unterschiedlichen Autoren kaum bewusst ist. In den Übergängen zwischen den Teilen zum 17./18., zum 19. und zum 20./21. Jahrhundert gibt es zwar einige kleinere Wiederholungen, diese ermöglichen aber ein separates Lesen der einzelnen Teile. Bei der „Kleinen Geschichte der USA“ handelt es sich um eine rundum gelungene Interpretation, die, obwohl sie ein breiteres Publikum anvisiert, an kritischen Stellen Forschungskontroversen erwähnt. Die Autoren kennen die neueste Literatur in allen Bereichen und scheuen sich nicht, immer wieder vorsichtig Stellung zu beziehen. Wenn man etwas bemängeln kann, so ist es, dass ethnische Geschichte und Frauengeschichte etwas zu kurz kommen. Das Werk beginnt mit der Besiedlung durch die Engländer, die in- HistLit 2007-3-143 / Marco Gerbig-Fabel über Gardner, William O.: Advertising Tower: Japanese Modernism and Modernity in the 1920s. Cambridge 2006. In: H-Soz-u-Kult 24.08.2007. Gassert, Philipp; Häberlein, Mark; Wala, Michael: Kleine Geschichte der USA. Stuttgart: Reclam 2007. ISBN: 978-3-150-10629-7; 550 S. Rezensiert von: Heike Bungert, Universität Köln Mit der „Kleinen Geschichte der USA“ legt auch der Reclam-Verlag eine Überblicksdarstellung der Geschichte der Vereinigten Staaten vor – nach der revidierten Neuauflage von Kröner, dem schmalen Band bei Beck-Wissen, dem Klassiker von Jürgen Heideking bei UTB, den eher für Studierende konzipierten zwei Bänden in der Reihe Oldenbourg Grundriss der Geschichte und dem achtbändigen, detailreichen Werk beim Lit-Verlag sowie geplanten Bänden bei Kohlhammer und Böhlau.1 Da die Geschichte der USA aber trotz der überragenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rolle der Vereinigten Staaten kaum in der Schule gelehrt wird und mit 15 Professuren bundesweit auch in der deutschen 1 Sautter, Udo, Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Stuttgart, 7. Aufl., 2006 [1976]; Dippel, Horst, Geschichte der USA, München, 7. Aufl., 2005 [1996]; Jürgen Heideking, Geschichte der USA, Stuttgart, 5. Aufl., 2007 [1996]; Adams, Willi Paul, Die USA vor 1900, München, 2000; Adams, Willi Paul, Die USA im 20. Jahrhundert, München, 2000; Wellenreuther, Hermann/Finzsch, Norbert/Lehmkuhl, Ulla, Geschichte Nordamerikas in atlantischer Perspektive von den Anfängen bis zur Gegenwart, Münster, 2004. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 457 Außereuropäische Geschichte dianischen Bewohner wie auch die spanischen Eroberer im Südwesten und in Florida werden ausgelassen. Indianer finden jedoch bei der Besiedlung durch die Weißen, bei der Eroberung des Westens und in der Zwischenkriegszeit Erwähnung. Afroamerikaner spielen eine relativ große Rolle, Mexikaner und die Chicano-Bewegung hingegen nicht. Frauen werden in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts immer mal wieder gestreift, aber beispielsweise nur zweimal in der Zeitleiste erwähnt; selbst der Verweis auf das erste Frauenrechts-Treffen in Seneca Falls 1848 fehlt. Wie bei jedem Überblickwerk werden Fachleute bei einzelnen Interpretationen oder Schwerpunktsetzungen anderer Meinung sein; so nimmt die Jacksonian Democracy nur geringen Raum ein, und die Sklaverei in den Nordstaaten gilt mit 1804 als erloschen. Im Gegensatz zum Vergleichsband, der Geschichte der USA von Jürgen Heideking, zeichnet sich die „Kleine Geschichte der USA“ in Reclam-Manier durch sehr nützliche Epochenüberblicke aus, die den vier Hauptteilen vorausgehen. Auch die Zusammenfassung des Charakters der amerikanischen Revolution (S. 165-169) ist positiv hervorzuheben. Dafür gibt es nur drei Karten und keine Statistiken oder Graphiken über Bevölkerungswachstum, Urbanisierung usw. Neu gewählte Präsidenten werden jedoch mit wenigen Ausnahmen in der Zeitleiste erwähnt. Für weitere Auflagen, die sicher folgen werden, wäre eine Erweiterung der Bibliographie zu erwägen, deren Auswahlkriterien – mit Ausnahme einer einleuchtenden Bevorzugung deutschsprachiger Literatur – nicht ganz einsichtig sind. Während der Band ein Personen- und Ortsregister enthält, täte ein Sachregister dringend not. Denn dieser Band wird sicher nicht nur von Anfang bis Ende gelesen, sondern auch immer wieder zum Nachschlagen genutzt werden. Insgesamt richtet sich die „Kleine Geschichte der USA“ sowohl an ein allgemeines Publikum als auch an Studierende und interessierte KollegInnen anderer Fachrichtungen. HistLit 2007-3-177 / Heike Bungert über Gassert, Philipp; Häberlein, Mark; Wala, Michael: Kleine Geschichte der USA. Stuttgart 2007. In: 458 H-Soz-u-Kult 06.09.2007. Guardino, Peter: The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850. Durham: Duke University Press 2005. ISBN: 0-82233520-4; 405 S. Rezensiert von: Silke Hensel, Historisches Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Recently interpretations of Latin American independence have changed dramatically. Understanding has moved from a merely anticolonial movement to a perspective wherein political transformations in Latin America form an integral part of the „age of revolutions“ which earlier had been considered to be exclusively of European and US-American character. Historians now argue that major changes in the political system took place from the end of the colonial period to the end of the independence period. They emphasize the impact of the Spanish monarchical crisis in 1808 and the Spanish constitution of 1812. Thus, independence did not only sever bonds with Spain, but also brought about a profound political change leading to the establishment of sovereign states in the first decades of the 19th century based on new forms of political representation. In addition the impulse of subaltern studies stimulated new approaches among historians of Latin America in order to better understand Latin American societies and their history from bottom up. Peter Guardino aptly interweaves both tendencies. The author interprets the time from 1808 onwards as a period of rapid change. He stresses the impact of the constitution of Cádiz on political culture as being even more important than independence from Spain. These transformations were set in motion by the elite. But Guardino is not only interested in how this elite influenced subalterns in Mexico, but as well how subalterns reacted to and took advantage of these changes to meet their own ends. The study compares urban plebeians of Antequera, the capital of the province of Oaxaca in Mexico and the only major Spanish settlement in the province on the one hand, and the indigenous peasants of Villa Alta, a Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart P. Guardino: The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca remote district in the north eastern part of Oaxaca on the other. Political culture in the eighteenth century in both, city and countryside, shared some characteristics, as for example the important role religion and patriarchy played in the everyday lives of the Oaxaqueños. Political authority derived from proximity to the king. But there existed some differences as well, especially in the communal institutions. While only members of the elite held positions in the „cabildo“ (city council) of Antequera the cargo system in the indigenous „repúblicas“ of Villa Alta obliged all male inhabitants to community service. Nevertheless, the cargo system was far from egalitarian. Indian nobles insisted on their privileges and used the colonial judicial system to have their noble status confirmed. Even though the Bourbon reformers intended to implement a new „authoritarianism“ in the second half of the 18th century, Guardino comes to the conclusion that they ultimately failed to do so, because they were more concerned about the increase of royal revenues than in other long-term goals. In addition, the Bourbon reforms had only a limited impact on the everyday political routines of ordinary people, because the rulers did not consider the lower social groups as possible contributors to the intended transformations. With the monarchical crisis in 1808 a period of dramatic changes started. The rising notion of national sovereignty was connected to an almost universal male suffrage installed by the Constitution of Cádiz. Contrary to the interpretation of scholars like François X. Guerra for whom the new political methods were incompatible with the traditional social structure in Mexico, Guardino argues that urban plebeians for the first time could participate in the elections and furthermore actually did so. They were not moved by clientelism, but because elections offered new opportunities. But, urban politics became dominated by the conflict between the two emergent parties in Oaxaca, the „vinagres“ (later becoming liberals) and the „aceites“ (later becoming conservatives). Their existence did not fit into the political culture, because political pluralism and competition were not accepted. Furthermore, national politics intervened and thus sharpened conflicts. 2007-3-123 In his discussion of urban politics Guardino can rectify earlier assumptions. While the „vinagres“, earlier equated with liberals of the second half of the nineteenth century, did not act against religion and the church as liberals would do later, the conservative „aceites“ did not opt for centralism in the 1820s but favoured federalism. The analysis of urban politics is in large part a discussion of these emerging political groups and their most important representatives. The latter were in their majority members of prominent families of the city. I agree with Guardino that social origin alone does not explain the ideological orientation of a person (p. 186s.), but still think that it might give some clues to better understand political affinities. In spite of his denial the author himself does support such a view. For instance when he describes the „vinagres“ as a group composed of members of the middle class (p. 205), or when he is not surprised of the conservative orientation of a member of one of the principal families of Antequera (p. 216). Guardino’s emphasis on the biographies of some important political leaders in urban Oaxaca in the end fails to explain the background of political orientations. Urban plebeian political culture remains obscure to a certain extent, which is due to the lack of sources, as Guardino admits. The most convincing parts of the book are those on Villa Alta. Within the communities the new political impulses helped to change the internal power structure. When egalitarian discourse and popular elections gained importance since 1808 these were successfully used by part of the community to challenge the cargo system. In addition, after independence, a new form of leadership, „caciquismo“, arose due to outside interference, even though it was not the main form of powerholding during the time under study. With respect to the autonomy of the communities Guardino stresses continuity rather than change. Contrary to authors who interpret the municipalisation of the colonial „repúblicas de indios“ after independence as a dramatic loss of autonomy, he argues that the indigenous population could retain its autonomy with respect to internal affairs, because of the willingness of state politicians to make compromises. In exchange for considerable Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 459 Außereuropäische Geschichte tax contributions autonomy was granted to the indigenous communities. Guardino makes a convincing point in showing the interconnectedness and interdependence of indigenous peasants with the outer world and their aptness to employ norms and institutions of larger society to bring about changes in their communities, too. Even though the main interest of the rural indigenous population lay in the internal conditions of their communities this did not mean that they had no vision of the larger framework. Guardino draws the conclusion that urban plebeians and the rural indigenous population did not promote these changes. They nevertheless, not only had to cope with them but seized the opportunities offered by new laws and procedures to follow their own goals. But the urban masses had lesser chances to do so than the members of indigenous communities. In sum, Guardino has provided a beautifully written and inspiring study that provokes further research, especially on the question, why the „time of liberty“ did not last longer and Mexican political history took a route that lead to restrictions of political liberty. Guardino’s book should find a wide readership among scholars and students alike. HistLit 2007-3-123 / Silke Hensel über Guardino, Peter: The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850. Durham 2005. In: H-Soz-u-Kult 16.08.2007. Jenkins Schwartz, Marie: Birthing a Slave. Motherhood and Medicine in the Antebellum South. Cambridge: Harvard University Press 2006. ISBN: 0-674-02202-5; 401 S. Rezensiert von: Julia Kramer, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg Marie Jenkins Schwartz erschließt mit ihrer Studie „Birthing a Slave“ einen neuen Aspekt der Geschichte der Sklaverei in den USA. Durch die Verknüpfung von Medizin- und Sozialgeschichte eröffnen sich Einblicke, welche die Machtgefüge der Sklaven haltenden Südstaatengesellschaft neu ausleuchten. 1808 hatte der Kongress die Beteiligung der USA am 460 internationalen Sklavenhandel beendet. Unter dieser Voraussetzung war die Sklaverei nur aufrechtzuerhalten, wenn nicht nur die produktiven, sondern auch die reproduktiven Fähigkeiten von Sklavinnen ausgebeutet wurden. Jenkins Schwartz zeigt auf, wie master und mistress in das Intimste von versklavten Personen eingriffen und wie SklavInnen es dennoch schafften, sich gewisse Freiräume zu erhalten. Dabei verortet sie Mediziner, medizinische Versorgung und medizinische Forschung zwischen diesen beiden Parteien. Der Arzt wurde nur gerufen, wenn keine andere Lösung gesehen wurde. Für Ärzte im Süden war die Behandlung von SklavInnen eine wichtige Einnahmequelle und eine wertvolle Gelegenheit, sich zu erproben. Durch diese Erfahrung konnten sie hoffen, als angesehener Arzt auch Weiße behandeln zu dürfen oder gar in die hohe Sklavenhaltergesellschaft aufgenommen zu werden. Auf den Plantagen waren sie auch der mistress untergeordnet. Jenkins Schwartz’ Quellen sind hauptsächlich Aufzeichnungen und veröffentlichte Bücher von Ärzten sowie medizinische Zeitschriften und Ratgeber. Zusätzlich wertet sie allgemeinere Zeitschriften aus, in denen auch Plantagenbesitzer ihre Erfahrungen darlegten. Durch diese Literatur informierten sich Sklavenhalter, um ihre Betriebe optimieren zu können. Es wird deutlich, dass es als erklärtes Ziel galt, eine Farm so autark wie möglich zu führen. Dieses schloss die medizinische Versorgung ihrer Bewohner ein. Darüber hinaus lässt Jenkins Schwartz ehemalige SklavInnen durch Interviews zu Wort kommen, die in den 1930er-Jahren von der US-Regierung mit noch lebenden ZeitzeugInnen durchgeführt wurden. Die folgenden Bereiche reproduktiver Gesundheit werden in vielen Einzelbeispielen angeführt: Fortpflanzung, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Geburt, postnatale Komplikationen, gynäkologische Chirurgie, Krebs und andere Tumore. Ein abschließendes Kapitel ist der Situation nach der Befreiung der SklavInnen gewidmet. Da Sklavenhalter durch die Emanzipation ihren Besitzanspruch auf African-Americans verloren, gaben sie auch ihr Interesse auf, diese gesund und leistungsfähig zu halten. Zugang zu Gesundheitsversorgung wurde ihnen aus finanziellen und rassistischen Gründen zusätzlich Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart M. Jenkins Schwartz: Birthing a Slave erschwert. Die vorher von der weißen Gesellschaft so vehement vorangetriebene Fruchtbarkeit wurde unter den neuen Arbeitsverhältnissen als hinderlich eingestuft. Auch während der Sklaverei war die Medizin der weißen Gesellschaft nicht um das Wohlergehen der Sklavinnen und Sklaven bemüht, sondern richtete sich nach den Vorgaben ihrer Besitzer. In der rassistischen Vorstellung der weißen Gesellschaft galten schwarze Frauen als besonders fruchtbar und zusätzlich als besonders schmerzresistent (analog dazu führte die vermeintlich „höhere Zivilisiertheit“ weißer Frauen zu deren gesteigerter Empfindlichkeit). SklavInnen wurden zur Arbeit gezwungen, ihnen konnte Nahrung verweigert werden, sie konnten ungestraft gezüchtigt und vergewaltigt werden. Jenkins Schwartz konstatiert (obsoleterweise), dass SklavInnen keine uneingeschränkte Kontrolle über ihre Körper hatten, da als wertvoll und damit schützenswert nur jene angesehen wurden, die besonders hart arbeiten konnten oder schnell viele Kinder bekamen. Eine gute „Gebärmaschine“ konnte auf dem Sklavenmarkt hohe Preise erzielen. Unfruchtbarkeit dagegen wurde mit Verkauf oder zusätzlicher Arbeit geahndet. Um auch den höchst intimen Lebensbereich der Fortpflanzung zu kontrollieren, arrangierten Sklavenbesitzer mehr oder weniger freiwillige Paarungen. Manche verfolgten dabei regelrechte „Zuchtkonzepte“. Für SklavInnen waren diese vermittelten Lebensgemeinschaften unter Umständen die einzige Gelegenheit, eine Familie zu gründen und so etwas Eigenes und Privates zu haben – auch daher ließen sie sich darauf ein. „Not all slaves accepted planter matchmaking docilely, but the willingness of some couples to mate under such circumstances is not hard to understand given that the majority of enslaved people wanted to marry and have families. The constraints that enslavement placed upon a man’s or woman’s ability to choose a spouse rendered marriage difficult.” (S. 16) Erzwungener Sex durch weiße Männer wird als Thema nur vage angedeutet, obwohl es eng mit der systematischen Unterwerfung der SklavInnen zusammenhängt. Die Medizin entwickelte im 19. Jahrhundert neue Vorstellungen über Frauen und „entdeckte“ sie dabei geradezu als Forschungs- 2007-3-094 objekt. Mediziner wollten sich als Experten auf dem Gebiet weiblicher Körper und Gesundheit profilieren. Schwangerschaften wurden zu einem biologischen Zustand, der von Männern der Wissenschaft reguliert werden musste. Der Stand der Medizin und der medizinischen Ausbildung, wie er in „Birthing a Slave“ dargestellt wird, öffnet den Blick auf das damalige Verständnis von Krankheit und Tod und von der Aufgabe, eine Bevölkerung gesund zu halten. Im Falle von Sklavinnen waren es allerdings ihre Besitzer, die als Klienten angesehen wurden, nicht die Patientinnen. An ihnen konnten auch ungeübte Ärzte Erfahrungen sammeln, oder es wurde an ihnen experimentiert, um das Ansehen und das Vertrauen der weißen Gesellschaft zu erreichen. Über die Köpfe der schwarzen Frauen hinweg wurde ihr „Schicksal“ zwischen dem Geltungsbedürfnis und der Neugierde weißer Ärzte und der Sorge um die Profite ihrer weißen Besitzer entschieden. Sie selbst hatten nur wenige Möglichkeiten, sich diesen oft brutalen und experimentellen Eingriffen zu entziehen. Sie schafften dies nur, wenn sie ihren Gesundheitszustand verbergen oder durch eigene Heilmethoden verbessern konnten. Dies galt auch für Versuche, Familienplanung im Rahmen des Möglichen selbst zu steuern. Viele Thesen der Sklavereiforschung finden hier Anklang, so die doppelte körperliche Ausbeutung der versklavten Frau und das paternalistisch fürsorgende Bild, das auch durch die medizinische Versorgung der SklavInnen von ihren Besitzern vermittelt wurde. Neu ist, wie weit die reproduktive Ausbeutung ging, dass schwarze Frauen als Versuchsobjekte medizinischer Forschung herhalten mussten und so die weiße Gesellschaft erneut von deren entmenschlichender Unterwerfung profitierte, und dass auch Mediziner keinerlei Respekt vor den Körpern und Wertvorstellungen der SklavInnen hatten, die ihnen anvertraut wurden. Auch ihre Toten wurden von Erforschung nicht verschont, obwohl sich African-Americans häufig gegen eine Obduktion aussprachen. Den Lebenden wurde meist keine ärztliche Verschwiegenheit zuteil, obwohl diese bei weißen Patienten selbstverständlich war. Ihre Geschichten wurden zum Teil detailliert veröffentlicht. So ist das vorliegende Buch mehr eine Studie über Entwick- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 461 Außereuropäische Geschichte lungen und Vorstellungen in der weißen Medizin, als über die der SklavInnen. Sicherlich ist dies auch der Quellenlage geschuldet. Mary Jenkins Schwartz berichtet von ärztlichem Verhalten, das nach heutigen Maßstäben entrüstet; sie versäumt aber meist, die ethischen Vorgaben der Zeitgenossen zu benennen. Ihre Erzählung bleibt beispielhaft (durch den Fokus auf medizinische Problemfälle wirkt das Berichtete häufig kurios) und ist beschreibender als analytisch. Leider bleibt die Analyse der sich offenbarenden machtvollen Verstrickungen und Abhängigkeiten dabei auf der Strecke. Einige spannende Überlegungen werden zwar aufgeworfen, dann aber nicht weiter diskutiert. Dessen ungeachtet ist dieses Buch ein Vorstoß in einem enorm aufschlussreichen Aspekt des im 19. Jahrhundert vorherrschenden Menschenbildes: eine Grundlagenarbeit, die viele weitere Studien nach sich ziehen sollte. HistLit 2007-3-094 / Julia Kramer über Jenkins Schwartz, Marie: Birthing a Slave. Motherhood and Medicine in the Antebellum South. Cambridge 2006. In: H-Soz-u-Kult 06.08.2007. König, Hans-Joachim: Kleine Geschichte Lateinamerikas. Stuttgart: Reclam 2006. ISBN: 3-15010612-5; 815 S. Rezensiert von: Ulrich Mücke, Historisches Seminar, Universität Hamburg Endlich! – „Endlich“ könnte man sagen „gibt es eine Geschichte Lateinamerikas auf Deutsch.“ Zwar liegen eine ganze Reihe von deutschsprachigen Büchern vor, die im Titel einen Überblick über die „Geschichte Lateinamerikas“ versprechen, doch keines dieser Bücher hat den Anspruch, eine geschichtswissenschaftlich fundierte Gesamtdarstellung der Geschichte dieses riesigen Subkontinents zu liefern.1 Genau das ist aber das Vorhaben des vorliegenden Reclam1 Zu nennen sind hier insbesondere vier Titel. Die „Geschichte Lateinamerikas. Von der Unabhängigkeit bis zur Gegenwart“ von Halperin Donghi (Suhrkamp Verlag), welche auf einer italienischen Ausgabe von 1968 basiert. Die im Rowohlt-Verlag 2005 erschienene „Lateinamerikanische Geschichte“, welche von einem Romanisten, Norbert Rehrmann, verfasst wurde, so dass man nicht erwarten darf, dass die vielen in dem Buch 462 Bandes. Hier soll die gesamte Geschichte des ganzen Subkontinents erzählt werden. Dass dies trotz der beeindruckenden 815 Seiten ein ganz und gar unmögliches Unterfangen ist, räumt Hans-Joachim König allerdings gleich auf der ersten Seite der Einleitung ein. Er macht daher die Einschränkung, dass er „als roten Faden den historischen Prozess der Staats- und Nationsbildung gewählt“ hat (S. 7). Diesen Prozess zu verstehen und zu erklären, ist das vornehmliche Ziel des Buches. Der Aufbau des Buches entspricht diesem Vorhaben. Das 19. Jahrhundert (1808-1900), „welches in gewissem Sinn die Mitte“ der Darstellung bildet (S. 8), macht fast die Hälfte des Gesamttextes aus. Den beiden Kapiteln zum 19. Jahrhundert ist ein Kapitel vorangestellt, welches die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts schon im Blick auf die später einsetzenden Unabhängigkeitsbewegungen analysiert. Hier wird verständlich, dass die späteren Nationalstaaten nicht als ein Zufallsprodukt der napoleonischen Kriege verstanden werden dürfen. Entdeckung und Eroberung, die Strukturen der Kolonialzeit (S. 11103) und die Zeit seit 1900 (S. 575-759) werden dagegen recht knapp behandelt. Ihnen ist etwa 40 Prozent des Textes gewidmet. Zu dieser sich aus Königs Fragestellung ergebenden Gesamtstruktur des Bandes tritt eine Binnengliederung der Kapitel, die sich durch das bewährte Reclam-Format auszeichnet, demnach die einzelnen Kapitel mit kurzen Zusammenfassungen und tabellarischen Übersichten eröffnet werden. Der pädagogische Impetus ist auch bei der notgedrungen sehr kurzen Bibliographie gut zu erkennen, sind die angegebenen Titel hier doch thematisch sehr feingliedrig geordnet, so dass der Literatur suchende Leser sehr genau zu den für seine Frage bedeutsamen Titel geführt wird. Das Personenregister besticht dann wiederum durch behandelten Themen und Fragen immer anhand der neuesten historischen Literatur diskutiert werden. Die sehr differenzierte politikwissenschaftliche Einführung zu Lateinamerika, welche Nikolaus Werz 2005 bei Nomos veröffentlicht hat und die ihren Schwerpunkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat. Und die „Einführung in das Studium der iberischen und lateinamerikanischen Geschichte“ von Karin Schüller (Aschendorff, 2000), welche nicht den Anspruch hat, einen Überblick über die Geschichte Lateinamerikas zu geben, sondern vielmehr Hinweise und Empfehlungen zum Studium der lateinamerikanischen Geschichte liefern will. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart A. Köth u.a. (Hrsg.): Building America die kurze Erläuterung zu jedem der dort genannten Namen. Die Stärke des Buches liegt aber nicht einfach in der guten didaktischen Gestaltung. Viel mehr zu loben ist der Versuch HansJoachim Königs, die vielen Länder des Subkontinents im Auge zu behalten. Dies kann in den relativ kurzen Kapiteln zur Kolonialzeit und zum 20. Jahrhundert natürlich nicht umgesetzt werden. Diese Kapitel sind daher thematisch strukturiert, so dass ein Land in der Darstellung nur erscheint, insofern es als spezifisches Beispiel für das entsprechende Thema betrachtet wird. Bei der langen Abhandlung über das 19. Jahrhundert bietet König dagegen eine Geschichte Lateinamerikas, die sich aus vielen – zum Teil miteinander verbundenen, zum Teil sich ähnelnden – Geschichten zusammensetzt. Der Vielfältigkeit des Kontinents wird eine solche Darstellung selbstredend eher gerecht, als eine thematische Ordnung, die zwangsläufig zur Vernachlässigung einer Reihe von Ländern führen muss. Was ist an der „Kleinen Geschichte Lateinamerikas“ zu kritisieren? Vor allem die Einleitung. König schreibt hier, dass sich sein Buch weniger an Lateinamerikaner und an Fachkollegen als vielmehr an „deutsche Leserinnen und Leser“ richtet und dass er mit seinem Buch „Interesse für die Geschichte Lateinamerikas bei ihnen wecken“ will (S. 8f.). Diese von König anvisierte Leserschaft hat vermutlich relativ wenig Vorkenntnisse von der Geschichte Lateinamerikas. Gerade deshalb wäre es hilfreich, wenn in der Einleitung genauer erläutert würde, was Gegenstand und was nicht Gegenstand dieser kleinen Geschichte ist. Ein Fachkollege versteht, dass der „rote Faden“ Staats- und Nationsbildung bedeutet, dass viele Felder der lateinamerikanischen Geschichte ausgeklammert werden. So beginnt Königs Geschichte mit der europäischen Ankunft und Landnahme. Die Zeit vor 1492 nimmt er nicht in den Blick. Und auch später erscheinen Indianer und Afroamerikaner (und übrigens auch Frauen) in erster Linie als Objekte der Geschichte. Die von König gewählte Perspektive macht dies verständlich. Aber ein unbedarfter Leser wird dies aufgrund der knappen Bemerkungen in der Einleitung nicht verstehen. Für ihn wird der Ti- 2007-3-038 tel („Kleine Geschichte Lateinamerikas“) vielmehr bedeuten, dass alle wichtigen Aspekte abgedeckt sind. Für eine zweite Auflage würde es der Einleitung also gut tun, wenn klar umrissen würde, welche Felder das Buch nicht behandelt. Dass es eine solche zweite Auflage geben wird, daran kann kaum ein Zweifel bestehen. Denn das Buch wird sich schnell als eine zentrale Referenz für all jene erweisen, die sich in Studium oder Beruf mit Lateinamerika beschäftigen. Sein Wert ergibt sich dabei gerade aus der detaillierten Zusammenstellung von Daten, den langen tabellarischen Übersichten und den konzisen Zusammenfassungen zentraler Themen. In mancher Hinsicht nähert sich diese „Kleine Geschichte Lateinamerikas“ damit dem „Lateinamerika-Ploetz“, dem leider (bisher?) keine Neuauflage beschieden war. Mit Königs „Kleiner Geschichte Lateinamerikas“ hat sich eine solche Neuauflage wohl auch erledigt. HistLit 2007-3-055 / Ulrich Mücke über König, Hans-Joachim: Kleine Geschichte Lateinamerikas. Stuttgart 2006. In: H-Soz-u-Kult 23.07.2007. Köth, Anke; Minta, Anna; Schwarting, Andreas (Hrsg.): Building America. Die Erschaffung einer neuen Welt. Dresden: Thelem 2005. ISBN: 3-937672-45-1; 356 S. Rezensiert von: Sebastian Jobs, Historische Anthropologie, Universität Erfurt Mit dem „spatial turn“ hat sich in den Kultur- und Sozialwissenschaften ein Konzept etabliert, das die Bedeutung von Vorstellungen vom Raum sowie dessen Aneignung als entscheidende Elemente menschlichen Handelns hervorhebt.1 In Anknüpfung daran versucht der vorliegende Sammelband „Building America – die Erschaffung einer neuen Welt“, herausgegeben von Anke Köth, Anna Minta und Andreas Schwarting, Antworten auf die Frage zu finden, „wie Identitäts- und Geschichtskonstruktio1 Bachmann-Medick, Doris, Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2006. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 463 Außereuropäische Geschichte nen, nationale Geltungsansprüche sowie gesellschaftliche Ordnungs- und Kontrollstrategien in Architektur, Städtebau und Denkmalpolitik zum Ausdruck gelangen“ (Klappentext). Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, Ideen, Raumfantasien und Mythen sowie deren Umsetzung in der Schaffung neuer Räume in Nordamerika vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart aus den Perspektiven von Architektur-, Kultur-, Technik-, Konsum- und Kunstgeschichte sowie der Literaturwissenschaft in den Blick zu nehmen. In seinem einführenden Beitrag umreißt Hans-Georg Lippert kurz die Entstehungsgeschichte des Bandes, der größtenteils die Vorträge dreier Symposien zusammenfasst, die 2003 und 2004 am Sonderforschungsbereich 537 „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ in Dresden stattfanden. Die Themen dieser Symposien geben gleichzeitig auch die inhaltliche Ausrichtung der drei Kapitel des Sammelbands vor. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse zweier weiterer Symposien aus dem Jahr 2005 („Kultur – Ästhetik – Wahrnehmung“ und „Eigenbilder – Fremdbilder“) in einem zweiten Sammelband publiziert werden. Den ersten thematischen Schwerpunkt setzt der Sammelband in der Trias von „Identität – Geschichte – Gedächtnis“. Michael Hochgeschwenders eröffnender Beitrag verortet die aktuellen Diskussionen um Raum und Identität in der US-amerikanischen Geschichte sehr pointiert und informativ zwischen den wohlbekannten Theorieklassikern von „Frontier“-These und „American Exceptionalism“. Dabei stellt er diese Debatten einerseits in den theoretisch-methodischen Kontext des „spatial turn“, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass Reinhart Koselleck schon 1986 die Bedeutung räumlicher Perspektiven für historisches Arbeiten betont hat.2 Caroline Rosenthal erweitert dieses Methodenensemble aus literaturwissenschaftlicher Perspektive um postmoderne Raumtheorien wie Michel Foucaults Heterotopiekonzept, um den städtischen Raum als Kristallisationspunkt des nationalen amerikanischen Zivilisationsprojekts zu beschreiben. Gleichzeitig untersucht sie 2 Koselleck, Reinhart, Raum und Geschichte, in: ders., Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt am Main 2000, S. 78-97. 464 Traditionen der literarischen Pastorale, die innerhalb eines zivilisationskritischen Projekts „Natur“ als sehnsuchtsvoll aufgeladenen dritten Raum jenseits von „wilderness“ und Stadt formulierten. Jennifer Dickeys Text „Historic Preservation and the Shaping of National Identity in the United States“ hebt die zunehmende Bedeutung einer „memory infrastructure for the nation“ (S. 71) seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hervor. Dabei betont sie die zentrale Bedeutung von Erinnerungsorten wie Mount Vernon oder Ellis Island als Plätze amerikanischer Identitätsdebatten. An diesem Punkt setzen auch die Beiträge von Jens Kabisch und Eduard Führ an, die die Wirkungsweise verschiedener Memorialisierungsdiskurse analysieren und dabei vor allem die inszenatorische Qualität des Erinnerns betonen. Um die Inszenierung von Tradition und Herrschaft geht es auch im zweiten Kapitel des Bandes: „Macht – Autorität – Moral“. Während Wolfgang Sonne hierbei die Planungen um eine städtebauliche Überarbeitung der amerikanischen Hauptstadt zu Beginn des letzten Jahrhunderts untersucht, stehen in Anna Mintas Beitrag vor allem die Debatten über die Errichtung der National Cathedral in Washington D.C. im Mittelpunkt. Dabei hebt sie vor allem auf die Überschneidungen von christlicher und ziviler Religion, religiösem und patriotischem Eifer hervor. Ähnliche ideologische Berührungspunkte betont auch Harold Hammer-Schenk. Er findet in Profanbauten wie kommerziellen Hochhäusern, Bibliotheken und auch Privatbauten stilistische Anlehnungen an kirchliche Sakralbauten und stellt damit einen Zusammenhang zu zivilreligiösen Missions- und Fortschrittsideen her. Klaus P. Hansens kurzer Beitrag über den Weg „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ analysiert die Herkunft amerikanischer Mythen von Erfolg in verschiedenen literarischen Texten. Dabei beschreibt er eine „Mentalität der Machbarkeit“ (S. 212), die sich an Motiven protestantischer Ethik orientiert und Optimismus und Hoffnung auf Fortschritt hervorhebt. Gleichzeitig betont er jedoch auch die Mythoskritik, wie sie beispielsweise Arthur Millers „Death of a Salesman“ betreibt. In diesem Kapitel fällt vor allem Laura Biegers Artikel „’Make no little Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart A. Köth u.a. (Hrsg.): Building America plans’ – der Modus des Spektakulären von der White City bis Las Vegas“ methodisch aus dem Rahmen. In ihrer Betrachtung der Modellstadt „White City“ auf der Chicagoer Weltausstellung (1893) und der architektonischen Entwicklung verschiedener Bauten in Las Vegas macht sie sich den aus der Musik stammenden Begriff des Modus zueigen. Unter anderem lässt sich der Modus des Spektakulären in „White City“ in seinem Charakter als städtische Utopie erkennen, der noch dadurch unterstrichen wurde, dass es sich um ein bautechnisches Provisorium handelte, dass teilweise schon während der eigentlichen Ausstellung zusammenbrach. Diese Inszenierung des Verfalls (S. 232f.) und des Abbruchs bezeichnet Bieger genau so als spektakulär wie die Architektur der Casinos und Hotels in Las Vegas, die einer ständigen Überarbeitung und Aktualisierung unterworfen seien. Gerade die Konstanz des bleibenden Wandels eröffne Räume für Grenzüberschreitung und Utopien. Damit unterscheide sich die spektakulär-utopische Architektur in Las Vegas und „White City“ klar von eher monumentalen Bauweisen in Washington D.C., die gleich einem Museum vor allem Tradition und Herkunft hervorhöben. Das abschließende Kapitel fasst die Diskussion um „Fortschritt – Technik – Geschwindigkeit“ zusammen. Dabei analysiert Ellen Kloft die Debatten um eine Nutzung des New Yorker „Ground Zero“. Besonders in den Hochhausentwürfen für den Wettbewerb über die Neubebauung des Areals entdeckt Kloft Elemente nostalgischer Rückbesinnung wie auch visionärer Fortschrittshoffnung. Gerade auf den letzten Punkt hebt auch Anke Köths Beitrag über die Bedeutung des amerikanischen Hochausbaus in den 1920erJahren ab. Sie zeigt, dass Wolkenkratzer, je nach Verwendungszweck, als Zeichen von Modernität, Fortschritt und Wohlstand gedeutet wurden, deren Herausforderung vor allem im Ausloten der Grenzen und der technischen und finanziellen Machbarkeit lag. Zwei weitere Texte dieses Abschnitts beschäftigen sich mit dem Einfluss des Autos auf Formen amerikanischer Mobilität. Während Christoph Asendorf in seinem Artikel „Verkehrsfluss und Gesellschaftsform“ Reichsautobahn und Highways einem konzeptionellen 2007-3-038 Vergleich unterzieht, betrachtet Liane Löwe in ihrem Beitrag „’A Nation Built on Transport’. Das Auto und die US-amerikanische Gesellschaft“ die Anfänge einer Auto- und Fahrkultur in den USA in den 1920er- und 1930er-Jahren. Dabei hebt sie vor allem darauf ab, wie die zunehmende Verbreitung von Autos die Möglichkeiten für die Aneignung des Raums prägte: Stadt und Land wurden enger miteinander verknüpft, Wohngegenden in den Vorstädten wurden zunehmend attraktiver. Durch diese Art des Unterwegsseins, so Löwe, veränderte sich gleichzeitig auch die bauliche Infrastruktur des Verkehrsnetzes, angefangen von den Straßen über Motels, „drive-in restaurants“ und Tankstellen bis hin zur heimischen Garage, die ab den 1930er-Jahren zum häuslichen Standard gehörte. Der Beitrag zeigt überzeugend, wie die Möglichkeiten von Bewegung den Alltag von Menschen veränderten. Eine benachbarte Perspektive greift auch Astrid Bögers Text über „Die Zukunft der Vergangenheit“ über eine städtebauliche Utopie auf der New Yorker Weltausstellung 1939 auf. Sie stellt unter anderem fest, dass diese Vision einer umfassenden Städteerneuerung erhebliche Leerstellen produzierte, indem sie „auf die Präsenz von Menschen weitestgehend verzichtet[e]” (S. 300) und damit die alltäglichen Praktiken der Menschen im Raum (Michel de Certeau) ausblendete. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Sammelband dort am überzeugendsten ist, wo die Perspektive der einzelnen Beiträge über die Konzeptionen, Planungen und Ideen (meist urbaner) Räume hinausgeht und zusätzlich das sprichwörtliche „Gehen in der Stadt“ (de Certeau) in den Blick der Autoren kommt. In ihrer starken Bezugnahme auf Klassiker und „Dauerbrenner“ US-amerikanischer Ideengeschichte bewegen sich alle Beiträge auf solidem konzeptionellen „common ground“ („frontier“, „American exceptionalism“, „manifest destiny“ et cetera), antworten also auf die Fragen, die dem Sammelband zugrunde liegen. Durch diesen Fokus kommt jedoch gerade die Perspektive der Aneignung der imaginierten und neu entstandenen Räume in den meisten Texten zu kurz. Die Frage nach den Akteuren, beispielsweise in Form städtischer Bewohner, wird zu selten Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 465 Außereuropäische Geschichte gestellt. Dabei stecken gerade im Abschreiten von Räumen genauso wie im „Benutzen“ von Denkmalen Momente der Produktion, der Deutung und Sinnstiftung, gleichzeitig aber auch des Scheiterns, der Veränderung und der Brüche mit Vertrautem und Geplantem.3 Die meisten Beiträge betonen Traditionen und Kontinuitäten, folgen dabei Meistererzählungen von Fortschritt, Technisierung, Demokratisierung und schreiben sie damit fort, ohne ihre mythischen Qualitäten zu thematisieren. Vielleicht sind dies ja Perspektiven, die im zweiten Teil der Veröffentlichung stärker zum Tragen kommen werden. HistLit 2007-3-038 / Sebastian Jobs über Köth, Anke; Minta, Anna; Schwarting, Andreas (Hrsg.): Building America. Die Erschaffung einer neuen Welt. Dresden 2005. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2007. Lafi, Nora (Hrsg.): Municipalités méditerranéennes. Les réformes urbaines ottomanes au miroir d’une histoire comparée (Moyen-Orient, Maghreb, Europe méridionale). Berlin: Klaus-SchwarzVerlag 2006. ISBN: 3-87997-634-1; 373 S. Rezensiert von: Astrid Meier, Historisches Seminar, Universität Zürich Um es gleich vorwegzunehmen: Dies ist ein sehr anregendes Buch zu einem äußerst spannenden Thema, aber es ist leider auch ein Buch verpasster Chancen. Im Zentrum des Interesses steht der beschleunigte Wandel der Städte im östlichen und südlichen Mittelmeerraum im 19. Jahrhundert. Gerade für urbane Räume unter osmanischer Herrschaft wird diese Periode oft als Transformation von einer traditionellen „islamisch“ oder „orientalisch“ geprägten Stadt zur modernen Stadt europäischen Zuschnitts angesehen. Auf den ersten Blick scheint sich diese Entwicklung bis heute in der augenfälligen Trennung zwischen islamisch geprägter Altstadt mit ihren engen Sackgassen und den modernen Vierteln der kolonialen Städte mit ihren großzügigen Boulevards zu manifestieren. Doch 3 de Certeau, Michel, Die Kunst des Handelns, Berlin 1988; Young, James E., The texture of memory – Holocaust memorials and meaning, New Haven, CT 1993. 466 der historische Wandel betraf nicht nur die Gestaltung des gesamten städtischen Raums und seine Nutzung in einer Zeit beträchtlichen demographischen und urbanen Wachstums, sondern nicht zuletzt auch die Arten, wie städtischer Raum verwaltet wurde und wer darin einbezogen war. Der Band ist das Resultat einer kollektiven Unternehmung von etwa zwanzig Forscherinnen und Forschern, die sich mehrmals zum Austausch trafen. Ausgangspunkt war das Interesse an der Rolle munizipaler Räte in den osmanischen Städten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dies war laut Herausgeberin Nora Lafi ein kritischer Moment in der Geschichte der städtischen Gesellschaften: „Mais autour de la question du passage d’institutions urbaines anciennes, ou d’Ancien régime [...], à des institutions de type municipal, on retrouve partout un des points essentiels de l’histoire des sociétés urbaines.“ (S. 14) Demgemäß lag die Stadtverwaltung unter dem Ancien régime in den Händen eines Rates von Notablen, der den städtischen Raum (u. a. Märkte) und die gesellschaftliche Ordnung entlang berufsständischer und konfessioneller Linien kontrollierte. Unter dem neuen, „munizipalen“ Regime basierte die Mitgliedschaft im Rat auf einem Zensuswahlrecht, das auf der Steuerkraft von Individuen aufbaute, insbesondere was Immobilbesitz betraf. Berufsständische Organisation und konfessionelle Gemeinschaft spielten nunmehr eine untergeordnete Rolle. Der Band versucht, diesen Übergang von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung nahöstlicher Städte in verschiedene Richtungen hin zu kontextualisieren. Gegen simple Erklärungen wie die bloße Imitierung eines europäischen Modells verspricht das Vorwort, sowohl nach den Vorläufern der neuen, „reformierten“ und „modernen“ Formen von Stadtverwaltung und -planung zu suchen als auch parallele Entwicklungen in Europa in den Blick zu nehmen. Weiter interessieren die langfristigen Auswirkungen dieser Reformen. Diese hochgesteckten Ziele spiegeln sich im etwas ungleichgewichtigen Aufbau des Bandes wider. In einer ausführlichen Einleitung rekapituliert die Herausgeberin die Geschichte dieses Forschungsprojektes und ver- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart N. Lafi (Hrsg.): Municipalités méditerranéennes sucht, Einwänden methodischer Art bereits hier zu begegnen, indem sie stark die allmähliche Entwicklung einer gemeinsamen Fragestellung herausstreicht. Es schließt sich ein erster Teil mit zwei Beiträgen an, der dem Vergleichspunkt „Italien“ gewidmet ist. Anhand der munizipalen Reformen von 1780 in Livorno zeigt Samuel Fettah, wie unter dem System eines aufgeklärten Absolutismus mit der Ausweitung der Wählerschaft und der Integration der jüdischen Gemeinschaft in den neuen Rat tendenziell eine neue städtische Elite geschaffen wurde, obwohl alte, „adelige“ Privilegien durchaus weiter galten. Denis Bocquet zeichnet in einem überblicksartigen Artikel die Geschichte der Stadtverwaltung von Rom vom 16. bis zur Inkorporation ins Königreich Italien im Jahr 1870 nach. Der zweite Teil zu den osmanischen Reformen ist zweifellos das Kernstück des Bandes und thematisiert die oben beschriebene Transformation an den Fällen Jerusalem, Beirut, Damaskus und Tunis. Dabei sticht besonders der weit ausholende Artikel von Yasemin Avci und Vincent Lemire mit einer ReEvaluation der osmanischen Munizipalität in Jerusalem zwischen 1867 und 1917 hervor. Er thematisiert das bewusste Vergessen dieser Institution der städtischen Selbstverwaltung unter kolonialen und post-kolonialen Vorzeichen. Es war darum ein Glücksfall, dass mit siebzehn Bänden von osmanisch-türkischen Protokollen (1870-1914) die Arbeit dieses Rates besonders gut dokumentiert ist. Insbesondere die innovative Diskussion von Instanzen der Stadtverwaltung unter dem „Ancien régime“ bietet willkommene Anknüpfungspunkte für diejenigen Forschungsrichtungen, die mit der Zeit vor den Tanzimat (1839-1876) befasst sind. Sie fangen gerade an, sich eingehender damit zu beschäftigen, wie städtischer Raum verwaltet wurde und welche Instrumente zur Verfügung standen.1 Dies wird sicher dazu führen, dass der Beginn der Moderne und das Ende des Ancien régime nicht mehr so klar datiert werden können, wie es 1 So zum Beispiel in den Arbeiten von Stefan Knost zu Stadtviertelstiftungen u.a. in Aleppo, s. Knost, Stefan, Die Stadtviertelstiftungen in Aleppo von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Meier, Astrid; Pahlitzsch, Johannes; Reinfandt, Johannes (Hrsg.), Für immer und ewig? Islamische Stiftungen im historischen Wandel, Berlin, in Vorbereitung. 2007-3-204 an verschiedenen Orten dieses Bandes geschieht. Formen von „moderner“ Stadtverwaltung existierten bereits vor dem 19. Jahrhundert. So muss die Bautätigkeit in den osmanischen Städten schon vor der Einführung der munizipalen Räte einer Art Planung unterworfen gewesen sein. Jens Hanssen konzentriert sich in seinem Beitrag auf die personelle Zusammensetzung des Stadtrates von Beirut. Dabei betont er die Bezüge der im Rat versammelten Personen zum kulturellen und intellektuellen Umfeld ihrer Zeit (1860-1908). Stefan Weber verweist in seinem Artikel stärker auf die Aktivitäten des Rates und wie sich unter seiner Planung Infrastruktur und Plan von Damaskus von 1864 bis 1918 veränderten. Der vierte Beitrag stammt von der Herausgeberin Nora Lafi und zeigt am Beispiel von Tunis in einer sehr interessanten und überzeugenden Langzeitperspektive Brüche und Kontinuitäten in der Art auf, wie und von wem die Stadt verwaltet wurde. Auch sie verweist mit den Quartiervorstehern (shaykh al-balad) auf einen alten Funktionsträger der osmanischen Stadtverwaltung, von dem wir noch viel zu wenig wissen. Der dritte Teil umfasst zwei Beiträge, die die Modalitäten der Stadtverwaltung unter kolonialen Vorzeichen betrachten. Carla Edde verweist am Beispiel von Beirut auf die ambivalente Umsetzung der modernisierenden Diskurse der „mission civilisatrice“ in der Instrumentalisierung des Stadtrates, „puisque la perte de pouvoir réel de la municipalité se fait au moment où celle-ci est dotée de moyens corrects de fonctionnement“ (S. 285). Der zweite Beitrag von Denis Boquet in diesem Band zeichnet nach, wie in den Jahren um 1912 die Stadtverwaltung von Rhodos aus der Perspektive der italienischen Besatzer aussah. Im vierten Teil schließlich thematisiert Emna Bchir El Aouani am Beispiel eines Erschließungsprojektes in der Stadt Tunis die Probleme gegenwärtiger Stadtplanung. Warum also verpasste Chancen? Zum ersten frappiert der Umstand, dass in einem kollektiven Forschungsunternehmen, in dem man sich laut Vorwort in mehrmaligen Treffen über methodische Fragen des Vergleichs und gemeinsame Fragestellungen austauschte, die Beiträge fast gänzlich auf sich selber bezogen Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 467 Außereuropäische Geschichte bleiben. Die Ergebnisse der Untersuchung zu den einzelnen Fällen bleiben so isoliert und werden nicht in einer Synthese gegeneinander abgewogen und diskutiert. Zweitens ist die Funktion des Vergleichs mit zwei, vielleicht mit Rhodos unter italienischer Herrschaft sogar drei Sonderfällen aus der europäischen Geschichte nicht unmittelbar einsehbar. Zu unterschiedlich ist die Qualität dieser Beiträge, die von einer Detailstudie (Livorno) über einen Forschungsüberblick (Rom) zu einer ersten Quellenskizze (Rhodos) reichen. Fast ganz aus dem Rahmen fällt der Überblicksbeitrag zu Tunis am Ende des 20. Jahrhunderts, weil seine erste Hälfte zum größten Teil wiederholt, was anderenorts schon detaillierter und genauer dargestellt wurde, und sein zweiter Teil in einen sehr unterschiedlichen Kontext gehört. Auch wenn, wie die Herausgeberin im Vorwort betont, die kollektive Arbeit vor allem in der Ausarbeitung eines gemeinsamen Fragekatalogs bestand, hätte man sich von einem komparativen Ansatz mehr und vor allem anregendere Resultate erhofft. Das verhält sich ebenso für Fragestellungen im Rahmen einer histoire croisée, die im Vorwort angesprochen, aber dann nirgends eingelöst werden. Schließlich ist mir unverständlich, warum in einem Band, der zu interdisziplinärem Arbeiten aufrufen will, die Transkription von häufig eingestreuten arabischen und osmanisch-türkischen Begriffen so uneinheitlich ist, dass selbst SpezialistInnen über sie stolpern. Diese unnötige Hürde lässt sich nicht mit dem Hinweis entkräften, dass man eine möglichst einfache Transkription den einzelnen Autorinnen und Autoren überlassen hat (S. 9), denn zum einen werden selbst dort, wo genau transkribiert wird, uneinheitliche Systeme angewandt (so z. B. gehäuft S. 143, 148). Schwerer wiegt aber generell die überaus unsorgfältige redaktionelle Bearbeitung der Beiträge, die den Lesefluss an einigen Stellen empfindlich stört: So dürfte es nicht einfach sein, von der „jâmac ezzitûna“ (S. 340) auf den berühmten ZaytunaHochschulkomplex in Tunis zu schließen. Trotz dieser Kritik ist der Band all jenen wärmstens zu empfehlen, die etwas zur Geschichte von städtischen Gesellschaften unter osmanischer Herrschaft seit dem 18. Jahrhun- 468 dert wissen möchten. Die Anregungen dieses Bandes werden sicher die Forschungslandschaft zur Stadtgeschichte in den nächsten Jahren mit gestalten. Auf eine Synthese der Resultate warte nicht nur ich gespannt. HistLit 2007-3-204 / Astrid Meier über Lafi, Nora (Hrsg.): Municipalités méditerranéennes. Les réformes urbaines ottomanes au miroir d’une histoire comparée (Moyen-Orient, Maghreb, Europe méridionale). Berlin 2006. In: H-Soz-u-Kult 17.09.2007. Laurinat, Marion: Kita Ikki (1883-1937) und der Februarputsch 1936. Eine historische Untersuchung japanischer Quellen des Militärgerichtsverfahrens. Münster: LIT Verlag 2006. ISBN: 3-8258-9841-5; 328 S. Rezensiert von: Maik Hendrik Sprotte, Institut für Japanologie, Zentrum für Ostasienwissenschaften (ZO), Universität Heidelberg Die Diskussion, ob das Herrschaftssystem des japanischen Kaiserreichs zu irgendeinem Zeitpunkt in der Phase des so genannten „Fünfzehnjährigen Krieges“ in China und im Pazifik (1931-1945) als faschistisch klassifiziert werden kann, hält in der historischen Japanforschung seit Jahrzehnten an.1 Als „Kronzeuge“ der Befürworter dieser These einer japanischen Variante faschistischer Herrschaft wird – neben dem Publizisten und politischen Aktivisten Ôkawa Shûmei (1896-1957)2 – oft Kita Ikki als mutmaßlicher Chefideologe des japanischen Faschismus ge1 Siehe dazu: Schölz, Tino, Faschismuskonzepte in der ja- panischen Zeitgeschichtsforschung, in: Krämer, Hans Martin; Schölz, Tino; Conrad, Sebastian (Hrsg.), Geschichtswissenschaft in Japan, Göttingen 2006, S. 107134; Kasza, Gregory J., Fascism from above? Japan’s kakushin right in comparative perspective, in: Larsen, Stein Ugelvik (Hrsg.), Fascism outside Europe. The European Impulse against Domestic Conditions in the Diffusion of Global Fascism. New York 2001, S. 183268; Krämer, Hans Martin, Faschismus in Japan. Anmerkungen zu einem für den internationalen Vergleich tauglichen Faschismusbegriff, in: Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts 2 (2005), S. 6-32; Martin, Bernd, Zur Tauglichkeit eines übergreifenden Faschismus-Begriffs. Ein Vergleich zwischen Japan, Italien und Deutschland, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 29 (1981), S. 48-73. 2 Bei ostasiatischen Personennamen wird der Familienname dem persönlichen Namen vorangestellt. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart M. Laurinat: Kita Ikki (1883-1937) und der Februarputsch 1936 nannt. Marion Laurinat hat sich in ihrer 2004 an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Tübingen eingereichten und 2006 in der renommierten Publikationsreihe der Tübinger Ostasienwissenschaften erschienenen Dissertation seinem publizistischen Werk und nicht zuletzt seinem politischen Handeln zugewendet. Laurinat hat den Schwerpunkt ihrer historisch-hermeneutischen Analyse dabei auf die Auswertung von Gerichtsakten und Verhörprotokollen gelegt – Dokumenten, in denen Kita, unter dem Vorwurf der Beteiligung am so genannten „Zweiten Putschversuch der Jungen Offiziere“ zur Schaffung einer absoluten Tennô-Herrschaft, dem Februarputsch des Jahres 1936, verhaftet, Rechenschaft gegenüber den Sicherheitsbehörden, der Staatsanwaltschaft und einem Militärgericht abzulegen hatte. Ein zentraler Begriff der Untersuchung Laurinats ist der Terminus der „ShôwaRestauration“. Damit wird die politische Forderung nationalistischer Kreise nach einer alle Bereiche des Gemeinwesens umfassenden Reform der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen Japans nach 1868 beschrieben. Mutmaßlicher Korruption, Insubordination gegenüber dem Tennô als quasigöttlichem Herrscher des Landes, sozialer wie wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und einer daraus resultierenden Revolutionsgefahr sollte mit der Errichtung einer unmittelbaren Tennô-Herrschaft unter gleichzeitiger Aussetzung der seit 1889 bestehenden japanischen Verfassung begegnet werden. Auf der Basis der Aussagen Kita Ikkis und von Putschisten nach ihrer Verhaftung 1936 geht Laurinat den Fragen nach, wie sich einerseits „die konkrete Einflussnahme Kita Ikkis auf die Shôwa-Restauration“ gestaltete, und welche Rolle ihm andererseits „innerhalb des Februarputsches von 1936“ (S. 15) zukomme. Dabei bezieht sich Laurinat auf verschiedene, mehr oder weniger vollständige Dokumentensammlungen, in denen Verhör- und Gerichtsprotokolle sowie weitere Materialien zum Verfahren gegen Kita Ikki als mutmaßlichem geistigem Vater des Februarputsches in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts publiziert wurden. Ein kenntnisreicher Überblick über die Dokumentenlage und den Stand der japanischen und westlichen Forschung zu Ki- 2007-3-210 ta (S. 18-22, S. 24-28) gibt einen Eindruck von den Mühen, denen sich Laurinat bei der Erschließung des Materials zu stellen hatte. Dieses erste Kapitel endet mit einer Klärung der für die vorliegende Arbeit fundamentalen Termini „Shôwa-Restauration“, „Ultranationalismus“ und „Faschismus“, wobei Laurinat die Anwendung des letzteren auf Japan für problematisch hält. Im Sinne des Erkenntnisinteresses Laurinats ein wenig zu monolithisch ist das zweite Kapitel zu den „historischen Grundlagen“ gestaltet. Neben einem Lebenslauf Kitas geht Laurinat auf die Erscheinungsform des japanischen Staates und seiner Staatsideologie ein, wobei sie es für erforderlich hält, bis in die feudale Übergangsphase unmittelbar vor dem Beginn der Moderne in Japan mit der Meiji-Restauration des Jahres 1868 zurückzugehen. Bedauerlich sind hier begriffliche Ungenauigkeiten, die die Samurai beispielsweise mal als Stand, als Klasse oder gar Kaste (S. 50) charakterisieren. Neben dem Einfluss des Westens auf Japan berücksichtigt Laurinat in ihrer Darstellung ebenso die Konstitutionsbedingungen des Meiji-Staates (Verfassung, Erziehungsedikt und Staatsshintô) wie die „nationalistische Entwicklung Japans und ihre politischen Einflussfaktoren von 1920 bis 1936“ (S. 62ff.). Der Begriff der „TaishôDemokratie“ als Synonym für eine wachsende politische Bedeutung des Volkes und seiner erwachenden politischen Sensibilität findet allerdings keineswegs erst, wie Laurinat schreibt, für die „ab Mitte der zwanziger Jahre währende Regierungsform“ der Parteienkabinette (S. 62), sondern bereits für die Zeit nach 1905 Verwendung.3 Für eine Bewertung des Einflusses Kitas auf den japanischen Ultranationalismus der 1920er- und 1930er-Jahre von zentraler Bedeutung sind seine Schriften, von denen Laurinat im dritten Kapitel die drei wichtigsten Abhandlungen unter den Stichworten „Sozialismus“, „Panasiatismus“ und „Staatsreorganisation“ vorstellt. Mit diesen drei Kategorien sind auch zugleich die wichtigsten Elemente von Kitas politischem Denken identifiziert. Besonders die Schrift „Umriss eines 3 Vgl. Meyer, Harald, Die „Taishô-Demokratie“. Begriffs- geschichtliche Studien zur Demokratierezeption in Japan von 1900 bis 1920, Bern 2005, S. 62. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 469 Außereuropäische Geschichte Planes zur Reorganisation Japans“ von 1919 (S. 88ff.) mit einem starken anti-westlichen Ressentiment und seiner Forderung nach einem Staatstreich im Sinne der „ShôwaRestauration“ stützte den juristischen Vorwurf gegen Kita als möglicher geistiger Urheber des Februarputsches. Der „Vita activa“ Kitas ab 1923 wendet sich Laurinat in ihrem vierten Kapitel zu. Neben seine Funktion als einer der konzeptionellen Denker des japanischen Ultranationalismus trat bei Kita das konkrete politische Engagement, indem er sich als Politikberater für seine politischen Überzeugungen aktiver einzusetzen und sich mit zahlreichen ultranationalistischen Gruppen, Einzelpersonen und Wirtschaftsunternehmen zu verbinden begann. Laurinat analysiert in diesem Kontext auf der Grundlage der Gerichtsakten den Einfluss Kitas auf die zwischen 1931 und 1936 vergeblich mehrere Putsche planende und gelegentlich ausführende „Bewegung Junger Offiziere“, die mit seinen Vorstellungen zu sympathisieren schienen. Die folgenden beiden umfangreichen Kapitel widmet Laurinat einerseits der Frage seiner persönlichen Verstrickung in den Februarputsch 1936 durch direkte Kontakte zu Putschisten vor und während des Aufstandes und den intellektuellen Austausch mit ihnen, andererseits vor allem der Problematik, inwieweit seine im Reorganisationsplan formulierten Gedanken und deren Wirkung, so sie denn überhaupt einen spürbaren Einfluss auf die Ziele der Putschisten hatten, einer richterlichen Entscheidung unterworfen werden konnten. Ihre Analyse führt Laurinat zu dem Fazit, das gegen Kita ausgesprochene Todesurteil entbehre einer juristischen Grundlage, da er sich einerseits trotz Kenntnissen der Putschplanung nicht aktiv an dieser beteiligt habe, andererseits aber auch seine Schrift im Kreise der Putschisten weitgehend unter dem Generalverdacht sozialistischer Färbung gestanden und daher nicht den bisher angenommenen Einfluss gehabt habe. Eine Untersuchung und Evaluation des zeitgenössischen strafrechtlichen Hintergrundes des Urteils, die dem autoritären Charakter des japanischen Herrschaftssystems bis 1945 Rechnung tragen, unterbleibt allerdings. 470 Durch die vollständige Übersetzung des Protokolls der eigentlichen Gerichtsverhandlung gegen Kita macht Laurinat außerdem ein wichtiges Zeitdokument für die historische Forschung in deutscher Sprache zugänglich. Die Arbeit schließt mit einem Literaturverzeichnis und umfangreichen, deutschjapanischen Glossaren der „handelnden Personen“ (inklusive eines Abrisses ihrer Lebensläufe), nationalistischer Gruppen und wichtiger Fachtermini. In stilistischer Hinsicht hätte dem Text sicher eine Überarbeitung und Beseitigung sprachlicher Unebenheiten gut getan. Gelegentlich verbinden sich zudem sprachliche mit inhaltlichen Ungenauigkeiten: z.B. „terroristische Staatsstreiche“ (S. 13), als nur scheinbarer Pleonasmus, der die theoretischen Annahmen zu Differenzierungen der politikwissenschaftlichen Termini „Terror“ und „Staatsstreich“ verwischt, „Kriegsministerium“ (z.B. S.14) statt „Heeresministerium“ als Pendant zum gleichfalls existierenden Marineministerium. Zweifelsohne vom individuellen Leseverhalten abhängig hat sich die Entscheidung Laurinats, auf Fußnoten zu verzichten und den Kapiteln Endnoten hinzuzufügen, bei der Lektüre gelegentlich als störend erwiesen. Erklärungen hätte man sich eher in unmittelbarer Nähe des erläuterten Sachverhalts gewünscht. Es ist das Verdienst Laurinats, einen gehaltvollen und quellenreichen Überblick über den jüngsten japanischen Forschungsstand zur tatsächlichen Bedeutung Kita Ikkis innerhalb der ultranationalistischen Bewegung im Japan der 1920er- und 1930er-Jahre vorgelegt zu haben. Ob diese Arbeit jenseits fremdsprachlicher Beschränkungen, die ihre Rezeption in Japan verständlicherweise erschweren, in Detailaspekten Fragen und Hinweise auf die japanische Forschung zurückwerfen kann, die dort einen weiteren, wenn vielleicht auch nur marginalen Perspektivwechsel ermöglichen, bleibt abzuwarten. HistLit 2007-3-210 / Maik Hendrik Sprotte über Laurinat, Marion: Kita Ikki (1883-1937) und der Februarputsch 1936. Eine historische Untersuchung japanischer Quellen des Militärgerichtsverfahrens. Münster 2006. In: H-Soz-uKult 18.09.2007. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart U. Leitner (Hrsg.): Alexander von Humboldt Leitner, Ulrike (Hrsg.): Alexander von Humboldt. Von Mexiko-Stadt nach Veracruz. Tagebuch. Berlin: Akademie Verlag 2005. ISBN: 3-05-004136-6; 184 S. Rezensiert von: Christoph Pause, Hannover Alexander von Humboldt ist eine der beliebtesten Figuren der deutschen Wissenschaftsgeschichte. Seine Person ruft auch heute noch das Interesse von Wissenschaftlern und Laienpublikum hervor. Die Neuedition der Hauptwerke in der von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen „Anderen Bibliothek“ vor einigen Jahren hat noch einmal deutlich gemacht, wie sehr Humboldt die Leser fasziniert (und dass damit Geld zu verdienen ist, wie nicht zuletzt Daniel Kehlmann mit seinem Erfolgsroman belegt hat).1 Abseits dieser Publikumserfolge arbeitet die Alexander-vonHumboldt-Forschungsstelle an der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften seit Jahrzehnten daran, das Tagebuchwerk Humboldts zu edieren. Eine Herkulesaufgabe, wenn man bedenkt, dass dieses Werk tausende, in oft fast unleserlicher Schrift in mehreren Sprachen eng beschriebene Seiten umfasst, die nach Humboldts Rückkehr nach Berlin bis zu seinem Lebensende als Basis für die Abfassung seines so genannten Reisewerks dienten. Zu diesem Zweck hat Humboldt selbst die Tagebücher durch nachträgliche Notizen und LektüreExzerpte ergänzt. Er hat die Schriften teilweise neu angeordnet und so die Tagebücher immer wieder neu gestaltet. Die vorliegende Edition eines Teils der Tagebücher, die Humboldt während seines rund einjährigen Aufenthalts in Neu-Spanien/Mexiko geführt hat, reiht sich ein in diese Folge von Tagebuch-Editionen, die die Alexander-vonHumboldt-Kommission, später Alexandervon-Humboldt-Forschungsstelle herausgegeben hat. Die Herausgeberin ordnet ihre Edition knapp, aber sehr präzise in die Geschichte der Herausgabe der Humboldt-Tagebücher 1 Humboldt, Alexander von, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Ediert von Ottmar Ette und Oliver Lubrich, Frankfurt am Main 2004; Kehlmann, Daniel, Die Vermessung der Welt, Reinbek 2005. 2007-3-184 ein. Das Tagebuch „Von Mexiko-Stadt nach Veracruz“ umfasst die Aufzeichnungen Humboldts in den knapp sieben Wochen, die er benötigte, um von der Hauptstadt zum Hafen am Golf von Mexiko zu reisen. Eben weil es sich nur um wenige Wochen handelt und die Aufzeichnungen demnach nicht so umfangreich sind, sind die Eintragungen erstmals komplett ediert worden, das heißt mit allen wissenschaftlichen Beobachtungen und Messergebnissen, die Humboldt festgehalten hat. Bei den bisherigen Editionen war dies aus Zeit- und Kostengründen nicht möglich (S. 10). Die vorliegende Tagebuch-Edition gibt einen eindrucksvollen Einblick in die Arbeitsweise des reisenden Gelehrten Humboldt: Er zeichnete fast alles auf, was ihm wichtig erschien, ohne erkennbare Systematik. Die Tagebücher dienen ihm offensichtlich einfach als Sammelstelle für alle Eindrücke und Reflexionen, für geologische, astronomische und geodätische Messungen, für Exzerpte und Zeichnungen. So nutzt Humboldt einen Aufenthalt in Cholula, um von dort die Höhe verschiedener Berge, etwa des Popocatépetl, zu bestimmen. Zudem gibt er die mythischen Erzählungen der Bevölkerung über die Entstehung der Pyramide von Cholula wieder, unterbrochen von Berechnungen zu Höhe und Umfang des Bauwerks. Eingefügt ist ein Zettel, der sich mit einer Rezension auseinandersetzt, die Jahre später in einer deutschen Zeitung über sein Buch „Vues des cordilleres“ erschienen ist (S. 57). Ein gutes Beispiel dafür, wie Humboldt über die Jahre mit seinen Aufzeichnungen gearbeitet hat, wie er sie für seine wissenschaftliche Tätigkeit in Berlin genutzt hat. Ergänzt werden diese Aufzeichnungen durch Randbemerkungen, die auf andere Seiten in seinem Tagebuch verweisen, die das Geschriebene zusammenfassen, mit Gelesenem in Beziehung setzen. Die vorliegende Edition der Aufzeichnungen Humboldts vom 20. Januar bis zum 7. März 1804 ist ausgesprochen aufschlussreich, denn sie zeigt eindrucksvoll, wie Humboldt seine unterschiedlichen wissenschaftlichen Interessen befriedigt hat und wie er die verschiedenen Ergebnisse seiner Messungen und Beobachtungen versucht hat zusammen- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 471 Außereuropäische Geschichte zuführen. Stärker als in den bislang veröffentlichten Tagebüchern seiner Reise verdeutlicht diese Edition, wie ausführlich und umfangreich Humboldt gemessen hat, um etwa die untere Schneegrenze in der mexikanischen Sierra zu ermitteln. Unmittelbar darauf folgen dann Überlegungen zur Geologie, anthropologisch-soziologische Betrachtungen der Einwohner der Gegend, die abgelöst werden von botanischen Beobachtungen: Humboldt praktiziert in seinen Tagebüchern in nuce, was er später als Hauptaufgabe seines Schreibens und Denkens bezeichnen wird – die physische Weltbeschreibung. Der Herausgeberin ist mit dieser Edition ein großer Wurf gelungen. Ihre Bedeutung liegt nicht nur darin, die Lücke in der Gesamtedition von Humboldts Tagebüchern zu verkleinern. Entscheidender ist, dass sie alle Eintragungen vollständig wiedergibt und dem Leser somit ermöglicht, einen noch genaueren Blick als bislang in die Werk- und Denkstatt Alexander von Humboldts zu tun. HistLit 2007-3-184 / Christoph Pause über Leitner, Ulrike (Hrsg.): Alexander von Humboldt. Von Mexiko-Stadt nach Veracruz. Tagebuch. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult 10.09.2007. Levine, Elana: Wallowing in Sex. The New Sexual Culture of 1970s American Television. Durham, NC: Duke University Press 2007. ISBN: 978-0822339199; 336 S. Rezensiert von: Felix Krämer, Hamburg Wallowing – sich suhlen, wälzen, schwelgen in. Das US-Fernsehen der 1970er-Jahre habe sich im Sex gesuhlt, zitiert die Medienwissenschaftlerin Elana Levine im Titel ihres Buches einen anonymen Fernsehmacher aus jener Zeit (S. 2). Hinter dem reißerischen Titel verbirgt sich eine ausgesprochen lesenswerte Studie, in der Levine geschickt Kultur- und Medientheorie verbindet sowie Ansätze aus Gender und Queer Studies heranzieht, ohne sich dabei im theoretischen Geflecht zu verfangen. Vielmehr zeigt sie auf, wie das Fernsehen in den 1970er-Jahren die so genannte sexuelle Revolution der späten 1960er-Jahre aufnahm und diese in wohldosierten Teilen in 472 den Mainstream der Gesellschaft transportierte. Die Fernsehprodukte der 1970er-Jahre werden von Levine auf ihre gesellschaftspolitische Wirkung befragt und eingeordnet vor dem zeithistorischen Hintergrund von Frauen-, Jugend-, Schwulen- und Lesbenbewegung sowie auch der Bürgerrechtsbewegung, die bereits in den frühen 1960er-Jahren in breiterer Front begonnen hatte, rassistische Stereotype um ‚schwarze Sexualität’ zu attackieren (S. 9). Die Analyse fördert eine bemerkenswerte Ambivalenz zu Tage, die kennzeichnend ist für die Übertragung einiger Impulse der neuen sexuellen Kultur in die Wohnzimmer der US-AmerikanerInnen. Die drei großen Fernsehanstalten ABC, NBC und CBS bewirkten mit ihrer Kommerzialisierung des Sexes via TV zweierlei: Einerseits verankerten sie eine breitere Palette von möglichen Rollenzuschreibungen in der US-Kultur, andererseits wurden in den unzähligen TVProduktionen, die im weiteren Sinne sexuell aufgeladene Körper präsentierten, systematisch radikalere Tendenzen aus der Subkultur der sexuellen Revolution gekappt. So subsumiert Levine in der Schlussfolgerung: „The new sexual culture of 1970s television changed Americans’ relationship to the sexual revolution, securing some of its most significant gains while minimizing some of its more radical impulses.“ (S. 253) Levine behandelt die sexualisierten Filmund Fernsehwelten in sechs Kapiteln. Das Buch ist nach thematischen Gesichtspunkten untergliedert und orientiert sich nur gelegentlich an der Chronologie der 1970er-Jahre. Unter dem Titel „Kiddie Porn Versus Adult Porn“ fokussiert Levine im ersten Kapitel die medienökonomischen Verhältnisse des Untersuchungszeitraums und führt den Wettbewerb der drei großen Medienkonzerne im Fernsehgewerbe untereinander vor Augen. Erstens ist in diesem Zusammenhang auffällig, dass das Aufkommen der neuen Thematik ‚Sex’ maßgeblich dazu beitrug, die Quotenanteile im Fernsehgeschäft neu zu verteilen. So konnte beispielsweise ABC, ein bis dato recht mäßig erfolgreiches Network, das aber in den 1970er-Jahren besonders zielstrebig auf Sex gesetzt hatte, von dem neuen Rückenwind profitieren. Zweitens hebt Levine her- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart E. Levine: Wallowing in Sex vor, dass zur Mitte der 1970er-Jahre hin deutlich wurde, dass die Fernsehanstalten selbst eine ‚sexy’ Identität brauchten und diese im Zuschnitt ihrer jeweiligen Formate kreierten (S. 20). Die beiden folgenden Kapitel befassen sich mit der Begrenzung von Sexualitätsdarstellungen im TV-Medium. „Not in my Living Room“ heißt das zweite Kapitel, in dem Levine Tabus und Versuche der Eindämmung des ‚Sexes’ in der Fernsehlandschaft der 1970er-Jahre beschreibt. Neben Selbstregulierungsmechanismen innerhalb der TVIndustrie – hauptsächlich durch die Vereinigung NAB (National Association of Broadcasters) (S. 60ff.) – führt Levine das religiösmoralisierende Werk der Journalistin Mary Lewis Coakley „Rated X: The Moral Case Against TV“ von 1977 an – eine erbitterte Anklage, die im Kern die moralischen Abgründe der neuen Fernsehformate anprangerte. Das Buch reihte sich ein in eine breitere Bewegung der christlichen Rechten, die gegen Ende der 1970er-Jahre begann, auf verschiedenen politischen Ebenen gegen den angeblichen ‚Sittenverfall’ in der US-Gesellschaft zu mobilisieren. Coakley beschwor in ihrem Traktat die Gefahren expliziter Darstellung verschiedener Sexualitätspraktiken im Fernsehen und der Titel ihres Buches gab den Zensurbestrebungen einen Namen: X-Rate (S. 48). Allerdings erläutert Levine, dass sie, trotz aller möglichen Versuche (auch seitens der Regierung) auf die Inhalte des medial verbreiteten Materials einzuwirken, in ihrer Studie von ‚Regulation’ und eben nicht von ‚Zensur’ sprechen will. (S. 266f., Anm. 2.2.) Hintergrund für den Vorbehalt gegenüber dem Zensurbegriff ist Levines Verwendung eines Machtbegriffs im Sinne Michel Foucaults, der in seinen Untersuchungen zur modernen Sexualitätsgeschichte nicht davon ausgeht, dass Macht lediglich repressiv und ‚von oben’ auf die Darstellungen und Realitäten einwirken kann, sondern bereits produktiver Teil des Konstruktionsprozesses von Figuren und Zuschreibungen sexualisierter Körper ist.1 Das bedeutet auch für Elana Levines Analyse, dass für die Sexualisierung der Fernsehlandschaften vielschichtige Mechanismen in den 1 Foucault, Michel, Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen, Bd.1, Frankfurt am Main 1983, S. 17ff. 2007-3-125 Blick geraten, die das Bild einer an die Oberfläche drängenden Subkultur, die offensiv für ‚die wahrhafte Befreiung der Sexualität’ stritt und gegen eine prüde und unterdrückende Herrschafts-Kultur ankämpfte, fraglich erscheinen lassen. Dies zeigt Levine bereits im dritten Kapitel, wobei dieses unter dem Titel „The Sex Threat“ noch zwischen Begrenzungsforderungen und der Faszination an der beginnenden ‚sexpanic’ hin und her changiert. Bei der Lektüre des Kapitels offenbart sich aber überzeugend die (produktive) Repräsentation einer von Sexualität geradezu gefährdeten Jugend im Fernsehmedium der 1970er-Jahre. Die in diesem Kontext aufgeworfenen Bedrohungsszenarien sind eng verknüpft mit der Furcht vor sich verflüchtigenden Familienwerten, wie sie auch in anderen Medien (beispielsweise Zeitschriften oder Ratgeberliteratur) jener Zeit Verhandlungsgegenstand waren. Besonders die Bedrohung jugendlicher Konsumenten durch die Sexualitätsdarstellungen schien sich im Verlauf des Jahrzehnts stetig zu erhöhen, betrachtet man die sich steigernde Beschäftigungsintensität mit dem Thema allein im Fernsehen. Das Fernsehen selbst perpetuierte in Filmen über Runaways, minderjährige Mädchen, die in die Prostitution gerieten oder Vergewaltigungen zum Opfer fielen, die paranoide Angst vor einer neuen sexuellen Freiheit und ihrem Mündungsdelta in Chaos und Gewalt (z.B. Born Innocent, NBC 1974). Levine stellt dazu fest: „Television movies often represented the fears expressed in regulatory discourse while instigating much regulatory angst about their own effects on young viewers.“ (S. 13) Im vierten Kapitel wendet sich das Blatt endgültig von der Regulation zur Produktion sexueller Darstellungen. Levine zeigt auf, wie trotz Begrenzungsbegehrlichkeiten und ‚sex-panic’ in den 1970er-Jahren neue Modi sexueller Rollenzuschreibungen im Fernsehprogramm auszumachen sind. „Symbols of Sex – Television’s Women and Sexual Difference“ lautet der Titel des Kapitels, in dem Levine unter anderem nachzeichnet, wie Mitte der 1970er-Jahre eine Wonder Woman (ABC, 1974) geboren wurde und als Leitbild einer aktiven Weiblichkeit neue Sphären im Bewegungsraum ‚der Frau’ erkämpfte. Auch Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 473 Außereuropäische Geschichte Charlie’s Angels begannen bereits zu dieser Zeit Verbrecher zu jagen (ABC, 1976). Allerdings weist Levine darauf hin, dass diese selbstbewussten weiblichen Sexsymbole der 1970er-Fernsehwelt jung, attraktiv (in der Regel weiß) und bis zu einem gewissen Grad auch Objekt heterosexuell-männlicher Begehrensprojektion zu sein hatten. Somit standen diese Figuren gewissermaßen im Gegensatz zu den Forderungen der Frauenbewegung. Zwar absorbierten solche Frauenkörper einen Teil der sexuellen Kultur und eines neuen Typus Frau, repräsentierten die grundlegenden Emanzipationsforderungen des Feminismus jener Zeit aber in keiner Weise (S. 125ff.). Im fünften Kapitel richtet Levine den Blick auf unterschwellige, implizite Formen des Sexes im Fernsehen. „Sex with a Laugh Track“ ist es betitelt und legt dar, wie in ComedySendungen wie z.B. The Sonny and Cher Comedy Hour (CBS, 1971-74), Sitcoms wie Happy Days (ABC, ab 1974) oder Game Shows, beispielsweise Match Game (CBS, 1973-79) sexuelle Praktiken in Anspielungen thematisiert wurden, die in expliziter Darstellung weitestgehend nicht zum Spektrum möglicher Äußerungen gehört hätten. So konnten durch die ironisierende Distanz – teilweise auch durch homophobe Untertöne – ‚Normabweichungen’ benannt werden, ohne dass auf der symbolischen Ebene der Fernsehunterhaltung grundsätzlich die heteronormative und an kleinfamiliären Strukturen orientierte Verfasstheit der US-Gesellschaft in Zweifel gezogen werden musste bzw. sollte (S. 207). In den späten 1970er-Jahren war zum Beispiel die von ABC gesendete Serie The Love Boat eine äußerst populäre Produktion. Auf dem Love Boat verbanden sich sexuelle Beziehungen und humoreske Anspielungen auf Sex mit moralischen Abfederungen (S. 182). So konnten Geschichten um Promiskuität, schwule Beziehungen, lesbische Sexualität etc. in einer Weise präsentiert werden, dass sie den Konsumenten erreichten, ohne jedoch die gesellschaftspolitischen und -kritischen Dimensionen zu transportieren. Levine beschreibt darüber hinaus einen bemerkenswerten Disput zwischen ABC und den Produzenten des Love Boats. ABC hatte 1979 gefordert, dass mehr schwarze Schauspieler in der „overwhelmingly white show“, wie Levine 474 The Love Boat bezeichnet, eingesetzt werden sollten. Daraufhin wurden afroamerikanische Akteure in einigen Episoden in die Story eingeflochten. Es wurden aber im Plot jener Episoden sexuelle Anspielungen oder gar Beziehungen mit den weißen Figuren ausgeschlossen. Dieses Beispiel zeigt, wie (auch) auf der symbolischen Ebene der Fernsehunterhaltung die rassistische ‚colorline’ inszeniert und festgeschrieben wurde (S. 185f.). Ein Thema, das in den 1970er-Jahren wie kein zweites polarisierte, greift Levine im sechsten und letzten Kapitel unter der Überschrift „From Romance to Rape“ auf. Die mediale Rezeption des Themas ‚Vergewaltigung’ war gezeichnet durch ein von Widersprüchen bevölkertes Deutungsspektrum. Dieses reichte beispielsweise vom Kampf der feministischen Bewegung für die konsequente Verfolgung von Vergewaltigungen an Frauen als Straftatbestand bis hin zur Verharmlosung der Gewaltakte oder zu deren Romantisierung. Bereits zu Beginn der 1970erJahre hatte ein Abgeordneter des Staates New York, den Levine eingangs des Kapitels zitiert, die Vermutung geäußert: „The difference between rape and romance is a very thin line.“ (S. 208) Die obsessive Beschäftigung in verschiedenen Fernsehformaten mit Geschichten, die von Vergewaltigungen erzählten, steigerte sich während des Jahrzehnts und erreichte einen Höhepunkt in der populären ABC Soap Opera General Hospital. An dieser Stelle wurden die über zehn Millionen ZuschauerInnen der Serie 1979 Zeugen der Vergewaltigung einer jungen Frau durch den männlichen Protagonisten. Zwei Jahre darauf konnte das Publikum 1981 der Hochzeit jener beiden Fernsehfiguren beiwohnen. Levine beschreibt ihre Analyse der Vergewaltigungsgeschichten im Fernsehen des fraglichen Jahrzehnts folgendermaßen: „Scarce to nonexistent before the 1970s, rape stories became standard fare in daytime serials during the decade, steadily building to the virtual explosion of rape plots at decade’s end.“ (S. 209) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 1970er-Jahre – und dabei kann durchaus ein übermäßig langes Jahrzehnt von 1968 bis 1981 gemeint sein – sich geradezu anbieten für eine kritische Medienanalyse im Kontext der Sexualisierung des Sym- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart D. Lowy: The Japanese New Woman bolischen. Warum? – Die Dekade der 1970erJahre erscheint beim ersten Hinsehen wie eine Schaltstelle zwischen verschlepptem Aufbruch emanzipativer Kräfte und einer bereits beginnenden Restauration seitens der Bewahrer von Tradition und Moral in den USA. Das Fernsehen war zu dieser Zeit das Massenmedium schlechthin. Es ist demzufolge eine drängende Aufgabe der Kultur- und Geschichtswissenschaften, die medialen Diskurse um die neue Frau, den angeblich kriselnden Mann sowie die Stränge um die Sexualisierung der öffentlichen Sphäre körpergeschichtlich genau unter die Lupe zu nehmen – wie Elana Levine es in ihrer Betrachtung der Fernsehwelten tut. Dies ist nämlich ein wesentlicher Teil einer Geschichte der Nach-1960er-Jahre, der gegenwärtig in den Fokus von körpertheoretisch fundierten Geschlechter-, Sexualitäts- und somit Gesellschaftsanalyse gerückt werden sollte. In jedem Fall beleuchtet Elana Levines Studie eine wichtige sowie raumgreifende Schnittstelle zwischen Sexualitätsgeschichte und Medienkultur. Spannend wäre darüber hinaus zu untersuchen, wie die angeführten TV-Produktionen auch als Exporteure einer sexualisierten und vergeschlechtlichten USKultur verstanden werden können – nämlich vor dem Hintergrund einer sich bereits in den 1970er-Jahren globalisierenden Film- und Fernsehwelt. Dies würde den Blick für kulturtransferierende Mechanismen weiten und könnte den weltweiten Erfolg von US-Serien und Filmformaten in einen machttheoretischen Kontext stellen. Aus historiographischer Sicht wäre es außerdem vielversprechend, wenn künftige Arbeiten ausgehend von solch einer fruchtbaren Untersuchung der geschlechtlich geprägten Medienkultur in den USA der 1970er-Jahre die politische Bedeutung medial transportierter Diskurse noch stärker historisch verorten würden. Auf diese Weise können Sexualitäts- und Geschlechtergeschichten zu einer umfassenden politischen Kulturgeschichte werden. Jüngste Debatten aus dem Feld der Geschichtstheorie eröffnen solche Perspektiven im hochaktuellen Spannungsfeld zwischen Kultur, Medien, Körper und Geschichte.2 2 Frevert, Ute; Braungart, Wolfgang (Hrsg.), Sprachen des Politischen. Medien und Medialität in der Ge- 2007-3-181 HistLit 2007-3-125 / Felix Krämer über Levine, Elana: Wallowing in Sex. The New Sexual Culture of 1970s American Television. Durham, NC 2007. In: H-Soz-u-Kult 16.08.2007. Lowy, Dina: The Japanese New Woman. Images of Gender and Modernity, 1910-1920. Piscataway, NJ: Rutgers University Press 2007. ISBN: 978-0813540450; 192 S. Rezensiert von: Nadin Hee, SFB 700, Freie Universität Berlin Seit längerem versuchen kulturgeschichtliche Studien, die sich mit Japans „Moderne“ oder „Modernisierung“ beschäftigen, von modernisierungstheoretischen Ansätzen wegzukommen.1 Zudem finden alternative Kategorien wie Gender – oft allerdings nach wie vor als Geschlecht „Frau“ verstanden – Berücksichtigung.2 In diese Forschungsrichtungen lässt sich Dina Lowys Buch über die „Neuen Frauen“ in Japan einordnen. Es beruht auf einer 2001 an der Rutgers Universität abgeschlossenen Dissertation. Das Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan breit diskutierte so genannte „Frauenproblem“ als Ausgangslage nehmend, untersucht die Autorin das Phänomen der „Neuen Frauen“. Dabei geht es ihr um diskursive Bilder sowohl in den Medien und zeitgenössischer Intellektueller als auch um die eigenen Stimmen einer literarischen Gruppe namens Seitôsha. In ihre Studie einfließen lässt sie auch biografische Hintergründe einzelner dieser über ihren teilweise unkonventionellen Lebensstil als typische „Neue Frauen“ eingestuften Frauen. Dabei will sie einen Einblick in die Geschichte der japanischen „Neuen Frauen“ zwischen 1910 und 1920, insbeschichte, Göttingen 2004. zum Beispiel: Hardacre, Helen; Kern, Adam (Hrsg.), New Directions in the Study of Meiji Japan, New York u.a. 1997; Harootunian, Harry, Overcome by Modernity, Priceton 2000; Vlastos, Stephen (Hrsg.), Mirror of Modernity. Invented Traditions of Japan, Berkeley u.a. 1998. 2 Siehe zum Beispiel: Garon, Sheldon, Molding Japanese Minds: the State in Everyday Life, Princeton 1997; Sato, Barbara Hamill, The New Japanese Women: Modernity, Media and Women in Interwar Japan, Durham 2003. Andrea Germer, Ulrike Wöhr und Vera Mackie geben voraussichtlich im Herbst 2007 einen Band mit dem Titel „Gender, Nation State in Modern Japan“ heraus. 1 Siehe Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 475 Außereuropäische Geschichte sondere aber deren Koppelung an das Narrativ der japanischen Modernisierung geben. Diskurs definiert Lowy in Anlehnung an Michel Foucault. Bei Gender zitiert sie Joan Scott und geht nicht von biologischen Geschlechtern, sondern Konstruktion von Geschlecht aus. Sie distanziert sich von Modernisierungstheorien, findet aber die Kategorie Moderne und Modernisierung im Sinne von Sheldon Garon und Tetsuo Najita als Analyseinstrument verwendbar. Im Unterschied zu Garon interessiert sie sich weniger für die Kollaboration zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und deren Interessen an der Idee der Modernisierung Japans, sondern mehr für Konflikt und Widerstand. Unter Widerstand versteht sie Äußerungen der Seitô-Frauen, die sich gegen staatliche unterstützte Meinungen richteten. Lowy möchte dabei untersuchen, wie diese Moderne und gender definierten. Zu Beginn diskutiert sie, wie nach einer Phase der unkritischen Übernahme westlicher Gedanken und Institutionen in den späten 1880er-Jahren eine Hinwendung zum Shintoismus und zu konfuzianischem Gedankengut zu beobachten war. Dies ging einher mit der Implementierung hierarchisierender patriarchalischer Sozialstrukturen. 1890 wurden beispielsweise politische Versammlungen von Frauen untersagt, 1898 im Zivilgesetz der Frau eine untergeordnete Stellung im Haushaltssystem zugewiesen. Nur Männer waren legale Personen, verheiratete Frauen hatten keinen Besitz, außerehelicher sexueller Verkehr war nur bei Frauen strafbar. In den 1890er-Jahren tauchte zudem die Ideologie der „guten Ehefrau, weisen Mutter“ (ryôsai kenbô) auf, die auf konfuzianischen Ideen basierte, aber auch westliche Ideen inkorporierte. Einige konservative japanische Erzieherinnen sahen darin ein Zeichen für Fortschritt, andere Frauen aber wiederum ein Mittel der Regierung, die Rechte und Rolle der Frauen einzuschränken und auf ihren „Dienst an der Nation“ zu reduzieren. Als repräsentative Gruppe solcher Frauen sieht Lowy die 1911 gegründeten Seitôsha. Diese Gruppe grenzt sie ab von Vorläuferinnen der „Neuen Frauen“ wie zum Beispiel Frauen, die sich im sozialistischen Milieu bewegten. Die Mitglieder der Seitôsha waren die ersten, die als Frauen eine eigene Zeitschrift veröffentlichten und 476 sowohl von anderen als „Neue Frauen“ beschrieben wurden als auch sich selbst so bezeichneten. Lowy beschreibt, wie in der späten MeijiZeit westliche Theaterstücke von Henrik Ibsen, George Bernard Shaw, Hermann Sudermann und anderen eingeführt und als Teil eines neuen modernen Theaters aufgeführt und breit diskutiert wurden. An den weiblichen Protagonisten dieser Stücke, die konventionelle Frauenrollen ablehnten, entzündete sich in Japan die Diskussion über die „Neuen Frauen“. Dabei analysiert Lowy einerseits die Reaktion der Medien, andererseits aber auch die der Seitôsha am Beispiel der Protagonistin Nora aus Ibsens „Ein Puppenheim“. In dieser frühen Phase der Seitô-Frauen unterschieden sich ihre Meinungen oft wenig von denen der männlichen Kritiker. Als zweites Beispiel zieht die Autorin das Stück „Magda“ von Sudermann und diskursive Reaktionen darauf heran. Dabei geht es auch um die Frage der Zensur, da das Stück wegen „Verletzung der öffentlichen Moral“ verboten worden war. Auch eine Ausgabe der Zeitschrift „Seitô“, des Sprachrohrs der Seitôsha, wurde kurz nach der Einstellung des Stücks zensiert. Nach den Auseinandersetzungen über die „Neue Frau“ anhand des modernen Theaters fokussierten laut Lowy die männlich dominierte Presse sowie einige Intellektuelle auf den Lebensstil der Seitôsha-Mitglieder, die als Paradebeispiele für die „Neuen Frauen“ und als gefährlich, unseriös und unmoralisch denunziert wurden. Häufige Vorwürfe waren, dass sie an Alkohol, Sex, gleichgeschlechtlicher Liebe, Bordellen und jüngeren Männern interessiert seien. Im Anschluss daran untersucht Lowy, wie die Seitô-Frauen diesen Definitionen der „Neuen Frau“ eigene entgegenstellten. Diese sich teilweise stark voneinander unterscheidenden, aber meist positiv konnotierten neuen Bilder riefen wiederum eine vielschichtigere Diskussion über die „Neuen Frauen“ hervor, die sich nicht nur auf Aspekte des Lebenswandels beschränkte, sondern häufig um weibliches Selbstverständnis oder Fragen nach legaler Gleichberechtigung drehte. In diesem Kontext – so Lowy – ist auch die Entstehung einer zweiten Gruppe „Neuer Frauen“ zu sehen, der Shinshinfujinkai („Verei- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart L. Yingtai u.a.: Taiwans ’kulturelle Schizophrenie’ nigung der Wahren Neuen Frauen“). Diese Gruppe offerierte eine alternative Vision der „Neuen Frau“ – die der Verheirateten und Mutter. Sie lehnte Japans traditionelle Werte und Moral nicht ab, trat aber doch für Gleichberechtigung in bestimmten Bereichen sowie für Monogamie ein. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Seitôsha und dieser Gruppe wurden von den Medien als Rivalität konstruiert, trugen aber zu einer Erweiterung der Debatte um die „Neuen Frauen“ bei. Das Buch schließt mit einem kurzen vergleichenden Überblick über das Phänomen der „Neuen Frauen“ in mehreren anderen Ländern. Nach einer Analyse der Attribute und Debatte im euroamerikanischen Kontext streift Lowy Fallbeispiele aus Ägypten, China und Korea. Damit sollen die Effekte der Moderne und die unterschiedlichen Reaktionen auf sie in verschiedenen Ländern gezeigt werden. Im Anschluss daran kommt die Autorin zurück auf die japanischen „Neuen Frauen“ und gibt einen kurzen Ausblick, wie sie sich in den 1920er- und 1930er-Jahren weiterentwickelt hatten. Dina Lowys gut geschriebenes Buch gibt auf der Grundlage fundierten Quellenmaterials Einblick in vielschichtige Diskurse über die „Neuen Frauen“ Japans zwischen 1910 und 1920. Die Autorin macht klar, dass diese Diskurse nicht losgelöst von Regierungsprogrammen wie „Zivilisierung und Aufklärung“ und Konzepten wie „gute Ehefrau, weise Mutter“ zu denken sind und mehrere oft konkurrierende Vorstellungen von gender-Rollen kursierten. Sie thematisiert damit einen bisher wenig beachteten Aspekt der japanischen Modernisierungsdebatte in den 1910er-Jahren. Problematisch jedoch erscheint ihr teilweise etwas freier Umgang mit Begrifflichkeiten. So erfahren Leserinnen und Leser nichts davon, wie die einzelnen SeitôFrauen den Begriff „modern“ definierten, was Lowy aber ausdrücklich als Desiderat ihrer Arbeit postuliert. In den zitierten Stellen sprechen diese nie von „modern“, sondern Schlüsselbegriffe in den Quellen sind vielmehr eigenes „Erwachen“ (sameru) oder „selbstbewusst werden“ (jikaku suru) (z.B. S. 32). Genauso wenig lassen sich Aussagen von Lowy zu der von ihr häufig postulierten Dichotomie von „westlich“ und „japanisch“ (z.B. S. 11) in 2007-3-145 den Quellenzitaten wiederfinden. Dieser Umgang mit Quellen- und Methodenvokabular spiegelt sich nicht zuletzt auch in der Bibliografie: Eine Aufteilung in Quellen und Sekundärliteratur hätte das Nachschlagen einzelner Titel erleichtert. HistLit 2007-3-181 / Nadin Hee über Lowy, Dina: The Japanese New Woman. Images of Gender and Modernity, 1910-1920. Piscataway, NJ 2007. In: H-Soz-u-Kult 07.09.2007. Lung, Yingtai; Meyer, Christian: Taiwans ’kulturelle Schizophrenie’. Drei Beiträge Lung Yingtais zur taiwanesischen Identitätsdiskussion. Mit einem Anhang „Ein offener Brief an Herrn Hu Jintao“. Bochum u.a.: projekt verlag 2006. ISBN: 978-3-89733-136-5; 101 S. Rezensiert von: Ann Heylen, Katholieke Universiteit Leuven Essays zur taiwanesischen Identitätsdiskussion bilden eine wichtige Grundlage für ein Verständnis Taiwans in seinen geopolitischen Dimensionen. Leider ist chinesischsprachiges Quellenmaterial vielen Forschern noch immer unzugänglich. Daher ist diese Übersetzung dreier Essays Lung Yingtais durch Christian Meyer sehr zu begrüßen. Ergänzt wird Meyers Übersetzung von einer Einleitung, einem ausführlichen Fußnotenkommentar und einem Literaturverzeichnis. In Taiwan ist die Autorin Lung Yingtai bekannt als Wissenschaftlerin, Essayistin und umstrittene Kulturpolitikerin. Von 1999 bis 2003 fungierte sie im Auftrag der Guomindang (GMD) als Direktorin des Kulturbüros der Hauptstadt Taibei. Zuvor sammelte sie während eines zehnjährigen Verbleibs in Deutschland (verheiratet mit einem deutschen Mann) Lebenserfahrungen, die sich, wie Meyer im Vorwort präzisiert, zum Teil auch direkt in ihren Beiträgen niederschlagen (S.7). Das Buch gliedert sich in zwei Hauptkapitel, welche gleichermaßen den Hintergrund der Autorin und die Hauptthemen der Artikel und der Übersetzungen reflektieren. Das erste Kapitel, „Einleitung“, besteht aus sieben Unterkapiteln. Das abschlie- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 477 Außereuropäische Geschichte ßende Unterkapitel „Die fortgesetzte Debatte im Internetforum und andere Beiträge zur Diskussion“ (S. 26-28), verleiht dem Buch einen besonderen Mehrwert. Es ist lobenswert, dass Meyer den historisch-kulturellen Hintergrund nicht im Kontext einer chronologisch dargestellten Geschichte und Kultur Taiwans betrachtet. Im Gegenteil: Er fokussiert die drei Artikel auf die jüngste politische Geschichte Taiwans nach dem Regierungswechsel im Jahr 2000. Besondere Aufmerksamkeit erhalten auch der Ausgang der Präsidentenwahl 2004 sowie innen- und kulturpolitische Unterschiede zwischen der Demokratischen Fortschrittspartei (Minzhu Jinbu Dang, DPP) und der moderaten Taiwanisierungspolitik des früheren Präsidenten Lee Teng-hui. Hauptteil des Buches sind drei Artikel, die erstmals in vollständiger deutscher Übersetzung erscheinen, geschrieben im Vorwahlkampf des Jahres 2003/04 und zunächst in der China Times (Zhongguo Shibao) veröffentlicht. Weitere Verbreitung dieser Artikel, die zweifelsohne wichtige Zeitdokumente darstellen, gab es im Zeitungen des chinesisch¬sprachigen Auslands (Malaysia, Hong Kong, VR China) und auch im Internet. Der erste Artikel, „Zwischen Teehaus Wistaria und Starbucks: Taiwans Selbstbezogenheit“ ist, wie Meyer argumentiert, vor dem Hintergrund der forcierten „Internationalisierung“ zu betrachten (S. 22). Der Artikel, datiert vom 13. Juni 2003, entstand in einer Zeit, in der im Zuge der Internationalisierung verstärkt die Bedeutung des Englischen innerhalb des Bildungssystems betont wurde. Einige Politiker forderten sogar die Etablierung des Englischen als offizielle Staatssprache. Lung Yingtai kritisiert, dass „Internationalisierung“ nicht die Übernahme ausländischer Feste, Gebräuche oder Sprachen bedeuten sollte. Sie benutzt ein kräftiges Vokabular: „Auf den eigenen Nabel bezogene Selbstvernarrtheit [Taiwans] ist nicht nur ein Symbol der Zurückgebliebenheit des Landes, sondern sogar schon ein Zustand der krankhaften Degeneration der Kultur.“(S. 38) Was dies alles mit dem im traditionellen Stil erbauten Teehaus „Wistaria“ in Taibei zu tun hat, klärt sich am Ende des Artikels. Als Internationalisierung beschreibt Lung dort „die Art und Wei- 478 se, die andere verstehen können“. Dies, so die Autorin, fängt a priori damit an, sich selbst zu öffnen. Das amerikanische Starbucks-Café ist Symbol des Anderen. Um es aufzunehmen, benötigt man erst Wistaria als Symbol des Eigenen, so dass es von „mir“ erkannt werden kann. Je mehr Starbucks es gibt, desto wichtiger ist ein Teehaus „Wistaria“ (S.39). Im zweiten Artikel, „Heimat seit 50 Jahren: Taiwans ‚kulturelle Schizophrenie’“ (10.12. Juli 2003) reflektiert Lung Yingtai ebenfalls über die gegenwärtige Internationalisierungskrise Taiwans. Objekt der Kritik ist hier die Taiwanisierung oder Indigenisierung, die „schneller vonstatten geht als die Internationalisierung“ und Taiwan in seiner provinziellen und unveränderten Art gefangen hält (S. 41). Es ist mit einer Subjektivität geschrieben, die die tiefe Spaltung der Inselbewohner zwischen Einheimischen und Festländern typisiert. Lung Yingtai hat keinesfalls Unrecht, wenn sie schreibt, dass „die hohe Unterstützung für die Taiwanisierung die Antipathie gegenüber der Sinisierung übertrifft“ (S. 41). Diese Polarisierung Taiwanisierung versus Sinisierung ist nicht nur eingebettet in den gesellschaftlichen Hintergrund der Kolonialgeschichte Taiwans, sondern speist sich auch aus 50-jähriger Gewaltherrschaft und einer nach wie vor unsicheren politischen Zukunft. Bietet Lung Yingtai, wie es sich für eine Kulturkritikerin gebührt, konstruktive Kritik? Sie argumentiert philosophisch und benutzt viele Vergleiche. Die tief in das Fleisch eingewachsene Narbe der Taiwaner ist ‚China’ (S. 55). Wie sollen die Taiwaner das Element ‚China’ innerhalb ihrer eigenen Identität und ihres kulturellen Selbstverständnisses einordnen? Die Antwort Lung Yingtais ist keine weitere Tendenz zum „kulturellen Faschismus“ (S. 51) im Sinne einer Politik der „Taiwanisierung“1 , die „die Dämonisierung Chinas nur vergrößert und verstärkt“ (S. 50), sondern die notwendige Erkenntnis, dass die chinesische Kultur ein wertvolles Kapital Taiwans ist. Lung Yingtai argumentiert, dass Taiwan mit seiner Zivilgesellschaft, seiner starken Wirt1 Ein deutlicher Ausdruck der Taiwanisierungs-Politik und Taiwanesischseins ist die offizielle Propagierung des ‚Taiwanesischen’ oder der Süd-Fujian-Sprache (Minnanhua), die während des Kriegesrechts unterdrückt und daher als negativer Identitätsindikator erfahren wurde. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart J. Meyer-Aurich: Entstehung der ersten politischen Parteien in Paraguay schaft und dem hohen Bildungsniveau für die chinesische Kultur „ein Leuchtturm in der Dunkelheit“ und eine „in der Nacht leuchtende Perle der chinesischsprachigen Welt“ (S. 62, 66) sei. Das Konzept von Taiwan als Ort dieser modernen „kulturellen Renaissance“ der chinesischsprachigen Kultur ist Schwerpunkt des dritten Artikels, „Dem Meere zugewandt“ (29. September 2003). Insgesamt äußert sich die Autorin darin pessimistisch über den eigentlichen Geist der Kultur Taiwans. Sie argumentiert, dass Werte wie Offenheit, Akzeptanz, Toleranz und Pluralismus noch nicht zum Kerninhalt der taiwanesischen Kultur gehörten und die innere Selbstisolationshaltung wie früher weiterbestehe (S. 80-81). Lung Yingtai ist eine privilegierte Frau, die im Ausland studieren konnte und auch längere Zeit an verschiedenen Orten außerhalb Taiwans gelebt hat. Sie hatte die Chance, sich Internationalisierung eigen zu machen, und gehört daher – wie sie selbst meint – der Generation an, die dem Meere den Rücken zugekehrt hat. Dass Lung Yingtais scharfe Kritik an Taiwans Selbstbezogenheit äußert, kann durchaus im Kontext der 1985 erschienenen Essaysammlung Yehuoji (Wildes Feuer) gesehen werden. Darin fordert sie die Taiwaner noch vor Aufhebung des Kriegsrechts auf, nicht mehr still zu halten, sondern gegen Ungerechtigkeiten und Unterdrückung offen mit Zorn aufzubegehren (S. 19). In dieser Zeit verrichtete sie Pionierarbeit, indem sie es als Festländerin (waishengren) wagte, gegen die GMD Staatspartei zu schreiben. Die Taiwanisierung nach der Aufhebung des Kriegsrechts im Jahr 1987 ermöglichte es allen Bewohnern Taiwans, insbesondere jedoch den Einheimischen (benturen), normative Werte für ihre Stimme zur Geltung zu bringen. Gleichzeitig entwickelte sich mit der Überbetonung der taiwanesischen Partikularität eine ideologische Schizophrenie, mit der sich Lung Yingtai nicht anfreunden konnte. Ihre Antwort darauf ist eine Konzeption von Taiwan als Teil eines großchinesischen Kulturkreises. Diese Konzeption erschließt sich aus einem Brief an den chinesischen Präsidenten Hu Jintao, dessen Übersetzung „Ein offener Brief an Herrn Hu Jintao“ (25. Januar 2006, S. 82-89) als Anhang zu den drei Essays aufgenommen wurde. 2007-3-203 Ein besonderes Augenmerk der Kommentare Meyers liegt auf dem Vergleich der in Büchern publizierten Essays mit den Erstveröffentlichungen in Tageszeitungen. Wortwahländerungen, Umformulierungen und Auslassungen werden akribisch dargestellt. Insgesamt ist das Buch ein „Taiwan-Konzentrat“. Dennoch sollten die Leser wissen, dass es sich bei den Argumenten Lung Yingtais um die Standpunkte einer Person handelt. Das Buch sollte nicht in der Erwartung gelesen werden, dass es ein breites Spektrum des gegenwärtigen ideologischen Diskurses abdeckt. Hier hätte Meyer vielleicht überzeugender und mit mehr Abstand die Kontextualisierung der politischen Position Lung Yingtais darstellen können. HistLit 2007-3-145 / Ann Heylen über Lung, Yingtai; Meyer, Christian: Taiwans ’kulturelle Schizophrenie’. Drei Beiträge Lung Yingtais zur taiwanesischen Identitätsdiskussion. Mit einem Anhang „Ein offener Brief an Herrn Hu Jintao“. Bochum u.a. 2006. In: H-Soz-u-Kult 27.08.2007. Meyer-Aurich, Jens: Wahlen, Parlamente und Elitenkonflikte: Die Entstehung der ersten politischen Parteien in Paraguay, 1869–1904. Ein Beitrag zur Geschichte politischer Organisation in Lateinamerika. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2006. ISBN: 3-515-08838-5; 365 S. Rezensiert von: Barbara Potthast, Historisches Seminar, Universität zu Köln Obwohl sich fast alle lateinamerikanischen Staaten nach Erlangung der Unabhängigkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Republiken und somit zumindest formale Demokratien konstituierten, galt eine Untersuchung von Wahlen und Parteien lange Zeit als überflüssig, da die Verfassungen zumeist nicht beachtet wurden, Wahlen manipuliert und von gewalttätigen Auseinandersetzungen begleitet waren. Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Wahlen, trotz ihrer Defizite, einen wichtigen Beitrag zur Mobilisierung und Politisierung breiterer Bevölkerungsschichten geleistet haben. Für Paraguay scheint diese These nicht zuzutreffen, denn Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 479 Außereuropäische Geschichte das Land wurde, trotz gelegentlicher Wahlen im 19. Jahrhundert, weitgehend autoritär regiert, durch einen verheerenden Krieg gegen seine Nachbarn (1864-1870) politisch und sozio-ökonomisch zerstört und erlebte dann eine Phase politischer Liberalisierung, die ab den 1940er-Jahren wiederum in diktatorische Regime mündete. Allerdings existieren in Paraguay seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zwei Parteien, die bis heute das politische Leben bestimmen. Es stellt sich daher die Frage nach ihren Entstehungsbedingungen und den Faktoren, die ihre Langlebigkeit und Bedeutung erklären. Diese zu beantworten, ist das zentrale Anliegen der Dissertation von Meyer-Aurich. Darüber hinaus bettet der Autor seine Untersuchung in die zumeist am europäisch-nordamerikanischen Vorbild entwickelten Theorien zur Entstehung von Parteien ein. Der Autor arbeitet vor allem mit dem klassischen Ansatz von Maurice Duverger, da sich dieser als besonders geeignet erwies, berücksichtigt aber auch andere Theorien. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Tatsache, dass sich die Entstehungsbedingungen der beiden paraguayischen Parteien nicht von denjenigen in Europa unterschieden, es sich mithin um ein Zusammenspiel von parlamentarischen Gruppen und Wahlkomitees oder -clubs handelte, die sich in einer bestimmten Situation zu einer dauerhaften und umfassenderen Einheit zusammenschlossen. Allerdings spielten bei den Wahlen in Paraguay, anders als in Europa, inhaltliche Fragen kaum eine Rolle. Gewählt wurde aufgrund persönlicher Loyalitäten, strategischer Allianzen oder des Charismas eines Kandidaten, ein Aspekt, der, wie der Autor zu Recht bemerkt, für die Wahlforschung zu Europa und den USA bislang zu wenig beachtet wurde. Hier könnte die lateinamerikanische Debatte für die europäische Forschung fruchtbringend einbezogen werden. Die besonders große Bedeutung „caudillistischer“ Elemente in Paraguay liegt darin begründet, dass die Parteien hier keine unterschiedlichen sozialen Gruppen repräsentierten, da die klassischen Konfliktlinien zwischen Staat und Kirche, Kapital und Arbeit oder Agrar- und Industriewirtschaft hier nicht vorhanden waren. In diesem Punkt un- 480 terscheidet sich Paraguay von den meisten anderen lateinamerikanischen Staaten, nicht jedoch in dem Umstand, dass auch hier der Kreis der „mündigen Staatsbürger“, auf denen die liberalen Verfassungen basierten, sich auf eine kleine städtische Elite beschränkte. Allerdings war deren Anzahl aufgrund der sozio-ökonomischen und demographischen Zerstörungen des Krieges in Paraguay besonders klein. Trotz eines allgemeinen männlichen Wahlrechtes, das keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Besitz oder Alphabetisierung unterlag, blieb Politik eine Angelegenheit weniger gebildeter Männer, die darüber hinaus auch die Bereiche, die man heute als „Zivilgesellschaft“ bezeichnen würde, dominierten. Die Gründung der Parteien, so legt Meyer-Aurich überzeugend dar, erfolgte in Paraguay daher nicht aufgrund des Drängens einer ausgeschlossenen Gruppe von Beherrschten, die an der Macht teilhaben wollten, sondern aufgrund eines Konfliktes innerhalb der Elite selbst. Worin bestand nun dieser Konflikt? Die paraguayischen Parteien sehen immer wieder die Haltung ihrer Mitglieder zu dem umstrittenen Präsidenten Francisco Solano López und ihre Rolle im Krieg als einen entscheidenden Faktor an. Dieser These zufolge hätten sich die „Nationalisten“, die an der Seite des Diktators kämpften, vor allem in der Asociación Nacional Republicana (ANR, besser bekannt als Colorados, das heißt die „Roten“) gesammelt, wohingegen diejenigen, die auf Seiten der Alliierten kämpften und zumeist im argentinischen Exil gelebt hatten, sich in dem Centro Democrático (CD oder Azules, die „Blauen“) zusammengeschlossen hätten. Diese These, die allerdings schon 1993 von Paul H. Lewis eindeutig widerlegt worden ist, hält sich in den politischen Auseinandersetzungen bis heute hartnäckig. Dieses Ergebnis von Meyer-Aurich ist also nicht so neu, wie er den Leser glauben macht, allerdings widerlegt er Lewis Erklärung der Spaltung der Elite durch einen Generationenkonflikt. Und Meyer-Aurich erläutert, warum sich die Vorstellung von den „nationalistischen“ Colorados und den „unpatriotischen“ Liberalen bis heute so hartnäckig hält. Der Konflikt innerhalb der insgesamt liberal gesinnten Oberschicht trat auf, als der Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart G. Mund: Ostasien im Spiegel der deutschen Diplomatie Kreis derjenigen, der zu der Elite zählen konnte, aufgrund der allmählichen Erholung von den Kriegsfolgen anwuchs, die zur Verfügung stehenden Ämter jedoch nicht, und diese zudem von einer gut vernetzten Gruppe um Präsident Bernardino Caballero immer stärker monopolisiert wurden. Die ausgeschlossene Gruppe sah sich somit gezwungen, zur Erlangung von Ämtern – und damit Macht und Pfründen – ebenfalls ein stabiles und landesweit operierendes Netzwerk aufzubauen. In einer ausführlichen Analyse legt der Autor dar, dass sich die Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Partei weder auf einen ideologischen Konflikt, eine bestimmte Haltung zur nationalen Geschichte, eine Generation oder einen Klassenkonflikt zurückführen lässt, wohl aber eine Korrelation zwischen der Nähe zur Regierungspartei und der Ausübung eines staatlichen Amtes festzustellen ist. Wer schon über ein wichtiges politisches Amt verfügte, organisierte sich vorwiegend in der Regierungspartei, wer sich vom Zugang zu solchen Ämtern ausgeschlossen fühlte, im Centro Democrático. Die ideologischen Unterschiede beschränkten sich daher im Wesentlichen auf eine stärkere Betonung von staatlicher Autorität und innenpolitischer Ruhe als unerlässliche Basis für den Fortschritt auf Seiten der Colorados und stärkerer Betonung von Freiheit und Demokratie auf der anderen Seite. Die Langlebigkeit und die starke Bedeutung der Parteien auch für breitere Kreise der Bevölkerung entwickelte sich daher in den folgenden Jahren nicht aufgrund sich verschärfender ideologischer Konflikte, sondern aufgrund der Tatsache, dass die Parteien patriarchalische Schutz- und Hilfsfunktionen für ihre Mitglieder übernahmen und es schafften, die Loyalität durch emotionale Bindungen zu erhalten. Diese wurde durch eine gemeinsame Geschichte von Siegen und Niederlagen, Märtyrern und Symbolen geschaffen, die bis zum Krieg und den Diktatoren des 19. Jahrhunderts vorverlegt wurden. „Das Fundament der beiden traditionellen paraguayischen Parteien ist demnach in Wahrheit kein politisches, es ist ein überwiegend pseudohistorisches. Abgesehen von den zahlreichen sozialen Funktionen, die sie mit den Jahren übernehmen, haben die beiden 1887 gegrün- 2007-3-217 deten Parteien wohl nur aus einem Grund so lange überlebt und sind so stark geblieben: weil sie sich über all die Jahre von ihren eigenen Legenden ernährten.“ (S. 310f.) Die Arbeit von Jens Meyer-Aurich, die auf einer umfassenden Bearbeitung bislang nicht systematisch ausgewerteter Quellen basiert und deren prosopografische Ergebnisse im Anhang umfassend dokumentiert sind, stellt nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der politischen Geschichte eines Landes dar, das auch von der Historiographie zu Lateinamerika zumeist kaum beachtet wird, sie ist auch geeignet, unser Verständnis zur Entstehung und Stabilisierung von Parteien zu erweitern, indem strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede gerade am Beispiel eines „außergewöhnlichen“ Falles klarer erfasst werden. HistLit 2007-3-203 / Barbara Potthast über Meyer-Aurich, Jens: Wahlen, Parlamente und Elitenkonflikte: Die Entstehung der ersten politischen Parteien in Paraguay, 1869–1904. Ein Beitrag zur Geschichte politischer Organisation in Lateinamerika. Stuttgart 2006. In: H-Soz-u-Kult 17.09.2007. Mund, Gerald: Ostasien im Spiegel der deutschen Diplomatie. Die privatdienstliche Korrespondenz des Diplomaten Herbert v. Dirksen von 1933 bis 1938. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2006. ISBN: 351508732X; 343 S. Rezensiert von: Susanne Kuß, Historisches Seminar/Neuere und Neueste Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Auch die Diplomatiegeschichte, die in der Geschichtswissenschaft lange Zeit als gegenüber jeglichen methodischen Modernisierungsversuchen besonders resistentes Ressort galt, geht zwischenzeitlich neue Wege. Diplomaten werden nicht mehr nur als Handlanger einer von der jeweiligen Zentrale vorgegebenen Politik betrachtet. Untersuchungen zu ihrer sozialen Herkunft und politischen Prägung, ihren Weltbildern und ihrem Denken, ihren Ambitionen und Einflussmöglichkeiten sollen Erkenntnisse über die soziale Verankerung der Außenpolitik liefern und diplomati- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 481 Außereuropäische Geschichte sches sowie außenpolitischen Handeln deutlicher als bisher voneinander trennen.1 Um diese Ebenen genauer auszuloten, bietet sich ein Blick in die privatdienstliche Korrespondenz eines Diplomaten an, denn in diesem nichtoffiziellen Briefwechsel mit Freunden und Arbeitskollegen war der Ton offener und freier als in den amtlichen Berichten. Diese Briefe wurden nach Möglichkeit durch Privatpersonen überbracht, um die Gefahren der Zensur zu bannen. Allein durch die Auswahl solchen Quellenmaterials eröffnet sich somit ein Blick, der über das tagespolitische Geschehen hinausgeht. Im Mittelpunkt der Edition von Gerald Mund steht Herbert von Dirksen, einer der „großen“ Diplomaten des Auswärtigen Amtes. Zunächst in Osteuropa eingesetzt, war Dirksen zwischen 1933 und 1938 als deutscher Botschafter in Japan tätig. Damit befand er sich an einem „Brennpunkt der internationalen Politik“ (Hencke, Kiew, an Dirksen, Tokyo, 10. Juni 1934, S. 178), als die Verschärfung des chinesisch-japanischen Gegensatzes und die Herausbildung der Achse zwischen Berlin, Tokyo und Rom den Zweiten Weltkrieg einleiteten. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war Dirksen ein wichtiger Entscheidungsträger in der deutschen Ostasienpolitik, die zwischen Japan und China lavierte und vor allem daran interessiert war, die Sowjetunion in die Zange zu nehmen.2 Zur Drehschei1 Conze, Eckhart, Zwischen Staatenwelt und Gesellschaftswelt. Die gesellschaftliche Dimension in der Internationalen Geschichte. In: Loth, Wilfried; Osterhammel, Jürgen (Hrsg.), Internationale Geschichte. Themen - Ergebnisse - Aussichten, München 2000, S. 117140, hier: S. 127. Sowie: Schwabe, Klaus (Hrsg.), Das Diplomatische Korps 1871-1945, Boppard 1985; Sütterlin, Ingmar, „Russische Abteilung“ des Auswärtigen Amtes in der Weimarer Republik, Berlin 1994. Sowie speziell zu Ostasien: Scheidemann, Christiane, Zwischen Tradition und Abkehr: Die Chinapolitik deutscher Diplomaten 1919-1938. In: Kuß, Susanne; Schwendemann, Heinrich, Der Zweite Weltkrieg in Europa und Asien, Freiburg 2006, S. 143-160. Grundsätzlich auch: Biographisches Handbuch des Auswärtigen Dienstes 1871-1945, hrsg. vom Auswärtigen Amt, 2 Bände, Paderborn 2000 und 2005. 2 Fox, John P., Germany and the Far Eastern Crisis 1931-1938. A Study in Diplomacy and Ideology, Oxford 1982; Ratenhof, Udo, Die Chinapolitik des Deutschen Reiches 1871 bis 1945. Wirtschaft -Rüstung -Militär, Boppard 1987; ADAP, Serie C und D.; Martin, Bernd (Hrsg.), Deutsch-chinesische Beziehungen 192837. „Gleiche“ Partner unter „ungleichen“ Bedingungen, Berlin 2003; Leutner, Mechthild (Hrsg.), Deutsch- 482 be entwickelte sich hierbei die Mandschurei, welche die Japaner 1931 besetzt hatten. Dort trafen chinesische, japanische und russische Interessen aufeinander. Dirksen nahm in diesen Konflikten stets eine ostentativ japanfreundliche Position ein und forderte nachdrücklich die deutsche Anerkennung des japanischen Marionettenregimes in Manzhouguo. Bekanntlich brachte ihn dies in einen starken Gegensatz zum deutschen Gesandten und späteren Botschafter in Nanjing, Oskar Trautmann. Zu Dirksens Korrespondenzpartnern zählten vor allem seine deutschen Kollegen in China und der Sowjetunion. Da seine privatdienstliche Korrespondenz, die sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes befindet, jedoch nur die Jahre zwischen 1933 und 1936 umfasst, der vorliegende Quellenband aber den gesamten Zeitraum seiner diplomatischen Tätigkeit in Tokyo abdecken sollte, ist die Edition mit Schreiben aus anderen Nachlässen der Adressaten oder aus dienstlichen Akten erweitert worden. Die Briefe an und von Dirksen betrachtet Mund als Ergänzung zu bisher veröffentlichten und unveröffentlichten Quellen der deutschen Ostasienpolitik. Denn in ihnen werden - so der Autor etwas vage - „viele außenpolitische Sachverhalte zu Ostasien thematisiert, die so bislang noch nicht zusammengestellt wurden.” (S. 21) Damit wird bereits darauf hingewiesen, dass das Buch weniger den Leser anleiten, als vielmehr Material zur Verfügung stellen möchte, auf dessen Grundlage geforscht werden kann. Dieser unspezifische Zugang mag darauf zurückzuführen sein, dass der Herausgeber im Bereich der Wirtschaft tätig ist, worauf er in Vorwort und Einleitung ausdrücklich hinweist (S. 13). Das Buch ist deutlich zweigeteilt in einen Text- und einen Dokumententeil. Den Dokumenten vorangestellt sind zwei längere Hinführungen - die erste gibt Einblick in Herbert von Dirksens Leben, die andere beschreibt die politische Situation in Ostasien in den 1930erJahren aus japanischer, chinesischer und russischer Sicht. In dem sehr ausführlichen biographischen Teil werden Dirksens verschiedene Lebensstationen beschrieben, ohne jeland und China 1937-1949. Politik, Militär, Wirtschaft, Kultur, Berlin 1998. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart H. Nitschack (Hrsg.): Brasilien im amerikanischen Kontext doch die wesentlichen Punkte seiner Prägung und seines Denkens zusammenzufassen. Welche Spuren hat seine Sozialisierung hinterlassen? Wie schätzte er seine Gebundenheit an das Auswärtige Amt ein? Wo sah er seine Freiräume? Wie veränderten sich seine Prioritäten durch seine langjährige Tätigkeit in der Sowjetunion? - Hier hätte eine Essenz aus den umfangreichen Informationen gezogen werden müssen. Auch die einleitende Übersicht zu Ostasien in den 1930er-Jahren ist sehr faktenlastig und berücksichtigt nicht immer die neueste Forschungsliteratur. Zudem fragt sich der Leser verwundert, warum die Hintergründe des Antikominternpaktes 1936 so breit beschrieben werden, obwohl Dirksen an dessen Zustandekommen nicht beteiligt gewesen ist. Insgesamt leidet das Buch darunter, dass die drei Teile - die zwei Hinführungen und die Dokumente - nicht stärker verzahnt worden sind. Eine nützliche Übersicht und Zusammenfassung der Briefe ist dem Dokumententeil vorangestellt. Einen solchen Überblick und die an dieser Stelle eingefügten technischen Informationen hätte sich der interessierte Leser gleich zu Anfang des Buches gewünscht. Die edierten Briefe sind den jeweiligen Korrespondenzpartnern zugeordnet, chronologisch aufgeführt und sorgfältig kommentiert. Hierbei werden vor allem Zusatzinformationen gegeben, ohne auf weiterführende Sekundärliteratur zu verweisen. Die Briefe an und von Herbert von Dirksen spiegeln erwartungsgemäß ein buntes Bild wider und beschreiben zunächst den Alltag eines Diplomaten. Bereits ein flüchtiger Blick zeigt, dass sie meistens einem strengen thematischen Schema folgen: Familie, Gesundheit und Krankheiten, Heimaturlaub und Personalfragen sind angesprochen, bevor auf politische Sachverhalte eingegangen wird. Auffallend oft werden Krankheiten thematisiert, auch Nervenkrankheiten. Besonders nachdrücklich aber demonstrieren die Briefe, wie sehr die Diplomaten von Informationsschöpfung abhängig waren. Hierunter fallen einheimische Informanten vor Ort, aber eben auch die jeweiligen Kollegen: Von Fritz von Twardowski und Andor Hencke (Moskau und Kiew) erhielt Dirksen Informationen zu den japanisch-russischen bzw. 2007-3-072 deutsch-russischen Beziehungen, von Hermann Kriebel (Shanghai) Informationen zu den chinesisch-japanischen bzw. den deutschchinesischen Beziehungen. Somit liegt der Wert der Briefe weniger darin, dass bereits bekannte Punkte der deutschen Ostasienpolitik in einzelnen Details ergänzt werden - so etwa die Heye-Mission 1934, das japanische Interesse an der Inneren Mongolei oder die deutsche Vermittlungsaktion im chinesischjapanischen Krieg 1937/38 -, als vielmehr in der Offenlegung von Kommunikation und Interaktion einer kleinen Gemeinschaft, die weitab von der Heimat bei einander feindlich gegenüberstehenden Regierungen akkreditiert war und miteinander kommunizieren musste, um ihren Auftrag überhaupt erfüllen zu können. Dieser Umstand wird im Übrigen durch den Terminus der „privatdienstlichen“ Korrespondenz auffallend gut erfasst. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Veröffentlichung der nichtamtlichen Briefe des Diplomaten Herbert von Dirksen nicht nur eine nuanciertere Bewertung der deutschen Ostasienpolitik ermöglicht, sondern auch Materialien zu einer Rekonstruktion der Netzwerke und damit zu den Entscheidungsfindungsprozessen eines in Übersee tätigen Diplomaten liefert. Die Edition erlaubt, einen neuen Blick auf die Geschichte der deutschen Diplomatie in Ostasien zu werfen, auch wenn sich der Leser gerade dabei mehr Orientierungshilfen gewünscht hätte. HistLit 2007-3-217 / Susanne Kuß über Mund, Gerald: Ostasien im Spiegel der deutschen Diplomatie. Die privatdienstliche Korrespondenz des Diplomaten Herbert v. Dirksen von 1933 bis 1938. Stuttgart 2006. In: H-Soz-u-Kult 20.09.2007. Nitschack, Horst (Hrsg.): Brasilien im amerikanischen Kontext. Vom Kaiserreich zur Republik: Kultur, Gesellschaft, Politik. Frankfurt am Main: TFM - Zentrum für Bücher und Schallplatten in portugiesischer Sprache 2005. ISBN: 3-925203-94-X; 303 S. Rezensiert von: Matthias Humboldt-Universität zu Berlin Harbeck, Brasilien ist das einzige lateinamerikanische Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 483 Außereuropäische Geschichte Land, das nach erreichter Unabhängigkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst den Weg der konstitutionellen Monarchie wählte, dauerhaft beibehielt und sich erst vergleichsweise spät in eine Republik verwandelte (1889/91). Dieser verfassungsgeschichtlichpolitische Hintergrund ist aber nur einer der Aspekte, die im vorliegenden Tagungsband behandelt werden. Es geht vielmehr um eine breite Einbettung in ein ganzes Spektrum von Transformationsprozessen, die sich in den Dekaden um die Jahrhundertwende vollzogen und die hier in insgesamt 14 Einzelbeiträgen und der knappen Herausgebereinleitung aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. Besonders hervorzuheben ist dabei das Bemühen, durch explizite und implizite Vergleiche mit unter anderen Argentinien, Cuba und den USA brasilianische Spezifika zu profilieren. Der Band bietet die seltene Möglichkeit, sich in deutscher Sprache über eine ganze Vielzahl von Forschungsfeldern der „Brasilianistik“ zu informieren. Schwerpunkte bilden hierbei neben der politischen Transition, die Siedlungspolitik, die Situation der Farbigen sowie die Haltung von Intellektuellen und Literaten zur Nation und zu Amerika. Die ersten drei Aufsätze kreisen um den politischen Übergang vom Kaiserreich zur Republik und die Rollen, die die Verfassung bzw. das Militär hierbei spielten. Wolf Paul arbeitet heraus, dass die Nähe der brasilianischen Verfassung zum US-amerikanischen Modell vor allem darin begründet lag, dass der in der breiten Bevölkerung und in Teilen der Eliten abgelehnte Putsch der Republikaner gegen das Kaiserreich rasch eine neue Legitimationsbasis zur Begründung politischer Herrschaft erforderte. Die US-amerikanische Verfassung wurde als die Grundlage für den beispiellosen und auch von brasilianischen Eliten ersehnten Aufstieg der USA und ihre „Fortschrittlichkeit“ angesehen. Paul spricht allerdings auch die sich hier bereits abzeichnende Kluft zwischen Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit an. Wolfgang Heinz knüpft teilweise direkt an den vorangehenden Aufsatz an, indem er zeigt, dass das Militär die in der Verfassung verankerte „moderierende“ Rolle des abgelösten Kaisers (poder moderador) für sich in Anspruch nahm – auch ohne explizite Verfassungsgrundla- 484 ge. Ausländische Einflüsse auf die republikanische Armee waren in dieser Phase eher struktureller und nicht so sehr politischer Natur. Jens Hentschkes Analyse des brasilianischen Transitions- und Konsolidierungsprozesses stellt überzeugend dar, dass es sich nicht um eine Revolution, sondern vielmehr um eine „Mischung aus Verschwörung, Militärputsch und Reform ‚von oben’“ (mit deutlichen Kontinuitäten zum Kaiserreich) gehandelt habe. Erst seit den 1920er-Jahren sei es verstärkt zu einer Ausweitung demokratischer Ansprüche und zu einer partiellen Abkehr vom Modell der „konservativen Modernisierung“ (S. 68) gekommen. Gerson Roberto Neumann behandelt die Einwanderungspolitik. Seine wichtigsten Beobachtungen beziehen sich auf ihre Verknüpfung mit den Interessen der Landaristokratie und mit der Sklaverei-Debatte. Im Vergleich mit den USA und Argentinien war Brasilien durch die größere Entfernung bzw. die den Arbeitsmarkt „blockierende“ Sklaverei im Nachteil und „nur“ an dritter Stelle der Haupteinwanderungsländer Amerikas. Ergänzend hierzu stellt Beatrice Zieglers Artikel Kolonisationsprojekte seit der Ankunft des portugiesischen Hofes in Brasilien (1808) vor. Sie hätten sich aufgrund mangelnder oder schädlicher staatlicher Regulierung meist nur in den Regionen durchsetzen können, die nicht durch die Plantagenwirtschaft dominiert wurden bzw. in denen sie in frontier-Situationen als Puffer dienlich waren. Argentiniens effizientere Kolonisationspolitik habe eine größere Attraktion auf Auswanderer ausgeübt, weil sie weitgehend ohne gesetzliche Beschränkungen auskam und durch Landverkäufe gegenfinanziert war. Jochen Kemner und Katharina Bosl von Papp setzen sich mit Aspekten afrobrasilianischer und afrokubanischer Kultur auseinander. Kemner vergleicht soziale Aufstiegsmöglichkeiten für freie Farbige in Recife und Santiago de Cuba. In Brasilien stand theoretisch jedem freien Mann seit der Verfassung von 1824 der Zugang zu Bildung und Besitz offen. In Kuba bot sich ihnen bis zur Zäsur des Unabhängigkeitskrieges 1868-78 ausschließlich der ökonomische Aufstieg. Allerdings sind auch in Brasilien Theorie und Praxis der Anerkennung zu unterscheiden. Die Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart H. Nitschack (Hrsg.): Brasilien im amerikanischen Kontext Zahl farbiger Aufsteiger blieb begrenzt. Die verschiedenen Gruppen bildeten kein übergreifendes Selbstverständnis als „farbige Brasilianer“ aus. Papp verweist in ihrem knappen Beitrag zu Religion und Sklaverei in Brasilien und auf Kuba auf die interessante Stellung der Laienbruderschaften. Diese boten den Afrikanern und ihren Nachkommen einen Freiraum, in dem sie sich selbst organisieren und somit aktiv und passiv Widerstand gegen die Sklavenhaltergesellschaft leisten konnten. Der Vergleich mit Kuba fällt jedoch dünn aus und ihre interessantesten Feststellungen zum Ausbleiben einer Integration der Sklavinnen und Befreiten nach der Abschaffung der Sklaverei und dem Übergang zur Republik handelt sie nur in Stichpunkten ab. Der Aufsatz von Karen Lisboa leitet in einen großen eher kulturgeschichtlichliterarischen Block über. Sie untersucht den kulturellen Vergleich, den Brasilianer der frühen Republik zwischen ihrer Heimat und den USA anstellten. In ihrer Auswertung ausgewählter Reiseberichte meist brasilianischer Intellektueller, stellt sie das Vorherrschen eines positiven Bildes der Vereinigten Staaten fest: Gleichberechtigung, Leistungswillen und Fortschritt wurden von der Mehrheit der Autoren teils begeistert hervorgehoben. Nur Wenige differenzieren dagegen stärker oder orientieren sich eher an Europa. Deutlich wird hier aber auch die Meinungsvielfalt der Umbruchsphase und das ambivalente Verhältnis zu den USA. Susanne Klengel behandelt den interkulturellen Dialog zwischen Brasilien und Argentinien anhand des 1900 erschienenen Werkes „O Brasil intelectual“ des argentinischen Diplomaten Martín García Merou. Mit diesem Werk habe er eine erste kritisch-wohlwollende Betrachtung der literarischen Produktion Brasiliens vorgelegt, die aber sowohl von der brasilianischen als auch von der einheimischen Literaturkritik lange Zeit missachtet wurde. Der Herausgeber Horst Nitschack wendet sich Sílvio Romeros Sicht auf die brasilianischen Nationalliteratur zu. Vom Positivismus geprägt habe Romero sich, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, weniger mit der literarischen Produktion der Nachbarstaaten und dem politischen Verhältnis zu ihnen auseinander gesetzt. 2007-3-072 Die Herausbildung einer Nationalliteratur sei für Romero geradezu die Voraussetzung für die angestrebte Internationalisierung Brasiliens im Zeichen der vorherrschenden Fortschrittsideologie gewesen (S. 244). Trotz seiner positivistisch-darwinistischen Ansätze sei Romero gleichzeitig ein großer Verfechter der „mestizagem“, also der Vermischung verschiedener Völker und Ethnien gewesen. Sabine Schlickers widmet sich Azevedos „O cortiço“. Am Vergleich mit Zolas Werken demonstriert sie, dass es sich um ein ParadeBeispiel des brasilianischen Naturalismus handelt. Ligia Chiappini schließlich lenkt das Augenmerk auf grenzüberschreitende Regionalkulturen am Beispiel der Gaucho-Literatur Südbrasiliens und Uruguays. Anhand der Autoren Javier de Viana und João Simões Lopes stellt sie Parallelen und Unterschiede kultureller Akteure dar und zeigt anschaulich, dass die kulturelle Tordesilhas-Linie längst überschritten und dieser Umstand nur allzu lange ignoriert wurde. Mit dem Sammelband liegt ein gelungener Überblick über diverse Facetten des (frühen) republikanischen Brasiliens vor. Gerade im ersten Teil gehen die Themenkomplexe der Einzelaufsätze fließend ineinander über. Der rote Faden ist deutlich zu spüren. Im eher kulturbezogenen Teil hätten diese Zusammenhänge vielleicht stärker herausgestellt werden müssen, allerdings verdeutlichen sie die kulturelle und regionale Diversität Brasiliens. Auch die thematisch isolierter stehenden Beiträge Martina Neuburgers über den Aufstieg und Niedergang der Kautschukproduktion in Amazonien und Ute Hermanns zur frühen Kinoproduktion in Brasilien durch Immigranten stützen dieses Bild. Als Handbuch, das kohärent alle Aspekte des Übergangs vom Kaiserreich zur Republik beleuchtet, wie die ersten drei Aufsätze vielleicht erwarten lassen, eignet sich der Band – leider – nicht, als Nachschlagewerk, um einen schnellen Überblick zu Einzelthemen zu gewinnen, oder als Grundlagenlektüre für Einführungskurse ist er dagegen gut einsetzbar. Auf jeden Fall aber veranschaulicht er, dass es nicht ausreicht, Brasilien mit seinen kontinentalen Ausmaßen isoliert zu betrachten, sondern dass sich durch die Einbeziehung amerikanisch-vergleichender Aspek- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 485 Außereuropäische Geschichte te neue Einblicke gewinnen lassen. HistLit 2007-3-072 / Matthias Harbeck über Nitschack, Horst (Hrsg.): Brasilien im amerikanischen Kontext. Vom Kaiserreich zur Republik: Kultur, Gesellschaft, Politik. Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult 30.07.2007. Oren, Michael B.: Power, Faith, and Fantasy. America in the Middle East: 1776 to the Present. New York: W.W. Norton & Company 2007. ISBN: 978-0-393-05826-0; 672 S. Rezensiert von: Manfred Berg, CurtEngelhorn Lehrstuhl für Amerikanische Geschichte, Historisches Seminar der Universität Heidelberg Spätestens seit Beginn des gegenwärtigen Jahrzehnts stehen die Beziehungen zwischen den USA und der arabisch-islamischen Welt im Mittelpunkt der internationalen Politik. Entsprechend ist auch das Interesse an der Geschichte dieses überaus schwierigen Verhältnisses gewachsen. Allerdings konzentrieren sich die meisten einschlägigen Publikationen auf die unmittelbare Gegenwart oder allenfalls auf die Zeitgeschichte seit 1945. Mit dem hier zu besprechenden Werk beansprucht der amerikanisch-israelische Historiker Michael B. Oren nun, die erste Synthese vorzulegen, die den gesamten Zeitraum seit der Gründung der Vereinigten Staaten bis in die Gegenwart behandelt. In der Tat nehmen die mehr als eineinhalb Jahrhunderte von den ersten Reisen amerikanischer Abenteurer in den „Orient“ bis zum Zweiten Weltkrieg den weitaus größten Raum ein. Die Geschichte nach 1945, so der Autor, sei dagegen gut erforscht und vielfach abgehandelt worden und werde deshalb nur noch kurz und zusammenfassend dargestellt. Orens Buch wendet sich sowohl an die Geschichtswissenschaft als auch an ein allgemeines Lesepublikum. Wie der Titel des Buches anzeigt, strukturieren drei große Themen die Darstellung: die machtpolitischen und wirtschaftlichen Konflikte und Interessen, die religiösen und ideologischen Ziele der USA und die kulturellen Wahrnehmungsmuster und Stereotypen der Amerikaner. Der Autor betont, es gehe ihm 486 nicht darum, in den aktuellen Kontroversen Partei zu ergreifen oder gar spezifische politische Vorschläge zu machen, sondern mit seinem Buch die Grundlage für ein tieferes historisches Verständnis zu schaffen. Orens sachlich-deskriptiver Stil kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein Buch sehr wohl eine unmissverständliche politische Botschaft hat, die der Autor auf der letzten Seite auch offen ausspricht. Um sich Respekt zu verschaffen und seine Vision friedlicher und fruchtbarer Beziehungen zum Mittleren Osten zu verwirklichen, müsse Amerika seine Macht klug und verantwortlich demonstrieren und seine normativen Prinzipien konsequent, aber zugleich geduldig durchsetzen (S. 604). Oren gehört also keinesfalls zu den „demokratischen Imperialisten“, die den Irakkrieg ideologisch vorzubereiten halfen, sondern plädiert für einen machtgestützten, illusionslosen Realismus, der sich von den romantischen Fantasien vom „Orient“ ebenso verabschiedet wie vom Versuch allzu aufdringlicher religiöser oder weltanschaulicher Missionierung. Für Oren haben die so genannten „Barbary Wars“, die die USA zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegen die Maghrebstaaten führten, paradigmatischen Charakter. Schwäche, Nachgeben und die Zahlung von Tributen an erpresserische Piraten und Tyrannen zogen lediglich immer neue Demütigungen und höhere Forderungen nach sich, während militärische Macht und Wagemut den Amerikanern Respekt verschafften. Mit seiner Entscheidung für den Kampf – anstatt die Piraten nach dem europäischen Vorbild zu „verhätscheln“ – habe sich Amerika gegenüber sich selbst und der Welt seines nationalen Charakters versichert (S. 78). Vor allem im Zusammenhang mit der Herausforderung durch den Terrorismus seit den 1970er-Jahren bemüht der Autor immer wieder dieses historische Lehrstück, kritisiert die verschiedenen US-Administrationen aber gerade für ihren nach seiner Auffassung erratischen und illusorischen Kurs gegenüber den Terroristen und die sie stützenden Regime. Im Hinblick auf das Thema „Faith“ behandelt Oren ausführlich die missionarischen Aktivitäten amerikanischer Protestanten, die ihren Anfang in der ersten Hälfte des 19. Jahr- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart M. B. Oren: Power, Faith, and Fantasy hunderts nahmen, aber erst ab den 1880erJahren größere Ausmaße erreichten. Die protestantische Mission unterlag natürlich strengen Restriktionen und fand bei der Masse der muslimischen Bevölkerung kaum Resonanz. Allerdings trugen amerikanische Schulen und Universitäten nicht unwesentlich zur Verbreitung säkular-nationalistischer Ideen unter den Eliten bei. Im Zusammenhang mit der religiösen Dimension ist besonders interessant, dass Oren die lange Tradition des evangelikalen „Restaurationsglaubens“ aufzeigt, der in letzter Zeit einige Aufmerksamkeit erregt hat, also die biblisch begründete Überzeugung, dass die Rückgabe des „Heiligen Landes“ an die Juden die Voraussetzung für die Wiederkehr Christi sei. Doch obwohl evangelikale Christen auf dieser Grundlage immer wieder für eine prozionistische und proisraelische Politik der USA eintraten, war ihr Einfluss selbst bei Präsidenten, die evangelikalen Denominationen angehörten, sehr gering. Auch Oren hat offenkundig für religiöse Israel-Schwärmerei wenig übrig, sein Plädoyer für eine enge amerikanisch-israelische Allianz gründet sich vielmehr auf die Definition gemeinsamer strategischer Interessen und demokratischer Werte. Breiten Raum nimmt das dritte Motiv des Buches ein, die Orient-Faszination der Amerikaner, die unablässig zwischen Fantasien von nomadischer Freiheit, Exotik und geheimnisvoller Erotik aus Tausendundeiner Nacht einerseits und abgrundtiefer Verachtung für die vermeintliche Dekadenz, Brutalität und Primitivität der „Orientalen“ andererseits oszillierte. Der Islam wurde dabei zum Inbegriff des „Fremden“, ohne dass sich die amerikanischen Abenteurer, Kaufleute, Söldner, Diplomaten, Forschungsreisenden und Missionare, die das Bild des Mittleren Ostens im 19. Jahrhundert prägten, je ein tieferes Verständnis des Islam und der mittelöstlichen Kulturen erschlossen hätten. Allerdings distanziert sich Oren ausdrücklich vom Orientalismus-Paradigma Edward Saids. Die Orient-Fantasien der Amerikaner sieht er nicht als Ausdruck kolonialistischer Ideologie, sondern als ärgerliches Hindernis für eine realistische Beurteilung der amerikanischen Interessen und Optionen in der Region. Gleichwohl bleibt der Autor über weite 2007-3-090 Strecken seines Buches selbst einer recht einseitigen und bisweilen durchaus stereotypen Darstellung verhaftet. Das Bild, das er etwa von den maghrebinischen Herrschern zu Zeiten der „Barbary Wars“ zeichnet, unterscheidet sich kaum von dem der amerikanischen Militärs, die gegen die Piratenstaaten ins Feld zogen. Überhaupt interessiert sich Oren nur wenig für die Perspektive der Osmanen, Türken, Araber und Iraner, für ihre Amerikabilder und ihre Interessen gegenüber den USA, die spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg eine immer wichtigere Rolle in der Region spielten. Das implizite Grundmotiv seiner kritischen Interpretation der US-Mittelostpolitik seit 1945 ist die notorische Undankbarkeit der arabischen Führer gegenüber der amerikanischen Unterstützung des arabischen Nationalismus gegen die europäischen Kolonialmächte und der fortgesetzten Bemühungen um eine Vermittlung im Konflikt mit Israel. Sein Fazit, dass die Amerikaner dem Mittleren Osten und seinen Bevölkerungen ganz überwiegend mit guten Absichten und Wohltätigkeit begegnet seien und historisch bedeutend mehr Nutzen als Schaden gestiftet hätten, werden die meisten amerikanischen Leser gewiss mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen (S. 603). In der arabisch-islamischen Welt wird diesem Urteil allerdings bekanntlich vehement widersprochen. Auch wenn man die gegenteilige Vorstellung, Amerika und der Westen seien für alle Probleme des Mittleren Ostens verantwortlich, nicht teilt, kann der Topos von den fehlgeleiteten guten Absichten als Hauptproblem amerikanischer Mittelostpolitik nicht überzeugen und dementiert in gewisser Hinsicht auch die realistischen Prämissen des Autors. Mehr denn je stehen die USA heute vor dem Dilemma, dass sie ihre wirtschaftlichen und strategischen Interessen in der Region notfalls mit militärischer Gewalt sichern müssen, dass ihre politischkulturelle Akzeptanz jedoch nirgendwo auf der Welt so gering ist und sie so gut wie keine prowestlichen und demokratisch legitimierten Bündnispartner finden. Die grandiosen Demokratisierungsvisionen der Washingtoner „Neocons“ haben sich als destruktive Machtfantasien erwiesen. Um diese Einsicht drückt sich Oren am Schluss herum und trös- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 487 Außereuropäische Geschichte tet seine Leser stattdessen mit der einigermaßen voluntaristischen Hoffnung, dass die Völker der arabisch-islamischen Welt doch noch Amerikas guten Willen erkennen mögen. HistLit 2007-3-090 / Manfred Berg über Oren, Michael B.: Power, Faith, and Fantasy. America in the Middle East: 1776 to the Present. New York 2007. In: H-Soz-u-Kult 03.08.2007. Staden, Hans: Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555) - História de duas viagens ao Brasil. Kritische Ausgabe: Franz Obermeier; Übertragung ins heutige Deutsch: Joachim Tiemann; Tradução ao português: Guiomar Carvalho Franco. Kiel: Westensee-Verlag 2007. ISBN: 3-931368-70-X; 410 S. Rezensiert von: Horst Pietschmann, Historisches Seminar, Universität Hamburg In der Fülle überlieferter zeitgenössischer Prosatexte und teils sogar gereimter Überlieferungen aus dem thematischen Umfeld der iberischen Expansion finden sich zahlreiche Editionen, die sich als kritische Ausgaben bezeichnen. Davon können aber nur die Wenigsten für sich in Anspruch nehmen, in der deutschen Tradition historisch-philologischkritischer Editionen zu stehen. Meist handelt es sich um Ausgaben mit mehr oder weniger ausführlichen Einleitungen der Herausgeber, die die Entstehungsgeschichte nachzeichnen. Oft rekonstruieren sie die handschriftliche(n) Überlieferung(en) noch nicht einmal. Selbst dann, wenn die Texteditionen mit Fußnoten versehen sind, beschränken sie sich überwiegend auf Sacherklärungen. Es verwundert daher auch nicht, dass diese Überlieferungen unterschiedslos der Gattung der Chronistik zugeschrieben werden, gleichgültig ob sie in lateinisch oder volkssprachlich verfasst wurden, gleichgültig auch, ob sie von Zeitzeugen oder von dem Geschehen fernen, sich ihrerseits auf Quellen stützenden Autoren stammen. Welcher Historiker erinnert sich schon daran, dass die berühmte „Historia verdadera. . . “ des Bernal Díaz del Castillo von der Eroberung Mexikos als ohne Überschrift überliefertes Manuskript ihren Namen erst in einem späteren Jahrhundert erhielt. Dage- 488 gen ist das hier vorzustellende Werk tatsächlich bereits 1557 unter dem Titel „Warhaftig Historia und beschreibung eyner Landtschaft der Wilden/Nacketen/Grimmigen MenschfresserLeuthen/in der Newenwelt America gelegen/vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen unbekant/bis uff dieses nechst vergangene jar/Da sie Hans Staden von Homberg auß Hessen durch sein eygne erfahrung erkant/und yetzo durch den truck an tag gibt. . . .“ erschienen. Ebenso wie viele ähnliche spanische Titel lässt auch diese deutsche Überschrift erkennen, dass ihre Edition philologischer und historischer Kritik dringend bedarf, ja, dass die Gattung insgesamt genauer historiografiegeschichtlich erforscht und eingeordnet werden muss. Mit entsprechender Erwartung nimmt man die vorliegende Edition zur Hand. Das im Verlag des Kieler Romanisten und Guaraní-Forschers Thun erschienene, gemeinsam mit dem brasilianischen Instituto Martius-Staden publizierte Werk wurde im Rahmen einer im März 2007 im hessischen Wolfhagen abgehaltenen internationalen Tagung vorgestellt. Veranstaltet hatte sie das dortige Regionalmuseum, das auch eine Ausstellung über Staden organisierte, die noch in Korbach und danach in Brasilien gezeigt werden soll.1 Der äußere Anlass war das 450. Jubiläum des Erscheinens von Stadens Buch in Marburg, über dessen Verfasser wir ansonsten nur wenig gesichert wissen. Überliefert sind der Geburtsort Homburg an der Efze, die Lebensspanne von circa 1520 bis nach 1558, seine Funktion als Büchsenschütze während zweier Brasilienreisen zwischen 1548 und 1555, von denen er eine in portugiesischen und eine in spanischen Diensten antrat, die Aufenthaltsorte Wolfhagen und Korbach nach seinem Brasilienabenteuer sowie der ebenfalls nach Rückkehr erlernte Beruf eines Salpetersieders. Das Buch verdankt seine Entstehung wesentlich Stadens Beziehung zu dem Marburger Medizin- und Mathematikprofessor Johannes Dryander, der offen1 Vgl. zu Tagung und Ausstellung: Tópicos. Deutschbrasilianische Gesellschaft e.V. – LateinamerikaZentrum e.V. 46/2 (2007), S. 30-31. Obermeier erwähnt in seiner Edition, S. XXX, ohne nähere Angaben eine Staden-Sammlung des Ehepaars Bezzenberger und eine Hans-Staden-Stiftung Wolfhagen, die das Andenken an Staden dort lebendig halten. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart H. Staden: Warhaftige Historia bar aus dem gleichen Geburtsort wie Stadens Vater, nämlich Wetter, stammte. Eine Pfändungsandrohung aus dem Jahre 1558 gilt als letzter dokumentarischer Beleg von Stadens Leben. Der Herausgeber der Edition, Franz Obermeier, ist Fachreferent an der Kieler Universitätsbibliothek und durch zahlreiche Publikationen zu Staden und den frühen französischen Brasilienberichten ausgewiesen. Obermeier gibt die vorgenannten Informationen zu Stadens Biografie bereits auf den ersten drei seiner insgesamt 31 Seiten umfassenden Einleitung. Danach wendet er sich anderen Brasilienwerken der Epoche, Fragen nach Charakter und Struktur des Werkes sowie der Illustrationen zu. Ergänzt wird diese Einleitung durch eine 34 Seiten umfassende Bibliographie. Es folgt unpaginiert der reich bebilderte Faksimilenachdruck von Stadens Werk. Es ist in zwei Widmungsschreiben (je eines von Staden und von Dryander an Landgraf Philipp von Hessen) und zwei Bücher gegliedert. Das Erste schildert in chronologischer Folge Stadens Erlebnisse, während das Zweite den Sitten und Gewohnheiten der Tupinambá gewidmet ist, die den Verfasser mehr als ein halbes Jahr gefangen hielten. Auf den Seiten 179 bis 212 liefert der Bearbeiter knappe Kommentare zu den einzelnen Seiten bzw. Abschnitten von Stadens Text gefolgt von einer Auflistung der in den Kommentaren zitierten Quellentexte. Eine Liste der genannten Stammesbezeichnungen, Indizes von Personennamen und geographischen Bezeichnungen, Erläuterungen von Tupiwörtern und Verzeichnisse von Namen aus Fauna und Flora einmal in Übersetzung aus dem Tupi und sodann mit deren modernen taxonomischen Bezeichnungen sollen die Erschließung des Textes erleichtern. Auf den Seiten 229 bis 288 findet sich dann die von Joachim Tiemann besorgte Übersetzung des Werkes in modernes Deutsch und anschließend die Übersetzung von Obermeiers Einleitung und Stadens Werk ins Portugiesische, besorgt von Guiomar Carvalho Franco und durchgesehen von Augusto Rodrigues. Eine Zeittafel zu Stadens Leben und Werk, die Danksagung an unterstützende Personen und Institutionen sowie das zweisprachige Inhaltsverzeichnis schließen den Band ab. 2007-3-225 Wie die knappe Beschreibung der Edition bereits verdeutlicht, konzentrieren sich die editorischen Teile auf die buchgeschichtliche Bedeutung von Stadens Text und Illustrationen, seine Wirkung und Verbreitung, seine Verortung in der frühen Überlieferung zu Brasilien, vor allem im Vergleich zu Thevet, Léry, Abbeville und anderen und auf seine ethnographische Bedeutung. Das Fehlen einer die Kriterien der Bearbeitung und Kommentierung verdeutlichenden Einleitung erweckt bei einem der Thematik ferner stehenden Benutzer der Edition den Eindruck, dass es sich um ein Buch von Spezialisten für Spezialisten handelt, ein Eindruck, der dadurch verstärkt wird, dass der Bearbeiter in seiner spartanischen Einleitung den Leser allzu oft auf diverse seiner 49 eigenen, unter „Forschungsliteratur“ aufgelisteten Titel verweist. Unter dieser „Forschungsliteratur“ fehlen zentrale Titel (wie Jürgen Pohle, Deutschland und die überseeische Expansion Portugals im 15. und 16. Jahrhundert. Münster 2000), die hätten erklären können, wie ein hessischer Büchsenschütze nach Brasilien gelangte. Auch wenn die Fragen des Historikers an eine solche Edition unbeantwortet bleiben und das Werk nicht den Anforderungen an eine philologisch-historischkritische Edition, wie sie einleitend angerissen wurden, entspricht, bildet es doch einen unverzichtbaren Baustein zu einer solchen, noch zu leistenden Edition. Von dieser ist unter anderem der Versuch zu verlangen, herauszufinden, inwieweit der Text auf Staden selbst oder überwiegend auf Dryander zurückgeht, von dem mehrere Veröffentlichungen bekannt sind. Vieles an Stadens Werk erinnert mehr an die Vertrautheit des Universitätslehrers mit den zeitgenössischen wissenschaftlichen und politischen Debatten und Konstellationen als an einen abenteuernden Büchsenschützen, vor allem wenn man an zeitgenössische Korrespondenz von gebildeteren Schreibern, wie etwa Kaufleuten, denkt. Woher mag Staden den Namen „America“ gehabt haben? Sicher nicht von der Iberischen Halbinsel oder aus Brasilien, wo er zu der Zeit jedenfalls nicht in Gebrauch war. Man wird der Edition freilich zugute halten müssen, dass zu viel auf zu knappem Raum beabsichtigt war: Ein solches Werk in einem Band Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 489 Außereuropäische Geschichte für zwei große Märkte, den brasilianischen und den deutschen, gleichzeitig erschließen zu wollen, ist kein realistisches Unterfangen. Vielleicht helfen da die Akten der Tagung von Wolfhagen im letzten März weiter. HistLit 2007-3-225 / Horst Pietschmann über Staden, Hans: Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555) - História de duas viagens ao Brasil. Kritische Ausgabe: Franz Obermeier; Übertragung ins heutige Deutsch: Joachim Tiemann; Tradução ao português: Guiomar Carvalho Franco. Kiel 2007. In: H-Soz-u-Kult 24.09.2007. Steen, Andreas: Zwischen Unterhaltung und Revolution. Grammophone, Schallplatten und die Anfänge der Musikindustrie in Shanghai, 18781937. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2006. ISBN: 978-3-447-05355-6; 525 S. Rezensiert von: Lena Henningsen, Institut für Sinologie, Universität Heidelberg Ausgehend vom Medium Schallplatte zeichnet Andreas Steen in seiner 2006 veröffentlichten Dissertation die Entstehung und Entwicklung der chinesischen Musikindustrie in Shanghai nach. Eingebettet in den weiteren historischen Kontext entwirft er dabei ein lebendiges Bild der musikalischen Szene und ihrer Akteure. Durch die Fokussierung auf ein in der sinologischen Forschung bislang wenig untersuchtes Medium beleuchtet der Autor die vermeintlich gegensätzlichen Phänomene Tradition und Moderne, fremde und eigene kulturelle Errungenschaften, Konsum und Propaganda. Produktion, Verkauf und Rezeption der Schallplatte zeigen, dass es sich bei diesen keineswegs um einander ausschließende Konzepte handelt. Vielmehr spiegeln sich in sämtlichen Anwendungen der Schallplatte Mischformen wider – und damit die Hybridität Shanghais im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Zwar kam die Grammophon-, und Schallplattenindustrie als eine westliche Industrie im Dienste westlicher imperialistischer und kommerzieller Interessen nach China. Doch ihr Erfolg beruhte nicht nur auf westlichem Kapital und Know-how, sondern auf der Integration chinesischer Experten und auf der 490 Nutzbarmachung des chinesischen musikalischen Repertoires. Schließlich wurde nicht nur westliche Musik nach China eingeführt. Vielmehr wurde chinesische Musik in China aufgenommen, in Europa oder Amerika auf Schallplatten gepresst und dann zum Verkauf an ein chinesisches Publikum wieder nach China eingeführt. Entsprechend waren die westlichen Konzerne auf chinesische Künstler ebenso angewiesen wie auf chinesische Mittelsmänner, die Kontakte zu diesen herstellten, Verträge aushandelten und Aufnahmesitzungen arrangierten. Hierbei zeigt sich, dass diese Mittelsmänner nicht willenlose Handlanger westlicher Unternehmen waren. Im Gegenteil, sie setzten den Produkten ihren eigenen Stempel auf. In der Frühzeit waren dies Liebhaber der Pekingoper, die das aufgenommene Repertoire prägten. Später gelang es Musikern wie Ren Guang und Nie Er, bei EMI sozialkritische Lieder zu platzieren, die ihren politischen Überzeugungen entsprachen (S. 425f). Auch erkannten die politischen Parteien das propagandistische Potential des neuen Mediums und schickten sich an, dieses auszunutzen. Da die westlichen Firmen darauf zielten, Musik für ein chinesisches Publikum zu produzieren, waren nicht nur chinesische Akteure zentral für die frühen Schritte dieser Industrie, sondern auch der Klang der chinesischen Musik. Das chinesische musikalische Repertoire fand seinen Weg auf das neue Medium, und wurde in seiner weiteren Entwicklung von diesem stark geprägt, insbesondere gilt dies für die chinesische Oper sowie populäre chinesische Lieder. Aufnahmen berühmter Opernsänger dienten Laien oder dem Nachwuchs als Unterrichtsmaterial. Damit brachte die Schallplatte den Klang der chinesischen Oper nicht nur – potentiell – in jedes Wohnzimmer, sondern leistete der Professionalisierung ebenso wie einer nationalen Vereinheitlichung des Stils Vorschub. Ohne die kommerziell motivierten Bemühungen der Schallplattenindustrie wäre dies nicht denkbar gewesen. Erfolgreiche Opern-Künstler wie Tan Xinpei – „unbestritten der erste ‚Schallplattenstar’ in China“ (S. 134) – oder Mei Lanfang konnten ihren Ruhm und ihre überragenden Interpretationen für die Nachwelt sichern. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart A. Steen: Zwischen Unterhaltung und Revolution Gleichzeitig begründete ihre akustische Präsenz ihre Medienwirksamkeit – und im Falle Mei Lanfangs seinen Erfolg als Werbeikone. Neben der Oper verhalf die Schallplatte auch anderen populären Formen zu Gehör, wie dem „Lied seiner Zeit“ (Shidaiqu, S. 245ff.). An der Verbreitung dieses Genres und dem Erfolg des Musikers Li Junhui wird deutlich, wie traditionelle und moderne Elemente erfolgreich eingesetzt wurden, um kommerzielle wie politische Interessen umzusetzen: in den Shidaiqu werden Elemente westlicher Schlagermusik und Jazz mit volkstümlichen Melodien und überlieferten Volksliedern kombiniert. Stärker noch als bei der Pekingoper ist die Popularität dieses Genres an das neue Medium gebunden. Damit wird deutlich, dass die neuen künstlerischen Entwicklungen zwar sehr wohl geistige Strömungen der Zeit widerspiegelten, in denen es um Erneuerung der chinesischen Kultur ging durch eine Rückbesinnung auf Wurzeln in der eigenen Tradition ebenso wie durch eine Nutzbarmachung neuer, westlicher Techniken. Darüber hinaus kann aber ein Vorrang kommerzieller Interessen vor politischen konstatiert werden. Das Spannungsfeld „zwischen Revolution und Unterhaltung“ durchzieht die Studie wie ein roter Faden. Neben den oben geschilderten unterhaltenden Musikformen diente die Schallplatte auch als Medium zur Verbreitung politischer Ideen. Die Erkenntnis des propagandistischen Werts der Schallplatte schlug sich z.B. in Aufnahmen von Reden Sun Yatsens (S. 182) oder von politischen Liedern nieder, in den Bestrebungen, eine nationale chinesische Schallplattenindustrie zu fördern, aber auch in Bemühungen seitens der nationalistischen GMD-Regierung, die Produkte zu zensieren. Das Buch basiert auf akribischer Quellenrecherche in diversen Archiven in China und Europa. Um die Entwicklung der Schallplattenindustrie möglichst genau nachzuzeichnen, greift der Autor neben diesem Archivmaterial auf Statistiken und Unterlagen der Schallplattenindustrie zurück. Darüber hinaus wertet er Berichte und Werbeanzeigen in zeitgenössischen chinesischen Tageszeitungen und Magazinen aus und zieht schlaglichtartig literarische Texte aus dem frühen 20. 2007-3-080 Jahrhundert hinzu, in denen berühmte chinesische Autoren wie Lu Xun, Mao Dun oder Ding Ling das Grammophon oder die Schallplatte thematisieren. Der Autor benennt dabei klar die Grenzen der Quellenlage und markiert nachvollziehbar, welche Thesen sich auf empirische Daten stützen lassen und welche Thesen auf spekulativen Indizien und gut begründeten Vermutungen beruhen. Klare Zusammenfassungen am Anfang und Ende der Arbeit, sowie in den einzelnen Abschnitten erleichtern die Lektüre. Darüber hinaus wird der analytische Teil der Arbeit ergänzt durch einen umfangreichen Bildteil sowie Übersichtstafeln zur Schallplattenproduktion in China. Ein Personenindex findet sich am Ende des Buches. Ein Sachregister sowie der chinesische Wortlaut übersetzter Passagen fehlen leider. Die Abwesenheit der klanglichen Komponente stellt ein weiteres – und bedeutenderes – Manko der Arbeit dar. Der Autor benennt zwar wiederholt die unterschiedlichen Traditionen, aus denen sich die Produkte der Schallplattenindustrie sowie der „hybride Klang Shanghais“ speisen. Doch in den Analysen exemplarischer Schallplatten liegt der Fokus auf den Liedtexten. Die akustischen Merkmale (melodische, rhythmische und harmonische Gestaltung, Instrumentierung, Verhältnis von Text und Musik) werden bestenfalls gestreift, nicht jedoch in die Analyse mit einbezogen. Eine klarere Beschreibung und Analyse dieses Aspekts hätte dem Leser des Buchs geholfen, den „Klang Shanghais“ nicht nur anhand abstrakter Kategorien (Jazz, klassische Orchestermusik, Pekingoper), sondern auf konkreten Klangerlebnissen nachzuvollziehen. Wie hat die Kombination unterschiedlicher Musikstile geklungen? Wie hat sie möglicherweise auf einen zeitgenössischen Hörer gewirkt, dem nicht nur die Schallplatte, sondern auch die darauf erklingenden musikalischen Inhalte völlig neu waren? Wie hybrid war der Klang tatsächlich? Ohne eine Antwort auf diese Fragen erscheint der „hybride Klang“ lediglich als eine konstatierte Kategorie. Dies ist umso bedauerlicher, als Steen die Hybridität in den übrigen Bereichen der Schallplattenproduktion sehr differenziert nachgezeichnet hat: in der für beide Seiten ertragreichen Koopera- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 491 Außereuropäische Geschichte tion zwischen westlichen und chinesischen Akteuren, zwischen westlichem technischen Know-how und chinesischem künstlerischen Input auf der Seite der Produktion, in der Interaktion zwischen Hörern und Produzenten, ebenso wie in der innovativen Kombination chinesischer und westlicher Elemente und in der kommerziell erfolgreichen Nutzbarmachung politischer Inhalte. Mit seinem Buch zu den Anfängen der chinesischen Musikindustrie hat Andreas Steen eine fundierte, lesenswerte und gut lesbare Studie vorgelegt, die unser Bild von Shanghai in den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende um einige Facetten erweitert und die Entstehung der chinesischen Schallplattenindustrie nachvollziehbar analysiert. HistLit 2007-3-080 / Lena Henningsen über Steen, Andreas: Zwischen Unterhaltung und Revolution. Grammophone, Schallplatten und die Anfänge der Musikindustrie in Shanghai, 1878-1937. Wiesbaden 2006. In: H-Soz-u-Kult 01.08.2007. Steffelbauer, Ilja; Hakami, Khaled (Hrsg.): Vom Alten Orient zum Nahen Osten. Essen: Magnus-Verlag 2006. ISBN: 3-88400-602-9; 272 S. Rezensiert von: Elisabeth Kübler, Universität Wien / Lauder Business School, Wien Die Anzahl an Publikationen und Veranstaltungen zum komplexen Verhältnis „des Westens“ und der arabischen bzw. islamischen Welt ist unüberschaubar geworden, vermag jedoch letztlich wenig zu erklären. Dieser Befund ist ein zentrales Anliegen des Vorworts zum interdisziplinären Sammelband „Vom Alten Orient zum Nahen Osten“, herausgegeben von Ilja Steffelbauer und Khaled Hakami. Außerdem geht es um eine Dekonstruktion jener europäischen Perspektive, die die arabische bzw. die islamische Welt hauptsächlich entlang von drei Zäsuren wahrnimmt: „Die Wiege der Zivilisation steht im Alten Orient. Die Kreuzfahrer ziehen ins Heilige Land. Der aktuelle Krisenherd schwelt im Nahen Osten.” (S. 9) Die Auflösung verzerrender und verzerrter europäischer „Orientperzep- 492 tionen“ bildet eine Klammer um die Beiträge der an der Universität Wien lehrenden HistorikerInnen, AnthropologInnen, OrientalistInnen, ByzantinistInnen, GeografInnen und PolitikwissenschafterInnen. Im Folgenden sollen die inhaltlichen, regionalen und epochalen Schwerpunktsetzungen des Sammelbandes kursorisch angerissen werden, ehe dann eine Bewertung vor der Folie der eingangs dargestellten Kritik stattfindet. Der Geograf Heinz Nissel zeigt in seiner disziplinhistorischen Aufarbeitung die Schwierigkeit den betreffenden „Kulturerdteil“ begrifflich zu fassen. In Folge des von Edward Said – dem Nissel kritisch gegenübersteht – ab den späten 1970er-Jahren vorgebrachten Orientalismus-Vorwurfes setzten sich die Bezeichnungen „arabische Welt“ und „islamische Welt“ durch. Nissel führt aus, dass auch diese Benennungen viele chronologische und regionale Unterschiede einebnen und insofern Verwirrung stiften, als zum Beispiel die größten muslimischen Bevölkerungen (Indonesien, Indien, Iran, Bangladesh, Pakistan) gerade nicht in arabischen Ländern leben, wobei letztere allerdings das historische und religiöse Zentrum des Islam bilden. Auch die innerislamische Abgrenzung des „Dar alIslam“ (Haus des Islam) bietet letztlich nur dann wissenschaftliches Erklärungspotential, wenn die muslimische Welt „als Netzwerk sozialer Interaktionen, symbolischer Systeme und bestimmter Alltagspraktiken“ (S. 24) aufgefasst wird. Claudia Kickinger und Gabriele Rasuly-Paleczek beschäftigen sich in ihren Beiträgen mit Aspekten nomadischer Lebensweise. Rasuly-Paleczek rückt dabei Zentralasien, das in der populären eurozentrischen „Orientwahrnehmung“ häufig völlig ausgeblendet wird, in den Fokus. Khaled Hakami zeigt in seinem Beitrag zur Wahrnehmung der antiken Zivilisationen Ägyptens und Mesopotamiens, dass „[m]it Theorien, die eher unschöne Dinge wie ökologische Zwänge, Bevölkerungsdruck und Krieg als eigentlichen Motor der gesellschaftlichen Entwicklung sehen, [...] natürlich kein Schulbuch zu machen [ist]. [...] Viel lieber sehen wir Ägypten als das ‚Geschenk des Nils’ (Herodots Worte) und die großen Entwicklungen als die ‚großartigen Leistungen der Menschheit‘, die natürlich in direkter Li- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart I. Steffelbauer u.a. (Hrsg.): Vom alten Orient zum Nahen Osten nie zu uns modernen Europäern reichen.” (S. 53) Dass selbst in der einschlägigen mediävistischen Forschung die Darstellung der Kreuzzüge vielfach zu eindimensional gerät, können Peter Feldbauer und Michael Mitterauer nachweisen. Indem sie das innereuropäische Vorgehen gegen die „Feinde der Christenheit“ (z. B. gegen Albigenser und Hussiten) und nicht-religiös inspirierte kriegerische Auseinandersetzungen mit den Sarazenen (Araber) hervorheben, machen sie deutlich, dass die „Konvention der ‚gezählten Kreuzzüge‘ [...] eine verengte Perspektive [schafft]”. (S. 140) Die zwischen den Einflusssphären mehrerer Machtzentren gespaltene islamische Welt erfuhr auch unabhängig von den Kreuzzügen oft strukturbedingte und teils krisenhafte Veränderungen, wobei es partiell auch zu Kooperationen mit den „Franken“ kam. Im Zuge eines möglichen EU-Beitritts der Türkei gewinnen Beiträge, die sich jenseits klischeebehafteter Vorstellungen von „Abendland“ und „Morgenland“ mit dieser imaginierten Grenze Europas auseinandersetzen, an besonderer Relevanz. Ilja Steffelbauer liefert in „Hellenismus und Orient“ eine spannende Darstellung zu hellenistischen Städteund Staatsgründungen bzw. zum „Hellenismus als ein[em] globale[n] – natürlich nur im Sinne der antiken Ökumene – soziökonomische[n] wie auch kulturelle[n] Wandlungsprozess“. (S. 80) Damit werden jene Bilder von den heroischen Eroberungsfeldzügen Alexander des Großen, mit denen jedes europäische Schulkind sozialisiert wird, zumindest erweitert. Wolfgang Felix‘ herrscherzentrierte Abhandlung über mehr als ein halbes Jahrtausend römisch-persischer Beziehungen („Pompeius bis Herakleios“) passt hingegen eher in ein enzyklopädisches Nachschlagewerk zur Antike als in einen interdisziplinären Sammelband. Kartenmaterial und chronologische Auflistungen der Regentschaftszeiten wären auf alle Fälle notwendig gewesen, um den Beitrag anschaulicher und nachvollziehbarer zu gestalten. Das komplexe Herrschafts- und Verwaltungssystem des Osmanischen Reiches steht schließlich im Mittelpunkt des detailreichen Aufsatzes von Marlene Kurz, der auch in die osmanische Terminologie einführt.1 1 In diesem Zusammenhang muss Kritik bezüglich un- 2007-3-050 Herbert Eisenstein und Thomas Schmidinger konstatieren, dass die Gesellschaften der islamischen Welt ebenso wenig statisch sind wie jene Europas und Amerikas und leiten damit in die unmittelbare Gegenwart über. Während Eisenstein die Periode vom Zerfall des Osmanischen Reiches, der europäischen Kolonisierung und der Dekolonisierung unter die Lupe nimmt und neben Länderbeispielen auch Aspekte der Parteienentwicklung (Wafd-Partei in Ägypten und Ba‘thPartei im Irak und in Syrien) sowie abrissartig bewaffnete internationale Konflikte unter die Lupe nimmt, fokussiert Schmidinger auf die rezentesten Ereignisse in der Region. Neben den äußerst informativen Ausführungen zum Irak-Krieg, zum Libanonkrieg 2006, zum Nahostkonflikt und zum Islamismus bearbeitet er auch Themenbereiche wie Feminismus und Lesben- und Schwulenbewegungen in arabischen Gesellschaften. Ebenfalls erwähnt wird die zunehmende Implementierung neoliberaler Wirtschaftsmodelle nicht nur in den meisten Golfstaaten, sondern auch in Jordanien und im Libanon und die damit verbundenen sozialen Probleme. Den Herausgebern gelingt es in „Vom Alten Orient zum Nahen Osten“ eine breite Themenpalette unterzubringen. Wiewohl kein Anspruch auf eine erschöpfende Darstellung von jahrtausendelangen Entwicklungen besteht, werden zahlreiche Momente irreführender europäischer „Orientwahrnehmungen“ aufgezeigt. Trotzdem muss unterschieden werden, ob Versatzstücke oberflächlicher Schulbuchgeschichtsschreibung und klischeehafter Nachrichtenbilder einer allgemeinen Öffentlichkeit zur Disposition stehen oder ob sich die Kritik an die jeweilige fachwissenschaftliche Beschäftigung mit der Region richeinheitlicher Schreibweisen vor allem an die Herausgeber adressiert werden. Sie betonen zwar, dass die Transkription arabischer Wörter nach den Regeln der Deutschen Orientgesellschaft erfolgt, wobei im Text vielfach die diakritischen Zeichen ausgelassen werden oder auch ägyptische Schreibweisen vorkommen. Während sich auch philologisch nicht bewanderte LeserInnen bei Jihad – Dschihad – Gihad noch orientieren können, wird es schwieriger, wenn Marlene Kurz die irakische Stadt Nacaf in türkischer Orthografie schreibt oder JüdInnen und ChristInnen als Schutzbefohlene des Islam gemäß der persisch-türkischen Aussprachetradition als „zimmi“ bezeichnet, während in deutschsprachigen Publikation die arabische Schreibung „dhimmi“ üblich ist (vgl. S. 203). Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 493 Außereuropäische Geschichte tet. In dieser Hinsicht differieren die Beiträge mithin beträchtlich. Durchaus als Imperativ an beide AdressatInnenkreise kann Thomas Schmidingers Schlussstatement verstanden werden, in dem er am Beispiel des Nahostkonfliktes, der in den Medien und vielen wissenschaftlichen Debatten im Vergleich mit anderen Krisenherden überrepräsentiert ist, mehr Distanz und (Selbst-)Reflexion moniert: „Nachrichten aus dem Nahen Osten dringen so immer auch in unser Unbewusstes ein, sind nicht nur Nachricht, sondern berühren uns auf seltsame Weise mehr als ebenso lang andauernde Konflikte, sei es in Sri Lanka oder Westpapua. [...] Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum nur sehr wenige europäische Beobachter – seien es Politiker, Journalisten oder Intellektuelle – versuchen, ernsthaft den Konflikt als solchen zu verstehen und den Fokus auf die Akteure und Betroffenen in der Region zu legen, ohne sich sofort in jeder Frage reflexhaft als Kriegspartei zu imaginieren.” (S. 269) HistLit 2007-3-050 / Elisabeth Kübler über Steffelbauer, Ilja; Hakami, Khaled (Hrsg.): Vom Alten Orient zum Nahen Osten. Essen 2006. In: H-Soz-u-Kult 20.07.2007. Tyrrell, Ian: Historians in Public. The Practice of American History, 1890-1970. Chicago: University of Chicago Press 2005. ISBN: 0-22682194-3; 312 S. Rezensiert von: Katja Naumann, Zentrum für Höhere Studien, Universität Leipzig Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des eigenen Faches rückt nicht allzu oft in das Zentrum des Forschungsinteresses von Historikern, obwohl sie sich längst professionalisiert hat und jüngst von der Konjunktur erinnerungskultureller wie imperiengeschichtlicher Fragestellungen profitierte. Dies gilt auch für die US-amerikanische Fachgeschichte, unabhängig davon, ob dabei von innen oder außen geschaut wird. Um so größere Aufmerksamkeit sollte der Studie von Ian Tyrrell über „Historians in Public“ zuteil werden, zumal Tyrrell, Professor für amerikanische Geschichte an der University of 494 New South Wales in Sydney, schon mehrfach kenntnisreich zur Disziplinengeschichte in den USA publiziert hat. In seinem jüngsten Beitrag wendet er sich in einem bislang kaum beachteten Aspekt der Historiographiegeschichte zu: den Beziehungen professioneller, das heißt universitär angebundener Historiker, zu jenen, die außerhalb von Universitäten Geschichte betrieben haben, sowie zu ihrem Publikum jenseits der eigenen Fachöffentlichkeit. Als Ausgangspunkt nimmt er die gegenwärtig in den USA innerhalb des Faches erhobene Klage über den Relevanzverlust wissenschaftlicher Vergangenheitsdeutung in der öffentlich-politischen Aushandlung von Geschichtsbildern und hält ihr entgegen: „I will argue, that the threat to history is a recurrent, exaggerated, and often misunderstood one and that history has adapted to and influenced its changing publics more than the profession is given credit for.“ (S. 2) USamerikanische Historiker haben vielmehr eine traditionsreiche Praxis der Intervention in öffentliche Debatten entwickelt (S. 4). Die vielschichtige Geschichte dieses Eingreifens in gesellschaftliche Herausforderungen, die sich wandelnde Position wissenschaftlicher Geschichtsschreibung ebenso wie die fachinternen Auseinandersetzungen um Politisierung versus Wissenschaftlichkeit präsentiert Tyrrell auf etwas mehr als 300 Seiten in dichter empirischer Beschreibung. Seine Ausführungen beginnt der Autor in den 1890er-Jahren und führt sie bis in die 1960er-Jahre. Denn erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts sei es zu einer Distanzierung zwischen Öffentlichkeit und Geschichtswissenschaft gekommen, während die Professionalisierung der Geschichtsschreibung ab dem Ende des 19. Jahrhunderts keineswegs mit dem Rückzug aus dem öffentlichen Raum und dem Zurückweisen von gesellschaftlicher Verantwortlichkeit verbunden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen erhielten nichtakademische Leserkreise zunehmend weniger Beachtung, verschwand öffentliches Engagement aus dem professionellen Selbstverständnis, und zwar mit Verweis auf Kriterien der Wissenschaftlichkeit, und geriet die Arbeit in Regierungsbehörden in Verruf. In dieser Zeit entstand auch die heu- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart I. Tyrrell: Historians in Public te so vertraute Polarisierung zwischen spezialisiertem Experten und öffentlichem Kritiker, wobei Tyrrell den entscheidenden Grund in dem schwindenden Einfluss der „progressive historians“ innerhalb der eigenen Disziplin ausmacht, die für eine „democratization of learning“ und die „utility of history for civic responsibility“ eingetreten waren (S. 6). Jene Teile der akademischen Historikerschaft, die gegenüber dem Anliegen der „progressive historians“ skeptisch geblieben waren („conservatives“), verschrieben sich unter dem Druck einer „New Left“, die sich in den sechziger Jahren formierte, nun umso mehr den Kriterien von Objektivität sowie politischer Neutralität und leiteten einen „consolidated cult of detachment“ (ebd.) ein. Zwar konnte sich ‚public history’ am Rande des Faches zu einer Subdisziplin verfestigen (S. 249), die vielfältigen Traditionen des Einbringens historischen Wissens in zeitgenössische Konstellationen gerieten jedoch in Vergessenheit. In einem einführenden ersten Teil setzt sich Tyrrell mit jenen Diskussionen seit den 1990er-Jahren auseinander, die um Fragen der „political correctness“ historischer Deutungen geführt werden. Drei Aspekte seien dabei verhandelt worden, nämlich „the dangers of multiculturalism and cultural fragmentation, the problem of academic specialization, and the professionalization of history and a concomitant academic distance from the public“(S. 12). Für jeden dieser Debattenstränge werden beispielhaft Wortführer, Positionen und Konfliktpunkte skizziert, so dass sich eine gute Einführung in jüngste erinnerungskulturelle Debatten ergibt. Daran anschließend führt Tyrrell in die Auseinandersetzung um die zunehmende Spezialisierung ein und verweist auf zweierlei: Erstens sei die Rede über Spezialisierung schnell zu einer Chiffre geworden, mit der verschiedene Aspekte historiographischen Schaffens – wie die Spannung zwischen Fachsprache und Lesbarkeit oder der Grad narrativer Kohärenz – thematisiert werden konnten. Zudem ließen sich mit ihr auch eine Reihe ganz anderer Ziele verfolgen, „such as the popularization of history, attacks on the nature of training for university research and attempts to incorporate new themes in the discourse of history“ (S. 26). 2007-3-110 Zweitens durchliefen die Auseinandersetzungen über Spezialisierung und öffentliche Präsenz des Faches unterschiedliche Phasen: Während zunächst die Vereinbarkeit von Detailforschung und „general history“ keineswegs bezweifelt worden war, sei seit den 1930er-Jahren eine deutliche Tendenz der Profession hin zu Spezialisierung und Konzentration auf Einzelstudien festzustellen. Darauf reagierte eine immer stärkere Kritik, die für eine historisch interessierte Leserschaft außerhalb der Universitäten Partei ergriff, da man besorgt war über „the lack of influence over public policy, civic debate, and popular culture“ (S. 39). Zudem lagen dieser Konfrontation zwei weitere Entwicklungen zugrunde: Die Große Depression hatte auch unter Historikern zu hoher Arbeitslosigkeit geführt. Daher versuchten einige die Promotionsausbildung hin zu mehr Allgemeinwissen zu reformieren, um die Arbeitsmarktchancen zu erhöhen (S. 33). Ferner stand die Geschichtswissenschaft in einem Konkurrenzverhältnis mit den neuen Sozialwissenschaften. Auch hierfür versprach ein breiteres Verständnis Vorteile: „history had the potential to explain the other social sciences and to situate human development more intelligibly by its commitment to including all of the human past in its stories.“ (S. 39) Für die drei an diese Einführung anschließenden historischen Teile des Buches, die sich jeweils anderen Sphären öffentlichen Engagements und verschiedenen Adressatenkreisen zuwenden, hat der Autor umfangreiche Bestände aus institutionellen Überlieferungen und individuellen Nachlässe ausgewertet und dabei von vornherein zwei Eingrenzungen vorgenommen: Erstens betrachtete er nur jene Historiker, die sich mit US-amerikanischer Geschichte befassten und ließ demnach die Historiographie zu anderen Weltregionen, einschließlich Europas, außen vor. Zweitens beschränkte er sich auf nationale Bedingungsfaktoren, wenngleich er eingangs darauf hinweist, dass Wissenstransfer und internationale Entwicklungen in der Historiographie Einfluss ausgeübt hätten. Der zweite Abschnitt des Buches („Historians and the Masses, 1890-1960“) widmet sich dem Verhältnis akademischer Ge- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 495 Außereuropäische Geschichte schichtsschreibung zu einem Massenpublikum, also den „general readers“, Kinogängern, Fernsehkonsumenten sowie Radiohörern. Grundsätzlich hält Tyrrell fest, dass trotz fortschreitender Professionalisierung und Spezialisierung historischer Forschung ein beachtlicher Teil der Historikerschaft beständig ein breites Publikum zu erreichen bemüht war. Obwohl unter anderem 1938 innerhalb des Historikerverbandes, der American Historical Association (AHA), eine Initiative zur Herausgabe einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift gescheitert war, kooperierten seit den 1920er-Jahren Journalisten, Intellektuelle, Fachhistoriker und Verlagshäuser in vielfältigen Projekten. Sie reagierten damit auf ein gesellschaftliches Interesse an US-amerikanischer Geschichte in der Folge des Ersten Weltkrieges sowie auf den Bedarf an einer Vergewisserung der eigenen Traditionen im Zuge der Reformen des New Deals. Allerdings erwies sich diese Zusammenarbeit im Verlauf der 1940er-Jahre als immer schwieriger und kam in der folgenden Dekade ganz zum Erliegen. Tyrrell sieht dies im Wesentlichen in einer veränderten Erwartungshaltung gegenüber Vergangenem begründet: „Rather than history as explanation for the present, people in the age of the bomb and American world power sought the less critical terrain of ‘heritage’.“ (S. 71) Das Aufkommen neuer Medien änderte zwangsläufig die Formen und Wege des Ansprechens und Erreichens eines breiten Publikums. Im Umgang mit neuen Medien wie Radio und Fernsehen fiel es offensichtlich um einiges leichter, historisch-wissenschaftliche Inhalte über Hörfunksendungen zu vermitteln, als Einfluss auf kommerzielle Spielfilme zu nehmen oder gar eigenständige Fernsehsendungen zu produzieren. Die Aktivitäten reichten vom Betreiben universitätseigener Rundfunkstationen über die Ausstrahlung von Vorlesungen und ganzen Kursen auf kommerziellen Radiowellen bis hin zu einem Hörprogramm der AHA, welches ab 1937 zehn Jahre lang gestaltete wurde. Dem Einfluss akademischer Geschichtswissenschaft auf Schulen und Colleges wendet sich Tyrrell im nächsten Teil („The Problem of Schools“) zu. Tyrrell macht zum einen auf vielfältige Initiativen der AHA hin- 496 sichtlich der Gestaltung des Geschichtsunterrichtes seit den 1890er-Jahren aufmerksam und interpretiert sie überzeugend als Reaktion auf die andauernde öffentliche Forderung nach einer verbesserten Geschichtsvermittlung, die von ganz unterschiedlichen Akteuren mit noch unterschiedlicheren Interessen artikuliert wurde: „From the 1910s onward politicians, newpaper editors, and interest groups lobbied to boost U.S. history [...] and force American school history to conform with patriotic ideals. This drive began during the hypernationalist phase of World War I. In the 1920s it took a new twist as Irish Americans and Catholics strove to defeat what they saw as Anglo bias in university-authored history texts [...]. In the mid 1930s the focus sharpened into anti-Communist pressure to explore Marxist influence on textbooks.“ (S. 115) Die Haltung von Fachhistorikern gegenüber diesen Erwartungen wandelte sich mit dem Beginn des zweiten Weltkrieges auffallend: Hatte man bis dahin professionelle Distanz zu politisch motivierten Forderungen zu wahren gesucht, verschrieb sich nun die Mehrzahl bereitwillig dem Plädoyer für die Konzentration auf die Nationalgeschichte in Dienste des Vaterlandes. Zwar wurde anfangs noch überlegt, ob amerikanische Geschichte „in terms of a broader international context“ (S. 136) gelehrt werden sollte, doch verloren sich solche Ansätze je länger der Krieg andauerte. Die Einschätzung Tyrrells, dass die Geschichte anderer Länder zunehmend aus dem disziplinären Kanon verdrängt wurde, bedarf allerdings weiterer Begründung: Denn weder zeigt er quantitativ auf, dass die Geschichte anderer Länder in den Lehrplänen und Textbüchern tatsächlich abgenommen hätte, noch geht er dem Aufschwung der „area studies“ und deren Integration in die historische Lehre (zumindest) am College nach. Überzeugend beschreibt er hingegen die Herausforderung, die das in den 1920er-Jahren entstehende Fach der „social studies“ bedeutet haben musste, aus der sich schließlich auch das – bislang in der Forschung unbeachtet gebliebene – Ringen der AHA mit neuen bildungspolitischen Institutionen, wie der „National Education Association“, dem „National Council for the Social Studies“ oder der „Progressive Education Association“, ergab. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart Susannah Walker: Style and Status Wichtig ist ferner der Hinweis, das Verhältnis universitär angebundener Historiker zum Unterricht an den Schulen erkläre sich wesentlich aus zwei strukturellen Bedingungen des US-amerikanischen Bildungssystem: Als ein „product of cultural diversity und mass education“ (S. 142) ohne landesweite Lehrplanvorgaben seien Reformen nur schrittweise und mühsam durchzusetzen. Erschwerend sei zudem die fehlende Basis institutioneller Kooperation zwischen Geschichtslehrern und Fachhistorikern. Im letzten Teil des Buches („Public Historians“) untersucht Tyrrell die Integration von professionellen Historikern in Arbeiten für die Regierung und staatliche Behörden. Auch hier widerspricht er der fachinternen Wahrnehmung und unterstreicht, „they did intervene in the production of public knowledge and allied their efforts closely to those of the nation-state“ (S. 153). Diese Interventionen seien am nachhaltigsten zwischen den 1930er- und 1950er-Jahren gewesen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Verhältnisses läge in der Rolle des Staates: „All aspects of the state’s history-making functions were fragmented and ineffective“ (S. 155), und daher bedurfte es besonderer Formen des Zusammengehens, anderer zumindest als der europäischen Anbindung an den Nationalstaat, worauf Tyrrell explizit hinweist. Während zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts akademische Historiker zunächst vereinzelt in „local historical societies, city administrations and state governments“ arbeiteten, setzte in den 1930er-Jahren eine viel intensiveres Einbindung in staatliche Strukturen ein (unter anderem dem „U.S. Departmet of Agriculture“, dem „National Park Service“ oder den „National Archives“). Die geschichtspolitischen Aktivitäten der Regierung nahmen vor allem während des Zweiten Weltkriegs zu und banden immer mehr Fachhistoriker ein: „by 1945, at least 50% of professional historians aged twenty-five to forty had engaged in some type of war-history activity“ (S. 187). Schließlich wird noch ein weiterer Bereich der Kooperation mit staatlicher historischer Forschung aufgezeigt: das „state und local history movement“. Dabei wird deutlich, wie sich diese ‚grass-root’-Bewegung zunehmend nach Standards der akademischen His- 2007-3-092 toriographie professionalisierte und damit in Konkurrenz zu ihr trat sowie zugleich ‚amateur historians’ aus dem professionellen Feld verdrängte. Dieser Prozess war zudem von einer stetigen Nationalisierung der Lokal- und Regionalgeschichtsschreibung begleitet. Mit dieser Studie liegt ein eindrucksvolles Buch vor, das nicht nur eine Leerstelle in der Forschungslandschaft füllt, sondern auch mit Hilfe einer konsequenten Historisierung gegenwärtige Selbstbeschreibungen des Faches hinterfragt. Dass der Vergleich mit Großbritannien und Frankreich am Ende einiger Kapitel unbefriedigend bleibt, ist dabei zu verschmerzen. Dieser Verortung der Historiographiegeschichte in ihrem gesellschaftlichen und politischen Kontext, und zwar als Handlungsraum und nicht nur Bedingungsgefüge, kann man nur viele Leser/innen zu wünschen, auch weil das Buch über die engere Problemstellung hinaus gleichsam ein Gesamtbild der Profession in den USA entwirft. HistLit 2007-3-110 / Katja Naumann über Tyrrell, Ian: Historians in Public. The Practice of American History, 1890-1970. Chicago 2005. In: H-Soz-u-Kult 10.08.2007. Walker, Susannah: Style and Status. Selling Beauty to African American Women, 1920-1975. Lexington: University Press of Kentucky 2007. ISBN: 978-0-8131-2433-9; 264 S. Rezensiert von: Silke Hackenesch, Universität zu Köln, Historisches Seminar, AngloAmerikanische Abteilung „African American beauty culture was distinctive because it explicitly reflected and articulated twentieth-century racial politics in the United States“ (S. 3), konstatiert Susannah Walker in der Einleitung zu „Style and Status. Selling Beauty to African American Women, 1920-1975“. Mit ihrer Arbeit über die Entstehung und Entwicklung der afrikanisch-amerikanischen Schönheitsindustrie lässt sie sich in eine relativ junge Forschungslandschaft einordnen, die sich mit der Konzeption und Bedeutung von Schönheitsidealen für African-Americans auseinandersetzt. Wie verschiedene Autorinnen ge- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 497 Außereuropäische Geschichte zeigt haben, lassen sich anhand von Haarfrisuren und Kosmetikartikeln, beziehungsweise deren Bewerbung, distinkte Vorstellungen von „race“, „class“, und „gender“ ablesen. Diese konstituieren sich innerhalb eines Spannungsfeldes, in dem sich vor allem afrikanisch-amerikanische Frauen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, die ihnen ihre Schönheitsideale zu diktieren versucht, bewegen und in der sie sich Handlungsspielräume erkämpfen.1 In „Style and Status“ wählt Walker einen konsumgeschichtlichen Zugang, der einer chronologischen Ordnung folgt. Ziel ihrer Arbeit ist es, die afrikanisch-amerikanische „Schönheitskultur“ („beauty culture“) zu untersuchen, indem sie zum einen Werbeanzeigen von Kosmetikartikeln in Printmedien analysiert, und zum anderen die Entstehung und Entwicklung der Kosmetikindustrie für Afroamerikanerinnen nachzeichnet (S. 7). Walker betrachtet „beauty culture“, verstanden hier als Schönheitspflege und -industrie, als den zentralen Bereich, in dem African-Americans aktiv an der amerikanischen Konsumkultur partizipierten. Nicht nur, dass sie trotz oft geringerer Einkommen verhältnismäßig mehr Geld für Kosmetika ausgaben, mehr noch, „beauty culture was one industry that flourished in black communities, and it was an industry dominated by black businesswomen“ (S. 7). Walker zeigt gleich zu Beginn das Spannungsverhältnis zwischen „consumer citizenship“ und „black business nationalism“ auf (S. 7). Letzterer resultierte aus der bis Mitte des 20. Jahrhunderts praktizierten Segregation, die African-Americans dazu zwang, eine eigene Schönheitsindustrie zu etablieren, die sich als äußerst lukrative ökonomische Nische erwies (S. 21). Folglich wurde versucht, obgleich mit schwindendem Erfolg, „weiße“ Firmen aus diesem profitablen Geschäftszweig heraus zu halten. Ein Artikel von 1935 in dem Branchenblatt „Apex 1 Vgl. Banks, Ingrid, Hair Matters. Beauty, Power, and Black Women’s Consciousness, New York 2000; Blackwelder, Julia K., Styling Jim Crow. African American Beauty Training During Segregation, College Station, TX 2003; Craig, Maxine, Ain’t I a Beauty Queen? Black Women, Beauty, and the Politics of Race, Oxford, New York 2002; Rooks, Noliwe M., Hair Raising. Beauty, Culture, and African American Women, Piscataway, NJ 1996. 498 News“ beispielsweise verglich den Vorstoß euro-amerikanischer Unternehmen mit Mussolinis Invasion in Äthiopien (S. 22). „Consumer citizenship“ implizierte auf der anderen Seite jedoch, dass African-Americans als gleichwertig finanzstarke Konsumenten wahrgenommen und in der Werbung adressiert werden wollten, auch und gerade von großen marktführenden Unternehmen. In der Nachkriegszeit schließlich rückten AfricanAmericans, von denen inzwischen 60 Prozent in den Städten des Nordens lebten und höhere Einkommen erzielten (S. 121), stärker in das Blickfeld „weißer“ Firmen. Gleichzeitig etablierten sich Hochglanzmagazine wie zum Beispiel „Ebony“ mit hohen, landesweiten Auflagen, in denen große, überregionale Unternehmen, die meist über größere finanzielle Mittel verfügten, Anzeigen für ihre Produkte schalteten (S. 95). Dabei bedienten sie sich oft einer Rhetorik, die suggerierte, dass es sich um afrikanisch-amerikanische Firmen handelte (S. 24f., 43f.). Ein weiterer Eckpfeiler der Expansion dieses Marktes waren Kosmetiksalons. Kamen Kosmetikerinnen und Friseurinnen in den 1920er- und 1930er-Jahren noch zu ihren Kundinnen nach Hause oder betrieben kleine Salons in ihren Nachbarschaften, so entstanden in den späten 1940erund 1950er-Jahren in allen großen Städten des Nordens Kosmetiksalons, die in erster Linie mittelständische Kundinnen anzogen (S. 115117). In ihrer Analyse der Bewerbung von Schönheitsprodukten für Haut und Haare zeichnet Walker überzeugend deren rhetorischen Wandel nach. In den 20er- und 30er-Jahren, in denen die Schönheitskultur zusehend kommerzialisiert wurde, bewarben Pioniere wie Madam C. J. Walker und Annie Turbo Malone Produkte wie „hair straighteners“ und „skin bleaching creams“ als Mittel, die weibliche Attraktivität zu maximieren und somit mehr Respektabilität und ökonomische Unabhängigkeit zu erlangen, wobei sie stets den Nutzen für die gesamte „schwarze“ Community unterstrichen (S. 66). In der Nachkriegszeit hingegen lag der Fokus stärker auf einem glamourösen, femininen Erscheinungsbild, um den Wert auf dem Heiratsmarkt zu steigern (S. 109). Die Produkte selber waren keinesfalls unumstritten und führten in- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart H. Walravens: Joseph Franz Rock (1884-1962) nerhalb der afrikanisch-amerikanischen Communities zu hitzigen Debatten, die die Autorin in ihrer ganzen Komplexität skizziert. Zum einen brauchte es eine Weile, bis Kosmetika als „modern“ galten und keinen „verruchten“ Beigeschmack mehr hatten (S. 32); zum anderen sahen sich Madam Walker und Malone dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden mit ihren Produkten ein „weißes“ Schönheitsideal propagieren, dass „schwarze“ Frauen von vornherein als unattraktiv konstruiere. Dem entgegneten sie, dass „hair straightening“ keineswegs als Versuch, „weiß zu werden“ interpretiert werden, sondern vielmehr der Pflege und Handhabbarkeit dienen sollte. In den folgenden zwanzig Jahren wurden die Techniken des „straightening“ immer weiter entwickelt und die Praktik als solche nicht mehr hinterfragt (S. 124). Vor dem Hintergrund der Bürgerrechtsbewegung in den 1940er- und 1950er-Jahren „integrierten“ afrikanisch-amerikanische Firmen ihre Anzeigen, indem sie nicht nur „schwarze“, sondern auch „weiße“ Models abbildeten (S. 145). Dies mag verwunderlich erscheinen, richteten sich die beworbenen Produkte doch ausschließlich an Afroamerikanerinnen. Walker argumentiert jedoch, dass damit vielmehr eine multikulturelle Vision kommuniziert wurde, ein Ideal der Gleichheit, was den politischen Wunsch der Zeit reflektieren sollte (S. 160). Schließlich widmet sich die Autorin der Neudefinition von „schwarzer“ Schönheit, die unter dem Einfluss des „Black Power Movement“ popularisiert worden ist. Obwohl geglättetes Haar zu jedem Zeitpunkt die favorisierte Frisur bei Afroamerikanerinnen war, galt der Afro, der eigentlich in einem Modetrend im New York der späten 50er-Jahre wurzelte2 , als „natürlicher“ style, der wie kein anderer „schwarze“ nationalistische Politik ausdrückte (S. 182). Gleichzeitig wurde der Afro als Rückgewinnung der eigenen Körperlichkeit deklariert und brach mit gängigen Vorstellungen von Femininität (S. 179f.). Das Vermarktungs- und Verkaufspotenzial des Afros schnell erkennend, überfluteten Produkte den Markt, die sich einer „black pride“-Rhetorik bedienten (S. 171f., 2007-3-170 186). Die afrikanisch-amerikanische Schönheitsindustrie war jedoch nicht ausschließlich enthusiastisch. Skeptiker befürchteten, dass der Stil, entgegen seiner politischen Konnotation, den „schwarzen“ Communities schaden würde, da den Friseursalons die Kundschaft ausblieb, wenn Frauen ihre Haare „natürlich wachsen“ ließen (S. 189). Durch die chronologische Vorgehensweise Walkers ergeben sich an manchen Stellen Redundanzen, und bei der – im ganzen recht „theoriearmen“ – Lektüre wird aufgrund mangelnder Verweise stellenweise nicht klar, aus welchen Quellen die Autorin ihre Informationen bezieht. Zudem schenkt Walker bei ihrer Diskussion von „straightened hairstyles“ dem „gender“-Aspekt nicht immer die nötige Aufmerksamkeit, beispielsweise wenn sie den „conk“ mit „straightening“-Techniken für Frauen gleichsetzt (S. 106, 141). Der „conk“ muss vielmehr als eine Mimikry von „weißem“, männlichen Haar gelesen werden, der in den 1940er-Jahren vor allem von „hustlern“ getragen wurde und sämtlichen Konventionen trotzte, die vorgaben, wie bürgerliche, respektable Männer, gleich ob „schwarz“ oder „weiß“, auszusehen hatten. Dahingegen stand geglättetes Haar bei Afroamerikanerinnen in Übereinstimmung mit MittelklasseNormen.3 Dennoch gelingt es Walker anschaulich, das Paradoxon aufzuzeigen, in dem sich die „schwarze“ Schönheitsindustrie permanent bewegte. Mit ihrem Fokus auf die Kommerzialisierung und Expansion der afrikanischamerikanischen Schönheitskultur leistet sie einen originären Beitrag zu diesem Forschungsgebiet. HistLit 2007-3-092 / Silke Hackenesch über Walker, Susannah: Style and Status. Selling Beauty to African American Women, 1920-1975. Lexington 2007. In: H-Soz-u-Kult 06.08.2007. 3 Mercer, 2 Kelley, Robin D. G., Nap Time. Historicizing the Afro, in: Fashion Theory, 1, 4 (1997), S. 339-352, hier S. 341. Kobena, Black Hair/Style Politics, in: Gelder, Ken; Thornton, Sarah (Hrsg.), The Subcultures Reader, London, New York 1997, S. 420-435, hier S. 432. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 499 Außereuropäische Geschichte Walravens, Hartmut: Joseph Franz Rock (18841962). Tagebuch der Reise von Chieng Mai nach Yünnan, 1921-1922. Briefwechsel mit C. S. Sargent, University of Washington, Johnannes Schubert und Robert Koc. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 2007. ISBN: 978-3-7001-3830-3; 580 S. Rezensiert von: Evelyn Gottschlich, Frühe Neuzeit, LMU München Joseph Franz Rock war ein Geograph, Sprachwissenschaftler und Botaniker, der sich mit seinen Studien über die Flora Hawaiis und Chinas einen Namen machte. Von 1922 bis 1949 lebte er im Südwesten Chinas in der Nähe von Lijiang und erforschte die Kultur der Naxi, später eine der anerkannten Minderheiten in der Volksrepublik China. Seine letzten Jahre verbrachte er auf Reisen in den USA, Europa, der Himalayaregion und Hawaii. Sein umfangreicher Nachlass wird von Hartmut Walravens ausgewertet, der bereits mehrere Quelleneditionen1 zu Rock herausgegeben hat. Vermutlich aus diesem Grund fehlen in dem vorliegenden Band umfangreiche biographische Angaben zu Rock. Walravens weist lediglich auf die bereits zu seiner Person erschienene Literatur hin. Den chinesischen Titeln fügt er eine kurze Inhaltsangabe bei. In dem vorliegenden Band werden die Zusammenarbeit und die persönlichen Verbindungen Rocks zu den führenden Fachwissenschaftlern seiner Zeit sichtbar. Die Briefwechsel und das Tagebuch Rocks sind aussagekräftige Quellen zur Erforschung der internationalen Wissenschaftsgeschichte. So nahm die institutionelle Tibetologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam Gestalt an und Rock korrespondierte mit 1 Walravens, Hartmut (Hrsg.), Joseph Franz Rock. Briefwechsel mit Egbert H. Walker, 1938-1961 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Klasse Sitzungsberichte, 738. Band), Wien 2005; ders. (Hrsg.), Joseph Franz Rock (1884-1962). Berichte, Briefe und Dokumente des Botanikers, Sinologen und Nakhi-Forschers. Mit einem Schriftenverzeichnis (= VOHD Supplement 36), Stuttgart 2002; ders. (Hrsg.), Joseph Franz Rock. Expedition zum Amnye Machhen in Südwest-China im Jahre 1926. Im Spiegel von Briefen und Tagebüchern (= Orientalistik Bibliographien und Dokumentationen 19), Wiesbaden 2003. 500 ihren wichtigsten Vertretern: zum Beispiel Giuseppe Tucci, dessen Quelleneditionen bis heute relevant sind, Turrell Wylie, der die heute gebräuchlichste Transliterationsschrift für Tibetisch verfasste und Johannes Schubert, der in Leipzig den ersten deutschen Lehrstuhl für Tibetologie inne hatte. Die Tibetologie wurde oft über den religiösen Aspekt mit der Indologie verknüpft – die hier deutliche Kooperation von Sinologen und Tibetologen korrigiert dieses Bild und weist auch auf manchmal ganz pragmatische Gründe für die Zusammenarbeit hin. Die Quellen bieten viel für eine Geschichte der Tibetologie und Sinologie, auch für die einzelnen Forscherbiographien. Arbeiten zu diesen Themen sind wünschenswert, da sich bisher nur vereinzelte Publikationen damit beschäftigen.2 Walravens will mit dem vorliegenden Werk auf folgende Aspekte von Rocks Leben hinweisen: a) die Rezeption seiner Arbeit in den USA, b) seine spätere Schaffensphase, c) sein persönliches Handeln und Fühlen, d) weitere Details zum Verlauf der AmnyeMachhen-Expedition3 , e) Rocks Bereitschaft zur Teamarbeit, f) Rocks Reiseroute (1926) im Vergleich zu der von Major Davies (1909). Im weiteren Verlauf der Einleitung spricht Walravens unter den Überschriften „Biographisches“, „Persönliches Leben“, „Neffen“, „Amerika“, „Deutschland“, „Veröffentlichungen“, „Wissenschaftliche Beziehungen“ und „Bibliothek“ die Interpretation einzelner Textstellen an (S. 10–18). Diese Hinweise auf mögliche Lesarten der Quellen sind aufschlussreich und interessant. Die Deutungen können als Einladung verstanden werden, sich unter den von Walravens angesprochenen Perspektiven mit der Person Rocks zu beschäftigen. Der Herausgeber selbst liefert keine weitergehende Analyse. In der Edition folgt der eher knappen Einführung der Abdruck einiger amerikanischer Zeitungsartikel zu Rocks Reisen und Arbeiten zwischen 1921 und 1934 sowie ein Leserbrief Rocks von 1955 (S. 19–34). Die Artikel berich2 Z.B. Martin, Helmut; Hammer, Christiane (Hrsg.), Chinawissenschaften. Deutschsprachige Entwicklungen. Geschichte. Personen. Perspektiven. (=Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg 303), Hamburg 1999. 3 Vgl. Walravens (Hrsg.), Joseph Franz Rock. Expedition zum Amnye Machhen (wie Anm. 1). Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart H. Walravens: Joseph Franz Rock (1884-1962) ten meist enthusiastisch über die Reisen und Entdeckungen Rocks und sind für die Untersuchung der öffentlichen Resonanz auf Rock und seine Arbeit relevant. Anschließend werden mehrere Briefwechsel von Rock mit Fachkollegen und Freunden sowie mit seinem Neffen ediert. Zunächst werden die Briefe von Rock und Wissenschaftlern der University of Washington in den Jahren 1950 bis 1962 zusammengefasst (S. 35–132), in welchen vor allem die Übergabe von Rocks Bibliothek und weitere Kooperationen verhandelt wurden. Der Austausch Rocks mit Fachkollegen spiegelt sich auch in den Korrespondenzen von Rock mit Charles Sprague Sargent in den Jahren 1924 bis 1927 (S. 225–300) und dem Leipziger Tibetologen Johannes Schubert von 1935 bis 1961 (S. 301–364). Die Briefe bieten einen kontinuierlichen Einblick in die Arbeit Rocks – angesprochen werden unter anderem die Expedition Rocks in das Innere Chinas, konkrete Quellenfunde, Übersetzungen und Treffen mit anderen Kollegen. Teilweise gibt der Schriftverkehr die Meinungen und Urteile Rocks und der anderen Verfasser in sehr persönlicher Weise wieder. Die Briefe der Gelehrten sind nach den ersten Kontakten oft keine offiziellen Schreiben mehr, sondern berichten auch über das Privatleben, gemeinsame Freunde, Krankheiten und geplante Reisen. Insgesamt werden weitaus mehr an Rock adressierte Schreiben wiedergegeben, als von ihm verfasste. Eine sinnvolle Ergänzung wäre, auf andere schon veröffentlichte Briefe hinzuweisen. Die Briefe an seinen Neffen Robert Koc zwischen 1957 und 1962 geben nun Rocks genuine Aussagen wieder. Hier finden sich wiederum nur wenige Antworten Kocs. In diesen Briefen schrieb Rock oft über seine Gefühle und seinen Gesundheitszustand. Diesem Kapitel beigeordnet ist ein Briefwechsel zwischen Koc und Giuseppe Tucci (S. 133–224). Auf seiner Reise 1921 bis 1922 von Chieng Mai nach Yünnan führte Rock das Titel gebende Reisetagebuch (S. 365–533). Neben seiner Reiseroute beschrieb der Botaniker Rock in langen Absätzen die regionale Pflanzenwelt. Sehr ergiebig sind in diesem Teil die Erzählungen von Begegnungen mit den einheimischen Völkern und ihren Kulten. Auch die Schilderung der Situationen, in denen Rock 2007-3-170 fotografiert oder versucht, zu fotografieren, sowie die Berichte über seine fotografischen Motive sind für die Begegnung der Europäer mit den chinesischen Völkern äußerst aufschlussreich. Die Veröffentlichung dieser Briefe und Texte, die in verschiedenen Archiven zwischen Hawaii und Berlin liegen, ist sehr lobenswert. Die chronologische Übersicht über die Briefe vor jedem Abschnitt und die Register sind hilfreich, um Textsstellen schnell zu finden. Beim Lesen wird klar, wie vielschichtig und wie eng der Kontakt innerhalb der Tibetologen- und Sinologenwelt war. Es steckt noch weitaus mehr in diesen Quellen als die Punkte, die Walravens aufwirft. Die Verfasser äußerten sich zur politischen Lage in China, zu ihren Arbeiten und Verbindungen. Daneben lassen sich Hinweise zum Beispiel auf die Sammlungen tibetischer und chinesischer Quellen oder etwa auf die Reisemöglichkeiten finden. Einen Einblick in die Gefühlswelt und Motivation Rocks lässt sich natürlich erst nach einer umfassenden Analyse all seiner Äußerungen und auch dann nur mit Vorsicht gewinnen. Dennoch wäre aus der Edition mehr zu machen gewesen. Bei den meisten Texten vermisst man einen ausführlichen Kommentar. Es fehlen Anmerkungen zu den Originalquellen. Bei den Zeitungsartikeln wären Informationen zu Layout, Rubrik, Bebilderung etc. interessant; bei den Briefen neben diesen Beschreibungen Kommentare zu dem Verhältnis von Rock und seinen Briefpartnern, wie sie Walravens bei der Einführung zu dem Schriftverkehr mit Schubert (S. 301–302) oder vor den letzten beiden Briefen (S. 535–539) bietet. Weiterhin fehlen Bemerkungen zur Quellenlage und -auswahl. Gerade weil die veröffentlichten Briefe oft auf Seiten eines Korrespondenzpartners liegen, wäre es wichtig, zu wissen, ob andere Briefe nicht eingesehen werden konnten, anderweitig veröffentlicht wurden oder verloren gegangen sind. Die Anmerkungen zum Inhalt der Briefe sind sehr spärlich, beim Tagebuch fehlen sie ganz. Die Einführung der erwähnten Personen ist im Allgemeinen sehr knapp. Die biographischen Informationen zu seinen Korrespondenzpartnern Sargent und Schubert muss man in den Fußnoten des ersten Abschnitts suchen (Sargent Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 501 Außereuropäische Geschichte auf S. 50, Schubert S. 80). Unverzeihlich ist jedoch, dass die Biographie von Rocks Neffen Robert Koc an keiner Stelle erwähnt wird. Zum besseren Verständnis wäre ein kurzer Überblick über die Familienverhältnisse, etwa in der Einleitung unter „Neffen“ (S. 13), sinnvoll gewesen. Die Gliederung des Bandes und das Inhaltsverzeichnis könnten klarer strukturiert sein. Eine Bibliographie der verwendeten Literatur würde die Edition gut ergänzen. Insgesamt ist es jedoch ein großes Verdienst von Walravens, diese handschriftlichen Quellen ediert zu haben. Sie sind für die Wissenschaftsgeschichte wertvoll und auf diese Weise in einer sinnvollen Zusammenstellung zugänglich. HistLit 2007-3-170 / Evelyn Gottschlich über Walravens, Hartmut: Joseph Franz Rock (18841962). Tagebuch der Reise von Chieng Mai nach Yünnan, 1921-1922. Briefwechsel mit C. S. Sargent, University of Washington, Johnannes Schubert und Robert Koc. Wien 2007. In: H-Soz-uKult 04.09.2007. Walter, Richard J.: Politics and Urban Growth in Santiago, Chile, 1891-1941. Stanford: Stanford University Press 2005. ISBN: 0-8047-4982-5; 319 S. Rezensiert von: Christof Parnreiter, Institut für Geographie, Universität Hamburg Chile ist heute mit einem Verstädterungsgrad von fast 90 Prozent nicht nur eines der Länder mit dem weltweit höchsten Anteil an Stadtbevölkerung, sondern auch einer der Staaten Lateinamerikas, in dem sich ein sehr hoher – und steigender – Anteil von Bevölkerung, Wirtschaft und sozialer Infrastruktur in der Hauptstadt Santiago zusammenballt. Wie wurde Santiago zu einer Stadt, die in Chile alle anderen hinter sich ließ? Diese Frage beantwortet Walter in einer Studie über die Stadtentwicklung in den fünf Jahrzehnten zwischen 1891, als zum ersten Mal eine Stadtregierung gewählt wurde, und 1941, als die erste Mitte-Links-Regierung Chiles mit dem Tod des gewählten Präsidenten Pedro Aguirre Cerda zu Ende ging. Walter zeichnet entscheidende Abschnitte von Stadtwachs- 502 tum und –politik auf Basis einer großen Zahl von Primärquellen nach. Das Buch stellt, so viel sei vorweg genommen, eine Bereicherung der Literatur zur lateinamerikanischen Stadt dar: es ist faktenreich; es richtet sich an HistorikerInnen ebenso wie an StadtgeografInnen oder PlanerInnen; es ist gut lesbar, ohne den Verlockungen einer populärwissenschaftlichen Darstellung zu erliegen. Walters Studie ist in 13 Abschnitte gegliedert. Drei sind der Zeit von 1891 bis 1920 gewidmet, vier den 1920er-Jahren, fünf den 1930er-Jahren und ein abschließendes Kapitel den frühen 1940er-Jahren. Zu jedem Jahrzehnt gibt es einen einführenden Überblick, auf den detailliertere Abschnitte folgen, deren Periodisierung sich an der politischen Geschichte der Stadt orientiert. Ein Schwerpunkt liegt auf dem öffentlichen Verkehr, weil, so Walter, dieses Thema nicht nur von großer Bedeutung für die Stadt, ihre BewohnerInnen und ihre jeweiligen Regierungen war, sondern auch, weil sich hier die Dynamiken lokalen Regierens besonders deutlich herausarbeiten lassen. Im – recht kurzen – Abschlusskapitel stellt Walter der Geschichte Santiagos die der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegenüber (einer Stadt, über die er vor wenigen Jahren ein ähnliches Buch verfasst hat), um insgesamt mehr Ähnlichkeiten als Divergenzen festzustellen. Das Buch stellt für Interessierte an lateinamerikanischer Stadtentwicklung einen guten Einstieg dar. Für LeserInnen, die mit aktuellen Debatten der Stadtforschung vertraut sind, bietet es darüber hinaus eine interessante Blickerweiterung, die sich aus der historischen Betrachtungsweise ergibt. Die Erweiterung um die longue durée zeigt die Beständigkeit bestimmter stadtpolitischer Themen, was sich gut an den Problemen des öffentlichen Verkehrs erkennen lässt, die in den letzten Monaten ja auch von europäischen Medien berichtet wurden. Konflikte zwischen der Stadtverwaltung, der Straßenbahngesellschaft und deren Arbeitern ziehen sich durch die Geschichte Santiagos. Hauptstreitpunkte waren einerseits die von den Betreibergesellschaften gewünschten Fahrpreiserhöhungen, die diese mit den Lohnforderungen der Arbeiter rechtfertigten, und andererseits „conflicts, congestion, and confusion as they (Be- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart A. Windus: Afroargentinier und Nation treibergesellschaften von Taxis, Bussen und Straßenbahn) fought for the same passengers over many of the same routes“ (S. 209). Wer würde bei dieser Schilderung der 1930erJahre nicht an die heutigen „Wettrennen“ beispielsweise auf der O’Higgins denken? Die Konflikte um den öffentlichen Verkehr in Santiago enthüllen aber auch ein weiteres Element der Geschichte der Stadt (und des Landes), nämlich den sogenannten „ökonomischen Nationalismus“, der in Chile auch heute eine im lateinamerikanischen Vergleich relativ große Rolle spielt. In den frühen 1920er-Jahren versuchte etwa die in britischen Besitz stehende „Chilean Tramway and Light Company“, durch eine Fusion mit einem neu gegründeten chilenischen Unternehmen, durch eine Umbenennung und durch die Berufung namhafter Chilenen in wichtige Positionen ihren (schlechten) Ruf als ausländischer Monopolist loszuwerden, um danach Fahrpreiserhöhungen besser durchsetzen zu können. Das misslang zwar; in einer Besprechung des Bandes fand die Business History Review aber in solchen Manövern Beispiele für die „origins of Chilean hostility to foreignowned businesses“. Walters Ausführungen zur residenziellen Segregation bieten ein Beispiel dafür, dass der historische Blick hilfreich für die aktuelle Stadtforschung ist. Lange dominierte in der (stadtgeografischen) Forschung das Bild, Santiago sei, wie andere lateinamerikanische Städte auch, eine sozialräumlich gespaltene Stadt, in der Reiche und Arme klar voneinander getrennt seien. Jüngere Arbeiten, die diesen Befund in Frage stellen, erhalten nun Schützenhilfe von Walter, der bereits für die Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert feststellt, dass „some of the worst housing [. . . ] could be found close to some of the best“ (S. 10). Das Bild wandelt sich bis zum Ende der in dem Band behandelten Zeit nicht: Avenida Independencia, eine der Straßen, in denen sich das Stadtwachstum der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts materialisierte, wird in den 1930er-Jahren in einem zeitgenössischen Bericht als eine sehr heterogene Gegend dargestellt. Ein anderer Beobachter beschreibt in den 1940er-Jahren eine Armensiedlung an den Ufern des Mapocho, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Reichenbe- 2007-3-103 zirk El Golf befindet. Auch die heute in Santiago geführte Debatte um die Amerikanisierung der Stadt(gestalt) stellt keine Neuheit dar: In den 1920er-Jahren und 1930er-Jahren wurden an mehreren Stellen so genannte Wolkenkratzer errichtet, die von den einen als Ausdruck von Modernität gefeiert, von den anderen aber wegen ihrer Monströsität abgelehnt wurden. Beide Seiten, und das ist hier der springende Punkt, sahen in den neuen Hochhäusern die Globalisierung dessen, was sie als US-amerikanische Architektur bezeichneten. So heißt es zustimmend in einem Bericht der Zeitschrift Zig-Zag, die Wolkenkratzer zeigten „the advance of North America towards the extreme south of South America“ (S. 149), während ein kritischer Bericht in der gleichen Zeitschrift monierte, dass die aus „Yankilandia“ (S. 148) importierten Gebäude Santiago von seiner Kultur und seiner Tradition entfremden würden. Abschließend seien noch zwei kritische Punkte angeführt. Zum einen ergibt sich aus der Themenstellung des Buches – „Politics and Urban Growth“ – eine starke Schwerpunktsetzung auf die politische Ereignisgeschichte. Diese verliert sich zwar nur selten in langatmigen Aufzählungen; die Verflechtungen zwischen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen aber werden zu wenig herausgearbeitet. Auch die Verbindungen zwischen der lokalen und der nationalen Ebene, und das ist ein zweiter Schwachpunkt des Buches, werden nur oberflächlich angesprochen. Mit Schilderungen, dass Stadtpolitik in Santiago für zahlreiche Politiker sowohl Training als auch Sprungbrett für eine Karriere auf nationaler Ebene war, oder mit der etwas lapidaren Feststellung, dass Entwicklungen auf lokaler Ebene nationale Trends „spiegelten“ (S. 199), schöpft Walter das Potenzial, das in einer systematischen Mehrebenenanalyse liegen würde, leider nicht aus. HistLit 2007-3-160 / Christof Parnreiter über Walter, Richard J.: Politics and Urban Growth in Santiago, Chile, 1891-1941. Stanford 2005. In: H-Soz-u-Kult 31.08.2007. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 503 Außereuropäische Geschichte Windus, Astrid: Afroargentinier und Nation. Konstruktionsweisen afroargentinischer Identität im Buenos Aires des 19. Jahrhunderts. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2005. ISBN: 3-86583-004-8; 317 S. Rezensiert von: Ulrike Bock, SFB 496: Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Westfälische WilhelmsUniversität Münster Die Gruppe der Afroargentinier, so der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts aus der argentinischen Nationalgeschichte und der argentinischen Erinnerungskultur konsequent ausgeblendet. So konsequent, dass sie auch heutzutage noch damit rechnen muss, nicht als Angehörige der argentinischen Nation anerkannt zu werden, wie Astrid Windus in der Einleitung ihres Buches unter Verweisen auf jüngere Meldungen der argentinischen Tageszeitung „El Clarín“ aufzeigt. Die herkömmlichen Erklärungen für die Unsichtbarkeit der Afroargentinier bewegen sich dabei vor allem im Bereich eines vermeintlichen demographischen Rückgangs dieser Bevölkerungsgruppe insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz schwarzer Soldaten in den Kriegen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Demgegenüber geht Astrid Windus in ihrer Arbeit davon aus, dass es sich bei derartigen Wahrnehmungen zu einem großen Teil um Resultate einer Konstruktion Argentiniens als primär europäisch geprägter, kulturell homogener Nation handelt, die mit dem Herausschreiben nicht-weißer Gruppen aus der argentinischen Erinnerungskultur einherging. Der Mythos des Todes auf dem Schlachtfeld gehört somit neben der Reduktion der Wahrnehmung von Schwarzen als Sklaven während der Kolonialzeit zu den Elementen, die den Anteil der Afroargentinier an der Konstruktion Argentiniens auf die Zeit vor der Konstituierung des Nationalstaats beschränkt. Genau dieses Spannungsfeld zwischen hegemonialen Konstruktionsweisen von Nation sowie den damit verbundenen Alterisierungsstrategien und den eigenen afroargentinischen Identitätsentwürfen innerhalb der argentinischen Nation bildet die zentrale Fra- 504 gestellung dieser Publikation. Dabei bedient die Autorin sich, ausgehend vor allem von Stuart Halls Ansatz von nationaler Identität als einem System kultureller Repräsentationen, eines diskurstheoretischen Zugriffs. Identität wird hierbei als stetiger Aushandlungsprozess zwischen Selbstpositionierungen und Fremdzuschreibungen betrachtet, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, innerhalb der Untersuchung zur afroargentinischen Identität nicht nur die Repräsentationen von Seiten der afroargentinischen Gemeinschaft, sondern auch die hegemonialen Diskurse von „Argentinität“ sowie die hegemoniale Sichtweise auf die Afroargentinier zu untersuchen. Im Mittelpunkt des ersten Teils der Arbeit steht die Analyse hegemonialer Konstruktionsweisen der nationalen Identität. Die Entwicklung der herrschenden Zugehörigkeitsmuster im Laufe des 19. Jahrhunderts wird zunächst über die Untersuchung der Bedeutungen von zentralen Begrifflichkeiten wie „patria“, „nación“, „pueblo“, „soberanía“, der Konstruktion eines amerikanischen Kollektivs sowie schließlich von „Argentina“ als Identität stiftenden Bezugspunkt nachgegangen. Dabei postuliert Astrid Windus eine zunehmende Homogenisierung, die von einer graduellen Verschiebung von primär lokalen Bezugspunkten von Identität hin zu einer abstrakteren Vorstellung von Nation als einer politischen Gemeinschaft während der ersten Hälfte und schließlich der Vorstellung einer auch kulturell begründeten nationalen Bezugsgröße in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Die Analyse der Konstruktionsweise dieser als kulturell homogen gedachten Nation erfolgt anhand der innerhalb dieses Diskurses zentralen Felder „Zivilisation und Barbarei“, „Fortschritt“ sowie „Rasse“. Während schon innerhalb der Wahrnehmung der Nation als politischer Gemeinschaft gesellschaftliche Gruppen wie Frauen und Unterschichten ausgeschlossen wurden, zeichneten sich die Konstruktionsweisen der zweiten Jahrhunderthälfte nicht nur durch die Herausstellung von nationalen Gemeinsamkeiten, sondern vor allem auch durch konsequente Alterisierungsstrategien aus. So wurden beispielsweise Indigene als dem Fortschritt entgegen stehend konzeptualisiert und Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart A. Windus: Afroargentinier und Nation in Diskurs und Praxis auf einen marginalen Status innerhalb der Nation reduziert. Von besonderer Bedeutung für die weitere Untersuchung ist das dritte diskursive Feld mit dem ihm inhärenten Gedanken einer Hierarchie menschlicher „Rassen“, die zu einer diskursiven Exklusion der Afroargentinier und der Erzeugung bestimmter, wiederum mit den Vorstellungen von Zivilisation, Barbarei und Fortschritt verknüpften, Stereotypen führte. Den Repräsentationen afroargentinischer Identität nähert sich die Verfasserin im besonders gelungenen zweiten Teil der Arbeit an. Ausgehend von dem schon oben erwähnten Konzept von Identität als Wechselspiel zwischen Selbst- und Fremdzuschreibungen stellt Astrid Windus dabei zunächst jeweils die innerhalb der weißen Mehrheitsgesellschaft präsenten afroargentinischen Stereotypen dar und analysiert den Kontext ihrer Entstehung. In einem weiteren Schritt erfolgt die Dekonstruktion dieser Stereotypen durch die Gegenüberstellung der entsprechenden afroargentinischen Positionierungen bzw. Gegendiskurse. Insgesamt werden in diesem Kapitel diskursiv erzeugte Figuren wie der „gute“ schwarze Soldat, der „negro federal“ bzw. die „negra rosina“, zwei vermutlich seitens der liberalen Historiografie konstruierte Stereotypen der Afroargentinier als bedingungslose Unterstützer des Rosas-Regimes, sowie stereotype Vorstellungen afroargentinischer Weiblichkeit (sexualisierte Mulattinnen, schwarze Hexen) untersucht. Ein besonders interessanter Befund, der die Bedeutung der Analysekategorie „Gender“ hervorhebt, besteht hier in den hegemonialen Konstruktionsweisen einer Feminisierung schwarzer Männer bei einer gleichzeitig vermännlichten Konzeptualisierung afroargentinischer Frauen. Gegen diese Konstruktionen wandte sich der afroargentinische Gegendiskurs unter anderem durch Umdeutungen der diskursiven Elemente sowie durch Positionierungen in Anlehnung an die bürgerliche Geschlechterordnung der Mehrheitsgesellschaft. Dass sich Diskursanalyse nicht auf rein textuell hervorgebrachte Phänomene beschränken muss, zeigt Astrid Windus in ihrer Behandlung afroargentinischer Selbstentwürfe, in der sich die Autorin ausführlich Aspekten der afroargentinischen kollektiven kulturellen Prakti- 2007-3-103 ken widmet, die ihren Ausdruck in Organisationsformen wie den „cofradías“ (Bruderschaften), den „sociedades africanas“ (afrikanischen Gesellschaften), den karnevalistischen „comparsas“ oder den „candombes“ fanden. Dabei betont die Autorin einerseits deren transethnischen Charakter sowie andererseits die Sichtweise dieser kollektiven Praktiken als kulturelle Aneignungen im Gegensatz zu einer in der Historiografie immer noch verbreiteten Perspektive einer Perpetuierung mehr oder weniger „authentischer“ afrikanischer Elemente. Zu dem letzten Feld der afroargentinischen Selbstentwürfe zählt auch das Idealbild des schwarzen Bürgers, dessen Aufgabe in der Erfüllung eines zivilisatorischen Auftrags gegenüber der afroargentinischen Gemeinschaft gesehen wurde. Dieser Typus stellte die vielleicht sichtbarste Bemühung um Partizipation innerhalb der Zivilgesellschaft dar. Allerdings ist hier festzustellen, dass auch diese Einforderungen einer aktiven Staatsbürgerschaft trotz weitgehender Übernahme hegemonialer Diskurselemente an den exkludierenden gesellschaftlichen Bedingungen scheiterten. Insgesamt kommt in diesem Kapitel die Reichhaltigkeit des hier herangezogenen Quellenmaterials zum Tragen, welches in erster Linie afroargentinische Zeitungen der zweiten Jahrhunderthälfte umfasst. So werden anhand der verschiedenen Positionen nicht nur übereinstimmende Tendenzen des afroargentinischen Diskurses, sondern auch die Heterogenität der entsprechenden Entwürfe deutlich. Ein abschließender dritter Teil führt die Erträge der ersten beiden Kapitel noch einmal unter den beiden Gesichtspunkten des kontinuierlichen Ausschlusses der Afroargentinier durch die gesellschaftlich hegemonialen Alterisierungssstrategien einerseits sowie der Unsicherheit und Heterogenität der schwarzen Selbstentwürfe andererseits zusammen. Hierbei wird besonders im ersten Teil nochmals die Chronologie des Ausschlusses aus den Identitätskonstruktionen der weißen Mehrheitsgesellschaft klargestellt und betont, dass die afroargentinischen Selbstpositionierungen nicht in der Lage waren, die Macht dieser hegemonialen Diskurse zu durchbrechen. Gleichzeitig stellt Astrid Windus aber auch die fehlende Homogenität innerhalb eben die- Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 505 Außereuropäische Geschichte ser Selbstentwürfe heraus, die zudem oftmals stark von der Übernahme hegemonialer Konzepte geprägt waren. In einem kurzen Ausblick stellt die Autorin den afroargentinischen Fall in einen weiteren Zusammenhang. Das von Paul Gilroy wesentlich geprägte Konzept eines „Black Atlantic“ als System gegenseitiger kultureller Durchdringungen bildet hierbei den Bezugsrahmen. Astrid Windus stellt sich damit den gängigen Sichtweisen eines argentinischen Sonderfalls entgegen. Die schon früher im Text immer wieder herangezogenen Vergleiche mit ähnlichen Phänomenen vor allem aus Brasilien und den USA werden so systematisch in ein transnational konzipiertes Bild einer gesamtafroamerikanischen Kulturgeschichte eingefügt und diese als integraler Bestandteil der Moderne postuliert. Astrid Windus hat ein äußerst vielschichtiges Buch geschrieben, welches durch intensive Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden theoretischen Konzepten wie auch durch einen flüssigen Schreibstil überzeugt. Nicht umsonst handelt es sich hierbei um eine zweifach prämierte Arbeit, die 2003 den Walter-Markov-Preis der KarlLamprecht-Gesellschaft/ Institut für Kulturund Universalgeschichte e.V. (Leipzig) und 2006 den zweiten Preis der interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) gewann. Da es ein erklärtes Ziel der Autorin ist, den Afroargentiniern eine stärkere Präsenz im kollektiven Bewusstsein zu geben und ihnen so einen Platz in der argentinischen Erinnerungskultur einzuräumen, bleibt es nur zu hoffen, dass diese durch eine Übersetzung ins Spanische bald auch dem argentinischen Publikum zugänglich gemacht wird. HistLit 2007-3-103 / Ulrike Bock über Windus, Astrid: Afroargentinier und Nation. Konstruktionsweisen afroargentinischer Identität im Buenos Aires des 19. Jahrhunderts. Leipzig 2005. In: H-Soz-u-Kult 09.08.2007. Wüstenbecker, Katja: Deutsch-Amerikaner im Ersten Weltkrieg. US-Politik und nationale Identitäten im Mittleren Westen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007. ISBN: 978-3-515-08975-3; 428 S. Rezensiert von: Melanie Henne, Philosophische Fakultät, Lehrbereich Nordamerikanische Geschichte, Universität Erfurt Die Fragen nach Assimilierung, Akkulturation und Integration bestimmen die Forschung zu ImmigrantInnen in den USA seit Jahrzehnten. Es ist dabei unter anderem von besonderem Interesse zu fragen, wie ImmigrantInnen in den USA leben, mit ihrer Herkunft umgehen, von AmerikanerInnen wahrgenommen werden und sich selbst definieren. Katja Wüstenbeckers Studie zu Deutsch-Amerikanern1 im Ersten Weltkrieg beschäftigt sich zum einen mit der Frage, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf die Selbstwahrnehmung der DeutschAmerikanerInnen hatte. Damit knüpft Wüstenbecker an zwei gegensätzliche Thesen in der Forschung an: Eine Strömung konstatiert einen durch den Ersten Weltkrieg ausgelösten Assimilationsschub, während andere bei Deutsch-AmerikanerInnen eine Stärkung ihrer ethnischen Identität als Deutschstämmige ausmachen. Wüstenbeckers differenzierte Analyse liefert überzeugende Belege für beide Thesen, wobei eine der Stärken der Arbeit darin besteht, die Heterogenität der Gruppe der Deutsch-AmerikanerInnen herauszustellen. Als weiteren Schwerpunkt thematisiert Wüstenbecker die Einstellungen der amerikanischen Bevölkerung zu DeutschAmerikanerInnen im Ersten Weltkrieg und die damit interagierenden politischen Konsequenzen bezüglich ihres Rechtsstatus. Als Analysekategorien dienen Wüstenbecker die „drei Bereiche Staat, Gesellschaft und die Gruppe der Deutsch-Amerikaner“ (S. 14). Durch die Auswertung vielfältiger Materia1 Mit diesem Begriff bezeichnet Wüstenbecker AmerikanerInnen deutscher Herkunft, die auf rechtlicher Ebene die amerikanische Staatsbürgerschaft besaßen und sich damit von „feindlichen Ausländern“ in ihrem rechtlichen Status unterschieden. Als letztere wurden nach Kriegseintritt Deutsche bezeichnet, die in den USA lebten ohne eingebürgert zu sein. Sie standen in besonderem Maße unter dem Verdacht der Spionage. 506 Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart K. Wüstenbecker: Deutsch-Amerikaner im Ersten Weltkrieg lien gelingt es ihr dabei, die Erfahrungen von Deutsch-AmerikanernInnen in einen politischen und gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Sie verwendet einerseits Selbstzeugnisse von Deutsch-AmerikanerInnen sowie Schriften von deutsch-amerikanischen Vereinen, Kirchengemeinden oder Schulen. Andererseits fließt auch statistisches Datenmaterial in die Untersuchung ein. Auf staatlicher Ebene werden unter anderem Akten des Justizministeriums, „des Committee on Public Information, des Bureau of Immigration and Naturalization, des Bureau of Investigation und des United States Secret Service“ (S. 18) herangezogen. Den Bereich Gesellschaft erschließt Wüstenbecker mit Material von nicht-staatlichen Organisationen, die sich zur Stärkung der Heimatfront im Ersten Weltkrieg bildeten. Des Weiteren verwendet Wüstenbecker Zeitungen und Karikaturen, um Rückschlüsse auf die amerikanische Gesellschaft ziehen zu können. Dabei hätten die Karikaturen jedoch detaillierter untersucht werden können. Teilweise werden sie lediglich zu Illustrationszwecken verwendet, so dass ihr Potential nicht ausgeschöpft wird. Die chronologische Studie betrachtet zunächst den Mittleren Westen der USA als Region, die in besonderer Weise von deutschen ImmigrantInnen geprägt wurde. Dabei ist Wüstenbeckers Arbeit als vergleichende Regionalstudie angelegt. Die Städte Milwaukee (Wisconsin), Chicago (Illinois), St. Louis (Missouri) und Cincinatti (Ohio) bilden einen Untersuchungsraum, der in einem einführenden Kapitel mit einem Fokus auf deutsche ImmigrantInnen sowie der Einwanderungspolitik vor 1914 dargestellt wird. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit zur differenzierten Analyse deutsch-amerikanischer Lebensweisen in den USA, dem Wüstenbecker durch die Betrachtung zahlreicher Einzelfälle gerecht wird. Im folgenden Kapitel steht die Neutralitätsphase Amerikas im Ersten Weltkrieg im Mittelpunkt der Betrachtung. Gefragt wird nach der Stellungnahme von DeutschAmerikanerInnen zur Kriegsführung des Deutschen Reiches sowie den amerikanischen Reaktionen darauf. Wüstenbecker arbeitet überzeugend heraus, dass DeutschAmerikanerInnen keine einheitliche Position 2007-3-144 bezogen. Sie unterscheidet vier Gruppen, „die Pro-Deutschen, die Pro-Amerikaner, die Neutralisten (die den Krieg aus politischen oder pazifistischen Gründen ablehnten) und die große Mehrheit derjenigen, die nicht auffallen wollten.“ (S. 307) Wüstenbecker zeigt auf, dass diese Gruppen in der Öffentlichkeit jedoch unterschiedlich präsent waren: Pro-Deutsche und Neutralisten erweckten gerade in der (deutschsprachigen) Presse den Anschein, alle Deutsch-AmerikanerInnen zu repräsentieren, da sie sich am lautesten Gehör zu verschaffen wussten und zur Boykottierung beispielsweise von Banken aufriefen, die den Alliierten Kriegskredite gewährten. Dies führte nach Wüstenbecker dazu, dass die Deutsch-AmerikanerInnen insgesamt im Hinblick auf ihr politisches Engagement von der amerikanischen Öffentlichkeit mit Misstrauen betrachtet wurden. Für viele der assimilierten Deutsch-AmerikanerInnen hatte der Kriegsausbruch ein Rückbesinnen auf ihre deutsche Herkunft zur Folge, was sich auch in dem verstärkten Interesse an deutschsprachigen Zeitungen ausdrückte. Wüstenbecker betont, dass Deutsch-AmerikanerInnen in ihren pro-deutschen Aktivitäten (beispielsweise Spendensammlungen für Familie und Bekannte im Deutschen Reich) keinen Widerspruch zu ihrem Amerikanischsein wahrnahmen, während dieses Verhalten für viele AmerikanerInnen einen Verrat an der amerikanischen Nation bedeutete. Im letzten, umfangreichsten Analysekapitel stellt Wüstenbecker heraus, wie sich durch den Kriegseintritt der USA die Wahrnehmung der Deutsch-AmerikanerInnen sowie deren Verhalten maßgeblich veränderten und welche politischen Auswirkungen dies für die Deutsch-AmerikanerInnen hatte. Mit dem Kriegseintritt der USA änderten viele Deutsch-AmerikanerInnen ihre Haltung zum Deutschen Reich und die überwiegende Mehrheit betonte ihre Loyalität zur amerikanischen Nation. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass sie vom Großteil der amerikanischen Bevölkerung negativ wahrgenommen wurden. Gerüchte über deutsche Spione in den USA verstärkten die feindliche Haltung gegenüber Deutsch-AmerikanerInnen und führte dazu, dass sich die amerikanische Bevölkerung auch von in den USA lebenden Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart 507 Außereuropäische Geschichte Deutschen – die als „alien enemies“ (S. 12, Anm. 6) bezeichnet wurden – sowie AmerikanerInnen deutscher Herkunft bedroht fühlte, was sich auf mehreren Ebenen auswirkte: Die Existenz nicht-staatlicher Organisationen mit dem Ziel der Amerikanisierung von ImmigrantInnen sowie die verschärfte Gesetzgebung gegenüber „feindlichen Ausländern“( S. 208-214) führten zu weit verbreiteten Denunziationen und zahlreichen tätlichen Übergriffen auf Deutsch-AmerikanerInnen. Letztere sahen sich dem Druck ausgesetzt, ihre Loyalität gegenüber den USA unter Beweis zu stellen, was sie beispielsweise durch den Kauf von Liberty Loans, das Singen der amerikanischen Nationalhymne in Situationen, wo ihre Loyalität öffentlich angezweifelt wurde oder das Zurschaustellen der amerikanischen Flagge an ihren Häusern versuchten. Die anti-deutsche Stimmung hatte zudem massive Auswirkungen auf deutsch-amerikanische Institutionen: Zahlreiche Maßnahmen gegen die Verwendung der deutschen Sprache wirkten sich äußert negativ auf das Fortbestehen der deutsch-amerikanischen Kultur aus. Wüstenbecker argumentiert, dass dies sich unter anderem am Niedergang von deutschen Bildungsinstitutionen in den USA, dem Vereinswesen, der deutschsprachigen Presse sowie kirchlichen Einrichtungen, deren Gottesdienste in deutscher Sprache abgehalten wurden, zeigte. In Wüstenbeckers Darstellung der unterschiedlichen Reaktionen von DeutschAmerikanerInnen auf den Ausbruch des Ersten Weltkrieges betonte sie insbesondere die Heterogenität dieser Gruppe. Dabei hätte die zusätzliche Berücksichtigung der Analysekategorie Gender zu einer weiteren, produktiven Differenzierung beigetragen. Bei der Analyse des Komplexes „Gesellschaft“ scheint diese zum Teil als homogener Gegenblock zu den Deutsch-AmerikanerInnen betrachtet zu werden. Unterschiedliche Positionen zu Deutsch-AmerikanerInnen innerhalb der amerikanischen Bevölkerung werden nur ansatzweise berücksichtigt. Hier wäre es spannend zu fragen, wie sich beispielsweise andere Migrantengruppen zu Deutsch-AmerikanerInnen positionierten oder in welchem Verhältnis sie zu African Americans standen, um auch in dieser 508 Analysekategorie die Heterogenität und Vielschichtigkeit von Gesellschaftsstrukturen zu berücksichtigen. Trotz dieser Einwände bietet Katja Wüstenbeckers Arbeit eine differenzierte Analyse deutsch-amerikanischer Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Sie ist besonders lesenswert für alle HistorikerInnen, die sich mit ImmigrantInnen in den USA beschäftigen und dabei insbesondere an gesellschaftspolitischen Fragestellungen interessiert sind. HistLit 2007-3-144 / Melanie Henne über Wüstenbecker, Katja: Deutsch-Amerikaner im Ersten Weltkrieg. US-Politik und nationale Identitäten im Mittleren Westen. Stuttgart 2007. In: H-Soz-u-Kult 24.08.2007. Historische Literatur, 5. Band · 2007 · Heft 3 © Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart