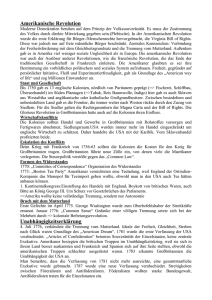Gratis Leseprobe zum
Werbung

Michael Hochgeschwender Die Amerikanische Revolution Geburt einer Nation 1763–1815 C.H.Beck Mit 28 Abbildungen, 7 Karten (Peter Palm, Berlin) 1. Auflage. 2016 © Verlag C.H.Beck oHG, München 2016 Umschlaggestaltung: Konstanze Berner, München Umschlagabbildung: Emanuel Gottlieb Leutze, Washington überquert den Delaware, 1851, New York, Metropolitan Museum of Art © akg-images ISBN Buch 978-3-406-65442-8 ISBN eBook 978-3-406-65443-5 Die gedruckte Ausgabe dieses Titels erhalten Sie im Buchhandel sowie versandkostenfrei auf unserer Website www.chbeck.de. Dort finden Sie auch unser gesamtes Programm und viele weitere Informationen. Inhalt Einleitung: Welche Revolution? Wessen Revolution? . . . . . . 7 I. 1763: Am Vorabend der Revolution 1. 2. 3. 4. Die britischen Kolonien in Nordamerika . . . . . . . . . . . Der Siebenjährige Krieg und seine Folgen . . . . . . . . . . Transatlantische Diskurslandschaften . . . . . . . . . . . . . Keine Verfassung ist auch eine Verfassung: Souveränität und Partizipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 51 75 101 II. Der Sturm zieht auf 1. Das Ende des wise and salutory neglect: Die Stamp-Act-Krise. 2. Gezeitenwechsel: Von den Townshend Duties zum Boston Massacre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Der Weg in die Gewalt: Von der Boston Tea Party nach Lexington und Concord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Der Sturm bricht los: Das erste Kriegsjahr . . . . . . . . . . 108 . 134 . . 154 174 III. Der Orkan: Unabhängigkeit und Weltkrieg 1. Der Weg in die Unabhängigkeit . . . . . . . . . . . 2. Die Streitkräfte im Unabhängigkeitskrieg . . . . . 3. A World Turned Upside Down: Der Kriegsverlauf von 1776 bis 1781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Frieden und Unabhängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 . . . . . 208 . . . . . . . . . . 232 258 IV. Jenseits der Schlachtfelder: Eine Kulturgeschichte des Unabhängigkeitskrieges 1. Tross und Lagerleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2. An der Schwelle zum Jenseits: Verwundung, Krankheit und Tod . . . . . . . . . . . . . . . 280 3. 4. 5. 6. 7. Die Ökonomie des Krieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Mütter der Revolution: Frauen im Krieg . . . . . . . . . Eine Gesellschaft zerfällt: Tories, Verräter und Neutrale . . . Die Revolution in der Revolution: Die schwarzen Amerikaner Der längste Krieg: Die Revolution bei den Indianern . . . . . 288 297 306 319 330 V. Aufräumen und Aufbauen: Die Nachwirkungen der Revolution 1. Die Geburtskrise: Institutionen und Identitäten . . . . . . 2. Der menschliche Makel: Politische Kultur, Parteien und Parteipolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Das Imperium im Wartestand: Expansion und Krieg gegen Großbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mythische Erinnerungen: Die Ära der Amerikanischen Revolution in der modernen Populärkultur . . . . . . . . . . 345 . 386 . 405 . 431 Schluss: Tragik und Größe einer unvollendeten Nation . . . . . . . . . . 443 Anhang Danksagung . . . . Anmerkungen . . . . Literaturverzeichnis Bildnachweis . . . . Karten . . . . . . . . Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 453 486 497 498 506 Einleitung Welche Revolution? Wessen Revolution? Einleitung Welche Revolution? Wessen Revolution? Erste Szene: Irgendwo in einer mittelgroßen amerikanischen Stadt demonstrieren im Jahr 2009 mehrere hundert Menschen, überwiegend männliche Weiße zwischen 50 und 70 Jahren, Angehörige einer zornigen, beständig kleiner werdenden Mittelklasse, gegen «Obamacare», die vom ersten farbigen Präsidenten der USA, Barack Obama, geplante allgemeine Krankenversicherung. Diese Wutbürger der Gegenwart befürchten, ihre angestammten Freiheiten und Rechte als Amerikaner würden durch weitere Eingriffe der Bundesregierung, sei es im Gesundheitswesen, sei es bei den Waffengesetzen, nicht nur eingeschränkt, sondern regelrecht außer Kraft gesetzt werden. Dabei verwenden sie altbekannte Symbole, eine Fahne mit einer aus den Gründerstaaten zusammengesetzten Schlange, die «Don’t tread on me» zischt, allerdings aus der vorrevolutionären Epoche, genauer aus dem Jahr des Albany-Kongresses von 1754, stammt, sowie selbstredend das Sternenbanner, und sie führen einen bezeichnenden Namen: TeaParty-Bewegung. Der Rückgriff auf eine der ersten revolutionären Aktionen Bostoner Bürger aus dem Jahr 1773, die dann in den Unabhängigkeitskrieg von 1776 bis 1783 mündeten, ist offenkundig. Damit stellen sich die Demonstranten ganz bewusst und ohne jeden Selbstzweifel in die Tradition eines besseren, revolutionären Amerika, jener guten alten Zeit, als die USA noch weiß, protestantisch, tugendhaft, frei und voller Optimismus waren, einer Zeit allerdings, die so womöglich nie existiert hat. Vor allem richtet sich ihr Protest nicht gegen eine ferne monarchisch regierte Kolonialmacht, sondern gegen die eigene, von einer Mehrheit gewählte Regierung, deren Existenz genau auf die Kämpfe zurückgeht, auf welche die Menge sich nun beruft. Dennoch glauben die Demonstranten fest daran, dass sie und nicht der Präsident in Washington die glorreichen und mythischen Traditionen des amerikanischen Ursprungs repräsentieren. Zweite Szene: der Film The Patriot aus dem Jahr 2000, ein farbiges, gefühlsseliges Historienspektakel mit dem Australier Mel Gibson als Haupt- 8 Einleitung darsteller und dem Deutschen Roland Emmerich als Regisseur, eine Melange, die für die Studios Hollywoods nicht untypisch ist. Auch amerikanischer Patriotismus soll sich schließlich weltweit verkaufen. Gibson spielt den Witwer Benjamin Martin aus South Carolina, einen Veteranen der britischen Kolonialkriege in Nordamerika, der gegen seinen Willen durch die Brutalität des britischen Offiziers William Tavington in den Unabhängigkeitskrieg hineingezogen wird. Als archetypischer Frontierfarmer greift Martin die Miliztradition der Amerikaner auf, um sich dem grausamen und heimtückischen Feind entgegenzustellen. In einer Schlüsselszene motiviert er seine Mitstreiter, darunter einen freien Schwarzen und einen schwarzen Sklaven, der für seine Freiheit auf Seiten der Revolutionäre kämpft, durch einen patriotischen Appell zum Kampf. In dieser Rede ist viel von Freiheit und der Notwendigkeit, den aufgezwungenen Kampf gegen die Tyrannei tapfer anzunehmen, zu hören. Entschlossen greifen die Männer zur Waffe und ringen den Feind, der dargestellt wird, als handele es sich um SS-Männer des Zweiten Weltkriegs, nieder. Dritte Szene: der 4. Juli 1776. Es ist ein heißer Tag in Philadelphia, dem Ort, an dem der zweite nordamerikanische Kontinentalkongress tagt, um die Unabhängigkeit von Großbritannien zu erklären. Demonstranten sind hier nicht zu sehen, Schwarze bestenfalls als Sklaven, die den versammelten Vertretern der kolonialen Eliten aus 13 vormals britischen Kolonien etwas kühle Limonade reichen. Viele Frontierbauern in South Carolina kämpfen zu diesem Zeitpunkt ebenso wie viele schwarze Sklaven nicht etwa für die Unabhängigkeit, sondern für den britischen König, den sie als Wahrer ihrer Interessen und als legitimen Herrscher über die Kolonien betrachten. Mit den feinen Herrschaften in Philadelphia wollen sie nichts zu tun haben. Von der Einheit der guten alten Zeit, auf die sich die Demonstranten der Tea-Party-Bewegung so lautstark berufen, ist damals wenig zu spüren. Selbst unter den versammelten Delegierten finden sich einige, die sich noch bis in den Juni 1776 hinein gegen die Unabhängigkeitserklärung gestemmt haben. Dennoch sind auch sie sich darüber im Klaren, dass am 4. Juli Geschichte geschrieben wird. Wie aber wurde aus diesem historischen Tag der Mythos, auf den sich bis heute Amerikaner aller politischen Couleur, Liberale, Radikale und Konservative, ebenso berufen wie sogar die vietnamesischen kommunistischen Revolutionäre des Jahres 1946, deren Anführer Ho Chi Minh, später einer der furchtbarsten Gegner der USA, nahezu wörtlich von Thomas Jefferson abschrieb? Was macht die Amerikanische Revolution noch fast 250 Jahre Welche Revolution? Wessen Revolution? 9 später so attraktiv? Welcher Weg führte von den würdevollen Ereignissen in der Sommerhitze des Jahres 1776 zu dem bildgewaltigen Hollywoodepos des beginnenden 21. Jahrhunderts und den wütenden Demonstrationen der Gegenwart? Die Amerikanische Revolution war ein komplexes, mitunter widersprüchliches historisches Ereignis, genauer: eine epochale Kette von Ereignissen, ein Prozess, der lange vor dem Ausbruch der Gewalttätigkeiten 1774 begann und erst Jahrzehnte nach dem Frieden von Paris 1783, der den USA die Unabhängigkeit brachte, allmählich zu einem Ende kam. Historische Ereignisse aber sind beständig interpretationsbedürftig. Und nicht umsonst haben sich Historiker, Politikwissenschaftler und Publizisten seit den 1780er Jahren über den Charakter der Amerikanischen Revolution gestritten. Dabei leisteten sie immer wieder auch Mythen Vorschub. Für Leopold von Ranke etwa stellte der amerikanische Unabhängigkeitskampf aus der Sicht des Jahres 1854 die größte Revolution der Weltgeschichte dar, da just hier der kühne Weg vom Gottesgnadentum zur Idee der Volkssouveränität beschritten worden sei.1 Damit stand er bereits in einer älteren Tradition, der sogenannten Whig Interpretation of History2, für die mit der Revolution ein unumkehrbarer Weg zu liberalen Fortschritts- und Freiheitsidealen beschritten worden war.3 Fast zeitgleich mit Ranke hatte der amerikanische Historiker George Bancroft, von Hegels Idealismus beeinflusst, in der Amerikanischen Revolution das objektive Zu-sich-selbst-Kommen des absoluten Geistes erblickt. Nicht, wie Hegel noch geglaubt hatte, die preußische Monarchie, sondern die amerikanische Republik war demnach das Instrument des Weltgeistes schlechthin. Der Bezug auf Hegel kam nicht von ungefähr, hatte Bancroft doch, dem Beispiel vieler seiner Landsmänner folgend, an Deutschlands hohen Schulen studiert. Gleichwohl systematisierte er im Grunde nur, was die meisten Amerikaner sowieso dachten. Unabhängig von religiösen oder politischen Überzeugungen waren die ersten Generationen nach der Revolution fest davon überzeugt, ihr Staatswesen sei von Gott, der Natur oder der Geschichte zu einer besonderen Freiheitsmission berufen. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein verfochten nicht allein amerikanische, sondern auch britische, deutsche und französische Historiker, die dem Liberalismus nahestanden, diese These in vielfältiger Form, obwohl der zunehmende, wiederum von Deutschland ausgehende Professionalisierungsprozess der Geschichtswissenschaften sie im Ton weniger euphorisch werden ließ.4 R. R. Palmer beispielsweise sprach von einem Virus 10 Einleitung der Freiheit, der von Amerika ausgegangen sei und einerseits die Besonderheit, die Exzeptionalität5 der Vereinigten Staaten begründet, sich andererseits aber im gesamten transatlantischen Raum als wirksam erwiesen habe. Die Revolution in Frankreich sei ohne das amerikanische Vorbild kaum denkbar. Ähnliches gelte für die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika oder die fortschrittlichen liberalen Bewegungen im Rest Europas.6 In dieser Sichtweise, die in erster Linie nach Ideen fragte und politisch im liberalen Lager verortet war, stand die Amerikanische Revolution ohne jede Ambivalenz für einen idealistischen Durchbruch in die Moderne.7 Gerade für Amerikaner war das unter Gesichtspunkten der nationalen Identität zentral, denn diese Interpretation erleichterte es, aus den Ereignissen von 1776 einen Gründungsmythos zu konstruieren, der gleichzeitig nach innen – im Zuge nationaler Integration – und nach außen – hegemonial – nutzbar war. Die USA befanden sich im eigenen Selbstverständnis von Beginn an auf der richtigen Seite der Geschichte, nicht nur weil sie den Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien gewonnen hatten, sondern vor allem weil sie in einzigartiger Weise für die Ideen von Freiheit, Fortschritt, Demokratie, Modernität und Eigentum eintraten. Die Revolution hatte ihnen eine exzeptionelle Mission mit auf den Weg gegeben, die es weltweit durchzusetzen galt. Hatte nicht bereits Thomas Jefferson die USA als «Empire of Liberty» bezeichnet? Dieses Reich der Freiheit aber bedurfte des aktiven Engagements. Weniger aggressiv gewendet, dienten die Vereinigten Staaten zumindest dem Rest der Welt als Leuchtturm. Die Whig-Interpretation stand freilich nie alleine da, obwohl sie bis weit in das 20. Jahrhundert vorherrschend blieb und teilweise heute noch verfochten wird.8 Neben einer verständlicherweise eher in Großbritannien verbreiteten Tory-Interpretation, welche Revolution und Krieg als empörende, sinnlose und schlechthin illegitime Akte amerikanischer Undankbarkeit verstand, fand sich alsbald eine weitere eher konservative Interpretation, die um 1800 von Friedrich von Gentz, dem späteren Vordenker des antirevolutionären, restaurativen Systems Metternich, erstmals angedacht wurde.9 Unter dem Eindruck der Französischen Revolution, die für viele Gründerväter des europäischen Konservativismus, darunter eben Gentz und Metternich, aber auch der Brite Edmund Burke, zum traumatischen Erlebnis geworden war, befand Gentz, die Amerikanische Revolution sei eine «gute», da ausschließlich politische und relativ unblutige Revolution gewesen. Demgegenüber habe es sich bei der Fran- Welche Revolution? Wessen Revolution? 11 zösischen Revolution um eine «schlechte» Revolution gehandelt, da es ihr mit äußerster Brutalität unter dem Regime des Terrors und der Guillotine um einen totalen politischen und gesellschaftlichen Umsturz gegangen sei. Im Grunde, so diese Sichtweise, sei die Amerikanische Revolution fast schon evolutionär verlaufen, eine vorsichtige Anpassung des politischen Systems an die Bedingungen der sich verändernden Moderne. Mehr noch: Die Amerikanische Revolution habe im organischen Einklang mit dem Verlauf der Geschichte gestanden, die Französische Revolution hingegen sei der Versuch gewesen, blasse Abstraktionen mit Gewalt gegen die Geschichte zu stellen. Insofern markierte die Revolution von 1776 für moderate Konservative des 19. und 20 Jahrhunderts geradezu den Idealfall einer besonnenen revolutionären Aktion, die überdies neue Wege in das bürgerliche Zeitalter aufgewiesen habe, welche weitere Umstürze schlichtweg überflüssig machten. Von nun an konnte der Weg der maßvollen, pragmatischen Reform beschritten werden.10 Auf diese Weise ließen sich die moderat konservative und die liberale Interpretation unter den Auspizien des Kalten Krieges der 1950er und 1960er Jahre nahezu problemlos miteinander verknüpfen. Beide fragten vorrangig nach Ideen und Idealen, beide lehnten revolutionäre Aktivitäten für die Gegenwart ab, insbesondere wenn sie von Marxisten initiiert wurden, und beide standen vorbehaltlos zur Exzeptionalität der Vereinigten Staaten und ihrem globalen Führungsanspruch als Hegemonialmacht des freien Westens.11 Der nationale Gründungsmythos der USA blieb auf diese Weise unangetastet, allein der interpretative Schwerpunkt changierte zwischen einem liberalen und einem konservativen Pol. Aller Dominanz dieser liberal-konservativen Interpretation zum Trotz blieben wissenschaftliche Fragen ebenso wenig aus wie beißende weltanschauliche Kritik. Letztere kam vornehmlich aus dem marxistischen Lager. In fast ironischer Manier nahmen die Marxisten das liberal-konservative Unbehagen am Revolutionsbegriff auf, und einige von ihnen stellten fest, bei den Ereignissen in Nordamerika habe es sich gar nicht um eine Revolution gehandelt. Im Grunde habe eine konservative, auf Besitz gegründete koloniale Elite den Machtanspruch einer ihr wesenhaft ähn lichen imperialen Elite in Frage gestellt. So sei es lediglich zu einer Elitenverschiebung gekommen, die an den Produktionsverhältnissen und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen nichts geändert habe.12 Allein schon der ungebrochene Fortbestand der Sklaverei belege den unrevolutionären Charakter der nordamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, die bestenfalls 12 Einleitung im Kontext bürgerlicher Revolutionen des 19. Jahrhunderts einen gewissen Vorläufercharakter für sich in Anspruch nehmen könne. Wer nicht so weit gehen wollte – und die Mehrheit der Marxisten ging nie so weit, der Amerikanischen Revolution das Revolutionäre abzustreiten –, konnte sie damit gut in die Kategorie der bürgerlichen Revolution einordnen. Allerdings berührte die marxistische Kritik immerhin einen wunden Punkt der liberal-konservativen, bürgerlichen Geschichtsschreibung. Eine bloß auf Ideen konzentrierte Interpretation musste notwendig vor Fragen nach gesellschaftlichen Entwicklungen ebenso versagen wie bei der Analyse scheinbarer Anachronismen, zu denen die Sklaverei im Verständnis der liberal-bürgerlichen, aufgeklärten Moderne zweifellos zählte. Es war ein amerikanischer Historiker aus der älteren, progressivistischen Konfl iktschule des frühen 20. Jahrhunderts, Charles Beard, der diese schon von den Briten in den 1780er Jahren angestoßene und nie ganz verstummte Kritik aufnahm und theoretisch verarbeitete. Beard, der wie die Marxisten von der Ökonomie her dachte, aber kein Determinist war, begann um 1910, die Frage nach den Interessen der revolutionären Eliten zu stellen. Insbesondere stieß er sich an dem für viele offenkundigen Gegensatz zwischen der radikalen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der deutlich konservativeren Verfassung von 1787. In den Augen Beards und vieler progressivistischer Kritiker des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart waren irgendwo zwischen 1776 und 1787 die Ideale der Amerikanischen Revolution wahlweise abhandengekommen oder verraten worden.13 Tatsächlich glaubte Beard, einen Konfl ikt zwischen den Besitzinteressen der urbanen und der ländlichen Eliten der USA nachweisen zu können, der letztlich dazu geführt habe, der Revolution eine Verfassung folgen zu lassen, der es im Kern um nichts anderes als die Wahrung von Besitzansprüchen und Klasseninteressen gegangen sei. Gleichwohl kam er damit nicht weit. Seine Unterscheidung von landed interests und monied interests, also von Landbesitzern und Finanzbürgertum, erwies sich als zu simpel, um der komplexen Wirklichkeit des sozialen Lebens um 1780 gerecht zu werden. Überdies war nicht zu bestreiten, dass die Verfassung der USA, so konservativ sie sein mochte, durchaus nicht nur repressive, sondern sehr wohl moderne, fortschrittliche Züge aufwies, zum Beispiel die Prinzipien der Gewaltenteilung und der Volkssouveränität. Vor diesem Hintergrund fiel es den sorgfältig die ideengeschichtliche Empirie erforschenden Anhängern der Konsensschule nicht schwer, Beards Thesen zurückzudrängen, wobei ihnen die Konstellation des Kalten Krieges zu- Welche Revolution? Wessen Revolution? 13 gutekam. Ökonomistische Fragestellungen waren in der Auseinandersetzung mit dem Marxismus nicht gefragt, noch weniger Zweifel am Idealismus der Revolutionäre von 1776. Gerade weil die Amerikanische Revolution für nationale Identität und Nationalmythologie derart wichtig war, blieb ihre geschichtswissenschaftliche Interpretation stets eng mit den jeweiligen aktuellen Problemlagen verbunden. Geschichtswissenschaft war und ist unter diesem Gesichtspunkt zumindest potentiell immer Legitimationswissenschaft. Daran hat sich bis heute nichts geändert, wie gerade der Umgang der Tea-Party-Bewegung mit der Gedankenwelt der Gründerväter belegt.14 Dennoch blieben Beards kritische Fragen nach der sozialen Praxis der Revolution und den Interessen der Akteure virulent. Vorerst wurde aber aus einer ganz anderen Ecke am liberal-konservativen Konsens gerüttelt. Vor dem Hintergrund wachsender Kritik der studentischen Neuen Linken am kapitalistischen System, am liberalen Individualismus und am sozialen Materialismus und Konformismus in den USA während der 1960er Jahre wandten sich verschiedene Historiker erneut den Leitideen der Amerikanischen Revolution zu. Bis dahin hatte niemand, weder die Marxisten noch Charles Beard und die Progressivisten, bezweifelt, dass die Ideenwelt der Revolutionäre an John Lockes Protoliberalismus orientiert gewesen war. Die Konsensschule hatte diesen ganz im Gegenteil ausdrücklich als die geradezu eingeborene Fundamentalidee der Amerikanischen Revolution und der amerikanischen Gesellschaft insgesamt herausgearbeitet.15 Quentin Skinner und J. G. A. Pocock aus der «Cambridge School» in der Ideengeschichte16 hatten aus italienischen Renaissancequellen eine Weltanschauung herauskristallisiert, die sich offenbar auch in den amerikanischen Quellen des 18. Jahrhunderts wiederfinden ließ: den Republikanismus.17 Ihnen schloss sich eine ganze Reihe amerikanischer Wissenschaftler an, darunter Gordon Wood.18 In ihren Augen hatte weniger der liberale, auf eine kapitalistische Eigentümergesellschaft und ihre Rechte fokussierte Lockeanismus die Amerikanische Revolution charakterisiert, sondern eine auf Bürgertugend abhebende republikanische Weltanschauung, deren kritisches Potential gegenüber der existierenden kapitalistisch-individualistischen Gesellschaft keineswegs ausgeschöpft sei. Der Tugendrepublikanismus musste dabei nicht notwendig im Sinne der Neuen Linken ausgelegt werden, ja er konnte wie bei Wood und Bailyn explizit konservativ verstanden werden, aber er diente als Korrektiv gegenüber dem einseitigen Liberalis- 14 Einleitung mus der älteren Konsensschule. Zeitweilig erhob allerdings der Tugendrepublikanismus einen ähnlich exklusiven Interpretationsanspruch wie zuvor der Lockeanismus und mit ihm der weltanschauliche angelsächsische Liberalismus.19 So entspann sich eine über beinahe 30 Jahre anhaltende wissenschaftliche Kontroverse zwischen dem liberalen und dem tugendrepublikanischen Lager, die jedoch zunehmend unfruchtbar wurde, zumal der Tugendrepublikanismus im Effekt bei Weitem nicht so antikapitalistisch und gemeinschaftsorientiert eingestellt war, wie seine frühen Befürworter geglaubt hatten.20 Die Debatte warf mehr Schwierigkeiten auf, als sie löste. Eine nachgerade unübersehbare Vielzahl von Aspekten stand seit Beginn der 1970er Jahre im Mittelpunkt von Kritik und Erneuerung der Revolutionshistoriographie: Zum einen blieb die Diskussion der Liberalen und Tugendrepublikaner weitgehend auf die Ideenebene beschränkt. Als Träger dieser Ideen wurden vor allem die kolonialen Eliten ausgemacht. Damit aber wurden wesentliche Akteursgruppen marginalisiert. Sowohl die sozialen Bewegungen der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung, die indianische Bürgerrechtsbewegung, die hispanische Bewegung, die viel ältere Arbeiterbewegung als auch die neue Sozialgeschichte, die neue Kulturgeschichte und die neue Kulturanthropologie21 forderten lautstark dazu auf, die bislang vernachlässigten sozialen Gruppen in die geschichtswissenschaftliche Deutung einzubeziehen. Welche Rolle hatten eigentlich Frauen22, schwarze Sklaven23 und Indianer24 während der Revolution gespielt?25 Handelte es sich wirklich ausschließlich um eine Revolution von oben? Damit stellte sich zum anderen die Frage nach der Amerikanischen Revolution als Sozialrevolution mit einem Schlag neu.26 Die Einsicht wuchs, dass Kaufleute und Großgrundbesitzer als ausschließliche Träger einer Revolution nicht ausreichten, was wiederum die Frage einerseits nach den Ideenwelten der «kleinen Leute» und andererseits nach den sozialen, kulturellen, religiösen und ökonomischen Interessen von Eliten, Mittelklassen und Unterklassen aufwarf. Beards Anliegen wurde, wenngleich deutlich differenzierter als zuvor, wieder aktuell. Endlich entkam die Forschung dem entökonomisierten, idealistischen Paradigma der Konsensschule. Gleichzeitig wurde es notwendig, all diese Ideen und Interessen konsequent zu historisieren. Was meinten Menschen des 18. Jahrhunderts, wenn sie von Freiheit, Gleichheit und Rechten sprachen, was wollten sie, wenn sie Freiheit des Handels oder der Westexpansion ver- Welche Revolution? Wessen Revolution? 27 15 langten? Und schließlich gelangten die Kontrahenten zu der Erkenntnis, der Lockeanismus sei nicht so individualistisch und der Republikanismus nicht so kommunitär gewesen, wie man anfangs gedacht hatte. In der gesellschaftlichen Praxis widersprachen beide Denksysteme sich nicht mehr diametral. Mit dieser Historisierung bekam der Gedanke der konservativen Revolution eine völlig neue inhaltliche Dimension. Das konservative Element in der Amerikanischen Revolution wurde jetzt weniger von der Warte des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern aus dem Verständnishorizont des 18. Jahrhunderts heraus interpretiert. Die Rebellen der 1770er Jahre kämpften, wie der britische Historiker Stephen Conway festgestellt hat, bis zu einem gewissen Grad für den Erhalt frühneuzeitlicher Privilegien gegen das Modernisierungsregime des britischen, imperialen Parlaments.28 Die Revolution war nicht ausschließlich auf Freiheit, Fortschritt und Moderne ausgerichtet, ihre Träger blickten nicht nur in die Zukunft, sondern womöglich viel mehr in eine idealisierte Vergangenheit; die Amerikanische Revolution bekam unübersehbar ein Janusgesicht. Und sie wurde komplexer. Neben den revolutionären Akteuren rückten nun die Gegner der Revolution verstärkt in das Blickfeld der Forschung. Welche Amerikaner kämpften aktiv gegen die Revolution, wer blieb neutral, wie sah es mit Frontwechseln aus? Welche Gründe führten zu diesem Verhalten? Wem brachte die Revolution etwas, wer waren die Verlierer? Insbesondere die Schwarzen und die Indianer wurden als überhaupt nicht marginale Akteure in der Revolution wahrgenommen, die sich oft mit guten Gründen auf Seiten der britischen Krone wiederfanden. Wie sah eigentlich die Revolution vor Ort aus, auf ganz banalen Handlungsfeldern wie dem Versuch, die öffentliche Sicherheit und die Eigentumsordnung aufrechtzuerhalten? All diese Fragestellungen konnten nicht mehr aus der Vogelperspektive der großen Ideen und sozialen Gruppen beantwortet werden. Schon aus diesem Grund neigte die neue Sozial- und Kulturgeschichte zu regionalen und lokalen Untersuchungen, in denen immer wieder belegt wurde, wie kontextgebunden und situativ das Verhalten individueller Akteure war. Im Zuge der Globalisierungsdebatten der 1990er Jahre weitete sich die Perspektive noch stärker. Schon länger war die nationalmythologische Fixierung gerade der US-amerikanischen Forschung auf die vorgeblich exzeptionelle Rolle Amerikas kritisiert worden. Transnationale und globalhistorische Arbeiten relativierten diesen Anspruch mit der gebotenen 16 Einleitung Deutlichkeit. Man konnte die Amerikanische Revolution nicht länger auf Nordamerika beschränken.29 Transatlantische, globale, aber auch britische, irische, kontinentaleuropäische und selbst indische Perspektiven waren einzubeziehen. Für nordamerikanische Kolonisten wie für britische Untertanen im Mutterland waren die Ereignisse auf den Schlachtfeldern Indiens von ebenso unmittelbarem Interesse wie das Geschehen in Saratoga oder Yorktown, von den weltweiten Aktivitäten der am Krieg beteiligten Flotten gar nicht erst zu reden.30 Immerhin, dies wird gerne vergessen, mutierte der Unabhängigkeitskrieg seit dem Beginn des französischen und spanischen Engagements 1778 zu einem Weltkrieg, der dem Siebenjährigen Krieg in nichts nachstand. Auf der Interessen- wie der Ideenebene stand die Amerikanische Revolution somit im weiteren Zusammenhang des blutigen französisch-britischen Ringens um Hegemonie in Europa, Indien, Nordamerika und auf den Weltmeeren, welches das 18. Jahrhundert beherrschte. Im Namen britischer Werte von Freiheit, Rechten und Protestantismus verbündeten sich die amerikanischen Revolutionäre ausgerechnet mit Frankreich, das spätestens im Siebenjährigen Krieg zum stereotypen Vorkämpfer von Katholizismus, Absolutismus und Tyrannei stilisiert worden war. Die Analyse dieser merkwürdigen Konstellation führte die Forschung dazu, vor allem das britische Handeln vor, während und nach der Revolution einer neuen Deutung zu unterziehen, denn die globale Perspektive bedingte nachgerade den intensiveren Blick auf die britischen imperialen Interessen, die mit den Wünschen und Zielen der Kolonisten kollidierten, obwohl beide Seiten sich der Idee des Empire verpfl ichtet fühlten. Gerade in der amerikanischen Geschichtsschreibung hatte allzu lange ein hochgradig einseitiges Bild von den Briten vorgeherrscht, dem es häufiger an der notwendigen Differenziertheit, bisweilen sogar an grundlegenden Kenntnissen fehlte. Die Entscheidungsprozesse in London wurden lange fast ausschließlich aus der Sicht der amerikanischen Quellen wahrgenommen, während die politische und soziokulturelle Eigenlogik der imperialen Zentrale ausgeblendet blieb.31 Weder wurden die Reformbedürfnisse des Imperiums nach dem siegreichen Siebenjährigen Krieg hinreichend berücksichtigt noch die Feinheiten britischer Innenpolitik. Vor allem wurden die britischen Akteure parteipolitisch oft falsch zugeordnet. So hat der renommierte amerikanische Historiker Francis X. Jennings den dritten Herzog von Cumberland zum Tory stilisiert, obwohl dieser der politische Ziehvater des angeblich proamerikani- Welche Revolution? Wessen Revolution? 17 schen Marquess of Rockingham und ein ausgewiesener Court Whig war.32 Außerdem wurden in der Regel Kriegstreiber als Tories und Friedenspolitiker als Whigs beschrieben, wohl weil Tory in den USA ein negativ konnotierter Begriff war, Whig hingegen nicht. In Wahrheit tendierten im Laufe des 18. Jahrhunderts eher die Whigs zu einer aggressiven Kriegspolitik, während die Tories militärischen Aktivitäten meist skeptisch gegenüberstanden.33 Noch problematischer erschien bei näherer Betrachtung der gängige, direkt den Quellen entnommene Topos, die britischen Politiker seien über die Lage und den Stand der Dinge in den Kolonien schlecht informiert gewesen. Man wird wohl eher sagen müssen, dass dieser Vorwurf immer dann erhoben wurde, wenn die britische Regierung oder das Westminster-Parlament nicht das taten, was die nordamerikanischen Eliten von ihnen erwarteten. Gerade in Fragen der Indianerpolitik waren die britischen Regierungen bemerkenswert gut unterrichtet.34 Die vielfältigen und dichten Kommunikationsnetzwerke zwischen Nordamerika und Großbritannien sind viel zu lange unterschätzt worden.35 Die britischen Ideen, Interessen und Handlungsoptionen müssen also in der Historiographie endlich denjenigen der amerikanischen Revolutionäre gleichberechtigt und ohne vorgängige normative Wertung zur Seite gestellt werden. Die einfache Geschichte von den Amerikanern als freiheitsliebenden, patriotischen Helden auf der einen Seite und den Briten als korrupten, arroganten und despotischen Schurken auf der anderen Seite lässt sich heute nicht mehr erzählen.36 Dieser normative Dualismus würde vor allem die grundlegende Tragik eines Konfl ikts überdecken, in dem beide Seiten unter dem Banner derselben Ideen, derselben politischen Sprache, derselben kulturellen Traditionen und für durchaus egoistische Interessen kämpften. Mit feiner Ironie hat Pocock die Amerikanische Revolution die einzig wahrhaft britische Revolution genannt, nachdem sämtliche Revolutionen des 17. Jahrhunderts ja englische gewesen waren, kämpften hier doch Mutterlandsbriten gegen Kolonialbriten um die Frage, was es hieß, Brite zu sein.37 Die Amerikanische Revolution entstand, global und imperial betrachtet, aus einer sozialen, ökonomischen, kulturellen und ideellen Transformationskrise des britischen ersten Empire auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung, und sie entstand vor allem aus einem eskalierenden Konfl ikt um die Deutungshoheit über dieses Empire. Mehr noch: Selbst in der neueren amerikanischen Geschichtsschreibung haben sich die Zweifel am freiheitlichen und fortschrittlichen Charakter der Amerika- 18 Einleitung nischen Revolution gemehrt. In einer aufsehenerregenden und provokanten Neuinterpretation der Ereignisse zwischen 1763 und der Verfassungsgebung 1787 / 91 kam Eric Nelson zu dem Schluss, die amerikanische Kolonialbevölkerung sei das Wagnis des Unabhängigkeitskrieges eingegangen, weil sie mit der Rolle König Georgs III. als parlamentarischer Monarch unzufrieden gewesen sei. Im Grunde, so Nelson, hätten sich die Amerikaner einen König gewünscht, der seine traditionellen Prärogativen ernst genommen und gegenüber dem Parlament strikter zur Geltung gebracht hätte. Die Freiheitsrhetorik der Revolution sei im Vergleich instrumentell und sekundär gewesen.38 Selbst wenn man Nelsons Interpretation als zu gewagt empfindet, so bleibt doch die Erkenntnis bestehen, dass die Revolution nur sehr bedingt Ausdruck eines modernen, aufgeklärten Freiheitswillens autonomer und souveräner Subjekte war. Erst im Laufe der Zeit erstarrte sie zu diesem Mythos.39 Ein typischer, gleichfalls mythischer Vorwurf der amerikanischen Seite an die Adresse der Mutterlandsbriten bleibt von diesen historischen Relativierungen gleichwohl unberührt. Zwar war die britische Regierung keineswegs uninformiert und unwissend, wenn es um die Lage und die Interessen der nordamerikanischen Kolonien ging, aber von dem Vorwurf eines an Arroganz grenzenden, hartnäckigen Unwillens, die kolonialen Eliten ernst zu nehmen, wird man die britischen Akteure, seien es Offiziere oder Beamte der Krone, nicht durchweg freisprechen können. Von Ausnahmen wie den Gebrüdern Howe abgesehen, nahmen die Mutterlandsbriten gegenüber der Kolonialbevölkerung eine eher bornierte Haltung ein. Die Ökonomie und die politisch-sozialen Gegebenheiten in den Kolonien wurden regelmäßig ausschließlich oder doch überwiegend vom Standpunkt britischer Interessen aus beurteilt, was auf der anderen Seite des Atlantiks naturgemäß auf wenig Gegenliebe stieß. Damit bewegten sich die Mutterlandsbriten ganz im Rahmen zeitgenössischer europäischer Diskurse über die Kolonien. In Spanien und Frankreich, wo der Aufklärer Buffon der vorgeblich klimatisch bedingten, zwangsläufigen Degeneration der Kolonialbevölkerungen einen ganzen Traktat widmete, fanden sich vergleichbare Phänomene. Viele Missverständnisse zwischen London und den Kolonien hätten sich womöglich vermeiden lassen, hätte man in Großbritannien die britischen Amerikaner als kulturell gleichberechtigt akzeptiert. Ob allerdings weniger Arroganz aus dem Mutterland den Unabhängigkeitskrieg tatsächlich vermieden hätte, ist eine rein hypothetische Frage. Welche Revolution? Wessen Revolution? 19 Neben dem britischen imperialen Handeln rückte mit der Debatte um den transnationalen und globalen Charakter der Amerikanischen Revolution eine ältere, ideengeschichtliche Fragestellung wieder in den Vordergrund: Wie eigentlich stand es um R. R. Palmers famoses Freiheitsvirus, das contagion of liberty, das von den USA ausgegangen sei? Nun ist unbestreitbar, dass die Amerikanische Revolution tatsächlich in eine Art revolutionärer Sattelzeit fiel, die den bürgerlich-liberalen Staat des 19. Jahrhunderts vorbereitete. Gerade im transatlantischen Raum zeitigte die Rezeption amerikanischer Ideen Folgen. Aber Horst Dippel hat bereits vor mehreren Jahrzehnten bemerkt, Palmers Feststellungen würden am ehesten noch für Deutschland und Frankreich gelten, wobei gleichwohl in Deutschland Enthusiasmus mit bisweilen grotesker Unkenntnis der realen Umstände in Amerika einhergegangen sei.40 Daher wird man sich vor einer voreiligen Universalisierung des amerikanischen Freiheitsverständnisses sowohl in Amerika selbst wie in der Geisteswelt des späten 18. Jahrhunderts hüten müssen.41 Faktisch finden sich sogar regelrecht antirevolutionäre Gegenströmungen in Europa, so etwa in Schottland und Irland. Dort hatte man die dem amerikanischen Bündnis mit den Franzosen inhärente Ironie wohl wahrgenommen und äußerst kritisch kommentiert. Die amerikanischen Rebellen waren aus dieser imperialen Sicht Verräter an der gemeinsamen Britishness.42 Mit Blick auf Lateinamerika oder den iberischen Raum wird man ebenfalls sehr vorsichtig sein müssen, ehe man direkte nordamerikanische Einflüsse postuliert, und selbst in Frankreich ließ die Rezeption der Amerikanischen Revolution ab 1791 merklich nach. Die universalistische und individualistische liberale Freiheitsrhetorik des 19. Jahrhunderts, die unser zeitgenössisches Begriffsverständnis maßgeblich geprägt hat, trägt wenig dazu bei, die Auswirkungen der Amerikanischen Revolution im Horizont ihrer eigenen Epoche einzuordnen.43 Fasst man nun die lokale und die globale Perspektive zusammen, drängt sich ein weiteres Problem auf, das der Lösung harrt: Warum brach die Revolution eigentlich in den 13 Festlandskolonien Großbritanniens aus? Immerhin hatte Großbritannien um 1770 weitaus mehr Kolonien im westlichen Teil des Atlantiks. Im Norden fanden sich Nova Scotia, Neufundland und Neubraunschweig sowie Quebec, das ehemalige Neufrankreich mit seiner Mehrheit katholischer, frankokanadischer Einwohner. Im Süden wiederum lagen die großen, wirtschaftlich bedeutenden Plantagenkolonien auf Barbados, den Bermudas und dem als außerordentlich unruhig verschrienen Jamaika. Keine dieser Kolonien schloss sich der 20 Einleitung Revolution an, obschon sie durchaus Grund zur Unzufriedenheit hatten. Darüber hinaus verschärft sich das Problem, wenn man der sozialen und kulturellen Unterschiede zwischen den 13 Kolonien gewahr wird. Es war wenig genug, was das neuenglische Massachusetts mit den kosmopolitischen Städten Philadelphia und New York oder gar mit der Sklavenhalterkolonie South Carolina, die eher an Barbados und Jamaika erinnerte, verband. In London glaubte man in den Reihen der Regierung von Lord North noch 1774 / 75 nicht ohne gute Gründe, es mit einer lokal begrenzbaren Revolte von Boston und Umgebung zu tun zu haben. Die neuenglischen Kolonisten waren unter den Siedlern im Mittelatlantikraum und vor allem im Süden denkbar unbeliebt, galten sie doch ent weder als engstirnige und bornierte Puritaner oder als materialistische Yankee-Kapitalisten. Der britische Glaube, die südlichen Kolonien würden loyal bleiben, war nicht vollkommen unbegründet und basierte ebenso auf Informationen von Kronbeamten, die vor Ort tätig waren, wie auf den angenommenen Interessen der dortigen Eliten, die strukturell in vielem den britischen verwandt waren. Immerhin handelte es sich um eine Oligarchie, die vollkommen nach britischem Vorbild modelliert war.44 Spätestens seit Timothy Breens bahnbrechendes Werk zum Zusammenhang von Konsumgesellschaft und Revolution 2004 erschien, ist die Diskussion um die Ursachen des trotz aller Widrigkeiten und internen Konfl ikte vorhandenen Gemeinschaftsgefühls der 13 Kolonien wieder voll entbrannt. Breen wies auf die Furcht vieler Amerikaner aus der blühenden kolonialen Mittelklasse hin, die britischen Soldaten, die im Zuge des Siebenjährigen Krieges nach Nordamerika gekommen waren, könnten die dortige Bevölkerung, insbesondere aber die politische Führung auf den Reichtum Amerikas aufmerksam machen. Dies würde unweigerlich zu Neidgefühlen führen, die sich dann in repressiven Ausbeutungspraktiken niederschlagen würden, welche im Umkehrschluss die etablierten Konsumgewohnheiten sämtlicher Amerikaner zwischen Maine und Georgia, unabhängig von ihren lokalen Interessen und ökonomischen Praktiken, empfindlich betreffen würden. Der gerade erst erkämpfte Wohlstand Nordamerikas würde so auf Nimmerwiedersehen im Mutterland versickern.45 Eine Geschichte der Amerikanischen Revolution und ihrer Epoche muss heute also eine Geschichte von Widersprüchen sein. Möglicherweise handelt es sich bei der Revolution um ein Mosaik, das bei aller Schönheit der einzelnen Steine kein geschlossenes Bild ergibt. Eine solche Geschichte muss außerdem der Janusköpfigkeit einer Revolution ge- Welche Revolution? Wessen Revolution? 21 Hafenansicht von Boston um 1770, handkolorierter Stich von Paul Revere, 1768. recht werden, die auf der einen Seite ganz dem frühneuzeitlichen, partikularistischen und rückwärtsgewandten Denken verpflichtet war, auf der anderen Seite aber das Potential zu einem der Zukunft zugewandten, folgenreichen Universalismus in sich barg, eine Revolution also, die sich historisch präzise in der Zeit des Übergangs zur Industriemoderne verorten lässt. Das aber hat Folgen für jede Rezeption dieser Revolution, gerade wenn sie, wie in den USA, zum nationalen Gründungsmythos geworden ist. Vieles an der heutigen amerikanischen Gesellschaft ist ohne das Wissen um die vormodernen Ursprünge ihres politischen und sozialen Systems nicht begreifbar. Insbesondere darf man niemals vergessen, wie fremd uns Menschen des 21. Jahrhunderts die Frühe Neuzeit ist. Die Akteure handelten teilweise aus anderen Gründen als heute, der aristokratische Ehrbegriff war weiterhin wichtig, Religion zentral – aller Aufklärung, aller Skepsis und allem Deismus der Eliten zum Trotz. Begriffe und Konzepte bedeuteten etwas anderes als heutzutage. Das kann als defizitär wahrgenommen werden, aber ein solcher Vorwurf wäre ein reiner Anachronismus. Menschen sind Menschen ihrer Zeit, sie wissen nicht, was aus ihrem Denken und Handeln folgt. Vor allem aber kann es nicht ausreichen, sich der Amerikanischen Revolution nur von der Seite der – im Kern britischen – Werte und Ideen her zu nähern. Das bedeutet nicht, auf eine historisierende Diskussion dieser Ideen zu verzichten. Aber sie müssen nicht nur als zeitgebunden, sondern auch als kontextgebunden ver- 22 Einleitung standen werden. Ideen werden nicht schlagartig wertlos, wenn man sie mit Interessen, Ränkespielen sowie lokalen und zufälligen Konstellationen verknüpft, die sich jeder voreiligen Theoretisierung entziehen. Man bekommt jedoch einen sachgemäßeren und kritischeren Zugang zu ihnen, wenn man sich gleichzeitig die Frage stellt, welche Bedeutung etwa dem Schmuggel, der Sklaverei und der Bodenspekulation bei der Formulierung des amerikanischen Freiheitsverständnisses zukam. Damit verliert sich die Zeit- und Ortlosigkeit vorgeblich universaler Ideen, und die von der Revolutionsära ausgehende semantische und soziopolitische beziehungsweise soziokulturelle Dynamik wird erkennbar. Erst in diesem Transformationsprozess entfalteten die Freiheitsideale der Amerikanischen Revolution eine transnationale und globale Wirkung. Die Revolution in Nordamerika war kein universalistisches Projekt, aber sie setzte ein solches in Gang. Gemeinhin lässt man die Epoche der Amerikanischen Revolution mit dem Siebenjährigen Krieg beginnen, und es gibt keine wirklich überzeugenden Gründe, von dieser Konvention abzurücken. Viel schwerer ist es, das Ende der revolutionären Ära zu bestimmen. Der Friede von Paris 1783 beendete den Unabhängigkeitskrieg, war aber ansonsten ein randständiges Ereignis. Auf alle Fälle muss die Diskussion um die Verfassung von 1787 einbezogen werden, da sie die Revolution institutionell verstetigte. Aber unter sozial- und kulturhistorischen Gesichtspunkten bieten sich weitere wichtige Ereignisse an, ohne die man die von der Revolution entfaltete Dynamik nur schwerlich korrekt einzuordnen vermag. Es sei nur an den Übergang zum allgemeinen Wahlrecht für alle freien weißen Männer in den 1810er und 1820er Jahren erinnert, ebenso an die Neupositionierung gesellschaftlicher Eliten, den aufkommenden Marktkapitalismus, die Kommunikationsrevolution der 1830er Jahre, die Akzeptanz der Massendemokratie durch die Whigs gleichfalls in den 1830er Jahren, die zweite evangelikale Erweckungsbewegung und viele andere Ereignisse mehr, die einen Epochenwechsel um 1835 nahelegen. Sehr radikal gedacht, könnte man das Zeitalter der Amerikanischen Revolution bis zu Dorr’s Rebellion im Rhode Island des Jahres 1842 laufen lassen, in deren Verlauf die letzte Royal Charter aus den 1660er Jahren außer Kraft gesetzt und damit die Herrschaft der alten kolonialen Eliten endgültig beendet wurde – ähnlich wie annähernd zeitgleich mit dem Anti-Rent War 1838 die Vormachtstellung der semifeudalen, kolonialen Eliten in New York zusammenbrach. Hier wird ein mittlerer Weg gewählt, indem das Ende Welche Revolution? Wessen Revolution? 23 des Krieges von 1812, des sogenannten zweiten Unabhängigkeitskriegs mit Großbritannien, die revolutionäre Epoche beschließt. Auf weiterführende Ereignisse soll aber im jeweiligen sachlichen Zusammenhang knapp eingegangen werden.46 Abschließend sind zwei Bemerkungen zur Wortwahl notwendig. Ich verzichte darauf, von den Revolutionären als «Amerikanern» zu sprechen, da sie zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit der kolonialen Bevölkerung repräsentierten. Daher werden sie entweder als (amerikanische) Whigs, als Rebellen, Patrioten, Revolutionäre oder Aufständische bezeichnet. Ihre amerikanischen Gegenspieler laufen unter (amerikanischen) Tories, Loyalisten oder Tory-Loyalisten, obwohl sie streng genommen überwiegend keine Tories im britischen Sinn, sondern moderate Whigs waren. Die Briten können der Abwechslung halber auch als Engländer erscheinen, zumal viele der Befehlshaber tatsächlich Engländer und nicht Waliser, Schotten oder Iren waren. Etwas schwerer ist es mit den Namen der Briten, vor allem wenn es sich um Angehörige der Aristokratie handelte. Sie werden in der Regel mit ihrem Titularnamen aufgeführt, zum Beispiel Grafton anstelle von Fitzroy, Newcastle anstelle von Pelham (Pelham wäre dann sein Bruder), Bute statt Stuart und Rockingham statt Watson-Wentworth. Eine besondere Schwierigkeit stellt dabei allerdings Sir William Pitt der Ältere dar. Als Premierminister heißt er traditionell Pitt, in den 1760er Jahren wurde er dann aber zum Earl of Chatham, und seine Parteigänger firmierten als Chathamites. Ich folge diesem Sprachgebrauch, das heißt, Pitt und Chatham sind eine Person, deren Anhänger die Chathamites sind. I. 1763: Am Vorabend der Revolution 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 1763: AmKolonien Vorabendinder Revolution 1. Die I.britischen Nordamerika Im Spätherbst des Jahres 1773 herrschte eine klirrende Kälte in den Neuenglandkolonien.1 Zwar schien häufig die Sonne aus einem strahlend blauen Himmel, während eine leichte Brise über den unruhigen Nordatlantik wehte, aber der Wind war frostig kalt. Viele kleinere Gewässer waren längst eingefroren. Die Menschen in Boston waren froh, wenn sie ihre Tage und Nächte in ihren festgefügten Häusern aus Stein oder Holz verbringen durften. Der Rauch aus den zahllosen Schornsteinen dieser entlegenen, etwas provinziellen Großstadt des britischen Empire vermittelte dem unbeteiligten, oberflächlichen Beobachter einen beinahe behaglichen, ruhigen Eindruck. «Biedermeier» hätte man im 19. Jahrhundert gesagt. Indes, der Eindruck trog. Die Stadt stand nicht nur seit Jahrzehnten in dem allzu berechtigten Ruf, notorisch unruhig zu sein, nein, seit Wochen sorgten immer neue Meldungen für Aufruhr. Gerüchte machten die Runde. Nicht einmal mehr hinter vorgehaltener Hand sprachen die Einwohner Bostons über Vorgänge, die ihnen aus dem warmen, viel weiter südlich, in South Carolina, gelegenen Charles Town, dem heutigen Charleston, zu Ohren gekommen waren. Dort hatte der königliche Gouverneur eine Ladung Tee der Ostindienkompanie (EIC) auf dem Schoner Polly beschlagnahmt, weil wegen des Drucks einer patriotischen Gruppe, der Sons of Liberty (Söhne der Freiheit), keine Abgaben entrichtet worden waren. Nun schimmelte der Tee im dortigen Hafen vor sich hin, wo die Sons of Liberty die Ladung bewachten und somit ihren Verkauf unterbanden. In Philadelphia wiederum hatte ein Schiff der Ostindienkompanie einfach kehrtgemacht und war unverrichteter Dinge nach Großbritannien zurückgesegelt, weil die dortigen Freiheitssöhne ebenfalls Anstalten gemacht hatten, das Entladen des indischen Tees zu verhindern. All dies erregte die Yankees in Boston. Sie solidarisierten sich mit ihren so unbekannten britischen Landsleuten im Süden. Nein, Tee aus Indien war ein Unding, ein Angriff auf die Freiheit und Lebensweise 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 25 guter Briten hier auf dem nordamerikanischen Kontinent. Sollte die Ladung in Charles Town doch verschimmeln. Am besten verrottete der britische Tory-Premier Lord Frederick North, der an allem schuld war, gleich mit! Vorerst aber blieb die Unruhe verhalten. Noch brach sie sich nicht in einem der üblichen gewalttätigen und blutigen riots Bahn, für die Boston so berühmt und berüchtigt war. Aber viele, auch aus der konservativen Oberklasse, hatten Sorgen. Wenn die Stadt explodierte, könnte es Tote geben. Würden die Demonstranten sich möglicherweise nicht bloß am Eigentum der ungeliebten EIC vergreifen, sondern obendrein Häuser der reichen Kaufleute angreifen, wenn ihr Zorn erst einmal entfesselt war? Wie würde sich der Gouverneur der Krone, der umtriebige und einflussreiche Thomas Hutchinson, verhalten, wie die Soldaten, die zum Ärger aller in der Stadt stationiert waren? Wenn es zu Unruhen kommen sollte, war es an den Eliten, die Kontrolle zu behalten, zumal gerade sie ebenso verärgert über die englische Regierung waren wie der verachtete Pöbel. Nicht wenige Augen richteten sich in diesen Novembertagen verstohlen auf den Hafen. Dann kam es, wie es kommen musste. Am 27. November, einem Samstag, fuhr ein Frachtschiff, die Dartmouth, in den Hafen ein. Etwas gelangweilt und routiniert machte sich die Hafenwache auf, die Besatzung zu kontrollieren, ob sich eventuell einer der Seeleute auf der neunwöchigen Überfahrt mit einer schwerwiegenden Krankheit infiziert hatte, was womöglich zu einer längeren Quarantäne geführt hätte. Nachdem diese Sorge sich zur Erleichterung aller Beteiligten als unbegründet herausgestellt hatte, erkundigten sich die Herren von der Hafenbehörde nach der Ladung der Dartmouth, um die Abfertigung durch die Zollinspektoren einzuleiten. Als sie das Wort «Tee» hörten, setzten sie sorgenvolle Mienen auf. Jetzt war es so weit. Auch Boston würde sich entscheiden müssen. Um Zeit zu gewinnen, wurde der Frachter bei Griffin’s Wharf untergebracht, einer besonders abgelegenen Ecke des weiträumigen Hafens, die heute nicht mehr identifiziert werden kann. So absonderlich es anmuten mag: Eines der wichtigsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte, die Boston Tea Party, lässt sich nicht mehr verorten. Kaum war die Hafenwache von Bord gegangen, begannen die ersten Meldungen über die Ankunft der Dartmouth die Runde zu machen. Da der nächste Morgen, der 28. November, ein Sonntag war, machten sich die Bostonians, gute puritanische Protestanten, die sie überwiegend waren, auf zum Kirchgang. Bereits während der Gottesdienste begannen die Pfarrer 26 I. 1763: Am Vorabend der Revolution und ihre Gemeinden sich über die Ladung Tee am Griffin’s Wharf zu ereifern. Nach dem Ende der oft mehrere Stunden währenden Predigten, die Mittagszeit war schon verstrichen, wälzten sich die Menschenmengen zu den bekannten Versammlungshallen. Dort warteten die lokalen Sons of Liberty auf ihre Anhänger. Über den gesamten Tag hinweg tobten die Debatten, Argumente wurden ausgetauscht, Resolutionen eingebracht, verabschiedet oder verworfen. Wie in Charles Town, Philadelphia und inzwischen auch New York wollten die Bostonians sich dem Ansinnen verweigern, Abgaben auf den Tee der EIC zu entrichten, die sie als verfassungswidrig und als Anschlag auf ihre Freiheiten begriffen. Gouverneur Hutchinson bestellte seine eigenen Ratgeber ein, darunter auch die ranghöchsten Offiziere der Garnison. Niemand hatte ein Interesse daran, die Situation eskalieren zu lassen, aber Hutchinson war der Ansicht, Recht sei Recht und müsse Recht bleiben. Das Parlament in London hatte diese Abgaben beschlossen, also mussten sie entrichtet werden. Die Diskussionen zogen sich über mehrere Tage hin. Hutchinson stellte dem Kapitän der Dartmouth, der bereits signalisiert hatte, er würde an sich gerne nach England zurückkehren, eine Frist bis zum 16. Dezember, eine Art Ultimatum, danach würde der Tee wegen Verstoßes gegen geltendes Abgabenrecht beschlagnahmt und von den Behörden verkauft werden. Die Lage wurde noch dramatischer, als zwei weitere Frachtschiffe, die Beaver und die Eleanor, gleichfalls bis an den Rand mit Tee beladen, in den Hafen einfuhren. Sie ankerten gleichfalls am Griffin’s Wharf. Während es ungeachtet der beißenden Kälte zwischen dem 28. November und dem 16. Dezember täglich zu Demonstrationen gegen die Teelieferung kam, sammelte der ehemalige Steuereintreiber Samuel Adams eine besonders engagierte und radikale Gruppe innerhalb der örtlichen Sons of Liberty um sich. Diese Männer strebten nach radikaler Aktion. Die bisherige Vorgehensweise der elitären Führer der Freiheitssöhne, die sich mit ihren Protesten an den Vorbildern im Süden orientierten, war ihnen zu moderat, eines freien Bostonians unwürdig. Immer dieses leere Geschwätz von öffentlicher Ordnung und Eigentumsrechten selbst der Ostindienkompanie. Das britische Mutterland, so die feste Überzeugung der Radikalen, bewegte sich unter dem Einfluss der EIC und der Tories am Rande der Despotie. Ein Schritt noch, und der katholische Absolutismus Frankreichs würde auf Großbritannien und seine Kolonien übergreifen. Angesichts dieser unheimlichen und überwältigen- 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 27 Historisierende Darstellung der Boston Tea Party von N. Currier und J. M. Ives, 1846. den Bedrohung wirkten die Reden der Moderaten wie Gefasel. Einige Teehändler taten sich in den Diskussionen durch besondere Radikalität hervor, obwohl sie bislang zu den Moderaten gezählt hatten. Auf diese Weise rückte der Termin für die Beschlagnahmung näher und näher. Gouverneur Hutchinson gab sogar den Befehl, einige Kriegsschiffe der Royal Navy zum Schutz der drei Frachter abzukommandieren, da sein gut ausgebildetes Spionagenetzwerk ihm von den nicht eben sehr geheimen Vorbereitungen der Radikalen berichtet hatte. Aber die Kommandeure der Marine befürchteten eine weitere Eskalation, und kein einziges Kriegsschiff ließ sich blicken. Am Mittag des entscheidenden Tages trafen sich die Protestierer in einem der Versammlungssäle der Stadt. Hunderte von Menschen aus Boston und Umgebung strömten dorthin. Samuel Adams berichtete über Hutchinsons Weigerung, die Schiffe absegeln zu lassen, und sein Bemühen um militärischen Beistand. Die Menge tobte. Adams verkündete, man könne in dieser Situation nicht mehr tun, außer um die Freiheit zu kämpfen. Just – und nicht zufällig – in diesem Moment stürmten Männer in Kostümen, die an die Kleidung der Irokesen vom Stamme der Mohawk erinnerten, die für ihre grausame und tapfere Kriegführung bekannt und gefürchtet waren, den Saal. Kein Augenzeuge konnte angeben, wie viele es tatsächlich waren. 28 I. 1763: Am Vorabend der Revolution Schätzungen schwankten zwischen 30 und 300, was einiges über den Wert von Augenzeugen aussagt. Die «Indianer», deren Identität den meisten Anwesenden und auch Hutchinson nur zu gut bekannt war, stimmten das an, was sie für das Kriegsgeheul der Irokesen hielten, und einige Radikale auf der Galerie antworteten ihnen begeistert. In den frühen Abendstunden zog die jubelnde Menge dann zum Hafen. Das britische Militär blieb in der Garnison und tat – nichts. Die Flotte glänzte durch Abwesenheit, und Hutchinson verbarrikadierte sich mit seinem Stab in seinem Amtsgebäude. Im Hafen angekommen, rannten alle zum Griffin’s Wharf, und die «Mohawk» setzten auf die Dartmouth über, wo ihnen gleichfalls keinerlei Widerstand entgegengesetzt wurde. Die Offiziere und Matrosen des Frachters waren klug genug einzusehen, dass es keinen Sinn machte, für das Eigentum der Ostindienkompanie das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Ungestört machten sich die verkleideten Revolutionäre ans Werk und kippten den Inhalt der Teekisten in die schäumende See. Bald waren tote Fische zu sehen, die ersten unschuldigen Opfer der Amerikanischen Revolution. Nach der Dartmouth waren die beiden anderen Schiffe dran. Insgesamt wurden im Laufe von drei Stunden 342 Kisten mit 45 Tonnen Tee «entsorgt». Drei lange Stunden, während derer eine riesige Menschenmenge dem ungewöhnlichen Geschehen lautstark jubelnd folgte und die Obrigkeit sich weiterhin konsequent darauf beschränkte, die Hände in den Schoß zu legen, obwohl weit über tausend britische Rotröcke, also Berufssoldaten, in der Stadt stationiert waren. Nicht alle Zuschauer waren reine Überzeugungstäter. Einige versuchten unbemerkt, Tee aus dem Wasser zu entnehmen, um ihn rasch nach Hause zu bringen und einer nützlichen Verarbeitung zuzuführen. Als man sie erwischte, wurden sie gnadenlos verprügelt. Die Freiheitssöhne kannten keinen Spaß, wenn es um ihre heilige Sache ging. Erst als es bereits dunkel war, verstreute sich die Menge entweder nach Hause oder in die Tavernen um das Hafenviertel herum. Am nächsten Morgen machte sich bei einigen Moderaten dann Ernüchterung breit. War man unter Umständen zu weit gegangen? Immerhin hatte man sich an fremder Leute Eigentum vergriffen, und das war nach den Maßstäben der liberalen Aufklärung ein todeswürdiges Verbrechen. Wenn der Pöbel einmal entfesselt war, wer garantierte dann, dass er das Eigentum der reichen Bürger Bostons weiterhin respektieren würde? Immerhin, einen Lichtblick gab es: Mit Ausnahme des ungeliebten Tees 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 29 war nichts anderes zerstört oder entwendet worden. Die «Mohawks» hatten peinlich genau darauf geachtet, keinerlei Privatbesitz der Matrosen anzutasten. Trotzdem, so die Moderaten, blieb der britischen Regierung jetzt kaum eine Möglichkeit, als hart zu reagieren, wollte sie nicht vollends das Gesicht verlieren. Möglicherweise konnte man das Schlimmste verhindern, wenn man der Ostindienkompanie eine Entschädigung anbot. Die Radikalen hingegen beharrten darauf, es habe keine Alternative gegeben,2 obwohl alle wussten, dass sie in Charles Town und Philadelphia sehr wohl existiert hatte. Die Sorgenfalten der Moderaten waren nicht unberechtigt. Als die Nachrichten von der Boston Tea Party wenige Wochen später in Großbritannien eintrafen, konnte der stets aufmerksame Beobachter Benjamin Franklin in London notieren, die Stimmung in der britischen Presse, aber auch in den Wirtshausdiskussionen sei binnen weniger Tage von relativer Sympathie für die Kolonialen in wütende Ablehnung umgeschlagen. Viele fragten sich, ob – bei aller berechtigten Empörung über Steuern und Abgaben – jede Kolonie das Recht haben könne, sich einfach über Beschlüsse des Londoner Parlaments hinwegzusetzen. Abgeordnete, aber auch einfache Passanten schimpften wie Rohrspatzen über die Eigensinnigkeit der Nordamerikaner. Kaum irgendwo war ein Wort des Verständnisses, der Geduld oder der Nachsicht zu vernehmen. Logik und politische Vernunft geboten ein hartes, unnachsichtiges Durchgreifen, sonst hätte ja jeder Untertan seiner Majestät, gleichgültig ob in Massachusetts oder in Kilkenny, Derby oder Kent, das Recht, über die eigene Abgabenlast selbständig zu entscheiden. Der Zusammenhalt des Imperiums stand auf dem Spiel. Obwohl Lord North vor militärischer Vergeltung weiterhin zurückschreckte, konnte er, der gänzlich unmilitärische Fachmann für Verwaltung und Finanzen, sich dem Sog einer aufgeputschten öffentlichen Meinung nicht mehr entziehen. Der Weg in den Unabhängigkeitskrieg war eingeschlagen. Noch exakt zehn Jahre zuvor hätte das kein vernünftig denkender Mensch für möglich gehalten. Damals, 1763, hatten Briten im Mutterland und den Kolonien noch gemeinsam die Glocken läuten lassen. Das Vereinigte Königreich hatte nach Jahren harten und entbehrungsreichen Krieges den französischen Erzfeind in einer Weise in die Schranken gewiesen, die nicht zu erwarten gewesen war. Frankreich lag am Boden, und Großbritannien triumphierte. Es war die letzte verbliebene Supermacht des 18. Jahrhunderts. Wer hätte gedacht, dass ein Konfl ikt über Teeabgaben 30 I. 1763: Am Vorabend der Revolution diesen Triumph binnen zweier Jahrzehnte zunichtemachen würde. Eine Revolution wegen Tee, allen Ernstes? Natürlich nicht! Der indische Tee war nur ein Auslöser, der auf sehr viel tiefer liegende Probleme hinwies. Dennoch warf allein schon die Boston Tea Party viele Fragen auf. Wer waren eigentlich die handelnden Akteure? Welche Interessen und Ideen trieben sie an? Wie verständigten sie sich mit den Kolonisten jenseits der Stadtgrenzen von Boston? Wie sahen überhaupt das Leben, die Gesellschaft, die Kultur in den britischen Festlandskolonien aus? Wie gestaltete sich das Verhältnis zum Mutterland? Oder ganz banal: Warum verkleideten sich die Teestürmer als Mohawk-Indianer? All diese Fragen nach den eigentlichen Ursachen der Amerikanischen Revolution führen unweigerlich mitten in den Siebenjährigen Krieg hinein, denn ohne diesen hätte es keine Revolution gegeben, zumindest nicht so früh.3 Man kann allerhand kontrafaktische Überlegungen darüber anstellen, was gewesen wäre, wenn Großbritannien 1763 die Franzosen nicht vom nordamerikanischen Festland vertrieben hätte. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die beiden bourbonischen Mächte Frankreich und Spanien sich im Falle eines Sieges mit zwei Millionen britischen Untertanen belastet hätten. Aber man könnte sich durchaus vorstellen, in welche Richtung sich die nordamerikanischen Kolonien im Falle einer britischen Niederlage oder eines Patts entwickelt hätten. Viele Konfl ikte, die ab 1763 das Verhältnis zwischen den Kolonien und dem Mutterland prägten, wären zumindest weniger heftig ausgefallen, denn der französisch-spanische Außendruck hätte weiterhin disziplinierend gewirkt.4 Möglicherweise wäre Nordamerika im Laufe der Zeit zu einem gleichberechtigten Partner Großbritanniens herangewachsen, man könnte an eine Art Konföderation in Gestalt einer Personalunion denken. Vielleicht hätte sich sogar, wie Benjamin Franklin es in den 1760er Jahren erwartete, Nordamerika zum neuen Zentrum des britischen Reiches emporgearbeitet, auch wenn diese Vorstellung den Briten absurd erscheinen mochte. Vielleicht hätte man sich friedlich getrennt, oder ein Unabhängigkeitskampf wäre Jahrzehnte später aktuell geworden. Die Geschichte des Verhältnisses zwischen Brasilien und Portugal bietet eine Grundlage für derartige Hypothesen. All dies muss notwendig Spekulation bleiben, denn Großbritannien und seine nordamerikanischen Kolonien gingen aus dem Siebenjährigen Krieg als Sieger hervor. Der Sieg aber wurde zur Katastrophe. Um dies zu verstehen, muss die Situation der Kolonien vor 1754, dem Beginn des 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 31 Siebenjährigen Krieges auf nordamerikanischem Boden, genauer in den Blick genommen werden.5 Dabei kann es nicht um eine komplette Geschichte der 13 Kolonien gehen, sondern um eine knappe Skizze ihres Rechtsstatus, ihrer Beziehungen zum Mutterland und der zwischen ihnen waltenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf sozialer, kultureller, wirtschaftlicher sowie politischer Ebene.6 Rechtlich gesehen, handelte es sich bei den 13 Festlandskolonien, die später zu den Vereinigten Staaten von Amerika wurden, um höchst unterschiedlich organisierte, untereinander kaum verbundene Einheiten. Vor 1754 etwa existierten keine formalisierten Beziehungen zwischen den Kolonien, deren politische und ökonomische Netzwerke samt und sonders nach London, also transatlantisch und nicht kontinental, ausgerichtet waren. Tatsächlich fanden vor den Wahlen zum ersten Kontinentalkongress von 1774 überhaupt nur zwei Versammlungen statt, auf denen die Kolonien sich untereinander trafen. Zum einen handelte es sich um den Kongress von Albany von 1754, auf dem neben den unablässigen Grenzstreitigkeiten der Kolonien untereinander erstmalig über gemeinsame Verteidigungsmaßnahmen gegenüber Frankreich diskutiert wurde, ohne dass dies im Mutterland oder in den Kolonien selbst auf besondere Gegenliebe gestoßen wäre. Zum anderen trafen sich inmitten der vorrevolutionären Unruhen von 1765 Delegierte der kolonialen Antisteuerbewegung zum Stamp-Act-Kongress, um gemeinsame Positionen zu bestimmen und den zivilgesellschaftlichen Protest gegen die Maßnahmen des britischen Parlaments zu koordinieren. Selbst der Begriff «Amerikaner» war inhaltsleer und rein geographisch definiert. Man war Virginier, Pennsylvanier, Neuengländer aus Connecticut oder Rhode Island, New Yorker, Jamaikaner oder aus Nova Scotia. In zweiter Linie verstand man sich als Brite und Angehöriger des britischen Weltreichs.7 Dies galt allerdings nur bedingt für Zuwanderer aus Deutschland und die alteingesessenen Kolonialbevölkerungen aus den Niederlanden oder Schweden. Ihre Eingliederung bereitete angesichts der angelsächsischen Dominanz erhebliche Probleme, vor allem wenn sie keiner akzeptierten protestantischen Denomination angehörten. Die Unterschiede zwischen den Kolonien wurden bereits deutlich, wenn man einen Blick auf ihre rechtliche Struktur warf.8 Sieben von ihnen, namentlich New Hampshire, New York, New Jersey, Virginia, North Carolina, South Carolina und Georgia, waren Kronkolonien, die juristisch zumindest der Fiktion nach direkt dem britischen Monarchen 32 I. 1763: Am Vorabend der Revolution unterstanden. Massachusetts hatte eine Sonderstellung inne, da es zwischen dem Status einer Kronkolonie und einer Charterkolonie, die einer Handelsgesellschaft mit königlicher Charta gehörte, schwankte. Rhode Island und Connecticut waren solche Charterkolonien, Pennsylvania, Delaware und Maryland waren Eigentümerkolonien, die den Familien der vormals quäkerischen Penns und der einstmals katholischen Calverts – die Häupter beider Familien waren zwischenzeitlich zum Anglikanismus konvertiert – gehörten, im Grunde also Lehen nach europäischem Muster. Diese unterschiedliche Rechtsstellung hatte Folgen für die verfassungsrechtliche Situation der einzelnen Kolonien, primär für die Stellung der Gouverneure, ihres Rates und der Legislaturen (Assemblies, die ebenfalls unterschiedliche Namen hatten, so etwa House of Burgesses in Virginia). Die Stellung der Gouverneure war in den Kronkolonien etwas stärker als in den Eigentümer- und den Charterkolonien. In Rhode Island etwa wurde der Gouverneur gewählt und nicht von der Krone ernannt, in den Eigentümerkolonien bestimmten die Eigentümer den Gouverneur. In der Regel waren die Parlamente mit zwei Kammern ausgestattet, einem vom Gouverneur ernannten Rat und der gewählten Assembly, nicht so in Pennsylvania und Delaware, wo es keinen Rat gab, und in Massachusetts, wo der Rat gewählt und nicht ernannt wurde. Aber selbst in den Kronkolonien hingen die Gouverneure und die königliche Verwaltung, so sie überhaupt über ein paar Zollkommissare hinaus existierte, in sämtlichen Finanzfragen, einschließlich ihrer eigenen Besoldung, vom guten Willen der Assembly ab, die nach alter englischer Tradition das Recht beanspruchte, in Haushalts- und Finanzfragen allein zu entscheiden. Die Krone stellte ihren Gouverneuren normalerweise keine gesonderten Mittel zur Verfügung. Vor 1754 verfügten diese zudem über keine regulären britischen Soldaten, die notfalls ihre Position hätten durchsetzen können. Die Krone besaß in Nordamerika bestenfalls eine rudimentäre Autorität. Diese zurückhaltende Art, Herrschaft vor Ort auszuüben, war einerseits Produkt des Zufalls. Die Engländer hatten ihr koloniales Abenteuer auf der gegenüberliegenden Seite des Ozeans ohne Plan und mit beschränkt rationalem Kalkül angetreten. Im Gegensatz zu den Franzosen, die gerne mit fertigen Plänen operierten, und selbst zu den Spaniern und Portugiesen, bei denen die staatliche Autorität stets gewahrt werden musste, handelten die Engländer bevorzugt auf der Basis privatunternehmerischen Eigennutzes und vertrauten auf den Zufall und Gottes Hilfe. Im Ergebnis führte dies zu einem verlustreichen trial-and-error-System. 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 33 Letztlich musste die Krone dann doch immer wieder ordnend eingreifen, was aber nicht zu vereinheitlichten Verwaltungsstrukturen führte. Andererseits kam das organisatorische Chaos den Interessen Sir Robert Walpoles, First Lord of the Treasury und von 1721 bis 1742 nach moderner Nomenklatur der erste Premierminister Großbritanniens, durchaus entgegen. Die Könige Georg I. und Georg II. stammten aus dem Hause Hannover und interessierten sich, anders als ihr Nachfolger Georg III., der primär britisch sozialisiert war, vor allem für die Angelegenheiten des Kontinents. Dies nutzte Walpole, um sein eigenes Herrschaftssystem im Westminster-Parlament und der Whig-Regierung derart zu festigen, dass ihm kein Rivale das Wasser reichen konnte. Das System Walpole wurde von keinerlei Scham gebremst und erfreut sich bis heute des Rufes uneingeschränkten parteipolitischen Nepotismus, ungebremster Vetternwirtschaft und leidenschaftlich betriebener Korruption.9 Da Walpole zwar, wie nahezu alle Staatsmänner des 18. Jahrhunderts, in merkantilistischen Kategorien dachte, aber gleichzeitig ein von ideologischen Zwängen gänzlich freier Pragmatiker war, hatte er sich für die Kolonien eine Wirtschaftsordnung ausgedacht, die mit der lückenhaften politischen Kontrolle bestens harmonierte: den wise and salutary neglect, wie Edmund Burke, gleichfalls ein Whig, es in den 1760er Jahren ausdrückte. Auch Walpole glaubte, jede wirtschaftliche Transaktion führe notwendig auf der einen Seite zu Gewinnen und auf der anderen zu Verlusten. Wie jeder gute Merkantilist wollte er seine Gewinne maximieren und damit die Verluste auf der anderen, also der amerikanischen Seite maximieren. Win-win-Situationen im Sinne moderner Wirtschaftstheorien waren in diesem Gedankengut nicht vorgesehen. Erst Adam Smith und der Utilitarismus erschlossen ab 1776 gedanklich neue Wege. Aber Walpole bemerkte, wie sehr in der ökonomischen Praxis beide Seiten, Mutterland und Kolonien, von niedrigen Abgaben profitierten.10 Also beschränkte sich Großbritannien unter seiner politischen Verantwortung wesentlich darauf, einzig die vorgesehenen Handelsabgaben einzutreiben. Und selbst dies wurde eher lax gehandhabt. Insbesondere drückte die Royal Navy vor 1760 bei der Lieblingsbeschäftigung der amerikanischen Kolonisten, dem Schmuggel mit den bourbonischen Mächten Frankreich und Spanien oder mit den Portugiesen, alle Augen zu. Steuern wurden gar nicht erst erhoben, weswegen sich die Frage nicht stellte, wer denn in den Kolonien das Steuerrecht habe, das Westminster-Parlament oder die lokalen Assemblies. Kaum zufällig wurde die Herrschaft Großbritanniens 34 I. 1763: Am Vorabend der Revolution neben dem königlichen Privy Council in erster Linie vom Board of Trade ausgeübt. Handel und Gewinnaussichten dominierten den britischen Blick auf Nordamerika und Westindien gleichermaßen, dann erst folgten geostrategische Interessen. Vor die Wahl gestellt, die Kolonien oder Hannover möglichen Feinden preiszugeben, hätte die Regierung Walpole sich allemal für die Kolonien entschieden, die deswegen ihre Verteidigung vor 1754 überwiegend selbst organisieren und finanzieren mussten. Das System Walpole war deswegen im Kriegsfall für die Amerikaner ausgesprochen problematisch, ansonsten aber kam es ihren Wünschen und Erwartungen maximal entgegen. Im Vorfeld der Amerikanischen Revolution behaupteten wohlwollende britische Whigs wie Edmund Burke und der Radikale Thomas Paine, die amerikanischen Kolonien seien faktisch schon unabhängig.11 Dies war allerdings eine Übertreibung. Bei aller offenkundigen Zurückhaltung hatte London selbst unter Walpole die Kolonien nie ganz aus den Augen verloren. In erster Linie aber verstanden sich die Kolonisten als Briten, wobei ihre genaue Rechtsstellung aufgrund des Fehlens einer koordinierten Kolonialpolitik mit klaren Regeln und Zielen unklar blieb. Die Kolonien waren zwar auf Dauer ausgerichtete Siedlungskolonien, aber niemand hatte sich vor 1760 je die Mühe gemacht, sie rechtlich und konzeptionell in ein systematisches Regelwerk einzubetten.12 Was blieb, waren fehlende Regeln, unsystematisches Handeln und ein vages Bewusstsein von Britishness. Doch nicht nur gegenüber dem Mutterland, sondern auch zwischen den Kolonien selbst existierten zahllose Differenzen. An erster Stelle standen interkoloniale Grenzkonfl ikte. Im Unterschied zu den französischen Kolonien im heutigen Kanada und im Mississippi-Delta, die vor allem dem Handel dienten, hatten die Briten Siedlungskolonien gegründet. Eine auf Dauer angelegte Landwirtschaft stand im Mittelpunkt ihres Wirtschaftssystems. Angesichts der anhaltenden Migration erforderte dies jedoch neues Land. Da allerdings die königlichen Chartas, auf denen die Existenz der Kolonien beruhte, meist von keinerlei geographischen Sachkenntnissen getrübt waren, blieb es den Kolonien im Laufe der Zeit vorbehalten, sich über Grenzverläufe zu einigen, was bis weit in die 1780er Jahre hinein zu permanenten Auseinandersetzungen führte, bei denen London dann vermittelnd eingreifen konnte. Mindestens ebenso wichtig waren soziale, wirtschaftliche und kulturelle, zum Teil auch religiöse Unterschiede zwischen den Kolonien.13 Man kann die 13 Kolonien zum Zweck der besseren Vergleichbarkeit in 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 35 drei Großräume einteilen (Neuengland, den Mittelatlantikraum und den Süden), die allerdings in sich wiederum ausdifferenziert werden müssen. Vorab gilt es jedoch einige zentrale Gemeinsamkeiten festzuhalten. Entgegen älteren Vorstellungen, nach denen sich die amerikanischen Kolonien in gesellschaftlicher Hinsicht ganz anders als das hierarchisch-traditionale Europa entwickelt hätten, nämlich egalitär, sozial homogen, mit einer ausgeprägten Dominanz eines sehr breiten, auf kleinem Landbesitz beruhenden Mittelstands, der dann entsprechende politische Teilhabe hätte einfordern können, hat die neuere Sozialgeschichte ein facettenreicheres Bild gemalt. So waren sämtliche britischen Kolonien von gestuften, fl ießend ineinander übergehenden Formen sozialer und ökonomischer Abhängigkeit gekennzeichnet. Überall, nicht nur im Süden mit seiner Sklavenhaltung, fanden sich personale, hierarchisierte Formen von Abhängigkeit, bis in die Familien hinein, wo die Familienväter gegenüber Frauen und Kindern das Sagen hatten. Dies war insofern wichtig, als die amerikanische Landwirtschaft, das Handwerk und das Kleingewerbe von Familienbetrieben beherrscht wurden, das heißt von einer mehrheitlich auf Subsistenz und das Bedienen regionaler Märkte ausgerichteten Oikos-Wirtschaft, einer typisch frühneuzeitlichen Variante des Wirtschaftslebens.14 In diese Wirtschaft des gesamten Hauses waren über die Familienmitglieder (Eltern und Kinder) im engeren Sinne hinaus auch unfreies Personal aller Hautfarben und beiderlei Geschlechts in ein gleichermaßen paternalistisches wie gelegentlich rohes und grausames patriarchalisches System integriert. Nur im puritanischen Massachusetts war beispielsweise die körperliche Züchtigung von Frauen, Kindern und Hauspersonal verboten, ansonsten war es üblich, Familienangehörige und unfreie beziehungsweise halbfreie Arbeiter ebenso zu prügeln oder auszupeitschen wie Sklaven. Tatsächlich waren nicht nur schwarze Sklaven unfrei, sondern obendrein arme Weiße, die sich als indentured servants zu einer mehrjährigen Dienstzeit als Hörige verpfl ichtet hatten, um ihre Überfahrt zu bezahlen und anschließend auf eine Landzuteilung hoffen zu dürfen. Während ihrer Dienstzeit fungierten diese Kontraktarbeiter praktisch als Äquivalent zu den Hörigen und Leibeigenen Kontinentaleuropas. Verfügte eine Familie über mehr Kinder, als zum Betrieb der Oikos-Wirtschaft notwendig waren, wurden diese an andere Familien als unfreie Beschäftigte, beispielsweise als Lehrlinge oder Dienstboten, abgegeben. In den 1760er Jahren standen 15 bis 35 Prozent der fünf bis 15 Jahre alten Kinder in derartigen abhängigen, außerfamiliären 36 I. 1763: Am Vorabend der Revolution Beschäftigungsverhältnissen. Daneben fanden sich landlose Wanderarbeiter, die saisonal von Kolonie zu Kolonie wechselten, um dort als halbfreie Lohnarbeiter ihr Auskommen zu finden. Sie fanden meist im Süden und im Mittelatlantikraum ihr Auskommen, waren aber in Neuengland höchst unwillkommen, weswegen ihre Einreise dort gesetzlich verboten war. Soziale Ungleichheit war demnach die Regel und zog politische Ungleichheit nach sich. Nur etwa 20 Prozent der freien weißen Männer waren in der Gesamtheit der Kolonien wahlberechtigt, allerdings mit großen interkolonialen Unterschieden.15 Am ehesten kann man in Neuengland, in den Kolonien Massachusetts, Connecticut, Rhode Island und New Hampshire (Vermont und Maine existierten damals noch nicht), von sozialer und ethnokultureller Homogenität sprechen. Von einigen Plantagen in Rhode Island und dem südlichen Connecticut abgesehen, gab es dort praktisch keine Sklaverei. In Massachusetts etwa waren 85 Prozent der Bevölkerung Engländer und nur 1,8 Prozent schwarze Sklaven. Neuengland und weite Teile der Mittelatlantikregion waren Gesellschaften mit Sklaven, aber im Gegensatz zum Süden keine Sklavengesellschaften. Neuengland war darüber hinaus im ländlichen Raum fast ausnahmslos von freien Kleinlandwirten (yeomen) geprägt, die eifersüchtig über ihre Unabhängigkeit und politisch-rechtliche Gleichheit wachten. Wenn es in den britischen Kolonien Nordamerikas irgendwo eine egalitäre Ideologie gab, dann in den Neuenglandkolonien. In einem Punkt konnten die yeomen Neuenglands besonders hartnäckig sein. In der Institution der town meetings verteidigten sie über das Wahlrecht hinaus ihr Recht auf politische Mitsprache. Diese Institution war den restlichen Kolonien weitgehend fremd und sorgte für eine gewisse politische Sonderstellung des Nordostens. Die yeomen lebten ausschließlich von Subsistenzwirtschaft. Ihre Produktion reichte kaum aus, um die neuenglischen Hafenstädte Boston, Salem, Providence oder Newport zu versorgen. Dies bedeutete zugleich eine gewisse Abgeschiedenheit, ohne Verbindungen zu den transatlantischen imperialen Märkten. Das ländliche Neuengland war eine karge, rückständige Region mit einem eigensinnigen, provinziellen Menschenschlag. Überdies war sie von familialen Netzwerken durchzogen. In keiner anderen Sektion von Britisch-Nordamerika fanden sich derart viele eng miteinander verflochtene Familien. Gerade in den abgelegenen Gebieten wird man Inzucht nicht ausschließen können. Vom imperialen Zentrum in London aus gesehen, war Neuengland hinterstes Hinterland. 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 37 Deutlich anders war hingegen die Situation in den nahe gelegenen Küstenstädten. Zwar pflegten auch sie die Tradition der town meetings, aber sie taten es vor dem Hintergrund stärkerer gesellschaftlicher Ungleichheit, weswegen es in den städtischen Zusammenkünften deutlich unruhiger zuging als in denen der ländlichen Regionen. Wie im Mittelatlantikgebiet hatte sich die Gesellschaft in den neuenglischen Städten funktional und nach Klassengesichtspunkten stark ausdifferenziert. Das Egalitätspathos der freien Kleinbauern musste hier hohl klingen, wurde aber in den Unterschichten weiterhin gepflegt. Sie setzten sich gegen die Machtansprüche einer klar definierten gesellschaftlichen Elite zur Wehr, an deren Spitze Kaufleute, Fernhändler, Bankiers, Schiff bauer, Juristen, der staatskirchliche kongregationalistische Klerus und das politische Umfeld des jeweiligen Gouverneurs standen. Vergleichbar mit den wenigen sklavenhaltenden Großgrundbesitzern in Connecticut und Rhode Island, pflegte diese Elite Merkmale sozialer Distinktion, man hatte beispielsweise Haussklaven oder umgab sich mit britischen Luxusgütern, britischer Architektur und Mode. Die sozialen Eliten Bostons oder Salems verstanden sich, wie die Eliten von Philadelphia und New York, von Charles Town und Savannah, als Angehörige einer imperialen und zugleich selbstbewusst kreolischen Oligarchie, deren Verwandtschaftsnetzwerke und Klientelverhältnisse sich an den Kolonien und nicht mehr am Mutterland ausrichteten. Sie teilten aber, soweit es ihnen möglich war, die Kultur, den Geschmack, die Sitten und den Standesdünkel der britischen Oligarchie und richteten sich an deren politischer Kultur aus. Allerdings fehlte der neuenglischen Elite die Erfahrung der aristokratischen Grand Tour durch die kulturellen Zentren Europas. Dies unterschied sie von den Söhnen reicher Eltern aus dem Mittelatlantikraum und dem Süden, weshalb deren Kontakt mit der britischen Elite intensiver war als derjenige der Neuengländer. Gleichzeitig war der Status der neuenglischen Eliten fragiler als der in den anderen Regionen. Teile ihres Wohlstands beruhten auf Schmuggel und konnten jederzeit von der britischen Krone konfisziert werden. Darüber hinaus fehlte es an traditionalen Strukturen, innerhalb deren die kreolische Oligarchie selbst in Krisenzeiten feste Gewissheiten und soziale Sicherheit gefunden hätte. Die Gesellschaft Neuenglands war nicht notwendig nach unten hin mobiler als die britische, aber es gab eine gefühlte Unsicherheit, Statusängste und Furcht vor aufmüpfigen Unterklassen. Das galt vor allem für Boston, eine der unruhigsten Städte des britischen Empire. Die 38 I. 1763: Am Vorabend der Revolution Rede vom unruly Boston war nachgerade sprichwörtlich. Doch soziale, politische und religiöse Unruhen fanden sich auch andernorts, etwa in New York oder den Carolinas. Die Sozialstruktur der Mittelatlantikkolonien (New York, New Jersey, Pennsylvania) war erheblich komplexer als jene Neuenglands. Dies begann schon bei ihrer ethnokulturellen und religiösen Vielfalt. Nur 30 bis 45 Prozent der Einwohner waren um 1770 Engländer, hinzu kamen Schotten, Iroschotten und Iren, Deutsche, Schweden, Niederländer und Angehörige anderer Nationen. Neben einer Mehrheit von Konfessionslosen, die sich auch in Neuengland und dem Süden fand,16 lebten hier Anglikaner, Presbyterianer, Kongregationalisten, Baptisten, niederländisch Reformierte, Quäker, Anabaptisten, Herrnhuter Pietisten und sogar Juden und Katholiken Seite an Seite. Eine derartige Diversität war sowohl in Amerika als auch in Europa eher die Ausnahme. Die großen Städte dieser Region waren so kosmopolitisch wie London, Paris oder Rotterdam, und sie waren außerdem vollständig in den transatlantischen Handel und das imperiale Marktgeschehen integriert. Zudem waren nicht nur die Städte, wo sich erste Ansätze zu industrieller Eisen- und Textilproduktion fanden, sozial ausdifferenziert, sondern zusätzlich der ländliche Raum. Neben der typischen yeomanry mit ihrer regionalen Subsistenzwirtschaft fanden sich besonders in New York und New Jersey riesige Ländereien mit semifeudalen Herrschaftsstrukturen. Im Tal des Huron River etwa siedelten einige Familien teilweise schon seit der niederländischen Kolonialzeit und verfügten dabei über gewaltige, für den imperialen Markt produzierende Gebiete. Die River Gods um die van Rensselaers, Livingstons, de Lanceys, Schuylers und Philipps traten als aristokratische Verpächter auf, die über im Grunde halbfreie Pächter (tenants) wie Feudalherren aus eigenem Recht regierten. Mitunter wohnten sie gar nicht auf ihrem Land, sondern beherrschten es von London aus als absentee owners, darin einigen der sklavenhaltenden Plantagenbesitzer des Südens vergleichbar. In den 1760er Jahren kam es zwischen den feudalen Großgrundbesitzern und Neusiedlern aus Massachusetts wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, in die auch die Pächter hineingezogen wurden. Vordergründig handelte es sich um einen Klassenkampf zwischen den wohlhabenden Eigentümern und den sozial marginalisierten. Im Hintergrund aber wurden die armen Neusiedler und die aufmüpfigen Pächter von reichen Bodenspekulanten aus Boston ausgenutzt, um das vom König in London garantierte Landmonopol der River 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 39 Gods aufzubrechen und den Boden einer intensiveren wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Bereits in diesen blutigen Revolten und Unruhen setzten die Bostoner Spekulanten den Freiheitstopos ein, um die Großgrundbesitzer ideologisch unter Druck zu setzen.17 Zusätzlich plagten die Feudalherren Zwistigkeiten mit dem Londoner Parlament. Ursprünglich hatten sie eine Art kolonialen Adel, eine landed gentry, bilden sollen, die nach englischem Vorbild für gesellschaftliche Stabilität und Treue zur Krone sorgen sollte. Allerdings gelang ihnen dies nie in der gewünschten Weise. Einzig die holländische Familie van Rensselaer mit ihrem kolossalen Landbesitz von der Größe des halben Saarlandes kam dem Ideal einigermaßen nahe. Obendrein trugen die britischen Regierungen dazu bei, die Macht der Feudalherren zu unterminieren, indem sie ihnen Schritt um Schritt die niedere Gerichtsbarkeit entzog und so ihre Stellung gegenüber den Pächtern schwächte. In Pennsylvania waren die Verhältnisse ähnlich, wobei die eigentliche soziale Elite dieser Kolonie von der religiösen Minderheit der Quäker gestellt wurde. Das sorgte beständig für Streitigkeiten zwischen dem Raum um Philadelphia, wo traditionell die Quäker das Sagen hatten, und den westlichen Distrikten, wo anglikanische Großgrundbesitzer und evangelikale yeomen untereinander, mit der Quäkerelite und mit den Indianern rangen. Der Widerwille der pazifistischen Quäker gegen gewaltsamen Raub von Indianerland verschärfte diese Konfl ikte noch. Als der Sohn William Penns, des Gründers der Society of Friends, wie die Quäker eigentlich hießen, Thomas Penn, 1751 schließlich zum Anglikanismus konvertierte, eskalierte die politische Situation in Pennsylvania zusehends. Gerade im Westen der Kolonie kam es zu wiederholten Unruhen und der wachsenden Opposition anglikanischer und presbyterianischer Neusiedler aus dem Süden gegen die Vormacht der Quäker. Dennoch gelang es den Quäkern dank eines auf sie zugeschnittenen Wahlrechts in der Kolonie, sich bis zur Revolution gegen den Eigentümer und seine Verbündeten zu behaupten. Auch in New York und New Jersey steuerten die dortigen Großgrundbesitzerdynastien die lokale Politik in ihrem Sinne. Opposition kam von den Kleinfarmern und aus den städtischen Unterschichten. Im Süden war alles anders. Zwischen dem oberen Süden mit Virginia, Maryland, Delaware und dem unteren Süden mit North Carolina, South Carolina und Georgia existierte eine klare Trennlinie. Sie wurde unterlaufen durch die Scheidelinie zwischen der küstennahen Tidewater-Region und der Mittelgebirgskette der Appalachen, dem Piedmont. 40 I. 1763: Am Vorabend der Revolution Ethnokulturell und sozialstrukturell erinnerten die Piedmont-Regionen des oberen und unteren Südens am ehesten an die Mittelatlantikkolonien und den neuenglischen Raum. Zwar lebten hier weniger Engländer, dafür aber relativ viele Iroschotten und Schotten. Die Sklaverei spielte in dieser kleinagrarischen, ebenfalls auf Subsistenzwirtschaft und regionale Märkte ausgerichteten Ökonomie18 keine herausragende Rolle. Wenn überhaupt, verfügten die Familienbetriebe der Frontierregion über höchstens ein bis zwei Sklaven. Die Siedler im Piedmont hatten neben Missernten und Krankheiten zwei grundlegende Sorgen: Zum einen lebten sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu den noch unabhängigen Indianerstämmen in beständiger Gefahr, zum anderen befürchteten sie Übergriffe der Großgrundbesitzerelite. Über die mittleren Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts war die kreolische Oligarchie nämlich damit beschäftigt, ihre Besitzansprüche immer weiter nach Westen auszudehnen und dabei das System der yeomanry durch ein semifeudales Pächtersystem nach New Yorker Vorbild abzulösen. Dabei wurden die neu erworbenen Ländereien entweder von Savannah, Charles Town, Baltimore oder gar von Großbritannien aus verwaltet. Da die Verwalter dann oft härter gegen widerständige Kleinbauern und Pächter vorgingen als anwesende Großgrundbesitzer, sorgten diese Eigentumsverhältnisse für erhebliche soziale Spannungen im Hochland. Diese wurden noch verstärkt, weil die Großgrundbesitzer rücksichtslos von ihrer Nähe zum politischen und juristischen Apparat der jeweiligen Kolonie Gebrauch machten. Sie zählten, gleichfalls wie in New York und New Jersey, zur Court Party, der durch koloniale Verwandtschaftsnetzwerke, Vetternwirtschaft, gemeinsamen Status und gemeinsame Interessen sowie Korruption zusammengehaltenen Faktion um den Gouverneur. Zusätzlich kamen religiöse Divergenzen ins Spiel. Die Iroschotten und Schotten, aber auch deutsche und andere Zuwanderer im Piedmont waren wahlweise konfessionslos, aber weder atheistisch noch antireligiös oder nonkonformistisch beziehungsweise evangelikal erweckt. Baptistische, anabaptistische und nonkonformistische presbyterianische Wanderprediger, vielfach Kleinbauern, die sich ohne weitere theologische Ausbildung selbst zu Predigern ernannt hatten und alsbald eigene Gemeinden mit einem ausgeprägt individualistischen Selbstverständnis aufgebaut hatten, bestimmten das religiöse Bild im Westen der Kolonien. Darin glichen sie erneut den westlichen Regionen des Mittelatlantikraums. Allerdings bestand im Süden ein anglikanisches Staatskirchensystem, das nonkonfor- 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 41 mistische Religiosität finanziell sanktionierte und – sogar in Maryland mit seinem relativ starken Katholikenanteil – den sonntäglichen Gottesdienstbesuch in einer anglikanischen Kirche zur Pfl icht machte, von der man sich nur durch Zahlung von Strafsteuern befreien konnte. Der Anglikanismus fand nun freilich seine soziale Stütze bei der Großgrundbesitzerelite an der Küste, wodurch soziale und religiöse Konfl iktlinien ineinander übergingen. Hinzu kam die Anwesenheit zwangsumgesiedelter Hochlandschotten, die sich in den Jakobitenunruhen der 1740er Jahre auf die Seite des Thronanwärters aus dem Hause Stuart, Bonnie Prince Charlie, gestellt hatten. Sie und die presbyterianischen Iroschotten verband ein inniger gegenseitiger Hass, da die Iroschotten prinzipielle Gegner des katholischen beziehungsweise anglikanisch-hochkirchlichen Hauses Stuart waren. In der Küstenebene des oberen Südens in Virginia und Maryland fanden sich neben den Großgrundbesitzern noch einflussreiche und politisch mächtige Relikte der älteren Freibauernschicht, der yeomanry. Die politischen Machtkämpfe spielten sich hier also zwischen den Großgrundbesitzern und der yeomanry ab, die sich von den Freibauern der frontier durch den Anbau von Gütern für überregionale und imperiale Märkte abhob. Dies verknüpfte sie wiederum mit der örtlichen Großgrundbesitzerelite, die allerdings im Gegensatz zum unteren Süden über erheblich weniger Sklaven verfügte. Fünf bis acht Sklaven galten bereits als hohe Anzahl. Eine eigentliche Plantagenwirtschaft war damit nicht zu bewerkstelligen, so dass die Großgrundbesitzer auf Pächter und Kontraktarbeiter sowie Wanderarbeiter zurückgreifen mussten, um ihre Produktion von Tabak, Reis, Indigo und anderen Gütern für den imperialen Markt aufrechtzuerhalten. Dies waren allesamt Produkte, die über längere Zeiten lager- und über weite Entfernungen transportfähig waren. Gerade in der Tabakproduktion zählten die Kolonien des oberen Südens zu den Weltmarktführern. Die Großgrundbesitzer Virginias waren kurz vor der Revolution gerade dabei, ihre Position zu festigen. Um 1770 gehörten 50 Prozent des Landes zehn Prozent weißen Eigentümern. Verglichen mit den Verhältnissen in Europa, wirkte dies gar nicht so schlimm, aber viele Siedler hatten sich von der Neuen Welt eine größere soziale Gleichheit versprochen. Diese egalitären Träume hatten sich allzu offenkundig nicht erfüllt. Gleichzeitig verfügte der obere Süden in seinen Küstenbereichen auch über einige mittelgroße Städte, allen voran Baltimore. Hier und in den 42 I. 1763: Am Vorabend der Revolution ländlichen Gebieten des südöstlichen Delaware und der angrenzenden Territorien der Kolonie Maryland lebten vergleichsweise viele Arme, die methodistischen Glaubens waren. Die radikalen und individualistischen politischen Vorstellungen der Yankee-Puritaner aus Boston waren ihnen fremd. Die Methodisten hatten sich erst kürzlich vom Anglikanismus getrennt und galten als dem Monarchen gegenüber besonders loyal. Der britische Historiker Eric Hobsbawm hat sie maßgeblich für das Ausbleiben revolutionärer Strömungen in der britischen Arbeiterschaft der 1790er Jahre verantwortlich gemacht.19 Das dürfte angesichts ihres geringen relativen Anteils an der britischen Industriearbeiterschaft einigermaßen übertrieben sein, nichtsdestoweniger bleibt die These des spezifisch methodistischen Monarchismus auch für die nordamerikanischen Kolonien, besonders für Maryland und Delaware, gültig. Die Katholiken waren im Süden deutlich in der Minderheit, meist stellten sie weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Einzig in Maryland war ihr Anteil unwesentlich höher. Dort bewegten sie sich indes bruchlos innerhalb der ländlichen und städtischen Oberklassen und unterschieden sich, soweit erkennbar, nicht vom politischen, sozialen und kulturellen Verhaltensmuster der übrigen gentry. Ganz im Gegenteil suchten sie, einen nach außen hin möglichst unauff älligen Gentleman-Katholizismus zu praktizieren.20 Dies war schon wegen des latent vorhandenen, von der großen evangelikalen Erweckungsbewegung der 1740er Jahre und Pitts patriotisch-protestantischer Kampagne der 1750er Jahre geförderten Antikatholizismus überlebenswichtig. Aber schon zuvor hatten Katholiken unter gesetzlichen Beschränkungen gelitten. Nur wenige Kolonien verzichteten ausdrücklich darauf, sie von öffentlichen Ämtern auszuschließen. Religiöse Toleranz gegenüber Katholiken war selbst im aufgeklärten 18. Jahrhundert eher die Ausnahme als die Regel.21 Dies legte der katholischen Diaspora südlich Neufrankreichs eine möglichst konformistische und unauff ällige politische Haltung nahe. Als verwundbarer Minderheit mit außerordentlich prekärer rechtlicher und kultureller Stellung, aber hohem sozialen Status lag für die Katholiken Marylands also eine grundsätzlich positive Haltung zur Revolution der elitären kreolischen Oligarchie in den 1770er Jahren nahe. Es war demnach weniger ihre religiöse Haltung – der Katholizismus war nicht zuletzt wegen der Rezeption der aristotelisch-thomistischen Lehre vom Staat und des daraus resultierenden fehlenden Widerstandsrechts alles andere als prorevolutionär –, sondern ihr eigenartiger Klassenstatus, der dazu führte, dass bis zu 79 Pro- 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 43 zent der Katholiken Marylands sich in den 1760er und 1770er Jahren gegen die britische Obrigkeit stellten.22 Hierin lag ein zentraler Unterschied zum revolutionsskeptischeren frankokanadischen Katholizismus. Gemeinsam war beiden gleichwohl die kritische Distanz zur dezidiert protestantischen britischen Monarchie. Je weiter man von Virginia aus entlang der Küste nach Süden vordrang, umso geringer wurde der Anteil der weißen Bevölkerung. Im gesamten nordamerikanischen Raum machten die Schwarzen 20 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, davon waren 96 Prozent Sklaven. Im Süden stieg der Anteil auf 40 Prozent, in South Carolina auf weit über 50 Prozent, weswegen diese Kolonie von ihrer Sozialstruktur her tatsächlich eher an Barbados und Jamaika erinnerte, zumal viele der weißen Siedler ursprünglich aus Barbados kamen. Aufs Ganze gesehen, sank der Anteil gebürtiger Engländer im unteren Süden auf 30 bis 35 Prozent, er war also noch einmal erheblich geringer als im ethnokulturell so inhomogenen Mittelatlantikraum. Entsprechend groß war hier und in Virginia die Angst vor Sklavenrevolten nach karibischem Muster, wobei diese für Virginia wegen der relativ geringen Sklavendichte auf einer Plantage eher unwahrscheinlich waren. Und weder in Virginia noch in den Carolinas kam es vor, dass – wie in Brasilien oder auf Santo Domingo, Kuba, Jamaika oder Barbados – die Krieger eines gesamten Stammes auf einer Plantage versklavt waren, was für die Sklavenhalter erhebliche Risiken in sich barg. Die Sklavenhalter des unteren Südens waren enorm wohlhabend und politisch einflussreich. Verglichen mit dem oberen Süden, fehlte in den Tidewater-Gebieten eine mächtige yeomanry. Viele freie Weiße waren hier Pächter der Großgrundbesitzer, was deren Machtstellung neuerlich befestigte. Die familiale Oikos-Wirtschaft trat hier ebenso zurück wie der politische Partizipationswille und die Teilhabemöglichkeiten der Freibauern. Aus diesem Grund wiesen diese Küstengebiete eine deutlich feudalaristokratische, auf das Empire ausgerichtete Sozialstruktur auf. Da überdies die Plantagen ausschließlich für den imperialen Markt produzierten und die Großgrundbesitzer sich Status und soziale Distinktion über den Konsum importierter britischer Luxusgüter erwarben, konnte man bis in die 1770er Jahre in London getrost von der Loyalität dieser Gebiete gegenüber dem britischen Mutterland ausgehen. Eine Sonderrolle fiel neben dem auf den westindischen Raum fi xierten South Carolina der Kronkolonie Georgia zu, und zwar weniger wegen 44 I. 1763: Am Vorabend der Revolution ihrer Sozialstruktur als vielmehr wegen ihrer einzigartigen Gründungsgeschichte. Diese war zugleich eine Geschichte des Scheiterns aufgeklärter Reformhoffnungen und der normativen Kraft des Faktischen. Ursprünglich hatte es für die Gründung Georgias im Jahre 1732 zwei gute Gründe gegeben. Einerseits sollte die Kolonie eine weitere Ausdehnung der Spanier von Florida, das erst nach dem Siebenjährigen Krieg zu Großbritannien kam, nach Norden unterbinden. Andererseits diente sie als Experimentierfeld für aufgeklärte Whig-Philanthropen aus Großbritannien. Unter ihnen ragte James Oglethorpe, ein Abgeordneter des britischen Unterhauses, hervor, der sich intensiv mit Fragen der Gefängnisreform beschäftigt hatte. Außerdem trieb ihn das Schicksal der deserving poor um, jener Armen also, die als arbeitsam, ehrsam und entsprechend förderungswürdig galten und sich damit von den angeblich faulen, triebhaften und verbrecherischen undeserving poor unterschieden. Beide Problemkreise waren miteinander verknüpft, da Armut und Schuldknechtschaft, sprich: Gefängnisaufenthalte, Hand in Hand gingen. Oglethorpe und seine gleichgesinnten Freunde wollten die Gefängnisund die Armenfrage lösen, indem sie eine Kolonie gründeten, in der ehrbare Arme als freie Kleinbauern auf eigenen, unveräußerlichen Parzellen angesiedelt wurden. Großgrundbesitz und Sklaverei waren ausdrücklich verboten. Aber bereits 17 Jahre später, 1749, musste dieses philanthropische Experiment abgebrochen werden. Die Sklaverei und die freie Verfügbarkeit über Grundeigentum wurden eingeführt. Alsbald strömten Sklavenhalter aus Westindien in die Kolonie, wodurch sie South Carolina immer ähnlicher wurde. Selbst in Georgia etablierte sich nun eine imperiale Oligarchie mit hohem gentry-Anteil und an Großbritannien ausgerichteter Elitenkultur. Neuengland hinkte in diesem Prozess deutlich hinterher, während die südliche Küstenebene, New York und New Jersey eine gewisse Vorreiterrolle innehatten. Der Historiker John G. A. Pocock hat in diesem Zusammenhang, urbane Zentren und den ländlichen Raum gleichermaßen umfassend, die These aufgestellt, es habe sich eine imperiale, bürgerlich-aristokratische Handelsoligarchie auf der ideologischen Grundlage des Republikanismus herausgebildet, die von den kolonialen Amerikanern gleichzeitig kritisch abgewehrt und beerbt wurde.23 Die koloniale Oligarchie unterschied sich jedoch von der des Mutterlandes durch eine markantere politische Partizipation der freien Kleinbauern und städtischer Unterschichten.24 Allerdings gab es durchaus Versuche, die politische und soziale Struktur der 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 45 Kolonien noch mehr an Großbritannien auszurichten. 1764 regte der sogenannte Bernard-Plan an, die Krone solle eine koloniale Aristokratie ernennen und Oberhäuser nach dem Muster des britischen House of Lords etablieren. Dies hätte in den Kolonien ein klassisches britisches Zweikammersystem geschaffen, das die gewählten Versammlungen zu echten House of Commons aufgewertet und die Kolonien zu gleichberechtigten Partnern im Empire gemacht hätte. In der Folge wäre gewiss auch eine auf die Großgrundbesitzer gestützte Tory-Fraktion entstanden. In Massachusetts, Connecticut und vor allem Rhode Island fand der Plan Sympathien unter den reformorientierten Kreisen, die die anachronistischen Royal Charters mitsamt den auf sie gestützten, fest etablierten Regierungen loswerden und diese Charterkolonien in Kronkolonien umwandeln wollten. In Pennsylvania hingegen fand der Plan kaum Unterstützer und wurde rasch fallengelassen.25 Es blieb dabei, die koloniale Oligarchie musste mit anderen politischen Strukturen arbeiten als ihr britisches Gegenstück.26 Die nordamerikanischen Kolonien zeichneten sich also in ihrer Gesamtheit durch ein außerordentlich hohes, lange unterschätztes Maß an gesellschaftlicher Komplexität und sozialer Ausdifferenzierung aus. Ja, man kann sagen, sie befanden sich weithin auf dem Weg, die britischen gesellschaftlichen Muster, inklusive Urbanisierung und Industrialisierung, mit den entsprechenden Folgen zu verinnerlichen, allenfalls mit der Ausnahme anderer, breiter aufgestellter politischer Teilhabemechanismen in Neuengland, dem Mittelatlantikraum und Virginia sowie dem Piedmont. Obendrein war die ethnokulturelle Ausdifferenzierung wegen der Migration aus ganz Europa und der Sklaverei erheblich höher als in Großbritannien. Vergleicht man die nordamerikanischen Kolonialgesellschaften mit dem zeitgenössischen frühneuzeitlichen Europa, wird man von älteren Thesen, die eine hohe soziale Homogenität mitsamt Mittelstandsbauch suggerierten, abrücken müssen. Doch damit fällt nicht das gesamte Argument von der sozialen Sonderstellung der nordamerikanischen Kolonialgesellschaften, denn in der Tat hatten sie sich traditionale alteuropäische Gleichheitsvorstellungen säkularer und radikalreformatorischer Provenienz bewahrt. Das Erbe der radikalen puritanischen und anabaptistischen, sozialrevolutionären levellers des 17. Jahrhunderts war in Nordamerika weitaus lebendiger geblieben als in Großbritannien, vom Kontinent ganz zu schweigen. Diesen altrevolutionären Zug ergänzte die konservative, rückwärtsgewandte Rede von den Rechten freier Englän- 46 I. 1763: Am Vorabend der Revolution der, die problemlos im Namen einer egalitären Ideologie instrumentalisiert werden konnte. Aber nicht allein ideell, sondern auch ganz praktisch auf der Ebene der Gesellschaftsstruktur wiesen die Kolonialgesellschaften eigenständige Züge auf. Es existierte eine regionale gentry, aber kein Geburtsadel. Der Anteil der yeomanry war immer noch relativ hoch und damit auch der Anteil potentieller Wähler in einem auf Eigentumsrechten beruhenden Wahlrecht. Bei allen Unterschieden war die relative Ungleichheit von Bodenbesitz und Eigentum in Nordamerika geringer als in Großbritannien und in Kontinentaleuropa. Die Kolonien bildeten keine Gesellschaft der Gleichen, wohl aber Gesellschaften, in denen Ungleichheit und gestufte Formen der Abhängigkeit nicht die Ausmaße wie andernorts annahmen, wenn man die Sklaverei außer Acht lässt. Diese bildete faktisch das funktionale Äquivalent zu Formen der Ungleichheit und Abhängigkeit in Alteuropa, nämlich Hörigkeit und Leibeigenschaft, wie vor allem Orlando Patterson herausgearbeitet hat.27 Gleichheitsansprüche und Gleichheitsrhetorik betrafen in erster Linie weiße Männer mit Eigentum, gleichgültig, ob es Grundstückseigentum oder Geld war, oder aber weiße Männer, die glaubten, ein Recht auf Eigentum zu haben, Pächter etwa oder Handwerkergesellen.28 Sie bildeten denn auch am ehesten das Potential für eine Sozialrevolution auf nordamerikanischem Boden und sorgten für das tief verinnerlichte Unsicherheitsempfinden der kreolischen, also genuin kolonialamerikanischen, weißen Oligarchie.29 Dabei war nicht von vornherein entschieden, ob sich diese Sozialrevolution notwendig gegen die britische Krone oder gegen die einheimischen Eliten richten würde. Denn diese Eliten waren bestrebt, die vergleichsweise durchlässigen Sozialstrukturen der Kolonien zu verdichten und zu verkrusten, um nicht zum Opfer sozialer Mobilität zu werden und das System, von dem sie profitierten, zu stabilisieren. Genau dies aber behinderte die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Teilhabehoffnungen der aufstrebenden weißen Männer aus den Unterschichten. Die 13 Festlandskolonien befanden sich um 1760 also in einem Prozess sozialen Wandels, dessen Ausgang offen war. Die Kolonien wurden wie alle nordatlantischen Gesellschaften des 18. Jahrhunderts von der Landwirtschaft beherrscht. Insofern waren sie traditionale, vormoderne Gesellschaften. 80 bis 90 Prozent der amerikanischen Bevölkerung lebten um 1760 / 70 in landwirtschaftlichen Betrieben oder in kleinen Dörfern und Städten. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts und beschleunigt seit den 1740er Jahren hatten die Kolonien 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 47 jedoch am Strukturwandel des Mutterlandes teilgenommen. Die frühe industrielle Revolution wirkte sich in Nordamerika ebenso aus wie in Großbritannien, und obwohl die Kolonien in einem merkantilistischen Handelssystem vorrangig als Rohstoffl ieferanten dienen sollten und dies auch taten, beschränkten sie sich nicht darauf. Obwohl die Briten recht offen zugaben, dass sie die Kolonien vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der eigenen Profitmaximierung betrachteten, fehlte es an einer ansonsten für Kolonien typischen Ausbeutungspraxis. Das postkoloniale theoretische Modell von imperialem Zentrum und kolonialer Peripherie versagt im britisch-amerikanischen Verhältnis des 18. Jahrhunderts. Das britische Board of Trade etwa hatte die amerikanischen Kolonien ab 1720 ermuntert, auch gegen merkantilistische Regeln in Friedenszeiten mit den französischen Westindienkolonien Handel zu treiben. Daneben existierte ein traditionell umfangreicher Handel mit den britischen Karibikkolonien, der vor allem von Rummolasse beherrscht wurde. Auf diese Weise entwickelte sich in den nordamerikanischen Städten eine wohlhabende Schicht von Kaufleuten und Händlern, die intensiv mit der Karibik, Afrika und selbstverständlich Großbritannien vernetzt waren. Es waren amerikanische Kauffahrer, die gemeinsam mit den Briten aus dem Mutterland den Atlantik beherrschten. Manchmal liefen sie der Konkurrenz aus England oder Schottland sogar den Rang ab, was zum Selbstbewusstsein der kolonialen Oligarchie erheblich beitrug. Um 1750 überholten die Festlandskolonien sogar die zuvor wesentlich bedeutenderen westindischen Plantagenkolonien des Empire und schlossen allmählich in der Wirtschaftsleistung zum Mutterland auf. Unterstützt wurde dieses nachhaltige Wachstum, das bald über Ressourcenproduktion hinaus frühindustrielle Textilmanufakturen, Schiff bau, Eisenproduktion und Ähnliches mehr umfasste, durch die massiven Migrationswellen seit 1720.30 Von 1700 bis 1770 stieg die Bevölkerung der 13 Kolonien von wenigen Hunderttausend auf über zwei Millionen Menschen, und selbst der Revolutionskrieg unterbrach diesen Zustrom nur kurzfristig. Die neuen Arbeitskräfte, denen es um Landbesitz und hohe Löhne ging (beides fand man in den Kolonien), sorgten für eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion und auch der Protoindustrie. Zwar konnten die kontinentalen Amerikaner nicht mit der außerordentlich rentablen Zuckerproduktion Westindiens mithalten, aber in der Baumwollproduktion waren sie nahezu konkurrenzlos. Zudem lieferten sie Reis und Rum, ein besonders begehrtes Getränk in jener Epoche, während Getreide und 48 I. 1763: Am Vorabend der Revolution Geldschein des Staates Virginia, 1777. Diese Banknote entsprach einem Sechstel eines spanischen Dollars. Mais für den Eigenbedarf produziert wurden. Und im Schiff bau waren die Amerikaner den Briten dicht auf der Spur. Bis in die unteren Mittelklassen hinein hatten Amerikaner ein gutes Auskommen, weswegen sie sich den Import britischer Luxus- und Industriegüter durchaus leisten konnten. Timothy Breen hatte vollkommen recht, als er die amerikanischen Kolonisten in erster Linie als Konsumenten britischer Güter beschrieb und herausstrich, wie wichtig und identitätsstiftend der eigene Wohlstand den Amerikanern war. Nicht ohne Grund befürchteten sie nach 1763 den Neid der Briten.31 So wohlhabend die Amerikaner waren, so wenig waren sie wirklich reich, denn dazu mangelte es am Geld, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Während die Habsburger und Bourbonen in den spanischen Kolonien Lateinamerikas eigene Münzprägestätten hatten einrichten lassen, fehlten diese in den britischen Kolonien. Dies führte zu einer chronisch unterkapitalisierten Wirtschaft, zum Teil sogar dazu, spanische Münzen anstelle der britischen Währung zu benutzen. Um der schlimmsten Not abzuhelfen, gaben die Kolonien eigene Papierwährungen heraus. Diese aber standen im Ruf, notorisch inflationär, mitunter regelrecht desolat zu 1. Die britischen Kolonien in Nordamerika 49 sein. Insbesondere die britischen Kaufleute und Bankiers in der Londoner City drängten angesichts dieser krisenhaften Situation die britische Regierung, die Kolonialwährungen für ungültig zu erklären, was 1751 und 1764 in den currency acts auch geschah. Die Agitation der Londoner Finanzmogule war weniger antiamerikanischen Ressentiments geschuldet – sie blieben im Verlauf der gesamten Revolution treue Freunde der amerikanischen Anliegen –, sondern schlicht der Angst, auf wertlosem Papier sitzen zu bleiben. Aus amerikanischer Warte waren die currency acts gleichwohl eine Katastrophe, da sie die Unterkapitalisierung der Wirtschaft weiter vorantrieben und die eigene Landwirtschaft und Industrieproduktion vollständig von den Krediten britischer Geldgeber abhängig machten. Umgekehrt hatte die Londoner City ein erhebliches Interesse am Florieren des amerikanischen Marktes und lenkte entsprechend hohe Investitionen in die Kolonien. Die großzügigen Kredite und Investitionen kurbelten wiederum die amerikanische Produktion und den entsprechenden Konsum an. Man darf sich die Kolonien des Jahres 1770 nicht als rückständige Provinzen am Rande eines weltumspannenden Imperiums vorstellen. Vielmehr handelte es sich um in jeder Hinsicht aufstrebende Regionen, die auf einigen Ebenen mit dem imperialen Zentrum mithalten konnten und die manche binnenimperialen Konkurrenten bereits hinter sich gelassen hatten. Die wirtschaftlichen Entwicklungen hatten eine doppelte Folge: Einerseits beförderten sie das Entstehen der bereits genannten bürgerlich-aristokratischen, transatlantischen Oligarchie, andererseits begünstigten sie aber auch das Entstehen eines spezifischen Selbstbewusstseins bei den kolonialen Eliten, das sich in einer Krisensituation gegen die britische Dominanz wenden ließ. Die Amerikaner, gleichgültig, ob sie in Boston, Philadelphia, New York oder Virginia lebten, wollten auf lange Sicht nicht mehr die zweite Geige spielen. Gleichzeitig befestigt die sozioökonomische Analyse die These von der sattelzeitlichen Ambivalenz, welche für das Umfeld der Amerikanischen Revolution so charakteristisch war. Wie in Großbritannien liefen traditionale und modernisierende Prozesse nebeneinanderher und wirkten aufeinander ein, ohne dass es zu einem echten Ausgleich, einem Äquilibrium, gekommen wäre. Dies war an sich noch keine hinreichende Basis für eine vorrevolutionäre Situation, eher eine Möglichkeitsbedingung. Je länger indes diese Instabilität anhielt, umso eher konnte es zu kleineren oder größeren Explosionen kommen. Der soziale und ökonomische Zünder war bereits am Glimmen. 50 I. 1763: Am Vorabend der Revolution Dies galt noch viel mehr auf der Identitätsebene, denn wenn etwas die Kolonien untereinander und mit dem Mutterland verband und sie zugleich vom Mutterland trennte, dann war es das Verständnis von Britishness. Niemand konnte oder wollte so recht definieren, was dieses Konzept eigentlich präzise bedeutete, es umfasste weniger eine ausgearbeitete Theorie oder eine einheitliche Idee, sondern bezog sich vornehmlich auf soziale Praktiken. Je nachdem, ob man Whig oder Tory, Aristokrat, Angehöriger der gentry, städtischer Bürger oder Bauer, ob man Engländer oder Schotte oder Amerikaner war, konnten in der kulturellen Praxis ganz andere Inhalte, Vorstellungen und Handlungen mit dem überwiegend positiven Gefühl, Brite zu sein, verbunden sein. Man wird sich auch hüten müssen, Britishness voreilig mit dem liberalen Nationalismus des 19. Jahrhunderts zu identifizieren, obwohl es spätestens seit den 1750er Jahren einen in hohem Maße glühenden gesamtbritischen Patriotismus auf beiden Seiten des Atlantiks gab. Daneben hielten sich jedoch dynastische, familiale und religiös-kulturelle Loyalitäten, die sich allesamt einem eher traditionalistischen Verständnis von Staat und Gesellschaft verdankten. Gerade die Abgrenzung gegenüber den bourbonischen, katholischen Mächten Frankreich und Spanien, die dank des Hundertjährigen Krieges mit Frankreich und den antispanischen Ressentiments aus der Epoche von Reformation und Gegenreformation bereits auf uralte Traditionen aufbauen konnte, zählte zu den zentralen Elementen von Britishness. Diese beinhaltete in aller Regel die dualistische Vorstellung, allein die Briten seien fähig und bereit, Europa und den Rest der Welt vor der Tyrannei und Despotie des katholischen Absolutismus und Obskurantismus zu bewahren. Freiheit und Protestantismus gingen in dieser Vorstellung Hand in Hand und konnten erste frühe Ansätze zu einem spezifisch angelsächsischen Rassismus beinhalten. Allerdings, so klar die Einheit zwischen Freiheit und Protestantismus war, so unklar blieb, welche Form von Protestantismus gemeint war. Anglikaner, evangelikal Erweckte,32 Presbyterianer, Puritaner, Kongregationalisten, Methodisten und Deisten oder freigeistige beziehungsweise aufgeklärt-skeptische Agnostiker rangen hier um die Definitionshoheit. Für alle war indes klar, dass der Katholizismus in keiner näheren Verbindung zur Idee der Freiheit stand. Der Freiheitsbegriff selbst blieb vage, indifferent und merkwürdig ungeklärt. Im Vordergrund stand die Tradition der «Rechte des freien Engländers». Diese meinten, breit gefasst, die Abwesenheit absolutistischer Willkürherrschaft. In bildungsbürgerlichen Schichten kam die Rezeption 2. Der Siebenjährige Krieg und seine Folgen 51 der angloschottischen Aufklärung hinzu, die, anders als die radikalere französische Aufklärung, kaum religionsfeindliche Züge aufwies und insbesondere divergierende Formen protestantischer Religiosität zu integrieren vermochte. Ebenso wichtig wie die Lektüre von Shaftesbury, Bolingbroke, Locke, Adam Smith, Frances Hutcheson und George Berkeley war die Antikenrezeption. Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts erfreuten sich die griechischen und römischen Autoren, Homer, Hesiod, Platon, Aristoteles und Cicero, einer ungebrochenen Beliebtheit und Autorität. Gerade die römische Antike galt trotz ihres Untergangs gleichermaßen in Großbritannien und Nordamerika als imperiales Vorbild, dem man nacheifern und das man übertreffen wollte.33 Je nach gesellschaftlichem Status konnten dann noch bestimmte architektonische und künstlerische Moden britische Gesinnung ausdrücken.34 Schließlich darf die Bedeutung der gemeinsamen englischen Sprache nicht vergessen werden, die in Schottland, Wales und Irland systematisch und durchaus mit Gewalt durchgesetzt wurde. Die Frage, ob Britishness inklusiv und pluralistisch oder exklusiv und monolithisch zu verstehen sei, wurde jedoch nie richtig geklärt, weswegen jeder, gleichgültig, ob Brite im Mutterland oder in den Kolonien das Konzept nach Gusto auslegen konnte. Selbst die weltanschaulichen Trennlinien unterschieden sich von Region zu Region: In Schottland wurde die Britishness vom Gegensatz Highlander gegen Lowlander beherrscht, in Irland von vielfältigen konfessionellen und sozialen Konfl ikten, in Nordamerika von rassischer Abgrenzung gegenüber Indianern und schwarzen Sklaven und in England von Klassengrenzen.35 Die Idee der Britishness einte also nicht nur diejenigen, die sich auf sie beriefen, sondern machte auch die Bruchlinien deutlich, die die imperiale Gesellschaft durchzogen. 2. Der Siebenjährige Krieg und seine Folgen 2. Der Siebenjährige Krieg und seine Folgen Der Siebenjährige Krieg intensivierte die bereits zuvor angelegten Kontroversen noch einmal. Man könnte sagen, er befeuerte die bereits glimmenden Lunten und kehrte den überwältigenden Sieg aller Briten aus dem Jahr 1763 in sein Gegenteil, eine verheerende Niederlage für das Empire, um. Dies vermochte er – eine Ironie der Geschichte – nur, weil er einen so überwältigenden Sieg der Briten gebracht hatte. Es war nicht der erste bewaffnete Konfl ikt zwischen Großbritannien und den bourboni- 52 I. 1763: Am Vorabend der Revolution schen Mächten gewesen, und in der Regel hatte Großbritannien diese Kriege im 18. Jahrhundert dank seiner überlegenen Seestreitkräfte und zuverlässiger Verbündeter auf dem europäischen Festland auch gewonnen. Aber es hatte sich zuvor durchweg um begrenzte Siege mit einem europäischen Interessenschwerpunkt gehandelt. Genau dies änderte sich im Siebenjährigen Krieg. Erstmalig kam es zu einem nahezu totalen Sieg der britischen Seite, und erstmalig rückte Nordamerika in den Mittelpunkt geostrategischen Handelns. Dies passierte nicht zufällig, ging der Krieg doch von Nordamerika aus. In Europa vergisst man gerne, dass der Siebenjährige Krieg neun Jahre gedauert hat. Er begann nämlich mit einer recht unüberlegten Nacht-und-Nebel-Aktion im Ohio-Tal im Jahr 1754. Ausgangspunkt war der Landhunger der britischen Siedler. Seitdem die englischen Kolonien gegründet worden waren, befanden sie sich in einem Machtkampf mit den älteren, bereits etablierten spanischen Kolonien in Nord- und Mittelamerika sowie den französischen Kolonien in Neufrankreich, dem heutigen Québec. Dieser spielte sich vor allem im Ohio- und im Mississippi-Tal ab und im heutigen Louisiana um New Orleans herum. In dieses Ringen wurden rasch die umliegenden Indianerstämme einbezogen. Briten, Spanier und Franzosen bauten eigene Allianzsysteme auf und integrierten die Indianer in ihre Handelsnetzwerke. Gerade der im 17. Jahrhundert so profitable Handel mit Biberpelzen wäre ohne indianische Jäger undenkbar gewesen. Umgekehrt suchten diese ihren wirtschaftlichen und militärischen Vorteil in der Kooperation mit den europäischen Mächten oder indem sie den durch die permanenten Konfl ikte entstehenden Freiraum nutzten, um eigene Interessen durchzusetzen. Die Irokesen-Konföderation im Osten und das Comanchen-Imperium im Südwesten sind klassische Beispiele für eine solche eigenständige indianische Machtpolitik.36 In diesem Zusammenhang hatte Frankreich Pfunde, mit denen es lange Zeit bestens zu wuchern verstand. Das Rechtsverhältnis zwischen dem französischen Mutterland und seinen Kolonien war deutlich klarer geregelt als zwischen England und seinen Besitzungen. Die Franzosen bevorzugten eine imperial zentralisierte Kolonialpolitik mit präzise abgegrenzten Rechten der Kolonialbevölkerung.37 Zudem handelte es sich, von Neufrankreich einmal abgesehen, bei den französischen Stützpunkten nicht primär um Siedlungskolonien, sondern um militärisch abgesicherte Handelsstützpunkte. Deswegen wurde das französische feudale Seigneuralsystem mit seinen starken Grundbesitzern (patrons), den nur halbfreien Landpäch-