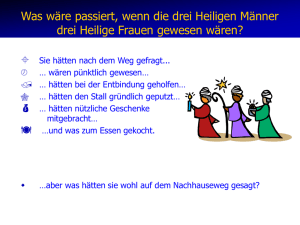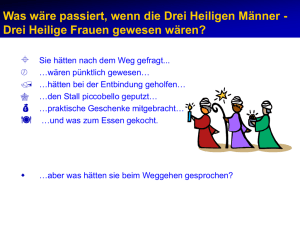Sie müssen wissen, ich bin ein Dinosaurier
Werbung
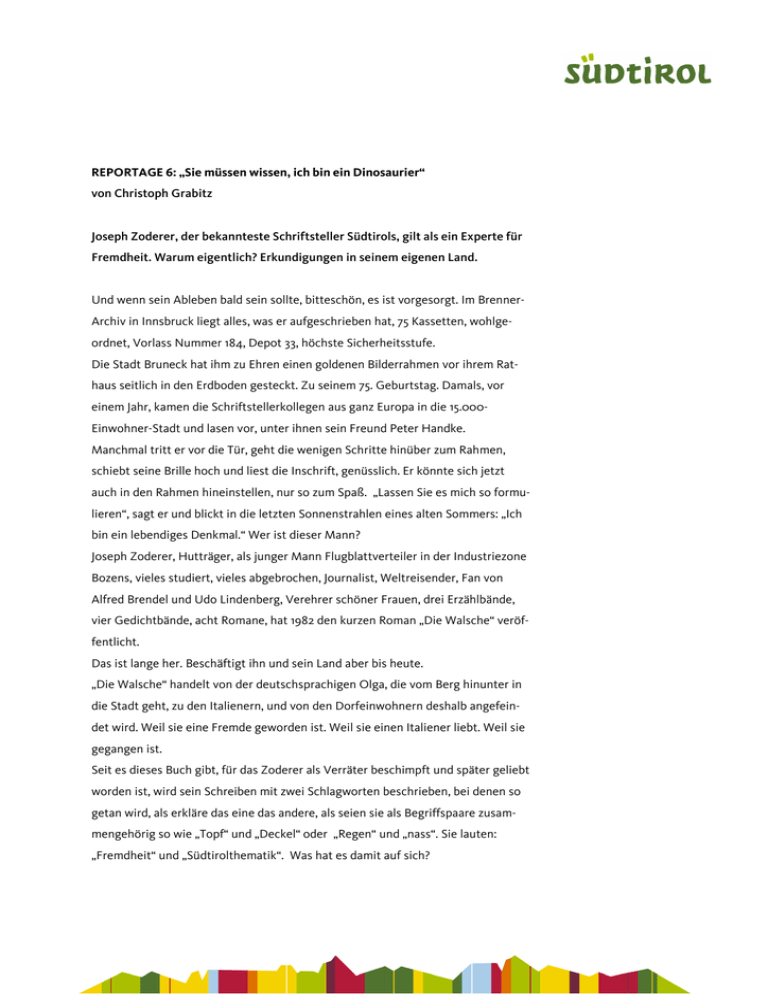
REPORTAGE 6: „Sie müssen wissen, ich bin ein Dinosaurier“ von Christoph Grabitz Joseph Zoderer, der bekannteste Schriftsteller Südtirols, gilt als ein Experte für Fremdheit. Warum eigentlich? Erkundigungen in seinem eigenen Land. Und wenn sein Ableben bald sein sollte, bitteschön, es ist vorgesorgt. Im BrennerArchiv in Innsbruck liegt alles, was er aufgeschrieben hat, 75 Kassetten, wohlgeordnet, Vorlass Nummer 184, Depot 33, höchste Sicherheitsstufe. Die Stadt Bruneck hat ihm zu Ehren einen goldenen Bilderrahmen vor ihrem Rathaus seitlich in den Erdboden gesteckt. Zu seinem 75. Geburtstag. Damals, vor einem Jahr, kamen die Schriftstellerkollegen aus ganz Europa in die 15.000Einwohner-Stadt und lasen vor, unter ihnen sein Freund Peter Handke. Manchmal tritt er vor die Tür, geht die wenigen Schritte hinüber zum Rahmen, schiebt seine Brille hoch und liest die Inschrift, genüsslich. Er könnte sich jetzt auch in den Rahmen hineinstellen, nur so zum Spaß. „Lassen Sie es mich so formulieren“, sagt er und blickt in die letzten Sonnenstrahlen eines alten Sommers: „Ich bin ein lebendiges Denkmal.“ Wer ist dieser Mann? Joseph Zoderer, Hutträger, als junger Mann Flugblattverteiler in der Industriezone Bozens, vieles studiert, vieles abgebrochen, Journalist, Weltreisender, Fan von Alfred Brendel und Udo Lindenberg, Verehrer schöner Frauen, drei Erzählbände, vier Gedichtbände, acht Romane, hat 1982 den kurzen Roman „Die Walsche“ veröffentlicht. Das ist lange her. Beschäftigt ihn und sein Land aber bis heute. „Die Walsche“ handelt von der deutschsprachigen Olga, die vom Berg hinunter in die Stadt geht, zu den Italienern, und von den Dorfeinwohnern deshalb angefeindet wird. Weil sie eine Fremde geworden ist. Weil sie einen Italiener liebt. Weil sie gegangen ist. Seit es dieses Buch gibt, für das Zoderer als Verräter beschimpft und später geliebt worden ist, wird sein Schreiben mit zwei Schlagworten beschrieben, bei denen so getan wird, als erkläre das eine das andere, als seien sie als Begriffspaare zusammengehörig so wie „Topf“ und „Deckel“ oder „Regen“ und „nass“. Sie lauten: „Fremdheit“ und „Südtirolthematik“. Was hat es damit auf sich? Die „Südtirolthematik“ ist eine komplexe Sache, das sperrige Wort kündigt es bereits an. Sie kann am Leben Joseph Zoderers erzählt und auch abgefahren werden, das haben wir vor, dazu steht ein schwarzer Mercedes-Kombi mit Münchner Kennzeichen (Zoderer: „Bischofskarosse“) vollgetankt auf dem Parkplatz für uns bereit. Aber zuvor, in einem Bistro, wenige Meter von der Moessmer-Villa entfernt, wo Zoderer die hohen Wände bis unter die Decke mit den Entwürfen für seine nächsten Romane und Kurzgeschichten behängt hat, nähern wir uns der „Südtirolthematik“ kulinarisch an: Was ist der größte Unterschied zwischen der Küche Südtirols und der Österreichs? Zoderer: „Nun, das ist die ewige Ananas oder Kirsche auf dem Fleisch, die stören mich ein bisschen, wir müssen das Südliche immer herauskehren. In Tirol gibt’s Schweinshaxen, in Bayern auch, und zwar pur, - sowas mag ich!“ Das kleine Land Südtirol. Auf den ersten Blick ein schwieriger Fall. Die nördlichste Provinz Italiens. Ungefähr so viele Einwohner wie Hannover. Ein Land, das zu Italien gehört, aber Deutsch fühlt. Und auch Italienisch. Ein Transitland, Brücke zwischen Nord und Süd, zwischen Arbeit und Urlaub. Nach oben und nach unten eine offene Membran. Joseph Zoderer sagt, das hat ihn beeinflusst. Wenn Südtirol ein Mensch wäre, der zum Psychologen gehen könnte, würde der in seinem Erstgespräch wahrscheinlich notieren: Patchwork-Familie, keine klare Zugehörigkeit, Heimat in der Mehrzahl vorhanden, dadurch aber große persönliche Vielfalt. Keine Fremdheit ohne ein Zuhause. Die erste Station, die Joseph Zoderer für diese Reise ausgesucht hat, führt zu einem ehemaligen Bergbauernhof in dem kleinen Ort Terenten im Pustertal. Der Osten des Landes, sagt Joseph Zoderer, ist streng genommen ein Norden: Enge Täler, Bauernhöfe, Nadelwald. Hier ist sein Zuhause. Joseph Zoderer sitzt im Auto am liebsten hinten rechts. Vielleicht, weil er so den größtmöglichen Abstand hat zur Technik. Er, der alles mit der Hand schreibt und eine junge Studentin dafür eingestellt hat, dass sie seine Worte abtippt, digitalisiert, verschickt, hegt einen tiefen Argwohn gegenüber Emails, Mobiltelefonen, Computern. „Ich lebe hier, ich kenne das alles“, grantelt es aus dem Fond, „also schalten Sie das Navi am besten aus, dann sind wir entspannt.“ Joseph Zoderer weiß von Menschen zu berichten, die einem Navi vertraut haben und im Rhein gelandet sind. Er sagt, er will sich in die Technik nicht mehr einarbeiten. Er will seine Zeit damit nicht mehr vergeuden. „Sie müssen wissen, ich bin ein Dinosaurier.“ Der Bergbauernhof heißt Weberhof und liegt etwas außerhalb von Terenten, die Auffahrt ist steil. Die Frau Joseph Zoderers, die Künstlerin Sandra Morello-Zoderer, hat einen Tisch mit einem weißem Tischtuch gedeckt, es gibt Schinken, Graukäse, Weißwein. Dieser alte Bergbauernhof, mit seinem wilden Blumengarten, dem Wohnhaus mit den Öfen, der urigen Küche mit der rußgeschwärzten Decke, den Wänden voller Bücher bis unter das Dach, ist das Zuhause der Familie Zoderer. Hier haben sie gelebt. Geliebt. Weihnachten gefeiert. Hier sind die Kinder aufgewachsen. Neben dem Haupthaus steht ein weiteres Haus am Hang, eine ausgebaute Scheune. Sie hat einen eigenen Eingang. Hierhin ist Joseph Zoderer gegangen um zu schreiben. Er sagt, er musste dazu weg von der Familie. Er sagt, er konnte nie ohne diese Distanz. Wer aus dem Fenster blickt, sieht kein einzige Haus, keine Straße, keinen Hinweis auf Unrast. Es ist ein Tal, das besteht aus Wald. Joseph Zoderer sagt, er ist einer, der mit der Natur in Dialog tritt. Was bedeutet ihm dieser Ausblick vom Bergbauernhof in das Tal? „Wenn ich diese Wälder sehe aus dem Fenster, dann stelle ich mir vor, dass es dort all die Zwerge und Feen und Geister und Schlümpfe noch gibt, die wir aus den Märchen kennen.“ Über einen Schriftsteller zu schreiben, ist schwer, denn so ein Text wird immer eine Welt über eine Welt in der Welt sein. Schwieriger noch im Falle Zoderer: Er gilt als Schriftsteller, dessen Werk nicht beschrieben werden kann ohne sein bewegtes Leben. Der französische Dramatiker Ionesco hat einmal gesagt: „Wir glauben Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns.“ Joseph Zoderers letzter Roman, „Die Farben der Grausamkeit“, handelt von Selma und Richard, einem glücklichen Paar, die sich einen Traum erfüllen und einen alten Bergbauernhof ausbauen. Sie zimmern und werkeln und gehen in Arbeit auf, es ist die Arbeit an ihrem Traum. Sie sind verliebt, sinnlich bis zu dem was sie essen, sie haben guten Sex, er ist Rundfunkjournalist unten in der Stadt, beide kümmern sich liebevoll um ihre zwei süßen Jungs. Paradiesisch. Doch das Problem mit dem Paradies: Immerzu fehlt irgendetwas. Das Andere ruft und lockt, es wirft seine Schatten voraus. Richard führt ein Doppelleben. Er hat eine Geliebte in der Stadt. Joseph Zoderer sagt, der Norden, der hier ein Osten ist, das ist auch der Ort der „Lederhosengeister“, eine „Erdäpfel- und Krautkopfwelt“ aus Tradition, katholischer Kirche, bäuerlichem Ritus, Häuser aus Holz und Stein, das ist eher Tirol als Italien. Joseph Zoderer sagt, das kann auch eine Enge bedeuten. Wir vollziehen den Weg, den die „Walsche“ gemacht hat, für den sie gehasst wurde von den Dorfbewohnern, der sie zu einer Fremden für sie machte, vom Bergbauernhof bewegt sich der Mercedes hinunter in die warme Ebene von Bozen. Wir fahren nach Italien. Bis zum ersten Weltkrieg gehörte Südtirol zu Österreich-Ungarn, es war ein deutschsprachiges Land. Auf der Geheimkonferenz von London 1915 hatten die Mittelmächte Großbritannien, Frankreich und Russland dem Königreich Italien den Zuschlag Südtirols als Anreiz dafür angeboten, wenn es seine Neutralität aufgeben und an ihrer Seite kämpfen würde. Südtirol wurde zur Verhandlungsmasse. Nach Kriegsende erfüllten die Sieger ihr Versprechen. Seit 1919 ist Südtirol italienisch, fühlte sich aber nicht so. Später versuchten Mussolini und Hitler auf ihre Weise klare Verhältnisse schaffen. Sie trafen ein Abkommen, wonach die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols dazu gebracht werden sollte, ihre Heimat zu verlassen und nach Nazideutschland auszuwandern. So sollten beide Seiten profitieren: Hitler, weil er deutschsprachigen Nachschub hatte für sein Projekt eines expansiven großdeutschen Reichs in Mitteleuropa. Und Mussolini, weil er sich den endgültigen Durchbruch der seit 1922 immer aggressiver Betriebenen Italianisierung Südtirols erhoffte. Die Frage, die sie nicht stellten: Kann man Heimat transplantieren? Joseph Zoderer ist vier Jahre alt als sein Vater, ein Meraner Hilfskurgärtner aus bescheidenen Verhältnissen, dem Werben Hitlers nachgibt und sich mit seiner Familie zu dem kleinen Bahnhof Meran-Untermais begibt, um seine Heimat für immer zu verlassen. Zoderer hat darüber eine Kurzgeschichte geschrieben, nüchtern und klar in der Sprache, aus den staunenden Augen des Kindes, das den älteren Bruder nach diesem Abschied befragt. Ein Satz seines Vaters, ausgerufen in Enttäuschung und Wut über seine Entscheidung, Hitlers Aufruf zu folgen, wird Joseph Zoderer sein Leben lang in den Ohren klingen: „Ich habe einen Bock geschossen.“ Joseph Zoderer hat diese Geschichte in einem Büchlein veröffentlicht, das man von der einen Seite auf Italienisch und von der anderen auf Deutsch lesen kann. In der Mitte, so sollte es für ihn sein, treffen sich die Sprachen. „Das ist“, sagt er, „mein Ideal des Ganzen, noch immer“ Zoderer verurteilt niemanden. Nicht die Deutschen, nicht die Italiener. Nicht die Verhältnisse, die dazu beitrugen, dass überwiegend Besitzlose bereit waren auszuwandern. Er erklärt seine Familie nicht zum Opfer, entlässt den Vater aber auch nicht aus der Verantwortung. Und so heißt die Geschichte denn auch nicht, wie man vielleicht denken könnte, „Abschied“ „Vertreibung“ oder „Versuchung“. Joseph Zoderer hat sie ganz schlicht genannt: „Wir gingen.“ Und auf Italienisch: „Ce n’andammo“. Bozen rückt näher und mit ihm Schanghai. Mit Schanghai beschrieben die „Lederhosengeister“ vom Berg die vielen vorwiegend von Italienern bewohnten Stadtteile Bozens. Enge Wohnungen auf wenig Raum, gedrungene Cafébars, laute Menschen auf öffentlichen Plätzen, Geknatter von Vespas und aufgebohrten Mofas. Die Antithese zum gemächlichen Leben am Berg. Fremder als Schanghai konnte ein Ort nicht sein. Als wir in die Stadt hinein fahren, werden die Straßenverhältnisse italienischer, ich schalte das Navi ein. Aus dem Fond wütende Proteste. „Ich sage Ihnen doch, brauchen wir nicht!“. Als ich mich wenige Minuten später weigere, mit dem Mietwagen über eine durchgezogene Linie zu fahren, heißt es: „Sie fahren wie ein Bundesdeutscher, werden Sie italienischer, das spart Zeit.“ In Bozen hat Joseph Zoderer bei der RAI als Rundfunkjournalist gearbeitet. Hier hat er die erste Wohnung mit seiner Frau bezogen, in einem Neubau mit Blick auf ein Weinfeld. Wenn der Bergbauernhof die Tradition ist, Fichten und Föhren, das Vertraute, dann steht Bozen für Leidenschaft, Eleganz, Genuss, Entgrenzung, man kann das in einem Wort zusammenfassen: Italien. Joseph Zoderer trägt jetzt weißes Leinen und einen weißen Hut mit schwarzem Band. Er spricht italienisch, er macht schnellere Schritte als am Berg. „Allein das Licht“, sagt er, „ist hier weich und südlich.“ Als warte hinter der nächsten Ecke ein Meeresstrand. „Reden wir endlich über Philosophie“, sagt er, „nicht bloß über die Walsche.“ Aber es ist gar nicht möglich, durch die Straßen Bozens zu gehen, ohne über die Walsche zu sprechen, denn hier hat Joseph Zoderer sie mit ihrem Freund Silvano ein Café betreiben lassen, „irgendwo hier war das, in der Nähe des Corso della Libertà, schreiben Sie bloß nicht Freiheitsstraße“, sagt er, „und übrigens, dieses Fischgeschäft hier, sie erinnern sich, auch das kommt in der Walschen vor.“ Der Spaziergang durch Schanghai macht die Konzeption von Fremdheit deutlich, die Joseph Zoderer hat. Das Fremde ist aufregend, es stimuliert uns, die Italiener auf den Straßen sind laut, sie sind aufgeregt, es gibt viele schöne Frauen. Zugleich kann die Begegnung mit dem Fremden Narben zurücklassen. Eine Narbe in der Stadt ist der „Faschistentempel“, womit das „Monumento alla Victoria“ auf dem Gerichtsplatz in Bozen bezeichnet wird, ein Triumphbogen aus Marmor, der auf Mussolinis persönliche Initiative hin hier errichtet wurde und auf der Stirnseite eine stilisierte Siegesgöttin trägt, die einen Pfeil abschießt gegen den germanischen Norden. „Von hier aus“, übersetzt Joseph Zoderer die lateinische Inschrift, „bildeten wir die Übrigen durch Sprache, Gesetze und Künste“, und fügt hinzu: „Im Angesicht des erfahrenen Leides ist das eine Unverschämtheit.“ Seit jeher ist das Denkmal zwischen Italienern und deutschsprachigen Südtirolern umstritten, nicht umsonst ist es von Videokameras und Zäunen umgeben. Die Gedenktafeln der Stadt Bozen an die Opfer des Faschismus durften laut Anweisung aus Rom nur in fünfzig Metern Entfernung vom Triumphbogen aufgestellt sein, sie messen 25 mal 25 Zentimeter. Wer sollte sich darüber wundern, dass die seit 2009 andauernde Renovierung des Denkmals aus öffentlichen Mitteln in Südtirol als Provokation bewertet wird? Joseph Zoderer sagt, es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Fremden umzugehen und auch mit den Narben der Vergangenheit. Er sagt, die Europäische Union, dieser Flickenteppich aus unterschiedlichen Sprachen und Ländern, die aber eine Einheit bilden, die ist gut für Südtirol. Er ist dafür, den Triumphbogen stehen zu lassen. „Ich bin mittlerweile für eine Historisierung dieses Denkmals, aber es bedarf der historischen Einbettung.“ Es ist ein Plädoyer dafür, die Fremdheit, auch wenn sie weh tut, zu versuchen zu umarmen. Es wird Nacht über Bozen. Joseph Zoderer sitzt im Garten des Parkhotel Laurin, umgeben von anderen zeitgenössischen Kunstwerken, mit einer extra für ihn angereisten, wie er es nennt „fraulichen Begleitung.“ Sie unterhalten sich und trinken Veneziano. Hinter dem Bahnhof von Bozen nimmt jetzt die dunkle Seite der Stadt Fahrt auf. Der Bahnhof ist in ein gelbliches Laternenlicht getaucht, das so auch in den Gassen von Neapel funzelt oder im Hafen von Ancona kurz vor der Griechenlandfähre. Gleise und Oberleitungen sind rostbraune Gestänge, von demselben Rostrot wie die Leitplanken der Brennerautobahn, Vorboten des Südens, wie verbrannte Erde, wie Terrakotta. Neben der Altkleidersammlung der Diözese Bozen-Brixen stehen die Nutten und warten auf Kundschaft, in babyblauen Alfa Romeos gleiten die Carabinieri auf Patrouille durch die Straßen, Neonröhren flackern, herrlich riecht es nach Staub. Gestern noch das Postkartenidyll der Berge, heute schon Italien, was für ein Land der Kontraste im Handtaschenformat! Vielleicht ist das der Grund, warum Joseph Zoderer zurückgekommen ist. Warum er, der das Reisen als Kind bereits erlernt hat, der in Graz aufwuchs, in der Schweiz zur Schule ging, in Wien studierte und durch die USA, Griechenland, Spanien, Mexiko reiste, zurückgekehrt ist in die Provinz. „Ständig in die Welt des anderen hinüberwechseln zu müssen, sich in den Bildern des anderen zu verlieren, sich selbst aufzugeben mit seinen eigenen Sprachbildern und Ghettos, und sich wieder zurückzuholen daraus – das war für mich der Ersatz für die Stadt“, hat er einmal gesagt, „Und für mich als Schriftsteller ist es eine gute Situation, an der Grenze zu leben.“ Im Auto zurück nach Bruneck, Joseph Zoderer sitzt jetzt vorne, das Navi wurde zum Schweigen gebracht. Aus den Lautsprecherboxen kommt Musik der deutschen Band „Element of Crime“, die für zartbittere Melancholie bekannt ist. „Ich will Deine Hand, ich will Deinen Mund, ich will Deine Zunge, ich will Deine Haare, ich will Deine Haut“, heißt es im Lied „Das alles kommt mit“, dazu fluten schleifende Trompeten, Schlagzeug, Akkordeon den Innenraum des Autos. Joseph Zoderer sagt: „So etwas mag ich, bitte drehen Sie lauter.“ Schweigend und lauschend fahren wir zurück in den Norden, der hier ein Osten ist, über die Autobahn. „Und den ganzen Kummer“, endet der Refrain, „den will ich auch.“ Die Protagonisten in den Romanen Zoderers sind auf der Suche nach einem Zuhause, doch die Fremde hat sie gerufen. Olga, die Walsche, die den Schritt vom Land in die Stadt gemacht hat, erlebt schmerzlich, dass im Bergdorf ihre Wurzeln sind, eine Zukunft aber hat sie nur in der Stadt. Sie wird immer eine Zerrissene bleiben. Und Richard, der Rundfunkjournalist aus „Die Farben der Grausamkeit“, gibt sich der magischen Anziehungskraft seiner Geliebten hin, erlebt wenige Tage des irren Glücks und wird dadurch zum Verräter. Er verliert seine Familie, das Liebste, das er hat. Heimat, so scheint es, ist für sie alle ein nur selten zu erreichender innerer Zustand. Ortseingang Bruneck, Zeit für ein Fazit. In Italien ist „Die Walsche“ so etwas wie Frischs „Homo Faber“ in Deutschland, ein Buch, das Generationen von Schülern aus der Schule kennen. Joseph Zoderer ist heute einer, den die italienische Presse gern anruft, als wäre er ein Übersetzer zwischen Nord und Süd, eine moralische Instanz. Leidenschaftlich, sagt er, habe er Berlusconi beschimpft, ohne eine strafrechtliche Konsequenz, „ich möchte fast sagen: Leider.“ Vielleicht lässt sich zu dem Schluss kommen, dass Joseph Zoderer und Südtirol etwas Paradoxes widerfahren ist: Dass ausgerechnet der Fremdheitsexperte mit dem Hut, der die Unüberbrückbarkeit des Wegs hinüber zum Anderen in seinem literarischen Werk so sehr herausgestellt hat, diesem kleinen Land beim Umgang mit Fremdheit und Vielfältigkeit geholfen hat. Joseph Zoderer nimmt den kleinen Rollkoffer und den Hutkoffer, den Filzhut trägt er, der weiße Hut ist verpackt, der Herbst kommt. Er verabschiedet sich herzlich und geht gemessenen Schrittes in ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt, in dessen Eingangsbereich der Stromzähler von „J.Zoderer“ zwischen denen von „Runggatscher, I.“ und „Ji Chang Hua“ und vielen anderen blinkt wie von Geisterhand. Hier ist was er „Schlafstube“ nennt, anderthalb Zimmer, zwei Herdplatten, Bücherregal, die Bücher auf Augenhöhe sind ausschließlich von Joseph Zoderer, der Staubsauger wickelt sich um das Tischbein, in der Ecke stehen leere Kartons. Hier wohnt er wie vorübergehend, wie auf dem Sprung, wie ein Student. „Und wissen Sie, was ich mache, wenn ich nicht schlafen kann?“, fragt er. „Dann höre ich Beethovens Klaviersonaten, gespielt von Alfred Brendel, auf genau 18 Dezibel Lautstärke, zur Not die ganze Nacht.“ KONTAKT Christoph Grabitz: [email protected]