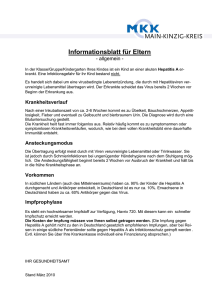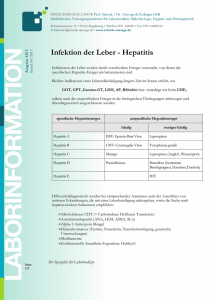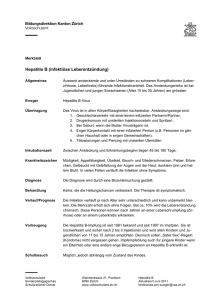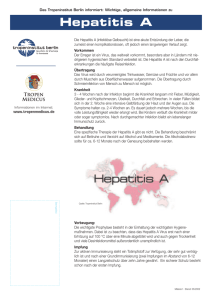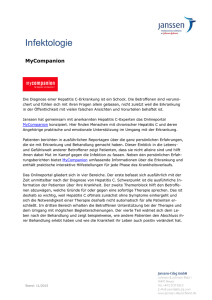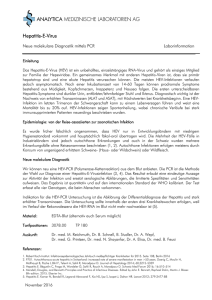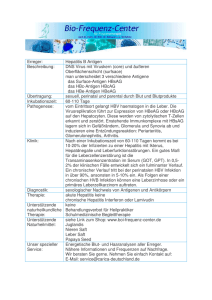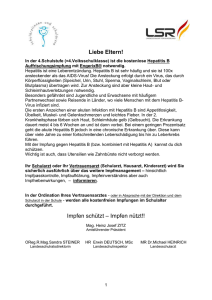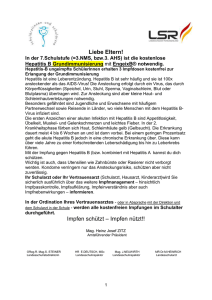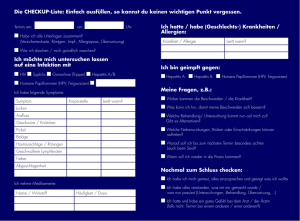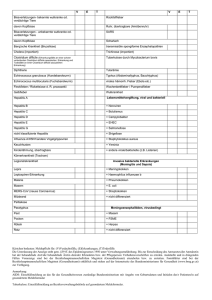Plattenbewegung mit Höchstgeschwindigkeit
Werbung

Neuö Zürcör Zäitung FORSCHUNG UND TECHNIK Mittwoch, 24. Oktober 2007 Nr. 247 B3 Mit Licht Nervenzellen steuern Plattenbewegung mit Höchstgeschwindigkeit Vielversprechender technischer Fortschritt der Neurowissenschaften Nur geringe Mächtigkeit der indischen Kontinentalplatte Ein neues System von Membranproteinen erlaubt es Hirnforschern, die Aktivität von Neuronen zeitlich und räumlich äusserst präzise zu steuern. Da man sich davon für die Zukunft einen grossen Nutzen verspricht, erheben gleich zwei Universitäten Anspruch auf ein entsprechendes Patent. Ein primäres Ziel der Hirnforschung ist es, grundlegende neuronale Prozesse wie das Wachsen und die Orientierung von Nervenzellen sowie deren Kommunikation untereinander zu verstehen, um Aufschluss sowohl über die Entwicklung und die Regeneration des Nervensystems als auch über die molekularen Vorgänge des Gedächtnisses zu erhalten. Um dies zu erreichen, stimulieren oder unterdrücken Forscher in Experimenten gezielt die Aktivität von Nervenzellen. Bis anhin war dies jedoch sowohl in der Zellkultur als auch in lebenden Organismen nur mittels implantierter Elektroden oder durch die Beigabe von sogenannten Neurotransmittern, den Botenstoffen des Zentralnervensystems, möglich. Beide Methoden weisen gewichtige Nachteile auf. So können in beiden Fällen lediglich vage definierte Gruppen von Neuronen, nicht jedoch einzelne Zellen stimuliert werden; Neurotransmitter verteilen sich zudem oft nur langsam in einem Gewebe oder in einer Zellkultur und lösen entsprechende Reaktionen deshalb mit einer gewissen Verzögerung aus. Seit kurzem existiert nun ein System, mit dem man Nervenzellen räumlich weitaus präziser und zeitlich beinahe unmittelbar aktivieren und inaktivieren kann. In neurowissenschaftlichen Kreisen spricht man von einer kleinen Revolution. Aus Algen und Archaebakterien Das System, das von einer internationalen Forschergruppe unter der Leitung von Karl Deisseroth von der Universität Stanford in Kalifornien etabliert wurde, beruht auf zwei lichtempfindlichen, in ihrer Beschaffenheit und Wirkung jedoch unterschiedlichen Membranproteinen: dem Channelrhodopsin-2 aus der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii und dem Halorhodopsin aus dem Archaebakterium Natromonas pharaonis. Über gentechnisch veränderte Viren schleusten die Forscher die Gene für diese Moleküle in Nervenzellen ein, wo die Proteine dann produziert und in die Zellhülle eingebaut wurden. Da beide Proteine nur bei Licht einer bestimmten Wellenlänge reagieren, können sie selektiv stimuliert werden: Blaues Licht mit einer Wellenlänge um 460 Nanometer aktiviert das Channelrhodopsin-2, einen Kationen-Kanal, der sich daraufhin öffnet und positiv geladene Kalzium-Ionen in die Zelle einlässt; die Zellmembran wird dadurch depolarisiert und die Nervenzelle aktiviert. Gelbes Licht mit einer Wellenlänge um 580 Nanometer wiederum regt das Halorhodopsin an, eine Chlorid-Pumpe, die daraufhin negativ geladene Chlor-Ionen ins Zellinnere befördert, dadurch die Membran hyperpolarisiert und die Nervenzellen somit inaktiviert. Mit diesem System konnten die Forscher die Aktivität der Nervenzellen ausschliesslich mit Licht und zeitlich äusserst präzise kontrollieren, ja es konnten sogar einzelne Aktionspotenziale, die charakteristischen Veränderungen der Membranspannung bei neuronaler Aktivität, beliebig an- und abgeschaltet werden. Gleichzeitig unterschieden sich die so manipulierten Zellen in Bezug auf ihr Verhalten in der Zellkultur, ihre Membranspannung und ihre Reaktion auf elektrische Stimulation nicht von normalen Neuronen, weshalb man davon ausgeht, dass sie trotz ihrer neuen Lichtempfindlichkeit unbeeinträchtigt funktionieren. Deutsche Elite-Universitäten Viel Exzellenz im Süden ces. Der in Deutschland lange verpönte Begriff der Elite erfreut sich wieder steigender Beliebtheit, und so haben Bundesregierung und Länder in einem Wettbewerb Elite-Universitäten erkoren. In der ersten Runde im Jahr 2006 wurden die Universität und die Technische Hochschule in München sowie die Technische Hochschule Karlsruhe ausgezeichnet. In der zweiten Runde sind nun die Freie Universität Berlin, die Universitäten in Göttingen, Heidelberg, Freiburg, Konstanz sowie die Technische Hochschule Aachen dazu gekommen. Allerdings ist der finanzielle Ertrag des neuen Titels mit zusätzlichen 7 bis 13 Millionen Euro für spezielle Forschungsvorhaben (inklusive Doktoranden-Kollegien und sogenannter ExzellenzCluster in Kooperation mit ausseruniversitären Forschungseinrichtungen) für jede Universität bis zum Jahr 2011 bescheiden. Insgesamt stehen in dem Zeitraum 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Ausserdem ändert der Wettbewerb nichts am gravierendsten Defizit der deutschen Universitäten: an der sukzessiven Verelendung des Lehrbetriebs infolge wachsender Studentenzahlen und eines spürbaren Abbaus der Professorenstellen. Eindrücklich demonstriert wurden die Möglichkeiten dieses Systems auch in einer Studie am Fadenwurm Caenorhabditis elegans; die Würmer waren dazu gentechnisch so verändert worden, dass ihre Muskelzellen die lichtempfindlichen Membranproteine produzierten. Durch die Stimulierung des hyperpolarisierenden Halorhodopsins konnten die Muskelzellen der Tiere vollständig gelähmt werden, was sich in einem unmittelbaren Unterbruch der typischen Schwimmbewegungen äusserte. Analog zu den Arbeiten an kultivierten Nervenzellen konnte diese Lähmung durch eine Lichtstimulierung des depolarisierenden Channelrhodopsins ebenso schnell wieder aufgehoben werden; der Wurm begann wieder zu schwimmen. Das System ermöglicht also nicht nur in vitro, sondern auch in vivo eine zeitlich sehr präzise, bidirektionale Aktivitätsregulierung eines bestimmten Zelltyps. Streit um das Patent Im Bereich der Grundlagenforschung – und dereinst vielleicht sogar in der Medizin – wird das durch Licht kontrollierbare Proteinsystem von grossem Nutzen sein. In Anbetracht dessen überrascht es kaum, dass die Rechte an diesem System äusserst begehrt sind, wie ein sich anbahnender Patentstreit beweist: Fast zeitgleich mit der «Nature»-Veröffentlichung, in der Deisseroth und sein Team vor einigen Monaten die Anwendung des Halorhodopsins vorstellten, erschien in der neuen Fachzeitschrift «PLoS One» ein in seinen Grundaussagen identischer Artikel einer Forschergruppe unter der Leitung von Edward Boyden vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Artikel in dieser Zeitschrift werden nicht «peer-reviewed» – also nicht von fachkundigen Experten evaluiert –, sondern nur von einem Editor auf die korrekte Anwendung von Techniken hin durchgesehen, was eine schnellere Veröffentlichung gewährleistet; dies lässt darauf schliessen, dass im Moment der Publikation grosser Zeitdruck herrschte. Pikanterweise war Boyden im Jahr 2005, als der Nutzen des Channelrhodopsins in Nervenzellen veröffentlicht wurde, Mitarbeiter in Deisseroths Gruppe in Stanford und Erstautor der entsprechenden Publikation. Sowohl das MIT als auch Stanford erheben mittlerweile Anspruch auf ein entsprechendes Patent. Johannes Gräff Nature Neuroscience 8, 1263–1268 (2005); Nature 446, 633–641 (2007); PLoS One 3, e299 (2007). Seismische Messungen legen nahe, dass die indische Platte unerwartet dünn ist. Dies könnte erklären, weshalb sich der heutige indische Subkontinent früher ungewöhnlich schnell auf Asien zubewegte. Seine Kollision mit der eurasischen Platte hebt noch heute den Himalaja. Vor mehr als hundert Millionen Jahren hatte sich Indien von dem damaligen Grosskontinent Gondwana abgelöst und begann, sich mit einer Geschwindigkeit von 18 bis 20 Zentimetern pro Jahr von Süden in Richtung Asien zu bewegen; die Kollision Indiens mit Asien vor etwa 50 Millionen Jahren verursachte schliesslich die Entstehung des Himalajas. Geologisch gesehen ist diese Geschwindigkeit für eine Kontinentalplatte enorm hoch. Die übrigen Krustenteile – die wir heute als Antarktis, Afrika und Australien kennen – bewegten sich laut paläomagnetischen Daten zumeist mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 4 Zentimetern pro Jahr zu ihren «momentanen» geografischen Standorten. Was Indien derart schnell machte, ist bis anhin nicht geklärt. Studien von Prakash Kumar vom National Geophysical Research Institut in Hyderabad in Indien und seinen Kollegen lassen nun aber annehmen, dass eine unerwartet geringe Mächtigkeit der indischen tektonischen Platte von nur maximal 100 Kilometern die rasche Fortbewegung ermöglichte. Eine tektonische Kontinental- oder Lithosphärenplatte – die wie ein Floss auf dem Erdmantel schwimmt – besteht aus kontinentaler Kruste und den sich ebenfalls fest und spröde verhaltenden oberen Bereichen des darunter liegenden Erdmantels. Dort, wo der Mantel beginnt, sich plastisch zu verhalten, geht die Lithosphäre in die darunter liegende sogenannte Asthenosphäre über. Dieser Grenzbereich lässt sich am Verhalten seismischer Wellen gut erkennen. Anhand der Aufzeichnung von Erdbebenwellen von rund fünfunddreissig seismischen Messstationen auf den fünf Kontinenten und im Indischen Ozean gelang es den Forschern daher, die Krustendicke der Kontinentalplatten zu berechnen. Dabei zeigte sich, dass die sich langsam bewegenden Platten zwischen 180 bis 300 Kilometer dick sind, Indien jedoch nur eine Mächtigkeit von 80 bis 100 Kilometern aufweist. Dies, obwohl Diamanten-Lagerstätten darauf hinweisen, dass auch Indien dereinst dicker gewesen sein muss. Die Diamanten müssen wegen der erforderlichen Drücke nämlich in etwa 150 Kilometern Tiefe, in den «Wurzeln» des mehr als eine Milliarde Jahre alten Krustenbereichs, gebildet worden sein. Um die Krustendicke zu messen, waren laut Rainer Kind vom Geoforschungszentrum Potsdam, einem der Autoren der Studie, Daten von Beben nötig, die sich in grosser Entfernung vom jeweiligen Seismometer ereigneten. Nur dann dringen die vom Beben verursachten Scherwellen so tief ins Erdinnere ein, dass sie relativ steil von unten die Asthenosphären- und LithosphärenGrenze passieren, bevor sie registriert werden. An diesem Grenzübergang erzeugten die Scherwellen Kompressionswellen, so Kind, die schneller seien und deshalb vor den Scherwellen registriert würden. Anhand der Differenz der Geschwindigkeiten lasse sich dann die Dicke der Lithosphäre berechnen. Eine simple Idee, meint Kind, die nicht neu sei. Da die Signale aber schwach seien, brauche es sehr empfindliche Seismometer und viele Daten sowie neue Computerprogramme zu deren Verarbeitung. Noch vor einigen Jahren hätten diese nicht zur Verfügung gestanden. Dass die Kruste derart dünn ist, könnte mit der Aufspaltung Gondwanas zusammenhängen. So gibt es die Hypothese, dass heisses Material von der Grenze zwischen Erdkern und -mantel aufgestiegen war, eine Aufwölbung und starken Vulkanismus hervorgerufen und letztlich zum Auseinanderbrechen des Kontinents geführt hatte. Diese These wird nun auch von den Forschern herangezogen. Solch hochquellendes Material könnte die Kontinentwurzeln teilweise aufgeschmolzen und somit ausgedünnt haben und damit dem leichten und schnelleren Krustenfragment zusätzlich noch einen entsprechenden «Kick» gegeben haben. Kind sagt aber auch, dass sie dazu keine Untersuchungen gemacht hätten und dies somit Vermutungen seien. Dietmar Müller von der School of Geosciences der Universität Sydney zeigt sich daher auch dieser These gegenüber skeptisch. Man wisse nun, um wie viel dünner die indische Lithosphäre gegenüber den anderen Kontinenten sei, die ehemals zu Gondwana gehörten, erklärt er – aber nicht, wann und wie es zu dieser Ausdünnung gekommen sei. Deshalb ist er auch nicht überzeugt davon, dass die dünne Kruste der Grund dafür ist, dass Indien auf seinem Weg in Richtung Asien so schnell vorankam. Simone Ulmer Nature 449, 894–897 (2007); ebenda, 795–796 (2007). Häufige Krankheiten – modern behandelt Hepatitis B und C Viruserkrankungen werden oft als «heimtückisch» bezeichnet – einer von vielen Belegen dafür, dass das menschliche Krankheitsverständnis bis tief in die Fachliteratur hinein von Metaphern geprägt ist. Im Fall der virusbedingten Leberentzündungen Hepatitis B und C ist dieses Attribut durchaus nachvollziehbar. Charakteristisch für beide Hepatitis-Arten ist, dass Betroffene von ihnen unter Umständen jahrzehntelang nichts spüren, bis sie eines Tages mit möglichen dramatischen Spätfolgen konfrontiert werden. Es soll deshalb gleich gesagt werden, dass gegen Hepatitis B eine wirksame und sichere Impfung zur Verfügung steht. Dagegen ist eine Impfung gegen Hepatitis C nach wie vor nicht absehbar. Unterschiedliche Übertragungswege Die verschiedenen Familien angehörenden Hepatitis-B- und -C-Viren (HBV bzw. HCV) gelangen durch Blut und Körperflüssigkeiten in den Organismus. Im Fall der Hepatitis C erfolgt die Infektion in der Regel durch kontaminiertes Blut, häufig in Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung von Fixernadeln und anderem Drogenbesteck, darunter auch «Sniffer-Röhrchen» von Kokainkonsumenten. Selten kommt es zur Übertragung des Hepatitis-C-Virus beim Geschlechtsverkehr oder – meist während des Geburtsvorgangs – von der Schwangeren auf ihr Kind. Anders sieht die Situation beim Hepatitis-B-Virus aus, für dessen Übertragung alle Wege relevant sind. Die Hepatitisviren schädigen die Leber, in denen sie gute Bedingungen für ihre Vermehrung vorfinden, nicht direkt. Das Immunsystem identifiziert die Eindringlinge indessen als «fremd» und setzt eine Abwehrreaktion in Gang, in deren Verlauf die infizierten Zellen inklusive Viren zerstört werden. Die frühe Phase der Immunantwort verläuft häufig «stumm» und damit unbemerkt, oder aber es zeigen sich Symptome wie Gelbsucht, ausgeprägte Müdigkeit, dunkler Urin und Verdauungsbeschwerden – Zeichen allerdings, die nicht spezifisch für eine virale Hepatitis sind. Die akute Form der Hepatitis B und C klingt spontan innert weniger als sechs Monaten ab, was gleichbedeutend ist mit Ausheilung oder dem Übergang in ein chronisches Stadium. Sehr selten kommt es zu einem rasch tödlichen Verlauf. Viren verursachten, aber «fäkal-oral» übertragenen Hepatitisformen A und E, die nie chronisch werden. Im Falle der Hepatitis C ist der natürliche Krankheitsverlauf durch eine Chronifizierungsrate von 70 bis 80 Prozent gekennzeichnet. Die grösste Risikogruppe in der Schweiz sind Drogenabhängige, die nach wie vor zu selten getestet und behandelt werden. Für die Hepatitis B gilt die Regel: je jünger der Infizierte, desto häufiger der chronische Verlauf. Beträgt die entsprechende Rate bei Neugeborenen rund 90 Prozent, so sinkt sie bei älteren Kindern deutlich ab und bewegt sich bei Jugendlichen und Erwachsenen noch im Bereich von 5 bis 10 Prozent. Gefürchtete, in der Regel zwei bis drei Jahrzehnte nach Ansteckung auftretende Spätfolgen der chronischen Hepatitis B und C sind die Leberzirrhose (eine mit Schrumpfung verbundene Degeneration des Lebergewebes) und der Leberkrebs. Von der Zirrhose sind je nach Quelle 10 bis 20 Prozent der Patienten mit Hepatitis C betroffen; für die Hepatitis B liegt dieser Prozentsatz sogar noch höher. Leberkrebs, der eine sehr Medizin-Serie ni. Die Beiträge dieser Serie sollen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte einer Krankheit geben. Ein Schwerpunkt liegt auf den Behandlungsmöglichkeiten, wie sie die wissenschaftliche Medizin («Schulmedizin») derzeit empfiehlt. Da bei jeder Beurteilung stets auch patientenspezifische Faktoren berücksichtigt werden müssen, können und sollen diese Beiträge das Gespräch mit dem eigenen Arzt nicht ersetzen. Bereits erschienene Artikel finden sich auf NZZ Online (www.nzz.ch). schlechte Prognose hat, tritt als Folge einer Zirrhose in 1 bis 10 Prozent der Fälle auf. In sehr frühen Stadien kann versucht werden, mittels operativer Entfernung des Tumors oder einer Lebertransplantation – auch bei Leberzirrhose eine Möglichkeit – eine Heilung zu erreichen. Vor dem Auftreten dieser Spätfolgen ist eine medikamentöse Behandlung möglich. Abhängig vom Virus-Subtyp liegt die Erfolgsquote bei der Hepatitis C zwischen 50 und 90 Prozent, bei der Hepatitis B bei 25 bis 40 Prozent. Allerdings ist der Begriff der Heilung in Anführungszeichen zu setzen, da nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob das Virus vollständig aus dem Organismus eliminiert ist oder sich lediglich nicht mehr nachweisen lässt. Die Behandlung sollte von erfahrenen Ärzten durchgeführt werden. Denn nicht jede chronische Virus-Hepatitis muss therapiert werden, aber es ist wichtig zu erkennen, wann eine Behandlung angezeigt ist. Bei der Hepatitis C kann diese schon im Akutstadium einsetzen. Die Behandlung dauert bei der Hepatitis C zwischen 6 und 12 Monaten, bei der Hepatitis B in vielen Fällen über Jahre. Standard ist bei chronischer Hepatitis C gegenwärtig die kombinierte Anwendung von sogenannt pegyliertem Interferon, das als Spritze unter die Haut verabreicht wird, und dem in Tablettenform eingenommenen Ribavirin. Interferon wird auch bei chronischer Hepatitis B eingesetzt. Daneben stehen gegen HBV weitere antivirale Medikamente zur Verfügung, mit denen jedoch lediglich eine Unterdrückung der Virusvermehrung zu erreichen ist. Ein Grund mehr, die Bedeutung der Hepatitis-B-Impfung für Risikogruppen zu unterstreichen. Bruno Kesseli Der Autor ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und Chefredaktor der «Schweizerischen Ärztezeitung». Anzeige Chronischer Verlauf als Problem Die chronische Verlaufsform der beiden Krankheiten ist häufig und weltweit ein schwerwiegendes Problem. In diesem Punkt sowie bezüglich des Ansteckungsmodus unterscheiden sich Hepatitis B und C grundlegend von den ebenfalls durch 4PGUXBSFMÏTVOHFO 1SPEVLUJOOPWBUJPO 'SPN#SBJOUP.BSLFU XXX[VFIMLFDPN