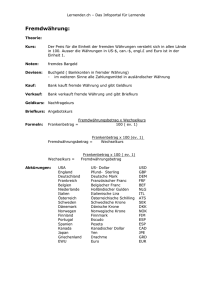Wenn der Peso purzelt
Werbung

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung Wenn der Pp eso Die Auswirkungen des internationalen Währungssystems für die Entwicklungsländer Von Philipp Hersel und Daniel Craffonara urzel t Wenn der Peso purzelt Die Auswirkungen des internationalen Währungssystems für die Entwicklungsländer – Berlin 2006 Herausgegeben von: Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung e.V. (BLUE 21) Gneisenaustraße 2a D-10961 Berlin Fon: +49-(0)30-694 61 01 Fax: +49-(0)30-692 65 90 eMail: [email protected] Internet: http://www.blue21.de Redaktion: Philipp Hersel Autoren: Philipp Hersel und Daniel Craffonara Verlag: FDCL-Verlag, Berlin Layout: Druck: Mathias Hohmann, Berlin agit Druck, Berlin Diese Publikation wurde gefördert mit Mitteln der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Die Verantwortung für die hier vertretenen Positionen liegt ausschließlich bei den Autoren. Titelbild: rien ne va plus von tourist (photocase.com) ISBN-10: 3-923020-36-8 ISBN-13: 978-3-923020-36-2 Diese Publikation wurde gefördert von Inwent gGmbH mit Mitteln des BMZ. Inhaltsverzeichnis Einleitung - Wieso ist das internationale Währungssystem wichtig für Entwicklung im Süden?.......2 Kapitel 1 – Welche Rolle spielen Wechselkurse für die wirtschaftliche Entwicklung?...........................4 1.1 Die Entstehung des Geldes 1.2 Was ist ein Währungssystem und wozu braucht man es? 1.3 Die Folgen für Entwicklung 4 5 7 Kapitel 2 – Die Entwicklung des Weltwährungssystems................................................................................11 2.1 Der erste Goldstandard bis 1914 2.2 Der zweite Goldstandard der Zwischenkriegszeit 2.3 Das Weltwährungssystem von Bretton Woods 2.4 Von 1973 bis heute: Ein flexibles Wechselkurssystem 11 12 13 14 Kapitel 3 – Das System des Währungshandels – Die Rolle von Banken, institutionellen Investoren und transnationalen Konzernen............................17 3.1 Der Währungsmarkt (Devisenmarkt) 17 3.1.1 Orte, Akteure und Instrumente des Währungshandels 3.1.2 Die Währungsspekulation 20 21 Kapitel 4 – Möglichkeiten und Grenzen einseitiger Wechselkurspolitik...................................................24 4.1 Formen von Wechselkurssystemen 24 4.1.1 Feste Wechselkurssysteme 4.1.2 Intermediäre Regime 4.1.3 Flexible Wechselkurssysteme 24 26 28 4.2. Die Währungspolitik des IWF 28 4.2.1 Der IWF als Anwalt der Extremlösungen 4.2.2 Einfluss auf die Währungspolitik 28 31 Kapitel 5 – Alternativen: Multilaterale Währungszusammenarbeit statt Währungskonkurrenz......32 5.1 Zielzonen 5.2 Langfristige statt kurzfristige Kreditvergabe 5.3 Tobin-Steuer 5.4 Spahn-Steuer 5.5 Die Clearing Union von Keynes 32 32 33 33 33 Abbildungen und Boxen Literatur.......................................................................................................................................................................35 Box 1: Tabelle 1: Abbildung 1: Box 2: Box 3: Abbildung 2: Tabelle 2: Box 4: Box 5: Abbildung 3: Box 6: Box 7: Box 8: Abbildung 4: Box 9: Verschuldung und Wechselkurs am Beispiel Deutsche Bank und Embraer Renditen für Anlagen in brasilianischer Währung R$ Außenwertentwicklung der D-Mark (1970 - 1975) Was ist ein Termingeschäft? Was ist Spekulation? Regionalstruktur der Weltwährungsreserven Die weltweit 10 größten Banken im Devisenhandel Das Market Maker Prinzip Wie funktioniert ein Währungsgeschäft? Kontinuum der Wechselkursregime Länderbeispiel Currency Board: Argentinien Länderbeispiel Adjustable Peg: Thailand Länderbeispiel Flexibler Wechselkurs: Südafrika Wechselkursverlauf des südafrikanischen Rand (1994-2006) Der Internationale Währungsfonds 8 9 15 17 18 18 20 21 22 24 25 27 29 29 30 1 Wenn der Peso purzelt Einleitung 2 Am 2. Juli 1997 begann in Thailand die sogenannte Asienkrise. Sie begann damit, dass Investoren, ausländische und thailändische, innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel Kapital aus Thailand ins Ausland verbrachten, weil sie eine Wirtschaftskrise in Thailand befürchteten. Investoren und Banken tauschten ihr Geld von der thailändischen Währung Bath in USDollar und Euro um, um es außer Landes zu bringen. Bath war nicht mehr gefragt und die Nachfrage nach Euro und Dollar stieg dramatisch. Das Ergebnis war ein dramatischer Verfall des Bath: er verlor bis zum Januar 1998 über 50 Prozent seines Wertes, der Wechselkurs war auf die Hälfte gefallen. Dieser Prozess setzte eine ökonomische Kettenreaktion in Gang: Wenn eine thailändische Bank im Ausland Geld geliehen hatte (und das hatten viele getan), musste sie Zinsen und Tilgungen in der Regel in Dollar und Euro bezahlen. Die von ihr in Thailand erwirtschafteten Bath waren nun aber nur noch die Hälfte wert, die Auslandsverschuldung Thailands hatte sich also, in Bath gemessen, verdoppelt. Das brachte viele Banken und sonstige Schuldner ganz schnell an den Rand des Bankrotts. Um ihre Kredite bezahlen zu können, versuchten die Banken versuchten, ihre ausstehenden Kredite bei thailän- dischen Unternehmen einzutreiben. Damit wurden auch viele Unternehmen zahlungsunfähig. Diese wiederum entließen ihre Angestellten und so verdreifachte sich die Arbeitslosigkeit in Thailand innerhalb weniger Monate. Die betroffene Bevölkerung kam zudem kaum an ihre Ersparnisse auf der Bank (wenn sie denn welche hatte), denn die Banken standen ja vor dem Zusammenbruch. Das Bruttosozialprodukt schrumpfte 1998 um 8 Prozent, die Armut nahm um 77 Prozent zu (Huffschmid 1999: 162, 165). Um einen Totalkollaps des thailändischen Bankensystems zu verhindern, übernahm die thailändische Regierung einen großen Teil der ausländischen Schulden. Die Auslandschulden des Staates von knapp 17 Mrd. US$ 1996 haben sich dadurch bis 1999 auf über 31 Mrd. US$ fast verdoppelt (Weltbank 2002). Dennoch brachen viele Banken und Unternehmen zusammen, wurden zerschlagen, entließen ihre Belegschaft und wurden im Laufe der Krise billig an ausländische Investoren verscherbelt. Dem Staat fehlte wegen der Wirtschaftskrise und der gestiegenen Schuldenbelastung gleichzeitig das Geld, die Krise abzumildern und die dramatisch zunehmende Armut zu lindern. Wie Thailand erging es 1997 auch Südkorea, Malaysia und Indonesien. Mexiko war von einer ähnlichen Finanzkrise, der sogenannten „TequilaKrise“, schon 1994 erschüttert worden. Brasilien, Russland, die Türkei und Argentinien folgten seit 1999 mit Währungs- und Finanzkrisen, die zum Teil ähnliche Abläufe und Folgen hatten. Das Beispiel Thailand veranschaulicht eindrücklich, wie beginnend mit einer Währungskrise, eine ganze Volkswirtschaft in einen Abwärtsstrudel geraten kann. Viele Entwicklungserfolge der Krisenländer wurden damals in nur kurzer Zeit zerstört und viele Länder, v.a. Indonesien, Brasilien und Argentinien, leiden bis heute an den Spätfolgen der Finanzkrisen. Zwar wiesen viele Kennzahlen der Krisenländer schon bald nach der Krise Zeichen von Erholung auf. Ein wieder deutlich steigendes Wachstum oder ein Abbau der Staatsverschuldung sagen aber noch nichts darüber aus, ob die Opfer der Krise, z.B. die Verarmten und erwerbslos Gewordenen, auch diejenigen sind, die „in den Genuss“ der Erholung kommen. Häufig gehen Wirtschaftskrisen mit Umverteilungsprozesse im großen Stile einher. Dabei hat es historisch nicht unbedingt immer nur die Ärmsten getroffen. Bei Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 haben nicht nur Millionen ihre Arbeit, sondern auch viele Millionäre ihr Vermögen verloren. Aber die Reichen wurden sehr ungleich getroffen. Große Börsentycoone gingen Pleite, die Immobilienbarone hingegen kamen sehr glimpflich davon. Traurigerweise festzustellen bleibt aber, dass die unteren Einkommensschichten, sofern sie sich nichtals KleinbäuerInnen selbst versorgen, meist am härtesten von Wirtschaftskrisen getroffen wurden. Die vorliegende Broschüre will aber über akute Währungskrisen hinaus den Blick auf noch etwas anderes richten: Wie wirkt sich das internationale Währungssystem im Alltag auch ohne akute Währungskrisen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Länder des Südens aus? Sind es nur die Momente der Krisen, die Entwicklungsländern zu schaffen machen oder ist auch der „alltägliche Normalzustand“ des Weltwährungssystems ein Problem für Entwicklung? Warum haben Entwicklungsländer meist schwache Währungen und warum bestimmen die Industrieländer die globale Zinspolitik? Auf diese und ähnliche Fragen versucht die Broschüre verständliche und handlungsorientierte Antworten zu geben. Daher darf nach einer Darstellung der ökonomischen Zusammenhänge, einem Abriss der Währungsgeschichte und einer Bestandsaufnahme der heutigen Akteure und Institutionen am Schluss der Ausblick auf Alternativen natürlich nicht fehlen. 3 Wenn der Peso purzelt Kapitel 1 Welche Rolle spielen Wechselkurse für die wirtschaftliche Entwicklung? 1.1 Die Entstehung des Geldes I 4 n der historischen Entwicklung hat sich Geld schon sehr bald aus dem Handel mit Waren entwickelt. Sobald Menschen anfingen, Güter untereinander zu tauschen (z.B. Vieh gegen Getreide oder Werkzeuge), stellte es sich als sehr praktisch heraus, den Tausch zweier Waren über eine zusätzliche dritte Ware als Vermittlungsinstrument abzuwickeln. Als Vermittlungsinstrument etablierten sich dabei solche Güter, die besonders wertvoll und physisch robust waren. Die Kriterien erfüllten z.B. Edelmetalle wie Gold, Silber etc., Naturprodukte wie Perlen oder Kauri-Muscheln, und bisweilen kultische Gegenstände oder Schmuckstücke. Hatte ein Stück Vieh den gleichen Tauschwert wie z.B. 100 kg Getreide und war der Tauschwert von 100 kg Getreide gleich dem Wert von 10 Gramm Gold, dann konnte ein Viehbesitzer sein Stück Vieh für 10 Gramm Gold verkaufen, für 5 Gramm Gold 50 kg Getreide kaufen und die restlichen 5 Gramm Gold für andere Käufe zu einem späteren Zeitpunkt aufbewahren. Mit diesem Beispiel sind die drei grundlegenden Geldfunktionen beschrieben. 1. Zahlungsmittelfunktion: Geld wird benutzt, um beim Kauf von Waren zu bezahlen. Wie man Gold (als Goldstaub oder keine Goldstückchen) in beliebige Mengen teilen konnte, so kann man heute durch die Stückelung von Münzen und Geldscheinen jeden beliebigen Wert beim Kauf übertragen. 2. Die Recheneinheit: Gleichzeitig wird der Tauschwert der Güter in einer einheitlichen Recheneinheit (z.B. in Gramm Gold oder Cents und Euro) ausgedrückt und der Wert der Güter wird dadurch leicht vergleichbar. 3. Die Wertaufbewahrungsfunktion: Man kann den Wert von Gütern in Form von Geld aufbewahren, z.B. wenn man heute etwas verkauft, man für den erhaltenen Gegenwert aber erst zu einem späteren Zeitpunkt etwas anderes kaufen will. Durch diese Funktionen hat Geld eine wichtige Rolle bei der Herausbildung der Arbeitsteilung gespielt. Von der Subsistenzwirtschaft, wo jeder die individuell benötigten Güter für sich selbst herstellt, wurde dadurch der Übergang zu einer Marktgesellschaft vorangetrieben, wo man statt dessen solche Güter herstellt, deren Verkauf auf dem Markt einträglich erscheint (z.B. gebrautes Bier) und für deren Erlöse man sich die notwendigen Zutaten (z.B. Getreide, Hopfen, Malz) und die Mittel zum eigenen Leben („Lebensmittel“) kaufen kann. Geld im Sinne des uns heute vertrauten Bargelds hat sich dabei erst relativ spät entwickelt. Es begann damit, dass nicht mehr nur ein physische Element, z.B. Gold, als Geld funktionierte, sondern dass einzelne HerrscherInnen in ihrem Einflussbereich Münzen aus diesem Material prägten. Die Münze drückte mit ihrer Prägung einerseits aus, dass sie eine bestimmte Menge Gold enthielt und so einen fest bestimmten Wert hatte. Man konnte sich also das Abwiegen sparen. Andererseits waren Münzen auch immer Ausdruck politischer Macht, denn sie wurden nur im jeweiligen Einflussgebiet der entsprechenden Herrschaft akzeptiert. Anders ausgedrückt: Die Einflusssphäre des römischen Reiches ließ sich z.B. als das Territorium definieren, wo Münzen des römischen Kaisers als Geld akzeptiert wurden. Dieser Gedanken lässt sich auch durchaus heute aufrechterhalten: Der Einflussbereich der USA und Europas endet nicht an ihren Ländergrenzen, sondern da, wo man mit Dollar und Euro bezahlen kann. Umgekehrt drückt sich die sehr viel begrenztere Macht Tansanias oder Guatemalas nicht zuletzt darin aus, dass man außerhalb von Tansania und Guatemala mit tansanischen Schillingen und guatemaltekischen Quetzal praktisch nichts kaufen kann. Und selbst innerhalb dieser Länder ist man mit Dollar und Euro oft sehr viel besser dran als mit der landeseigenen Währung. Geld ist offensichtlich ein extrem politisches Phänomen. Im vorgenannten Sinne drückt der beliebte Ausspruch „Geld ist Macht“ nicht nur aus, dass derjenige, der Geld hat, auch Macht hat. Noch viel mehr Macht hat derjenige, der Geld macht. Heute liegt das Recht, Geld herzustellen, bei nationalen Zentralbanken. Diese tragen, auch und gerade in parlamentarisch-repräsentativen Demokratien das Attribut „unabhängig“, d.h. sie sind der direkten Kontrolle und Einflussnahme von Parlament und Regierung entzogen. Sie sind zwar in ihren Statuten bestimmten politischen Zielen unterworfen, wie z.B. dem Primat der Geldwertstabilität im Fall der Deutschen Bundesbank bzw. der Europäischen Zentralbank, oder einer Kombination aus Geldwertstabilität und andern gesamtwirtschaftlichen Zielen wie Wachstum und Beschäftigung im Fall der Federal Reserve, der US-Zentralbank. Letztlich obliegt es damit den Zentralbankern (und nicht den nationalen Finanzministerien), die aus ihrer Sicht „richtige“ Geld- und Währungspolitik zu betreiben. Bevor Banknoten von Zentralbanken gedruckt wurden, gab es eine Phase des Gelddrucks durch private Banken. Banknoten sind in der Renaissance als Papiere entstanden, in denen private Banken versichern, dass sie gegen Vorlage dieses Papier vom Konto eines bestimmten Kunden einen bestimmten Betrag in Gold auszahlen, also quasi ein Barscheck. Dieser Kunde konnte dann, statt entsprechende Mengen Gold mit sich führen zu müssen, mit dieser Bescheinigung der Bank bezahlen. Im Laufe der Zeit entkoppelten sich diese Papiere von konkreten Kunden und die Verpflichtung, gegen Vorlage des Papiers Gold auszuzahlen, bezog sich nur noch auf die Bank selbst. Diese „Banknoten“ wurden dadurch ein allgemeines Zahlungsmittel und erhielten Geldfunktion. Wenn die Banken davon ausgehen konnten, dass ein bestimmter Anteil ihrer Banknoten als Zahlungsmittel im Umlauf blieb und nicht direkt wieder bei ihnen eingelöst wurden, dann konnten sie in diesem Umfang mehr Banknoten ausgeben, als sie an Goldreserven in der Bank hatten. Die Banken, die „Banknoten“ ausgaben, konnten auf diesem Wege zusätzliches Geld schaffen. Diese Möglichkeit bot natürlich auch Gelegenheit zum Missbrauch und gelegentlich brachen Banken zusammen, wenn sie es mit der Ausgaben von Banknoten übertrieben hatten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Missbrauchsmöglichkeiten wurde die Aufgabe, Banknoten auszugeben, in Laufe der Jahrhunderte auf staatliche Zentralbanken übertragen. Bis ins 20. Jahrhundert waren die Banknoten der Zentralbanken, ähnlich wie zuvor die Banknoten privater Banken, mit Edelmetallbeständen unterlegt, d.h. es bestand z.B. eine Goldeinlösegarantie für die umlaufenden Geldscheine. Die Goldeinlösegarantie des US-Dollars wurde z.B. erst 1971 aufgehoben (siehe dazu auch das Kapitel 2). 1.2 Was ist ein Währungssystem und wozu braucht man es? Wenn man der Einfachheit halber zunächst davon ausgeht, dass der Geltungsbereich eines nationalen Geldes (z.B. des polnischen Zloty) auf das Gebiet des entsprechenden Nationalstaats begrenzt ist (z.B. von Polen), bedarf es bei grenzüberschreitenden Transaktionen einer Möglichkeit, die nationalen Gelder, d.h. Währungen, zueinander ins Verhältnis setzen zu können. Das Verhältnis, wie sich die Werte zweier Währungen zueinander verhalten, ist der Wechselkurs. Der Wechselkurs kann entweder in der Mengen- oder in der Preisnotierung ausgedrückt werden. Bei der in den USA und Europa üblichen Mengennotierung gibt der Wechselkurs die Menge ausländischer Währungseinheiten an, die man für eine inländische Währungseinheit erhält (1 € = xy US$). Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar in der Mengennotierung lag 2006 durchschnittlich bei ca. 1,26. Bei der Preisnotierung wird der Wechselkurs als Preis für eine Einheit ausländischer Währung (xy € = 1 US$) ausgedrückt. In der Preisnotierung lag der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar in 2006 also durchschnittlich bei ca. 0,80. Da sich historisch in angrenzenden Gebieten häufig ähnliche Geldformen entwickelt haben (z.B. Goldoder Silbermünzen), konnten nationale Goldmünzen über ihren Goldgehalt zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Sobald sich aber der Wert des physischen Geldmaterials (z.B. bei Geldscheinen) nicht mehr als Vergleichsmaßstab nutzen lässt, müssen andere Maßstäbe her. Hierfür gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Ein nachvollziehbarer Maßstab ist die sogenannte Kaufkraftparität. Dabei geht man davon aus, dass der Wechselkurs die unterschiedliche Kaufkraft zweier Währungen ausgleicht. Wenn ein Pfund Butter in Polen 5 Zloty kostet und in Tschechien 30 tschechische Kronen, dann ist das Kaufkraftverhältnis zwischen Zloty und Krone 5 zu 30 bzw. 1 zu 6. Der Wechselkurs des Zloty zur Krone sollte also im Sinne der Kaukraftparität 6 (in der Mengennotierung) bzw. 1/6 (in der Preisnotierung) sein. Natürlich kann es z.B. sein, dass die Herstellung von Butter in Tschechien objektiv billiger ist als in Polen (z.B. wenn in Tschechien die Viehweiden fruchtbarer oder die Produktivität der Butterproduktion wegen höherem Maschineneinsatz höher ist). In der Summe sollte 5 Wenn der Peso purzelt man die Kaufkraft zweier Währungen daher nicht allein mittels eines Guts vergleichen, sondern man nimmt für Kaufkraftvergleiche den Warenkorb, mit dem im Inland auch die Inflation gemessen wird. Das Beispiel macht deutlich, wie wichtig der Wechselkurs für Importe und Exporte ist: Wenn eine Währung aufwertet, d.h. wenn sie im Vergleich zu anderen Währungen wertvoller wird, kann man mit dieser Währung im Ausland billiger einkaufen. Steigt der Wechselkurs des Zloty zur Krone von 6 auf 7 und sieht man von den Transportkosten ab, ist es für die Polen billiger, nur noch Butter aus Tschechien statt einheimischer Butter zu kaufen. Die polnischen Viehbauern werden davon sicherlich wenig begeistert sein, die tschechischen Bauern hingegen umso mehr. Ein gestiegener Wechselkurs macht also das einkaufen im Ausland billiger, umgekehrt werden damit aber auch die einheimischen Produkte teurer, wenn man sie ans Ausland verkaufen will. Bei einem Wechselkurs von 7 werden polnische Bauern nicht nur im Inland weniger Butter verkaufen, sondern auch in Tschechien wird polnische Butter quasi unverkäuflich. 6 Natürlich gilt das nicht gleichermaßen für alle Produkte. Die Ökonomen unterscheiden diesbezüglich zwischen handelbaren („Tradables“) und nicht-handelbaren („Non-Tradables“) Gütern. Je standardisierter und transportfähiger ein Produkt ist (z.B. Butter), umso mehr steht es im internationalen Preiswettbewerb. Gibt es sehr unterschiedliche Ausführungen der gleichen Produktart (z.B. die verschiedenen Segmente des Automobilmarktes), umso mehr wird auch über Qualität, Image und Produktdifferenzierung international konkurriert. Jenseits derartiger Tradables gibt es Waren, v.a. aber Dienstleistungen, die vor Ort angeboten und konsumiert werden und daher kaum handelbar sind. Ein typisches Beispiel ist ein Haarschnitt. Ein Friseursalon in Deutschland konkurriert kaum mit einem Friseur in Holland oder Frankreich. Derartige Non-Tradables können daher in unterschiedlichen Länder sehr unterschiedlich teuer sein. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie sich Wechselkurse in der Praxis herausbilden (für Details siehe das Kapitel 4.1). Entweder wird der Wechselkurs von einem einzelnen Land oder durch zwischenstaatliche Vereinbarungen offiziell festgelegt („fester Wechselkurs“) oder er wird auf dem Devisenmarkt durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage täglich ermittelt. Im letzten Fall spricht man von einem freien bzw. flexiblen Wechselkurs. Theoretisch sollen freie Wechselkurse für eine automatischen Korrektur ungleichgewichtiger Handelsbilanzen sorgen und in der Theorie sind die Argumente durchaus überzeugend. Wenn z.B. Deutschland etwas in die USA exportiert, dann tauschen die Käufer in den USA im Umfang dieses Exports ausländische Währung (d.h. US-Dollar) in heimische Währung (d.h. Euro), um damit beim deutschen Herstellern die Rechnung zu bezahlen. Ein Export aus Deutschland führt also zu einer Nachfrage nach Euro auf dem Devisenmarkt. Im Fall eines Imports aus den USA nach Deutschland ist es genau umgekehrt, dann werden Euro auf dem Devisenmarkt angeboten und US-Dollar nachgefragt. Solange sich Import und Export die Waage halten, sollte der Wechselkurs theoretisch stabil bleiben. Im Fall eines deutschen Exportüberschusses sollte durch die Übernachfrage nach Euro der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar steigen. Dadurch werden die deutschen Produkte aus US-Sicht teuer, die USProdukte aus deutscher Sicht billiger. Durch diese relative Preisverschiebung in Folge der Aufwertung sollten die Exporte aus Deutschland zurückgehen und die Importe aus den USA steigen, sodass sich im Ergebnis die Handelsbilanz mittel- und langfristig im Gleichgewicht einpendelt. Die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik zeigt aber diese Tendenz zum Gleichgewicht nicht. Seit in den 1970er Jahren freie Wechselkurse eingeführt wurden (und auch in der Zeit davor bei festen Wechselkursen), hat die Bundesrepublik einen hartnäckigen Exportüberschuss. Ein Grund dafür liegt darin, dass die zuvor dargestellte Wechselkurstheorie sich nur auf die Handelsströme konzentriert, sich also nur an der Funktion nationaler Gelder als Zahlungsmittel und Recheneinheit orientiert (siehe 1.1). Währungen als nationale Gelder haben aber daneben eben auch noch die Wertaufbewahrungsfunktion. Im internationalen Maßstab bedeutet die Wertaufbewahrungsfunktion, dass Menschen ihr Geld vorzugsweise in der Währung aufbewahren bzw. anlegen, die den Wert ihres Geldes am besten stabil hält bzw. vergrößert. Wenn man in den USA für das eigene Geld höhere Zinsen als in Deutschland erhält, ergibt das einen Anreiz, Geld in US-Dollar statt in Euro aufzubewahren und anzulegen. Derartige Anlageentscheidungen sind wichtig dafür, wie sich Kapital zwischen verschiedenen Ländern und Währungen bewegt. Kapitalbewegungen verlaufen aber genauso über den Devisenmarkt wie die oben skizzierten Handelsströme. Wenn man in einem System freier Wechselkurse einen stabilen Wechselkurs haben möchte, müssen also nicht nur die Handelsströme ausgeglichen sein, sondern die Summe der Handels- und Kapitalströme müssen sich im Gleichgewicht befinden. Dabei können sich Ungleichgewichte aufheben oder gegenseitig verstärken. Wenn Deutschland einen Exportüberschuss gegenüber den USA hat und gleichzeitig im Umfang dieses Überschusses Kapital in den USA anlegt, dann heben sich die Aufwertungswirkung durch den Exportüberschuss (also die Überschussnachfrage nach Euro) und die Abwertungswirkung durch den Export von Kapital (also die Überschussnachfrage nach US-Dollar) genau gegenseitig auf. Solange Länder mehr Kapital exportieren als sie importieren (d.h. ein Nettokapitalexport vorliegt), bildet sich aus Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt ein Wechselkurs, der tendenziell zu niedrig für eine ausgeglichene Handelsbilanz ist und einen Exportüberschuss im Güterhandel befördert. Diesen Zusammenhang kann man durchaus strategisch nutzen. Deutschland als Exportweltmeister hat es seit dem Zweiten Weltkrieg stets vermocht, die Aufwertung der damaligen DM soweit zu bremsen, dass weiterhin ein großer Exportüberschuss entstand. Die Entstehungsgeschichte der deutschen Entwicklungshilfe ist dafür ein bemerkenswertes Beispiel. Als Anfang der 1960er Jahren darüber nachgedacht wurde, die DM wegen des großen Exportüberschusses Westdeutschlands gegenüber dem US-Dollar aufzuwerten (damals wurden die Wechselkurse im Rahmen des Bretton-WoodsSystems noch staatlich festgelegt, siehe 2.3), hat die Bundesbank sich massiv dafür eingesetzt, das Instrument der Entwicklungshilfe auf Kreditbasis einzuführen, um auf diesem Wege Kapital aus Deutschland zu exportieren und so den Druck zur Aufwertung der DM gegenüber dem US-Dollar zu mindern (vgl. Emminger 1986: 111). Sowohl Kapital- als auch Handelsströme beeinflussen also die Wechselkurse auf den Devisenmärkten. Umgekehrt führen aber auch Erwartungen über die zukünftige Wechselkursentwicklung zu Kapitalbewegungen. Hierbei passiert das, was John Maynard Keynes schon in den 1930er Jahren mit dem Gleichnis eines Preisausschreibens bei Schönheitswettbewerben umschrieben hat. Die TeilnehmerInnen des Preisausschreibens sollten sagen, wen sie für die schönste Kandidatin des Wettbewerbs hielten. Der Gewinn des Preisausschreibens wurde unter den TeilnehmerInnen verlost, die die Kandidatin gewählt hatten, die von den Einsendungen am häufigsten als die Schönste ausgewählt wurde. Wer bei dem Preisausschreiben gewinnen wollte, durfte sich also nicht von einer subjektiven Meinung leiten lassen, sondern es ging darum, am besten zu erraten, wen die anderen TeilnehmerInnen als die Schönste auswählen würden. „Wir haben den dritten Grad erreicht, bei dem wir unsere Intelligenz darauf ver- wenden, welche Meinungen die meisten Leute über die Meinung der meisten Leute haben. Und es gibt einige, glaube ich, die den vierten, fünften oder noch höhere Grade praktizieren.“ (Keynes 1936: 131) Wenn z.B. ein wichtiger Regierungswechsel bevorsteht, überlegt sich der einzelne Kapitalanleger X, was die Mehrheit der Kapitalanleger tun wird. Auch wenn der einzelne Anleger X annimmt, dass sich durch die neue Regierung für seine Anlagen keine direkten Verschlechterungen ergeben (z.B. keine höheren Steuern), er aber gleichzeitig davon ausgeht, dass die Mehrzahl der Anleger Verschlechterungen (d.h. höhere Steuern) erwarten, wird er sein Kapital aus dem Land abziehen. X erwartet dann nämlich, dass die anderen ihr Kapital abziehen, was zu einer Abwertung der Währung führt. Diese Abwertung wiederum entwertet auch die Anlagen von X, auch wenn die Steuern nicht erhöht werden. 1.3 Die Folgen für Entwicklung Offensichtlich wirken sich die Handels- und Finanzströme eines jeden Landes auf seine Währung aus und umgekehrt beeinflusst der bestehende Wechselkurs und die Erwartungen über seine zukünftige Entwicklung die Handels- und Finanzströme dieses Landes. Ein Wechselkurs drückt letztlich immer das Vertrauen aus, dass man in die Wirtschaft eines Landes hat, denn mit einer Währung, d.h. dem Geld einer bestimmten Volkswirtschaft, kann man immer nur das Kaufen, was diese Volkswirtschaft auch zu produzieren in der Lage ist. Angesichts zum Teil krisengeschüttelter Ökonomien ist es daher nicht verwunderlich, dass die Währungen vieler Entwicklungsländer nicht besonders gefragt und damit auch nicht besonders wertstabil sind. Wie im Vorangegangenen beschrieben hat das positive und negative Folgen, die sich überlagern: Ein niedriger und abwertender Wechselkurs verbilligt die Exporte und verteuert Importe, beides an sich ist gut für die Wettbewerbsfähigkeit und die Handelsbilanz. Umgekehrt führt aber das mangelnde Vertrauen in die Währungen der Entwicklungsländer dazu dass die Einwohner dieser Länder ihre Ersparnisse lieber in US-Dollar oder Euro unter der Matratze, bzw. bei den Vermögenden, auch auf ausländischen Konten aufbewahren, statt die heimische Währung dafür zu benutzen. Aus Sicht des Devisenmarkt bedeutet das einen Kapitalexport oder, wie es häufig vorwurfsvoll genannt wird, eine Kapitalflucht, was die einheimische Währung weiter unter Druck setzt. Die monetär-keynesiansiche Entwicklungstheorie bzw. die „Theorie der geldwirtschaftlichen Ent- 7 Wenn der Peso purzelt wicklung“1 hat für die Schwäche der Entwicklungsländerwährungen noch eine zusätzliche Erklärung anzubieten. Länder, die in ausländischer Währung verschuldet sind, zahlen in der langen Frist über Zinsen und Tilgungen stets immer mehr an die Gläubiger zurück, als sie von diesen ursprünglich als Kredit bekommen haben. Langfristig führen daher die direkten Zahlungsströme einer Kreditaufnahme im Ausland zu einem Netto-Devisenabfluss an das Ausland. Um diesen Netto-Devisenabfluss auszuglei- erwirtschaften, dann können sich AnlegerInnen schon heute leicht ausrechnen, dass die inländische Währung im Laufe der zukünftigen Kreditrückzahlung noch weiter unter Druck geraten wird. Um einer zukünftigen Abwertung zu entgehen, legen AnlegerInnen daher ihr Vermögen lieber schon heute in ausländischer Währung an. Das Ergebnis ist ein beschleunigter Kapitalexport und ein beschleunigter Verfall der Währung. Box 1: Verschuldung und Wechselkurs am Beispiel Deutsche Bank und Embraer Die Deutsche Bank in Frankfurt gibt dem brasilianischen Luftfahrtunternehmen Embraer einen Kredit über 100 Mio. €. Der Kredit wird am 1.1.1996 ausgezahlt, der Zinssatz beträgt 10 Prozent pro Jahr. Die Tilgung erfolgt nach 10 Jahren am 31.12.2005. Angenommen wird ein fester Wechselkurs von 1 € = 3 R$ (Brasilianischer Real). 8 1.1.1996 1.1.1996 31.12.2005 31.12.2005 Die Deutsche Bank vergibt Kredit an Embraer über 100 Mio. €. Embraer tauscht die 100. Mio. € bei der brasilianischen Zentralbank in 300 Mio. R$ um. Embraer tauscht 10 mal jährlich bei der Zentralbank 30 Mio. R$ in 10 Mio. € um, um die Zinsen an die Deutsche Bank zu überweisen. Embraer tauscht bei der Zentralbank 300 Mio. R$ in 100 Mio. € um, um die Tilgung an die Deutsche Bank zu überweisen. Einmalig zusätzliche Nachfrage nach 300 Mio. R$. 10 Jahre lang zusätzliches Angebot von 10 x 30 Mio = 300 Mio. R$. chen, müssen mit den ausländischen Kredite Investitionen getätigt werden (z.B. in den Exportsektor), die die notwendigen zusätzlichen Deviseneinnahmen erwirtschaften. Wenn das nicht gelingt (z.B. weil die Kredite für binnenwirtschaftliche Investitionen verwandt werden), entsteht aus einem Auslandskredit ein gesamtwirtschaftlicher und systemischer Devisenabfluss. Auf dem Devisenmarkt bedeutet das ein Überschussangebot an heimischer Währung, dass den Wert der inländischen Währung drückt und zu einer Abwertung der Währung führt (siehe Beispiel Box 1). Ein solcher Zusammenhang wirkt sich aber nicht erst irgendwann in der Zukunft aus. Wenn ein Land in der Vergangenheit viele Auslandskredite aufgenommen hat, die damit finanzierten Investitionen zur Zeit aber nicht die nötigen Deviseneinnahmen 1 Einmalig zusätzliches Angebot von 300 Mio. R$. Gesamtzeitraum 1.1.1996 31.12.2005 Im Laufe von 10 Jahren gab es eine Nachfrage nach 300 Mio. R$ und ein Angebot von insgesamt 600 Mio. R$, d.h. netto ein Überschussangebot von 300 Mio. R$. Umgekehrt: Angebot von 100 Mio. € und Nachfrage nach 200 Mio. €, d.h. netto eine Überschussnachfrage nach 100 Mio. €. Um einen solchen Exodus ins Ausland zu begrenzen, bleibt den meisten Ländern nur eine sehr teure „Notbremse“: Sie müssen den inländischen AnlegerInnen entsprechend hohe Zinsen anbieten, damit diese ihr Vermögen nicht in ausländischer Währung anlegen. Gleichzeitig kann dies ausländische InvestorInnen dazu bewegen, in die inländische Währung zu investieren, indem z.B. europäische Anleger Anleihen in brasilianischer Währung (Real – R$) mit entsprechend hoher Verzinsung kaufen. Ein Entwicklungsland mit schwacher Währung muss in- und ausländischen KapitalbesitzerInnen also eine Prämie dafür anbieten, dass diese ihr Vermögen trotz des Risikos eines Wertverlusts in seiner Währung anlegen. Anleihen, aber auch andere Geldanlagen in Währungen von Entwicklungsländern müssen regelmäßig deutlich höhere Zinssätze und Profitraten bieten, um Für einen Einstieg in diesen theoretischen Ansatz siehe Schelkle (1995) und Lüken-Klaßen (1993). Tabelle 1: Renditen für Anlagen in brasilianischer Währung R$ 2000 2001 2002 2003 2004 (1) Nominalzins (Refinanzierungssatz SELIC) 16,2 19,1 23,0 16,5 17,8 (2) Inflation (Konsumentenpreisindex) 6,0 7,7 12,5 9,3 7,6 (3) Außenwert (Auf-/Abwertung des R$ gegenüber €) 14,0 -19,2 -21,0 -23,7 -4,7 (4) Realzins Inländer = (1) - (2) 10,2 11,4 10,5 7,2 10,2 (5) Realzins Euro-Ausländer = (1) + (3) 30,2 -0,1 2,0 -7,2 13,1 Quelle: Latin Focus, Eigene Berechnungen inländische und ausländische Anleger anzulocken. Das spiegelt zwar einerseits das höhere Risiko eines Zahlungsausfalls wieder (die Argentinien-Krise hat dieses Risiko erneut sehr deutlich gemacht), andererseits wird damit aber auch und gerade das Risiko eines Wertverlusts der Anlagewährung ausgeglichen. Die Tabelle 1 stellt dar, wie sich die Zinsrenditen für Anlagen in Brasilien im Zeitraum 2000-2004 entwickelt haben. Die Rendite einer verzinsten Anlage fällt aus Sicht inländischer und ausländischer Anleger sehr unterschiedlich aus. Für europäische Anleger kann man modellhaft davon ausgehen, dass sie ihr Geld mittelund langfristig wieder aus Brasilien abziehen, um es in ihren Heimatländern oder in anderen Ländern zu verwenden. Folglich verdienen sie bei einer Anlage den Nominalzins abzüglich des Wertverlusts der brasilianischen Währung gegenüber dem Euro. Beim modellhaften Inländer hingegen geht man davon aus, dass der Anlagebetrag später einmal für Zwecke in Brasilien verwendet werden. Inländer verdienen daher im Umfange des nominalen Zinses abzüglich der Inflation in Brasilien, denn im Umfang der Inflation verliert ihre Anlage gleichzeitig an inländischer Kaufkraft. Tabelle 1 zeigt einerseits, dass die Renditen für inländische Anleger sehr viel gleichmäßiger ausfielen als die der ausländischen Anleger. Grund dafür ist, dass sich der Außenwert der brasilianischen Währung viel wechselhafter entwickelte als die Inflation. Bemerkenswert an den Zahlen ist aber vor allem eins: Wenn sich ein Unternehmen in Brasilien am inländischen Kapitalmarkt in Real verschuldete, musste es dafür fast durchweg real mehr als 10% Zinsen zahlen. In Deutschland lag der vergleichbare Wert im selbem Zeitraum zwischen 0,4 und 2,8% Realzins. Derartig hohe Realzinsen wie im Fall Brasiliens sind für Entwicklungsländer zweifellos ein sehr großer Hemmschuh, denn sie schmälern und verhindern private Investitionen einheimischer Unternehmen im Süden. Entwicklungsländer mit schwachen Währungen müssen sich also unter den Bedingungen offener Kapitalmärkte scheinbar zwischen zwei Übeln entscheiden: Entweder verlieren sie inländische Finanzressourcen durch Kapitalexport, oder sie unterwerfen die inländische Geldpolitik dem Ziel der Wechselkursstabilisierung und verlieren damit die Möglichkeit, eine ihrer Binnenwirtschaft angemessene Zinspolitik zu machen. Die meisten Länder praktizieren eine Mischung aus beidem. Viele afrikanische und lateinamerikanische Länder erleben nach wie vor eine Kapitalflucht seitens ihrer inländischen Eliten. Durch hohe Zinsen wird dieser Abfluss allerdings gemildert und werden ausländische AnlegerInnen angezogen. Die Theorie der geldwirtschaftlichen Entwicklung sieht im systemisch höheren Zinsniveau in Entwicklungsländern ein zentrales Entwicklungshindernis, denn höhere Zinsen bedeuten auch höhere Finanzierungskosten für Investitionen und damit eine Einschränkung des Wachstumspotentials einer Ökonomie. In der Konsequenz kommt man zu einem völlig absurden Ergebnis: Nach keynesianischer und neoklassischer Theorie soll ausländisches Kapital mangelnde Ersparnisse in Entwicklungsländern ausgleichen, damit mehr investiert werden kann. Der Zufluss und langfristige Netto-Abfluss ausländischen Kapitals führt zu der Erwartung, dass die Währung des betreffenden Landes in Zukunft zusätzlich geschwächt wird. Das treibt die Zinsen in diesem Land hoch, was wiederum die Investitionen erheblich hemmt. Die Theorie der geldwirtschaftlichen Entwicklung rät Entwicklungsländern daher aus gesamtwirtschaftlichen Überlegungen im Grundsatz davon ab, ihre Entwicklungsstrategie auf ausländisches Kapital zu gründen. Für ein Entwicklungsland lässt sich daraus im Umkehrschluss das Ziel einer erfolgreichen Wechselkurspolitik formulieren, nämlich eine Währung zu etablieren, der zunehmende Stärke zugetraut wird, die als unterbewertet gilt und die daher unter Verdacht steht, in Zukunft aufzuwerten, wobei die Aufwertung aber möglichst lange herausgezögert wird. Eine solche Situation ist aus Sicht eines einzelnen Landes geradezu perfekt, denn sie begünstigt einerseits durch einen weiterhin relativ niedrigen Wech- 9 Wenn der Peso purzelt selkurs die laufenden Exportgeschäfte. Andererseits verstärkt aber ein damit häufig einher gehender Exportüberschuss die Erwartungen der Anleger, dass die Währung in Zukunft aufwerten wird. Das macht sie zu einer sehr attraktiven Anlagewährung, denn den Anlegern droht dann kein Wechselkursverlust, sondern es bestehen sogar Hoffnungen auf einen Wechselkursgewinn. Das geradezu idealtypische Beispiel einer solchen Wechselkurs- und Entwicklungsstrategie stellt ist Westdeutschland. Die D-Mark galt bis in die späten 1970er Jahre als unterbewertet und die BRD hat auf diesem Wege ihren Status als Exportnation begründet und befestigt. 10 Ein sehr gutes Beispiel, dass dies aber auch Entwicklungsländern gelingen kann, ist die Volksrepublik China. China hat auf sehr aggressive Weise seit den 1990er Jahren Exportüberschüsse erwirtschaftet, indem es zunächst systematisch Produkte aus dem Westen imitiert und zu konkurrenzlos billigen Preisen auf dem Weltmarkt angeboten hat. Heute gilt die durch Deviseninterventionen der chinesischen Zentralbank niedrig gehaltene chinesische Währung Yuan als massiv unterbewertet und es wird insbesondere von den USA ein großer politischer Druck ausgeübt, den Yuan aufzuwerten. Jenseits der noch vorhandenen Beschränkungen des Kapitalverkehrs in China gibt es in so einer Situation auch keinen Anreiz für die neureichen chinesischen UnternehmerInnen, ihr Vermögen ins Ausland zu schaffen. Kapitel 2 Die Entwicklung des Weltwährungssystems 2.1. Der erste Goldstandard bis 1914 D as heutige Weltwährungssystem ist uns vertraut als ein System verschiedener nationaler Währungen, welche jeweils im Inneren des jeweiligen Staates bzw. Währungsraumes die Geldfunktionen übernehmen und nach Außen zu den anderen Währungen über Wechselkurse in ein Wertverhältnis gesetzt werden. münzen zum dominierenden Zahlungsmittel wurden. Der somit entstandene de facto Goldstandard wurde etwa hundert Jahre später zu einem de jure Goldstandard. England hatte damit als erster Staat offiziell eine vollständige Goldwährung eingeführt (Eichengreen 2000: 28). Wie kam es dazu, dass sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus einer Vielfalt an Währungen ein internationales System entwickelte, welches auf einer allen gemeinsamen Grundlage – nämlich dem Gold – beruhte? Eine große Rolle bei der zumindest in ihren Ursprüngen „zufälligen“ Herausbildung des ersten Weltwährungssystems hat ganz einfach dessen zunehmende wirtschaftliche Notwendigkeit gespielt. „Die Expansion des Außenhandels und die Integration der liberalen Weltwirtschaft vor dem Ersten Weltkrieg erforderte ein funktionsfähiges internationales Währungssystem. Damit Importeure und Exporteure unbeschränkt am Welthandel teilnehmen konnten, musste gewährleistet sein, dass die verfügbaren Zahlungsmittel nicht nur national, sondern auch international verwendbar waren, d.h. dass die unbegrenzt und zu möglichst schwankungsfreien Wechselkursen in andere Währungen umtauschbar waren. Ein solches Währungssystem entstand im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, als nahezu alle Welthandelsländer [...] zur Goldwährung übergingen.“ (Czada et al. 1988: 23) Mehrere Faktoren führten dazu, dass ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts immer mehr Staaten, zunächst in Europa und dann weltweit, den Goldstandard Englands übernahmen. Insbesondere die zunehmende Dominanz Englands in den internationalen Finanz-, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie Stabilitätsprobleme mit den in einigen Staaten noch existierenden Silber- und Bimetallwährungen (z.B. ausgelöst durch große Silberfunde und damit einhergehenden inflationären Preisverfall des Silbers) machten eine Anpassung an das Währungssystem der führenden Wirtschaftsmacht immer attraktiver. Der Übergang des Deutschen Reiches, der damals zweitstärksten europäischen Industriemacht, zum Goldstandard im Jahr 1871 erhöhte zunächst in Europa den Nachahmungszwang für kleinere, handelspolitisch von den beiden „Großmächten“ abhängige Staaten. Innerhalb kurzer Zeit entstand dann auf Grund zunehmender handelsund finanzpolitischer Verflechtungen in einer Art Kettenreaktion ein internationales Währungssystem, an welchem Länder in Europa, Nord- und Südamerika und Asien beteiligt waren (Eichengreen 2000: 32ff). Die „Grundsteinlegung“ des internationalen Goldstandards war gewissermaßen einem Zufall zu verdanken: 1717 setzte der damalige englische Münzmeister Isaac Newton einen zu niedrigen Goldpreis für Silber fest; Gold war damit im Vergleich zu den Weltmarkpreisen in England überbewertet. Für Arbitrageure lohnte es sich nun, Gold nach England einzuführen, dort in Silber einzutauschen und dieses dann zu exportieren. Die logische Konsequenz war, dass in England vollhaltige Silbermünzen allmählich aus dem Zahlungsverkehr verschwanden und Gold- Wie gesagt befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits Banknoten im Umlauf; auch wurde in Goldstandard-Ländern mit Kupfer-, Silber- und Scheidemünzen bezahlt. Darüber hinaus entwickelte sich schon vor 1914 ein bargeldloser Zahlungsverkehr über Girokonten. „Goldwährung“ bedeutete also nicht, dass ausschließlich mit Gold bezahlt wurde – auch wenn in einigen Ländern, z.B. in England und Frankreich, ein nennenswerter Teil des Geldumlaufs aus vollwertigen Goldmünzen bestand. Die wesentlichen Merkmale des Goldstandards waren andere: Er sah zum 11 Wenn der Peso purzelt Einen vor, dass die sich im Umlauf befindende Geldmenge (zumindest zu einem festgelegten Anteil) durch Goldbestände der Zentralbank gedeckt war. Die Geldmenge hing also von den Goldbeständen ab, eine „natürliche“ Geldknappheit war dem System somit inhärent. Papiergeld entsprach gewissermaßen „Gold-Forderungen“, d.h. – dies war das zweite zentrale Kennzeichen des Systems – Banknoten konnten bei der Zentralbank zu einem festgesetzten Tauschverhältnis jederzeit gegen die entsprechende Menge Gold eingetauscht werden.2 Jedes am Goldstandard beteiligte Land legte die Goldparität seiner Währung fest, d.h. die Menge Gold (in Gramm gemessen), die man für eine Währungseinheit erhielt. Indem also alle Länder ein festes Tauschverhältnis ihrer Währung zu dem selben Wertmaßstab einrichteten, wurden ihre Währungen auch untereinander in feste Wechselverhältnisse gebracht. Drittens herrschte im Goldstandard Transferfreiheit; Gold konnte also ungehindert ein- und ausgeführt werden. 12 Mit der Ausbreitung des Goldstandards war gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal ein internationales System fester Wechselkurse entstanden. Dieses System beruhte nicht auf offiziellen internationalen Regeln und Vereinbarungen; es handelte sich eher um eine Art inoffizielles Regime, welches in einem historischen Prozess und durch ein Zusammenspiel mehrerer begünstigender Faktoren entstanden war (Czada 1988: 24ff). Der Goldstandard als gleichzeitig nationales und internationales Währungssystem unterschied sich grundlegend von unserem heutigen ZentralbankGeldsystem. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Geldmenge im Goldstandard durch die physisch vorhandene Goldmenge bzw. die Förderung und Produktion neuen Goldes begrenzt war. Auch wenn die wenigsten Länder ihre gesamte Geldmenge 1:1 durch Gold gedeckt haben (im Deutschen Reich war z.B. nur eine Deckung zu mindestens einem Drittel vorgeschrieben), war der Preis des Geldes, d.h. der Zins, quasi „natürlich“ bestimmt. In den Europa und anderen Industrieländern sind wir es hingegen heute gewohnt, dass das Zinsniveau eines Landes von einer Zentralbank im Sinne bestimmter wirtschaftlicher und politischer Ziele (z.B. Geldwertstabilität, Beschäftigung u.a.) bestimmt wird. Wenn ein Land im Goldstandard ein Handelsbilanzdefizit hatte, das entsprechend mit einem Abfluss von Goldreserven einherging, musste die Zentralbank die Zinsen erhöhen, um ausländisches Gold als verzinste Kapitalanlage anzuziehen. Ähnlich wie bei Entwicklungsländern mit schwachen Währungen heute war die nationale Zinspolitik dem Zwang unterworfen, für einen Ausgleich der Zahlungsbilanz zu sorgen. 2.2. Der zweite Goldstandard der Zwischenkriegszeit Der Beginn des Ersten Weltkriegs markierte das Ende des internationalen Goldstandards. Die wesentlichen Charakteristika des Währungssystems – die Golddeckung und die Konvertibilität der Währungen – wurden in den beteiligten Ländern nach und nach aufgegeben; die Bindung der Währungen an das Gold wurde aufgehoben und das System fester Wechselkurse damit von einem von hoher Volatilität geprägten System flexibler Wechselkurse abgelöst (Eichengreen 2000: 70f).3 In den ersten Nachkriegsjahren blieb es zunächst beim freien Floaten der Wechselkurse. Erst Mitte der 20er Jahre kehrten mehrere Länder wieder zu einer eingeschränkten Form des Goldstandards der Vorkriegszeit zurück. Der zweite Goldstandard – der auf Grund der zunehmenden Praxis, die Währungen nicht nur über Gold, sondern auch über Devisen zu decken, auch GoldDevisen-Standard genannt wird – stand allerdings von Anfang an unter schlechten Vorzeichen; seine Überlebensdauer sollte nur wenige Jahre betragen und seine Instabilität entscheidend zum Ausbruch und zur Intensität der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre beitragen (Czada 1988: 34ff). Die ersten Länder, z.B. Deutschland, Österreich und Ungarn, kehrten in den Jahren 1923 bis 1925 zum Goldstandard zurück, um ihre von hoher Inflation geplagten Währungen zu stabilisieren. Andere europäische Länder mit eher mäßiger Inflation folgten bald, und wie bereits beim Entstehen des ersten Goldstandards resultierte daraus eine Kettenreaktion, welche zur erneuten Etablierung eines internationalen Systems fester Wechselkurse führte. Im Jahr 1926 hatten 39 Länder wieder eine Goldwährung eingeführt (Eichengreen 2000: 72ff). Beide beschriebenen Merkmale gelten für den Goldstandard in seiner vollständigen Form, wie er in England praktiziert wurde. Andere Länder übernahmen nur eine Art „hinkenden Goldstandard“, indem sie beispielsweise nur einen Teil der umlaufenden Geldmenge durch Goldreserven deckten (wie im Deutschen Reich) oder nur eine eingeschränkte Konvertibilität der Banknoten und Münzen garantierten (wie in Frankreich) (Czada 1988: 24ff). 3 Inwiefern der Goldstandard unabhängig vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges ohnehin ein Ende gefunden hätte, ist bis heute umstritten. Mehrere Ökonomen betonen, dass das „reibungslose Funktionieren“ des Goldstandards ganz spezifischen historischen Gegebenheiten zu verdanken gewesen sei, welche sich bereits in den Jahren vor dem Krieg auf Grund wirtschaftlicher und politischer Modernisierungsprozesse zu verändern begannen. Dieser Argumentation zu Folge wäre die Stabilität des Goldstandards auch ohne Weltkrieg nicht von Dauer gewesen (Eichengreen 2000: 22 und 66f). 2 Mehrere Faktoren trugen von Anfang an zur Instabilität des zweiten Goldstandards bei, so z.B. die in vielen Ländern aus der Kriegsfinanzierung resultierenden chronischen Haushaltsdefizite sowie insbesondere in Deutschland die Last der Reparationszahlungen. Auch die zunehmend ungleiche Verteilung der weltweiten Goldbestände sowie die damit einher gehende Goldknappheit in vielen Staaten belasteten das neue Währungssystem. Aus heutiger Sicht lässt sich zudem feststellen, dass es ein Fehler war, unter völlig veränderten wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten ohne internationale Koordination zu fast denselben Konditionen zum Goldstandard zurück zu kehren. Zum Beispiel mussten die Regierungen der Staaten einem neuen innenpolitischen Umfeld Rechnung tragen, wodurch eine absolute Prioritätensetzung auf die Stabilität des Währungssystems – vor dem Krieg eine Selbstverständlichkeit und tragende Säule des Goldstandards – nicht mehr möglich war. Erstarkte Gewerkschaften und Unternehmen begannen, die Wirtschaftspolitik ihrer Regierung zu beeinflussen und erzwangen zunehmend eine Unterordnung außenwirtschaftlicher unter binnenwirtschaftliche Ziele wie z.B. den Abbau der Arbeitslosigkeit (Eichengreen 2000: 69f) Zudem wurde bereits damals von einigen Ökonomen – so unter anderem von John Maynard Keynes, der später auf der Konferenz von Bretton Woods Englands Chefunterhändler werden sollte – kritisiert, dass viele Länder die Goldparitäten ihrer Währungen auf dem Vorkriegsniveau festsetzten, obwohl sich die Kaufkraft der Währungen in den einzelnen Ländern unterschiedlich entwickelt hatte. Die somit festgelegten „falschen“ Wechselkurse brachten erhebliche Wettbewerbsverzerrungen unter den am Goldstandard beteiligten Staaten mit sich (Czada 1988: 40ff). Der re-etablierte Goldstandard war also von Anfang an krisenanfällig. „Von keinem der Faktoren, die vor dem Krieg den internationalen Goldstandard gestützt hatten, konnte man mehr annehmen, dass er selbstverständlich sei.“ (Eichengreen 2000: 69f). Spätestens das Ende des wirtschaftlichen Aufschwungs der „Goldenen Zwanziger“ und der Ausbruch der Weltwirtschafts- und Währungskrise, die am 25. Oktober 1929 mit dem Börsenkrach in New York ihren Anfang nahm, versetzten dem Währungssystem dann seinen Todesstoß. Die Weltwirtschaftskrise war entstanden aus einem Zusammenspiel und einer Kettenreaktion vielfältiger politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten und Fehlentscheidungen. Die Instabilität des Goldstandards war dabei einer der auslösenden und krisenverstärkenden Faktoren (Czada 1988: 50ff). Im September 1931 wurde die Goldkonvertibilität des britischen Pfunds aufgehoben. Dieses Datum markierte den Anfang vom Ende des zweiten Goldstandards, wobei auch diesmal wirtschaftliche Abhängigkeiten und Verflechtungen zu einer umgekehrten Kettenreaktion führten. „Nur wenige Jahre nach der mühsamen Rückkehr zum Gold-DevisenStandard brach dieses Festkurssystem unter den Belastungen der Weltwirtschaftskrise zusammen. Es bildeten sich mehrere lose Währungsblöcke, die intern bei weitgehenden Devisen- und Handelsbeschränkungen feste Kurse aufrechterhielten; so z.B. die Sterling-Area, d.h., vor allem die Commonwealth-Länder, die ihre Währungen ans britische Pfund banden [...], oder der Dollar-Block (vor allem südamerikanische Länder), der Franc-Block usw.“ (Czada 1988: 55) Außerhalb dieser Währungsblöcke bewegten sich die Wechselkurse wie schon zu Beginn der 20er Jahre wieder flexibel; jedoch wirkten Zentralbanken und Devisenausgleichsfonds im Sinne eines managed floating (siehe Kapitel 4.1.2) mäßigend auf die Wechselkurse ein (Eichengreen 2000: 126ff). 2.3. Das Weltwährungssystem von Bretton Woods Bereits in den 1930er Jahren waren Ansätze einer erneuten währungspolitischen Kooperation auf internationaler Ebene zu beobachten. So vereinbarten z.B. Frankreich, Großbritannien und die USA Ende 1936 in einem Dreierabkommen, auf weitere Abwertungen ihrer Währungen zu verzichten, um den mit der Weltwirtschaftskrise ausgebrochenen internationalen Abwertungswettlauf zu stoppen. Eine grundlegende Neuordnung des Weltwirtschafts- und -währungssystems wurde dann im Jahr 1944, also noch während dem Zweiten Weltkrieg, auf der Konferenz in Bretton Woods unternommen. Die aus währungspolitischer Sicht bedeutendsten Entscheidungen von Bretton Woods waren die Gründung des Internationalen Währungsfonds (s. Box 9, S. 30), das offizielle Bekenntnis zu einem stark eingeschränkten internationalen Kapitalverkehr sowie die Einrichtung eines internationalen Systems fester Wechselkurse (Eichengreen 2000: 131ff). Es wurde beschlossen – vor allem auf Drängen der Amerikaner, die über mehr als die Hälfte der offiziellen Goldreserven verfügten –, die Wechselkurse im Sinne eines modifizierten Gold-Devisen-Standards zu definieren, d.h. „dass die Länder Paritäten für ihre Währungen in Gold oder in einer in Gold konvertierbaren Währung festlegten (was in der Praxis Dollar bedeutete) und ihren Wechselkurs nur ein Prozent 13 Wenn der Peso purzelt um diesen Wert nach oben und unten schwanken ließen.“ (Eichengreen 2000: 137). Eine Deckung der Währungen durch Gold oder Devisen war im Gegensatz zum alten Goldstandard jedoch nicht vorgesehen. Der Dollar – die einzige Währung im System, die noch zu einem großen Teil durch Gold gedeckt war und zugleich das Zahlungsmittel der mittlerweile weltweit stärksten Wirtschaftsmacht – nahm in dieser Währungsordnung die unangefochtene Position einer Weltleitwährung ein. Die USA garantierten den ausländischen Notenbanken, jederzeit Dollar zur festgelegten Parität gegen Gold einzulösen. Das Wechselkurssystem wurde, vor dem Hintergrund der schlechten Erfahrungen mit allzu starren Wechselkursen unter dem zweiten Goldstandard, mit einer gewissen Flexibilität ausgestattet, so dass die Goldparitäten im Falle so genannter „fundamentaler Ungleichgewichte“ nach Absprache mit dem IWF geändert werden konnten. Innerhalb eines Rahmens von 10% konnte eine Änderung auch ohne Rücksprache mit dem Fonds vorgenommen werden (Czada 1988: 62f). Das Währungsregime von Bretton Woods entsprach somit dem theoretischen Modell eines adjustable peg – einem System mit festen, aber anpassbaren Wechselkursen (siehe Kapitel 4.1.2). 14 Gegen Ende der 1960er Jahre geriet das BrettonWoods-System in eine Krise, in deren Folge es stückweise bis 1973 zusammenbrach. Einerseits hatte die hohe Kreditaufnahme der US-Regierung im Zuge des Vietnamkrieges eine massive Inflation hervorgerufen. Entsprechend dem Modell des adjustable peg hätte daraufhin die Parität des US-Dollars zur Gold und der Wechselkurs des Dollars gegenüber den anderen Währungen abgewertet werden müssen. Da sich aber viele Länder, u.a. die Bundesrepublik, der Aufwertung ihrer eigenen Währungen wiedersetzten und die USA die Inflation des US-Dollars angesichts des Finanzbedarfs des Vietnamkrieges nicht entschieden bekämpfen wollte, zerbrach das System von Bretton Woods letztlich an seinen Konstruktionsmängeln: die politischen Zielkonflikt zwischen dem US-Dollar als nationaler und internationaler Währung wurden unüberbrückbar, die USA, aber auch die Bundesrepublik Großbritannien und Frankreich, kündigten das System auf. Zunächst wurde am 15. August 1971 die Goldkonvertibilität des Dollars von US-Präsident Nixon aufgehoben. Nach einigen Rettungsversuchen stiegen dann im März 1973 die wichtigsten europäischen Zentralbanken endgültig aus dem System aus, indem sie aufhörten, auf den Devisenmärkten durch Interventionen die festgelegten Kurse des BrettonWoods-Systems zu verteidigen. Mit dem Ende des Währungssystems von Bretton Woods endete zugleich auch die lange währungspolitische Geschichte des Goldes. Zwar werden von einigen Staaten und vom IWF auch heute noch beachtliche Goldbestände gehalten. Die Bedeutung des Goldes als internationales Währungsmetall war jedoch ein für allemal vorbei. 2.4. Von 1973 bis heute: Ein flexibles Wechselkurssystem Kurz vor seinem Ende hatte das Systems von Bretton Woods zur Aufrechterhaltung fester Wechselkurse immer stärkere Interventionen der Zentralbanken nötig gemacht. Das lag zu einem wesentlichen Teil daran, dass seit den späten 1950er Jahren die in Bretton Woods vereinbarten Beschränkungen des internationalen Kapitalverkehrs immer stärker ausgehöhlt worden waren. So entwickelte sich in Europa ein in Dollar ablaufender lebhafter Kapitalmarkt (der sogenannte „Euro-Dollar-Markt“), auf dem AnlegerInnen und Unternehmen immer größere Kapitaleinsätze für Kredite und Direktinvestitionen grenzüberschreitend verschieben konnten. Da dieser Markt zwar in US-Dollar, aber außerhalb der USA ablief, gab er einer ganzen Generation von nachfolgenden Finanzprodukten- und -zentren ihren Namen: Off-Shore-Banking. Die Währungsgeschäfte, die mit der grenzüberschreitenden Verschiebung von Kapital zu tun hatten, waren gegenüber den Umsätzen zur Abwicklung des Warenhandels immer bedeutsamer geworden. Gleichzeitig stiegen die Gesamtumsätze und die Zentralbanken musste mit immer höheren Einsätzen intervenieren, um die Wechselkurse entsprechend ihrer festgelegten Paritäten zu halten. Konservative Ökonomen, allen voran die Anhänger der „Chicagoer Schule“ um Milton Friedman, hatten schon seit den 1960er Jahren gefordert, die Wechselkurse endlich freien Devisenmärkten zu überlassen und auf diese Weise zu „angemesseneren“ und „stabileren“ Wechselkursen zu kommen. Diese Erwartungen wurden allerdings nicht erfüllt. Zwar hatte es gerade in den letzten Jahren des BrettonWoods-Systems viele Änderungen in den vereinbarten Wechselkursen gegeben, aber die starken und v.a. kurzfristigen Wechselkursschwankungen nach Freigabe der Wechselkurse im März 1973 waren aber bis dato unbekannt (siehe Abbildung 1, S. 15). Die unerwartet starken Turbulenzen auf die nun freien Devisenmärkten wurden durch die weltwirtschaftlichen Wirren der 1970er Jahre noch befeuert. Doch auch die Ölkrise und die nachfolgende Abbildung 1: Außenwertentwicklung der D-Mark (1970 - 1975; 1.1.1970 = 100) 180 Britisches Pfund 170 Ital. Lira 160 US$ Japanischer Yen 150 Franz. Franc 140 130 120 110 100 90 02.07.75 02.01.75 02.07.74 02.01.74 02.07.73 02.01.73 02.07.72 02.01.72 02.07.71 02.01.71 02.07.70 02.01.70 80 Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage von Daten der Bundesbank weltweiten Rezession hatten die wirtschaftlichen Fundamentaldaten (z.B. Wirtschaftswachstum, Preisentwicklung, Investitionsquoten etc.) der einzelnen Länder nicht so weit gegeneinander verschoben, dass sie die Veränderungen der Wechselkurse hätten erklären können. So hat die DM zwischen 1970 und 1975 gegenüber dem japanischen Yen 20 Prozent, ggü. dem US-Dollar 40 Prozent und ggü. Britischen Pfund über 60 Prozent an Wert gewonnen. Ein wesentlicher Teil dieser Verschiebungen waren einmalige Anpassungen, um die „Fehlbewertungen“ aus der Zeit des Festkurssystems auszugleichen. Spätestens die 1980er Jahre brachten aber noch stärkere Verschiebungen, die nach einhelliger Meinung nicht durch Veränderungen der Fundamentaldaten begründet waren. Von 1980 bis 1985 verlor die DM gegenüber dem US-Dollar ca. die Hälfte ihres Wertes, um dann zwischen 1985 und 1988 ihren Außenwert wieder zu verdoppeln. Diese starken Veränderungen wurden von den großen Industrieländerregierungen mit Sorge gesehen und führten zu zwei wichtigen politischen Abkommen, die Wechselkurse politisch zu stabilisieren. 1985 waren die fünf mächtigsten Regierungen und Zentralbanken im New Yorker Plaza Hotel übereingekommen („Plaza-Vereinbarung“), sich für eine Abwertung des US-Dollar einzusetzen. Schon allein die Veröffentlichung der Vereinbarung sorgte noch am selben Tag dafür, dass der US-$ gegenüber DM und Yen vier Prozent verlor, ohne dass die Zentralbanken intervenieren mussten (Eichen- green 2000: 198 ff). Schon allein die Ankündigung, dass die Zentralbanken in der nachfolgenden Zeit eventuell geschlossen intervenieren könnten, hatte die privaten Finanzmarktakteure davon überzeugt, dass der US$ deutlich an Wert verlieren würde. Ähnlich erfolgreich war das Louvre-Abkommen von 1987, als die G7-Finanzminister feststellten, die im Plaza-Abkommen befürwortete Abwertung des US-Dollars sei über das Ziel hinausgeschossen und es brauche nun wieder eine Stabilisierung und moderate Aufwertung des US-Dollars. Beide Abkommen haben sehr deutlich gemacht, dass eine gemeinsame und entschlossene politische Linie wichtiger Regierungen und Zentralbanken einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Wechselkurse habt. Schon 1972 hatten sich einige europäische Länder (u.a. Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande) auf die sogenannte „Währungsschlange“ verständigt. Diese sah politisch festgelegte Wechselkurse mit Schwankungsbreiten von +/– 4,5 Prozent zwischen ihren Währungen vor und bot ein gewisses Auffangnetz nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods. Die Währungsschlange wurde im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft (EG) 1979 zum europäischen Währungssystem weiterentwickelt und mündete, nach erheblichen Turbulenzen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre schließlich in der Europäischen Währungsunion. 15 Wenn der Peso purzelt Eine Währungsunion ist zweifellos die weitgehendste Form von Wechselkursstabilisierung. Sie hat aber den Nachteil, dass die alle in der Währungsunion zusammengeführten Länder dergleichen Zinspolitik unterworfen sind. Eine Währungsunion ist daher für solche Ländergruppen geeignet, die ähnliche Wirtschaftsstrukturen und eine ungefähr gleichlaufende Konjunktur haben. Ob dies im Fall der Europäischen Währungsunion gegeben ist, ist stark umstritten. Gibt es in einigen Ländern einer Währungsunion Inflationsdruck (also Bedarf nach einer Zinsstraffung) und in anderen Länder gleichzeitig einen Konjunktureinbruch (also Bedarf nach einer Zinssenkung), dann kann es keine „richtige“ Geldpolitik für die gesamte Währungsunion mehr geben. In Währungsunionen kommt es daher immer darauf an, dass es eine wirtschaftspolitische Koordination der beteiligten Länder gibt, in der diese ihre Wirtschaftsstrukturen aufeinander abstimmen und es langfristig idealerweise zu einer Angleichung („Konvergenz“) kommt. Diesen Anforderungen wird die Europäische Währungsunion nur eingeschränkt gerecht, denn viele Politikfelder wie z.B. die Steuerund die Sozialpolitik bleiben in der EU weiterhin den Nationalstaaten überlassen und dienen eher als Instrumente der Konkurrenz statt der Kooperation in der EU. 16 Zu den einschneidenden währungspolitischen Erfahrungen der Entwicklungsländer der jüngeren Zeit gehören zweifellos die Währungs- und Finanzkrisen in Mexiko 1994, in Südost-Asien 1997/98 und in Brasilien, Russland und Argentinien zwischen 1999 und 2001. Diese Krisen begannen, anders als die Krisen der 1980er Jahre, nicht mit Überschuldungskrisen, sondern mit Zusammenbrüchen unilateraler Währungssysteme (zu konkreten Krisenbeispielen Thailand und Argentinien siehe Kapitel 4). Sie waren unter anderem ein Ergebnis der erheblich gestiegenen Einbindung der Schwellenländer in den internationalen Kapitalverkehr mit all seinen Unwägbarkeiten. Der Internationale Währungsfond, der mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems 1973 seine Funktion als Überwachungsinstanz verloren hatte, hatte erst in den 1980er Jahren als Manager der Schuldenkrise wieder eine wichtige Bedeutung erlagt. Die sogenannten „Strukturanpassungsprogramme“, die er seit dieser Zeit den Schuldnerländern als Auflagen für neue Kredite abforderte, waren von Anfang an sehr umstrittenen. Es waren aber v.a. die vom IWF geforderten Reformpakete gegenüber den krisengeschüttelten Ländern während der Asienkrise, die die Akzeptanz und das Ansehen des Fonds, auch weit in die Szenen konventioneller Ökonomen hinein, angeknackst haben. Seitdem steckt der IWF in einer permanenten Legitimationskrise, denn einerseits haben seine Politikempfehlungen die Lage der Krisenländer eher verschlimmert als verbessert. Andererseits hat die Wirtschaftskraft der Schwellenländer Asiens dramatisch zugenommen, ohne dass ihnen die Industrieländer einen stärkeren Einfluss im IWF eingeräumt haben. Als Reaktion haben die meisten großen Schwellenländer mit Ausnahme der Türkei seit 2004 ihre Kredite gegenüber dem IWF so schnell wie möglich zurückgezahlt, um sich dem Einfluss des Fonds zu entziehen. Für den IWF hat das zur Folge, dass ihm mit diesen Hauptkunden zugleich die Finanzquellen abhanden kommen, denn der IWF finanziert sich v.a. aus den Zinsen seiner Kreditvergabe (für weitere Details zur aktuellen Finanzkrise des IWF siehe Temme 2006). Nicht zuletzt diese Legitimations- und Finanzierungskrise des IWF und die massive Ansammlung von Devisenreserven in China und Südkorea bieten für Schwellenländer die Gelegenheit, ihre währungspolitischen Bedürfnisse und Interessen stärker als bisher durchzusetzen. Die ärmeren Entwicklungsländer hingegen bleiben mit ihren Währungsproblemen derzeit weiterhin ungehört. Kapitel 3 Das System des Währungshandels – Die Rolle von Banken, institutionellen Investoren und transnationalen Konzernen 3.1. Der Währungsmarkt (Devisenmarkt) D ie Freigabe der Wechselkurse 1973 war der Beginn einer rasanten Entwicklung auf dem internationalen Währungsmarkt. Sie wurde befördert durch die etwa zeitgleich einsetzende Welle der Kapitalverkehrsliberalisierung in den Industrieländern. Viele Regeln wurden aufgehoben, die bis dahin grenzüberschreitende Kapitalanlage verboten oder behindert hatten und die anschwellenden Kapitalbewegungen erhielten im Vergleich zu den Handelsströmen einen immer stärkeren Einfluss auf die Preisbildung auf dem Devisenmarkt. Die von vielen Ökonomen prophezeite beruhigende und ausgleichende Kraft des Devisenmarktes ließ auf sich warten, statt dessen schwankten die Hauptwährungen in immer stärkerem und kurzfristigerem Maße. Gegen diese Unwägbarkeiten flexibler Wechselkurse wollten sich sowohl Staaten als auch die Privatwirtschaft abzusichern. Sie taten dies durch den Abschluss von Währungstermingeschäften (siehe Box 2). Box 2: Was ist ein Termingeschäft? Mit „Termingeschäft“ oder „Geschäft auf Termin“ sind Verträge gemeint, bei denen heute die Bedingungen zukünftiger Transaktionen festgelegt werden. Beispiel: Ein französischer Getreidebauer will z.B. schon vor der Aussaat wissen, was er im Herbst für seinen Weizen bekommen wird. Ein Termingeschäft auf Weizen besteht also z.B. dann, wenn der noch nicht gewachsene Weizen schon im Voraus zu einem bestimmten Preis „auf Termin“ verkauft wird. Gibt es in Deutschland wegen entsprechendem Wetter eine Rekordernte, so wird mehr Weizen auf dem Markt angeboten und der Weizenpreis wird fallen. Der französische Bauer ist mit seinem Termingeschäft gegen einen solchen Preisverfall abgesichert. Mit einem Termingeschäft erhält der französische Bauer Planungssicherheit. Der Vertragspartner des Bauers ist entweder jemand, der den Weizen tatsächlich im Herbst braucht und zum vereinbarten Preis profitabel weiterverarbeiten kann. Ebenso gut kann es aber auch ein Spekulant sein, der davon ausgeht, im Herbst einen höheren Preis für den Weizen zu erzielen, zu dem er ihn dem Bauern jetzt abkauft. Nehmen wir an, der Bauer will 50 Tonnen Weizen für 125 Euro/Tonne verkaufen. Der Spekulant erwartet im Herbst einen Preis von 140 Euro/Tonne. Dem Bauer sind die heute zugesicherten 125 Euro/Tonne lieber als unsichere 140 Euro/Tonne im Herbst. Wenn der Spekulant recht behält, kann er im Herbst den Vertrag mit dem Bauern an einen Endabnehmer von Weizen weiterverkaufen. Kostet der Weizen im Herbst tatsächlich 140 Euro/Tonne, ist der Vertrag den Differenzbetrag von 140 Euro –125 Euro pro Tonne wert, also insgesamt 750 Euro bei 50 Tonnen. Da der Spekulant den Weizen des Bauern auch erst im Herbst bezahlen muss, muss er quasi kein eigenes Kapital einsetzen. Geschichte: Historisch entwickelten sich Termingeschäfte auf Märkten für landwirtschaftlichen Rohstoffe wie z.B. Getreide, Blumenzwiebeln, Schweinehälften etc. Sie haben sich aber seit dem 19. Jahrhundert auch für Aktien, Währungen, Indizes und viele andere Produkte etabliert. Ein Termingeschäft ist immer die Zerlegung einer zukünftigen wirtschaftlichen Transaktion in einen garantierten und einen spekulativen Anteil. Die eine Vertragspartei erlangt durch das Termingeschäft Planungssicherheit und kann sich gegen die Risiken von Preisänderungen absichern, die andere Partei erwartet genau solche Preisänderungen und spekuliert darauf. Da Termingeschäfte für einen Teil der Beteiligten die Planungssicherheit erhöht, werden sie von der vorherrschenden Meinung als Beitrag zur Effizienz des Wirtschaftssystems angesehen. Hedge-Fonds: Das Motiv der Absicherung bei Termingeschäften wird als „hedging“ bezeichnet (engl. hedge – absichern). Daher kommt auch der Begriff der Hedge-Fonds. (Nicht nur) Sie sind das notwendige Gegenüber zur Absicherung, treten also als die spekulative Seite bei Termingeschäften auf und konzentrieren so große Risiken. 17 Wenn der Peso purzelt Box 3: Was ist Spekulation? Der Begriff der Finanzspekulation ist in der Alltagssprache üblicherweise mit Begriffen wie kurzfristiger Geldgier, hohem Risiko und Spielcasino verbunden. In der Ökonomie ist der Begriff nüchterner definiert. Streng genommen sind alle Aktivitäten, die mit Erwartungen über die Zukunft verbunden sind, in Unterschiedlichem Maße spekulativ. Das rührt daher, dass die Zukunft nun einmal ungewiss ist und alle Erwartungen für die Zukunft entsprechen mit Unsicherheiten gehaftet sind. Das Maß an Unsicherheit variiert natürlich sehr stark, zum Einen in Abhängigkeit von der geplanten Aktivität und zum Anderen im Hinblick auf den Zeithorizont. Wenn ich heute Butter produziere, um sie morgen zu verkaufen, so kann ich mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass ich sie auch morgen noch zu einem gewinnbringenden Preis verkaufen kann. Kaufe ich hingegen heute eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage mit einem Anlagehorizont von 30 Jahren, so weiß ich letztlich wenig darüber, wie sich die Immobilienpreise und die Mieten in den nächsten 30 Jahren entwickeln werden. Immobiliengeschäfte sind daher, v.a. wegen ihres langen Frist, rheblich „spekulativer“. Wenn aber schon Immobilien, das viel gelobte und vermeintlich so inflationssichere „Betongold“, schon spekulative Anlagen sind, wie soll man dann Aktieninvestments bezeichnen? 18 Mit diesen Geschäften stiegen gleichzeitig die Gewinnmöglichkeiten für Währungsspekulanten (siehe Box 3). Die Auswirkungen auf den Währungsmarkt waren enorm: es war sowohl ein starkes Anwachsen der weltweiten Währungsreserven als auch eine massive Zunahme des Handels mit Devisen zu beobachten. Während Ende der 70er Jahre offiziell Währungsreserven im Umfang von 92 Mrd. US-Dollar gehalten wurden, waren es Anfang 2005 sagenhafte 3.800 Mrd. Dollar (Huffschmid 1999: 43, BIZ, 2005: 97). Dies entspricht einer Steigerung um mehr als das 40-fache. Insbesondere Schwellen- und Entwicklungsländer erhöhten ihre Währungsreserven zum Teil drastisch, um auf zunehmende Wechselkursschwankungen und spekulative Angriffe mit Devisenmarkintervention reagieren zu können. Während sie bis Anfang der 70er Jahre stets um die 25% der weltweiten Währungsreserven gehalten hatten, ist ihr Anteil bis Ende 2003 auf mehr als 60% angewachsen – damit werden in Schwellen- und Entwicklungsländern insgesamt mehr Währungsreserven gehalten als in den Industrieländern (IMF 2004, UNCTAD 2004: 61f)4. 4 Spekulation ist offensichtlich nicht immer ein bewusster, gewollter Prozess. Wenn ein brasilianischer Exporteur heute einen Auftrag für die Lieferung von 30 Tonnen Soja in die USA in 8 Monaten erhält, so kalkuliert er den Verkaufspreis in US-Dollar auf Grundlage der heutigen Kosten und des aktuellen Wechselkurses. Streng genommen wird er zum Währungsspekulant, wenn er heute kein Währungsabsicherungsgeschäft abschließt, dass ihm heute schon einen festen Wechselkurs garantiert, zu dem er in 8 Monaten die dann erhaltenen US-Dollar in brasilianischen Real umtauschen kann. Ohne ein solches Absicherungsgeschäft kann es ihm passieren, dass der Real in der Zwischenzeit gegenüber dem US-Dollar aufwertet und er in 8 Monaten einen geringeren Verkaufserlös (in Real gerechnet) erzielt als geplant. Natürlich ist es sinnvoll, Geschäfte danach zu unterscheiden, ob die Spekulation das primäre Ziel oder nur der unerwünschte Nebeneffekt einer wirtschaftlichen Aktivität ist. Einem Devisenkauf ist von Außen nicht anzusehen, ob er zur Abwicklung eines Warengeschäfts, einer Direktinvestition oder eines Termingeschäfts dient. Von daher ist es kaum möglich, am Währungsmarkt systematisch zwischen mehr oder weniger spekulativen Geschäften zu unterscheiden. Das Halten hoher Reserven bedeutet für Entwicklungsländer einen ökonomischen Verlust. Neben gewissen Bar- und Goldbeständen wird der größte Anteil der Devisenreserven zwar üblicherweise in Form von festverzinslichen staatlichen Wertpapieren gehalten, d.h. z.B. in US-amerikanischen oder deutschen Staatsanleihen. Dieses Geld könnten die Entwicklungsländer aber häufig gewinnbringender in ihren eigenen Ländern investieren (vgl. Dieter 2002). 64% der Devisenreserven werden in US-Dollar geAbbildung 2: Regionalstruktur der Weltwährungsreserven Quelle: Deutsche Bundesbank (2003: 17) Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass sich der Großteil dieser Währungsreserven auf einige wenige, den Schwellenländern zuzurechnenden Staaten konzentriert, wie z.B. China, Südkorea, Indien, Mexiko (vgl. Deutsche Bundesbank 2003: 16ff.). halten, es folgen Euro (20%) und Yen (5%). Damit entfallen fast 90% der weltweiten Devisenreserven auf die drei so genannten Weltleitwährungen (IMF, 2004: 119). Besonders aussagekräftig in Bezug auf die Entwicklung des Währungsmarktes ist der internationale Handel mit Devisen. Dessen Umfang explodierte seit Ende der 70er Jahre um mehr als das fünfzehnfache – von geschätzten 120 Mrd. Dollar pro Börsentag im Jahr 1979 auf 1.880 Mrd. Dollar pro Arbeitstag im Jahr 2004 (Huffschmid 1999: 43 und BIZ 2004: 76). Bei angenommenen 250 Börsentagen ergibt sich ein Jahresumsatz von 470 Billionen Dollar. Vergleicht man diese Zahl nun mit dem Umfang der realwirtschaftlichen Aktivitäten – das sind internationale Handelsgeschäfte und Investitionen –, so zeigt sich, dass Devisenmärkte offensichtlich höhere Umsätze verzeichnen, als sie für unmittelbare Abwicklung realwirtschaftlicher Transaktionen nötig wären. Die Summe, die für die Finanzierung des internationalen Güter- und Dienstleistungshandels notwendig ist, wuchs von 0,6 Billionen US-Dollar Ende der 70er Jahre auf 10,8 Billionen Dollar im Jahr 2004 (IMF 2005: 229); der gesamte Umfang der ausländischen Direktinvestitionen belief sich 2004 auf ca. 650 Mrd. Dollar (UNCTAD 2006). Zusammen gerechnet machten Welthandel und Direktinvestitionen 2004 nur knapp zweieinhalb Prozent des jährlichen Devisenumsatzes aus – 1983 waren es immerhin noch 9,3% (Staritz 2003: 11). Zugegebenermaßen relativiert sich die gewaltige Differenz zwischen realwirtschaftlichen Vorgängen und Devisenmarktumsätzen ein wenig, wenn man das den Devisenmärkten inhärente Prinzip des „hot-potato trading“ (Handel mit „heißen Kartoffeln“) in die Rechnung mit einbezieht (siehe auch Box 4, S. 21). „Bietet etwa ein Exporteur seinen Dollarerlös einer deutschen Bank an, so wird diese den Betrag zwar aufnehmen, die dadurch entstehende ‘offene Position’ aber sofort wieder durch Weitergabe an den Markt schließen. Die Weitergabe des ‘Schwarzen Peters’ (‘hot-potato-trading’) geht so lange fort, bis sich am Markt ein Partner findet, der den Dollarbetrag defi- nitiv aufnimmt.“ (Spahn 2002: 34). Jede von einem Endnachfrager, d.h. aus einem realwirtschaftlichen Grund ausgelöste Devisentransaktion bringt somit automatisch mehrere weitere Transaktionen mit sich; der Umsatz an den Devisenmärkten steigt dementsprechend. „Selbst bei Berücksichtigung mehrfacher Wechselkursabsicherungsgeschäfte für jede Gütertransaktion ist [jedoch] offensichtlich, dass der Umfang des Devisenhandels in keinem Verhältnis zum realen Güter- und Dienstleistungsverkehr steht. [...] Hier ist das Spekulationsmotiv offensichtlich maßgeblich.“ (Huffschmid 1999: 45). Währungen haben also heute eine Funktion, die sie vor der Freigabe der Wechselkurse und der Kapitalverkehrsliberalisierung zumindest nicht in diesem Umfang hatten. Sie sind zu einer eigenen, auf den Devisenmärkten gehandelten „Ware“ und damit zu einem Gegenstand geworden, mit dessen Kauf und Verkauf Händler Gewinn erzielen wollen. Der Preis dieser Ware ist der Wechselkurs – und dieser Kurs wird von Devisenkäufen und -verkäufen, also von Angebot und Nachfrage, mit beeinflusst (WEED, 2001: 6)5. Zunehmende Wechselkursschwankungen zogen jedoch nicht nur einen verstärkten direkten Handel mit Währungen nach sich, sondern auch eine Verstärkung der Absicherungs- und Spekulationsgeschäfte. Parallel zum Devisenmarkt ist auch der Markt für Derivate in den letzten Jahren enorm gewachsen. Das tägliches Handelsvolumen lag 2004 bei 2,4 Billionen US-Dollar. Derivative Instrumente, welche sich auf Devisen beziehen, machten mit 1,3 Billionen Dollar mehr als die Hälfte davon aus (BIZ 2005a: 16). Noch mehr als der Devisenmarkt ist der Markt für Derivate von hoch spekulativen Geschäften geprägt. Die BIZ geht davon aus, dass die Risikoabsicherung vor Wechselkurs- oder Preisschwankungen – eigentlich die Grundfunktion des Derivatemarktes6 – nur noch einen sehr geringen Teil des Marktes ausmacht. Der überwiegende Teil der Geschäfte hat den Charakter reiner Wetten. Es erfolgt immer wieder der Einwand, aufgrund der hohen Liquidität des Marktes könnten Devisenmarkttransaktionen Wechselkurse nicht nachhaltig beeinflussen. Aktionen einzelner Marktteilnehmer hätten auch unter Einsatz hoher Summen lediglich kleinste Schwankungen zur Folge, welche in einem System flexibler Währungskurse innerhalb kurzer Zeit vom Markt wieder ausgeglichen würden. Demgegenüber stehen die Theorien der Auswirkungen des so genannten “Herdenverhaltens” sowie Beispiele “erfolgreicher” kollektiver Spekulationen gegen Währungen, wie z.B. im Falle der Krise des Europäischen Währungssystems, als gegen das britische Pfund und anschließend die italienische Lira aus dem Währung solange spekuliert wurde, bis das gesamte System aufgegeben werden musste. 6 Allerdings war auch die Spekulation von Anfang an ein fester Bestandteil derivativer Märkte. Risikoabsicherung vor Preisschwankungen setzt voraus, dass jemand anders bereit ist , dieses Risiko zu übernehmen. Die Übernahme solcher Schwankungsrisiken ist notwendigerweise spekulativ. 5 19 Wenn der Peso purzelt 3.1.1 Orte, Akteure und Instrumente des Währungshandels „Seit dem Zusammenbruch des Festkurssystems von Bretton Woods hat sich ein globaler, sehr differenzierter internationaler Devisenmarkt herausgebildet. Die wichtigsten Devisen können heute jederzeit, von jedem Ort aus und in erheblichen Beträgen zu geringen Kosten gegen andere Währungen getauscht werden. [...] Die am Devisenmarkt gehandelten Volumina sind beeindruckend: einzelne Transaktionen von 200 bis 500 Millionen US-Dollar sind nicht unüblich, d.h. es handelt sich im wesentlichen um einen Markt für Großhändler.“ (Spahn 2002, 29). Wie muss man sich diesen enormen „Marktplatz“ sowie seine Händler und Waren nun konkret vorstellen? 20 Der Devisenmarkt (Foreign Exchange Market – Forex) ist ein „außerbörslicher“ Markt, d.h. der Handel findet größtenteils nicht an einem zentralen physischen Ort (einer Devisenbörse) statt, sondern funktioniert als sogenannter „Über den Tisch“ – (englisch „Over the Counter“ - OTC-) Handel über elektronische Handelssysteme, welche ein weitverzweigtes dezentrales Netz an Handelszentren und -plattformen weltweit miteinander verbinden. Die Marktteilnehmer schließen von ihren jeweiligen Handelsplätzen in den verschiedenen Finanzzentren aus direkt per Telefon oder Internet miteinander Geschäfte ab – ohne eine Börse als Zwischeninstanz einzuschalten. Im Gegensatz zum Modell des Börsenhandel treffen bei OTC-Transaktionen Anbieter und Nachfrager von Devisen direkt aufeinander und können die Bedingungen ihrer Geschäfte (Zeitpunkt der Abwicklung, Höhe der Orders, Verrechnungsmodalitäten etc.) daher flexibler auf ihre speziellen Bedürfnisse abstimmen. Großbritannien ist traditionell das führende Finanzzentrum im Devisenhandel; so auch 2004, als ca. ein Drittel der weltweiten Währungsgeschäfte in London getätigt wurden. Weitere wichtige Handelszentren liegen in den USA (19% Marktanteil), Japan (8%), Singapur (5%), Deutschland (5%) und Hongkong (4%) (BIZ 2005a: 2). Der Forex ist im Gegensatz zu den traditionellen Börsenparketten ein rund um die Uhr geöffneter Markt. Bis auf eine kleine Unterbrechung am Wochenende wird 24 Stunden täglich gehandelt, wobei der Markt im Laufe eines Tages über die verschiedenen Finanzzentren und deren Zeitzonen hinweg rund um den Globus wandert, beginnend mit den Handelsplätzen im asiatisch-pazifischen Raum (Sydney, Tokio, Hongkong, Singapur), über Westeuropa (Frankfurt, Zürich, London) hin nach Nordamerika (New York; nur jeweils die wichtigsten Orte genannt). 7 Am Devisenhandel, den man sich grundsätzlich wie jeden anderen Handel auch als ein Geschäft zwischen zwei Parteien vorstellen kann, ist im Normalfall zumindest auf einer Seite eine Bank beteiligt. Zum einen kann dies eine Zentralbank sein, die unter Einsatz ihrer Währungsreserven auf den Devisenmärkten interveniert, um den Wechselkurs der nationalen Währung zu beeinflussen.7 Je nach dem vorherrschenden Währungssystem sind die Motive der Intervention dabei unterschiedlich (für Details siehe Kapitel 5): In einem festen Wechselkurssystem interveniert die Zentralbank mit dem Ziel, einen bestimmten erwünschten Kurs der nationalen Währung zu stützten; bei flexiblen Wechselkursen soll z.B. eine zu große Volatilität des Wechselkurses verhindert werden (Moreno 2005: 5). In den letzten Jahren intervenierten insbesondere Zentralbanken einiger asiatischer Schwellenländer massiv an den Devisenmärkten, um eine Aufwertung ihrer Währungen gegenüber dem US-Dollar zu verhindern (BIZ 2005: 97f). Zum anderen agieren Geschäfts- und Investmentbanken am Währungsmarkt, und zwar auf zweierlei Art und Weise: Einerseits wickeln sie für ihre Kunden Aufträge ab und nehmen damit wie ein Zwischenhändler eine Vermittlerposition ein. Andererseits – und damit unterscheiden sie sich vom Zwischenhändler – spekulieren sie auch auf eigene Rechnung mit Währungen, also unter Einsatz eigenen Kapitals. In den letzten Jahren ist eine verstärkte Konzentration innerhalb des Bankensystems zu konstatieren, mit der Tendenz, dass das Geschäft in den einzelnen Finanzzentren von immer weniger Großbanken abgewickelt wird. Die Zahl der so genannten „Market Maker“ (siehe Box 3, S. 18), d.h. der Banken, die weltweit auf den Devisenmärkten agieren und auf Tabelle 2: Die weltweit 10 größten Banken im Devisenhandel Bank Anteil Devisenhandel % Deutsche Bank 16,72 USB 12,47 Citigroup 7,50 HSBC 6,37 Barclays Capital 5,85 Meryll Lynch 5,69 JP Morgan 5,29 Goldman Sachs 4,39 ABN Amro 4,19 Morgan Stanley 3,92 Quelle: Euromoney, 2005 Unter einer Intervention wird in einem engen Sinn ausschließlich eine auf den Wechselkurs bezogene Aktion einer Zentralbank verstanden. Dies heißt jedoch nicht, dass Zentralbanken nicht auch aus anderen Gründen auf Devisenmärkten agieren (vgl. Moreno 2005: 16f). Box 4: Das Market Maker Prinzip Das Market Maker Prinzip ist die vorherrschende Handelsmethode auf Devisenmärkten. Market Maker sind Marktteilnehmer, die verpflichtet sind, verbindliche Kurse und Mengen anzugeben, zu denen sie Wertpapiere oder Währungen dann auch real kaufen und verkaufen. Market-Maker müssen z.B. Kaufkurse für US-Dollar angeben, auch wenn sie aktuell gar keinen Bedarf an US-Dollar haben. Dadurch ergibt sich das oben genannte „hot-potatotrading“ bei dem ein z.B. von einem Unternehmen in den Devisenmarkt gebrachtes Dollar-Guthaben sehr häufig zwischen den Market Makern umläuft, bis es endlich bei einer Bank angelangt, die tatsächlich einen zusätzlichen Bedarf an Dollar-Guthaben hat. Im Wertpapierhandel wird statt des Market-Maker-Prinzips zumeist das Auktionsprinzip angewandt. Beim Auktionsprinzip werden zwischen Anbietern und Nachfragern zuerst Verhandlungen geführt, bis diese sich hinsichtlich Preis und Menge einigen. Der konkrete Umsatz erfolgt erst nach Abschluss der Preisverhandlungen. Beim MarketMaker-Prinzip hingegen werden ständig einzelne Geschäfte mit leicht abweichenden Preisen abgeschlossen, so dass insgesamt sehr viel höhere Umsätze entstehen. Nachfrage ständig für die wichtigsten Währungspaare Wechselkurse angeben, wird von der BIZ mit nur noch 20 angegeben (BIZ 2001: 49). Die Banken können mit verschiedenen Parteien ein Währungsgeschäft abschließen: mit einer zweiten Finanzinstitution – dies kann entweder eine andere Bank oder ein institutioneller Investor sein – oder mit dritten, nicht-finanziellen Kunden (z.B. transnationale Konzerne, Direktinvestoren, private Einzelpersonen usw.). Mehr als die Hälfte aller Währungsgeschäfte sind so genannte Interbankgeschäfte, d.h. sie laufen zwischen zwei Banken ab. In den letzten Jahren hat allerdings insbesondere der Handel zwischen Banken und institutionellen Anlegern wie z.B. Pensionsfonds oder Hedge-Fonds stark zugenommen und macht mittlerweile über ein Drittel des gesamten Devisenhandels aus. Der Handel von Banken mit nicht-finanziellen Kunden ist zwar auch gestiegen, fällt aber mit 14% nach wie vor prozentual eher gering aus (BIZ 2005a: 6f). Im Wesentlichen ist und bleibt der Forex damit ein Marktplatz für Finanzinstitutionen und institutionelle Anleger. Allerdings können mittlerweile auch private „Klein-Händler“ über Online-Handelsplattformen unter Einsatz relativ geringer finanzieller Mittel verlockend hohe Gewinne erzielen – oder entsprechend große Verluste erleiden. Grundsätzlich lassen sich drei Arten von Devisengeschäften voneinander unterscheiden: Kassageschäfte, Termingeschäfte und Devisen-Swaps. 1. Der Kassamarkt ist sozusagen der konventionelle „Hier und jetzt Markt“. Im Kassageschäft (Spotgeschäft) werden zwei Währungen zu einem bestimmten Kurs gegeneinander getauscht, wobei die Verrechnung spätestens am zweiten Werktag nach Abschluss des Kontraktes erfolgen muss. 2. Ein Termingeschäft ist ein heute abgeschlossener Vertrag über den zukünftigen Handel eines Währungspaares zu einem bei Vertragsabschluss festgelegten Kurs. Im Unterschied zum Kassageschäft erfolgt die Abwicklung des Währungsgeschäfts also nicht zeitnah, sondern bei Fälligkeit des Vertrags, z.B. in drei oder sechs Monaten. 3. Das mittlerweile am häufigsten vorzufindende Devisengeschäft ist ein kombiniertes Kassa-TerminGeschäft, ein so genannter Devisen-Swap. Unter einem Devisenswapgeschäft versteht man einen Kassa-Devisenverkauf (d.h. ein Geschäft mit sofortiger Erfüllung) bei gleichzeitigem Rückkauf desselben Devisenbetrages auf Termin (d.h. mit späterer Erfüllung) oder umgekehrt. Solche Geschäfte machen z.B. Sinn, wenn ein Anleger 10.000 Euro für 6 Monate in US-Dollar anlegen will, weil die Zinsen auf Dollar-Festgelder höher sind als die auf EuroFestgelder. Durch den Devisen-Swap kennt der Anleger schon jetzt den genauen Wechselkurs, zu dem er in 6 Monaten sein Geld von US-Dollar zurück in Euro tauschen wird. Im konkreten Fall wird ein vorsichtiger Anleger sein Geld dann vorübergehend in US-Dollar anlegen, wenn der Preis, den er für den Devisen-Swap bezahlt, geringer ist als der Betrag, den er durch die höheren Zinsen in den USA erhält. Der US-Dollar spielt beim Devisenhandel mit Abstand die wichtigste Rolle. Im Jahr 2004 war er in ca. 89% der weltweiten Devisentransaktionen eine der beteiligten Währungen (es sind ja immer zwei Währungen an einer Transaktion beteiligt), es folgen Euro (37%) und Yen (20%). Der Anteil der Währungen von Schwellenländern am Devisenhandel stieg von 4,5% auf 5,2%. Die weltweit am öftesten gehandelten Währungspaare waren Dollar/Euro mit 28% und Dollar/Yen mit 17% Marktanteil an allen gehandelten Währungspaaren (BIZ 2005a: 10). 3.1.2 Die Währungsspekulation Die anhaltende Wechselkursvolatilität der G3 (USDollar, Euro, Yen) eröffnet Währungsspekulanten große Gewinnpotentiale, die sie an den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten nicht erzielen 21 Wenn der Peso purzelt Box 5: Wie funktioniert ein Währungsgeschäft: Zwei Beispiele X ist Devisenhändler („Trader“) einer Großbank, die international Devisengeschäfte tätigt. Sein Arbeitsplatz ist in einem Londoner Großraumbüro, sein Schreibtisch bestückt mit mehreren Computerbildschirmen und mindestens einem Telefon. Sein Auftrag ist die Erzielung eines größtmöglichen Gewinnes im Kassageschäft durch das Ausnutzen von kleinsten Wechselkursschwankungen, die sich im Bereich der vierten Stelle hinter dem Komma (genannt ‘Pip’) abspielen. Im Laufe eines Tages nimmt er unzählige Devisentransaktionen vor. Anders als noch vor einigen Jahren wird heute der Großteil der Geschäfte via Internet und nicht mehr telefonisch getätigt. X wählt einige Währungspaare aus, mit denen er handeln möchte und deren aktuelle Kauf- und Verkaufskurse (‘Bid and Ask’) ständig auf den Bildschirmen zu sehen sind. 22 Auf Grund seiner Marktanalyse rechnet X mit einer Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Per Mausklick kauft er mit Dollar eine große Summe Euro zu einem bestimmten Euro-Dollar-Wechselkurs von einer asiatischen Bank. Wenn der Euro ein wenig später dann tatsächlich in geringem Maße aufwertet, kann X die zuvor gekauften Euro gegen Dollar an eine Schweizer Bank verkaufen. X hat damit beim Verkauf der Euro eine größere Summe Dollar erhält, als er zuvor beim Kauf eingesetzt hatte. Die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufserlös ist der Gewinn, welcher seinem Arbeitgeber bzw. dessen Kunden zufließt. Umgekehrt kann X natürlich auch auf eine Währungsabwertung spekuliert werden. In diesem Fall muss unser Trader Euro also zuerst verkaufen und sie später zu einem günstigeren Preis zurück erwerben. Bei mehreren Hundert Devisentransaktionen pro Tag – durchaus kein Einzelfall für einen professionellen Händler – rechnen sich die potentiellen Gewinne aus den Einzeltransaktionen im besten Fall zu einer schönen Gewinnsumme zusammen. können. Währungsspekulation vollzieht sich also in erster Linie als bewusster Einsatz auf eine Wechselkursbewegung. Aber nicht nur eine gezielte Wette auf einen steigenden oder fallenden Wechselkurs, sondern z.B. auch ein nicht ausreichend gegen Währungsrisiken abgesichertes Exportgeschäft (ein ‘ungehedgtes’ Geschäft) kann als Spekulation bezeichnet werden (siehe Boxen 2 und 3). In erster Linie werden nicht Kleinanleger, sondern institutionelle Investoren wie Investment-Gesellschaften, Banken, Versicherungen etc. und unter diesen wiederum insbesondere Hedge-Fonds mit spekulativen (Währungs)Geschäften in Verbindung gebracht. In den letzten Jahren wuchs die HedgeFonds Branche enorm, und zwar sowohl hinsichtlich der absoluten Zahl existierender Fonds als auch bezüglich der von ihnen kontrollierten finanziellen Y hat sich entschieden, als Privatkunde über die OnlineHandelsplattform einer Devisenbank ins spekulative Währungsgeschäft einzusteigen. Bereits mit einem in Verhältnis zu den Einsätzen von Banken und institutionellen Investoren geringen Betrag (z.B. 10.000 Euro) kann Y hohe Summen verschieben und damit auch als Einzelperson von kleinsten Kursschwankungen profitieren. Das funktioniert folgendermaßen: Y eröffnet bei der Handelsplattform der Devisenbank ein Konto und muss auf diesem Konto einen gewissen Prozentsatz der Summe, mit der er spekulieren möchte, zur Absicherung vor möglichen Handelsverlusten einzahlen. Diese „Leistungsverpflichtung“ gegenüber der Bank nennt man Margin. Beträgt die Margin z.B. 4%, so kann der Privathändler mit einem Hebeleffekt (Leverage-Effekt) von eins zu 25 handeln, d.h. de facto ein 25mal höheres Volumen zum Handel einsetzen, als er tatsächlich auf dem Konto hinterlegt hat. Aus einem eingesetzten Grundkapital von 10.000 Euro werden so 250.000 Euro, die er zum Kauf von Devisen verwenden kann. Y kann so unter Umständen hohe Renditen erzielen. Sollte Y z.B. auf eine Aufwertung des US-Dollars spekulieren, kauft er für 250.000 Euro zum Kurs von 1,25 312.500 US$. Angenommen der Dollar wertet tatsächlich innerhalb von zwei Börsentagen um einen Viertel-Prozentpunkt (0,25%) auf (fällt also der Euro von 1,25 auf 1,2469), dann bekommt er beim Verkauf der 312.000 US$ 250.625 Euro. Er hat also innerhalb von zwei Börsentagen bei einem Einsatz von 10.000 Euro 625 Euro bzw. 6,25 Prozent Gewinn gemacht. Sollte Y auf Jahr hochgerechnet immer so erfolgreich spekulieren, dann würden aus seinen 10.000 Euro bei 250 Börsentagen 78.125 Euro. Es sind solche, wenngleich extrem unwahrscheinlichen, Aussichten, die das Spekulationsfieber von spekulativen Privatanlegern antreiben. Mit etwas weniger Glück verspekuliert Y allerdings innerhalb kurzer Zeit sein Kapital. Mittel. Schätzungen zu Folge gibt es weltweit über 8.000 Hedge-Fonds, die insgesamt über ein Anlagevermögen von mehr als 1.200 Milliarden Dollar verfügen (Spiegel 2005, Financial Times Deutschland 2006). Ein besonders prominentes und oft zitiertes Beispiel einer Währungsspekulation eines HedgeFonds sei auch hier erwähnt: Der Quantum Fonds des George Soros spekulierte Anfang der 90er Jahre unter Einsatz immenser Summen – Schätzungen sprechen von einem zweistelligen Milliardenbetrag – gegen das britische Pfund. Die britische Zentralbank konnte trotz massiver Stützungskäufe eine Abwertung der Währung nicht verhindern, mit dem Ergebnis, dass das Pfund aus dem Europäischen Währungssystem (EWS) ausscheiden musste. Soros erzielte für seinen Fonds einen geschätzten Gewinn von einer Mrd. Dollar (Huffschmid 1999: 95). Aber nicht nur die als „skrupellose Haie“ oder “Heuschrecken“ verschrienen Hedge Fonds, sondern auch transnationale Konzerne und Banken verdienen oder verlieren kräftig mit dem Devisengeschäft. DaimlerChrysler z.B. „erwirtschaftete“ über die Hälfte des operativen Gewinns im zweiten Quartal 2003 nicht etwa durch Autoverkäufe, sondern durch Währungsgeschäfte und Umrechnungseffekte. Der Automobilhersteller legte Wert darauf, dass es sich nicht um spekulative Geschäfte gehandelt habe, sondern um erfolgreiche Absicherungsstrategien. Im Gegensatz zu DaimlerChrysler verfolgt der Volkswagen-Konzern bereits seit Jahren eine Strategie der geringen Absicherung gegen Währungsrisiken. Im Jahr 2000 zahlte sich diese Taktik noch aus, VW konnte vom hohen Dollarkurs profitieren und unter anderem auch deshalb ein weiteres Rekordjahr vermelden. Drei Jahre später dann musste VW auf Grund der Dollar-Schwäche, gegen die man sich nicht ausreichend abgesichert hatte, erhebliche Verluste hinnehmen. Bereits Ende der 80er Jahre verlor VW fast 400 Millionen Dollar durch schief gegangene Dollar-Termingeschäfte mit der ungarischen Nationalbank (Seifert-Granzin, 1996: 39). Die hier beschriebene Strategie, sich gegen Kursschwankungen abzusichern und diese quasi nebenbei noch für Spekulationsgewinne zu nutzen, kann jedoch nur von den so genannten „global players“, also großen finanzstarken Weltkonzernen, verfolgt werden. Die vom deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten“ stellt in ihrem Abschlussbericht im Mai 2002 fest: „Diese Möglichkeiten stehen kleinen und mittleren Unternehmen im Gegensatz zu Konzernen in geringerem Maße und manchen Entwicklungsländern gar nicht zur Verfügung. Die große Volatilität der Kursbewegungen ist für sie wegen der Wirkung auf Import- und Exportpreise, Zinsbewegungen, Einkommen und Staatseinnahmen eher schädlich. Dies betont auch die UNCTAD (2001) in ihrem World Investment Report (WIR). Daher haben vor allem Entwicklungsländer und [kleinere und mittlere Unternehmen] Interesse an einer Reduzierung der Volatilität, nicht die großen „global players“, die genügend Instrumente zur Verfügung haben, die Volatilität durch jeweilige Gegengeschäfte zu kompensieren oder sogar spekulativ auszunutzen.“ (Deutscher Bundestag, 2002: 91). Die Deutsche Bank z.B. gibt in ihrem Geschäftsbericht 2000 an, 1 Mrd. Euro bzw. 14% ihres erfolgreichen Handelsergebnisses dem Devisenhandel zu verdanken. Zwar betont die Bank, dass das Devisengeschäft nach wie vor zum Großteil ein Kundengeschäft sei (und damit keine Spekulation auf eigene Rechnung) – sie hütet sich jedoch davor, den Ertrag aus dem Handel mit Währungen näher aufzuschlüsseln (Deutsche Bank, o.J.). Mit Devisenspekulation sind Unternehmen aber auch große Verluste entstanden „Die größte deutsche Landesbank, die WestLB, verlor Ende der siebziger Jahre zum Beispiel rund 300 Millionen Mark durch Devisenspekulationen. Und eine der größten Finanzaffären der Nachkriegszeit, die Pleite der Kölner Privatbank I. D. Herstatt, geht auf Devisentermingeschäfte zurück.“ (Brand Eins 2001). Solange sie nicht selbst spekulieren, verdienen Banken an Absicherungsgeschäften auf jeden Fall gut, denn allein die Transaktionsgebühren, die sie ihren Kunden für solche Geschäfte in Rechnung stellen, sind ein einträgliches Geschäft. Der Großteil der täglichen Devisenumsätze ist kurzfristiger Natur mit einer Laufzeit der Anlagen von weniger als einer Woche. Ziel eines guten Teiles dieser kurzfristigen Anlagen ist das Ausnutzen kleinster Kursänderungen (WEED 2001: 6). „Dass die Spekulanten – im Gegensatz zu den Unternehmen – nichts so sehr lieben wie stetige Wechselkursschwankungen, ist [...] unbestritten. Mit Währungsschwankungen wird im Devisenhandel das große Geld verdient.“ (NZZ, 1997) 23 Wenn der Peso purzelt Kapitel 4 Möglichkeiten und Grenzen einseitiger Wechselkurspolitik 4.1. Formen von Wechselkurssystemen S o lange das globale Währungssystem von hoher Instabilität und Dominanz der G3 geprägt ist, ist die Anpassung an dieses System, d.h. die unilateral bzw. regional gewählte Wechselkursstrategie von enormer Bedeutung für die wirtschaftliche und soziale Situation von Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese Tatsache erhält insbesondere vor dem Hintergrund der verheerenden sozialen und ökonomischen Auswirkungen der Finanz- und Währungskrisen, die sich seit den 90er Jahren ereigneten, Gewicht. 24 Es stellt sich demnach die Frage, welches Wechselkursregime für welches Land in welchem spezifischen Entwicklungsstadium das am besten geeignete ist. Die ökonomische Theorie hält eine Vielzahl an verschiedenen Wechselkurssystemen bereit, die in einem Kontinuum zwischen den Extremen „fester Wechselkurs“ (hard peg) einerseits und „völlig flexibler Wechselkurs“ (free floating) andererseits bewegen. Innerhalb des Kontinuums lassen sich drei übergeordnete Kategorien ausmachen: die Gruppe der festen Wechselkurssysteme (hard pegs), die Gruppe der intermediären Regime (soft pegs) und die der flexiblen Wechselkurssysteme (floating regimes) (vgl. Fisher, 2001: 2). Die Positionierung der verschiedenen Formen im Kontinuum ist nicht unproblematisch und kann allenfalls einer übersichtlichen Veranschaulichung dienen. So kann z.B. jedes der intermediären Regime je nach praktischer Handhabung und Konzeption hinsichtlich seines Grades an Flexibilität bzw. Fixierung erheblich variieren. Zudem schließen sich die einzelnen Merkmale der Zwischenlösungen gegenseitig nicht aus, sondern können in der Praxis miteinander kombiniert werden (vgl. Fraenkel 2003: 6). 4.1.1 Feste Wechselkurssysteme Am rigiden Ende des Kontinuums befinden sich Währungsunion, Dollarisierung und Currency Board als Formen fester Wechselkurssysteme. Die Idee der WähAbbildung 3: Kontinuum der Wechselkurssysteme rungsunion, d.h. einer regionalen Währungskooperation mit einer Gemeinschaftswährung, unterscheidet Absolut festes Wechselkurssystem sich von allen anderen Modellen Währungsunion darin, dass es sich zwingend um eine Feste Wechselkurssysteme multilaterale Anstrengung handelt. Dollarisierung, Euroisierung (Hard Pegs) Neben einer Währungsunion als sehr weitgehender Integrationslösung Currency Board kommt auch eine WährungskooperaAnpassfähiges Fixkurssystem tion in Frage. Zwei Möglichkeiten (Adjustable Peg) der regionalen Währungskooperation Fixkurssystem mit Währungskorb (Basket Peg) sind denkbar: zum einen besteht die Intermediäre Regime (sicherlich zu bevorzugende) Option (Soft Pegs) Crawling Peg / Crawling Band der Integration in einen Währungsblock mit einer Leitwährung (wie z.B. Fixkurssystem mit Zielzonen der D-Mark als Leitwährung bei der (Band, Target Zone) Konzeption der Euro-Zone); zum Managed Floating Flexible anderen ist auch eine WährungsWechselkurssysteme union mehrerer ‘SchwachwährungsVöllig flexibler Wechselkurs (Floating Regimes) länder’ vorstellbar, z.B. der Mercosur(Free / Pure Floating) Zone oder der Staaten des südlichen Absolut flexibles Wechselkurssystem Quelle: Frankel 54, 5 und Dieter 8, 32/33 Afrika (vgl. Fritz, 2004). Box 6: Länderbeispiel Currency Board: Argentinien Im Jahr 2001 geriet Argentinien in eine tiefe Finanzund Währungskrise, ein Land, welches seit Anfang der 90er Jahre vollständig einen vom IWF empfohlenen wirtschaftspolitischen Weg eingeschlagen hatte. Damit erlitt auch ein vom internationalen ökonomischen Mainstream bis dato gefeiertes Währungsmodell, das so genannte Currency Board, krachenden Schiffbruch. „[Der] Zusammenbruch der argentinischen Ökonomie [muss] als einer der schwersten seit der Great Depression gehandelt werden. Nicht nur hat das Land den bisher größten default [Zahlungsstopp, d. Verf.] der Weltwirtschaft erklärt, seit es für seine 150 Milliarden US-Dollar Außenschulden die Zahlungsunfähigkeit ausrufen musste; die Binnenrezession, die nunmehr ins vierte Jahr geht, hat inzwischen das nationale Volkseinkommen um annähernd 20% reduziert [...]. Eine Ökonomie befindet sich im freien Fall, und mit ihr die Strukturen von Politik und Gesellschaft.“ (Fritz 2002: 115) Dabei sah zu Beginn alles nach einer Erfolgsgeschichte aus: Nach Jahren des erfolglosen Kampfes gegen die Hyperinflation (die 1989 auf über 4.500% angestiegen war, vgl. WEED 2001, 34f.) beschloss die argentinische Regierung 1990/1991, Währungsstabilität und wirtschaftliche Gesundung von Außen zu importieren. Die Landeswährung Peso wurde im Rahmen der Einrichtung eines Currency Board im Verhältnis 1:1 unverrückbar fest an den US-Dollar gebunden; zusätzlich erfolgte eine weitgehende Liberalisierung und Deregulierung der argentinischen Ökonomie (vgl. WEED 2001a: 34f.). Beide Maßnahmen sollten vor allem dazu beitragen, ausländisches Kapital ins Land zu locken und den erhofften Aufschwung damit zu finanzieren. Die Phase des wirtschaftlichen Niedergangs schien in der Folge auch tatsächlich durchbrochen zu sein: das inländische Preisniveau konnte stabilisiert werden, ausländisches Kapitals floss ins Land, von 1991 bis 1998 wurden fast durchweg hohe Wachstumsraten erzielt. Spätestens seit Argentinien sich resistent gegenüber den Ansteckungsgefahren der Asien-Krise erwiesen hatte, galt das Currency Board als Erfolgsmodell für Entwicklungs- und Schwellenländer (Fritz 2002: 116). Die Nachteile der absolut festen Bindung der Landeswährung an den Dollar in Form eines Currency Board und dessen verheerende Folgen sollten jedoch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Eines der Hauptprobleme eines Currency Board – die nicht vorhandene Reaktionsmöglichkeit auf sich verändernde Wettbewerbsbedingungen – wog im argentinischen Fall besonders schwer: Der Real (Währung des wichtigen Handelspartners Brasilien) verlor von 1997 bis 2001 gegenüber dem US-Dollar ca. 60% an Wert, auch der Euro wertete seit 1999 gegenüber dem Dollar ab – der Peso dagegen blieb fest an den Dollar gebunden. Die daraus resultierende Peso - Überbewertung bedeutete für die argentinische Ökonomie, die mehr als die Hälfte ihrer Exporte nach Brasilien und Europa lieferte, einen immensen Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. In der Konsequenz führte dies zu einem Anstieg der Importe, einem Rückgang der Exporte und damit zu einem steigenden Handelsbilanzdefizit und einem Mangel an Devisen. Die günstigste und schnellstmögliche währungspolitische Reaktion auf eine derartig veränderte Wettbewerbsposition wäre eine Währungsabwertung gewesen – eine Möglichkeit, die innerhalb eines Currency Board aber ausgeschlossen ist. Argentinien war also nicht in der Lage, auf sich verändernde externe Bedingungen angemessen zu reagieren (vgl. auch Sangmeister 2000: 2f.). Die üblichen Kettenreaktionen traten schon bald ein: Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung führten zu Vertrauensverlust der ausländischen Investoren und damit zu einer Umkehr der Kapitalflüsse, wodurch das Land in noch größere Zahlungsschwierigkeiten geriet usw. (vgl. Fritz/Nolte 2004: 3). Nach Beginn der wirtschaftlichen Probleme im Jahr 2000 beschloss der IWF, einen internationalen Großkredit im Umfang von 40 Mrd. Dollar bereitzustellen. Nachdem sich die Lage dann weiter verschlechterte und der IWF im Dezember 2001 die Auszahlung einer fälligen Kredittranche verweigerte, stürmten die argentinischen Bürger die Banken, um sich ihre großteils in Dollar gehaltenen Bankeinlagen auszahlen zu lassen. Wirtschaftsminister Domingo Cavallo ließ daraufhin über Monate hinweg die Dollar-Bankkonten der argentinischen Bürger einfrieren (das so genannte „corralito“). Im Januar 2002 musste Argentinien seine Zahlungsunfähigkeit erklären. Nachdem der Wechselkurs des Peso am 10. Januar desselben Jahres freigegeben wurde, wertete er gegenüber dem Dollar drastisch ab und verlor bis April 2002 ca. 70% seines Außenwertes. Die Folgen der durch das Currency Board ausgelösten argentinischen Krise sind dramatisch. Der Zusammenbruch der nationalen und internationalen Kreditbeziehungen, der freie Fall des Wechselkurses, ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit auf über 20% und die extreme Unsicherheit über die ökonomische und politische Zukunft führten dazu, dass die ökonomischen Aktivitäten weitgehend zusammenbrachen. Im Vergleich zu 1998 fiel das Bruttoinlandsprodukt bis Ende 2002 um ca. 20% (IMF, 2005). Die Last der Auslandsverschuldung war im Vergleich zu 1990 infolge der Finanz- und Währungskrise geradezu explodiert; das Verhältnis Brutto-Auslandsverschuldung zu Exporten lag im Jahr 2001 bei 612% – selbst nach den Kriterien der Weltbank gilt ein Land bereits ab 220% als hochverschuldet (vgl. Fritz/Nolte 2004). „Das Beispiel Argentiniens zeigt [...] sehr deutlich, dass die Empfehlungen des IWF zur Schaffung eines festen Wechselkurses mittels eines sogenannte Currency Board eine Volkswirtschaft in eine ausweglose Lage bringen können.“ (Dieter 2002a: 7) 25 Wenn der Peso purzelt Dollarisierung als Wechselkursregime bedeutet nicht eine Ablösung der inländischen durch eine ausländische Währung im täglichen Wirtschaftsleben, v.a. auf Schwarzmärkten und im informellen Sektor, sondern vielmehr die bewusste politische Entscheidung für die aktive Übernahme einer Fremdwährung als einziges Zahlungsmittel im Inland. Dies heißt die völlige Abschaffung der eigenen Währung. Das entsprechende Land gibt damit sowohl den Gewinn durch die Ausgabe eigenen Geldes („Seigniorage-Gewinn“) als auch seine währungspolitische Souveränität auf (vgl. Fritz 2004: 12). „Die Botschaft ist eindeutig: will man politische und wirtschaftliche Autonomie, sollte man die eigene Währung nicht durch die eines anderen Landes ersetzen.“ (Dieter 2002: 188) 26 Die härteste Form der unilateralen Währungsanbindung unter Beibehaltung der inländischen Währung stellt das Currency Board dar. Es hat drei wesentliche Merkmale: erstens wird der Wechselkurs zur Ankerwährung festgesetzt, zweitens wird eine unbeschränkte Konvertibilität der Landeswährung in die Ankerwährung garantiert, und drittens erfolgt die vollständige Deckung des inländischen Geldbestandes durch Devisenreserven (vgl. Dieter 2002a: 19). Die Geldpolitik ist dem Wechselkursregime damit vollständig untergeordnet; die inländische Liquidität und das inländische Zinsniveau sind abhängig von Kapitalzu- bzw. -abflüssen (vgl. ICEG 2000). „Verfechter von Currency Boards betonen, diese würden für Glaubwürdigkeit, Transparenz, niedrige Inflationsraten und monetäre wie fiskalische Stabilität sorgen. [...] Einige dieser Effekte können tatsächlich erreicht werden, wenn auch nur zeitweise.“ (Dieter 2002: 187) Dem unbestreitbaren Vorteil der Stabilität stehen jedoch zumindest zwei schwerwiegende Nachteile gegenüber: erstens verliert die nationale Zentralbank ihre zentralen wirtschaftspolitischen Steuerungsinstrumente und damit jegliche Kontrollmöglichkeit des inländischen Geldbestandes und Zinsniveaus. Zweitens kann die Anpassung an externe Schocks nicht mehr durch Anpassung des nominalen Wechselkurses, sondern nur durch eine aufwändige und kostspielige Politik der Deflation, d.h. durch Senkung des inländischen Preis- und Reallohnniveaus, vorgenommen werden (vgl. Dieter 2002a: 20). 4.1.2 Intermediäre Regime Zwischen den beiden Extremlösungen hard peg und free floating befindet sich eine Vielzahl an intermediären Wechselkurssystemen. 8 Ein adjustable peg entspricht dem System, wie es in Bretton Woods 1944 eingerichtet wurde und wie es die Mehrzahl der von der Asien-Krise betroffenen Schwellenländer bis Mitte der 90er Jahre praktizierte: ein anpassfähiges Fixkurssystem. Dabei wird der Wechselkurs zu einer Ankerwährung zwar festgelegt, es besteht jedoch – im Unterschied zum Currency Board – unter bestimmten Umständen die Möglichkeit einer Anpassung. So könnte z.B. Land im Fall eines „externen Schocks“8 eine kontrollierte Abwertung zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgen (vgl. Flassbeck 2000: 8). Theoretisch kann der Stabilitätsvorteil eines „monetären Ankers“ in diesem Fall mit dem Erhalt der geldpolitischen Autonomie, also der Hoheit über die Zinspolitik, verbunden werden. Nach den Finanzkrisen in Ostasien wurden adjustable pegs jedoch von vielen Seiten als extrem spekulationsanfällig erachtet: „Solche festen, aber prinzipiell anpassfähigen Wechselkurse sind anfällig gegen spekulative Attacken, weil Regierungen und Notenbanken, die einen festen Wechselkurs lange verteidigt und damit beispielsweise erfolgreich die Inflation im eigenen Land bekämpft haben, dazu neigen, den Wechselkurs auch dann noch zu verteidigen, wenn es nicht mehr gerechtfertigt ist.“ (Flassbeck 2002: 20) Eine Möglichkeit, die Vorteile eines „monetären Ankers“ mit einer größeren Anpassungsfähigkeit des Wechselkurses an externe Veränderungen zu verbinden, bietet ein Fixkurssystem mit einem Währungskorb (basket peg) (ICEG 2000: 2). Der Wechselkurs wird an einen Währungskorb gebunden, wobei Anzahl und Gewichtung der Währungen im Korb so gewählt werden, dass sie das Handelsmuster des betreffenden Landes wiederspiegeln. Theoretisch liegt der Vorteil eines basket peg darin, dass das Land vor unberechenbaren Schwankungen ‘dritter’ Wechselkurse (vor allem der Kurse der drei Weltwährungen Euro, Dollar und Yen) geschützt und der reale Wechselkurs damit stabilisiert werden kann (vgl. Williamson 2000: 3). Bei einem crawling peg handelt es sich um eine gegenüber einer Ankerwährung vorgegebene „regelmäßige Anpassung des Wechselkurses aufgrund der Veränderung eines Indikators, z.B. der unterschiedlichen Inflationsentwicklung zwischen Inland und Ankerwährungsland“ (Dieter, 2002a: 32). Die primären Ziele dieses von vielen osteuropäischen Transformationsländern gewählten Wechselkursregimes sind, den realen Wechselkurs konstant zu Ein “externer Schock” ist eine starke kurzfristige Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auf die das betroffene Land keinen Einfluss hat. Wenn ein Entwicklungsland hauptsächlich aus den USA importiert, in die EU exportiert und seine Währung fest an den US-Dollar gebunden hat, dann kann eine starke Veränderung des Euro-Dollar-Wechselkurses ein externer Schock sein, auf den das Land reagieren muss. halten und/oder hohe Inflationsraten zu bekämpfen (vgl. VII, 3). Nach Ansicht von Michael Mussa vom IWF wurde die Mehrzahl der auf den Wechselkurs zurückzuführenden erfolgreichen Disinflationen seit den späten 80er Jahren über den Einsatz von crawling pegs bzw. crawling bands erreicht (ICEG, 2000). Am unteren, ‘flexiblen’ Rand der intermediären Regime liegt das Fixkurssystem mit Bandbreiten bzw. Zielzonensystem (band bzw. target zone). Der Wechselkurs einer Währung wird zwar auf eine Ankerwährung bzw. einen Währungskorb ausgerichtet, jedoch werden Bandbreiten definiert, innerhalb derer der Kurs gegenüber der Ankerwährung schwanken darf. Auch bei dieser Form ist das zentrale Ziel, den realen Wechselkurs und damit die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes langfristig konstant zu halten (vgl. 39, Flassbeck 2002: 16). Inwiefern eine recht Box 7: Länderbeispiel adjustable peg: Thailand Der offizielle Beginn der Asienkrise wird im Allgemeinen mit der Freigabe des Wechselkurses des thailändischen Baht im Juli 1997 markiert. Damit brach die Krise überraschend in einem Land aus, dessen ökonomische Entwicklung vorbildhaft zu verlaufen schien: Thailand verzeichnete von 1990-1995 mit durchschnittlich 8,5% hohe BIP-Wachstumsraten (vgl. Huffschmid 1999: 162) bei zugleich relativ niedrigen Inflationsraten (zwischen 3 und 6%). Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes wurde in erheblichem Maße durch Kapitalzuflüsse aus dem Ausland finanziert. Die liberale Wirtschaftspolitik Thailands galt in den Augen des internationalen ökonomischen Mainstreams als Musterbeispiel des Modells fremdfinanzierter nachholender Entwicklung (Köhler 1998: 3f.). Bei der Ursachenanalyse der Krise wurde neben vielen anderen Faktoren auch das in Thailand praktizierte System eines festen, prinzipiell anpassfähigen Wechselkurses (adjustable peg) gegenüber dem US-Dollar als krisenanfällig identifiziert – erstaunlicherweise insbesondere vom IWF, der das Wechselkursregime zuvor befürwortet hatte. Inwiefern trug der thailändische adjustable peg zur Krise bei? Grundsätzlich traten zwei Probleme in Verbindung mit dem festen Wechselkurs auf (die jedoch nur im Rahmen zuvor erfolgter, vom IWF vorangetriebener wirtschaftspolitischer Weichenstellungen ermöglichet wurden, z.B. durch die Anfang der 90er Jahre erfolgte Kapitalverkehrsliberalisierung): Zum einen begünstigte das Wechselkursregime, in Verbindung mit im Vergleich zu den Industrieländern hohen Zinssätzen, den Zufluss großer Mengen an überschüssigem Kapital aus den Industrieländern, v.a. in Form von Bankkrediten mit kurzfristiger Laufzeit (vgl. Huffschmid 1999: 164). „So gesehen erschien damals die Konstellation der thailändischen Zins- und Wechselkurspolitik als ein ‘free lunch’ für die internationalen Investoren. Was konnte es besseres geben als eine kurzfristige Bath-Anlage, die man über eine preiswerte Kreditaufnahme am US-Dollar-Markt finanzierte?“ (Bofinger 2001: 2). Zum anderen erwies sich das Wechselkurssystem als nicht resistent gegenüber der Währungsspekulation. Im thailändischen Fall zeigte sich das verheerende Zusammenspiel dieser beiden Faktoren besonders deutlich: Als der US-Dollar – und damit auch der an ihn gebundene Baht – im Vergleich zum japanischen Yen aufwertete, verschlechterte sich die thailändische Wettbewerbsposition gegenüber dem wichtigen Handelspartner und Exportkonkurrenten Japan. Als Folge stiegen die Importe, während die Exporte zurückgingen, das bisher harmlose Leistungsbilanzdefizit wuchs. Infolge erster Unsicherheiten über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes beginnt nun die Krisen-Spirale: „Die [durch den festen Wechselkurs vorhandene, d. Verf.] Verwundbarkeit schlägt um in Verwundung. Die ersten durch Überschusskapital aufgedrückten Projekte platzen. Die ersten Anleger bezweifeln die Haltbarkeit des Wechselkurses und ziehen ihr Geld ab. [...] Nach den ersten Anzeichen einer prekären Entwicklung steigt die Währungsspekulation ein, und das ist das Ende. Innerhalb weniger Stunden schlägt der hektische Kapitalzufluss in panischen Kapitalabzug um. Die Währung bricht zusammen, die auf Dollar lautenden Schulden werden unbezahlbar, Unternehmen und Banken brechen zusammen, die Aktienkurse gehen in den freien Fall über.“ (Huffschmid: 1999: 164). Hervorzuheben ist insbesondere die Rolle mächtiger Währungsspekulanten, die den festen Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar für ihre Zwecke ausnutzten. Die Spekulanten „wetteten“ unter Einsatz immenser Kapitalsummen auf eine potentielle Abwertung des Baht und waren damit letztendlich mit ausschlaggebend für die tatsächliche Abwertung, wodurch sich ihre erwarteten Gewinne dann realisierten. Alle Verteidigungsanstrengungen der thailändischen Zentralbank, die noch Ende 1996 über immerhin knapp 40 Mrd. US-Dollar Devisenreserven verfügte, waren erfolglos. Der Wechselkurs konnte nicht gehalten werden und wurde freigegeben (vgl. Köhler 1998: 8). Der thailändische Baht verlor gegenüber dem US-Dollar innerhalb von nur neun Monaten die Hälfte seines Wertes – entsprechende Gewinne strichen die Spekulanten ein (vgl. Huffschmid 1999: 162). Bleibt noch festzustellen, dass entgegen den Verlautbarungen des IWF „hausgemachte“ Probleme Thailands – und damit trotz offensichtlicher Schwächen auch das Wechselkursregime – keine hinreichende Begründung für spekulative Attacken auf die thailändische Währung lieferten. Vielmehr haben sowohl neoliberale wirtschaftspolitische Empfehlungen des IWF im Vorfeld als auch subjektive Annahmen und unverantwortliches Verhalten internationaler Währungsspekulanten maßgeblich zur Entstehung der Krise beigetragen (vgl. Köhler 1999: 7f). 27 Wenn der Peso purzelt enge Definition von Bändern spekulative Attacken verhindert oder aber provoziert, ist umstritten. Mussa weißt auf das mögliche Risiko hin: „Indeed, the principal difficulty of band arrangements […] is that when the exchange rate is driven to the limits of the bands, these arrangements work similarly to and can face the same type of problems as standard exchange rate pegs.“ (ICEG 2000: 3) 28 Die Gemeinsamkeit aller soft pegs ist, dass sie den begleitenden Einsatz von Kapitalverkehrskontrollen erfordern, um Wechselkurs-Instabilitäten zu vermeiden. Dies liegt in der so genannten impossible trinity der Finanzpolitik begründet: Wenn ein Land sein Zinsniveau autonom bestimmen will (z.B. auf einem niedrigeren Nievau als die USA oder Euroland) und gleichzeitig einen stabilen Wechselkurs aufrechterhalten will, dann muss es sich durch Beschränkungen des Kapitalverkehrs vor großen ungewollten Kapitalabflüssen schützen. Ansonsten werden die inländischen Anleger ihr Geld ins Ausland übertragen, um es dort anzulegen, und dabei auf die begrenzten Devisenreserven des Landes zugreifen. Diese Reserven gehen dann irgendwann zu Ende und der Wechselkurs kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Gerade Entwicklungs- und Schwellenländern sollten daher auf vollständig liberalisierten Kapitalverkehr verzichten und zur Stabilisierung der Wechselkurse selektive Kapitalverkehrskontrollen einsetzen (vgl. Dieter 2002a: 33ff.). 4.1.3 Flexible Wechselkurssysteme Intermediäre Wechselkursregime wurden nach der Asien-Krise vom internationalen ökonomischen Mainstream als krisen- und spekulationsanfällig betrachtet. In der Folge wurden Entwicklungs- und Schwellenländer nicht zuletzt vom IWF (siehe Kapitel 4.2) dazu gedrängt, sich für eine der Ecklösungen (corner solutions) des Wechselkurskontinuums zu entscheiden. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis wurden flexible Wechselkurse dabei oft bevorzugt. Frei nach den Kräften des Marktes schwankende Wechselkurse sollten unterschiedliche Entwicklungen zwischen den beteiligten Volkswirtschaften ausgleichen, beispielsweise externe Störungen und Schocks durch Wechselkursanpassungen auffangen und abfedern, und damit jegliche Intervention von Seiten der Zentralbanken unnötig machen (vgl. Flassbeck 2002; 11ff). Diese Hoffnungen können jedoch von einem free floating regime nicht erfüllt werden. Warum? Ebenso wie bei anderen Wechselkurssystemen besteht auch bei floating regimes das Risiko einer Fehlentwicklung, dass sich die Kurse eben nicht an der Veränderung der ökonomischen Grunddaten (fundamentals) der Volkswirtschaft orientieren, sondern es gemessen an den fundamentals zu Überoder Unterbewertung kommt. zieht folgendes Fazit: „Es ist vielleicht der größte Irrtum der Ökonomie in diesem Jahrhundert, lange Zeit der Politik die Vorstellung vermittelt zu haben, es gäbe so etwas wie nationale Souveränität in der Wirtschaftspolitik, wenn man nur ein Währungssystem installiert, daß ‘flexibel’ alle von außen kommenden Schocks abfängt. Das aber kann es nicht geben, weil die real existierenden Währungssysteme nicht einmal monetäre Störungen relativ friktionsfrei ausgleichen können, ganz zu schweigen von realen Schocks.“ (Heiner Flassbeck 2002: 15) Die Regierungen von Entwicklungs- und Schwellenländern sind sich der Risiken flexibler Wechselkurse bewusst. In Konsequenz hat die Zahl der Staaten mit de jure free floating regimes seit Ende der 90er Jahre zwar erheblich zugenommen, de facto schrecken die meisten Länder jedoch davor zurück, den Wechselkurs vollständig den Kräften des Marktes auszusetzten („fear of floating“). Sie praktizieren vielmehr ein so genanntes managed floating. Dabei bleiben die Wechselkurse zwar offiziell flexibel, die Zentralbank wirkt jedoch unter bestimmten Umständen durch Zinspolitik und/oder gezielte Interventionen auf den Devisenmärkten auf die Kursentwicklung ein (vgl. Williamson, 2000: 4). Der Begriff managed floating ist dabei recht unklar und umfasst je nach genauer Konzeption „a range of regimes from de facto pegging to something close to a free float“ (ICEG 2000: 3). Hier verschwimmen also die Grenzen zwischen flexiblen und intermediären Wechselkurssystemen. John Williamson (2000: 4) hält als Ergebnis seiner Auswertung zweier jüngerer Studien fest: „These results strongly suggest that most emerging market countries – especially those in East Asia – are reluctant floaters. Their revealed preference is for a regime that can at most be described as one of heavily managed floating. They describe themselves as floating because that is what the IMF wants to hear, but they do not practice floating in a form that would be approved by the two-corner advocates.“ 4.2. Die Währungspolitik des IWF 4.2.1 Der IWF als Anwalt der Extremlösungen Mit Ende des in Bretton Woods etablierten Festkurssystems und dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen in den 1970er Jahren gingen zunehmende Wechselkursunsicherheiten einher. Gleichzeitig begannen im internationalen ökonomischen Mainstream die Diskussionen, welche Währungsregime für Entwicklungs- und Schwellenländer geeignet sind und wie sie diese auch eigenständig, d.h. unilateral, einführen können. Eine Rückkehr zu internationaler, d.h. multilateraler Währungskooperation wurde kaum in Betracht gezogen. Box 8: Länderbeispiel Flexibler Wechselkurs: Südafrika 1994 hatte Südafrika im Rahmen wirtschaftspolitischer Liberalisierungsmaßnahmen den Wechselkurs der Landeswährung Rand freigegeben. Nach mehr einem Jahrzehnt flexibler Wechselkurse kann das afrikanische Schwellenland heute als Beispiel für die Probleme angeführt werden, die ein floating regime für ein Schwellenland möglicherweise mit sich bringt. Unabhängig von den wirtschaftlichen Basisdaten des Landes war der Rand immer wieder starken Schwankungen ausgesetzt (siehe Abbildung 4 im Kasten), welche sich zumindest kurzfristig auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auswirkten. Die jüngste und stärkste Schwankung des Rand- Kurses war im Jahr 2001 zu beobachten. Gegenüber dem US-Dollar verlor der Rand übers Jahr gesehen 37% seines Wertes, allein im letzten Quartal 2001 betrug der Verlust 27%. Im Jahr 2002 gewann der Rand dann 32% seines Wertes gegenüber dem US-Dollar zurück. Betrachtet man die makroökonomischen Daten Südafrikas, so findet man keine hinreichenden Gründe für die starken Währungsumbewertung: Die Wachstumsraten des BIP lagen seit 1999 stets um die 3%, die Inflation konnte auf einem relativ niedrigen Niveau stabilisiert werden, Auslandsverschuldung und Haushaltsdefizit waren nicht nennenswert hoch (vgl. DB Research, Lesezeichen Wechselkurs – Südafrika, Tansania). Wie ist der erhebliche Kursverlust dann zu erklären? Externe, von der südafrikanischen Regierung nicht beeinflussbare politische Entwicklungen scheinen für die Währungsabwertung mit entscheidend gewesen zu sein. Insbesondere die Unsicherheiten über die weitere politische Entwicklung Simbabwes könnte eine Rolle gespielt haben. „Die Flucht der Investoren aus Südafrika und die damit verbundene Schwäche des Rand hätten dann weniger mit der makroökonomischen Situation Südafrikas zu tun als vielmehr mit der kollektiven Skepsis von Investoren hinsichtlich der weiteren Entwicklung in Südafrika und den Nachbarländern. Die Währung wäre also zum Barometer für die Empfindungen von Investoren gegenüber der Region südliches Afrika geworden.“ (Dieter 2002a: 28f). 2000 und 2001 wurden netto Randanleihen im Umfang von 20,5 (2000) bzw. 26,5 (2001) Mrd. Rand von ausländischen Investoren abgestoßen. Die Investoren stehen in Verdacht, nicht nur aus Angst vor Verlusten verkauft zu haben, sondern auf die von ihnen erwartete Schwäche des Rand bewusst spekuliert und damit zur drastischen Abwertung letztendlich maßgeblich beigetragen zu haben. Laut der Neuen Züricher Zeitung vom 8.12.2001 sollen z.B. die international im Devisenhandel tätigen Großbanken Deutsche Bank, JP Morgans und Citibank unter Einsatz von 6 bis 8 Mrd. Dollar gegen den Rand spekuliert haben. In seiner Analyse der Asienkrise 1997/98 kam der IWF unter anderem zu dem Schluss, die intermediären Wechselkursregime – allen voran die der so genannten pegged systems, die der IWF vor der Asien-Krise befürwortet hatte – seien nunmehr als 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Die südafrikanische Zentralbank stand der Rand-Abwertung machtlos gegenüber. Das System flexibler Wechselkurse erlaubte keine groß angelegten Interventionen am Devisenmarkt, und die ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen wie z.B. das Erhöhen der Zinssätze oder strengere Devisenkontrollen verpufften zunächst mehr oder weniger wirkungslos. Erst 2002 führte die Aussicht auf hohe Renditen (u.a. auf Grund des mehrmaligen Erhöhens der Zinssätze durch die südafrikanische Zentralbank) dazu, dass ausländische Investoren wieder in den Rand investierten und der Kurs sich erholte (Die Welt, 2.1.2003). Die Einrichtung flexibler Wechselkurse brachte also für Südafrika nicht einkalkulierbare Risiken mit sich. Entgegen der Theorie verlief der Wechselkurs nicht entsprechend den makroökonomischen Abbildung 4: Wechselkurs Südafrikanischer Rand zu US-Dollar (1994-2006) Daten des Landes, 0,35 sondern es waren vielmehr unberechen- 0,3 bare und drastische, durch Spekulation 0,25 zumindest verstärkte Währungsabwertungen 0,2 erfolgt. Die nega0,15 tiven Auswirkungen eines stark unterbe0,1 werteten Rand auf die südafrikanische 0,05 Ökonomie, z.B. durch eine Aufwertung der 0 Auslandsschulden, sind nicht zu unterschätzen (vgl. Dieter 2002a: 29). Quelle: www.oanda.com krisenanfällig anzusehen. Die einzig vernünftige Lösung zur Vermeidung neuer Finanz- und Währungskrisen sei daher die Entscheidung für einen entweder unverrückbar festen oder einen völlig frei schwankenden Wechselkurs (vgl. Falk 2001: 5f). Der IWF war zu 29 Wenn der Peso purzelt Box 9: Der Internationale Währungsfonds Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde – gemeinsam mit seiner Schwesterinstitution, der Weltbank – auf der Konferenz zur Neugestaltung des Weltwirtschaftssystems in Bretton Woods/USA im Jahr 1944 geschaffen. Der IWF sollte die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Währungspolitik fördern, um dadurch ein ausgewogenes Wachstum des Welthandels sowie einen hohen Beschäftigungsgrad und ein hohes Einkommensniveau in seinen Mitgliedsländern zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde dem Fonds in erster Linie die Aufgabe übertragen, „die Stabilität der Währungen zu fördern, geordnete Währungsbeziehungen zwischen den Mitgliedern aufrechtzuerhalten und Währungsabwertungen aus Wettbewerbsgründen zu verhindern.“ (Artikel 1 der Gründungsstatuten des IWF). Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten eines Mitgliedslandes kann der IWF Kredite aus einem Pool vergeben, in den alle Mitglieder gemäß einer zuvor festgelegten Quote einzahlen. Diese Quoten, die entsprechend der wirtschaftlichen Größe und der handelspolitischen Bedeutung eines Landes festgelegt werden, sind zudem ausschlaggebend für die Stimmverteilung im Gouverneursrat, dem höchsten Entscheidungsgremium des IWF. Damit hatten und haben die finanz- und wirtschaftsstarken Industrieländer stets eine Stimmenmehrheit und können ihre Interessen gegenüber den zahlenmäßig weitaus stärker vertretenen Entwicklungs- und Schwellenländern durchsetzen. Derzeit (Stand: Oktober 2006) halten die USA 16,83% der Stimmen (womit die Amerikaner bei Entscheidungen über Satzungsänderungen eine Sperrminorität besitzen!), Japan 6,04% und Deutschland 5,9%. Bei seiner Gründung zählte der IWF 39 Mitglieder, mittlerweile ist die Mitgliederzahl auf 184 angewachsen. Aufgaben und Struktur des IWF entsprachen dem Entwurf des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Harry Dexter White; das vom britischen Ökonomen John Maynard Keynes vorgestellte Modell einer internationalen Clearing Union konnte sich in den Verhandlungen nicht durchsetzen (das Konzept der Clearing Union wird erläutert in Kapitel 5). Seit dem Zusammenbruch des Festkurssystems 1973 hat sich der Fonds sukzessive von seiner ursprünglichen Aufgabe der Wechselkursstabilisierung entfernt. Seit der Schuldenkrise der 80er Jahre nimmt er maßgeblichen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik von Entwicklungsländern, indem er Kreditzahlungen mit strengen wirtschaftspolitischen Auflagen verbindet. Die Bereitstellung von enormen finanziellen Mitteln an Krisenländer bedeutet zudem, dass Kreditgebern indirekt eine Absicherung vor Verlusten in Aussicht gestellt wird. 30 diesem Zeitpunkt sicherlich der prominenteste Verfechter dieser so genannten Ecklösungstheorie (corner hypothesis), aber dieselbe Position wurde grundsätzlich auch von den meisten Industrieländern vertreten.9 Im Rahmen von wirtschaftspolitischen Beratungen wurden Entwicklungs- und Schwellenländer dazu gedrängt, auf Zwischenmodelle zu verzichten und sich für eine der beiden Extreme des Wechselkurs-Kontinuums zu entscheiden (vgl. UNCTAD 2001: 109). „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Motive für die Präferenz der Ecklösungen bei den großen Ländern weniger in einem wirtschaftlichen, als in einem politischen Kalkül liegen. Beiden Varianten bieten nämlich scheinbar eine nationale, eine unilaterale Lösung für ein internationales, ein multilaterales Problem. Bei beiden Ecken kann das betroffene Entwicklungs- oder Schwellenland der Theorie nach seine Grenzen vollständig für Kapital jeder Fristigkeit öffnen, ohne daß es der Mithilfe anderer wie der großen Reservewährungen bedürfte.“ (Flassbeck 2002: 22f.) Die Skepsis gegenüber den intermediären Wechselkurssystemen – welche am besten unter Einsatz von Kapitalverkehrskontrollen funktionieren – hängt also eng mit dem Paradigma des uneingeschränkten Kapitalverkehrs zusammen. Während nach dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods in den 1970er Jahren noch die deutliche Mehrheit der Entwicklungsländer ein mehr oder weniger festes Wechselkurssystem beibehalten hatte, schrumpfte die Zahl der Länder mit einem – offiziell angegebenen – intermediären Regime bis Ende der 90er Jahre erheblich. Es schien, als hätten sich die meisten Länder, der Theorie des ökonomischen Mainstreams folgend, für eines der beiden Extreme entschieden (vgl. UNCTAD 2001: 109). Internationale Studien stellten jedoch fest, dass dieses angebliche Aussterben intermediärer Regime ein Trugschluss war und eine erheblich Differenz zwischen den offiziell und tatsächlich praktizierten Wechselkurssystemen besteht. In einem Papier des IWF wird 2004 festgestellt: „The divergence was particularly striking among socalled “floating” regimes – only 20 percent were de facto free floats, while 60 percent were either intermediate or pegged regimes, and another 20 percent had freely falling currencies.” (Rogoff et al 2004: 6)10 Die Ecklösungs-Theorie wurde in besonderem Maße auch vom US-Kongress (welcher einer Empfehlung der von ihm eingesetzten MeltzerKommission im Jahre 2000 folgte) und in der Folge von der Mehrheit der G7-Staaten vertreten. Nur Japan und Frankreich distanzierten sich bereits 2001 davon (vgl. Flassbeck 2002: 19f). 10 In diesem Papier wurden Währungen, die wegen hoher Inflationsraten permanent und schnell abwerten, als eigene Kategorie “freely falling“ behandelt. 9 Die Ansicht, dass ausschließlich extrem feste oder frei schwankende Wechselkurse dazu beitragen können, währungsbedingte Krisen zu vermeiden, hat angesichts der jüngsten Ereignisse in Argentinien und Südafrika auch unter den bisherigen Befürwortern schwer gelitten (vgl. Fritz 2004: 10f). Selbst prominente Verfechter der corner hypothesis, so z.B. mit Stanley Fisher ein ehemaliger Vize-Direktor des IWF, revidierten in der Folge dieser Krisen ihre zuvor vertretenen Thesen zumindest teilweise und gestehen Entwicklungs- und Schwellenländern nun unter bestimmten Umständen auch die Wahl intermediärer Regime zu (vgl. Fisher 2001: 2f.). Offiziell vertritt der IWF bereits im Juni 2000 die Position, „dass es kein einheitliches Wechselkursregime gibt, das für alle Länder unter allen Umständen optimal ist. Die Mitgliedsländer haben nach wie vor einen Handlungsspielraum bei der Wahl des für ihre Bedürfnisse optimalen Wechselkursregimes. [...] Zwischenlösungen [werden] in vielen Fällen voraussichtlich tragfähig und angemessen bleiben. [...] Der Ansatz des IWF besteht nach wie vor darin, die Mitgliedsländer in Bezug auf die Auswirkungen der verschiedenen Wechselkursregime zu beraten, es den einzelnen Ländern zu überlassen, welches Regime sie wählen und Politikempfehlungen auszusprechen, die mit der Aufrechterhaltung des gewählten Regimes im Einklang stehen.“ (IWF 2000: o.S.). 4.2.2 Einfluss auf die Währungspolitik Liest man im selben Positionspapier des IWF-Stabs (IWF 2000) weiter, so kommen jedoch Zweifel an der angeblichen Wahlfreiheit der Entwicklungs- und Schwellenländer auf: „Die Diskussionen über die geeignete Wechselkurspolitik und das geeignete Regime sowie Fragen in Bezug auf Devisenbeschränkungen können wichtig sein und sind manchmal zentrale Aspekte der Programmverhandlungen und der Überwachungsgespräche. [...] Das bevorzugte Wechselkursregime eines Landes zu akzeptieren, hält den IWF jedoch nicht davon ab, den Behörden eine Bewertung der Frage vorzulegen, ob das bestehende Wechselkursregime im Großen und Ganzen mit den außen- und binnenwirtschaftlichen Zielen des Landes übereinstimmt, oder Politikänderungen zu empfehlen, die erforderlich sein können, um eine solche Übereinstimmung zu gewährleisten. [...] Für die IWF-unterstützten Programme gilt, dass der IWF nur dann Kredite an ein Land vergibt, das einen festen Wechselkurs oder eine andere Wechselkursvereinbarung verteidigt, wenn er davon ausgeht, dass eine solche Politik im Rahmen der Programme tragfähig ist [...].“ Tenor dieser Aussagen ist: Jedes Land darf selbstbestimmt und frei das ihm am sinnvollsten erscheinende Wechselkursregime wählen – es sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass der IWF diese Wahl bzw. die sie begleitenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen bei Nichtgefallen im Rahmen von Beratungsgesprächen und Programmverhandlungen zu verändern sucht und Kredite nur dann vergibt, wenn eine „tragfähige“ Wirtschaftspolitik gewählt wird. Was bedeutet das in der Praxis? Ein Blick in die Geschichte der Beziehungen von IWF und Entwicklungs- und Schwellenländer hilft bei der Beantwortung dieser Frage. Anfang der 80er Jahre brach die bis heute ungelöste internationale Schuldenkrise aus. In der Folge hat sich der IWF eine zentrale Rolle beim Schuldenmanagement verschafft, indem er neue Kredite und Umschuldungsmaßnahmen – auf welche die verschuldeten Länder kurzfristig angewiesen waren – an die Umsetzung wirtschaftspolitischer Maßnahmen im Rahmen so genannter Strukturanpassungsprogramme (SAP) knüpfte Die haushalts-, finanz-, handels- und arbeitsmarktpolitischen Vorgaben der Programme stellen weit reichende Eingriffe in die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen der kreditnehmenden Länder dar. Die SAPs sind dem neoliberalen Entwicklungsmodell von Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung verpflichtet und haben in den Schuldnerländern oft verheerende ökologische und soziale Folgen nach sich gezogen. Zugleich ist aber auch der ökonomische Nutzen der Programme höchst zweifelhaft. In 36 sehr armen Ländern, denen in den 1980ern und 1990ern von Weltbank und IWF Schätzungen zu Folge insgesamt 958 SAPs auferlegt wurden, waren im selben Zeitraum fast keine nennenswerten Wachstumsraten zu verzeichnen (vgl. Falk 2001: 2). Im Rahmen von SAPs hat der IWF in der Regel Abwertungen der Schuldnerwährungen durchgesetzt. Da alle Schuldnerländer gleichermaßen zur Abwertung gedrängt wurden, veränderte sich die Wettbewerbsfähigkeit der konkurrierenden Schuldnerländer (z.B. im Export von mineralischen oder agrarischen Rohstoffen) kaum. Durch die Abwertung haben sich aber ihre Auslandsschulden relativ gesehen drastisch erhöht. 31 Wenn der Peso purzelt Kapitel 5 Alternativen: Multilaterale Währungszusammenarbeit statt Währungskonkurrenz I n der Diskussion um Alternativen zu unregulierten Devisenmärkten mit stark schwankenden Währungen und drohenden Währungskrisen gibt es eine ganze Reihe konkreter Vorschläge, wie man diese Probleme politischen angehen könne. Die folgende Auswahl soll zeigen, dass ein Nichts-Tun nicht durch mangelnde Politikalternativen begründet ist, sondern ausschließlich auf mangelnden politischen Willen und unzureichende multilaterale Kooperationsbereitschaft zurückzuführen ist. 5.1 Zielzonen 32 Eine Wechselkurszielzone ist ein spezielles Wechselkursregime, bei der die Notenbank einen festen Kurs der einheimischen Währung zu einer Ankerwährung festlegt, den Kurs aber innerhalb eines bestimmten Rahmens darum schwanken lässt (typischerweise einige Prozent nach oben und unten). Bricht er aus dem Band heraus, so interveniert die Zentralbank. Die Bandbreite erlaubt es, auch größere Volumina an Devisen zu handeln, ohne dass bei jeder einzelnen Transaktion die Zentralbank intervenieren muss. Die Idealvorstellung eines Zielzonen-Modells müsste sich an die multilateralen Rahmen des Bretton-Woods-Systems anlehnen, wo immer die Notenbank interveniert, deren Währung aufwertet. Denn einer Aufwertung z.B. des Euro kann immer durch ein zusätzliches Angebot von Euro durch die Europäische Zentralbank entgegengewirkt werden. Euro-Angebote sollten immer von der EZB ausgehen, denn diese kann Euro in unbegrenzter Menge am Markt anbieten, für alle anderen Länder hingegen wäre dies ein Rückgriff auf ihre Devisenreserven. Im Gegensatz zum Bretton-Woods-System mit festen Wechselkursen sieht das Zielzonen-Modell hingegen einen Währungskorridor vor, innerhalb dessen sich der Wechselkurs frei floatend bewegen darf, ohne dass es zu Notenbankinterventionen kommt. 5.2 Langfristige statt kurzfristige Kreditvergabe Eine wichtige Lektion aus den jüngeren Währungskrisen betrifft die Fristigkeit von Kapitalflüssen. Grundsätzlich steht außer Frage, dass langfristige Zuflüsse den kurzfristigen Zuflüssen entwicklungspolitisch vorzuziehen sind. Eine relativ hohe Einigkeit besteht unter ÖkonomenInnen (auch bis weit in den IWF hinein) darüber, dass Portfolio-Investitionen und kurzfristige Kredite besonders krisenanfällig sind und sie daher nicht zum Stopfen von Zahlungsbilanzlöchern genutzt werden dürfen. Zu groß wäre ansonsten die Gefahr, dass kurze Schwankungen der Erwartungen von AnlegerInnen gleich eine große Währungs- und Finanzkrise nach sich ziehen. Zwar sind kurzfristige Kredite oft billiger, d.h. niedriger verzinst, als langfristige Kredite, aber die unübersehbaren Risiken kurzfristiger Kapitalabflüsse sollten den Aufschlag für langfristige Kredite allemal wert sein. Leider ist die bisherige internationale Bankenregulierung dabei keine Hilfe. Statt die Banken zur Vergabe langfristiger Kredite zu animieren, befördert sie genau das Gegenteil und erhöht damit das systemische Risiko (siehe Hersel/Eichborn 2006: 45). Je nach Art und Laufzeit eines Kredits muss eine Bank einen Kredit nämlich mit mehr oder weniger Eigenkapital „unterlegen“. Langfristige Kredite müssen mit mehr Eigenkapital „unterlegt“ werden als kurzfristige. Das hat zur Folge, dass eine Bank insgesamt umso mehr Kredite vergeben kann, je kurzfristiger sie sind. Aus Sicht der einzelnen Bank macht eine solche Regulierung Sinn, denn bei Problemen kann sich die individuelle Bank ihr Geld schneller zurückholen. Aus Sicht eines Systems von Banken ist die Regelung aber widersinnig, denn sie schafft Anreize, dass alle Banken tendenziell kurzfristigere Kredite vergeben. Eine systemisch sehr viel weitsichtigere Lösung wäre es daher, die Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit von Kreditbeziehungen zu stärken, statt die ohnehin oft kurzsichtigen Planungshorizonte von Finanzdienstleistern noch zu belohnen. Zuständig für diesen Teil der internationalen Standards der Bankenaufsicht ist der „Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht“, der bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) angesiedelt ist. 5.3 Tobin-Steuer Das sicherlich bekannteste Instrument zur Entmutigung kurzfristiger Finanzflüsse ist die sogenannte Tobin-Steuer. Diese ist eine Umsatzsteuer auf Devisengeschäfte und wirkt sehr ähnlich wie die Bardepotpflicht. Pro Währungsumtausch muss eine geringe (z.B. 0,1-1 prozentige) Steuer auf die umgesetzte Summe entrichtet werden. Wenn z.B. einE Portfolio-AnlegerIn sein bzw. ihr Geld durchschnittlich alle zwei Wochen in Aktien in einem anderen Land mit einer anderen Währung anlegt (z.B. von Euro nach US-Dollar nach Real nach Rubel usw.), so wird die Tobin-Steuer bei 52 Wochen im Jahr 26 mal fällig. Bei einem Tobin-Steuer-Prozentsatz von 0,5 Prozent würde das einen Verlust von 13 Prozent bedeuten. Die Anlagen müssten also sehr profitabel sein, um diesen Steuerverlust auszugleichen. Wenn AnlegerInnen allerdings einen hohen Gewinn oder Verlust erwarten (z.B. die Abwertung einer Währung um 30 Prozent im Fall einer Finanzkrise), dann kann sie die 0,5 prozentige Steuer nicht schrecken und sie werden ihr Geldvermögen trotzdem entsprechend umschichten. Auch für langfristige Investitionsentscheidungen macht die Tobin-Steuer kaum einen Unterschied. Die Tobin-Steuer und die Bardepotpflicht sind also keine harten Kapitalverkehrsbegrenzungen, sondern sie wirken wie „Sand im Getriebe“ der internationalen Finanzmärkte und führen so zu einer Entschleunigung der Kapitalflüsse und zu einer Stabilisierung des Gesamtsystems. Auch wenn die Tobin-Steuer bis heute noch nicht in der Praxis umgesetzt ist, so gibt es auf dem Weg zu ihrer Einführung durchaus Fortschritte zu vermelden. Sowohl das französische als auch das belgische Parlament haben bereits verbindliche Beschlüsse gefasst, dass Frankreich und Belgien die Tobin-Steuer sofort einführen werden, sobald andere Länder (z.B. die Mitglieder der EU) mitziehen11. 11 12 5.4 Spahn-Steuer Die Spahn-Steuer ist nach Paul Bernd Spahn bezeichnet, der im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) die Möglichkeit der Einführung der Tobin-Steuer untersucht hat und dabei noch eine Weiterentwicklung der Tobin-Steuer vorgeschlagen hat (Spahn, 2002). Die Spahn-Steuer verbindet die Idee der Tobin-Steuer mit Elementen des ZielzonenModells. Innerhalb des politisch festgelegten Korridors einer Zielzone schwankt der Wechselkurs frei, es fällt allerdings die Tobin-Steuer als Devisenumsatzsteuer an. Sobald sich der Kurs von Markt an den Rand der Zielzone gedrängt wird, wird der Steuersatz der Tobin-Steuer drastisch erhöht (z.B. auf 50 Prozent) und wirkt damit quasi wie ein Verbot weiterer Devisenumsätze. Diese Form von Kapitalverkehrskontrolle würde es ermöglichen, für den Fall einer Währungskrise eine automatische Notbremse einzubauen, die die Währung und das entsprechende Land vor einem Kollaps schützt. Die Spahn-Steuer gilt heute als die aktualisierte Form der Tobin-Steuer und wird von den meisten Akteuren, die sich für die Tobin-Steuer aussprechen und ausgesprochen haben, heute ebenso befürwortet. 5.5 Die Clearing Union von Keynes Anders als solche vorsichtigen Ansätze von Re-Regulierung des internationalen Finanzsystems hatte John Maynard Keynes die Ungleichgewichte in den nationalen Zahlungsbilanzen und den damit einhergehenden Druck zur ständigen Anpassung der Wechselkurse grundsätzlicher angehen wollen. 1941/42 entwickelte er für die britische Regierung den „Plan for an International Currency (or Clearing) Union“ („Keynes Plan“, vgl. Keynes, 1980: 108ff) als Modell einer Weltwirtschaftsordnung nach dem Krieg, den er dann im Namen der britischen Regierung bei den Verhandlungen mit den USA über die Nachkriegsfinanzordnung vertrat12. Dieser Plan zielte auf einen mittelfristigen und verbindlichen Ausgleich der Handelsbilanzsalden im neuen Weltwirtschaftssystem. Unabhängig, ob sich die Handelsbilanzen als Reflex auf Kapitalflüsse oder aufgrund realwirtschaftlich induzierter Güterbewegungen ergeben hätten, wären Weitere Hintergründe zur Tobin-Steuer finden sich z.B. bei Spahn (2002), Jetin/Denys (2005), Spratt (2006). Als renommierter Wissenschaftler wurde Keynes ab Ende 1940 von der britischen Regierung um Vorschläge hinsichtlich einer weltwirtschaftlichen Nachkriegsordnung gebeten. Dabei hat er seine ursprünglichen Vorschläge auf Anfragen und Bitten v.a. des Schatzamtes (Finanzministeriums) und der Bank of England modifiziert und relativiert (für eine historische Rekonstruktion siehe Keynes, 1980). In seinen ersten, noch persönlichen, “Proposals for an International Currency Union” (vgl. Keynes, 1980: 33ff.) vom 8.9.1941 werden den Gläubigerstaaten noch stärkere Sanktionen auferlegt als in dem ab Ende Januar 1942 als offizielles Diskussionspapier des Schatzamtes kursierenden “Plan for an International Currency (or Clearing) Union” (ebd.: 108ff). Dieser wurde ab August 1942 in leicht veränderter Form zur Vorlage Großbritanniens bei den Verhandlungen mit den USA (ebd.: 168ff). Diese Verhandlungen wurden bekanntlich bei einer Konferenz im amerikanischen Bretton-Woods 1944 mit der Gründung des IWF und der Weltbank beendet. 33 Wenn der Peso purzelt sie in seinem Modell durch eine supranationale Instanz (die Clearing Union) gegenüber den Überschuß- und den Defizitländern sanktioniert worden. The proposal ... differs in one important respect from the pre-war system because it aims at putting some part of the responsibility for adjustment on the creditor country as well as the debtor. ... The object is that the creditor should not be allowed to remain passive [im Falle außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte, P.H.]. For if he is, an intolerably heavy task may be laid on the debtor country, which is already four that reason in the weaker position. (Keynes, 1980: 117) Der Keynes-Plan sah vor, daß eine neue internationale Reservewährung („bancor“) geschaffen werden sollte, um die Machtungleichgewichte zwischen Leit- und Schwachwährungen zu vermeiden. Damit wäre auch einer der Kardinalsfehler des BrettonWoods-System vermieden worden, dass nämlich die USA bei der Geldpolitik des US-Dollars häufig in Zielkonflikte zwischen dem Dollar als nationalem Geld und seiner Rolle als Weltwährung geraten. 34 Jedes Land hätte, ähnlich wie später auch für den IWF beschlossen, eine bestimmte Quote (orientiert an der Summe der durchschnittlichen jährlichen Exporte und Importe während der letzten drei Vorkriegsjahre1) zugewiesen bekommen. Diese hätte, und das ist der zentrale Unterschied zum IWF, die Obergrenze einer Schuldner- und Gläubigerposition eines Landes gegenüber dem Rest der Welt festgelegt (vgl. Keynes, 1980: 118). Je stärker und länger ein einzelnes Land seine Quote als Gläubiger oder Schuldner in Anspruch genommen hätte, desto stärker wären ihm Maßnahmen zum wirtschaftspolitischen Gegensteuern, d.h. zu einem Abbau des Ungleichgewichts, auferlegt worden. Nach Keynes Vorschlag sollte es durchaus klare Anpassungsmaßnahmen auf Seiten der Schuldnerländer geben. Aber im Unterschied zum heutigen IWF wären diese symmetrisch zu notwendigen Anpassungsschritten auf Seiten der Gläubiger- bzw. Exportüberschussländer gewesen. Ein Teil der Symmetrie hätte darin bestanden, dass Guthaben und Schulden bei der Clearing Union bis zu einem Viertel der Quote gleichermaßen mit einer Steuer in Höhe von einem Prozent pro Jahr belegt worden wären. Bei Kredit oder Debit von mehr als der Hälfte der Quote wäre die Steuer auf zwei Prozent gestiegen. In seinen ursprünglichen Plänen Anfang der 1940er Jahre hatte Keynes extremen Druck auf die Überschussländer ausüben wollte. 13 If at the end of any year the credit balance of the Clearing Account of any central bank exceeds the full amount or its index-quota, the excess shall be transferred to the Reserve Fund of the Clearing Bank. (Keynes, 1980: 36, Hervorhebung durch Keynes) Da allerdings die USA zu dieser Zeit (und wegen des Wiederaufbaus Europas noch für eine länger absehbare Zeit) Exportüberschüsse hatten und sie gleichzeitig das mächtigste Land am Konferenztisch von Bretton Woods waren, hat die britische Regierung diesen weitgehenden Vorschlag schon früh verworfen. Keynes reiste daher nur mit einer sehr viel weicheren Formulierung nach Bretton Woods. Das Gläubigerland shall discuss with the Governing Board [der Clearing Union, d. Verf.] (but shall retain the ultimate decision on its own hands) what measures would be appropriate to restore the equilibrium of its international balances ... (Keynes, 1980: 120). Trotz dieser Verwässerung hätte in jedem Fall die Steuer auf Guthaben bei der Clearing Union einen deutlichen Anreiz bedeutet, keine allzu großen Überschüsse aufzuhäufen. Letztlich blieben die genannten Aspekte des Keynes-Plans in Bretton Woods zugunsten des White-Plans der US-Amerikaner weitgehend unberücksichtigt. Nachdem er lange Zeit in der Versenkung verschwunden war, wurde der Keynes Plan (oder vielmehr der „Keynes-Vorschlag“ vom September 1941) in jüngerer Vergangenheit als Reaktion auf die 1982er Schuldenkrise und die schwindende Reichweite nationaler Sozial- und Wirtschaftspolitik im Rahmen der Globalisierung wieder ins Gespräch gebracht (vgl. Richardson, 1985; Hankel, 1995: 192ff; 1998; Achermann, 1996). Nicht nur inhaltlich, sondern auch strategisch stellt der Keynes-Plan zweifellos eine wichtigen Anknüpfungspunkt für die Alternativendiskussion in der globalisierungskritischen Bewegung dar. Der Verweis auf Keynes und die Tatsache, dass der Vorschlag von der britischen Regierung vorgelegt wurde, macht deutlich, dass man sich mit solchen Überlegungen nicht im bereicht „abenteuerlicher Ahnungslosigkeit“ bewegt (wie der Bewegung vom neoliberalen Mainstream oft vorgeworfen wird), sondern dass es sich um ökonomisch durchdachte Konzepte handelt, die besser heute als morgen umgesetzt werden sollten. In seinem ersten Vorschlag von September 1941 hatte die Quote nur die Hälfte der Ex- und Importe betragen sollen (vgl. Keynes, 1980: 35) Literatur Achermann, Beat (1996): EWS, WWU und flexible Wechselkurse als „Job-Killer“. Ansätze für beschäftigungsfreundliche Währungssysteme, Europa-Magazin des Forum für direkte Demokratie, http://crossnet.ch/europa-magazin/96/2/Job-Killer.html. BIZ (2001): BIZ-Quartalsbericht, Dezember 2001, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel. BIZ (2004): BIZ-Quartalsbericht, Dezember 2004, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel. BIZ (2005): 75. Jahresbericht - 1. April 2004 –31. März 2005, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel. BIZ (2005a): Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2004, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel. Bofinger, Peter (2001): Regulierungsbedarf und Regulierungsmöglichkeiten grenzüberschreitender Kapitalströme, Impulsreferat für Sitzung der Kommission „Internationale Finanzmärkte“ beim SPDParteivorstand am 2. März 2001 in Berlin, http:// www.blue21.de/PDF/bofinger.pdf. Brand Eins (2001): Riskante Sicherheit, 9/2001, http://www.brandeins.de/home/inhalt_print.asp?id= 597&MagID=21&MenuID=130&SID=su6624971296 540475. Deutsche Bank (o.J.): Management Discussion. Erstes Geschäftsjahr mit voller Integration von Bankers Trust und verselbstständigter Deutscher Bank 24, http://www.deutsche-bank.de/ir/index.html?conte ntOverload=http://www.deutsche-bank.de/ir/1030. shtml. Deutsche Bundesbank (2003): Währungsreserven: Entwicklung und Bedeutung in der Währungsunion, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Januar, Frankfurt am Main. Deutscher Bundestag (2002): Schlussbericht der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten, Drucksache 14/9200, Berlin. Dieter, Heribert (2002): Währungsregime auf dem Prüfstand. Hören Sie nicht auf den IWF!, in: Entwicklung und Zusammenarbeit, Juni 2002. Dieter, Heribert (2002a): Nach den Finanzkrisen. Die ordnungspolitische Gestaltung der Globalisierung, Studie der SWP, Berlin. Emminger, Ottmar (1986): D-Mark, Dollar, Währungskrisen, Stuttgart: DVA. Euromoney (2005): EUROMONEY – FX Survey Mai 2005, http://www.euromoney.com. Falk, Rainer (2001): The reform of the International Monetary Fund (IMF), WEED-Arbeitspapier, Bonn. Financial Times Deutschland (2006): Freie Sicht auf Hedge-Fonds, 29.9.2006. Fisher, Stanley (2001): Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct? http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/010601a.pdf, IWF, Washington DC. Flassbeck, Heiner (2000): Wanted: An International Exchange Rate Regime! in Internationale Politik und Gesellschaft, Nr. 5. Flassbeck, Heiner (2002): Das Ende von Bretton Woods, oder: Gibt es nationale Politik in einer internationalisierten Welt? in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2002/1, http://www.flassbeck. de/pdf/2001/8.11.01/DasEnde.pdf. Frankel, Jeffrey A. (2003): Experiences of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies, NBER Working Paper, August. Fritz, Barbara (2002): Argentinien – Ende eines Modells, in: Lateinamerika Analysen 2, Hamburg. Fritz, Barbara (2004): Currency Blocs: Looking at the Options for Developing Countries in a Multipolar Monetary Regime, CADERNOS PROLAM/USP Bd. 3 Nr.1, http://www.usp.br/prolam/Cadernos2004/ ano3vol12004.pdf Fritz, Barbara/Nolte, Detlef (2004): Ökonomische Erschütterungen und politische Stabilisierungstendenzen im südlichen Lateinamerika, in: Jahrbuch Internationale Politik 2001/2002, hg. von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Politik, München. Hankel, Wilhelm (1995): Das große Geld-Theater. Über DM, Dollar, Rubel und Ecu, Stuttgart: DVA. Hankel, Wilhelm (1998): Euro - Ende des Sozialstaates, Schach dem Globalismus? Zur Notwendigkeit einer globalen Geldordnung, Auszug aus einem Vortrag bei den 25. Römerberggesprächen am 5./6. Juni 1998 in der Paulskirche in Frankfurt am Main, http://www.chemie.fu-berlin.de/fb/diverse/hankel981028.html. Hersel, Philipp/Eichborn, Sebastian von (2006): Investoren als Entwicklungshelfer? – Zur Rolle von Krediten, Direktinvestitionen und Portfolio-Anlagen in Entwicklungsländern, BLUE 21, Berlin. 35 Wenn der Peso purzelt Huffschmid (1999): Die politische Ökonomie der Finanzmärkte, Hamburg. in: Aus Politik und Zeitgeschichten, B 37-38/2000, Bundeszentrale für politische Bildung. ICEG (2000): Exchange Rate Arrangements of Developing Countries, International Center for Economic Growth, Policy Brief 9910, http://www.iceg.org/NE/ policybriefs/P_B(E)10.PDF. Schelkle, Waltraud (1995): Die Theorie der geldwirtschaftlichen Entwicklung, in: Entwicklung und Zusammenarbeit, Jg. 36, Nr.10, http://www.blue21. de/PDF/Theorie_der_geldwirtschaftlichen_Entwicklung.pdf IMF (2004): Annual Report 2004, Washington DC. IMF (2005): World Economic Outlook 2005, Washington DC. IWF (2000): Wechselkursregime in einer zunehmend integrierten Weltwirtschaft, IWF-Stab, Washington DC, http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/ deu/062600g.htm. Jetin, Bruno/Denys, Lieven (2005): Ready for Implementation – Technical and Legal Aspects of a Currency Transaction Tax and its Implementation in the EU, hrsg. WEED, Berlin. 36 Keynes, John Maynard (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money. London, hier zitiert nach Keynes, John Maynard: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, Berlin, 7. Aufl. 1994. Keynes, John Maynard (1980): Activities 1940-1944: Shaping the Post-War World: The Clearing Union, in: The collected writings of John Maynard Keynes, Vol. XXV, London/Cambridge: Macmillan/Cambridge University Press. Köhler, Claus (1998): Spekulation contra Entwicklungspolitik. Eine Analyse der ostasiatischen Währungskrise, in: Politik und Gesellschaft Online 2/1998, www.fes.de/ipg/ipg2_98/artkoehler.html. Lüken-Klaßen, Mathilde (1993): Währungskonkurrenz und Protektion, Marburg: Metropolis. Moreno, Ramon: Motives for intervention, BIS Papers No 24, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel. NZZ (1997): Das Billionenspiel, von Andreas Heller, in: NZZ-Folio, 08/1997. Richardson, David (1985): On Proposals for a Clearing Union, in: Journal of Post Keynesian Economics, Vol.8, No.1. Rogoff, Kenneth et al (2004): Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, IMF Occasional Paper 229, Washington DC. Sangmeister, Harmut (2000): Finanzkrisen, Währungskrisen, Wirtschaftskrisen: Konstanten des lateinamerikanischen Entwicklungsprozesses? Seifert-Granzin, Jörg (1996): Finanzderivate – Formen, Märkte, Crashs, Kontrollen, Werkstatt Ökonomie, Heidelberg. Spahn, Paul Bernd (2002): Zur Durchführbarkeit einer Devisentransaktionssteuer, Gutachten im Auftrag des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn. Spiegel (2005): Geld wie Konfetti, 6.6.2005, http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,359211,00. html. Spratt, Stephen (2006): A Euro Solution – Implementing a levy on euro transactions to finance international development, Intelligence Capital Limited. Staritz, Cornelia (2003): Tobinsteuer, Institut für Volkswirtschaftslehre und –politik, Wien. Temme, Philipp (2006): Wie man sein Geld nicht los wird und dabei Pleite geht. Zur Finanzierungs-, Legitimations- und Strukturkrise des Internationalen Währungsfonds, BLUE 21, Berlin, http://www.blue21. de/PDF/Krise_IWF_Temme_2006.pdf. UNCTAD (2001): Trade and Development Report 2001, New York/Genf. UNCTAD (2004): Trade and Development Report 2004, New York/Genf. UNCTAD (2006): Beyond 20/20. UNCTAD FDI-Database, http://stats.unctad.org/fdi/, Genf. WEED (2001): Devisenumsatzsteuer. Ein Konzept mit Zukunft, von Peter Wahl und Peter Waldow, Berlin. WEED (2001a): Kapital braucht Kontrolle. Die internationalen Finanzmärkte: Funktionsweise - Hintergründe – Alternativen, Berlin. Weltbank (2002): Global Development Finance, CDROM Ausgabe, Washington DC. Williamson, John (2000): Designing a Middle Way between Fixed and Flexible Exchange Rates, Institute for International Economics. Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung (BLUE 21) entstand 1995 während des Rio-Nachfolgeprozesses zu nachhaltiger Entwicklung. Zu den Schwerpunkten der Arbeit von BLUE 21 gehören die Themen Welthandel, Internationale Finanzmärkte und Verschuldung. Die zentralen Ziele unserer Arbeit sind die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die genannten Themen und die Erzeugung politischen Drucks. Letzteres versuchen wir durch basisorientierte Vernetzungsarbeit, die Erstellung von Expertise und durch die direkte Auseinandersetzung mit Entscheidungsträgern in der Politik zu erreichen. BLUE 21 versteht sich als bewegungsorientierte Nichtregierungsorganisation und arbeitet intensiv in bundesweiten und internationalen Netzwerken und Bewegungen mit. Dabei pflegt BLUE 21 eine enge Zusammenarbeit mit dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac und kooperiert mit der internationalen Kampagne Erlassjahr/ Jubilee. BLUE 21 finanziert sich vorwiegend aus Zuwendungen öffentlicher und privater Zuschussgeber und Stiftungen. Zur Wahrung unserer finanziellen Unabhängigkeit sind Spenden ein stets gern gesehener Beitrag. Als gemeinnütziger Verein können wir steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen ausstellen (BLUE 21 e.V., Postbank Berlin, Kt.-Nr. 777896107, BLZ 100 100 10). Wenn der Peso purzelt Die Auswirkungen des internationalen Währungssystems für die Entwicklungsländer – von Philipp Hersel und Daniel Craffonara – Berlin 2006 ISBN-10: 3-923020-36-8 | ISBN-13: 978-3-923020-36-2