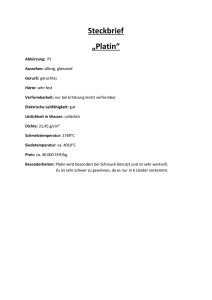Familiengeschichten aus der Steinzeit
Werbung

Geschlechtsbestimmung | 12 Familiengeschichten aus der Steinzeit Geschlechtsbestimmung Rekonstruierte Verwandtschaftsverhältnisse Die Geschlechtsbestimmung menschlicher Skelettreste ruht auf drei Säulen, dem metrisch fassbaren Unterschied zwischen den Geschlechtern, morphologisch abweichenden Formmerkmalen sowie molekulargenetisch nachweisbaren X- bzw. Y-chromosomalen Strukturen (DNA-Analyse). Auch wenn sie mit unterschiedlichen »Trefferquoten« einhergehen, konkurrieren diese Methoden nicht wirklich miteinander, sondern ergänzen sich. Die Extraktion, Vervielfältigung und Darstellung von DNA-Bausteinen ist kompliziert – Kontaminationen mit fremder Erbsubstanz müssen definitiv auszuschließen sein. Auch unter Berücksichtigung aller Standards »greift« die DNA-Analyse nicht in jedem Fall: Ätherische Öle, Phenole, Huminsäuren sowie feuchtes Liegemilieu wirken sich ungünstig aus, stärker erodiertes Knochenmaterial versagt häufig seine Kooperation. Weniger degradiertes Erbgut kann u.U. aus Zahndentin gewonnen werden. Es enthält zwar nur einen relativ geringen Anteil organischer Komponenten, ist allerdings durch den Zahnschmelz, der als härteste Sub- von Christina Jacob, Hans-Christoph Strien und Joachim Wahl Genetischer Fingerabdruck, DNA-Analysen, der »gläserne Bürger« – das sind gängige Stichworte, die uns tagtäglich begegnen. Diese modernen Methoden auf vergangene Epochen zu übertragen ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich. Entsprechende Untersuchungsergebnisse lassen sich nur unter ganz besonderen Bedingungen erzielen, wie etwa in der spätbronzezeitlichen Lichtensteinhöhle (s. Beitrag »Die Menschen aus der Lichtensteinhöhle – Größter DNAPool der Bronzezeit«). Oft führen Analysen zu keinem Resultat, weil bei Altfunden, üblichen Lagerungsbedingungen und unsachgemäßer Bergung die erhofften Informationen in den Knochen vielfach nicht mehr erhalten oder extrahierbar sind. Doch die Methoden verfeinern sich stetig, sodass es sich lohnt, mit manchen Probenentnahmen am Originalmaterial abzuwarten. So ist es auch bereits ein Vierteljahrhundert her, dass der einzigartige Fund von Talheim am Neckar 1983 entdeckt wurde. Den Ausgräbern des bandkeramischen Massengrabs bot sich ein chaotisches Durcheinander menschlicher Skelettreste. Einzelne Körperpartien lagen zwar noch in anatomischer Abfolge, doch viele Knochen konnten keinem bestimmten Individuum mehr zugeordnet werden. Die meisten Schädel ließen Spuren von Gewalteinwirkungen erkennen. Die hier vergrabenen Individuen waren gewaltsam zu Tode gekommen. Zwischen den Skelettteilen fanden sich Hüttenlehmbrocken und Keramikscherben der jüngeren Bandkeramischen Kultur, die den Befund auf etwa 5100 v. Chr. datieren. Altersbestimmung Bei Nichterwachsenen basiert die makroskopische Bestimmung des Sterbealters im Wesentlichen auf der Zahnentwicklung sowie messbaren Wachstumsvorgängen, bei Erwachsenen auf der Verwachsung der Schädelnähte, Abkauung der Zähne, Verschleiß- oder Degenerationserscheinungen sowie der Verknöcherung knorpeliger Strukturen. Prinzipiell geben all diese Kriterien aber nur Auskunft über das biologische Alter. Das tatsächliche, kalendarische Alter kann erheblich davon abweichen, da stets mit früh- und spätreifen Individuen zu rechnen ist. Zudem vermögen Familiengeschichten und Dramen von Mord und Totschlag aus der Vorzeit – eine Story, die reif für einen Krimi wäre. Nur hat sie sich nicht heute, sondern in der Jungsteinzeit vor mehr als 7000 Jahren im schwäbischen Talheim ereignet, und ihre Entdeckung und Rekonstruktion sorgt immer wieder für Aufsehen. Der Fund des Talheimer Massengrabes ist umso bemerkenswerter, weil es hier beispielhaft gelingt, verschiedenste Facetten des Lebens und der gesellschaftlichen Verhältnisse kleiner Gemeinschaften anhand akribischer Untersuchungen sterblicher Überreste zu rekonstruieren. Sehr oft sind Grabfunde regelrechte »Zeitkapseln«, die ganz direkte und entschlüsselbare Informationen über viele Jahrhunderte oder wie in diesem Fall Jahrtausende hinweg in unsere Gegenwart transportieren. Besonders wertvoll und entscheidend für die Interpretation bzw. weitreichende wissenschaftliche Auswertungen ist zudem die Tatsache, dass es sich um einen »geschlossenen Fund« handelt, der völlig ungestört durch spätere Veränderungen und Eingriffe entdeckt und minutiös dokumentiert werden konnte. MK endogene und exogene Faktoren Alterungsprozesse zu beeinflussen, ohne dass diese in jedem Einzelfall erkannt und benannt werden können. Deshalb wird die Angabe des Sterbealters in der Regel mit einer dem jeweiligen Kriterium entsprechenden Fehlerspanne versehen, z. B. für den Zahndurchbruch zwischen ± 0,5 und 3 Jahre bzw. für die Verwachsung der Schädelnähte ± 5 bis 10 Jahre. Durch die Kombination verschiedener Parameter lassen sich die relativ großen Fehlerspannen etwas einengen, doch sind hierbei geschlechtsspezifische und pathologische Einflüsse zu berücksichtigen. Abnutzungserscheinungen können lediglich schwache Indizien liefern, da sie u. a. von individueller genetischer Disposition, Ernährungsweise, eventuell vorhandenen Stoffwechselstörungen sowie körperlichen Belastungen abhängig oder Sekundärfolgen krankhafter Veränderungen und Verletzungen sein können. So kann z. B. die Abkauung der Zähne nur in groben Grenzen und unter entsprechenden Einschränkungen für die Altersdiagnose herangezogen werden. Eine zusätzliche Unsicherheit besteht insofern, als dass alle heute verwendeten Kriterien an rezenten Referenzgruppen erarbeitet wurden, die im Vergleich mit prähistorischen Bevölkerungen gänzlich anderen Lebensbedingungen unterliegen, und die daraufhin – was die Genauigkeit ihrer Aussage betrifft – prinzipiell nur unter Vorbehalt übertragbar sind. Die vier rekonstruierten Familien aus Talheim als Silhouetten und plastisch-wissenschaftliche Rekonstruktionen der ungefähr 20 Jahre alten Frau sowie des etwa achtjährigen Jungen in den Städtischen Museen Heilbronn 2007. stanz des menschlichen Körpers gilt, zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt. In etwa 5 % bis 30 % der Fälle konnten bislang erfolgreiche DNA-Typisierungen durchgeführt werden. Die morphologische Geschlechtsdiagnose beruht auf Formmerkmalen – insbesondere am Becken und am Schädel –, die zwischen Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägt sind, allerdings auch innerhalb der Geschlechter sowie regional und im diachronen Vergleich variieren. Der so genannte Geschlechtsdimorphismus kann dabei je nach Populationsstichprobe größer oder kleiner sein und die Formvarianten beider Geschlechter überlappen sich in verschieden großen Schnittmengen. Nachdem sich gezeigt hat, dass die Variationsbreite der meisten Einzelmerkmale bei Männern größer ist als bei Frauen, werden im Zweifelsfall grazile Männer eher als Frauen fehlbestimmt, robuste Frauen dagegen seltener als Männer angesprochen. Neben den visuell fassbaren Kriterien kommen verschiedene metrische Ansätze zur Geschlechtertrennung zum Einsatz. Sie sind objektiv und weniger vom Erfahrungsschatz des Bearbeiters abhängig. In einigen Fällen weisen bereits die 13 14 | Familiengeschichten aus der Steinzeit Mittelwertvergleiche signifikante Unterschiede auf. Daneben werden Indizes und Diskriminanzfunktionen berechnet, die zum Teil auf kleinräumigen Messstrecken basieren und somit auch noch bei bruchstückhaftem Knochenmaterial hilfreich sind. Unter allen Skelettelementen weist das knöcherne Becken die deutlichsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf. Infolge seiner Funktion im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt ist das weibliche Becken insgesamt ausladender, niedriger und mit einem rundlicheren Beckeneingang versehen als das männliche. Im Detail lassen sich etwa ein Dutzend typischer Einzelstrukturen ansprechen, die nach ihrem Ausprägungsgrad gewichtet werden, u. a. geburtstraumatische Veränderungen, deren Fehlen allerdings nicht zwangsläufig die Diagnose »männlich« bedeutet. An zweiter Stelle folgt der Schädel, der v. a. in der Überaugenregion, hinsichtlich der Stirnneigung sowie im Nackenbereich aussagekräftige Anhaltspunkte liefert. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind hier im Wesentlichen robustizitäts- und muskelzugabhängig. Für den Hirn- und Gesichtsschädel sowie den Unterkiefer sind zusammen mehr als 20 Merkmale sowie eine größere Zahl von Messstrecken beschrieben worden, deren »Trefferquoten« bei einem Abgleich mit geschlechtsbekannten Schädeln zwischen 75 % und 95 % liegen. Bei Messungen an Zähnen zeigte sich, dass v. a. die Eck- und Backenzähne und gleichzeitig die Zahnhalsdurchmesser besser geeignet sind als die Kronendurchmesser. Auch lässt das Extremitätenskelett Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennen. Weibliche Ober- und Unterarmknochen sowie Oberschenkelknochen, Schien- und Wadenbeine sind durchschnittlich graziler, schlanker und kleiner und weisen ein schwächeres Muskelmarkenrelief auf. Obwohl Männer im Mittel größer sind als Frauen und zudem mehr und kräftigere Muskeln besitzen, gibt es natürlich auch zierlich gebaute Männer bzw. große, robuste Frauen. Zur Geschlechtsbestimmung Nichterwachsener, insbesondere auch Föten und Neugeborene, stehen bislang nur wenige morphologische Anhaltspunkte am Unterkiefer, Darmbein und Oberschenkelknochen, ansonsten lediglich metrische Merkmale an Milchzähnen zur Verfügung. Man kann davon ausgehen, dass sich die sekundären Geschlechtsmerkmale auch am Knochen erst im Laufe der Pubertät in ihrer vollen Prägnanz ausbilden. Versuche aus jüngerer Zeit, über die Form des Unterkiefers oder den Winkelverlauf des inneren Gehörgangs am Felsenbein geschlechtstypische Merkmale bei Nichterwachsenen aufzuspüren, haben eine »Trefferquote« von immerhin um bzw. über 80 %. Schätzung der Körpergröße | Verwandtschaftsdiagnose Schätzung der Körpergröße Die Vermutung, dass zwei oder mehr Individuen miteinander verwandt sein könnten, ergibt sich nicht selten bereits aus dem Fundzusammenhang – bei Doppel- und Mehrfachbestattungen, abgesonderten Grabgruppen oder Grablegen innerhalb oder im Umfeld eines Grabhügels. Diese Rahmenbedingungen fehlen bei der Talheimer Grube, wo die Skelettteile wild durcheinander lagen. Anhaltspunkte von Seiten der Anthropologie waren zunächst Details in der Ausformung des Hirn- und Gesichtsschädels, später Ähnlichkeiten in der Verteilung von Merkmalen wie Nahtvarianten, Schaltknochen, zusätzliche Zahnhöcker, überzählige Zähne o.ä., die vorhanden oder nicht vor- Die Bestimmung der Körperhöhe basiert meistens auf der Korrelation zwischen der Länge einzelner Extremitätenknochen sowie der Körpergröße. Selten werden auch andere Skelettelemente herangezogen. Sie ist aus mehreren Gründen tatsächlich nur eine Schätzung: Erstens schwankt die Größe eines Erwachsenen über den Tag hinweg, abends ist man aufgrund nachlassender Elastizität der Bandscheiben etwa 2 cm kleiner als morgens. Zweitens nimmt sie mit zunehmendem Alter ab. Infolge von Rückbildungsprozessen, absinkendem Fußgewölbe, Osteoporose u. a. sind ältere Menschen kleiner als sie als jüngere Erwachsene waren. Bei Frauen setzen diese Vorgänge hormonbedingt etwa Mitte vierzig, bei Männern erst später ein. Drittens sind die unterschiedlichen Körperproportionen von Männern und Frauen sowie verschiedener Populationen in Raum und Zeit zu berücksichtigen. Insofern müssen Individualbestimmungen grundsätzlich eine Fehlerspanne enthalten. Die Erfahrung zeigt, dass Knochen der unteren Extremitäten enger mit der Körperhöhe korrelieren als Armknochen, da Letztere nicht unmittelbar zur Körpergröße beitragen. Altersbedingte Abbauprozesse werden bei der Übertragung auf (prä)historisches Skelettmaterial meist vernachlässigt. Den vorgenannten Unsicherheiten versucht man allerdings mit ausgewählten Berechnungsformeln zu begegnen, die der zu untersuchenden Populationsstichprobe regional und chronologisch am nächsten kommen. So existieren u. a. nach Geschlechtern getrennte Berechnungstabellen für verschiedene Volksgruppen, akzelerierte und weniger akzelerierte Gruppen. Gerade 16 Kinder und Jugendliche, sieben Frauen, neun Männer und zwei Erwachsene unbestimmten Geschlechts konnten identifiziert werden. Ihre Lage in der Grube zeigt, dass die Personen nicht sorgfältig in die Grube gelegt, sondern teilweise an Armen und Beinen gepackt und hineingeworfen wurden. Plastisch-wissenschaftliche Rekonstruktion des ungefähr 60 Jahre alten Mannes in den Städtischen Museen Heilbronn 2007. Geschlechtsbestimmungen basieren auf den unterschiedlich ausgeprägten Schädeln und Becken von Frauen und Männern. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Geschlechtsmerkmale häufig noch nicht ausgeprägt, sodass meist eine gewisse Unsicherheit bleibt. handen und in verschiedenen Populationen unterschiedlich häufig anzutreffen sind. Diese zum Teil sehr seltenen anatomischen Variationen, häufig auch »epigenetische« oder – für den Zahn- und Kieferbereich – »odontologische« Merkmale genannt, haben in der Regel keinen Einfluss auf die Lebensqualität des Trägers und treten bei verwandten Personen öfter auf als im Durchschnitt der Bevölkerung. Je seltener ein solches Detail vorkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Merkmalsträger in familiärem Zusammenhang stehen. Ähnlich aussagefähig sind Gemeinsamkeiten hinsichtlich Form und Ausdehnung der Nasennebenhöhlen, die ausgesprochen individuell gestaltet sind. Als erstes biochemisches Verfahren wurde versucht, über den Nachweis von Blutgruppeneigenschaften an überdauertem Hartgewebe Verwandtschaft zu erschließen. Der eigentliche Durchbruch gelang dann in den 1990er-Jahren mit Einführung der so genannten Polymerase-Kettenreaktion (PCR), mit deren Hilfe auch kleine Bausteine originaler Erbsubstanz vervielfältigt werden können. Damit ist der tatsächliche Beweis von Verwandtschaftsverhältnissen möglich. Hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten dieser Methode gelten allerdings auch hier die bereits oben angeführten Einschränkungen. Grundsätzlich muss zudem unterschieden werden zwischen der DNA der Mitochondrien, den »Kraftwerken« der Zelle, die lediglich Hinweise auf die mütterliche Abstammungslinie liefern, und der DNA aus dem Zellkern, die tatsächliche Verwandtschaft zwischen einzelnen Individuen nachzuweisen vermag. Die Chance, dass Letztere Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert, ist allerdings um ein Vielfaches geringer. 15 Frühe Metallurgie in Altperu | 64 Fingerabdrücke im Gold Spurenelementanalytik mit Laserablations-Massenspektrometrie von Sandra Schlosser Das Gold der Inka errang durch die spanischen Eroberer des 16. Jh. einen unauslöschbaren Ruf. Jedoch stellt es sich bei näherer Betrachtung lediglich als letzter Glanzpunkt einer jahrtausendealten Entwicklung der Metallverarbeitung dar, die nach jüngsten Funden bereits vor 4000 Jahren mit dem einfachen Hämmern großer Goldnuggets begann. Als gut formbares und repräsentatives Metall sollte das Gold von Anfang an eine herausragende Rolle in der amerikanischen und peruanischen Metallurgie spielen. So ist es auch wenig verwunderlich, wenn nicht nur Schatzsucher, sondern auch Archäologen sich fragen, woher dieser Goldreichtum stammte. Gab es eine bestimmte Region, die das ganze Land mit dem geschätzten Rohstoff versorgte, entspann sich ein weit verzweigtes Handelsnetz? Oder gab es – wie auch heute – in vielen Kleinregionen lokale Goldgewinnung aus Minen oder Flüssen? In einem Projekt am Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim wird diesen Fragen am Beispiel der Kulturen Paracas und Nasca nachgegangen, die zwischen 800 v. und 700 n. Chr. an der Südküste Perus bestanden. Gold ist nicht gleich Gold Natürliches Gold kommt häufig sekundär angereichert als Seifengold in Flüssen oder primär angereichert in so genannten Gold-Quarz-Gängen vor. Es enthält nicht nur Silber in Anteilen von bis zu 50 %, sondern auch eine Vielzahl verschiedenster Elemente in sehr geringen Konzentrationen, so genannte Spurenelemente. Ungefähr 25 davon sind für die Analyse von Interesse, unter anderem Blei, Nickel, Zink, Wismut oder Zinn. Die Gehalte der einzelnen Spurenelemente sind jeweils spezifisch für die unterschiedlichen Lagerstättentypen und -regionen und bilden eine Art Muster, das als geochemischer Fingerabdruck bezeichnet wird. In archäologischen Goldobjekten hat sich dieser weitgehend erhalten, da das Rohgold lediglich geschmolzen und nicht wie heute elektrolytisch gereinigt und raffiniert wurde. Zu den frühesten naturwissenschaftlichen Methoden in der Archäologie gehören zweifellos Materialanalysen. Natürlich lassen sich die Ende des 18. Jh. von Klapproth veröffentlichten Untersuchungen, für die mehrere Gramm schwere Münzen vollständig aufgelöst werden mussten, nicht mit modernen Laser-Anwendungen vergleichen, bei denen nur noch einige Mikrogramm (10-6 g) verdampft werden. Zudem war die Motivation Klapproths und vieler seiner Nachfolger vermutlich reine Neugier »an den Dingen an sich«, wohingegen der interdisziplinäre Ansatz heute entscheidender ist. Modernste Analytik und geologische Informationen werden nun zur Beantwortung archäologischer Fragestellungen mit einbezogen. Die Verbindung von Typologie, Technik und Spurenelementanalytik bei peruanischen Goldobjekten steht stellvertretend für einen solch modernen Ansatz der Materialanalyse. RS Wichtige beprobte archäologische Fundorte der Chavín-, Paracas- und Nasca-Kultur. In den grau unterlegten Gebieten wurden Goldproben aus Flüssen und Minen gesammelt. Plasma – ICP) bei sehr hohen Temperaturen atomisiert, ionisiert und mithilfe von hohen Spannungsunterschieden in den Analysatorteil, einen so genannten Quadrupol, abgesaugt. Dieser besteht aus vier Stabelektroden, die das Wechselfeld in ihrer Mitte sehr schnell variieren können und auf diese Weise nur je ein bestimmtes Isotop bzw. dessen Ion hindurchlassen. Im Detektor werden diese Ionen schließlich gezählt und in ein zeitabhängiges Signal umgewandelt, das dann weiter ausgewertet wird. Gewöhnlich werden die Proben in Säure aufgeschlossen und dem Gerät als verdünnte Lösung zugeführt, doch ist dies für die Analyse von Naturgold und archäologischen Funden nicht die beste Methode. Viel schneller und schonender für kleine Objekte ist die Laserablation, für die prinzipiell keine Probe entnommen werden muss. Nur bei Stücken, die aufgrund ihrer Größe nicht in die Laserkammer hinein- passen, ist es nötig, Material zu entnehmen. Allerdings reichen hier winzige Späne von etwa 1 mg Gewicht, die für das Auge gerade mal sichtbar sind. In der Laserablationskammer, durch die ein Trägergas (Helium oder Argon) strömt, trifft der Laserstrahl von oben auf die Oberfläche des Objektes oder Goldnuggets. Auf einen Punkt von nur ca. 50 μm Durchmesser gebündelt, verdampft der Strahl – von der Oberfläche in die Tiefe dringend – ein winziges Volumen des Goldes. Die dabei entstehenden feinen Partikel werden vom Gasstrom direkt in die Plasmafackel transportiert, wo sie ionisiert werden. Ein weiterer Vorteil der Laser-Beprobung ist zudem die hohe Ortsauflösung durch den sehr kleinen Strahldurchmesser. So können Veränderungen der Zusammensetzung in der Tiefe oder in Mikrobereichen auf der Fläche verfolgt werden. Auch kleine Einschlüsse im Gold, z. B. aus Platinmetallen, können einzeln analysiert werden. Frühe Metallurgie in Altperu Allgemein geht man davon aus, dass in den frühesten Gold verarbeitenden Kulturen noch keine anderen Metalle wie Silber oder Kupfer hinzulegiert wurden (die ihrerseits eigene Spurenelemente mitbringen würden) und auch kein Gold aus verschiedenen Regionen vermischt wurde. Dadurch ist es möglich, den geochemischen Fingerabdruck von Objekten und Lagerstätten miteinander zu vergleichen und die Herkunft des Rohstoffes zu bestimmen. Aber auch der Vergleich archäologischer Fundstücke untereinander erlaubt bereits Aussagen zur geografischen und zeitlichen Verbreitung bestimmter Goldtypen, die wiederum Hinweise zu Kontakten, Austausch und etwaigem Handel liefern. Massenspektrometrie Zur Bestimmung von Spurenelementen dient heute meist die Massenspektrometrie (MS). Bei dieser Analysemethode reichen sehr geringe Probenmengen aus, zugleich können extrem niedrige Konzentrationen nachgewiesen werden. Außerdem gibt sie auch Aufschluss zur Isotopenzusammensetzung in Erzen, Metallen, Knochen oder Gesteinen. Grundsätzlich besteht ein Massenspektrometer aus Ionenquelle, Analysator und Detektor, wobei heutzutage eine Vielzahl verschiedener Prinzipien und Bauteile für diese drei Einheiten verwendet wird. In unserem konkreten Fall wird die Probe in einem induktiv gekoppelten Plasma (Inductively Coupled Zu einer ersten Blüte kam die Metallurgie im Norden des Alten Peru in der Chavín-Kultur (1100–300 v. Chr.). Ohne dass bisher eine Vorentwicklung bekannt ist, tritt in den Bestattungen hochrangiger Persönlichkeiten ein plötzlicher Reichtum an Goldobjekten auf. Beeindruckend zeigen dies die im Tempel von Kuntur Wasi freigelegten Gräber (800–200 v. Chr.). Die Kronen, Pektorale, Nasengehänge und Ohrpflöcke überraschen nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch die Beherrschung des Materials und der Technik. Massive Bleche sind mit komplexen getriebenen Motiven verziert, die Vorderseiten sorgsam poliert, die Schnittkanten gerundet. Verbindungen wurden bei den frühesten Objekten noch mechanisch, d.h. mit Metallstreifen, geschaffen und erst später geschweißt und gelötet. Auch Kupfer und Silber treten in der weiteren Entwicklung erstmals auf. Sie wurden aber noch nicht aus Erzen gewonnen bzw. verhüttet, sondern als gediegene, also natürlich vorkommende Metalle verarbeitet. Im Kontakt mit der Chavín-Kultur entwickelte sich an der Südküste Perus die Paracas-Kultur (800– 200 v. Chr.), die besonders durch reich verzierte Textilien bekannt ist, die sich in Mumienbündeln dank des Wüstenklimas perfekt erhalten haben. Stil und Themen der Darstellungen auf Textilien und auch Keramikgefäßen lassen deutlich Chavíneinfluss erkennen. Die Metallurgie hingegen ist eine viel einfachere als zur gleichen Zeit in Nordperu. Obwohl auch in der Paracas-Kultur Gold zu verschiedensten Schmuckstücken verarbeitet wurde, ist die Machart 65 66 | Fingerabdrücke im Gold doch eine ganz andere. Die Bleche sind oft papierdünn, grob ausgeschnitten und offenbar meist ausschließlich als Beigaben für die Mumienbündel und nicht für eine tatsächliche Benutzung hergestellt worden. War diese Goldmetallurgie eine eigene Entwicklung oder aus dem Nordandenraum initiiert? Wurde nicht nur die Technik, sondern auch das Rohmaterial weitergegeben? Für die nachfolgende Nasca-Kultur (100–700 n. Chr.), die sich aus der Paracas-Kultur entwickelte, verschärft sich der Kontrast weiter: Während an der Nordküste Perus in der Moche-Kultur die Metallverarbeitung mit der Produktion von Legierungen, verschiedenen Vergoldungstechniken, Löten und auch Gießen in voller Blüte steht, werden an der Südküste immer noch einfache Blechschmuckstücke gefertigt. Zwar sind diese im Vergleich zu Paracas-Objekten nun größer und sorgfältiger bearbeitet, aber mit den Grabbeigaben des Señor de Sipán, eines Mochefürsten, können sie nicht mithalten. Allgemein scheint der Kontakt zwischen Nordund Südküste in dieser so genannten Frühen Zwischenperiode eher gering gewesen zu sein. Produzierten die Nascaleute ihr Gold demnach ausschließlich selbst? Noch heute leistet die Region Ica-Nasca einen bedeutenden Beitrag zur jährlichen Goldproduktion Pe- Platinmetalle Von großer Bedeutung für die Charakterisierung von Gold sind die sechs so genannten Platinmetalle: Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium und schließlich Platin selbst. Als edle Metalle gehen sie z.T. eine Legierung mit Gold ein und sind unanfällig gegenüber äußeren Einflüssen wie Verwitterung oder Schmelzen, die das Spurenelementmuster verändern könnten. Die Verhältnisse dieser sechs Elemente zueinander sind besonders wichtig für die Unterscheidung verschiedener Goldtypen. rus. Aber anders als in den riesigen Tagebaulöchern in den Anden lohnt hier der Abbau im Familienbetrieb, da die Goldadern klein und ergiebig sind. Bislang fehlen allerdings jegliche Belege für eine vorinkaische Ausbeutung der Minen. Einzig der Vergleich von archäologischen Goldobjekten und Goldvorkommen kann hier Licht ins Dunkel bringen. Zu diesem Zweck wurden Proben aus Goldminen und Flüssen aus allen wichtigen Lagerstättengebieten Perus genommen. Von Interesse waren dabei ausschließlich solche Vorkommen, die bereits dem prähistorischen Menschen zugänglich waren, d.h. in denen das Gold mit bloßem Auge sichtbar war und mit einfachen Mitteln gewonnen werden konnte. Platin (Pt) – Palladium (Pd) – Streudiagramm. Die Stecknadel im Heuhaufen ist gefunden: Eindeutig liegen zwei Objekte von der Südküste (Paracas- und Nascakultur) im Bereich des sehr platinreichen nordperuanischen Goldes. Krone mit 14 beweglichen Gesichtern aus dem Grab eines ca. 60 Jahre alten Mannes, der in der zentralen Plattform des Tempels von Kuntur Wasi bestattet wurde (Objekt im Museo de Sitio Kuntur Wasi, Nordperu). Isotope Bezeichnet Atome desselben Elementes mit verschiedenen Massenzahlen. Diese kommen durch die unterschiedliche Anzahl der Neutronen im Atomkern zustande. Die meisten Elemente setzen sich aus mehreren natürlich vorkommenden Isotopen zusammen, deren Verhältnisse zueinander leicht variieren können. So ermöglicht z. B. die Bestimmung der Isotopenverhältnisse des im Kupfer stets enthaltenen Bleis eine Zuordnung des Metalls zu bestimmten Lagerstätten. Das Wort Isotop ist abgeleitet vom Altgriechischen »iso« (gleich) und »topos« (Ort), da die Isotope trotz unterschiedlicher Massenzahl an derselben Stelle im Periodensystem der Elemente stehen. Neue Dimension in archäologischen Funden Als Erstes brachten die Analysen unerhofft neue Erkenntnisse zur Metallurgie der Paracas- und NascaKultur. Denn außer den Spurenelementen wurden auch die Hauptbestandteile Gold, Silber und Kupfer bestimmt, die Auskunft über die Objektzusammensetzung geben. Entgegen der bisherigen Meinung wurde in beiden Kulturen bereits Kupfer verwendet, und spätestens mit der Nascakultur auch in erheblichen Anteilen (bis Baumdiagramm oder Dendrogramm mit denselben Proben wie im Pt-Pd-Diagramm. Hier sind die beiden »Exoten« aus nördlichem Gold (Nr. 6 und 17) noch besser zu erkennen, ebenso die gefälschten Nascableche (Nr. 11–13) und die Goldtypen innerhalb der Nasca- und Paracaskultur. Zur Berechnung wurden die Elemente Nickel, Arsen, Rhodium, Palladium, Zinn, Antimon, Osmium, Iridium, Platin, Blei und Wismut herangezogen. zu ca. 27 %) zum Gold hinzulegiert. Doch damit nicht genug: Erstmals konnte das Vergolden in der Nascakultur nachgewiesen werden – da die Objekte mit hohen Kupferanteilen genauso goldgelb schimmern, als bestünden sie aus reinem Gold. Die Art der Vergoldungstechnik ist noch Gegenstand weiterer Untersuchungen. Glücklicherweise ist das für die Legierungen verwendete Kupfer – sehr wahrscheinlich gediegenes Kupfer – so rein gewesen, dass der geochemische Fingerabdruck des Goldes nicht verwischt wurde. Die Auswertung der einzelnen Spurenelementkonzentrationen erfolgt mit statistischen Methoden. Am einfachsten zeigen Streudiagramme, wie sich bestimmte Elemente zueinander verhalten. Es wurden die gemessenen Platin- und Palladiumgehalte in ppm (parts per million = millionstel Teile) von Goldobjekten der Paracas- und Nasca-Kultur und einiger nordperuanischer Fundstücke zum Vergleich gegeneinander aufgetragen. Als Erstes fällt auf, dass die von der Südküste Perus stammenden Gegenstände fast alle viel geringere Gehalte an Platin (Pt) und Palladium (Pd) enthalten als Objekte von der Nordküste. Das ist bereits ein erster Hinweis auf einen südlichen Ursprung des Goldes, da weiter im Norden (v. a. Ekuador, Kolumbien) auch Platin mit dem Gold vorkommt und so in die Objekte gelangt sein kann. 68 | Fingerabdrücke im Gold Außerdem lassen sich unter den Funden der Südküste drei Goldtypen unterscheiden: 1) Gold mit wenig Palladium und gleich bleibendem Verhältnis zu Platin; 2) Gold mit viel Palladium und wenig Platin und schließlich 3) Gold mit beiden Elementen zu fast gleichen Anteilen. Dieser dritte Goldtyp ist durch vier identische Nasca-Schmuckbleche vertreten, die im Diagramm deutlich aus allen anderen Objekten herausfallen. Bereits Herstellung und Stil dieser Schmuckbleche ließen Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen, was nun durch die Spurenelemente bestätigt werden kann. Bei genügend großer Datenbasis lassen sich mittels des geochemischen Fingerabdrucks also auch Fälschungen entlarven. Zwei Objekte von der Südküste, die im Diagramm genau in den Bereich des nördlichen Goldes fallen, brachten eine Überraschung: Ein zerknittertes Goldblech aus einem Mumienbündel von der ParacasHalbinsel hatte offenbar eine weite Reise aus dem Norden hinter sich, ehe es zur Grabbeigabe wurde, und ein Kopfschmuck der späten Nascazeit in Form eines Vogels wurde bestimmt nicht aus einheimischem Gold geschmiedet. Bezieht man in der weiterführenden Auswertung mehr als zwei oder drei Elemente in die Betrachtung Neue Dimension in archäologischen Funden | ein (multivariate Statistik), ergeben sich dementsprechend komplexere Beziehungen, die auch nicht mehr in einem Streudiagramm dargestellt werden können. Mithilfe verschiedener statistischer Funktionen lässt sich die Ähnlichkeit von Proben in Abstände umrechnen und z. B. in einem Baumdiagramm darstellen. Goldarten, die sich in ihren Spurenelementen am meisten unterscheiden, teilen sich als erste im Diagramm in die Hauptäste, während fast gleiche Proben wie kleine Zweige direkt nebeneinander stehen. Auch hier gruppieren sich die beiden Paracas- und Nascaobjekte aus nördlichem Gold eindeutig mit den Gegenständen von der Nordküste, und die beiden sich im Streudiagramm bereits andeutenden Goldtypen werden sichtbar. Einzelne Goldobjekte passen bisher zu keiner Gruppe, was sich mit dem Fortgang der Analysen jedoch ändern kann. Im letzten Schritt, für den Vergleich zwischen Goldlagerstätten und Objekten, können nur diejenigen Elemente herangezogen werden, die sich beim Schmelzen nicht verflüchtigen oder zu einer Schlacke oxidieren. Geeignet sind z. B. Silber, Nickel und Platinmetalle. Leider ermöglicht der bisherige Stand der Analysen noch keinen umfassenden Vergleich mit allen beprobten Lagerstättengebieten, aber erste Ergebnisse Reich verzierte Ohrschmuckscheibe der Nasca-Kultur mit Darstellung des typischen menschengestaltigen mythischen Wesens. (Objekt im Peabody Museum, Harvard University, Boston). Der Rio Chinchipe – einer der goldreichen Flüsse am Ostabhang der Anden in Nordperu, an dem noch heute Goldwäscher anzutreffen sind. Chavín-Kultur (1100–300 v. Chr.) Benannt nach dem Fundort Chavín de Huántar am Ostabhang der Weißen Kordillere in den nordperuanischen Anden. Der mehrphasige Tempelkomplex aus Plattformen, Plätzen, eingetieften Innenhöfen und unterirdischen Galerien war einst reich mit Steinreliefs verziert. Im Kult spielten Jaguar, Kondor und Schlange eine zentrale Rolle und wurden häufig abgebildet. Auf den typischen vexierbildartigen Darstellungen finden sich oft aber auch nur Einzelelemente wie z. B. Reißzähne oder Augen. Das Einflussgebiet der Chavín-Kultur erstreckte sich bis an die Küste und weit in den Süden. Dabei handelte es sich allerdings vermutlich weniger um ein administratives Gebilde als um die Verbreitung einer Ideologie oder Religion. In den Tempelgalerien von Chavín de Huántar fanden sich Opfergaben aus weit entfernten Regionen, wie z. B. Spondylusmuscheln von der ekuadorianischen Pazifikküste. von Gold aus der Ica-Nasca-Region zeigen, dass in der Nascazeit auf alle Fälle lokales Gold verwendet wurde. Auch wenn die Gesamtauswertung noch nicht abgeschlossen ist, lassen sich zusammenfassend bereits erste Aussagen treffen: In der Paracaszeit wanderte offenbar nicht nur das Wissen um die Gewinnung und Verarbeitung von Gold, sondern in einigen Fällen auch das Gold selbst. Denn außer dem Blech aus dem Mumienbündel wurde auch ein jüngst analysierter Ring aus einem frühen Paracasgrab im Palpatal bei Nasca aus nördlichem Gold hergestellt. Bei letzterem Fund gibt auch die Herstellungstechnik Grund zur Annahme, dass der Ring im Chavíngebiet angefertigt wurde. Bei dem einfachen Goldblech ist dazu keine Aussage möglich. Für die Nasca-Kultur gibt es bisher nur einen Beleg für Gold aus dem Norden: eine vogelförmige Schmuckfeder aus der späten Phase, die vom Stil her aber an der Südküste hergestellt worden ist. Durch weitere Analysen wird sich das Bild noch vervollständigen. 69