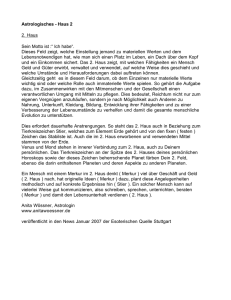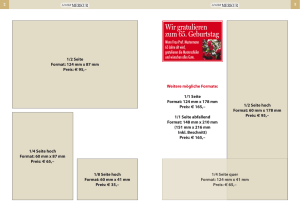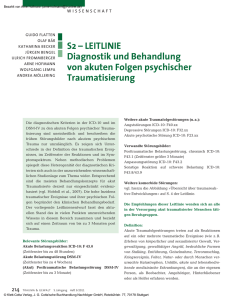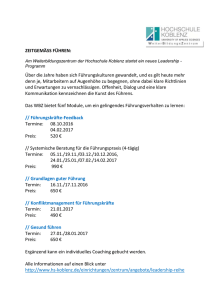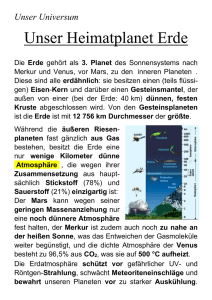Wir, die Bürger(lichen)
Werbung

Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Christoph Möllers Wir, die Bürger(lichen) Bei Anbruch der Dämmerung Ob liberale Demokratien überleben, erscheint heute überraschend ungewiss. Vielleicht hat eine Ordnung, an der Mehrheiten kein Interesse haben, weil sie bloß versorgt und unterhalten werden wollen, keine Zukunft – schon gar nicht, wenn sich die Ordnung selbst als Mehrheitsherrschaft versteht. Doch ist offen, ob die, die sich heute auf eine Mehrheit berufen, um deren Herrschaft aus den Angeln zu heben, tatsächlich in der Mehrheit sind. Denn Präsident Trump, der Brexit oder die knapp gescheiterte Wahl von Norbert Hofer in Österreich, der einen höheren Stimmenanteil erhielt als Trump, sind nur unter zwei Bedingungen möglich: Sie bedürfen einer nicht mehrheitsfähigen Linken, die Kandidaten wie Corbyn oder Mélenchon unterstützt und so rechtsautoritäre Siege wahrscheinlicher macht. Vor allem gäbe es den Vormarsch des Rechtsautoritarismus nicht ohne eine politisch schwach mobilisierte bürgerliche Mitte, die erschrocken zusieht, wie die Welt zerfällt, an der sie hängen sollte, weil sie in ihr ordentlich bis sehr gut, jedenfalls überdurchschnittlich, lebt. Das Weltbild dieses potentiell einflussreichen Teils jeder Bevölkerung scheint auf politische Auseinandersetzung nicht recht eingestellt zu sein. Man mag sagen: So war es immer schon. Aber das wäre zu pauschal und mit Blick auf viele historische Momente geradezu falsch. Warum aber stimmt es heute? Vielleicht, weil die bürgerliche Mitte es sich angewöhnt hat, an eine Welt ohne Politik zu glauben, oder zumindest an eine, in der Politik ihr weder etwas nehmen noch geben kann. Politikfreies Institutionenvertrauen Dieser Glaube findet seinen Ausdruck im Vertrauen in politikferne Institu­ tio­nen: in eine qualifizierte und neutrale Bürokratie, eine unabhängige Justiz, in ein moderates politisches und ökonomisches Establishment und in manchen Ländern auch in das Militär. Dieses Vertrauen wird in vielen Staaten der Welt in der Tat nicht oder nur selten enttäuscht. Die Frage ist nur, wo es enden sollte; konkreter, ob politikferne Institutionen Politik moderieren und stabilisieren oder ob sie selbst von der Stabilität des politischen Prozesses abhängen. Unter Bedingungen eines sich selbst einhegenden politischen Prozesses ziehen Gerichte und Zentralbanken der Politik Grenzen. Beginnt das politische System zu schlingern, schlingern alle Institutionen mit. Wie Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung 6 Christoph Möllers wenig dieser simple Zusammenhang theoretisch verstanden wird, zeigt sich daran, dass die politische Theorie ihren Lesern fast nur die Wahl zwischen liberalen Normalisten und apokalyptischen Ausnahmetheoretikern, sozusagen zwischen Rawls und Agamben, lässt, die zu der jeweils anderen Seite des Problems nichts zu sagen haben. So erweisen sich heute vermeintlich politikimmune Institutionen als vom allgemeinen politischen Klima höchst abhängig. Wenn mobilisierte politische Gruppen den Kampf gegen sie aufnehmen, sind sie verwundbar, wie sich nicht nur in Polen, Ungarn, Indien und der Türkei besichtigen lässt. Auch die alltägliche Wahrnehmung von Freiheitsrechten hängt von politischen Stimmungen ab. Minderheiten haben wenig von ihren Grundrechten, wenn Mitbürger, Nachbarn, Grenzbeamte, Polizisten und Lehrer ihre Spielräume nutzen, um ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Diese Spielräume sind durch formalisierte Institutionen wie Recht nicht aus der Welt zu schaffen.1 Die Idee, öffentliche Institutionen könnten ohne Politik funktionieren, unterstellt, dass ihre wesentliche Funktion darin besteht, vor Mehrheiten zu schützen. Auf dieser Grundlage wird es folgerichtig, wenn die aktuelle politische Entwicklung in der bürgerlichen Mitte den Zweifel an demokratischen Verfahren und die Überzeugung von ihren freiheitsfeindlichen Effekten forciert – Zweifel, die in der allgegenwärtigen Klage über den grassierenden »Populismus« zum Ausdruck kommen. Denn die Kategorie des »Populismus« kennt keine Unterscheidung zwischen rechts und links, sie passt in ein politikaverses Schema von Politik. Dass Skepsis gegenüber Mehrheitsherrschaft wenig demokratisch ist, versteht sich von selbst. Es ist nicht möglich, Demokratie so zu bestimmen, dass die praktische politische Relevanz von Mehrheiten verschwindet.2 Interessanter als das fehlende demokratische Bekenntnis ist aber die irrige politische Diagnose, die der Kritik an Mehrheitsherrschaft zugrunde liegt. Sie ignoriert, dass es Minderheitenschutz nur dort gibt, wo Mehrheiten gezählt werden. Mehrheitsherrschaft ist vielleicht keine hinreichende, aber doch eine notwendige Bedingung für funktionierende unpolitische Institutionen. Eine unabhängige Gerichtsbarkeit und eine zuverlässige Bürokratie gibt es empirisch jedenfalls nur in Demokratien, also dort, wo das politische 1 Vgl. George Orwell, Freedom of the Park. In: The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell. New York: Harcourt Brace Jovanovich 1968. 2 Zu diesem erstaunlich selten ausgesprochenen Zusammenhang vgl. Liav Orgad, The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights. Oxford University Press 2016. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Wir, die Bürger(lichen) 7 System so viel Sinn für ergebnisoffene Verfahren hat, dass es diese vervielfachen und aus einer direkten politischen Anbindung entlassen kann. Solche Freiheitsgrade manifestieren sich in föderaler Vielfalt, in unabhängigen Gerichten und eben auch in freien Wahlen. Nur wo jede Stimme zählt, liegen die Voraussetzungen für Minderheitenschutz bereit. Wo sie fehlen, wird es Institutionen, die dem Minderheitenschutz dienen und politisch unabhängig sind, nicht geben. Das Deutschland des späten 19. Jahrhunderts mag ein Rechtsstaat ohne Demokratie gewesen sein. Heute findet sich ein solches Gebilde nicht mehr auf der Landkarte. In unpolitische Institutionen zu vertrauen, ohne sich um politische zu kümmern, ist politisch naiv. Es ist aber auch nützlich. Dort, wo sich Beamte, Richterinnen und Forscher um die Offenheit ihrer Verfahren kümmern, ist der Rest der Bürgerschaft von dieser Pflicht ebenso befreit wie von der Verantwortung für den Fall ihres Scheiterns. Ohne Parteien Niemand mag politische Parteien, und das ist nichts Neues. Ihr Aufkommen war ein theoretisch nicht vorgedachter Betriebsunfall praktizierter Demokratie. Bis heute findet die politische Philosophie keinen rechten Ort für sie.3 Ihre Funktion, zwischen einem eingesessenen gesellschaftlichen Establish­ ment und dem demokratischen Wahlvolk zu vermitteln, bestätigt den Verdacht, dass Parteien demokratische Herrschaft weniger ermöglichen als verhindern, indem sie eine weitere Ebene korporatistischer Oligarchie in die Politik einbauen. Der Widerspruch zwischen allgemeiner Abneigung und der schwer zu bestreitenden praktischen Notwendigkeit von Parteien für Demokratien ließ sich solange überdecken, wie Parteien zumindest Teilhabe an Macht versprachen. Heute haben sie in westlichen Demokratien auch deswegen einen so schlechten Ruf, weil niemand mehr an dieses Versprechen glaubt. Im Verfall politischer Parteien verbindet sich die politische Selbstentmächtigung derjenigen, die von ihrer Herrschaft profitieren könnten, mit einer Radikalisierung moralischer Anforderungen an Politik. Da Parteiarbeit als kleinkariert und unglamourös gilt – und zwar absolut zu Recht –, bleibt damit unklar, wer sich mit ihr abgeben will. In Deutschland sind dies jedenfalls nicht nur Leute mit anderweitigen Karriereaussichten. Auch in anderen Ländern gibt es einen spürbaren Niveau- und 3 Vgl. zuletzt Jonathan White / Lea Ypi, The Meaning of Partisanship. Oxford University Press 2016. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung 8 Christoph Möllers Einflussverlust des politischen Establishments. Zudem werden politische Parteien durch basisdemokratische Willensbildung radikalisiert und bieten damit immer weniger allgemein wählbare Alternativen. Die Einsicht, dass politische Prozesse organisiert und vermittelt werden müssen und nicht auf allen Ebenen egalitär und öffentlich ausgestaltet sein können, gilt mehr und mehr als undemokratisch.4 Mit dem Sieg von Transparenz- und basisdemokratischen Idealen schlägt jede parteiinterne politische Bewegung schnell ungefiltert auf das allgemeine politische System durch – und dieses Durchschlagen bestätigt dann noch einmal den Zweifel an demokratischer Politik, der doch Ursache des Problems ist. Wer die Mühen und die Undurchsichtigkeit repräsentativer Prozesse nicht mag, bekommt das Präsidialplebiszit mit allen Folgen. So kann das Publikum der Parteiendemokratie vorwerfen, sie sei zu wenig demokratisch, der direkten Demokratie aber, sie sei es zu viel. Weil die Klage über zu viel Demokratie bis auf Weiteres nicht gut klingt, klagt es nun über Populismus. Die Wahl autoritärer Figuren ist nicht per se undemokratisch. Doch folgt aus dieser Einsicht allein kein Argument gegen demokratische Herrschaft. Dieser Schluss erschiene so, als würde man nach einem Asthma-Anfall das Atmen einstellen, um den nächsten Anfall zu verhindern. Wer die Ordnung der Gleichen aufgibt, wenn sie falsche Entscheidungen trifft, hat sich von vornherein nicht auf sie eingelassen und sollte besser nach Autokratien suchen, die dem eigenen Lebenskreis nutzen. Dies ist freilich ein riskantes Geschäft. So wenig die Berufung auf das »Volk« per se demokratisch ist, so wenig sind autoritäre Bewegungen per se undemokratisch – und vielleicht sind sie nicht zuletzt durch eine bürgerliche Verachtung gegenüber demokratischen Prozessen mitmotiviert. Eben diese Verachtung dürfte es liberalen Mittelschichten wiederum schwer machen, das Problem zu erkennen und sich selbst zu mobilisieren. Sie bleiben in einer sich selbst verstärkenden Skepsis befangen. Aussageloses Eigeninteresse Geht nicht alles gut, solange jeder an sich denkt? Auch diese liberale In­ tui­tion funktioniert nicht. Der Brexit ist dafür nur das sichtbarste Beispiel. Mit erstauntem Unbehagen beobachtet das Publikum, wie schwer sich das wirtschaftliche Establishment selbst in angelsächsischen Ländern damit tut, eine Freihandelsagenda am Leben zu erhalten. In Britannien, dem Mutter4 Vgl. Nadia Urbinati, Democracy Disfigured. Opinion, Truth, and the People. Cambridge / Mass.: Harvard University Press 2014. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Wir, die Bürger(lichen) 9 land liberaler Mäßigung, regiert von einer zutiefst wirtschaftsfreundlichen Partei, ist diese Bremse des Volkswillens außer Kraft gesetzt. Und wenn sie dort nicht funktioniert, kann sie überall kaputtgehen. Seit längerem fragen sich Beobachter, warum politische Parteien auch von denen gewählt werden, die als Erste an ihrer Wirtschaftspolitik leiden.5 Die Befürworter des Brexit seien, so erklären uns etwas mitleidige Kommentare, die ersten Opfer ihrer eigenen Entscheidung. Das ist zu kurz gedacht. Ohnehin wählt niemand allein nach seinen wirtschaftlichen Interessen. Vor allem ist es anmaßend, Wähler auf wirtschaftliche Präferenzen zu reduzieren, weil sie sich keine anderen leisten können. Dann müsste genug verdienen, wer eine Partei wählen will, die gegen Abtreibung eintritt. Einerseits wird die besitzbürgerliche Vereinzelung der Bürger gerade von Linken immer neu beklagt,6 auf der anderen Seite werden Wähler als irrational bezeichnet, wenn sie sich über andere als ihre höchstpersönlichen Probleme politisieren. Kaum jemand kann seine eigenen wirtschaftlichen Interessen hinreichend genau definieren. Wir haben keine Ahnung, welche politischen Entscheidungen welche konkreten Folgen für den eigenen wirtschaftlichen Status haben. Soweit wir wissen, hat die Liberalisierung des Welthandels bürgerliche Mittelschichten in Asien aufgebaut, aber in Europa und den Vereinigten Staaten leiden lassen.7 Dies mag für manche europäischen Staaten ein größeres Problem sein als für andere, so wie sich die Ursachen sozialer Ungleichheit in verschiedenen Staaten unterschiedlich darstellen. Wenn die Welt so schwer zu überschauen ist, verliert das Kriterium des liberalen Eigennutzes seinen politischen Sinn. Das bedeutet nicht, dass es in der Wirtschaftspolitik nicht bessere und schlechtere Entscheidungen gäbe. Es ist gut möglich, dass unter dem Brexit Briten und Europäer, Arme und Reiche leiden werden. Aber trotzdem lassen sich solche individuellen ökonomischen Nutzenkalküle nur mit politischer Vermittlung denken, also nicht nur über das Versprechen von konkretem Nutzen, sondern auch über die Verpflichtung der Wählenden auf bestimmte normative Kriterien ihrer Politik. Das Vertrauen darauf, dass sich niemand selbst schaden werde, leidet an zu vielen Ungewissheiten sowohl hinsichtlich ökonomischer Kausalitäten als auch hinsichtlich der 5 Für die amerikanischen Republikaner vgl. Thomas Frank, What’s the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America. New York: Metropolitan Books 2004. 6 Nicht zuletzt mit Neulektüren der Marx’schen Judenfrage vgl. Christoph Menke, Kritik der Rechte. Berlin: Suhrkamp 2015. 7 Vgl. Branko Milanovič, Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. Cambridge / Mass.: Harvard University Press 2016. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung 10 Christoph Möllers Härte normativer Maßstäbe, die es gebieten, eigene Nachteile im Namen eines Prinzips in Kauf zu nehmen. Emanzipatorischer Fortschritt als Politik Lange Zeit schienen amerikanische Linksliberale davon auszugehen, dass sich die politische Auseinandersetzung mit den Republikanern irgendwann durch den demografischen Fortschritt erledigen werde. Es müssten nur genug Hispanics und Asian Americans nachwachsen, um das reaktio­näre weiße Amerika zu majorisieren. In Deutschland wird ein vergleichbares libe­ rales Fortschrittsnarrativ mithilfe von Grundrechten formuliert, Gerichten überlassen und dann als Verfassungskonsens festgeschrieben. Zuletzt geschah dies bei der allerdings immer noch nicht vollendeten Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften. Beide Narrative versöhnten – mit manchen systematischen Brüchen – ein bürgerliches Fortschrittsbewusstsein mit demokratischer Politik. Mit beiden ist man nicht schlecht gefahren. Beide stoßen heute an ihre Grenzen. Das Problem emanzipatorischer Politik liegt nicht in ihrer fragmentierenden Fixierung auf die Identitätspolitik von Minderheiten, wie seit Trumps Wahl für die USA vermutet wird.8 Hier unterscheiden sich amerikanische und deutsche Politik. Politisch klug ist es, die Diskriminierungserfahrungen, die emanzipatorische Politik in Bewegung halten, nicht sozial selektiv auszuwählen. Oft steckt in der Diskriminierung von Gruppen auch eine Diskriminierung von Schichten. Damit lässt sich das Emanzipationsprojekt nicht mehr an die Demografie oder die Gerichte delegieren – aber das spricht nicht gegen das Projekt selbst. Emanzipatorische Politik glaubt freilich an einen Fortschritt, der sich in der Durchsetzung des moralisch Richtigen manifestiert. Das Problem emanzipatorischer Politik liegt daher in der Frage, wann ein politisches Anliegen auch als moralisches ausgewiesen werden sollte. Natürlich gelten für die Behandlung von Flüchtlingen oder die Gleichstellung Homosexueller moralische Argumente. Nur sind die politischen Nebenwirkungen zu beachten, wenn man sie verwendet. Eine besteht im Ausschluss der politischen Gegner. Der kann richtig sein. Nicht alle Fragen sind moralisch verhandelbar – und die Unsicherheit bei der Formulierung einer solchen Grenze ist ein großes Problem. Aber diese Schwierigkeit hängt auch damit zusammen, dass mehr Fragen moralisch verhandelbar sind, als uns lieb sein kann. Das Anzünden 8 Vgl. Mark Lilla, The End of Identity Liberalism. In: New York Times vom 18. November 2016. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Wir, die Bürger(lichen) 11 von Flüchtlingsheimen ist nicht moralisch verhandelbar, aber die Grenzöffnung schon. Wer Letztere moralisch festzurrt, vertreibt die Gegenseite aus dem etablierten politischen Diskurs. In der deutschen Diskussion zeigt sich das an dem geradezu lachhaften Ärger großer Teile des liberalen Milieus verschiedener politischer Affiliationen – von Rot-Grün bis zur CDU – über die CSU. Die CSU war gegen die Grenzöffnung und ist für eine quantitative Begrenzung der Zuwanderung. Vieles spricht dagegen, aber es ist eine Posi­ tion, die innerhalb des etablierten politischen Diskurses möglich bleiben muss. Wer sie für moralisch unzulässig erklärt, verengt den Raum legitimer Politik, so dass bestimmte Positionen sich einen Ort außerhalb dieses Raums suchen. Das »bürgerliche Lager« wird dann so bestimmt, dass viele Bürger aus ihm herausfallen. Nicht wirklich hilfreich ist dabei die verbreitete Begeisterung für die Position der Kirchen in der Flüchtlingspolitik.9 Für Christen gibt es gute theologische Gründe, gegenüber Flüchtlingen barmherzig zu sein. Was aber bedeuten gute theologische Gründe in einer Demokratie? Wer sich an der Rolle der Kirchen erwärmt, ohne an ihren theologischen Grundlagen teilzuhaben, sollte sich bei anderer Gelegenheit nicht über Einmischung beklagen. Der Kampf gegen die politische Bevormundung durch die Kirchen stand am Anfang der liberalen Bundesrepublik. Um seinetwillen trat Ernst-Wolfgang Böckenförde in die SPD ein. Heute wird das Problem politisch überdeterminierter Religion nur noch gesehen, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Durch starke moralische Unterfütterung politischer Positionen werden nicht nur extreme Gegenpositionen ermächtigt, sondern letztlich auch die eigenen Positionen politisch geschwächt. Moralische Positionen erschweren Kompromisse und Koalitionen. Sie verhindern sie nicht, führen aber oft dazu, dass sie nicht mehr als solche bezeichnet werden können – was das Publikum bemerkt, als Heuchelei deutet und zum Anlass nimmt, das politische System umso mehr zu verachten. Exakt so geschah es in der Flüchtlingspolitik. Nachdem die Bundesrepublik jahrelang die Verlagerung des Problems an die europäischen Außengrenzen betrieben hatte, rechtfertigte sie mit einem Mal mit einer moralisch hochgezonten Begründung die Grenzöffnung, um sich dann wieder von ihr abzuwenden, ohne diesen letzten Schritt jemals öffentlich gerechtfertigt zu haben. 9 Einsame kritische Verwunderung bei Hans Joas, Kirche als Moralagentur? München: Kösel 2016. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung 12 Christoph Möllers Rationalnationalismus der Mitte Wenn Politik sich in eine Gemengelage von Rechten, Moral und Fortschrittsglaube auflösen ließe, könnte sie auf nationale Identitäten verzichten. Für einen solchen Verzicht war die alte Bundesrepublik berühmt – bei manchen berüchtigt.10 Freilich ist nicht ganz klar, wie relevant dieser Verzicht war, weil Nationalismen in der Ära des Kalten Kriegs kaum eine politische Funktion erfüllten. Heute ist dies anders. In der Europapolitik ist die Überzeugung, dass Deutsche die besseren Europäer seien, in Deutschland so verbreitet, dass schon der Bundesaußenminister sein eigenes Volk vor ihr warnt.11 In vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt die Verbindung von Sparsamkeit gegenüber Griechenland, einem Mitglied der EU, und Offenheit gegenüber außereuropäischen Flüchtlingen als recht erratisch, jedenfalls sicher nicht als europafreundlich. Beide Entscheidungen galten in Deutschland verbreitet als so offensichtlich korrekt, dass über Vermittlung in der EU und ihre Folgen für das deutsche Bild wenig gesprochen wurde. In beiden Fällen schienen mit diesen Entscheidungen Tugenden verwirklicht zu werden, einmal Eigenverantwortung und Sparsamkeit, einmal Hilfsbereitschaft, und diese Tugenden gelten als nationale Tugenden. Es geht nicht darum, Nationalstolz zu kritisieren. Diese unergiebige Debatte hat die alte Bundesrepublik lange genug begleitet. Eigentümlich ist dieser Stolz aber als Element eines Weltbilds, das auf Politik verzichten will. Es ist ein Stolz, der seine eigene Existenz leugnet. Unvergessen die Szene, als die Bundeskanzlerin nach gewonnener Bundestagswahl Hermann Gröhe die Bundesfahne entwand. Man ist vielmehr stolz darauf, der beste Universalist zu sein, also partikular stolz im Namen von Universalien wie dem Respekt vor der Menschenwürde oder der richtigen Form der Europapolitik. Ein solcher Stolz sieht sich als Konsequenz der Fähigkeit, das Richtige tun zu können. Er kommt nicht aus Liebe zum eigenen Land, gegen die nichts zu sagen wäre, sondern daraus, dass das eigene Land gegenüber anderen Ländern Recht behält. Damit dient auch diese Art von Stolz dazu, sich über andere Länder, bemerkenswert häufig über andere europäische Länder, zu erheben. Am deutlichsten wird dies an der Gewissheit, fundamental besser zu funktionieren als Frankreich – ein Land, dessen wirtschaftliche und intellektuelle Kraft hierzulande vielfach unterschätzt wird. Hier tritt eine Art irregeleiteter Kantianismus auf den Plan, der Politik durch gute Gründe zu ersetzen sucht, ohne sich in die Position der anderen versetzen zu wollen. 10 Vgl. Karl Heinz Bohrer, Die Ästhetik des Staates. In: Merkur, Nr. 423, Januar 1984. 11 Sigmar Gabriel an der Hertie School of Governance Berlin am 16. März 2017. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Wir, die Bürger(lichen) 13 Politisch ist eine solche Rationalisierung des eigenen Überlegenheitsgefühls gefährlicher als ein Nationalstolz aus Heimatliebe, der sich auch darauf einlassen kann, was im eigenen Land alles schief läuft. Der Untergang der Fakten – und der politischen List Das postfaktische Zeitalter nimmt der bürgerlichen Mitte eine weitere Stütze, um damit noch eine Bestätigung für deren Skepsis gegenüber der Politik zu liefern. Natürlich können wir uns wieder und wieder über politisch kultivierte Wissensignoranz aufregen. Seltener wird die wissenssoziologische Binsenweisheit ausgesprochen, dass zwischen dem Anspruch auf faktische Richtigkeit, der Ausdifferenzierung von Expertise und der Etablierung eines bürgerlichen Stands ein Zusammenhang besteht. Modernisierung verlangt nach ausdifferenziertem Wissen und damit nach Expertentum, aber Expertentum ist kein gesellschaftlich neutrales Phänomen. Umgekehrt muss jeder demokratische Prozess eine bei allen Bürgern gleichverteilte politische Urteilskraft unterstellen. Der Widerspruch lässt sich kleinarbeiten, etwa mithilfe der Unterscheidung zwischen politischen und technischen Fragen, verschwinden wird er nicht. Bürgerliche Mittelschichten haben sowohl ein ökonomisches Interesse an Expertise, weil sie oft von ihrer eigenen leben, als auch ein politisches, weil sie Ungleichheit zu ihren eigenen Gunsten legitimiert. Dazu gehört auch die Abschließung sozialer Sphären von »Akademikern« und »Nichtakademikern«, die seit kurzem auch in den Vereinigten Staaten als Haben oder Fehlen eines College-Degrees zu einer politisch relevanten Unterscheidung wurde. Im Ergebnis hat die Kritik am Expertenwesen auch dann einen demokratischen Punkt, wenn sie nicht so gemeint ist. »Science-Märsche« fallen vor diesem Hintergrund unter die Rubrik LobbyAktionen mit erfreulichen Anliegen – das politische Problem verfehlen sie. Dass die demonstrierenden Wissenschaftler unter einem Slogan des politischen Sachzwangs marschierten (»Zu Fakten gibt es keine Alternative«) dokumentiert diese Blauäugigkeit aufs Drastischste. Dass rechtsautoritäre Bewegungen die Erinnerung an Genozide in Zweifel ziehen, erfüllt vor diesem Hintergrund einen doppelten Zweck. Zum einen identifizieren sie sich dadurch mit ihren totalitären Vorbildern. Zum anderen suchen sie eine ihrem eigenen politischen Projekt im Wege stehende Funktion der Erinnerungskultur zu stören, nämlich die Verbindung eines historischen Faktums mit dessen moralisch eindeutiger Bewertung. Diese Verbindung hilft liberalen Systemen über ihre eigene moralische Ambiguität hinwegzukommen. In einer komplexen Welt, in der jeder Konsument und jede Touristin schnell zum Komplizen moralisch anfechtbarer Praktiken Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung 14 Christoph Möllers wird, suchen alle umso mehr nach einem Stück moralischer Eindeutigkeit in Form historischer Wahrheit. Die ihrerseits nicht ohne historische Expertise funktionierende Erinnerungskultur liefert hier einen archimedischen Punkt. Solche Punkte sind kostbar, weil sie selten sind. Aus Fakten allein folgen keine politischen Handlungsanweisungen. Die meisten Fakten sehen aus wie die in der Debatte um den Klimawandel, in der das Phänomen nicht zu bestreiten ist, aber unklar bleibt, was aus ihm folgen sollte. Sich über »Klimaleugner« aufzuregen greift zu kurz, denn es geht darum, dass die Einsicht in den Klimawandel nicht davor bewahrt, mit ihm politisch umzugehen. Aus Fakten folgt keine Politik, ja es gehört umgekehrt sogar zu jedem politischen Prozess, mit Fakten frei umzugehen. Dieser freie Umgang ist in liberalen Ordnungen das zentrale Gut der Meinungsfreiheit. Gerichte unterstellen, dass sich im Normalfall Fakten und Meinungen in einer Äußerung vermischen – und dass diese Mischung im Ganzen von der Meinungsfreiheit zu schützen ist. Nicht geschützt sind nachweisbare und intendierte Unwahrheiten. Die Grenze zu ziehen zwischen einer vertretbaren politischen Halbwahrheit und einer glatten Lüge ist schwierig, aber juristisch und politisch notwendig – jedenfalls soweit wir im Ergebnis Wert darauf legen, zwischen Adenauer und Trump unterscheiden zu können. Diese Unterscheidung verlangt, den politischen Prozess nicht als eine Kombination aus faktischem Sachzwang und moralischer Vorgabe zu verstehen. Wo der Raum für poli­ tische Halbwahrheiten nicht geöffnet bleibt, bricht sich die postfaktische Lügenwelt Bahn. Die ungeliebten Praktiken des Politischen Sollten Parteien, die die Meinungsfreiheit bekämpfen und Minderheiten bedrohen, »fair« behandelt werden? Das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Jedenfalls kann eine politische Auseinandersetzung, in der Umgangsregeln nur von einer Seite beachtet werden, nicht gelingen. Auch hier wäre besser zwischen rechtlichen, moralischen und politischen Normen unterschieden. Listen und Halbwahrheiten gehören wie Kompromisse zu den ungeliebten Praktiken des Politischen, dieser eigenartigen Kulturtechnik, die darauf angewiesen zu sein scheint, Überzeugungen zugleich zu besitzen, zu bewahren und zu verraten. Was dem Publikum wie Heuchelei erscheint, könnte praktizierte Demut sein, die weiß, dass sie mit endlichen Gegenständen handelt, die den Wert des Zweifels an den eigenen Überzeugungen nicht für eine Schwäche hält und die damit leben kann, sich nicht durchzusetzen. Wirklich moralisch attraktiv ist das nicht. Wenn es in der Politik darum geht, Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Wir, die Bürger(lichen) 15 Mehrheiten zu beschaffen, dann erscheint das zugleich zu wenig erbaulich und zu wenig profitabel. Die Abneigung gegenüber der Praxis der Politik im Inneren hat ihr Pendant in der auswärtigen Politik. Nach 1989 erschien die Möglichkeit greifbar, Außenpolitik im Aufbau internationaler Institutionen aufgehen zu lassen, die moralische und technische Anliegen miteinander verbinden. Der Traum währte bekanntlich nur ein gutes Jahrzehnt und ging mit dem 11. September 2001 zu Ende. Heute wirken die außenpolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre wie ein Spiegelbild der innenpolitischen Szene. Irritierte formsichere Bürger stoßen auf politische Rabauken. Doch beherrschen diese Rabauken im Äußeren, namentlich die Russen, die alteuropäischen Künste der diplomatischen Finten und Intrigen, die dem an Institutionen und Regeln hängenden alten Westen abhanden gekommen zu sein scheinen. Irgendeine Nostalgie für die alte Politik sollten wir uns sparen. Jeder kann wissen, dass sie schlimmstenfalls viele Opfer hatte, bestenfalls ein Instrument faute de mieux ist, eine Kunst des Möglichen unter Bedingungen, in denen weniger möglich ist, als zu wünschen wäre. Auch der Wunsch nach mehr »Politisierung« klingt nur solange schön, wie er nicht in Erfüllung geht. Sich an der Repolitisierung der Politik nicht ergötzen zu sollen, heißt aber nicht, die Techniken des Politischen ignorieren zu dürfen. Sie gehören zu der Art grauer Praktiken, mit denen man sich für den Fall der Fälle besser vertraut machen sollte.12 Mobilisierung und Privatheit Linksliberalen wie konservativen bürgerlichen Mittelschichten fällt es schwer, sich politisch zu mobilisieren. Sie definieren sich über ihre Indivi­ dua­li­tät. Sie sind notorisch überbeschäftigt. Die Anforderungen des individuellen Erfolgs, der Selbstvervollkommnung und der Familiengründung kosten Zeit und stehen politischem Engagement entgegen. Außerdem verstehen sich viele Bürger gar nicht als unpolitisch – und es ist nur zu verständlich, warum. Sie informieren sich und diskutieren, gehen zur Wahl, sie erziehen ihre Kinder, sie engagieren sich in Vereinen, und sie gehen für die Europäische Union oder die Fakten auf die Straße. 12 Vor diesem Hintergrund ist das Aufkommen von Ratgeberliteratur durchaus willkommen. Vgl. Masha Gessen, Autocracy: Rules for Survival. In: NYRB vom 10. November 2016; Timothy Snyder, On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. New York: Tim Duggan Books 2017. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart Kostenlos zur Verfügung gestellt von: Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung 16 Christoph Möllers Aber so wichtig all dies sein mag, so ist doch immer weniger klar, ob es genügt. Solche Formen des Engagements konnten früher auf eine Arbeitsteilung mit dem funktionierenden politischen System vertrauen, das vielleicht die eine oder andere unliebsame Regierung, aber doch nicht das Ende der Ordnung bringen würde. Zugleich besteht gerade bei engagierten Mittelschichten, die über besondere Ausdrucksmöglichkeiten verfügen, die Tendenz, mit politischen Motiven noch einmal zu tun, was ohnehin getan wird: Geld für ein Projekt organisieren, Webseiten designen, Aufsätze im Merkur schreiben, Projekte planen oder Unterschriften sammeln. Dagegen ist nichts zu sagen, nur dürfte es sich als Selbsttäuschung erweisen, dies als genuin politisches Engagement zu verstehen. Wer die Ordnung so, wie sie ist, für schützenswert hält, wird sich ihren politischen Formen anvertrauen müssen – und das bedeutet vor allem anderen, in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in diesen zu verbringen. Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält, wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen. Die Bevölkerung in Deutschland hat in den letzten Jahren an vielen Fronten eine erstaunliche Gelassenheit gezeigt: bei terroristischen Anschlägen, die ohne Hysterie zur Kenntnis genommen wurden, oder bei der Konfrontation damit, dass die ökonomischen Erfolgschancen der nach 1960 Geborenen deutlich unter denen ihrer Eltern liegen dürften. Weiterhin liegt über den meisten Teilen des Landes wenig Angst und Verbitterung in der Luft. Vielleicht wird es einfach so bleiben. Vielleicht wäre es auch besser, sich ernsthaft darauf einzurichten, dass dies eine unwahrscheinliche Variante ist. Merkur 71 (818), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart