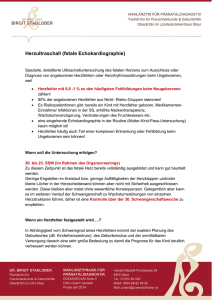FAZ: Artikel über Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern
Werbung
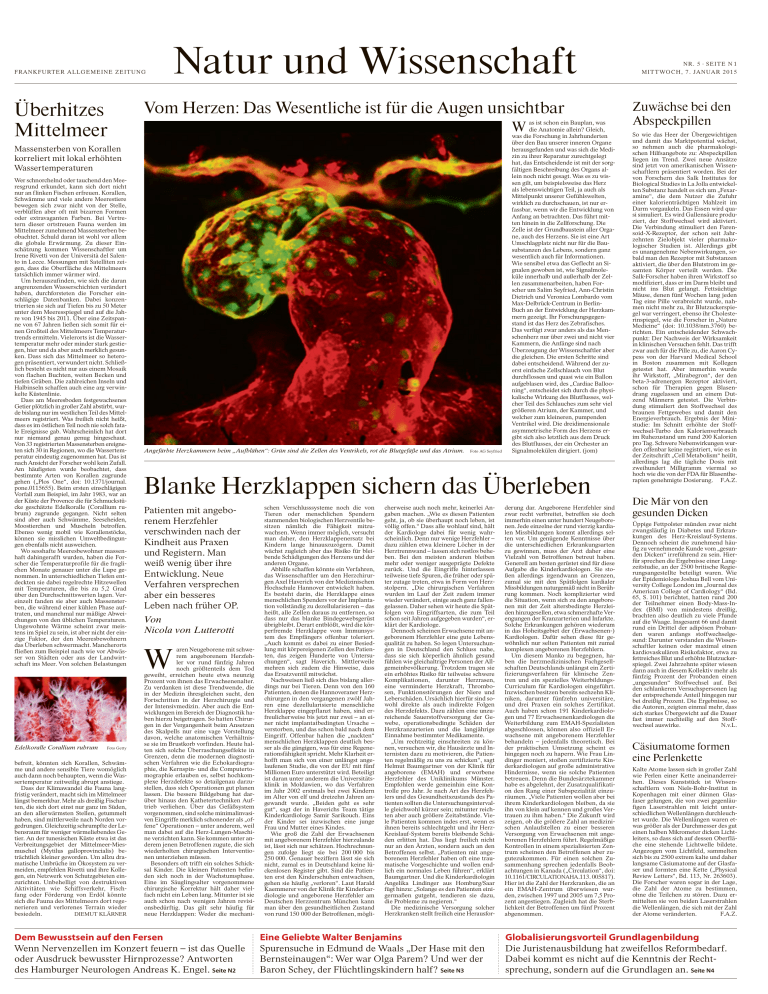
FRANKFU RT ER A L LG EM E I NE Z E I TU NG Überhitzes Mittelmeer Natur und Wissenschaft Vom Herzen: Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar as ist schon ein Bauplan, was die Anatomie allein? Gleich, W was die Forschung in Jahrhunderten Massensterben von Korallen korreliert mit lokal erhöhten Wassertemperaturen Wer schnorchelnd oder tauchend den Meeresgrund erkundet, kann sich dort nicht nur an flinken Fischen erfreuen. Korallen, Schwämme und viele andere Meerestiere bewegen sich zwar nicht von der Stelle, verblüffen aber oft mit bizarren Formen oder extravaganten Farben. Bei Vertretern dieser ortstreuen Fauna werden im Mittelmeer zunehmend Massensterben beobachtet. Schuld daran ist wohl vor allem die globale Erwärmung. Zu dieser Einschätzung kommen Wissenschaftler um Irene Rivetti von der Università del Salento in Lecce. Messungen mit Satelliten zeigen, dass die Oberfläche des Mittelmeers tatsächlich immer wärmer wird. Um herauszufinden, wie sich die daran angrenzenden Wasserschichten verändert haben, durchforsteten die Forscher einschlägige Datenbanken. Dabei konzentrierten sie sich auf Tiefen bis zu 50 Meter unter dem Meeresspiegel und auf die Jahre von 1945 bis 2011. Über eine Zeitspanne von 67 Jahren ließen sich somit für einen Großteil des Mittelmeers Temperaturtrends ermitteln. Vielerorts ist die Wassertemperatur mehr oder minder stark gestiegen, hier und da aber auch merklich gesunken. Dass sich das Mittelmeer so heterogen präsentiert, verwundert nicht. Schließlich besteht es nicht nur aus einem Mosaik von flachen Buchten, weiten Becken und tiefen Gräben. Die zahlreichen Inseln und Halbinseln schaffen auch eine arg verwinkelte Küstenlinie. Dass am Meeresboden festgewachsenes Getier plötzlich in großer Zahl abstirbt, wurde bislang nur im westlichen Teil des Mittelmeers registriert. Was freilich nicht heißt, dass es im östlichen Teil noch nie solch fatale Ereignisse gab. Wahrscheinlich hat dort nur niemand genau genug hingeschaut. Von 33 registrierten Massensterben ereigneten sich 30 in Regionen, wo die Wassertemperatur eindeutig zugenommen hat. Das ist nach Ansicht der Forscher wohl kein Zufall. Am häufigsten wurde beobachtet, dass bestimmte Arten von Korallen zugrunde gehen („Plos One“, doi: 10.1371/journal. pone.0115655). Beim ersten einschlägigen Vorfall zum Beispiel, im Jahr 1983, war an der Küste der Provence die für Schmuckstücke geschätzte Edelkoralle (Corallium rubrum) zugrunde gegangen. Nicht selten sind aber auch Schwämme, Seescheiden, Moostierchen und Muscheln betroffen. Ebenso wenig mobil wie Korallenstöcke, können sie misslichen Umweltbedingungen ebenfalls nicht ausweichen. Wo sesshafte Meeresbewohner massenhaft dahingerafft wurden, haben die Forscher die Temperaturprofile für die fraglichen Monate genauer unter die Lupe genommen. In unterschiedlichen Tiefen entdeckten sie dabei regelrechte Hitzewellen mit Temperaturen, die bis zu 5,2 Grad über den Durchschnittswerten lagen. Vereinzelt fanden sie aber auch Massensterben, die während einer kühlen Phase auftraten, und manchmal nur mäßige Abweichungen von den üblichen Temperaturen. Ungewohnte Wärme scheint zwar meistens im Spiel zu sein, ist aber nicht der einzige Faktor, der den Meeresbewohnern das Überleben schwermacht. Mancherorts fließen zum Beispiel nach wie vor Abwässer von Städten oder aus der Landwirtschaft ins Meer. Von solchen Belastungen Edelkoralle Corallium rubrum Foto Getty befreit, könnten sich Korallen, Schwämme und andere sensible Tiere womöglich auch dann noch behaupten, wenn die Wassertemperatur zeitweilig abrupt anstiege. Dass der Klimawandel die Fauna langfristig verändert, macht sich im Mittelmeer längst bemerkbar. Mehr als dreißig Fischarten, die sich dort einst nur ganz im Süden, an den allerwärmsten Stellen, getummelt haben, sind mittlerweile nach Norden vorgedrungen. Gleichzeitig schrumpfte der Lebensraum für weniger wärmeliebendes Getier. An der tunesischen Küste etwa ist das Verbreitungsgebiet der Mittelmeer-Miesmuschel (Mytilus galloprovincialis) beträchtlich kleiner geworden. Um allzu dramatische Umbrüche im Ökosystem zu vermeiden, empfehlen Rivetti und ihre Kollegen, ein Netzwerk von Schutzgebieten einzurichten. Unbehelligt von destruktiven Aktivitäten wie Schiffsverkehr, Fischfang oder Förderung von Erdöl könnte sich die Fauna des Mittelmeers dort regenerieren und verlorenes Terrain wieder besiedeln. DIEMUT KLÄRNER Angefärbte Herzkammern beim „Aufblähen“: Grün sind die Zellen des Ventrikels, rot die Blutgefäße und das Atrium. Foto AG Seyfried über den Bau unserer inneren Organe herausgefunden und was sich die Medizin zu ihrer Reparatur zurechtgelegt hat, das Entscheidende ist mit der sorgfältigen Beschreibung des Organs allein noch nicht gesagt. Was es zu wissen gilt, um beispielsweise das Herz als lebenswichtigen Teil, ja auch als Mittelpunkt unserer Gefühlswelten, wirklich zu durchschauen, ist nur erfassbar, wenn wir die Entwicklung von Anfang an betrachten. Das führt mitten hinein in die Zellforschung. Die Zelle ist der Grundbaustein aller Organe, auch des Herzens. Sie ist eine Art Umschlagplatz nicht nur für die Bausubstanzen des Lebens, sondern ganz wesentlich auch für Informationen. Wie sensibel etwa das Geflecht an Signalen gewoben ist, wie Signalmoleküle innerhalb und außerhalb der Zellen zusammenarbeiten, haben Forscher um Salim Seyfried, Ann-Christin Dietrich und Veronica Lombardo vom Max-Delbrück-Centrum in BerlinBuch an der Entwicklung der Herzkammern gezeigt. Ihr Forschungsgegenstand ist das Herz des Zebrafisches. Das verfügt zwar anders als das Menschenherz nur über zwei und nicht vier Kammern, die Anfänge sind nach Überzeugung der Wissenschaftler aber die gleichen. Die ersten Schritte sind dabei entscheidend. Während der zuerst einfache Zellschlauch von Blut durchflossen und quasi wie ein Ballon aufgeblasen wird, des „Cardiac Ballooning“, entscheidet sich durch die physikalische Wirkung des Blutflusses, welcher Teil des Schlauches zum sehr viel größeren Atrium, der Kammer, und welcher zum kleineren, pumpenden Ventrikel wird. Die dreidimensionale asymmetrische Form des Herzens ergibt sich also letztlich aus dem Druck des Blutflusses, der ein Orchester an Signalmolekülen dirigiert. (jom) Blanke Herzklappen sichern das Überleben Patienten mit angeborenem Herzfehler verschwinden nach der Kindheit aus Praxen und Registern. Man weiß wenig über ihre Entwicklung. Neue Verfahren versprechen aber ein besseres Leben nach früher OP. Von Nicola von Lutterotti aren Neugeborene mit schwerem angeborenem Herzfehler vor rund fünfzig Jahren noch größtenteils dem Tod geweiht, erreichen heute etwa neunzig Prozent von ihnen das Erwachsenenalter. Zu verdanken ist diese Trendwende, die in der Medizin ihresgleichen sucht, den Fortschritten in der Herzchirurgie und der Intensivmedizin. Aber auch die Entwicklungen im Bereich der Diagnostik haben hierzu beigetragen. So hatten Chirurgen in der Vergangenheit beim Ansetzen des Skalpells nur eine vage Vorstellung davon, welche anatomischen Verhältnisse sie im Brustkorb vorfinden. Heute halten sich solche Überraschungseffekte in Grenzen, denn die modernen diagnostischen Verfahren wie die Echokardiographie, die Kernspin- und die Computertomographie erlauben es, selbst hochkomplexe Herzdefekte so detailgenau darzustellen, dass sich Operationen gut planen lassen. Die bessere Bildgebung hat darüber hinaus den Kathetertechniken Auftrieb verliehen. Über das Gefäßsystem vorgenommen, sind solche minimalinvasiven Eingriffe merklich schonender als „offene“ Operationen – unter anderem, weil man dabei auf die Herz-Lungen-Maschine verzichten kann. Sie kommen unter anderem jenen Betroffenen zugute, die sich wiederholten chirurgischen Interventionen unterziehen müssen. Besonders oft trifft ein solches Schicksal Kinder. Die kleinen Patienten befinden sich noch in der Wachstumsphase. Eine im Säuglingsalter vorgenommene chirurgische Korrektur hält daher vielfach nicht ein Leben lang. Mitunter ist sie auch schon nach wenigen Jahren revisionsbedürftig. Das gilt sehr häufig für neue Herzklappen: Weder die mechani- W Dem Bewusstsein auf den Fersen Wenn Nervenzellen im Konzert feuern – ist das Quelle oder Ausdruck bewusster Hirnprozesse? Antworten des Hamburger Neurologen Andreas K. Engel. Seite N2 schen Verschlusssysteme noch die von Tieren oder menschlichen Spendern stammenden biologischen Herzventile besitzen nämlich die Fähigkeit mitzuwachsen. Wenn immer möglich, versucht man daher, den Herzklappenersatz bei Kindern lange hinauszuzögern. Damit wächst zugleich aber das Risiko für bleibende Schädigungen des Herzens und der anderen Organe. Abhilfe schaffen könnte ein Verfahren, das Wissenschaftler um den Herzchirurgen Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover entwickelt haben. Es besteht darin, die Herzklappe eines menschlichen Spenders vor der Implantation vollständig zu dezellularisieren – das heißt, alle Zellen daraus zu entfernen, so dass nur das blanke Bindegewebsgerüst übrigbleibt. Derart entblößt, wird die körperfremde Herzklappe vom Immunsystem des Empfängers offenbar toleriert. „Auch kommt es dabei zu einer Besiedlung mit körpereigenen Zellen des Patienten, das zeigen Hunderte von Untersuchungen“, sagt Haverich. Mittlerweile mehren sich zudem die Hinweise, dass das Ersatzventil mitwächst. Nachweisen ließ sich dies bislang allerdings nur bei Tieren. Denn von den 160 Patienten, denen die Hannoveraner Herzchirurgen in den vergangenen zwölf Jahren eine dezellularisierte menschliche Herzklappe eingepflanzt haben, sind erfreulicherweise bis jetzt nur zwei – an einer nicht implantatbedingten Ursache – verstorben, und das schon bald nach dem Eingriff. Offenbar halten die „nackten“ menschlichen Herzklappen deutlich besser als die gängigen, was für eine Regenerationsfähigkeit spricht. Mehr Klarheit erhofft man sich von einer unlängst angelaufenen Studie, die von der EU mit fünf Millionen Euro unterstützt wird. Beteiligt ist daran unter anderem die Universitätsklinik in Moldawien, wo das Verfahren im Jahr 2002 erstmals bei zwei Kindern im Alter von elf und dreizehn Jahren angewandt wurde. „Beiden geht es sehr gut“, sagt der in Haverichs Team tätige Kinderkardiologe Samir Sarikouch. Eins der Kinder sei inzwischen eine junge Frau und Mutter eines Kindes. Wie groß die Zahl der Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler hierzulande ist, lässt sich nur schätzen. Hochrechnungen zufolge liegt sie bei 200 000 bis 250 000. Genauer beziffern lässt sie sich nicht, zumal es in Deutschland keine lückenlosen Register gibt. Sind die Patienten erst den Kinderschuhen entwachsen, gehen sie häufig „verloren“. Laut Harald Kaemmerer von der Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum München kann man über den gesundheitlichen Zustand von rund 150 000 der Betroffenen, mögli- cherweise auch noch mehr, keinerlei Angaben machen. „Wie es diesen Patienten geht, ja, ob sie überhaupt noch leben, ist völlig offen.“ Dass alle wohlauf sind, hält der Kardiologe dabei für wenig wahrscheinlich. Denn nur wenige Herzfehler – dazu zählen etwa kleinere Löcher in der Herztrennwand – lassen sich restlos beheben. Bei den meisten anderen bleiben mehr oder weniger ausgeprägte Defekte zurück. Und die Eingriffe hinterlassen teilweise tiefe Spuren, die früher oder später zutage treten, etwa in Form von Herzstolpern. „Die chirurgischen Verfahren wurden im Lauf der Zeit zudem immer wieder verändert, einige auch ganz fallengelassen. Daher sehen wir heute die Spätfolgen von Eingriffsarten, die zum Teil schon seit Jahren aufgegeben wurden“, erklärt der Kardiologe. Dennoch scheinen Erwachsene mit angeborenem Herzfehler eine gute Lebensqualität zu haben. So legen Untersuchungen in Deutschland den Schluss nahe, dass sie sich körperlich ähnlich gesund fühlen wie gleichaltrige Personen der Allgemeinbevölkerung. Trotzdem tragen sie ein erhöhtes Risiko für teilweise schwere Komplikationen, darunter Herzrasen, eine verminderte Herzkraft, Thrombosen, Funktionsstörungen der Niere und Leberschäden. Ursächlich hierfür sind sowohl direkte als auch indirekte Folgen des Herzdefekts. Dazu zählen eine unzureichende Sauerstoffversorgung der Gewebe, operationsbedingte Schäden der Herzkranzarterien und die langjährige Einnahme bestimmter Medikamente. „Um rechtzeitig einschreiten zu können, versuchen wir, die Hausärzte und Internisten dazu zu motivieren, die Patienten regelmäßig zu uns zu schicken“, sagt Helmut Baumgartner von der Klinik für angeborene (EMAH) und erworbene Herzfehler des Uniklinikums Münster. Empfohlen werde gemeinhin eine Kontrolle pro Jahr. Je nach Art des Herzfehlers und des Gesundheitszustands des Patienten sollten die Untersuchungsintervalle gleichwohl kürzer sein; mitunter reichten aber auch größere Zeitabstände. Viele Patienten kommen indes erst, wenn es ihnen bereits schlechtgeht und ihr HerzKreislauf-System bereits bleibende Schäden erlitten hat. Das liegt freilich nicht nur an den Ärzten, sondern auch an den Betroffenen selbst. „Patienten mit angeborenem Herzfehler haben oft eine traumatische Vorgeschichte und wollen endlich ein normales Leben führen“, erklärt Baumgartner. Und die Kinderkardiologin Angelika Lindinger aus Homburg/Saar fügt hinzu: „Solange es den Patienten einigermaßen gutgeht, tendieren sie dazu, die Probleme zu negieren.“ Die medizinische Versorgung solcher Herzkranken stellt freilich eine Herausfor- Eine Geliebte Walter Benjamins Spurensuche in Edmund de Waals „Der Hase mit den Bernsteinaugen“: Wer war Olga Parem? Und wer der Baron Schey, der Flüchtlingskindern half? Seite N3 derung dar. Angeborene Herzfehler sind zwar recht verbreitet, betreffen sie doch immerhin einen unter hundert Neugeborenen. Jede einzelne der rund vierzig kardialen Missbildungen kommt allerdings selten vor. Um genügende Kenntnisse über die unterschiedlichen Erkrankungsarten zu gewinnen, muss der Arzt daher eine Vielzahl von Betroffenen betreut haben. Generell am besten gerüstet sind für diese Aufgabe die Kinderkardiologen. Sie stoßen allerdings irgendwann an Grenzen, zumal sie mit den Spätfolgen kardialer Missbildungen naturgemäß nicht in Berührung kommen. Noch komplizierter wird die Situation, wenn sich zu den angeborenen mit der Zeit altersbedingte Herzleiden hinzugesellen, etwa schmerzhafte Verengungen der Kranzarterien und Infarkte. Solche Erkrankungen gehören wiederum in das Hoheitsgebiet der (Erwachsenen-) Kardiologen. Dafür sehen diese für gewöhnlich nur selten Patienten mit zumal komplexen angeborenen Herzfehlern. Um diesem Manko zu begegnen, haben die herzmedizinischen Fachgesellschaften Deutschlands unlängst ein Zertifizierungsverfahren für klinische Zentren und ein spezielles WeiterbildungsCurriculum für Kardiologen eingeführt. Inzwischen besitzen bereits sechzehn Kliniken, darunter fünfzehn universitäre, und drei Praxen ein solches Zertifikat. Auch haben schon 191 Kinderkardiologen und 77 Erwachsenenkardiologen die Weiterbildung zum EMAH-Spezialisten abgeschlossen, können also offiziell Erwachsene mit angeborenem Herzfehler behandeln – jedenfalls theoretisch. Bei der praktischen Umsetzung scheint es hingegen noch zu hapern. Wie Frau Lindinger moniert, stoßen zertifizierte Kinderkardiologen auf große administrative Hindernisse, wenn sie solche Patienten betreuen. Denn die Bundesärztekammer habe es abgelehnt, der Zusatzqualifikation den Rang einer Subspezialität einzuräumen. „Viele Patienten wollen aber bei ihrem Kinderkardiologen bleiben, da sie ihn von klein auf kennen und großes Vertrauen zu ihm haben.“ Die Zukunft wird zeigen, ob die größere Zahl an medizinischen Anlaufstellen zu einer besseren Versorgung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern führt. Regelmäßige Kontrollen in einem spezialisierten Zentrum scheinen den Betroffenen aber zugutezukommen. Für einen solchen Zusammenhang sprechen jedenfalls Beobachtungen in Kanada („Circulation“, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113. 005817). Hier ist die Zahl der Herzkranken, die an ein EMAH-Zentrum überwiesen wurden, zwischen 1997 und 2005 um 7,5 Prozent angestiegen. Zugleich hat die Sterblichkeit der Betroffenen um fünf Prozent abgenommen. N R. 5 · S E I T E N 1 M I T T WO C H , 7 . JA N UA R 2 0 1 5 Zuwächse bei den Abspeckpillen So wie das Heer der Übergewichtigen und damit das Marktpotential wächst, so nehmen auch die pharmakologischen Hilfsangebote zu: Abspeckpillen liegen im Trend. Zwei neue Ansätze sind jetzt von amerikanischen Wissenschaftlern präsentiert worden. Bei der von Forschern des Salk Institutes for Biological Studies in La Jolla entwickelten Substanz handelt es sich um „Fexaramine“, die dem Nutzer die Zufuhr einer kalorienträchtigen Mahlzeit im Darm vorgaukeln. Das Essen wird quasi simuliert. Es wird Gallensäure produziert, der Stoffwechsel wird aktiviert. Die Verbindung stimuliert den Farensoid-X-Rezeptor, der schon seit Jahrzehnten Zielobjekt vieler pharmakologischer Studien ist. Allerdings gibt es unangenehme Nebenwirkungen, sobald man den Rezeptor mit Substanzen aktiviert, die über den Blutstrom im gesamten Körper verteilt werden. Die Salk-Forscher haben ihren Wirkstoff so modifiziert, dass er im Darm bleibt und nicht ins Blut gelangt. Fettsüchtige Mäuse, denen fünf Wochen lang jeden Tag eine Pille verabreicht wurde, nahmen nicht mehr zu, ihr Blutzuckerspiegel war verringert, ebenso ihr Cholesterinspiegel, wie die Forscher in „Nature Medicine“ (doi: 10.1038/nm.3760) berichten. Ein entscheidender Schwachpunkt: Der Nachweis der Wirksamkeit in klinischen Versuchen fehlt. Das trifft zwar auch für die Pille zu, die Aaron Cypess von der Harvard Medical School in Boston zusammen mit Kollegen getestet hat. Aber immerhin wurde ihr Wirkstoff, „Mirabegron“, der den beta-3-adrenergen Rezeptor aktiviert, schon für Therapien gegen Blasendrang zugelassen und an einem Dutzend Männern getestet. Die Verbindung stimuliert den Stoffwechsel des braunen Fettgewebes und damit den Energieverbrauch. Ergebnis der Ministudie: Im Schnitt erhöhte der Stoffwechsel-Turbo den Kalorienverbrauch im Ruhezustand um rund 200 Kalorien pro Tag. Schwere Nebenwirkungen wurden offenbar keine registriert, wie es in der Zeitschrift „Cell Metabolism“ heißt, allerdings lag die tägliche Dosis mit zweihundert Milligramm viermal so hoch wie die von der FDA für Blasentherapien genehmigte Dosierung. F.A.Z. Die Mär von den gesunden Dicken Üppige Fettpolster münden zwar nicht zwangsläufig in Diabetes und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Dennoch scheint die zunehmend häufig zu vernehmende Kunde vom „gesunden Dicken“ irreführend zu sein. Hierfür sprechen die Ergebnisse einer Langzeitstudie, an der 2500 britische Regierungsangestellte beteiligt waren. Wie der Epidemiologe Joshua Bell vom University College London im „Journal des American College of Cardiology“ (Bd. 65, S. 101) berichtet, hatten rund 200 der Teilnehmer einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens dreißig, brachten also deutlich zu viele Pfunde auf die Waage. Insgesamt 66 und damit rund ein Drittel der adipösen Probanden waren anfangs stoffwechselgesund: Darunter verstanden die Wissenschaftler keinen oder maximal einen kardiovaskulären Risikofaktor, etwa zu fettreiches Blut und erhöhte Blutzuckerspiegel. Zwei Jahrzehnte später wiesen dann auch in diesem Kollektiv mehr als fünfzig Prozent der Probanden einen „ungesunden“ Stoffwechsel auf. Bei den schlankeren Versuchspersonen lag der entsprechende Anteil hingegen nur bei dreißig Prozent. Die Ergebnisse, so die Autoren, zeigten einmal mehr, dass sich starkes Übergewicht auf die Dauer fast immer nachteilig auf den Stoffwechsel auswirke. N.v.L. Cäsiumatome formen eine Perlenkette Kalte Atome lassen sich in großer Zahl wie Perlen einer Kette aneinanderreihen. Dieses Kunststück ist Wissenschaftlern vom Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen mit einer dünnen Glasfaser gelungen, die von zwei gegenläufigen Laserstrahlen mit leicht unterschiedlichen Wellenlängen durchleuchtet wurde. Die Wellenlängen waren etwas größer als der Durchmesser des gut einen halben Mikrometer dicken Lichtleiters, so dass sich auf dessen Oberfläche eine stehende Lichtwelle bildete. Angezogen vom Lichtfeld, sammelten sich bis zu 2500 extrem kalte und daher langsame Cäsiumatome auf der Glasfaser und formten eine Kette („Physical Review Letters“, Bd. 113, Nr. 263603). Die Forscher waren sogar in der Lage, die Zahl der Atome zu bestimmen, ohne die Teilchen zu stören. Dazu ermittelten sie von beiden Laserstrahlen die Wellenlängen, die sich mit der Zahl der Atome veränderten. F.A.Z. Globalisierungsvorteil Grundlagenbildung Die Juristenausbildung hat zweifellos Reformbedarf. Dabei kommt es nicht auf die Kenntnis der Rechtsprechung, sondern auf die Grundlagen an. Seite N4