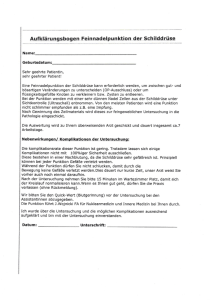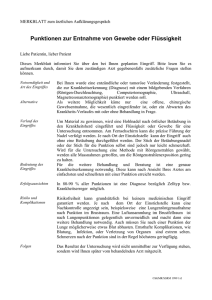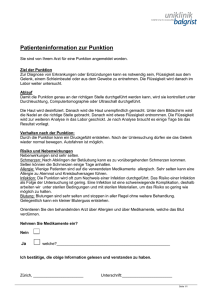8 G e fä ßzu g änge
Werbung

Ein venöser Zugang ist – außer bei einfachen Lokalanästhesien – obligat bei jeder Form der Anästhesie. Hierzu wird am häufigsten eine Kunststoffkanüle in eine periphere Vene gelegt („Venenverweilkanüle“). Dies ermöglicht –– die Einleitung einer Allgemeinanästhesie, –– die Zufuhr von Notfallmedikamenten, –– die Infusionstherapie inkl. zügiger Volumensubstitution, –– die Transfusion von Blut(produkten) und –– die Blutentnahme für Laboranalysen. 8 Gefäßzugänge A. Periphervenöser Zugang 144 Punktionsorte. Die Auswahl des Punktionsortes richtet sich nach den Venenverhältnissen, der Zugänglichkeit der Punktionsstelle, die möglichst weit vom Operationsgebiet entfernt liegen sollte, nach Art und Venenverträglichkeit der Medikamente und der Dauer deren Anwendung. Um Venenreizungen und Thrombophlebitiden zu vermeiden, sollte die Osmolarität der eingesetzten Lösungen 800–1.000 mosmol/l nicht überschreiten. Aus dem gleichen Grund ist die Injektion von Medikamenten mit unphysiologischem pH-Wert in kleinlumige Gefäße nicht ratsam (unzureichende Verdünnung). In der Regel werden Venen des Handrückens oder des Unterarms bevorzugt (A1), weil hier die Kanüle sicher fixiert werden kann und die Gefahr einer Fehlpunktion am geringsten ist. Soll der Zugang einige Tage liegenbleiben, so empfiehlt sich die Kanülierung einer Unterarmvene, weil damit die Armbeweglichkeit am wenigsten eingeschränkt wird. Nach Möglichkeit soll zunächst distal punktiert werden. Bei Fehlpunktion einer proximalen Vene mit Perforation der Venenwand und Hämatombildung können nämlich anschließend distale Venen, deren Blut über die perforierte Vene abfließt, nicht mehr verwendet werden. Venenkanüle. Eine Venenkanüle besteht aus einer an ihrer Spitze abgeschrägten, scharf geschliffenen inneren Hohlkanüle aus Stahl, die außer im Spitzenbereich von einer flexiblen Kunststoffkanüle ummantelt ist (A2). Nach der Punktion bleibt nur der Kunststoffteil im Gefäß. Venenkanülen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Bei einer Variante schiebt sich beim Herausziehen der Stahlkanüle aus dem Gefäß eine zeltförmige Ummantelung über die Kanülenspitze, so daß Stichverletzungen beim Personal vermieden werden („Sicher- heitskanüle“). Seitliche Flügel vereinfachen die Fixierung mit z. B. geschlitztem Pflaster, ein Zuspritzventil ermöglicht die Injektion von Medikamenten bei angeschlossener Infusion. Bei Erwachsenen werden meist Flügelkanülen mit einem Innendurchmesser (ID) von 1,4–1,6 mm benutzt (entsprechend einem Außendurchmesser von 18–17 G [Gauge]). Für den zügigen Volumenersatz sind allerdings großlumigere Modelle besser geeignet (ID 1,7–2,0 mm bzw. 16–14 G), vorausgesetzt, sie liegen in einer Vene, deren Innendurchmesser nicht kleiner ist als der Außendurchmesser der Kanüle. Punktionstechnik. Es werden 2 Methoden unterschieden: die direkte (= einzeitige) und die indirekte (= zweizeitige). Bei der direkten Punktion werden Haut und Venenwand in einer Bewegung durchstochen, bei der indirekten wird die Kanüle nach dem Durchdringen der Kutis erst 1–2 cm durch das subkutane Gewebe geführt, bevor die Venenwand penetriert wird (A3). Dieser Tunnel zwischen Punktionsort und Vene bildet einen gewissen Schutz vor dem Eindringen von Keimen. Zudem verringert sich i. Vgl. zur direkten Punktion das Risiko einer Gefäßperforation (Durchstechen des Gefäßes nach hinten). Unabhängig vom angewandten Verfahren muß das betreffende Hautareal vorher gesäubert, entfettet und ausreichend desinfiziert werden. Die hierzu üblichen alkoholischen Lösungen benötigen eine Einwirkzeit von mindestens 60 sec, um effektiv zu sein. Bei wachen Patienten sollte die Punktionsstelle örtlich betäubt werden, und zwar in Form einer intrakutanen Lokalanästhesie („Hautquaddel“), ganz besonders vor der Anlage großlumiger Kanülen. Komplikationen. Bevor Medikamente durch eine Venenkanüle injiziert werden, muß unbedingt deren korrekte intravenöse Lage sichergestellt sein. Zur Kontrolle wird eine Infusion angeschlossen, die bei ausreichendem hydrostatischen Druckgefälle spontan in die Vene tropfen muß. Eine intraarterielle Fehllage kann – bei ausreichendem Blutdruck – am Zurückfließen von Blut ins Infusionssystem festgestellt werden. Eine paravasale Fehllage äußert sich unter der Infusion durch Austreten von Infusat ins umgebende Gewebe (→ Schwellung). Bestehen Zweifel, ob die Kanüle intra- oder paravenös liegt, so sollten unter Inspektion 5–10 ml 0,9 %ige NaCl-Lösung mit geringem Stempeldruck durch die Kanüle inji- primustype: Georg Thieme Verlag, Frau Biehl-Vatter - Roewer/Thiel, Taschenatlas der Anästhesie - 17. 02. 10 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 8.1 Venöse Zugänge 8.1 Venöse Zugänge Venöse Zugänge I V. basilica V. cephalica Zuspritzventil A. brachialis Ellenbeuge (cave: Arterie u. Nerv!) Flügel innere Stahlkanüle Handrücken 1. Punktionsorte • Fußrücken oder Knöchel • V. jugularis externa • Fehlpunktion – paravenös – arteriell • Injektionsschmerz (Venenwandreizung!) • Thrombophlebitis bis hin zur Thrombosierung der Vene 4. Komplikationen 1. Anlegen einer Staubinde oder Aufpumpen einer Blutdruckmanschette knapp über den diastolischen Druck 1. 3. 2. Haut in Längsrichtung (!) mit der nicht punktierenden Hand straffen, um die Vene zu fixieren 3. Einführen der Kanüle in möglichst flachem Winkel durch die Hautquaddel 1–2 cm parallel zur Vene 4. Penetration der Venenwand 5. nach Bluteintritt ins Kanülenende das ganze System flach absenken, dabei die Spitze leicht anheben (verhindert eine Perforation!) und noch 1–2 mm weiter vorschieben (erst jetzt liegt die Öffnung der Kunststoffkanüle sicher intravasal!) 6. 6. Kunststoffkanüle weiter in die Vene vorschieben und dabei die Stahlkanüle herausziehen 8 Gefäßzugänge Unterarm (Beugeseite) Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 2. Venenkanüle (Sicherheitskanüle) 7. sichere Fixierung der Kunststoffkanüle (z.B. mit 2 geschlitzten breiten Pflasterstreifen) 7. 3. Indirekte Punktionstechnik A. Periphervenöser Zugang 10 8. Entfernen der Stahlkanüle und Anschließen einer Infusion 145 primustype: Georg Thieme Verlag, Frau Biehl-Vatter - Roewer/Thiel, Taschenatlas der Anästhesie - 17. 02. 10 ziert werden. Kommt es unter einer Injek­tion zu Schmerzen oder zu einem Abblassen des distalen Hautgebiets, so muß umgehend eine intraarterielle Kanülenfehllage ausgeschlossen werden. Erst danach darf weiterinjiziert werden (zur intraarteriellen Fehlinjektion s. Kap. 8.2). Um die Venenreizung zu vermindern, sollte die Injektion dann aber langsamer und unter laufender Infusion fortgesetzt werden (→ Verdünnung). 8 Gefäßzugänge B. Zentralvenöser Katheter Als zentralvenöse Katheter (ZVK) werden Katheter bezeichnet, die mit ihrer Spitze in der V. cava superior plaziert werden („oberer Kavakatheter“). Idealerweise soll die Öffnung 2–3 cm oberhalb der Stelle liegen, wo die obere Hohlvene in den rechten Vorhof mündet. So soll bei Bewegungen im Schulter-Hals-Bereich eine Katheterdislokation in den Vorhof verhindert werden, wo die Spitze Irritationen (→ Arrhythmien, Klappenläsionen) bis hin zu einer Perforation (→ Perikardtamponade) auslösen könnte. Indikationen. Je nach Indikation (B1) werden ein- oder mehrlumige Katheter verwendet. In einfachen Fällen (intermittierende Messung des zentralvenösen Drucks [ZVD], Blutprobenentnahme) genügen einlumige Modelle. Mehrlumige werden benötigt, wenn z. B. bei Operationen mit großem Volumenumsatz der ZVD kontinuierlich gemessen werden soll, oder für eine differenzierte Kreislauftherapie mit z. B. hochdosierten Katecholaminen und natürlich bei längerfristiger Intensivtherapie. 146 Punktionsorte. Wenn eine längere Liegedauer (> 3 Tage) zu erwarten ist, sollte der Katheter über eine V. jugularis externa eingeführt werden. Hier ist das Punktionsrisiko um einiges geringer als bei der Kanülierung einer tiefen Halsvene (V. jug. interna, V. anonyma) oder einer V. subclavia. Die Katheterisierung der V. subclavia bietet allerdings, ebenso wie die der V. femoralis, Vorteile im hypovolämischen Schock, weil ihr Lumen durchs umgebende Bindegewebe immer offengehalten wird. Da aber auch bei richtiger Punktionstechnik ein Pneumothorax, aus dem sich unter Beatmung schnell ein Spannungspneumothorax entwickeln kann, nie sicher zu vermeiden ist, sollte eine Subklaviapunktion unmittelbar präopera- tiv unterbleiben. Eine Katheteranlage über eine Ellenbeugevene (bevorzugt V. basilica) oder eine V. femoralis kommt nur bei kurzer Liegedauer in Betracht, weil hier katheterbedingte Komplikationen wie Thrombophlebitiden und Thrombosen viel eher auftreten. Über eine Femoralvene wird die Katheterspitze außerdem in der V. cava inferior plaziert („unterer Kavakatheter“), und zwar kaudal der Nierenvenen, so daß man hier eigentlich nicht mehr von einem ZVK sprechen kann. Punktionstechnik. Die Katheterisierung erfordert ein streng steriles Vorgehen, um eine Keimausbreitung, ausgehend vom Punktionsort oder Katheter, und damit eine systemische Infektion zu verhindern. Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehören mindestens eine gründliche Hautdesinfektion, das sterile Abdecken des Punktionsbereichs mit einem Lochtuch sowie das Tragen steriler Handschuhe (vorher hygienische Händedesinfektion) und eines Mundschutzes. Vor der Punktion von Halsvenen sollte der Patient, wenn er dies kardial verträgt, in die Trendelenburg-Position gebracht werden (d. h. Kopftieflagerung um 15–20°), um durch Erhöhung des hydrostatischen Drucks die Venenfüllung zu verbessern und so das Luftembolierisiko zu senken. Zudem wird durch die Aufweitung der Venen die Punktion erleichtert. Für die Katheterisierung der V. jugularis interna sind mehrere Zugänge beschrieben (B3). In jedem Fall dient der M. sternocleidomastoideus als anatomischer Bezug und ist zu bedenken, daß die Vene (antero)lateral zur A. carotis communis verläuft. Das Aufsuchen kann mit einem Ultraschallsensor erheblich erleichtert werden, besonders in schwierigen Fällen, womit auch das Risiko einer Pleuralä­ sion (→ Pneumothorax), Karotispunktion (→ Hämatom) und Plexusverletzung minimiert wird. Nach versehentlicher Punktion der A. carotis muß sofort durch digitale Kompression die Bildung eines Hämatoms verhindert werden. Große Hämatome können zu einer Trachealkompression oder -verdrängung, Rekurrensparese und Läsion anderer Nerven führen. Erst wenn sichergestellt ist, daß sich kein Hämatom entwickelt hat, darf die kontralaterale V. jug. interna punktiert werden. Zur Katheterisierung der V. subclavia wird meist der infraklavikuläre Zugang benutzt. Nach der Punktion in der Medioklavikularlinie zwischen Klavikula und erster Rippe wird die primustype: Georg Thieme Verlag, Frau Biehl-Vatter - Roewer/Thiel, Taschenatlas der Anästhesie - 17. 02. 10 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 8.1 Venöse Zugänge 8.1 Venöse Zugänge speziell • chirurgische Eingriffe mit größerem Flüssigkeitsumsatz oder Blutverlust • Operationen mit Luftemboliegefahr • ausgeprägte Dehydratation • Schock • V. a. Lungenembolie • Polytrauma • kontrollierte Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz 1. Indikationen • V. anonyma (= V. brachiocephalica) • peripher: V. basilica, V. femoralis V. jugularis interna V. jugularis externa V. subclavia Hautdurchtritt Venendurchtritt 2. Punktionsorte Vorgehensweise • wenn möglich Kopftieflagerung um 15–20° • Hautdesinfektion, steriles Abdecken des Punktionsortes • beim wachen Patienten Lokalanästhesie des Stichkanals Auffinden der Vene • Kopf in Neutralstellung lagern • Palpation der A. carotis communis im Kieferwinkel mit der nicht punktierenden Hand • Hauteinstich so weit kranial wie möglich, ca. 0,5 cm lateral der A. carotis communis • Stichrichtung: von der A. carotis weg in einem Winkel von 10–15° nach lateral, außerdem nach kaudal und dorsal in einem Winkel von ca. 30° zur Haut • Penetration der Vene unterhalb des M. sternocleidomastoideus in 3–4 cm Tiefe Erfolgskontrolle •eindeutige Aspiration von Blut über den Katheter 8 Gefäßzugänge allgemein • Messung des zentralvenösen Drucks • Blutgasanalyse: O2-Sättigung (SvO2), PvCO2, Säure-Base-Status • Verabreichung venen- oder gewebereizender Medikamente • langfristige Infusionstherapie • hochkalorische parenterale Ernährung (Intensivstation) Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Venöse Zugänge II Fixierung des Katheters • am besten durch Annähen, ggf. mit Fixierhilfe Lagekontrolle (s. Text) 3. Punktion der V. jugularis interna („hoher Zugang“) B. Zentralvenöser Katheter 10 147 primustype: Georg Thieme Verlag, Frau Biehl-Vatter - Roewer/Thiel, Taschenatlas der Anästhesie - 17. 02. 10 8 Gefäßzugänge Nadel von laterokaudal nach mediokranial in Richtung des Sternoklavikulargelenks vorgeschoben, wobei ständig Kontakt mit der Klavikula gehalten werden soll. In diesem relativ flachen Winkel ist das Risiko einer Pleuraverletzung ebenso wie das einer Punktion der A. subclavia zwar nur gering, aber eben doch vorhanden. Daher darf nach der (Fehl-)Punktion einer V. subclavia nie (!) unmittelbar anschließend ein Versuch auf der anderen Seite unternommen werden. Vorher muß immer ein Pneumothorax ausgeschlossen werden. 148 Punktionsnadeln. Für die Punktion kann eine Stahl-Kunststoff-Doppelkanüle nach dem oben erläuterten Prinzip verwendet werden. Die Kunststoffkanüle wird zur Einführung des Katheters so weit wie möglich ins Gefäß vorgeschoben. Alternativ kann das Gefäß nur mit einer Stahlkanüle punktiert werden, durch die dann ein spiralisierter Draht in die obere Hohlvene plaziert wird. Der Draht dient als Leitschiene für den Katheter („Seldinger-Technik“). Lagekontrolle. Jeder Kavakatheter muß lagekontrolliert werden. Dies läßt sich relativ einfach dadurch realisieren, daß über den Katheter ein EKG abgeleitet wird. Um die Katheterspitze als unipolare Elektrode nutzen zu können, muß der Katheter mit einem Elektrolyt (z. B. NaCl 0,9 %) gefüllt und das äußere Katheterende über ein spezielles Kabel mit dem EKG-Monitor verbunden werden. Das Auftreten überhöhter P-Wellen beim Vorschieben des Katheters zeigt dessen Eintritt in den rechten Vorhof an. Nun muß er so weit zurückgezogen werden, bis sich das EKG wieder normalisiert hat, und dann noch um weitere 2–3 cm, um seine korrekte Position in der Hohlvene einzunehmen (B4). Wenn die richtige Katheterlage mit einer intraatrialen EKG-Ableitung nachgewiesen wird, ist bei einem ZVK, der über eine V. jug. externa oder eine Ellenbeugevene eingeführt wurde, keine radiologische Kontrolle mehr nötig. Die EKG-gesteuerte ZVK-Plazierung hat gegenüber der Röntgenkontrolle mehrere Vorteile. Sie läßt nicht nur die richtige Katheterlage sofort erkennen, sie ermöglicht auch unmittelbare Korrekturen. Zudem verursacht sie keine Strahlen- und Kontrastmittelbelastung, und sie ist kostengünstiger. Allerdings wird ihre Beurteilbarkeit durch Herzrhythmusstörungen, Wechselstromüberlagerungen, Muskelzittern und Bewegungsar- tefakte eingeschränkt. Bei nicht eindeutigem Ergebnis kann daher auch weiterhin auf eine radiologische Lagekontrolle nicht verzichtet werden. Hierbei soll sich die Katheterspitze idealerweise ca. 1 cm oberhalb der Trachealbifurkation (bzw. der Herztaille) oder auf den hinteren Ansatz der 5. und den vorderen Ansatz der 3. Rippe projizieren. Eine Röntgenkontrolle ist ferner nach der Punktion einer tiefen Halsvene oder einer V. subclavia erforderlich, auch dann, wenn diese erfolglos war. Hier dient sie neben anderen Maßnahmen wie der Auskultation zum Ausschließen oder Erkennen eines (Mantel-)Pneumothorax. Komplikationen. Es können punktions- und katheterbedingte Komplikationen unterschieden werden. Punktionsbedingte sind abhängig vom Zugang. Am bedrohlichsten ist hierunter der Spannungspneumothorax, wobei die größte Gefahr einer Pleuraverletzung von der Subklaviapunktion ausgeht. Eine Luftembolie läßt sich dagegen mit der nötigen Sorgfalt sicher vermeiden, sie ist eher bei einer Dekonnexion des Katheters am spontan atmenden Patienten zu befürchten. Am häufigsten noch sind Hämatome. Sie sind die typische Komplikation einer arteriellen Fehlpunktion. Während Blutungen im Halsbereich meist digital komprimiert werden können (cave: Bradykardie durch Karotissinusdruck!), ist dies bei der A. subclavia nicht möglich, so daß sich hier eine Punktion bei verlängerten Gerinnungszeiten verbietet. In seltenen Fällen kann es, am ehesten noch bei der Punktion einer tiefen Halsvene, zu Nervenverletzungen kommen (Ganglion stellatum [→ Horner-Syndrom], Pl. brachialis, N. phrenicus). Unter den katheterbedingten Komplikationen dominieren die Fehllagen (intra-, extravasal, intrakardial). Am gefährlichsten ist die Dislokation des Katheters ins Herz, was meist mit Arrhythmien verbunden ist, aber auch zu einer Verletzung der Herzklappen und sogar zu einer Myokardperforation führen kann. Mit zunehmender Liegedauer steigen – auch bei primär sterilem Vorgehen – die Gefahr einer Keimbesiedelung des Katheters und einer Keimverschleppung, aus der sich eine Endokarditis oder Sepsis entwickeln kann, und das Risiko einer Thrombenbildung mit anschließender Embolisierung. Um dies zu verhindern, soll ein ZVK immer nur so lange liegenbleiben, wie es wirklich nötig ist, und die Indikation sollte täglich aufs neue kritisch hinterfragt werden. primustype: Georg Thieme Verlag, Frau Biehl-Vatter - Roewer/Thiel, Taschenatlas der Anästhesie - 17. 02. 10 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 8.1 Venöse Zugänge 8.1 Venöse Zugänge Venöse Zugänge III a) a) b) c) c) b) Die Katheterspitze befindet sich im rechten Vorhof, erkennbar an überhöhten P-Wellen. Die Katheterspitze wurde aus dem rechten Vorhof zurückgezogen, die P-Wellen haben sich dementsprechend normalisiert. Anschließendes Zurückziehen um weitere 2–3 cm führt zur korrekten Position. 4. Lagekontrolle mit intraatrialem EKG allgemein • Infektionen im Punktionsbereich • Punktionsbereich im Operationsgebiet • Obstruktion der betreffenden Vene • Hypokoagulabilität des Bluts bei nicht möglicher „digitaler Blutstillung“: (cave: Punktion der V. subclavia >> V. jugularis interna > V. anonyma!) • ipsilaterale Herzschrittmacher- oder Defibrillatorsonde für die Punktion tiefer Halsvenen • kurzer, dicker Hals • schweres Schädelhirntrauma • zerebrale Durchblutungsstörungen • ein- oder beidseitige Karotisstenose • intrakranieller Eingriff • kontralaterale Thorakotomie für die Punktion tiefer Halsvenen oder der V. subclavia • kontralaterale Phrenikus- oder Rekurrensparese • kontralateraler Pneumothorax • kontralaterale Lungenkontusion • kontralaterales Horner-Syndrom 5. Kontraindikationen für ZVK-Punktionen B. Zentralvenöser Katheter 10 für die Punktion von Halsvenen • HWS-Trauma 8 Gefäßzugänge b) Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. a) 149 primustype: Georg Thieme Verlag, Frau Biehl-Vatter - Roewer/Thiel, Taschenatlas der Anästhesie - 17. 02. 10