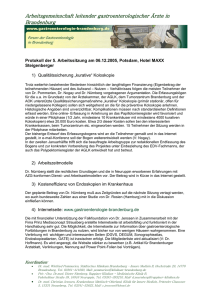Prof. Dr. Jürgen Kromphardt Wirtschaftswissenschaftler im Gespräch
Werbung

BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 25.05.2000 Prof. Dr. Jürgen Kromphardt Wirtschaftswissenschaftler im Gespräch mit Klaus-Joachim Jenssen Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Grüß Gott, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu Gast bei Alpha-Forum ist Professor Kromphardt, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der TU Berlin und seit März 1999 Mitglied des Sachverständigenrats. Herr Professor Kromphardt, die "Fünf Weisen" sind durch Sie ergänzt worden. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen: Sie wurden 1933 in Kiel geboren, sind also schon stattliche 66 Jahre alt. Sie sind nur für eine Periode gewählt und können anschließend in Pension gehen. Daher sind Sie vielleicht etwas abgesetzter von politischen Einflüssen, dazu aber später mehr. Sie sind in Kiel geboren, und Ihr Vater, Professor Wilhelm Kromphardt, war Volkswirtschaftsprofessor. Wahrscheinlich hat das eine gewisse Bedeutung für Sie. Damals war Keynes tätig, und man sagt Ihnen nach, dass Sie ein "Keynesianer" sind. Damals - nach 1933 - war Deutschland etwas abgeschottet gegenüber dem Ausland, und insofern wurden zwar die Gedanken von Keynes schon aufgenommen, aber doch sehr versteckt. Mein Vater würde sich eher als Anhänger von Schumpeter bezeichnen, einem bekannten österreichischen Ökonom, und nicht zu sehr von Keynes. Nach dem Krieg nahm er Keynes Lehren natürlich voll auf. Sie sind ein relativ sesshafter Mensch, wie ich Ihrer Vita entnommen habe. Sie waren an der Uni in Köln und haben dort bei Professor Erich Schneider promoviert, der ein "Keynesianer" ist. Wir werden gleich unseren Zuschauern erklären, was man darunter versteht. Anschießend waren Sie kurz bei der Europäischen Kommission und haben sich furchtbar gelangweilt, wie man lesen kann. Dann haben Sie sich in Münster habiliert, nicht weit weg von Kiel. Hatte das einen bestimmten Grund? Die Wahl fiel auf Münster, weil dort Professor Hoffmann tätig war, den ich aus der Literatur kannte und der mir von der ganzen Ausrichtung her sehr gut gefiel. Deshalb habe ich mich bei ihm wegen einer Habilitation beworben. Danach waren Sie wieder in Brüssel und haben dort auch nicht viel Erfahrungen gesammelt. Das muss ich etwas korrigieren: Ich war insgesamt neun Jahre in Brüssel tätig, zunächst beim Statistischen Amt. Das Interessante in Brüssel ist die Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Man lernt dort sehr viel über die Denkweise anderer Völker und Mitglieder anderer Nationen. Der Nachteil ist, dass man im Ausland ist. De Gaulle hat von den vaterlandslosen Technokraten gesprochen, die dort sitzen. Man muss sich entscheiden, ob man nicht doch lieber nach Deutschland zurück möchte, und da habe ich mich dafür entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Sie sind dann nach Gießen gegangen und dort 20 Jahre geblieben. In Gießen war ich 12 Jahre tätig, und anschließend sind wir nach Berlin Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: gegangen, wo wir nun seit 20 Jahre sind. Sie sind seit 1980 an der TU in Berlin, und gleichzeitig haben Sie sehr viel geschrieben, einige Bücher, die - wie mir Kollegen gesagt haben - durchaus zur Standardliteratur gehören. "Grundlagen der Makroökonomie" - da sollte man gleich erklären, was man darunter versteht. Können Sie uns mit einem kurzen, plakativen Beispiel den Unterschied zwischen Mikro- und Makroökonomie erklären? Die Mikroökonomie beschäftigt sich mit dem einzelnen Unternehmen, dem einzelnen Haushalt. Sie überlegt, wovon sein Haushalt abhängt, sie reflektiert die Änderung des Verhaltens und wie man dieses beeinflussen kann. Die Besteuerung führt dazu, dass sich der Haushalt anders verhält, als wenn er keine Steuern zahlen müsste. Der Ausgangspunkt ist also der einzelne Haushalt, während die Makroökonomie auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene bleibt und die einzelnen Entscheidungsträger zu großen Aggregaten oder Gruppen zusammenfasst - in die Unternehmen, die privaten Haushalte, den Staat -, um eine gewisse Übersichtlichkeit in die Gedankengänge zu bringen. Man hat dann nur drei große Gruppen, anhand derer man überlegen muss. Seit Frühjahr 1999 sind Sie Mitglied im Sachverständigenrat. Damals musste Ihr Vorgänger ausscheiden, was Sie und 180 Wirtschaftswissenschaftler bedauert haben. Sie haben ein Protestschreiben aufgesetzt und abgeschickt. Die Bundesregierung hat trotzdem so gehandelt, wie sie glaubte, handeln zu müssen. Da spielen wohl die Gewerkschaften eine große Rolle. Sie gelten als Gewerkschaftsmann, aber diesen Schlips ziehen Sie sich wahrscheinlich nicht an. Richtig ist, dass zwei der fünf Sitze im Sachverständigenrat nach einer Tradition, die sich etabliert hat, im Benehmen - was immer man darunter verstehen mag - einmal mit den Arbeitgebern und einmal mit den Gewerkschaften besetzt werden. Es war in der Tat so, dass damals die Initiative von den Gewerkschaften ausgegangen ist, die gesagt haben, dass sie eine neue Person benennen möchten, und die dann auf mich zukamen. Herr Frantz ist - wie man das unschicklich ausdrückt - in Ungnade gefallen. Er hat sich den anderen vier Kollegen zu sehr angeschlossen für den Geschmack der Gewerkschaften. Es ist eine merkwürdige Situation, wenn ein großer Sozialverband sagt: „Du hast gefälligst die und die Meinung zu vertreten und keine andere.“ Das lassen Sie sich so aber nicht bieten. Nein. Die Unabhängigkeit muss und wird respektiert. Wir haben selbst in unserem letzten Gutachten ein paar Sätze dazu geschrieben, dass wir diese Maßnahmen nicht gut fanden, vor allem auch, weil es in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Wir haben einvernehmlich festgestellt, dass die Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträchtigt sei - weder vorher, noch jetzt. Darauf lege ich natürlich größten Wert. Traditionell sind die Gewerkschaftsökonomen auf John Maynard Keynes ausgerichtet, der die nachfragorientierte Wirtschaftspolitik eingeführt hat. Sie sind dafür, die angebotsorientierte mit der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik in Einklang zu bringen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Der englische Ökonom Keynes hat 1936 ein Buch geschrieben, das eine neue, makroökonomische Sichtweise in den Vordergrund stellt. Er hat es damals nach der Weltwirtschaftskrise mit den hohen Arbeitslosenzahlen geschrieben - sechs Millionen in Deutschland, ähnlich viele in Großbritannien und in den USA -, und er hat gesagt, dass in dieser Situation jeder Unternehmer bereit und auch in der Lage ist, mehr zu produzieren, wenn nur mehr nachgefragt wird an Gütern. Insofern konzentrierte er sich auf die Nachfrage und sagte, dass wir überlegen müssen, weshalb die Nachfrage so niedrig ist - wobei sich das Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: zusammensetzt aus dem Privatkonsum, dem staatlichen Konsum, den Investitionen und den Exporten. Er überlegte, weshalb die Nachfrage so niedrig ist und wie man sie erhöhen könnte. Er konnte darauf in seiner Situation zu recht davon ausgehen, dass, wenn wirklich mehr Güter nachgefragt würden, die Unternehmer sie auch produzieren könnten. Inzwischen haben wir wieder viele Arbeitslose, aber es ist trotzdem so, dass man nicht einfach die Angebots- und Produktionsseite vernachlässigen soll, sondern sich überlegen muss, ob die Nachfrage an Gütern gesteigert werden sollte und ob wir sicher sein können, dass die Unternehmer dann mehr produzieren werden und damit mehr Leute beschäftigen, was der eigentliche Zweck ist. Es könnte passieren, dass die Unternehmer die Gelegenheit nutzen, um die Preise zu erhöhen, das hätte dann nur Nachteile. Wir hätten dann eine höhere Preissteigerung und nicht mehr Beschäftigung. Insofern muss man immer Angebot und Nachfrage berücksichtigen und sich überlegen, wie die eine Seite auf die Änderung der anderen reagiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Glaubenskrieg ausgebrochen, der in endlose Streitereien bis hin zur Verunglimpfung dieses Ökonomen geführt hat, der sich gar nicht mehr wehren konnte. Wissenschaft bedeutet ja nicht zu sagen: "Das, was ich glaube, ist richtig", sondern die Gegebenheiten abzuwägen. So war es aber nicht. Es gab einen regelrechten Krieg und die Monetaristen sagten, dass die Keynesianer alle Idioten wären. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Ja, das ist sehr stark unterstrichen worden. Das liegt einerseits daran, dass man auch in der Wissenschaft dadurch am bekanntesten wird, wenn man deutliche und manchmal auch extreme oder zugespitzte Positionen vertritt, und das haben die Angebotsökonomen, die Monetaristen, gemacht. Als die Keynesianer noch unbestritten waren, haben sie es sich vielleicht auch in manchen Dingen zu leicht gemacht und haben z. B. das Problem der Inflation unterschätzt. Dadurch kam die Gegenbewegung, dass gerade die Monetaristen gesagt haben, dass das Wichtigste die Inflation sei. Das hing mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen: Wir hatten diese beiden Ölpreisschocks, einmal 1973 mit einer Vervierfachung, dann noch einmal 1979 mit einer Verdopplung des Mineralölpreises mit den entsprechenden inflationären Entwicklungen in allen Industriestaaten. Da hat man festgestellt, dass man ein neues zusätzliches Problem hatte. Auch in der wirtschaftspolitischen Debatte stürzte man sich auf das neue Problem und hat das alte ein bisschen vergessen. Inzwischen geht die Tendenz dahin, dass wir angebots- und nachfrageorientiert sein müssen. Wir müssen eine Politik suchen, die beide Seiten beachtet. Ich habe in Ihren Schriften eine interessante These gefunden, die darauf hinausläuft, dass die angebotsorientierten Wirtschaftspolitiker plötzlich zu Monetaristen werden, wenn es um die Frage geht, die Zinsen zu senken oder anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen, und dann wird die Chance der Zinssenkung nicht wahrgenommen. Jetzt sind wir bei dem Hauptthema, nämlich der Beschäftigung. Sind niedrige Zinsen nicht ganz wichtig, um die Beschäftigungsfrage endlich zu lösen? Ist es nicht falsch, in bestimmten Momenten, wie es im Frühjahr 2000 der Fall war, die Zinsen langsam wieder anzuheben, obwohl es nicht so nötig wäre? Wie vieles im Leben hat auch die Zinsentwicklung zwei Seiten: Die Begründung der Europäischen Zentralbank für die letzte Zinserhöhung war die Sorge um künftige Inflation, und man möchte durch die Zinserhöhung erstmals signalisieren, dass man als Zentralbank darauf achten wird. Das ist völlig in Ordnung. Zum Zweiten bedeuten Zinserhöhungen, dass die Finanzierung von Investitionen über Kredite etwas teurer wird, so dass man dort eine gewisse Dämpfung der Investitionsgüternachfrage hat. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der Nachfrageaspekt: Wenn weniger Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: investiert wird, dann fällt die Güternachfrage aus, und es besteht die Gefahr der Beschäftigungsbeeinträchtigung. Zwischen diesen beiden Punkten muss die Geldpolitik hindurch. Die Monetaristen haben den Akzent nur auf die Inflationsbekämpfung gelegt, was in der Zeit nach 1979, als wir bis zu acht Prozent Inflation hatten, auch nicht völlig unberechtigt war. Inzwischen steht das Problem der Beschäftigung wieder mehr im Vordergrund, und deswegen muss man nun auf die andere Seite schauen, inwieweit die Zinserhöhungsschritte nicht gerade die Investitionen und damit die Nachfrage und Beschäftigung beeinträchtigen. Man kann nicht sagen, dass etwas falsch oder richtig ist, weil es immer diese beiden Aspekte gibt. Jede Institution, die entscheiden muss, muss eine Abwägung vornehmen und überlegen, was wichtiger ist: den Vorteil hier mit dem Nachteil dort oder die umgekehrte Kombination. Gerade hier liegt das Problem, denn es ist offenbar so, dass Ihre vier anderen Kollegen im Sachverständigenrat doch eher zur monetaristischen Richtung neigen. Sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie nicht falsch, wobei man das nicht unbedingt auf die Monetaristen einengen muss. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, den man hinzufügen kann und der in der Diskussion eine wichtige Rolle spielt: die Fristigkeit der Ergebnisse. Hier wird von den einen befürchtet, dass eine Zinssenkung, die dann zu mehr Investition und zu zusätzlicher Geldschöpfung führt, zwar kurzfristig einen positiven Effekt hat - mehr Nachfrage und mehr Beschäftigung -, aber langfristig dann doch zu einer rascheren Preissteigerung führt. So hat man dann noch die Abwägung zwischen kurzfristigem und langfristigem Aspekt. Bei den langfristigen Befürchtungen ist es sehr schwer zu sagen, ob sie berechtigt oder unberechtigt sind, denn das ist ein Prozess, der über vier Jahre läuft. Was in vier Jahren alles passiert, ist aber sehr schwer zu beurteilen. Insofern kann man sagen, dass man momentan erst einmal an die kurzfristigen positiven Wirkungen denkt und immer noch hofft, dass die langfristigen Wirkungen entweder nicht eintreten oder wenn sie doch eintreten, man dann erst Maßnahmen ergreifen muss. Es gibt einen sehr schönen Satz vom Vizepräsidenten des Währungsfonds. Er hat bezüglich der amerikanischen Geldentwicklung - die USA haben eine sehr lange Expansion mit guter Beschäftigungsentwicklung - im Vergleich zu Europa gesagt, dass man die Expansion mit "Inflationsangsthasen" in den USA nie zustande gebracht hätte. Das ist also auch eine Frage, welche Risiken man eingeht, um einen solchen Expansionsprozess zu bekommen. Die "Angsthasenposition" taucht auch in Ihren Schriften auf, nämlich warum man es nicht wagt und einen Monat später zugibt, dass man sich geirrt hat und man dann doch etwas unternehmen muss. Dass ist die Angst, die hier in Europa grassiert. Was könnte man wirklich tun, um die Beschäftigung voranzubringen? Die Zahlen, die wir haben, sind alles andere als befriedigend - über zehn Prozent Arbeitslosigkeit sollten und können wir uns nicht leisten. Ist hier das soziale Netz womöglich zu eng gespannt? Man hört immer wieder, dass bestimmte Lohngruppen so nah an der Sozialhilfe sind, dass wenn es sich um Fälle mit drei Kindern handelt, die Sozialhilfezahlungen höher sind als das Arbeitseinkommen. Ja, das ist richtig. Wir haben eine große Menge an strukturellen Problemen. Als Makroökonom sieht man natürlich erst auf die gesamtwirtschaftlich wirkenden Maßnahmen - das wäre die Geldpolitik oder die Finanzpolitik des Bundes und der Länder. Hier ist es so, dass die Europäische Zentralbank die Geldpolitik macht und nicht nur schauen muss, was in Deutschland, sondern auch im Gebiet des Euro passiert. Bei der Finanzpolitik ist es so, dass sich die Mitgliedstaaten im Maastrichtvertrag verpflichtet haben, ihre Staatsdefizite zu reduzieren. Damit haben sie sich die Hände gebunden, z. B. über mehr Staatsausgaben oder die generellen Senkung von Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Steuereinnahmen die Beschäftigung positiv zu beeinflussen. Dann bleiben nur noch strukturelle Maßnahmen übrig, und ein Thema ist die Frage, inwieweit die Strukturen unserer Sozialhilfe kollidieren mit einer Beschäftigungsexpansion. Hier ist es so, dass im Niedriglohnbereich die Sozialhilfe - eigentlich nur bei Leuten mit Kindern - höher ist als das, was man netto verdient. Daraus folgt nun nicht, dass die Leute deswegen nicht mehr arbeiten, sondern es gibt eine ganze Reihe von Sozialhilfeempfängern - ungefähr zehn Prozent -, die arbeiten und zusätzlich zur Auffüllung noch Sozialhilfe beziehen. Diese Leute sagen sich offenbar, dass es ihnen auch wegen des sozialen Netzes wichtig ist, erwerbstätig zu sein, und sie nehmen die Sozialhilfe als Zusatz, weil sie sonst nicht mit dem Erwerbseinkommen auskommen. Sicherlich gibt es einige Leute, die die Sozialhilfe in Anspruch nehmen, obwohl sie eigentlich einen Job finden könnten. Man weiß nicht, inwieweit dies eine Ursache für hohe Arbeitslosigkeit ist. Das ist ein Stein im Mosaik. Ein anderer Stein ist die mangelnde Bildung und Ausbildung. Ja, das ist ein Problem, das durch die Greencard-Diskussion aktuell wurde. Die Tendenz geht dahin, dass die Ansprüche an die Qualifikation der Arbeitnehmer immer höher werden. Die früheren einfachen Arbeitsplätze in der Industrie für die Hilfsarbeiter sind weitgehend verschwunden. Je einfacher eine Tätigkeit ist und je mehr man immer denselben Arbeitsvorgang wiederholen muss, desto leichter lassen sich diese Arbeiten durch Maschinen ersetzen. Es ist kein Wunder, dass diese Arbeitsplätze für die wenig qualifizierten Leute verschwinden. Die Konsequenz muss sein, dass die Durchschnittsqualifikation gesteigert wird auf allen Eben. Das fängt bei der Schulbildung an und geht weiter zur Berufsausbildung, den Universitäten, der Weiterbildung - es ist ein sehr großes Programm, das hier bewältigt werden muss. Diese Greencard-Diskussion zeigt auch, dass es plötzlichen Mehrbedarf gibt, wenn so eine neue Technik sich ausbreitet und man im Inland keine gut qualifizierten Leute findet, die man plötzlich braucht oder meint zu brauchen. Spielt hier auch die Technikfeindlichkeit eine Rolle, die in den siebziger Jahren so schick war? Ja, das spielt eine Rolle. Es ist auffällig, dass an der Hochschule, wenn die Konjunktur schlecht ist und die Nachfrage an Hochschulabsolventen zurückgeht, dann besonders die Zahl der Studenten zurückgeht, die Ingenieur werden wollen. Das heißt, das Ingenieurstudium ist kein attraktives Studium wie z. B. das Studium der Kunstgeschichte oder Geschichte, die einen als Fächer interessieren, sondern man studiert das, weil man damit eine Berufsausbildung bekommt. Wenn man nun den Eindruck hat, dass man hier keine Arbeitsplätze findet, studiert man etwas anderes. Ob man das als technikfeindlich bezeichnet oder ob es am anspruchsvollen Studium liegt - was z. B. die Mathematik betrifft -, weiß ich nicht. Es mag insofern auch der fehlende Anreiz sein. Wenn man nicht das Gefühl hat, Ingenieurwissenschaft zu studieren, um später einen interessanten Beruf zu finden, dann sucht man sich etwas anderes aus. Was sind die weiteren Mosaiksteine auf dem Bild, das sich uns darbietet? Wo müsste man etwas ändern? Ein anderer Mosaikstein ist die Belastung mit Steuern und Abgaben. Hier ist erfreulicherweise bei den Steuern etwas in Gang gesetzt worden, nämlich dass die Steuersätze reduziert werden sollen. Andererseits hat man die Bemessungsgrundlage, auf die sich die Steuersätze beziehen, verbreitert, so dass das Steueraufkommen nicht so stark abnimmt, wie die Sätze reduziert werden. Dadurch hat man erreicht, dass der Abschreckungseffekt verringert wird, der darin besteht, dass man ein bestimmtes Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Mehreinkommen hat, von dem - der Grenzsteuersatz liegt bei uns noch bei bis 53 Prozent - gleich abkassiert wird. Das ist leistungsbremsend für Leute, die überlegen, sich weiterzubilden. Denn das, was man dann mehr verdient, möchte man auch für sich behalten. Insofern ist es gut, dass die Steuersätze gesenkt worden sind. Sie sind aber nicht weit genug gesenkt worden, was der Sachverständigenrat auch schon festgestellt hat. Ja, diese Höhe des Satzes ist ein Problem, weil eine Differenzierung gemacht wurde zwischen der Einkommensteuer, die jedermann zahlt, und der Körperschaftsteuer, die die Kapitalgesellschaften zahlen. Weil die Kapitalgesellschaften auch Gewerbesteuer zahlen müssen, hat man gesagt, dass man für die Kapitalgesellschaften den Steuersatz auf 25 Prozent setzen muss. Man hat dann ungefähr einen Gewerbesteuerbelastung von 13 Prozent. Insgesamt sind das dann 38 Prozent. Die Einzelpersonen und die Personengesellschaften müssen einen anderen Steuersatz zahlen, der nun bei 45 Prozent liegt. Diese 45 Prozent muss man nun mit den 38 Prozent vergleichen. Hierin liegt eine gewisse Diskrepanz. Man hätte das ganze Differenzierungsproblem zwischen Kapitalgesellschaften und Nichtkapitalgesellschaften durch einen einheitlichen Steuersatz von 40 Prozent vermeiden können, dazu konnte man sich aber nicht durchringen. Jetzt wird der Steuersatz gesplittet, und hier wird nun wohl das Bundesverfassungsgericht ein Wort zu sprechen haben. Ja, das ist zumindest die Befürchtung, und es werden mit Sicherheit Klagen kommen. Ob das Bundesverfassungsgericht diesen Klagen stattgibt, ist noch nicht so sicher, denn es gibt schon Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, in denen gesagt wurde, dass bestimmte Abstände gerechtfertigt sind, weil die Situation einer Kapitalgesellschaft anders ist als die einer Personengesellschaft, so dass die Sätze nicht übereinstimmen müssen. Wenn man rechnet, das die Differenz sieben Prozent beträgt, dann könnte das Bundesverfassungsgericht sagen, dass das noch tolerabel ist. Sicher wird geklagt werden, aber da bei uns sehr viele Klagen beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind, ist das kein Sonderfall. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Man sollte sowieso die Frage stellen, ob man nicht viel radikaler vorgehen hätte müssen, um ein völlig neues Steuerrecht auf den Weg zu bringen. Es gibt Kollegen von Ihnen, die sagen, dass man völlig neu anfangen sollte. Es gibt auch ein interessantes Steuermodell, das in Kroatien verwirklicht wurde. Welche Meinung vertreten Sie? Wäre es wünschenswert, alles einmal über den Haufen zu werfen, alles in Frage zu stellen und völlig neu anzufangen? Ein völliger Neuanfang klingt immer gut, aber wir haben ein gewachsenes System, und jeder wird sich überlegen, wie sich seine Position verändern wird. In einem ganz neuen System weiß niemand genau, was dabei herauskommt. Insofern würde ich sagen, dass für den tatsächlichen politischen Prozess die Idee eines völlig neuen Systems nicht sehr relevant ist. Man sollte stattdessen überlegen, wie wir unser System schrittweise in die gewünschte Richtung verändern könnten. Hier gibt es eine Diskussion, die sich mit der Frage beschäftigt, nach welcher Zielgröße die Steuern verteilt werden sollen. Die Finanzwissenschaftler sind überwiegend - aber nicht einheitlich - der Meinung, dass das Kriterium die Leistungsfähigkeit sein sollte. Man sollte also die Leute nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuern, d. h. nach ihrem Einkommen, was bedeutet, dass alle Einkommen - egal aus welcher Quelle sie kommen zusammengezählt und einer Steuer unterworfen werden. Zum Beispiel gilt das dann auch für das Zinseinkommen, bei dem man Erfassungsprobleme hat. Dann hätte man ein Prinzip, an dem man sich orientieren kann. Die Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Leistungsfähigkeit sollte im Prinzip der Maßstab sein. Das ist bisher bei uns überwiegend der Fall. Ich bin der Ansicht, dass das sehr richtig ist und man bei diesem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit bleiben sollte. Nun gibt es die Diskussion, dass die Alterssicherung dadurch zusätzlich belastet und zum Teil obsolet wird. Derjenige, der steuerlich ehrlich ist, muss auf seine jämmerlichen Zinsen - wenn man es auf den Festsatz bezieht - auch noch bis zu 50 Prozent Steuern zahlen. Das ist dann wirklich absurd, wenn eine mittlere Anlage nur vier Prozent bringt. Ist es nicht kontraproduktiv, wenn man die Zinsen besteuert? Wäre es nicht sinnvoll, das völlig abzuschaffen? Ich bin nicht Ihrer Ansicht, was die Besteuerung der Zinsen betrifft. Es ist negativ, wenn man ein Einkommen besteuert, das sonst für Güterkäufe ausgegeben wird, das also Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen und somit Arbeitsplätze schafft. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es unproblematisch, ein Einkommen zu besteuern, das nicht zur Güternachfrage führt. Vermögens- und Zinseinkommen sind eine Kategorie, die die Leute meistens nicht verwenden, um Güter zu kaufen, sondern sie legen dieses Geld wieder an. Das ist das mehrheitliche Verhalten. Ich kaufe aber das Auto und unter Umständen auch Luxusgüter gerade aus diesem Vermögen. Es gibt Leute, die über größeres Vermögen verfügen und hohe Zinseinnahmen haben. Diese Leute kaufen sowieso alles aus ihrem laufenden Einkommen, benötigen dazu nicht das Vermögenseinkommen, sondern legen es wieder an. Dann müsste man höhere Freibeträge einräumen, die aber momentan wieder halbiert wurden. Den Leuten, die wirklich sparen, um dafür ein Auto zu kaufen, könnte man einen gewissen Freibetrag einräumen. Gerade die höheren Vermögenseinkommen sollte man versteuern, weil sie gesamtwirtschaftlich und unter Nachfrage- und Beschäftigungsaspekten nichts bringen, denn dieses Geld wird wieder angelegt. Es kommt hinzu, dass die Einkommensverteilung bei uns ungleich ist, aber das ist in jedem Staat so. Es ist verständlich, dass die Einkommensverteilung ungleich ist, aber die Vermögensverteilung ist noch stärker ungleich. Hier ist die Konzentration viel stärker. Man sollte die Leute, die sowieso schon über ein hohes Einkommen verfügen und dadurch hohe Zinseinkommen haben, steuerlich entlasten, und damit würden die Steuereinnahmen an den Finanzminister gehen, womit er dann z. B. die Bildungsausgaben finanzieren kann. Während die Leute selbst, wenn man ihnen das Geld lässt, eben keine Güter kaufen. Aus dieser Nachfrageüberlegung heraus bin ich dafür, dass man die Zinseinkommen voll besteuert. Dann müsste man aber einen Weg finden, komplett an der Quelle zu besteuern. Ja, das ist richtig. Die Frage ist dann natürlich, wie man das durchsetzt. Hier hakt es vor allem in Europa, weil sich die Länder bislang nicht einigen können. Hier kann man darüber diskutieren, ob man den Weg gehen sollte, dem die Österreicher beschritten haben. Sie haben sich gesagt, solange sie die Zinseinkommen der Einkommensteuer generell unterworfen haben, haben die Leute die Zinsen nicht angegeben. Jetzt haben sie eine endgültige Steuer von 25 Prozent eingeführt, plötzlich geben alle Leute ihre Zinseinkommen an, und der Finanzminister hat deutlich höhere Steuereinnahmen. Man weicht vom Prinzip ab und fragt sich, ob man dann nicht auch eine pragmatische Lösung anwenden kann. Die Österreicher Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: haben sich für die pragmatische Lösung entschieden und haben dabei Erfolg. Wenn das in Europa vereinbart wird, dann bin ich auch zufrieden. Unser großes Problem ist, dass das gesamte Kapital zurückgeholt werden müsste, damit es hier in Deutschland arbeitet. Ich weiß nicht, wie viel hundert Milliarden im Ausland liegen. Ja, es sind sehr viele Milliarden. Wenn man alles durchsetzen könnte, was man an Prinzipien hat, dann wäre ich für eine Besteuerung, aber die pragmatische Lösung wäre dann auch akzeptabel. Ein anderes Problem ist die Frage der Alterssicherung. Hier ist es so, dass die längere Lebensdauer der Individuen dazu führt, dass die Belastung der beitragszahlenden Erwerbstätigen durch die Rentner und Renten immer größer wird und man hier Auswege finden muss. Hier ist eine Lösung, die auch diskutiert wird, zu sagen: Wenn jemand für seine Altersvorsorge spart - in einer Weise spart, die auch sicherstellt, dass er erst im Alter an das Geld herankommt -, dann sollte er das von der Steuer absetzen können. Das gilt auch für die Beiträge zur Lebensversicherung, die man auch von der Steuer absetzen kann. Das nützt nichts, weil die meisten Leute Sozialversicherung zahlen müssen, so dass die Freibeträge ausgeschöpft sind. So hilft uns das Steuerrecht nicht weiter. Hier wäre eine klare Lösung - da warten wir alle auf das Urteil des Verfassungsgerichts, das im Sommer kommen soll - zu sagen, dass alle Beiträge, die für das Alter zurückgelegt und festgelegt werden und die man erst mit 65 Jahren verwenden kann, steuerfrei gestellt werden. Das hätte zur Konsequenz, dass dann die späteren Bezüge - ob sich das Versicherung, Zinsen, Dividende oder Zahlung aus einem Fond nennt - der Steuer unterworfen werden. Es sollte Freistellung bei der Einzahlung geben, damit es attraktiv wird, Vorsorge zu leisten, und später wird es Einkommen und somit mit allen anderen Einkommen addiert und versteuert. Das wäre eine klare Lösung, die ich auch für gut hielte. Die Finanzpolitiker haben davor wahnsinnige Angst - auch vor der Steuerreform insgesamt - und sind dadurch zaghaft geworden. Eigentlich sollten sie viel Mut entwickeln. Sie meinen, dass man Subventionen streichen müsste. Wo überall sollte man ansetzen? Das Problem muss man auf zwei Ebenen angehen. Wenn man überzeugt ist, dass so eine Steuerreform - die die Steuersätze deutlich senkt und dadurch auch die Leistungs- und Innovationsbereitschaft vergrößert vielleicht auch dazu führt, dass mehr Investitionen in Deutschland getätigt werden, die jetzt im Ausland getätigt werden, dann würde man damit in Deutschland zu einer Belebung von Produktion und Beschäftigung kommen und es würde auch mehr Einkommen entstehen, aus dem wiederum mehr Steuern gezahlt werden würden. Das dauert natürlich, aber es wäre eine Selbstfinanzierung. In diesem Punkt würde ich dem Finanzminister den Mut empfehlen zu sagen, dass diese Selbstfinanzierung vielleicht erst in zwei Jahren kommt, aber in der Zwischenzeit müsste man ein etwas höheres Defizit in Kauf nehmen. Also sollte man durchaus Schuldenpolitik für eine begrenzte Zeit betreiben, obwohl wir so viele Schulden haben? Ja, wenn man gute Argumente hat zu sagen, dass es nur für zwei Jahre ist und dann dieses Defizit von alleine verschwindet. Auch hier kann man wieder auf die USA verweisen, die ein sehr hohes Defizit hatten. Sie haben eine Politik des Wachstums und der Beschäftigung zustande gebracht, auch durch eine flexiblere Geldpolitik. Durch dieses Wachstum von Produktion, Beschäftigung und Einkommen sind die Steuereinnahmen so stark angestiegen, dass nun der amerikanische Bundeshaushalt im Überschuss ist. Sie haben nicht gesagt, dass man das Defizit durch Sparen Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: Kromphardt: Jenssen: reduzieren muss, sondern die generelle Wirtschafts- und Wachstumspolitik hat ihnen die Steuermehreinnahmen beschert. Das wäre der Weg, den man in dem von mir beschriebenen Szenario beschreiten müsste. Die staatliche Sparpolitik ist überhaupt kein so günstiger Weg. Letzten Endes wäre es sinnvoller, gewisse Staatsausgaben im investiven Bereich zu verstärken. Gerade bei der "Deutschen Bahn AG" ist alles im desolaten Zustand. Ja, das ist richtig. Von manchen Ökonomen wird der Staat so betrachtet, als sei das eine Last, die auf der Wirtschaft liegt. Natürlich stöhnen die Steuerzahler darunter. Der Staat tut aber auch etwas Positives, z. B. für die Ausbildung. Hier muss der Staat Geld hineinstecken, auch in die Infrastruktur - dazu gehört das Verkehrswesen, Informationskanäle usw. Diese Ausgaben müssen und sollen finanziert werden, denn das kann kein anderer machen. Zurück zu meiner Frage, ob Subventionen gestrichen werden sollten. Hier ist noch einiges im Argen. Ja, hier muss man überlegen, ob man auf andere Ausgaben verzichten kann. Ein Stichwort sind die Subventionen, die - das wird seit Jahrzehnten gesagt - gestrichen werden sollten, und das stößt immer wieder auf Widerstand der Betroffenen. Im Prinzip ist es richtig, zumal wir mit den Subventionen vor allem Wirtschaftszweige unterstützen und erhalten, die wie z. B. die Landwirtschaft, Kohlebergbau und die Wohnungswirtschaft einem Schrumpfungsprozess unterliegen. Das ist natürlich eine zweischneidige Sache. Beim Kohlebergbau ist die Zahl der Bergarbeiter schon deutlich zurückgegangen. Im Bereich der Subventionen kann man sparen, und nun muss man sehen, ob man nicht auch die Personalausgaben reduzieren kann, da das eine Dauerbelastung ist. Wenn man wirklich Geld freisetzen will für Investitionen und Infrastruktur, dann ist der sicherste Weg zu versuchen, mit weniger Personal auszukommen, z. B. dadurch, dass man Tätigkeiten nach außen verlagert, sie von Privaten einkauft. Früher wurden die öffentlichen Gebäude noch von Bediensteten gereinigt, die im Öffentlichen Dienst beschäftigt waren. Das machen heute private Reinigungsfirmen. Somit kann man viele Dinge auslagern, weil dann flexibler gearbeitet wird als im Öffentlichen Dienst. Viele sagen dann: „Na ja, trotzdem Subventionen, aber in die 'New Economy'." Was halten Sie davon? Ihr Ökonom-Kollege Schumpeter war der Meinung, dass sich die Innovation schon selber finanzieren müsste. Schumpeter war derjenige, der sagte, dass die Innovation ein ganz zentraler Faktor ist für die wirtschaftliche Entwicklung, vor allem für die langfristige und mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung. Er hat vor allem in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts geschrieben, und hier war es ganz selbstverständlich, dass die Innovationen von den privaten Unternehmen selber gemacht und finanziert werden und dass diejenigen, die erfolgreich sind, viel daran verdienen bis ein Konkurrent kommt und etwas Besseres auf den Markt bringt oder Konkurs macht. Wir haben gerade deshalb das Konkursrecht entwickelt, damit ein Unternehmen in Konkurs gehen kann, ohne dass der Unternehmer selbst - wie früher - in den Schuldturm geworfen wird. Er kann vielmehr eine neue Firma aufmachen und versuchen, seine Kreativität neu zu bewähren. Alle Staaten fördern die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Unternehmen, aber eigentlich ist das Aufgabe der Unternehmen. Vielen Dank, Herr Professor Kromphardt. Wir sind am Ende dieses interessanten Gesprächs. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sprachen mit Professor Jürgen Kromphardt, TU Berlin, Wirtschaftswissenschaftler und Mitglied des Sachverständigenrats der "Fünf Weisen". Auf Wiedersehen. © Bayerischer Rundfunk