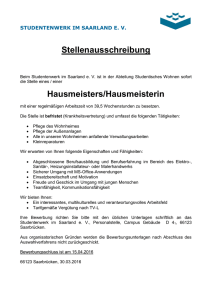Teil 2 - Saarland.de
Werbung

F r a n z - J o s e f - R ö d e r- S t r a ß e 2 3 , 6 6 1 1 9 S a a r b r ü c k e n Stephan Kolling Leiter Ministerbüro und Pressesprecher Te l . : ( 0 6 8 1 ) 5 0 1 3 1 8 1 e-mail: [email protected] w w w. j u s t i z - s o z i a l e s . s a a r l a n d . d e Ä LT E R E M E N S C H E N I M S A A R L A N D LANDESSENIORENPLAN / ZWEITER TEIL „Ältere Menschen im Saarland“ Landesseniorenplan / Zweiter Teil – Fortschreibung 2009 – 1 2 “Ältere Menschen im Saarland” – Fortschreibung des Landesseniorenplanes 2009 Vital und zufrieden älter werden: Präventionspotenziale nutzen – Wohn- und Lebensqualität bewahren VORWORT Liebe Saarländerinnen und Saarländer, im Saarland, wie auch andernorts, werden immer mehr Menschen immer älter. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung plädiert der Landesseniorenplan - ausgehend von einem neuen Selbstverständnis älterer Menschen und dem damit verbundenen Bedürfnis nach umfassender gesellschaftlicher Teilhabe - für eine differenzierte Wahrnehmung des Altersprozesses, eine Modernisierung des Altersbildes, die Einbindung der Potenziale älterer Menschen, eine Stärkung von Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung und eine altersgerechte Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung. Dass eine zukunftsfähige Seniorenpolitik stärker als bisher Fähigkeiten und Fertigkeiten älterer Menschen, ihre heutigen und zukünftigen Umwelt- und Umfeldbedingungen sowie spezifische Selbsthilfepotenziale zur Alltagsbewältigung berücksichtigen und daran die öffentliche Planung orientieren wird müssen, wurde im Landesseniorenplan Teil 1 ausführlich dargelegt und themenspezifisch mit konkreten Handlungsempfehlungen unterlegt. Daran knüpft Teil 2 des Landesseniorenplanes an, der sich der gesellschaftlichen Zukunftsaufgabe des „gesunden bzw. erfolgreichen Alterns“ widmet und sich auf die Themenschwerpunkte „Alter und Wohnen“ sowie „Alter und Gesundheit“ konzentriert. Ältere Menschen von heute und morgen wollen möglichst vital und zufrieden älter werden. Dazu gehört, sich aktiv in das gesellschaftliche Leben einbringen zu können. Neben Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe älterer Menschen in allen Lebensbereichen ist wesentliche Voraussetzung für aktives gesundes Altern die bestmögliche Erhaltung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens. Sowohl eine individuell passende Wohnsituation als auch die Förderung und Erhaltung körperlicher und geistiger Gesundheit während des gesamten Lebenslaufs sind wesentliche Voraussetzungen für die Sicherung eines möglichst selbstbestimmten und selbständig organisierten Lebens im Alter. Diese Erkenntnis in Verbindung mit der Tatsache, dass die meisten Menschen solange wie möglich selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung älter werden wollen, stellt erhebliche Anforderungen insbesondere an die Bereiche Soziale Dienste, Seniorenhilfe, kommunale Wohnungspolitik, Wohnraumförderung, Städtebau und Landesplanung. Eine der wesentlichen Herausforderungen besteht darin, Wohnen mit variabler Nutzung zur Entwicklung möglichst unterschiedlicher Lebensformen einer Familie zu verwirklichen, so dass die eigene Wohnsituation den wechselnden, alterssensiblen Bedürfnissen in einzelnen Lebensphasen angepasst werden kann. Rechtzeitige Vorsorge für das Leben im Alter könnte daher bereits mit der Planung eines Neubaus beginnen. 3 Der 2. Teil des Landesseniorenplanes will dazu beitragen, dass Präventionspotenziale mit Blick auf ein gesundes, zufriedenes und leistungsfähiges Leben im Alter stärker als bisher ins Bewusstsein der Bevölkerung gelangen und genutzt werden, individuelle Lebens- und Wohnqualität möglichst bis ins hohe Alter zu bewahren. Dazu gilt es, das Bewusstsein der Menschen in breit angelegter Weise zum Beispiel mit Blick sowohl auf Gesundheitsförderung als auch die individuelle Wohnsituation zu schärfen und Eigenverantwortung sowie Vorsorge zu stärken. Wenn dies auf der Grundlage der Leitlinien Saarländischer Seniorenpolitik (=> Landesseniorenplan, Teil 1) in Verbindung mit der Fortschreibung des Landesseniorenplanes gelingt, ist das ein Gewinn für mehrere Generationen – für die ältere Generation von heute und morgen. Prägend für den Entstehungsprozess (=> Anhang 3) des Landesseniorenplanes war und bleibt der kontinuierliche Dialog mit dem Landesseniorenbeirat und den Sozial- und Wirtschaftspartnern im Land. Für die vielfältigen Impulse und überaus kompetente Mitwirkung während des gesamten Dialogprozesses danke ich dem Landesseniorenbeirat ebenso wie allen beteiligten Akteuren und Kooperationspartnern sehr herzlich und freue mich auf eine Fortsetzung des senioren- und generationenpolitischen Dialoges im Land. Ihr Prof. Dr. Gerhard Vigener Minister für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales 4 Inhaltsverzeichnis G Alter und Wohnen ..............................................................................................8 1. Neue Herausforderungen durch die demografische Entwicklung – wachsender Bedarf an selbstbestimmten Wohnformen ......................................................8 2. Bedeutung des Wohnens im Alter ....................................................................................10 3. Wohnmöglichkeiten und Entscheidungssituation der Betroffenen ....................................12 4. Beratung - Ältere Menschen organisatorisch unterstützen – Leitstellen „Älter werden“/ Wohnberatungsstellen/ Pflegestützpunkte helfen weiter ........................14 4.1 Beratungsmöglichkeiten vor Ort ............................................................................14 4.2 Organisation niedrigschwelliger Angebote ............................................................15 5. Eigene Häuslichkeit und eigenständige Lebensführung sichern ........................................16 5.1 Anpassung der eigenen Wohnung – persönlich und individuell ..............................16 5.2 Finanzielle Hilfen ....................................................................................................18 5.2.1 Wohnraumförderung ..................................................................................18 5.2.2 Demografie-sensibles Investitionsprogramm des Saarlandes ........................19 5.2.3 Förderung von Umbaumaßnahmen auf Grundlage der Pflegeversicherung ......................................................................................21 5.3 Generationenübergreifende Stadtentwicklung ......................................................22 5.4 Wohnen im Ländlichen Raum – auch im Alter ........................................................25 6. Alternative Wohnformen..................................................................................................27 6.1 Gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen ..............................28 6.2 “Wohnen für Hilfe“ – junge Leute und Senioren unter einem Dach........................29 7. Ambulante Pflege und Hilfen zur Sicherung der Häuslichkeit ............................................30 7.1 Anpassung gesetzlicher Grundlagen ......................................................................30 7.2 Aufgabe und Funktion von Pflegestützpunkten ......................................................32 7.3 „Poolen“ in neuen Wohnformen - mehr Möglichkeiten für Einzelpflegekräfte ..................................................................................................33 7.4 Teilstationäre Pflege: Tages- und Nachtpflege ........................................................33 7.4.1 Tagespflege ..................................................................................................34 7.4.2 Nachtpflege ..................................................................................................36 7.5 Kurzzeitpflege ............................................................................................................37 7.6 Verbesserung des Entlassungsmanagements ..............................................................38 8. Betreutes Wohnen............................................................................................................38 9. Wohnen in stationären Einrichtungen der Seniorenhilfe....................................................41 9.1 Bewohnerstruktur in saarländischen Heimen nach Altersstruktur, Geschlecht, Herkunft ............................................................................................42 9.2 Bauliche Anforderungen an stationäre Einrichtungen ............................................44 9.3 Landesheimgesetz sichert Rechte der Heimbewohner ............................................44 10. Saarländische Qualitätsoffensive zur Verbesserung des Verbraucherschutzes ....................45 Handlungsempfehlungen ................................................................................................48 5 H 6 Alter und Gesundheit ........................................................................................50 1. Gesellschaftliche Zukunftsaufgabe: „gesundes bzw. erfolgreiches Altern“ ........................50 1.1 Gesundheit älterer Menschen in Deutschland ........................................................51 1.2 Gesundheitliche Situation älterer Menschen im Saarland ........................................53 1.2.1 Die ESTHER-Studie ......................................................................................53 1.2.1.1 Diabetes ..........................................................................................54 1.2.1.2 Bluthochdruck ................................................................................55 1.2.1.3 Fettstoffwechselstörungen ..............................................................55 1.2.1.4 Koronare Herzkrankheit: ..................................................................56 1.2.2 Amtliche Statistiken ....................................................................................57 1.2.2.1 Lebenserwartung ............................................................................57 1.2.2.2 Die Todesursachenstatistik................................................................59 1.2.2.3 Die Krankenhausdiagnosen-Statistik ................................................61 1.2.3 Epidemiologisches Krebsregister Saarland ....................................................64 1.3 Psychosoziale Problemlagen ..................................................................................68 1.3.1 Demenz ......................................................................................................68 1.3.2 Suchtprävention............................................................................................72 1.3.3 Suizidprävention ..........................................................................................73 2. Prävention und Gesundheitsförderung ............................................................................76 2.1 Ziele von Prävention und Gesundheitsförderung im Alter: Krankheiten vorbeugen – Pflegebedarf vermeiden..................................................77 2.2 Lebensqualität bewahren - Präventionspotenziale nutzen ......................................77 2.2.1 Partnerschaft im Alter ..................................................................................77 2.2.2 Gesunde Ernährung im Alter ........................................................................79 2.2.2.1 Physiologische Veränderungen im Alter und ihre Konsequenzen für die Ernährung ....................................................79 2.2.2.2 Ernährung in Senioreneinrichtungen ................................................81 2.2.3 Sport im Alter ..............................................................................................82 2.2.3.1 Nutzen des Seniorensports ..............................................................84 2.2.3.2 Gegenwärtige Situation des Seniorensports im Saarland ..................86 2.2.4 Vorsorgen durch Impfung – auch im Alter....................................................87 2.2.5 Sturzprophylaxe – Sturzrisiken erkennen und vermeiden ..............................88 2.3 „Saarland - aktiv und gesund“ ..............................................................................88 Handlungsempfehlungen ................................................................................................89 3. Gesundheitliche Versorgung älterer Menschen ................................................................91 3.1 Ambulante Versorgung durch den Hausarzt ..........................................................91 3.2 Medizinische Versorgung in stationären Einrichtungen ..........................................92 3.2.1 Medizinische Versorgung in stationären Einrichtungen der Altenhilfe ....................................................................................................92 3.2.2 Geriatrische stationäre Akutversorgung........................................................92 3.2.3 Gesundheitsversorgung im Krankenhaus......................................................93 3.3 Arzneimittelversorgung ..........................................................................................94 3.3.1 Apothekenversorgung ................................................................................94 3.4 Rehabilitation ........................................................................................................96 3.5 Gerontopsychiatrie ................................................................................................99 Handlungsempfehlungen ..............................................................................................100 4. Gesundheitswirtschaft im Saarland ................................................................................101 5. 5.1 5.2 Patientenrechte ....................................................................................................103 Unabhängige Patientenberatung..........................................................................104 Regelungsinstrumentarien zum Patientenschutz in saarländischen Krankenhäusern ..................................................................................................105 Anhang 1: „15 Regeln für gesundes Älterwerden“ ....................................................................107 Anhang 2: Quellen- und Literaturverzeichnis..............................................................................110 Anhang 3: Entstehungsprozess ....................................................................................................113 Soweit die Schreibweise in der männlichen Form verwendet wird, ist bei Entsprechung auch die feminine Form gemeint. 7 G Alter und Wohnen „Ältere Menschen sollen selbstbestimmt und möglichst selbständig ihr Leben organisieren können.“ (3. Leitlinie Saarländischer Seniorenpolitik) 1. Neue Herausforderungen durch die demografische Entwicklung – wachsender Bedarf an selbstbestimmten Wohnformen Wohnen im Alter ist in Zukunft infolge der demografischen Entwicklung sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum mit einer Reihe neuer Herausforderungen verbunden. Ältere Menschen werden dabei zur zentralen Zielgruppe am Wohnungsmarkt, so dass mit einem steigenden Bedarf für altersgerechtes Wohnen zu rechnen ist. Passende Angebote, die entweder dem Wunsch älterer Menschen, möglichst lange in der eigenen Wohnung verbleiben zu können oder dem Aufwertungsbzw. Modernisierungsbedarf gerecht werden, müssen nicht nur den sich wandelnden Wohnbedürfnissen älterer Menschen entsprechen, sondern auch den zukünftigen sozialen und volkswirtschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen. Die Zielgruppen am Wohnungsmarkt kehren sich um, die potenzielle Zielgruppe für altersgerechte Wohnformen wächst: Das Saarland hat im Vergleich zu anderen Bundesländern mit 56,9 % (Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, Heft 1, 2002, S. 37) die höchste Eigentümerquote, die im ländlichen Raum höher ausfällt als im städtischen Raum, wo verstärkt Individualisierungsprozesse, Mieteigentum und Ein-Personen-Haushalte anzutreffen sind. 8 Bedingt durch die hohe Eigentümerquote im Saarland sind hier viele ältere Menschen weniger mit den Problemen wie zum Beispiel Mietzinsanstieg oder unsichere Wohnsituation konfrontiert. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass insbesondere in Rentnerhaushalten mit geringerem Einkommen mangelnder Komfort bzw. wenig altersgerechte Wohnqualität anzutreffen sind. Auch kann es aufgrund der Finanz- ausstattung des Haushaltes dazu kommen, dass notwendige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am Gebäude und im Wohnraum – hier vor allem in den Sanitärbereichen - nicht mehr durchgeführt werden können. Eine Analyse (focushabitat: Perspektiven 2035 – Wohnen im Alter in Deutschland, Untersuchung durchgeführt vom Pestel Institut für Systemforschung, Hannover 2007) prognostiziert, dass sinkende Alterseinkommen auf steigende Wohnkosten treffen werden. Wenn ältere Menschen in ihrem Wohneigentum bleiben wollen, werden Lebensraum- und Quartierskonzepte benötigt, um Angebote vor Ort weiterzuentwickeln und einen Verbleib unter Wahrung größtmöglicher Unabhängigkeit im Eigenheim im Alter zu sichern. Unterstützende, nachbarschaftliche Strukturen, die im städtisch geprägten Bereich oftmals in Kooperation mit Gemeinwesenarbeit realisiert werden, sind insbesondere in gewachsenen Wohngebieten mit geringem Mieter- bzw. Eigentümerwechsel in der Regel gut ausgeprägt und ausbaufähig. Folgende Faktoren beeinflussen Wohnen und Leben im Alter in Zukunft: a) Demografische Alterung der Bevölkerung Hier stellt insbesondere die Zunahme der Zahl hochaltriger Menschen erhebliche Anforderungen an die Bereiche Soziale Dienste, Seniorenhilfe, Städte- und Landesplanung. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass sich der Zeitraum zwischen Beginn des Ruhestandes und dem eigentlichen „Altsein“, der Hochaltrigkeit, für viele Menschen erweitert und das Rentenalter keine einheitliche Lebensphase mehr ist. Seniorenhilfe und Wohnungsanbieter müssen sich also verstärkt auf die wachsende Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen, hier insbesondere auch älterer Migrant/innen und auf deren besondere Lebensgewohnheiten bei Planungs- und Sanierungsmaßnahmen einstellen. b) Zunahme alleinstehender älterer Menschen und Verringerung des Potenzials helfender Angehöriger innerhalb der Familie Durch Vereinzelung der Gesellschaft, zahlenmäßigen Rückgang der jüngeren Altersgruppen, Familienleben auf Distanz und insgesamt veränderte Familienstrukturen wird familiale Pflege zunehmend auch durch Pflege und Hilfe von Nicht-Familienangehörigen ergänzt werden, um die Verringerung des Potenzials helfender Anghöriger auszugleichen. Da das familiäre Unterstützungsnetz in Zukunft nicht mehr seinem heutigen Umfang entsprechen wird, ist zu erwarten, dass zudem die Nachfrage nach professioneller Hilfe in den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft steigen wird. c) Veränderte Erwartungshaltungen an das Wohnen im Alter - Wachsender Bedarf an selbstbestimmten Wohnformen Bei immer mehr Menschen verliert das Heim als institutionalisierte Wohnform, die primär auf funktionelle Pflege ausgerichtet ist, an Akzeptanz. Statt im Heim zu leben, wünscht sich eine Vielzahl älterer Menschen immer häufiger, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Weiter ist davon auszugehen, dass künftig ältere Menschen nicht zuletzt aufgrund gestiegener beruflicher Mobilitätsanforderungen auch im Alter bereit sind, etwas Neues zu probieren und ihre Wohnsituation noch einmal zu verändern. Nach dem 55. Lebensjahr ziehen rund 50 % der Mieterhaushalte und 20 % der Eigentümerhaushalte noch einmal um, weil sich die Ansprüche an das Wohnen und die Erfordernisse hinsichtlich Größe und räumlicher Ausstattung des Wohnbereichs mit zunehmendem Alter verändern. In höherem Alter nimmt diese Bereitschaft allerdings ab. (Schmidtke Siegfried: Alternative Wohnformen fürs Alter in: Gesellschaft für Pflegeinforma- 9 tionen, Ausgabe 8/2007, in www.gesellschaft-pflegeinfo.de; Kremer-Preis Ursula/Stolarz Holger: Leben und Wohnen im Alter. Neue Wohnkonzepte für das Alter, hg. v. Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 2003, S. 8) 2. Bedeutung des Wohnens im Alter Häufig wird die große Bedeutung von Wohnraumgestaltung und Wohnbedingungen für den Erhalt der Selbständigkeit bzw. für den Fall von Hilfe- und Pflegebedarf unterschätzt. Angesichts der Tatsache, dass von den über 65-Jährigen bundesweit etwa 93 % und im Saarland rund 97 % in der eigenen Häuslichkeit leben und 5,3 % bundesweit bzw. 3,5 % im Saarland (Trapp Hans-Joachim: Selbständigkeit im Alter – mehr als eine Frage der Wohnung, Referat vom 16.03.2006, Saarlouis; Landesseniorenplan, Teil 1, S. 39; Kruse Andreas: Sicherung der Unabhängigkeit im Alter, in: Dokumentation zur Fachtagung am 07.05.2004, hg. v. Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales. Saarbrücken 2005, S. 36 und 111) in stationären Einrichtungen der Altenhilfe, muss der Frage, wie Verbleib und Selbständigkeit älterer Menschen in ihrer angestammten Wohnung und ihrem gewohnten Lebensumfeld, in Haus, Hof und mit starker psychischer Bindung zum Wohnviertel und einer meist vertrauten Nachbarschaft besser unterstützt werden können, in Zukunft größere Beachtung geschenkt werden. „Wohnen im Alter“ ist daher zentraler Arbeitsschwerpunkt einer zukunftsorientierten Senioren- und Generationenpolitik. Wohnqualität beeinflusst Lebensqualität Wohnen und Wohnumfeld ebenso wie öffentliche und private Umfeldgestaltung beeinflussen die Lebensqualität, das Wohlergehen und die persönliche Zufriedenheit. Für ältere Menschen hat das Wohnen eine zusätzliche Bedeutung: Im Wohnen spiegeln sich ihre Biografie und ihre Erinnerungen. Wohnen in vertrauter Umgebung fördert Wohlbefinden und Gesundheit. Über Funktionsgerechtigkeit, baulich-technische Standards und Wohnkomfort hinaus ist es für ältere Menschen besonders wichtig, ihr Zuhause zu behalten, um soziale Kontakte aufrecht erhalten und auf ein vertrautes und soziales Lebensumfeld mit Angehörigen, Nachbarn und Freunden zurückgreifen zu können. Wohnqualität ist Lebensqualität und bedeutet auch, sozialer Isolation vorzubeugen. Rechtzeitige Vorsorge für das Leben im Alter kann bereits mit der Planung eines Neubaus getroffen werden. Die Herausforderung besteht darin, Räume und Ausstattung mit variablen, vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zur Entwicklung möglichst unterschiedlicher Lebensformen einer Familie vorzusehen, so dass das Wohnen den wechselnden Bedürfnissen in einzelnen Lebensphasen angepasst werden kann. 10 Wohnräume sind Lebensräume, die Nähe ebenso wie Distanz zu anderen Menschen fördern oder behindern können. Wohnen gemeinsam mit anderen, gleichzeitig aber mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten (zum Beispiel: Wohngruppen oder Mehrgenerationenwohnen), sollte von Stadtplanern und Architekten als bedeutender werdende Option bei der Gestaltung von Stadtvierteln und Wohnkomplexen vorgesehen werden. Die Gestaltung der Wohnumgebung ist hoch bedeutsam für das Erleben sozialer Teilhabe älterer Menschen. Zukunftsfähige Planungskonzepte sind dahingehend zu hinterfragen, ob sie neben den traditionellen „Fenstern zur Welt“ wie Fernsehen, Telefon, Internet auch Möglichkeiten aktiver Teilhabe am Gemeinwesen eröffnen, um professionelle Leistungen und freiwilliges Engagement in geeigneter Weise miteinander zu verknüpfen. Gebaute und gestaltete Umwelt beeinflussen Wohn- und Lebensräume jedes Einzelnen und damit das soziale Beziehungsgefüge, das die Bewältigung von Krisen, Krankheiten und Pflegebedürftigkeit erschweren oder vereinfachen kann. Wohnung im Alter – vertrauter Lebensraum Die Wohnung als vertrauter Lebensraum vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Die zweite Lebenshälfte ist meist geprägt von kleineren Haushalten. Einem Familienalltag folgt ein Leben zu zweit und danach, vor allem für Frauen, ein Leben allein. Zwar wohnen viele über 50-Jährige im Allgemeinen ausschließlich in Zweipersonenhaushalten gemeinsam mit ihrem (Ehe)Partner, übernehmen aber in diesem Lebensabschnitt dennoch vielfältige Familienaufgaben: Die erwachsenen Kinder erhalten praktische Hilfen ihrer Eltern, oder diese erreichen ein Alter, in dem sie zunehmend der Unterstützung ihrer Kinder bedürfen. Nicht ausgeschlossen werden kann der zeitweilige Rückzug von eigenen Kindern in die Wohnung der Eltern oder aber auch ein Wohnarrangement, das den „Einzug“ der betagten Eltern vorsieht. Ältere Menschen verbringen im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen viel mehr Zeit in ihrer Wohnung und im Wohnumfeld; so bedeutet Alltag im Alter vielfach vor allem Wohnalltag. Zeitbudget-Studien zufolge sind ältere Menschen nach ihrem Erwerbsleben täglich im Durchschnitt weniger als drei Stunden außerhalb ihrer Wohnung unterwegs. Heimbewohnerinnen und Bewohner gestalten 90 % ihrer Zeit in den Einrichtungen und damit in ihrem Zimmer bzw. ihrem Wohnbereich. (Backes Gertrud/Clemens Wolfgang: Lebensphase Alter. Berlin 2003, S. 231; Saup Winfried/Monika Reichert: Die Kreise werden enger. Wohnen und Alltag im Alter, in: Funkkolleg Altern 2, hg. v. Annette Niederfranke, Gerhard Naegele, Eckart Frahm, Wiesbaden 1999, S. 248) Je älter Menschen werden, desto mehr Zeit verbringen sie in ihrem Zuhause. Somit weitet sich das innerhäusliche Leben aus. Da die Wohnsituation für ältere Menschen mehr noch als für jüngere Altersgruppen für die Lebensqualität von entscheidender Bedeutung ist, kommt es wesentlich auf eine altersgerechte und funktionale Gestaltung, Anpassung und Ausstattung des Wohnraums im Alter an. Soziale Beziehungen – kommunikative Konstante Soziale Beziehungen im Allgemeinen und nachbarschaftliche Beziehungen im Besonderen stellen eine wichtige kommunikative Konstante im Alltag von Senioren dar. Demografiebedingt müssen in den sozialen Lebensraum älterer Menschen zukünftig verstärkt notwendige Dienstleistungsangebote eingebunden werden. Über die Intensivierung nachbarschaftlicher Netzwerke können freiwillige, selbstorganisierte Tätigkeiten professionelle Angebote ergänzen. Dies wird vor allem auch für alleinwohnende ältere Menschen erforderlich sein. Mit einer Förderung der Generationenmischung eines Wohngebietes sollen langfristig einseitige „Alterswohngebiete“ verhindert und positive Effekte generationenübergreifender Unterstützung aus den Möglichkeiten von Haushalten mit unterschiedlicher generationeller Zusammensetzung („Kultur des Helfens“) erreicht werden. Bei den grundlegenden Wohnbedürfnissen • Funktionsgerechtigkeit von Wohnung und Wohnumfeld • Sicherheit und Schutz • Beständigkeit und Vertrautheit der Lebensbezüge • Privatheit und Intimität • Kontakt, Kommunikation und Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld • Anerkennung und soziale Teilhabe • Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbstorganisation des Alltags haben ältere und jüngere Menschen nahezu identische Ansprüche. 11 3. Wohnmöglichkeiten und Entscheidungssituation der Betroffenen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen ergeben sich aus der jeweiligen Entscheidungssituation der Betroffenen und ihren Bedürfnissen: So lange wie möglich zu Hause bleiben Eine barrierefreie, alters- und behindertengerechte sowie pflegegeeignete Wohnung ist eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung eines selbständigen Haushalts vor allem bei körperlicher Beeinträchtigung. Eine Wohnberatung hilft, eine individuelle Wohnungsanpassung vorzunehmen, Barrieren und Gefahrenquellen zu vermindern und geeignete Lösungen zum Erhalt einer selbständigen Lebensführung zu verwirklichen. Auch sollte eine fachkundige Beratung durch Architekten und Innenarchitekten in Erwägung gezogen werden. Betreutes Wohnen zu Hause („Wohnen plus“) – Der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit oder Wohnung wird gesichert durch Inanspruchnahme ergänzender Hilfsdienste bzw. Dienstleistungsangebote zum Beispiel in den Bereichen Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung – dies auch im Rahmen nachbarschaftlicher oder quartiersbezogener Hilfe- und Betreuungskonzepte. Siedlungsgemeinschaften – Ausgehend von der Erfahrung, dass ein Großteil der Bewohner einer Siedlung der älteren Generation angehört - werden Gemeinschafts- und Hilfeangebote innerhalb einer Siedlung bzw. Wohnanlage organisiert, zum Beispiel von Wohnungsbau-, Siedlungsgesellschaften oder Selbsthilfegruppen. Wohnalternative wählen Selbstorganisierte Wohn- oder Hausgemeinschaften – Nur ältere oder auch ältere und jüngere Menschen (Mehrgenerationenwohnen) wohnen gemeinsam in einer Wohnung oder einem Haus. Es handelt sich um gemeinschaftliche Wohnformen, wobei die Gemeinschaft bewusst gesucht wird. Dabei hat jeder Bewohner einen eigenen Wohnbereich, einige Räume werden gemeinschaftlich genutzt. Bei Hilfe- und Pflegebedarf, der über nachbarschaftliche Hilfe hinausgeht, erfolgt meist ein Rückgriff auf ambulante Dienste. Wohnstifte/Seniorenresidenzen – Hier erfolgt eine Koppelung von Wohn- und Betreuungsangeboten in einer eigenen Wohnung innerhalb einer Wohnanlage. Im Unterschied zum Betreuten Wohnen besteht hier in der Regel die Verpflichtung, nicht nur allgemeine Betreuungsleistungen im Bereich der Betreuung, Pflege und Versorgung, sondern auch weitere Dienstleistungen im Bereich der Betreuung, Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung anzunehmen. Inwieweit und in welchem Umfange betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften, Wohngruppen und sonstige alternative Wohnformen aufsichtsrechtlichen Regelungen unterliegen, ergibt sich aus den Ausführungen unter Kapitel 8. „Bezug zum Heimgesetz“. 12 Wohnsituation verändern, weil es nicht mehr anders geht Senioren- und Pflegeheime – Hier steht die Notwendigkeit im Vordergrund, die bisherige Wohnform zu verlassen, weil eine selbständige Haushaltsführung nicht mehr zu bewältigen ist, zum Beispiel wegen Pflegebedürftigkeit, fehlenden ambulanten Hilfeangeboten, sozialer Isolation, Wohnungsmängeln. Betreute Hausgemeinschaften – Eine kleine Gruppe pflege – bzw. hilfebedürftiger älterer Menschen lebt in einer Wohnung oder einem Haus zusammen. Jeder Bewohner hat einen eigenen Wohn-/Schlafbereich, und das Alltagsleben findet weitgehend in einem oder mehreren Gemeinschaftsräumen und einer dazugehörigen Küche statt. Die Betreuung erfolgt stundenweise oder dauerhaft durch Betreuungspersonal. Unterschiede zwischen den aufgeführten Typen bestehen im Wesentlichen mit Blick auf folgende Merkmale: • • • • selbständigkeitsfördernde räumliche Gestaltung von Wohnung und Wohnumfeld Sicherstellung von Normalität/Alltagsgewohnheiten Integration in die soziale Umwelt mit Erhalt sozialer Kontakte und Mitwirkung der Betroffenen Versorgungssicherheit und Prävention vor (erhöhtem) Pflegebedarf Mit Rücksicht auf unterschiedliche individuelle Entscheidungssituationen erfordert die Gestaltung von Lebens- und Wohnqualität im Alter unterschiedliche Strategien, • die dem Wunsch nach Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ebenso gerecht werden wie einer möglicherweise erforderlichen Wohnraumanpassung oder –veränderung, • die soziale, ökonomische, ökologische und stadtplanerische Gesichtspunkte berücksichtigen und einer Vereinsamung im Alter entgegenwirken, • die eine Integration von Wohnen und Pflege vorsehen und dabei Vernetzung, Koordination und Kooperation ebenso berücksichtigen wie die Transparenz der Angebotsstruktur. Die Verwirklichung der jeweils passenden Strategie im privaten Umfeld ebenso wie in einem Stadtviertel, einem Dorf oder einer Gemeinde ist eine Gemeinschaftsaufgabe für alle Beteiligten: Kommunen, Verbände, Vereine, Wohnungsunternehmen, Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Handwerk, Wirtschaft und Bürger. Entwicklungsplanung Um älteren Menschen die Entscheidung zur Sicherung der eigenen Häuslichkeit zu erleichtern, müssen die Bedingungen im Wohnumfeld und der weiteren Umgebung stimmen. Zentral für die Entwicklungsplanung der Zukunft ist dabei die Frage, wie die gesamte, ins örtliche Umfeld eingebundene Wohnsituation den Anforderungen älterer Menschen angepasst werden kann. Hier ist zum Beispiel zu denken an: • Ortskernsanierungen durch Schaffung eines passenden Wohnumfeldes sowie generationengerechter Wohnungen – barrierefrei und in Anbindung an eine passende Dienstleistungsinfrastruktur mit Versorgungseinrichtungen und Freizeitangeboten, • Umzugsmanagement, das für die Betroffenen wirtschaftlich attraktiv ist und der zunehmend schwieriger werdenden Vermarktung von Immobilien durch gezielte Hilfen entgegengewirkt. Angesichts immer kleiner werdender Erbenzahl ist dies von besonderer Bedeutung. 13 Kommunale Wohnungspolitik wird auch künftig in der Verantwortung stehen, preiswerten Wohnraum für ältere Menschen vorzuhalten. Viele Gemeindeverbände, Städte und Gemeinden im Saarland unternehmen auf der Grundlage einer konkreten Entwicklungsplanung bereits Anstrengungen zur Entwicklung bzw. Modernisierung bedarfsgerechter Wohnraumangebote, zur Weiterentwicklung generationengerechter und seniorenfreundlicher Angebotsstrukturen – in dem Bestreben, den Herausforderungen der demografischen Entwicklung vor Ort durch eine zukunftsorientierte Entwicklungsplanung gerecht zu werden.1) Um Kommunen dabei zu unterstützen und älteren Menschen einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, wurde seitens des Landes das demografie-sensible Investitionsprogramm aufgelegt. (=> Kap. 5.2.2) 4. Beratung - Ältere Menschen organisatorisch unterstützen – Leitstellen „Älter werden“/ Wohnberatungsstellen/ Pflegestützpunkte helfen weiter Ältere Menschen fühlen sich vielfach durch den organisatorischen Aufwand, den Veränderungsnotwendigkeiten in Richtung einer alters- bzw. pflegegerechten Wohnung meist mit sich bringen, überfordert, weil • Entscheidungen von großer finanzieller oder baulicher Tragweite bis hin zum Umzug zu treffen sind, • benötigte Hilfen im Haushalt mit einer Abkehr bisheriger Alltagsgewohnheiten verbunden sein können. 4.1 Beratungsmöglichkeiten vor Ort Je selbständiger ältere Menschen in ihrem gewohnten Wohnumfeld leben können – verbunden mit Aktivität und sozialen Kontakten ggf. mit Unterstützung ambulanter Pflege und hauswirtschaftlicher Betreuung - umso niedriger ist das Risiko eines unfreiwilligen Umzuges in den stationären Bereich, der für Kommunen mit erheblichen Folgekosten verbunden ist. Daher ist es wesentliche Aufgabe kommunaler Seniorenhilfe (=> im Saarland: Leitstellen „Älter werden“/Seniorenbüros), in Kooperation mit Wohnberatungsstellen, Pflegestützpunkten/Beratungs- und Koordinierungsstellen, Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften, Dienstleistungsunternehmen sowie Einrichtungsträgern, bereits vorhandene, abgestufte Hilfesysteme wohnortnah und möglichst in zentraler Lage zukunftsfähig zu machen durch • Schaffung eines differenzierten Wohnungsangebots in Form -> von Beratung zur Anpassung bestehender Wohnungen mit dem Ziel, „Betreutes Wohnen“ im gewohnten Umfeld zu sichern -> einer an den Bedürfnissen älterer Menschen orientierten Ergänzung bzw. Modernisierung des bestehenden Wohnungsangebots -> einer Weiterentwicklung des Betreuten Wohnens („Service-Wohnens“) unter Berücksichtigung der seit 1. September 2006 bestehenden DIN 77 800 für Qualität und Sicherheit im Betreuten Wohnen -> einer Weiterentwicklung gemeinschaftlicher Formen des Zusammenlebens (Mehrgenerationenwohnen, Senioren-Wohngemeinschaften, Pflegewohngruppen) 1) 14 Weitere Informationen speziell für Kommunen dazu vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Wohnen im Alter. Bewährte Wege – Neue Herausforderungen. Ein Handlungsleitfaden für Kommunen, Berlin 2008 • Schaffung eines bedürfnisgerechten Wohnumfelds in Form -> generationengerechter Wohnumfeldgestaltung -> gemeinwesenorientierter Infrastrukturgestaltung -> (aufsuchender) Sozialberatung bzw. –betreuung vor allem für sozial benachteiligte ältere Menschen -> attraktiver Gemeinschafts- und Freizeitangebote -> einer Aktivierung von Selbst- und Nachbarschaftshilfe -> einer Bereitstellung hauswirtschaftlicher Dienstleistungsangebote z. B. durch Dienstleistungsagenturen -> einer Weiterentwicklung technischer Hilfen in Haus und Haushalt (z. B. Internet-Anschluss und Notrufsysteme) • Schaffung eines differenzierten, koordinierten und abgestuften Pflege- und Betreuungsangebots z. B. durch -> wohnortnahe bzw. quartiersbezogene, ambulante Dienste -> Besuchsdienste z. B. von Ehrenamtsbörsen oder Kirchengemeinden 4.2 Organisation niedrigschwelliger Angebote Bei der Entwicklung niedrigschwelliger Angebote ist darauf zu achten, dass sie möglichst frühzeitig einsetzen und geeignet sind, Pflegebedürftigkeit hinauszuschieben. Dazu sollten • insbesondere in größeren Siedlungskomplexen, wo meist in besonders großer Zahl SingleHauptmieter zu finden sind, von Betreibern (z. B. Wohnungsbau- bzw. Siedlungsgesellschaften) Betreuungsangebote verwirklicht werden, die dem Konzept des betreuten Wohnens entsprechen, • Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften auch zur Vermeidung zukünftiger Leerstände, die sich angesichts der Bevölkerungsentwicklung abzeichnen, sukzessive die Mietwohnungen baulich an die Bedürfnisse älterer Menschen anpassen, • familienentlastende Dienste integriert werden, um Hilfebereitschaft und -fähigkeit von Familien zu erhalten. Zur Organisation niedrigschwelliger Angebote und zur Unterstützung älterer Menschen im Falle erforderlicher Veränderungen bieten Wohnberatungsstellen, Seniorenbeiräte, Pflegekassen, Wohlfahrtsverbände umfassende Information und Beratung an. Zahlreiche Kommunen haben (Wohn-)Beratungs- und Koordinierungsstellen für ältere Menschen eingerichtet. Wenn es erforderlich ist, werden auch Hausbesuche durchgeführt. Für eine Verbreiterung des Beratungsangebots werden die mit der Pflegereform geschaffenen Pflegestützpunkte (Aufgabe und Funktion von Pflegestützpunkten vgl. 7.2) sorgen. Angesichts einer Studie (Klie Thomas/Pfundstein Thomas: Von der kommunalen Altenhilfeplanung zum Kultur- und Systemmanagement. Die neue Rolle der Kommunen in der Seniorenpolitik, in: informationsdienst altersfragen, Ausgabe Mai/Juni 2008, S. 7 – 10) , nach der 80 % der über 55-Jährigen angeben, sich mit einer künftigen Wohnsituation nicht aktiv auseinanderzusetzen, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe der kommunalen Altenhilfeplanung darin zu sehen, 15 • • • • kommunale Entwicklungsplanung und kommunale Wohnungsbaugesellschaften für das Thema stärker zu sensibilisieren, Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit dem Thema „Wohnen für ältere Menschen“ zu schaffen (z. B. im Rahmen von Zukunftswerkstätten, speziellen Informationsangeboten, Ausstellungen, Themen-Wochen), Transparenz hinsichtlich der in Kommunen ggf. bestehenden Wohnalternativen zu vermitteln, kommunenspezifische demografie-sensible Konzepte zu entwickeln und mit bestehenden Landesförderinstrumenten, wie z. B. dem demografie-sensiblen Investitionsprogramm, zu kombinieren. 5. Eigene Häuslichkeit und eigenständige Lebensführung sichern Die Unabhängigkeit zu Hause kann durch die soziale Situation, gesundheitliche Einschränkungen und durch Probleme bei Mobilität und Barrierefreiheit beeinträchtigt sein. Deshalb wird es in Zukunft verstärkt Aufgabe infrastruktureller Angebote sein, Selbsthilfefähigkeiten zu unterstützen. Hierzu können gehören • aktivierende statt immobilisierende Angebote, • unterstützende Hilfen beim Aufbau nachbarschaftlicher oder anderer Netzwerke (Einkaufshilfen, Besuchsdienste, Telefonketten), • aktive Förderung der Freiwilligenarbeit bzw. selbstorganisierter Angebote, z. B. auf Ebene der Nachbarschaftshilfe, Kirchengemeinden, Ehrenamtsbörsen. 5.1 Anpassung der eigenen Wohnung – persönlich und individuell In dem Bewusstsein, dass Hilfebedarfe schleichend entstehen, ist es Ziel einer präventiven Verbesserung des privaten Wohnungsbestandes sowie einer bewohnerorientierten Umgestaltung in größeren Wohneinheiten, „normale“ Wohnungen den Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen anzupassen, damit sie ihren eigenen Haushalt aufrechterhalten können. Technisch-bauliche Verbesserungen Im Gegensatz zur strukturellen Wohnungsanpassung, bei der ein Wohngebäude oder mehrere Wohneinheiten von Barrieren befreit werden, handelt es sich bei der individuellen Wohnungsanpassung um kleinere bis mittlere baulich-technische Maßnahmen, wie z. B. • Ergänzung der Ausstattung (Bad, WC, Küche, Heizung), • Reorganisation der Wohnung (Verkleinerung, Stockwerktausch,) • Beseitigung von Barrieren in Bezug auf Wohnung und Verkehrsflächen (Lift, Rampe, bodengleiche Dusche, Türverbreiterung), • Alltagserleichterungen (Kücheneinrichtung, Erhöhung Bett/Sessel, niedrigere Fenstergriffe), • technische Hilfen (Haltegriffe, Stütz- und Gehhilfen, intelligente Lösungen bei Elektroinstallationen, Notrufsystem). 16 Betriebsdatei der Handwerkskammer für seniorenfreundliches Handwerk Die Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) hat die Betriebsdatei "seniorengerechtes Bauen" eingerichtet. In der Datei werden Handwerksbetriebe aus den Handwerken, die auf diesem Gebiet besondere Kenntnisse und Erfahrung nachweisen können, geführt. Die HWK betreut diese Betriebe und bildet sie in Verbindung mit den Innungen weiter. Ein Arbeitskreis, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, wird eingerichtet. Wohnungseigentümer, Architekten bzw. sonstige Institutionen, die auf diesen Gebieten tätig sind, können sich an die Beratungsstelle der HWK wenden und erhalten die Kontaktadressen. Schaffung einer assistierenden Wohnumgebung Bauweisen und Technologien, die Komfort, Barrierefreiheit, Energieeffizienz, Sicherheit und Multimediakommunikation unterstützen, ermöglichen die Schaffung einer assistierenden Wohnumgebung und ergänzen das Angebot seniorenfreundlicher Betriebe. Bei Instandsetzungsarbeiten sollte der Blick auch darauf gerichtet werden, dass Assistenzsysteme älteren Menschen bei schlechter werdender körperlicher Verfassung weiterhin die Möglichkeit bieten, eigenständig in ihrem Zuhause zu leben. Ziel ist, mithilfe unterstützender Technologien wie z. B. elektrischer Rollladenheber, automatisierter Raumbeleuchtung und Raumtemperaturregulierung, medizinisch-pflegerischer Fernüberwachung, automatischer Alarmierung und Alarmweiterschaltung, Datenübertragung, Fernsteuerung (z. B. von Türen und Fenstern) sowohl Unabhängigkeit als auch Lebensqualität zu erhöhen. Solche intelligenten Assistenzsysteme werden unter dem Begriff »Ambient Assisted Living« (AAL) zusammengefasst und ermöglichen die Aus- bzw. Aufrüstung von Räumlichkeiten dergestalt, dass Alte und chronisch Kranke in ihren eigenen vier Wänden bleiben können, obwohl eine ständige intensive medizinische und pflegerische Betreuung notwendig ist. Die verschiedensten wissenschaftlichen Fachbereiche sind derzeit mit Entwicklungen rund um AAL befasst. Die Politik hat die Bedeutung dieses interdisziplinären Forschungsfeldes in Zeiten des demografischen Wandels erkannt und fördert AAL-Systeme auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene. Aus der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkte und Dienstleistungen ergeben sich auch für Bauwirtschaft und Handwerk neue Perspektiven und Wachstumsmärkte. Denn die wachsende Zahl älterer Menschen lässt die Nachfrage nach AAL-Systemen mittelfristig anwachsen. Auch im Saarland soll deshalb der Bereich „Ambient Assisted Living“ in den kommenden Jahren ausgebaut werden und wurde daher als Schwerpunktbereich in das neue Cluster healthcare.saarland aufgenommen, das von der Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT) und dem Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) gemeinsam geleitet wird. Im Rahmen des EU-Projektes TOPCARE wurde beispielsweise am IBMT in St. Ingbert eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema eingerichtet, die gemeinsam mit europäischen Partnern Telematikdienste für die häusliche Umgebung organisiert und erprobt hat. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken verfügt ebenfalls über besondere Kompetenzen in diesem Bereich. Weiterführende Informationen sind beispielsweise bei der Initiative Intelligentes Wohnen unter www.intelligenteswohnen.com, www.fachausschuss-haushaltstechnik.de, www.aal-deutschland.de und www.aal-europe.eu erhältlich. 17 Individuelle Ressourcen fördern Selbsthilfe Die technisch-bauliche Ausgestaltung der Wohnung muss nicht immer an erster Stelle beim Nachdenken über eine altersgerechte Anpassung der Wohnung stehen. Beschwerliche Verhältnisse können einen Trainingseffekt haben, technische Erleichterungen die Bequemlichkeit und damit die Inaktivität zu sehr fördern. Gute Nachbarschaft, Nähe von Versorgungseinrichtungen, finanzielle Vorteile und die Berücksichtigung individuell angenehmer Gewohnheiten sind oftmals wichtiger als technisch-baulicher Komfort. Erforderlich ist es, vorhandene Ressourcen zu identifizieren und zu fördern, um sicherzustellen, dass Bereitschaft und Fähigkeit bewahrt werden, soviel Selbsthilfe wie möglich zu leisten. Dazu gehört insbesondere die Schärfung des Bewusstseins, dass • • • in Zukunft Hilfe von Jüngeren mangels Verfügbarkeit kaum noch eingefordert werden kann, professionelle Dienstleistungen in der gegenwärtigen Form nicht beliebig verfügbar und vielfach mit zu hohen Kosten verbunden sein werden, die ökonomische Situation älterer Menschen sich langfristig z. B. angesichts geringer Erwerbseinkommen, lückenhafter Erwerbsbiografien oder mangelnder Eigenvorsorge, aber auch z. B. wegen des Verfalls der Immobilienpreise verschlechtern kann. 5.2 Finanzielle Hilfen 5.2.1 Wohnraumförderung Ziel der Wohnraumförderung ist, differenzierte Wohnangebote im Bestand insbesondere für ältere und auch behinderte Menschen zu schaffen, damit diese möglichst lange in ihren Wohnungen und ihrem Wohnquartier wohnen bleiben und bei Bedarf auch ambulant gepflegt werden können. Zielgruppe sind ältere (ab 60 Jahren) sowie behinderte Menschen, deren behinderungsspezifische Wohnbedürfnisse durch entsprechende bauliche Umgestaltung befriedigt werden können. Aus Sicht der Wohnraum- bzw. Wohnungsbauförderung ist es erforderlich, Eigentümern von Mietwohnungen Modernisierungshilfen bei der Anpassung des Bestandes an die Anforderungen altersgerechten Wohnens zu bieten, dabei zugleich aber Belegungs- und Mietpreisbindungen zu vereinbaren, um auch einkommensschwächeren Personen eine ausreichende Wohnungsversorgung zu gewährleisten. Hinsichtlich der Belegungsbindung sind flexible Konzepte erforderlich, die auch Wohngemeinschaften oder generationenübergreifende Wohnformen ermöglichen. Eigentümern selbst genutzter Wohnimmobilien sollte eine Förderung angeboten werden, wenn sie ihr Eigentum barrierefrei und altersgerecht gestalten wollen. Fördergegenstand Gegenstände der Förderung sind bauliche Maßnahmen in und an bestehenden Wohngebäuden, die dazu beitragen, Barrierefreiheit für ältere und behinderte Menschen herzustellen. Es sollen bauliche Maßnahmen im Wohnungsbestand in Mietwohnungen ebenso wie in selbst genutzten Wohnungen gefördert werden. Gesetzliche Grundlagen der Wohnraumförderung 18 Rechtsgrundlage der Wohnraumförderung ist das als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Wohnungsbaurechts erlassene Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz – WoFG) vom 13. September 2001, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. September 2008 (BGBl. S. 1856) geändert wurde. In der saarländischen Wohnraumförderung wird das WoFG ab dem Förderjahr 2003 angewandt. Als generelle Zielgruppe der Wohnraumförderung sind nach § 1 Abs. 2 Satz 1 WoFG Haushalte bestimmt, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Ältere Menschen bilden eine Kerngruppe der sozialen Wohnraumförderung. Modernisierungsprogramme des Saarlandes Im Rahmen der allgemeinen Programme zur Wohnraumförderung sind grundsätzlich auch Maßnamen der altersgerechten Modernisierung von Wohnungen förderungsfähig. Die aktuellen Programmvorschriften zur Durchführung des Wohnungsbauprogramms bestimmen zur Förderung der Modernisierung (§ 16 Abs. 3 WoFG) von Mietwohnungen, dass bei baulichen Maßnahmen zur Anpassung von Wohnungen an die Belange älterer oder behinderter Menschen durch Reduzierung von Barrieren als förderfähige Kosten folgende Maßnahmen gelten: • Verbesserung der Erreichbarkeit der Wohnungen (z. B. Einbau von Rampen oder Aufzügen), • rollstuhlgerechter Umbau von Wohnungen (bspw. Grundrissänderungen zur Schaffung von notwendigen Bewegungsflächen in Wohn- und Schlafräumen sowie Fluren), • nahezu barrierefreie Umgestaltung des Bades (z. B. Einbau bodengleicher Dusche, Schaffung von notwendigen Bewegungsflächen, sonstige Ausstattungsverbesserungen), • Verbreiterung von Türen und Abbau von Türschwellen, • Nachrüstung von elektrischen Türöffnern. Daneben ist in den jährlich aufgelegten Förderprogrammen – wie bereits in den Vorjahresprogrammen – die Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen (§ 16 Abs. 1 WoFG) zur Herstellung altersgerechter Wohnungen grundsätzlich enthalten; die Neuschaffung solcher Wohnungen wird dann unterstützt, wenn der Bedarf an solchen Wohnungen am vorgesehenen Standort durch die zuständige Gemeinde bestätigt wird. 5.2.2 Demografie-sensibles Investitionsprogramm des Saarlandes Das demografie-sensible Investitionsprogramm des Saarlandes resultiert aus der demografischen Entwicklung, die u.a. eine altersgerechte Anpassung von Wohnumfeld, Wohnraum und Dienstleistungen an die Bedürfnisse insbesondere der älteren Generation erforderlich macht. Sog. alternative Wohnformen finden zunehmendes Interesse, was wesentlich auf den Wunsch vieler Menschen zurückzuführen ist, sich größtmögliche Unabhängigkeit bis ins hohe Alter – auch im Falle von Pflegebedürftigkeit – bewahren zu können, dabei aber auch Vereinsamung im Alter zu vermeiden. Das Saarland ist auf der Grundlage des Demografieberichtes der Landesregierung bestrebt - gemäß den jeweiligen Einwirkungsmöglichkeiten in den Bereichen wie z. B. Sozialer Wohnungsbau, Generationen- und Seniorenarbeit, Gesundheits-, Sozial- und Familienpolitik -, die Entwicklung zukunftsorientierter Wohnmodelle zu unterstützen und hat dazu im Jahr 2007 das demografie-sensible Investitionsprogramm aufgelegt – mit dem Ziel der Förderung von Initiativen und Handlungskonzepten sowohl zur Entwicklung generationengerechter Wohnformen mit zukunftsfähigen Pflege-Arrangements (generationsübergreifende Dienstleistungs-, Hilfsund Beratungsangebote auf der Grundlage einer technischen, sozialen und versorgenden Infrastruktur) als auch zum gemeinwesenorientierten Umbau bestehenden Wohn- und Siedlungsraums, um häusliche Versorgung sicherzustellen und stationäre Unterbringung im Alter möglichst zu vermeiden; 19 der Konzentration auf einige wenige zukunftsorientierte Weiterentwicklungen des Wohnens, die beispielgebend für Gemeinden, Siedlungsgesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften und Privatinitiativen sein können. Das Programm ermöglicht die demografiebedingte Anpassung von Wohnumfeld, Wohnraum und Dienstleistungen an die Bedürfnisse der jeweiligen Generationen, insbesondere jedoch an die der älteren Menschen. Handlungsleitend für Bauherren, die in Abstimmung mit Kommunen auf Grundlage des Förderprogramms tätig werden, ist der Gedanke, die Häuslichkeit zu sichern, das Leben der Generationen miteinander nicht nur zu erleichtern, sondern gezielt wechselseitige Unterstützung zu ermöglichen und ortsund stadtplanerisch dazu beizutragen, dass Dienstleistungen im Wohnbereich möglichst ökonomisch zur Verfügung stehen. Das Förderprogramm trägt durch Unterstützung von Modellvorhaben auf kommunaler Ebene dazu bei, übertragbare bzw. anpassbare Lösungen zu entwickeln, z. B. durch Maßnahmen a) b) c) d) e) f) zur Schaffung von gemeinsamen wohnungsbezogenen Flächen für ältere Menschen oder für ältere Menschen und Familien, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen, zur Umgestaltung von Räumlichkeiten zur Schaffung von Flächen für Pflegestationen, Tagesaufenthalte und ambulante Pflege in Hochhäusern oder Wohnsiedlungen mit mindestens 200 Bewohnerinnen und Bewohnern, zur Schaffung von infrastrukturellen Angeboten zur Sicherung der Hilfe und der nachbarschaftlichen Unterstützung in sonstigen Wohngebieten, zur Schaffung von Flächen für Sozialzentren, zur Wohnungsteilung und Schaffung von Wohnraum für jüngere Menschen, wenn dies an eine Selbstverpflichtung zur Unterstützung eines älteren Menschen geknüpft ist, zur Schaffung von Flächen für Dienstleistungsstützpunkte, die Selbsthilfe fördern und der Erhaltung der Mobilität dienen. Während der ersten Phase des Investitionsprogramms wurden Maßnahmen gefördert, u. a. zur Schaffung von gemeinsamen wohnungsbezogenen Flächen für ältere Menschen oder für ältere Menschen und Familien, um soziale Kommunikation und generationenübergreifende Zusammenarbeit zu unterstützen. In der zweiten Phase des Investitionsprogramms erfolgt die Förderung von Einzelmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms „Wohnen im Alter“, das sich sowohl an Eigentümer/innen von Wohnraum als auch an Mieter/innen wendet. Mit dem Sonderprogramm „Wohnen im Alter“ für Menschen ab 60 Jahren unterstützt die Landesregierung die alters- und behindertengerechte Wohnraumanpassung durch einzelfallbezogene Finanzierung von Umbaumaßnahmen, die beispielsweise der Verbesserung der Erreichbarkeit oder der barrierefreien Umgestaltung des Wohnraums dienen und damit einen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit möglichst bis ins hohe Alter sichern können. Förderungsfähige Einzelmaßnahmen in der privaten häuslichen Umgebung älterer Menschen sind z. B. eine sicherheitsfördernde Gestaltung des Bades, die Beseitigung von Barrieren im Wohnraum, eine Verbreiterung der Türen oder ein altersgerechter Umbau der Küche. Die Förderung erfolgt in Form einer zweckgebundenen Zuschussgewährung. 20 Mit dem demografie-sensiblen Investitionsprogramm leistet das Land einen Beitrag, altersgerechte Wohnräume und Wohnumfelder zu schaffen. Ältere Menschen erhalten verbesserte Möglichkeiten, wohnungsnah Dienstleistungs- bzw. Versorgungszentren vorzufinden, sich in ihre eigene Wohnung zurückziehen oder an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen zu können. Die altersgerechte Umgestaltung des privaten Wohneigentums wird ebenso vereinfacht wie die Anpassung von Wohnumfeld, Wohnraum und Dienstleistungen an die Bedürfnisse der jeweiligen Generationen mit der Möglichkeit, Gemeinschaftsräume oder Gemeinschaftsflächen anzulegen. Wesentliches Kriterium für die geförderten Wohnprojekte ist das Jung-hilft-Alt / Alt-hilft-Jung Prinzip, so dass mit dem demografie-sensiblen Investitionsprogramm insgesamt die Anlage bzw. Modernisierung altersgerechter Wohnflächen ebenso nachhaltig unterstützt werden wie der Dialog der Generationen. Diese Landes-Programme tragen insgesamt dazu bei, Wohn- und Lebensqualität der älteren Generation nachhaltig zu verbessern. Der Erfolg demografie-sensibler Investitionsmaßnahmen wird wesentlich beeinflusst a) b) c) von der Bereitschaft der Kommunen, die Entwicklung und Verwirklichung entsprechender Wohnformen in Zusammenarbeit z. B. mit Seniorenbüros, Seniorenbeiräten, Leitstellen „Älter werden“ und Wohnberatungsstellen sowie mit Vereinen, Verbänden oder Initiativen zu unterstützen, von der Bereitschaft von Bauträgern und Wohnungsgesellschaften, bestehenden Wohnraum nachfrageorientiert entsprechend umzubauen und zur Verfügung zu stellen sowie ServiceAngebote innerhalb bestehender Wohnanlagen, insbesondere für ältere Menschen, sowohl bedarfsgerecht als auch generationenübergreifend anzubieten, von der Bereitschaft von Wohneigentümern, rechtzeitig ihre Wohnung und ihr Wohnumfeld altersgerecht umzubauen und zu gestalten. 5.2.3 Förderung von Umbaumaßnahmen auf Grundlage der Pflegeversicherung Die Pflegeversicherung gewährt gemäß § 40 Absatz 4 SGB XI unter bestimmten Bedingungen bei anerkannter Pflegebedürftigkeit finanzielle Unterstützung für eine Wohnraumanpassung. Danach können die Pflegekassen ergänzend finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen gewähren, beispielsweise für technische Hilfen im Haushalt, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbständige Lebensführung der Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird. Die Höhe der Zuschüsse ist unter Berücksichtigung der Kosten der Maßnahme sowie eines angemessenen Eigenanteils in Abhängigkeit von dem Einkommen des Pflegebedürftigen zu bemessen. Der Zuschuss wird von den Pflegekassen bis zu einem Betrag von 2.557,- € je Maßnahme gewährt. Dabei sind alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Zuschussgewährung (und damit auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hilfebedarfs) zur Wohnumfeldverbesserung erforderlich sind, als eine Verbesserungsmaßnahme zu werten. Dies gilt auch dann, wenn die Verbesserungsmaßnahmen in Einzelschritten verwirklicht werden. So stellt z. B. bei der Befahrbarmachung der Wohnung für den Rollstuhl nicht jede einzelne Verbreiterung einer Tür eine Maßnahme im Sinne dieser Vorschrift dar, sondern die Türverbreiterungen und die Entfernung von Türschwellen insgesamt. Ändert sich die Pflegesituation und werden weitere Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung erforderlich, handelt es sich erneut um eine Maßnahme im Sinne von § 40 Abs. 4 SGB XI, so dass ein erneuter Zuschuss bis zu einem Betrag von 2.557,- € gewährt werden kann. 21 Umfassende Informationen zu möglichen, das Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen sind bei Pflegekassen bzw. bei in den Landkreisen/im Regionalverband Saarbrücken eingerichteten Pflegestützpunkten erhältlich. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten bestehen z. B. im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII – Sozialhilfe) sowie im Rahmen der Wohnraum- bzw. Modernisierungsförderung der Länder. So kommen für pflegeversicherte Pflegebedürftige aufstockende Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII in Betracht, wenn die Zuschüsse der Pflegeversicherung für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nicht ausreichen. Für nicht versicherte Pflegebedürftige ist die Sozialhilfe originär zuständig, wenn der Pflegebedürftige oder seine unterhaltspflichtigen Angehörigen nicht über genügend Eigenmittel verfügen, um die Kosten für eine Wohnungsanpassung zu finanzieren. 5.3 Generationenübergreifende Stadtentwicklung Zentrale Aufgabe nachhaltiger Stadtentwicklung ist es, die Standortqualitäten der Städte als Wohn- und Versorgungsstandorte zu stärken. Angesichts der sozialen und demografischen Rahmenbedingungen im Saarland bedeutet dies für die Städte, ihre Stadtquartiere generationsübergreifend attraktiv zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Städte die Lebensbedingungen aller Generationen in den Blickpunkt einer weitsichtigen Stadtplanung und Wohnungspolitik rücken. Dabei kommt der passenden Verzahnung von wohnungs- und städtebaulichen Maßnahmen mit sozialer Infrastruktur und Versorgungsangeboten demografiebedingt besondere Bedeutung zu. Die spezifischen Anforderungen einzelner Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen und dadurch integrierende und identitätsstiftende Quartiere für alle zu schaffen, ist eine der wesentlichen Herausforderungen für eine zukunftsfähige generationenübergreifende Stadtentwicklung. Saarländische Städtebauförderprogramme Im Rahmen der saarländischen Städtebauförderprogramme werden die Kommunen darin unterstützt, die „Stadt der kurzen Wege“ zu gestalten. Gerade für Ältere und für Familien ist die Nähe zu Angeboten des täglichen Bedarfs besonders wichtig. Eine kompakte Nutzungsmischung sorgt für eine gute Auslastung vorhandener Infrastruktur, für den effizienteren Umgang mit Energie und für eine Reduktion des Mobilitätsaufwandes. Im Vordergrund der Förderung steht dabei: 1. 2. 3. 22 die Einrichtung bzw. Stärkung von Gemeinschaftseinrichtungen im Quartier sowie der Umbau bzw. die Anpassung sozialer Infrastruktur, die Gestaltung öffentlicher Räume für alle Generationen und die Attraktivitätssteigerung des Wohnens im Quartier für Jung und Alt. 1. Gemeinschaftseinrichtungen im Quartier – Umbau sozialer Infrastruktur Im Mittelpunkt stehen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, die ein Angebot an alle Bevölkerungsgruppen darstellen. Es geht weniger um die Sicherung bzw. Schaffung bedarfsgruppenspezifischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Seniorenbegegnungsstätten und Jugendzentren. Diese Angebote werden auch weiterhin wichtig und notwendig sein. Vorrangig sollen solche Einrichtungen gestärkt und ausgebaut werden, die das Zusammenleben begünstigen und die gemeinschaftliche Nutzung unterschiedlicher Generationen beiderlei Geschlechts beinhalten. Eine besondere Herausforderung besteht insbesondere darin, den demografisch bedingten Leerstand nicht mehr nachfragegerechter Einrichtungen für eine gemeinschaftliche Nutzung zu gewinnen, wie zum Beispiel Nachbarschaftshäuser für alle Generationen. Aus der Verknüpfung infrastruktureller Maßnahmen mit wohnungswirtschaftlichen und das Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen können wesentliche Qualitätsgewinne für dauerhaft attraktive Stadtquartiere erwachsen. So hat das Saarland beispielsweise in Dillingen, Neunkirchen und Saarbrücken-Brebach Begegnungs- bzw. Kommunikationszentren für Jung und Alt gefördert. In Völklingen-Wehrden wurde die Kulturhalle modernisiert und Platzangebote für unterschiedliche Nutzergruppen geschaffen, in Losheim am See wird derzeit der Bürgersaal für generationsübergreifende Nutzung umgebaut; gleiches gilt für die Umnutzung des ehemaligen Sulzbacher Gymnasiums zu einem Multifunktionsveranstaltungszentrum. Weitere Einrichtungen dieser Art wurden in vielen Gemeinden bzw. werden auch in Zukunft gefördert. Grundsätzlich gilt für alle Einrichtungen, dass sie barrierefrei gebaut bzw. umgebaut werden. 2. Gestaltung urbaner Freiräume – öffentlicher Raum für alle Generationen Hier geht es nicht um die herausgehobenen großen Plätze und Parks von gesamtstädtischer Bedeutung, sondern um „Orte des Alltags“, an denen Bürger sich aufhalten, einander begegnen, ihre Besorgungen erledigen und einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Wohnen - insbesondere das städtische Wohnen - braucht diese Freiräume. Werden sie vernachlässigt, so trägt dies dazu bei, dass die Menschen sich in der Stadt nicht mehr wohl fühlen. Die Aufwertung der wohnungsnahen Freiräume ist damit ein wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Ziel der Planung neuer Freiräume muss deshalb die Nutzbarkeit für verschiedene soziale Gruppen, die Aneignung und damit auch die Veränderbarkeit sein. Die Herausforderung besteht darin, für viele Funktionen offene und die Lebensqualität im Quartier fördernde Räume zu schaffen. Damit öffentliche Räume als attraktive Angebote wahrgenommen werden, ist eine integrierte Planung nötig; ein offener Prozess, der bei der Programmplanung beginnt, eine umfassende Vermittlung an alle Nutzer beinhaltet und eine qualitätsvolle bauliche Lösung vorsieht. Da die öffentliche Hand nicht mehr in der Lage ist, allen Anforderungen nachzukommen, stellt sich auch die Frage nach der Finanzierbarkeit des Umund Ausbaus und der Unterhaltung. Hier ist eine Aktivierung und Beteiligung aller Quartiersakteure, junger und alter Bewohner ebenso wie der Gewerbetreibenden nötig, die nach Möglichkeit durch eigenes Engagement, gemeinsame Planung und Realisierung ein Verantwortungsgefühl für ihr Quartier entwickeln. Im Zuge der Umgestaltung des Wohnumfeldes werden in den Städtebaufördergebieten der Kommunen Grün- und Freiräume unterschiedlichster Art gefördert. 23 So wurden beispielsweise der Landwehrplatz und das Kirchenumfeld der Johanniskirche im Nauwieser Viertel in Saarbrücken im Rahmen einer intensiven Bürgerbeteiligung neu gestaltet. In Merzig wurde eine innerstädtische Grünzone, die Bewohner und Besucher anzieht, entlang des Seffersbaches geschaffen. In Völklingen wurde durch den Rückbau von Gebäuden eine attraktive Innenhofsituation hinter dem alten Rathaus gestaltet. Der Wehrdener Platz bietet den Wehrdener Bürgern ebenso wie die Umfeldgestaltung der Kulturhalle angenehme Ruheräume im urban geprägten Umfeld. In St. Ingbert wurden mehrere kleine Flächen in einem innerstädtischen Wohnquartier neu gestaltet. Das ebenfalls neu gestaltete Kirchenumfeld in Freisen, der künftige Bürgerpark in Merzig, die Mietergärten in der Schalthaussiedlung in Merzig oder der Themenpark am Begegnungszentrum Dillingen Überm Berg sind weitere Beispiele. Eine Vielzahl weiterer Maßnahmen befindet sich zurzeit in der Planung bzw. Umsetzung. 3. Attraktives Wohnen im Quartier - Nachbarschaften von Jung und Alt Die Bereitstellung von attraktivem Wohnraum für alle Generationen ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein wichtiger Standort- und Haltefaktor für die Städte. Ältere Menschen orientieren sich bereits zunehmend wieder in Stadtgebiete, da hier vor allem die benötigte Infrastruktur für sie leichter zugänglich ist. „Sicherheit im Quartier“ ist nicht nur mit Anforderungen älterer Menschen mit Blick auf den Abbau von Zugangsbeschränkungen verbunden. Verbesserte Sicherheit im öffentlichen Raum wird mit zunehmendem Alter eine entscheidende Rolle für individuelle Lebensqualität an sich darstellen. Mobilitätseingeschränkten Personen kann mit technischer Hilfe der Aufenthalt im Wohnumfeld und im Stadtquartier erleichtert werden. Denkbare Unterstützungsmöglichkeiten für innovative Technik sollen sowohl für den barrierefreien Zugang und die Nutzung des lokalen Stadtquartiers bis ins hohe Alter wie auch bei der Gewährleistung der individuellen Sicherheit durch Vernetzung von Hilfsdiensten und weiteren Serviceangeboten im Stadtquartier weiterentwickelt und verwirklicht werden. Nachbarschaftshäuser bzw. Mehrgenerationenhäuser können zu „Identifikation mit dem Quartier“ stiftenden Einrichtungen erwachsen. Sie können zu konkreten Orten und ideellen Trägern eines „Wir-Gefühls“ im Quartier werden und damit generationenübergreifendes Wohnen (=> Kapitel 6.1) im Quartier positiv beeinflussen. Eine wesentliche Funktion für familien- und altersgerechte Stadtquartiere hat zudem die Stärkung der wohnungsnahen Versorgung der Bevölkerung. Unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich des Einzelhandels einerseits und der demografischen Entwicklung andererseits liegt eine große Chance darin, eine neue Qualität für fußläufige, verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. Im Rahmen der Städtebauförderung werden vielfältige Maßnahmen zur Unterstützung des generationenübergreifenden Wohnens im Quartier gefördert. Beispiele sind in Saarbrücken das Projekt „Alt und Jung“ im Nauwieser Viertel, das Mehrgenerationenhaus in Nonnweiler, aber auch das Projekt Nachbarschaftstreff „goldene Au“ in Sulzbach. 24 Darüber hinaus wurden in vielen Gemeinden die Voraussetzungen für verschiedene Formen des Betreuten Wohnens geschaffen. Zudem wurden zusätzliche Beleuchtungen im öffentlichen Raum zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bewohner gefördert. Im Rahmen der Wohnumfeldgestaltung werden barrierefreie Fußwege mit direkter Wegeführung zu sozialer Infrastruktur und medizinischer sowie sonstiger Versorgung besonders gefördert. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und das Herrichten kleiner Frei- und Ruheräume werden ebenfalls in zahlreichen Stadterneuerungsgebieten gefördert. Die Verknüpfung der Wohnraumförderung mit der Städtebauförderung stellt zudem sicher, dass Wohnungsmodernisierungen und Wohnraumumfeldverbesserungen in den Stadterneuerungsgebieten Hand in Hand gehen. Die Förderung des Wohnumfeldes wird künftig auch verstärkt durch das Initiieren privaten Engagements im Rahmen von Eigentümerstandortgemeinschaften erfolgen. Hier wird insbesondere die Flexibilisierung der Wohnungsangebote und der Einsatz neuer Technologien in Stadtquartieren das generationengerechte Wohnen verbessern helfen. 5.4 Wohnen im Ländlichen Raum – auch im Alter Um den Menschen im Alter ihr Zuhause im Dorf zu sichern, erfordert der demografische Wandel neue Konzepte für das soziale Miteinander und für attraktive Lebensbedingungen auch im ländlichen Raum. Die Agentur ländlicher Raum der Landesregierung fördert mit dem Programm MELaniE (Modellvorhaben zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch innerörtliche Entwicklung) beispielhafte Projekte für Zukunftsperspektiven in den Dörfern. Dabei ist das Beleben von bürgerschaftlichem Engagement von besonderer Bedeutung. Um auch im Alter in seinem vertrauten Dorf bleiben zu können und sich dort wohl zu fühlen, sind besonders folgende Aspekte wichtig: Netzwerkstrukturen aufbauen Im intensiven und vertrauensvollen Miteinander einer intakten Dorfgemeinschaft sind Menschen verschiedener Fähigkeiten gut integriert und können voneinander profitieren. Mit den sozialen Beziehungen wächst auch die selbstverständliche Bereitschaft, sich in Phasen der Hilfsbedürftigkeit gegenseitig zu unterstützen. Beispiel: MELaniE Projekt „Netzwerk Freisen“ Der Austausch zwischen Dorfbewohnern aller Generationen wird in Arbeitsgruppen zu lokal interessanten Themen aktiviert. Die enge Zusammenarbeit wird durch gemeinsame Interessen und Ziele gefördert, beispielsweise durch das Einbinden eines Seniorencafés in einen Kindergarten, um einen Treffpunkt sowohl für ältere Menschen als auch Möglichkeiten zur Beteiligung an der Betreuung der Kinder zu schaffen. Die jüngere Generation profitiert von den Erfahrungen der Älteren und für diese ist es bereichernd, im Einsatz für die Jugend gebraucht zu werden. Denn Erfahrung, Wissen und handwerkliche Fähigkeit zielgerichtet und sinnvoll einsetzen zu können, bedeutet auch, Teilhabe an Gemeinschaft zu gewährleisten. Beispiel: MELaniE Projekt „Jugendwerkhaus Theley“ Das Jugendwerkhaus ist ein Ort der Begegnung, an dem erwachsene Dorfbewohner ihr Wissen weitergeben und durch neue Aufgaben zusätzliche Lebensqualität finden. Gleichzeitig können Jugendliche die Vielfalt ihrer Talente erproben und ihre persönlichen Interessen herausfinden. Durch diesen Austausch kann die Dorfgemeinschaft enger zusammenwachsen. Die Motivation des Einzelnen, die eigenen Fähigkeiten auch in Problemlagen für andere einzusetzen, wird gefördert. 25 Dienstleistungs- und Kommunikationszentren Regelmäßiger Erfahrungsaustausch und Information zum sozialen und kulturellen Leben im Ort stärken das Zugehörigkeitsgefühl zur Dorfgemeinschaft. Gleichzeitig ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein wichtiger Aspekt der Lebensqualität. Beispiel: MELaniE Projekt „Dienstleistungsagenturen 60+ in Tholey und Hasborn-Dautweiler“ Diese Agenturen gründen sich auf drei Säulen. Erstens sollen sie Informationszentrale für ältere Mitbürger sein. Zweitens stellen sie einen Treffpunkt zur Kommunikation und auch für Veranstaltungen dar. Drittens sollen sich an diesen Treffpunkten Gruppen bilden, in denen Senioren ihre Fähigkeiten als Dienstleistung für andere anbieten. Beispielsweise können Lehrkräfte im Ruhestand Nachhilfestunden oder Unterstützung beim Sprachunterricht für Migrant/innen geben. Oder es können Betreuungsangebote für Kleinkinder angeboten werden. Die Dienstleistungsagenturen sind räumlich in einem Wohnstift und in einem Seniorenhaus untergebracht und verzahnen diese mit dem dörflichen Leben. Einkaufsläden – Kontaktzentrum im Dorf Schon immer waren Einkaufsläden wichtige Kommunikationszentren im Dorf, in denen man sich trifft und neben Lebensmitteln auch mit Neuigkeiten versorgt. Das Aufrechterhalten oder Wiederansiedeln von Dorfläden hat damit eine gleichermaßen wesentliche Funktion für die sozialen Kontakte wie für die Versorgung mit Lebensmitteln und Dienstleistungen. Da es wegen der abnehmenden Bevölkerungszahlen wirtschaftlich schwierig ist, ständig alle Dienstleistungen in einem Ort vorzuhalten, gilt es auch in dieser Beziehung neue Wege zu gehen. Beispiel: MELaniE Projekt „Bickenalb Center Altheim“ Der Kern des Dienstleistungscenters ist ein Dorfladen, in dem man sich mit Einkaufsgütern des täglichen Bedarfs versorgen kann. Zusätzlich werden in dem Gebäude zu bestimmten Zeiten weitere Dienstleistungen angeboten: Lottoannahme, Zeitschriften, Schreibwaren, Zigaretten, Reinigung, Friseur, Poststelle, Sprechstunden der Stadtverwaltung, Rentenberatung, Geldautomat. Der Dorfladen als Ort, den jeder besucht, wurde somit genutzt, um eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen wieder im Ort verfügbar zu machen. Wenn in das Spektrum der abrufbaren Dienstleistungen auch eine ärztliche Versorgung und die Möglichkeit von betreuenden und pflegerischen Leistungen eingebunden ist, könnten in Kombination mit einer aktiven Nachbarschaftshilfe auch Phasen körperlicher Schwäche im dörflichen Zuhause bewältigt werden. Versorgung mit Handwerksleistung – „Handwerker für ältere Menschen“ 26 Die Sicherheit, vom Handwerk gut und nachvollziehbar beraten zu sein, ist das Ziel beim Projekt „Handwerker für ältere Menschen“. Angestrebt wird, dass Handwerksbetriebe ihre Angebote vor allem auch für ältere Menschen bedürfnisorientiert, verständlich und serviceorientiert aufbereiten. Dazu gehören ein Beratungsgespräch und die Bereitschaft, individuell ausführlich zu erklären. Auch das Kleingedruckte sollte nicht klein gedruckt, sondern für ältere Menschen gut lesbar geschrieben sein. Interessierte Betriebe könnten sich beispielsweise bei der Gemeinde oder den Wirtschaftskammern einer freiwilligen Zertifizierung als seniorenfreundlicher Betrieb unterziehen. Für ältere Menschen wäre die Liste der Betriebe zum Beispiel über Dienstleistungsagenturen, im Dorfladen, oder über die Gemeinde zugänglich. MELaniE Projekt „Aktion Dorfglück“ Im Rahmen dieses Projektes wurden innovative Vorschläge zur Verbesserung der innerdörflichen Kommunikation gesammelt. Ein digitales Türschild macht es beispielsweise möglich, Nachrichten mit Nachbarn und Besuchern auch in Abwesenheit auszutauschen. Neue Technik wie diese eröffnet dem sozialen Umfeld, das sich für das Wohlergehen der älteren Mitbürger engagiert, eine hervorragende Möglichkeit des Austauschs und der organisatorischen Abstimmung. Eine dörfliche Gemeinschaft bietet Raum für enge soziale Kontakte und ermöglicht die Organisation gegenseitiger Hilfe. Beides sind wichtige Voraussetzungen, um den Verbleib im Dorf auch im Alter zu sichern. Um das Leben im Dorf für ältere Menschen attraktiv zu gestalten und soziale Qualität aufrecht zu erhalten, kommen in erster Linie Maßnahmen in Betracht, die – wie in den oben genannten Beispielen ausgeführt - das soziale Miteinander fördern, den Austausch zwischen den Generationen anregen und den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken. Außer der Sicherung der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen müssen allerdings auch Projekte verwirklicht werden, die älteren Menschen die Möglichkeit bieten, ihr Können und ihre Lebenserfahrung zum Nutzen der Gemeinschaft einzusetzen. Dadurch wird sich die Lebensqualität für alle Generationen im Dorf verbessern. Auch die dörfliche Vereinsarbeit wird von der Förderung kreativer Ideen und dem generationenübergreifenden Austausch im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich profitieren. Derart aktive und lebendige Dorfgemeinschaften sind für Kommunen im ländlichen Raum der Schlüssel zu Integration und Teilhabe aller Generationen. Dazu ist auf kommunaler Ebene die Bildung der beschriebenen Netzwerke eine wesentliche Grundlage und wesentlicher Förderansatz. Investive Maßnahmen werden als flankierende Fördermöglichkeit gesehen. Dies kann beispielsweise auch zutreffen, wenn alte Leerstandsviertel im Ort belebt werden sollen. Bei deren baulicher Neugestaltung sollte ebenfalls auf Fachwissen und Kreativität hilfsbereiter älterer Dorfbewohner/innen zurückgegriffen werden. 6. Alternative Wohnformen Diese Wohnformen gelten als neu oder alternativ, weil sie sich als kritische Antwort auf die Defizite der traditionellen Wohnangebote für Senioren verstehen. Ihre wesentlichen Ziele sind: • selbständiges, selbstbestimmtes Wohnen verwirklichen • Sicherheit und Verfügbarkeit von bedarfsorientierten Hilfen bieten • gemeinschaftliches, generationenübergreifendes Wohnen ermöglichen. Der Wunsch, größtmögliche Unabhängigkeit im Alter zu bewahren, die Tendenz zur Vereinzelung sowie das Bestreben, rechtzeitige Vorsorge vor den Folgen einer Pflegebedürftigkeit zu treffen, veranlassen viele Menschen, über alternative Wohnformen für ihr Alter nachzudenken. Zum Spektrum neuer Wohnformen zählen beispielsweise Wohngemeinschaften, also Wohnformen, bei denen sich Menschen in freiem Entschluss zusammenfinden, gemeinsam Wohnungen oder Wohnräume mieten und ihren Alltag gemeinsam organisieren, bis hin zur Beauftragung von ambulanten Diensten. 27 Hinzuweisen ist darauf, dass das Land bei alternativen Wohnformen im Alter für deren Etablierung und Fortentwicklung keine unmittelbare Zuständigkeit hat. Hierfür, und somit insbesondere auch für den Ausbau kostengünstiger vorstationärer Leistungsangebote, ist die örtliche Zuständigkeit im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts und der finanziellen Leistungsfähigkeit gegeben. Jedoch nimmt das Land im Rahmen gesetzlicher Bestrebungen bei der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen (z. B. Beratungsangebote, Verbraucherschutz) auf die optimale Entwicklung und Ausgestaltung Einfluss. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise im Rahmen der Pflegeversicherungsreform die bessere Förderung niedrigschwelliger Angebote und stärkere Verzahnung von Leistungsangeboten im stationären und ambulanten Bereich zu unterstützen, um auch auf diesem Wege eine generationengerechte Gestaltung zukunftsweisender Pflegearrangements verwirklichen zu können. Landesheimgesetz unterstützt Entwicklung neuer Wohnformen Das Saarländische Gesetz zur Sicherung der Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalität für ältere Menschen sowie pflegebedürftige und behinderte Volljährige (Landesheimgesetz Saarland – LHeimGS) vom 6. Mai 2009 trägt der Weiterentwicklung neuer Wohnformen dadurch Rechnung, dass es eine Erprobungsregelung vorsieht, die in begründeten Fällen Ausnahmen von den gesetzlichen Vorschriften dieses Gesetzes zulässt. 6.1 Gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen Gemeinschaftliches Wohnen unterscheidet sich baulich vom normalen Wohnen in vielen Fällen durch einen zusätzlichen Gemeinschaftsraum. Ist keine feste Gemeinschaft vorhanden, ist die Realisierung aufgrund der Tatsache, dass sich eine passende Gruppe erst finden und konsolidieren muss, oft schwierig. Gemeinschaftliches Wohnen innerhalb der eigenen Generation (z. B. Senioren-Wohngemeinschaft) oder aber auch generationenübergreifend hilft älteren Menschen, ihr Leben länger selbständig zu organisieren. Wesentlich ist die vorhandene Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Senioren-Wohngemeinschaft Von einer Senioren-Wohngemeinschaft (WG) ist auszugehen, wenn sich mehrere ältere Personen selbstbestimmt zusammenschließen, um gemeinsam zu wohnen. Die Senioren-WG bildet eine häusliche oder familiäre Wohnform, da ihre Mitglieder selbst darüber entscheiden, mit wem sie in der Wohngruppe leben wollen. Wohnnutzung und Pflegeleistung stehen unabhängig nebeneinander. Mehrgenerationenwohnen 28 Das seitens der Bundesregierung im Jahr 2007 aufgelegte Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhäuser“ kann im Zusammenhang mit der Etablierung neuer Wohnformen gesehen werden. Die Idee der Mehrgenerationenhäuser in Verbindung mit deren Erweiterung in Form des Mehrgenerationenwohnens findet größeren Zuspruch dort, wo sie bekannt gemacht werden. Mehrgenerationenhäuser und –wohnanlagen sind in vielen Städten eine Antwort auf das Schwinden der Großfamilie bzw. der weiteren räumlichen Trennung von Eltern und Kindern. Die Wohnkonzeption des Mehrgenerationenwohnens kann sowohl für junge Familien als auch für alte Menschen, für Alleinerziehende wie für Elternpaare passende Unterstützung im Alltag sein und damit die Lebensqualität erhöhen. Sie fördern eine positive Grundhaltung zur nachbarschaftlichen Solidarität. Alte wie junge Menschen können sich leichter mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen und zum Gelingen des Zusammenlebens beitragen. Eine Entwicklung eines solches Angebotes als alternative Wohnform zum „saarländischen Einfamilienhaus“ liegt im allgemeinen Interesse und sollte deshalb nachhaltige Unterstützung erhalten. Gründe für Mehrgenerationenwohnen – im Überblick: • • • • • • Das Zusammenleben von Jung und Alt hat sich verändert Erfahrungen aus dem Alltagsleben werden kaum mehr selbstverständlich weitergegeben Nachbarschaften als soziale Netzwerke funktionieren nicht mehr in dem Maße wie zu früheren Zeiten Professionelle Hilfestellungen werden im häuslichen Bereich weiter an Bedeutung gewinnen Die Betreuung von Kindern und alten Menschen findet zumeist separat voneinander statt Begegnungen und Kontakte zwischen den Generationen haben wenig Raum Ziele generationenübergreifender Wohnprojekte: a) b) c) d) e) f) Entwicklung zukunftsweisender Wohn- und Lebensmodelle zur Vermeidung von Vereinzelung Organisation eines sozialen Netzwerkes der Bewohner in dem Wohnobjekt und im umgebenden Stadtquartier Schaffung und Förderung des Gemeinschaftslebens von Jung und Alt durch freiwillige Strukturen Förderung sozialer, kultureller, ökologischer und ökonomischer Kooperationen im Wohnquartier Generationenübergreifendes Wohnen soll den Austausch der Generationen befördern, eine selbstbestimmte Lebensgestaltung bis ins hohe Alter ermöglichen, die den Menschen innewohnenden Ressourcen mobilisieren und Begegnungsmöglichkeiten und soziale Netzwerke schaffen Die Gemeinschaftseinrichtungen sind offen als Begegnungsstätte für mehrere Generationen, für deren unterschiedliche Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse Im Saarland erfolgt eine Förderung gemeinschaftlicher bzw. generationenübergreifender Wohnformen beispielsweise auf Grundlage des demografie-sensiblen Investitionsprogramms (=> Kapitel 5.2.2). 6.2 “Wohnen für Hilfe“ – junge Leute und Senioren unter einem Dach Hierbei profitieren beide Generationen. Das Prinzip, nach welchem im englischsprachigen Raum ähnliche Projekte unter der Bezeichnung „Homeshare“ entstanden sind, ist einfach: Ältere Menschen nehmen junge Menschen, meist Studierende, in ihr Wohneigentum auf. Die jungen Leute leisten vorher vereinbarte Hilfsdienste, wie z. B. Einkaufen oder Rasenmähen, die auf die Miete angerechnet werden (Faustregel: ein Quadratmeter Wohnraum für eine Stunde Hilfe im Monat). Pflegerische Hilfen sieht dieses alternative Wohnprojekt für Jung und Alt nicht vor. Ältere Menschen erhalten notwendige Hilfen, um im gewohnten Wohnumfeld verbleiben zu können. Die jungen Leute finden bezahlbaren Wohnraum. Junge Menschen profitieren von der Lebenserfahrung älterer Menschen, und für Senioren bedeutet das Zusammenleben weniger Einsamkeit im Alltag sowie Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, im Garten und in Notsituationen. 29 Diese Wohnpatenschaften für Studierende bei Senioren oder Familien vermitteln verschiedene Studentenwerke. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.wohnen-hilfe.de Im Saarland hat der Landesseniorenbeirat in Kooperation mit dem Studentenwerk und der Universität des Saarlandes sowie mit finanzieller Förderung der Bundesagentur für Arbeit und des Landes das Projekt, das sich in erster Linie an Studierende wendet, die keine Unterkunft im Studentenwohnheim finden, im Frühjahr 2009 auf den Weg gebracht. Studierenden soll “Wohnen für Hilfe“ als Alternative angeboten werden, um passenden Wohnraum in Uni-Nähe in Verbindung mit einfacher Hilfe für ältere Menschen zur Verfügung zu stellen: • “Wohnen für Hilfe“ trägt zur Steigerung der Lebensqualität älterer Menschen bei und fördert das gemeinschaftliche Leben zwischen Senioren und Studierenden. • Die Initiative bietet eine neue und solidarische Alternative zu klassischen Studentenwohnungen an und leistet einen Beitrag zur intergenerativen Verankerung der Universität in der Gesellschaft. Nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Interesses an alternativen Wohnformen, interessieren sich Gemeinden im Saarland zunehmend für einen demografie-orientierten Umbau ihres Wohnungsbestandes und arbeiten mit Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaften daran, wie drohenden Wohnungsleerständen entgegen gewirkt werden kann, bestehender Wohnraum altersgerecht und demografie-sensibel umgebaut oder beispielsweise zu Mehrgenerationenwohnen umfunktioniert werden kann. 7. Ambulante Pflege und Hilfen zur Sicherung der Häuslichkeit Um dem Wunsch der meisten Pflegebedürftigen zu entsprechen, in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben zu können, haben ambulante Hilfen Vorrang vor (teil-)stationären Angeboten. Seit Einführung der Pflegeversicherung stellen ambulante Pflegedienste sowohl die häusliche Pflege als auch die hauswirtschaftliche Versorgung sicher. 7.1 Anpassung gesetzlicher Grundlagen Die Leistungen der 1995 eingeführten sozialen Pflegeversicherung tragen dazu bei, dass rund 69 % aller Pflegebedürftigen entsprechend ihrem persönlichen Wunsch zu Hause versorgt werden können. Außerdem ermöglicht es die Pflegeversicherung den Pflegebedürftigen und ihrer Familie, die mit der Pflegebedürftigkeit zusammenhängen Aufwendungen abzufedern. Mit dem Pflege–Weiterentwicklungsgesetz wurden die Leistungen der Pflegeversicherung inhaltlich ausgebaut und auf die kommenden Herausforderungen der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung vorbereitet. 30 Insbesondere wurden strukturelle Veränderungen vorgenommen, die dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ stärker als bisher Rechnung tragen. Hervorzuheben sind insbesondere die Anhebung der Leistungsbeträge, vor allem im Bereich der häuslichen Pflege, der neue gesetzliche Anspruch auf eine Pflegezeit für Beschäftigte sowie die Einführung eines Anspruches auf Pflegeberatung (Fallmanagement) und die Schaffung von Pflegestützpunkten. Diese Maßnahmen stärken den Auf- und Ausbau wohnortnaher Versorgungsstrukturen, die eine quartiersbezogene Versorgung und Betreuung in Zukunft ermöglichen sollen, und dienen damit maßgeblich der angestrebten Sicherung der Häuslichkeit. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz hat mit seinen Leistungserhöhungen einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich der ambulanten Pflege gelegt. Konkret wurden die Pflegeversicherungsleistungen ab 1.07.2008 stufenweise bis 2012 deutlich angehoben: • Die ambulanten Sachleistungsbeträge für die Pflege durch Pflegefachkräfte erhöhen sich wie folgt: Pflegestufe Leistung bisher ab 1. Juli 2008 ab 1. Jan. 2010 ab 1. Jan. 2012 I 384 € 420 € 440 € 450 € II 921 € 980 € 1.040 € 1.100 € III 1.432 € 1.470 € 1.510 € 1.550 € Die Pflegestufe III für Härtefälle im ambulanten Bereich in Höhe von 1.918 € monatlich bleibt unberührt. • Wird die Pflege selbst sichergestellt, zahlt die Pflegeversicherung ein Pflegegeld in folgender Höhe: Pflegestufe Leistung bisher ab 1. Juli 2008 ab 1. Jan. 2010 ab 1. Jan. 2012 I 205 € 215 € 225 € 235 € II 410 € 420 € 430 € 440 € III 665 € 675 € 685 € 700 € Auch die Leistungen für Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz (dementiell Erkrankte und behinderte Menschen) deutlich angehoben. Seit 1. Juli 2008 wurden je nach Betreuungsbedarf ein Grundbetrag und ein erhöhter Betrag eingeführt. Der Betreuungsbetrag steigt von bisher 460 € jährlich auf bis zu 100 € monatlich (Grundbetrag) bzw. 200 € monatlich (erhöhter Betrag, also auf 1.200 € bzw. 2.400 € jährlich). Personen mit einem vergleichsweise geringeren allgemeinen Betreuungsaufwand erhalten den Grundbetrag. Personen mit einem im Verhältnis dazu höheren allgemeinen Betreuungsbedarf bekommen den erhöhten Betrag. Personen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, die einen Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung haben, der nicht das Ausmaß der Pflegestufe I erreicht, können diese Leistungen ab 1. Juli 2008 ebenfalls erhalten. Voraussetzung dazu ist, dass der Medizinische Dienst der Krankenversicherung in seiner Begutachtung als Folge der Krankheit oder Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitäten des täglichen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft zu einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz geführt haben. 31 7.2 Aufgabe und Funktion von Pflegestützpunkten Wer in die Situation kommt, Betreuung und Pflege für einen Angehörigen organisieren zu müssen, stand bisher vor einem großen Berg vieler unbeantworteter Fragen. Auf der Grundlage des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes wurden nach einer Bestimmung des Landes von den Pflege- und Krankenkassen nunmehr wohnortnahe Pflegestützpunkte in allen Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken eingerichtet. Neben den Pflege- und Krankenkassen haben die Kommunen im Rahmen der Altenhilfe und die Sozialhilfeträger im Rahmen der Hilfe zur Pflege, die örtlich tätigen Pflegeeinrichtungen, die Pflegedienste und weitere Kostenträger, wie die privaten Versicherungsunternehmen, die Möglichkeit sich am Pflegestützpunkt zu beteiligen. Auch Selbsthilfegruppen und ehrenamtlich Tätige können einbezogen werden. Auskunft und Beratung der Pflegeversicherten, ein individuelles Fallmanagement und größtmöglicher Service unter einem Dach stehen im Mittelpunkt des Konzepts aller Pflegestützpunkte. Die Stützpunkte sollen gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative oder sonstige medizinische sowie pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsangebote vermitteln und koordinieren. Damit können beispielsweise auch die Inanspruchnahme von Angeboten der offenen Altenhilfe, niedrigschwellige Angebote (z. B. Helferinnenkreise, Betreuungsgruppen) und Termine zu notwendigen ärztlichen Behandlungen von vornherein aufeinander abgestimmt werden. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finden in den Pflegestützpunkten Unterstützung und Hilfestellung – ähnlich wie in einem Bürgerbüro. In einem Pflegestützpunkt können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auch die notwendigen Anträge stellen. Anspruch auf Pflegeberatung/Fallmanagement Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Leistungsspektrums ist im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz ab 1. Januar 2009 für Betroffene und Angehörige ein individueller Anspruch auf Pflegeberatung gesetzlich verankert. Dadurch werden die Pflegekassen verpflichtet, für ihre pflegebedürftigen Versicherten Pflegeberatung (Fallmanagement) anzubieten. Für Versicherte bedeutet dies, auf ein den individuellen Problemlagen entsprechendes Beratungs-, Unterstützungs- und Begleitangebot zurückgreifen zu können. Die Pflegeberaterinnen bzw. Pflegeberater sind im Pflegestützpunkt angesiedelt. Die Pflegekassen setzen für die persönliche Beratung und Betreuung entsprechend qualifiziertes Personal ein, insbesondere Pflegefachkräfte, Sozialversicherungsfachangestellte oder Sozialarbeiter mit der jeweils erforderlichen Zusatzqualifikation. 32 Zu den Aufgaben der Pflegeberater/Fallmanager in den Pflegestützpunkten gehört insbesondere, den Hilfebedarf unter Berücksichtigung der Feststellungen der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung systematisch zu erfassen und zu analysieren. Außerdem gilt es, Betroffene und deren Angehörige - von der Organisation der Pflege, der Vermittlung von Pflegediensten, Haushaltshilfen bis hin zur Auswahl geeigneter Pflegeheime oder von anderen Betreuungseinrichtungen - zu unterstützen. Sie kümmern sich um die Formalien, beraten die Betroffenen und deren Angehörige über Leistungen, erarbeiten auch entscheidungsreife Anträge und leiten diese an die Pflegekasse weiter. Der Pflegeberater kommt auch zu den Betroffenen nach Hause. Die Beratung ist unabhängig und umfassend. Pflegeberater bzw. Fallmanager erstellen gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen und allen anderen an der Pflege Beteiligten einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen. Der Pflegeberater/Fallmanager veranlasst alle für den Versorgungsplan erforderlichen Maßnahmen einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger, begleitet die Umsetzung des Versorgungsplans und macht Vorschläge, wenn sich der Bedarf des Einzelnen verändert. 7.3 „Poolen“ in neuen Wohnformen - mehr Möglichkeiten für Einzelpflegekräfte Das sogenannte „Poolen“ von Leistungsansprüchen, d. h. mehrere Bewohner oder Nachbarn nehmen Leistungen ambulanter Pflegedienste oder von Einzelpflegekräften gemeinsam in Anspruch, soll u. a. die Entwicklung neuer Wohnformen oder Wohn- bzw. Hausgemeinschaften verbessern. Zur flexiblen Nutzung neuer Wohnformen können Sachleistungsansprüche von Versicherten künftig auch gemeinsam mit anderen Leistungsberechtigten in Anspruch genommen werden („Poolen“). Die Ansprüche mehrerer Pflegebedürftiger auf grundpflegerische Leistungen und hauswirtschaftliche Versorgung werden so gebündelt. Aus diesem „Pool“ können dann Betreuungsleistungen bezahlt werden. Beispielsweise kümmert sich eine Pflegekraft um mehrere Pflegebedürftige. Sich ergebende „Effizienzgewinne“ sind für zusätzliche Betreuungsleistungen durch Leistungserbringer (Vertragspartner der Pflegekassen) zu nutzen. Beispielsweise kümmert sich in einem Wohnhaus oder in einer Wohngemeinschaft eine Pflegekraft um mehrere Pflegebedürftige. Das kann für beide Seiten mehr Zeit und mehr Zuwendung bringen. 7.4 Teilstationäre Pflege: Tages- und Nachtpflege In teilstationären Pflegeeinrichtungen werden hilfebedürftige Menschen entweder tagsüber oder während der Nacht von professionellen Pflegekräften betreut. Dadurch können Pflegebedürftige, die in der eigenen Wohnung allein nicht mehr zurechtkommen oder in der Familie nicht (mehr) rund um die Uhr versorgt werden können, trotzdem weiter zu Hause wohnen. Für Angehörige bedeutet die Möglichkeit der Teilzeitpflege außer Haus meist eine große Entlastung. Die teilstationäre Pflege schließt eine Lücke zwischen der ambulanten Betreuung durch Pflegedienste in der eigenen Wohnung und der stationären Pflege im Heim. Durch die Inanspruchnahme von Tagespflegeangeboten kann für viele Pflegebedürftige ein längerer Verbleib in ihrer Häuslichkeit erreicht werden. Gemäß § 41 SGB XI ist die Tagespflege neben der Nachtpflege ein Bestandteil des teilstationären Versorgungsbereichs. Danach haben pflegebedürftige Menschen Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann, oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Vor dem Hintergrund einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung, in der von einer steigenden Nachfrage nach Angeboten für pflegebedürftige Menschen auszugehen ist, wird insbesondere mit Blick auf den Wunsch vieler pflegender Angehörigen, Familie, Beruf und Pflege angemessen zu vereinbaren, der Bereich der Tagespflege an Attraktivität gewinnen. Schließlich eröffnet die Tagespflege pflegenden Angehörigen die nötigen Freiräume und ermöglicht damit in jedem Falle eine punktuelle und damit hilfreiche Entlastung der Pflegepersonen. 33 Die Leistungen der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege) Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurden für die Tages- und Nachtpflege wichtige Verbesserungen eingeführt. Der Sachleistungsanspruch wurde entsprechend dem Anstieg bei den ambulanten Pflegesachleistungen schrittweise erhöht. Pflegeaufwendungen bis € monatlich seit 1.07.2008 ab 1.01.2010 ab 1.01.2012 Pflegestufe I 420,440,450,- Pflegestufe II 980,1.040,1.100,- Pflegestufe III 1.470,1.510,1.550,- Neben dieser allgemeinen Erhöhung der Leistung wird außerdem bei der Kombination von Leistungen der Tages- und Nachtpflege mit ambulanten Sachleistungen und/oder dem Pflegegeld der höchstmögliche Gesamtanspruch auf das 1,5-fache des ab 01.07.2008 neu festgesetzten Leistungsbetrages erhöht. Zwar konnten diese Leistungen auch bisher schon miteinander kombiniert werden. Jedoch galten als Leistungsobergrenze insgesamt jeweils das Pflegegeld oder die Sachleistung in der einfachen Höhe, so dass in der Praxis oftmals zu geringe Leistungen für die Versorgung zu Hause verblieben. Wird also beispielsweise 50 % der Leistung der Tages- und Nachtpflege in Anspruch genommen, besteht künftig daneben noch ein 100-%-iger Anspruch auf Pflegegeld oder eine Pflegesachleistung. Letzterer erhöht sich allerdings nicht, wenn weniger als 50 % der Leistung für die Tages- und Nachtpflege in Anspruch genommen wird. Die Leistungsverbesserungen kommen so der Tages- und Nachtpflege zu Gute. Mit der Reform der Pflegeversicherung wurde es den Pflegeeinrichtungsträgern ferner ermöglicht, mehrere selbständig wirtschaftende Einrichtungen, die örtlich und organisatorisch miteinander verbunden sind, unter einem vertraglichen „Dach“ zu betreiben (z.B. Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes mit einer Tagespflegeeinrichtung). Durch solche Maßnahmen können Synergieeffekte erzielt werden, die letztendlich die wirtschaftliche Erbringung der Dienstleistungen verbessern können und damit dem pflegebedürftigen Menschen zu Gute kommen. 7.4.1 Tagespflege In einer Tagespflegeeinrichtung verbringen Pflegebedürftige bis zu acht Stunden täglich (meist von 8 bis 16 Uhr), wohnen und schlafen jedoch in der eigenen Wohnung oder bei ihren Angehörigen. Ein Fahrdienst holt sie morgens ab und bringt sie nachmittags wieder zurück. Beim Aufstehen und Zubettgehen, während der Nacht und meist auch am Wochenende werden sie zu Hause von ihren Angehörigen oder von ambulanten Betreuern versorgt. Der Zeitraum der Tagesbetreuung kann mit dem Träger individuell abgesprochen werden – also zum Beispiel auch halbtags und je nach Bedarf auch mal einige Stunden länger. 34 Eine Tagesbetreuung kann die Pflege zu Hause wesentlich erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen – zum Beispiel wenn der betreute Mensch stark verwirrt ist, der pflegende Angehörige aber berufstätig ist. Wenn die Tageseinrichtung eine Pflege mit aktivierenden Angeboten praktiziert, ist sie zudem eine wertvolle Ergänzung zur häuslichen Pflege. Allein lebenden älteren Menschen bietet die Tagesbetreuung auch Wege aus einer drohenden Vereinsamung. Die Pflegebedürftigen gehen außer Haus und bekommen dadurch neue Anregungen und Kon- taktmöglichkeiten, können meist auch sportliche oder kulturelle Freizeitangebote nutzen und trainieren ihre noch vorhandenen Fähigkeiten. Die Erfahrung zeigt, dass viele Hilfebedürftige, die sich zu Hause einsam fühlen und Schwierigkeiten haben, sich selbst zu versorgen, durch den regelmäßigen Besuch einer Tagespflegegruppe wieder aufleben und sich ihr Zustand insgesamt verbessert. Tagespflegeplätze werden in speziellen bzw. separaten oder solitären Tagespflegeeinrichtungen, aber auch in Anbindung an ambulante Pflegedienste und in stationären Pflegeeinrichtungen angeboten. Die Angebote der Tagespflege sind von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. In der Regel umfasst das Angebot einer Tageseinrichtung die folgenden Leistungen: • Transport von der Wohnung in die Einrichtung und zurück durch einen Fahrdienst • Einnahme der Mahlzeiten, je nach Dauer der Betreuung vom Frühstück bis zum Nachmittagskaffee • Pflege: je nach Bedarf Hilfe beim Essen, beim Toilettengang oder der Einnahme von Medikamenten; medizinische Behandlung • Therapieangebote: Heilgymnastik, Mobilitätsübungen, Gedächtnistraining, Kontinenztraining • Beschäftigung und Alltagsaktivitäten: Handarbeiten, Malen, Spielen, Singen, Musik hören, lesen oder vorlesen, Spaziergänge und Ausflüge; Teilnahme an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die im Tagesablauf anfallen • Soziale Kontakte und Austausch: Gesprächskreise, psychosoziale Betreuung Tagespflegeangebote im Saarland Nach dem Landespflegeplan des Saarlandes findet Tagespflege im Saarland in speziellen Tagespflegeeinrichtungen mit mindestens vier Plätzen oder auch in besonderen Tagespflegestationen in Anbindung an Vollzeiteinrichtungen statt. Aus organisatorischen und wirtschaftlichen Überlegungen wird im Landespflegeplan zukünftig eine verstärkte Anbindung an ambulante Pflegedienste angestrebt. Im Saarland steht ein entsprechend flächendeckendes Angebot zur Verfügung, der Landespflegeplan des Saarlandes weist 312 Tagespflegeplätze aus. Neue Tagespflegeeinrichtungen werden in den Landespflegeplan aufgenommen, wenn mindestens eine Gruppe für demenzkranke Menschen vorgehalten und ein schlüssiges Marketing-Konzept nachgewiesen wird. Eine erfolgreich arbeitende Tagespflege erfüllt u.a. folgende Bedingungen: • • • Konzeptionelle Einbindung der Tagespflege in das Gemeinwesen Durchführung der Tagespflege als Schwerpunkt- bzw. Kerngeschäft Anpassung der Leistungen der Tagespflege an die besonderen Bedürfnisse der Besucher (Zielgruppenorientierung z.B. Demenzkranke, Besucher mit und ohne gravierenden grundund/oder behandlungspflegerischen Bedarf) 35 • • • • • Sinnvolle Fahrdienstorganisation verbunden mit leistungsgerechten und praxisnahen Fahrtkosten Durchführung von Pflegekursen für pflegende Angehörige, ggf. in Kooperation mit anderen Leistungsanbietern Erkennung und Anzeige präventiver und rehabilitativer Bedarfe Intensive Öffentlichkeitsarbeit (Beratung, Werbemaßnahmen) Enge Abstimmung mit der häuslichen Pflege des Pflegedienstes Vereinzelt mag es zutreffen, dass das Angebot der Tagespflege einen relativ geringen Bekanntheitsgrad hat. Viele Menschen erfahren erst davon, wenn eine unmittelbare Betroffenheit in der Familie vorliegt und somit ein entsprechender persönlicher Bedarf gegeben ist. Betroffene Menschen haben im Saarland die Möglichkeit, sich bei den in den Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken angesiedelten Pflegestützpunkten über das jeweils passende pflegerische Hilfsangebot beraten zu lassen. Stellenwert der Tagespflege Der Stellenwert der Tagespflege wird wachsen. Wenn häusliche Pflege an ihre Grenzen stößt und Angehörige passende Angebote der Entlastung suchen, ist die Tagespflege eine mögliche Alternative, um häusliche Pflege aufrecht zu erhalten. In Zeiten, in denen die Finanzierbarkeit sozialer Leistungen an vielen Stellen zur alleinigen Bedingung ihrer Aufrechterhaltung gemacht wird, hat die Tagespflege einen unverzichtbaren Platz im Rahmen der pflegerischen Angebote. Allerdings müssen, um die Akzeptanz dieses Angebots zu erhöhen, die Rahmenbedingungen verbessert werden. Das Saarland hat – gerade auch mit Blick auf die besondere Situation demenzkranker Menschen und ihrer Angehörigen – im Landespflegeplan entsprechende Weichenstellungen bereits im Jahr 2002 vorgenommen. Danach kann Tagespflege, die über eine reine Verwahrung der pflegebedürftigen Menschen hinausgeht und stationäre Unterbringungen vermeiden soll und der Erhaltung der körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte pflegebedürftiger Menschen zum Ziel hat, nur sinnvoll auf der Grundlage einer besonderen Konzeption durchgefügt werden. Die Notwendigkeit einer Konzeption in dem beschriebenen Sinne gilt insbesondere auch für den Personenkreis der Demenzkranken. Hier sind die angestrebten Erhaltungseffekte wichtig, der Entlastungseffekt für die Angehörigen ist in der Regel erheblich. 7.4.2 Nachtpflege In einer Einrichtung mit Nachtpflege werden Hilfebedürftige vom frühen Abend bis zum Aufstehen am nächsten Morgen betreut. Tagsüber übernehmen die Angehörigen oder ambulante Dienste die Pflege. Nachtpflegeplätze sind sinnvoll für Pflegebedürftige, die nachts sehr unruhig oder ängstlich sind oder die während der Nacht medizinisch versorgt werden müssen. Auch ein Nachtpflegeplatz erleichtert den Angehörigen die häusliche Pflege sehr: Viele Tätigkeiten der Grundpflege (waschen, aus- und anziehen, zu Bett bringen, beim Aufstehen helfen) werden ihnen abgenommen, und sie können ungestört und unbesorgt durchschlafen. Nachtpflegeeinrichtungen sind bisher allerdings selten – das Angebot ist kaum bekannt, die Nachfrage ist geringer als bei Tagespflegeplätzen. Auch bei der Kombination von Leistungen der häuslichen Pflege mit Nachtpflege wird der höchstmögliche Gesamtanspruch auf das 1,5 fache der ab 01.07.2008 neu festgesetzten Leistungsbeträge erhöht. 36 7.5 Kurzzeitpflege Kurzzeitpflege wird außer als Verhinderungspflege insbesondere im Anschluss an eine stationäre Behandlung sowie in sonstigen Krisensituationen in Anspruch genommen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist. Dementsprechend kann sich Kurzzeitpflege nicht auf grundpflegerische und/oder behandlungspflegerische Maßnahmen beschränken, sondern muss wesentlich auf Prävention und Rehabilitation ausgerichtet sein. Nur so kann Kurzzeitpflege als Überleitungspflege mit dazu beitragen, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich zu Hause in der gewohnten Umgebung bleiben können. Die Kurzzeitpflege ist eine vollstationäre Rund-um-die-Uhr-Pflege im Heim, jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum. Sie ist eine wichtige Hilfe in Situationen, in denen die Pflege zu Hause durch ambulante Kräfte oder in der Familie kurzfristig nicht möglich ist, zum Beispiel • wenn die Haupt-Pflegeperson krank wird, dringend Urlaub oder Abstand von der Pflege braucht oder aus anderen Gründen ausfällt, • zur Stabilisierung nach einer schweren Erkrankung des Pflegebedürftigen oder einem Krankenhausaufenthalt, • zur Vorbereitung auf die Übernahme einer häuslichen Pflege, wenn beispielsweise Umbauten in der Wohnung nötig werden. In diesen und ähnlichen Fällen kann für vier Wochen eine vollstationäre Betreuung in einer Kurzzeit-Pflegeeinrichtung in Anspruch genommen werden. Wie bei der teilstationären Pflege sind die Angebote der Kurzzeitpflege sehr unterschiedlich, und bisher leider noch nicht ausreichend (derzeit 362 Plätze). KurzzeitPflegeplätze werden vielfach von Pflegestationen in Heimen angeboten oder sind Sozialstationen angegliedert. Spezielle Kurzzeit-Pflegeheime sind selten. Eine Kurzzeitpflegeeinrichtung sollte möglichst nach einem auf die besonderen Erfordernisse der Rundum-Betreuung während einer begrenzten Zeit zugeschnittenen Pflegekonzept arbeiten. So ist aktivierende und rehabilitierende Pflege besonders wichtig, um nach einer Erkrankung verlorene Kräfte wiederherzustellen. Bei der Auswahl eines Kurzzeitpflegeplatzes ist es darüber hinaus wichtig, welche therapeutischen Angebote und Leistungen die Einrichtung anbietet. Die Pflegebedürftigen sollten auf keinen Fall einfach nur für ein paar Wochen „verwahrt“ werden. Wenn eine Kurzzeitpflege für die Zeit eines Urlaubs während der Schulferien geplant wird, ist es ratsam, sich rechtzeitig vorher um einen Kurzzeit-Pflegeplatz zu kümmern. Eine bereits von der Pflegekasse bezahlte „Verhinderungspflege“ (Vertretung für die Pflege zu Hause) mindert den Anspruch auf vier Wochen Kurzzeitpflege pro Jahr übrigens nicht, wenn die häusliche Pflege kurzzeitig unmöglich ist. 37 Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz werden die Leistungen der Kurzzeitpflege für bis zu 4 Wochen pro Kalenderjahr wie folgt schrittweise angehoben: Pflegeaufwendungen bis € im Jahr seit 1.07.2008 ab 1.01.2010 ab 1.01.2012 Pflegestufe I 1.470,1.510,1.550,- Pflegestufe II 1.470,1.510,1.550,- Pflegestufe III 1.470,1.510,1.550,- 7.6 Verbesserung des Entlassungsmanagements Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus stehen Menschen, die pflegebedürftig sind, oft hilflos vor einer neuen Situation. Künftig soll sich ein Mitarbeiter der Klinik noch während des Krankenhausaufenthalts um einen pflegebedürftigen Menschen kümmern. Durch Entlassungsmanagement sollen Krankenhäuser den nahtlosen Übergang von der Krankenhausbehandlung in die ambulante Versorgung, zur Rehabilitation oder Pflege gewährleisten. Liegt ein Antragsteller im Krankenhaus, in einem Hospiz oder wird er palliativ ambulant versorgt, hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen den Pflegebedürftigen innerhalb einer Woche zu begutachten. Die größte Belastung für Angehörige von Pflegebedürftigen und Betroffene ist weniger die pflegerische Aufgabe, sondern die Vorbereitung und Organisation rund um die plötzlich eingetretene Pflegesituation. Mit der Einführung der Pflegestützpunkte wird es ferner eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme geben. Betroffene erhalten auch durch die individuelle Pflegeberatung umfassende Beratung und Unterstützung in dieser besonderen Lebenssituation. 8. Betreutes Wohnen Wohnen mit Service, Wohnen-Plus oder Betreutes Wohnen – die Bezeichnungen sind vielfältig für eine Wohnform, die in den vergangenen Jahren bei der Nachfrage zunehmendes Interesse erfährt, weil diese Wohnform die Verbindung von selbständigem Wohnen im Alter mit einem Rückgriff auf qualifizierte Hilfsund Betreuungsleistungen herzustellen versucht. Der Begriff ist gesetzlich nicht definiert. In seinem Urteil vom 12.09.2003 definiert der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – 14 S 718/03 – das „Betreute Wohnen“ als eine Wohnform für ältere Menschen, bei der im Interesse der Wahrung einer möglichst lang dauernden eigenständigen Lebensführung neben der alten- und behindertengerechten Wohnung die Sicherung einer Grundversorgung gegeben ist und im Bedarfsfall weitere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können. Diese Begriffsfassung verweist also auf sehr vielfältige und unterschiedliche Wohnformen. So erlaubt diese Wohnform, selbstständig in einer eigenen oder einer angemieteten Wohnung zu leben. Die Wohneinheiten sind altersbzw. behindertengerecht gebaut und sollen insbesondere dem Bedürfnis der Barrierefreiheit sowie eines verlässlichen Betreuungsangebots gerecht werden. Zur Sicherstellung der Service-Leistungen schließt der ältere Mensch mit einem Dienstleister einen Dienstleistungsvertrag über Grund- und Wahlleistungen. Leistungen Es gilt der Grundsatz: soviel Selbstständigkeit wie möglich, soviel Hilfe wie nötig. Der Begriff „Betreutes Wohnen“ hat seit dem Inkrafttreten des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) für ältere Menschen in un- 38 vorteilhaften Wohnverhältnissen besonders an Bedeutung und Interesse gewonnen. So verknüpfen viele Menschen mit diesem Angebot das nochmalige Umziehen in eine Seniorenwohnanlage mit individuell zugeschnittenem Betreuungsservice. Die Struktur der Grund- und Wahlleistungen unterscheidet das Betreute Wohnen von der Vollversorgung eines Heims. Das „Selbständig-Wohnen-Bleiben-Können“ und die Wahlfreiheit bei den Dienstleistungen sind wesentliche Gründe für die umfängliche Nachfrage nach Angeboten des Betreuten Wohnens. Diese Tatsache allerdings sollte für Anbieter zukünftig ein wichtiges Motiv sein, eine Zertifizierung des Betreuten Wohnens sicherzustellen. Der Grundservice, für den eine Betreuungspauschale erhoben wird, soll Entlastung und Sicherheit im Alltag bieten und kann folgende Leistungen umfassen: • persönliche Betreuung und Beratung durch einen Ansprechpartner • Organisation von Hilfsdiensten • haustechnischer Service • Angebot eines Notfall- bzw. Notrufsystems Außerdem werden: • • • • • • können Wahlleistungen in Anspruch genommen werden, die gesondert berechnet Essensversorgung hauswirtschaftliche Dienste pflegerische Hilfen Krankenpflege Wäschedienst Fahr- und Begleitdienst DIN geprüft Das Betreute Wohnen hat sich als zukunftsweisendes Wohnkonzept sowohl für ältere als auch behinderte Menschen etabliert, das sich in Bezug auf die angebotenen Hilfeleistungen und deren Inanspruchnahme durch eine größtmögliche Wahlfreiheit auszeichnet. Für die Interessenten solcher Wohnformen ist es bisher kaum möglich, die vielfältige Ausgestaltung solcher Wohnformen zu beurteilen, da es an allgemein gültigen Mindestanforderungen an Dienstleistungen des Betreuten Wohnens fehlt. Im September 2006 hat der Normenausschuss „Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen“ die DIN 77800 „Qualitätsanforderungen an Anbieter der Wohnform Betreutes Wohnen für ältere Menschen“ veröffentlicht. Diese Norm stellt eine Zertifizierungsgrundlage hinsichtlich der Anforderungen an die Ausgestaltung solcher Wohnformen dar. Dabei stehen nicht nur bauliche Anforderungen als Schwerpunkt im Vordergrund, die DIN benennt auch die zur Umsetzung dieser Wohnform erforderlichen Dienstleistungsangebote. Insoweit beinhaltet diese Norm neben den baulichen Anforderungen, wie bauliche Gestaltung der gesamten Wohnanlage als auch der einzelnen Wohnungen, auch die zu stellenden Anforderungen an die notwendigen Grundleistungen und Wahlleistungen, sowie das für das Wohnen und die Dienstleistungen zu entrichtende Entgelt. 39 Wenn auch diese DIN-Vorschrift bisher nicht als allgemein gültig erklärt worden ist, stellt sie für interessierte Senioren und Behinderte eine geeignete Orientierungshilfe dar; zumal die bisher in den einzelnen Bundesländern am Markt befindlichen Qualitätssiegel doch von sehr unterschiedlichen Standards des Betreuten Wohnens ausgehen. Bezug zu heimgesetzlichen Regelungen Das Betreute Wohnen stellt im Unterschied zu den Einrichtungen nach dem Heimgesetz ab auf Miete oder Eigentum an einer selbständigen Wohnung einschließlich Küche und Sanitäreinrichtung; auf einen Betreuungsvertrag, der Service in Form von allgemeinen Betreuungsleistungen wie Notrufdienste oder Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistungen umfassen kann, während ansonsten die Inanspruchnahme weiterer Hilfen - insbesondere pflegerischer Hilfen - nicht zwingend an diesen Vertrag gekoppelt sein darf. Es steht Vermieter oder Träger frei, entsprechende Leistungen vorzuhalten bzw. anzubieten. Dabei darf aber keine Verpflichtung bestehen, diese Leistungen bei Bedarf zwingend von dem Träger oder Vermieter anzunehmen. Nach dem derzeit geltenden Heimgesetz des Bundes fällt das „echte“ Betreute Wohnen, bei dem der Vermieter lediglich allgemeine Betreuungsdienste (z. B. Notrufdienste) oder die Vermittlung von Pflegediensten anbietet und das dafür zu entrichtende Entgelt im Verhältnis zur Miete von untergeordneter Bedeutung ist, nicht unter den Anwendungsbereich des Gesetzes. Das Gesetz ist jedoch anzuwenden, wenn die Mieter vertraglich verpflichtet sind, Verpflegung und weitergehende Betreuungsleistungen vom Vermieter oder von bestimmten Anbietern anzunehmen. Im Interesse eines ausreichenden Verbraucherschutzes ist im Landesheimgesetz Saarland eine Anzeigepflicht und eine Informationsverpflichtung für Träger von Einrichtungen des „Betreuten Wohnens“, Wohngemeinschaften, Wohngruppen und anderen gemeinschaftlichen Wohnformen für ältere Menschen auch dann vorgesehen, wenn die Bewohner lediglich dazu verpflichtet sind, allgemeine Betreuungsleistungen, wie Notrufdienste, Informations- und Beratungsangebote, Vermittlung von Dienst-, Betreuungs- und Pflegeleistungen, von Trägern oder von bestimmten Anbietern anzunehmen. Mit dieser Erweiterung des Anwendungsbereichs des Heimrechts wird eine Stärkung des Verbraucherschutzes in diesen Einrichtungen verbunden sein. Die anlassbezogene, heimaufsichtsrechtliche Überwachung wird sich dabei auf die Einhaltung der zwingend vertraglich vereinbarten Leistungen (hier: allgemeine Betreuungsleistungen) beziehen. Die landesrechtlichen Regelungen werden aber keine strukturellen Vorgaben in personeller, baulicher oder betrieblicher Hinsicht machen. Insoweit finden nur bestimmte Regelungen auf diese betreuten Wohnformen Anwendung. Erfüllen betreute Wohnanlagen, Wohngemeinschaften, Wohngruppen und andere gemeinschaftliche Wohnformen die vollständigen Anwendungsvoraussetzungen, wie sie für Pflegeeinrichtungen für ältere oder behinderte Menschen gelten, finden die Bestimmungen des Landesheimgesetzes vollständige Anwendung, da in diesen Fällen die Bewohner der genannten Betreuungs- und Wohnformen im gleichen umfassenden Abhängigkeitsverhältnis zum Träger, Vermieter oder des Dienstleistungsanbieters stehen. Problematik 40 Die Kosten bzw. die Preise einschließlich des Service liegen insbesondere in neu gebauten Einrichtungen sehr hoch. Die Erwartungen werden oftmals nicht erfüllt, weil heimaufsichtsrechtliche Bedingungen zu Umgehungsformen führen, die die gewünschte unkomplizierte Versorgung auch im Fall der Pflegebedürftigkeit nicht sicherstellen Der Mehrwert erschließt sich für den Einzelnen nicht, da das Wohneigentum im Saarland verbreitet ist und bei Aufgabe der eigenen Wohnung das neue Angebot in keinem Verhältnis steht Gut genutzt sind lediglich die Einrichtungen in Anbindung an ein Pflegeheim, weil sie finanziell und versorgungstechnisch günstig zu betreiben sind. Allerdings sind sie von einem Heim nicht immer leicht zu unterscheiden 9. Wohnen in stationären Einrichtungen der Seniorenhilfe Stationäre Einrichtungen der Seniorenhilfe dienen nach § 1 des Landesheimgesetzes dem Zweck, ältere Menschen oder pflegebedürftige Menschen aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie Betreuungs-, Pflege- und Verpflegungsleistungen zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten. Die wesentlichen Gründe für einen Heimeintritt sind gesundheitliche Gründe, so zum Beispiel dementielle Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium, ein defizitäres soziales Hilfenetzwerk, fehlende familiäre Unterstützung aufgrund des Verlustes des Ehepartners, des Wegzugs der Kinder, Kinderlosigkeit oder eine ungeeignete, nicht mehr zufriedenstellende Wohnsituation. Das Eintrittsalter liegt heute häufig über 80 Jahren. Kennzeichnend für die Pflegesituation sind erhebliche Einschränkungen bei den alltäglichen Verrichtungen, eine deutliche Zunahme der Verbreitung von Krankheiten und Behinderungen und insbesondere ein gehäuftes Auftreten gerontopsychiatrischer Veränderungen. Die Betreuung älterer Menschen in Heimen ist unverzichtbar, weil es immer wieder Lebenssituationen gibt, in denen eine dichte und intensive Betreuung erforderlich ist. Daher, und weil sowohl Bewohner als auch Pflegekräfte in Heimen mit vielfältigen, aus individuell sehr unterschiedlichen Lebenslagen resultierenden Schwierigkeiten konfrontiert sind, können die Leistungen, die in Heimen erbracht werden, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Pflege–Weiterentwicklungsgesetz hat für den Bereich der stationären Pflege Leistungsverbesserungen in der Pflegestufe III vorgesehen. Die Leistungen der Pflegeversicherung stellen sich demnach wie folgt dar: Pflegestufe I II III III (Härtefall) bisher 1.023 € 1.279 € 1.432 € 1.688 € ab 1.07 2008 unverändert unverändert 1.470 € 1.750 € ab 1.01.2010 unverändert unverändert 1.510 € 1.825 € ab 1.01.2012 unverändert unverändert 1.550 € 1.918 € Durch die Leistungen der Pflegeversicherung hat sich die Situation der pflegebedürftigen Menschen erheblich verbessert, dennoch ist sie nur eine „Teilkaskoversicherung“. Sie kann aufgrund des derzeitigen Finanzierungssystems nur einen Teil der anfallenden Kosten übernehmen. Diese setzen sich aus den pflegebedingten Kosten, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und den Investitionskosten zusammen. 41 9.1 Bewohnerstruktur in saarländischen Heimen nach Altersstruktur, Geschlecht, Herkunft Mit rund 220.000 Personen lebt der überwiegende Teil (= 97,68%) der älteren Menschen im Saarland in Privathaushalten (=> Landesseniorenplan, 1. Teil, S. 39 f). Insgesamt 8.723 ältere Menschen ab 65 Jahren (= 3,87%) leben in Heimen, davon stammen 92,65 % aus dem Saarland, 4,10 % aus Rheinland-Pfalz, 2,03% aus anderen Bundesländern und 1,22 % aus dem Ausland. (Erhebung des MJAGS, März 2006) Herkunftsort Bewohner > 65 Jahre untergebracht im Landkreis Merzig-Wadern Landkreis Neunkirchen Landkreis Saarlouis Landkreis Saarpfalz-Kreis Landkreis St.Wendel Stadt Saarbrücken (SB) Regionalverband (SB) SAARLAND insgesamt im Saarland Saarland andere Bundesländer Rheinland-Pfalz Ausland w m Su. w m Su. % w m Su. % w m Su. % w m Su. % 795 298 1.093 662 259 921 84,26 39 18 57 5,22 21 7 28 2,56 73 14 87 7,96 953 238 1.191 911 216 1.127 94,63 38 14 52 4,37 4 8 12 1,01 0 0 0 0,00 1.144 306 1.450 1.095 301 1.396 96,28 15 1 16 1,10 28 3 31 2,14 6 1 7 0,48 865 242 1.107 732 198 930 84,01 101 38 139 12,56 32 6 38 3,43 0 0 0 0,00 556 177 733 498 153 651 88,81 48 21 69 9,41 8 3 11 1,50 2 0 2 0,27 1.109 304 1.413 1.076 296 1.372 97,10 8 2 10 0,71 20 6 26 1,84 5 0 5 0,35 1.377 359 1.736 1.340 345 1.685 97,06 8 7 15 0,86 25 6 31 1,79 4 1 5 0,29 6.799 1.924 8.723 6.314 1.768 8.082 92,65 257 101 358 4,10 138 39 177 2,03 90 16 106 1,22 Anzahl der Träger (freigemeinnützig, öffentlich, privat) stationärer Einrichtungen im Saarland Heimverzeichnis (Stand: 20.5.2008) Landkreis Merzig-Wadern Plätze im / in der Anzahl Plätze AltenAlten KurzEinrichtungsart der EininsgePflegeTages- NachtzeitHospiz richtungen samt wohnheim pflege Pflege heim heim pflege freigemeinnützig gewerblich Summe Landkreis Neunkirchen freigemeinnützig gewerblich Summe Landkreis Saarlouis freigemeinnützig gewerblich Summe Landkreis St.Wendel freigemeinnützig gewerblich Summe Regionalverband Saarbrücken freigemeinnützig gewerblich Summe freigemeinnützig Saarpfalz-Kreis gewerblich Summe freigemeinnützig 42 S A A R L A N D gewerblich Summe 13 9 1.034 560 0 0 16 12 950 527 38 8 30 13 0 0 0 0 22 16 4 1.594 1.676 143 0 0 0 28 30 12 1.477 1.581 119 46 37 0 43 26 10 0 2 2 0 0 0 20 16 8 1.819 1.337 639 0 0 0 42 32 5 1.700 1.164 603 37 71 0 36 70 31 4 0 0 0 0 0 24 8 5 1.976 626 375 0 0 0 37 0 3 1.767 505 372 71 63 0 101 50 0 0 0 0 0 8 0 13 32 11 1.001 3.114 1.073 0 343 0 3 26 7 877 2.563 1.051 63 111 0 50 55 15 0 0 0 8 16 0 43 12 5 4.187 1.311 320 343 0 0 33 34 12 3.614 1.186 259 111 50 14 70 41 35 0 0 0 16 0 0 17 97 42 1.631 9.098 3.110 0 343 0 46 138 51 1.445 7.949 2.931 64 370 22 76 272 104 0 2 2 0 24 0 139 12.208 343 189 10.880 392 376 4 24 In den insgesamt 139 saarländischen stationären Pflegeeinrichtungen (97 in freigemeinnütziger und 42 in gewerblicher Trägerschaft) leben nach der Pflegestatistik (2005) 31,8 % der pflegebedürftigen Menschen (dies entspricht 8.920 Menschen, davon befanden sich 3.552 in Pflegestufe I, 3.623 in Pflegestufe II und 1.359 in Pflegestufe III). HeimbewohnerInnen zum Stichtag: 1. März 2006 %-Anteil an den Gesamtbewohnern Altersstufe 18-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 weiblich 9 21 109 139 124 128 männlich 14 37 146 218 137 160 insgesamt 23 58 255 357 261 288 bis unter 65 Jahre 530 712 1.242 12,46 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 >90 307 394 918 1.804 1.603 1.773 356 341 359 388 266 214 663 735 1.277 2.192 1.869 1.987 6,65 7,38 12,81 22,00 18,76 19,94 65 Jahre und älter 6.799 1.924 8.723 87,54 Bewohner insgesamt 7.329 2.636 9.965 100,00 0,23 0,58 2,56 3,58 2,62 2,89 Auf der Grundlage der Erhebung (Stand: März 2006) des Ministeriums für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales ist festzustellen, dass von 9.965 zu diesem Zeitpunkt in saarländischen Heimen lebenden Personen 8.723 65 Jahre und älter waren, was einem Prozentanteil von 87,54 % entspricht. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass im Personenkreis der über 65-Jährigen rd. 60,7 % (6.048 Personen) bereits das 80. Lebensjahr überschritten hatten. Dies legt nahe, dass stationäre Einrichtungen der Seniorenhilfe erst in höherem Alter - und meist bei fortgeschrittenem Pflegebedarf - das Mittel der Wahl sind. Zugleich verdeutlichen die Zahlen, dass von einer homogenen Altersgruppe der über 65-Jährigen nicht auszugehen ist, das Heim zu den wenig bevorzugten Wohnformen im Alter gehört, eine Strategie, die infolge der demografischen Veränderungen auf Problemlösungen durch den Bau von Heimen setzt, weder die Bedürfnisse älterer Menschen noch die Notwendigkeiten trifft. Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung wird der Platzbedarf nach dem Landespflegeplan (Bedarf nach dem Stand vom 31.12.2007 = 7.783 Pflegeplätze) bis zum Jahr 2020 zwar um weitere 400 Plätze ansteigen. Alleine daraus ergibt sich jedoch kein weiterer planerischer Handlungsbedarf, weil tatsächlich bereits über 11.000 geeignete Pflegeplätze in saarländischen Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. 43 9.2 Bauliche Anforderungen an stationäre Einrichtungen Die baulichen Anforderungen an stationäre Einrichtungen richten sich grundsätzlich nach dem allgemeinen Baurecht des Landes. In den Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime (auch Kurzzeitpflege) und Wohnheime für Behinderte (HeimR) vom 11. Februar 2000 werden spezielle bauliche Anforderungen für die genannten Einrichtungen verlangt, z. B. für Treppen und Flure, für den Brandschutz, für Aufzugsanlagen und Sanitäreinrichtungen. Darüber hinaus sind die nach dem Landesheimgesetz zwingend vorgeschriebenen baulichen Mindestanforderungen für die Räume, insbesondere die Wohn-, Aufenthalts-, Therapie- und Wirtschaftsräume sowie die Verkehrsflächen, sanitären Anlagen und die technischen Einrichtungen einzuhalten. Das Nähere hierzu wird in einer Rechtsverordnung geregelt. Dabei werden die baulichen Anforderungen so ausgestaltet, dass sie einerseits den Anforderungen an die Qualität des Wohnens, der Betreuung und Pflege älterer Menschen sowie andererseits den Anforderungen an die Qualität des Wohnens und der individuellen Förderung und Hilfe für Menschen mit Behinderung Rechnung tragen. Das Land hat mit dem Landespflegeplan insbesondere in baulicher Hinsicht Anforderungen an die Qualität für stationäre Pflegeeinrichtungen gestellt, um die Voraussetzungen für die Durchführung einer zukunftsorientierten Pflege zu schaffen – nämlich: • • • • • • Mindestens 50 % der Plätze in Einzelzimmern Eigener Sanitärraum in jedem Pflegezimmer Allgemeine Barrierefreiheit in und um das Gebäude Rollstuhlgerechte Ausstattung von mindestens 25 Prozent der Pflegeplätze Verbessertes Angebot an multifunktionalen Gemeinschafts- und Therapieräumen Dementengerechte Gestaltung der Pflegeeinrichtung zur besseren Betreuung und Anleitung betroffener BewohnerInnen. 9.3 Landesheimgesetz sichert Rechte der Heimbewohner Öffentliche Fürsorge bei der Erbringung stationärer Pflege und der Betreuung älterer Menschen muss sich daran messen lassen, inwieweit aufsichtsrechtliche Regelungen den genannten Aspekten, insbesondere unter Wahrung der Menschenwürde und der Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, Rechnung tragen. Das Einfordern dieser Interessen und Bedürfnisse wird gerade für ältere Menschen mit zunehmendem Alter bei gleichzeitig steigender Multimorbidität immer schwieriger. Etwa für die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner ist dies sogar unmöglich, wenn man Schätzungen zu Grunde legt, die davon ausgehen, dass bereits heute rund die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen an dementiellen Erkrankungen leiden, zumindest aber von diesen Erkrankungen akut bedroht sind. Dies hat zur Folge, dass in Zukunft immer mehr ältere Menschen zur Wahrung ihrer Rechte in stationären Einrichtungen auf staatliche Fürsorge und damit auf heimaufsichtsrechtliche Regelungen auf Grundlage des Heimgesetzes für den Betrieb dieser Einrichtungen angewiesen sind. Heimmitwirkung 44 Das geltende Heimgesetz hat zum Ziel, die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen zu schützen. Dazu gehört u. a. auch, die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner zu wahren und soweit als mög- lich zu fördern. In diesem Zusammenhang wird die Sicherung der Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in Angelegenheiten des Heimbetriebs verbindlich vorgegeben. Dadurch ist den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Mitgestaltungsrecht in den Angelegenheiten eingeräumt, die ihre individuellen Lebensverhältnisse im Heim berühren. Die Mitwirkung erstreckt sich auf die Unterkunft, die Aufenthaltsbedingungen, die Verpflegung und Freizeitgestaltung, und bezieht sich auch auf die Sicherung einer angemessenen Qualität der Betreuung im Heim. Die Mitwirkung erfolgt grundsätzlich durch einen von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu wählenden Heimbeirat. Für die Zeit, in der im Heim ein Heimbeirat nicht gebildet werden kann, wird die Mitwirkung durch einen von der Heimaufsicht bestellten Heimfürsprecher wahrgenommen. In 136 der insgesamt 139 saarländischen Heime müssen Heimbeiräte gewählt werden. Eine Erhebung zum Stichtag 31. Dezember 2007 ergab, dass in 92 Heimen ein Heimbeirat nach dem bisherigen Heimrecht des Bundes gebildet werden konnte. Die Heimaufsicht hat für insgesamt 44 Einrichtungen Heimfürsprecher bestellt. Anzahl der Heime Insgesamt (Stand: 12/2007) Anzahl der Heime, für die ein Heimbeirat rechtlich vorgesehen ist Anzahl der Heime mit gewählten Heimbeiräten Anzahl der Heime mit einem Ersatzgremium an Stelle des Heimbeirates Anzahl der Heime mit Heimfürsprechern 139 136 92 0 44 Das Landesheimgesetz erweitert die Möglichkeiten der Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen. Dies wird erreicht durch die Einführung eines Wahlrechts der Bewohnerinnen und Bewohner über die jeweilige Mitwirkungsform (Bewohnervertretung, Bewohnerversammlung oder externer Bewohnerbeirat). Darüber hinaus soll das Verfahren zur Wahl einer Bewohnervertretung durch entsprechende Regelungen in einer Verordnung zum Landesheimgesetz wesentlich vereinfacht werden. 10. Saarländische Qualitätsoffensive zur Verbesserung des Verbraucherschutzes Pflegequalität, Qualitätssicherung sowie Maßstäbe und Grundsätze zu ihrer Weiterentwicklung, einschließlich der Verfahren zur Durchführung von Pflegequalitätsprüfungen, sind im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz geregelt. Kontrollfunktionen werden von Heimaufsicht und den Medizinischen Diensten der Krankenkassen übernommen, hinzukommen können Qualitätsüberprüfungen durch Zertifizierungsunternehmen. Auch kommt das Land durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen auf dem Gebiet der Sicherung und Steigerung der Pflegequalität seiner Verantwortung nach. So wurde im Saarland zur Unterstützung und Intensivierung der gesetzlichen Qualitätsbemühungen auf Initiative der Landesregierung und unter Mitwirkung der Landesverbände der Pflegekassen sowie der Saarländischen Pflegegesellschaft die Kampagne „Qualitätsoffensive – Pflege“ im April 2001 gestartet. Unter dem Motto „Pflegequalität stärken – Menschen in den Mittelpunkt“ soll sich das Qualitätsbewusstsein aller an der Pflege beteiligten Menschen und Organisationen im täglichen Tun widerspiegeln. Die Saarländische Qualitätsoffensive besteht im Wesentlichen aus folgenden Elementen: - Die Selbstverpflichtung der Einrichtungen für mehr Qualität: Am 6. Dezember 2001 wurden im Saarland die Weichen für mehr Qualität in den Altenheimen gestellt. Erstmalig in Deutschland verpflichteten sich die Pflegeeinrichtungen, die Pflegekassen, die Gebietskörperschaften, der Medizinische Dienst der Krankenkassen und das Sozialministerium einheitliche Qualitätsstandards einzuführen. 45 - Mehr Information für die Kunden: Verbesserung der Information über Pflegedienste und -einrichtungen sowie Schaffung eines flächendekkenden Beratungsangebots zur Information speziell für ältere Menschen und ihre Angehörigen. - Neuorganisation der Altenpflege- und Altenpflegehilfeausbildung: Im Vorgriff auf das Bundesaltenpflegegesetz wurde die Berufsausbildung in der Altenpflege und Altenhilfe im Saarland bereits im Jahr 2002 modernisiert. Die damit verbundene Verwirklichung höherer Qualifizierungsstandards vor allem in der praktischen Ausbildung hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, die Pflegequalität im Interesse aller pflegebedürftigen Menschen und aller am Pflegeprozess Beteiligten nachhaltig zu verbessern und die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern. - Entwicklung des Pflegequalitätssiegels: "Das Saarländische Plus“: Dieses Pflegesiegel soll dazu beitragen, diejenigen Einrichtungen im Saarland hervorzuheben, die mit ihren Leistungen nicht nur den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sondern auch nachweisen können, dass Transparenz und die Gestaltung des sozialen Lebens einen besonderen Schwerpunkt bilden. Pflegeheime der Zukunft – „gläserne Heime“ Ausgehend von der saarländischen Qualitätsoffensive umfassen die Anforderungen an die Qualität stationärer Pflegeeinrichtungen folgende allgemeingültige Zielsetzungen: • hinreichende Orientierung an den Bedürfnissen und Erwartungen der Bewohner, • eine bessere Mitarbeiterzufriedenheit, • eine angemessene Einbindung der Pflegeeinrichtungen in das Gemeinwesen und • eine nachhaltige Öffnung und Transparenz der Pflegeeinrichtungen. Die bewohnerbezogene Orientierung erfordert, dass pflegebedürftige alte Menschen in der Einrichtung Bedingungen vorfinden, die dazu befähigen, trotz vorhandener Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Pflege sollte sich nicht nur auf die primären körperlichen Grundbedürfnisse erstrecken, sondern die Förderung des psychischen und sozialen Wohlbefindens und den Erhalt der Persönlichkeit des Pflegebedürftigen mit einschließen. Insofern orientiert sich die Pflege an den individuellen Erwartungen und Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der BewohnerInnen. Neben den Pflegebedürftigen selbst tragen auch die Angehörigen und Freunde im unmittelbaren sozialen Umfeld Verantwortung. Die Mitarbeiterorientierung sollte von regelmäßigen Mitarbeitergesprächen und Mitarbeiterbefragungen geprägt sein. Hieraus sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit abgeleitet werden. Den Mitarbeiterwünschen sollte bei der Dienstplangestaltung, sofern sachlich und fachlich möglich, Rechnung getragen werden. Außerdem sollten die MitarbeiterInnen bei der konzeptionellen Weiterentwicklung, bei der konkreten Ausgestaltung des Arbeitsumfeldes, bei der Überprüfung von Arbeitsprozessen und der Entwicklung von Standards mit einbezogen werden. Die Einbindung in das Gemeinwesen sowie die Öffnung und Transparenz der Pflegeeinrichtungen sind weitere Schwerpunktthemen der Qualitätsoffensive Pflege. 46 Das Heim sollte einen Plan zur Verbesserung der Einbindung in das örtliche Gemeinwesen und zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements erstellen. Es sollte geeignete öffentliche Veranstaltungen durch- führen und dabei offensiv über die Pflegekonzeption, die Arbeit im Pflegealltag und die sonstigen regelmäßigen Aktivitäten unter Einbindung der Bewohner informieren. Insgesamt sollte es den Prinzipien einer „gläsernen Einrichtung“ folgen, die um größtmögliche Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit bemüht ist. Öffnung und Transparenz der Pflegeeinrichtungen kann erreicht werden durch: • • • • eine übersichtliche und aussagekräftige schriftliche Kundeninformation zu den Leistungen und Preisen der Pflegeeinrichtungen, den regelmäßigen schriftlichen Abschluss eines Heimvertrages, die aktive Förderung der Mitwirkung des Heimbeirates und ehrenamtlicher HelferInnen, die Einbeziehung der Angehörigen in die Pflege und die soziale Betreuung. Stärkung der Transparenz Eine stärkere Transparenz spielt in Bezug auf die in der Einrichtung vorgehaltenen Leistungen, die Qualität dieser Leistungen und die Angemessenheit der zu entrichtenden Entgelte für die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sowie deren Angehörige eine immer wichtigere Rolle. Zur Gewährleistung der Transparenz des Leistungsangebots und der Qualität dieser Leistungen ist die Veröffentlichung von aufsichtsrechtlich festgestellten schwerwiegenden Mängeln beim Betrieb von stationären Einrichtungen ein geeignetes Mittel, das konsequent ergriffen werden sollte. Daher erhält die Förderung von Transparenz und Vergleichbarkeit der Leistungen im Landesheimgesetz Saarland einen zentralen Stellenwert. Saarländisches Pflegesiegel Die Einführung des saarländischen Pflegequalitätssiegels ist Bestandteil der saarländischen Qualitätsoffensive Pflege. Diese verfolgt das Ziel, die Betreuungs- und Pflegequalität für Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen durch nachhaltige Qualitätssicherung zu steigern, um damit für höheren Verbraucherschutz zu sorgen und Angehörigen größtmögliche Transparenz über Qualität sowie Leistungsangebot der stationären Altenhilfeeinrichtungen im Saarland zu bieten. „Freiwillige Internetbasierte Qualitätsberichterstattung“ Die Saarländische Pflegegesellschaft und das Saarland, vertreten durch den Minister für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales, haben dazu eine Vereinbarung über die Schaffung von Transparenz in den Einrichtungen der stationären Altenhilfe unterzeichnet. Zentraler Bestandteil dieser vertraglich manifestierten Transparenz-Offensive ist die von der Saarländischen Pflegegesellschaft betriebene „Freiwillige Internetbasierte Qualitätsberichterstattung“, deren Start im Oktober 2008 erfolgt ist und in Kooperation mit dem Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales betrieben wird. Auf dieser Grundlage sind alle stationären Altenhilfeeinrichtungen im Saarland aufgefordert, ihre freiwilligen Qualitätsberichte nach dem von der Pflegegesellschaft in Abstimmung mit dem Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales konzipierten einheitlichen Muster auf der Internet-Plattform zu veröffentlichen. Die freiwillige Qualitätsberichterstattung der Pflegeeinrichtung ist dabei keine „reine Selbstdarstellung“ der Träger. Die eingestellten Informationen unterliegen vielmehr einer vorhergehenden heimaufsichtsrechtlichen Prüfung. 47 Bessere Vergleichbarkeit von Zertifizierungsverfahren Zusätzlich hat das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales gemeinsam mit der Saarländischen Pflegegesellschaft eine Möglichkeit herbeigeführt, um im Sinne eines höheren Verbraucherschutzes eine bessere Vergleichbarkeit bestehender und in Einrichtungen der stationären Altenhilfe im Saarland eingesetzter Zertifizierungsverfahren sicherzustellen. Hierzu hat sich das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales mit den Qualitätsmangementbeauftragten der Träger der Pflegeeinrichtungen ebenso wie mit der KTQ-Gesellschaft2) darauf verständigt, die bisher im Saarland eingesetzten Zertifizierungsverfahren (AWO ISO 9000, bpa-Qualitätssiegel, Caritas Qualitätskatalog für katholische Einrichtungen der stationären Altenhilfe, Diakonie-Siegel, DPWV-TQP-Verfahren) sowie den „KTQ-Katalog“ jeweils um die landeseigenen Prüfkriterien nach dem „Saarländischen Plus“ zu erweitern. Dazu gehören Kriterien • für eine „Bewohnerorientierte Gestaltung des sozialen Lebens“, • für die „Gestaltung der Speiseräume“, • für „Esskultur“, • für „Service und Bedienung“, • für „Transparenz/Informationswesen“, • für „Einbindung in das Gemeinwesen“. Einrichtungen der stationären Seniorenhilfe, die zukünftig ein Zertifizierungsverfahren anwenden, das die für das „Saarländische Pflegequalitätssiegel“ erforderlichen Qualitätsmerkmale beinhaltet, erhalten vom Land eine Förderung sowie im Falle erfolgreicher Zertifizierung das Saarländische Pflegesiegel: Saarländisches Plus. Damit engagieren sich stationäre Einrichtungen gemeinsam mit der Saarländischen Pflegegesellschaft und dem Saarland für höhere Betreuungs- und Pflegequalität sowie für mehr Transparenz im Land – im Interesse eines umfassenden Verbraucherschutzes. Handlungsempfehlungen Für ‚Wohnen im Alter’ gibt es keine vorgefertigten Rezepte. Wie alte Menschen leben wollen, ist von der individuellen Situation abhängig. In Zukunft muss es allerdings unter dem Aspekt weniger umfassend vorhandener Familienhilfe darum gehen, Dienstleistungen für ältere Menschen auf Fragen der Gesundheit, der Sicherung sozialer Teilhabe sowie ausdrücklich auch auf Fragen der Wohnraumgestaltung zu konzentrieren. Sowohl zur Sicherung der eigenen Häuslichkeit, bei der Auswahl für den auf die individuelle Situation passenden Hilfe-Mix, aber auch bei der Verwirklichung alternativer Wohnraumlösungen fürs Alter haben Kommunen eine Schlüsselrolle bei der Bedarfsanalyse, der Koordinierung der Beratungsangebote und der Ingangsetzung von Kooperationsprozessen, um z. B. im Rahmen von Wohnkonferenzen optimale Umsetzungsstrategien für die jeweiligen Bedarfslagen in der Kommune herbeizuführen. > Gefragt ist das synergetische Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure, wie z.B. Wohnungswirtschaft, Architekten, Bankenwesen, Wohlfahrtspflege, Handwerk, Verbraucherschutzorganisationen und Seniorenbeiräte. > Gefragt ist der Auf- bzw. Ausbau kommunaler Informations- und Aktionsnetzwerke für Handwerksbetriebe, Hochschulen, Seniorenbeiräte und Bauplanung zur Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit von Altenhilfe, Handwerk, Wohnungsunternehmen, Banken/Sparkas- 48 2) Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen. KTQ ist ein Zusammenschluss aller Krankenkassen sowie der Bundesärztekammer mit dem Ziel, die Qualität in den Einrichtungen zu verbessern. > sen, zur (Multiplikatoren-)Schulung und Heranführung an das Thema „praktisch und sicher Wohnen im Alter“, zur Verbesserung der Wohnbedingungen älterer Menschen insbesondere in benachteiligten Gebieten. Neben älteren Menschen, denen ihr Ruhestandseinkommen die Deckung der Kosten für Service-Wohnen gestattet, wird ein erheblicher Teil der älteren Bevölkerung von sinkenden Alterseinkommen und steigenden Wohnkosten insbesondere bei der 2. Miete, den Neben-, Betriebs-, und Energiekosten, betroffen und auf die Aufrechterhaltung eines preiswerten Wohnungsbestandes in den Kommunen angewiesen sein. Hierauf sollten sich im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge für das Wohnen im Alter vor allem kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen einstellen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass kleine, preiswerte und seniorengerechte Wohnungen langfristig gute Vermarktungschancen haben. (Perspektiven 2035 – Wohnen im Alter in Deutschland, Untersuchung im Auftrag der focushabitat – Lösungsplattform für die Wohnungswirtschaft - durchgeführt vom Eduard Pestel Institut für Systemforschung e.V., April 2007; Möhrke, Stefan: Soziales Management in der Wohnungswirtschaft, in: Deutsche Zeitschrift für Soziale Arbeit/Blätter der Wohlfahrtspflege 1/2007, S. 3 – 6) > Erforderlich ist die verstärkte Schaffung von kommunalen Kooperationsverbünden durch Verzahnung von Wohnungswirtschaft und Sozialer Arbeit, die Mieter und Bürger/innen in wesentliche Entscheidungsprozesse bei der Gestaltung ihrer persönlichen Wohnsituation einbinden und gemeinsam mit ihnen Nachbarschafts- und Selbsthilfepotenziale etablieren bzw. bedarfsgerecht weiterentwickeln. (Klikar, Clemens; Ruhnke, Dieter: Bauen, Wohnen, Soziale Arbeit, in: Deutsche Zeitschrift für Soziale Arbeit/Blätter der Wohlfahrtspflege 1/2007, S. 7 – 11) > Zur Entstehung und Verbreitung alternativer Wohnformen sollte eine kommunale Steuerung erfolgen. Dazu können kommunale Bauplanungsämter, Seniorenhilfe, Seniorenbüros und Seniorenbeiräte beispielsweise folgende Maßnahmen ergreifen und unterstützen: geeignete Grundstücke ausweisen oder passende Objekte vermarkten, Mittel aus der sozialen Wohnungsbauförderung bereitstellen, abgestimmte Handlungskonzepte erarbeiten. (Deutscher Städtetag: Wohnen in der Stadt – Anforderungen an eine soziale Wohnraumversorgung. Positionspapier des Deutschen Städtetages, o.O. 2006; Kuratorium Deutsche Altershilfe – Regiestelle Modellprogramm Neues Wohnen: Wohnen im Alter: Bewährte Wege – Neue Herausforderungen. Ein Handlungsleitfaden für Kommunen, hg. v. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend. Berlin 2008) > > Unentbehrlich sind kontinuierliche Schulung und Qualifizierung kommunaler Beratungsstellen, Leitstellen „Älter werden“ und Seniorenbüros zu Fragen des Wohnens im Alter ebenso wie eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Fachberatung bei Kommunen und Verbänden als Anlaufstellen für Fragen zu Wohnraumanpassung und alternativen Wohnformen, um Beteiligte, Interessenten und bürgerschaftliche Initiativen zusammenzubringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. 49 H Alter und Gesundheit „Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für ein aktives Älterwerden und die Realisierung von Potenzialen im Alter.“ (Clemens Tesch-Römer: Impulsreferat bei der Tagung „Älter werden im Saarland“, 22.06.2006, Bürgerhaus Dudweiler) 1. Gesellschaftliche Zukunftsaufgabe: „gesundes bzw. erfolgreiches Altern“ Gute Bedingungen im Bereich der Ernährung, der Hygiene, der Bildung, in Gesundheitsvorsorge und -versorgung sowie soziales Engagement, eine individuell gesunde Lebensgestaltung durch körperliche und geistige Aktivitäten beeinflussen Lebensqualität, Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und Wohlbefinden bis ins hohe Alter. „Gesundes bzw. erfolgreiches Altern“ ist somit ein komplexer und mehrdimensionaler Prozess, der vor allem gesundheitsbewusstes Verhalten und eine verantwortungsvolle Lebensführung beinhaltet. (Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Band I: Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung und Partizipation, Bundestags-Drucksache 14/5660, Berlin 2001, S. 105 f) Aufgrund der Zunahme der Anzahl älterer Menschen und neuer Erkenntnisse aus Medizin, Sportwissenschaft und Neuropsychologie, die auf beachtliche Präventions- und Rehabilitationspotenziale im höheren Alter hinweisen, gewinnen Prävention und Gesundheitsförderung im höheren Alter zunehmend an Bedeutung, um krankheitsbedingte Beeinträchtigungen im Alter zu minimieren, Unabhängigkeit und Mobilität weitestgehend zu bewahren sowie insgesamt Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Die World Health Organisation (WHO) bezeichnete in ihrem Weltgesundheitsbericht im Jahr 1998 diese Aufgabe bereits als eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Gesundheit im Alter hat somit eine umfassende individuelle und gesellschaftliche Bedeutung. Das Saarland sieht es daher als eine wesentliche gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe an, höhere Altersgruppen verstärkt als Zielgruppe der Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung zu berücksichtigen. Gesundheit und Krankheit – (K)eine Frage des Alters? Nach den Ergebnissen einer Repräsentativerhebung im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung aus dem Jahr 2005 zur alternden Gesellschaft nannten Bundesbürger unter der Fragestellung „Alter: Vor was haben Sie am meisten Angst?“ mit 38 % an erster Stelle Krankheit/gesundheitliche Probleme und Schmerzen/Gebrechen. Vor allem chronische Schmerzzustände als Folge von Erkrankungen sind bei älteren Menschen überproportional häufig vertreten, was sich auf Wohlbefinden und persönliche Lebenszufriedenheit auswirken kann. 50 Das Altern bringt es mit sich, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen und die Verletzlichkeit des Organismus (Vulnerabilität) zunehmen, jedoch ist Alter nicht automatisch gleichbedeutend mit Krankheit, Leiden und Pflegebedürftigkeit. Viele Erkrankungen im Alter sind bereits in früheren Lebensjahren entstanden und nicht allein Folge des biologischen Alters, sondern auch der Lebensführung. Möglichst gesund älter zu werden, ist ein komplexer Prozess, der aufgrund besserer Lebensbedingungen, medizinischen Fortschritts und einer umfassenderen Gesundheitsförderung und eigenen Zutuns individuell und institutionell (Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz- und Umweltgestaltung) über die gesamte Le- bensspanne zu beeinflussen ist. Während des gesamten Lebens sollten personale und umweltbedingte Faktoren in der Weise begünstigt werden, dass sie sich auf den Gesundheitszustand vorteilhaft auswirken: • • personale Faktoren (biografische Entwicklung, materielle Situation, soziale Kontakte und Beziehungen, emotionale Bindungen, Bildungsstand, Lebensweise, Belastungen in Beruf und Familie), umweltbedingte Faktoren (ökologische Bedingungen, Qualität von Wohnumfeld und Umgebung, Hygienestandards, Schadstoffbelastung). Demnach wird Gesundheit im Alter wesentlich beeinflusst von der räumlichen und sozialen Umwelt eines Menschen, davon, ob er über ein gutes Unterstützungssystem verfügt, sozial und kulturell eingebunden ist, emotionale Bindungen hat und nicht zuletzt auch von seiner inneren Haltung und seinem Selbstwertgefühl. Der Gesetzgeber hat in § 20 Absatz 1 SGB V die gesundheitsfördernde Perspektive aufgegriffen und Leistungen der primären Prävention als solche definiert, die den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen erbringen sollen. 1.1 Gesundheit älterer Menschen in Deutschland Für die ältere Bevölkerung in Deutschland liegen bisher nur wenige Daten zur Gesundheit und zum präventiven Verhalten vor und auch die sozialmedizinische Alternsforschung gewinnt erst allmählich aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft stark an Bedeutung. Ihre Erkenntnisse sind wesentlich für gesundheitspolitische Entscheidungen und können in diesem Zusammenhang dazu beitragen, möglichst „gesundes und erfolgreiches Altern“ zu unterstützen. Gerontologische Forschungen zeigen, dass sich in den vergangen Jahrzehnten nicht nur die Lebenserwartung erhöht, sondern auch die körperliche und geistige Verfassung im dritten Lebensalter deutlich verbessert hat. (Robertz-Grossmann, Beate: Wissen umsetzen. Aufgaben und Aktivitäten der Arbeitsgruppe 3 „Gesund Altern“ des Deutschen Forums Prävention und Gesundheitsförderung, in: Altern und Gesundheit, Bundesgesetzblatt, Band 49, Heft 6, Juni 2006, S. 523 – 528, hier: S. 523) Gleichwohl bestätigt der Alterssurvey3), dass sich die Gesundheit im Schnitt mit steigendem Alter verschlechtert. So treten Erkrankungen und Unfälle häufiger auf und Funktionseinbußen nehmen deutlich zu, wobei letztere nicht allein altersabhängig sind, sondern beispielsweise Folgen von Krankheiten, Unfällen, Gesundheitsbelastungen sein können. Weiterhin nimmt mit dem Alter der Anteil von Menschen mit mehreren Krankheiten zu (Multimorbidität). Allerdings ist auch bereits im Erwerbsalter ein nennenswerter Anteil von Personen von Erkrankungen und Einschränkungen betroffen. 3) Der Alterssurvey ist eine bundesweit repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung von Personen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden (d.h. 40 Jahre und älter sind). Die ersten beiden Befragungswellen des Alterssurveys erfolgten im Jahr 1996 und im Jahr 2002. Die dritte Welle begann im Jahr 2008. 51 Multimorbidität ist also nicht allein eine Herausforderung des hohen Alters. Zwar spielen altersphysiologische Veränderungen eine große Rolle, aber auch lange Latenzzeiten von Krankheiten, die unter Umständen chronisch verlaufen und Folgekrankheiten verursachen, wirken sich, ebenso wie Risikofaktoren während des Lebenslaufes, auf den Gesundheitszustand aus. Die Ergebnisse des Alterssurveys zeigen weiter, dass es in Bezug auf die Gesundheit Älterer positive Entwicklungstendenzen gibt. Allerdings bestehen Potenziale, diese weiter zu verbessern, insbesondere bei der Gesundheitsversorgung und beim präventiven Gesundheitsverhalten. Häufigste Todesursachen im Alter sind chronische Krankheiten und hier vor allem zwei Krankheitsgruppen: Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems und Krebserkrankungen. Diese bieten beträchtliche Präventionspotenziale durch verändertes Gesundheitsverhalten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in allen Phasen des Alters der häufigste Grund für eine Krankenhauseinweisung. Daher zählt Prävention zur Vermeidung von Therapie und Rehabilitation bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den vorrangigen Aufgaben der gesundheitlichen Versorgung älterer Menschen. Frauen und Männer altern unterschiedlich Frauen haben eine im Durchschnitt höhere Lebenserwartung als Männer. Als Ursache werden sowohl genetische Faktoren als auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Lebensstil angenommen. 52 Die Unterschiede in der Lebenserwartung von Männern und Frauen verringern sich jedoch zunehmend. Weiterhin bestehen jedoch mit steigendem Alter Unterschiede im Gesundheitszustand von Männern und Frauen. Ältere Frauen sind stärker von körperlichen und psychischen Belastungen betroffen und leiden im Vergleich zu Männern öfter an chronischen Erkrankungen (Arthrose, Osteoporose, Rheuma) und funktionalen Einbußen mit negativen Auswirkungen auf Mobilität und Selbständigkeit. (Kruse, Andreas: Gesund altern. Stand der Prävention und Entwicklung ergänzender Präventionsstrategien. Baden-Baden 2002, S. IX und S. 189) Ältere Frauen haben ein höheres Verwitwungsrisiko (bei den über 80-jährigen Frauen sind fast drei Viertel verwitwet) (Tesch-Römer, Clemens/Wurm, Susanne: Lebenssituation älter werdender und alter Menschen in Deutschland, in: Altern und Gesundheit, Bundesgesetzblatt, Band 49, Heft 6, Juni 2006, S. 499 – 512, hier: S. 502) und damit weniger partnerschaftliche Unterstützung als die Mehrheit der älteren Männer. Physische und psychische Belastungen resultieren für Frauen darüber hinaus mitunter aus ihrer Mehrfachbelastung in Familie, Beruf und Pflege und daraus, dass sie im Durchschnitt mehr soziale Unterstützungsleistungen in unterschiedlichen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements erbringen als Männer. (Kruse, ebd., S. IX) Maßnahmen der Prävention müssen darauf abzielen, Geschlechtsunterschiede bei den Risiken des Alterns zu beseitigen. Hierbei ist sowohl bei den Umwelt- und Lebensbedingungen, als auch den unterschiedlichen Gewohnheiten und Lebensstilen anzusetzen. 1.2 Gesundheitliche Situation älterer Menschen im Saarland4) Vorbemerkung zur Datenlage Daten, die Aussagen zur gesundheitlichen Situation von älteren Menschen im Saarland vermitteln und einen Bundesvergleich ermöglichen, stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Über die sog. Inzidenz (Zahl der Neuerkrankungen) und die Prävalenz (Anzahl oder der prozentuale Anteil von Menschen, die von einer bestimmten Krankheit wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck betroffen sind) der meisten Krankheiten können keine statistisch gesicherten Aussagen gemacht werden. Bei den Inzidenzen ist dies im Saarland für Krebserkrankungen möglich. Es fehlen jedoch entsprechende Vergleichzahlen auf Bundesebene. Als Datenquellen, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand älterer Menschen im Saarland ermöglichen, stehen zur Verfügung: 1.2.1 die ESTHER-Studie 1.2.2 amtliche Statistiken 1.2.3 Daten des Epidemiologischen Krebsregisters Saarland (EKRS) 1.2.1 Die ESTHER-Studie Aussagen über die gesundheitliche Situation älterer Menschen im Saarland ermöglicht die ESTHER-Studie, die seit dem Jahr 2000 mit regelmäßigen Follow-ups der Teilnehmer von der Stabsstelle Gesundheitsberichterstattung Saarland - Krebsregister in Zusammenarbeit mit dem Institut für klinische Epidemiologie und Alternsforschung am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg durchgeführt wird. Dabei steht ESTHER für „Epidemiologische Studie zu Chancen und Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung“. Ziele der Studie sind die Ermittlung und quantitative Abschätzung von Ursachen, Risikofaktoren und Risikoindikatoren chronischer Erkrankungen im höheren Erwachsenenalter sowie die Ableitung wissenschaftlich fundierter Anhaltspunkte für eine verbesserte Verhütung, Früherkennung und Therapie früher Stadien chronischer Erkrankungen in der älteren 4) Quelle: Stabsstelle Gesundheitsberichterstattung Saarland – Krebsregister. 53 Bevölkerung in Deutschland. An der Studie beteiligen sich 5.469 Frauen und 4.484 Männer, die im Rekrutierungszeitraum vom 01.07.2000 bis zum 30.6.2002 zwischen 50 und 74 Jahre alt waren. Am Anfang der Studie wurden von den behandelnden Ärzten aller Teilnehmer Daten über deren Gesundheitszustand erhoben. Für die häufigsten chronischen Krankheiten wurden dabei folgende Prävalenzen ermittelt (Datenquelle jeweils: Prof. Dr. med. Hermann Brenner, Abteilung für klinische Epidemiologie und Alternsforschung am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg): 1.2.1.1 Diabetes Bei 15,3 Prozent der Frauen zwischen 65 und 69 Jahren und bei 19,2 Prozent zwischen 70 und 74 Jahren war den behandelnden Ärzten eine Diabeteserkrankung bekannt bzw. wurde im Rahmen der Untersuchung neu diagnostiziert. Bei den Männern lagen die entsprechenden Quoten bei 20,3 Prozent bzw. 19,9 Prozent. 54 Diabetes in der Akte bekannt oder neu diagnostiziert Frauen Männer 642 (11,7%) davon mit 733 (16,4%) Diabetesmedikation n (%) % n (%) davon mit Diabetesmedikation % Alter in Jahren 50 – 54 61 (6,6%) 55 – 59 74 (8,2%) 60 – 64 159 (11,2%) 65 – 69 186 (15,3%) 70 – 74 162 (19,2%) 47,7% 44,0% 50,5% 58,7% 57,7% 55,7% 58,1% 50,9% 55,9% 54,3% 88 (12,3%) 100 (13.6%) 202 (16,7%) 206 (20,3%) 137 (19,9%) 1.2.1.2 Bluthochdruck 62,1 Prozent der Frauen zwischen 65 und 69 Jahren und 70,0 Prozent zwischen 70 und 74 Jahren litten unter Bluthochdruck, bei den Männern lagen die entsprechenden Raten bei 61,6 Prozent bzw. 67,1 Prozent. Hypertonus in der Akte bekannt oder neu diagnostiziert Frauen Männer 2831 (51,8%) davon mit 2412 (53,8%) antihypert. Medikation n (%) % n (%) davon mit antihypert. Medikation % Alter in Jahren 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 78,5% 75,5% 81,2% 82,0% 83,6% 313 389 776 761 592 (33,4%) (42,6%) (54,0%) (62,1%) (70,0%) 78,6% 81,5% 83,3% 85,0% 85,6% 283 (39,3%) 359 (48,5%) 674 (55,6%) 627 (61,6%) 469 (67,1%) 1.2.1.3 Fettstoffwechselstörungen Bei 48,2 Prozent der Frauen zwischen 65 und 69 Jahren und bei 51,7 Prozent zwischen 70 und 74 Jahren war den behandelnden Ärzten eine Störung des Fettstoffwechsels bekannt bzw. wurde im Rahmen der Untersuchung neu diagnostiziert. Bei den Männern lagen die entsprechenden Quoten bei 44,1 Prozent bzw. 42,2 Prozent. Hyperlipidämie in der Akte bekannt oder neu diagnostiziert 55 1.2.1.4 Koronare Herzkrankheit: Bei 11,0 Prozent der Frauen zwischen 65 und 69 Jahren und bei 17,5 Prozent zwischen 70 und 74 Jahren war den behandelnden Ärzten eine Koronare Herzkrankheit (KHK) bekannt bzw. wurde im Rahmen der Untersuchung neu diagnostiziert. Bei den Männern lagen die entsprechenden Raten bei 18,2 Prozent bzw. 24,2 Prozent. 56 1.2.2 Amtliche Statistiken Belastbare Daten, die auch einen Ländervergleich ermöglichen, stehen in den Bereichen zur Verfügung, in denen amtliche Statistiken geführt werden. Dies sind: die Berechnung der Lebenserwartung, die Todesursachenstatistik, die Krankenhausdiagnosestatistik, die Pflegestatistik, die Statistik über Menschen mit Behinderung. Für die folgenden Ausführungen wurden diese Statistiken unter besonderer Berücksichtigung der über 65Jährigen ausgewertet. 1.2.2.1 Lebenserwartung5) Nach der Sterbetafel 2004/2006 hatte ein 65-jähriger Mann im Saarland eine Lebenserwartung von 16,01 Jahren, im Bundesschnitt waren es 16,77 Jahre. Auch bei den Frauen lag diese sog. fernere Lebenserwartung der über 65-Jährigen im Saarland mit 19,31 Jahren unter dem Bundesschnitt von 20,18 Jahren. Im Vergleich der Bundesländer haben bei den 65-jährigen Männern nur Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt eine geringere Lebenserwartung, das Saarland hat bei den 65-jährigen Frauen die geringste fernere Lebenserwartung aller Bundesländer. Ähnlich sieht es mit der ferneren Lebenserwartung der 80-Jährigen aus: Während 80-jährige Männer im Saarland noch eine Lebenserwartung von 7,07 Jahren haben, liegt die Lebenserwartung dieser Altersgruppe in Deutschland bei 7,51 Jahren. Auch die 80-jährigen Frauen im Saarland haben mit 8,26 Jahren eine um rund ein halbes Jahr kürzere fernere Lebenserwartung als im Bundesschnitt (8,87 Jahre). Und auch in dieser Altersgruppe haben saarländische Frauen die geringste fernere Lebenserwartung, die Männer vor Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt die fünftniedrigste. Von der geringeren Lebenserwartung sind übrigens nicht nur ältere Menschen im Saarland betroffen, sondern alle Altersgruppen. So haben männliche Neugeborene nach der Sterbetafel 2004/2006 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 75,40 Jahren und weibliche Neugeborene von 80,77. In Deutschland liegt die Lebenserwartung Neugeborener dagegen bei 76,60 Jahren (Männer) und 82,60 Jahren (Frauen). Die geringere Lebenserwartung der Saarländerinnen und Saarländer ist allerdings keine neue Erscheinung, sondern zeigte sich schon in der ersten vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Sterbetafel von 1970/1972. Damals hatten 65-jährige Männer im Saarland eine fernere Lebenserwartung von 11,42 Jahren, Frauen von 14,56 Jahren. Die entsprechenden Bundeswerte lagen bei 12,06 und 15,18 Jahren. 5) Die vom Statistischen Bundesamt bzw. den statistischen Ämtern der Länder berechnete Lebenserwartung gibt die durchschnittliche Zahl von weiteren Jahren an, die ein Mensch in einem bestimmten Alter nach den zum aktuellen Zeitpunkt geltenden Sterblichkeitsverhältnissen voraussichtlich noch leben könnte. Sie wird mit Hilfe von Perioden-Sterbetafeln ermittelt, in die die aktuellen Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Altersjahre, im jeweiligen Alter zu sterben, eingehen. Bei der Lebenserwartung handelt es sich um eine hypothetische Kennziffer, da sich die Sterbeverhältnisse im Laufe des weiteren Lebens ändern können. 57 65-jährige Männer 65-jährige Frauen Anstieg Anstieg Anstieg Anstieg Lebenserwartung Lebenserwartung in in in in 1970/1972 2004/2006 Jahren Prozent 1970/1972 2004/2006 Jahren Prozent Deutschland BadenWürttemberg Bayern Bremen Hamburg Hessen Niedersachsen NordrheinWestfalen Rheinland-Pfalz Saarland SchleswigHolstein 12,06 16,77 4,7 39,1 15,18 20,18 5,0 32,9 12,46 12,29 11,96 12,06 12,37 12,29 17,55 17,01 16,79 16,89 17,1 16,76 5,1 4,7 4,8 4,8 4,7 4,5 40,9 38,4 40,4 40,0 38,2 36,4 15,36 15,15 15,59 15,61 15,34 15,35 20,81 20,26 20,32 20,23 20,33 20,2 5,5 5,1 4,7 4,6 5,0 4,9 35,5 33,7 30,3 29,6 32,5 31,6 11,6 12,05 11,42 16,37 16,56 16,01 4,8 4,5 4,6 41,1 37,4 40,2 14,97 14,95 14,56 19,89 19,85 19,31 4,9 4,9 4,8 32,9 32,8 32,6 12,42 16,81 4,4 35,3 15,43 20,05 4,6 29,9 Seither ist die Lebenserwartung im Saarland wie auch in Deutschland insgesamt kontinuierlich angestiegen – und zwar in etwa in gleichem Umfang. So ist die Lebenserwartung der über 65-jährigen Männer in den rund 35 Jahren im Saarland um 4,6 Jahre gestiegen, im Bundesschnitt um 4,7 Jahre. Ein Vergleich des prozentualen Anstiegs zeigt sogar, dass in dieser Altergruppe die Zunahme der Lebenserwartung bei Männern im Saarland mit 40,2 Prozent über dem Bundesschnitt von 39,1 Prozent liegt. Bei den Frauen liegt die Zunahme mit 32,6 Prozent nur leicht unter dem Bundesschnitt von 32,9 Prozent. Auch die Lebenserwartung der 80-Jährigen ist seit 1970/72 angestiegen, allerdings liegt in dieser Altersgruppe der Anstieg bei beiden Geschlechtern deutlich unter dem Bundesschnitt. 58 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die fernere Lebenserwartung der älteren Menschen im Saarland in der Vergangenheit geringer war als im Bundesdurchschnitt, und auch heute noch geringer ist. Zwar ist die Lebenserwartung der 65-Jährigen in den vergangenen 35 Jahren im Saarland in etwa so stark angestiegen wie der Bundesdurchschnitt. Diese Entwicklung verlief allerdings nahezu parallel, d.h. der Abstand hat sich in diesem Zeitraum nicht verringert. Bei den 80-Jährigen dagegen hat sich die Schere weiter geöffnet, die Lebenserwartung ist im Bundesdurchschnitt deutlich stärker angestiegen als im Saarland. 1.2.2.2 Die Todesursachenstatistik6) Im Jahr 2006 wurden von den saarländischen Städten und Gemeinden insgesamt 12.296 Sterbefälle registriert. Von den 5.811 gestorbenen Männern waren 4.452 (76,6 Prozent) 65 Jahre und älter, von den 6.485 gestorbenen Frauen waren 5.764 (88,9 Prozent) 65 Jahre und älter. Die mit Abstand häufigste Todesursache der über 65-Jährigen sind Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems. Im Jahr 2006 waren diese im Saarland bei den Männern für 40,9 Prozent aller Todesfälle verantwortlich, bei den Frauen sogar für 49,0 Prozent. Es folgen die Neubildungen (Krebserkrankungen) mit einer Quote von 30,2 Prozent bei den Männern und 20,8 Prozent bei den Frauen. Diese beiden Krankheitsgruppen ver6) In der Todesursachenstatistik wird das Grundleiden aller Verstorbenen auf der Grundlage der Eintragungen zur Todesursache auf dem Leichenschauschein und entsprechend den Regeln der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) ermittelt. Bei der Interpretation der Todesursachenstatistik muss aber berücksichtigt werden, dass ältere Menschen häufig unter mehreren chronischen Krankheiten, z.B. Diabetes und Bluthochdruck, leiden (Multimorbidität). Bei der Feststellung der Todesursache fließt das Grundleiden in die Statistik ein, das nach Ansicht des Arztes, der die Todesbescheinigung ausstellt, die unmittelbare Todesursache ist. Die anderen in der Todesbescheinigung erfassten Grundleiden, die zum Tode beigetragen haben, können in der Todesursachenstatistik nicht berücksichtigt werden. Insbesondere bei multimorbiden Patienten kann die Angabe einer unmittelbaren Todesursache deshalb zu Verzerrungen in der Statistik führen. 59 ursachen also rund 70 Prozent der Todesfälle. Es folgen mit weitem Abstand bei den Männern die Krankheiten des Atmungssystems, die Krankheiten des Verdauungssystems, die Stoffwechselkrankheiten, die Krankheiten des Urogenitalsystems sowie die Verletzungen, Vergiftungen und Folgen äußerer Ursachen. Bei den Frauen liegen die Krankheiten des Verdauungssystems auf Rang drei der Todesursachen, gefolgt von den Stoffwechselkrankheiten, den Krankheiten des Atmungssystems, den Krankheiten des Urogenitalsystems sowie den Verletzungen, Vergiftungen und Folgen äußerer Ursachen. Im Jahr 2006 betrug die altersstandardisierte7) Sterberate der 65-jährigen und älteren Männer im Saarland 5.204,3 je 100.000 Einwohner, der Frauen 3.619,0. Im Bundesdurchschnitt lagen die entsprechenden Raten bei 4.751,3 bzw. 3.286,4. Damit lagen die Sterberaten der älteren Menschen im Saarland um 9,5 Prozent (Männer) bzw. 10,1 Prozent (Frauen) über dem Bundesschnitt. Da die Sterberaten jährlichen Schwankungen unterliegen, ist es sinnvoll, 3-Jahres-Mittelwerte zu bilden. Im 3-Jahres-Mittelwert 2004-2006 lag die standardisierte Rate der Männer im Saarland 7,5 Prozent über dem Bundesschnitt, die der Frauen um 8,5 Prozent. Diese „Übersterblichkeit“ ist allerdings keine neue Erscheinung, sondern kann über den gesamten Untersuchungszeitraum, also bis Anfang der 80er Jahre, zurückverfolgt werden. Seit 1980 sind die Sterberaten im Saarland wie auch im Bund bei den Männern und den Frauen kontinuierlich zurückgegangen, bei den Männern allerdings wesentlich stärker als bei den Frauen. 60 7) Für einen Ländervergleich ist es wichtig, die unterschiedlichen Altersverteilungen innerhalb der zu vergleichenden Bevölkerungen „herauszurechnen“. Dazu wird das Verfahren der Altersstandardisierung durchgeführt, das zu sog. „altersstandardisierten Sterberaten“, die Vergleiche ermöglichen, führt. Für die Altersstandardisierung wurden verschiedene „Modellbevölkerungen“ entwickelt, in der Gesundheitsberichterstattung werden Altersstandardisierungen mit der sog. „Europabevölkerung alt“ durchgeführt. Die „Übersterblichkeit“ der Frauen lag 1980 bei knapp drei Prozent und ist seither kontinuierlich, wenn auch mit Schwankungen, auf über acht Prozent angestiegen. Bei den Männern lag sie im gesamten Zeitraum von 1980 bis 2006 stetig auf einem in etwa gleichen Niveau zwischen sieben und zehn Prozent. Bis Ende der 90er Jahre war die höhere Sterberate der Frauen in erster Linie auf die Herz-KreislaufErkrankungen zurückzuführen. Seit 1998 geht die höhere Sterberate bei diesen Erkrankungen kontinuierlich zurück, während sie bei den Neubildungen (Krebserkrankungen) stark ansteigt. Ähnlich verlief die Entwicklung auch bei den Männern, wobei die Schwankungen der Raten nicht so ausgeprägt waren wie bei den Frauen. 1.2.2.3 Die Krankenhausdiagnosen-Statistik8) Aussagen über den Gesundheitszustand älterer Menschen im Saarland lassen sich ebenfalls aus der Diagnosestatistik der Krankenhäuser zu vollstationär behandelten Patienten ableiten. Im Jahr 2006 wurden in deutschen Krankenhäusern insgesamt 60.593 Behandlungsfälle von Frauen und 48.829 von Männern über 65 Jahre mit Wohnsitz im Saarland registriert. Dass die wesentlich höheren Fallzahlen bei Frauen darauf zurückzuführen sind, dass es wesentlich mehr ältere Frauen als Männer gibt, zeigen die Fallzahlen je 100.000 Einwohner: Bei Frauen liegt die Behandlungsquote bei 46.190 Krankenhausfällen je 100.000 Einwohner und bei Männern bei 53.071 je 100.000. Die entsprechenden Vergleichszahlen auf Bundesebene liegen bei 41.524 je 100.000 Frauen und 46.816 Fällen je 100.000 Männer. Damit liegt die Behandlungshäufigkeit der 65-jährigen und älteren Männer um 13,4 Prozent über dem Bundesschnitt, die der Frauen um 11,2 Prozent. Offen bleiben muss allerdings, inwieweit die höheren Krankenhausfallraten im Saarland tatsächlich auf einen schlechteren Gesundheitszustand der Bevölkerung zurückzuführen sind. Da die Raten für die Gruppe der über 65-Jährigen nicht altersstandardisiert sind, spielt sicher auch eine Rolle, dass der Anteil älterer und hochbetagter Menschen, die eine höhere Quote an Krankhausaufenthalten haben, im Saarland höher ist als in anderen Bundesländern. Auch könnten die Gründe in der hohen Krankenhausdichte, der überdurchschnittlichen Bettenzahl sowie dem möglicherweise anderen Einweisungsverhalten der niedergelassenen Ärzte bzw. der höheren Zahl von „Selbsteinweisern“ im Vergleich zu anderen Bundesländern vermutet werden. 8) Erfasst wird dabei die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt ein eigener Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Damit gehen Patienten, die, mehrfach in einem Jahr aufgrund der gleichen Krankheit behandelt werden, auch mehrfach in die Diagnosenstatistik ein. Als Hauptdiagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Bei den Krankenhausdiagnosen stehen für die über 65-Jährigen keine altersstandardisierten Raten zur Verfügung. 61 Bei den Krankenhausdiagnosen stehen im Saarland – wie in ganz Deutschland - die Krankheiten des Kreislaufsystems bei beiden Geschlechtern mit weitem Abstand an der Spitze der Rangskala. Bei Männern folgen Neubildungen, die Krankheiten des Verdauungs-, des Atmungssystems- und des Muskel-Skelettsystems und die Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Folgen äußerer Ursachen. Bei Frauen sind die Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Folgen äußerer Ursachen der zweithäufigste Anlass für eine Krankenhausbehandlung, gefolgt von den Neubildungen, den Krankheiten des Muskel-Skelett- und des Verdauungssystems9). Die höhere Zahl von Krankenhausfällen je 100.000 Einwohner lässt sich über den gesamten Beobachtungszeitraum seit dem Jahr 2000 zurückverfolgen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist in diesem Zeitraum allerdings eine rückläufige Tendenz feststellbar. 9) 62 Verantwortlich für die wesentlich höheren Raten bei den Folgen äußerer Ursachen bei den Frauen sind Verletzungen, die größtenteils auf Stürze zurückgeführt werden können: Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Frauen: 1.163 je 100.000, Männer 495, Verletzungen im Bauch-, Wirbel- und Beckenbereich: Frauen: 595, Männer: 251, Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes: Frauen: 441, Männer 83. 63 1.2.3 Epidemiologisches Krebsregister Saarland Das saarländische Krebsregister ist in Deutschland das einzige bevölkerungsbezogene Krebsregister, das über vollzählige Daten für den Diagnosezeitraum von 1970 bis 2006 verfügt. Bundesweite aussagekräftige Vergleichsdaten stehen derzeit noch nicht zur Verfügung. Im Folgenden wird deshalb die Situation der älteren Menschen im Saarland im Hinblick auf Krebserkrankungen betrachtet. Im Jahr 2006 sind im Saarland 3407 Männer und 2922 Frauen neu an Krebs erkrankt. Dabei waren 66,1 Prozent der Männer und 61,7 Prozent der Frauen – also knapp zwei Drittel der neu Erkrankten – 65 Jahre und älter. Dies zeigt, dass Krebserkrankungen besonders häufig im fortgeschrittenen Lebensalter auftreten. Betrachtet man die altersspezifischen Erkrankungsraten, also die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 einer Altersgruppe, so zeigt sich, dass die Erkrankungsrate bei Männern ab dem 60. Lebensjahr besonders stark und konstant bis zum 75. Lebensjahr ansteigt und dann wieder zurückgeht. Bei Frauen ist die Erkrankungsrate im mittleren Lebensalter etwas höher als bei Männern. Der Anstieg nach dem 60. Lebensjahr setzt sich zwar bis zur Altersgruppe der über 80-Jährigen fort, ist allerdings wesentlich weniger steil als bei den Männern. 64 Im Zeitverlauf ist die Neuerkrankungsrate der über 65-Jährigen bei Männern um rund ein Drittel angestiegen (33,2 Prozent), bei Frauen um knapp 30 Prozent (29,1 Prozent). Bei diesen ist die Kurve nach einem Anstieg in den 70er Jahren seit Beginn der 80er Jahre abgeflacht, seit Anfang dieses Jahrzehnts ist ein leichter Rückgang feststellbar. Auch bei Männern gab es am Anfang der 90er Jahre einen leichten Rückgang der Neuerkrankungsrate, Ende der 90er Jahre einen Anstieg, und seit 2002 ist wieder ein leichter Rückgang feststellbar. Wie die nachfolgende Darstellung der wichtigsten Lokalisationen zeigt, ist diese Entwicklung in erster Linie auf die Entwicklung der Neuerkrankungen an Prostata-Krebs zurückzuführen. Der massive Anstieg der Prostataneuerkrankungsraten kann zumindest teilweise als ein Effekt der zunehmenden PSA-Untersuchungen betrachtet werden. Durch den PSA-Test können in einem frühen Stadium Prostatakarzinome erkannt werden, die noch nicht getastet werden können. So erkrankten Anfang der 70er Jahre rund 250 von 100.000 Männern im Alter von 65 und mehr Jahren an Prostatakrebs, diese Rate hat sich dann mit leichten Schwankungen auf rund 500 Neuerkrankungen pro 100.000 Anfang der 90er Jahre verdoppelt, und ist bis zum Jahr 2003 auf 821 Neuerkrankungen je 100.000 angestiegen. Seither ist die Rate rückläufig, 2006 lag sie bei 617 Neuerkrankungsfällen je 100.000. 65 Bis Anfang der 90er Jahre war Lungenkrebs die häufigste Krebserkrankung von Männern in der untersuchten Altersgruppe, Anfang der 90er Jahre wurde er dann vom Prostatakarzinom als häufigster Krebserkrankung abgelöst. Nach einem Anstieg der Lungenkrebs-Erkrankungsrate bis zur Mitte der 80er Jahre ist seither ein fast steter Rückgang zu verzeichnen, im Jahr 2005 lag die Rate um mehr als zehn Prozent unter dem Wert von 1970. Allerdings gab es im Jahr 2006 erneut einen deutlichen Anstieg. In den nächsten Jahren kann festgestellt werden, ob es sich beim 2006er Wert um einen „Ausreißer“ oder um eine erneute Trendwende handelt. Beim Magenkrebs hat sich die alterspezifische Rate der 65-jährigen und älteren Männer seit dem Jahr 1970 mehr als halbiert. Demgegenüber hat der Darmkrebs seither stark zugenommen, die Rate ist von rund 250 Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner auf mehr als 400 angestiegen. Bei 65-jährigen und älteren Frauen war bis Ende der 90er Jahre der Darmkrebs die häufigste Krebsneuerkrankung, wobei die Brustkrebsrate fast auf dem gleichen Niveau lag und nahezu parallel mit der Darmkrebsrate angestiegen ist. Aber während seit Ende der 90er Jahre bei Frauen die Darmkrebsrate sinkt, ist die Brustkrebsrate bis zum Jahr 2003 weiter angestiegen und erst seither leicht rückläufig. Im Gegensatz zu den Männern ist die Lungenkrebsrate bei den Frauen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern seit 1970 stark angestiegen: In den letzten 30 Jahren hat sie sich bei den 65-jährigen und älteren Frauen mehr als verdreifacht. Bei den unter 65-jährigen Frauen war der Anstieg sogar noch stärker, hier hat sich die Rate mehr als verfünffacht. Dies dürfte auf eine in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegene Raucherprävalenz bei den Frauen zurückzuführen sein. Beim Magenkrebs gibt es eine ähnliche Entwicklung wie bei Männern, seit 1970 hat sich die altersspezifische Erkrankungsrate mehr als halbiert. Nahezu konstant geblieben ist die Erkrankungshäufigkeit bei Gebärmutterkrebs, der sich nach einem leichten Rückgang in den 80er Jahren seit Anfang der 90er Jahre relativ konstant um eine Erkrankungsrate von 80 bis 90 Fällen je 100.000 Einwohner bewegt. Seit Ende der 90er Jahre ist allerdings wieder ein leichter Rückgang feststellbar. 66 Multimorbidität im Alter Die Daten des Krebsregisters liefern einen Hinweis auf die mit zunehmendem Lebensalter häufiger werdende Ko- und Multimorbidität. So versterben über alle Altersstufen gemittelt etwas mehr als ein Viertel aller Krebspatientinnen und -patienten trotz Krebserkrankung nicht an ihrem Tumor, sondern an einer anderen Todesursache. Wie die folgende Grafik mit Daten aus den Diagnosejahren 2000 bis 2004 zeigt, nimmt der Anteil der sonstigen Todesursachen in den höheren Altersgruppen deutlich zu und liegt ab dem 80. Lebensjahr über 40%. 67 Zusammenfassung: Die Analyse der Daten der Sterbetafeln, der Todesursachen- und der Krankenhausdiagnosenstatistik zeigt, dass die Lebenserwartung älterer Menschen im Saarland etwas geringer ist als im Bundesschnitt und dass sie häufiger im Krankenhaus behandelt werden. Dies ist jedoch keine neue Entwicklung, sondern lässt sich in den genannten Statistiken über die gesamten Analysezeiträume beobachten. Aufgrund fehlender Untersuchungen können keine wissenschaftlich fundierten Aussagen über die Ursachen getroffen werden. Es kann lediglich vermutet werden, dass die im Vergleich zum Bundesschnitt höheren Krankenhaus- und Sterberaten auf die Lebensumstände, insbesondere die von der Montanindustrie geprägten Arbeitsbedingungen, sowie auf ein abweichendes Gesundheitsverhalten zurückzuführen sind. Im Hinblick auf den Gesundheitszustand älterer Menschen ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die Erkrankungen, die für den Tod verantwortlich sind, bereits Jahrzehnte früher verursacht worden sein können. 1.3 Psychosoziale Problemlagen 1.3.1 Demenz Dementiellen Erkrankungen kommt eine ständig wachsende Bedeutung zu. Dies liegt an der Tatsache, dass vor allem ältere Menschen zunehmend an dementiellen Erkrankungen und hier insbesondere der Alzheimerkrankheit leiden, die Zahl älterer Menschen in den letzten Jahren ständig gestiegen ist und in den nächsten Jahren ein weiterer Anstieg zu verzeichnen sein wird (=> Landesseniorenplan, 1. Teil, Kapitel C 5.1). 68 Was die Situation in Einrichtungen der Altenhilfe anbelangt, kommt die Langzeitstudie MuG IV10) zu dem Ergebnis, dass Demenzkranke die größte Gruppe der Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Ein- richtungen der Altenhilfe bilden und sich der Umgang mit und die adäquate Betreuung und Versorgung von Demenzkranken als Schlüsselfragen qualifizieren lassen. Dementsprechend stehen Gesellschaft und Politik in der Verantwortung, betroffene Menschen und ihre Angehörigen nicht allein zu lassen. Formen der Demenz Es werden folgende Formen der Demenz unterschieden: Primäre Formen: • Alzheimer, ca. 70 % der Demenzen • vaskuläre, gefäßbedingte Demenz, ca. 20-25 % der Demenzen Sekundäre Formen: Erkrankungen, die aufgrund anderer medizinischer Ereignisse (z. B. niedriger Blutdruck) entstehen und die, wenn sie erkannt werden, behandelt werden können. Die primären Formen der Demenz sind gegenwärtig nicht heilbar. Die Betroffenen sind bei fortschreitender Krankheit immer weniger in der Lage, eine eigenständige Lebensführung zu realisieren. Ihr Leben wird beeinflusst bzw. bestimmt durch zunehmende Unsicherheiten und Orientierungsschwierigkeiten in Folge von Gedächtnisstörungen verbunden mit Angst, Depression und auch Aggression. Die Alzheimer-Krankheit, benannt nach dem bayerischen Nervenarzt Alois Alzheimer, der die Krankheit in den Jahren 1906/07 als Erster beschrieben hat, ist inzwischen die häufigste Demenzerkrankung und in der entwickelten Welt die vierthäufigste Todesursache der über 65-Jährigen. Die Krankheit betrifft zu 90% Patienten über 65 Jahren. Zwar kann sie vor dem 50. Lebensjahr schleichend beginnen und sich fortentwikkeln, jedoch steigt ihre Häufigkeit mit dem Alter steil an und erreicht bei den 80-Jährigen nach heutigen Erkenntnissen 20%. Einem Zwischenbericht des Instituts für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Saarbrücken im Rahmen des Modellprojektes „Beratungsdienst für Angehörige und Heime“ vom Dezember 2007 zufolge, belief sich in 5 ausgewählten Saarbrücker Pflegeheimen das Alter der überwiegend weiblichen Patienten auf einen Mittelwert von 81 Jahren. Anzahl demenzkranker Menschen im Saarland In den meisten bisher in Deutschland durchgeführten Studien wird zwischen zwei Gruppen von Demenzen unterschieden: • Mittelschwere bis schwere Demenz • Leichte oder beginnende Demenz Für die erste Gruppe wird in verschiedenen Studien übereinstimmend eine Prävalenzrate von ca. 6 % der über 65-Jährigen angenommen. Die Annahme einer entsprechenden Prävalenzrate für die zweite Gruppe erfolgt in den Studien uneinheitlich. Dies hängt mit der problematischen diagnostischen Klassifikation dieser Demenzformen zusammen 10) Die Studie “Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung in Einrichtungen der Altenhilfe“ wurde von Juli 2005 bis Ende 2007 von einem Forschungsverbund um TNS Infratest München im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt. Befragt wurden dazu Pflegerinnen und Pfleger von 4.229 Bewohnerinnen und Bewohner aus 609 Alteneinrichtungen in Deutschland. www.bmfsfj.de 69 (fließende Übergänge zwischen normalen Alterungsprozessen und beginnenden krankhaften psychischen Störungen). Angemessen erscheint für die zweite Gruppe eine Prävalenzrate von 2-3 % der über 65-Jährigen. Zur Zahl saarländischer Demenzpatienten fehlen bisher passende Erhebungen. Auf der Basis der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Basis: 31.12.2006) ergibt sich bei Anwendung der obigen Prävalenzraten für das Saarland bis 2030 folgende Entwicklung: Jahr 2006 2007 2010 2015 2020 2025 2030 Bevölkerung insgesamt über 65 insgesamt über 65 insgesamt über 65 insgesamt über 65 insgesamt über 65 insgesamt über 65 insgesamt über 65 1.043.167 225.204 1.038.200 224.200 1.024.100 222.300 996.800 226.000 967.500 237.800 942.600 257.000 916.600 279.600 6 % über 65 * 3 % über 65 13.512 6.756 13.452 6.726 13.338 6.669 13.560 6.780 14.268 7.134 15.420 7.710 16.776 8.883 * Diese Gruppe ist aufgrund des fortgeschrittenen Krankheitsbildes relevant für die Feststellung der Notwendigkeit besonderer Betreuung/Pflege. Obige Zahlen sind berechnet auf der Annahme von übernommenen Prävalenzraten, die Repräsentativität der zugrundeliegenden Studien wird unterstellt. Erhöhter Hilfebedarf 70 Die Prognosen hinsichtlich der Zunahme der Demenzerkrankungen fordern zum Handeln heraus. Sie lassen vorstellen, wie sich Pflegebedürftigkeit als neue gesellschaftliche Herausforderung auswirkt. Die demografische Entwicklung, aber auch veränderte Lebensentwürfe werden zur Folge haben, dass Pflege immer seltener von Angehörigen übernommen wird. Dem steht gerade bei den Demenzerkrankungen ein erhöhter Hilfebedarf gegenüber, der mit fortschreitender Entwicklung der Erkrankung eines hohen Maßes an Professionalität in der Pflege bedarf. Dabei steigt der Bedarf an psychosozialen Hilfen nicht nur, weil immer mehr hochbetagte Menschen allein leben, sondern auch, weil Art und Ausmaß ihrer Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit die Angehörigen zunehmend überfordern. Zwar tragen Angehörige immer noch die Hauptlast der Pflege Demenzkranker, jedoch die steigende Frauenerwerbsquote und zunehmende berufliche Mobilität führen mit dazu, dass die häusliche Versorgung Dementer vom Scheitern bedroht ist und die Übersiedlung in ein Heim gerade bei Dementen ansteigen wird. Die meisten Familien sind im Umgang mit der Krankheit schlicht überfordert. Denn die Pflege von Dementen ist mit besonderen körperlichen, psychischen, emotionalen und sozialen Belastungen verbunden, was mit Beruf und Familie nur sehr schwer zu vereinbaren ist. Landesförderung Das Saarland fördert Vorhaben zur Verbesserung der Versorgungssituation Demenzkranker und ihrer Angehörigen. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 175.000 € zur Verfügung. Gefördert werden insbesondere Modellvorhaben, die vor allem niedrigschwellige Betreuungsangebote im Sinne des SGB XI anbieten. Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind Projekte, in denen Helferinnen und Helfer unter pflegefachlicher Anleitung die Betreuung pflegebedürftiger Menschen mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung in Gruppen oder im häuslichen Bereich übernehmen oder aber pflegende Angehörige entlasten und beratend unterstützen. Im Rahmen dieser Modellförderung kommen auch Projekte einer wirksamen Vernetzung der erforderlichen Hilfen für demenzkranke Pflegebedürftige in Betracht. Dabei handelt es sich um Projekte in den Bereichen: • Angehörigenberatung, • Schulungsangebote für Angehörige dementiell Erkrankter, • Vernetzung der an der Pflege Demenzkranker beteiligten Stellen, • Förderung der Bewegung pflegebedürftiger und dementiell erkrankter Menschen durch seitens des Saarländischen Turnerbundes geschulte, ehrenamtlich tätige Betreuerinnen und Betreuer, • Hilfe- und Betreuungsangebote insbesondere zur Entlastung pflegender Angehöriger, • Implementierung der Hospiz- und Palliativarbeit in Einrichtungen der stationären Altenhilfe für schwerdemenzkranke Menschen. Tabu-Zone Dank umfassender Öffentlichkeitsarbeit der Interessensvertretungen wie zum Beispiel Alzheimer Gesellschaften, Demenz Vereine, Neurologen, Gerontologen, Psychologen, Regierungsorganisationen, rückt die Demenz-Problematik zunehmend aus der Tabu-Zone und wird von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Gemeinsam mit Demenz-Vereinen, Alzheimer-Gesellschaft, Altenpflegeschulen, Leitstellen „Älter werden“ und Beratungs- und Koordinierungsstellen/Pflegestützpunkten sowie Seniorenorganisationen wurden vielfach in enger Kooperation mit der Landesregierung wichtige Initiativen zum Beispiel im Rahmen der „Pflege-Qualitätsoffensive“ zur Enttabuisierung des Themas „Demenz“ in der Öffentlichkeit ergriffen. Beispiele: Der von der Landesregierung herausgegebene „Alzheimer-Führer für das Saarland“ (2003) ebenso wie der „Demenzführer“ (2005), die einen Überblick zu den im Saarland bestehenden Hilfsangeboten für demenzkranke Menschen bieten. Darüber hinaus haben Angehörige mit dem landesweiten AlzheimerTelefon die Möglichkeit, anonym nach Rat für ihre konkrete Hilfssituation zu fragen. Gerontopsychiatrisches Modellprojekt Um das Informationsniveau bei Betroffenen, pflegenden Angehörigen sowie insgesamt in der Bevölkerung zu steigern und die Vernetzung der medizinischen und pflegerischen Einrichtungen weiterzuentwickeln, wurde im Saarland das Modellprojekt „Gerontopsychiatrie - Beratung für Angehörige und Heime“ aufgelegt und wissenschaftlich vom Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Saarbrücken begleitet. (Kirchen-Peters, Sabine; Herz-Silvestrini Dorothea: Gerontopsychiatrisches Modellprojekt der SHG „Beratungsdienst für Angehörige und Heime“, hg. v. Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Saarbrücken 2007) Im zweiten Zwischenbericht von Dezember 2007 kommen die Wissenschaftler zu der Fest- stellung, dass das Modellprojekt aufgrund seiner multiprofessionellen Ausrichtung eine Versorgungslücke im bestehenden Hilfesystem schließt und die Interventionen positive Auswirkungen auf Patienten und die 71 spezielle Belastungssituation des Personals von Pflegeeinrichtungen haben. Zudem konnte die Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten und ambulanten Leistungserbringern verbessert werden. Die Mehrheit der befragten Angehörigen (48 bis 56%) war insbesondere mit den Informationen zum Krankheitsbild und den Tipps zum Umgang mit den Patienten, ebenso wie mit der Behandlungsempfehlung und der Beratung zufrieden. Mit Blick in die Zukunft werden sich weitere Anstrengungen vor allem auf den Ausbau der ambulanten Arbeit und dabei auf eine noch stärkere Vernetzung der medizinischen und pflegerischen Instanzen in diesem Bereich richten müssen. Eine wichtige Zielgruppe werden dabei die zurückgezogen lebenden Hilfebedürftigen sein, die notwendige medizinische und pflegerische Hilfen ablehnen oder zu spät in Anspruch nehmen. Demenz-Forschung im Saarland An der Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum des Saarlandes, bilden „Demenzen“ sowohl unter klinischen als auch unter Forschungsgesichtspunkten einen beträchtlichen Schwerpunkt. Die Bereiche Psychiatrie, Neurologie und Neurobiologie bearbeiten das Themenfeld zusammen und setzen dadurch einen deutlichen Fokus auf die Problematik. Auch wurde die Stiftungsprofessur „Demenzforschung“ eingerichtet. Das Saarland ist an vielen nationalen und internationalen Studien beteiligt, von denen einige vom Saarland aus koordiniert werden. Eines der größten europäischen Projekte zur Prävention von Alzheimer, „LipiDiDiet“, findet hier statt. Darüber hinaus hat sich eine große Zahl an Institutionen, Forschungseinrichtungen, Firmen und Initiativen zusammengeschlossen, um das Netzwerk „ReCognizeSaar – die Gedächtnisregion“ zu bilden. 1.3.2 Suchtprävention Suchtmittelkonsum im Alter Sucht und Abhängigkeitserkrankungen bei älteren und alten Menschen kristallisieren sich in den meisten Fällen primär auf die legalen Suchtstoffe wie Alkohol und Nikotin. Ein besonderes Augenmerk ist bei altersbedingten Suchterkrankungen auf die Medikamentenabhängigkeit zu richten. Gerade in diesem Bereich gilt es, Mediziner und medizinisches Fachpersonal entsprechend zu sensibilisieren und zu schulen. Aber auch nichtstoffliche Süchte, wie z. B. Spielsucht, stellen ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotential im Alter dar. Aktuelle Situation Konkrete Zahlen über die Anzahl von suchtgefährdeten und abhängigen älteren Menschen liegen bis dato nicht vor. Ausgehend von den Schätzzahlen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), sind Suchtprobleme auch im hohen Lebensalter weit verbreitet: Mehr als zwei Millionen ältere Männer und Frauen rauchen, bis zu 400.000 sind von einem Alkoholproblem betroffen und bei ein bis zwei Millionen Menschen besteht eine gewisse Gewöhnung an den Gebrauch psychoaktiver Medikamente. 72 Überträgt man die bundesdeutschen Zahlen der DHS11) auf das Saarland12), dann ergibt sich folgende Verteilung für die in der Altersgruppe der über 60-Jährigen am meisten genutzten Stimulanzien (Nikotin, Medikamente und Alkohol): • • • Fast 30.000 Menschen über 60 Jahre rauchen (davon sind 16 % Männer, 7 % Frauen). Etwa 21.000 Ältere gebrauchen Medikamente in problematischer Weise.13) Alkoholmissbrauch bzw. –abhängigkeit liegt bei fast 3.000 Männern und bei rund 1.200 Frauen vor. Die Schätzungen bezüglich eines erhöhten Alkoholkonsums mit zahlreichen Krankheitsrisiken in der Folge ergeben sogar einen Anteil von rund 32.000 Männern und über 12.000 Frauen in der genannten Bevölkerungsgruppe. Kooperationen und Netzwerke Suchtmittelkonsum hat - auch im Alter - mannigfache Ursachen und führt in vielen Fällen zu weiteren seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen sowie Erkrankungen. Daher ist es notwendig, entsprechende Hilfeangebote vorzuhalten. Das Saarland weist ein breites Spektrum an Institutionen und Einrichtungen auf, die sich mit der Problematik des Suchtmittelkonsums bei älteren Menschen befassen. Erste Ansprechpartner sollten für Betroffene und ihre Angehörigen vor allem die niedergelassenen Ärzte sein. Darüber hinaus ist es notwendig, die Mitarbeiter in den Seniorenbüros/Leitstellen „Älter werden“, in den Pflegestützpunkten der Landkreise bzw. des Regionalverbandes Saarbrücken für die Problematik „Sucht im Alter“ zu sensibilisieren und entsprechend zu schulen sowie ihnen die vielfältigen Hilfeangebote (von der professionellen Beratung bis zur Selbsthilfe) näher zu bringen. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die „Entstehungsgeschichte“ der Sucht sowie die entsprechenden Hilfeangebote auch geschlechtsspezifisch zu thematisieren, weil Männer und Frauen sich in ihrer Suchtgeschichte unterscheiden, oftmals andere Suchtmittel haben und unterschiedlicher Hilfeangebote bedürfen. Im Sinne einer effizienten Arbeit sollte grundsätzliches Ziel einer Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Alter sein, zu einer verbesserten Vernetzung in den Landkreisen/im Regionalverband Saarbrücken zu gelangen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Seniorenarbeit in den Arbeitskreisen der gemeindenahen Suchtprävention zu verankern. 1.3.3 Suizidprävention Von den mehr als 11.000 Menschen, die sich jährlich in Deutschland das Leben nehmen, sind laut Statistischem Bundesamt 40 % 60 Jahre und älter bei einem Anteil dieser Bevölkerungsgruppe an der Gesamtbevölkerung von 24 %. („Wenn das Altern zur Last wird – Suizidprävention im Alter“, hg. v. der Arbeitsgruppe Alte Menschen im Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, Februar 2005, S. 3) 11) Broschüre „Unabhängig im Alter – Suchtprobleme sind lösbar“, herausgegeben von der DHS in Kooperation mit die BARMER und dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA); Juni 2006; Internet: www.dhs.de 12) Statistisches Amt Saarland, Bevölkerung zum 31.12.2005 13) Dies ist ein Durchschnittswert, die Streuung liegt lt. DHS zw. 5% und 10%. Eine Unterteilung nach Geschlecht wurde nicht aufgeführt. Die Erkenntnisse von Medizinern und Krankenkassen belegen aber, dass der weitaus größere Anteil des Medikamentenmissbrauchs bei Frauen auftritt. „Problematisch“ bedeutet hierbei, dass die Medikamente regelmäßig eingesetzt werden, um seelisch belastende Zustände (wie Trauer, Einsamkeit, Angst, Schmerzen) besser ertragen zu können. 73 Von den 122 Menschen, die sich laut Todesursachenstatistik14) im Jahr 2006 im Saarland das Leben nahmen, waren 39,3 % 60 Jahre und älter. Experten gehen darüber hinaus von einer hohen Dunkelziffer unerkannter Selbsttötungen in dieser Altersgruppe aus, z. B. bei Unfällen oder wenn Medikamente bewusst über- oder unterdosiert werden oder die Nahrungsaufnahme verweigert wird. Die Zahlen belegen die traurige und oft ignorierte Tatsache, dass das Suizidrisiko im Alter nicht zu unterschätzen ist. Gerne werden in unserer Gesellschaft objektive Gründe vermutet, wenn ein älterer Mensch sich selbst tötet („Freitod, Bilanzsuizid“). Dabei stecken hinter dem Sterbewunsch meist als hoffnungslos erlebte Krisensituationen aufgrund individueller und hochkomplexer Zusammenhänge. Zu den Lebensumständen, die dazu führen können, dass ältere Menschen nicht mehr weiterleben wollen, zählen z. B. Beeinträchtigungen der Lebensqualität durch gesundheitliche Probleme, befürchteter oder tatsächlicher Verlust der Selbständigkeit, Veränderungen im sozialen Umfeld, Gefühle von Einsamkeit und Isolation, Angst vor Abhängigkeit, Kontrollverlust oder auch die Empfindung, nicht mehr gebraucht zu werden. Zu oft erleben ältere Menschen, dass sie eher auf Gleichgültigkeit treffen, wo sie sich Beachtung erhoffen. Es gilt daher, das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und betroffene Menschen rechtzeitig durch Prävention und geeignete Hilfestrukturen zu unterstützen. Risiko psychische Erkrankungen Häufige Auslöser suizidaler Krisen sind psychische Krankheiten (=> vgl. 3.5), insbesondere Depressionen, die allerdings in den wenigsten Fällen bemerkt und behandelt werden. Typisch für die Betroffenen ist, dass sie in der Selbsttötung die einzige Möglichkeit sehen, ihrer quälenden Situation zu entkommen. Dabei gibt es für an Altersdepressionen leidende Patienten Erfolg bringende Therapiemöglichkeiten z. B. mit modernen Antidepressiva und Psychotherapie. Angehörige, Betreuer und Ärzte sollten daher auf depressive Verstimmungen achten und rechtzeitig auf sachgerechte Behandlung hinwirken. Gefahr erkennen Es gibt typische Symptome, bei deren Auftreten das Umfeld älterer Menschen aufmerksam werden sollte, weil sie auf einen möglichen Suizid hinweisen können. Vorboten und Signale einer Suizidgefährdung15): • • • • • • 14) 74 Gefühl der Einengung Grübeln, „lautes Nachdenken“ „Ich werde nicht mehr gebraucht/Keiner kann mir helfen“ Aufgeben gewohnter Interessen und Aktivitäten Rückzug aus zwischenmenschlichen Beziehungen Ankündigung des Suizids (direkt oder indirekt) Unerwartet auftretende Ruhe nach Suizidäußerungen („Ruhe vor dem Sturm“) Statistisches Amt Saarland, Tabelle: „Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht“ und eigene Berechnungen. Dabei ist zu beachten, dass die aufgrund ärztlicher Leichenschau „nicht geklärten“ Todesfälle von dieser Statistik nicht erfasst sind. 15) Quelle: Broschüre „Wenn das Altwerden zur Last wird – Suizidprävention im Alter“ hg. v. der Arbeitsgruppe Alte Menschen im Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, www.suizidpraevention-deutschland.de Schlüsselrolle von Ärzten und Pflegekräften Eine Schlüsselrolle bei der Suizidprävention kommt Hausärzten und Pflegekräften zu. Sie können typische Symptome beim Patienten, den sie meist schon lange kennen, erkennen, sich als Gesprächspartner anbieten, Angehörige oder Nachbarn sensibilisieren und adäquate therapeutische Hilfe in die Wege leiten bzw. an einen Facharzt überweisen. Voraussetzung ist, dass Ärzte und Pflegekräfte in Aus- und Fortbildung auf das Thema „Suizidprophylaxe“ und den Umgang mit Suizidgefährdeten vorbereitet worden sind (Beispiel: Gesprächsführung mit Suizidanten, Abschätzung des Suizidrisikos eines Patienten). Eigenvorsorge Zum Erhalt seiner seelischen Gesundheit kann jeder Einzelne viel tun. Dazu gehört, sich frühzeitig und bewusst auf sein Altern vorzubereiten, über sinnvolle Aufgaben und Perspektiven nachzudenken, (=> Landesseniorenplan 1. Teil, Kapitel E 6), soziale Kontakte und Beziehungen aufrecht zu erhalten und sich mit existentiellen Fragen am Lebensende auseinander zu setzen. Zur Wahrung der Selbstbestimmung können die Vorsorgemöglichkeiten der Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung genutzt werden (=> Landesseniorenplan 1. Teil, Kapitel E 3.1). Zu den Entwicklungserfordernissen im Alter gehört es darüber hinaus, Einschränkungen und Behinderungen akzeptieren zu lernen und die Fähigkeit zu entwickeln, im Bedarfsfall Hilfen anzunehmen. Hilfs- und Beratungsangebote Wichtig ist es zu wissen, dass es in suizidalen Krisen Hilfen gibt. Großer Leidensdruck kann von den Betroffenen allein schon durch das Gespräch mit Vertrauenspersonen oder dem Hausarzt genommen werden. Gespräche mit suizidalen alten Menschen sind jedoch mit Berührungsängsten und vielen Unsicherheiten verbunden.16) Gute Anlaufstelle in akuten Krisensituationen, insbesondere für alte Menschen, die immobil sind und allein leben, ist die Telefonseelsorge. Unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 kann kostenlos angerufen werden. Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge hören zu, nehmen Anteil und verweisen bei Bedarf an andere Einrichtungen. Die Telefonsseelsorge ist somit die flächendekkende Basis aller spezialisierten Krisenhilfeangebote. Daneben gibt es an den Gesundheitsämtern Sozialpsychiatrische Dienste, die Menschen in psychischen Krisen und bei psychiatrischer Erkrankung Beratung bieten und weitere Hilfen vermitteln. Die Adresse und Telefonnummer des nächsten Dienstes erfährt man über die Gemeinden oder die Leitstellen „Älter werden“/Seniorenbüros. 16) Gute Orientierungshilfen bietet die Broschüre s. Fußnote 11) 75 2. Prävention und Gesundheitsförderung 17) Diese Ärzte – immerzu fragen sie, wie du es geschafft hast, so lange zu leben. Ich sage Ihnen: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange leben würde, hätte ich besser auf mich acht gegeben.“ (James Hubert ‚ Eubie’ Blake, US-amerikanischer Jazz-Musiker, 1887 – 1983) Altern ist ein lebenslanger Prozess, der zwar nicht detailliert planbar, jedoch individuell durch verantwortliches Verhalten beeinflussbar ist. Das Auftreten und der Verlauf chronischer Erkrankungen sind neben rein medizinischen Ursachen abhängig von persönlichem Verhalten sowie gesellschafts- und umweltbedingten Einflüssen. Bei einer Analyse der Krankheiten im Alter wird deutlich, dass es sich vielfach um „mitalternde“ Krankheiten handelt. Gesundheitsförderung und Prävention tragen dazu bei, das Alter nicht mehr ausschließlich als Phase eingeschränkter bzw. abnehmender Ressourcen zu sehen. Insofern sind Gesundheitsförderung und Prävention mit Blick auf ein gesundes, zufriedenes und leistungsfähiges Leben im Alter als lebenslange Aufgabe der Gesellschaft und des Individuums anzusehen. Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention sollten also möglichst alle Generationen ansprechen. Das Bemühen um die Selbst- und Mitverantwortung für die eigene Gesundheit sollte lebenslang bestehen. So lohnt es sich, entgegen weit verbreiteter Ansicht, auch noch im Alter mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu beginnen. Empirische Befunde belegen, dass Organfunktionen und kognitive Funktionen im Alter positiv veränderbar sind. Hier kommt insbesondere der körperlichen Aktivität eine herausragende Bedeutung zur Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit zu. Durch Training kann sowohl dem Abbau der Muskelmasse, als auch dem der Hirnleistung entgegengewirkt werden. (Kruse, A.: Gesund altern. Baden-Baden 2002, S. 77) Wichtig ist der Schutz vor koronaren Herzkrankheiten und Schlaganfall sowie Stürzen. Darüber hinaus hat körperliche Aktivität einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. Geistige Leistungsfähigkeit kann zusätzlich mit kognitiven Aktivitäten (z. B. Gedächtnistraining) beeinflusst werden. Sinnvoll für Alter und Gesundheit ist es also, gesunderhaltende Schutzfaktoren und Ressourcen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter kontinuierlich zu stärken, (nach Hurrelmann, Klaus u.a.: Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. Bern 2007) und Gesundheitsförderung und Prävention als integrale Bestandteile des gesamten Versorgungsgeschehens neben Kuration/Therapie, Rehabilitation und Pflege zu verwirklichen. 17) 76 Prävention bezieht sich auf die Vermeidung eines schlechteren Gesundheitszustandes, Gesundheitsförderung auf die Steigerung gesundheitlicher Ressourcen. Gesundheitsförderung orientiert sich weniger an der Vermeidung von Erkrankungen und Einbußen als vielmehr an einem umfassenden Verständnis von Gesundheit und zielt ab auf Maßnahmen zur aktiven Beeinflussung der Verhaltensweisen, Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen in Richtung einer gesunden Lebensweise 2.1 Ziele von Prävention und Gesundheitsförderung im Alter: Krankheiten vorbeugen – Pflegebedarf vermeiden Ausgehend von einem umfassenden Verständnis von Gesundheit sind folgende Präventionsziele für ältere Menschen hervorzuheben: • Aufrechterhaltung von aktiver, selbst- und mitverantwortlicher Lebensführung. Wichtig sind die Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfepotenzialen sowie die Aufrechterhaltung eines angemessenen Systems der Unterstützung • Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden auch im Falle chronischer Erkrankungen sowie bei beistehendem Hilfe- bzw. Pflegebedarf, • Verwirklichung eines gesunden Lebensstils, um Erkrankungen und Funktionseinbußen hinauszuzögern, das bedeutet: • Risikofaktoren vermeiden, • Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, • Bewegungs- und Ernährungsverhalten der jeweiligen Lebensweise anpassen, • Unfallrisiken vermeiden durch altersgerechte Gestaltung von Wohnung und Wohnumfeld, durch Barrierenbeseitigung und die Verwendung technischer Hilfsmittel • Förderung der Fähigkeit, sich an im Lebensverlauf auftretende Verluste mithilfe geeigneter Bewältigungsstrategien anzupassen • Wahrung sozial-kultureller Partizipation und Nutzung vorhandener Ressourcen 2.2 Lebensqualität bewahren - Präventionspotenziale nutzen Körperliche, psychische und vielfältige soziale Faktoren (=> Landesseniorenplan, 1. Teil, S. 94, 95) bestimmen allgemein das Wohlbefinden während des persönlichen Lebensverlaufs und insbesondere „erfolgreiches Altern“, wobei das Wohlbefinden im Alter wesentlich von der Ausprägung physischer, psychischer und sozialer Ressourcen beeinflusst wird. (Backes, G./Clemens, W.: Lebensphase Alter. München 1998, S. 206) 2.2.1 Partnerschaft im Alter „Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe schützt bis zu einem gewissen Grade vor Alter.“ (Jeanne Moreau,*1928, französische Filmschauspielerin) Das Erleben sozialer Bindungen und verlässlicher Beziehungen - zum Lebenspartner, zu Kindern, Freunden, Bekannten, Nachbarn - beeinflusst während des gesamten Lebensverlaufs sowohl physische als auch psychische Widerstandskraft und hilft dabei, Belastungen sowie Lebenskrisen besser zu verarbeiten. Partnerschaft, Vertrauen, Zärtlichkeit und körperliche Nähe sind auch im Alter für Lebenszufriedenheit und möglichst gesundes Älterwerden von Bedeutung. Lebensgeschichtliche, geschlechtsspezifische, partnerschaftliche Faktoren und individuelle Bewältigungsfähigkeiten beeinflussen das emotionale Beziehungsspektrum, ebenso wie das sexuelle Interesse älterer Menschen. Dass körperliche Nähe und Intimität im Alter von Interesse bleiben und in Zukunft nicht zuletzt wegen medizinischer Möglichkeiten (Potenzmittel) an Bedeutung gewinnen können, wird inzwischen durch Studien bestätigt. (Niederfranke, Annette: Das Alter ist weiblich. Frauen und Männer altern unterschiedlich, in: Funkkolleg Altern 2 – Lebenslagen und Lebenswelten, soziale Sicherung und Altenpolitik. Wiesbaden 1999. S. 41; Denniger, Tina: Sexualität im Alter, in: informationsdienst altersfragen, 05/2008, S. 16 - 21) 77 Allerdings werden erst allmählich - einhergehend mit einem sich verändernden, modernisierten Altersbild, das nicht nur vom Alter als einer von Verlusten geprägten Lebensphase ausgeht - Partnerschaft und Intimität im Alter aus der thematischen Tabu-Zone herausgelöst und in der Alternsforschung, in Paarberatungen, aber auch in der Pflegeausbildung sowie im Alltag von Pflegeeinrichtungen berücksichtigt. Verheiratet, verwitwet – allein oder gemeinsam Während das Leben als Single in Zukunft vermutlich ein häufigeres Muster der Lebensgestaltung wird, ist aktuell die Ehe die am häufigsten im Alter anzutreffende Form der Partnerschaft im Saarland. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Familienstand der über 65-jährigen Menschen im Saarland. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen sind 56 % (75 % der Männer und 43 % der Frauen) verheiratet. Diese Zahlen verringern sich in der Altersgruppe der über 80-Jährigen bei Männern auf 63 % bzw. in der Altersgruppe der über 90-Jährigen auf 28 %, bei Frauen in der Altersgruppe der über 80-Jährigen auf 18 % bzw. auf 6 % in der Altersgruppe der über 90-Jährigen. Auffallend ist, dass in der Altersgruppe der über 65-Jährigen der Anteil älterer Frauen, die verwitwet sind, mit 47 % gut dreimal so hoch ist wie der der Männer mit 14%. Bevölkerung über 65 Jahren nach Alter, Geschlecht und Familienstand (Stand: 31.12.2007) (Quelle: Statistisches Amt und eigene Berechnungen) Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Familienstand am 31.12.2007 Gemeinde Alter Kreis / Land 65-70 70-80 80-90 90 und älter >65 SAARLAND Gesamtbevölkerung > 65 %-Anteil Gemeinde Kreis / Land SAARLAND Gesamtbevölkerung 78 SAARLAND Gesamtbevölkerung > 65 %-Anteil 32.217 45.366 14.722 Alter 65-70 70-80 80-90 90 und älter >65 Insgesamt 36.292 58.042 32.684 2.120 2.055 544 Insgesamt 68.509 103.408 47.406 Ledig 1.335 2.755 2.386 %Anteil 78,67 78,33 62,63 11,86 5,22 42,02 28,13 75,18 46,93 Ledig 3.455 4.810 2.930 3,09 420 70.519 236.586 29,81 2.080 5.683 4.557 %Anteil 6,46 12,53 30,95 820 13.140 16.251 54,92 14,01 3,22 Verwitwet 80,86 2.672 2.094 400 %Anteil 8,29 4,62 2,72 76 5.242 39.414 5,09 5,59 7,82 Geschieden 13,30 Weiblich %Anteil Verheiratet 3,68 23.158 4,75 27.284 7,30 5.768 %Anteil 63,81 47,01 17,65 Verwitwet 8.787 25.217 23.557 %Anteil 24,21 43,45 72,08 Geschieden 3.012 2.786 973 12,01 5,36 33,05 6,26 42,82 44,95 3.959 61.520 73.769 79,63 46,61 13,85 105 6.876 43.369 4,02 6.465 774 225.788 11.969 1.036.598 387.816 21,78 Männlich %Verheiratet Anteil 6,58 25.344 4,53 35.534 3,70 9.221 2,31 4.972 597 131.990 7.073 532.519 175.988 24,79 Alter 65-70 70-80 80-90 90 und älter >65 Ledig 1.493 177 93.798 4.896 504.079 211.828 18,61 > 65 %-Anteil Gemeinde Kreis / Land Insgesamt 311 56.521 239.393 23,61 83,40 %Anteil 70,80 60,75 31,62 Verwitwet 10.867 30.900 28.114 %Anteil 15,86 29,88 59,30 Geschieden 5.684 4.880 1.373 11,97 5,30 37,41 11,31 56,27 45,92 4.779 74.660 90.020 73,92 33,07 8,68 181 12.118 82.783 26,69 82,94 2,11 5,21 8,14 15,85 Summe %Anteil Verheiratet 5,04 48.502 4,65 62.818 6,18 14.989 731 127.040 475.979 %Anteil 8,30 4,80 2,98 14,64 %Anteil 8,30 4,72 2,90 2,80 5,37 7,99 Balance einer Beziehung bewahren Eine wesentliche Zäsur stellt in vielen Ehen oder Partnerschaften beispielsweise der Eintritt in den Ruhstand oder der Eintritt von Pflegebedürftigkeit bei einem der Partner dar. Hier ist es Aufgabe beider Partner, die Balance einer Beziehung zwischen Nähe und Distanz, zwischen Gemeinsamkeit und Unabhängigkeit neu auszurichten und neue Möglichkeiten des Zusammenseins zu entdecken. Auch ältere Menschen machen meist die Erfahrung, dass eine stabile, funktionierende und vertrauensvolle Partnerschaft wichtig bleibt, um Krisensituationen gemeinsam aufzuarbeiten und besser zu bewältigen. Je nach persönlicher Situation können lebensgeschichtliche oder krankheitsbedingte Beeinträchtigungen der Sexualität im Alter als leidvoll erfahren werden und sich auf eine gemeinsame Beziehung auswirken. Beim Umgang mit auftretenden Problemen kann professionelle Hilfe und Unterstützung bei Beratungsstellen, die Sexual- und Paarberatung anbieten, nachgefragt werden. Im Saarland sind dies z. B. die Beratungsstellen der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, des Diakonischen Werkes, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der Sozialdienste Katholischer Frauen und Männer sowie des pro familia Landesverbandes Saarland. Inanspruchnahme und Kontaktaufnahme mit professionellen Beratungsdiensten ist beispielsweise auch über ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Hausarzt möglich. 2.2.2 Gesunde Ernährung im Alter Ziel ist es, durch gesunde Ernährung bis ins hohe Alter mobil und aktiv zu bleiben. Qualität und Quantität der Nahrung beeinflussen die Gesundheit und den Alterungsprozess. Eine ausgewogene Ernährung von Kindheit an ist eine gute Voraussetzung für ein gesundes Leben. Ernährungsumstellung ist jedoch auch im Alter möglich und kann mit einem Gewinn an Lebensqualität verbunden sein. Der 9. Ernährungsbericht 2000 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) kommt zu dem Ergebnis, dass die Ernährung selbständiger, im eigenen Haushalt lebender Senioren insgesamt gut, aber zu einseitig ist. Sie könnten gesundheitlich von einigen Änderungen in ihren Ernährungsgewohnheiten profitieren. Nährstoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Milch- und Vollkornprodukte sollten daher auf dem täglichen Speiseplan auch im Alter berücksichtigt werden. 2.2.2.1 Physiologische Veränderungen im Alter und ihre Konsequenzen für die Ernährung Physiologische Veränderungen im Alter sind, vielfältig, schleichend und erfolgen nicht in allen Organen gleichmäßig. Sie verlaufen darüber hinaus höchst individuell und werden von Veranlagung und persönlichem Lebensstil beeinflusst. Gerade Senioren sind aufgrund altersbedingter physiologischer Veränderungen anfälliger für Fehl- und Mangelernährung und Austrocknung (Dehydratation). Eine dem Alter angepasste Ernährung muss daher im Zusammengang mit den körperlichen Veränderungen gesehen werden und den individuellen Gesundheitszustand älterer Menschen berücksichtigen. Ernährungsprobleme können nur behoben werden, indem auf die speziellen Probleme im Einzelfall (wie z. B. Appetitverlust, Kauprobleme, Zunahme chronischer und akuter Krankheiten, Multimedikation, veränderter Nährstoffbedarf usw.) abgestellt wird. Empfehlenswert ist ein dem Energiebedarf entsprechender individueller Ernährungsfahrplan. 79 a) Zahlreiche Veränderungen betreffen das Verdauungssystem Die Verdauung läuft beispielsweise etwas langsamer als früher, die Fettverdauung ändert sich. Durch eine verminderte Leistungsfähigkeit des Magens wird die Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen und Vitaminen eingeschränkt. b) Veränderungen durch Kieferverformung und Zahnverluste Das Kauen „harter Lebensmittel“, wie z. B. von Obst, rohem Gemüse und Vollkornprodukten, bringt für viele ältere Menschen erhebliche Probleme mit sich. Daher ist es notwendig, bis ins hohe Alter einen Beitrag zur Förderung der Zahn- und Mundgesundheit zu leisten. Regelmäßige zahnärztliche Kontrollen sowie sorgfältige Mund- und Zahnpflege sind unerlässlich. c) Veränderungen durch Abnahme der Leistung der Sinnesorgane Viele Menschen sind im Alter in ihrer Geschmacks- und Geruchswahrnehmung eingeschränkt, so dass Nahrung oftmals als fade und/oder ungewürzt empfunden wird. Bei der Zubereitung von Speisen sollte daher z. B. auf das Würzen mit Kräutern geachtet werden. d) Veränderungen des Energiebedarfs und der Knochenmasse des Körpers Der körperliche Energiebedarf ist abhängig von Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht, aber auch vom täglichen Leistungsumfang. Mit zunehmendem Alter verringert er sich. Daher empfiehlt es sich auf geringe Fettzufuhr, fünf bis sechs kleinere Mahlzeiten am Tag, ausreichenden Obst- und Gemüsekonsum sowie ausgewogene Zufuhr von Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen zu achten. e) Bedeutung der Flüssigkeitszufuhr im Alter Da die Nierenfunktion im Alter abnimmt, eine gute Nierenfunktion aber wichtig für den Wasser- und Elektrolythaushalt und die Regulation des Blutdrucks ist, muss eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sichergestellt werden. 80 Viele alte Menschen trinken zu wenig und bemerken es nicht, weil das Durstgefühl mit zunehmendem Alter abnimmt. Symptome von Flüssigkeitsmangel können Mundtrockenheit, trockene Schleimhäute und schlaffe Haut sein. Die Folgen reichen von Verstopfung, Verwirrtheit, Schwäche, Schwindel und erhöhter Anfälligkeit für Infektionen bis hin zu Kreislaufoder Nierenversagen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) empfiehlt gesunden älteren Menschen eine tägliche Flüssigkeitszufuhr von 2,25 Litern. 1,5 Liter sollten über Getränke und die restliche Menge über das Essen (Gemüse, Salate, Obst, Milchprodukte u.s.w.) aufgenommen werden. Bei sommerlicher Hitze sollte in besonderem Maße auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Am besten stellt man sich bereits morgens Getränke sichtbar bereit und trinkt zu jeder Mahlzeit ein Glas Flüssigkeit. Hilfreich kann es sein, sich an einem Tagestrinkplan für Senioren zu orientieren, der beispielsweise so aussehen kann: Tageszeit nach dem Aufstehen Frühstück vormittags Mittagessen Nachmittags Abendessen Insgesamt Getränke 1 Glas Mineralwasser 2 Tassen Kaffee oder schwarzen Tee 2 Gläser verdünnter Apfelsaft 1 Glas Mineralwasser 2 Tassen Früchte- oder Kräutertee 1 Glas Mineralwasser Menge in Liter 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 1,6 Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Ernährungsstörungen korrigieren – Fehlernährung vermeiden Ernährungsstörungen sowie Fehlernährung können in jedem Alter durch entsprechende Beratung und Programme korrigiert werden. Älteren und insbesondere alleinlebenden sowie hochaltrigen Menschen, z. B. mit Kau- oder Schluckproblemen, sollte besondere Aufmerksamkeit vor allem im Rahmen der primärärztlichen Versorgung bzw. Betreuung zukommen. Spezielle Programme für diesen Personenkreis vorzuhalten und umzusetzen, ist in einer alternden Gesellschaft eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, um Fehlbzw. Mangelernährung im Alter zu vermeiden. 2.2.2.2 Ernährung in Senioreneinrichtungen Während bei rüstigen Senioren eher Probleme mit Übergewicht/Adipositas und damit verbundenen Folgeerkrankungen dominieren, ist bei alten und sehr alten Menschen nicht selten Mangel- oder Unterernährung anzutreffen. Oft ist bei Eintritt ins Heim aus verschiedensten Gründen der Ernährungszustand nicht optimal. Daher sind vor allem hochbetagte Bewohner von Senioreneinrichtungen z. B. aufgrund von Behinderungen, Kau- und Schluckstörungen, Appetitverlust, Verwirrtheitszuständen, Demenz oder Depressionen, Auswirkungen von Medikamenteneinnahme anfällig für Ernährungsdefizite. Auch wirken sich Bewegungsmangel und die ungewohnte Heimatmosphäre negativ auf die Nahrungsaufnahme auf. Da sich die Therapie von Mangel- oder Unterernährung schwierig gestaltet und ein guter Ernährungszustand für ältere Menschen von hoher Bedeutung ist, ist Prävention im Sinne von Gewährleistung einer ausreichenden Nahrungsaufnahme mit Hilfe des Pflegepersonals umso wichtiger. Entscheidend für die Sicherstellung einer adäquaten Versorgung sind z. B.: • • • individueller Ernährungszustand, regelmäßige Erfassung der möglichen Risikofaktoren, regelmäßige Erfassung der aufgenommenen Nahrungsmenge. In saarländischen Einrichtungen der Altenhilfe basiert das Verpflegungsangebot auf der vollwertigen Ernährung der sogenannten Vollkost, aus der verschiedene Kostformen bedürfnisorientiert abgeleitet werden (z. B. bei Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus, Magen- Darmstörungen). Bei Personen, die hilfs- oder pflegebedürftig sind, müssen entsprechende Angebote für die zu betreuenden Personen seitens der Pflegepersonen (Angehörige und Pflegepersonal) geschaffen und mit erforderlichen Hilfs- und Unterstützungsleistungen beim Trinken verbunden werden; beispielsweise Getränke in Reichweite stellen oder anbieten. Hilfreich ist auch ein abwechslungsreiches Angebot von Heiß- und Kalt- 81 getränken. In stationären Einrichtungen haben sich Selbstbedienungsmöglichkeiten für Getränke (Getränkeoasen) bzw. das sichtbare Platzieren von Getränken im Aufenthaltsbereich bewährt. Ernährung und Flüssigkeitszufuhr – besondere Situation pflegebedürftiger Menschen Um Folgen von Mangelernährung wie Gewichtsverlust, Immunschwäche und Krankheitsanfälligkeit zu verhindern, muss die Ernährung in Senioreneinrichtungen den individuellen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden und in Zubereitung, Geschmack und Darreichung zur Steigerung von Lebensfreude und Wohlbefinden beitragen. Altersbedingte Veränderungen und Probleme, aber auch persönliche regionalspezifische Ernährungsgewohnheiten der Tischgäste sollten bei der Gestaltung der Speisepläne und der Rahmenbedingungen zur Nahrungsaufnahme von Heimleitung und Personal berücksichtigt werden. Auch hochbetagte Bewohner sollten möglichst zum selbständigen Essen animiert werden. Insbesondere demente Bewohner erfordern ein individuelles Ernährungsregime, da sich die Erkrankung meist nachteilig auf das Ess- und Trinkverhalten auswirkt. Nach Schätzungen von Experten ist heute bereits jede zweite Bewohnerin bzw. jeder zweite Bewohner einer Pflegeeinrichtung auf Grund einer dementiellen Erkrankung bei der Nahrungsaufnahme auf die Hilfe der Pflegekräfte angewiesen. Die Frage einer ausreichenden Ernährung und Flüssigkeitszufuhr in diesen Einrichtungen gewinnt mit Blick auf diesen Bewohnerkreis daher immer größere Bedeutung. Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind oft aus verschiedensten Gründen nicht mehr in der Lage, ihre Mahlzeiten selbständig zu sich zu nehmen oder genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Hier ist eine enge Zusammenarbeit von Pflegekräften, Ärzten und Angehörigen nötig, um eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr der Bewohner/innen sicherzustellen. Besondere Sensibilität ist bei der Anordnung von Sondenernährung gefordert. Von entscheidender Bedeutung dabei ist, Gründe für eine zu geringe Nahrungs- und Getränkeaufnahme oder sogar eine Verweigerung zu hinterfragen. Beobachtungen zufolge wird oftmals jedoch zu schnell auf eine Sondenernährung der Pflegebedürftigen zurückgegriffen. Bei der Legung einer Sonde zur künstlichen Ernährung handelt es sich um einen körperlichen Eingriff, der eine Einwilligung des Betroffenen erfordert. Für den Fall des Verlustes der entsprechenden Entscheidungsfähigkeit sollte der Wille bezüglich der Art und Weise einer ärztlichen Behandlung frühzeitig durch eine Patientenverfügung niedergelegt werden, damit dem Willen des Betroffenen im Falle von lebenserhaltenden Maßnahmen entsprochen werden kann. Um sicher zu stellen, dass dieser Wille auch von einer Person des Vertrauens mit Rechtsmacht zur Geltung gebracht werden kann, empfiehlt es sich, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht, oder zumindest mit einer Betreuungsverfügung, zu kombinieren (Näheres dazu im Landesseniorenplan, 1. Teil, S. 66 – 68). 2.2.3 Sport im Alter Nach dem Bundes-Gesundheitssurvey nimmt die sportliche Aktivität mit dem Ende der Erwerbstätigkeit im 7. Lebensjahrzehnt zunächst zu. Danach erhöht sich der Anteil der nicht sportlich aktiven Bevölkerung wieder deutlich. Über 50% der Männer bzw. 60% der Frauen der 60- bis 69-Jährigen und über 70% der 70bis 79-Jährigen sind nicht regelmäßig körperlich aktiv. Weniger als 10% der über 60-jährigen Frauen und weniger als 15% der Männer folgen der Empfehlung, sich an mindestens drei Tagen in der Woche eine halbe Stunde körperlich zu betätigen. (Walter, U./Schneider, N./Bisson, S.: Krankheitslast und Gesundheit im 82 Alter. Herausforderungen für die Prävention und gesundheitliche Versorgung, in: Bundesgesundheitsblatt, Band 49, Juni 2006, S. 537-544, hier: S. 544) Aufgrund des Wandels in der Bevölkerungsstruktur rückt die körperliche und psychische Verfassung eines Drittels der Bevölkerung stärker in den Blickpunkt des Interesses. Der lange Erhalt der Leistungsfähigkeit kann zur Gesamtleistungsfähigkeit der Gesellschaft beitragen und damit Sozialsysteme entlasten. Kosten für Betreuung und Pflege könnten insgesamt verringert werden. Sowohl individuelle Aspekte des Seniorensports (Förderung der Durchblutung, Mattigkeit und Müdigkeit verschwinden, Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit der Gelenke) als auch der geselligkeitsstiftende Effekt verweisen auf die Wichtigkeit einer Förderung und Aufwertung von Bewegungs- und Sportaktivitäten für ältere Menschen. Regelmäßige Bewegung fördert die Durchblutung, Mattigkeit und Müdigkeit verschwinden und die Muskulatur wird gekräftigt. Aber auch eine verbesserte Beweglichkeit der Gelenke, verbesserte Durchblutung des Gehirns sowie insgesamt das Training der Herz-/Kreislauffunktionen machen das Leben lebenswerter. Präventiv - ausgleichend – rehabilitativ Ziel muss es sein, älteren Menschen möglichst lange die Selbstständigkeit zu erhalten. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit hängen wesentlich davon ab, wie Alltagsanforderungen bewältigt werden können. Untersuchungen konnten belegen, dass passend dosierte und regelmäßige Bewegungs- und Sportaktivitäten präventive, ausgleichende und rehabilitative Wirkungen entfalten und damit dem Abbau der Leistungsfähigkeit begegnet werden kann. Je nach Umfang und Intensität der Inhalte sportlicher Aktivitäten lassen sich Trainingswirkungen sowohl im konditionellen als auch im koordinativen Bereich und bei der Beweglichkeit erreichen. Zudem wirken sich Bewegungs- und Sportaktivitäten positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Lebensfreude aus. Für jede Altersgruppe und fast jeden Gesundheitszustand stehen Kurs- und Trainingsprogramme für geeignete Bewegungs- und Sportaktivitäten zur Wahl, um koordinative und konditionelle Fähigkeiten möglichst lange in bestmöglicher Ausprägung aufrecht zu erhalten und vital älter zu werden. Darüber hinaus wird älteren Menschen empfohlen, ihre favorisierten und regelmäßigen Bewegungsabläufe im Alltag (z. B. forciertes Gehen sowie Gartenarbeit) beizubehalten. Sportarten und Sportaktivitäten älterer Menschen Als häufigste sportliche Aktivitäten werden Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Kegeln und mit deutlichem Abstand Laufen/Joggen, Tanzen, Ski-Langlauf betrieben. Fremdorganisiert (d. h. in Vereinen oder anderen Organisationen) werden unter den meistgenannten Sportarten Gymnastik, Kegeln, Tennis und Fußball ausgeübt, während Wandern, Joggen, Radsport, Schwimmen und Tanzen häufiger selbstorganisiert betrieben werden. Sportangebote zu festen wöchentlichen Zeiten haben einen stabilisierenden und den Wochenablauf rhythmisierenden Einfluss. (Pache, D.: Die gegenwärtige Situation des Sports der Älteren, in: Denk, H./Pache, D./Schaller, H.-J. (Hrsg.): Handbuch Alterssport. Grundlagen - Analysen - Perspektiven. Schorndorf 2003, S. 67 – 85) 83 Seniorentanz18) Neben Sportarten ohne besondere Anleitung für ältere Menschen, wie zum Beispiel schnelles Gehen, Wandern oder Schwimmen gibt es Sportarten für ältere Menschen, für die Ärzte eine Anleitung empfehlen. Zu diesen Sportarten gehört neben Rücken- und Wassergymnastik, Skiwandern und Fitnesstraining auch der Seniorentanz, der im Bundesverband Seniorentanz e. V. Landesverband Saarland im Interesse einer sicheren Abstimmung auf die jeweiligen Bedürfnisse älterer Menschen von qualifizierten Tanzleitern vermittelt wird. 2.2.3.1 Nutzen des Seniorensports (modif. nach Pache, ebd., 2003, S. 86) Der Nutzen des Seniorensports... … für den Älteren • Förderung von objektiver und subjektiver Gesundheit • • Förderung von Wohlbefinden, Zufriedenheit und Lebensfreude • • Erhalt von Selbständigkeit und Kompetenz Aktive Einflussnahme auf Entwicklungsprozesse Erhalt und Förderung körperlicher und motorischer Fähigkeiten Abwechslung im Tagesablauf • Möglichst langer Erhalt der Leistungsfähigkeit und Selbständigkeit einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe Stärkung der Selbstverantwortung für die körperliche und gesundheitliche Verfassung von 1/3 der Bevölkerung Senkung von Betreuungs- und Pflegekosten • Senkung von Gesundheitskosten • • • • • 18) 84 … für die Gesellschaft Soziale Kontakte und Geselligkeit Könnens- und Leistungserlebnisse Seniorentanz, der seinen Ursprung in den Volkstänzen, der Folklore und auch neuen Tanzformen aus aller Welt hat, gilt als eine speziell für ältere Menschen entwickelte Tanzdisziplin ohne Wettbewerbsgedanke. Die Mischung aus Tanz und musikorientierter Gymnastik in der Gruppe bietet älteren Menschen Gemeinschaft; die rhythmischen Bewegungsabläufe in entspannter Atmosphäre ermöglichen eine selbstgestaltete und zugleich gesellige Lebensführung. Erhalt der Ausdauerfähigkeit im Alter Die wesentliche Bedeutung eines ausdauerorientierten Gesundheitstrainings im Alter liegt in den günstigen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Herz-/Kreislauf-Systems und anderer Organsysteme. Eine Ökonomisierung von Herz-Kreislaufarbeit und Stoffwechsel zeigen sich bereits nach einigen Trainingswochen und machen sich in Ruhe, aber vor allem auch bei alltäglichen Anforderungen und Belastungen (z. B. Treppensteigen) positiv bemerkbar. Erhalt der Kraftfähigkeit im Alter Die Muskelmasse nimmt im Alter vom zwanzigsten bis zum siebzigsten Lebensjahr um ca. 30 bis 40 % ab. Der Kraftverlust bedeutet eine Einengung der Leistungsfähigkeit im Alltag, z. B. beim Treppensteigen, beim Transportieren von Gegenständen oder bei Urlaubsaktivitäten und hat somit eine Einschränkung der Lebensqualität zur Folge. Die Kraftfähigkeit hat nicht nur für die Bewegungskraft, sondern auch für die Haltekraft eine spezifische Bedeutung. Verursacht durch eine Abschwächung der Haltemuskulatur des Rumpfes kommt es zu Fehlhaltungen, die zu Degenerationen der Zwischenwirbelscheiben führen: Rückenbeschwerden und Haltungsschäden können die Folge von Fehlbelastungen sein. Erhalt der Beweglichkeit im Alter Eine hinreichend entwickelte Beweglichkeit erleichtert dem Menschen wesentlich die Bewältigung vieler Alltagsaufgaben (Ankleiden, Aufräumen, Gartenarbeit, Putzen oder Benutzung von Fahrzeugen). Beweglichkeit hat – zusammen mit der Kraft – eine wichtige präventive Bedeutung im Hinblick auf muskuläre Dysbalancen. Durch altersgerechtes Beweglichkeitstraining können Dysbalancen vermieden und die Verletzungsgefahr für Muskeln, Sehnen und Bänder gesenkt und deren Verschleiß frühzeitig verringert werden. Erhalt der (Re-)Aktionsfähigkeit im Alter Angemessene Reaktionsfähigkeit hilft, die Anforderungen des Alltags besser zu bewältigen. Hinreichende Reaktions- ebenso wie Bewegungsschnelligkeit unterstützen ältere Menschen bei der allgemeinen Sicherheit, etwa im Straßenverkehr oder im Haushalt. Erhalt der Bewegungskoordination im Alter Erhalt und Förderung der Bewegungskoordination sind mit zunehmendem Alter im Alltag unter präventiven Gesichtspunkten wichtig. Denn (in Anlehnung an Schaller, Hans-Jürgen: Bewegungskoordination im Alter, in: Handbuch Alterssport. Grundlagen - Analysen - Perspektiven. Schorndorf 2003, S. 199-242) • • • • koordinative Fähigkeiten sichern die Haltungsregulation (Standsicherheit), Unfallrisiken werden gemindert (Sturzprävention), Alltagsfertigkeiten bereiten weniger Probleme (z. B. Aufstehen aus dem Sitzen und Liegen, auf einen Hocker steigen, Orientierung im Verkehr, Benutzen von (Roll-)Treppen und Drehtüren), ungewohnte Anforderungen und Überraschungssituationen werden besser bewältigt (unerwartetes Ausrutschen, Stolpern, Fallenlassen von Gegenständen), 85 • • • Mehrfachhandlungen gelingen besser, Handlungsspielräume bleiben gewahrt, körperliche Selbstständigkeit, Selbstsicherheit und Wohlbefinden werden stabilisiert. 2.2.3.2 Gegenwärtige Situation des Seniorensports im Saarland Im Saarland sind nach der Statistik des Landessportverbandes für das Saarland für das Jahr 2008 in den saarländischen Sportvereinen 118.755 Personen im Alter von 41 – 60 Jahren Mitglied (72.974 Männer und 45.781 Frauen), 66.724 Sportvereinsmitglieder sind 61 Jahre und älter (39.363 Männer und 27.361 Frauen). Eine Förderung des Seniorensports im Saarland erfolgt durch den Landessportverband für das Saarland (LSVS) im Rahmen der Förderung des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports. Dem LSVS als Körperschaft des öffentlichen Rechts gehören die saarländischen Sportfachverbände an. Beim LSVS können wohnortnahe Sportangebote für ältere Menschen erfragt oder im Internet unter www.lsvs.de gefunden werden. Projekt „Fit und vital älter werden“ Der Saarländische Turnerbund arbeitet in dem Projekt „Fit und vital älter werden“ eng mit den Landkreisen/dem Regionalverband Saarbücken und dem Landessportverband für das Saarland zusammen. Ansprechpartner bei den Landkreisen und beim Regionalverband Saarbrücken sind die Leitstellen „Älter werden“ bzw. die Seniorenbüros. Ziel ist, die vorhandenen kommunalen und regionalen Ansätze und Strukturen zur möglichst passgenauen Vernetzung von Sport und Altenarbeit bedarfsgerecht und zukunftsorientiert weiter auszubauen, um ein flächendeckendes, qualitativ hochwertiges Bewegungsprogramm für die ältere Generation bereitzuhalten. Übersicht zum Projekt „Fit und vital älter werden" (http://www.fit-und-vital-aelter-werden.de/) Zielgruppe des Projekts • Menschen ab 30, ganz besonders für die ältere Generation • Neueinsteiger • Wiedereinsteiger • alle, die aktiv und fit werden oder bleiben möchten • alle sportlich Interessierten 86 Ziele des Projekts • Lebenslange Fitness • Lebensfreude - Wohlbefinden • Verbesserung der Lebensqualität • Steigerung der geistigen und körperliche Leistungsfähigkeit durch Bewegung und Geselligkeit • gemeinsames Erleben • bedürfnisgerechte Angebote • weitere Vernetzung innerhalb der verschiedenen Organisationen Projektbausteine • Angebote von Bewegungsprogrammen • „Tage der offenen Tür“ • Durchführung von Aktionstagen • Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern • Bewerbung von Zielgruppen • Projektdarstellung in den Medien • Unterstützung der Pilotvereine • Vernetzung von Sport- und Altenarbeit Bewegungsprogramme • Allgemeiner Präventivsport • Herz-Kreislauf/Wirbelsäulengymnastik • Rückenschule • Körperwahrnehmung und Entspannung • Gymnastik und Tanz • Aerobic und Fitness • Wassergymnastik – Aquatraining • Walking/Nordic Walking • Freizeitsport (Radfahren, Wandern, Lauftraining) • kleine Spiele / Turnspiele • Bodystyling • Qigong / Tai Chi • Boule • Aerostep • Osteoporosetraining • orthopädisches Krafttraining • Yoga • Gedächtnistraining. 2.2.4 Vorsorgen durch Impfung – auch im Alter Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass die Impfungsraten unter älteren Menschen in Deutschland sehr niedrig sind, obwohl Schutzimpfungen gerade für Senioren eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme gegen z. B. eine lebensbedrohende Grippe oder Lungenentzündung darstellen. Eine wesentliche körperliche Veränderung im Alter betrifft das Nachlassen der Immunfunktion (Immunseneszenz). Ergebnisse der biomedizinischen Alternsforschung zeigen, dass Senioren häufiger und schwerer an Infektionskrankheiten erkranken. Ältere Menschen sollten mit ihrem Arzt überprüfen, welche (Auffrischungs- und Grundimmunisierungs-)Impfungen benötigt werden, um den Impfschutz in individuell passender Weise zu gewährleisten. 87 2.2.5 Sturzprophylaxe – Sturzrisiken erkennen und vermeiden Eine erhebliche Gefahr für ältere Menschen stellen Stürze oder Beinahe-Stürze dar. Die Ursache von Stürzen kann durch Faktoren wie zum Beispiel motorische Einschränkungen, Medikamenteneinnahme, chronische Erkrankungen, Sehschwäche, Stolperfallen im Wohnumfeld bedingt sein. Neben den direkten Verletzungen entwickelt sich bei älteren Menschen oft eine ausgeprägte Angst vor weiteren Stürzen sowie insgesamt vor Immobilität. Mehr als ein Drittel aller alten Menschen ist bereits ein- oder mehrmals gestürzt. Das sind deutschlandweit etwa vier bis fünf Millionen Stürze älterer Menschen pro Jahr. Mit zunehmendem Alter häufen sich auch die Sturzfolgen: trägt ein jüngerer Mensch meist nur einen "blauen Fleck" davon, so kommt es bei älteren Menschen beim Sturz zu schmerzhaften Prellungen oder ernsthaften Frakturen. Oftmals ist die Folge von Stürzen ein Oberschenkelhalsbruch oder ein Bruch des Hüftgelenks; mehr als die Hälfte der Menschen müssen nach einem Sturz mit Mobilitätseinbußen zurechtkommen. (Huhn, Siegfried: Expertenstandard Sturzprophylaxe, in: Österreichische Pflegezeitschrift 10/2005, S. 8; Ders.: Stolperfallen auf der Spur – Mit Weitsicht vorbeugen, in: Pflege ambulant (14), 6/2003, S. 16 – 19; Stürze und ihre Folgen: Risiko erkennen und vermeiden. Eine wissensbasierte Information für ältere Menschen, hg. v. Ärztekammer Nordrhein, Düsseldorf 2007) Durch gezielte Risikominimierung und entsprechendes motorisches Training (z. B. Balance-, Kraft-, Koordinationstraining) können die Koordination, das Zusammenspiel von Muskeln und Nervensystem, ebenso wie der Gleichgewichtssinn und die Reaktionsfähigkeit gezielt bis ins hohe Alter geschult und aktiv gehalten werden. Darüber hinaus ist es notwendig, sturzfördernde Faktoren im Lebensumfeld der Senioren zu reduzieren. In Krankenhäusern und in Einrichtungen der stationären Altenhilfe zählen Stürze zu den häufigsten unerwünschten Zwischenfällen. So stürzen ca. zwei Drittel aller älteren Bewohner in geriatrischen Einrichtungen einmal pro Jahr und in 50 % der Fälle führen Stürze zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen, bei 30 % zur Hilfsbedürftigkeit und bei 20 % zur Pflegebedürftigkeit. (Voelcker-Rehage, C./Godde, B./Staudinger, U. M.: Bewegung, körperliche und geistige Mobilität im Alter, in: Bundesgesundheitsblatt, Alter/n und Gesundheit, Band 49, Heft 6, Juni 2006, S. 558 – 566, hier: S. 562) So können Stürze im Alltag vermieden werden: • • • • • • • nachts im Haus für „automatisches Licht“ sorgen, damit der Gang zur Toilette nicht im Dunkeln erfolgen muss Stolperfallen in Haus und Garten beseitigen Treppenstufen mit Handläufen versehen Rutschfestigkeit für Teppiche und Läufer herstellen Bad, Keller- und Garagenaufgänge mit Haltegriffen und Antirutschmatten ausstatten bodengleiche Duschen und/oder geeignete Einstiegshilfen bei Badewannen installieren riskante Balanceakte im Bad oder auf Treppenleitern bei der Hausarbeit vermeiden 2.3 „Saarland - aktiv und gesund“ 88 Prävention und Gesundheitsförderung sind – wie auf Grundlage von Ergebnissen der Alternsforschung dargestellt - bis ins hohe Alter wirksam und begünstigen erfolgreiches Altern, das nicht ausschließlich als Phase abnehmender Gesundheit und eingeschränkter Ressourcen bestimmbar ist. Auf Gesundheitsverhalten, Prävention und Gesundheitsförderung einzuwirken, ist eine gesamtgesellschaftliche, aus den Faktoren a) b) c) Beratung bzw. Information Befähigung Vermittlung bestehende Aufgabe und eine zugleich eigenverantwortliche Aufgabe jedes einzelnen Menschen. Ziel dabei ist, über Möglichkeiten der Vorsorge, Prävention und Gesundheitsförderung aufzuklären, die Eigenverantwortung zu stärken und sowohl Selbständigkeit als auch Lebensqualität bis ins hohe Alter zu fördern und zu erhalten. Dazu hat das Saarland im Rahmen einer auf Prävention und Gesundheitsförderung setzenden, vorausschauenden Gesundheitspolitik die Kampagne „Saarland – aktiv und gesund“ auf zwei Jahre hin konzipiert, um nachhaltig für eine gesunde und bewegungsorientierte Lebensweise quer durch die Bevölkerung19) zu werben und zu helfen, Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Handlungsempfehlungen Um ältere Menschen aktiv für Prävention und Gesundheitsförderung zu sensibilisieren, gilt es a) gesamtgesellschaftlich > auf Landesebene das Leitbild des „erfolgreichen Alterns“ zu entfalten, Gesundheitsbewusstsein in allen Generationen ebenso wie gesundheitsfördernde Lebenswelten in allen Bereichen (Wohnen, Ernährung, Arbeiten, Freizeit) zu unterstützen. > Gesundheitswissen und Wissen über den Zugang zu Gesundheitsversorgung altersspezifisch in Zusammenarbeit vor allem mit Medizinern, Therapeuten, Wohlfahrtsverbänden sowie der Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland e.V. (LAGS)20) weiterzuentwickeln. > die Notwendigkeit umfassender Prävention und Gesundheitsförderung im Zusammenhang mit der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung weit stärker als bisher in Land und Kommunen zu erkennen, und Maßnahmen z. B. in Form von Aufklärungskampagnen, persönlicher Beratung, Verhaltenstraining und gezielter Angebote einer lebenslangen und soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung zu verwirklichen. > Wissenschaft und Forschung über Gesundheit und Prävention im Alter und für das Alter im Land zu intensivieren. 19) Die Broschüre zu der Kampagne "Saarland – aktiv und gesund" kann kostenlos bei der Pressestelle des Ministeriums für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales angefordert werden. Sie informiert über gesundes Ernährungsverhalten, gibt Tipps zu verschiedenen Sport- und Bewegungsarten für jung und alt und liefert Rezepte für gesunde Mahlzeiten. Im Internet unter www.saarland.de - Gesundheit 20) Die Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheit im Saarland e.V. arbeitet seit 1990 landesweit als gemeinnütziger und unabhängiger Fachverband für Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und Prävention. Sie ist eine Gemeinschaftsinitiative von gesetzlichen Krankenkassen, Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, Berufsverbänden, Kammern, Wohlfahrtsverbänden, freien Initiativen und Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich (www.lags.de) 89 > > > > > > > > > > > b) 90 die Bereitschaft älterer Menschen zur Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen, die Impfbereitschaft und Sturzprophylaxe älterer Menschen über die Ärzteschaft sowie in Form multimedialer Informationen zu stärken. in Land und Kommunen den Erhalt und die Stärkung körperlicher, geistiger und sozialer Aktivitäten durch Förderung von Vereinen, Verbänden, Bildungseinrichtungen und Sportanlagen zu gewährleisten. in Sportvereinen attraktive Angebote für ältere Menschen zu erarbeiten, zu erhalten und Barrieren abzubauen, z. B. durch zielgruppenorientiertes Marketing, durch Schulung der Übungsleiter in Bezug auf grundlegendes Wissen über den Alterungsprozess und die Betreuung von Senioren- und altersgemischten Sportgruppen unter dem Motto „Fördern ohne zu überfordern“. Aspekte umweltbezogener Prävention im Wohn- und Arbeitsumfeld (Schutz vor Lärm, Abgasen, Verschmutzung) zu beachten. Potenziale und Handlungsmöglichkeiten für Prävention und Gesundheitsförderung in der ärztlichen und pflegerischen Praxis insbesondere mit Blick auf Risikogruppen im Alter (z. B. für sozial benachteiligte Menschen, für hochaltrige Alleinlebende) stärker auszuschöpfen. zugehende medizinisch-pflegerische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen insbesondere für alleinlebende (hochaltrige) Personen im ländlichen Raum in Kooperation mit Krankenund Pflegekassen. den Zugangsweg zu Anbietern von Sport auch ohne Vereinsmitgliedschaft, z. B. durch die Erstellung von kommunalen Sportentwicklungsplänen, zu vereinfachen. die Ernährungskompetenz älterer Menschen mit eigenem Haushalt zu stärken durch niedrigschwellige Angebote individueller Ernährungsberatung beispielsweise in Form geeigneter Gruppenvorträge oder durch aufsuchende Beratung von Kommunen, Leitstellen „Älter werden“/Seniorenbüros, Pflegestützpunkten. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime für Fragen der Ernährung im Alter und für die Veränderung des Essverhaltens älterer, insbesondere kranker Menschen zu sensibilisieren. die Benutzung von Hör- und anderen Hilfsmitteln seitens der Familie, Ärzte, des Pflegepersonals zu unterstützen. die zahnmedizinische Versorgung älterer Menschen u. a. durch regelmäßige Betreuung von Personen in Heimen einschließlich Sensibilisierung des Pflegepersonals zu gewährleisten. individuell > im Rahmen einer ganzheitlichen Altersvorsorge in allen Lebensaltern das persönliche Gesundheitsbewusstsein zu stärken. > durch Bewegungs- und Gleichgewichtstraining sowohl körperliche als auch geistige Funktionsfähigkeit zu bewahren, lang anhaltende Überbelastungen zu vermeiden, sich vor Stürzen zu schützen, um Mobilität und Selbständigkeit im Alltag nach Möglichkeit zu erhalten. > den Tabak- und Alkoholkonsum zu reduzieren bzw. darauf zu verzichten, um vor allem das Herzinfarktrisiko zu senken. > für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung zu sorgen und starkes Übergewicht (Adipositas) als Ursache einer Reihe von Krankheiten zu vermeiden. > eine intensive Mund-, Zahn- und Prothesenhygiene sicherzustellen. > regelmäßig geistig aktiv zu sein und soziale Beziehungen zur Förderung der seelischen Gesundheit zu pflegen. 3. Gesundheitliche Versorgung älterer Menschen Aufgrund der demografischen Entwicklung stellt die Betreuung und medizinische Versorgung älterer Patienten an alle Akteure des Gesundheitssystems besondere Anforderungen. Wie stark der Anstieg der Krankenhausbehandlungen von pflegebedürftigen älteren Menschen ist, hängt auch davon ab, wie sich Lebens- und Arbeitsumstände auf den Gesundheitszustand der Menschen auswirken. 3.1 Ambulante Versorgung durch den Hausarzt Den Ergebnissen des Alterssurveys zufolge nehmen mit steigendem Alter Besuche in allgemeinmedizinischen und internistischen Arztpraxen zu. Anders bei der zahnmedizinischen Versorgung. Rund ein Drittel der 70- bis 85-Jährigen war über den Zeitraum eines Jahres nicht beim Zahnarzt, obwohl auch Menschen ohne Zähne bzw. mit Zahnprothesen halbjährliche Kontrollen nutzen sollten. Risiko Multimorbidität Bei der ambulanten Versorgung und Betreuung älterer Menschen sollte der ganzheitliche Blick geschärft werden. Denn Kennzeichen vieler geriatrischer Patienten ist das gleichzeitige Vorliegen mehrerer voneinander unabhängiger Krankheiten, die eine sehr individuelle Behandlung des einzelnen Patienten erfordern. Durch ganzheitliche Behandlung der Patienten und gezielte Rehabilitation können älteren Menschen ein großes Maß an Selbständigkeit, Lebensqualität und Beschwerdefreiheit wiedererlangen. Das bei älteren Menschen erhöhte Risiko der Multimorbidität, die Gefahr der Einschränkungen in den Aktivitäten des alltäglichen Lebens und der häufig komplexen Problemkonstellation bei zu Hause (allein) lebenden älteren Menschen erfordert einen umfassenden Behandlungsansatz und ein adäquates Management von Schnittstellenproblemen. Hier kommt dem Hausarzt eine zentrale Rolle zu. 90 % aller älteren Menschen werden kontinuierlich durch einen Hausarzt medizinisch versorgt. Er betreut diese Patienten häufig über viele Jahre und hat damit die Möglichkeit, die Patienten bei ihrer Vorbereitung auf das Älterwerden zu unterstützen und ihnen die Wichtigkeit der Prävention nahe zu legen. Der Hausarzt hat darüber hinaus eine wichtige Steuer- und Koordinierungsfunktion bei der Zusammenarbeit mit niedergelassenen Spezialisten sowie stationären bzw. teilstationären geriatrischen Einrichtungen und Pflegediensten bzw. pflegenden Angehörigen. Die grundsätzliche Verbesserung der gesundheitlichen Lage alter Menschen insgesamt in den vergangenen Jahren darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere im hohen Alter ein erhebliches Krankheitsrisiko besteht. Am Beispiel der Demenzerkrankungen (=> Kapitel 1.3.1) wird deutlich, dass auch im Bereich der häuslichen und stationären neuro-psychiatrischen Krankenpflege noch Handlungsbedarf besteht und die Kooperation zwischen Hausärzten und dem neurologisch-geriatrisch-gerontopsychiatrischen Sektor eine Vertiefung benötigt. Übergeordnetes Ziel in der ambulanten ärztlichen Versorgung von Alterspatienten ist es, sowohl eine Überals auch eine Fehl- und Unterversorgung zu vermeiden. 91 3.2 Medizinische Versorgung in stationären Einrichtungen 3.2.1 Medizinische Versorgung in stationären Einrichtungen der Altenhilfe Die in stationären Einrichtungen der Altenhilfe lebenden älteren Menschen bedürfen je nach ihrer gesundheitlichen Situation neben den Dienstleistungen und Hilfestellungen bei Lebensgestaltung, Verpflegung, Betreuung und Pflege auch einer nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse ausgerichteten gesundheitlichen und medizinischen Versorgung. Die Heimträger als Partner des Heimvertrages haben bei Bedarf eine humane und aktivierende Pflege sowie ärztliche und gesundheitliche Betreuung der in der Einrichtung lebenden älteren Menschen zu gewährleisten. Dabei übernehmen deren Hausärzte, in begründeten Fällen auch die zusätzlich hinzugezogenen Fachärzte, die medizinische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die in den stationären Einrichtungen beschäftigten Pflegefachund –hilfskräfte stellen die erforderlichen Dienste der Grundpflege und der Behandlungspflege, ggfls. auf Grund ärztlicher Anordnungen, sicher. Darüber hinaus obliegt den Pflegefachkräften der stationären Einrichtung die Verabreichung der ärztlich verordneten Arzneien und Medikamente. Für einen an den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichteten Heimalltag sind darüber hinaus auch therapeutische Angebote wie Gymnastik und Massagen (erforderlichenfalls unter entsprechendem Einsatz weiterer fachlicher Hilfen, z. B. von Krankengymnasten, Bewegungstherapeuten usw.) angezeigt, um körperlichen Einschränkungen vorzubeugen bzw. bei bereits bestehenden Einschränkungen passende aktivierende Angebote vorzuhalten. Wesentlich zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer gesundheitlichen Versorgung tragen vorbeugende und rehabilitative Pflege- und Betreuungsmaßnahmen sowie tagestrukturierende Maßnahmen sowie abwechslungsreiche Freizeitangebote der Einrichtungen bei. 3.2.2 Geriatrische stationäre Akutversorgung Die Geriatrie21) ist gefordert, wenn mehrere sich wechselseitig und nachhaltig beeinflussende Krankheiten nebeneinander bestehen (Multimorbidität). Die Heilung bei diesen Patientinnen und Patienten ist meist verzögert und die Motivation zur Wiedergesundung geschwächt. Die Wirkung insbesondere von medikamentösen Therapien unterscheidet sich von derjenigen bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Häufig treten im Alter nach Bettlägerigkeit Einschränkungen des Bewegungsapparates sowie Auffälligkeiten der Atmungs- und Herz-/Kreislauf-Organe auf. Neben körperlichen Gebrechen sind häufig psychische Störungen zu beobachten, die zu Problemen im Zusammenleben mit Angehörigen und Betreuenden führen. Die Geriatrie verlangt daher ein fächerübergreifendes Arbeiten. Auch die Zielsetzung bei der akutstationären Behandlung geriatrischer Patientinnen und Patienten unterscheidet sich von der bei jüngeren Menschen. Hauptziel ist die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten (z. B. Mobilität, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung) und die Verminderung von Anzahl und Dauer der Klinikaufenthalte mit Unterstützung von Angehörigen (z. B. durch Beratungen und Schulungen). Diese Ziele werden am ehesten erreicht, wenn die Betroffenen parallel zur fachspezifischen Intervention (z. B. Hüftendoprothetik, Schlaganfalltherapie) spezifisch geriatrisch behandelt werden und das unmittelbare Betreuungsumfeld (Krankenzimmer, Station, Stationspersonal) nicht gewechselt werden muss. 92 21) Geriatrie (Altersheilkunde): Lehre von den Krankheiten des alternden und des alten Menschen und ihrer Behandlung, gewissermaßen der medizinische Zweig der Gerontologie. Im deutschen Sprachraum Grenzziehung zum geriatrischen Patienten relativ willkürlich ungefähr beim 70. Lebensjahr Bedarf akutgeriatrischer Versorgung steigt Auf Grund der demografischen Entwicklung steigt der Bedarf an akutgeriatrischer Versorgung. Hatte das Saarland im Jahr 1995 noch 15,1 geriatrische Fälle pro 10.000 Einwohner und 1.640 Fälle insgesamt, so waren es im Jahr 2006 bereits 23,3 Fälle pro 10.000 Einwohner und 2.433 Fälle insgesamt. Im gleichen Zeitraum sank allerdings die Verweildauer von 30,9 Tagen auf 21,5 Tage. Die Auslastung der geriatrischen Akutversorgung betrug 93,0 % im Jahr 2006. (Quelle: Statistisches Landesamt) Hinzu kommt, dass - wie in allen anderen Fachbereichen auch - eine Verlagerung von der stationären Versorgung in den ambulanten Bereich stattfindet und der Übergang von der akutgeriatrischen Versorgung in die geriatrische Rehabilitation oft fließend ist. Der Anteil der Frauen in der stationären geriatrischen Akutversorgung war im Jahr 2006 weitaus höher als der der Männer und betrug ca. 70 %. Eine Darstellung der Altersstruktur ergibt folgendes Bild: Bis 64 Jahren betrug der Anteil der männlichen Patienten an der Gesamtzahl der geriatrischen Patienten ca. 5,5 % und der weibliche Anteil ca. 4,2 %. Diese Altersgruppe ist die einzige, bei der der Männeranteil überwiegt. In allen anderen Altersgruppen liegt der Frauenanteil (immer gemessen an der Gesamtzahl der geriatrischen Patienten) wesentlich höher, was folgende Darstellung zeigt: Altersgruppe bis 64 65 bis 79 80 bis 89 90 und älter Männer 5,5 % 18,2 % 6,0 % 0,6 % Frauen 4,2 % 38,3 % 24,7 % 2,6 % Entsprechend dem Krankenhausplan für das Saarland 2006 – 2010 werden im Saarland an drei Krankenhäusern die nachfolgend genannten akutgeriatrischen Kapazitäten vorgehalten (Stand: 1.1.2008): Krankenhaus SHG-Kliniken Sonnenberg St. Nikolaus-Hospital Wallerfangen DRK-Klinik Mettlach Insgesamt Vollstationäre Betten 126 15 15 156 Teilstationäre Plätze 14 2 10 26 In den SHG-Kliniken Sonnenberg werden zusätzlich folgende Schwerpunkte vorgehalten: - naturheilkundlicher Schwerpunkt innerhalb der geriatrischen Hauptfachabteilung gerontopsychiatrischer Schwerpunkt. 3.2.3 Gesundheitsversorgung im Krankenhaus Zu den grundlegenden Zielen zukunftsorientierter Gesundheitsversorgung im Krankenhaus mit Blick auf ältere Patienten gehören Qualitäts- und Patientenorientierung. 93 Gemäß § 9 Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) müssen Krankenhäuser eine den fachlichen Erfordernissen und dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechende Qualität ihrer Leistungen gewährleisten und sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung beteiligen. Zur Erfüllung dieser Pflicht haben sie die nach dem Vierten Kapitel, Neunter Abschnitt des SGB V (§§ 135 – 139 c) vorgesehenen Maßnahmen zu treffen. Der Krankenhausträger ist deshalb verpflichtet, für das in seiner Trägerschaft stehende Krankenhaus entsprechende Organisationsstrukturen aufzubauen, um das angebotene medizinische Leistungsspektrum (Versorgungsauftrag gem. Krankenhausplan) entsprechend dem jeweiligen wissenschaftlichen Stand gewährleisten zu können (Eigenverantwortung des Krankenhausträgers). Dies setzt voraus, dass Ärztinnen und Ärzte entsprechend fortgebildet werden. Dabei obliegt speziell die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und die Gewährleistung der Weiter- und Fortbildung des ärztlichen Dienstes der Ärztlichen Direktion (§ 18 SKHG). Neben organisationsorientierten Programmen (z. B. zur Verbesserung der Krankenhaushygiene und Maßnahmen für eine transparente Organisationsentwicklung), patientenorientierten Programmen (z. B. Prävention spezieller Krankheiten, Rauchentwöhnungs- und Ernährungsprogramme, Angebote der Gesundheitsberatung und –erziehung, Einbeziehung freiwilliger Laienhelfer) sowie umfeldorientierten Programmen (z. B. durch Schaffung kommunaler Allianzen für Gesundheit zur Organisation von Reha-Maßnahmen, der Überleitungspflege oder psychosozialer Betreuungsangebote) wird es hierbei vor allem darum gehen, die den Genesungsprozess der Patienten negativ beeinflussenden Schnittstellenprobleme innerhalb des „Settings Krankenhaus“ sowie zwischen stationärer und ambulanter Versorgung zu beseitigen. 3.3 Arzneimittelversorgung Es ist eine bekannte Tatsache, dass der Arzneimittelverbrauch mit steigendem Lebensalter zunimmt. Der Personenkreis „70+“ ist traditionell eine bedeutende Apothekenzielgruppe. Das Vorliegen mehrerer Krankheitsbilder hat zur Folge, dass ältere Menschen oft mit mehreren Medikamenten gleichzeitig behandelt werden, was das Risiko von Neben- und Wechselwirkungen erhöht. Darüber hinaus haben ältere Menschen oft Probleme bei der Medikamenteneinnahme aufgrund von Einschränkungen bei Feinmotorik, Seh/Hörvermögen oder Gedächtnisleistung. Zudem führen altersabhängige Organveränderungen zu Änderungen in der Arzneimittelwirkung, was Ausmaß und Geschwindigkeit von Aufnahme, Verteilung, Abbau und Ausscheidung beeinflusst. Aus senioren- und gesundheitspolitischer Sicht ist es daher wichtig, dass Arzneimittelhersteller, Apotheker, Mediziner und Pflegekräfte ein besonderes Augenmerk auf Betreuung und Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen mit Arzneimitteln legen. 3.3.1 Apothekenversorgung 94 Das Saarland ist das Bundesland mit der höchsten Apothekendichte. Es gibt mehr als 350 Apotheken. Während im Bundesdurchschnitt auf 1 Apotheke ca. 3.800 Einwohner kommen, sind es im Saarland ca. 2.800 Einwohner. Apotheken haben einen öffentlichen Versorgungsauftrag und stellen die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung flächendeckend, ortsnah und 24 Stunden am Tag sicher. Damit erfüllen sie eine gesetzlich übertragene, öffentliche Aufgabe. Soweit erforderlich sichern Filial-, Zweig- und Notapotheken, Rezeptsammelstellen, der Arzneimittelversand durch Apotheken und der Botendienst durch Apotheken jederzeit die Arzneimittelversorgung in entlegene Gebiete und insbesondere auch für immobile Patienten. Zum Versorgungsauftrag gehören neben angemessener Bevorratung insbesondere die Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln sowie die Information und Beratung über Arzneimittel. Arzneimittelsicherheit durch Beratung – die seniorengerechte Apotheke Das in Apotheken tätige pharmazeutische Personal leistet kundenorientiert mit fundierter und verständlicher Information und Beratung einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und Sicherheit in der Arzneimitteltherapie. Die Aufklärung der Patienten über die richtige Medikamenteneinnahme (z. B. Art der Einnahme, Dosierung, optimaler Einnahmezeitpunkt, Fragen zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und nichtmedikamentösen Begleitmaßnahmen) trägt wesentlich zum Behandlungserfolg bei. Ältere Menschen sollten daher in ihrer Apotheke großen Wert auf Beratung legen und lieber einmal zu viel als zu wenig fragen. Mit Blick auf die Tatsache, dass ältere Patienten oft mehrere Arzneimittel gleichzeitig verordnet bekommen, ist das pharmazeutische Personal auf höchstem Niveau gefordert, insbesondere bei der Überprüfung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen verschriebenen Arzneimitteln und der Information über mögliche Nebenwirkungen. Hierzu bedienen sich die Apotheken spezieller Datenbanken oder der Literatur und stellen Rückfragen bei Ärzten und Heimpersonal. Profilierungsmöglichkeiten bestehen für Apotheken in Bezug auf die Seniorenfreundlichkeit ihres Service. Qualitätsmerkmale für die "Seniorengerechte Apotheke" sind einer Umfrage der BAGSO22) (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) zufolge: • • • • • • • • • seniorenorientierter Beratungsservice, Angebot, die Arzneimittel in einzelne Dosiseinheiten für die individuelle Einnahme zu teilen oder zu verblistern, barrierefreier Zugang, gut lesbare Preisschilder, reichhaltiges Informationsangebot, diskreter Beratungsbereich, gut sichtbares Produktangebot, Serviceleistungen der Apotheke, Qualifikation des Personals. Integrierte Versorgung Im Rahmen integrierter Versorgung arbeiten Apotheken eng und konkret auf den Einzelfall bezogen mit behandelnden Ärzten und anderen Heilberufen sowie mit sonstigen Institutionen des Gesundheitswesens zusammen. Ergeben sich aufgrund von apothekenüblichen Präventionsmaßnahmen, z. B. Blutdruck-, Cholesterin-, Blutzuckermessung, oder aus einem Patientengespräch Anhaltspunkte für eine Erkrankung des Patienten, empfehlen die Mitarbeiter der Apotheke eine Konsultation des Arztes. 22) Basis war eine Befragung der BAGSO, im Rahmen derer 350 ältere Menschen ihre „ideale Apotheke“ beschrieben haben 95 Apotheken sorgen für einen optimalen Informationsfluss über den Arzneimitteleinsatz beim Patienten an den Nahtstellen innerhalb und zwischen ambulanter, stationärer und rehabilitativer Versorgung. Damit leisten sie einen Beitrag zum effizienten Ressourceneinsatz bei Arzneimitteln und zur Gesundheit der Bevölkerung insgesamt. Neue Versorgungsform Wochenblister – praktisch vor allem für ältere Menschen Wenn Arzneimittel unregelmäßig, falsch oder überhaupt nicht eingenommen werden, sprechen Mediziner und Apotheker von fehlender Therapietreue (Non-Compliance). Sie führt zu zusätzlichen Ausgaben des Gesundheitssystems, beispielsweise Mehraufwendungen für unnötig lange Krankenhausaufenthalte. Experten beziffern diese Kosten auf rund zehn Milliarden Euro pro Jahr. Zusätzlich landen in Deutschland jährlich rund 4.000 Tonnen ungenutzte Arzneimittel im Wert von 500 Millionen Euro auf dem Müll. Medizinisch gesehen steigt der Anteil der Patienten mit Polypharmazie, d.h. immer mehr Patienten müssen zur Behandlung ihrer Krankheiten immer mehr Arzneimittel gleichzeitig einnehmen. Immer mehr im Vordergrund steht deshalb die ambulante Versorgung älterer Menschen, die durch ein Zusammenspiel von professionell erbrachten Dienstleistungen und Helfern innerhalb und außerhalb der Familie sichergestellt werden muss. Eine verbesserte Compliance, d.h. Einhaltung der ärztlichen Verordnungen, kann dabei den Pflegebedarf und vor allem Krankenhauseinweisungen vermindern, die oft auch auf Medikamentenzwischenfälle zurückgehen. Vor diesem Hintergrund hat ein saarländisches Unternehmen die automatisierte patientenindividuelle Arzneimittel-Versorgung über sogenannte Wochenblister (Durchdrückverpackungen) entwickelt. Tag für Tag sind darin die vom Arzt verordneten festen oralen Medikamente zusammengestellt, vorsortiert für sieben Tage und vier Einnahmezeitpunkte (morgens, mittags, abends, nachts). Die vollautomatisierte Technologie zum Herstellen von patientenindividuellen Wochenblistern ist weltweit ein absolutes Novum. Sie hat das Potenzial, international zum Vorreiter eines hochtechnisierten, patientenindividuellen Versorgungssystems zu werden. Das neue System sorgt für eine therapiegerechte Einnahme-Praxis und hilft damit vor allem älteren Menschen und chronisch Kranken, länger im gewohnten Lebensumfeld zu bleiben. Der Einsatz vorsortierter Arzneimittel bedeutet für betreuende Angehörige sowie Pflegekräfte von Heimen eine erhebliche Zeitersparnis. Die so gewonnene Zeit kann wiederum für die eigentliche Pflege genutzt werden. 3.4 Rehabilitation Forschungsergebnisse zeigen, dass bis ins hohe Alter Rehabilitationspotenziale bestehen. Leider werden diese u. a. aufgrund von Schnittstellenproblemen noch zu wenig genutzt. 96 Ältere Menschen sollen nach einem Unfall, Schlaganfall, Sturz, einer Operation oder einer Krankheit so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können und die Chance erhalten, aktiv am Leben teil zu haben. Deshalb haben ältere Menschen seit dem 1. April 2007 einen Rechtsanspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation sowohl im ambulanten, teilstationären als auch im stationären Bereich gemäß dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG). Auch die so genannte mobile Rehabilitation, welche im gewohnten Wohnumfeld des Patienten durchgeführt wird, gehört seitdem zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Je nach Art der Krankheit oder des Unfalls übernimmt für die verschiedenen Rehabilitationsleistungen die Kranken-, Unfall- oder Rentenversicherung die Kosten. Die geriatrische Rehabilitation ist eine spezialisierte Form der Rehabilitation für ältere Menschen. Sie berücksichtigt die charakteristische Multimorbidität der im Schnitt ca. 80-jährigen Patienten und die damit verbundenen komplexen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Erkrankungen. Grundsätze der Rehabilitation Die Rehabilitation älterer Menschen zielt darauf ab, ein möglichst hohes Maß an Selbständigkeit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Durch Mobilisierung und Förderung einzelner Fertigkeiten soll körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden erhalten, wiederhergestellt oder verbessert werden. Es geht also letztendlich um eine Verbesserung der Hilfs- und Pflegesituation für den betroffenen Menschen selbst, wie auch für seine Angehörigen oder sein soziales Umfeld - darum, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, hinauszuzögern oder zu vermindern. Früh einsetzende Reha Eines der tragenden Prinzipien der Rehabilitation ist die Forderung, umfassende Rehabilitationsmaßnahmen zum frühest möglichen Zeitpunkt einzuleiten und dies als Leitidee dem gesamten Behandlungskonzept zugrunde zu legen. Es geht zum einen darum, den drohenden Verlust an Rehabilitationspotenzial und damit die Gefährdung des objektiv möglichen Rehabilitationserfolgs auszuschließen. Zum anderen geht es darum, vermeidbare Verzögerungen zu verhindern, um die unverzichtbare Motivation des Rehabilitanden und seine aktive Mitwirkung an der Rehabilitation zu bewahren. Die wissenschaftliche Forschung belegt, dass eine frühe Berufsperspektive und Rückkehrmotivation den Rehabilitationserfolg deutlich verbessern. Dies gilt sowohl für die Einsatzbereitschaft bei der „Mobilisierungsarbeit“, z. B. bei orthopädischen Krankheiten, als auch für die Vermeidung von Rückfällen bei psychosomatischen Störungen. Reha vor Pflege Durch zielgerichtete und am individuellen Bedarf orientierte Rehabilitationsleistungen können Menschen in vielen Fällen vor Pflegebedürftigkeit und dem Verlust von Lebensqualität bewahrt werden. Aber auch bei bereits eingetretener Pflegbedürftigkeit kann Rehabilitation das Ausmaß an erforderlichen Hilfen begrenzen. Ein wichtiger und durchgängiger Handlungs- und Leistungsgrundsatz im Sozialrecht lautet daher: Rehabilitation vor und bei Pflege 97 Stationäre geriatrische Rehabilitation Bisher findet die Rehabilitation älterer Menschen vorrangig in stationären Reha-Einrichtungen statt. Aufnahme in geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen finden Patienten i.d.R. über den Krankenhausoder Hausarzt, wenn gezielte und intensive therapeutische Maßnahmen eine Verbesserung erwarten lassen. Nach einer diagnostischen Abklärung (geriatrisches Assessment)23) ist Ausgangspunkt der Behandlung die Bestimmung des individuellen Rehabilitationsziels, welches von den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Patienten abhängt. Meist geht es darum, Alltagsverrichtungen - wie essen, trinken, zur Toilette gehen - soweit möglich, wieder ohne fremde Hilfe ausführen zu können. Das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales hat für den Bereich der stationären Rehabilitation keine Planungskompetenz analog der Krankenhausplanung. Die Versorgung ist von Krankenkassen und Trägern der Rehabilitationseinrichtungen im Rahmen der Selbstverwaltung sicherzustellen. Aus der gesundheits- und sozialpolitischen Gesamtverantwortung heraus ist das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales jedoch mitverantwortlich dafür, dass Schnittstellenprobleme vermieden werden und ein nahtloser Übergang von der Krankenhausversorgung in geriatrische Rehabilitationseinrichtungen ermöglicht wird. Im Saarland besteht ein flächendeckendes Netz von geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsverträgen gemäß § 111 SGB V. Im Regionalverband Saarbrücken und in jedem Landkreis werden insgesamt 6 geriatrische Rehabilitationseinrichtungen mit insgesamt 350 Betten und 75 tagesklinischen Plätzen vorgehalten, überwiegend in direkter Anbindung an ein Akut-Krankenhaus. Die Auslastung der vollstationären geriatrischen Rehabilitation betrug 83,1 % im Jahr 2006, die Fallzahl belief sich auf 2.854 Fälle. (Quelle: Statistisches Landesamt) Geriatrische Rehabilitation im Saarland wird an folgenden Standorten vorgehalten: Geriatrische Rehabilitationseinrichtung DRK–Klinik Mettlach SHG Fachklinik Quierschied Geriatrische Reha–Klinik am Kreiskrankenhaus St. Ingbert Geriatrische Reha–Klinik am Marienkrankenhaus St. Wendel St. Nikolaus Hospital Wallerfangen Fachklinik St. Hedwig Illingen Insgesamt Betten 2008 60 80 tagesklinische Plätze 2008 10 15 50 10 60 60 40 350 20 10 10 75 Die so geschaffene wohnortnahe Versorgungskette ermöglicht eine nahtlose, frühzeitige und gezielte Rehabilitation, um den alten Menschen ein großes Maß an Selbstständigkeit und Lebensqualität zu erhalten bzw. zurückzugeben. 98 23) Ist die umfassende Diagnose und Beurteilung der Lebensumstände des älteren Patienten verbunden mit einer Einschätzung und Darstellung der Funktionsdefizite im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich. 3.5 Gerontopsychiatrie Psychiatrische Probleme im Alter Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird in Zukunft die gerontopsychiatrische Versorgung für alt gewordene, psychisch kranke Menschen und von Menschen, die im Alter psychisch krank werden, eine besondere Aufgabe darstellen. Im höheren Lebensalter treten oft neue psychische Belastungssituationen auf, die zu psychischen Erkrankungen führen können wie z. B.: • • • • • • die Verarbeitung der Ruhestandssituation mit vermeintlich gesellschaftlicher Entwertung und Entpflichtung (Altersdepression), die Verringerung der Kontakte durch Versterben gleichaltriger Freunde und Bekannter sowie durch körperliche Beeinträchtigungen, Wohnungswechsel (zu den Kindern, ins Heim), Verlust des Partners/der Partnerin, Zunahme chronischer und akuter Erkrankungen, hirnorganische Abbauprozesse (Demenzen sowie organische Psychosyndrome bei körperlichen Erkrankungen). Etwa 25 bis 30 % der über 65-Jährigen leiden unter psychischen Erkrankungen. (Quelle: "Psychiatrie in Deutschland - Strukturen, Leistungen, Perspektiven" erarbeitet von der Arbeitsgruppe Psychiatrie der Obersten Landesgesundheitsbehörden im Auftrag der Gesundheitsministerkonferenz, Stand: Februar 2007) Dabei treten vor allem behandlungsbedürftige depressive Störungen zunehmend in den Vorder- grund. Außerdem ist damit zu rechnen, dass innerhalb des medizinischen Versorgungssystems die Wechselwirkungseffekte zwischen somatischen und psychischen Erkrankungen an Bedeutung gewinnen werden. So werden beispielsweise 40 % aller alten Schlaganfallpatienten depressiv, 50 % davon mit chronischem Verlauf und nachteiligen Folgen für die Rehabilitation. Integrativer Versorgungsansatz Trotz vielfacher Forderungen nach Entwicklung von gerontopsychiatrischen Versorgungsstrukturen ist es gelungen, den überwiegenden Teil der älteren psychisch kranken Menschen im bestehenden Versorgungssystem zu betreuen. Denn die Schaffung spezieller gerontopsychiatrischer Einrichtungen würde zu einer Ausgrenzung dieser Personengruppe führen. Die Teilhabe psychisch kranker Menschen (jeden Alters) am Leben in der Gesellschaft kann nur realisiert werden, wenn diesen die bereits bestehenden Versorgungsund Leistungsangebote offen stehen. Dieser integrative Ansatz der Versorgung macht es erforderlich, dass sich insbesondere stationäre Altenhilfeeinrichtungen personell, räumlich und organisatorisch auf Menschen mit psychiatrischen Beeinträch- 99 tigungen einstellen, denn mehr als 40%24) der Heimbewohnerinnen und -bewohner benötigen psychiatrische Unterstützung. Hier kann beispielsweise die psychiatrische Institutsambulanz, die in jedem Landkreis/im Regionalverband Saarbrücken aufsuchend arbeitet, neben der Behandlung auch eine Organisationsberatung erbringen. Bei einer umfassenden Vernetzung der verschiedenen Hilfsangebote ist die bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker älterer Menschen auch ohne spezielle gerontopsychiatrische Einrichtungen sichergestellt. Handlungsempfehlungen Um das vielfältige Angebot medizinischer, pflegerischer und sozialer Leistungen passgenau auf die Verschiedenartigkeit älterer Patienten – orientiert an individuellen physischen, psychischen, sozialen und materiellen Ressourcen und Bedarfslagen – auszurichten, gilt es > die Geriatrie in höherem Maße als bedeutsames medizinisches Fachgebiet zu begreifen und die Erkenntnisse geriatrischer Forschung und Praxis stärker in Diagnostik und Therapie im Bereich der ambulanten und stationären Versorgung einzubeziehen. > Angehörige und Hausärzte für eine Früherkennung und Erstbehandlung von dementiellen Erkrankungen weiter zu sensibilisieren und auf Hilfenetze und Therapiemöglichkeiten in Beratungsstellen aufmerksam zu machen. > das Beratungs- und Service-Angebot von Apotheken mit Blick auf die speziellen Beratungsbedürfnisse älterer Menschen stärker auszurichten. > die Zusammenarbeit zwischen Apotheken, Ärzten und stationären Einrichtungen der Altenhilfe zu intensivieren. > präventive, kurative und rehabilitative Möglichkeiten zu Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit zu nutzen. Dazu bedarf es der Auswahl eines passenden Angebots in Abstimmung mit behandelnden Ärzten und Pflegepersonal. > einen erfolgreichen Transfer des gerontopsychiatrischen Wissens aus dem klinischen Sektor in den Bereich der Altenhilfe/Altenpflege sicherzustellen. Dies betrifft vor allem die Qualifizierung von Menschen in Ausbildung/Studium/Fort- u. Weiterbildung, die Hilfen und Leistungen für ältere Menschen erbringen. > eine stetige Verbesserung der Kooperation zwischen Hausärzten und dem neurologisch-geriatrisch-gerontopsychiatrischen Sektor anzustreben und zu verwirklichen. > im Rahmen der Wissenschaftsförderung und einer Intensivierung der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen (Gerontopsychiatrie, Geriatrie, Neuromedizin, Pflegewissenschaften, Sozialwissenschaften) die altersspezifischen Aspekte und die Belange spezifischer Gruppen (z. B. alleinlebende hochaltrige Menschen, Migranten) bei der Entwicklung von präventiven Strategien, gesundheitsfördernden Maßnahmen, bei Diagnostik, Therapie und Rehabilitation besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus gilt es, dem nach wie vor bestehen Forschungsbedarf im Bereich Gerontopsychiatrie vor allem zu Fragen der Versorgung z. B. dementiell erkrankter Menschen entsprechend Rechnung zu tragen. 24) 100 Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitstudie ermittelte das iso-Institut für die am „Gerontopsychiatrischen Modellprojekt der SHG“ beteiligten Pflegeheime im Regionalverband Saarbrücken bereits einen Schweregrad der psychischen Beeinträchtigung in Höhe von 60% bei im Durchschnitt 82-jährigen Bewohnern, vgl. Kirchen-Peters, Sabine/HerzSilvestrini, Dorothea: Gerontopsychiatrisches Modellprojekt der SHG „Beratungsdienst für Angehörige und Heime“, 2. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung, hg. v. Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Saarbrücken 2007, S. 28. 4. Gesundheitswirtschaft im Saarland Die saarländische Gesundheitswirtschaft hat sich zu einem bedeutenden Faktor im Wirtschaftsgefüge des Landes entwickelt. Die demografische Entwicklung, aber auch der technologische Fortschritt bieten heute neue Perspektiven für diesen Wirtschaftszweig. Einerseits wirkt sich der demografische Wandel auf die Alterung der Bevölkerung und die Ausdehnung der individuellen Lebenszeit aus. Andererseits gibt es auch sehr viel mehr Therapie- und Vorsorgemöglichkeiten als früher. Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Gesundheitswirtschaft im Saarland Der demografische Wandel bewirkt, dass der Sektor in Zukunft weiter wachsen wird, wie u.a. die Prognos AG in ihrem aktuellen „Deutschland-Report 2030“ feststellt25). Auch die Unternehmensberatung McKinsey prognostiziert in ihrer Studie „Deutschland 2020“ einen starken Anstieg der Beschäftigung im Gesundheitswesen26). Es liegt nahe, dass die massiven Verschiebungen zwischen den Altersgruppen Auswirkungen auf die regionale Gesundheitswirtschaft haben werden, wobei sowohl der Arbeitsmarkt als auch die Versorgungsund Angebotsstrukturen betroffen sind27). Insofern wird die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, nach Heilmitteln und Medizintechnik in den nächsten Jahren steigen. Trends wie • • • • die permanente Zunahme der Zahl von Kleinfamilien und Single-Haushalten, die steigende Selbstverantwortung der Menschen für die eigene Gesundheit bei gleichzeitiger Konsolidierung des Rahmens der gesetzlich finanzierten Leistungen, die Revolutionierung der häuslichen Pflege-Situation durch neue Technologien der Kommunikation, die durch zunehmenden Abbau nicht notwendiger Bettenbelegungen in der Klinik wachsende Zahl von Betreuungen schwerer Fälle in ambulanter (Homecare-28)) Situation, verdeutlichen die Wachstumspotenziale und die Notwendigkeit für ein größeres Engagement in diesem Markt in den kommenden Jahren. Gesundheit ist im Saarland daher ein bedeutender Faktor für Wachstum und Beschäftigung. Rund 45.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte werden gezählt. Nach der regionalen Statistik ist die Zahl gegenüber dem Jahr 2000 um 7,3 Prozent gestiegen. Je nach Abgrenzung ist festzustellen: Zwischen 12 und etwas mehr als 15 Prozent aller Beschäftigten sind diesem Bereich zuzuordnen. Damit steht das Saarland an vierter Stelle der deutschen Bundesländer. 25) Deutschland-Report 2030 der Prognos AG (Prognos AG) McKinsey AG: Deutschland 2020 – Zukunftsperspektiven für die deutsche Wirtschaft“ (McKinsey) 27) vgl iso-Studie, S. 18f. 28) Homecare gilt in der Medizinproduktebranche als Wachstumsmarkt mit Zukunft. Insbesondere durch die demografische Entwicklung sind immer mehr Menschen auf häusliche Therapiekonzepte angewiesen. Homecare ist ein relativ junger Versorgungsbereich im deutschen Gesundheitswesen. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich Homecare zu einem unersetzlichen Bestandteil der ambulanten Patientenversorgung entwickelt. Homecare steht für eine sektorenverbindende Versorgungsform, die nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ arbeitet. 26) 101 Der engere Health-Care-Bereich umfasst rund 400 Betriebe, darunter zahlreiche Aus- und Neugründungen aus dem Umfeld der Hochschulen, aus Medizintechnik, Medizinprodukte, Pharma und innovative Dienstleistungen rund ums Gesundheitswesen. Hier arbeiten heute rund 8.500 Menschen. Definition Gesundheitswirtschaft Eine aktuelle Studie des Saarbrücker iso-Instituts im Auftrag der Arbeitskammer des Saarlandes29) geht von folgender Definition der Gesundheitswirtschaft aus: „Neben dem Kern des klassischen Gesundheitswesens, das auch das Leistungsspektrum der medizinischen Versorgung abdeckt, werden auch die wertschöpfenden und produktiven Wirtschaftsbranchen erfasst, die Vorleistungen und Zulieferdienste für die medizinische Versorgung erbringen“30). In diesem Sinne umfasst der Begriff der Gesundheitswirtschaft folgende Branchen und Segmente entlang der Wertschöpfungskette: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Betriebe und Einrichtungen des Gesundheitswesens (Kliniken, Praxen etc.) Pflegeeinrichtungen (ambulante/stationäre Einrichtungen der Alten- und Behindertenpflege) Hersteller aus den Vorleister- und Zulieferbranchen (Pharmaindustrie, Medizintechnik/Medizinprodukte, Gesundheitshandwerk) Handelsbranche (Groß- und Einzelhandel für pharmazeutische und medizinische Produkte) Hochschul- und Forschungseinrichtungen Betriebe der Verwaltung (Krankenkassen, Sozialversicherungsträger, Verbände, Kammern etc.)31) Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem Ersten und Zweiten Gesundheitsmarkt: Während der Erste Gesundheitsmarkt den Kern des klassischen Versorgungssystems darstellt (also „alle Leistungen, Angebote, Produkte und Waren, die durch das gesetzlich definierte Leistungsspektrum abgedeckt sind und durch die Ausgabenträger des Gesundheitssystems finanziert werden“32), handelt es sich beim so genannten Zweiten Gesundheitsmarkt um einen reinen Konsumentenmarkt, der die nachgelagerten Bereiche des Gesundheitstourismus, Sport, Ernährung, Wellness und Wohnen umfasst. Dieser Zweite Gesundheitsmarkt spielt für die gesundheitswirtschaftliche Strategie der Landesregierung eine besondere Rolle. Häusliche Pflege und Gesundheitsversorgung im privaten Umfeld sind bereits heute wachstumsstarke Dienstleistungssegmente. Bis 2030 wird für das Gesundheitswesen in Deutschland eine Erhöhung der Erwerbstätigenzahl auf 4,7 Millionen prognostiziert. Die saarländische Gesundheitswirtschaft befindet sich in einer guten Ausgangsposition. Der klassische Gesundheitssektor mit Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen und Arztpraxen ist dabei für einen Großteil der Beschäftigungseffekte verantwortlich. Hinzu kommt eine profilierte Ausbildungslandschaft, die vom Klinikcampus der Universität des Saarlandes in Homburg über den 29) 102 iso – Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V.: Arbeit und Beschäftigung in der saarländischen Gesundheitswirtschaft. Studie im Auftrag der Arbeitskammer des Saarlandes von Ingrid Matthäi, Jörg Marschall. Saarbrücken, Januar 2008, S. 14 (iso-Studie) 30) ebd, S. 14 31) vgl. ebd., S. 14 f. 32) ebd., S. 16 neuen Studiengang Biomedizinische Technik und dem Institut für Gesundheitsforschung und Technologie (igft) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) bis hin zu einer Vielzahl von Kliniken und Diagnostikeinrichtungen reicht. Im Rahmen der Innovationsstrategie bis 2015 ist die Gründung eines Health-Care-Clusters vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk aus Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, das die Perspektiven und Chancen der Branche im Saarland im Sinne der Innovationsstrategie weiterentwickeln wird. Damit geht die Landesregierung eine weitere Bündelung und Vernetzung der regionalen Kräfte im Themenfeld Gesundheit aktiv an. Die Bildung und der Ausbau des Health-Care-Clusters ist eines der zentralen Vorhaben in der Umsetzung der saarländischen Innovationsstrategie bis 2015. Der Start des Health-Care-Clusters erfolgte im Herbst 2008. Bildung und Forschung – Blickpunkt: “Ambient Assisted Living“ Die Gesundheitswirtschaft im Saarland kann auf eine differenzierte Forschungslandschaft aufbauen. Beispielhaft sind das Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik (IBMT), das Leibniz-Institut für Neue Materialien (INM), das Institut für pharmazeutische Biotechnologie oder auch das Institut für Bioinformatik an der Universität des Saarlandes. Zur weiteren Bündelung und Stärkung der interdisziplinären Kompetenz in biomedizinischen Forschung und Entwicklung wurde 2006 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken das Institut für Gesundheitsforschung und -technologie (igft) gegründet. Dieses widmet sich vornehmlich den Fragestellungen des „Ambient Assisted Living“ aus Sicht der biomedizinischen Technik, der Gesundheits- und Pflegeforschung und der gesundheitsökonomischen Evaluation. Dem Zukunftsthema „Ambient Assisted Living“ wird national und international eine große Bedeutung eingeräumt. Die Gesundheitswirtschaft im Saarland ist gut aufgestellt. Dies nutzt älteren Menschen ebenso wie erwerbstätigen Menschen. Wenn es gelingt, das wissenschaftliche und wirtschaftliche Know-how im Bereich Gesundheitswirtschaft weiter zu bündeln und auszubauen, wird sich die Branche im Saarland positiv entwickeln und neuen Berufsgruppen in der Medizintechnik, Informatik, Biotechnologie und Mechatronik interessante und innovative Arbeitsfelder bieten. 5. Patientenrechte Patient im Mittelpunkt – Patienten als Experten für die eigene Gesundheit Mittlerweile ist in Wissenschaft und Praxis anerkannt, dass gesundheitlicher Verbraucherschutz von großer Bedeutung für die Verbesserung von Prävention, Gesundheit und Lebensqualität ist. Die Stärkung von Patientensouveränität trägt zur Verbesserung der Versorgung bei. Dies umso mehr vor dem Hintergrund des enormen Kostendrucks im Gesundheitswesen. 103 Das Forum zur Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitszielen in Deutschland gesundheitsziele.de33) hat für das Zielthema Patientensouveränität nachstehende Oberziele entwickelt: 1. 2. 3. 4. Transparenz bei Gesundheitsinformationen und Beratungsangeboten erreichen gesundheitsbezogene Kompetenzen der Bürger und Patienten entwickeln kollektive und individuelle Patientenrechte stärken Beschwerde- und Fehlermanagement für Versicherte und Patienten verbessern 5.1 Unabhängige Patientenberatung Unabhängige Patientenberatung und Nutzerinformationen sind Instrumente zur Erhöhung der Patientensouveränität und zur Verbesserung der Versorgung. Im Rahmen der Gesundheitsreform 2000 erfuhr die Förderung der Patientenorientierung und -partizipation eine neue Gewichtung im Gesundheitswesen. Grundlage für die Förderung einer unabhängigen Patientenberatung durch die Spitzenverbände der Krankenkassen bildet § 65b SGB V. Die Unabhängigkeit der Beratung bildet die Voraussetzung, um die Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten zu stärken. Beratung über Qualität und Effizienz medizinischer Angebote Durch ein Modellprojekt wurden bundesweit 22 regionale und mehrere überregionale Beratungsstellen "Unabhängige Patientenberatung Deutschland" (UPD) mit einem bundesweiten Beratungstelefon eingerichtet und offiziell im Januar 2007 gestartet. Damit besteht die Möglichkeit für Verbraucher, sich neutral, unabhängig und kostenfrei von den Leistungsanbietern über die Qualität und Effizienz von medizinischen Angeboten beraten zu lassen und • • • Information sowie nützliche und weiterführende Hinweise zum Thema Gesundheit und zu speziellen patientenrelevanten Themen, Beratung in gesundheitlichen Fragen sowie Auskünfte über ergänzende (regionale) Angebote der Gesundheitsversorgung zu erhalten. Partner in der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland sind der Sozialverband VdK Deutschland e.V., die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und der Verbund unabhängige Patientenberatung e.V. Das Thema "Patientenschutz und Patientensicherheit" wird im Saarland seit Jahren sehr ernst genommen. Die Beratungsstelle Saarbrücken der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland/UPD begann ihre Tätigkeit im August 2001 unter dem Namen „Patientenberatung im Saarland“. Seit Beginn wurde sie als Modellprojekt gemäß § 65 b SGB V gefördert. 104 33) Als Modellprojekt hat gesundheitsziele.de seine Arbeit unter Beteiligung von Politik (Bund, Länder und Kommunen), Kostenträgern und Leistungserbringern, Selbsthilfe- und Patientenorganisationen, Fachverbänden und Wissenschaft im Dezember 2000 aufgenommen, finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung (GVG) Seit 2006 ist die Beratungsstelle in das bundesweite Angebot der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland eingebunden. Seitens des Ministeriums für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales wurde kürzlich eine dauerhafte Einrichtung über den derzeitigen Förderungszeitpunkt hinaus befürwortet. Ein Patientenschutz-Gesetz ist seit einigen Jahren in der Diskussion, bisher aber nicht zum Tragen gekommen. Derzeit beruht der Patientenschutz überwiegend auf den Feststellungen der ständigen Rechtsprechung. 5.2 Regelungsinstrumentarien zum Patientenschutz in saarländischen Krankenhäusern 1. Verantwortung des Krankenhausträgers und des Krankenhauses Die Krankenhäuser haben nach § 1 Abs. 2 Saarländisches Krankenhausgesetz bei der Krankenhausbehandlung die Belange und die Würde der Patienten zu berücksichtigen. Jeder Patient ist nach Art und Schwere der Erkrankung unabhängig von ihrer/seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sozialen Stellung und Krankenversicherung medizinisch zweckmäßig und ausreichend zu versorgen. Der konkrete Betriebsablauf obliegt der Krankenhausdirektion im Rahmen des selbststeuernden Systems. Grundsätze hierzu normiert das Saarländische Krankenhausgesetz (SKHG) in den §§ 16 ff. 2. Krankenhausaufsicht durch das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales nach § 15 Saarländisches Krankenhausgesetz Nach § 15 des Saarländischen Krankenhausgesetzes unterliegen die Krankenhäuser der Rechtsaufsicht des Ministeriums für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales (Krankenhausaufsichtsbehörde). Die Vorschriften über die hygienische Überwachung der Krankenhäuser gemäß § 11 Abs. 3 und über die Aufsicht über die Ausbildungsstätten gemäß § 43 Abs. 4 sind Teil der Krankenhausaufsicht. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass die für die Krankenhäuser geltenden Rechtsvorschriften beachtet und eingehalten werden. Wird durch das Handeln oder Unterlassen eines Krankenhauses das Recht verletzt, soll die Aufsichtsbehörde zunächst beratend darauf hinwirken, dass das Krankenhaus die Rechtsverletzung behebt. Kommt das Krankenhaus dem innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde das Krankenhaus verpflichten, die Rechtsverletzung zu beheben. Bei begründetem Verdacht auf einen Verstoß gegen Berufspflichten der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten unterrichtet das Krankenhaus die Krankenhausaufsichtsbehörde, das Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz und die jeweils zuständige Heilberufekammer. 105 3. Verpflichtung des Arztes, Berufspflichten und Kontrolle der Einhaltung der Berufspflichten durch die Ärztekammer Ob der Arzt seinen Beruf ordnungsgemäß ausübt, wird von der Ärztekammer des Saarlandes überprüft (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG), die auch verpflichtet ist, Patientenbeschwerden nachzugehen. Sofern Verstöße gegen die Berufspflichten festgestellt werden bzw. ein begründeter Verdacht der Pflichtverletzung besteht, unterliegt der betreffende Arzt der Berufsgerichtsbarkeit. Dies bedeutet, dass die ärztlichen Berufsgerichte Fehlverhalten sanktionieren können. Die Ärztekammer des Saarlandes unterliegt - ebenso wie Krankenhäuser - als Körperschaft des öffentlichen Rechts der Rechtsaufsicht durch das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales (§ 1 Abs. 5 SHKG). Konkret bedeutet dies, dass das Ministerium kontrolliert, ob das Verhalten der Ärztekammer des Saarlandes im Einklang mit geltendem Recht steht, d. h., ob die Kammer ihrer Verpflichtung zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Berufsausübung unter Beachtung geltenden Rechts nachkommt. Das Ministerium ist Beschwerden von Patienten, die Ärztekammer des Saarlandes sei ihrer Verpflichtung zur Kontrolle der Einhaltung der Berufspflichten nicht nachgekommen, stets nachgegangen, allerdings ohne nennenswerte Beanstandungen. 106 4. Möglichkeiten der Patienten bei Beschwerden • Einschaltung eines Patientenfürsprechers, der nach § 8 Abs. 3 SKHG die Interessen des Patienten gegenüber dem Krankenhaus vertritt, Anregungen, Bitten und Beschwerden der Patienten prüft und auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten tätig wird • Beratung bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland - UPD, Regionale Beratungsstelle Saarbrücken • Einschaltung der Krankenhausaufsicht • Einschaltung der Ärztekammer des Saarlandes • Einschaltung der Rechtsaufsicht über die Ärztekammer des Saarlandes • Einschaltung der Gutachterkommission für Fragen ärztlicher Haftpflicht bei der Ärztekammer des Saarlandes • Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Anhang 1: „15 Regeln für gesundes Älterwerden“ Anlässlich des Weltgesundheitstages im Jahr 1999 entwickelte Prof. Dr. Andreas Kruse, Gerontologe an der Universität Heidelberg, 15 Regeln für möglichst gesundes Älterwerden34). 1. Seien Sie in allen Lebensaltern körperlich, geistig und sozial aktiv! Suchen Sie nach Aufgaben, die Sie ansprechen und herausfordern. Beachten Sie, dass Sie durch Ihr Verhalten in Ihrem Leben entscheidend dazu beitragen, ob Sie ein hohes Alter bei erhaltener Gesundheit, Aktivität und Selbständigkeit erreichen. Hier sind auch die Erfahrungen, die Sie im Beruf und in der Familie gewonnen haben, nützlich. Ebenso sind Ihre Freizeitaktivitäten eine bedeutende Grundlage für die Kompetenz im hohen Alter. 2. Leben Sie in allen Lebensaltern gesundheitsbewusst! Achten Sie also auf ausreichende Bewegung und ausgewogene Ernährung, vermeiden Sie übermäßige Licht- bzw. Sonnenexposition und Nikotin sowie andere Suchtmittel und gehen Sie verantwortlich mit Alkohol und Medikamenten um. Achten Sie auch im Berufsleben und bei Ihren familiären Aufgaben auf Ihre Gesundheit. Vermeiden Sie lang anhaltende körperliche und seelische Überbelastung. 3. Nutzen Sie Vorsorgemaßnahmen! So können drohende Krankheiten frühzeitig erkannt und eine Behandlung rechtzeitig eingeleitet werden. Ergreifen Sie selbst die Initiative und sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, was Sie für die Erhaltung Ihrer Gesundheit tun und auf welche Weise Sie zu einem gesunden Altwerden beitragen können. Wenn Sie berufstätig sind, informieren Sie sich auch darüber, welche präventiven Angebote in Ihrem Betrieb oder Ihrem Wohnumfeld angeboten werden, um körperliche Fehlbelastungen zu reduzieren sowie Folgen von übermäßigem Stress entgegenzuwirken. Nutzen Sie diese Angebote. 4. Es ist nie zu spät, den eigenen Lebensstil positiv zu verändern! Man kann in jedem Alter anfangen, ein gesundheitsbewusstes und körperlich, geistig sowie sozial aktives Leben zu führen. Durch die positive Veränderung des Lebensstils können Sie auf bereits vorhandene Risikofaktoren - wie z.B. Stoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Übergewicht und Vorstufen des Hautkrebses - einwirken und deren schädliche Einflüsse auf das Alter bzw. auf Ihre Gesundheit verringern. 5. Bereiten Sie sich auf Ihr Alter vor! Setzen Sie sich rechtzeitig mit der Frage auseinander, wie Sie Ihr Leben im Alter gestalten möchten. Bereiten Sie sich gedanklich auf Veränderungen in Ihrem Leben (z. B. auf den Berufsaustritt oder den Auszug der Kinder) vor. Fragen Sie sich, mit welchen Chancen und Anforderungen diese Veränderungen verbunden sind und wie Sie diese nutzen bzw. wie Sie auf diese antworten können. Denken Sie bei der Vorbereitung auf Ihr Alter auch an Ihre Wohnsituation. Durch Veränderungen in Ihrer Wohnung können Sie dazu beitragen, Ihre Selbständigkeit zu erhalten. Die Beseitigung von Hindernissen und der Einbau von Hilfsmitteln 34) „Regeln für gesundes Älterwerden“, entwickelt von Prof. Dr. Andreas Kruse im Auftrag der Bundesvereinigung für Gesundheit e. V. anlässlich des Weltgesundheitstages „Aktiv leben – gesund alt werden“, aktualisiert von der AG 3 „Gesund altern“ des Deutschen Forums Prävention und Gesundheitsförderung 107 sind für die Erhaltung Ihrer Selbständigkeit wichtig. Nutzen Sie die Wohnberatung vor Ort, z.B. eine Wohnraumberatung, um Anregungen für sinnvolle Veränderungen in Ihrer Wohnung zu erhalten. Bei dieser Beratung erhalten Sie auch Auskunft über die finanzielle Unterstützung bei der Ausführung solcher Veränderungen. 108 6. Nutzen Sie freie Zeit, um Neues zu lernen! Setzen Sie die Art der körperlichen, geistigen und sozialen Aktivität, die Sie in früheren Lebensjahren entwickelt haben, auch im Alter fort. Fragen Sie sich, inwieweit Sie im Alter daran anknüpfen möchten. Nutzen Sie die freie Zeit im Alter, um Neues zu lernen. Sie können auch im Alter Gedächtnis und Denken trainieren. Setzen Sie sich bewusst mit Entwicklungen in Ihrer Umwelt (z.B. im Bereich der Technik, der Medien, des Verkehrs) auseinander und fragen Sie sich, wie Sie diese Entwicklungen für sich selbst nutzen können. 7. Bleiben Sie aktiv und denken Sie positiv! Bleiben Sie auch im Alter offen für positive Ereignisse in Ihrem Leben. Bewahren Sie die Fähigkeit, sich an schönen Dingen im Alltag zu erfreuen. Beachten Sie, dass Sie sich bei aktiver Lebensführung und positiver Lebenseinstellung gesünder fühlen. Wenn Sie eine persönlich ansprechende Aufgabe gefunden haben, wenn Sie sich an schönen Dingen im Alltag freuen können und wenn Sie in belastenden Situationen nicht resignieren, dann bleibt auch Ihr gesundheitliches Wohlbefinden eher erhalten. 8. Begreifen Sie das Alter als Chance! Begreifen Sie das Alter als eine Lebensphase, in der Sie sich weiterentwickeln können. Sie können Ihre Fertigkeiten und Interessen erweitern, Sie können zu neuen Einsichten und zu einem reiferen Umgang mit Anforderungen des Lebens finden. Beachten Sie, dass Sie sich auch in der Auseinandersetzung mit Belastungen und Konflikten weiterentwickeln können. 9. Pflegen Sie auch im Alter Kontakte! Beschränken Sie sich nicht alleine auf die Familie, sondern denken Sie auch an Nachbarn, Freunde und Bekannte. Bedenken Sie, dass auch der Kontakt mit jüngeren Menschen Möglichkeiten zu gegenseitiger Anregung und Bereicherung bietet. 10. Geben Sie der Zärtlichkeit eine Chance! Eine Partnerschaft, in der beide Partner Zärtlichkeit, körperliche Nähe und Sexualität genießen, trägt zur Zufriedenheit und zu körperlichem Wohlbefinden bei. Lassen Sie sich nicht durch jene Menschen verunsichern, die meinen, dass Alter und Zärtlichkeit oder Alter und Sexualität nicht zusammenpassen. Diese Menschen haben unrecht. 11. Trauen Sie Ihrem Körper etwas zu! Bewegen Sie sich ausreichend und treiben Sie Sport, ohne sich zu überfordern. Sie erhalten damit Ihre körperliche Leistungsfähigkeit. Sie tragen dazu bei, dass Ihr Stütz- und Bewegungssystem elastisch und kräftig bleibt und dass Sie die Aufgaben des Alltags leichter bewältigen können. Sie spüren Ihren Körper auf angenehme Art und Weise. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche Art des körperlichen Trainings für Sie die richtige ist. Suchen Sie sich eine Sportgruppe, denn gemeinsam macht es nochmals soviel Spaß! 12. Gesundheit ist keine Frage des Alters! Fragen Sie sich deshalb immer wieder, was Sie tun können, um im Alter Ihre Gesundheit, Selbständigkeit und Selbstverantwortung zu erhalten. Beachten Sie: Allein des Alters wegen büßen wir nicht die Gesundheit sowie die Fähigkeit zur selbständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung ein. 13. Nehmen Sie Krankheiten nicht einfach hin! Wenn Erkrankungen auftreten, so wenden Sie sich an Ihren Arzt. Eine frühzeitige Diagnose bedeutet eine erfolgreichere Therapie. Auch im Falle einer chronischen Erkrankung ist der regelmäßige Besuch der ärztlichen Sprechstunde notwendig. Beachten Sie, dass Ihnen auch bei Einbußen des Seh- und Hörvermögens geholfen werden kann. Nehmen Sie diese nicht einfach hin. Sprechen Sie vielmehr mit Ihrem Arzt über die Möglichkeiten an Hilfsmitteln und nutzen Sie diese, wenn sie verordnet werden. Wenn Sie durch Erkrankungen in Ihrer Selbständigkeit beeinträchtigt sind, erweist sich eine Rehabilitation oft als sinnvoll und notwendig. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die möglichen Rehabilitationsaussichten in Ihrem speziellen Fall. Bedenken Sie, dass die Rehabilitation besonders dann erfolgreich sein wird, wenn Sie selbst alles tun, um Ihre Selbständigkeit wiederzuerlangen. 14. Suchen Sie nach guter Hilfe und Pflege! Wenn Sie hilfsbedürftig oder pflegebedürftig geworden sind, so suchen Sie nach Möglichkeiten einer guten Hilfe und Pflege. Achten Sie darauf, dass Ihnen durch die Hilfe oder Pflege nicht Selbständigkeit und Selbstverantwortung genommen, sondern dass diese erhalten und gefördert werden. Falls Sie von Ihren Angehörigen betreut werden, so achten Sie mit darauf, dass diese nicht überfordert werden und ausreichend Unterstützung erhalten. 15. Haben Sie Mut zur Selbständigkeit! In belastenden Situationen sollten Sie sich fragen, wie Sie mit dieser Belastung am Besten fertig werden, was Ihnen gut tun könnte, mit welchen Menschen Sie zusammen sein möchten, wie Ihnen diese helfen können und wann Ihnen die Hilfe anderer zu viel ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, so trauen Sie sich, um diese Hilfe zu bitten. Haben Sie aber auch den Mut, Hilfe abzulehnen, wenn Sie sich durch diese in Ihrer Selbständigkeit beeinträchtigt sehen. 109 Anhang 2: Quellen- und Literaturverzeichnis Arbeitsgruppe Alte Menschen im Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland (Hg.): Wenn das Altwerden zur Last wird – Suizidprävention im Alter. Februar 2005 Backes, Gertrud/Clemens, Wolfgang: Lebensphase Alter. Berlin 2003 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Wohnen im Alter. Bewährte Wege – Neue Herausforderungen. Ein Handlungsleitfaden für Kommunen. Berlin 2008 Denniger, Tina: Sexualität im Alter, in: informationsdienst altersfragen, 05/2008 Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Bundesweit repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung von Personen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden, gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). In: www.dza.de; www. bmfsfj.de Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (Hg.): Unabhängig im Alter – Suchtprobleme sind lösbar. Juni 2006 Focushabitat GmbH (Hg.): Perspektiven 2035 - Wohnen im Alter in Deutschland, Untersuchung durchgeführt vom Eduard Pestel Institut für Systemforschung e.V., Hannover 2007 Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Band I: Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung und Partizipation, Bundestags-Drucksache 14/5660. Berlin 2001 Huhn, Siegfried: Expertenstandard Sturzprophylaxe, in: Österreichische Pflegezeitschrift 10/2005, Huhn, Siegfried: Stolperfallen auf der Spur – Mit Weitsicht vorbeugen, in: Pflegen Ambulant (14), Ausgabe 6/2003 Hurrelmann, Klaus/Klotz, Theodor/Haisch, Jochen (Hg.): Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. Bern: Huber 2007 Kirchen-Peters, Sabine/Herz-Silvestrini, Dorothea: Gerontopsychiatrisches Modellprojekt der SHG „Beratungsdienst für Angehörige und Heime“, hg. v. Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V.. Saarbrücken 2007 Klie, Thomas/Pfundstein, Thomas: Von der kommunalen Altenhilfeplanung zum Kultur- und Systemmanagement. Die neue Rolle der Kommunen in der Seniorenpolitik, in: informationsdienst altersfragen, Ausgabe Mai/Juni 2008 Kremer-Preis, Ursula/Stolarz, Holger: Leben und Wohnen im Alter. Neue Wohnkonzepte für das Alter, hg. v. Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 2003 110 Kruse, Andreas: Gesund altern. Stand der Prävention und Entwicklung ergänzender Präventionsstrategien. Baden-Baden 2002 Kruse, Andreas: Sicherung der Unabhängigkeit im Alter, in: Dokumentation zur Fachtagung am 07.05.2004, hg. v. Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales. Saarbrücken 2005 Landesregierung des Saarlandes (Hg.): Den demographischen Wandel gestalten. Demographiebericht der saarländischen Landesregierung, Saarbrücken 2007 Lutz, Michel: Mogelpackungen ade. Zwischenbilanz zur DIN 77 800 – Qualität und Sicherheit im Betreuten Wohnen, in: Die BAGSO-Nachrichten 4/2007 Matthäi, Ingrid/Marschall, Jörg: Arbeit und Beschäftigung in der saarländischen Gesundheitswirtschaft. Studie im Auftrag der Arbeitskammer des Saarlandes, hg. v. Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Saarbrücken. Januar 2008 McKinsey & Company, Inc.: Deutschland 2020. Zukunftsperspektiven für die deutsche Wirtschaft Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hg.): Landesseniorenplan Erster Teil. Saarbrücken 2007.In: www.justiz-soziales.saarland.de Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hg.): SAARLAND – aktiv und gesund. Saarbrücken 2008.In: www.justiz-soziales.saarland.de Prognos AG: Deutschland-Report 2030 Niederfranke, Annette: Das Alter ist weiblich. Frauen und Männer altern unterschiedlich, in: Funkkolleg Altern 2. Lebenslagen und Lebenswelten, soziale Sicherung und Altenpolitik, hg. v. Annette Niederfranke, Gerhard Naegele, Eckart Frahm. Wiesbaden 1999 Pache, Dieter: Die gegenwärtige Situation des Sports der Älteren, in: Denk, Heinz/Pache, Dieter/Schaller, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch Alterssport. Grundlagen - Analysen - Perspektiven. Schorndorf 2003 Psychiatrie in Deutschland - Strukturen, Leistungen, Perspektiven, hg. v. Gesundheitsministerkonferenz der Länder, Februar 2007 Robertz-Grossmann, Beate: Wissen umsetzen. Aufgaben und Aktivitäten der Arbeitsgruppe 3 „Gesund Altern“ des Deutschen Forums Prävention und Gesundheitsförderung, in: Altern und Gesundheit, Bundesgesetzblatt, Band 49, Heft 6, Juni 2006 Saup, Winfried/Reichert, Monika: Die Kreise werden enger. Wohnen und Alltag im Alter, in: Funkkolleg Altern 2, hg. v. Annette Niederfranke, Gerhard Naegele, Eckart Frahm. Wiesbaden 1999 Schaller, Hans-Jürgen: Bewegungskoordination im Alter, in: Handbuch Alterssport. Grundlagen - Analysen - Perspektiven. Schorndorf 2003 Stürze und ihre Folgen: Risiko erkennen und vermeiden. Eine wissensbasierte Information für ältere Menschen, hg. v. Ärztekammer Nordrhein. Düsseldorf 2007 111 Schmidtke, Siegfried: Alternative Wohnformen fürs Alter in: Gesellschaft für Pflegeinformationen, Ausgabe 8/2007, in: www.gesellschaft-pflegeinfo.de Schneekloth, Ulrich/Wahl Hans Werner (Hgg): Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung in stationären Einrichtungen (MuG IV). Integrierter Anschlussbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. München, November 2007 Tesch-Römer, Clemens: Aktives Altern. Potenziale des Alters in Gesellschaft und Wirtschaft fördern – zukünftige Lebenswelten gestalten. Impulsreferat bei der Tagung „Älter werden im Saarland“ am 22. Juni 2006 in Saarbrücken-Dudweiler. In: www.justiz-soziales.saarland.de Tesch-Römer, Clemens/Wurm, Susanne: Lebenssituation älter werdender und alter Menschen in Deutschland, in: Altern und Gesundheit, Bundesgesetzblatt, Band 49, Heft 6, Juni 2006 Trapp, Hans-Joachim: Selbständigkeit im Alter – mehr als eine Frage der Wohnung, Referat vom 16.03.2006, Saarlouis Voelcker-Rehage, Claudia/Godde, Benjamin/Staudinger, Ursula M.: Bewegung, körperliche und geistige Mobilität im Alter, in: Bundesgesundheitsblatt, Alter/n und Gesundheit, Band 49, Heft 6, Juni 2006 Walter, Ulla/Schneider, Nils/Bisson, Susanne: Krankheitslast und Gesundheit im Alter. Herausforderungen für die Prävention und gesundheitliche Versorgung, in: Bundesgesundheitsblatt, Band 49, Juni 2006 112 Anhang 3: Entstehungsprozess Redaktionelle Bearbeitung und Beratung erfolgten in der internen Arbeitsgruppe des Ministeriums für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales, die aus folgenden Mitgliedern besteht: Jutta Bettinger, Reinhard Fiedler, Carmen Galecki, Anette Hoffmann, Gerhard Schreiber, Thomas Schulz, Petra Steinbach, Hans-Joachim Trapp, Wolfgang Wahl, Harald Zimmer In Zusammenarbeit: a) mit der Arbeitsgruppe Landesseniorenplan des Landesseniorenbeirates, bestehend aus folgenden Mitgliedern: • • • • • Gerd Amman (Seniorenbeirat der Stadt Ottweiler) Wolfgang Bintz (Saarländischer Städte- und Gemeindetag) Gabriele Grass (Liga der Freien Wohlfahrtspflege Saar) Vera Hewener (Landkreistag Saarland) Inge Lehmann (stellvertretende Vorsitzende des Landesseniorenbeirates; Seniorenbeirat der Stadt Neunkirchen) Josef Mailänder (Vorsitzender Landesseniorenbeirat) Horst Nalbach (Seniorenbeirat der Stadt Dillingen) Irmgard Schmidt (EUROP’age Saar-Lor-Lux e. V. Saarbrücken) Nikolaus Schwan (Heimbeirat Stiftung Hospital St. Wendel) Christel Steitz (stellvertretende Vorsitzende des Landesseniorenbeirates; Seniorenbeirat der Stadt Homburg) • • • • • Die Arbeitsgruppe des Landesseniorenbeirates hat sich in zwei Sitzungen am 25. September und am 28. Oktober 2008 mit den Kapiteln „Alter und Wohnen“ und „Alter und „Gesundheit“ befasst. Die Beratung erfolgte unter Hinzuziehung • von Vertreter/innen des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Wirtschaft und Wissenschaft, der Architektenkammer, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer sowie der im Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales angesiedelten Stabsstelle Gesundheitsberichterstattung Saarland – Krebsregister. b) mit dem Landesseniorenbeirat In seinen Sitzungen am 28. Februar und am 28. Oktober 2008 war der Landesseniorenplan zentraler Bestandteil der jeweiligen Tagesordnung. In der Sitzung am 28. Oktober 2008 hat der Landesseniorenbeirat den zweiten Teil des Landesseniorenplanes abschließend beraten und verabschiedet. Darüber hinaus unterstützten folgende Veranstaltungen zur Fortschreibung des Landesseniorenplanes den Dialog in Gesellschaft und Wirtschaft: 113 • Diskussionsforum „Die ältere Generation als Wirtschaftsfaktor und Konsument“ am 15. Mai 2008 bei der IHK Saarland, veranstaltet von EUROP’age Saar-Lor-Lux e.V. in Kooperation mit dem Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales • Themen-Nachmittag „Vital und gesund im Alter“ bei der „Welt der Familie“ am 24. September 2008 • Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Gerhard Vigener, Minister für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales im Saarland zum Thema „Potenziale des Alters - die Alten greifen an!“ und • Prof. Dr. Gertrud M. Backes, Professorin für Soziale Gerontologie, Direktorin des Zentrums für Altern und Gesellschaft an der Hochschule Vechta, langjährige Sprecherin und Mitgründerin der Sektion "Alter(n) und Gesellschaft" in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie • Josef Mailänder, Vorsitzender des Landesseniorenbeirates im Saarland • Dr. Jürgen Stenger, Geschäftsführer der Saarländischen Pflegegesellschaft • Raimund Thul, Seniorenberater im Seniorenbüro des Saarpfalz-Kreises • Hans-Joachim Trapp, Leiter der Abteilung Soziales im Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales • Diskussionsveranstaltung „Altersdiskriminierung – Ein neues Altersbild“ am 23. Oktober 2008 in der „Villa Europa“ in Saarbrücken, veranstaltet von EUROP’age Saar-Lor-Lux e.V. in Kooperation mit dem Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales • Festveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des Landesseniorenbeirates des Saarlandes am 6. November 2008 in der Bel Étage der Spielbank Saarbrücken mit Prof. Dr. Andreas Kruse, Leiter des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg, als Hauptreferent und Grußworten von Jean Bohler, Président du Conseil Supérieur des Personnes Âgées de Luxembourg, Roswitha Verhülsdonk, Ehrenvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO), Rolf Kauls, Stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen e. V. und Schirmherr Peter Müller, Ministerpräsident des Saarlandes 114 115 116