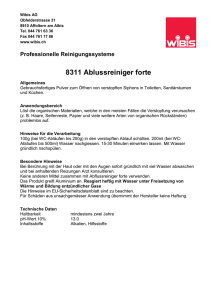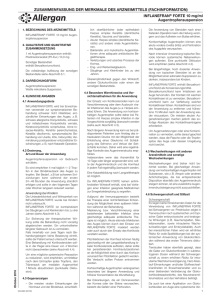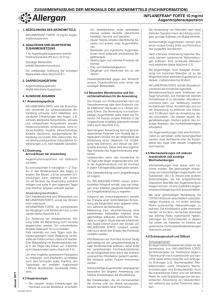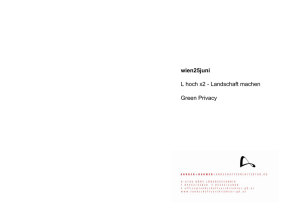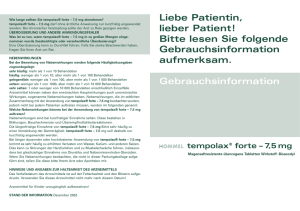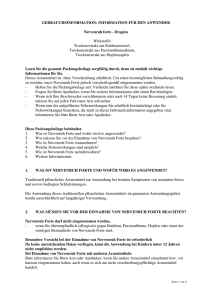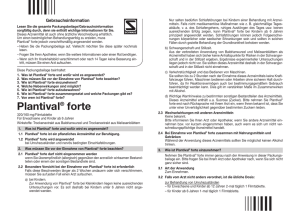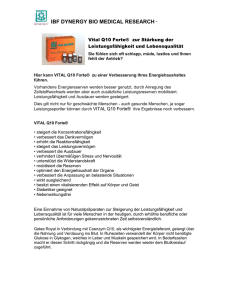Untitled
Werbung

__________________________________________________________________________ Musikstunde mit Werner Klüppelholz Piano für Gebildete, Forte für den Rest Über Lautstärke in der Musik (4) SWR 2, 5. – 9. 3. 2012, 9h05 – 10h00 IV Forte Indikativ „Die meisten Kapellmeister können keine Partituren lesen“, sprach der Spötter Hans von Bülow. Er hingegen bemühte sich. „Auf einer Orchesterprobe in Meiningen“, erzählt Richard Strauss, „rief Bülow dem ersten Hornisten zu: ‚Forte!’ Der blies stärker. Bülow klopfte ab und sagte sanft verweisend: ‚Ich habe Ihnen doch gesagt: Forte.’ Der Hornist blies noch stärker. Bülow zum dritten Mal abklopfend, mit merklich erhobener Stimme: ‚Erstes Horn: Forte!’ Der Hornist antwortet verzweifelt: ‚Aber Herr von Bülow, ich kann nicht mehr stärker blasen.’ Bülow, mit mephistophelischem Lächeln und äußerster Süßigkeit im Ton: ‚Das ist es ja gerade. Ich sage Ihnen die ganze Zeit forte, und Sie blasen fortwährend fortissimo.’“ Forte ist ebenso ein Problem wie alle anderen Lautstärkegrade und ebenso abhängig von ihnen. Forte und Piano allein, stark und schwach ohne alle Zwischenstufen, ist die primitivste Form der Dynamik, sie soll eine ganze Epoche beherrscht haben. Das ist die sogenannte Terrassendynamik im Barock. Nun gibt es in den Noten wenig Indizien für diese Behauptung, denn dynamische Angaben der Komponisten sind vergleichsweise selten. Eine schlagende Begründung für die Terrassendynamik sind gewiss die instrumentalen Möglichkeiten; ein Cembalo etwa kann gar nicht anders spielen als laut oder leise und ist zu Übergängen nicht fähig. Streicher, Bläser und Sänger können hingegen sehr wohl dynamische Zwischenstufen bewältigen, ebenfalls in der Barockmusik. Hier demonstriert vom Freiburger Barockorchester, mit kleinen Crescendi und Decrescendi zwischen Forte und Piano, sehr 2 lebendig. Schade, dass Strawinsky das nicht mehr hören kann, der Vivaldi doch für so langweilig hielt. Vivaldi: L’Olimpiade, Ouvertüre 5’39“ Freiburger Barockorchester, Ltg. Th. Hengelbrock DHM 88697 93705 LC 0761 Das Freiburger Barockorchester spielte die Ouvertüre zur Oper „L’Olimpiade“ von Antonio Vivaldi. Die Leitung hatte Thomas Hengelbrock. Welche Lautstärke sollte eingehalten werden, wenn dynamische Angaben in den Noten fehlen, im 18. Jahrhundert zumal? Dann muss von den vorhandenen musikalischen Elementen indirekt auf die Lautstärke geschlossen werden, etwa von der Harmonik. Die zu Bachs Zeit schärfste Dissonanz war der verminderte Septakkord. Als Antwort auf die Frage von Pilatus steht er in der „Matthäus-Passion“ beim Schrei „Barrabam“, heute noch Gänsehaut erzeugend. Kein Chorleiter käme auf die Idee, ihn Pianissimo singen zu lassen, hier muss es laut sein. Nun findet sich derselbe Akkord ebenfalls gegen Schluss des b-MollPräludiums im ersten Band des „Wohltemperierten Klaviers“. Dort erscheint er nicht unvermittelt, urplötzlich, sondern steht am Ende einer spannungsvollen Steigerung mittels Orgelpunkt im Bass. In diesem Trauerstück sei das „der Aufschrei einer geängstigten Seele“, wie ein Exeget meint. Was macht Glenn Gould, dem die Welt doch eine fabelhafte Aufnahme der „Goldbergvariationen“ verdankt? Er beginnt in leiser Melancholie und summt dazu fröhlich vor sich hin; offenbar fühlt er sich als Pianist nicht ausgelastet oder glaubt, Bach habe eine Stimme vergessen. Oben auf Seite zwei, was der Notentext gar nicht hergibt, verfällt Gould in Forte. Dann wird er wieder leiser und im Diminuendo schleicht er sich an den besagten Akkord heran. Vor der Generalpause kommt unsere Dissonanz, die – siehe oben – ruhig ein Forte vertragen könnte. Gould versteckt sie, macht aus der Dissonanz ein Gesäusel, indem er im Pianissimo bleibt, die Fermate über dem Akkord ignoriert, gleich weiterspielt und dem Akkord überdies ein Arpeggio verpasst. Statt gleichzeitig kommen die 3 Töne nach Harfenart hintereinander, was die Dissonanz endgültig weichspült. Bach hat durchaus Arpeggios im „Wohltemperierten Klavier“ vorgesehen, nur nicht an dieser Stelle. Mir scheint, die Dynamik bei Bach ist ein letztes Refugium der Anarchie. Bach: Wohltemperiertes Klavier I, Präludium und Fuge b-moll 9’05“ G. Gould CBS M3K 42266 LC 0149 Der Pianist und Vokalist Glenn Gould interpretierte Präludium und Fuge b-Moll aus Bachs „Wohltemperiertem Klavier“, Teil eins. Kühl kalkulierend hat Mozart zuweilen Forte hingeschrieben, um den Beifall des Publikums zu entfachen. „So fing ich mit die zwei Violin allein piano nur acht Takt an. Darauf kam gleich ein Forte. Mithin machten die Zuhörer, wie ich’s erwartete, beim piano sch – und dann kam gleich das forte. Sie das Forte hören und in die Hände klatschen war eins.“ Daher endet die große Mehrzahl gerade der Orchester-Stücke bis ins 20. Jahrhundert hinein tatsächlich im Forte oder Fortissimo. Die Lautstärkegrade Forte und Piano dienen jedoch nicht nur dem Erleben, sondern zugleich dem Verstehen von Musik. Lange Zeit waren sie das einzige Mittel, musikalische Strukturen zu verdeutlichen. So hat Mozart ebenfalls komponiert. Beim Andante der Klaviersonate C-Dur fordert er, dass es „accurat mit dem Gusto forte und piano, wie es steht, gespielt werden“ muss. dann nämlich wird der Kontrast der einzelnen Phrasen klarer. Da diese „Musikstunde“ aber nicht in Pianistenbeschimpfung ausarten soll, verzichten wir auf die Köchelnummer 309 zugunsten der Köchelnummer 551, ebenfalls C-Dur. Mozarts letzte Sinfonie, der ein britischer Impresario den Beinamen „Jupiter“ gab, ein lauter Gott bei den Römern, der zuständig war für den Donner. Der erste Satz beginnt bereits mit der Gegenüberstellung von Forte und Piano und für den weiteren Verlauf gilt, dass die gleiche motivische Substanz die gleiche Lautstärke erhält. Allerdings mit einigen Ausnahmen von solch starrer Regel, die aufmerksamen Ohren nicht entgehen werden. 4 Mozart: Sinfonie KV 551, 1. Satz 13’23“ Royal Concertgebouw Orchestra, Ltg. N. Harnoncourt WPCS 21007 Kein LC Das Royal Concertgebouw Orchestra, geleitet von Nikolas Harnoncourt, spielte den Kopfsatz von Mozarts „Jupiter-Sinfonie“. Ein Instrument ist durch den Lautstärkegrad Forte ständig gefährdet, die Gesangsstimme im Orchester. Der Gesang soll schließlich einen Text verstehbar vermitteln, was schon durch die Tonhöhe schwierig ist. Ab einer gewissen Höhe klingen alle Vokale wie /a/. Sollte irgendeine Sopranpartie das Wort „Uhu“ enthalten, so käme im Parkett ein „Aha“ an. Über das Verhältnis von Lautstärke und Verständlichkeit hat sich Richard Strauss die meisten Gedanken gemacht. „Orchesterpolyphonie, und sei sie in den zartesten Farben, im schwächsten Pianissimo, ist nun einmal der Tod des auf der Bühne gesprochenen Wortes, und der leidige Satan hat uns Deutschen den Kontrapunkt in die Wiege gelegt, damit es uns auf der Opernbühne nicht allzu wohl ergehe. Wer meine späteren Opernpartituren genau kennt, wird aber zugestehen müssen, dass bei deutlicher Textaussprache durch den Sänger die Textworte vom Zuhörer deutlich aufgefasst werden können. Ich höre kein Lob wohlgefälliger, als wenn mir als Dirigenten meiner ‚Elektra’ die Anerkennung gespendet wird: ‚Heute Abend habe ich mal jedes Wort verstanden.’“ Ob das auch heute Morgen der Fall ist, kann an einer dreifach preisgekrönten Aufnahme der Staatskapelle Dresden unter Karl Böhm überprüft werden, am Schluss der „Elektra“ mit dem finalen Mord an Ägisth. Die Interpreten heißen Uhl, Inge Borgh und Marianne Schech. Strauss: Elektra, Finale 7’22“ I. Borgh, M. Schech, Sächsische Staatskapelle Dresden, Ltg. K. Böhm M 0020565007 5 Wie relativ die Lautstärke in der Musik ist, wurde bereits festgestellt und ein psychologischer Sachverhalt macht die Lage noch hoffnungsloser. Lautstärke ist nicht nur abhängig von der Epoche, dem Instrument oder einem einzelnen Spieler, sondern zugleich von den musikalischen Vorlieben der Hörer. Da ballert ein Fan Tekkno mit 100 Dezibel aus dem geöffneten Fenster hinaus und findet das leise wie Blätterrauschen, während ein Verächter solcher Art elektronischer Musik dabei den Start eines Düsenjets erlebt. James Watt, Erfinder der Dampfmaschine und heute vertraut als Kilowatt, hielt große Lautstärke für Sache der Ungebildeten, sie identifizierten sich dabei mit Macht, was gebildete Menschen nicht nötig hätten. Kommen wir von der aufführungspraktischen zur lebenspraktischen Bedeutung des dynamischen Grades Forte. Er repräsentiert Stärke, Entschiedenheit, Kraft, und wer hätte mehr davon als Atlas. Von Schubert, der gestern zu kurz gekommen war und in extrem guter Textverständlichkeit mit Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Schubert: Der Atlas 2’11“ D. Fischer-Dieskau, G. Moore DG 415188-2 LC 0173 Ein Forte wird auch dort gebraucht, wo eine Botschaft sich über den allgemeinen Schallpegel erheben muss, um wahrgenommen zu werden, etwa bei einem Ausrufer. Dafür findet sich ein geistreiches Beispiel im dritten Finale der „Dreigroschenoper“, entstanden rund zwei Jahrzehnte und einen Weltkrieg später als das Finale der „Elektra“. Der Gangsterboss Macheath ist gefangen genommen worden, seine Hinrichtung beschlossene Sache, als der reitende Bote erscheint, kein anderer als der Polizeipräsident selber, ein guter Freund von Macheath. Weill parodiert das barocke Rezitativ. Zunächst drei Schläge des Orchesters, so wie Ludwig der Vierzehnte durch drei Schläge einer Hellebarde angekündigt wurde. Im Forte dann der Kern der Nachricht, die Freilassung Macheaths. Doch dann klingt immer phantastischer, was der Bote verkündet. Der Mörder, Vergewaltiger und Brandstifter 6 Macheath erlangt nicht nur die Freiheit zurück, sondern wird überdies in einen Aristokraten verwandelt, ein Schloss wird ihm geschenkt und er bekommt eine Riesen-Rente. Solche traumhaften Versprechungen begleitet Weill nicht mehr in entschiedenem Forte, vielmehr im kleinlauten Piano des Klaviers, fast ein Echo der drei Orchesterakkorde, damit die Unglaubwürdigkeit des reitenden Boten andeutend. Man hat viel herausgehört aus dem dritten „Dreigroschen-Finale“, Reminiszenzen an die „Zauberflöte“, „Lohengrin“, „Tosca“, das Ende von Händel-Opern, dabei ist es originaler Weill. Eine Erinnerung an den „Don Giovanni“ ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Wurde Mozarts Ouvertüre zwölf Stunden vor der Aufführung fertig, so Weills Finale gerade einen Tag vor der Probe. Wie dort so auch hier singende Schauspieler: Hannes Hellmann, der es besonders ironisch machen will, Max Raabe und Sona MacDonald sowie das Ensemble Modern unter Leitung von HK Gruber, der zugleich den Peachum gibt. Weill: Dreigroschenoper, 3. Finale, ab Rezitativ 4’44“ M. Raabe, H. Hellmann, S. MacDonald, Ensemble Modern, Ltg. HK Gruber BMG 7432166133 LC 0316 7