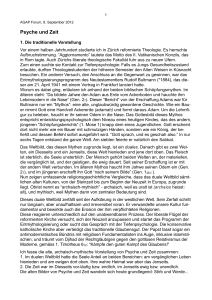Leseprobe zum Titel: Warum unsere Kinder Tyrannen
Werbung

Wie ein Kind die Welt erlebt: Weltbilder Wenn man sich Gedanken macht, wie die Psyche eines Kindes im Idealfall einmal aussehen sollte, so müsste das Ziel sein, dass der 20-jährige Mensch über eine altersangemessene ausgereifte, anderen gesunden Erwachsenen vergleichbare psychische Reife verfügt. Als Psychiater, der sich in seiner täglichen Arbeit ausschließlich mit Störungen befasst, sind die individuellen, in der Hauptsache durch Vererbung erlangten Anteile der Psyche für mich weitestgehend zu vernachlässigen, sie spielen auch für die hier dargestellten Fehlentwicklungen keine Rolle. Die zentrale Frage, die für meine Arbeit von Belang ist, lautet: Welche formbaren Anteile der Psyche sind wichtig, damit der erwachsene Mensch selbstständig leben kann? Wie muss sich Psyche entwickeln, damit Menschen Beziehungen zu anderen Menschen leben können, damit sie erfolgreich arbeiten gehen können, oder auch damit sie eigene Gefühle richtig einschätzen und entsprechend kontrollieren können. Um das zu leisten, benötigt der Mensch im Wesentlichen zwei Anteile der Psyche: zum einen sind das psychische Funktionen wie etwa Frustrationstoleranz, Gewissensinstanz, Arbeitshaltung oder auch Leistungsbereitschaft. Diese Funktionen müssen nach und nach ausgebildet werden, um einen optimalen Aufbau der Psyche zu gewährleisten. Zum anderen sind dafür Weltbilder nötig, also eine ganz bestimmte Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum und unsere Position in ihr wahrnehmen und interpretieren. In unserer westlich geprägten, christlich orientierten modernen Gesellschaft sieht das Weltbild im Wesentlichen so aus, dass wir uns als Individuen im Rahmen einer größeren Gesellschaft erfahren. Bevor sich dieses Weltbild beim erwachsenen Menschen etablieren kann, durchläuft ein Kind bei einer gesunden Entwicklung drei verschiedene Phasen, in denen sich sein Weltbild jeweils ändert: die orale, die anale und die magisch-ödipale Phase. Die orale Phase Die orale Phase hält von der Geburt bis zu einem Alter von etwa anderthalb bis zwei Jahren vor. In dieser Phase kann man das Weltbild des Kindes mit dem Satz »Ich bin, was ich bekomme« beschreiben. Diese Zeit ist jene, in der die sofortige Bedürfnisbefriedigung des Kindes eine zentrale Rolle spielt. Das noch sehr kleine Kind muss in der oralen Phase die Erfahrung machen, dass eine direkte Bezugsperson vorhanden ist, die dem Bedürfnis nach körperlicher Nähe und schnellem Stillen von Hunger und Durst nachkommt. So wird ein Neugeborenes im Allgemeinen, wenn es Hunger hat, nicht schreien, da es noch gar nicht sehen kann, ob die Objekte, die seinen Hunger stillen könnten, Mutterbrust oder Flasche, in der Nähe sind. Es fantasiert aber die Nähe der Brust und würde diese in der Regel durch die sofortige Befriedigung seines Bedürfnisses bestätigt bekommen, d.h., die Mutter würde sofort das Kind an die Brust anlegen und es stillen, bzw., falls das nicht möglich sein sollte, ihm die Flasche geben. Das typische Baby-Schreien setzt erst nach etwa vier bis sechs Wochen ein, wenn das Kind nicht mehr nur Hell und Dunkel unterscheidet, sondern sich in die Lage versetzt sieht, zu erkennen, ob die Nahrungsquelle sich in erreichbarer Nähe befindet oder nicht. Wenn die Brust oder die Flasche dann nicht vor Ort sind, ist der Schrei ein Ausdruck der Wut über diesen Zustand. Wichtige Veränderungen entstehen in dieser Phase auch bei der Motorik des Kindes, es erschließt sich die Welt zunächst über das Krabbeln, dann über das beginnende Laufen. Durch die Erfahrung der immer »größer« werdenden Welt, fängt das Kind an, sein eigenes Selbst vom Selbst des jeweiligen Gegenübers in der Umwelt zu unterscheiden. Es erfährt also »sich selbst«, und es erfährt »das andere Selbst«, bzw. schlicht und ergreifend die Existenz des anderen. Nach der Beschreibung Sigmund Freuds fungiert beim Kind der Mund in dieser Zeit als erogene Zone, da es einen erheblichen Lustgewinn aus dem Saugen, Lutschen und Beißen bezieht. Letzteres kennzeichnet die späte orale Phase, da in dieser die ersten Zähne des Kindes kommen, so dass das Beißen eine wichtige Rolle spielt. Die anale Phase Die anale Phase findet gewöhnlich im Alter von zwei bis drei Jahren statt. Für das Weltbild des Kindes ist diese Phase gekennzeichnet durch den Satz »Ich bin, was ich behalte oder abgebe«. Übertragen auf das Verhalten des Kindes gegenüber seiner Umwelt bedeutet das nichts anderes, als dass das Kind in dieser Phase entdeckt, dass es sich selbst bestimmen kann und auch darüber bestimmt, ob es sich von außen bestimmen lässt. Ein Kind kommt also populär gesprochen in die »Trotzphase«, es versucht zunehmend, seinen Kopf durchzusetzen und den Erwachsenen dazu zu bringen, die Bedürfnisse des Kindes in jedem Fall zu befriedigen. Die magisch-ödipale Phase Bei Freud beschreibt die ödipale Phase ein frühes Stadium der genitalen Phase und gipfelt in der populären Beschreibung des so genannten Ödipuskomplexes, des Phänomens also, dass Kinder sich nun zum jeweils gegengeschlechtlichen Elternteil hingezogen fühlen. In der modernen Theorie kommt noch hinzu, dass Kinder durch die plötzlich eingetretene Konkurrenzsituation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil vom ausschließlichen Bezug auf eine Person Abstand nehmen und sich zu diesem Zeitpunkt erstmals in das System Familie integrieren. Die umfangreichen Studien Freuds führen an dieser Stelle zu weit, für meine These ist wichtig, dass Kinder in der magisch-ödipalen Phase, die im Alter von vier bis fünf Jahren eintritt, sich über den Satz »Ich bin, was ich mir vorstelle« definieren. Sie handeln also nach dem Motto »Ich baue mir die Welt so auf, wie ich sie brauche«. Kinder in diesem Alter leben folglich für Erwachsene unrealistische Fantasien aus, funktionieren etwa Gegenstände zu etwas um, was diese in jenem Moment für sie sein sollen. Die Phasen, in denen diese kindlichen Weltbilder entstehen, werden bei einer gesunden psychischen Entwicklung des Kindes nacheinander durchlaufen, am Ende dieser Entwicklung ist es in der Lage, zu erkennen, dass eine Eigenreaktion eine Gegenreaktion im Gegenüber auslösen kann. In Konflikten kann es beispielsweise nun Eigenanteile sehen und entsprechend handeln. Im klassischen Sinne ist das Kind damit schulreif. Das Kind kann diese Entwicklungsschritte nur nehmen, wenn sich die Eltern phasenspezifisch verhalten. Diese müssen also dafür sorgen, dass jede Phase abgeschlossen und in die nächste übergegangen werden kann. Dieser Vorgang beruht keineswegs auf Automatismen. Auch später, also nach dem sechsten Lebensjahr schließen sich weitere Entwicklungsphasen an, bis schließlich, beginnend im späteren Jugendalter, unser Erwachsenenweltbild entsteht. Diese die Entwicklung beschreibenden Bilder beziehen sich auf die Frage »Wie erlebe ich mich aus mir selbst heraus innerhalb dieser Welt?« Gleichzeitig entsteht jedoch in einem anderen Bereich der Psyche eine weitere Sichtweise, die auf die Frage antwortet »Wie erlebe ich diese Welt als solche?« Sobald das Kind krabbelt und läuft, untersucht es alles in seinem Umfeld auf Funktionen hin, etwa durch Ertasten, Befühlen oder Belecken. Ein Stuhl beispielsweise wird zunächst als zum Schieben geeignet erkannt, danach als Klettergerät. Die Funktion als Sitzmöbel wird von einem Kleinkind erst sehr spät wahrgenommen. Auch die Bezugspersonen um das Kind herum werden entsprechend untersucht. Dabei unterliegt das Kind in der frühkindlich-narzisstischen Phase vom zehnten bis zum sechzehnten Lebensmonat der Vorstellung, es könne alles und jeden steuern und bestimmen, genieße also absolute Autonomie. Bis zum dritten Lebensjahr wird dann in weiteren Schritten die Entdeckung gemacht, dass sowohl Kind als auch Erwachsener eigenständige Personen sind. Das Kind kann nun auch erkennen, dass ein Erwachsener größer, stärker und mächtiger ist. Von diesem Zeitpunkt an reagiert das Kleinkind in Konflikten auf den Erwachsenen, klassisch ausgedrückt: »es hört«. Mit Abschluss dieser Phase ist die Kindergartenreife erlangt, und das Kind reagiert auf pädagogische Interventionen des Erwachsenen. Die Situation, wie sie sich mir in meiner täglichen Arbeit mittlerweile darstellt, zeigt, dass wir auf dem besten Wege sind, immer weniger Kinder hervorzubringen, die eine kindgerechte Entwicklung durchlaufen können. Zusätzlich muss ich feststellen, dass immer weniger Kinder in ausreichendem Maße psychische Funktionen gebildet haben. Die Folge: In den letzten 15 Jahren lässt sich eine enorme Zunahme an Störfeldern im Kinder- und Jugendalter feststellen, die Auffälligkeiten, mit denen Kinder mir vorgestellt werden, könnten kaum vielfältiger sein. So haben wir etwa diverse Schwierigkeiten im motorischen Bereich. Es können keine koordinierten Bewegungen ausgeführt werden, besonders die feinmotorischen Bewegungen, wie sie etwa für das Schreiben unerlässlich sind, sind oft vollkommen unterentwickelt. Um eine Vorstellung vom Ausmaß dieser Störung zu bekommen, muss man sich nur vor Augen halten, dass vor 15 Jahren die Störung der Motorik im Kleinkindesalter etwa bei 20 Prozent der Kinder zu sehen war. Heute ist die Schallmauer von 50 Prozent längst durchbrochen, Tendenz steigend. Das führt in der Folge zu absurd erscheinenden Auswüchsen. So ist mir ein Kindergarten bekannt, der bis vor einigen Jahren mit den Kindern gerne einen Ausflug zum