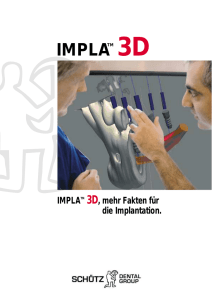Quintessenz Journals
Werbung

INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Eine neue Generation effizienter Bohrschablonen für die Implantologie Digital, dreidimensional, onlinebasiert, interdisziplinär Ralf Kräher-Grube, Ulrich Konter, Matthias Müller Zusammenfassung Im Rahmen implantologischer Diagnostik und Planung war bisher die Anfertigung einer extra röntgenopaken Schablone für die Erfassung mit bildgebenden Verfahren erforderlich, um in einem weiteren Schritt eine Bohrschablone für die Implantatbettaufbereitung und -insertion herzustellen. Die Herstellung der röntgenopaken Schablone ist bei dem hier vorgestellten neuen Verfahren nicht mehr nötig. Eine 3-D-Aufnahme des jeweiligen Kiefers wird mit Scans des Situationsmodells und des Wax-ups bzw. der Zahnaufstellung passgenau digital übereinandergelegt (gematcht). In der sog. Planungscommunity im Internet können Implantatplanung und Modellation der Bohrschablone von allen Beteiligten besprochen und bearbeitet werden. Nach Freigabe wird die Bohrschablone, abgestimmt auf das gewünschte Implantatsystem, über einen 3-D-Drucker im additiven Verfahren hergestellt. Indizes Implantatprothetik, navigierte orale Implantation, 3-D-Implantatplanungssystem, digitaler Workflow, smop, Planungscommunity, interdisziplinäre Zusammenarbeit, integrierte Zahnaufstellung, Bohrschablone, additives Verfahren Die dreidimensionale Bildgebung ist aus der modernen Implantologie nicht mehr wegzudenken.5 Die relevanten anatomischen Strukturen – wie Hart- und Weichgewebe, Verlauf des Nervenkanals und Blutgefäße – sind vor dem chirurgischen Eingriff darstellbar. Mit entsprechender Planungssoftware ist es möglich, die entscheidenden Parameter – wie Implantatlänge und -durchmesser, vertikale und horizontale Positionierung und Angulation – präoperativ zu zeigen. Werden die Planungsdaten korrekt in ein Schienensystem respektive eine Bohrschablone übertragen, kann der Chirurg den Eingriff in Form einer navigierten Implantation durchführen und die Implantate wie geplant in die prothetisch gewünschte Position inserieren.1,2,6 Einleitung Durch gestiegene Ansprüche des Patienten und die Optionen knochenaufbauender Maßnahmen haben die prothetischen Aspekte einer Implantattherapie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der langfristige Behandlungserfolg hängt dabei maßgeblich von der Planung der exakten Implantatpositionen und -angulationen ab. Hierfür muss Prothetische Implantatplanung 332 Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION in aller Regel ein Kompromiss zwischen dem Knochenangebot und der prothetischen Forderung nach optimal positionierten und ausgerichteten Implantaten gefunden werden. Je nach Komplexität des einzelnen Falls werden, idealerweise im Team von Chirurg, Prothetiker und Zahntechniker sowie Patient, alle planungsrelevanten Einflussfaktoren im Rahmen einer sogenannten Rückwärtsplanung (Backward planning) besprochen. Der Planungsprozess ist dabei wiederum abhängig von der Qualität und der Präzision der diagnostischen Information sowie der Möglichkeit eines möglichst fehlerfreien und d. h. unmissverständlichen Informationsaustauschs. Dies insbesondere unter dem Aspekt, dass der Erfolg der Implantattherapie aus chirurgischer Sicht nicht nur von der oben beschriebenen Wahl der richtigen Implantatposition und -ausrichtung abhängt, sondern auch von der Invasivität des operativen Eingriffs, die wiederum den Grad der Traumatisierung der Strukturen und die Einheilung der Implantate beeinflusst. Anhand einer vom Labor angefertigten und mit allen beteiligten Spezialisten besprochenen aufgewachsten und/oder aufgestellten Situation (Zahnaufstellung oder aufgewachst als Wax-up) können die Implantate prothetisch orientiert für die chirurgische Phase geplant werden. Für die Übertragung des hergestellten Wax-ups in die 3-D-Röntgensituation muss für die gängigen Planungssysteme die Zahnaufstellung als Röntgenschablone dupliziert und anschließend vom Patienten mit eingegliederter Röntgenschablone eine Computertomografie (CT) oder eine digitale Volumentomografie (DVT) erstellt werden. Hierfür sind verschiedene Systeme bzw. Systemvarianten von verschiedenen Anbietern – wie Simplant (Materialise, Leuven, Belgien), NobelGuide (Nobel Biocare, Köln), coDiagnostiX (Straumann, Freiburg), Sicat (Sicat, Bonn), med3D (C. Hafner, Pforzheim) – erhältlich. Sind die Scandaten in die jeweilige Planungssoftware eingelesen, kann mit der definitiven Implantatplanung begonnen werden. Die Umsetzung in eine Bohrschablone und ihre anschließende Herstellung erfolgt dann je System vor Ort durch den Zahntechniker oder zentral. Bei der lokalen Fertigung werden die Planungsdaten in der Regel mechanisch mithilfe eines Planungs- bzw. Bohrtischs in aufwendigen Einzelschritten auf die Bohrschablone übertragen, ein manuelles Verfahren, welches das Risiko von Übertragungsfehlern in sich trägt.3 Bei einer Schablonenherstellung in einer zentralen Fertigung auf Grundlage der elektronisch übermittelten Datensätze sind diese Risiken zwar weitgehend minimiert, jedoch handelt es sich dann in aller Regel um ein geschlossenes System, an dessen Vorgaben und Konditionen man gebunden ist. Bekannte Systeme mit zentral stereolithografisch hergestellten Bohrschablonen sind NobelGuide oder ExpertEase (Dentsply Implants, Mannheim). Gemeinsam ist allen diesen Systemen, dass auf Grundlage des Wax-ups oder einer Zahnaufstellung eine Röntgenschablone aus röntgenopakem Bariumsulfat angefertigt und der Patient damit gescannt werden muss. Neben diesem zusätzlichen Arbeitsschritt lassen sich beim unbezahnten Kiefer aufgrund der Resilienz des Weichgewebes abweichende Lagepositionen zum ursprünglichen intraoralen Sitz des Wax-ups sowie Positionierungsfehler während des Röntgens nicht ausschließen (Abb. 1). Das smop-Verfahren smop (swissmeda online planning) ist ein neuartiges 3-D-Implantatplanungssystem, das in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich auf seinen heutigen Stand hin optimiert wurde. Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 333 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Modell mit abgestimmtem Wax-up Herstellung der Diagnostikschablone Einprobe vor dem Röntgen DVT/CT mit Schablone Digitale 3-D-Planung Umbau der Diagnostikschablone zur Navigationsschablone Navigierte Implantation Abb. 1 Der herkömmliche Workflow vom Wax-up zur Bohrschablone, bislang kein einfacher Weg. DVT ohne Schablone Set-up Digitaler Scan vom Modell DVT mit Modell und Set-up überlagert Detailgenaue Implantatplanung Digital konstruierte, geplottete Navigationsschablone Abb. 2 Das neue Verfahren am Beispiel von smop: In wenigen Schritten und ohne Röntgenschablone zur Bohrschablone. 334 Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Abb. 3 Die Zahnaufstellung auf montierten Modellen. Abb. 4 Oberfläche der smop-Verwaltungsseite beim Hochladen eines Datensatzes. Überblick Das System ermöglicht es, präzise Implantatplanungen auf Basis von DICOM-Daten (Digital Imaging and Communications in Medicine; aus den CT- oder DVT-Aufnahmen) sowie Oberflächenscans der aktuellen Mundsituation und der prothetischen Planung zu erstellen (Abb. 2). Hierfür sind keine Röntgenschablonen mehr nötig. Der Planungsprozess erfolgt online gestützt. Alle berechtigten Teilnehmer können sich jederzeit und auch zeitgleich in den Planungsprozess online einklinken und die Planungsparameter nachvollziehbar verändern. Anschließend wird die Schablone virtuell konstruiert und schließlich über einen 3-D-Drucker im additiven Verfahren ausgedruckt. Derart hergestellte Schienen sind in der Genauigkeit mit konventionellen Schienen vergleichbar, reduzieren jedoch die Komplexität des Behandlungsablaufs.4 Das Verfahren ist, unabhängig vom Implantatsystem, für alle implantologischen Indikationen vom Einzelzahn bis hin zum komplett zahnlosen Kiefer anwendbar. Planungscommunity Grundlage jeder Implantation sollte eine im Team abgestimmte prothetische Rückwärtsplanung (Backward planning) sein. Dazu werden vom Patienten eine CT- oder DVTAufnahme sowie auf montierten aktuellen und exakten Situationsmodellen je nach Fallkomplexität ein im Artikulator oder am Patienten kontrollierte Zahnaufstellung erstellt und mit allen Teamkollegen abgestimmt (Abb. 3). Diese Diagnostik-Daten werden als DICOM-Datensätze direkt nach ihrer Erstellung online auf einen zentralen (FTP-)Server geladen und stehen allen Beteiligten online zur Verfügung. In dieser sogenannten Planungscommunity können – als Mitglied des smop-Netzwerks – alle am Fall beteiligten Spezialisten das Programm mit allen seinen Software-Tools orts- und zeitunabhängig nutzen. Da die Daten auf nur einem zentralen Server abgelegt sind, ist das Risiko eines Datenverlusts oder fehlerhafter Datenkommunikation weitestgehend minimiert. Beim Anlegen des Stammdatensatzes können Hierarchieebenen bzw. Zugriffsberechtigungen definiert werden, wer was in der Planungscommunity sich nur ansehen oder aktiv verändern kann. Alle Zwischenschritte werden abgespeichert, sodass man jederzeit beliebig weit im Programm zurückgehen kann (Abb. 4 und 5). Außerdem sind jederzeit Alternativplanungen möglich, ohne dass dabei die Originalplanung verändert wird. Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 335 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Abb. 5 Die primäre Darstellung der DICOM-Daten im Planungsprogramm. Für eine optimale computergestützte Implantatplanung müssen die intraorale Situation und die geplante Prothetik möglichst exakt dargestellt werden können. Daher sollten die Oberflächen-Scans vom Situationsmodell und der final abgestimmten Zahnaufstellung möglichst in Präzisionsscannern wie dem D103i (Imetric, Courgenay, Schweiz) oder dem S600 ARTI (Zirkonzahn, Gais, Italien) oder über einen Intraoralscanner (iTero, Align Technologies, Amsterdam, Niederlande) mit einer hohen Genauigkeit angefertigt werden. Die Verwendung einer ausschließlich digitalen Zahnaufstellung als Richtlinie und Orientierung ist zwar bereits technisch möglich, erfordert aber hohe zahntechnische Fachkenntnisse mit einem entsprechenden Software-Programm. Der DICOM-Satz der CT- oder DVT-Aufnahmen vom Kiefer wird mit den Oberflächenscans überlagert (Abb. 6 bis 8). „Referenzmarken“ sind die in den Aufnahmen gut dargestellten Hart- und Weichgewebestrukturen sowie die Grenzflächen zwischen Luft und Schleimhaut. Die smop-Software unterstützt den Matchingprozess der Datensätze aktiv. Die Planung der Implantate erfolgt dann unter den genannten chirurgischen und prothetischen Gesichtspunkten. In der smop-Software sind die hierfür relevanten Tools bereits implementiert (Abb. 9 und 10). Die Bohrschablone wird direkt im Programm digital erstellt und vor Ort oder in einem Produktionszentrum im additiven Verfahren (zum Beispiel Objet Eden 260V, Stratasys, Rheinmünster) gedruckt. Form und Bauart der Bohrschablone können ganz individuell auf den jeweiligen Fall und das verwendete Implantatsystem – ob mit Führungshülsen oder mit Führungslöffel – abgestimmt werden. Die Konstruktionsweise der Schablone gewährleistet während der Operation eine optimale Übersicht und eine wirkungsvolle Kühlung (Abb. 11 und 12). Sie ist zahngestützt oder wird, bei zahnlosem Kiefer, über 336 smop-Workflow Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Abb. 6 Oberflächenscan mit Set-up (14–17 und 24–27). Abb. 7 Dicomdatensatz mit überlagerter situ und Set-up. Situationsmodell a Zahnaufstellung b Abb. 8 Der Matching-Prozess: a Die DVT- oder CT-Aufnahme vom Patienten wird zunächst mit dem Scan des Situationsmodells und das wiederum b mit dem Scan der Zahnaufstellung überlagert. Anschließend kann mit dem Planungsprozess begonnen werden. Pins oder eigens dafür krestal inserierte Interimsimplantate stabilisiert. Auch in atrophierten Kieferknochensituationen lassen sich durch die Konstruktionsmerkmale der Bohrschablone die geplanten Implantatpositionen gut erreichen. Das gilt ebenso, wenn Implantate distal anguliert gesetzt werden sollen. Zusätzlich ist es möglich, die als Oberflächenscan vorliegende Zahnaufstellung der Planung zur Informationsübertragung vor allem der vertikalen Dimension am Kronenrand als Orientierungsschablone auszudrucken. Der Operateur kann sie intraoperativ gegen die Bohrschablone tauschen und so sich zwischendurch die Lage der geplanten Kronenränder bzw. des Emergenzprofils verdeutlichen (Abb. 13). Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 337 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Abb. 9 Sagittale Detailansicht der Implantatplanung in regio 36. Abb. 10 Implantatplanung in regio 32, 35, 36 aus verschiedenen Blickrichtungen. Abb. 11 Die komplett digital erstellte, neuartige smop-Bohrschablone. Die Schablonen werden vor dem Eingriff am Patienten einprobiert. Sind der OPZugang sowie die vorgesehenen Bohrer und Bohrlöffel kontrolliert (Abb. 14), kann der Chirurg mit der Aufbereitung gemäß Implantatsystem beginnen (Abb. 15 und 16). Die Insertion des Implantats erfolgt ebenfalls durch die Bohrschablone hindurch, wobei die vertikale Position durch die Schablone definiert ist. Sind die Implantate wie geplant inseriert, wird die Bohrschablone entfernt und der Operationssitus entsprechend behandelt (Abb. 17). 338 Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Abb. 12 Interdisziplinär geplante und in Folge optimierte Implantatpositionen in der Bohrschablone (gedruckte Bohrschablone auf dem Situationsmodell). Abb. 13 Bohrschablone mit Setup auf dem Planungsmodell. Abb.14 Klinische Einprobe der Schablone im Mund des Patienten. Abb. 15 Eingesetzter Bohrlöffel (Straumann Guided Implantatsystem) in einer hülsenlosen Schablone während der OP (anderer Fall). Abb. 16 Durch die vorbereitete Schablone exakt geführte Implantatinsertion. Abb. 17 Operationssitus unmittelbar nach Abschluss des minimalinvasiven Eingriffs mit transgingivalem Vorgehen. Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 339 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Abb. 18 Ausgangssituation im III. Quadranten. Abb. 19 Transversalschicht aus dem DICOM-Datensatz mit finaler Planung. Abb. 20 Inseriert wie geplant – die operativ umgesetzten finalen Planungsparameter (Kontroll-PSA). Die Röntgen- bzw. Planungsbilder zeigen die Ausgangslage im dritten Quadranten, die im Planungsprogramm gesetzten Implantate in einer Transversalschicht des DICOMDatensatzes sowie das Kontroll-PSA nach der Implantation (Abb. 18 bis 20). Die geplanten Implantatpositionen konnten mit der Schablone präzise umgesetzt werden. Im Vergleich zum ursprünglichen prothetischen Set-up musste für die Implantatposition in der Frontregion ein Kompromiss zwischen der prothetischen Planung und den biologischen Möglichkeiten eingegangen werden. Augmentative Maßnahmen lehnte der Patient ab, der chirurgische Aufwand und die Zahl der Eingriffe sollten so weit als möglich reduziert werden. In der gedruckten Bohrschablone (vgl. Abb. 12, Bohrschablone auf dem Situationsmodell) sind die finalen Planungsparameter erfasst, während auf dem Situationsmodell noch die ursprüngliche Planung erkennbar ist. Die postoperative Röntgenkontrollaufnahme zeigt, wie exakt diese finalen Planungsparameter mit einer navigierten Implantologie umgesetzt werden können. Smop fußt auf einem Mitgliederkonzept. Pro Jahr fallen 800,– € Mindestkosten an. Davon sind 400,– € der jährliche Mitgliedsbeitrag; hierfür erhält man die Software einschließlich eventueller Updates. Für die zweiten 400,– € erhält man eine Art Gutscheinheft für die Herstellung von Bohrschablonen. Solange in der Community nur geplant und keine Bohrschablone beauftragt wird, fallen keine Kosten an. Erst bei Versand der STL (Standard-Triangulation-Language)-Daten für die Schablonenherstellung wird eine Lizenzgebühr von 150,– € je Kiefer fällig, die jedoch mit dem Gutscheinheft verrechnet wird, sodass man nicht ganz drei Planungssätze für die Bohrschablonen im Voraus bezahlt. Weitere smop-spezifische Kosten fallen nicht an. 340 Kosten und Konditionen Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 INNOVATIONEN NAVIGIERTE ORALE IMPLANTATION Diskussion Für den Zahntechniker ergeben sich mehr Chancen als Risiken. Über die Planungscommunity ist er in das Team eingebunden und kann jederzeit seine Fachkenntnisse in den Planungsprozess kundenbindend einbringen. So setzt allein das Matching der Datensätze ein hohes Maß an zahntechnischer Fachkompetenz und Erfahrung im Lesen radiologischer Datensätze voraus. Zudem hängt die Passform der Schablonen ganz wesentlich von der Genauigkeit der digitalen Grunddaten ab. Für nicht so erfahrene Zahnärzte wie Zahntechniker ist es daher zu überlegen, sich für die Planung und den operativen Eingriff eines entsprechend kompetenten Labors und Chirurgen zu bedienen. Die Wertschöpfung aus der Prothetik bleibt davon unberührt. Fazit Bei dem hier vorgestellten Vorgehen wird direkt die Information einer Zahnaufstellung digital integriert. Da keine Radiologie-Schablone mehr notwendig ist, vereinfacht das smop-System den Planungsablauf erheblich. Es erlaubt ob seiner uneingeschränkten Kommunikation eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit und am Ende eine sicher geführte Implantation. Der Kosten- und Zeitaufwand wird für alle Beteiligten reduziert. Der Ablauf vom ersten Patientenkontakt über die interdisziplinäre Fallplanung bis hin zur Herstellung der Komponenten gestaltet sich sehr effektiv, da das smop-System überaus benutzerfreundlich ist und intuitiv bedient werden kann. Da keine eigentlichen Investitionskosten anfallen, kann eine navigierte Implantation für alle Teilnehmer interessanter werden. Nicht nur in komplexen Situationen erscheint dieses teamorientierte Verfahren als sehr hilfreich, auch anspruchsvolle Einzelzahnversorgungen werden deutlich sicherer vorhersagbar. Hinweis Die Aufnahmen entstammen einem aktuellen Fall. Die Planung wurde vom Labor Cuspidus (siehe auch Laborprofil in der QZ-Ausgabe 01/2013) in Kooperation mit dem Prothetiker Dr. Matthias Müller und dem Chirurgen Dr. Ulrich Konter vorgenommen. Cuspidus ist Referenz- und Schlungslabor für das smop-Verfahren. Literatur 1. 2. 3. 4. 5. 6. Besimo CE, Lambrecht JT, Guindy JS. Accuracy of implant treatment planning utilizing template guided reformatted computer-tomography. Dentomaxillofac Radiol 2000;29;46-51. Heurich T, Brief J, Wörtche R, Marmulla R, Hassfeld S. Computergestützte Implantatplanung. Quintessenz 2002;53:867-873. Kalt G, Gehrke P. Transfer precision of three-dimensional implant planning with CT assisted offline navigation. Int J Comput Dent 2008;11:213-225. Marquardt P. Diagnostik mit Swissmeda und Implantation mit dem SIC-Guided-Surgery-System. Quintessenz Zahntech 2010;36:1630-1642. Neugebauer J, Stachulla G, Ritter L, et al. Computer-aided manufacturing technologies for guided implant placement. Expert Rev Med Devices 2010;7:113-129. Schlieper J, Brinkmann B. Computergestützte Planung in der Implantatprothetik. Z Zahnärztl Impl 2000;16:95-100. ZTM Ralf Kräher-Grube, Labor Cuspidus Sternstraße 105, 20357 Hamburg E-Mail: [email protected] Dr. med. Ulrich Konter, Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg E-Mail: [email protected] Dr. Matthias Müller, Johannisbollwerk 19, 20459 Hamburg E-Mail: [email protected] Quintessenz Zahntech 2013;39(3):332–342 341