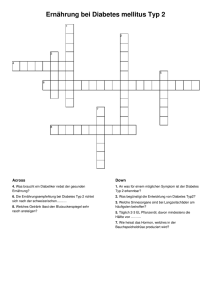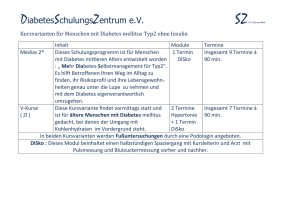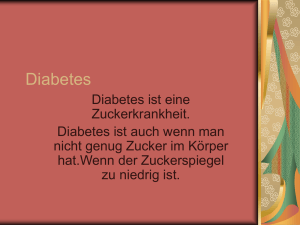Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs in einer Kohorte von LVA
Werbung
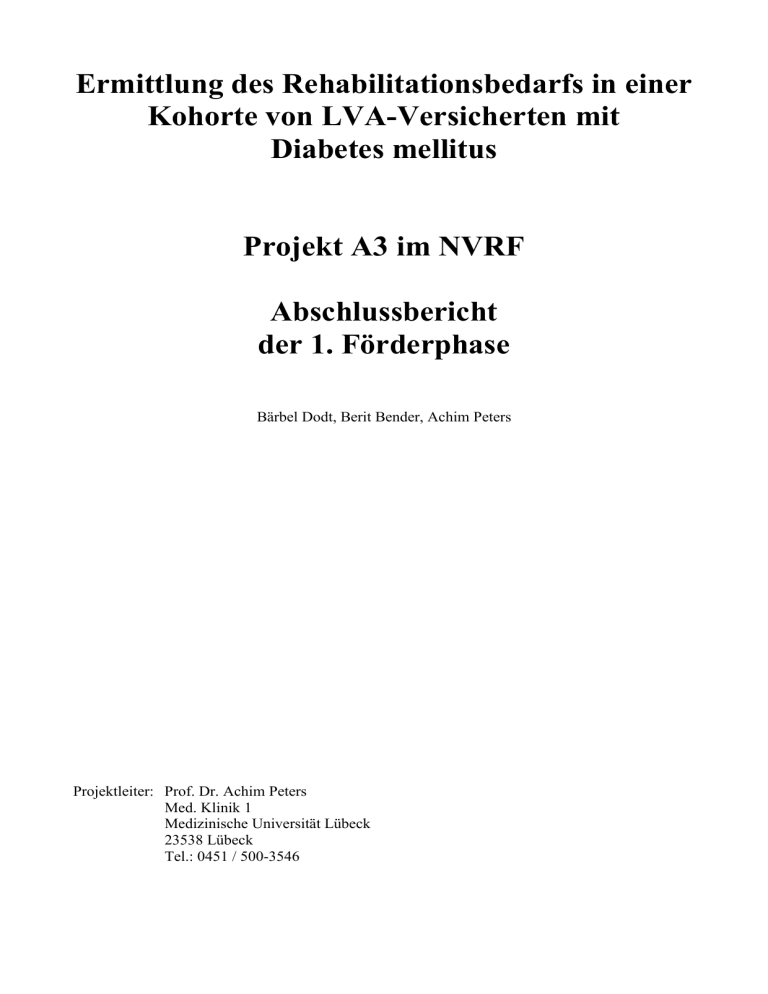
Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs in einer Kohorte von LVA-Versicherten mit Diabetes mellitus Projekt A3 im NVRF Abschlussbericht der 1. Förderphase Bärbel Dodt, Berit Bender, Achim Peters Projektleiter: Prof. Dr. Achim Peters Med. Klinik 1 Medizinische Universität Lübeck 23538 Lübeck Tel.: 0451 / 500-3546 Inhaltsverzeichnis A Studienplan 1 Einleitung 2 Fragestellung der Studie 3 Projektverlauf 4 Auswertung der epidemiologischen Daten 6 Rekrutierung der LVA-Kohorte 6 Auswertung des Rücklaufs der 2421 älteren Teilnehmer („Diabeteswelle“): 7 Rücklauf-Bias 7 Prävalenz des Diabetes mellitus 8 Prävalenz nach Selbstangabe im Fragebogen 8 Gesundheitszustand bei Patienten mit Diabetes versus Gesamtkohorte 9 Korrigierte Prävalenz 11 Vergleich mit Angaben aus der Literatur 14 B Screening-Untersuchung bei einer Sonder-Stichprobe mittels Bestimmung des 15 HbA1c-Wertes Partizipation 17 Partizipations-Bias 17 C Charakterisierung der untersuchten Diabetes-Patienten 18 I Untersuchungsablauf 18 II Messmethoden 21 Bestimmung des HbA1c 21 Bestimmung der Serumglukose 22 Bestimmung des C-Peptids 22 Bestimmung des Cholesterins, der Triglyceride und Harnsäure 22 Bestimmung des Urinalbumins 23 23 III Statistische Auswertung IV Ergebnisse 23 Demographische Beschreibung der Stichprobe 23 Einteilung nach Diabetes Typ 24 Pathophysiologischer Hintergrund 24 II D Algorithmus zur Bestimmung des Diabetes-Typs 25 Untersuchungsergebnisse 29 Body Mass Index 29 Blutdruck und antihypertensive Medikation 32 Laborparameter 35 Diabetesmedikation und Blutglukose-Spiegel 37 Fragebogen zum Essverhalten 39 Fragebogen zum chronischen Stress 43 Depressivität 46 Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-36 48 Lebensqualität bei Diabetes (LQD) 53 Wissenstest für Patienten mit Diabetes mellitus 56 Folge-Erkrankungen 58 Diabetische Nephropathie 58 Retinopathie / Makulopathie 61 Reha-Score für Diabetes mellitus: Ein Instrument zur Abschätzung 66 des Rehabilitationsbedarfs bei Diabetes mellitus I Hintergrund 66 Entwicklung des Reha-Scores 67 Der Typ2 Diabetes als Beispiel einer multidimensionalen Erkrankung 68 Multimodaler Therapieansatz beim Typ2 Diabetes 69 Operationalisierung des Reha-Scores 70 Identifikation der krankheitsrelevanten Störungen (Reha-Indikatoren) 70 1) Bewegungsmangel 70 2) Übergewicht 71 3) Arterielle Hypertonie 71 4) Hyper-/ Dyslipidämie 72 5) Störung des Glukosestoffwechsels 72 6) Diabeteswissen 72 7) Risikofaktor Rauchen 73 8) Depressivität 73 9) Essverhalten 73 10) Chronischer psychischer Stress 74 III 11) Probleme am Arbeitsplatz 74 12) Hypoglykämie-Neigung 75 II Indizierte therapeutische Interventionen 75 1) Sporttherapie 75 2) Diätberatung 76 3) Ärztliche Stufentherapie 77 a) Verbesserung des Glukosestoffwechsels 78 b) Therapie der Dyslipidämie 78 c) Therapie der arteriellen Hypertonie 79 4) Diabetesschulung 80 5) Raucherentwöhnungsprogramm 81 6) Psychologische Therapie 81 7) Arbeitsplatzberatung 82 8) Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining 82 III Auswertung des Reha-Scores 83 Kontraindikationen für eine stationäre Rehabilitation 84 Illustrierende Daten aus der vorliegenden Studie 85 Diskussion 88 E Zusammenfassung 91 F Anlagen Literaturverzeichnis 95 Tabellarische Übersicht 1 101 Tabellarische Übersicht 2 102 Grafik 1 103 Grafik 2 104 Grafik 3 105 Grafik 4 106 Grafik 5 107 Grafik 6 108 Grafik 7 109 IV A Studienplan: Übersicht: Die Studie „Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs in einer Kohorte von LVA-Versicherten mit Diabetes mellitus“ wurde für 3 Jahre bewilligt. Studienbeginn für das Projekt A3 war am 16. 11. 1998 mit Einstellung der Studienärztin. Bewilligt wurden an Sachkosten: DM 68.000 für die Gesamtförderzeit von 3 Jahren. Personalausstattung: • Studienärztin (1/2 Stelle BAT IIa) Frau Dr. med. Bärbel Dodt, von 16. 11. 1998 bis 31.5.2001 • Studienärztin (Ärztin im Praktikum) Frau Eva Deininger vom 16. 1. 1999 bis 31. 8. 1999 • Studienärztin (Ärztin im Praktikum) Frau Dr. med. Dorle Dantz vom 1. 9. 1999 bis 15. 5. 2000 • Studienärztin (Ärztin im Praktikum) Frau Kerstin Oltmanns vom 16. 5. 2000 bis 15. 7. 2000 • Arzthelferin (1/2 Stelle BAT VII) Frau Christina Bluhm seit 16. 3. 1999 • Mathematikerin (1/2 Stelle BAT IIa) Frau Berit Bender vom 9.1.2001 bis 8. 7. 2001 1 Einleitung: Beim Diabetes mellitus (DM) handelt es sich um die häufigste endokrine Erkrankung. In den letzten Jahren war durch die Verbesserung des Lebensstandards in den westlichen Industriestaaten ein deutlicher Anstieg des Typ2 Diabetes zu beobachten (Hauner H 1998). Für die Bundesrepublik Deutschland wurde die Diabetesprävalenz Anfang der 90er Jahre mit 4-5% angegeben (Potthoff P 1987) (Bormann C et.al. 1990), die neueren Daten des Bundes-Gesundheitssurveys zeigten eine Prävalenz (geschlechts-und altersabhängig) von 4,7-5,6%. Unter den derzeit etwa 3,5 Millionen Diabetikern in Deutschland sind ca. 5-7% dem Typ1 Diabetes zuzurechnen (IDDM=insulindependent DM, sogenannter Jugendlicher DM), 93-95% dem Typ2 Diabetes (NIDDM=nichtinsulin-abhängiger DM, sogenannter Altersdiabetes) (Anonym. 1998a). Patienten mit Diabetes weisen eine gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhte Morbidität auf. Beispielsweise ist das Risiko, einen Myokardinfarkt oder apoplektischen Insult zu erleiden, 2-5fach erhöht (Kannel WB, McGee DL 1979). Gegenüber Nicht-Diabetikern ist das relative Risiko für Erblindung 20-fach erhöht, für terminales Nierenversagen 25-fach und für eine Amputation 40-fach. (Nathan DM 1993). Diese Folgekrankheiten verursachen erhebliche direkte (Behandlungskosten usw.) und indirekte (Ausfälle durch Krankheitstage, Frührente usw.) volkswirtschaftliche Kosten. Neueste Studien zeigen, dass eine intensive Diabetes-Therapie mit einer Verbesserung der Stoffwechsellage sowohl die direkten als auch die indirekten Krankheitskosten deutlich senken kann (Gray A et.al. 2000; Wake N et.al. 2000; Licciardone JC et.al. 1997). Präventive Maßnahmen (im Sinne einer Primärund Sekundärprävention) beim Diabetes mellitus, besonders des Typ2 Diabetes, gewinnen im Hinblick auf die weiter steigende Prävalenz und die dadurch verursachten hohen Folgekosten für das Gesundheitssystem eine zunehmende Bedeutung für die kommenden Jahre. Eine Besonderheit unserer Studie ist, dass es sich ausschließlich um LVA-Versicherte handelt. Es ist anzunehmen, dass gerade bei den Arbeitern in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg des Diabetes und seinen assoziierten Störungen zu rechnen ist. Einerseits fand gerade in den gewerblichen Berufen in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel der Tätigkeitsprofile statt: der An- 2 teil der körperlich arbeitenden Menschen nimmt durch die zunehmende Automatisierung und Technisierung der Arbeitsplätze ständig ab. Viele Versicherte führen nur noch körperlich leichte oder sitzende Tätigkeiten durch. Andererseits ist das Gesundheitsbewusstsein in den unteren sozialen Schichten geringer ausgeprägt als in den höheren Schichten, was sich zum Beispiel an einem höheren Anteil an Rauchern, höheren Blutdruckwerten und einer höheren kardiovaskulären Morbidität zeigt (Chaturvedi N et.al. 1998). Gerade in dieser Bevölkerungsgruppe ist deshalb eine Zunahme des Risikos für Adipositas, Typ2 Diabetes und Erkrankungen des kardiovaskulären Systems zu rechnen. Fragestellung der Studie: Die Prävalenz des objektivierbaren und subjektiven Rehabilitationsbedarfs beim Diabetes mellitus ist in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht bekannt. Für die Effektivität (im Sinne von „efficacy“) von rehabilitativen Interventionen unter Studienbedingungen gibt es bei Diabetes mellitus mittlerweile gute Evidenz (Gaede P et.al. 1999). Mittels einer Querschnittsuntersuchung sollte die Prävalenz des Diabetes mellitus auf Bevölkerungsebene und des prävalenten Rehabilitationsbedarf beim Diabetes mellitus in einer Kohorte von LVA-Versicherten ermittelt werden. Das Projekt steht damit im Kontext eines Schwerpunktthemas des Norddeutschen Verbunds für Rehabilitationsforschung (NVRF): die Objektivierung des Bedarfs für eine stationäre Rehabilitation: Der von uns in der ersten Förderphase entwickelte Reha-Score für Diabetes mellitus ist ein Screening-Instrument für einen wahrscheinlichen bzw. sicheren Rehabedarf. Dieses Instrument kann unter Abwandlung der krankheitsspezifischen Parameter analog auch auf Patienten mit anderen gesundheitlichen Störungen übertragen werden. Für die 2. Förderphase ist geplant, anhand des Reha-Scores auch den Rehabilitationsbedarf bei Patienten mit Metabolischem Syndrom zu ermitteln. Das Ziel einer rechtzeitigen und präventiv (im Sinne einer sekundären und tertiären Prävention) wirkenden Rehabilitation ist als eine Maßnahme auf dem Hintergrund des europäischen Gesamtplans zur Verbesserung der Diabetesversorgung zu verstehen. In der St. Vincent Declaration wurde 3 als Ziel festgelegt, die diabetesbedingten Komplikationen wie terminale Niereninsuffizienz, Erblindung, Amputationen und kardiovaskuläre Ereignisse in den folgenden Jahren um 30-50% zu senken durch Intensivierung der Prävention, Therapie und Rehabilitation (Anonym. 1990a). Die Implementation dieser Beschlüsse von St. Vincent im rehabilitativen Bereich ist ein Ziel dieser Studie. Projektverlauf: Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf des Projekts A3 zeigt die Grafik 1 (s. Anlage). Insgesamt wurden für die Projekte A3 und A4 im NVRF 12429 LVA-Versicherte der Jahrgänge 1939-1958 in Lübeck und näherer Umgebung angeschrieben und um die Beantwortung eines postalischen Fragebogens gebeten. Die Stichprobenziehung, der Versand und die Auswertung der Fragebögen wurden durch das Projekt A4 organisiert. Die Auswertung der postalischen Fragebögen der älteren Teilnehmer (Jahrgänge 1939-1943), die nur für das Projekt A3 angeschrieben wurden, erfolgte im Projekt A3. In der Vorbereitungsphase der Studie wurden die einzelnen Module des Untersuchungsprogramms zusammengestellt und die Mitarbeiter in den Gebrauch der bei der Untersuchung verwendeten methodischen Instrumente eingearbeitet. Gleichzeitig wurde durch das Projekt A4 der postalische Versand der Anschreiben vorbereitet. Am 14. 1. 1999 erfolgte der postalische Versand der ersten 500 Anschreiben (Welle 1). Wegen des erheblich geringer als erwarteten Rücklaufs der postalischen Fragebögen und anderer organisatorischer Schwierigkeiten (s. Bericht Projekt A4 und die Zwischenberichte), dauerte die Vorphase länger als beantragt bis zum 22. 4. 1999. Dadurch verzögerte sich der Versand der postalischen Fragebögen bis zum 7. 9. 2000. Die Untersuchungen der Patienten mit Diabetes mellitus begannen im Mai 1999, die letzten Patienten wurden im Oktober 2000 untersucht. Ab Oktober 2000 erfolgte die Endauswertung der Daten. Da sich die erste Studienphase erheblich verzögerte und der Versand der Fragebögen erst im September 2000 abgeschlossen war, war das ursprüngliche Studiendesign des Projekts A3 nicht mehr realisierbar. Dies sah eine Eingangsuntersuchung der im postalischen Anschreiben identifizierten Diabetes-Patienten vor zur Er- 4 fassung des Gesundheitszustands und des Rehabilitationsbedarfs. Nach einem Beobachtungszeitraum von 2 Jahren war eine Follow-up-Untersuchung geplant zur Re-Evaluation des Gesundheitszustands und intermediärer Outcome-Variablen, die eine Aussage über die Effectiveness zwischenzeitlich stattgehabter stationärer oder ambulanter Reha-Maßnahmen ermöglichen sollte. Da innerhalb des ersten Förderzeitraums keine ausreichend lange Beobachtungsphase mehr möglich war, wurde in Übereinstimmung mit den Förderern beschlossen, die erste Förderphase mit der 1. Querschnittsuntersuchung und der Entwicklung eines Reha-Scores zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs bei Diabetes mellitus zu beenden. Die Follow-up-Untersuchung soll nun zu Beginn der zweiten Förderphase stattfinden und gleichzeitig anhand des Reha-Scores Patienten mit Rehabilitationsbedarf identifizieren. Bei diesen wird in einer randomisierten Studie die Effectiveness einer multmodalen stationären Therapie in einer Reha-Klinik gegenüber einer hausärztlich koordinierten multifaktoriellen Therapie verglichen. Zusätzlich verbleiben die Patienten der ersten Studienphase, die der Randomisierung nicht zustimmen oder bei denen kein Bedarf für eine stationäre Rehabilitation besteht, in einem Beobachtungsarm der Studie. Sie werden ebenso wie die randomisierten Patienten in einer 2. Follow-up-Untersuchung am Ende der 2. Förderphase nachuntersucht. 5 B: Auswertung der epidemiologischen Daten : Rekrutierung der LVA-Kohorte: Die Stichprobenziehung unter den LVA-Versicherten in Lübeck und die Organisation der postalischen Anschreiben erfolgte durch das Projekt A4. Die ursprüngliche Planung sah vor, eine nach Alter und Geschlecht stratifizierte Stichprobe unter den LVA-Versicherten in Lübeck zu ziehen, die insgesamt 10.000 Versicherte im Alter zwischen 45-54 Jahre (in jedem Jahrgang jeweils 5000 weibliche bzw. männliche Versicherte) umfassen sollte. Es zeigte sich, dass nicht ausreichend aktiv Versicherte in Lübeck und nächster Umgebung in diesem Altersfenster zur Verfügung stehen, so dass eine Erweiterung der Stichprobe um die Altersgruppe der 40-44-jährigen erfolgte. Da in dieser jüngeren Teilkohorte die Prävalenz des Typ2 Diabetes als sehr niedrig einzuschätzen ist, entschlossen wir uns, für das Projekt A3 zusätzlich noch eine Teilkohorte von Versicherten zwischen 55 und 59 anzuschreiben. So ergab sich eine gemeinsame Ausgangskohorte der Projekte A3 und A4 von 10.008 aktiven LVA-Versicherten, die in 9 sogennanten Wellen angeschrieben wurden (im weiteren Verlauf Hauptwellen: HW1-9 gennant). Die Daten von 250 Teilnehmern aus dieser Stichprobe wurden in einer Sonderauswertung zur Reliabilität und Non-Response ausgewertet und gingen deshalb nicht in die Endauswertung ein. Des weiteren wurden 2421 ältere Versicherte der Jahrgänge 1939-1943 angeschrieben, deren Daten nur im Projekt A3 ausgewertet wurden. Die Anschreiben dieser älteren Versicherten wurden in 4 Wellen versandt (im weiteren Verlauf als Diabeteswellen: DW1-4 benannt). So ergab sich für das Projekt A3 insgesamt eine Ausgangskohorte von 12429 LVA-Versicherten der Jahrgänge 1939-1958. Eine Gleichverteilung der Geschlechter insgesamt und innerhalb der einzelnen Jahrgänge konnte wegen der Versichertenstruktur der LVAVersicherten in Lübeck nicht erreicht werden, da keine ausreichende Anzahl an weiblichen Arbeitnehmerinnen zur Verfügung stand. Bei der Stichprobenziehung erfolgte deshalb zunächst eine Vollerhebung aller weiblichen LVA-Versicherten, wodurch ein Geschlechtsverhältnis von etwa 1/3 weiblichen zu 2/3 männlichen Versicherten erreicht wurde. (Näheres siehe Bericht des Projekts A4). Insgesamt war in der LVA-Stichprobe der älteren Versicherten der Jahrgänge 1939-1943 der 6 Anteil der Frauen höher als bei den jüngeren Jahrgängen von 1944-1958 (s. Projekt A4). Da in die Stichprobenziehung nur die erwerbstätigen Versicherten eingingen, ist dies dadurch zu erklären, dass unter den älteren Versicherten mehr Frauen nach einer Familienpause wieder ihrem Beruf nachgehen. Dieses Geschlechtsverhältnis spiegelt sich auch beim Vergleich der jüngeren mit den älteren LVA-Versicherten, die gültige Fragebögen zurückgesandt hatten, wider: mit 36,7% gegenüber 31,3% waren bei den älteren Teilnehmern signifikant mehr Frauen als bei den jüngeren (s. Grafik 3 und 4, Anlage). Die Stichprobenziehung für die Diabeteswellen wurde vom Projekt A4 für uns vorgenommen. Die Versendung der postalischen Fragebögen und Organisation des Rücklaufs erfolgten für die Hauptwellen ebenfalls durch das Projekt A4, für die Diabeteswellen wurde dies in Kooperation von Mitarbeiterinnen beider Projekt durchgeführt. Auswertung des Rücklaufs der 2421 älteren Teilnehmer („Diabeteswelle“): Für die sogenannte Diabeteswelle wurden 2421 LVA-Versicherte der Jahrgänge 1939-1943 angeschrieben, die sich auf 38,6% weibliche und 61,4 % männliche Versicherte verteilten. Nicht erreichbar (verstorben, nicht teilnahmefähig -z.B. wegen schwerer Erkrankung- oder verzogen) waren insgesamt 57 Teilnehmer (2,4%). (s. Grafik 2, Anlage). Rücklauf-Bias: Die Daten dieses Abschnitts beziehen sich nur auf die älteren Versicherten (Jahrgänge 1939-1943, „Diabeteswelle“); für den Rücklauf der 10008 Versicherten der Jahrgänge 1944-1958 siehe Bericht des Projekts A4. Um eine Verzerrung (Bias) bei den erhobenen Daten auszuschließen, führten wir anhand der von der LVA erhaltenen Basisdaten Alter und Geschlecht einen Vergleich zwischen den Versicherten, die einen Fragebogen zurückgeschickt hatten (n=1878, 79,4 %) und Versicherten, die nicht geant- 7 wortet hatten (n=486, 20,6%), durch. Die statistische Auswertung erfolgte mittels Kreuztabellen, Chi-Quadrat-Koeffizient nach Pearson und exaktem Test nach Fisher. Bezüglich des Geschlechts fand sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Bei der Analyse nach Altersgruppen wiesen die älteren Teilnehmer (60 Jahre) eine geringe Tendenz zu einer besseren Teilnahmebereitschaft auf, jedoch ohne statistische Signifikanz. Weiterhin stellten wir einen Vergleich an zwischen den Versicherten, die einen gültigen (d.h. ausgefüllten) Fragebogen zurückgeschickt hatten (n=1490) und den restlichen Versicherten, über die keinen weiteren Informationen vorliegen (n=931), weil sie nicht erreichbar waren, nicht geantwortet hatten oder die Fragebögen leer zurückgeschickt hatten. Diese Kollektive unterschieden sich nicht im Durchschnittsalter (s. Grafik 2, Anlage). Bezüglich der Geschlechtsverteilung ergab sich jedoch ein signifikanter Unterschied (Kreuztabellen, exakter Test nach Fisher, p<0,05): es hatten prozentual mehr Männer als Frauen gültige Fragebögen zurückgesandt. Dies könnte zum einen durch die häufige Mehrbelastung der berufstätigen Frauen mit Arbeit, Haushalt und Familie zu erklären sein. Zusätzlich fiel uns bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit den Versicherten auf, dass die Betroffenen teilweise nichts von der Fragebogenaktion wussten, da die Partnerin sie ausgefüllt hatten. Umgekehrt wurde uns jedoch nicht berichtet, dass der Fragebogen einer weiblichen Versicherten von Ihrem Partner ausgefüllt worden wäre. Prävalenz des Diabetes mellitus: Prävalenz nach Selbstangabe im Fragebogen: Durch Eigenangabe im postalischen Fragebogen wurden aus der Kohorte der angeschriebenen LVA-Versicherten Menschen mit einem bekannten Diabetes mellitus identifiziert. Von den 6987 Teilnehmern, die einen ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt hatten, gaben 371 an, zuckerkrank zu sein (s. Grafik 5, Anlage). Das entspricht einer Prävalenz durch Eigenangabe von 5,3%. Unter 8 den 56-60-jährigen lag die Prävalenz erwartungsgemäß deutlich höher mit 7,85% (s. Grafik 3, Anlage), bei den 41-55-jährigen fanden wir eine Prävalenz von 4,62% (s. Grafik 4, Anlage). Die Diabetesprävalenz war unter den Männern (5,97%) deutlich höher als unter den Frauen (3,93%). Dies zeigte sich in beiden Stichproben: bei den Versicherten der Jahrgänge 1939-1943 lag die Prävalenz bei 6,0% bei den Frauen und bei 8,9% bei den Männern. Bei den Jahrgängen 19441958 fand sich eine Diabetesprävalenz von 3,3% bei den weiblichen und von 5,2 % bei den männlichen Versicherten. Gesundheitszustand bei Patienten mit Diabetes versus Gesamtkohorte: Unter den Personen, die eine Diabeteserkrankung bejahten, waren signifikant mehr Männer als in der Gesamtheit derer, die den postalischen Fragebogen ausgefüllt hatten (Kreuztabellen, exakter Test nach Fisher, p<0,001). Diese Geschlechtsverschiebung ließ sich sowohl in der Gruppe der älteren („Diabeteswelle“, s. Grafik 3, Anlage) wie auch in der jüngeren Teilkohorte („Hauptwelle“, s. Grafik 4, Anlage) nachweisen. Zusätzlich zeigte sich in der jüngeren Versichertengruppe – erwartungsgemäß - ein signifikant höheres Alter der Diabeteskranken gegenüber der Gesamtheit (Mann-Whitney-U-Test: Z=-5,540; p<0,001). Bei den über 55-jährigen konnte in unserer Stichprobe hingegen kein Altersunterschied zwischen Diabetespatienten und den übrigen Versicherten gefunden werden. Weiterhin prüften wir, ob sich Personen mit Diabetes mellitus bezüglich einiger im postalischen Fragebogen erfragter Basis-Parameter von der Gesamtstichprobe unterschieden. Eine Übersicht über diese Daten zeigt Tabelle 1: 9 ältere LVA-Versicherte der jüngere LVA-Versicherte der Jahrgänge 1939-43 (100%) Jahrgänge 1944-58 (100%) Selbstangabe im Frage- Diabetes ja kein Diabetes Diabetes ja kein Diabetes bogen (Häufigkeit in %) (7,85% ) (92, 15%) (4,62%) (95,38%) art. Hypertonie 63,7% * 41,8% 54,5% * 28,8% Angina Pectoris 22,6% * 12,4% 10,7% * 4,7% Herzinfarkt 4,0% 3,9% 4,8% * 1,5% Depression 22,3% * 13,8% 17,1% 13,5% 29,4 ± 4,6 * 27,3 ± 4,1 29,0 ± 5,1 * 26,8 ± 4,3 18,4% 13,0% 12,1% * 4,5% 3,36 ± 0,87 P: 3,14 ± 0,93 P. 3,25 ± 0,94 P. * 2,87 ± 0,95 P. 28,2% / 71,8% 37,4% / 62,6% 22% / 78% * 31,7% / 68,3% Body Mass Index (BMI in kg/m2, MW ± 1SD) derzeit keine Erwerbstätigkeit allg. Gesundheitszustand (Punkte, Mittelwert ± 1SD) Geschlecht w/m („sehr gut=1 / gut=2 / zufriedenstellend=3 / weniger gut=4 / schlecht=5“) *signifikanter Unterschied (Diabetes ja vs. kein Diabetes: Kreuztabellen, Chi-Quadrat-Test bzw. exakter Test nach Fisher, zweiseitige Fragestellung) Tabelle 1: Anamnestische Angaben zum Gesundheitszustand aus dem postalischen Fragebogen bei LVA-Versicherten mit Diabetes mellitus (n=371) und ohne Diabetes (n=6616). Bei den älteren Versicherten fanden wir keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Eigenbeurteilung des allgemeinen Gesundheitszustands („sehr gut=1 / gut=2 / zufriedenstellend=3 / weniger gut=4 / schlecht=5“). Bei der Frage: „Hat bei Ihnen ein Arzt jemals eine der folgenden Erkrankungen festgestellt“ ergab sich eine signifikant häufigere Angabe für „Bluthochdruck“ (Kreuztabellen, exakter Test nach Fisher; p<0,001), für „Durchblutungsstörungen am Herzen (Angina pectoris)“ (p<0,05) und für „Seelisches Leiden / Depression“ (p<0,05). Keine signifikanten Unterschiede ergaben sich für die Frage nach einem Herzinfarkt, nach „chronischem Husten mit Auswurf (chronische Bronchitis)“ und nach einer Krebserkrankung. Weiterhin zeigte sich nach der Selbstangabe im Fragebogen ein signifikanter Gewichtsunterschied zwischen Diabetes-Patienten und den übrigen 10 Versicherten: die Patienten mit Diabetes waren signifikant schwerer (Mann-Whitney-U-Test; p<0,001). Bei den jüngeren Versicherten beurteilten Patienten mit Diabetes ihren allgemeinen Gesundheitszustand signifikant schlechter als die Personen ohne Diabetes (Kreuztabellen, Chi-Quadrat-Test, p<0,001). Ebenso gaben die Diabetes-Patienten signifikant häufiger an, an Bluthochdruck (exakter Test nach Fisher, p<0,001), Angina Pectoris (p<0,001), an Herzinfarkt (p<0,005) und chronischer Bronchitis (p<0,05) zu leiden. Die Anzahl der aktiv Erwerbstätigen (Ganztags-oder Teilzeitbeschäftigte versus Arbeitslose, Rentner oder Hausfrauen/-männer) war unter den Personen mit Diabetes signifikant höher (exakter Test nach Fisher, p<0,001). Auch hier wiesen Diabetespatienten nach den Angaben des postalischen Fragebogens ein signifikant höheres Gewicht auf als die übrigen Befragten (Mann-Whitney-U-Test, Z=-6,529, p<0,001). Korrigierte Prävalenz: Bei 12,7% der Teilnehmer, die zunächst im Fragebogen eine Diabeteserkrankung angegeben hatten, wurde diese Angabe später bei der telefonischen Nachfrage verneint (s. Grafik 5, Anlage). Diese 47 „Doch-nicht–Diabetes“-Personen wurden von den ursprünglich als Diabetes-Patienten identifizierten 371 Teilnehmern abgezogen. Andererseits versuchten wir auch diejenigen zu kontaktieren, die im postalischen Fragebogen bei der Frage nach Diabetes „ich weiss nicht“ angekreuzt hatten, um eine möglichst genaue Angabe über die reale Diabetes-Prävalenz in der LVA-Kohorte zu erhalten. Insgesamt beantworteten 3,4% die Diabetesfrage mit „vielleicht“ (2,8% bei den jüngeren, 5,4% bei den über 55-jährigen Teilnehmern). Die Personen mit der Antwort „vielleicht“ hatten, wie bei den Diabetespatienten, ein signifikant höheres Alter gegenüber der Grundgesamtheit in der Haupwelle (Kohorte der jüngeren Versicherten der Jahrgänge 1944-1958), nicht jedoch bei den älteren Versicherten (Jahrgänge 1939-1943). Bezüglich des Geschlechts waren in beiden Teilkohorten keine Unterschiede nachzuweisen (s. Grafik 3 und 4, Anlage). 11 Die Personen mit einer „Vielleicht“-Antwort versuchten wir, soweit möglich, zu erreichen. In einem telefonischen Interview erfragten die Studienärztinnen unter anderem das persönliche und familiäre Diabetes-Risiko und als Screeningwert einen nicht länger als 12 Monate zurückliegenden Nüchtern-Blutglukosewert. Falls bisher keine Blutglukosebestimmung erfolgt war oder die Untersuchung länger als ein Jahr zurücklag, versuchten wir die Teilnehmer zu einer NüchternBlutglukosemessung beim Hausarzt oder in der Poliklinik der Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums Lübeck zu motivieren. Von 14,9% (16,8% bei den jüngeren, 11,2% bei den älteren Teilnehmern) erhielten wir aus Mangel an Zeit oder Interesse keine weitere Auskunft bezüglich der Blutglukose. Bei 75,7% (75,5% der jüngeren, 76,25% der älteren Befragten) lag der NüchternBlutglukose unter 126 mg/dl und wurde als „kein Diabetes“ gewertet. Einen manifesten Diabetes definierten wir entsprechend den Richtlinien der American Diabetes Association (ADA) bei Personen mit einem Nüchtern-Blutglukosewert ≥ 126 mg/dl (Anonym. 1997a). Auf diese Weise konnten unter den Personen mit „Vielleicht“-Antworten weitere 9,4% (n=22) neu diagnostizierte DiabetesPatienten herausgefiltert werden (7,7% bei der jüngeren und 12,5% bei der älteren Altersgruppe). Nach Abzug der „Doch-nicht-Diabetes“- und Hinzufügen der neu identifizierten Diabetiker errechnete sich insgesamt eine korrigierte Prävalenz von 5,0% (346 Teilnehmer von 6987 gültigen Fragebögen), s. Abbildung 1. Unter den jüngeren Teilnehmern lag die korrigierte Prävalenz bei 4,24% (4,8% Männer, 3,0% Frauen), bei den älteren Jahrgängen 7,58% (8,8% Männer, 5,5%Frauen) (s. Grafik 5, Anlage). 12 Prävalenz des Diabetes mellitus in der LVA-Kohorte (Versicherte der Jahrgänge 1939-1958 n=6987 gültige Fragebögen) Prävalenz des Diabetes mellitus: 5,0% Abbildung 1: Prävalenz des Diabetes mellitus (Eigenangabe im Fragebogen und telefonische Bestätigung der Diagnose) in der Kohorte der angeschriebenen LVA-Versicherten, die einen ausgefüllten Fragebogen zurückgesandt hatten (n=6987). Bei diesen „wahren“ Diabetespatienten mit gesicherter Diagnose testeten wir nochmals einige Basisdaten zum allgemeinen Gesundheitszustand aus dem postalischen Fragebogen gegenüber der Gesamtheit der Versicherten ohne Diabetes. Wiederum ergab sich bei den älteren Versicherten eine signifikant häufigere Angabe für Bluthochdruck (exakter Test nach Fisher, p<0,001) und Angina Pectoris (p<0,05). Die häufigere Angabe einer Depression bei Diabetes erreichte hier nicht mehr das Signifikanz-Niveau (p<0,1). Unter den Versicherten der Jahrgänge 1944 und jünger zeigten die Angaben der „wahren“ Diabetespatienten dieselben Unterschiede zur Grundgesamtheit ohne Diabetes wie bereits oben beschrieben (s. Tabelle 1): signifikant häufigere Angabe von Bluthochdruck, Angina Pectoris, Herzinfarkt, chronischer Bronchitis sowie höheres Gewicht. Bei den älteren Versicherten fand sich unter den „wahren“ Diabetespatienten wie bei den jüngeren Versicherten eine 13 signifikante Erhöhungung von Nicht-Erwerbstätigen im Vergleich zur Grundgesamtheit (exakter Test nach Fisher, p<0,05). Vergleich mit Angaben aus der Literatur: Die in der LVA-Kohorte gefundene Gesamtprävalenz von 5,3% für die Eigenangabe einer Diabeteserkrankung (bzw. einer korrigierten Prävalenz nach telefonischer Nachfrage von 5,0%) stimmt weitgehend mit den Angaben anderer Untersuchungen der letzte Jahre in der Bundesrepublik Deutschland überein. Die Diabetesprävalenz (Gesamtprävalenz von Typ1 und Typ2) lag zu Anfang der 90er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland bei 4-5%. Dies gilt sowohl für die subjektive Prävalenzangabe durch Befragung (Altersgruppe 20-65 bzw. 25-69 Jahre) (Potthoff P1987) (Bormann C et al. 1990), durch Untersuchung (DHP-Survey) (Bormann C et al. 1990) und nach der Auswertung von Krankenversicherungsdaten (sämtliche Altersgruppen) (Hauner H, von Ferber L, Koster I 1992), davon abweichende, deutlich höhere Prävalenzangaben (insgesamt 8,2% bei Personen im Alter von 18-70 Jahren) wurden bei der epidemiologischen Untersuchung auf der Basis einer HbA1c-Analyse von Palitzsch et al. berichtet (Anonym. 1999). In unserer Erhebung bei den LVA-Versicherten ergab sich eine höhere Diabetesprävalenz unter den männlichen im Vergleich zu den weiblichen Personen, dies fand sich ebenso in der Studie von Palitsch et al. (Anonym. 1999) Hingegen zeigten die neuesten Daten (Altersgruppe 18-79 Jahre) bei der ärztlichen Befragung im Bundes-Gesundheitssurvey eine Diabetesprävalenz von 4,7% bei den Männern und 5,6% bei den Frauen, bei der Selbstangabe 5,0 % bzw. 5,5% (Thefeld W 1999a). Wie in unseren Daten war in den obengenannten Studien eine überlineare Altersabhängigkeit beim Typ2 Diabetes zu beobachten. Im Nationalen Untersuchungssurvey und nach Auswertung von Krankenversicherungsdaten der AOK Dortmund zeigte sich etwa folgende Altersverteilung in der Diabetesprävalenz: in der Altersgruppe 40-49 Jahre etwa 3%, zwischen 50-59 Jahren bei 6-7%, 14 über 60 Jahren bei 12-17% (Potthoff P1987; Bormann C et al. 1990; Hauner H, von Ferber L, Koster I 1992). Screening-Untersuchung bei einer Sonder-Stichprobe mittels Bestimmung des HbA1cWertes: Um einen Anhaltspunkt über die Prävalenz eines bisher unentdeckten Diabetes mellitus zu gewinnen, analysierten wir in einer gesonderten Stichprobe aus derselben LVA-Kohorte als ScreeningWert das glykierte Hämoglobin (HbA1c). Es handelte sich bei dieser Stichprobe um 403 Probanden, die im postalischen Anschreiben die Frage nach einer Zuckererkrankung mit „nein“ beantwortet hatten und wegen chronischer Rückenschmerzen oder eines unspezifischen Schmerzsyndroms (entsprechend den Untersuchungskriterien des Projekts A4) zur Untersuchung im A4-Projekt eingeladen wurden. Bei schriftlicher Einwilligung zu der freiwilligen Blutabnahme wurden Cholesterin, (Gesamtcholesterin, HDL-und LDL-Fraktion), CRP (als Marker eines entzündlichen Prozesses, s. Projekt A4) und das HbA1c bestimmt. Die Bestimmung des HbA1c-Wertes dient bei nichtnüchternen Personen als Screening-Test für eine diabetische Stoffwechsellage (Anonym. 1997a). Diese Screening–Untersuchung mittels HbA1c-Bestimmung ergab bei 16 Menschen auffällige Werte mit einem erhöhten HbA1c-Wert über 6,7% (Werte zwischen 6,75% und 8,56%; Mittelwert ± 1 Standardabweichung: 7,16 ± 0,46%). Dies entspricht einem erhöhten Screening-Wert bei knapp 4% (3,97%) der Untersuchten. Eine weitere Bestätigung der Verdachtsdiagnose sollte mittels einer hausärztlichen Kontrolle der Nüchtern-Blutglukose erfolgen (entsprechend den Empfehlungen der American Diabetes Association (Anonym. 1997a)). Dies wurde von 3 der Probanden abgelehnt, bei weiteren 7 Probanden lagen nach hausärztlicher Kontrolle die Blutglukosewerte im Normbereich, die Verdachtsdiagnose Diabetes konnte nicht bestätigt werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass bei einigen dieser Patienten, die wegen Rückenbeschwerden zur Untersuchung im Projekt A4 eingeladen wurden, im akuten Schmerzstadium Glukokortikoid-Injektionen erfolgt waren, die vorü15 bergehend eine Störung des Glukosestoffwechsels hervorriefen, was sich in der Erhöhung des HbA1c-Wertes widerspiegelte. Weiterhin könnte die im Befundbrief des Projekts A4 erwähnte Erhöhung des HbA1c-Wertes bei den Probanden zu einer Änderung der Ernährungsgewohnheiten und zu einer dadurch bedingten Normalisierung der Blutglukosewerte geführt haben. Bei 6 dieser Teilnehmer (entsprechend 1,5% der untersuchten Probanden) konnte ein Diabetes mellitus bestätigt werden. Einer dieser Patienten willigte zu einer Untersuchung in unserem DiabetesUntersuchungsprogramm ein. Die übrigen 5 neuentdeckten Diabetiker konnten aus persönlichem Zeitmangel (4 Probanden) oder mangels Interesse (1 Proband) nicht an der Untersuchung in unserem Projekt teilnehmen. Die Prävalenz des bestätigten, bisher unbekannten Diabetes, liegt mit 1,5% etwas unterhalb der Angaben aus anderen Untersuchungen. Bormann et. al. postulierten aufgrund der Daten im Nationalen Untersuchungs-Survey, dass das Verhältnis von bekannten zu neuentdeckten Diabetespatienten etwa 2/3 zu 1/3 betrage: demnach wären bei einer Diabetesprävalenz („wahre Diabetiker“) von 5% etwa 2,5% bisher unentdeckte Diabetespatienten zu erwarten gewesen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Diagnosestellung lediglich aufgrund eines (nicht nüchternen) Blutglukosewertes > 180 mg/dl erfolgte. Im Bundes-Gesundheitssurvey fanden sich bei 2% der Teilnehmer pathologische Screening-Werte (2 von 3 der bestimmten Parameter: HbA1c, Serumglukose oder Uringlukose erhöht) und somit eine etwas höhere Prävalenz an bisher unentdecktem Diabetes als in unserer Screening-Untersuchung (Thefeld W1999a). Bei diesem Unterschied ist die unterschiedliche Altersstruktur unserer Studie im Vergleich zum Nationalen Untersuchungs-Survey oder BundesGesundheitssurvey zu berücksichtigen. Ausserdem handelte es sich bei unserer ScreeningPopulation um eine vorselektierte Gruppe von Menschen, die sich wegen starker und chronischer Rückenschmerzen oder anderer chronischer funktioneller Störungen (Einladungskriterien für das Projekt A4) meist in regelmäßiger ärztlicher Behandlung befanden und auf diesem Wege häufiger einer Vorsorge-Untersuchung mit Blutglukosekontrolle zugeführt werden als eine unselektierte Bevölkerungsstichprobe. 16 Partizipation: Studienteilnehmer, die zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen ihr schriftliches Einverständnis für eine eventuelle Untersuchung geschickt und die Frage nach einer Zuckerkrankheit (Diabetes) mit „Ja“ beantwortet hatten, wurden telefonisch oder schriftlich zu einer Untersuchung in die Poliklinik der Medizinischen Klinik I eingeladen. Ebenso baten wir die Teilnehmer, die im Fragebogen die Diabetesfrage mit „vielleicht“ beantwortet hatten und bei denen die nachfolgende Blutglukosekontrolle erhöhte Nüchternblutglukosewerte ergeben hatten, zur Untersuchung in die Poliklinik. Die Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen, lag insgesamt bei 62,1% (62,2% bei den 41-55jährigen und 61,9% bei den über 55-jährigen Patienten). Diese Zahlen errechneten sich aus der Anzahl der untersuchten Patienten dividiert durch die Anzahl der „korrigierten“ Diabetes-Patienten (s. Abschnitt korrigierte Prävalenz). Die Partizipationsrate schwankte innerhalb der einzelnen Wellen zwischen 35 und 90% (s. tabellarische Übersicht 1, Anlage). Partizipations-Bias: Um eine Verzerrung der Untersuchungsdaten infolge Nicht-Teilnahme bestimmter Patienten einzuschätzen, verglichen wir die Daten zum allgemeinen Gesundheitszustand aus dem postalischen Fragebogen bei den untersuchten 216 Patienten mit denen, die aus Mangel an Zeit oder Interesse nicht zur Untersuchung gekommen waren. Hierbei fanden sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen, allgemeinem Gesundheitszustand oder Erwerbstätigkeit. 17 C: Charakterisierung der untersuchten Diabetes-Patienten: I Untersuchungsablauf: Wir entwickelten in der Vorbereitungsphase ein umfangreiches Instrumentarium zur Befragung und Untersuchung der Probanden mit Diabetes mellitus. Das Untersuchungsprogramm sah wie folgt aus: Die Probanden kamen morgens nüchtern zur Untersuchung, nach dem Aufklärungsgespräch und dem schriftlichen Einverständnis erfolgte die erste Blutabnahme. Anschließend erhielten die Probanden ein Frühstück am Frühstücksbuffet, eine Stunde später erfolgte die postprandiale Blutabnahme. • Blutuntersuchungen: Aus dem Nüchternblut wurden folgende Parameter bestimmt: Plas- maglukose, Gesamt-Cholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyceride, Harnsäure Kreatinin im Plasma, HbA1c. Für eine Unterscheidung des Typ2 Diabetes vom Typ1 und anderen Sonderformen des Diabetes (z.B. pankreopriver Diabetes) ist neben den anamnestischen Angaben der Probanden zusätzlich die Messung des C-Peptids im Serum von großer Bedeutung, da durch diese Messung eine Aussage zur körpereigenen Insulinproduktion erfolgen kann. In der Auswertung unterscheiden wir Patienten mit klassischem Typ2 Diabetes, Typ1 Diabetes (C-Peptid-negativ) und als Sonderform den durch Pankreatitis bedingten Diabetes mellitus im weiteren Verlauf als „pankreopriver Diabetes“ benannt). • Postprandiales Labor: Eine Stunde nach Beginn des Frühstücks erfolgte eine zweite Blutab- nahme zur Messung des Blutglukoseanstiegs und eines etwaigen Anstiegs des C-Peptids nach der Mahlzeit zur Charakterisierung von Typ2 und Typ1 Diabetes (Anonym. 1990b). In einer postprandialen Urinprobe wurde die Ausscheidung von Glukose und Mikroalbumin über die Nieren gemessen, um eine bestehende diabetische Nephropathie zu erkennen. • Ärztliches strukturiertes Interview: Es wurde in Anlehnung an die Fragebögen nach dem PORT-Konzept (Patient Outcome Research Team) für Medical Effectiveness Studies erstellt und umfasst die diabetesspezifische Anamnese, Komorbiditäten und Folgeerkrankungen (Kaplan S, Sullivan L 1992). Weiterhin erfassten wir, in Abstimmung mit Projekt A4, sozioökonomische Da18 ten, Fragen zur Reha-Anamnese, Arbeitsunfähigkeit und Belastungen am Arbeitsplatz (Dauer des Interviews ca. eine Stunde). • Ärztliche strukturierte Untersuchung: Die körperliche Untersuchung erfasste die diabetes- spezifischen und –assoziierten Erkrankungen sowie Komorbitäten, die den allgemeinen Gesundheitszustand beeinflussen. Weiterhin wurden Basisgrößen bestimmt wie Größe (auf 0,1 cm genau), Gewicht bei leichter Bekleidung (auf 0,1 kg genau). Hieraus wurde der Body Mass Index (BMI) bestimmt, der sich aus dem Gewicht G (in kg) und der Körpergröße K (in m) nach der Formel G/K2 errechnet. Eine standardisierte Blutdruckmessung wurde mit einem automatischen Blutdruckmessgerät durch insgesamt dreimalige Blutdruckmessung im Liegen nach mindestens zweiminütigem Abstand durchgeführt. Eine orientierende Untersuchung des Bewegungsapparates, v.a. der Wirbelsäule, des Abdomens und die Auskultation der Lunge erfasste weitere Komorbiditäten. Diabetesspezifische Komplikationen finden sich bei Vorliegen eines diabetischen Fußes oder bei herabgesetztem Vibrationsempfinden im Stimmgabeltest. Diabetesassoziierte Makroangiopathien wurden durch Auskultation der Carotiden und Palpation der Fußpulse klinisch diagnostiziert. Ausserdem erfolgte die Ableitung eines 12-Kanal-EKG`s, um Zeichen einer koronaren Herzerkrankung und hypertensive Veränderungen zu dokumentieren. • Technische Untersuchungen: Hierdurch werden weitere wichtige Folgeerkrankungen des Dia- betes mellitus erfasst. 1) Das Vorliegen einer kardialen autonomen diabetischen Neuropathie (KADN) kann mit Hilfe der Messung der Herzfrequenzvariabilität diagnostiziert werden. Diese ist ein wichtiger Prädiktor für zu erwartende kardiale Komplikationen wie Schwindel, Tacharrhythmien und ist ein Indikator für weitere Formen der diabetischen autonomen Neuropathie (z.B. Gastroparese) (Ziegler, D 1994). • 2) Mit Hilfe einer Non-Mydriatischen Funduskamera (Retinalkamera TCR-NW5, Fa. Topcon, Topcon Deutschland GmbH, 47877 Willich) untersuchen wir den Augenhintergrund beider Augen auf das Vorliegen einer diabetischen Retinopathie. Dies ist eine sehr häufige Spätkomplikation des Diabetes (Prävalenz 80-100% nach einer Diabetesdauer > 20 Jahre), die der eigentlichen Krank- 19 heitsdiagnose auch schon vorausgehen kann. (Ferris, FL, Davis, MD 1999). Wegen einer möglichen Beeinträchtigung des Sehvermögens und dadurch bedingter Einschränkung der Erwerbsfähigkeit sowie der Gefahr einer drohenden Erblindung ist eine frühzeitige Erfassung dieser diabetesbedingten Erkrankung besonders wichtig. Die im Projektantrag ursprünglich geplante augenärztliche Untersuchung erwies sich aus verschiedenen Gründen als nicht praktikabel: Die zur augenärztlichen Untersuchung erforderliche Mydriasis wird im Rahmen einer freiwilligen Untersuchung von den meisten Teilnehmern als unakzeptabel empfunden, zumal die Verkehrstüchtigkeit danach für mehrere Stunden beeinträchtigt ist. Auch war der weitere Ablauf des Studienprotokolls durch Zeitverluste infolge langer Wegstrecken auf dem Universitätsgelände und nicht zu kalkulierender Wartezeiten gefährdet, das Lesen und Ausfüllen von Fragebögen nach der Augenuntersuchung war wegen Akkomodationsstörung behindert. Die Verwendung einer Non-mydriatischen Kamera wurde von Prof. Dr. Laqua (Direktor der Augenklinik der Medizinischen Universität Lübeck (MUL)) empfohlen. Deshalb wurden nach Abstimmung mit dem Projektförderer die bewilligten Finanzmittel umverteilt und zur Anschaffung einer Non-mydriatischen Funduskamera benutzt. Dieses Verfahren hat sich im bisherigen Verlauf der Studie sehr bewährt wegen seines didaktischen Werts und positiver Motivation der Probanden mit sicherlich positivem Einfluss auf die weitere Teilnahme im Followup. Eine gute Qualität der Polaroid-Aufnahmen konnte nach relativ kurzer Einarbeitungszeit der ärztlichen Mitarbeiterinnen erzielt werden. Eine Einarbeitung in die Beurteilung und Auswertung der Fotos erfolgt derzeit in Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen der Augenklinik der MUL. Die nicht im Antrag berücksichtigten laufenden Kosten für die Polaroid-Aufnahmen und die Abzüge für die Probanden wurden von der Medizinischen Klinik I der Universität getragen. Alle Studienteilnehmer werden gebeten, zur zusätzlichen Beurteilung der bei der non-mydriatischen Aufnahme nicht erfassten peripheren Netzhautabschnitte bei ihrem Augenarzt einen standardisierten augenärztlichen Befundbogen ausfüllen zu lassen. So konnte häufig eine zusätzlich eine wünschenswerte Anbindung der Teilnehmer an einen niedergelasssenen Augenarzt erreicht werden. 20 • Fragebögen: Zur Erfassung des allgemeinen Gesundheitszustands und zur Vergleichbarkeit der Diabeteskohorte mit Studienteilnehmern anderer Teilprojekte wurden folgende der vom Zentralprojekt empfohlenen Erhebungsinstrumente eingesetzt: Euroquol (deutsche Version: (Graf von der Schulenburg J et.al. 1998) ,SF-36 (Bullinger M, Kirchberger I 1998), CESD (Gerbershagen H-U, Kohlmann T 1998). Zur Erhebung der Lebensqulität bei Diabetes wandten wir den LQD an (Hirsch A, Bartholomae C, Vollmer T 1997). Das Wissen über Diabetes erfragen wir über den Wissenstest für nichtinsulinbehandelte Typ2 Diabetiker (Hermanns N, Kulzer B 1996), für die insulinbehandelten Patienten mit Diabetes stellten wir in Anlehnung daran einen Wissenstest mit Elementen aus dem obengenannten Fragebogen und dem Wissenstest aus dem Diabetesschulungsprogramm nach Berger zusammen (Berger M et.al. 1984). Da die Diagnose „Diabetes“ und die dadurch notwendige Änderung der Lebenssituation selbst Stress verursachen kann, andererseits pathologischer Stress einen Risikofaktor für vaskuläre Komplkationen darstellt (McEwen BS 1998), erfassten wir chronischen Stress durch das TICS (Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress;) (Schultz P, Schlotz W 1999). Das Essverhalten spielt beim Diabetes eine wichtige Rolle: einerseits als mögliche Ursache für Übergewichtigkeit, andererseits verändert sich das Essverhalten möglicherweise als Folge therapeutischer Intervention nach Diagnosestellung. Die verschiedenen Verhaltensmuster bezüglich Essenskontrolle und –störbarkeit erfassten wir im FEV (Fragebogen zum Essverhalten) (Pudel V, Westenhöfer J 1989). II Messmethoden: Bestimmung des HbA1c: Die Bestimmung des HbA1c erfolgte mittels HPLC an einem Kationen-Austauscher (MONO SSäule, Fa. Pharmacia Biotech, Postfach, 91051 Erlangen). Die dazu benötigten Puffer sind ein eigener Ansatz des Labors für Klinische Chemie des Universitätsklinikums Lübeck. Zur Messung wird 21 eine HPLC-Anlage und Photometer der Firma Merck (Merck, Postfach 101042, 64210 Darmstadt) verwendet. Bestimmung der Serumglukose: Die Serumglukose wurde mit Hilfe des Beckmann-Glukose-Analysators 2 durchgeführt (Fa. Beckman Coulter GmbH, Europark Fichtenhain B13, D-47807 Krefeld). Es handelt sich um eine kinetische Messtechnik, bei der die Oxidation der im Serum vorhandenen Glukose durch die Glukoseoxidase anhand des verbrauchten Sauerstoffs bestimmt wird. Ein Vorteil ist die absolute Spezifität dieser Methode und sowie die fehlende Beeinträchtigung durch lipämische, urämische oder hämolytische Proben. Bestimmung des C-Peptids: Das C-Peptid wurde mittels ELISA bestimmt. Die dazu benötigten Reagenzien wurden von der Firma DAKO (DAKO Ltd., Denmark House, Angel Drove, Ely, Cambridgeshire,CB7 4ET, United Kingdom) bezogen. Als Analysegerät diente ein Photometer der Firma Bio-Rad (Bio-Rad, Postfach 450133, 80901 München). Bestimmung des Cholesterins, der Triglyceride und Harnsäure: Das Gesamt-Cholesterin, die Triglyceride und die Harnsäure wurden mittels automatisierter Standardmethoden (BM Hitachi System717, Fa. Roche Diagnostics, Boehringer Mannheim GmbH, 68298 Mannheim) bestimmt. Cholesterin-Bestimmung: enzymatischer Farbtest mittels CholesterinEsterase und Cholesterin-Oxidase. Triglycerid-Bestimmung: enzymatischer Farbtest mittels Hydrolyse (Lipase). Harnsäure-Bestimmung mittels Uricase. HDl- und LDL- Cholesterin wurden mittels eines homogenen enzymatischen Farbtests (HDL-C plus bzw. LDL-C plus: Fa. Roche Diagnostics, Boehringer Mannheim GmbH, 68298 Mannheim) bestimmt. 22 Bestimmung des Urinalbumins: Das über die Niere ausgeschiedene Albumin wurde im Spontanurin bestimmt. Die quantitative Analyse erfolgte mittels Immunluminometrischem Assay (Steinhoff J et al. 1997). Zur Analys e wurde das Luminometer der Fa. Berthold (AutoCliniLuminat LB 952T/16, Berthold, D-75323 Wildbad) verwandt. III Statistische Auswertung: Sämtliche Untersuchungsdaten wurden mittels SPSS (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc.,Chicago) ausgewertet. Die Dateneingabe aus den Fragebögen erfolgte mit Hilfe von AccessEingabemasken, die das Methodenprojekt Z2 im NVRF für uns erstellt hatte. Für die Berechnung signifikanter Unterschiede beim Vergleich von Mittelwerten wandten wir den tTest an, falls es sich um normalverteilte Parameter handelte. Bei nicht-normalverteilten Parametern erfolgte die Berechnung mit dem Mann-Whitney-U-Test für zwei unabhängige Stichproben bzw. mit dem Wilcoxon-Test für verbundene Stichproben. Falls bei der zu testenden Variable nur eine begrenzte Anzahl von Kategorien vorlagen, wurden der Chi-Quadrat-Test nach Pearson bzw. der exakte Test nach Fisher durchgeführt. Korrelationen wurden bei nicht normalverteilten Stichproben mittels der nicht-parametrischen Korrelation nach Spearman errechnet. Falls nicht anders erwähnt, wurde die Testung jeweils 2-seitig durchgeführt. IV Ergebnisse: Demographische Beschreibung der Stichprobe: Insgesamt untersuchten wir 216 Patienten mit Diabetes mellitus. Tabelle 2 zeigt die wichtigsten Basisdaten aller 216 Patienten. 23 Gesamtzahl n=216 Alter 52,9 J. ± 5,5 J. weiblich: n=54 (25,0%) Geschlecht männlich: n=162 (75,0%) erwerbstätig n=173 (80,1%) arbeitslos n=32 (14,8%) berentet n=11 (5,1%) Tabelle 2: Demographische Charakterisierung aller im Projekt A3 untersuchten DiabetesPatienten Einteilung nach Diabetes Typ: Pathophysiologischer Hintergrund: Dem Typ1 und Typ2 Diabetes liegen ganz unterschiedliche pathogenetische Störungen des Kohlehydratstoffwechsels zugrunde, entsprechend unterschiedlich sind die Risiko-und Begleitfaktoren dieser beiden Erkrankungen ausgeprägt. Während beim Typ1 Diabetes eine autoimmunologisch verursachte Zerstörung der insulinproduzierenden ß-Zellen der Bauchspeicheldrüse einen absoluten Mangel an Insulin im Körper bewirkt, liegen bei der Entwicklung eines Typ2 Diabetes komplexe pathogenetische Störungen vor. Grafik 6 (Anlage) veranschaulicht diese pathophysiologischen Zusammenhänge. Als Grundstörung wurde eine Insulinresistenz identifiziert (Reaven GM 1988), der Typ2 Diabetes ist somit als Sonderform des sogenannten Metabolischen Syndroms zu verstehen und umfasst als Hauptsymptome das „Deadly Quartett“ : Adipositas, Hyperglykämie, Hyperlipidämie und arterielle Hypertonie. Als Risikofaktoren für die Entwicklung der Insulinresistenz gelten Bewegungsmangel, chronischer psychosozialer Stress, übermäßiger Alkoholkonsum, eine inadäquate Nahrungszufuhr und Nikotinabusus. 24 Wegen der unterschiedlichen pathogenetischen Ursachen sind auch die therapeutischen Ansätze beim Typ1 und Typ2 grundsätzlich verschieden: Während die kausale Therapie beim Typ1 Diabetes in der Substitution des fehlenden körpereigenen Insulins liegt, erfordert die multidimensionale Störung des Typ2 Diabetes nicht nur eine Wiederherstellung des Glukosestoffwechsels, sondern eine multimodale Therapie, die die unterschiedlichen Risikofaktoren und Grundstörungen gleichermaßen erfasst. Der durch eine Pankreaserkrankung bedingte Diabetes (pankreopriver Diabetes) ist ebenfalls durch einen Mangel an körpereigenem Insulin gekennzeichnet und daher eher dem Typ1 vergleichbar. Algorithmus zur Bestimmung des Diabetes-Typs: Die Festlegung des Diabetes-Typs war eine wichtige Voraussetzung zur Charakterisierung der untersuchten Diabetes-Patienten. Hierzu entwickelten wir einen Algorithmus, mit dessen Hilfe aus wenigen Basisdaten eine Unterscheidung in Typ1 und Typ2 vorgenommen werden kann. Der pankreoprive Diabetes wurde vorab aufgrund der anamnestischen Angabe einer stattgehabten Pankreaserkrankung bestimmt. Basisdaten zur Bestimmung des Diabetes-Typs: benötigt werden Nüchtern-und postprandiales CPeptid, die anamnestische Angabe, ob und zu welchem Zeitpunkt nach der Diagnosestellung eine Insulintherapie begonnen wurde sowie der Body Mass Index (BMI). Das Hormon C-Peptid ist ein Nebenprodukt bei der körpereigenen Insulinproduktion und ist somit ein Indikator, ob und wieviel körpereigenes Insulin produziert wird. Beim Typ1 Diabetes ist sowohl basal als auch nach der Stimulation durch eine Mahlzeit kein oder nur wenig körpereigenes Insulin und somit auch C-Peptid im Blut nachzuweisen, während beim Typ2 Diabetes aufgrund der Insulinresistenz meist hohe CPeptid-Spiegel gemessen werden. Der normale C-Peptid-Spiegel liegt in unserem Referenz-Labor nüchtern bei 0,5 bis 3,0µg/l, postprandial bei 5,0-12,0 µg/l. Zur Berechnung des Algorithmus werden bei den Nüchtern- und postprandialen C-Peptid-Werten insgesamt 6 Klassen gebildet und einem Score von 1-6 Punkten zugeordnet. Dabei sind einem geringen oder unterhalb der Nachweis- 25 grenze liegenden C-Peptid-Wert 1 Punkt zugeordnet, bei hohen bzw. oberhalb der Nachweisgrenze liegendem C-Peptid-Wert 6 Punkte (s. Tabelle 3). Weiterhin geht in den Algorithmus die Frage nach dem Beginn der Insulintherapie ein. Während beim Typ1 Diabetes die Destruktion der Inselzellen des Pankreas meist eine sofortige Insulinsubstitution erforderlich macht, ist beim Typ2 Diabetes häufig keine Insulintherapie erforderlich oder erst im späteren Verlauf der Erkrankung, wenn die Sekretionskapazität der Bauchspeicheldrüse erheblich supprimiert wird. Zur anamnestischen Frage nach dem Beginn der Insulintherapie erstellten wir ebenfalls eine 6-stufige Punkteskala: der Antwort „sofortige Insulintherapie“ wird ein Punkt zugeordnet, einem Intervall zwischen Diagnosestellung und Insulintherapie von Tagen 2 Punkte, von ≥2 Wochen 3 Punkte, von ≥2 Monaten 4 Punkte, von ≥ 2 Jahren 5 Punkte, „keine Insulintherapie“ erhält 6 Punkte. ScorepunkNüchternte C-Peptid (µg/l) jeweils: <0,55 1 BMI (kg/m2) <0,55 Intervall zwischen Diagnose und Insulintherapie sofort postprandiales C-Peptid (µg/l) 15 -<20 2 0,5 -<1,5 0,55 -<2,0 nach Tagen -<2 Wochen 20 -<25 3 1,5 -<3 2,0 -<4,0 ≥2 Wochen -< 2 Mon. 25 -<30 4 3,0 -<4,5 4,0 -<6,0 ≥ 2 Monate - <2 Jahre 30 -<35 5 4,5 -<6,0 6,0 -<8,0 ≥ 2 Jahre 35 -<40 6 ≥6,0 ≥8,0 kein Insulin ≥40 Tabelle 3: Zuordnung des Diabetes-Typs (Typ1/Typ2) entsprechend einem Algorithmus, bei dem aus den 4 Basisdaten (Nüchtern- und pp C-Peptid, Intervall zwischen Diabetesdiagnose und Insulintherapie sowie Body Mass Index) mit jeweils 6 klassigem Punktescore ein Gesamtscore errechnet wird. Eine Zuordnung zu Diabetes Typ1 ergibt sich bei 4-9 Punkten, zum Typ2 Diabetes bei >9 Punkten. 26 Die Punktwerte aus den jeweils 4 Parametern werden addiert. Auf diese Weise können insgesamt mindestens 4, maximal 4 x 6, also 24 Score-Punkte erreicht werden. Es zeigten sich 2 Häufungen des Scores mit Maxima bei 6 und 16 Score-Punkten. Die „Referenzdiagnose“ zur Unterscheidung zwischen Typ1 und Typ2 legte unabhängig vom Bewertungsalgorithmus ein Diabetologe fest. Legt man die Referenzdiagnose zugrunde, so kann mit dem Algorithmus die Diskriminierung zwischen Typ1 und Typ2 Diabetes ohne Überschneidungen vorgenommen werden. Bei einem Punktwert zwischen 4-9 Punkten lag ein Typ1 Diabetes vor. Eine Zuordnung als Typ2 Diabetker erfolgte bei 10 und mehr Punkten im Gesamt-Score (s. Abbildung 2). Bestimmung des Diabetes-Typs Anzahl der Patienten 40 30 20 10 0 5 10 15 Score-Punkte 20 25 Typ 1 Diabetes Typ 2 Diabetes Grenze zwischen Typ 1 und Typ 2 Abbildung 2: Zuordnung des Diabetes-Typs (Typ1/Typ2) entsprechend eines Algorithmus mit einem erreichbaren Punkte-Score zwischen 4 und 24 Punkten. 27 Unter den von uns untersuchten Diabetes-Patienten fanden sich nach Anwendung dieses Algorithmus 17 mit Typ1 Diabetes (7,9%) und 191 mit Typ2 Diabetes (88,4%). Dies stimmt in etwa mit den gesamtdeutschen Daten überein, nach denen 5-7% der Diabetes-Patienten dem Typ1 und 93-95% dem Typ2 zuzurechnen sind (Anonym. 1998a). Zusätzlich trennten wir von den Typ1 und Typ2 Diabetikern aufgrund anamnestischer Angaben Patienten mit einem sogenannten pankreopriven Diabetes. Dies traf für 8 Patienten (3,7%) zu. Die Auswertung unserer Daten wurde getrennt nach Diabetestyp durchgeführt. Der Schwerpunkt der Auswertung bezieht sich dabei auf den Typ2 Diabetes, da über diese Patientengruppe die meisten Daten vorliegen. Typ1 Typ2 pankreopriv (n=17) (n=191) (n=8) Alter (Jahre) 49,0 ± 5,32 53,24 ± 5,28 52,88 J. ± 7,43 . Geschlecht: weiblich w: n=3 (17,6%) w: n=50 (26,2%) w: n=1 (12,5%) m: n=14 (82,4%) m: n=141 (73,8%) m: n=7 (87,5%) erwerbstätig n=13 (76,5%) n=155 (81,2%) n=5 (62,5%) arbeitslos n=3 (17,6%) n=28 (14,7%) n=1 (12,5%) berentet n=1 (5,9%) n=8 (4,2%) n= 2 (25%) Diabetestyp männlich: Tabelle 4: Demographische Charakterisierung der 216 untersuchten Diabetes-Patienten, unterteilt nach Diabetes-Typ In Tabelle 4 sind die demographischen Daten der 216 nochmals im Überblick, nach Diabetes-Typ unterteilt, dargestellt. 28 Untersuchungsergebnisse: Tabelle 5 stellt die Basis-Untersuchungsdaten aller 216 Diabetes-Patienten dar. Es zeigt sich insbesondere beim Gewicht und beim Body Mass Index ein deutlicher Unterschied zwischen den verschiedenen Diabetes-Typen. Diabetestyp Typ1 Typ2 pankreopriv Gewicht (kg) 75,85 ± 9,03 93,16 ± 16,27 73,76 ± 12,29 BMI (kg / m2) 24,76 ± 2,03 31,37 ± 5,15 24,56 ± 3,28 133, 24 ± 13,67 143,53 ± 19,35 140,25 ± 17,26 80,12 ± 7,35 86,47 ± 9,06 83,75 ± 7,98 mittlerer systolischer Blutdruck aus 3 Messwerten (mm Hg) mittlerer diastolischer Blutdruck aus 3 Messwerten (mm Hg) Tabelle 5: Medizinische Charakteristika der 216 untersuchten Diabetes-Patienten (jeweils Mittelwert ± Standardabweichung) Body Mass Index: Der Body Mass Index ist ein international anerkanntes Maß zur Erfassung der Adipositas, da er leicht und exakt zu bestimmen ist (Dwyer J 1996). Allerdings wird nicht ausschließlich die Fettmasse erfasst, sondern auch Muskelmasse und Körperbau. Wie bereits erwähnt und in der Grafik 6 (Anlage) veranschaulicht, spielt bei der Entwicklung des Typ2 Diabetes die Adipositas eine bedeutende Rolle. In der Tabelle 6 ist der BMI für die Patienten mit Typ2 Diabetes nach Geschlechtern getrennt dargestellt. Dabei lagen uns bei den untersuchten Diabetes-Patienten sowohl die gemessenen Daten (Körpergröße und Gewicht) vor als auch die Eigenangaben bezüglich dieser Daten aus dem postalischen Fragebogen. Schließlich zeigt die Tabelle 6 die BMI-Werte von 6450 Probanden, die im postalischen Fragebogen eine Diabeteserkrankung verneinten und Körpergröße sowie Gewicht angegeben hatten. In der Abbildung 3 werden diese Daten nochmals grafisch veranschaulicht. 29 BMI-Werte: Frauen Männer 33,14 ± 6,16 30,74 ± 4,60 (n=50) (n=141) 31,95 ± 5,78 30,07 ± 4,26 (n=50) (n=139) Probanden ohne Diabetes mellitus (n=6450) 26,50± 4,83 27,23 ± 3,97 Selbstangabe im Fragebogen). BMI (kg / m2) (n=2081) (n=4369) Probanden mit Typ2 Diabetes (n=191): ge2 messene Werte BMI (kg / m ) Probanden mit Typ2 Diabetes (n=189) Selbst2 angabe im Fragebogen). BMI (kg / m ) Tabelle 6: Body Mass Index (Mittelwert ± Standardabweichung) bei Patienten mit Typ2 Diabetes (n=191), nach Geschlecht getrennt ausgewertet, und bei LVA-Versicherten ohne Diabetes mellitus (n=6450). Zunächst wird deutlich, dass der aus Messdaten errechnete BMI bei den Frauen mit Typ2 Diabetes signifikant höher ist (Mann-Whitney-U-Test, Z= -2,55; p<0,05) als bei den Männern. Weiterhin zeigte sich, dass bei den Frauen mit Typ2 Diabetes der BMI aus den gemessenen Daten signifikant höher liegt als bei der Eigenangabe im Fragebogen (Wilcoxon-Test, Z=-4,913; p<0,001). Schließlich zeigt der Vergleich der (im Fragebogen angegebenen) BMI´s einen signifikant höheren Wert bei den Frauen (Mann-Whitney-U-Test, Z= -6,37; p<0,001) und den Männern (t-Test, T=-6,84; p<0,001) für Patienten mit Typ2 Diabetes mellitus gegenüber den Probanden ohne Diabetes. Bei diesen Probanden ist der BMI bei den Männern etwas höher als bei den Frauen. Diese Beobachtung steht in Übereinstimmung mit den Daten aus dem Bundes-Gesundheitssurvey: hier wurde bei 7124 Personen der BMI aus Untersuchungsdaten ermittelt. In der Altersgruppe zwischen 40-60 Jahren fand sich dort ebenfalls ein etwas höherer BMI bei den Männern als bei den Frauen und entsprachen bis auf geringe Unterschiede den bei uns durch Eigenangabe ermittelten Werten (Bergmann KE, Mensink GB 1999). 30 Body Mass Index 40 35 B M I (kg/m2) 30 25 20 15 10 5 0 Frauen Männer Typ 2 Diabetes (Messwerte) Typ 2 Diabetes (Eigenangabe) Probanden ohne Diabetes (Eigenangabe) Abbildung 3: Body Mass Index (Mittelwert + 1 Standardabweichung) bei Patienten mit Typ2 Diabetes und bei Personen ohne Diabetes mellitus. 31 Blutdruck und antihypertensive Medikation: Diabetestyp anamnestisch art. Hypertonie Typ1 Typ2 pankreopriv 24,0% 60,7% 25,0% 2,67 ± 1,15 J. 10,21 ± 10,43 J. 15,5 ± 20,5 J. 17,6% 50,3% 25,0% 41,2% 68,6% 87,5% (Häufigkeit in %) Dauer der art. Hypertonie (Jahre, MW ± 1SD) antihypertensive Medikation (Häufigkeit in %) RR Werte >135/85 mm Hg (für Typ1 und pankreopriver Diabetes) bzw. >140/85 mm Hg (für Typ2) (%) Tabelle 7: Häufigkeit der artereillen Hypertonie (anamnestische Abgaben und gemessene Werte) und von antihypertensiver Medikation bei 216 Patienten mit Diabetes mellitus. In der Tabelle 7 werden von 216 Diabetes-Patienten anamnestische Angaben zur arteriellen Hypertonie und gemessene Blutdruckwerte gegenübergestellt. Bei den gemessenen Werten handelt es sich um die Mittelwerte aus 3 Messungen im Liegen, jeweils gemessen im Abstand von mindestens 2 Minuten. Als Grenzen für erhöhte Werte wurden die Grenzwerte nach den European Guidelines für Typ1 und Typ2 Diabetes mellitus (Alberti G 1999; 1998b) gewählt. Diese Blutdruckgrenzen stellen Zielblutdruckwerte für Diabetespatienten dar und liegen deshalb unter den häufig in der Literatur angegebenen Grenzwerten von 140 / 90 mmHg, wie sie für Patienten ohne Diabetes mellitus angegeben werden (Anonym. 2000a). Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass bei allen Diabetes-Typen die anamnestische Angabe einer arteriellen Hypertonie weniger häufig ist als erhöht gemessene Blutdruckwerte. Es ist natürlich zu berücksichtigen, dass aus den vorliegenden Messungen zum Untersuchungszeitpunkt nicht die Diagnose eine arteriellen Hypertonie gestellt werden darf, diese muss 32 durch wiederholte Einzelmessungen und/oder eine Langzeitblutdruckmessung bestätigt werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass bei einem großen Teil der untersuchten Patienten eine bisher unbekannte oder unbehandelte Hypertonie vorlag. Die Abbildung 4 veranschaulicht, wieviel Prozent der 216 Diabetes-Patienten keine bzw. eine antihypertensive Medikation erhielten. Häufigkeit von blutdrucksenkender Medikation bei Patienten mit Diabetes mellitus (n=216) 100 Häufigkeit in Prozent 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 Anzahl der blutdrucksenkenden Medikamente Typ 1 Diabetes Typ 2 Diabetes pankreopriver Diabetes Abbildung 4:Häufigkeit blutdrucksenkender Medikation bei 216 Patienten mit Diabetes mellitus. 33 In der Abbildung 5 ist für Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes die Höhe der gemessenen Blutdruckwerte in Abhängigkeit von der Anzahl der blutdrucksenkenden Medikamente dargestellt. Man sieht einerseits, dass die Blutdruckwerte von Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes nicht signifikant unterschiedlich sind. Ebenso ist die Höhe des Blutdrucks nicht mit der Anzahl der antihypertensiven Medikamente korreliert. Höhe des Blutdrucks bei Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes 200 180 Blutdruck (mm Hg) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 Anzahl der blutdrucksenkenden Medikamente Typ 1: systolischer RR (Mittelwert + SD) Typ 1: diastolischer RR (Mittelwert + SD) Typ 2: systolischer RR (Mittelwert + SD) Typ 2: diastolischer RR (Mittelwert + SD) Abbildung 5 : Höhe des Blutdrucks und Anzahl der antihypertensiven Medikamente bei Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes mellitus (n=208). 34 Blutdruck im Normbereich Blutdruck erhöht keine antihypertensive Medikation (n=95) 18,3% 31,4% antihypertensive Medikation (n=96) 13,1% 37,2% Tabelle 8: Erhöhte bzw. normale Blutdruckwerte bei Patienten mit Typ2 Diabetes (n=191). Die Kreuztabelle zeigt am Beispiel der Patienten mit Typ2 Diabetes, wie häufig normale bzw. erhöhte Blutdruckwerte bei Patienten mit bzw. ohne antihypertensive Medikation vorkommen. Insgesamt lagen nur 31,4 % der gemessenen Blutdruckwerte im Normbereich, wobei fast gleich viele Patienten mit wie ohne antihypertensive Medikation waren. Die Güte der Blutdruckeinstellung zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen Patienten mit und ohne Medikation. Bei den Patienten mit Typ1 Diabetes lagen 58,8 % der Blutdruckwerte im Normbereich, auch hier zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied in der Blutdruckeinstellung bei Patienten mit versus Patienten ohne Medikation. Laborparameter: Tabelle 9 zeigt die Laborparameter der 216 Diabetes-Patienten. Als Vergleichskollektiv dienen Probanden aus Projekt A4 ,die im Rahmen ihrer Untersuchung wegen Rückenschmerzen oder unspezifischem Schmerzsyndrom einer freiwilligen Blutabnahme zugestimmt hatten. Zunächst zeigt sich, dass die prä-und postprandialen Blutglukosewerte von Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes annähernd identisch sind. Auch die HbA1c-Werte sind bei Typ1 und Typ2 und auch zwischen Typ2 und pankreoprivem Diabetes sind nur geringfügig unterschiedlich und erreichen nicht das Signifikanz-Niveau. 35 nü-Blutglukose (mg/ dl) Diabetes Diabetes Pankreopri- Typ1 Typ2 ver Diabetes (n=17) (n=191) (n=8) Stichprobe von Nicht- Labor-Refe- Diabetikern renzwerte (n=405) 180,1 ± 64,4 180,3 ± 60,7 148,6 ± 35,6 <110 pp Blutglukose (mg/ dl) 246,8 ± 81,2 247,6 ± 69,3 251,1 ± 48,0 <180 (Plasmaglukose) HbA1c (%) Gesamt-Cholesterin (mmol /l) LDL-Cholesterin (mmol /l) HDL-Cholesterin (mmol /l) Triglyceride (mmol / l) Harnsäure (µmol / l) 8,09 ± 1,10 7,74 ± 1,59 8,91 ± 2,35 5,80 ± 0,489 5,0-6,7 5,68 ± 1,03 6,10 ± 1,31 5,31 ± 1,71 6,01 ± 1,06 <5,2 3,38 ± 0,96 3,75 ± 0,99 3,18 ± 1,46 3,79 ± 1,01 <4,1 1,84 ± 0,67 1,24 ± 0,30 1,33 ± 0,29 1,43 ± 0,37 >1,15 1,03 ± 0,49 2,91 ± 3,76 2,35 ± 1,82 <2,3 349 ± 81(m) 368 ± 74 (m) 344 ±143(m) 200-420 (m) 199 ± 33 (w) 309 ± 79 (w) 200-340 (w) 124 (w) Tabelle 9: Labordaten der 216 untersuchten Diabetes-Patienten (jeweils Mittelwert ± Standardabweichung) nach Diabetestyp. Zum Vergleich die Daten von 409 Probanden aus der Rückenschmerzstudie des Projekts A4 und die jeweiligen Labor-Referenzwerte. Beim Gesamt-Cholesterin und auch bezüglich der LDL-Cholesterin-Fraktion finden sich ebenfalls nur geringe, nicht signifikante Unterschiede zwischen den Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes bzw. zwischen Typ2 Diabetes und der Stichprobe von Probanden ohne Diabetes. Lediglich der Vergleich des HDL-Cholesterins ergab im Mann-Whitney-U-Test signifikant unterschiedliche Werte sowohl zwischen den Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes (Z=-4,529; p<0,001) als auch zwischen Personen mit Typ2 Diabetes und ohne Diabetes (Z=6,589; p<0,001). Dass bei DiabetesPatienten häufig eine Störung des HDL-Stoffwechsels vorliegt, wurde auch in anderen Untersuchungen deutlich (Anonym. 1999) (Anonym. 1996). Bezüglich der Triglyceride zeigten die Typ2 36 Diabetes-Patienten erheblich höhere Werte als Typ1-Patienten, allerdings bei einer sehr großen Streuung innerhalb der Typ2-Gruppe. Diabetesmedikation und Blutglukose-Spiegel: Die Therapie des Diabetes mellitus sah bei den 216 untersuchten Diabetespatienten wie folgt aus: 45,4% erhielten Blutglukose-senkende Tabletten, 10,2% Tabletten und Insulin, 20,8% nur Insulin und 23,6 % hatten keine Medikation. Im Vergleich zu den Daten im Bundes-Gesundheitssurvey waren etwa gleichviele Personen mit einer oralen Medikation eingestellt (ca. 45%), dort fanden sich jedoch weniger Patienten mit Insulintherapie (ca. 25%) und mehr Personen ohne Medikation (ca. 30%) (Thefeld W 1999b). Die Diabetesmedikation der Patienten mit Typ2 Diabetes zeigt Abbildung 6: Diabetestherapie bei Typ 2 Diabetes (n=191) nur Diät: 26,7% Tabletten: 50,8 % Insulin : 11,5 % Tabletten und Insulin: 11,0 % Abbildung 6 : Verschiedene Formen der antidiabetischen Therapie bei 191 Patienten mit Typ2 Diabetes. 37 In Abbildung 7 ist die Höhe des HbA1c-Wertes in Abhängigkeit von der Art der Diabetestherapie für die Patienten mit Typ2 Diabetes dargestellt. Man sieht keinen signifikanten Unterschied in der Höhe des HbA1c-Wertes zwischen der Therapie mit Insulin, Metformin und anderen oralen Medikamenten. HbA1c und Diabetestherapie bei Typ 2 Diabetes (n=191) 12 10 HbA1c (%) 8 6 4 2 0 nur Diät nur Metformin andere orale Insulin / Ins.+ orale Medikation Medikation Diabetestherapie HbA1c (Mittelwert + 1 SD) Abbildung 7: HbA1c-Wert und verschiedene Formen der Diabetestherapie bei Patienten mit Typ2 Diabetes (n=191). 38 Fragebogen zum Essverhalten: Unter der Vorstellung, dass das Essverhalten beim Typ2 Diabetes eine zentrale Rolle spielt, wandten wir den Fragebogen zum Essverhalten (FEV) von Pudel und Westenhöfer an (Pudel V, Westenhöfer J 1989). Die 51 Items zum Essverhalten werden den drei Skalen 1) Kognitive Kontrolle des Essverhaltens (21 Items), 2) Störbarkeit des Essverhaltens (16 Items) und 3) Erlebte Hungergefühle (14 Items) zugeordnet. Das Essverhalten könnte beim Typ2 Diabetes in zweifacher Hinsicht eine bedeutende Rolle spielen: erstens bei der Entstehung des Metabolischen Syndroms und der Entwicklung eines Typ2 Diabetes, zweitens im Verlauf eines manifesten Diabetes mellitus. Im ersten Fall wäre ein Essverhalten mit einer verminderten Kontrolle und einer erhöhten Störbarkeit zu postulieren. Im zweiten Fall würde man durch ärztliche Intervention und Schulungsmaßnahmen ein modifiziertes Essverhalten mit verstärkter Kontrolle erwarten. In der Tabelle 10 sind die Auswertungsergebnisse der 3 FEV-Skalen, nach Diabetes-Typ geordnet, dargestellt. Als Referenzdaten dienten die Mittelwerte einer alters-und geschlechtsgemischten westdeutschen Bevölkerung (n=1838, weiblich = 954, männlich =884; BMI 24,9 +/- 3,1 kg/m2 , Alter 14-87 Jahre) (Westenhöfer J, Stunkard A, Pudel V 1999). Diabetestyp FEV 1: kognitive Kontrolle: (max: 21 Punkte (P) FEV 2: Störbarkeit des Essverhaltens: (max. 16 P.) FEV 3: erlebte Hungergefühle: (max 14 P.) Referenz- Typ1 Typ2 pankreopriv 10,71 ± 5,0 10,82 ± 4,86 10,38 ± 2,56 7,1 ± 4,9 2,29 ± 2,14 4,69 ± 2,88 2,0 ± 1,2 5,2 ± 3,2 2,06 ± 1,48 3,76 ± 2,83 1,38 ± 1,51 5,2 ± 3,4 population Tabelle 10: Auswertung des Fragebogens zum Essverhalten bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ), jeweils als Punktwerte ( Mittelwert ± 1 Standardabweichung) 39 Aus der Tabelle 10 ist ersichtlich, dass beim Typ1 Diabetes erwartungsgemäß eine höhere kognitive Kontrolle (signifikant im Mann-Whitney-U-Test, Z=-2,709; p <0,01) und geringere Störbarkeit (Z=-4,03; p<0,001) sowie geringere störende Hungergefühle (Z= -4,25; p<0,001) auftreten als bei der Normalbevölkerung. Erstaunlicherweise ist die kognitive Kontrolle bei den Typ2 Diabetikern ebenso hoch wie beim Typ1 Diabetes und somit ebenfalls signifikant höher (Z=-9,335; p<0,001) als bei der Referenzpopulation. Dies könnte eventuell iatrogen verursacht sein: durch häufige Mahnungen zur Gewichtsabnahme, Ratschläge bei Schulungsmaßnahmen usw. Die Störbarkeit und die erlebten Hungergefühle sind beim Typ2 stärker ausgeprägt als beim Typ1 Diabetes. Gegenüber der Normalbevölkerung sind die Hungergefühle jedoch signifikant geringer (Z=-6,291; p<0,001); ebenso die Störbarkeit (Z=-2,921; p<0,005). Angesichts der meist beim Typ2 Diabetes vorliegenden Adipositas sind diese Befunde erstaunlich. Eine Erklärung für die relativ geringe Störbarkeit des Essverhaltens und die geringen Hungergefühle könnten hormonelle Feed-back-Mechanismen liefern: z.B. ist bekannt, dass der Hunger durch Leptin und erhöhte Insulinspiegel unterdrückt werden kann (Schwartz MW et.al. 2000). Eine graphische Übersicht dieses Zusammenhangs ist nochmals in der Abbildung 8 dargestellt. 40 Frabebogen zum Essverhalten (FEV) 20 18 16 Punktwerte 14 12 10 8 6 4 2 0 FEV 1 Typ 1 Diabetes Typ 2 Diabetes pankreopriver Diabetes Kontrollgruppe FEV 2 FEV 3 FEV-Skalen Abbildung 8: Fragebogen zum Essverhalten (FEV): Darstellung der Mittelwerte ± 1 Standardabweichung der erreichten Punktwerte in den 3 Skalen (FEV1-3) bei Patienten mit Diabetes mellitus und einem Vergleichskollektiv. In der Literatur wird eine signifikante Korrelation zwischen dem BMI und der Skala Störbarkeit des Essverhaltens beschrieben, nicht jedoch mit der Skala kognitive Kontrolle (Westenhöfer J, Stunkard A, Pudel V 1999). Diesen Zusammenhang konnten wir bei den Typ2 Diabetikern ebenfalls nach41 weisen: Bei der nichtparametrischen Korrelation nach Spearman zeigte sich bei einseitiger Fragestellung eine Signifikanz auf dem Niveau von 0,05 bei der Skala störende Hungergefühle und eine Signifikanz auf dem Niveau von 0,01 bei der Skala Störbarkeit des Essverhaltens, während keine signifikante Korrelation bezüglich BMI und der Skala kognitive Kontrolle zu finden war. Beim Typ1 Diabetes fand sich umgekehrt eine signifikante Korrelation (p<0,05) zwischen BMI und kognitiver Kontrolle, während Störbarkeit des Essverhaltens und störende Hungergefühle keine Signinifikanz zeigten. Weiterhin untersuchten wir, ob sich ein Zusammenhang zwischen dem Essverhalten und der Güte der Stoffwechseleinstellung nachweisen lässt. Diese wurde anhand des HbA1c gemessen, der eine Aussage über die Güte der Blutzuckereinstellung der letzten 6-8 Wochen zulässt und somit weniger störanfällig ist als der am Untersuchungstag gemessene Blutglukosewert. Wir fanden bei den Patienten mit Typ1 Diabetes eine signifikante Korrelation zwischen dem HbA1cWert und der FEV-Skala Störbarkeit des Essverhaltens (p<0,05), die übrigen Skalen zeigten keinen signifikanten Zusammenhang. Beim Typ2 Diabetes wies keine der FEV-Skalen eine Korrelation zum HbA1c-Wert auf. Dies mag nochmals die Hypothese unterstreichen, dass beim Typ2 Diabetes die Blutzuckereinstellung sehr komplexen pathogenetischen Mechanismen unterliegt. Die Tabelle 11 zeigt, dass keiner der Patienten mit Typ1 oder pankreoprivem Diabetes ausserhalb der Grenzen des Mittelwerts +/- 1 Standardabweichung des Vergleichskollektivs lag. Bei den Personen mit Typ2 Diabetes war am häufigsten die Skala 2 (Störbarkeit des Essverhaltens) erhöht. Da diese Skala eine Korrelation mit der Höhe des BMI aufweist, scheint nach unseren Ergebnissen ein verhaltensmedizinischer Therapieansatz zur Gewichtsreduktion durchaus sinnvoll zu sein. Bei der Darstellung des von uns entwickelten Reha-Scores (s. Abschnitt C) wird hierauf näher eingegangen. 42 Diabetestyp FEV 1 (kognitive Kontrolle): Typ1 Typ2 pankreopriv 0% 5% 0% 0% 11% 0% 0% 8% 0% 0% 18% 0% Häufigkeit < 2,2 P. FEV 2 (Störbarkeit des Essverhaltens): Häufigkeit > 8,4 P. FEV 3 (erlebte Hungergefühle): Häufigkeit > 8,6 P. mindestens 1 Skala des FEV erhöht (ausserhalb MW +/- 1 SD) Tabelle 11: Auswertung des Fragebogens zum Essverhalten bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ). Dargestellt ist, wie häufig (in %) die erreichten Punktwerte ausserhalb des Bereichs Mittelwert minus einer Standardabweichung (bei FEV1) bzw. plus einer Standardabweichung (bei FEV2 und FEV3) der Referenzpopulation lagen. Fragebogen zum chronischen Stress: Wie in der Grafik 6 (Anlage) dargestellt, spielt chronischer Stress eine Rolle als einer der Risikofaktoren des Metabolischen Syndroms und des Typ2 Diabetes (Chrousos GP, Gold PW 1998; Rosmond R, Dallman MF, Bjorntorp P 1998). Um die Bedeutung dieses Risikofaktores beim Diabetes zu erfassen, erfragten wir die psychische Belastung durch chronischen psychischen Stress mittels des TICS (Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress) (Schultz P, Schlotz W 1999). Dieser Fragebogen enthält 39 Items mit jeweils 5 Antwortmöglichkeiten, die in folgenden 6 Skalen zusammengefasst werden: Arbeitsüberlastung, Arbeitsunzufriedenheit, soziale Belastung, Mangel an sozialer Anerkennung, Sorgen und belastende Erinnerungen. Zum Vergleich wurde die von den Autoren beschriebene Referenzstichprobe herangezogen. Diese umfasste 1258 Probanden im Alter 43 von 16-90 Jahren (37,93 ± 14,74 J.) und bestand aus 46,3% Männern und 53,5% Frauen aus einem gemischten sozialen Umfeld (Arbeitnehmer, Rentner, Studierende, Hausfrauen). Diabetestyp Skala 1: Arbeitsüberlastung (UEBE: max. 40 Punkte) Referenz- Typ1 Typ2 pankreopriv 19,50 ± 6,28 19,60 ± 5,21 20,38 ± 8,03 22,33 ± 6,31 11,35 ± 4,06 11,36 ± 2,85 12,63 ± 4,41 12,65 ± 3,65 17,94 ± 3,94 18,37 ± 3,55 19,38 ± 3,96 18,50 ± 4,48 13,71 ± 3,27 12,93 ± 3,37 13,05 ± 1,81 15,20 ± 3,67 14,88 ± 3,89 14,76 ± 4,04 18,0 ± 3,70 16,82 ± 4,77 13,71 ± 3,69 13,60 ± 4,19 15,38 ± 2,45 15,65 ± 5,0 population Skala 2: Unzufriedenheit bei der Arbeit (UNZU. max. 25 Punkte) Skala 3: Mangel an sozialer Anerkennung (SOZA: max. 40 Punkte) Skala 4: Soziale Belastungen (SOZB: max. 30 Punkte) Skala 5: Sorgen (SORG: max. 30 Punkte) Skala 6: belastende Erinnerungen (ERIN: max: 30 Punkte) Tabelle 12: Auswertung des TICS (Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress) bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ), jeweils als Punktwerte (Mittelwert ± 1 Standardabweichung) Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, unterscheiden sich die verschiedenen Diabetes-Typen in den 6 Skalen untereinander nur sehr geringfügig. In keiner der 6 Skalen lagen die Mittelwerte der Patienten mit Typ1 oder Typ2 Diabetes oberhalb der Mittelwerte der Referenzpopulation. Eine höhere Belastung durch chronischen psychischen Stress scheint demnach in der untersuchten Stichprobe nicht vorzuliegen. Zu bedenken ist jedoch, dass die Zusammensetzung des Referenzkollektivs be- 44 züglich Alter und sozialem Status nicht unbedingt mit den von uns untersuchten LVA-Versicherten übereinstimmte. Weiterhin sollte berücksichtigt werden, dass die Versicherten zu einer freiwilligen, zusätzlichen Untersuchung eingeladen wurden. Es ist deshalb anzunehmen, dass Personen, die sich durch erhöhten chronischen Stress sehr beeinträchtigt fühlen, wahrscheinlich eher die Untersuchung abgelehnt haben als Personen ohne vermehrten Stress und somit eine Verzerrung der Stichprobe bezüglich des Faktors Stress vorliegen könnte. Diabetestyp Skala 1 (Arbeitsüberlastung): Häufigkeit > 28,64 P. Skala 2 (Unzufriedenheit bei der Arbeit): Häufigkeit > 16,3 P. Skala 3 (Mangel an sozialer Anerkennung): Häufigkeit > 22,98 P. Skala 4 (Soziale Belastungen): Häufigkeit > 18,87 P. Skala 5 (Sorgen): Häufigkeit > 21,59 P. Skala 6 (belastende Erinnerungen): Häufigkeit > 20,65 P. Mindestens 1 Skala der Skalen 3-6 des TICS erhöht (ausserhalb MW ± 1 SD): Mindestens 1 Skala aller 6 Skalen des TICS erhöht (ausserhalb MW ± 1 SD): Typ1 Typ2 pankreopriv 12% 5% 13% 12% 4% 13% 12% 15% 25% 12% 5% 0% 6% 8% 13% 6% 8% 0% 24% 25% 25% 29% 28% 50% Tabelle 13: Auswertung des TICS bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ). Dargestellt ist, wie häufig (in %) die erreichten Punktwerte ausserhalb des Bereichs Mittelwert ± einer Standardabweichung der Referenzpopulation lagen. 45 In Tabelle 13 ist zusammengefasst, wieviele der Diabetes-Patienten bei den einzelnen Skalen des TICS ausserhalb des Mittelwerts und einer Standardabweichung der Referenzpopulation lagen. Es zeigt sich, dass Patienten mit Typ2 Diabetes weniger häufig Stress in Zusammenhang mit der Arbeit verspüren als Patienten der Typen 1 und 3. Dies hängt sicherlich häufig mit der Insulintherapie zusammen, die auch während der Arbeit ein zusätzliche Belastung darstellen kann. Patienten mit Typ1 Diabetes gaben häufiger Stress durch soziale Belastungen an, Patienten mit Typ2 Diabetes häufiger Mangel an sozialer Anerkennung. Insgesamt war bei ca. einem Viertel der Patienten mit Typ1 oder Typ2 Diabetes eine Stress-Skala erhöht. Zusammenfassend lässt sich aus unseren Ergebnissen ableiten, dass im Vergleich zu Personen des Normkollektivs bei den Patienten mit Diabetes mellitus keine vermehrte psychische Belastung durch chronischen Stress vorliegt. Depressivität Eine abdominell betonte Adipositas, wie sie beim metabolischen Syndrom und beim Typ2 Diabetes häufig zu finden ist, wird in vielen Fällen von einer Depression oder depressiver Verstimmung begleitet. Als gemeinsame pathogenetische Ursache vermutet man eine Aktivierung hypothalamischer Zentren bei Übergewicht, was einerseits zu der depressiven Störung und zweitens, über eine Stimulierung des sympathischen Nervensystems, zu den Veränderungen im Stoffwechsel führt (Eaton WW et.al. 1996; Lustman PJ et.al. 1992; Bjorntorp P 1991). Zur Erfassung einer vorliegenden Depressivität wandten wir die CESD (Center for Epidemiological Studies Depression Scale, deutsche Version von Gerbershagen und Kohlmann) an (Gerbershagen H-U, Kohlmann T 1998). Dieser Fragebogen umfasst 20 Items, in denen depressive Symptome einer Skala von 0-3 Punkte zugeordnet werden. Bei der Auswertung können 0-60 Punkte erreicht werden. Ab einer Punktezahl von > 23 ist eine Depressivität wahrscheinlich. Dieser Wert liegt eine Standardabweichung über dem Mittelwert der Allgemeinbevölkerung und stuft 17% (11% Männer und 24% Frauen) als depressiv ein. Als 46 Referenzgruppe diente eine zufällig ausgewählte Bevölkerungsstichprobe (n=1205, 53,2% Männer, 46,8% Frauen, mittleres Alter 33 ± 14,9 Jahre). Diabetestyp Referenz- Typ1 Typ2 pankreopriv 11,53 ± 8,67 12,77 ± 8,93 14,75 ± 9,16 14,33 ± 9,66 CESD-Punkte (nur Frauen): 14,0 ± 15,62 16,01 ± 9,78 7,00 15,83± 10,78 CESD-Punkte (nur Männer): 11,0 ± 7,30 11,66 ± 8,37 15,86 ± 9,30 12,98 ± 8,35 CESD-Punkte (max. 60 Punkte) Männer und Frauen insgesamt population Tabelle 14: Auswertung der CESD (Center for Epidemiological Studies Depression Scale) bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ), jeweils als Punktwerte ( Mittelwert ± 1 Standardabweichung) Die Tabelle 14 zeigt, dass Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes insgesamt keine stärkere Depressivität zeigen als das Referenzkollektiv. Hingegen zeigt sich ein deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied: Ebenso wie in der Normalbevölkerung sind auch bei Typ2 Diabetes signifikant mehr Frauen depressiv (16 ± 9,8 P.) als Männer (11,7 ± 8,49) (Mann-Whitney-U-Test, Z=-2,865; p<0.005).Weiterhin zeigen die Männer mit Typ2 Diabetes sogar eine geringere Depressivität als die Männer des Referenzkollektivs (Z=-5,099, p<0,001), während die etwas höhere Punktzahl der Frauen mit Diabetes Typ2 gegenüber den Frauen der Bevölkerungsstichprobe nicht das Signifikanzniveau erreicht. Dieser Befund erscheint zunächst erstaunlich, erwarteten wir doch eine erhöhte Rate an depressiver Verstimmung unter den Patienten mit Typ2 Diabetes. Zu erklären wäre dieses Phänomen jedoch mit dem unterschiedlichen Verhalten depressiver und nicht-depressiver DiabetesPatienten. Sowohl die postalische Befragung wie auch die Teilnahme an unserer Untersuchung waren freiwillig, so dass Menschen mit depressionsbedingten Antriebs-und Motivationsproblemen in der untersuchten Kohorte durchaus unterrepräsentiert sein können gegenüber der Ausgangsstichprobe (Selektions-Bias). Von den ca. 30-40% Non-Respondern fehlen uns diesbezügliche Informa47 tionen. Der Vergleich der Frage im postalischen Fragebogen nach depressiven Leiden („ Hat bei Ihnen jemals ein Arzt eine Depression / ein depressives Leiden festgestellt“) ergibt eine etwas höheren Anteil an depressiven Personen unter den Diabetikern im Vergleich zur Gesamtzahl derer, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, jedoch ohne Erreichen des Signifikanz-Niveaus. Allerdings wurde hier nach einer ärztlich diagnostizierten Depression gefragt, während der CESD Fragebogen die persönliche Befindlichkeit (auch ohne ärztliche Diagnose erfasst). Diabetestyp CESD >23 Punkte: Häufigkeit (%) Männer und Frauen insgesamt CESD >23 Punkte: Häufigkeit (%) nur Frauen: CESD >23 Punkte: Häufigkeit (%) nur Männer: Referenz- Typ1 Typ2 pankreopriv 17,6% 12,0% 25% 17,4% 33,3% 22% 0 24,4% 14,3% 8,5% 28,6% 11,2% population Tabelle 15: Auswertung der CESD (Center for Epidemiological Studies Depression Scale) bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ),: Anzahl bzw. prozentualer Anteil „depressiver“ Personen (definiert als CESD-Punktzahl >23 P.) Tabelle 15 veranschaulicht, wieviel Prozent der Befragten mit der erreichten Punktzahl oberhalb des Mittelwerts plus einer Standardabweichung der Normalbevölkerung lag. Dies waren in allen Gruppen vorwiegend die Frauen (Typ1: 33%; Typ2: 22%; Normalbevölkerung: 24%). Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-36: Der SF-36 Fragebogen ist ein international anerkanntes Erhebungsinstrument zur Einschätzung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Bullinger M, Kirchberger I 1998). Der SF-36 enthält 8 Ska48 len sowie die Bewertung der Gesundheitstendenz in insgesamt 36 Items. Er misst die subjektiven Folgen des Gesundheitszustands auf die erlebte physische und psychische Funktionsfähigkeit auf individueller und sozialer Ebene. Die einzelnen Items umfassen jeweils unterschiedlich viele Antwortmöglichkeiten. Bei der Zusammenfassung der Items in die 8 Skalen erfolgt für alle Skalen eine einheitliche Transformation mit Skalenwerten zwischen 0 und 100 zur besseren Vergleichbarkeit der Skalen untereinander, dabei zeigen die höheren Zahlen jeweils den besseren Gesundheitszustand an. Die 8 Skalen erfassen folgende Dimensionen: 1) Körperliche Funktionsfähigkeit (KÖFU), 2) Körperliche Rollenfunktion (KÖRO), 3) Körperliche Schmerzen (SCHM), 4) Allgemeine Gesundheitswahrnehmung (AGES), 5) Vitalität (VITA), 6) Soziale Funktionsfähigkeit (SOFU), 7) Emotionale Rollenfunktion (EMRO), 8) Psychisches Wohlbefinden (PSYC). Weiterhin können diese 8 Skalen zu zwei aggregierten Summenskalen zusammengefasst werden: 9) Körperliche Summenskala (KÖSU) und 10) Psychische Summenskala (PSYSU). Bei diesen beiden Summenskalen erfolgt eine Transformation zu Mittelwerten von 50 und einer Standardabweichung von 10. In der Tabelle16 sind die Punktwerte der 8 Einzelskalen des SF-36 sowie der psychischen und körperlichen Summenskala für die von uns untersuchten Patienten mit Diabetes dargestellt. Als Referenz wurden hier die Werte der gesamtdeutschen Normstichprobe aus dem SF-36 Manual übernommen (n=2914; mittleres Alter 47,7 Jahre, 55,6% Frauen, 44,4 % Männer). Die Werte dieser Bevölkerungsstichprobe sollen nur als grobe Orientierung den Werten unserer Diabetes-Patienten gegenübergestellt werden: Aus den Voruntersuchungen zur Normierung und neueren Ergebnissen des Bundes-Gesundheitssurveys wurde die Abhängigkeit der Fragebogen-Ergebnisse von Alter, Geschlecht und Schichtzugehörigkeit deutlich (Bullinger M, Kirchberger I 1998; Radoschewski M, Bellach BM 1999). Mit zunehmendem Alter verstärken sich vor allem Einschränkungen in den körperlichen Funktionen (KÖFU, KÖRO, SCHM, AGES), während die psychischen Funktionen weniger beeinträchtigt werden. Weiterhin ist bekannt, dass Frauen durchgehend in allen Skalen niedrigere Werte zeigen als Männer, und ebenso Menschen, die der unteren sozialen Schicht angehören, gegenüber Menschen der Oberschicht. Da die demographische Zusammensetzung der Normstich- 49 probe (jüngerer Altersdurchschnitt (MW 47,7 J.), frauenbetont (55,6%), Personen aus allen sozialen Schichten) deutlich abweicht von der Stichprobe unserer Diabetes-Patienten (Altersdurchschnitt 52,9 J., 25% Frauen, LVA-versicherte Erwerbstätige), ist eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben. Typ1 Typ2 pankreopriv Normstich- (n=17) (n=189) (n=8) probe (N=2914) 87,94 ± 15,425 74,74 ± 26,16 63,06 ± 25,53 85,71 ± 22,10 72,06 ± 44,97 68,28 ± 40,71 53,13 ± 47,13 83,70 ± 31,73 63,65 ± 27,95 55,03 ± 27,09 52,75 ± 20,313 79,08 ± 27,38 58,28 ± 21,12 57,42 ± 17,88 55,63 ± 17,90 68,05 ± 20,15 62,35 ± 13,36 58,07 ± 19,29 53,75 ± 16,20 63,27 ± 18,47 SOFU 80,15 ±20,28 79,39 ± 23,92 70,31 ± 29,08 88,76 ± 18,40 EMRO 86,27 ± 33,46 75,41 ± 39,18 50,0 ± 53,45 90,35 ± 25,62 PSYC 71,29 ± 17,04 70,98 ± 17,53 63,50 ± 22,57 73,88 ± 16,38 KÖSU 46,54± 10,30 43,12 ± 10,34 41,14 ± 8,24 50,21 ± 10,24 PSYSU 50,02 ± 9,55 49,89 ± 9,76 44,66 ± 13,97 51,54 ± 8,14 Diabetestyp KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA Tabelle 16: Auswertung des SF-36-Fragebogens (Fragebogen zum Gesundheitszustand) bei 216 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ), jeweils als Punktwerte ( Mittelwert ± 1 Standardabweichung). 50 In Tabelle 16 ist zusehen, dass Patienten mit Typ2 Diabetes in allen Skalen niedrigere Mittelwerte zeigen als Patienten mit Typ 1 Diabetes, jedoch höhere als bei pankreoprivem Diabetes. Die Unterschiede zwischen Typ1 und Typ2 sowie zwischen Typ2 und pankreoprivem Diabetes sind jedoch nicht signifikant, und auch beim Vergleich zwischen Typ1 und pankreoprivem Diabetes ist der Unterschied nur bei der Skala KÖFU (Körperliche Funktionsfähigkeit) signifikant (Mann-Whitney-UTest, Z=-2,273, p<0,05). Weiterhin analysierten wir die Ergebnisse bei den Patienten mit Typ2 Diabetes hinsichtlich der Alters-und Geschlechtsunterschiede. Bezüglich des Alters ergab sich bei keiner Skala ein Unterschied auf Signifikanzniveau. Hingegen zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Körperlichen Funktionsfähigkeit (Z= -2,08, p<0,05), der Vitalität (Z= -2,68, p<0,05), der Emotionalen Rollenfunktion (Z=-2,953, p<0,05), dem Psychischen Wohlbefinden (Z=-3,414, p<0,01) sowie bei der Psychischen Summenskala (Z=-2,972, p<0,05). Eine weitere Vergleichsmöglichkeit entsteht durch die Berechnung der sogenannten z-Werte, bei denen der Mittelwert der jeweiligen Normpopulation (alters-und geschlechtsbezogen) vom Mittelwert der untersuchten Stichprobe subtrahiert und durch die Standardabweichung der Normpopulation geteilt wird. Positive z-Werte ergeben sich bei einer besseren, negative Werte bei einer schlechteren Lebensqualität der untersuchten Population im Vergleich zur Normpopulation. In Abbildung 9 werden die z-Werte verschiedener Untergruppen der Patienten mit Typ2 Diabetes graphisch dargestellt. 51 Abweichungen von der alters- und geschlechtsspezifischen Normpopulation z-Werte 0 -1 -2 KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC Männer, Alter <= 50 Jahre Frauen, Alter <= 50 Jahre Männer, Alter > 50 Jahre Frauen, Alter > 50 Jahre Abbildung 9: Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-36: Abweichungen von der alters-und geschlechtsspezifischen Normpopulation bei Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus. Wie in der Literatur beschrieben (Bullinger M, Kirchberger I 1998; Radoschewski M, Bellach BM 1999) lassen sich in Querschnittsuntersuchungen gesundheitliche Beeinträchtigungen durch akute und chronische Erkrankungen mit Hilfe des SF-36 nachweisen. Der SF-36 weist jedoch vor allem eine große Veränderungssensitivität in Längsschnittuntersuchungen auf (Hemingway H et.al. 1997), weshalb dieses Instrument auch im Hinblick auf die Follow-up-Untersuchungen in dieser Studie angewandt wurde. 52 Lebensqualität bei Diabetes (LQD): Die Lebensqualität kann sich bei Menschen mit Diabetes nach der Diagnosestellung erheblich verschlechtern. Die Umstellung vieler zentraler Aspekte des Lebensstils wie Essenszeiten, Essenszusammensetzung, Essensmenge sowie Einschränkung der freien Zeit durch Kontrollen und Arztbesuche beeinträchtigen häufig die Lebensfreude der Betroffenen. Häufig bestehen auch Ängste, dass die sozialen Kontakte durch die Erkrankung beeinträchtigt werden könnten. Mit zunehmender Erkrankungsdauer können auch die Begleit- und Folgeerkrankungen die Lebensqualität in erheblicher Weise einschränken (Hirsch A 1996). Um diese krankheitsspezifische Beeinflussung der Lebensqualität zu erfassen, wandten wir den LQD-Fragebogen an (Hirsch A, Bartholomae C, Vollmer T 1997). Dieser Fragebogen lehnt sich inhaltlich an den DQoL-Fragebogen der DCCT an (Anonym. 1988). Er umfasst 17 Items mit je 5 Antwortmöglichkeiten. Diese werden zu 3 Skalen zusammengefasst: 1) Zufriedenheit (7 Items), 2) Belastung (7 Items), 3) Belastung durch Blutzuckerwerte (3 Items). Die Fragen nach der Zufriedenheit messen direkt die Lebensqualität, die Belastungen spiegeln indirekt die Lebensqualität wider. Da diese zwei Dimensionen der Lebensqualität nicht immer korrelieren, werden bei Fragen zur Lebensqualität meist beide Aspekte als sich ergänzende Bestandteile in den Fragebogen integriert (Hirsch A 1996). Die Referenzstichprobe der Autoren umfasste 144 Patienten (69 Männer, 75 Frauen) mit Typ2 Diabetes im Alter zwischen 39 und 77 Jahren (57,23 ± 7,6 J.). Es handelte sich um Patienten vor einer Schulungsmaßnahme oder zu Beginn eines stationären Krankenhausaufenthalts. Von diesen Patienten hatten jeweils ca. ein Drittel noch nie, einmal bzw. bereits mehrmals eine Schulung. Die Behandlung erfolgte bei der Hälfte der Patienten mit Tabletten, bei der anderen Hälfte mit Insulin bzw. Insulin plus Tabletten. 53 Diabetestyp LQD 1: Zufriedenheit (max. 35 Punkte): LQD 2: Belastung (max. 35 Punkte): LQD 3: Belastung durch Blutzuckerwerte (max 15 P.) Referenz-Stich- Typ1 Typ2 pankreopriv 28,82 ± 3,15 27,37 ± 4,77 28,25 ± 4,98 25,74 ± 5,14 14,28 ± 4,95 15,74 ± 5,18 16,38 ± 5,32 17,13 ± 5,98 8,65 ± 2,26 7,01 ± 2,59 11,13 ± 3,23 7,91 ± 3,0 probe (Typ2) Tabelle 17: Auswertung des LQD-Fragebogens (Lebensqualität bei Diabetes) bei 216 DiabetesPatienten (getrennt nach Diabetes-Typ), jeweils als Punktwerte (Mittelwert ± 1 Standardabweichung). Tabelle 17 veranschaulicht, dass bezüglich der Zufriedenheit und der Belastung keine signifikanten Unterschiede zwischen den Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes bestehen. Die Skala „Belastung durch Blutzuckerwerte“ zeigt bei den Patienten mit Typ1 Diabetes signifikant höhere Werte und damit eine stärkere Belastung als bei Typ2 Diabetes (Mann-Whitney-U-Test, Z=-2,36, p<0,05). Dies ist dadurch bedingt, dass die Patienten mit Typ2 Diabetes häufig keine Blutglukoseselbstbestimmung durchführen (94% der Typ1 Patienten versus 50% der Typ2 Patienten) und deshalb durch die Höhe bzw. Schwankungen der Blutglukosewerte nicht belastet sind. Zwischen den StudienPatienten mit Typ2 Diabetes und den Typ2 Patienten aus der Referenzstichprobe bestehen jeweils signifikante Unterschiede in allen Skalen des LQD in dem Sinne, dass die Studienteilnehmer insgesamt zufriedener (MannWhitney-U-Test, Z= -3,14, p<0,005) und weniger belastet (p<0,05) waren als die Referenzpersonen. Auch waren die Studienpatienten signifikant geringer (p<0,005) durch die Blutzuckerwerte belastet, wobei dieser Unterschied wiederum durch die unterschiedliche Häufigkeit der Blutglukoseselbstkontrolle (50% bei den Studienpatienten versus 74% bei der Referenzgruppe) zu erklären ist. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich die Studienteilnehmer aus einer relativ unselektierten Gruppe von Diabetespatienten zusammensetzten, während es sich bei den 54 Referenzpersonen um Patienten vor einer Schulung bzw. vor einem stationären Krankenhausaufenthalt handelte. Bei diesem Kollektiv ist davon auszugehen, dass eine Selektion von Patienten vorliegt, die mit ihrer Blutzuckereinstellung größere Probleme haben und demzufolge auch unzufriedener und mehr belastet waren. Typ2Diabetestyp Patienten ohne Insulin (n=148) LQD 1: Zufriedenheit (max. 35 Punkte): LQD 2: Belastung (max. 35 Punkte): LQD 3: Belastung durch Blutzuckerwerte (max 15 P.) Blutglukose-Selbstkontrolle Typ2Patienten mit Insulin (n=43) Referenz- Referenz- Stichprobe Stichprobe ohne Insulin mit Insulin (n=70) (n=72) 27,45 ± 4,73 27,12 ± 4,95 26,2 ± 4,8 25,3 ± 5,5 15,38 ± 5,22 16,95 ± 4,93 17,0 ± 5,5 17,3 ± 6,4 6,59 ± 2,58 8,35 ± 2,16 7,4 ± 2,8 8,3 ± 3,2 36% 98% 55,6% 91% 38,4% 90,5% 52,7% 73,6% 4,74 ± 5,5 J. 10,67 ± 6,11 J. (%) Jemals Diabetes-Schulung (%) Durchschnittliche Diabetesdauer (J., MW ± 1SD) Tabelle 18: Auswertung des LQD-Fragebogens ) bei Patienten mit Typ2 Diabetes (n=191) und einer Referenzstichprobe (ebenfalls Patienten mit Typ2 Diabetes, n=142), jeweils als Punktwerte (Mittelwert ± 1 Standardabweichung). Die Auswertung beider Stichproben erfolgte getrennt nach Art der Behandlung (mit / ohne Insulin). Zusätzlich zeigt die Tabelle jeweils den Anteil der Patienten mit Blutglukose-Selbstkontrolle, mit stattgehabter Schulung sowie die Diabetesdauer. In der Tabelle 18 wurden nur die Patienten mit Typ2 Diabetes der Studienkohorte denen der Referenzstichprobe gegenübergestellt. Innerhalb der Studienpatienten zeigte sich, dass Patienten unter 55 Insulintherapie eine signifikant höhere Belastung durch Blutzuckerwerte angaben (p<0,001) als Patienten ohne Insulin, wobei unter Insulin 98% und ohne Insulin nur 36% der Personen Blutglukosekontrollen durchführten. Dieser Unterschied war innerhalb des Referenzkollektivs weniger deutlich ausgeprägt und erreichte nicht das Signifikanzniveau, die Unterschiede in der Blutglukoseselbstkontrolle waren hier ebenfalls geringer (91% mit versus 56% ohne Insulin). Bei Patienten, die bereits an einer Diabetesschulung teilgenommen hatten, war eine signifikant höhrere Belastung durch Blutzuckerwerte nachzuweisen (nichtparametrische Korrelation nach Spearman, p<0,01). Dies lässt sich erklären durch die Tatsache, dass die geschulten Patienten signifikant häufiger Blutglukose-Selbstkontrollen durchführten (p<0,01). Die anderen LQD-Skalen zeigten keinen Unterschied zwischen Patienten mit und ohne stattgehabter Schulung. Bezüglich der Diabetesdauer ergab sich bei den Studienpatienten ebenfalls nur eine signifikante Korrelation für die Belastung durch Blutzuckerwerte (nichtparametrische Korrelation nach Spearman, p<0,05), hierbei ist ebenfalls zu beachten, dass die Patienten unter Insulintherapie auch eine längere Diabetesdauer aufweisen. Für die Skalen „Zufriedenheit“ und „Belastung“ ergab sich keine signifikante Korrelation zur Diabetesdauer. Die Messung der diabetesbezogenen Lebensqualität mittels des LQD-Fragebogens zeigte eine zufriedenstellende Lebensqualität, die direkt durch die Zufriedenheit und indirekt durch die Belastungen ausgedrückt wurde. Die These, dass bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus häufig eine Anpassung des Kranken an die Gegebenheiten und die notwendigen Therapiemaßnahmen erfolgt mit der Folge einer Senkung des Anspruchsverhaltens für die Lebensqualität, wird durch unsere Untersuchungsdaten nicht gestützt (Hirsch A 1996). Wissenstest für Patienten mit Diabetes mellitus: Das Wissen über Diabetes erfragten wir über den Wissenstest für nicht-insulinbehandelte Typ2Diabetiker (Hermanns N, Kulzer B 1996). Für die insulinbehandelten Patienten stellten wir in Anlehnung daran einen Wissenstest mit Elementen aus oben genanntem Fragebogen und dem Wissenstest aus dem Schulungsprogramm nach Berger zusammen (Berger M et al. 1984). Der Wissens56 test besteht aus 14 Fragen mit 3-4 Antwortmöglichkeiten nach dem Multiple-Choice–Verfahren. Die Fragen gelten als richtig beantwortet, wenn die Antwortkombinationen korrekt angekreuzt wurden, so dass eine Punktzahl zwischen 0 und 14 Punkte erreichbar ist. Laut Kulzer et al. liegt das mittlere Diabeteswissen bei ungeschulten Diabetes-Patienten bei 6,44 Fragen (46%), und steigt nach der Schulung vor allem bei initial schlechtem Wissen deutlich an (Hermanns N, Kulzer B 1996). Diabetestyp Wissenstest (max. 14 Punkte) pankreopriv Typ1 Typ2 n=17 n=189 8,53 ± 2,12 6,69 ± 3,05 (mit Insulin) n=7 7,86 ± 4,10 Tabelle 19: Auswertung des Diabetes-Wissenstests bei 214 Diabetes-Patienten (getrennt nach Diabetes-Typ), jeweils als Punktwerte (Mittelwert ± 1 Standardabweichung). Diabetestyp Wissenstest (max. 14 Punkte) Typ2 mit Insulin Typ2 ohne Insulin n=43 n=146 7,88 ± 2,89 6,34 ± 3,01 Tabelle 20: Auswertung des Diabetes-Wissenstests bei 189 Patienten mit Typ2 Diabetes (getrennt nach Art der Diabetestherapie), jeweils als Punktwerte (Mittelwert ± 1 Standardabweichung). Aus der Tabelle 19 wird deutlich, dass das Diabeteswissen stark abhängig ist vom Diabetestyp: die Patienten mit Typ1 Diabetes erreichten die höchste Punktzahl, Patienten mit Typ2 Diabetes die geringste. Die erreichte Punktzahl zwischen Personen mit Typ1 und Typ2 Diabetes zeigt einen signifikanten Unterschied (Mann-Whitney-U-Test, Z=-2,275; p<0,05), zwischen Typ1und Typ2 sowie Typ2 und pankreoprivem Diabetes sind die Unterschiede nicht signifikant. Hier mag auch die Dauer 57 der Diabeteserkrankung eine Rolle spielen: Bei den Patienten mit Typ1 Diabetes betrug die mittlere Diabetesdauer 21,8 ± 11,35 Jahre, bei Typ2 6,08 ± 6,15 Jahre und bei pankreoprivem Diabetes 3,14 ± 3,48 Jahre). Das unterschiedliche Diabeteswissen hängt vor allem von der Art der Diabetestherapie ab: Patienten unter Insulintherapie bedürfen einer intensiveren Schulung und zeigen ein höheres Diabeteswissen als Patienten ohne Insulintherapie. Dies wird beim Vergleich der Wissenstests bei den Patienten mit Typ2 Diabetes deutlich (s.Tabelles 20): Typ2 Patienten unter Insulintherapie haben ein signifikant größeres Wissen als Patienten ohne Insulin (Z=-2,67; p<0,01). Typ2 Patienten, die bereits eine oder mehrere Schulungen hinter sich hatten, wiesen dementsprechend ein signifikant größeres Wissen (Z=-2,276; p<0,05) auf als solche ohne Schulung. Unter den Patienten mit Typ2 Diabetes hatten jeweils 50% bereits eine oder mehrere Schulungen, 50% hatten noch keine. Die Schulungen fanden zu 42% in einer stationären Reha statt, 26 stationär im Krankenhaus, 10% beim Hausarzt, die restlichen in diabetologischen Ambulanzen oder Schwerpunktpraxen. Ebenso war das Wissen hoch korreliert mit der Selbstkontrolle der Blutglukose (nicht-parametrische Korrelation nach Spearman, p<0,005). Folge-Erkrankungen: Bereits bei Diagnosestellung wiesen bis zu 50 % der Typ2 Diabetiker der UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) im Alter von 25-65 Jahren diabetische Folge-Komplikationen auf (z.B. 2% unerkannte Herzinfarkte, 35 % arterielle Hypertonie, 18% beidseitige Retinopathie, 18% Mikroalbuminurie) (Anonym. 1990c). Bereits vorhande Schädigungen erwiesen sich als Risikofaktor für die Entwicklung weiterer Folgekrankheiten (Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA 1998). Diabetische Nephropathie: Als Hinweis für eine beginnende diabetische Nephropathie wurde die Albuminausscheidung im Urin ausgewertet. Eine Auscheidung von mehr als 30mg Albumin /g Kreatinin bei Männern bzw. 58 von mehr als 40mg /g Kreatinin bei Frauen wird hierbei als pathologischer Befund gewertet. Eine Mikroalbuminurie liegt vor bei erhöhten Werten bis 300mg/g Kreatinin. Die Mikroalbuminurie gilt als ein zuverlässiger Marker für eine diabetische Nephropathie, kann jedoch auch (vor allem bei Typ2 Diabetes) Ausdruck einer generalisierten Makroangiopathie und eines schlecht eingestellten arteriellen Hypertonus sein. Anhand der Tabelle 21 ist ersichtlich, dass bei den 215 untersuchten Urinbefunden eine sehr große Streubreite vorlag. Zwischen den Patienten mit Typ1 und Typ2 Diabetes waren bezüglich der Urinalbuminausscheidung keine signifikanten Unterschiede nachzuweisen. Beim Typ2 Diabetes lagen bei 78% der Patienten Normalwerte für die Urinalbuminausscheidung vor, bei Patienten mit Typ1 Diabetes in 82,4% der Fälle. Diabetestyp Urin-Albumin (mg/g Kreatinin) Typ1 Typ2 pankreopriv alle n=17 n=190 n=8 n=215 89,21 ± 267,20 56,31 ± 168,84 51,17 ± 89,75 58,78 ± 175,66 Path. Albuminurie (für w>40mg/g Kreatinin, für 17,6% 22,0% 37,5% 22,2% m>30mg/g Kreatinin) Tabelle 21: Urinalbuminausscheidung bei 215 Patienten mit Diabetes mellitus Zwischen der Albuminausscheidung und der Dauer der Diabeteserkrankung zeigte sich sowohl für den Typ1 als auch für den Typ2 Diabetes keine signifikante Korrelation. Hingegen fand sich eine signifikante, positive Korrelation zwischen der Höhe der Urinalbuminausscheidung und dem HbA1c-Wert (nicht-parametrische Korrelation nach Spearman, p<0,01). Weiterhin war die Höhe der Albuminausscheidung mit der Höhe des systolischen und des diastolischen Blutdrucks bei Patienten mit Typ2 Diabetes korreliert (nicht-parametrische Korrelation nach Spearman, p<0,01). Bei den Patienten mit Typ1 Diabetes fand sich nur für den diastolischen Blutdruck eine signifikante Korrelation (p<0,05). 59 In Abbildung 10 ist die Albuminausscheidung aller 215 Patienten mit Diabetes graphisch dargestellt. Hier ist zu sehen, dass für einen großen Anteil der Patienten (bis zum Prozentrang 77) Normalwerte vorlagen. Auch wiesen viele Patienten nur eine mäßig erhöhte Albuminausscheidung auf, (62 mg/g Kreatinin bei der 85. Perzentile und 262 mg/g Kreatinin bei der 95. Perzentile). Bei 5% der Patienten fand sich eine Albuminausscheidung >300mg/g Kreatinin (der höchste Wert lag bei 1606 mg/g Kreatinin). Als Zeichen einer fortgeschritteneren Nierenschädigung ist eine Erhöhung des Serumkreatinins zu werten. 2% der untersuchten Patienten (n=4) wiesen einen erhöhten Wert für das Serumkreatinin (>115µmol/l) auf, wobei bei einem Patienten eine bekannte, nichtdiabetesbedingte Nephropathie vorlag. Zur Höhe des Serumkreatininwertes zeigte die Albuminausscheidung im Urin keine signifikante Korrelation. Albuminausscheidung im Urin 100 Kumulative Häufigkeit (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Urinalbumin (mg) pro g Kreatinin Abbildung 10: Albuminausscheidung im Urin bei Patienten mit Diabetes mellitus (n=215). Der Grenzwert für eine normale Albuminausscheidung (Grenzwert für Männer bei 30mg/gKreatinin) ist durch den senkrechten Strich markiert. 60 Diabetische Retinopathie / Makulopathie: Eine sehr wichtige diabetesspezifische Komplikation, die für die Lebensqualität des Patienten sehr einschneidende Folgen haben kann, stellen die Veränderungen am Augenhintergrund dar. Hier kann zwischen der diabetischen Retinopathie, d.h. den Veränderungen der gesamten Netzhaut, und der Makulopathie, d.h. den Veränderungen im Bereich des Punkts des schärfsten Sehens, unterschieden werden. Bei Menschen mit Typ2 Diabetes, insbesondere bei den älteren Patienten, tritt häufiger eine Makulopathie auf, während bei den jüngeren Patienten und vor allem bei Typ1 Diabetes meist diabetische Veränderungen im Sinne einer Retinopathie anzutreffen sind. Beide Augenhintergrundveränderungen können, je nach Schweregrad, in verschiedene Stadien eingeteilt werden. Zur Diagnostik der diabetesbedingten Augenveränderungen führten wir bei jedem Patienten, soweit technisch möglich, eine Fotographie des Augenhintergrunds mit einer Non-mydriatischen Funduskamera (Retinalkamera Fa. Topcon) durch. Zunächst erfolgte eine Zwischenauswertung der vorliegenden Polaroidfotos, die endgültige Auswertung wird bei Vorliegen der Befunde der Follow-upUntersuchung mittels einer international standardisierten Methode (modifizierte Airlie House Classification) im prä/post- Vergleich durchgeführt werden (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group 1991). Für die jetzt vorliegende Auswertung verwendeten wir eine Einteilung des Schweregrads in 3 Skalen, wie sie von der Initiativgruppe „Früherkennung diabetischer Augenerkrankungen“(Prof. K.Roll, Marburg) und WHO Collaborating Center for Diabetes Treatment and Prevention (Prof. Berger, Düsseldorf) vorgeschlagen wurde. Dabei ist der Grad 0 = keine diabetische Retinopathie / Makulopathie, Grad 1 = milde oder mäßige diabetische Retinopathie / Makulopathie, Grad 2 = schwere nichtproliferative Retinopathie / Makulopathie, Grad 3 = proliferative Retinopathie. Eine Behandlungsindikation (Lasertherapie) ist ab einer 2.-gradigen Veränderung des Augenhintergrunds gegeben. Insgesamt lagen bei der Mehrzahl der untersuchten Patiente nur gering bis mäßig ausgeprägte diabetische Veränderungen vor. Dies ist dadurch zu erklären, dass unsere Stichprobe aus erwerbstätigen Rentenversicherten bestand. Eine stärker ausgeprägte diabetesbedingte Augenerkrankung führt jedoch meist zu einer deutlichen Einschränkung des Sehvermögens 61 und ist häufig mit anderen Folgeerkrankungen (Nierenerkrankung oder koronare Herzerkrankung) assoziiert, so dass eine Erwerbsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Die Tabelle 22 zeigt den durchschnittlichen Grad der diabetesbedingten Augenhintergrundveränderungen bei 174 Diabetes-Patienten, bei denen eine Fundusphotographie technisch möglich war. Bei 70% Prozent dieser Patienten waren keine Augenhintergrundveränderungen zu entdecken. Schwere, akut behandlungsbedürftige Veränderungen ≥ Grad 2 wiesen insgesamt 2,3% der untersuchten Patienten auf (nur 1,3% bei Typ2 Diabetes, jedoch signifikant häufiger mit 16,7% bei Typ1 Diabetes). Dies ist durch die unterschiedliche Diabetesdauer zu erklären: die durchschnittliche Diabetesdauer aller Patienten betrug 7,4 ± 7,9 Jahre. Die Diabetesdauer der Typ1-Patienten war mit 21,8 ± 11,3 Jahren erwartungsgemäß deutlich höher als bei den Typ2-Patienten mit 6,1 ± 6,1 Jahren. 22 % der Patienten mit Typ2 Diabetes wiesen eine Diagnosedauer von <2 Jahren auf (davon war bei 8,8% der Personen die Diagnose innerhalb des letzten Jahres gestellt worden). Grad der Retinopathie/ Makulopathie (Mittelwert beider Augen) Diabetes Typ1 Diabetes Typ2 pankreopriver Diabetes alle Typen n=12 (100%) n=157 (100%) Grad 0 n=5 (41,7%) n=113 (72,0%) n=4 (80,0%) n=122 (70,1 %) Grad 0,125-0,875 n=4 (33,3%) n=28 (17,8%) n=1 (20,0%) n=33 (19,0%) Grad 1,0-1,875 n=1 (8,3%) n=14 (8,9%) n=15 (8,6%) Grad 2,0-2,875 n=2 (16,7%) n=2 (1,3%) n=4 (2,3%) n=5 (100%) n=174 (100%) Tabelle 22: Durchschnittlicher Grad der Augenhintergrundveränderungen (Retinopathie / Makulopathie, jeweils beide Augen) bei 174 Patienten mit Diabetes mellitus. Statistisch ließ sich eine signifikante Korrelation zwischen der Schwere der diabetischen Augenhintergrundveränderungen und der Dauer der Erkrankung nachweisen (nicht-parametrische Korrelation 62 nach Spearman, p<0,01). Diesen Zusammenhang zwischen Diabetesdauer und Grad der diabetesbedingten Augenhintergrundveränderungen stellt Abbildung 11 für die Patienten mit Typ2 Diabetes graphisch dar. Es zeigt sich, dass Patienten mit einer kurzen Diabetesdauer von 0 bis 4 Jahren (n=87) eine geringen durchschnittlichen Grad der Retinopathie / Makulopathie von 0,32 Punkten aufwiesen. Bei einer Diabetesdauer von 5-9 Jahren lag der durchschnittliche Grad bei 1,19 Punkten (n= 35), bei einer Dauer zwischen 10-14 Jahren (n=17 Patienten) bei 1,5 Punkten. Patienten mit einer Diabetesdauer von 15-19 Jahren (n=7) wiesen eine Punktzahl von 1,6 auf, bei 20-24 Jahren (n=8) lag der Punktwert bei 1,75, bei einer Diabetesdauer von 25-30 Jahren (n=2) lag der mittlere Punktwert bei 3,25. Retinopathie / Makulopathie bei Typ 2 Diabetes Grad der Retinopathie / Makulopathie (Durchschnittswert pro Patient / 2 Augen) 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 Diabetesdauer (Jahre) Abbildung 11: Abhängigkeit der Ausprägung der Retinopathie / Makulopathie von der Dauer der Diabeteserkrankung bei Patienten mit Typ2 Diabetes mellitus (n=157). Es ist deutlich zu sehen, dass mit zunehmender Diabetesdauer die Augenhintergrundveränderungen zunehmen. 63 Beim Vergleich dieser Daten mit Angaben aus der Literatur finden sich ähnliche Ergebnisse: So zeigte sich in einer epidemiologischen Studie in Österreich, bei der ebenfalls die Fundusphotographie als Screening-Methode für diabetesbedingte Augenhintergrundveränderungen angewandt wurde, bei ca. 2% (1,9%) der Untersuchten ein akut behandlungsbedürftiger Befund (Muhlhauser et al. 1992). Die Häufigkeit aller, auch der geringer ausgeprägten Augenhintergrundveränderungen fiel bei unseren Untersuchungen eher geringer aus als nach bisherigen Veröffentlichungen zu erwarten war: nur 28% der Patienten mit Typ2 Diabetes wiesen überhaupt Zeichen einer Retinopathie bzw. Makulopathie auf. Hingegen zeigten in der UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) bereits 21% der Patienten zu Beginn der Diagnosestellung eines Typ2 Diabetes Zeichen einer Retinopathie (UK Prospective Diabetes Study 6 1990 ). In der Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) wiesen 28,8% der Patienten mit einer Diabetesdauer von unter 5 Jahren Zeichen einer Retinopathie auf, hingegen nur 11,5 % der Patienten in unserer Studie. Bei einer Diabetesdauer von mehr als 15 Jahren zeigten Patienten der WESDR in 78% Veränderungen, bei uns in 58,8% (10 von 17 Patienten) (Klein et al. 1984). Trotz dieser positiven Befunde war die für jeden Diabetespatienten zu fordernde jährliche augenärztliche Kontrolle längst nicht bei allen von uns untersuchten Patienten erfolgt: 30,1% der befragten Studienteilnehmer gaben an, keine augenärztliche Untersuchung wegen des Diabetes gehabt zu haben. Bei 40,8% der Personen erfolgte einmal jährlich eine Kontrolle beim Augenarzt, 28,7% der Patienten suchten den Augenarzt mehrmals pro Jahr zur Kontrolle und / oder Therapie auf. Wir motivierten alle Studienteilnehmer, nachdem ihre eigenen Augenbefunde anhand der Polaroid-Aufnahmen besprochen wurden und eine Aufklärung über die möglichen diabetesspezifischen Komplikationen am Augenhintergrund erfolgt war, sich, unabhängig vom Befund der Fundusphotographie, zu einer kurzfristigen Kontrolluntersuchung in Mydraisis beim niedergelassenen Augenarzt vorzustellen. Zur Dokumentation dieser augenfachärztlichen Untersuchung gaben wir den Patienten einen standardisierten Untersuchungsbogen, entwickelt von der Initiativgruppe „Früherkennung diabetischer Augenerkrankungen“(Prof. K.Roll, 64 Marburg) und WHO Collaborating Center for Diabetes Treatment and Prevention (Prof. Berger, Düsseldorf) mit. Von diesen Befundbogen erhielten wir 59,7% zurück. Eine Laserbehandlung der Netzhaut wegen diabetischer Veränderungen war bei insgesamt 16 Patienten (7,4% aller Patienten) erfolgt (bei 2,6% an einem Auge, bei 4,6% beidseits). Eine Erblindung auf einem Auge gaben 2 Patienten an, dies war jedoch nicht diabetesbedingt. 65 D: Reha-Score für Diabetes mellitus: Ein Instrument zur Abschätzung des Rehabilitationsbedarfs bei Diabetes mellitus: Hintergrund: Patienten mit Diabetes weisen eine gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhte Morbidität auf. Beispielsweise ist das Risiko, einen Myokardinfarkt oder apoplektischen Insult zu erleiden, 2-5 fach erhöht (Kannel WB, McGee DL 1979). Gegenüber Nicht-Diabetikern ist das relative Risiko für Erblindung 20-fach erhöht, für terminales Nierenversagen 25-fach und für eine Amputation 40-fach. (Nathan DM1993). Diese Folgekrankheiten verursachen erhebliche volkswirtschaftliche Kosten. Neueste Studien belegen, dass eine intensive Diabetes-Therapie mit einer Verbesserung der Stoffwechsellage sowohl die direkten wie die indirekten Krankheitskosten deutlich senken kann (Gray A et al. 2000; Licciardone JC et al. 1997). Die Verhinderung von Komplikationen und diabetesspezifischer Folgeerkrankungen ist das Ziel verstärkter präventiver Maßnahmen, wie sie schon in der St. Vincent Declaration 1990 gefordert wurden (Anonym. 1990a). Im Hinblick auf die häufig assoziierten Risikofaktoren und Folgeerkrankungen handelt es sich beim Diabetes mellitus um eine multidimensionale Erkrankung, die eine multidisziplinär-multimodale Intervention mit verhaltensmedizinisch orientierten Therapien unter ärztlicher Koordination erfordert (cf. §15 SBG VI). In den Einrichtungen der stationären Rehabilitation können die verschiedenen Gesundheitsstörungen mit Hilfe eines interdisziplinären Teams nach einem ganzheitlichen Therapieansatz behandelt werden. Die Aufgabe einer Rehabilitationsmaßnahme besteht nach SBG VI darin, den Auswirkungen einer Krankheit auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entgegenzuwirken und ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern. Betrachtet man die Rehabilitations-Statistik des VDR (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger) der Jahre 1991 bis 1999, so liegt der prozentuale Anteil der Rehabilitationen aufgrund der Erst- 66 diagnose ICD 250 (Diabetes mellitus) bei 1,5%-1,6% (davon 24,7% Typ1, 74,3 % Typ2 Diabetes) aller Rehabilitationen. Angehörige der Arbeiterrentenversicherung weisen mit 1,75% einen etwas höheren Anteil auf (VDR Frankfurt 2000). Ausgehend von ca. 36,4 Mio. Erwerbstätigen (Statistisches Bundesamt 1999) und einer Diabetesprävalenz von ca. 5% (s.o.) sind in der Bundesrepublik Deutschland etwa 1,8 Millionen erwerbstätige Personen an Diabetes mellitus erkrankt. Die Anzahl der Rehabilitationen aufgrund der Erstdiagnose Diabetes liegt laut VDR-Statistik (Anonym. 1999) bei ca. 10.000 pro Jahr bzw, (wegen des Wiederholungsintervalls für eine stationäre Rehabilitation von frühestens 4 Jahren) etwa 40.000 in 4 Jahren. D.h. von den 1,8 Millionen Erwerbstätigen mit Diabetes werden etwa 2,2% (40.000 / 1,8 Mio.) durch eine stationäre Rehabilitation im Zeitintervall von 4 Jahren erreicht. Angesichts dieser Daten stellt sich die Frage nach einer rehabilitativen Unterversorgung der RV-Versicherten mit Diabetes mellitus. Schließlich müssen noch die Auswirkungen der finanziellen Beschneidungen im Rehabilitationssektor durch das WFG (Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz) vom September 1996 betrachtet werden, durch die ab 1997 im Reha-Bereich jährlich 2,7 Milliarden DM eingespart werden sollten. Mit Inkrafttreten des WFG war die Anzahl aller medizinischen Rehabilitationen (bei gleichbleibender Zahl an Rentenversicherten) um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Der Anteil der wegen der Erstdiagnose Diabetes gestellten Rehabilitationen hielt sich bei einem prozentualen Anteil von etwa 1,55 %, das heißt es bestand ebenfalls ein absoluter Rückgang von circa einem Drittel - bei der bereits ohnehin geringen Anzahl diabetesbedingter Unter dem Zwang dieser einschneidenden Sparmaßnahmen ist es daher wichtig zu prüfen, Rehabilitationen. ob die medizinische Versorgung von RV-Versicherten mit einem Diabetes (entsprechend dem Grundsatz von § 70 SBG) bedarfsgerecht erfolgt. Das Anliegen unserer Studie war es deshalb, ein Instrumentarium zu schaffen, um einen objektivierbaren Reha-Bedarf bei Diabetes mellitus zu operationalisieren. 67 Entwicklung des Reha-Scores: Mit dem Reha-Score für Diabetes mellitus stellen wir ein Verfahren und Instrument vor, das geeignet erscheint, den Bedarf für eine multimodal-multidisziplinäre Intervention bei Diabetes mellitus objektiv abzuschätzen. Er wurde im Rahmen der vorliegenden Studie in Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des Projekts A4 entwickelt. Wie bereits zuvor erwähnt (s. S.23) liegen beim Typ1 und Typ2 Diabetes verschiedene Pathomechanismen des gestörten Kohlenhydratstoffwechsels vor mit unterschiedlich ausgeprägten Risikound Begleitfaktoren. Bei der Entwicklung des Reha-Scores haben wir uns deshalb auf das häufigere Krankheitsbild des Typ2 Diabetes beschränkt. Zunächst erfolgt eine allgemeine Darstellung des Reha-Scores mit den zugrundeliegenden theoretischen Voraussetzungen. Abschließend werden diese Ausführungen durch Daten aus der vorliegenden Studie illustriert. Der Typ2 Diabetes als Beispiel einer multidimensionalen Erkrankung: Der Typ2 Diabetes ist als eine Form des Metabolischen Syndroms (auch Insulinresistenz-Syndrom oder Syndrom X genannt) zu verstehen und wird charakterisiert durch eine Hyperglykämie, Hypertonie, Hyperlipoproteinämie und stammbetonte Adipositas (s. Grafik 6, Anlage). Neuere Forschungen ergänzten diesen Symptomenkomplex um weitere Störungen wie z.B. Hyperurikämie, Gerinnungsstörungen, Depression. Die zugrundeliegenden pathogenetischen Faktoren sind 1.) eine überschießende Aktivierung des sympathischen Nervensystems und der hypothalamo-hypophysäradrenalen Achse (HPA-Achse), 2.) ein relativer Insulinmangel und 3.) eine Insulinresistenz. Als Risikofaktoren für die Entwicklung des Metabolischen Syndroms gelten Bewegungsmangel, chronischer psychosozialer Stress, Schlafstörungen, übermäßiger Alkoholkonsum, eine inadäquate Nahrungszufuhr und Nikotinabusus. Im weiteren Krankheitsverlauf spielen beim Typ2 Diabetes ebenso wie beim Typ1 Diabetes die diabetesspezifischen, chronischen Folgeerkrankungen eine zunehmende Rolle und bestimmen durch gesundheitsbedingte Einschränkungen 68 in Beruf und Privatbereich das weitere Leben des Patienten in einschneidender Weise. Man unterscheidet makrovaskuläre Komplikationen, zu denen die koronare Herzerkrankung, der apoplektische Insult und die periphere arterielle Verschlusskrankheit zählen, und mikrovaskuläre Schäden, die die Nephropathie, Neuropathie und Retinopathie umfassen. Beim Typ2 Diabetes stehen die makrovaskulären gegenüber den mikrovaskulären Komplikationen im Vordergrund. Akutkomplikationen können sich durch eine Stoffwechselentgleisung in Form einer akuten Hyperglykämie oder Hypoglykämie manifestieren. Schließlich sind noch allgemeine Komplikationen zu erwähnen: durch hormonelle Veränderungen kann sich eine Depression entwickeln oder verstärken. Die Depression kann ihrerseits zu Motivations- und Verhaltensänderungen führen, die im Sinne eines Circulus vitiosus den Stoffwechsel wieder negativ beeinflussen können. Multimodaler Therapieansatz beim Typ2 Diabetes: Die erwähnten pathogenetischen Zusammenhänge verdeutlichen, dass eine wirksame Therapie (und Prävention) möglichst viele Störungen und Risikofaktoren des Typ2 Diabetes verändern muss und nicht nur die isolierte Verbesserung eines einzelnen Parameters (z.B. der Blutglukose) zum Ziel haben kann. Durch gleichzeitige Beeinflussung mehrerer Störungen und Risikofaktoren ist ein synergistischer Effekt auf die gesamte Erkrankung zu erwarten (Gaede P et al. 1999). In unserem Gesundheitssystem bietet eine stationäre medizinische Rehabilitation ideale Voraussetzungen für eine solche multimodale Therapie. Ein Ziel unserer Studie war es, aufgrund standardisierter Befunde die Diabetes-Patienten mit einem Rehabilitationsbedarf im engeren rentenversicherungsrechtlichen Sinne zu identifizieren, bei denen die Erwerbsfähigkeit gemindert oder gefährdet ist (§10 SBG VI). Dabei wurde ein präventiver Therapieansatz zugrundegelegt, d.h., die Rehabilitanden sollen möglichst schon vor dem Eintreten von Komplikationen erreicht werden. Infolgedessen fließen in den Reha-Score weniger die bereits eingetretenen Komplikationen als vielmehr Risikofaktoren und diabetesassoziierte Gesundheitsstörungen ein. 69 Operationalisierung des Reha-Scores: Die Operationalisierung erfolgt mit Hilfe eines additiven Index in drei Schritten: • I: Identifikation der krankheitsspezifischen Störungsbereiche: Mittels eines standardisierten Un- tersuchungsablaufs wird festgestellt, wieviele der insgesamt 12 krankheitsrelevanten Störungen („Reha-Indikatoren“) vorhanden sind. Die Cut-Offs legten wir teilweise kategorial fest, (z.B. derzeitiger Nichtraucher), teilweise normativ (z.B. Definition des Bewegungsmangels). Bei den Fragebögen lagen die Cut-Offs jeweils eine Standardabweichung ausserhalb des Mittelwerts der entsprechenden Normstichprobe, für die Untersuchungs- und Laborwerte übernahmen wir die in den jeweiligen Leitlinien genannten Grenzwerte. • II: Indikationsstellung für bestimmte therapeutische Interventionen: Den vorhandenen Störun- gen werden je nach Art und Ausprägung bis zu 8 Interventionen verschiedener medizinischer Berufszweige (Psychologen, Sporttherapeuten, Diätassistenten, Diabetesschwester, Arzt) zugeordnet (s. tabellarische Übersicht 2, Anlage und Grafik 7, Anlage). • III: Auswertung: Die jeweils benötigten therapeutischen Interventionen werden addiert. Den Cut-off für einen sicheren Rehabilitationsbedarf legten wir bei einem Bedarf an 6 oder mehr indizierter Therapien fest. • Einschränkungen und Kontraindikationen: Abschließend wird überprüft, ob Einschränkungen und Kontraindikationen vorliegen, die einer aktuellen stationären Rehabilitation entgegenstehen. I: Identifikation der krankheitsrelevanten Störungen (Reha-Indikatoren): 1) Bewegungsmangel: Im ärztlichen Interview erfragten wir die körperliche Aktivität während der Berufstätigkeit und in der Freizeit. Aus einer jeweils 4-stufigen Punkteskala wurden für das Ausmaß der Bewegung in Beruf und Freizeit die entsprechenden Punkte zwischen 1 und 4 vergeben und addiert. (Je 1 Punkt: bei sitzender Berufstätigkeit bzw. sitzender Freizeitbeschäftigung. 2 Punkte: bei leichter Arbeit, d.h. 70 ≤ ½ Tag auf den Beinen und leichter körperlicher Freizeitbeschäftigung wie Gartenarbeit oder Spaziergänge. Je 3 Punkte: bei mittelschwerer Arbeit, d.h. > ½ Tag auf den Beinen bzw. sportlicher Betätigung 1-2 Mal wöchentlich. 4 Punkte: bei regelmäßig schwerer körperlicher Arbeit bzw. bei Sport ≥ 3x wöchentlich.) Somit kann in diesem Bewegungs-Score eine Punktzahl zwischen 2 und 8 Punkten erreicht werden. Ein Bewegungsmangel mit der Notwendigkeit einer vermehrten körperlichen Betätigung wurde festgelegt bei einer Punktzahl < 4 P. 2) Übergewicht: Das aktuell ermittelte Übergewicht wurde anhand des Body Mass Index (BMI) bestimmt, der sich aus dem Gewicht G (in kg),gemessen in leichter Kleidung, und der Körpergröße K (in m) nach der Formel G/K2 errechnet. Nach der WHO Klassifikation besteht Normalgewicht bei einem BMI von 18,5-24,9 kg/m2, Übergewicht bei ≥ 25 kg/m2. Ein Interventionsbedarf bei Adipositas legten wir entsprechend den Grenzwerten des National Health And Nutrition Examination Surveys (NHANES) fest: für Frauen bei einem BMI > 27,3 kg/m2, für Männern bei > 27,8 kg/m2 (entsprechend der 85. Percentile) (Kuczmarski RJ et.al. 1994). 3) Arterielle Hypertonie: Der Blutdruck wurde mit einem automatischen Blutdruckmessgerät nach einer 5-minütigen Ruheperiode im Liegen gemessen. Es erfolgten drei Messungen in 2-minütigen Abständen, in die Auswertung ging jeweils der Mittelwert aus den drei systolischen bzw. diastolischen Werten ein. Eine Erhöhung der Blutdruckwerte wurde nach Guidelines der European Diabetes Policy Group für Typ2 Diabetes definiert bei einem systolischen Blutdruck > 140 mm Hg oder diastolischen Blutdruck > 85 mm Hg. Bei Vorliegen einer Nierenschädigung ist diese Grenze strenger gesetzt auf systolische Blutdruckwerte >130 mm Hg und diastolische Werte >80 mmHg. Eine Nierenschädigung wird anhand des im Spontanurin ausgeschiedenen Albumins definiert: bei Frauen ab >40 mg Albumin pro g Urinkreatinin, bei Männern >30mg Albumin pro g Urinkreatinin (Alberti G1999). 71 4) Hyper-/ Dyslipidämie: Im Nüchternplasma wurden Gesamtcholesterin, HDL- und LDL-Fraktion sowie die Triglyceride bestimmt, die Cut-off-Werte für eine Erhöhung der einzelnen Parameter wurden ebenfalls den europäischen Guidelines für Typ2 Diabetes entnommen (Alberti G1999). Die Notwendigkeit einer Intervention wird dort festgelegt bei Triglyceriden >1,7 mmol/l, bei Gesamtcholesterin >4,8 mmol/l, bei LDL-Cholesterin >3,0 mmol/l und HDL-Cholesterin < 1,2 mmol/l. 5) Störung des Glucosestoffwechsels: Als Parameter dient die Höhe des glykierten Hämoglobins (HbA1c), das eine zuverlässige Aussage über die Höhe und Dauer der hyperglykämischen Phasen in den zurückliegenden 6-8 Wochen erlaubt. Die Grenzwerte für eine Erhöhung und die Notwendigkeit einer Intervention definierten wir entsprechend den Guidelines der Europan Diabetes Policy Group für Typ2 Diabetes bei einem Wert >6,5% (Alberti G1999). 6) Diabeteswissen: Das Wissen über Diabetes erfragten wir mit dem Wissenstest für nicht-insulinbehandelte Typ2Diabetiker (Hermanns N, Kulzer B 1996). Für die insulinbehandelten Patienten stellten wir in Anlehnung daran einen Wissenstest mit Elementen aus oben genanntem Fragebogen und dem Wissenstest aus dem Schulungsprogramm nach Berger zusammen (Berger M et al. 1984). Der Wissenstest besteht aus 14 Fragen mit 3-4 Antwortmöglichkeiten nach dem Multiple-Choice-Verfahren. Die Fragen gelten als richtig beantwortet, wenn die Antwortkombinationen korrekt angekreuzt wurden, so dass eine Punktzahl zwischen 0 und 14 Punkte erreichbar ist. Laut Kulzer et al. liegt das mittlere Diabeteswissen bei ungeschulten Diabetes-Patienten bei 6,44 Fragen (46%), und steigt nach der Schulung vor allem bei initial schlechtem Wissen deutlich an. Wir setzten (normativ) als Grenzwert 72 ein Diabetewissen mit 60% richtigen Antworten voraus, d.h. bei weniger als 8 richtig beantworteten Fragen wurde ein Schulungsbedarf angenommen. 7) Risikofaktor Rauchen: Im ärztlichen Interview fragten wir nach den Rauchgewohnheiten: Einen Interventionsbedarf für ein Raucherentwöhnungsprogramm legten wir (kategorial) für jede Person fest, die einen derzeitigen Zigarettenkonsum („current smoker“) angab. 8) Depressivität Zur Erfassung einer vorliegenden Depressivität wandten wir die CESD-Skala (Center for Epidemiological Studies Depression Scale, deutsche Version von Gerbershagen und Kohlmann) an (Gerbershagen H-U, Kohlmann T 1998). Dieser Fragebogen umfasst 20 Items, in denen depressive Symptome Werten zwischen 0-3 Punkte zugeordnet werden. Bei der Auswertung können 0-60 Punkte erreicht werden, ab einer Punktezahl von > 23 (entspricht dem Mittelwert plus einer Standardabweichung der Referenzpopulation) ist eine depressive Verstimmung wahrscheinlich und damit eine supportive Intervention auf diesem Gebiet indiziert. 9) Essverhalten: Das Vorliegen eines pathologischen Essverhaltens erfassten wir mit dem FEV (Fragebogen zum Essverhalten) von Pudel und Westenhöfer (Pudel V, Westenhöfer J 1989). Dieser Fragebogen wurde für die verschiedenen Arten von Essstörungen entwickelt und ist mittlerweile ein Standardinstrument in der Adipositasforschung. Er umfasst 51 Items, die in den drei Skalen 1.) Kognitive Kontrolle des Essverhaltens, 2.) Störbarkeit des Essverhaltens und 3.) Erlebte Hungergefühle zusammengefasst werden. Als Referenzdaten zogen wir die Mittelwerte einer alters-und geschlechtsgemischten westdeutschen Bevölkerung heran (n=1838, weiblich = 954, männlich = 884; BMI 24,9 +/- 3,1 kg/m2 , Alter 14-87 Jahre). Einen Interventionsbedarf bezüglich des Essverhaltens legten wir 73 fest, wenn die Messwerte auf wenigstens einer der 3 Skalen ausserhalb des Bereichs Mittelwert und plus eine Standardabweichung lag. 10) Chronischer psychischer Stress: Die psychische Belastung durch chronischen Stress erfassten wir mittels des TICS (Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress) (Schultz P, Schlotz W 1999). Dieser Fragebogen enthält 39 Items mit je 5 Antwortmöglichkeiten. Sie werden zu 6 Skalen zusammengefasst: soziale Belastung, Mangel an sozialer Anerkennung, Sorgen und belastende Erinnerungen sowie Arbeitsüberlastung und Arbeitsunzufriedenheit. Für den allgemeinen Stress errechneten wir die erreichte Punktzahl in den ersten 4 Skalen und verglichen diese mit der Referenzpopulation. Wenn in mindestens einer der Skalen der erreichte Wert ausserhalb des Bereichs Mittelwert plus eine Standardabweichung der Referenzpopulation lag, werteten wir dies als ein Anzeichen für das Vorliegen von chronischem Stress im Alltag mit der Notwendigkeit einer therapeutischen Intervention. 11) Probleme am Arbeitsplatz: Probleme am Arbeitsplatz verbunden mit vermehrtem Stress erfragten wir mit Hilfe der Skalen Arbeitsüberlastung und Arbeitsunzufriedenheit des TICS (Schultz P, Schlotz W 1999). Weiterhin legten wir (normativ) einen Bedarf für eine Arbeitsplatzberatung fest, falls ein Patient regelmäßig im Schichtbetrieb mit Nachtschichten eingesetzt wird. Eine Störung des Schlafes führt nachweislich zu einer Hyperaktivität des Sympathischen Systems und der HPA-Achse sowie zu einer Zunahme der Insulinresistenz. Deshalb ist davon auszugehen, dass eine Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus eine wesentliche Rolle bei der Entstehung und Progression des Metabolischen Syndroms und des Diabetes mellitus spielt (Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E 1999). Einen Bedarf für eine arbeitsplatzbezogene Beratung sahen wir, wenn in einer der beiden Skalen des TICS der erreichte Wert ausserhalb des Bereichs Mittelwert plus eine Standardabweichung der Referenzpopulation lag oder der Patient regelmässig im Drei-Schichtbetrieb eingesetzt wurde. 74 12) Hypoglykämie-Neigung: Hypoglykämien nehmen mit Intensivierung der blutglukosesenkenden Medikation zu, in der UKPDS wiesen 1,2% der Menschen mit Typ2 Diabetes unter Sulfonylharnstoffen und 2,0% unter Insulintherapie schwere Hypoglykämien auf (Anonym. 1998c). Im ärztlichen Interview fragten wir nach schweren Hypoglykämien: „Hatten Sie jemals so niedrigen Blutzucker, dass Sie sich selbst nicht mehr helfen konnten? Wenn ja, wie oft in den letzten 12 Monaten?“. Einen Handlungsbedarf legten wir fest, wenn im letzten Jahr mindestens einmal eine Hypoglykämien mit Fremdhilfebedarf eingetreten war. II: Indizierte therapeutische Interventionen: Bei der Indikationsbegründung für die nachfolgend vorgestellten 8 Therapien orientierten wir uns, soweit vorhanden, an Empfehlungen von Leitlinien. Wie in Grafik7 (s. Anlage) veranschaulicht, werden jeder Störung eine oder mehrere Therapien bzw. Berufsgruppen zugeordnet. Umgekehrt können auch mehrere dieser Reha-Indikatoren eine gemeinsame Therapieform erfordern. Die tabellarische Übersicht 2 (s.Anlage) zeigt, welche Störung(en) jeweils eine bestimmte Therapie begründen. 1) Sporttherapie: Die zunehmende Bewegungsarmut und vorwiegend sitzende Lebensweise führte in den letzten Jahren zu einer epidemischen Zunahme der Adipositas und der Insulinresistenz. Ein kausaler Therapieansatz mit höchster Priorität ist bei übergewichtigen Personen mit Typ2 Diabetes deshalb die frühzeitig einsetzende Bewegungstherapie (Anonym. 1997b). Als positive Auswirkungen einer regelmäßigen körperlichen Betätigung wurden beim Typ2 Diabetes eine verbesserte Stoffwechselkontrolle (Reduktion des HbA1c-Spiegels um 10-20% des Ausgangswerts), eine Minderung der Insu- 75 linresistenz und ein Absinken des Blutdrucks beschrieben. Empfohlen wird eine regelmäßige sportliche Betätigung 3-5 mal wöchentlich von 30-60 minütiger Dauer. Hierbei ist nach neuesten Studien eine moderate Leistung (50-70% der maximal erreichbaren Herzfrequenz = 220-Lebensalter) ausreichend. 2) Diätberatung: Die meisten Menschen mit Typ2 Diabetes (ca. 80%) sind übergewichtig. Pathogenetisch spielt das Fettgewebe bei der Entwicklung der Insulinresistenz eine wichtige Rolle. Deshalb sollte bei den übergewichtigen Personen mit Diabetes die Gewichtsreduktion im Vordergrund der Interventionen stehen (American Diabetes Association 2000). Bereits eine geringe Gewichtsreduktion von 5-10% des Ausgangsgewichts erweist sich als wirksame Maßnahme zur Normalisierung erhöhter Blutglukosespiegel, Blutfette und Blutdruckwerte (NHLBI Obesity Education Initiative 1998). Die empfohlene moderate Gewichtsabnahme von ca. ½ kg pro Woche ist durch eine fettreduzierte hypokalorische Ernährung (Einsparung von etwa 500-1000 kcal täglich) zu erreichen (American Diabetes Association2000). Der Alkoholkonsum sollte beim Diabetes wie bei gesunden Personen auf 30 g Alkohol pro Tag (bei Frauen 15 g) eingeschränkt werden, da dieser eine Quelle zusätzlicher Kalorien und einen Risikofaktor für die abdominelle Adipositas und eine Hypertriglyceridämie darstellt (NHLBI Obesity Education Initiative1998). Jeder Patient unter blutglukosesenkender Medikation muss über die Gefahr einer Hypoglykämie bei Alkoholgenuss informiert sein, die wegen einer alkoholinduzierten Hemmung der Gluconeogenese eintreten kann. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bezüglich der Ernährung ist die Kalorienverteilung auf 5-6 kleine Mahlzeiten über den Tag, was zu einer Glättung der Blutglukoseprofile und der Insulinsekretion führt. Zur Kostzusammensetzung werden ca. 10-15% Proteine, 20-30% Fette (max. 10% gesättigte, 10-20% ungesättigte Fettsäuren) und 50-60% komplexe Kohlenhydrate empfohlen. Eine Beeinflussung des erhöhten Blutdrucks ist, wie erwähnt, durch eine Gewichtsreduktion möglich, zusätzlich sollte eine Restriktion des Kochsalzkonsums auf maximal 6g täglich erfolgen (National Insitutes of Health 1997). Die 76 Wissensvermittlung über eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Gewichtsabnahme dar. Eine verbesserte und längeranhaltende Wirksamkeit ist jedoch durch die Kombination mit einer Bewegungstherapie und einer verhaltenstherapeutischen Unterstützung zu erreichen (NHLBI Obesity Education Initiative1998; Wing RR 1993). 3) Ärztliche Stufentherapie: Wichtig bei jedem Diabetes-Patienten ist ein frühzeitiges Screening bezüglich der Folgeerkrankungen. Gerade beim Typ2 Diabetes liegen bereits zu Beginn der Diagosestellung in ca. 50 % mikround makrovaskuläre Folgeschäden vor (s.o.) (Anonym. 1990c). Die Entstehung einer Nephropathie wird durch schlechte Blutglukose-Einstellung, arterielle Hypertonie und Rauchen begünstigt. Eine Mikroalbuminurie erwies sich als Prädiktor für erhöhte kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität und erfordert daher ein aggressives therapeutisches Vorgehen bezüglich der klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren (Anonym. 2000b). In gleicher Weise zeigten epidemiologische Studien bei der diabetischen Retinopathie eine Abhängigkeit der Inzidenz und Progression vom HbA1cSpiegel, der Höhe des Blutdrucks und der Dauer des Diabetes (Klein R et.al. 1984). Das kardiovaskuläre Risikoprofil spielt bei der Diabetes-Therapie ebenfalls eine entscheidende Rolle. Das Risiko, einen Myokardinfarkt zu erleiden, liegt beim Diabetes deutlich höher als in der Normalbevölkerung und entspricht etwa dem erhöhten Re-Infarktrisiko von Nicht-Diabetikern (Haffner SM et.al. 1998). In den Empfehlungen des amerikanischen Cholesterin-Programms sind deshalb alle über 45jährigen Diabetes-Patienten mit einer Dyslipidämie in die kardiovaskukäre Hochrisikogruppe einzustufen (Expert Panel on Detection EaToHBC 1993). Von der American Heart Association wurde der Satz geprägt „Diabetes ist eine kardiovaskuläre Erkrankung“ (Grundy SM et.al. 1999). Folglich sind bei jedem Diabetespatienten die vorhandenen kardiovaskulären Risikofaktoren (arterielle Hypertonie, erhöhtes LDL-Cholesterins, erniedrigtes HDL-Cholesterin und Rauchen) ebenso aggressiv zu therapieren wie in der Sekundärprävention nach erfolgtem Myokardinfarkt. 77 a) Verbesserung des Glucosestoffwechsels: Nach den Europäischen Leitlinien ist eine therapeutische Intervention erforderlich, wenn bei Typ2 – Diabetes der HbA1c über 6,5% liegt. Die Ergebnisse der UKPDS zeigten, dass eine signifikante Korrelation zwischen der Höhe des glykierten Hämoglobins und der Inzidenz von Komplikationen besteht. Es fand sich kein Schwellenwert, so dass eine nahe-normoglykämische BlutglukoseEinstellung anzustreben ist (Stratton IM et.al. 2000). Eine Senkung des mittleren HbA1c-Wertes um 1% bewirkte eine deutliche Risiko-Reduktion für sämtliche Outcome-Variablen (beispielsweise 14% für Herzinfarkte, 37% für mikrovaskuläre Komplikationen). Für die Blutglukose-Einstellung ist entsprechend den Guidelines ein Stufenschema anzuwenden, das bei Typ2 Diabetes zunächst eine diätetische Therapie und Veränderungen des Lebensstils (v.a. mehr Bewegung) vorsieht. Auf der zweiten Stufe stehen verschiedene orale Antidiabetika zur Mono- oder Kombinationstherapie zur Auswahl. Für den übergewichtigen Diabetes-Patienten stellte sich in der UKPDS Metformin wegen der fehlenden Gewichtszunahme als besonders günstig heraus. Bei ungenügender Blutglukosesenkung unter medikamentöser Therapie wird der Beginn einer zusätzlichen Insulintherapie empfohlen, gegebenenfalls auch eine intensivierte Insulintherapie, falls die Blutglukosewerte oder der Lebensstil des Patienten dies erfordern (Alberti G1999). In der täglich geübten Praxis erhalten Patienten mit erhöhten Blutglukosewerten häufig keine ausreichende Schulung und Beratung, sondern werden sofort mit Medikamenten behandelt. Durch eine Umstellung der Essgewohnheiten und Anleitung zu vermehrter körperlicher Aktivität während einer stationären Rehabilitation kann die medikamentöse Behandlung häufig reduziert bzw. weggelassen werden (Haupt E et.al. 1996). Ein Ziel der Rehabilitation ist in diesen Fällen, die Verhaltensmodifikationen auch auf den Alltag zu übertragen. 78 b) Therapie der Dyslipidämie: Eine Erhöhung der Blutfette insgesamt bzw. Erhöhung des Gesamt-Cholesterins, der LDL-Fraktion und Erniedrigung des HDL-Cholesterins zählt beim Diabetes genauso wie bei Nichtdiabetikern zu den stärksten atherogenen Risikofaktoren. Die Therapie unterscheidet sich deshalb bei beiden Personengruppen nicht, jedoch sollen bei Menschen mit Diabetes wie bei anderen Hochrisikogruppen (z.B. Postinfarkt-Patienten) die Therapieziele sehr konsequent verfolgt werden (Expert Panel on Detection EaToHBC1993). Die Grundlage der Behandlung besteht in einer Gewichtsreduktion, fettreduzierter Diät sowie Einschränkung des Alkoholgenusses (v.a. bei Hypertriglyceridämie) und vermehrter Bewegung. Zusätzlich muss bei unzureichender Wirkung dieser Maßnahmen eine medikamentöse Therapie begonnen werden. Die verschiedenen Substanzklassen weisen ein unterschiedliches Wirkungsprofil auf und werden je nach Art der Dyslipidämie eingesetzt. Bei einer überwiegenden Erhöhung der Triglyceride empfiehlt sich zunächst ein Fibrat, Statine senken v.a. das LDLCholesterin, ebenso die Gallensäuerebinder. Nikotinsäurederivate sind wegen einer Verschlechterung der Glukosetoleranz bei Diabetes wenig geeignet (Expert Panel on Detection EaToHBC1993). c) Therapie der arteriellen Hypertonie: Diabetes-Patienten weisen eine etwa doppelt so hohe Prävalenz der arteriellen Hypertonie auf wie die Normalbevölkerung. In der UKPDS bestanden zu Beginn der Diagnosestellung bereits bei 35% der 25-65 jährigen Personen mit Typ2 Diabetes hypertone RR-Werte >160/95 mmHg. (Anonym. 1990c). Der Hypertonus ist entscheidend beteiligt an der Entwicklung und Progression der chronischen Komplikationen des Diabetes. Eine gute Kontrolle der arteriellen Hypertonie führte zur Risikoreduktion von 38% bei der Progression der mikrovaskulären Komplikationen (der Retinopathie in 34%), und von 44% für das Ereignis eines Schlaganfalls (Anonym. 1998d). Nach übereinstimmender Meinung von Experten ist eine frühzeitige und konsequente Blutdrucksenkung eine der wichtigsten Maßnahmen beim Diabetes. Auch hier werden begleitend zur medikamentösen Therapie Veränderungen des Lebensstils wie Gewichtsreduktion und Bewegungstherapie empfohlen, um die 79 Zielblutdruckwerte zu erreichen (National Insitutes of Health1997; Alberti G1999). Unter den Antihypertensiva kommen bei Diabetes grundsätzlich dieselben Substanzklassen zur Mono-und Kombinationstherapie wie bei Nicht-Diabetikern in Frage. Unbestritten ist die Wirksamkeit einer aggressiven Blutdrucksenkung bei beginnender Nierenschädigung: bei einer nachgewiesenen Mikroalbuminurie liegt der empfohlene Zielblutdruck deshalb unter 130/80 mmHg (Alberti G1999). 4) Diabetesschulung Die Diabetes-Schulung ist heutzutage ein integraler Bestandteil jeder Diabetes-Therapie. Als übergreifendes Behandlungsziel verfolgt sie das Selbstmanagement bzw.„Empowerment“ der Patienten, d.h. die Befähigung des Patienten, mit seinen krankheitsspezifischen Problemen (z.B. Blutglukoseschwankungen, Essen bei Feiern / im Restaurant,...) weitgehend selbstständig zurecht zu kommen. Der Anteil der geschulten Diabetes-Patienten, vor allem der Typ2-Patienten, ist immer noch als sehr unzureichend anzusehen (Vogel H, Kulzer B 2000). Folgende Schulungselemente bilden die Voraussetzung dafür: Erwerb eines Basiswissens über die Stoffwechselzusammenhänge, Vermittlung von handlungsorientiertem Wissen und praktischen Fähigkeiten sowie Entwicklung eines Bewusstseins für Eigenverantwortlichkeit. Je nach Diabetes-Typ bzw. Behandlung (rein diätetisch, medikamentös, mit/ ohne Insulin) stehen verschiedene strukturierte Schulungsprogramme zur Verfügung. Als kurzes Standardprogramm von 4 x 2 Stunden findet derzeit in Arztpraxen beim Typ2 Diabetes das ambulante Schulungsprogramm nach Berger weite Verbreitung, das deutliche Effekte bezüglich biomedizinischer Parameter wie Gewicht und Triglyceride im 1-Jahres-Verlauf zeigte (Kronsbein P et.al. 1988). Um eine dauerhafte Motivation zur Veränderung von gesundheitsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen aufzubauen, sollte die Patientenschulung zentraler Bestandteil einer ganzheitlich orientierten Therapie sein. In Rehabilitationskliniken mit meist multiprofessionellen Teams ist solch ein integrierender Behandlungsansatz unter Berücksichtigung von sozialen, emotionalen und verhaltensmedizinischen Faktoren gut zu verwirklichen. 80 5) Raucherentwöhnungsprogramm: Zigarettenkonsum ist für Menschen mit und ohne Diabetes einer der Hauptrisikofaktoren für arteriosklerotische Erkrankungen, die Gesamtmortalität erhöht sich um den Faktor 1,7 (Chaturvedi N, Stevens L, Fuller JH 1997). Die Rauchgewohnheiten von Personen mit und ohne Diabetes unterscheiden sich nicht signifikant (Chaturvedi N et al. 1998), es findet sich jedoch eine höhere Prävalenz in den unteren Gesellschaftsschichten und eine positive Korrelation mit psychischem Stress (Ford ES et.al. 1994; Spangler JG, Konen JC 1993). Bei Ex-Rauchern mit Diabetes wird die Mortalität durch Senkung der makrovaskulären Komplikationen signifikant reduziert. Ein frühzeitiger Beginn der Raucherentwöhnung ist deshalb absolut notwendig (Muhlhauser I 1990). Leider wird meist eine Raucherentwöhnung erst dann empfohlen und durchgeführt, wenn bereits raucherbedingte Schädigungen eingetreten sind. Nach einem Review der Cochrane Library ist bei der Raucherentwöhnung die Beratung und Unterstützung durch Ärzte oder anderes medizinisches Personal (z.B. Psychologen, geschultes Pflegepersonal) sehr hilfreich. Eine Nikotinersatztherapie, in Verbindung mit persönlicher Beratung, erhöht die Erfolgsrate auf das 1,5 –2fache, während aversive Methoden keine Vorteile erbrachten. Bei den verhaltensmedizinischen und anderen psychologischen Interventionen zeigten sowohl individuelle Therapien wie Gruppenbehandlungen gute Erfolge (Lancaster T et.al. 2000). Auch für Patienten, die zunächst unentschlossen oder ablehnend einer Raucherentwöhnung gegenüberstehen, stehen leitliniengestützte Vorgehensweisen zur Verfügung (Anonym. 2000c). 6) Psychologische Therapie: Beim Typ2 Diabetes spielen neben den biomedizinischen auch psychologische und verhaltensmedizinische Aspekte eine erhebliche Rolle. Eine abdominell betonte Adipositas, wie sie beim metabolischen Syndrom und Typ2 Diabetes häufig zu finden ist, wird in vielen Fällen von einer Depression oder depressiver Verstimmung begleitet. Als gemeinsame pathogenetische Ursache vermutet man eine Aktivierung hypothalamischer Zentren aufgrund metabolischer Signale (Leptin), was einerseits 81 zu der depressiven Störung und zweitens, über eine Stimulierung des sympathischen Nervensystems, zu den Veränderungen im Stoffwechsel führt. Die Behandlung einer den Diabetes begleitenden depressiven Störung vermag die Insulinresistenz zu verbessern (Stewart TD, Atlas SA 2000). Die Besserung der depressiven Symptomatik ist zusätzlich eine wichtige Voraussetzung für eine wirksame Diabetesbehandlung, indem sie eine positive Einstellung und eine aktive Mitarbeit des Patienten bei den einzelnen therapeutischen Interventionen ermöglicht (Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo JE 2000). Chronischer Stress gilt als Risikofaktor des Metabolischen Syndroms und kardiovaskulärer Erkrankungen (Chrousos GP, Gold PW 1998). Eine psychologische Intervention bei pathologischem Stress kann deshalb als Maßnahme der sekundären und tertiären Prävention wirksam werden (Bradley C 1994). Neben Entspannungsübungen zum kurzfristigen Stressabbau (z.B. muskulär mittels Progressiver Muskelrelaxation nach Jacobsen, vegetativ mittels Autogenem Training) sind für eine langfristige Wirkung verschiedene verhaltensmedizinisch orientierte StressTrainingsprogramme etabliert. Diese erwiesen sich in Bezug auf das Coping (Krankheitsbewältigung) bei verschiedenen chronischen Erkrankungen als sehr hilfreich für einen positiven Umgang mit den Erfordernissen der Erkrankung (Hampel P, Petermann F 1997). 7) Arbeitsplatzberatung: Eine wichtige Aufgabe jeder Rehamaßnahme besteht in der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Patienten und einer Beratung bezüglich der individuellen beruflichen Möglichkeiten. Unter Einbeziehung eines Reha-Fachberaters können anhand der medizinischen Befunde und der Angaben des Patienten in einem interdisziplinären Team Maßnahmen zur beruflichenn Anpassung, zur Umsetzung oder beruflichen Wiedereingliederung eingeleitet werden. Eine Einbeziehung des betreuenden Hausarztes und Betriebsarztes sollte hierbei angestrebt werden, denn der längerfristige Erfolg ist von einer guten Kooperation zwischen Reha-Team und der weiteren Nachsorge abhängig (VDR Frankfurt 1996). 82 Trotz des oft geringen Problembewusstseins ist eine kompetente sozial-und arbeitsmedizinische Beratung ist bei Diabetes-Patienten häufig notwendig. Wichtige Punkte sind die Pausenregelung, um regelmäßige, kleinere Mahlzeiten zu ermöglichen, gegebenenfalls auch mit der Möglichkeit zur Blutglukosebestimmung/ Insulininjektion. Individueller Beratungsbedarf besteht weiterhin bei Schichtarbeit und bei anstehenden Arbeitsplatzumsetzungen wegen eingetretener Komplikationen (z.B. Sehstörungen bei feinmechanischen Arbeiten) oder wegen gesetzlicher Regelungen (z.B. bei Fahr-und Steuertätigkeiten, Arbeit in gefährlichen Situationen). 8) Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining: Hypoglykämien stellen bei der Therapie des Typ2 Diabetes eine seltene, jedoch unter Umständen lebensbedrohliche Komplikation dar. Deshalb ist es wichtig, dass gefährdete Patienten die Warnsymptome einer drohenden Hypoglykämie kennen und rechtzeitig wahrnehmen. Dies kann durch ein standardisiertes Blutglukose-Wahrnehmungs-Training (BGAT) erfolgreich erlernt werden (Peters A et.al. 2000). III: Auswertung des Reha-Scores: Die Anzahl der vorliegenden Störungen (Reha-Indikatoren) wird bei jedem Patienten mit Hilfe der oben genannten Untersuchungen erfasst und bezüglich pathologischer Parameter ausgewertet (mittels SPSS 9.0 Statistik Programm, SPSS Inc., Chicago). Entsprechend des Algorithmus` (s. tabellarische Übersicht 2, Anlage) ergibt sich daraus die Art und Anzahl der erforderlichen Interventionen. Eine sichere Indikation für eine stationäre Rehabilitation liegt nach unserer Meinung vor, wenn ein Patient 6 oder mehr unterschiedliche Interventionen (bzw. 6 oder mehr verschiedene Therapeuten) benötigt: Die Durchführung von 6 verschiedenen Therapien in engem zeitlichen Rahmen ist für Versicherte ambulant, neben Arbeit und häuslichen Anforderungen, nicht mehr zu bewältigen. Da auch 5 Therapie-Indikationen unter Umständen eine erhebliche zeitliche Belastung darstellen, leg- 83 ten wir bei 5 indizierten Therapien einen relativen Bedarf für eine stationäre Rehabilitation fest. Anhand der tatsächlichen Beanspruchung des Patienten (z.B. Doppelbelastung bei Frauen mit Familie, häusliche Pflege von Angehörigen) ist zu entscheiden, ob eine zusätzliche zeitliche Belastung durch multiple Therapien realisierbar erscheint. Muss dies verneint werden, wäre die relative RehaIndikation aufgrund der Kontextfaktoren als tatsächliche Indikation für eine stationäre Rehabilitation zu begründen. Kontraindikationen für eine stationäre Rehabilitation: Als Kontraindikationen für eine aktuelle Rehabilitation, die im Sinne des §12 und §13 SBG VI einen Leistungsausschluss bewirken, sind vor allem akutmedizinische Behandlungsindikationen zu nennen. Hierunter fallen z.B. akute Blutglukose-Entgleisungen oder krisenhafte Blutdruckanstiege, die einen akuten Handlungsbedarf mit einer sofortigen medikamentösen Neu-Einstellung erforderlich machen. Ebenso bedürfen pathologische oder unklare Augen-, EKG- oder andere auffällige Untersuchungsbefunde zunächst einer raschen fachärztlichen Abklärung und gegebenenfalls Intervention, ehe die Indikation zu einer stationären Rehabilitation gegeben ist. Auch der Verdacht auf eine bestehende Alkoholkrankheit stellt eine Kontraindikation dar, da die erforderliche Kooperation des Patienten mit florider Alkoholabhängigkeit nicht zu erwarten ist (Anonym. 1991). Bestätigt sich dieser Verdacht, ist zunächst die Therapie der Sucht mit einer Entzugsbehandlung als vorrangig zu betrachten. Den Cut-off für den Verdacht einer bestehenden Alkoholproblematik legten wir bei einem mittleren täglichen Konsum von >15 g Alkohol (für Frauen) bzw. >30g (für Männer) fest. Diese Menge berechneten wir aus den Eigenangaben der Patienten in einem Selbstausfüllfragebogen („an wieviel Tagen pro Monat trinken Sie ein alkoholisches Getränk?“. „Wieviel der folgenden Getränke nehmen Sie jeweils an einem dieser Tage zu sich: ? Bier, ? Wein/Sekt, ? Likör, ? Schnaps ?“). Zusätzlich erfolgte die Bestimmung der γ-GT und des MCV`s (mittleres Zellvolumen der Erythrozyten) als mögliche Marker eines erhöhten Alkoholkonsums. 84 Schließlich ist eine medizinische Rehabilitation grundsätzlich (aber nicht zwingend) ausgeschlossen, wenn innerhalb der letzten 4 Jahre bereits eine solche solche Leistung vom Rentenversicherungsträger gewährt wurde. Illustrierende Daten aus der vorliegenden Studie: Anhand der Ergebnisse aus unserer Studie soll die Handhabung des vorgestellten Reha-Scores als Screening-Instrument zur Objektivierung des Rehabilitationsbedarfs bei Diabetes mellitus veranschaulicht werden. Die Untersuchungsbefunde wurden nach dem oben beschrieben Algorithmus erhobenen und ausgewertet. In der Tabelle 23 ist zu sehen, wieviel Prozent der Patienten die jeweiligen Störungen (Reha-Indikatoren) aufwiesen. Typ2 Diabetes Reha-Indikatoren n=191 Bewegungsmangel 17,8 % Erhöhter BMI 77,0 % Erhöhter Blutdruck 68,6 % Erhöhte Blutfette 95,3 % Erhöhter HbA1c-Wert 77,5 % Unzureichendes Diabeteswissen 54,5 % Raucher, aktuell 36,1 % Depressivität 12,0 % Pathologischer Stress 24,6 % Pathologisches Essverhalten 18,3 % Arbeitsplatzprobleme 23,6 % Hypoglykämie mit Fremdhilfe 1,6 % Tabelle 23: Häufigkeit von krankheitsspezifischen Störungen mit Interventionsbedarf (RehaIndikatoren) bei 191 Patienten mit Typ2 Diabetes mellitus. 85 Diese Reha-Indikatoren wurden, wie in der Grafik 7 (s. Anlage) dargestellt, den benötigten Therapien zugeordnet. Tabelle 24 zeigt, bei wieviel Prozent der untersuchten Patienten ein Bedarf für die einzelnen Interventionen bestand. Weiterhin ist zu sehen, dass 21% der Patienten mehr als 6 verschiedene Interventionen benötigen. Dies ist der Cut-off, den wir für eine sichere Reha-Indikation festlegten. Hiervon abgezogen werden noch Personen mit bestehenden Kontraindikationen (z.B. aktueller Interventionsbedarf bei akuten kardialen Komplikationen oder entgleister Stoffwechsel oder Verdacht einer bestehenden Alkoholkrankheit) sowie Versicherte, die bereits an einer stationären Rehabilitation in den vergangenen 4 Jahren teilgenommen hatten (relative Kontraindikation). Art der Intervention Patienten mit Typ2 Diabetes (n=191) Sporttherapie 82,7 % Diätberatung 99,5 % Ärztliche Stufentherapie 99,0 % Schulung 99,5 % Raucherentwöhnung 36,1 % Psychologische Therapie 39,8 % Arbeitsplatzberatung 23,6 % Hypoglykämietraining 1,6 % ≥ 6 Therapie-Indikationen 20,9 % ≥ 6 Therapie-Indikationen und keine Kontraindikationen 15,2 % Tabelle 24: Indizierte Interventionen bei Typ2 Diabetes mellitus (n=191). Die Tabelle zeigt, bei wieviel Prozent der Patienten jeweils eine Indikation für die entsprechenden Therapien bestand. Ab 6 oder mehr benötigter Therapien legten wir einen sicheren Bedarf für eine stationäre Rehabilitation fest. Dies traf für 21% der untersuchten Personen zu. Nach Abzug der Patienten mit Kontraindikationen ergab sich ein aktueller Rehabedarf bei 15% der Patienten mit Typ2 Diabetes. 86 Somit wiesen aus unserem Kollektiv 15% der Patienten mit Typ2 Diabetes (29 von 191) einen sicheren, aktuellen Bedarf für eine multimodale stationäre Rehabilitation auf. In der Abbildung 12 ist graphisch veranschaulicht, wieviel Prozent der Patienten 3,4,5,6 oder 7 Therapie-Interventionen benötigen. 45 % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Anzahl der Interventionen Abbildung 12: Häufigkeit der indizierten Therapien bei Patienten mit Typ2 Diabetes (n=191). Das Histogramm veranschaulicht, in wieviel Prozent der Fälle eine Indikation für 3, 4, 5, 6 oder 7 verschiedene Therapien besteht . 87 Diskussion: Mit dem Reha-Score für Diabetes mellitus stellen wir ein Assessmentinstrument vor, mit dem der Rehabilitationsbedarf bei dieser Erkrankung im Sinne eines Screenings objektiv und reproduzierbar erfasst werden kann. Es handelt sich um einen Index, der neben diabetesrelevanten biomedizinischen Parametern auch psychosoziale Faktoren berücksichtigt. Entsprechend den Empfehlungen der Reha-Kommission des VDR kann mittels solcher Verfahren ein Beitrag zur Standardisierung in der Rehabilitationssteuerung geleistet werden (Anonym. 1991). Für die Erstellung eines bedarfsgerechten Rehabilitationskonzepts liefert unser Reha-Score bereits wichtige Vorinformationen, indem die Anzahl und Art der indizierten Interventionen genannt werden, sodass eine problemorientierte Therapie geplant werden kann. Die neuere internationale Reha-Forschung zeigte sehr gute Erfolge in den verschiedensten Indikationsgebieten, wenn gut organisierte, multidisziplinäre Teams problemzentriert zusammenarbeiten (Wade DT, de Jong BA 2000). Unter dem Einfluss der ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) hat sich das Rehabilitationskonzept von einem rein biomedizinisch geprägten Krankheitsmodell zu einem ganzheitlichen Konzept mit Berücksichtigung von psychologischen und soziokulturellen Aspekten gewandelt. Diese neue Denkweise findet sich auch in der modernen Rehabilitationsmedizin wieder. Danach besteht das Ziel der medizinischen Rehabilitation darin, hinsichtlich des Primärprozesses (hier: Diabetes) Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen zu minimieren und die Entwicklung von Sekundärprozessen zu verhindern. Auf diese Weise soll die Eingliederung in Beruf, Familie und Gesellschaft gesichert bzw. wiederhergestellt werden (VDR Frankfurt1996). Bei der Gewährung einer Rehamaßnahme wird die Erwartung einer positive Reha-Prognose gefordert. In der Literatur fehlen jedoch für viele Erkrankungen Daten aus kontrollierten Studien. Für den Typ2 Diabetes konnte in einer neueren dänischen Studie der Vorteil einer intensiven, standardisierten multifaktoriellen Therapie gezeigt werden (Gaede P et al. 1999). Gegenüber der hausärztlichen Standardtherapie zeigte diese intensivierte Therapie mit multimodaler medikamentöser Therapie und Maßnahmen zur Verhaltensmodifikation (wie Sportprogramm, Diätberatung, Raucherentwöhnung) deutliche 88 Effekte nach 3,8 Jahren mit einer signifikanten Verzögerung bei der Progression von diabetischen Folgekrankheiten wie Nephropathie, Retinopathie und Neuropathie. Der Cut-off für eine Indikation zur stationären Rehabilitation liegt bei unserem Reha-Score bei einer Indikation zu 6 oder mehr heterogenen Interventionen. In Anbetracht der multidimensionalen Störung beim Typ2 Diabetes ist es vorteilhaft, die indizierten Therapie-Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zusammenhang, möglichst en bloc, durchzuführen und so eine synergistische Wirkung zu erzielen. Dies ist, neben den täglichen Anforderungen durch Beruf, Familie und soziales Umfeld, schon bei 4-5 therapeutischen Interventionen schwierig. Sind jedoch 6 oder 7 verschiedene Therapien notwendig (z.B. Schulung, Ernährungsberatung, ärztliche und psychologische Therapie, Raucherentwöhnung, Bewegungstherapie), so ist dies im Alltag nicht mehr in einem engen zeitlichen Rahmen zu bewältigen. Während in den Diabetologischen Schwerpunktpraxen vor allem die Patienten mit Typ1 Diabetes und Typ2 Diabetiker unter intensivierter Insulintherapie behandelt werden, erfolgt die Behandlung der meisten Patienten mit Typ2 Diabetes in Hausarztpraxen. Dort haben ganzheitliche und verhaltensmedizinische Therapieansätze noch kaum Niederschlag gefunden, so dass häufig nach einiger Zeit keine Therapieerfolge mehr eintreten und Hausarzt und Patient resigniert eine schlechte Stoffwechseleinstellung hinnehmen. Eine Verzahnung von ambulanter und rehabilitativer Intervention ist beim Diabetes, wie bei vielen chronischen Erkrankungen, als sich ergänzende Maßnahmen zu betrachten. Ambulante Vorleistungen (wie Ernährungsumstellung, Änderung der Lebensgewohnheiten, Vermittlung eines krankheitsbezogenen Grundwissens) werden zudem als Voraussetzung für die Gewährung von Reha-Leistungen gefordert. Um den Effekt der Rehabilitation zu erhalten, ist wiederum eine Kooperation zwischen Rehabilitationsklinik und ambulanter Weiterbetreuung notwendig. Denkbar wären beispielsweise Diabetikergruppen ähnlich den bereits vielerorts etablierten Koronarsportgruppen, die sich regelmäßig treffen und gegenseitig zur Weiterführung von Bewegungsprogrammen und Verhaltensmodifikationen motivieren. 89 Eine Besonderheit unserer Studie ist, dass es sich ausschließlich um LVA-Versicherte handelte. Es ist anzunehmen, dass gerade bei den Arbeitern in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg des Diabetes und seinen assoziierten Störungen zu rechnen ist. In den gewerblichen Berufen fand in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel der Tätigkeitsprofile statt: der Anteil der körperlich arbeitenden Menschen nimmt durch die zunehmende Automatisierung und Technisierung der Arbeitsplätze ständig ab. Viele Versicherte führen nur noch körperlich leichte oder sitzende Tätigkeiten durch, während die geistigen und psychischen Anforderungen (durch Kontroll-und Überwachungstätigkeiten) steigen. Andererseits ist das Gesundheitsbewusstsein in den unteren sozialen Schichten geringer ausgeprägt ist als in den höheren Schichten, was sich zum Beispiel an einem höheren Anteil an Rauchern, höheren Blutdruckwerten und einer höheren kardiovaskulären Morbidität zeigt (Chaturvedi N et al. 1998). Gerade in dieser Bevölkerungsgruppe ist deshalb ein höherer Bedarf an multifaktoriellen, verhaltensmedizinisch orientierten Therapien zu erwarten. Zusammenfassend steht mit dem Reha-Score für Diabetes mellitus jetzt ein Screening-Instrument zur Objektivierung des Rehabilitationsbedarfs zur Verfügung, das in der Praxis erprobt und ggf. weiter modifiziert werden kann. Er kann auch Grundlage sein für künftige kontrollierte Studien zur Effektivitätssicherung und Qualitätssicherung von Reha-Maßnahmen bei Diabetes mellitus. 90 Zusammenfassung: Der Diabetes mellitus gehört zu den modernen Zivilisationserkrankungen mit zunehmener Inzidenz und hohen volkswirtschaftlichen Folgekosten. Primär- und sekundärpräventive Maßnahmen haben, vor allem bei der häufigsten Form, dem Typ2 Diabetes (sog. Altersdiabetes), einen hohen Stellenwert. Für eine intensive Form der Prävention und Therapie scheint eine stationäre Rehabilitation wegen der zeitlich sehr kompakten und dadurch synergistischen Wirkung sehr geeignet. Ein Ziel dieser epidemiologischen Studie war, bei LVA-Versicherten in der Altersgruppe von 40-60 Jahren die Prävalenz des Diabetes mellitus und den prävalenten Bedarf für eine stationäre Rehabilitation zu ermitteln. Durch Mitarbeiter des Projekts A4 im NVRF wurden im Raum Lübeck 12429 postalischen Fragebögen an erwerbstätige LVA-Versicherte versandt. Der Rücklauf gültiger Fragebögen lag bei 56,2%. Durch Selbstangabe im Fragebogen und telefonische Bestätigung der Diagnose durch Mitarbeiter dieses Projekts wurden 5,0% Patienten mit Diabetes mellitus identifiziert. Unter den älteren Teilnehmern (ab 55. Lebensjahr) lag die Diabetesprävalenz erwartungsgemäß deutlich höher als bei den 40-54-Jährigen (7,9% vs. 4,6%). Die weiblichen Versicherten wiesen eine geringere Prävalenz des Diabetes auf als die männlichen Teilnehmer (3,9% versus 6,0%). Von den 346 als Diabetespatienten identifizierten Versicherten kamen 62,1% zu der angebotenen freiwilligen Untersuchung in die Poliklinik der Medizinischen Klinik I des Universitätsklinikums Lübeck. Die Non-Partizipations-Analyse zeigte keinen Bias bezüglich Alter, Geschlecht, allgemeinem Gesundheitszustand, Begleiterkrankungen und Erwerbstätigkeit. Insgesamt nahmen 216 Patienten an unserem Untersuchungsprogramm teil: 17 (7,9%) mit einem Typ1 Diabetes (sog. „jugendlicher“ Diabetes), 191 (88,4 %) mit einem Typ2 Diabetes (sog. „Altersdiabetes“) sowie 8 Patienten (3,7%) mit einem Insulinmangel aufgrund einer Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung (sog. pankreopriver Diabetes). Die Mehrzahl (77%) der Patienten mitTyp2 Diabetes waren deutlich übergewichtig. Etwa ein Viertel dieser Patienten (26,7%) behandelten ihren Diabetes ohne Medikamente, 50,8% waren medikamentös mit Tabletten eingestellt, 22,5% mit Insulin (davon 11,5% nur Insulin, 11% Insulin plus 91 Tabletten). Der mittlere HbA1c Wert (glykiertes Hämoglobin A1c) lag für die Patienten mit Typ1 Diabetes bei 8,1%, bei Typ2 Diabetes bei 7,7%. Eine Behandlungsindikation zur Verbesserung der Blutglukose-Einstellung ergab sich entsprechend den Guidelines der European Diabetes Policy Group für 70,6% der Teilnehmer Typ1 und 77,5% der Personen mit Typ2 Diabetes. Die Blutdruckkontrollen ergaben unabhängig von der antihypertensiven Medikation bei 41,2% der Patienten mit Typ1 Diabetes und 68,6% bei Typ2 erhöhte Werte und somit einen Interventionsbedarf zur Verbesserung der Blutdruckeinstellung. Eine behandlungsbedürftige Erhöhung der Blutfette fand sich bei 88% der Patienten mit Typ1 und bei 95% der Patienten mit Typ2 Diabetes. Zur Erfassung diabetesspezifischer Folgeerkrankungen untersuchten wir die Albuminausscheidung im Urin und den Augenhintergrund mittels einer Funduskamera. Zeichen einer beginnenden diabetischen Nierenschädigung (Mikroalbuminurie) fanden sich bei 17,6% der Personen mit Typ1 Diabetes und 22% mit Typ2 Diabetes. Die Schwere der Augenhintergrundveränderungen zeigte eine deutliche Abhängigkeit von der bisherigen Dauer des Diabetes. Bei den Patienten mit Typ2 Diabetes wiesen 78% einen Normalbefund auf, 17,8% hatten diskrete bis leichte Veränderungen, 1,3% zeigten Veränderungen mit einem aktuellen augenärztlichen Interventionsbedarf. Patienten mit Typ1 Diabetes wiesen häufiger diabetesbedingte Augenhintergrundveränderungen auf, und es waren vermehrt höhergradige Veränderungen zu sehen. Bei den Untersuchungen wurden folgende psychologische Fragebögen eingesetzt: Fragen zum Essverhalten (FEV), zum chronischen psychischen Stress (TICS) und Depressivität (CESD), sowie Fragen zur allgemeinen (SF-36) und diabetesbezogenen Lebensqualität (LQD). Eine wichtige Voraussetzung zum Selbstmanagement bei Diabetes mellitus ist ein ausreichendes Wissen über die Erkrankung. Dies wurde mittels Wissenstests für Diabetespatienten (für Patienten mit Typ2 Diabetes ohne Insulintherapie und für Patienten mit Insulin) getestet. Es zeigte sich, dass Patienten mit Typ1 Diabetes ein signifikant höheres Wissen zum Diabetes aufwiesen als Typ2-Patienten. Unter den Teilnehmern mit Typ2 Diabetes schnitten Personen unter Insulintherapie sowie nach Schulungsmaßnahmen signifikant signifikant besser ab. 92 Feststellung des Bedarfs für eine stationäre Rehabilitation: Trotz der drastischen Sparmaßnahmen im Rehabilitationssektor besteht weiterhin die Notwendigkeit eines bedarfsgerechten Rehabilitationszugangs für die Versicherten. Mit dem Reha-Score stellen wir ein Screening-Instrument zur objektivierbaren Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs bei Patienten mit Typ2 Diabetes vor. Bei der multifaktoriellen Genese des Typ2 Diabetes ist ein multidisziplinäres, präventives Therapiekonzept in einer stationären Rehabilitation eine Maßnahme, die erfolgversprechender erscheint als die alleinige Korrektur einzelner Stoffwechselparameter (wie z.B. des HbA1c-Wertes). Zur Erfassung des Bedarfs für eine solche multimodale Therapie fließen in den Reha-Score sogenannte Reha-Indikatoren ein: dies sind Risikofaktoren wie Rauchen, chronischer psychischer Stress, Arbeitsplatzprobleme, körperliche Inaktivität und pathologisches Essverhalten; Stoffwechselparameter wie HbA1c und Blutfette; Kofaktoren des Diabetes wie arterielle Hypertonie und Depresssion sowie als akute Komplikation Hypoglykämien. Erhöhte bzw. pathologische Werte für diese RehaIndikatoren implizieren nach einem Algorithmus, dem evidenz-basierte Kriterien zugrunde liegen, die Indikation für eine oder mehrere der folgenden 8 therapeutischen Interventionen: Sporttherapie, Diätberatung, ärztliche Stufentherapie, Schulung, Raucherentwöhnungsprogramm, psychologische Therapie, Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining, Arbeitsplatzberatung. Benötigt ein Patient 6 oder mehr dieser Therapien, so ist nach dem Reha-Score ein sicherer Bedarf für eine stationäre Rehabilitation gegeben. Unter den 191 Patienten mit Typ2 Diabetes in dieser Studie erfüllten 15% diese Kriterien für einen sicheren stationären Rehabilitationsbedarf. 93 Wir danken den Mitarbeiterinnen R. Klockgether und C. Bluhm, die für den reibungslosen Ablauf der Studie eine unverzichtbare Hilfe waren. Mit den Ärztinnen im Praktikum Eva Deininger, Dorle Dantz und Kerstin Oltmanns hatten wir in allen Phasen des Projekts engagierte und freundliche Mitarbeiterinnen. Bei J. Beversdorf bedanken wir uns für die Unterstützung bei den Untersuchungen und der Dateneingabe. Anlagen: Literaturverzeichnis Tabellarische Übersicht 1 und 2 Grafiken 1-6 94 Literatur Anonym. Reliability and validity of a diabetes quality-of-life measure for the diabetes control and complications trial (DCCT). The DCCT Research Group. Diabetes Care 1988; 11: 725-732 Anonym. Diabetes care and research in Europe: the Saint Vincent declaration. Diabet.Med. 1990a; 7: 360 ff Anonym. UK Prospective Diabetes Study 6. Complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients and their association with different clinical and biochemical risk factors. Diabetes Res. 1990c; 13: 1-11 Anonym. UK Prospective Diabetes Study 7: response of fasting plasma glucose to diet therapy in newly presenting type II diabetic patients, UKPDS Group. Metabolism 1990b; 39: 905-912 Anonym. Bericht der Reha-Kommission des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger: Empfehlungen zur Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation in der gesetzlichen Rentenversicherung. 1991 Anonym. Consensus Statement: Detection and Management for Lipid Disorders in Diabetes. Diabetes Care 1996; 19: S96-S102 Anonym. Diabetes mellitus and exercise. American Diabetes Association. Diabetes Care 1997b; 20: 1908-1912 Anonym. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997a; 20: 1183-1197 Anonym. A Desktop Guide to Type 1 (Insulin-dependent) Diabetes Mellitus: European Diabetes Policy Group 1998, International Diabetes Federation, European Region. Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes 1998b; 106: 240-269 Anonym. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group [see comments] [published erratum appears in Lancet 1998 Nov 7;352(9139):1557]. Lancet 1998c; 352: 854-865 Anonym. Gesundheitsbericht für Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 1998a Anonym. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998d; 317: 703-713 Anonym. Die Prävalenz des Diabetes mellitus wird in Deutschland unterschätzt- eine bundesweite epidemiologische Studie auf der Basis einer HbA1c-Analyse. Diabetes und Stoffwechsel 1999; 8: 189-200 Anonym. Clinical Advisory: Treating Hypertension in the Patient with Type 2 Diabetes. National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) 2000a 95 Anonym. Supplement 1. American Diabetes Association: clinical practice recommendations 2000. Diabetes Care 2000b; 23 Suppl 1: S1-116 Anonym. Treating Tobacco Use and Dependance. Clinical Practice Guideline. 2000c Alberti G. A desktop guide to Type 2 diabetes mellitus. European Diabetes Policy Group 1998-1999 International Diabetes Federation European Region. Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes 1999; 107: 390-420 American Diabetes Association. Nutrition Recommendations and Principles for People With Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2000; 21: S32-S35 Berger M, Bockholt M et al. Das weiß ich über meinen Typ 2 Diabetes - Wissenstest für Diabetiker. 1984 Bergmann KE, Mensink GB. Körpermaße und Übergewicht. Gesundheitswesen 1999; 61 Spec No: S115-S120 Bjorntorp P. Visceral fat accumulation: the missing link between psychosocial factors and cardiovascular disease? J.Intern.Med. 1991; 230: 195-201 Bormann C, Hoeltz J et al. Subjektive Morbidität. 1990 Bradley C. Contributions of psychology to diabetes management. Br.J.Clin.Psychol. 1994; 33: 11-21 Bullinger M, Kirchberger I. SF-36: Fragebogen zum Gesundheitszustand. 1998 Chaturvedi N, Jarrett J et al. Socioeconomic gradient in morbidity and mortality in people with diabetes: cohort study findings from the Whitehall Study and the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. BMJ 1998; 316: 100-105 Chaturvedi N, Stevens L, Fuller JH. Which features of smoking determine mortality risk in former cigarette smokers with diabetes? The World Health Organization Multinational Study Group. Diabetes Care 1997; 20: 1266-1272 Chrousos GP, Gold PW. A healthy body in a healthy mind--and vice versa--the damaging power of "uncontrollable" stress. J.Clin.Endocrinol.Metab 1998; 83: 1842-1845 Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo JE. Depression and diabetes: impact of depressive symptoms on adherence, function, and costs. Arch.Intern.Med. 2000; 160: 32783285 Dwyer J. Policy and healthy weight. Am.J.Clin.Nutr. 1996; 63: 415S-418S Eaton WW, Armenian H et al. Depression and risk for onset of type II diabetes. A prospective population-based study. Diabetes Care 1996; 19: 1097-1102 Expert Panel on Detection EaToHBC. Second report of the Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. National Cholesterol Education Program. 1993; NIH Publication No. 93-3096 Ferris FL, III, Davis MD, Aiello LM. Treatment of diabetic retinopathy. N.Engl.J.Med. 1999; 341: 667-678 96 Ford ES, Malarcher AM et al. Diabetes mellitus and cigarette smoking. Findings from the 1989 National Health Interview Survey. Diabetes Care 1994; 17: 688-692 Gaede P, Vedel P et al. Intensified multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: the Steno type 2 randomised study. Lancet 1999; 353: 617-622 Gerbershagen H-U, Kohlmann T. CESD (Center for Epidemiological Studies Depression Scale). 1998 Graf von der Schulenburg J, Claes C et al. Die deutsche Version des EuroQolFragebogens. Z.f.Gesundheitswesen 1998; 11: 3-20 Gray A, Raikou M et al. Cost effectiveness of an intensive blood glucose control policy in patients with type 2 diabetes: economic analysis alongside randomised controlled trial (UKPDS 41). United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. BMJ 2000; 320: 1373-1378 Grundy SM, Benjamin IJ et al. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999; 100: 1134-1146 Haffner SM, Lehto S et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N.Engl.J.Med. 1998; 339: 229-234 Hampel P, Petermann F. Zur Bedeutung der Stresskonzepte. 1997; 2: 53-99 Hauner H. Verbreitung des Diabetes mellitus in Deutschland. Dtsch.Med.Wochenschr. 1998; 123: 777-782 Hauner H, von Ferber L, Koster I. Schätzung der Diabeteshäufigkeit in der Bundesrepublik Deutschland anhand von Krankenkassendaten. Dtsch.Med.Wochenschr. 1992; 117: 645-650 Haupt E, Herrmann R et al. The KID Study. III: Impact of inpatient rehabilitation on the metabolic control of type I and type II diabetics--a one-year follow-up. Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes 1996; 104: 420-430 Hemingway H, Stafford M et al. Is the SF-36 a valid measure of change in population health? Results from the Whitehall II Study. BMJ 1997; 315: 1273-1279 Hermanns N, Kulzer B. Entwicklung und Evaluation eines Wissenstests für nichtinsulinpflichtige Typ IIb-Diabetiker. Diabetes und Stoffwechsel 1996; 5: 183-190 Hirsch A. Diabetes und Lebensqualität. 1996; 185-222 Hirsch A, Bartholomae C, Vollmer T. General and disease specific quality of life measures in people with diabetes. 1997 Kannel WB, McGee DL. Diabetes and cardiovascular disease. The Framingham study. JAMA 1979; 241: 2035-2038 Kaplan S, Sullivan L. Interport AHCPR Patient Outcome Research Team. 1992 97 Klein R, Klein BE et al. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. Arch.Ophthalmol. 1984; 102: 527-532 Kronsbein P, Jorgens V et al. Evaluation of a structured treatment and teaching programme on non- insulin-dependent diabetes. Lancet 1988; 2: 1407-1411 Kuczmarski RJ, Flegal KM et al. Increasing prevalence of overweight among US adults. The National Health and Nutrition Examination Surveys, 1960 to 1991. JAMA 1994; 272: 205-211 Lancaster T, Stead L et al. Effectiveness of interventions to help people stop smoking: findings from the Cochrane Library. BMJ 2000; 321: 355-358 Licciardone JC, Kotsanos JG et al. Resource utilization and work or school loss reported by patients with diabetes: experience in diabetes training programs. Am.J.Manag.Care 1997; 3: 777-782 Lustman PJ, Griffith LS et al. Depression in adults with diabetes. Diabetes Care 1992; 15: 1631-1639 McEwen BS. Protective and damaging effects of stress mediators. N.Engl.J.Med. 1998; 338: 171-179 Muhlhauser I. Smoking and diabetes. Diabet.Med. 1990; 7: 10-15 Muhlhauser I, Sulzer M, Berger M. Quality assessment of diabetes care according to the recommendations of the St. Vincent Declaration: a population-based study in a rural area of Austria. Diabetologia 1992; 35: 429-435 Nathan DM. Long-term complications of diabetes mellitus. N.Engl.J.Med. 1993; 328: 16761685 National Insitutes of Health. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure. 1997; NIH Report 98-4080 NHLBI Obesity Education Initiative. Clinical guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in adults. 1998 Peters A, Pohlmann B et al. Das Blutglukose Wahrnehmungstraining. Diabetologie Informationen DGG 2000; 21: 130-134 Potthoff P. Entwicklung von Indikatoren zur Messung subjektiver Gesundheit. 1987; GSFBericht 540 / 82, München Pudel V, Westenhöfer J. Fragebogen zum Essverhalten (FEV). 1989; Radoschewski M, Bellach BM. Der SF-36 im Bundes-Gesundheitssurvey - Möglichkeiten und Anforderungen der Nutzung auf der Bevölkerungsebene. Gesundheitswesen 1999; 61 Spec No: S191-S199 Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 1595-1607 98 Rosmond R, Dallman MF, Bjorntorp P. Stress-related cortisol secretion in men: relationships with abdominal obesity and endocrine, metabolic and hemodynamic abnormalities. J.Clin.Endocrinol.Metab 1998; 83: 1853-1859 Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA. Presence of diabetes related complication at the time of NIDDM diagnosis: an important prognostic factor. Eur.J.Epidemiol. 1998; 14: 439-445 Schultz P, Schlotz W. Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress (TICS): Skalenkonstruktion, teststatistische Überprüfung und Validierung der Skala Arbeitsüberlastung. Diagnostica 1999; 45: 8-19 Schwartz MW, Woods SC et al. Central nervous system control of food intake. Nature 2000; 404: 661-671 Spangler JG, Konen JC. Predicting exercise and smoking behaviors in diabetic and hypertensive patients. Age, race, sex, and psychological factors. Arch.Fam.Med. 1993; 2: 149-155 Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. Lancet 1999; 354: 1435-1439 Steinhoff J, Einecke G, Niederstadt C, de Groot K, Fricke L, Machnik H et al. Renal graft rejection or urinary tract infection? The value of myeloperoxidase, C-reactive protein, and alpha2-macroglobulin in the urine. Transplantation 1997; 64: 443-447 Stewart TD, Atlas SA. Syndrome X, depression, and chaos: relevance to medical practice. Conn.Med. 2000; 64: 343-345 Stratton IM, Adler AI et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 2000; 321: 405-412 Thefeld W. Bundes-Gesundheitssurvey: Response, Zusammensetzung der Teilnehmer und Non-Responder-Analyse. Gesundheitswesen 1999a; 61 Spec No: S85-S89 Thefeld W. Prävalenz des Diabetes mellitus in der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands. Gesundheitswesen 1999b; 61 Spec No: S85-S89 UK Prospective Diabetes Study 6. Complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients and their association with different clinical and biochemical risk factors. Diabetes Res. 1990; 13: 1-11 VDR Frankfurt. Rahmenkonzept zur medizinischen Rehabilitation in der gesetzlichen Rentenversicherung. Deutsche Rentenversicherung 1996; 633-665 VDR Frankfurt. VDR-Statistik Rehabilitation, Reha-Antrags-/Erledigungsstatistik. 2000 Vogel H, Kulzer B. Patientenschulung bei Diabetes mellitus: Konzepte und empirische Befunde. 2000; 2: 231-262 Wade DT, de Jong BA. Recent advances in rehabilitation. BMJ 2000; 320: 1385-1388 99 Wake N, Hisashige A et al. Cost-effectiveness of intensive insulin therapy for type 2 diabetes: a 10-year follow-up of the Kumamoto study. Diabetes Res.Clin.Pract. 2000; 48: 201-210 Westenhöfer J, Stunkard A, Pudel V. Validation of the Flexible and Rigid Control Dimensions of Dietary Restraint. Int.Journal of Eating Disorders 1999; 26: 53-64 Wing RR. Behavioral treatment of obesity. Its application to type II diabetes. Diabetes Care 1993; 16: 193-199 Ziegler D. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy: prognosis, diagnosis and treatment. Diabetes Metab Rev. 1994; 10: 339-383 100