Europa setzt auf Abriegelung
Werbung
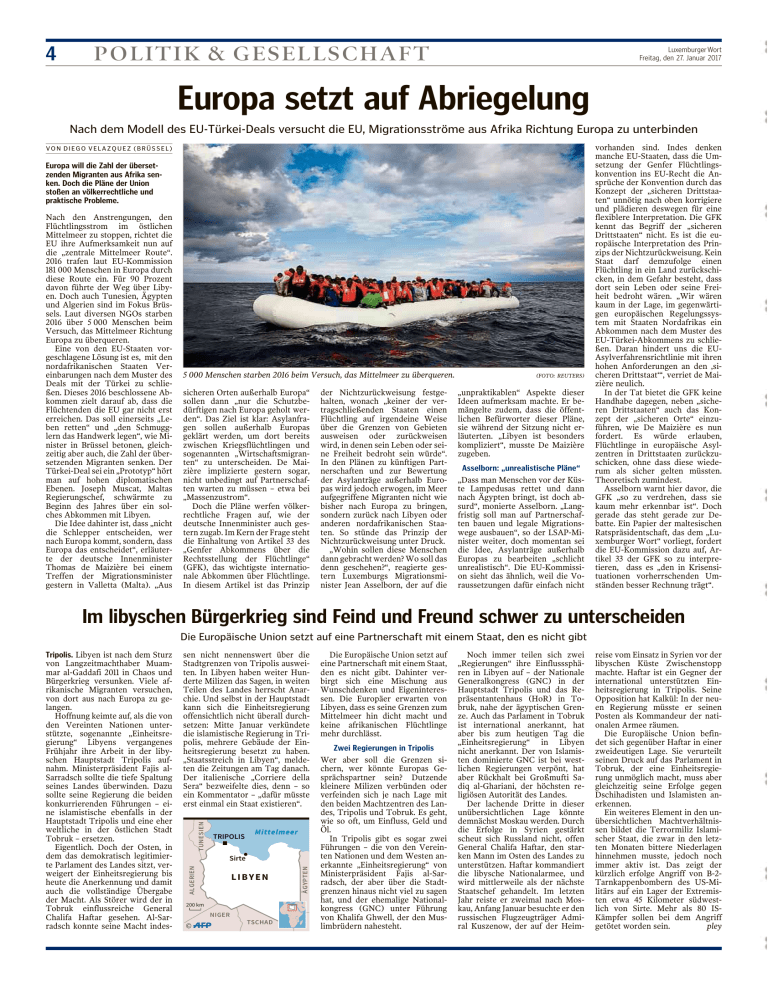
4 POLITIK & GESELLSCHAFT Luxemburger Wort Freitag, den 27. Januar 2017 Europa setzt auf Abriegelung Nach dem Modell des EU-Türkei-Deals versucht die EU, Migrationsströme aus Afrika Richtung Europa zu unterbinden VON DIEGO VELAZQUEZ (BRÜSSEL) Europa will die Zahl der übersetzenden Migranten aus Afrika senken. Doch die Pläne der Union stoßen an völkerrechtliche und praktische Probleme. Nach den Anstrengungen, den Flüchtlingsstrom im östlichen Mittelmeer zu stoppen, richtet die EU ihre Aufmerksamkeit nun auf die „zentrale Mittelmeer Route“. 2016 trafen laut EU-Kommission 181 000 Menschen in Europa durch diese Route ein. Für 90 Prozent davon führte der Weg über Libyen. Doch auch Tunesien, Ägypten und Algerien sind im Fokus Brüssels. Laut diversen NGOs starben 2016 über 5 000 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer Richtung Europa zu überqueren. Eine von den EU-Staaten vorgeschlagene Lösung ist es, mit den nordafrikanischen Staaten Vereinbarungen nach dem Muster des Deals mit der Türkei zu schließen. Dieses 2016 beschlossene Abkommen zielt darauf ab, dass die Flüchtenden die EU gar nicht erst erreichen. Das soll einerseits „Leben retten“ und „den Schmugglern das Handwerk legen“, wie Minister in Brüssel betonen, gleichzeitig aber auch, die Zahl der übersetzenden Migranten senken. Der Türkei-Deal sei ein „Prototyp“ hört man auf hohen diplomatischen Ebenen. Joseph Muscat, Maltas Regierungschef, schwärmte zu Beginn des Jahres über ein solches Abkommen mit Libyen. Die Idee dahinter ist, dass „nicht die Schlepper entscheiden, wer nach Europa kommt, sondern, dass Europa das entscheidet“, erläuterte der deutsche Innenminister Thomas de Maizière bei einem Treffen der Migrationsminister gestern in Valletta (Malta). „Aus 5 000 Menschen starben 2016 beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. sicheren Orten außerhalb Europa“ sollen dann „nur die Schutzbedürftigen nach Europa geholt werden“. Das Ziel ist klar: Asylanfragen sollen außerhalb Europas geklärt werden, um dort bereits zwischen Kriegsflüchtlingen und sogenannten „Wirtschaftsmigranten“ zu unterscheiden. De Maizière implizierte gestern sogar, nicht unbedingt auf Partnerschaften warten zu müssen – etwa bei „Massenzustrom“. Doch die Pläne werfen völkerrechtliche Fragen auf, wie der deutsche Innenminister auch gestern zugab. Im Kern der Frage steht die Einhaltung von Artikel 33 des „Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ (GFK), das wichtigste internationale Abkommen über Flüchtlinge. In diesem Artikel ist das Prinzip der Nichtzurückweisung festgehalten, wonach „keiner der vertragschließenden Staaten einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen wird, in denen sein Leben oder seine Freiheit bedroht sein würde“. In den Plänen zu künftigen Partnerschaften und zur Bewertung der Asylanträge außerhalb Europas wird jedoch erwogen, im Meer aufgegriffene Migranten nicht wie bisher nach Europa zu bringen, sondern zurück nach Libyen oder anderen nordafrikanischen Staaten. So stünde das Prinzip der Nichtzurückweisung unter Druck. „Wohin sollen diese Menschen dann gebracht werden? Wo soll das denn geschehen?“, reagierte gestern Luxemburgs Migrationsminister Jean Asselborn, der auf die (FOTO: REUTERS) „unpraktikablen“ Aspekte dieser Ideen aufmerksam machte. Er bemängelte zudem, dass die öffentlichen Befürworter dieser Pläne, sie während der Sitzung nicht erläuterten. „Libyen ist besonders kompliziert“, musste De Maizière zugeben. Asselborn: „unrealistische Pläne“ „Dass man Menschen vor der Küste Lampedusas rettet und dann nach Ägypten bringt, ist doch absurd“, monierte Asselborn. „Langfristig soll man auf Partnerschaften bauen und legale Migrationswege ausbauen“, so der LSAP-Minister weiter, doch momentan sei die Idee, Asylanträge außerhalb Europas zu bearbeiten „schlicht unrealistisch“. Die EU-Kommission sieht das ähnlich, weil die Voraussetzungen dafür einfach nicht vorhanden sind. Indes denken manche EU-Staaten, dass die Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention ins EU-Recht die Ansprüche der Konvention durch das Konzept der „sicheren Drittstaaten“ unnötig nach oben korrigiere und plädieren deswegen für eine flexiblere Interpretation. Die GFK kennt das Begriff der „sicheren Drittstaaten“ nicht. Es ist die europäische Interpretation des Prinzips der Nichtzurückweisung. Kein Staat darf demzufolge einen Flüchtling in ein Land zurückschicken, in dem Gefahr besteht, dass dort sein Leben oder seine Freiheit bedroht wären. „Wir wären kaum in der Lage, im gegenwärtigen europäischen Regelungssystem mit Staaten Nordafrikas ein Abkommen nach dem Muster des EU-Türkei-Abkommens zu schließen. Daran hindert uns die EUAsylverfahrensrichtlinie mit ihren hohen Anforderungen an den ,sicheren Drittstaat‘“, verriet de Maizière neulich. In der Tat bietet die GFK keine Handhabe dagegen, neben „sicheren Drittstaaten“ auch das Konzept der „sicheren Orte“ einzuführen, wie De Maizière es nun fordert. Es würde erlauben, Flüchtlinge in europäische Asylzentren in Drittstaaten zurückzuschicken, ohne dass diese wiederum als sicher gelten müssten. Theoretisch zumindest. Asselborn warnt hier davor, die GFK „so zu verdrehen, dass sie kaum mehr erkennbar ist“. Doch gerade das steht gerade zur Debatte. Ein Papier der maltesischen Ratspräsidentschaft, das dem „Luxemburger Wort“ vorliegt, fordert die EU-Kommission dazu auf, Artikel 33 der GFK so zu interpretieren, dass es „den in Krisensituationen vorherrschenden Umständen besser Rechnung trägt“. Im libyschen Bürgerkrieg sind Feind und Freund schwer zu unterscheiden Die Europäische Union setzt auf eine Partnerschaft mit einem Staat, den es nicht gibt sen nicht nennenswert über die Stadtgrenzen von Tripolis ausweiten. In Libyen haben weiter Hunderte Milizen das Sagen, in weiten Teilen des Landes herrscht Anarchie. Und selbst in der Hauptstadt kann sich die Einheitsregierung offensichtlich nicht überall durchsetzen: Mitte Januar verkündete die islamistische Regierung in Tripolis, mehrere Gebäude der Einheitsregierung besetzt zu haben. „Staatsstreich in Libyen“, meldeten die Zeitungen am Tag danach. Der italienische „Corriere della Sera“ bezweifelte dies, denn – so ein Kommentator – „dafür müsste erst einmal ein Staat existieren“. Tripolis. Libyen ist nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 in Chaos und Bürgerkrieg versunken. Viele afrikanische Migranten versuchen, von dort aus nach Europa zu gelangen. Hoffnung keimte auf, als die von den Vereinten Nationen unterstützte, sogenannte „Einheitsregierung“ Libyens vergangenes Frühjahr ihre Arbeit in der libyschen Hauptstadt Tripolis aufnahm. Ministerpräsident Fajis alSarradsch sollte die tiefe Spaltung seines Landes überwinden. Dazu sollte seine Regierung die beiden konkurrierenden Führungen – eine islamistische ebenfalls in der Hauptstadt Tripolis und eine eher weltliche in der östlichen Stadt Tobruk – ersetzen. Eigentlich. Doch der Osten, in dem das demokratisch legitimierte Parlament des Landes sitzt, verweigert der Einheitsregierung bis heute die Anerkennung und damit auch die vollständige Übergabe der Macht. Als Störer wird der in Tobruk einflussreiche General Chalifa Haftar gesehen. Al-Sarradsch konnte seine Macht indes- Die Europäische Union setzt auf eine Partnerschaft mit einem Staat, den es nicht gibt. Dahinter verbirgt sich eine Mischung aus Wunschdenken und Eigeninteressen. Die Europäer erwarten von Libyen, dass es seine Grenzen zum Mittelmeer hin dicht macht und keine afrikanischen Flüchtlinge mehr durchlässt. Zwei Regierungen in Tripolis Wer aber soll die Grenzen sichern, wer könnte Europas Gesprächspartner sein? Dutzende kleinere Milizen verbünden oder verfeinden sich je nach Lage mit den beiden Machtzentren des Landes, Tripolis und Tobruk. Es geht, wie so oft, um Einfluss, Geld und Öl. In Tripolis gibt es sogar zwei Führungen – die von den Vereinten Nationen und dem Westen anerkannte „Einheitsregierung“ von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, der aber über die Stadtgrenzen hinaus nicht viel zu sagen hat, und der ehemalige Nationalkongress (GNC) unter Führung von Khalifa Ghwell, der den Muslimbrüdern nahesteht. Noch immer teilen sich zwei „Regierungen“ ihre Einflusssphären in Libyen auf – der Nationale Generalkongress (GNC) in der Hauptstadt Tripolis und das Repräsentantenhaus (HoR) in Tobruk, nahe der ägyptischen Grenze. Auch das Parlament in Tobruk ist international anerkannt, hat aber bis zum heutigen Tag die „Einheitsregierung“ in Libyen nicht anerkannt. Der von Islamisten dominierte GNC ist bei westlichen Regierungen verpönt, hat aber Rückhalt bei Großmufti Sadiq al-Ghariani, der höchsten religiösen Autorität des Landes. Der lachende Dritte in dieser unübersichtlichen Lage könnte demnächst Moskau werden. Durch die Erfolge in Syrien gestärkt scheut sich Russland nicht, offen General Chalifa Haftar, den starken Mann im Osten des Landes zu unterstützen. Haftar kommandiert die libysche Nationalarmee, und wird mittlerweile als der nächste Staatschef gehandelt. Im letzten Jahr reiste er zweimal nach Moskau, Anfang Januar besuchte er den russischen Flugzeugträger Admiral Kuszenow, der auf der Heim- reise vom Einsatz in Syrien vor der libyschen Küste Zwischenstopp machte. Haftar ist ein Gegner der international unterstützten Einheitsregierung in Tripolis. Seine Opposition hat Kalkül: In der neuen Regierung müsste er seinen Posten als Kommandeur der nationalen Armee räumen. Die Europäische Union befindet sich gegenüber Haftar in einer zweideutigen Lage. Sie verurteilt seinen Druck auf das Parlament in Tobruk, der eine Einheitsregierung unmöglich macht, muss aber gleichzeitig seine Erfolge gegen Dschihadisten und Islamisten anerkennen. Ein weiteres Element in den unübersichtlichen Machtverhältnissen bildet die Terrormiliz Islamischer Staat, die zwar in den letzten Monaten bittere Niederlagen hinnehmen musste, jedoch noch immer aktiv ist. Das zeigt der kürzlich erfolge Angriff von B-2Tarnkappenbombern des US-Militärs auf ein Lager der Extremisten etwa 45 Kilometer südwestlich von Sirte. Mehr als 80 ISKämpfer sollen bei dem Angriff getötet worden sein. pley
