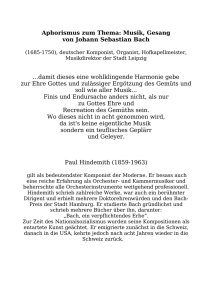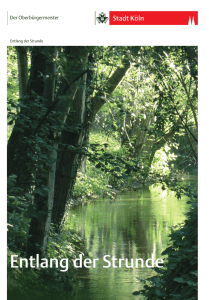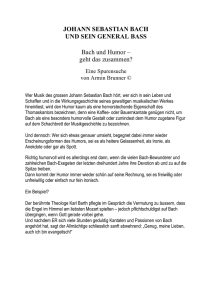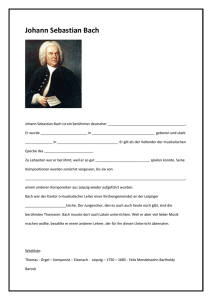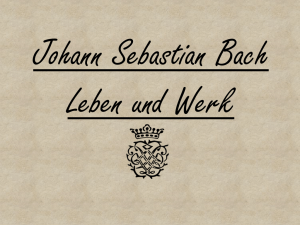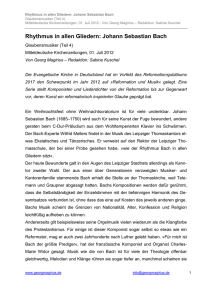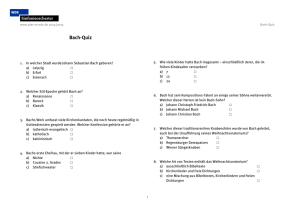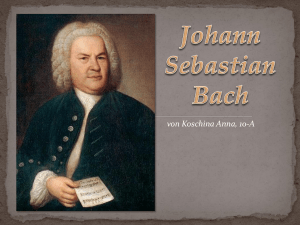Leseprobe - Laaber
Werbung

82 BEI BACH ZUHAUSE: DER ALLTAG EINES ORGANISTEN UND MUSIKDIREKTORS Den Berufsalltag eines barocken Musikers zu beschreiben, über den kaum private Aufzeichnungen existieren, ist außerordentlich schwierig. Genau genommen besitzen wir nur vier Privatbriefe Bachs1, dazu mehrere Briefentwürfe von seinem Privatsekretär Johann Elias Bach (1705–1755)2, die teils privater Natur sind. So kann man in Ermangelung von Quellen lediglich den Informationen, welche uns aus jener Zeit vorliegen, folgen und diese auf die einzelnen Abschnitte der Biographie des Komponisten übertragen, um zu prüfen, ob die Angaben zuzutreffen vermögen. Um Spekulationen zu begrenzen, verzichte ich auf Details, für die keine fundierten Belege vorliegen. Aus denselben Gründen bleibt auch der private Anteil des Alltags hier weitestgehend unberücksichtigt. Wenn vom beruflichen Alltag die Rede ist, sind sämtliche Tätigkeiten des Musikers Bach gemeint, gleichgültig ob sie seinen offiziellen Ämtern dienten oder aus privater Initiative hervorgingen. Da sich jedoch die Anstellungen und die mit ihnen verbundenen Pflichten wiederholt änderten, empfiehlt es sich, eine Gliederung in die einzelnen biographischen Stationen vorzunehmen, nämlich Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen und Leipzig. So wünschenswert es wäre, einen chronologischen Tagesplan zu rekonstruieren, so bleibt ein solches Unterfangen doch fast immer versagt, weil uns Einzelheiten zum Alltag von Bach und seiner Familie fehlen. Lediglich dort, wo berufliche Vorgaben Zäsuren setzen, wurden zeitliche Abläufe in einen Kontext gestellt, der den historischen Tatsachen entsprechen dürfte. Eine offene Frage bleibt auch, wo Bach zuhause arbeitete. Denn erst mit dem Bezug der Dienstwohnung im Gebäude der Leipziger Thomasschule 1723 lässt sich eine »Componir-Stube« nachweisen. Ob Bach auch zuvor ein Arbeitszimmer besaß oder ob sich das Komponieren, Üben und Unterrichten im häuslichen Wohnzimmer bzw. in einer anderen Stube abspielte, bleibt ungewiss. Daher wissen wir auch nicht, ob er sich für seine berufliche Arbeit zurückziehen konnte oder diese Tätigkeiten inmitten seiner ständig wachsenden Familie verrichtete. Letzteres dürfte zumindest beim Unterrichten der Fall 1 Dok I/23, 49 und 50 und Dok V/A 13. 2 Die Briefentwürfe des Johann Elias Bach (1705–1755). Zweite, erweiterte Auflage (Leipziger Beiträge zur Bachforschung 3), hrsg. und kommentiert von E. Odrich / P. Wollny, Hildesheim etc. 2005. Unterricht 3 Dok III/803, S. 290. 83 gewesen sein, da er Gruppenunterricht erteilte und hierfür einen größeren Raum benötigte, der über eine Kammer hinausging. Allerdings hat Bach während des Unterrichtens auch komponiert, und so ist gut möglich, dass viele seiner beruflichen Tätigkeiten unmittelbar Teil des Familienlebens waren. Man muss sich also das Unterrichten und Üben an Tasteninstrumenten zuhause sowie das Erledigen von Theorie- und Kompositionsaufgaben inmitten der Kinderschar vorstellen, die im Haus und auf dem Boden gespielt hat und sich keineswegs immer still und leise verhalten wird, selbst wenn eine gewisse Ruhe zweifellos erforderlich war. Folglich kann man sich leicht ausmalen, dass Bachs »Haus einem Taubenhause u. deßen Lebhaftigkeit vollkommen« geglichen haben muss, wie dies der Sohn Carl Philipp Emanuel (1714–1788) berichtet.3 Aus dieser Bemerkung geht zugleich hervor, dass dies nicht der Normalfall einer Musikerfamilie war, was zweifellos darauf zurückzuführen ist, dass in Bachs Familie stets eine gewisse Anzahl von Schülern lebte. UNTERRICHT Das Unterrichten steht hier an erster Stelle. Denn der Forschung ist bisher entgangen, dass die meiste Zeit von Bachs Alltag dem Unterricht gewidmet gewesen sein muss, da der Komponist wohl von der Arnstädter Zeit bis in seinen letzten Lebensmonaten in Leipzig stets junge Organisten und Komponisten ausbildete. Da Bach in der Regel mehrere Schüler gleichzeitig hatte, fand der Unterricht offenbar in der Gruppe statt, und zwar über je sechs Stunden an sechs Tagen der Woche (siehe S. 425). In dieser Form könnten zehn und mehr Schüler zur selben Zeit ausgebildet worden sein, weshalb ein Unterrichtsraum erforderlich war, der ausreichend Platz bot. Aus dieser Szenerie ergibt sich von selbst, dass das Unterrichten während des gesamten Berufslebens Bachs die eigentliche Einteilung des Tages bestimmte. Ja wohl bereits im Eisenacher Elternhaus wie auch während der Organistenlehre bei seinem älteren Bruder Johann Christoph (1671–1721) in Ohrdruf wurde Bachs Alltag maßgeblich vom Unterrichten geprägt. Denn schon sein Vater verfügte stets über Lehrlinge und Gesellen, die zuhause ausgebildet wurden (siehe S. 61), und auch für den Bruder Johann Christoph sind aus den Quellen meh- 84 Bei Bach zuhause: Der Alltag eines Organisten und Musikdirektors rere Lehrlinge zugleich zu erschließen (siehe S. 74). Insofern dürfte der Privatunterricht den Hauptinhalt von Bachs Leben dargestellt haben, und diese Funktion kam ihm auch aus inneren Gründen zu: Nach allem, was wir wissen, muss in der Ausbildung von Organisten und Komponisten die größte Einnahmequelle Bachs bestanden haben, die selbst seine Gehälter in Köthen und Leipzig übertraf (siehe S. 143ff.). Daher hatte er alles zu tun, das Unterrichten mit seinen offiziellen Dienstpflichten und dem Familienleben zu koordinieren. Die Schüler werden zwar nicht immer vorgegangen sein, aber einen festen Platz im Alltag eingenommen haben: Wahrscheinlich wurde die eine Hälfte der täglich sechs Unterrichtsstunden am Vormittag, die andere am Nachmittag erteilt. Am Abend und in der Nacht kopierte man, wie wir aus verschiedenen Quellen wissen, bevorzugt Noten und erledigte schriftliche Arbeiten.4 Vermutlich ist dies auch jene Zeit, in der Bach größere Kompositionsprojekte durchführte, für die während des Unterrichtens weniger Gelegenheit bestand. Dennoch ist bekannt, dass er in den Lektionen ebenfalls komponierte, nämlich kleinere Tastenwerke wie die Inventionen und Sinfonien BWV 772–801 (siehe S. 426), wahrscheinlich auch das Orgel-Büchlein BWV 599–644. Diese Arbeiten dürften zu Papier gelangt sein, als die Schüler ihre Theorie- oder eigene Kompositionsaufgaben ausführten, welche der Lehrmeister nur anzuleiten und zu kontrollieren hatte. Sollte Bach komplexere Kompositionen im voraus entworfen oder gar skizziert haben, dürften die schriftlichen Aufgaben seiner Schüler auch Gelegenheit geboten haben, solche Entwürfe zu Papier zu bringen. Jedenfalls ist damit zu rechnen, dass er diesen Teil des Unterrichts für eigene Arbeiten zu nutzen wusste. Auch hier gilt also, dass zahlreiche zumal der didaktischen Kompositionen nicht in der Abgeschiedenheit einer »Componir-Stube«, sondern in der Gruppe und wohl am Esszimmertisch entstanden. Das Unterrichten umfasste drei Bereiche (siehe S. 73): a) den Tastenunterricht zur Ausbildung eines Organisten, b) theoretisch-praktische Wissensvermittlung von der Musikgeschichte bis hin zum Orgel- und Clavierbau, die Bach wahrscheinlich dozierend vornahm, und c) praktische Aufgaben zu Generalbass, Harmonielehre, Satztechnik und Kontrapunkt sowie Komposition. Dieser letzte Bereich ist jener, während dessen Bach selbst komponieren konnte, da er die Arbeiten seiner Schüler nur zu 4 S. Rampe, Orgel- und Clavierspielen 1400–1800. Eine deutsche Sozialgeschichte im europäischen Kontext (Musikwissenschaftliche Schriften 48), München / Salzburg 2014, S. 42. Unterricht 85 beaufsichtigen hatte. Vermutlich arbeiteten Lehrer und Schüler dabei am selben Tisch, so dass ein unmittelbarer Kontakt untereinander unvermeidlich wurde. D. h. auch, dass alle über die Arbeiten des anderen Bescheid wussten und sich gegenseitig stören konnten, wenn Fragen oder Kritik aufkamen. Bevor man jedoch Papier beschrieb, dürfte für diesen Teil des Unterrichts eine »Tabula compositoria« gedient haben, auch »Eselshaut«, »Cartell« oder »Palimpsest« genannt. Hier handelte es sich um einen hölzernen Rahmen, der mit Pergament oder dünnem Leder bespannt war, oder eine Schiefertafel, auf denen sich die Aufzeichnungen mit Wasser abwischen ließen. Der thüringische Organist Jacob Adlung (1699–1762) berichtet: 5 J. Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758; Faks., hrsg. von S. Rampe, München / Salzburg [i. Vorb.], S. 787. 6 S. Rampe, Orgel- und Clavierspielen 1400–1800, S. 70–76. »Ein geübter ist froh, wenn die Gedanken zu Papiere gebracht sind, und wird nicht nöthig haben, solche ins reine zu bringen; ein Anfänger aber, welcher seine Sätze mehrmal durch zu studieren und zu ändern Ursache hat, kann sein Concept niemanden vorlegen. Daher ist solchen Leuten sehr dienlich, eine Eselshaut mit derjenigen weissen und harten Materie zu überziehen, womit die Pergamenttafeln überzogen sind. Hierauf zieht man scharf Linien, reibt etwas schwarzes in dieselben, und trägt alsdenn seine Noten darauf. Die Noten lassen sich mit Wasser wegnehmen, wenn man etwas corrigiren will; aber wenn man sie allzu lange lässt stehen, gehen sie nicht so gut aus, sondern es bleiben gelbe Flecken.«5 Wahrscheinlich dozierte Bach mithilfe einer Eselshaut, wenn er die Anfangsgründe des Generalbasses, der Satzlehre und des Kontrapunkts vermittelte. Auch in diesem Fall war ausreichender Raum für die Gruppe von Schülern erforderlich, wobei die fortgeschrittenen vermutlich dieselbe Zeit nutzten, um sich inzwischen am Instrument oder auf dem Papier zu üben. Grundlegende Informationen über Musikgeschichte, Musiktheorie und Instrumentenbau könnte Bach den Schülern in ein Heft diktiert haben, das diese als Lehrbuch führten. Das erscheint auch bei praktischen Aufgaben möglich, wobei die Notenbeispiele dann vermutlich von der Eselshaut kopiert wurden. Für den Instrumentalunterricht standen bei deutschen Organisten damals Clavichorde mit oder ohne Pedal zur Verfügung, und zwar mehrere, damit die Schüler gleichzeitig üben konnten.6 Da Clavichorde sehr leise sind, war dies sogar im selben Zimmer, zumindest aber in benachbarten Räumlichkeiten möglich, ohne sich gegenseitig zu stören. Bach besaß bei seinem Tod (1750) drei Pedalclavichorde (siehe S. 306), womöglich aber noch weitere kleinere Instrumente dieser Art, die in keinem amtlichen Verzeichnis auftauchen, weil sie unter der 86 Bei Bach zuhause: Der Alltag eines Organisten und Musikdirektors Hand weggegeben wurden. Darüber hinaus verfügte er damals über fünf Cembali und zwei Lautenclaviere (siehe S. 305), welche er gewiss nicht alle selbst benötigte, sondern auch für seine Schüler angeschafft hatte. Dabei stellt sich jedoch ein praktisches Problem: Es ist nämlich nicht vorstellbar, dass diese mindestens zehn größeren Tasteninstrumente alle in den Räumlichkeiten selbst der 1732 umgebauten, erweiterten Dienstwohnung im Gebäude der Leipziger Thomasschule Platz fanden. Bach muss also einige Instrumente in die Klassenzimmer der Thomasschule ausgelagert oder zusätzlichen Raum angemietet haben, damit er seine Sammlung unterbringen konnte. Das bedeutet, dass Schüler auch außerhalb der Wohnung übten; möglicher Weise fand dort sogar ein Teil des Unterrichts statt. Jedenfalls hätte die wirtschaftliche Bedeutung, die das Unterrichten für Bach haben musste, einen solchen Aufwand durchaus gelohnt. Vermutlich waren die Cembali ebenfalls als Attraktion für die Schüler bestimmt, da ihr Klang jenen der leisen Clavichorde weit übertraf. Allerdings besaßen Bachs Cembali kein Pedal, so dass das eigentliche Orgelüben nach wie vor am Pedalclavichord stattgefunden haben wird. Der Tastenunterricht wird ebenfalls in der Gruppe erfolgt sein. Demnach saßen mehrere Schüler um ein Pedalclavichord oder Cembalo und hörten sich und dem Lehrmeister gegenseitig zu. Dabei konnte der Eine vom Anderen und der Anfänger vom Fortgeschrittenen profitieren und auch solche Stücke kennenlernen, die er selbst gar nicht spielte. Zugleich bewirkte diese Methode, dass die Schüler über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen gegenseitig informiert waren. Und schließlich erfuhr der Anfänger von den fortgeschrittenen Mitschülern, worauf es bei einer Komposition ankam. Der Lehrer unterrichtete übrigens nicht an einem zweiten Clavierinstrument, wie dies heute üblich ist, sondern mit der Violine in der Hand, indem er einzelne Stimmen vor- oder mitspielte und dadurch mit Leichtigkeit das Clavichord übertönte.7 Diese Praxis erklärt auch, weshalb Bach im Generalbassunterricht Violinsonaten heranzog: Während der Schüler den Continuo ausführte, dürfte er selbst die Geigenpartie vorgetragen haben. Auch hier ging es also darum, den Generalbass nicht als musiktheoretischen Tonsatz, sondern so praxisnah als möglich zu vermitteln. Der Orgelunterricht erfolgte gewöhnlich am Pedalclavichord. Erst in der Schlussphase der Ausbildung ging man auch 7 Ebenda, S. 58. Unterricht 8 Vgl. auch Dok V/B 90a. 9 S. Rampe, Orgel- und Clavierspielen 1400–1800, S. 70–86. 10 Ebenda, S. 98f. 87 auf die Orgel, um dem Lehrling dieses Instrument nahe zu bringen. Hierfür dienten zweifellos Bachs Dienstinstrumente in Arnstadt, Mühlhausen und Weimar. In Köthen wird er auf die Orgel der lutherischen Agnuskirche ausgewichen sein, deren Gemeinde er angehörte8, in Leipzig wahrscheinlich auf das Instrument der Universitätskirche, der sogenannten Paulinerkirche. Allerdings war regelmäßiger Orgelunterricht aus finanziellen Gründen nicht möglich, da die hohen Kosten für die Kalkanten zum Bedienen der Blasebälge vom Lehrherrn aufzubringen gewesen wären. Deshalb zog man als Ersatz zum Üben und Unterrichten in der Regel das Pedalclavichord heran, das ein bis drei Manuale umfassen konnte.9 Ebenfalls in den praktischen Teil der Organistenausbildung dürfte die Unterweisung auf Streichinstrumenten gefallen sein, wie sie für mehrere Bach-Schüler nachweisbar ist.10 Das setzt voraus, dass auch Bach auf diesen Instrumenten regelmäßig selbst übte. Den Schülern vermittelte er Violine, Viola und sogar Violoncello, damit sie im Orchester mitwirken konnten und eine Vorstellung davon erhielten, wie man für Streichinstrumente komponiert. Vermutlich erfolgten die drei unterschiedlichen Teile des Unterrichts in Zeitstunden und abwechselnd, um die Schüler nicht zu ermüden. Für den Lehrherrn bedeutete dies, dass er täglich sechs Stunden beschäftigt war und diese Zeit nicht für andere Aufgaben nutzen konnte, etwa um selbst zu üben. Womöglich wurde er bei der praktischen Ausbildung später jedoch von seinem Lieblingssohn Wilhelm Friedemann (1710– 1784) unterstützt; denn einige Bach-Schüler, beispielsweise Christoph Nichelmann (1717–1761/62), gaben an, sie hätten auch von diesem Unterricht erhalten. Im Juni 1733 verließ Wilhelm Friedemann Bach freilich das Elternhaus für immer und es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein andere BachSohn oder -Schüler dessen Platz als Assistent eingenommen hätte. Soweit wir wissen, hat Bach fast ausschließlich professionelle Musiker ausgebildet. Zu seiner Zeit gab es zwei Varianten der Durchführung einer Musikerlehre: Entweder der Lehrling wohnte bei seinen Eltern zuhause und übte und arbeitete dort auch, so dass er sich nur zum eigentlichen Unterricht in der Wohnung des Meisters aufhielt. Hierfür wurde ein reines Unterrichtshonorar fällig, das mit deutlich geringeren Kosten verbunden war als in der zweiten Variante (siehe S. 139). Die- 88 Bei Bach zuhause: Der Alltag eines Organisten und Musikdirektors se umfasste eine Lehre in Kost und Logis, so dass der Lehrling in der Wohnung des Lehrmeisters lebte und dort auch aß; selbst für Kleidung und Wäsche war der Lehrer verantwortlich und erhielt dafür ein hohes Entgelt (siehe S. 139). Diese Art der Ausbildung wurde für jene Schüler erforderlich, die von weit her kamen. Soweit wir wissen, traf das auf die meisten der Bach-Schüler zu. Folglich dürften in der Familie bis zu zehn oder sogar mehr Lehrlinge zugleich gelebt und zusammen mit den Söhnen in einer Kammer oder auf dem Dachboden geschlafen haben. Das bedeutet, dass die Bach-Familie von Anfang an sehr umfangreich gewesen sein muss und zahlreiche Gäste beherbergte, die ein wirkliches Privatleben weitgehend unmöglich machten. Nicht nur der Unterricht, auch das Familienleben erfolgten in der Gruppe und bewirkten, dass man zuhause fast niemals allein war. ARNSTADT Diese komplexe Unterrichtstätigkeit dürfte freilich noch nicht bestanden haben, als Bach im August 1703 seine erste Stelle übernahm, das Organistenamt an der Neuen Kirche in Arnstadt. Vielmehr wird es Jahre gedauert haben, einen festen Stamm von Schülern aufzubauen und zu unterhalten. Allerdings kann man annehmen, dass Bach damit bald begann, und die spektakulären Umstände um seine Berufung nach Arnstadt werden ihr Übriges getan haben, um auf ihn als fortschrittlichen Lehrer aufmerksam zu machen. So wird er im Verlauf der Arnstädter Jahre mit dem Unterrichten auf jene Art angefangen habe, wie es oben beschrieben wurde. Freilich werden dies anfangs nur Schüler aus der Region gewesen sein. Denn Bach verfügte noch nicht über einen eigenen Hausstand und war deshalb wohl nicht in der Lage, Lehrlinge in Kost und Logis unterzubringen. Als lutherischem Organisten stand ihm zwar eine kostenfreie Mietwohnung zu. Da die Gemeinde über eine solche jedoch nicht verfügte, bezahlte man ihm 1704–1705 separat Geld für Wohnung und Kost in bar (siehe S. 139). Wahrscheinlich wohnte und aß er zur Untermiete, vielleicht sogar bei einem seiner örtlichen Verwandten. Seit 1706 ging dieser Betrag jedoch an den Bürgermeister Martin Feldhaus (1634–1720) »vor jährlich Kost, bett undt stuben«, so dass Bach in einem von dessen Häusern