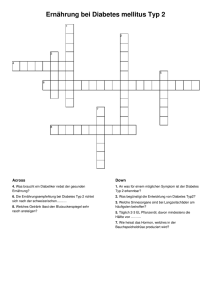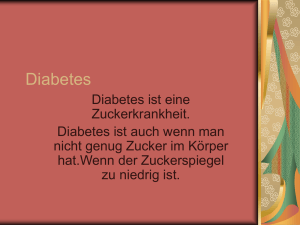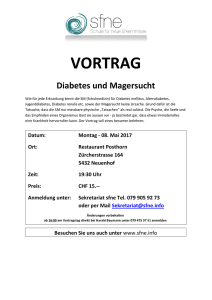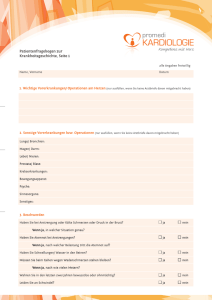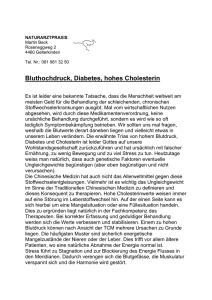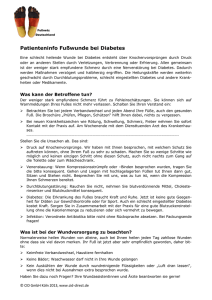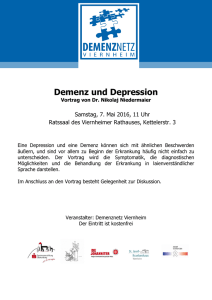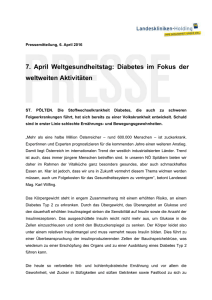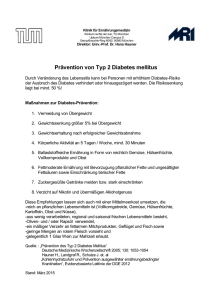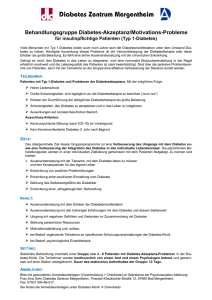Psychologische Besonderheiten geriatrischer Patienten 2012
Werbung

Psychologische Besonderheiten geriatrischer Patienten PD Dr. Bernhard Kulzer Forschungsinstitut FIDAM Diabetes Akademie Bad Mergentheim Diabetes im Alter: Veränderte Therapieziele § Es ist eine ärztliche Aufgabe, unter Berücksichtigung des biologischen Alters des Patienten, seiner Begleiterkrankungen und seiner Beschwerden sowie des sozialen Umfeldes, das individuelle Therapieziel zu definieren und damit die einzelnen Therapiemaßnahmen festzulegen. § Als globale und allgemein anerkannte Therapieziele gelten die Förderung und der Erhalt der Lebensqualität und des allgemeinen Wohlbefindens des Patienten. § Je nach Lebensalter treten die Ziele der Reduktion diabetesassoziierter Komplikationen und Begleiterkrankungen und einer Verlängerung der Lebenserwartung in den Hintergrund. § Der Ausdehnung der „behinderungsfreien Lebenszeit“ … kommt … eine ganz besondere Bedeutung zu. Dies betrifft speziell den „geriatrischen Patienten“ mit Diabetes mellitus. Memo: Prävalenz des Diabetes nach Altersgruppen Zwei Drittel aller Menschen mit Aber: Selbständiges Leben mit Diabetes Diabetes älter als 60 Jahre bis ins hohe Alter ist eher die Regel Pflegequote: Anteil der Menschen, die pflegebedürftig sind im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes Zeyfang, A. Diabetes und Geriatrie, Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2012, 134 – 139; GEDA 2009 www.statistik.bayern.de/statistikdesmonats/00420.php Diabetes im Alter: Lebensqualität Forschungsverbund DIAB-CORE (Diabetes Collaborative Research of Epidemiologic Studies) (Mit freundlicher Genehmigung, Dr.Schunk) Diabetes im Alter: Körperliche Lebensqualität SF-12 Körperlicher Summenscore 55,0 50,0 Kein Diabetes 45,0 Diabetes 40,0 35,0 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 Altersgruppen • Die körperliche Lebensqualität von Personen mit Diabetes ist in allen Altersgruppen niedriger als bei Personen ohne Diabetes. • Der Effekt von Diabetes auf der körperlichen Subskala (SF-12 KSK) beträgt: - 4,1 Punkte [95% KI: -4,8; -3,4]. (mit freundlicher Genehmigung, Dr.Schunk) Diabetes im Alter: Psychische Lebensqualität PSK-12 Seelischer Summenscore 55,0 50,0 Kein Diabetes 45,0 Diabetes 40,0 35,0 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 Altersgruppen • Die HRQL von Personen mit Diabetes ist in allen Altersgruppen niedriger als bei Personen ohne Diabetes, verstärkt in jüngeren Altersgruppen. • Auf der psychischen Subskala (SF-12 PSK) ist der Diabetes-Effekt nur bei Frauen signifikant: - 2,6 Punkte [95% KI: -3,5; -1,7]. (mit freundlicher Genehmigung, Dr.Schunk) Diabetes im Alter: Einfluss der Insulintherapie P= <.0001 (mit freundlicher Genehmigung, Dr.Schunk) Männer und Frauen P= 0.0039 Männer Frauen Lebensqualität im höheren Lebensalter § Ältere Menschen - können häufig mit kurzfristigen Spannungen und Kritik leichter umgehen - verschwenden weniger Energie auf unlösbare Probleme § Häufigkeit negativer Emotionen - gehen bis zum 60. Lebensjahr zurück, steigen dann leicht wieder an - Episoden positiver Befindlichkeit werden stabiler, Episoden negativer Befindlichkeit werden instabiler § Höherer Grad an Differenzierung - der emotionalen Befindlichkeit im höheren Alter Carstensen LL, Pasupathi M, Mayr U, Nesselroade JR. Emotional Experience in Everyday Life Across the Adult Life Span. J Pers Soc Psych, 2000; 79 (4): 644 - 655 Einbuße der Lebensqualität durch Hypoglykämien ACCORD2 ADVANCE1 p<0,001 12 9 6 3 0,4 0,7 0 Pro 100 Patienten pro Jahr 15 p<0,001 12 9 6 3,1 3 1,0 0 Standard Intensiv Schwere hypoglykämische Ereignisse 15 Schwere hypoglykämische Ereignisse Schwere hypoglykämische Ereignisse Pro 100 Patienten pro Jahr VADT3 Pro 100 Patienten pro Jahr 15 p<0,01 12 12,0 9 6 4,0 3 0 Standard Intensiv 1: Gerstein et al. N Engl J Med 2008; 358(24): 2545-59. 2: Patel et al. N Engl J Med 2008; 358(24): 2560-72. 3: Duckworth et al. N Engl J Med 2009; 360(2): 129-39. Standard Intensiv Schwere Hypoglykämien und Mortalität: ACCORD Studie Für spezifische Risikofaktoren (wie Alter, Rauchen, kardiovaskuläre Vorerkrankungen, EKGVeränderungen, Albumin und Kreatinin-Ratio etc.) adjustieres Mortalitätsrisiko. Bonds et al, BMJ 2010, 340:b4909 Schwere Hypoglykämien und Mortalität: VADT Studie Duckworth et al. N Engl J Med 2009; 360: 129-39. Hypoglykämien im höheren Lebensalter § Hypoglykämien: passagerer kardialer Stressor, gefährlich für ältere Menschen mit KHK 1 § Verminderte Elastizität der Koronararterien: Erhöhtes Risiko bei Hypoglykämien für kardiale Ischämie 1 § Hyperkaliämie als Konsequenz der Ausschüttung von Katecholaminen: Erhöhtes Risiko für kardiale Arrhytmien 1 Euglykämie Hypoglykämie § EKG: Verlängertes QT-Intervall – starker Prädiktor für „sudden death“ 1 § Verdoppeltes Mortalitätsrisiko bei Patienten mit Diabetes, KHK und schweren Hypoglyämien (2-Jahreskatamnese) 2 1 Frier BM, Schernthaner G, Heller SR. Hypoglycemia and Cardiovascular Risks.Diabetes Care, 2011, 34 (2): S132 - 137 2 Svensson AM, McGuire DK, Abrahamsson P, Dellborg M. Association between hyper and hypoglycaemia and 2 year all-cause mortality risk in diabetic patients with acute coronary events. Eur Heart J 2005; 26:1255–1261 Hypoglykämien im höheren Lebensalter § Verminderte autonome Aktivierung bei Hypoglykämien: Geringere Intensität der Symptome § Absenkung der glykämischen Schwellen für autonome und neuroglykopenische Symptomen: verkleinertes Zeitfenster zur Hypoglykämiebehandlung § Angleichung der glykämischen Schwellen für autonomen und neuroglykopenischen Symptome § Erschwerte Unterscheidbarkeit: TIA / Apoplex, koronare Ischämie Zammit NN, Frier BM. Hypoglycaemia in Type 2 Diabetes and in Elderly People (2007). In: Frier BM, Fisher M (Eds): Hypoglycaemia in Clinical Practice, 239 – 264, Chichester: Wiley & Sons Hypoglykämie und Demenz bei Typ 2 Diabetes (27 Jahre Follow up) Hypoglykämiehäufigkeit und Demenz Inzidenz Demenz 20 16,95 2,5 15 2 10,34 10 % % 1,8 1,5 1,94 1,26 1 5 0,5 0 0 ohne Hypo mit Hypo Adj. OR 1.44 (1,25-1,66) Whitmer et al. JAMA 2009 1 Hypo 2 Hypo 3 Hypo Diabetes ist ein Riskofaktor für Demenz Hassing * ns Luchsinger Xu * * ns Mc Knight ns Peila ns Brayne * * * * * Ott ns 0 1 2 3 Odd ratio bzw. Hazard ratio Alzheimer Biessels et al. Lancet Neurology 2006 Vaskuläre Demenz 4 5 Abbau kognitiver Leistungen und Demenzrisiko bei Menschen mit Diabetes: Metaanalyse prospektiver Studien § Auswertung von 25 Studien mit 8.656 Menschen mit Diabetes § Follow-up‘s zwischen 2 und 18 Jahren § Untersuchungen mit standardisierten und validen kognitiven Leistungstests Abfall kognitiver Leistungen: Vergleich Diabetiker – Nicht-Diabetiker Alter MiniMentalStateTest ZahlenSymbolTest Follow-up (Jahre) Risiko für die Abnahme kognitiver Leistungen: Vergleich Diabetiker – Nicht-Diabetiker Mini-Mental-State Examination (MMSE) Zahlen-SymbolTest (DSS) Risiko für Entwicklung einer künftigen Demenz: Vergleich Diabetiker – Nicht-Diabetiker Alter Follow-up (Jahre) N/A: keine Angaben vorhanden HR: Hazard Ratio: Verhältnis der Ereignisse in einem Beobachtungszeitraum zwischen zwei Gruppen (Nicht-Diabetiker / Diabetiker) RR: Relative Risk: Verhältnis von Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen bei zwei Bedingungen: WSK für Demenz bei Vorliegen eines Diabetes vs WSK für Demenz ohne Diabetes Risiko für Entwicklung einer künftigen Demenz: Vergleich Diabetiker – Nicht-Diabetiker Schlussfolgerungen der Autoren: § Prospektive Studien zeigen: - stärker ausgeprägte Defizite kognitiver Leistungen bei Diabetikern - ca. 1.5 fach erhöhtes Risiko für künftigen Abbau kognitiver Leistungen - ca. 1.6 fach erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer künftigen Demenz § Übereinstimmende Ergebnisse trotz unterschiedlicher Studiendesigns und Messinstrumente § Assoziation zwischen Diabetes und Abbau kognitiver Leistungen unabhängig vom Vorliegen einer Depression § Assoziation zwischen Diabetes und Abbau kognitiver Leistungen assoziiert mit klinischen Markern von Hyperglykämie, wenig Evidenz für Zusammenhang mit Unterzuckerungen Kognitive Leistungsfähigkeit und Alter Lindenberger et al. Die Berliner Altersstudie. 3. Aufl. 2010. Akademie Verlag Einfluss des Diabetes auf die kognitive Leistungsfähigkeit bei hochbetagten Menschen § Populationsbasierte Stichprobe: Menschen zwischen dem 85. und 90. Lebensjahr § Längsschnittstudie (jährliche Untersuchungen) § n = 500 Probanden ohne Diabetes, n = 90 Probanden mit Diabetes § Erfassung globaler kognitiver Fähigkeiten sowie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung Standardisierte Tests zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten Stroop-Test: Aufmerksamkeitsleistungen Mini-Mental State Examination (MMSE): Globale Erfassung kognitiver Fähigkeiten Zahlen-Symbol-Test (DSS): Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung Ergebnisse (1): (Sekunden für 40 Items) Stroop-Test: § Betagte Menschen mit Diabetes: Diabetiker NichtDiabetiker - Schlechtere Aufmerkmerksamkeitsleistungen - Langsamere Informationsverarbeitung Zahlen-Symbol-Test (Anzahl richtiger Zuordnungen in 60 Sekunden) NichtDiabetiker Diabetiker - Gedächtnis und globale kognitive Fähigkeiten: keine Unterschiede Ergebnisse (2): § Verschlechterung aller kognitiven Leistungen innerhalb der 5 –jährigen Beobachtungszeit, unabhängig vom Diabetes § Abnahme der globalen kognitiven Fähigkeiten in 5 Jahren um ca. 15 % (MMSE-Punkte) § Kein beschleunigter Abbau bei allen kognitiven Fähigkeiten bei Menschen mit Diabetes § Wichtigster Risikofaktor für beschleunigten Abbau: Aufgetretener Schlaganfall Schlussfolgerungen der Autoren: § Im Lebensalter zwischen 55 und 75 Jahren: Diabetes und ausgeprägte Hyperglykämie erhöht die Wahrscheinlichkeit, - dass sich der Abbau kognitiver Fertigkeiten beschleunigt - dass sich eine Demenzerkrankung entwickelt Normnahe BZ-Einstellung sinnvoll § Bei hochbetagten Patienten: Geringere Bedeutung des Diabetes und der Hyperglykämie für den Verlauf kognitiver Leistungen Moderate metabolische Therapieziele sinnvoll Psychische Störungen bei geriatrischen Patienten Ursachen psychischer Störungen im Alter § Erhöhtes Krankheitsrisiko und verlängerte Krankheitsdauer - körperliche Erkrankungen - Stoffwechselentgleisungen - Multimorbidität - Nebenwirkungen von Medikamenten § Erschwerte Lebensbedingungen - Ungünstige Wohnsituation/ Verkehrsanbindung - Schlechtere Kontakt- und Freizeitgelegenheiten als Ursache für soziale Isolation - Eingeschränkte ökonomische Ausstattung (vor allem bei älteren Frauen) § Verlustsituationen des höheren Lebensalters - Verlust der körperlichen Unversehrtheit - Austritt aus dem Berufsleben - Verlust von Bezugspersonen - Verlust von Zielvorstellungen und Zukunftserwartungen § Erworbenes kognitives Ausgangsniveau - In frühen Lebensjahren häufig eingeschränkte AusbildungsTrainingsmöglichkeiten für intellektuelle Fähigkeiten Diagnostische Zuordnung psychischer Störungen im Alter § Erschwerte Grenzziehung „pathologisch“ vs „gesund“ - Psychische Störungen zeigen bei Menschen im höheren Lebensalter eine andere Symptomatik als bei jüngeren Erwachsenen - ICD-Diagnosekriterien für psychische Erkrankungen gelten für das gesamte Erwachsenenalter, keine eigenen Kriterien für alte Menschen § Konfundierung von Altersvorgängen mit Kriterien für psychische Störungen - Gefahr: Behandlungsbedürftige psychische Störung wird als „Altererscheinung“ betrachtet - Gefahr: Alter Mensch mit „zugespitzten“ Persönlichkeitszügen wird als „psychisch krank“ eingeordnet Gerontopsychiatrische Störungen § Organisch begründbare Erkrankungen - z.B. dementielle Erkrankungen, Delir § Endogene, psychotische Erkrankungen - z.B. Schizophrenie, im Alter auftretende Wahnerkrankungen § Nicht-psychotische Erkrankungen - z.B. Angststörungen, Depression, Abhängigkeitserkrankungen Häufigkeit psychischer Störungen im Alter (70 – 100) Diagnosen Prävalenz in % • Demenz 13.9 • Depression insgesamt 9.1 Major depression 5.4 Dysthmia 2.0 Demenz mit Depression 1.0 Depressive Anpassungsstörung 0.7 • Depression: Subklinische Symptomatik 17.8 • Angststörung 10.2 • Schizophrene / paranoide Störung: 0.7 Helmchen, H., Baltes, M.M. et al. Psychische Erkrankungen im Alter. In K.U. Mayer & P. Baltes (Hrsg.), Die Berliner Altersstudie, 185 – 220, Berlin: Akademie Verlag Psychische Störungen: Unterschiedliche Verteilung nach Lebensabschnitten Jugendalter Frühes Erwachsenenalter Mittleres Erwachsenenalter Alter • Prävalenz psychischer Störungen über 65 J.: ca. 25% • Zunahme von Demenzerkrankungen • Gesamtmorbidität vergleichbar mit jüngeren Altersgruppen - Substanzabhängigkeit - Depressive Störungen - Angststörungen Zusätzlich erhöhtes Risiko: - Psychotische Erkrankungen (z.B. Schizophrenie) - Demenzen - Depressive Störungen - Angststörungen Häufigste psychische Störungen im Alter: Demenz und Depression 25 21,5 20 15 11,8 10 5 7,9 4,8 0 keine Depression Depression 5 Jahresprävalenz Katon et al. Gen Intern Med 2010 Inzidenz % bzw. Inzidenz pro 1000 Patjanhre % bzw. Inzidenz pro 1000 Patjanhre Depression und Demenzrisiko bei Diabetes: (5 Jahres Follow-up) 3 2,69 2,5 1,83 2 1,5 1 1 1 0,5 0 keine Depression unadjustiert Depression adjustiert Besonderheiten der Depression im höheren Lebensalter § Ausgeprägte Fluktuation der Symptomatik § Abnahme der Major Depression, Zunahme subklinischer Depressivität § Überlagerung der depressiven Symptomatik durch kognitive Störungen § Dominanz somatische Symptome § Achtung: Suicidalität ! Hautzinger C. (2000). Depression im Alter. Weinheim: Beltz Suizid im Alter: Epidemiologie - Trotz sinkender Suizidraten: Fallzahlen pro 100.000 Personen nehmen mit steigendem Alter zu 1 - Nicht berücksichtigt: „verdeckte“ / „stille“ Suizide: Verweigerung der Nahrung und Getränke, Medikamente 1 Deutsches Bündnis gegen Depression e.V. Im Gespräch mit suizidalen älteren Menschen beachten - Hinweise auf Suizidalität ernst nehmen, nicht dramatisieren, aber suizidale Gedanken und Absichten offen ansprechen - Nicht-wertendes Gesprächsverhalten, Verständnis zeigen - Arzt verständigen - Lebensgeschichtliche Zusammenhänge verstehen und einbeziehen - Möglichkeit der Unterstützung im sozialen Umfeld erkunden (Bezugspersonen, soziale Dienste, medizinische Hilfen) - Angebot zur Fortsetzung des Gesprächskontakts machen (Ängste ansprechen, Hilfsmöglichkeiten aufzeigen) Wenn das Altwerden zur Last wird – Suizidprävention im Alter. Hrsg: Arbeitsgruppe ‚Alte Menschen‘, Nationales Suizidpräventionsprogramm für Deutschland Abgrenzung Depression - Demenz Für depressive Störungen sprechen: Für eine beginnende bzw. manifeste Demenz sprechen: 1 § Frühmorgentliches Erwachen mit grüblerisch – pessimistischem Denken § Umkehrung des Schlaf-WachRhythmus § Antriebsminderung § Unkooperatives, misstrauisches, ungeselliges Verhalten § Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken § Flacher Affekt, emotionale Labilität, fluktuierende Stimmungszustände Bei Vorliegen einer depressiven Symptomatik muss mit einer Unsicherheit von bis zu 25% gerechnet werden 2 1 Hautzinger C. (2000). Depression im Alter. Weinheim: Beltz 2 Neher, K.M. & Sowarka, D. (1993): Ergebnisse einer Follow-up-Studie mit dementiell und depressiv Erkrankten. Zeitschrift für Gerontopsychologie und –psychiatrie, 6, 1137-147 Abgrenzung Abgrenzung Depression Depression -- Demenz Demenz Für depressive Störungen sprechen: Für eine beginnende bzw. manifeste Demenz sprechen: 1 § Depressive Episoden in der Vorgeschichte § Keine Hinweise für Psychopathologie und Depression in der Vorgeschichte § Unauffällige neurologische Symptomatik, in der Regel keine Beeinträchtigung: - Aufmerksamkeitsspanne, Orientierung - Sprache - Steuerung von Handlungsabläufen - Mustererkennung und -reproduktion § Neurologische Symptomatik § Klagsame Haltung zu subjektiv erlebten kognitiven Defiziten § Bemühungen, kognitive Defizite zu verbergen 1 Hautzinger C. (2000). Depression im Alter. Weinheim: Beltz § Reduzierte Wachheit, eingeschränkte Konzentration und Aufmerksamkeit § Desorientierung, Verwirrtheit, Vergesslichkeit Bemühungen, kognitive Defizite zu verbergen Angst bei geriatrischen Patienten Angststörungen im Alter: Epidemiologie § Prävalenz (6 Mon.): ca. 10% § Häufigste Angststörung: Generalisierte Angststörung (GAS) § Keine überzeugenden Belege für eine erhöhte Prävalenz von Angststörungen bei Menschen mit Diabetes 2 § Diabetesspezifische Ängste – auch bei älteren Menschen mit Diabetes: - Angst vor Unterzuckerungen - Angst vor Folgekomplikationen 2 1 1 1 Beekman ATF, Bremmer MA, Dorly JH et al. Anxiety disorders in later life: a report from the longitudinal aging study Amsterdam. Int J Geriatr Psychiat 1998; 13: 717-726 2 Evidenzbasierte Leitlinie „Psychosoziales und Diabetes mellitus“. Diab Stoffw 2003; 12: 35-58 Erschwerte Definition von Angststörungen im Alter § Fehlende Diagnosekriterien für pathologische Angstformen im Alter - z.B. fehlende diagnostische Abgrenzung zu beeinträchtigter Befindlichkeit § Zweiseitige „zirkuläre Verleugnung von Ängsten“ - Von Seiten des Patienten: Angst wird bagatellisiert - Von Seiten des Behandlers: Inadäquate Urteilsprozesse § Hohes Ausmaß an Komorbidität - von Angststörungen untereinander - mit weiteren psychischen Störungen (z.B. Depression, Demenz) Behandlung psychischer Störungen bei Menschen ab 65 Anteil (in %) mit Kontakten zu Nervenärzten und Psychotherapeuten Nervenärzte Psychotherapeuten GEK-Report ambulant-ärztliche Versorgung 2007, Schwerpunkt: Ambulante Psychotherapie Behandlung psychischer Störungen bei Menschen ab 65 Behandlung psychischer Störungen bei Menschen ab 65 Was kann man tun? Prävention von Demenz und minimaler kognitiver Beeinträchtigungen (MCI) Unspezifisch n Verringerung des Risikos zerebrovaskulärer Erkrankungen n Gute Blutdruck-, Blutzucker- und Blutfettwerte n Beibehaltung von geistig anregenden Tätigkeiten n Bewegung Spezifisch n ??? Was kann man tun? Balance zwischen Anforderungen und verbliebenen Fähigkeiten Einfache Therapien Realistische Therapieziele • Safety first Spezielle Schulung • Strukturierte Geriatrische Schulung (SGS) Technische Hilfsmittel • Erinnerungshilfen • Telemedizin Erfolgreiche Strategie mit dem Älter werden umzugehen: Selektion, Optimierung und Kompensation Der 80-jährige Arthur Rubinstein ist in Interviews gefragt worden, wie er immer noch ein so guter Konzertpianist sein könne. Er habe sein Repertoire verringert – also eine Wahl getroffen (Selektion). Außerdem übe er diese Stücke mehr als früher. Das ist die Optimierung. Und weil er die ausgewählten Stücke nicht mehr so schnell wie früher spielen konnte, hat er noch einen Kunstgriff angewendet: Vor besonders schnellen Passagen verlangsamte er sein Tempo; im Kontrast erschienen diese Passagen dann wieder ausreichend schnell. Das ist eine Form der Kompensation. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !