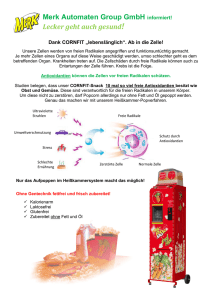Skript zum Kernblock „Forstbotanik und Baumphysiologie I
Werbung

Skript zum Kernblock „Forstbotanik und Baumphysiologie I“ (404 a) Forstbotanischer Teil INHALTSVERZEICHNIS 1. Bau der Zelle 1 1.1 Protoplast 1 1.1.1 Cytoplasma 1.1.2 Selfassembly Systeme 1.1.2.1 Cytoskelett 1.1.2.2 Ribosomen 1.1.3 Dynamische Kompartimente 1.1.3.1 Endoplasmatisches Reticulum 1.1.3.2 Dictyosomen 1.1.3.3 Lysosomen 1.1.4 Nicht dynamische Kompartimente 1.1.4.1 Kern (Nucleus) 1.1.4.2 Plastiden 1.1.4.3 Mitochondrien 1.1.4.4 Vacuolen 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 6 7 7 1.2 Apoplast 1.3 Differenzierung der Zelle 1.4 Lebensdauer von Zellen 8 8 9 2. Fortpflanzung 2.1 Syngamie 10 2.2 Meiosis 2.3 Entwicklung der Sexualität 2.4 Morphologische Organisationsstufen 2.5 Generationswechsel 2.5.1 Generationswechsel der Moose 2.5.2 Generationswechsel der Pteridophyta 2.5.3 Generationswechsel der Samenpflanze 2.5.3.1 Entwicklung der Gymnospermen 2.5.3.2 Entwicklung der Angiospermen 2.5.3.3 Entwicklung des Embryos 10 10 11 11 12 13 14 15 17 19 21 Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I 3. Stammesgeschichte 24 4. Systematik der Samenpflanzen 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 33 4.1 Unterabteilung: Coniferophytina 4.1.1 Klasse : Ginkgoopsida 4.1.2 Klasse: Pinopsida 4.1.2.1 Unterklasse: Cordaitidae 4.1.2.2 Unterklasse: Pinidae 4.1.1.1.1 Ordnung: Voltziales 4.1.1.1.2 Ordnung: Pinales 4.2 Unterabteilung: Cycadophytina 4.2.1 Klasse: Lyginopteridopsida 4.2.2 Klasse: Cycadopsida 4.2.3 Klasse: Benettitopsida 4.2.4 Klasse: Gnetopsida 4.3 Unterabteilung: Magnoliophytina 4.3.1 Klasse: Magnoliopsida 4.3.2 Klasse. Rosopsida 4.3.3 Klasse: Liliopsida -2- Professur für Forstbotanik 1. Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Bau der Zelle Organismen sind aus Zellen aufgebaut, wobei ihr lebender Charakter bestimmte Auswirkungen gegenüber der toten Materie aufweist: eine morphologische Komponente durch die Bildung von deutlich gegen die Umwelt abgegrenzten Individuen mit meist wohl definierter Gestalt sowie einige dynamische Komponenten wie das Aufweisen eines Stoff-(Energie-)wechsels, der Produktivität (Wachstum und Fortpflanzung), einer Reizbarkeit und der Fähigkeit zur sprunghaften Änderung von Eigenschaften (Mutabilität). Die Abgrenzung zwischen dem Tier- und Pflanzenreich wird überwiegend mit dem Vorhandensein von Chlorophyll und der Energiebeschaffung durch das Sonnenlicht (Kohlenstoff-Autotrophie), der meist ortsfesten Lebensweise, der großen äußeren Oberfläche, der offenen Form und der starren Zellwand bei Pflanzen begründet. Auf die meist zu den Pflanzen gerechneten Pilze treffen allerdings nicht alle diese Kriterien zu, so daß sie eine Zwischenstellung einnehmen. 1.1 Protoplast Im inneren Bau der Zelle selbst bestehen weniger Unterschiede zwischen Tier und Pflanze, wenn man vom höheren Differenzierungsgrad bei höheren tierischen Organismen absieht. Die Zellen bestehen aus dem Protoplasten, der kleinsten lebenden morphologischen Einheit, und dem diesen umgebenden Apoplasten (Zellwand), dem toten Anteil der Zelle. In einem vielzelligen Organismus wird der Protoplast durch plasmatische Verbindungen von Zelle zu Zelle zum Symplasten (Summe aller Protoplasten). Durch den hohen Wassergehalt (60-90%) und die Eigenschaft vieler seiner Bestandteile, Hydrathüllen auszubilden, erhält das Protoplasma in Zusammenspiel von pH-Wert und Ionenmilieu Sol- bzw. Gelcharakter. Durch Membranen entstehen Reaktionsräume (Kompartimente), in denen durch selektiven Transport und Permeabilität spezifische Reaktionen ablaufen. Der Protoplast selbst ist gegen die Zellwand hin von einer äußeren Zellmembran, dem Plasmalemma, umgeben. 1.1.1 Cytoplasma Im Protoplasten sind die geformten Organellen der Zelle im Grundplasma (Cytoplasma) eingebettet. In seinem hohen Wasseranteil liegen alle löslichen Bestandteile wie Mineralstoffe, organische Säuren und Aminosäuren in Ionenform gelöst vor. Zeigen Zellen Plasmaströmung, kommt darin mehr der solartige Charakter zum Ausdruck, mehr gelartig ist er in einzelligen Organismen und tierischen Zellen. Im Überstand (Cytosol) nach Zentrifugation befindet sich außerdem ein Gemisch hydratisierter Proteine, meist mit Enzymfunktion. 1.1.2 Selfassembly-Systeme Die Selfassembly-Systeme bestehen meist aus einer Vielzahl von identischen Untereinheiten, deren Größe aber für eine bestimmte Funktion festgelegt ist. Sie formieren sich spontan aus den „Monomeren“. 1.1.2.1 Cytoskelett Da tierische Zellen weder eine starre Zellwand noch eine Druck ausübende Vakuole besitzen, spielt ein Cytoskelett in ihnen eine größere Rolle als in pflanzlichen Zellen. Es bildet ein dreidimensionales Gerüst fädiger Proteine im Cytoplasma, das am Plasmalemma (äußere Membran des Protoplasten) verankert ist. In der pflanzlichen wie in der tierischen Zelle findet man Mikrofilamente (Durchmesser 6 nm) und Mikrotubuli (25 nm), während intermediäre Filamente (10 nm) nur in der tierischen vorkommen. Mikrofilamente bewirken die Plasmaströmung, die aus Tubulin-Untereinheiten aufgebauten röhrenförmigen Mikrotubuli andere Bewegungen in der Zelle, evtl. z.B. bei der Mitose. Mikrofilamente werden aus einem globulären Protein (Actin) zu -1- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Actinfilamenten aggregiert. Quervernetzung mit anderen Proteinen ist möglich. (Eine Wechselwirkung mit Myosinfilamenten ist im tierischen Muskel verwirklicht). Geißeln von einzelligen Eukaryonten sowie von Zoosporen und Gameten bei Algen, Pilzen, Moosen, Farnen und einigen Gymnospermen erhalten ihre Struktur durch Mikrotubuli. Sie sind dort als zwei zentrale einzelne und neun periphere Doppeltubuli angeordnet. 1.1.2.2 Ribosomen Ribosomen bestehen aus einem Komplex ribosomaler Ribonucleinsäure (r-RNA) und Proteinen, deren Anzahl vorbestimmt ist (Durchmesser 15-30 nm). In Prokaryonten und in den Plastiden und Mitochondrien der Eukaryonten kommt ein kleinerer Typ , in Eukaryonten sonst der größere Typ vor. Sie bauen sich jeweils aus einer größeren und einer kleineren Untereinheit auf. Ihre Funktion ist die Proteinbiosynthese. Aktive Ribosomen kommen im Cytoplasma in Gruppen (Polysomen) oder am Endoplasmatischen Reticulum gebunden vor. 1.1.3 Dynamische Kompartimente Eine wichtige Funktion in lebenden Zellen haben Membranen. Sie durchziehen das gesamte Cytoplasma, vermitteln über die Plasmodesmen zu Nachbarzellen und formen sehr unterschiedlich gestaltete Körper (Kompartimente). Durch Membranvesikelbildung und wieder fusionieren unter ihnen erhalten sie einen dynamischen Charakter. In der Regel sind diese Kompartimente lichtmikroskopisch nicht erkennbar; sie bilden die sog. „kleinen Organellen“. Zelle, embryonal ZK: Zellkern; N: Nucleolus; P: Proplastid mit Stärkekorn (st); M: Mitochondrien; D: Dictyosomen; V: Vacuolen; ER: Endoplasmatisches Reticulum; Pl: Plasmodesmen; Sph: Sphärosomen -2- Professur für Forstbotanik 1.1.3.1 Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Endoplasmatisches Reticulum Das Endoplasmatische Reticulum (ER) durchzieht unregelmäßig das Cytoplasma und stellt ein vielfach kommunizierendes System von Kanälen und flachen Hohlräumen dar. Sein Anteil in der Zelle ist stark von ihrem physiologische Zustand abhängig (groß z.B. im Vegetationskegel oder aktiven Herzmuskelzellen). Das ER steht mit der Kernhülle und mit Nachbarzellen in direktem Kontakt. Im elektronenoptischen Bild erscheint das ER z.T. mit Ribosomen besetzt als „rauhes“ ER; es ist dann Ort der Proteinsynthese, möglicherweise besser geeignet zur Produktion einer größeren Menge des gleichen Proteins. Die Proteine werden ins Cytoplasma abgegeben. Zusätzlich ist das ER Produktionsort von sekretorischen Polypeptiden, die aber im Innenraum des ER in Vesikeln zu den Dictyosomen transportiert werden. Das ER ohne Ribosomen wird als „glattes“ ER bezeichnet. Sie kommen beide gleichzeitig in einer Zelle vor. 1.1.3.2 Dictyosomen Dictyosomen bestehen aus einem Stapel von abgeflachten Membranhohlräumen (Zisternen), die sich am Rande in einzelne Vesikel (Golgi-Vesikel) auflösen. Die Summe aller Dictyosomen bildet den sog. Golgi-Apparat. Auch dieser ist Syntheseort und Teil des Transportsystems zugleich. Hier wird das Zellwandmaterial mit Ausnahme der Zellulose synthetisiert, wie zb. Protopektin, aber auch saure Polysaccharide und Schleim in Drüsenzellen. Die hier produzierten Zellwandbestandteile zusammen mit den im ER gebildeten Polypeptiden (z.T. in Form von Glykoproteinen) werden in Vesikeln verpackt durch das Plasmalemma transportiert und in die Zellwand eingebaut. Infolgedessen werden in sich teilenden Zellen am häufigsten Dictyosomen (Bildung der Zellplatte) angetroffen. 1.1.3.3 Lysosomen Lysosomen stellen von einer Membran umschlossene lytische Enzyme (Hydrolasen) dar, deren Funktion die Beteiligung am Abbau von Makromolekülen ist. Sie spielen bei der Stoffaufnahme in Form von Phagozytose bei Protozoen und tierischen Zellen eine größere Rolle. Bei Pflanzen wird eine Beteiligung beim Absterben von Zellen durch Autolyse (Selbstverdauung) diskutiert, wodurch diese erst ihre endgültige Funktion erlangen (Wasserleibahnen). Häufig stellt auch die Vacuole ein großes lysosomales Kompartiment dar. 1.1.4 Nicht-dynamische Kompartimente Auch bei den nicht-dynamischen Kompartimenten findet man z.T. Veränderungen in der Form und einen ständigen Umbau in den sie umgebenden Membranen, doch haben sie im voll funktionsfähigen Zustand eine konstante Form und Größe. 1.1.4.1 Kern (Nucleus) Der Kern macht ungefähr 10% des Plasmavolumens einer Zelle aus. Er bildet eine gewisse Zwischenstellung zwischen beiden Typen der Kompartimente. Er ist von einer doppelten Membran umgeben (Kernhülle), wobei die äußere Bestandteil des ER ist und sich am „Membranfluß“ beteiligt, während die innere davon unberührt bleibt. In der Kernhülle befinden sich besonders strukturierte Poren, über die ein Kontakt mit dem Cytoplasma möglich ist. Im Kern befindet sich die Hauptmasse der genetischen Information in Form von Chromosomen; er ist somit das Steuerzentrum der Zelle. Chromosomen sind anfärbbare Komplexe aus Histonen (basisch) und Desoxyribonucleinsäure (DNA). Die Bedeutung des Kerns für eine Zelle wird an kernlosen Zellen deutlich: Sie zeigen ein nur begrenztes Überleben (z.B. Geleitzellen des Phloems, Erythrozyten). -3- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Im nicht-teilenden Zustand des Kerns ist nach geeigneter Färbung ein Kerngerüst (Chromatin) sichtbar, das in das Karyoplasma (Karyolymphe) eingebettet ist. Außerdem finden sich mehrere Kernkörperchen (Nucleoli), in denen Vorstufen der ribosomalen RNA synthetisiert werden. Ist in einer länger überlebenden Zelle kein distinkter Kern vorhanden, dann ist wenigstens Nucleinsäure in einem nicht umgrenzten Bereich des Plasmas vorhanden, das dann Kernäquivalent (Nucleoid) heißt. Solche Verhältnisse herrschen bei Bakterien und Blau-grünen Algen (Prokaryonten), während alle höher entwickelten Organismen mit einem distinkten Kern zu den Eukaryonten zählen. Im Lichtmikroskop sind Chromosomen trotz Färbung nicht immer sichtbar, was an einem Wandel von der Arbeitsform in die Transportform und entsprechend beim Kern vom Arbeitskern in den Transportkern liegt. Dieser Zusammenhang wird im sog. Zellzyklus beschrieben: Eine Zelle zb. im embryonalen Gewebe ist die meiste Zeit hoch stoffwechselaktiv – die genetische Information ihres Kernes wird abgelesen und in eine Proteinsynthese übersetzt. Die Chromosomen sind dabei nicht sichtbar, es findet dann Synthese statt (S-Phase). Danach geht die Zelle (der Kern) in eine Teilung über. Die Chromosomen werden wieder sichtbar, Synthese findet nun nicht mehr statt. In einem solchen Beispiel (Vicia faba, Senf) kann die Teilung zwei Stunden beanspruchen, bis zur nächsten Teilung können 16 bis 17 Stunden vergehen, wobei neun Stunden für die S-Phase anzusetzen sind. Eine Pause (gap) nach (G1-Phase) und vor (G-2 Phase) der Teilung dauert jeweils drei bis vier Stunden. In der G1-Phase besteht das genetische Material aus einer Chromatide (Längshälfte eines Chromosoms), in der G2-Phase aus zwei Hälften. Dauerzellen und z.B. ruhende Zellen in Knospen und Samen verharren in der G1-Phase.Die Zeit zwischen zwei Teilungen ist die Interphase. Zellzyklus: G1-Phase: "gap" zwischen Mitose und DNA - Replikation; S - Phase: DNA Replikation; G2 - Phase; "gap" zwischen DNA Replikation und Mitose Chromosomen haben in der Transportform einen charakteristischen Bau, der durch das „Aufschrauben“ des DNA-Histon-Komplexes zustande kommt. Dabei ist die im Chromosom enthaltene DNA-Kette ungefähr um einen Faktor 104 verkürzt. Bei den meisten Organismen sind die Chromosomen in jeder Zelle in einer Art-typischen Anzahl vorhanden und jedes einzelne Chromosom als Individuum durch bestimmte Kriterien erkennbar: eine bestimmte Länge, eine Gliederung in zwei z.T. ungleich lange Schenkel durch eine Einschnürung am Centromer und ein -4- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Muster unterschiedlich färbbarer Querbänder. Der nach diesen Kriterien analysierbare Chromosomenstatus wird in einer Karyotypananlyse ermittelt. Nahe verwandte Arten stimmen im Karyotyp überein. In Körperzellen höherer Organismen ist jedes Chromosom doppelt vorhanden, in Gametophyten, Meiosporen und Keimzellen nur einmal. Entsprechend wird ihr Zustand diploid bzw. haploid genannt. In einem bestimmten Stadium des Zellzyklus ist eine Längsspaltung der Chromosomen in zwei Chromatiden als Folge der Replikation der DNA in der S-Phase und als Vorbereitung auf die Kernteilung (Mitose) sichtbar. Bei Eukaryonten geht die Kernteilung mit einer gesetzmäßigen Verteilung der genetischen Information auf die Tochterkerne einher: Es läuft eine charakteristische Folge von im Lichtmikroskop sichtbaren Mechanismen ab, wobei hauptsächlich der Formwechsel der Chromosomen auffällt. Die Mitose ist in vier Abschnitte unterschiedlicher Dauer gliederbar: 1. Die Prophase dauert mehrere Stunden. Sie beginnt mit einer Verkürzung (Aufschraubung) der schon in Chromatiden gespaltenen Chromosomen, wobei ein kompaktes Mitosechromosom entsteht. Es bilden sich im Protoplasten hyaline Zonen, die Polkappen. Das Material der Nucleoli verteilt sich im Cytoplasma, die Kernhülle löst sich in einzelne Vesikel auf, die sich an den Polen ansammeln. Es bildet sich ein Spindelfaserapparat, bei dem die „Fasern“ vom Centromer der Chromosomen zu den Polen reichen. 2. In der Metaphase vervollständigt sich die Kernspindel, die Chromosomen sind jetzt maximal verkürzt, die Chromosomen liegen mit vollständig getrennten Schenkeln vor, sie hängen nur noch am Centromer zusammen. Anschließend ordnen sie sich in eine Ebene zwischen den Polen ein (Äquatorialplatte). Die Metaphase dauert nur wenige Minuten. In diesem Stadium kann eine Karyotypanalyse durchgeführt werden. 3. Die Anaphase dauert ebenfalls nur wenige Minuten. In ihr „wandern“ die Chromatiden nach der Trennung der Centromere mit ihrem Centromer voraus jeweils zu einem Pol. Ein Teil der in der Zelle vorhandenen Mikrotubuli hatte Verbindung mit den Centromeren. Ihre genaue Rolle bei der Bewegung der Chromatiden ist nicht bekannt. Ihre Bedeutung läßt aber die Wirkung von zb. Colchizin, einem „Spindelfasergift“, erahnen: Es verhindert die Aggregation der Tubulin-Untereinheiten zur Bildung der Mikrotubuli, worauf die Verteilung der Chromatiden unterbleibt und nur ein Kern entsteht. Nach Abschluß der Teilung hätte eine solche Zelle einen verdoppelten Chromosomensatz. 4. In der folgenden Telophase aber formieren sich jetzt zwei Tochterkerne: Die Halbchromosomen entschrauben sich wieder – es entsteht die Funktionsform. Es bilden sich jeweils Kernhülle und Nucleoli und der Spindelfaserapparat verschwindet wieder. In der Region der ehemaligen Äquatorialebene bildet sich der Phragmoplast (Zellplatte), der Bereich der neuen Zellwand, der eine hohe Aktivität der Dictyosomen zeigt. Die Zellwand wird von der Mitte ausgehend (zentrifugal) gebildet, während sie bei Prokaryonten an der Mutterzellwand beginnend (irisblendenartig) entsteht. Dieser Teilungsmodus ist in der Starrheit der pflanzlichen Zellwand begründet. Bei der tierischen Zelle beobachtet man nach der Kernteilung die Verengung einer Ringfurche in Höhe der Äquatorialebene, die zur Durchschnürung der Mutterzelle führt. Normalerweise ergibt die Mitose zwei gleich große Tochterzellen (äquale Teilung). In bestimmten Fällen – bei Pflanzen zu Beginn einer Reembryonalisierung, bei höheren tierischen Organismen am Anfang einer Differenzierung von Stammzellen – läuft sie jedoch inäqual ab. Bei Pflanzen entsteht so eine große, die Zentralvacuole enthaltende Zelle und eine kleine, im Verhältnis plasmareichere Zelle. Diese entwickelt sich dann durch weitere Teilungen zb. zur Spaltöffnung, zum Wurzelhaar oder zu einem Teil des Pollenschlauchs. Im Normalfall wird die Chromosomenzahl durch eine Mitose nicht verändert. In besonders stoffwechselaktiven Zellen kann es zu Endomitosen kommen: eine Chromatidentrennung in der -5- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Anaphase unterbleibt und es entstehen nach mehrfacher Wiederholung dieses Vorganges sog. Riesenchromosomen. Das Ergebnis ist dann eine somatische Polyploidie. 1.1.4.2 Plastiden Die Plastiden der höheren Pflanzen (Durchmesser 4-8 µm, Dicke 2-3 µm, linsenförmig) sind von einer Doppelmembran umgeben. Sie sind in der Form der grünen Chloroplasten für die photoautotrophe Lebensweise der eukaryontischen grünen Pflanzen verantwortlich. Nach dem Pigmentgehalt unterscheidet man drei in der Farbe differierende Typen: den grünen Chloroplasten, den gelb-orangenen Chromoplasten und den farblosen Leukoplasten. Die äußere Membran der Plastiden besitzt Poren und ist dadurch permeabel, die innere Membran ist dicht und ist mittels enzymatischer Transportsysteme zum selektiven Austausch mit dem umgebenden Cytoplasma fähig. Im Innern (Stroma) befinden sich ringförmige DNA-Moleküle, die einen Teil der plasmatischen Erbinformation enthält (Gesamtheit einer Pflanze: Plastom) sowie Ribosomen. Da die Plastiden aus einer gemeinsamen embryonalen Form, dem Proplastid, entstehen können, liegt nur ein Typ von Organell vor. Bei der „Metamorphose“ der Plastiden entsteht aus einem weitestgehend undifferenzierten, kleinen Proplastiden im Licht ein Chloroplast, indem die innere Membran in den Stromaraum hinein Einfaltungen bildet, die sog. Thylakoide, die sich von der Membran abtrennen und einzeln als flache Vesikel Stromathylakoide oder im Stapel sog. Grana bilden. Der Leukoplast entsteht entweder direkt aus dem Proplastid oder aus einem Chloroplasten in einem im Dunkeln gehaltenen Pflanzenteil. Er enthält weder Pigmente noch innere Strukturen und kann als Amyloplast der Stärkespeicherung dienen. Im Chloroplasten ist nur kurzzeitig Stärke speicherbar (neben Proteinen und Lipiden). Chromoplasten gelten als Endstufe in der Plastidenumwandlung: Die Entstehung aus Proplastiden , Chloroplasten und Leukoplasten ist irreversibel. Die in Ihnen enthaltenen Carotinoide können im Herbstlaub in globulärer Form (Gerontoplasten) oder in Kristallen sowie an Tubuli oder Lamellen gebunden vorliegen. Chloroplast einer höheren Pflanze (aufgeschnittenes Modell) G: Grana; S: Stromatylakoide 1.1.4.3 Mitochondrien Mitochondrien sind etwas kleiner als Proplastiden . Sie haben ungefähr die Größe von Bakterien: bis 5 µm lang und 0,5 bis 1,5 µm breit. Die sie umgebende Doppelmembran zeigt durch den Besitz von Poren in der äußeren Membran Ähnlichkeit mit Plastiden, die innere Membran bildet aber hier durch Einstülpungen Cristae (faltenförmig) und Tubuli (röhrenförmig). Im Innern (Matrix) sind lösliche Enzyme des Citratcyclus und Fettabbaus lokalisiert, auf der Matrixseite der inneren Membran sitzen Enzymkomlexe der oxidativen Phosphorylierung und der Atmungskette. Auch -6- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Mitochondrien besitzen ringförmige DNA-Moleküle sowie Ribosomen für eine Proteinsynthese einiger eigener Strukturproteine. Wie die meisten Organellen werden sie bei einer Zellteilung zufällig auf die Tochterzellen verteilt. Unabhängig von der Mitose können sich Mitochondrien wie auch Plastiden mittels Durchschnürung vermehren. Auch ihre DNA-Moleküle und die Ribosomen werden dabei zufallsmäßig verteilt. Die offensichtliche Übereinstimmung mehrerer Eigenschaften bei Plastiden und Mitochondrien mit Prokaryonten führt zwanglos zu der Hypothese, daß diese Organellen der eukaryontischen Zellen urprünglich Prokaryonten waren, die im Laufe der Evolution als Endosymbionten in die Zellen höherer Organismen gelangten. Beim Eintritt einer solchen Zelle in die Wirtszelle wird sie mit einer Membranhülle des Plasmalemmas umgeben. 1.1.4.4 Vacuolen Vacuolen sind mit einer wäßrigen Lösung (Zellsaft) erfüllte Räume, die gegen das Cytoplasma durch eine selektiv permeable Membran (Tonoplast) abgegrenzt sind. In Ihrer Gesamtheit stellen sie ein Wasserreservoir des Organismus dar (Vacuom), das allerdings so ausgeprägt nur bei Pflanzen vorkommt. In der ausdifferenzierten Zelle nimmt sie als Zentralvacuole den größten Raum ein, der plasmatische Rest ist dann auf einen dünnen Wandbelag beschränkt. In embryonalen Zellen sind sie sehr klein; sie entstehen möglicherweise aus Lysosomen durch Autolyse deren Inhalts und Zusammenfließen zu größeren Einheiten. Die Funktion der Vacuolen besteht in ihrer Bedeutung für den Wasserhaushalt und über den in ihnen aufgebauten Druck (Turgor) im Zusammenspiel mit der festen Zellwand für die Stabilität zb. ganzer krautiger Pflanzen oder Gewebe, in der Speicherung von Reservestoffen, Exkreten und Ionen sowie in ihrer Rolle im hydrolytischen Stoffwechsel. Evident ist die Speicherung von Reservestoffen wie Fetten, Ölen, Proteinen und Kohlenhydraten in Samen von Kulturpflanzen. Zelle, ausdifferenziert ZK: Zellkern; KH: Kernhülle; N: Nucleolus; Chr: Chromosomen; P: Chloroplasten; M: Mitochondrien; V: zentrale Vacuole (von Plasmasträngen (Cg) durchzogen); C: Cytoplasma; W: Zellwand; Sph: Sphärosomen 1.2 Apoplast Der nicht-lebende Anteil eines Organismus wird als Apoplast bezeichnet. Auf die einzelne (pflanzliche) Zelle bezogen entspricht er der Zellwand. Da der tierische Organismus seine Stabilität meist aus einem Skelett bezieht, verzichtet er schon auf der zellulären Ebene auf die -7- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Bildung einer Zellwand. Da die Pflanzen zu einem großen Teil diese Stabilität aus dem Zusammenwirken der osmotischen Aktivität der Vacuole und der dem entstehenden Druck widerstehenden Zellwand erhält, besitzt die Wand in besonderer Weise Stabilität durch die Einlagerung von Cellulosefibrillen in eine Matrix. Die erste Wandbildung am Ende einer Mitose (Primärwand) ist das Ergebnis überwiegend der Aktivität der Dictyosomen im Bereich des Phragmoplasten. Sie besteht vor allem aus Hemicellulosen, Pektinen und Glykoproteinen, in die einige Cellulosefibrillen eingelagert werden (Anteil ca. 2,5%). Die Verbindung zwischen zwei Zellen bildet die sog. Mittellamelle, die nur aus Matrixsubstanz besteht. Die primäre Wand ist noch in der Lage, auf die Vergrößerung der Vacuole durch ihre Dehnung zu reagiere (Streckung und Weitung). Nach Abschluß des Zellwachstums kann je nach Spezialisierung der Zelle noch eine Sekundär- oder gar eine Tertiäwand mit steigendem Anteil an Cellulose (bis 94%) aufgelagert werden. Der Syntheseort für die Cellulose ist das Plasmalemma. In gequollenem Zustand sind die Wände für Wasser und darin gelöste Stoffe gut passierbar, was durch die Einlagerung von Lignin (einem phenolischen Polymer) beim Verholzen beendet wird. Dadurch erhalten die Zellwände ihre endgültige mechanische Stabilität. Die verholzte Zellwand ist also ein Mischkörper aus (zugfester) Cellulose und (druckfestem) Lignin, der trotz dieser Inkrustation für Wasser passierbar bleibt. In Suberin (Korkstoff) und Cutin (Cuticula-Bestandteil) besitzt die Pflanze Adkrusten, die durch ihren hydrophoben Charakter an oberirdischen Organen die Verdunstung herabsetzen. Eine Sonderstellung bzgl. des chemischen Baues und der Bildungsweise der Zellwand nehmen die Pilze ein. Das Monomer der Wandsubstanz ist hier Chitin (N-Acetylglucosamin), die fädigen Zellen zeigen nur Spitzenwachstum: Die Richtung der Zellplatte nach einer Mitose liegt also meist senkrecht zur Längsrichtung des Fadens. Den Abschluß nach außen bildet für den Protoplasten eine Plasmamembran, das Plasmalemma. Als Vermittler zur Außenwelt kontrolliert es den Transport von Stoffen durch eingebaute CarrierMoleküle, bestimmte Bestandteile an der Außenseite können von anderen Zellen (zb. Pathogenen) erkannt werden, andere sind in der Lage, als Rezeptor Strukturen an anderen Organismen zu erkennen. Speziell bei tierischen Zellen findet man eingebaute Rezeptoren für die Aufnahme von Signalen in Form von Hormonen oder Neurotransmittern. Die Membran kann aus dem Pool von Membranen im Cytoplasma durch einen Vesikeleinbau regeneriert werden; in einem Membranvesikel können auch Stoffe durch das Plasmalemma geschleust werden (Endocytose). Durch das Fehlen einer Zellwand bei tierischen Zellen spielen Wechselwirkungen zwischen der Plasmamembran und dem Cytoskelett (s.u.) eine besondere Rolle. Die dabei involvierten Proteinfilamente haben neben einer Skelettfunktion auch eine Funktion bei Bewegungsvorgängen in der Zelle, wozu sie Verankerungspunkte benötigen, die im Cytoplasma, aber auch in der Plasmamembran liegen. In tierischen Geweben wird der Zwischenraum zwischen den Zellen mit einer Matrix ausgefüllt, deren Hauptbestandteile Hyaluronsäure (saures Polysaccharid), Proteoglykane (Protein plus Glukosaminoglykane, stark hydratisierbar) und Kollagen (Matrixprotein) sind. In bestimmten Geweben befinden sich nur wenige Zellen in einer großen Matrixmasse. 1.3 Differenzierung der Zelle Je nach Höhe der Stellung eines Organismus im System besitzt er eine unterschiedliche Zahl verschiedener Zellen, die je nach ihrer Funktion in Ihrer Form und auch in den Stoffwechselleistungen differieren. Während höhere Pflanzen nur aus einigen –zig Zellsorten aufgebaut sind, besitzen höhere Tiere schon einige hundert verschiede Zellarten. Bei Pflanzen sind die entscheidenden Vorgänge zur Entwicklung aus zb. einheitlich gebauten embryonalen Zellen: a) Vacuolenvergrößerung und Bildung einer zentralen Vacuole, was zur Streckung und Weitung führt -8- Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I b) Wandverstärkung durch Auf- und Einlagerungen: Bildung von Sekundär- und Tertiärwand (zb. bei Festigungsgeweben) c) Synthese und Einlagerung (Speicherung) von Inhaltsstoffen d) damit einhergehende Form- und Funktionsveränderung von Organellen auch in Abhängigkeit von bestimmten Stoffwechselleistungen e) Bildung von Interzellularen, die für den Gaswechsel in bestimmten Geweben notwendig sind f) Auftreten von Riesenchromosomen durch Endomitosen in besonders stoffwechselaktiven Zellen/Geweben Mit dieser Differenzierung geht eine Arbeitsteilung der Zellen eines Organismus einher, die schon bei niederen vielzelligen Organismen durch Zellen, die der Ernährung und der Fortbewegung und solchen, die nur der Fortpflanzung dienen, beginnt. Beim höheren Organismus bilden Zellgruppen mit gleicher Funktion ein Gewebe. Bei Pflanzen ist die Umkehrung der Differenzierung, die Reembryonalisierung, relativ leicht möglich – die Zellen erweisen sich als totipotent. Tierische Zellen verlieren ihre Totipotenz schon wenige Teilungen nach dem Embryonalstadium. Nach ihrem Charakter können Gewebe in Bildungsgewebe (Meristeme) und Dauergewebe eingeteilt werden. Ein Meristem wird primär (Urmeristem) genannt, wenn es von Anfang der Entwicklung embryonal ist und sekundär (Folgemeristem), wenn es aus schon differenzierten Zellen durch Reembryonalisierung entsteht (zb. das Kokkambium). Neben den Meristemen existiert eine große Gruppe meist dünnwandiger Zellen als Grundgewebe (Parenchym). Sie sind häufig fast kugelig (isodiametrisch) und besitzen einen hohen Turgor. Nach ihrer Funktion lassen sie sich in Assimilations-, Speicher-, und Durchlüftungsparenchym untergliedern. Speziell im Blatt unterscheidet man das Assimilationsgewebe nach der Form der Zellen als Palisaden- und Schwammparenchym. Zum Abschluß- und Absorptionsgewebe zählen die Epidermis als äußerer Abschluß oberirdischer primärer Organe , die Rhizodermis wegen ihrer Funktion in der jungen Wurzel zum Absorptionsgewebe und die Endodermis als inneres Abschlußgewebe. Zusätzlich kommen noch Leit-, Festigungs- und Sekretionsgewebe vor mit entsprechender Funktion. Neben diesen in Gewebe eingebundenen Zellen kommen auch spezialisierte Einzelzellen vor als Drüsen-, Haar-, Schließ- und Keimzellen. 1.4 Lebensdauer von Zellen Neben der Einschränkung der Teilungsfähigkeit im vielzelligen Organismus ist im Laufe der Entwicklung auch der Tod von Zellen unvermeidlich. Am bekanntesten ist bei Pflanzen das Absterben von Zellen zusammen mit ihrem Funktionswandel zu Wasserleitelementen bei Tracheiden und Gefäßen, bei nur eine Vegetationsperiode funktionierenden Zellen des Phloems und den Zellen des Kernholzes und der Borke bei Bäumen und Sträuchern. Beim tierischen Organismus kann ein regelrechter Ersatz (turnover) bestimmter Zellen stattfinden, was eine zelltypische Lebensdauer bedingt (Leukozyten wenige Tage, Erythrozyten drei Monate). Man spricht hier vom vorprogrammierten, genetisch gesteuerten Zelltod (Apoptose). Die Zellen werden phagozytiert, im Gegensatz zur Lyse bei einer Nekrose. Neben diesem normalen Zellersatz können auch durch DNA-Schäden oder Virenbefall veränderte Zellen eliminiert werden. Nervenzellen allerdings werden so alt wie der gesamte Organismus. Im höheren tierischen Organismus können manche Körperzellen wie Gefäßwandzellen oder Leberzellen ihre Teilungsfähigkeit erhalten. Alle anderen schon ausdifferenzierten Zellen können nur ersetzt werden, indem Stammzellen sich teilen, wobei die Differenzierungsrichtung festgelegt ist (unipotente Stammzellen), wohingegen Stammzellen der Blutzellen zu verschiedenen Zellen differenzieren können (pluripotent). Bei Bäumen ohne planmäßige Kernholzbildung (z.B. Buche) können Zellen des inneren Holzparenchyms über 100 Jahre lebend bleiben; bei langlebigen baumförmigen Monocotyledonen (z.B. Palmen), bei denen eine ständige Bildung neuen Gewebes durch das Kambium fehlt, können sogar Phloemzellen über 100 Jahre alt werden. -9- Professur für Forstbotanik 2. Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Fortpflanzung Die Teilung von Zellen durch Mitose ist für Einzeller überwiegend, aber auch für einige Vielzeller die Grundlage für ihre Verbreitung (Propagation), um zb. Nahrungsquellen schnell zu erschließen. Es können mit Geißeln aktiv bewegliche Zoosporen oder unbewegliche Aplanosporen (zb. Konidien der Pilze) gebildet werden. Dabei entstehen in schneller Folge dünnwandige, reservestoffarme und gegenüber ungünstigen Lebensbedingungen wenig resistente Zellen. 2.1 Syngamie Bei Eukaryonten wurde aber relativ früh in der Evolution auch die Verschmelzung von zwei Zellen, oft als Folge der Erschöpfung der Nahrungsquelle, entwickelt: Es entsteht eine dickwandige, reservestoffreiche Zelle (mit doppeltem Chromosomensatz), die die ungünstigen Lebensbedingungen besser überdauern kann. Voraussetzung ist, daß diese Zellen geschlechtlich differenziert sind (als Gameten, Keimzellen fungieren) und es einen Mechanismus gibt, der die Verdopplung der Chromosomen an bestimmter Stelle in der Individualentwicklung (Ontogenie) wieder rückgängig macht. Das Verschmelzungsprodukt von zwei haploiden, männlich und weiblich differenzierten Gameten ist die Zygote; sie ist diploid. Sie entsteht durch Verschmelzung zunächst der Plasmen (Plasmogamie), gefolgt von der der Kerne (Karyogamie). Beide Vorgänge beschreiben die Syngamie. Normalerweise folgen die Teilprozesse der Syngamie unmittelbar aufeinander. Bei bestimmten höheren Pilzen wird jedoch eine Phase eingeschoben, bei der beide Kerne separat nach der Plasmogamie in den Zellen enthalten sind (Dikaryophase) und sich bei jeder Mitose synchron teilen. Die Karyogamie erfolgt dort erst zu einem späteren Zeitpunkt vor der endgültigen Zygotenbildung. Bei mehrzelligen Organismen werden die Gameten in speziellen Behältern (Gametangien) gebildet. Werden auch morphologisch unterschiedliche Gameten gebildet, so entstehen die größeren (weiblichen) im Makro-, die kleineren (männlichen) im Mikrogametangium. 2.2 Meiosis Der Mechanismus zur Reduzierung des diploiden (2n) Chromosomensatzes der Zygote auf den haploiden Zustand der Gameten ist die Meiosis (Reduktions-, Reifeteilung), die bei höheren Tieren direkt zu haploiden Gameten führt, bei höheren Pflanzen jedoch zu haploiden Sporen, die erst in der Folge weiterer Teilungen unter Bildung eines Gametophyten die Gameten dann rein mitotisch bilden. Die Meiosis läuft in zwei Teilschritten ab: In der Meiosis I werden homologe (morphologisch identische, je vom männlichen und weiblichen Elter abstammende) Chromosomen voneinander getrennt, in der Meiosis II dann deren Chromatiden (wie in einer Mitose). Bei Pflanzen dauert eine Meiosis Tage bis Wochen. Sie beginnt in der Prophase I mit einer Vergrößerung des Kerns. Ähnlich der Mitose schraubt sich das Chromatin zu Chromosomen auf. Je zwei äußerlich identische (homologe) Chromosomen lagern sich parallel aneinander (Synapsis). Die Chromatiden werden sichtbar, wobei je zwei als Schwester- oder NichtSchwesterchromatiden betrachtet werden können, je nachdem, ob sie zu ein und demselben Chromosom oder zu je einem homologen Chromosom gehören. In diesem Stadium kann es zu Überkreuzungen der Chromatiden (Chiasmata) kommen, in deren Folge es beim späteren Auseinanderweichen der homologen Chromosomen zu einem Bruch der beteiligten Chromatiden und zu einer „falschen“ Wiedervereinigung - also zu einem reziproken Stückaustausch - führen kann. Eine echte Neukombination (Rekombination, crossing-over) liegt nur vor, wenn der Austausch zwischen Nicht-Schwesterchromatiden stattfindet. Die Kernhülle ist nun schon aufgelöst und in der Metaphase I bilden sich die Spindelpole. Die Chromosomenpaare lagern sich in der Äquatorialebene ein, an den Übekreuzungsstellen trennen sich die Chromatiden vollständig. In der folgenden Anaphase I wandern nun ganze Chromosomen zu den Polen, wobei der Zufall - 10 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I entscheidet, welches von einem Elter stammende Chromosomen an welchen Pol gelangt. Es folgt eine Interkinese, die nicht einer Interphase sich mitotisch teilender Zellen entspricht und in der auch keine DNA-Synthese stattfindet. Der Kern hat hier kurzzeitig wieder eine Hülle, die Chromosomen entschrauben sich schwach. Die beiden Kerne sind zwar schon haploid, deren Chromosomen aber in zwei Chromatiden gespalten. Es folgt oft sofort die Meiosis II, die wie eine Mitose über Metaphase II, Anaphase II und Telophase II abläuft, wonach dann nur noch jeweils ein Chromatid jedes Chromosoms in einen Kern gelangt. Nach der Zellteilung liegt dann eine Gruppe von vier haploiden Zellen (Tetrade) zusammen. Der Vorteil der Einschaltung eines Sexualprozesses (Syngamie plus Meiosis) bei der sexuellen Fortpflanzung im Gegensatz zur vegetativen Vermehrung auf Basis der Mitose liegt in der Möglichkeit der Rekombination (Neukombination) auf der Ebene der Zufallsverteilung väterlicher und mütterlicher Chromosomen sowie des Austauschs von Chromatidenstücken in der Meiosis I. 2.3 Entwicklung der Sexualität Im Spektrum der Bildungsweise und der Form der Gameten zeigt sich eine deutliche Anpassung an das Landleben im Laufe der Stammesgeschichte: Bei Einzellern können vegetative Zellen als Gameten fungieren – nur ihr Verhalten läßt sie als Gameten erkennen. Äußerlich sind sie völlig gleich gestaltet, also Isogameten (physiologische Anisogamie). Verschmelzen schon in der Größe mehr oder weniger differierende Gameten, handelt es sich um Anisogameten, die Syngamie ist eine Anisogamie. Oogamie liegt vor, wenn ein unbeweglicher Makrogamet (Oogon) von einem beweglichen (mit Geißeln) befruchtet wird. Anfangs werden die Makrogameten noch in die Umgebung entlassen. Die Befruchtungswahrscheinlichkeit steigt aber, wenn sie im Oogonium verbleiben und die Mikrogameten chemotaktisch anlocken. Die Weiterentwicklung bringt dann eine Reduktion der Makrogameten bis auf eine einzige Eizelle in einem flaschenförmigen „Archegonium“ von den Moosen bis hin zu den Gymnospermen und ein „Antheridium“ (männliches Gametangium) mit vielen begeißelten Mikrogameten (Spermatozoiden) bei den Moosen und Farnen. Die höchste Anpassung an die Verhältnisse auf dem Land besteht in der Gametangiogamie: Ganze Gametangien verschmelzen miteinander und anschließend die Gametenkerne. Der höchste Grad der Reduktion ist in der Somatogamie bei höheren Pilzen verwirklicht: Körperzellen fungieren als Gameten, die aber genetisch unterscheidbar sind. 2.4 Morphologische Organisationsstufen Entsprechend der Entwicklung der generativen Organe als Ausdruck der Anpassung an das Landleben gab es eine Entwicklung im vegetativen, morphologischen Bereich. Dabei haben wohl mehrfach Endosymbionten eine Rolle gespielt, indem z.B. von heterotrophen Organismen photoautotrophe Einzeller (z.B. Blaualgen) aufgenommen wurden. Sie werden mit einer doppelten Membran umgeben und bilden dann ein Kompartiment (Plastiden) mit in diesem Fall der Funktion der Photosynthese. So kann aus einer prokaryontischen Protophyte (Einzeller) eine eukaryontische werden, deren Leistungsfähigkeit höher ist. Der Einzeller wird als unterste Entwicklungsstufe angesehen, ohne daß er systematischen Rang hat: Zu ihm gehören alle Bakterien und Blaualgen (Cyanobakterien), er kommt aber auch bei mehreren Algengruppen und bei Pilzen vor. Der Schritt zum vielzelligen Organismus lief über Zellaggregate, wobei die Tochterzellen nach Zellteilungen anfangs in einer gemeinsamen Schleimhülle verblieben, ohne plasmatische Kontakte auszubilden. Die weitere Entwicklung führte zu Aggregaten mit einer festen Zahl von Teilnehmern und z.T. schon mit einer Arbeitsteilung, wobei die in einer solchen Kolonie nach außen gerichteten (begeißelten) Zellen für die Bewegung zuständig sind, die inneren für die Ernährung und Fortpflanzung. Zellkontakte sind hier schon vorhanden. Die Vielzelligkeit führte anfangs zu unterschiedlichen morphologischen Formen, die als Organisationsstufen bei verschiedenen - 11 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I systematischen Gruppen auftreten. Es kann eine amöboide „Gestalt“ angenommen werden, wobei wandlose, vielkernige Plasmamassen (Plasmodien der Schleimpilze) mit „kriechender“ Fortbewegung entstehen. Zellen mit festen Wänden sind dann auch im Vielzeller für definierte äußere Formen verantwortlich, wobei sie anfangs zu den Lagerpflanzen (Thallophyten) gehören, die keine weiteren Festigungselemente aufweisen. Der Übergang zum Thallus sind schlauchförmige (siphonale Stufe) Organismen, bei denen die Mitose ohne folgende Querwandbildung abläuft; sie sind dann vielkernig (polyenergid). Normale Wandbildung bei der Teilung führt dann zum Fadenthallus (trichale Stufe), wie er bei Grünalgen häufig ist. Pilze und Rotalgen gehören ebenfalls zu dieser Organisationsstufe, da ihr Thallus aus verklebten (Plektenchym) oder nachträglich verwachsenden (Pseudoparenchym) nur spitzenwärts wachsenden Fäden aufgebaut ist. Erst bei Braun- und Grünalgen entstehen dann echte Gewebethalli, bei denen das Wachstum von einer Scheitelzelle ausgeht, deren Teilungsabkömmlinge in mehrere Richtungen abgegliedert werden. Die Zellen besitzen dann auch plasmatischen Kontakt. Die am höchsten differenzierten Thalli findet man bei den Moosen, die andeutungsweise zu den Kormophyten überleiten. Diese sind dann in vielen Eigenschaften an das Landleben angepaßt, wobei die auffälligsten in Zusammenhang mit der Regulation des Wasserhaushalts stehen: Die äußerste Zellschicht wird durch Auflagerungen von Cutin oder Suberin mehr oder weniger undurchlässig gemacht und wird zum Abschlußgewebe. Die zeitweise notwendige Abgabe von Wasserdampf (Transpiration) wird über verschließbare Öffnungen (Stomata) reguliert. Für die Aufnahme von Wasser wird in den Wurzeln ein Absorptionsgewebe entwickelt, für seine Verteilung im Kormus ein weitverzweigtes Leitgewebe. Da die tragende Kraft des Wassers am Land wegfällt, muß ein zusätzliches Festigungsgewebe gebildet werden auch mit der Möglichkeit der Verholzung durch die „Erfindung“ des Lignins bei bestimmten Kormophyten. Bei den generativen Organen fällt mit der Höherentwicklung eine zunehmende Reduktion des Gametophyten und das Unabhängigwerden des Befruchtungsvorganges vom Wasser durch den Ersatz beweglicher (und Flüssigkeit benötigender) Gameten auf. 2.5 Generationswechsel Der Individualzyklus (Ontogenie) eines Organismus läßt sich beschreiben durch die Angabe der Kernphase (haploid oder diploid) von Teilabschnitten, die sich durch ihre Fortpflanzungsweise unterscheiden. Solch ein Teilabschnitt wird als Generation bezeichnet. Zusätzlich wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem die Zygote gebildet wird und die Meiosis abläuft. Sind Teile dieser Angaben nicht möglich, kann zb. eine systematische Zuordnung nicht erfolgen. Prinzipiell können drei Typen von Ontogenien unterschieden werden: Beim Diplonten sind alle Stadien diploid bis auf die Gameten. Aus der Zygote entsteht durch viele mitotische Teilungen ein diploider vegetativer Körper, der dann durch Meiosis Gameten bildet. Dieses Schema trifft für alle Metazoen zu. Im Gegensatz dazu sind bei Haplonten außer der Zygote alle Zellen haploid. Die Zygote wächst weiter, indem zuerst die Meiosis abläuft. Den dritten Typ kann man sich formal aus dem Haplontenschema ableiten, indem die Zygote nicht sofort eine Meiosis durchläuft, sondern sich mitotisch teilend zu einem zweiten, morphologisch häufig anders gestalteten, diploiden Abschnitt der Ontogenie entwickelt, auf dem dann bestimmte Zellen zum Abschluß auf dem Wege der Meiosis Sporen bilden. Es liegen dann zwei sich abwechselnde Generationen vor, der haploide, gametenbildende Gametophyt und der diploide, sporenbildende Sporophyt. Aus den keimenden Sporen bilden sich wieder Gametophyten. Der Sexualprozeß hat sich auf beide Generationen verteilt: Syngamie auf dem Gametophyten und Meiosis auf dem Sporophyten. Dieses Schema der „Haplo-Diplonten“ kommt bei vielen Algen und Pilzen sowie bei allen Moosen und höheren Pflanzen jeweils in charakteristischer Ausprägung vor. Variationsmöglichkeiten entstehen durch die Zahl der sich abwechselnden Generationen und deren Kernphase, durch die Art ihrer Syngamie und auch durch die unterschiedliche morphologische - 12 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Ausprägung von Gametophyt und Sporophyt. Selbst der Gametophyt kann sich noch unterschiedlich differenzieren, zb. wenn er nur zur Bildung einer Sorte von Gameten in jeweils anders gestalteten Gametangien in der Lage ist (getrennt geschlechtlich). Der Vorteil des Generationswechsels mit der Betonung des Sporophyten bei den höheren Pflanzen liegt wohl in der Vermehrung der Zahl der Meiosen pro Individuum, wodurch sich das Rekombinantenspektrum vermehrt und die Anpassungsfähigkeit steigt. 2.5.1 Generationswechsel der Moose Bei den Moosen ist die grüne Pflanze der Gametophyt. An ihrer Spitze werden Archegonien mit je einer Eizelle und Antheridien mit einer Vielzahl von Spermatozoiden gebildet. In einem Wassertropfen schwimmen sie chemotaktisch angelockt zur Eizelle, es findet die Befruchtung zur Zygote statt. Diese wächst zur gestielten Sporenkapsel aus und bleibt dabei mit dem Gametophyten verwachsen. In der Kapsel erfolgt in vielen Sporenmutterzellen die Meiosis. Bei der unselbständigen gestielten Kapsel handelt es sich um den Sporophyten. Aus den keimenden haploiden Sporen bildet sich wieder der Gametophyt, der anfangs als fädiges Protonema erscheint, an dem dann Knospen entstehen, die zu Moospflänzchen weiterwachsen. Der vorliegende Generationswechsel ist heteromorph: Sporo- und Gametophyt sind morphologisch voneinander unterschieden. Entwicklungsschema eines diözischen Mooses. G: Gametophyt (fädiges Protonema und grüne Moospflanze); S: Sporophyt (gestielte Kapsel); R !: Meiosis 2.5.2 Generationswechsel der Pteridophyta (Farne im weiteren Sinn, i.w.S.) Die zu den Pteridophyta gehörenden Bärlappgewächse, Schachtelhalme und Farne im engeren Sinn (i.e.S.) besitzen einen heteromorphen Generationswechsel. Der Gametophyt ist bei ihrer größten Gruppe, den Farnen i.e.S. (Klasse Pteridopsida), das wenige Millimeter im Durchmesser große, grüne, thallöse Prothallium, das mittels Rhizoiden am Boden haftet. Es bildet mehrere Archegonien und Antheridien aus, wobei auch hier Wasser zur Befruchtung der Eizelle nötig ist. Der aus der Zygote sich bildende grüne Sporophyt ist die eigentliche Farnpflanze mit Wurzeln, Sproß und Blättern. In speziellen Behältern (Sporangien) auf den Blättern wird durch Meiosis eine große Zahl von Sporen gebildet. Es gibt Farne, bei denen eine - 13 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Differenzierung einsetzt in Blätter, die mehr der Bildung der Sporen (Sporophylle) und solche, die mehr der Ernährung durch Photosynthese (Trophophylle) dienen. Farne, die nur eine Sorte Sporen bilden, aus denen dann auch nur gleich gestaltete Prothallien auskeimen, sind isospor. Heterospore Farne bilden in unterschiedlichen Sporangien (Mikro- und Makrosporangien) Mikro- und Makrosporen auf Mikro- und Makrosporophyllen. Aus einer Mikrospore keimt ein Mikroproprothallium aus, das nur Antheridien, aus der reservestoffreicheren Makrospore keimt ein Makroprothallium, das nur Archegonien bildet. Bei den Bärlappgewächsen (Klasse Lycopodiopsida) ist die heimische Gattung Lycopodium isospor, der Moosfarn Selaginella heterospor. Betrachtet man die Entwicklung der Gattung Selaginella genauer, findet man Tendenzen, die in der Evolution zu den höchst entwickelten Samenpflanzen führten: Beide Sporangiensorten werden in demselben Sporophyllstand gebildet. In den Mikrosporangien werden viele Sporen gebildet, die noch im Sporangium keimen. Das Mikroprothallium ist wenigzellig und verbleibt im Sporangium; es fungiert als Ganzes als ein (reduziertes) Antheridium. Nach der Meiosis in einer Makrosporenmutterzelle verbleiben die vier Makrosporen im Makrosporangium. Vom Makrosporophyll wird eine zusätzliche Hülle (Integument) gebildet, die am Scheitel offen bleibt für den Zutritt der Spermatozoiden. Jedes entstehende Makroprothallium bildet wenige Archegonien. Auch der nach der Befruchtung entstehende junge Sporophyt bleibt anfangs im Makrosporangium (wie ein Same). Die Sporophylle stehen gehäuft an der Sproßspitze (Blütenstand) und sind im Zustand der Reife ähnlich einem Samenzapfen gebaut. Sporophyllstand ("Blüte") von Selaginella mi: Mikrosporangium mit vielen Mikrosporen; ma: Makrosporangium mit vier Makrosporen ; Li: Libula (nach Wettstein) Die heute lebenden (rezenten) Schachtelhalme (Klasse Equisetopsida) sind isospor, nur fossile Formen sind heterospor, während die Farne i.e.S. überwiegend isospor sind bis auf wenige Wasserfarne. - 14 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Entwicklungsschema eines Farnes i. e. S. G: Gametophyt; S: Sporophyt; R !: Meiosis 2.5.3 Generationswechsel der Samenpflanzen (Spermatophyta) Aus der Kenntnis der Ontogenie der heterosporen Farne hat Hofmeister (1851) geschlossen, daß eine direkte Entwicklungslinie von den Moosen zu den isosporen Farnen, von diesen zu den heterosporen Farnen und direkt zu den Samenpflanzen besteht. Die Haupttendenz dabei ist die Reduktion der Gametophyten zugunsten einer Höherentwicklung der Sporophyten. Bevor die Homologien zwischen den heterosporen Farnen und den Samenpflanzen bekannt waren, hatten sich für die homologen Organe bei den höheren Pflanzen schon andere Fachausdrücke durchgesetzt, die auch heute noch Verwendung finden. Auf der Ebene der Mikrosporenentwicklung entsprechen: der Mikrospore - einkernige Pollenkörner, den Mikroprothallien (männlicher Gametophyt) – das mehrzellige Pollenkorn bzw. der Pollenschlauch, dem Mikrosporangium – der Pollensack, dem Mikrosporophyll – das Staubblatt sowie auf der Makrosporenebene der Makrospore – der einkernige Embryosack (Embryosackzelle), dem Makroprothallium (weiblicher Gametophyt) – das primäre Endosperm (bei Gymnospermen), dem Makrosporangium – der Nucellus und dem Makrosporophyll – das Fruchtblatt. Auch bei den Samenpflanzen liegt also ein Generationswechsel vor, wobei allerdings große Teile der Gametophyten nicht mehr frei vorkommen und zudem mikroskopisch klein sind. Die Meiosis führt zur Bildung einkerniger Pollenkörner und der Embryosackzellen. Die sich daraus entwickelnden Prothallien sind stark zurückgebildet: Das männliche Prothallium ist das mehrzellige Pollenkorn und der sich daraus entwickelnde Pollenschlauch, das weibliche das primäre Endosperm, das vom Sporophyt getragen und ernährt wird. Die Embryosackzelle - 15 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I (Makrospore) verläßt den Nucellus (Makrosporangium) nie ebenso wie das Endosperm. Die Eizelle entsteht z.T. noch in einem Archegonium. In den Pollensäcken (Mikrosporangien) entstehen durch Meiosis aus Sporenmutterzellen einkernige Pollenkörner, aus denen durch wenige Zellteilungen ein oft passiv flugfähiges Pollenkorn entsteht. Damit hat die Prothalliumentwicklung schon begonnen. In diesem Stadium bestäuben sie eine Blüte. Zur Befruchtung muß das Pollenkorn sich zum Pollenschlauch weiterentwickeln und zur Samenanlage wachsen. Hier werden ohne Antheridienbildung entweder Spermatozoide oder häufiger unbewegliche Spermakerne gebildet, die als Gameten fungieren und die Eizelle befruchten. Der sich nun entwickelnde Embryo (junger Sporophyt) wird von ein oder zwei Integumenten zusammen mit seinem Nährgewebe (noch nicht aufgebrauchtes Endosperm) umhüllt. Dieses Stadium stellt einen Ruhezustand dar und eine neue Verbreitungseinheit. Der Begriff „Diaspore“ für funktionelle Verbreitungseinheit kann über den Samen hinausgehen (zb. Frucht oder Fruchtstand). Die Sporophylle (Frucht- oder Staubblätter) sind meist an gestauchten Sproßenden in Wirteln inseriert und bilden zusammen mit Hüllorganen (Kelch- und Kronblätter) Blüten. Ihre Entwicklung in der Evolution ging über zerstreut stehende Sporophylle an fortwachsenden Hauptachsen über gehäuft an Seitenachsen mit begrenztem Wachstum stehenden hin zu einer quirligen Anordnung. Dabei wurde die Zahl der Organe allmählich reduziert, die Achsen stark gestaucht und durch die Einbeziehung weitere Blätter häufig ein Schauorgan gebildet. 2.5.3.1 Entwicklung der Gymnospermen Die Abteilung der Spermatophyta wird in die Unterabteilungen Coniferophytina (gabel- und nadelblättrige Nacktsamer), Cycadophytina (fiederblättrige Nacktsamer) und Angiospermae - 16 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I (Bedecktsamer) gegliedert, wobei die ersten beiden Unterabteilungen als Entwicklungsstufe Gymnospermae (Nacktsamer) der Entwicklungsstufe Angiospermae gegenübergestellt werden. Bei den Gymnospermen sind die carpellaten („weiblichen“) und staminaten („männlichen“) Blüten auf derselben Pflanze vorhanden (monözisch); („weiblich“ und „männlich“ sollte nur für haploide Zellen/Gewebe verwendet werden wie für Gameten oder Prothallien, nicht für Sporophyten, die Blüten mit nur Fruchtblättern (carpellat) oder nur Staubblättern (staminat) besitzen). Die carpellaten Blüten sind in einem zapfenförmigen Blütenstand angeordnet. An der Zapfenspindel stehen verholzende Deckschuppen in wechselständiger Anordnung, in deren Achsel eine Samenschuppe, die die Samenanlage trägt, sich bildet. Oft verwachsen beide, ohne daß die Samenanlage umhüllt wird. Der Komlex aus Deck- und Samenschuppe stellt die Einzelblüte dar. Die staminaten Blüten bestehen hauptsächlich aus zahlreichen schraubig angeordneten Staubblättern mit je zwei Pollensäcken: unterhalb davon können wenige vergängliche Schuppenblätter stehen. Die Samenanlage ist vom Grunde her von einem Integument umhüllt, das an der Spitze eine Öffnung (Mikropyle) freigibt und dort eine Pollenkammer bildet. Die Hauptmasse der Samenanlage bildet das Nucellusgewebe, in dem aus einer Embryosackmutterzelle nach Meiosis vier einkernige Embryosackzellen entstehen. Nachdem drei davon zugrunde gegangen sind, ist die verbliebene die Makrospore. Die Entwicklung zum weiblichen Gametophyten beginnt mit vielen freien Kernteilungen. Später werden auch Zellwände gebildet. Dieses zukünftige Nährgewebe ist das primäre Endosperm. Zur Mikropyle hin werden mehrere Archegonien (Sequoia bis zu 60), meist jedoch nur zwei, angelegt. Gekeimtes Pollenkorn der Kiefer a: Antheridialzelle; v: Kern der vegetativen Zelle Längsschnitt durch die Samenanlage von Picea abies e: Makrospore; a: Archegonien; c: reduzierter Halsteil des Archegoniums; o: Eizelle; n: Kern; nc:Nucellus; p: Pollenkörner; t: Pollenschlauch; i: Integument In den Pollensäcken (Mikrosporangien) durchlaufen viele Pollenmutterzellen eine Meiosis – es entstehen jeweils vier einzellige Pollenkörner. Nach mehreren inäqualen Teilungen (Araucaria ca. - 17 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I 40), liegt eine große Antheridiummutterzelle und mehrere an die Wand gedrückte Prothalliumzellen vor. In diesem Stadium wird der Pollen vom Wind verbreitet, wozu er häufig durch Abheben der äußeren Pollenwandschicht mit Luftsäcken ausgerüstet ist. Gelangt er im Bereich der Mikropyle auf den Nucellus, wächst er zum Pollenschlauch aus. Dabei teilt sich die Antheridiummutterzelle in eine große vegetative Pollenschlauchzelle und eine kleinere generative Zelle (Antheridiumzelle). Eine weitere Teilung der generativen Zelle ergibt eine sterile Zelle und eine spermatogene Zelle, die bei höheren Gymnospermen direkt als Gamet fungiert. Die Übertragung des Gameten mittels Pollenschlauch wird als Siphonogamie bezeichnet. Bei der Gattung Ginkgo und der Unterabteilung der Cycadophytina werden durch eine weitere Teilung der spermatogenen Zelle zwei begeißelte Spermatozoide (Zoidiogamie) gebildet, die bei letzteren eine Größe von 0,3 mm erreichen und die größten Gameten im Tier- und Pflanzenreich darstellen. Zwischen Bestäubung und Befruchtung können mehr als zwölf Monate vergehen. Bei der eigentlichen Syngamie sind die Pollenkammer und die Archegonien mit Flüssigkeit gefüllt, in der die Spermatozoiden zur Eizelle schwimmen. Die weitere Entwicklung führt von der Zygote zu einem Proembryo. Entwicklungsschema einer Gymnosperme (Pinus) G: Gametophyt; S: Sporophyt; R !: Meiosis; A: keimender Same; B: Sprosse mit Achsen, Nadeln sowie staminaten und carpellaten Blütenständen; C: staminate Blüte und carpellater Blütenstand (junger Zapfen); D: Staubblatt mit Pollensack und Pollenkörnern (links), Deckschuppe Samenschuppekomplex, darauf Samenanlage (rechts); E: carpellate Blüte zur Zeit der Befruchtung mit weiblichem Gametophyten; F: reife Zapfenschuppe, kreuzschraffiert: haploides primäres Endosperm (aus Braun 1982). - 18 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I 2.5.3.2 Entwicklung der Angiospermen Die Samenanlage ist bei den Angiospermen in einer von den Carpellen gebildeten Kammer (Fruchtknoten) eingeschlossen. Die Gesamtheit aller Fruchtblätter einer Blüte bezeichnet man als Gynoeceum, die der Staubblätter als Androeceum. Zur Aufnahme des Pollens trägt der verlängerte Teil des Fruchtknotens, der Griffel, meist gefiederte Narben. Im Gegensatz zu den Gymnospermen wird hier die Samenanlage von zwei Integumenten umhüllt, die ebenfalls an der Spitze eine Öffnung (Mikropyle) freilassen. Der Nucellus nimmt auch hier den meisten Raum ein. Schematische Darstellung der Befruchtung bei einer Blütenpflanze N: Narbe; p: gekeimte Pollenkörner; s: Pollenschlauch; t: Mikropyle; e: Eizelle; A: Antheren (links quer-, rechts längsgeschnitten) - 19 - Schematische Darstellung des oberen Endes des Embryosacks ez: Eizelle; s: Synergiden; ps: Rest des Pollenschlauches; ek: sek. Embryosackkern; mk: generative Kerne Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Die Staubblätter (Stamina) bestehen aus dem Stiel (Staubfaden, Filament) und die von ihm getragene Anthere (Staubbeutel). Die Anthere besteht aus vier Pollensäcken, wovon je zwei eine Theka bilden. Die beiden Theken sind durch das Konnektiv miteinander und mit dem Filament verbunden. Meist sind die Sporophylle von einer Hülle (Perianth) umgewandelter Laub- oder Staubblätter umgeben, dem Kelch (Kalyx) und der Krone (Corolla). In den Pollensäcken entstehen nach Meiosis in vielen Pollenmutterzellen einkernige, haploide Zellen (Mikrosporen), die nach wenigen Zellteilungen als Pollen verbreitet werden. Durch eine inäquale Teilung entsteht eine große Pollenschlauchzelle und eine linsenförmige generative Zelle. Im wachsenden Pollenschlauch teilt sich letztere in zwei Spermazellen. In diesem Zustand wächst der Pollenschlauch im Griffelgewebe bis zur Mikropyle der Samenanlage. Der männliche Gametophyt (fertiger Pollenschlauch) bildet kein Antheridium mehr. Es werden nie aktiv bewegliche Gameten gebildet. Längsschnitt durch eine Samenanlage einer Angiosperme. äJ: äußeres, iJ: inneres Integument; M: Mikropyle; N: Nucellus; E: Embryosack; S: Synergiden; Ez: Eizelle; Ek: sek.Embryosackkern; A: Antipoden. Die Entwicklung zum weiblichen Gametophyten beginnt mit der Meiosis in der Embryosackmutterzelle. Von den entstehenden vier Embryosackzellen gehen drei zugrunde (wohl ein Fall von Apoptose bei Pflanzen), die überlebende ist eine Makrospore. Nun folgen drei freie Kernteilungen, worauf acht Kerne im Embryosack vorhanden sind, die sich wie folgt gruppieren: Die sich abgrenzende Eizelle orientiert sich, flankiert von zwei Synergiden, die wohl einem Teil des ehemaligen Archegoniums homolog sind, an dem der Mikropyle zugewandten Pol, am gegenüberliegenden Pol gruppieren sich drei Zellen zu den sog. Antipoden, die zwei verbliebenen Kerne lagern sich zu den Polkernen in der Mitte der Zentralzelle zusammen. Dieses Achtzellstadium ist das fertige weibliche Prothallium. Vor der Befruchtung der Eizelle durch eine Spermazelle verschmelzen die beiden Polkerne zum diploiden sekundären Embryosackkern. Die Bestäubung erfolgt bei vielen Angiospermen durch Insekten (Zoogamie), wodurch der Erfolg der - 20 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Befruchtung erhöht wird. Sie beginnt mit dem Wachstum des Pollenschlauches, der den männlichen Gameten an eine Synergide „übergibt“; es folgt die Verschmelzung der plasmaarmen Spermazelle mit der plasmareichen Eizelle (Plasmogamie und sofort Karyogamie). Die zweite Spermazelle des Pollenschlauches ist nur deswegen nicht der Gamet, weil sie nicht mit der Eizelle verschmilzt, sondern sie verschmilzt mit der diploiden Zentralzelle, um nach vielen Zellteilungen das triploide sekundäre Endosperm zu bilden. Das Endosperm der Angiospermen entwickelt sich also erst nach der Befruchtung – insgesamt werden die beiden Zellverschmelzungen als „doppelte Befruchtung“ bezeichnet, was genau genommen nur auf die erste zutrifft. Entwicklungsschema einer Angiosperme G: haploider Gametophyt; S: diploider Sporophyt; R !: Meiosis; A: Pflanze mit Wurzelsprossachse, Blättern und zwittriger Blüte; B: offene Blüte mit Blütenhülle, Staubblättern und Fruchtblättern als Fruchtknoten mit Samenanlage; C: Same; D: keimender Same. (nach Braun, 1982) 2.5.3.3 Entwicklung des Embryos Bei der weiteren Entwicklung von der Zygote zum Embryo im Samen zeigen sich einige Unterschiede zwischen den Gymno- und Angiospermen. Die Zygote der Gymnospermen entwickelt sich zu einem fädigen Proembryo, dessen Aufgabe es ist, den an seiner Spitze sich bildenden Embryo in frisches Nährgewebe zu schieben. Die ersten Teilungen ergeben vier freie Kerne, die nächste vier Zellen (vier freie Kerne gehen zugrunde). Aus diesen vier Zellen (Rosettenzellen) bilden sich durch zwei weitere Teilungen vier langgestreckte Suspensorzellen und an deren Spitze je eine kleine Köpfchenzelle. Der künftige Embryo kann sich nun aus einer, aus zwei oder aus vier Köpfchenzellen bilden. Auf dieser Stufe kann es zur Bildung von mehreren Embryonen führen, wobei meist nur der die Entwicklung vollendet, der am weitesten ins Nährgewebe geschoben wurde. Außer der Polyembryonie auf dieser Stufe besteht eine weitere Möglichkeit dazu in der Befruchtung von mehr als einem Archegonium. Es findet aber in jedem Fall hier schon eine Selektion statt. - 21 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Entwicklung des Embryos einer dicotylen Pflanze. E.Z.: Reste der Eizelle; S: Suspensor; e: Embryo; Vs: Vegetationspunkt des Sprosses; Vw: Vegetationspunkt der Wurzel; C: Cotyledonen; W: Wurzel; 8.) fertiger Embryo; H: Hypocotyl; Kurzzeitig wird nun eine dreischneidige Scheitelzelle gebildet, wobei eine zylinderförmige Gestalt entsteht. In einer bestimmten Entfernung von der Spitze wird nun als erstes die Wurzelanlage mit der Wurzelhaube sichtbar, der Abschnitt bis zur Spitze ist das Promeristem für das Hypocotyl (künftiges Gewebe zwischen Sproß und Wurzel), erst zum Schluß ist an der Spitze die Differenzierung in Vegetationskegel (Plumula) und Keimblätter (Cotyledonen) erkennbar. In diesem Stadium beginnt meist eine Samenruhe. Der fertige Same enthält den Embryo, evtl. noch Reste des Suspensors, umgeben vom noch nicht verbrauchten primären Endosperm. Darauf folgt eine Schicht des Nucellus sowie die Samenschale entstanden aus dem Integument, meist mit einer harten äußeren und einer weichen inneren Schicht. Wenn der Zapfen den Samen freigibt, kann er sofort verbreitet werden. Hüllen wie eine Frucht (aus Fruchtblättern) kommen bei Gymnospermen nicht vor. Anhängsel am Samen wie z.B. Flügel sind Auswüchse des Integuments. Bei den Angiospermen ist der Suspensor wenigzellig. Nach zwei oder drei Zellteilungen teilt sich nur noch die Köpfchenzelle weiter. Durch Änderung der Teilungsrichtung wird ein kugelförmiger, achtzelliger Abschnitt gebildet, bei dem schon mit den obersten vier Zellen der Cotyledonarbereich festliegt, die Zelletage darunter gibt das Hypocotyl. Erst später wird die oberste Suspensorzelle zur Wurzelinitiale. Durch weitere (tangentiale) Teilungen tritt eine - 22 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Differenzierung in einen äußeren Tunica- und einen inneren Corpusbereich auf. Wenn sich dann die zwei Keimblätter bei Zweikeimblättrigen (Dicotyledonen) bilden, liegt die Plumula geschützt zwischen ihnen, bei Einkeimblättrigen (Monocotyledonen) liegt der Vegetationskegel seitlich. Die Keimwurzel (Radicula) wird zuletzt angelegt. Geht der Embryo bzw. der Same in sehr früher Entwicklung in die Ruhephase über, wird noch relativ viel Endosperm vorhanden sein, von dem der Same noch nach der Keimung zehrt. Häufig dienen aber die Cotyledonen (zb. Fabaceae) als Reservestoffspeicher; dann sind sie schon im Samen mächtig und übernehmen nach der Keimung die Ernährung des jungen Keimlings. Die bei Angiospermen typische Fruchtbildung beginnt oft schon früh in der Entwicklung nach der Befruchtung häufig auch unter Beteiligung von Achsengewebe, das dann den Fruchtknoten zusätzlich umwächst. Die Frucht ist dann eine Bildung, die die Samen bis zu Ihrer Reife umschließt und zu ihrer Verbreitung dient. Sie kann aus einer Einzelblüte oder ganzen Blütenständen entstehen. Die Variationsmöglichkeiten in der Samengestalt sind enorm durch die Ausbildung von Haaren, die Speicherung von Reservestoffen in verschiedenen Geweben und die Bildung sehr unterschiedlich großer Samen (Orchideen 0,002 mg, Palmen 8-9 kg). Hinzu kommt noch die Variabilität durch die unterschiedliche Ausgestaltung der Frucht, je nach Bau der Fruchtwand (Pericarp), einmal zum Schutz der Samen, aber auch ihrer besseren Verbreitung dienend. Sie kann als Ganzes zu einer trockenen, festen Hülle (sklerenchymatisch bei Hasel) oder insgesamt fleischig werden (Beeren), die äußere Schicht (Exocarp), die der Epidermis entspricht, kann sich verfärben, das mittlere Mesocarp kann fleischig ausgebildet sein und die innere (Endocarp) steinig (Steinfrüchte, Kirsche und Walnuß) und das Mesocarp faserförmig, das Endocarp steinig wie bei der Kokosnuß. Ansonsten werden Früchte nach der Zahl der Fruchtknoten, aus denen sie entstanden sind, gegliedert. Geht eine Frucht aus nur einem Fruchtknoten hervor, handelt es sich um Einzelfrüchte, wobei noch zwischen Öffnungsfrüchten, die sich nach der Reife selbst öffnen (z.B.. Hülse der Fabaceae und Schote der Brassicaceae), und Schließfrüchten, bei denen die Samen bei der Verbreitung in der Fruchtschale bleiben (zb. Beere des Kürbis, Nüsse bei Hasel und Eiche sowie Steinfrüchte). Bilden mehrere Fruchtknoten einer Blüte eine gemeinsame Frucht, spricht man von Sammelfrüchten wie zb. die Himbeere als Sammelsteinfrucht und die Erdbeere als Sammelnußfrucht. Bildet ein ganzer Blütenstand (Infloreszenz) eine einheitliche Frucht, liegt ein Fruchtstand vor (z.B.. Lonicera und Fagus nur zwei, Castanea drei und bei der Feige viele Blüten). - 23 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Verschiedene Fruchtformen. a bis d: Querschnitte durch einen Balg (a), Hülse (b), Schote (c) mit falscher Scheidewand und Kapsel (d); e bis m: Nußfrüchte: Corylus avellana L. (e), geflügelte Nüsse von Betula (f), Carpinus betulus L. (g), Ulmus (h), Fraxinus excelsior L. (i); Nüsse in einer Cupula von Fagus (k, Buchecker), Quercus (1), Castanea (m); Spaltfrucht von Acer platanoides L. (n); Steinfrucht (o); Sammelnußfrucht von Rosa (p, Hagebutte); Sammelsteinfrucht (q, Brombeere oder Himbeere); Apfelfrucht = Sammelbalgfrucht und Fruchtstand aus Steinfrüchten von Ficus carica (Feige). 3. Stammesgeschichte (Phylogenie) Nach der chemischen Evolution, bei der in der Uratmosphäre organisch-chemische Verbindungen (sog. „Bausteine des Lebens“) entstanden, begann die organismische Entwicklung, zunächst wohl als Ansammlung von organischen Verbindungen umgeben von einer Protein-Lipid-Membran mit der Möglichkeit der Stoffzufuhr („Wachstum“) und der Herausbildung energiespeichender Systeme und stoffwechselartiger Prozesse. Belege für eine Entwicklung von echten Organismen sind nicht vorhanden. Die Entwicklung von niederen Organismen (einzellig bis koloniebildend, nur Kernäquivalent) wird geschlossen aus der Abstufung unterschiedlicher Differenzierung heute lebender (rezenter) Formen. Einzige Möglichkeit der direkten Beweisführung für eine Evolution besteht im Auffinden von Resten von heute allerdings ausgestorbenen Organismen oder deren Versteinerungen (Fossilien). Geologische und klimatische Kräfte führen zu Abtragungen und Ablagerungen zusammen mit toten Resten von Organismen in Sedimenten. Die Erhaltung der Fossilien ist gut, wenn Lebensort und „Begräbnisort“ der Organismen ungefähr identisch sind (autochthone Fossilien). Ablagerungsorte sind häufig ehemalige Küsten, Seen und Moore. Die Fossilisierung beginnt nach dem Tod eines Organismus mit einer Fäulnis (unter Luftabschluß; sonst Verwesung) unter Bildung von z.B. Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Bitumenstoffen. Bitumierung führt zu Erdölbildung. Ist nur anfangs Sauerstoff zugegen, handelt es sich um Inkohlung: Sie führt aus Pflanzenmaterial zu Torf, Braunkohle oder Steinkohle, wobei widerstandsfähige Pflanzenteile erhalten bleiben. Pollen und Sporen überstehen eine Inkohlung, was in der Pollenanalyse zur Altersbestimmung von Sedimenten genutzt wird. Dringen in Gewebe und Zellwände mineralische Lösungen (Kieselsäure, Dolomite) ein, entstehen echte Versteinerungen (Inkrustate). Entsprechende Vorgänge führen bei Tieren zur Mumifizierung (pleistozäne Mammumute, Fäulnis und Verwesung frühzeitig gestoppt), zu Trockenmumien (schneller Wasserentzug), zu Moorleichen - 24 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I (im sauren Milieu) und zur Erhaltung von Hartteilen (Gehäuse, Schalen und Skeletten nach molekularen Umlagerungen und –kristallisationen). Für die Datierung von Fossilien (Biostratigraphie) in Sedimenten ohne sekundäre Störung der Schichtenfolge ist die Bestimmung altersgleicher Schichten durch Zuordnung gleicher Fossilien maßgebend; daraus ergibt sich eine zeitliche Abfolge von Fossilinhalten aufeinander folgender Sedimente, also eine stammesgeschichtliche Reihung. Die eigentliche historisch-kausale Interpretation der stammesgeschichtlichen Sippen und ihrer Baupläne erfordert den Vergleich einer Vielzahl von Merkmalen, um Ähnlichkeiten durch Anpassung an ähnliche Umweltbedingungen (z.B. Haie und Delphine) auszuschließen. Die absolute Datierung erfolgt aus der Kenntnis von Halbwertszeiten bestimmter Isotope; im Falle des Kohlenstoffs für die letzten 50 000 Jahre, für andere Isotope z.T. bis ins Präcambium zurück. Einzellige (algenähnliche) Organismen konnten fossil nur sporadisch nachgewiesen werden (1-3 Milliarden Jahre alt). Die Entwicklung von Bakterien, Algen, Pilzen, über Koloniebildung hin zu vielzelligen Pflanzen ist in Fossilien nur punktuell belegt, so dass die wahrscheinlich parallele Entwicklung der Organisationsstufen monadal/kokkal (einzellig), trichal (fädig, mehrzellig), siphonal (mehrkernig) bis zur Kolonie (dreidimensional, Zellen einkernig) nur aus Merkmalsvergleichen bei rezenten Organismen ableitbar ist. Gute Kenntnis hat man von siphonalen Grünalen aus dem Paläo- und Mesophytikum (wegen ihres erhaltenen Kalkgerüstes), die schon reiche Verzweigung zeigten, ebenso wie von einer Braunalgen-ähnlichen Pflanze mit einer Gliederung in einen Stamm und mehrfach geteilten Lappen am Schopf, alles aufgebaut aus verklebten Zellschläuchen (Pseudoparenchym). Aus der Gruppe der Pilze sind fossile Belege erst seit dem Devon bekannt, schon heterotroph, wohl als Parasiten oder Saprophyten im Gewebe der ersten Landpflanzen. Spätere Funde aus dem Oberkarbon gleichen schon rezenten Pilzen. Die Evolution zu Landpflanzen fand vorwiegend im Devon statt; davor gibt es nur geringe Spuren, danach (Karbon) kennt man eine üppige Landflora. Diese Entwicklung ist identisch mit der zum Kormus. Der Gang vom Wasser ans Land erforderte Anpassungen im Wasserhaushalt, eine Entwicklung von Blattorganen mit Spaltöffnungen sowie ein Festigungssystem. Gleichzeitig erkennt man bei Organismen mit Generationswechsel die Reduktion des Gametophyten und seine organische Verbindung (Ernährung) mit dem Sporophyten sowie später die Samenbildung durch Differenzierung eines jungen Sporophyten (Embryo) in einer Schutzhülle. Die Blattentwicklung beginnt in der Devonflora in Form von gefiederten Wedeln (Farne) oder Nadeln (Bärlappe, Schachtelhalme) aus dreidimensionalen dichotom verzweigten Sprossen (Telome). Die Entwicklung führt allmählich durch Planation zu einer zweidimensionalen Gestalt, Übergipfelung ergibt die Führung einer Achse, die anderen werden Seitenachsen, Verwachsungen zwischen den Achsen führt zur Blattspreite, Reduktionen zum Nadelblatt. Die ersten Landpflanzen (z.B. Rhynia, Mitteldevon) besaßen nur wenige Xylem- und Phloemelemente im Zentrum (Protostele, gute Zugfestigkeit), eine Verlagerung mehr an die Peripherie noch im Devon führt zu verschiedenen Stelentypen (Poly-, Actino-, Eustele, gute Knickfestigkeit). Die Xylemelemente sind schon lignifiziert, die Erfindung des Dickenwachstums fällt ebenfalls in diese Zeit. Anfangs werden Sporangien an den dichotomen Telomenden gebildet, später wandern sie im Zuge der Prozesse bei der Blattentwicklung an den Rand des Blattes (Farne) oder in die Achsel von Blättern (Bärlappe). Von den Moosen sind wenige Fossilien bekannt, z.B. Lebermoose aus dem Obercarbon. Die Laubmoose gelten als ein paralleler Ast der Entwicklung. Die Moose besaßen schon im Paläophytikum die rezente hohe Differenzierungsstufe, allerdings schon immer mit Merkmalen von im Wasser lebenden Pflanzen wie Befruchtung mit Spermatozoiden im Wasser außerhalb des Organismus und fast vollständig fehlende Leitsysteme (Ausnahme Polytrichum). Die Moose erobern mit den Gametophythen das Land. Sehr gut ist die Evolution der Farnflora durch Funde aus dem Steinkohlenbergbau (Obercarbon) belegt. Alle drei Gruppen (Bärlappe, Schachtelhalme, Farne im engeren Sinn) zeigen eine - 25 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I beachtliche Differenzierung ihrer Sporophyten, sie sind durchweg baumförmig. Heutige Vertreter sind überwiegend unbedeutende krautige Relikte. Die Bärlappe (Lycopodiopsida) hatten ihre größte Verbreitung im Obercarbon mit bis zu 50 m hohen baumförmigen Sporophyten (Siegel- und Schuppenbäume). Als Wasserleitbahnen waren Tracheiden vorhanden; das entsprechende Gewebe war aber noch spärlich entwickelt. Die Blätter hatten xeromorphen Bau (nadelartig). Die damaligen Vertreter waren heterospor, von rezenten Formen ist nur der Moosfarn (Selaginella) heterospor. Von den Schachtelhalmen (Equisetopsida) war vor allem im Obercarbon und Perm die Gattung Calamites vertreten. Diese Röhrenbäume (große zentrale Markhöhle) erreichten 30 m Höhe bei einem Durchmesser von 1 m. Es gab iso- und heterospore Schachtelhalmgewächse bis hinein ins Mesophyticum; rezent sind nur isospore Schachtelhalme vorhanden. Die Farne (Pteridopsida) erreichten ebenfalls im Obercarbon eine reiche Entfaltung. Ihre Sprophyten waren Baumfarne mit Sklerenchymsträngen im Stamm zur Festigung, einem mächtigen Mantel stammbürtiger Wurzeln, nur schwach entwickelten Stelen und wedelartigen gefiederten Blättern. Die ursprünglichsten waren noch isospor, alle anderen heterospor; von rezenten Farnen sind nur die Wasserfarne (Hydropterides) heterospor. Der Gametophyt ist selbständig, aber unscheinbar klein. Die Entwicklung zu den Samenpflanzen repräsentieren die Samenfarne (Lyginopteridopsida), beginnend im Oberdevon, mit einem Gipfel im Carbon und ausklingend in der Kreide. Äußerlich den Farnen gleichend ist nun der Gametophyt unselbständig und die Entwicklung des jungen Sporophyten (Embryo) auf der Mutterpflanze bis zur Samenbildung vollzogen. Der Sporophyt besitzt im Stamm einen mächtigen Holzmantel. Der Zeitraum vom Perm bis zum Ende des Jura gilt als das Zeitalter der Gymnospermen. Die Samenfarne treten allmählich zurück; die ersten Coniferen aus dem obersten Obercarbon waren noch kleine Bäume, aber schon im Zechstein gab es ausgedehnte Nadelwälder. In dieser Zeit gewann eine beblätterte Gymnospermengruppe an Bedeutung, die Ginkgogewächse, von denen heute noch das „lebende Fossil“ Ginkgo biloba erhalten ist. Sie alle hatten einen mächtigen Holzkörper mit guter Wasserleitung und Festigung. Zu diesen traten noch im Mesozoikum die Cycadeen, im Gegensatz zu benadelten Coniferen und der Ginkgogruppe mit gefierderten Wedeln. Die Sporophyten waren an Kurztrieben fast wirtelig angeordnet und bildeten Blütenstände (Zapfenform). Die drei Gruppen der Gymnospermen haben sich wohl parallel aus gemeinsamen Ahnen entwickelt. Die familientypische Gliederung der rezenten Coniferen beginnt in der Trias und ist vollständig im Jura vollzogen. Die erfolgreichste Gruppe des Pflanzenreiches mit heute 250 000 Arten (Gymnospermen 600) wurden die Angiospermen. Bei ihnen gibt es ausschließlich die Befruchtung mittels eines Pollenschlauches, die Samenanlage ist stets im Fruchtknoten, gebildet aus den Makrosporophyllen (Fruchtblätter), eingeschlossen. Von den ersten Entwicklungen in diese Richtung in der Trias bis Jura gibt es nur spärlich Fossilien. Ihren Ausgang nahmen sie von Magnolien-ähnlichen: Sie besitzen die größte Zahl relativ ursprünglicher Merkmale. Sie sind Bewohner tropischer und subtropischer Gebirge: Diese Abtragungsgebiete bargen eine geringe Chance zur Fossilisierung. Man vermutet, dass diese ursprünglichen Angiospermen in solch einer Vegetationszone wuchsen. Das Auftreten von Monocotyledonen schon in der unteren Kreide macht eine sehr frühe Trennung von den Dicotyledonen wahrscheinlich. 4. Systematik der Samenpflanzen (Spermatophyta) Die Samenpflanzen werden in drei Unterabteilungen gegliedert, wobei man die ersten beiden zu der Entwicklungsstufe Gymnospermae zusammenfaßt, die zweite stellt die Angiospermae-Stufe dar. - 26 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Entwicklungsstufe: Gymnospermae (Nacktsamer, 1. und 2. Unterabteilung) 4.1 Unterabteilung: Coniferophytina, gabel- und nadelblättrig Es handelt sich um Holzpflanzen mit monopodialem Hauptsproß (Führung der Hauptachse) und einfach gebautem Seitenorgan (Laub-,Staub- und Fruchtblätter). Die Blüten sind immer eingeschlechtig und windbestäubend. Ein Staubblatt besitzt nur eine Pollensackgruppe ebenso wie ein Fruchtblatt nur eine gestielte Samenanlage trägt. Sie stehen zu mehreren seitlich an der Blütenachse. Eine Blütenhülle fehlt. Die reduzierten weiblichen Blüten sind meist in einem Zapfen im Blütenstand zusammengefaßt. 4.1.1 Klasse: Ginkgoopsida Die staminaten und carpellaten Blüten stehen in der Achsel von Tragblättern auf verschiedenen Pflanzen (diözisch). Die aus dem Integument der Samenanlage gebildete Samenschale besteht aus einer verholzten harten Schicht und einer äußeren, Buttersäure enthaltenden weichen Schicht. Ginkgo ist so wie der rezente Vertreter Ginkgo biloba fast unverändert aus dem Jura und der Kreide bekannt (lebendes Fossil); die Klasse existiert seit dem Perm. Die Triebe sind gegliedert in Kurz- und Langtriebe. Der Jugendwuchs ist monopodial, im Alter wird eine mächtige Krone gebildet. Ginkgo biloba a: Kurztrieb mit Blättern und staminater Blüte; b: Staubbltatt mit Pollensäcken; c: carpellate Blüte mit zwei Samenanlagen; d: reifer Same; ster: verkümmerte Samenanlage. 4.1.2 Klasse: Pinopsida (Nadelhölzer) Die Achsen der Blüten sind verkürzt und seitlich in Gruppen gestielt inseriert zusammen mit einzelnen sterilen Blattorganen. Die weiblichen bilden meist kätzchen- oder zapfenartige Blütenstände. 4.1.1.1 Unterklasse: Cordaitidae (Cordaiten) Die Cordaiten sind nur fossil bekannt (Karbon bis Perm). Die staminaten und carpellaten Blüten enthalten neben den Staub- und Fruchtblättern zahlreiche sterile Blättchen, ähnlich einem Perianth. - 27 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Sie bilden kätzchenförmige Blütenstände in der Achsel von Tragblättern. Es waren ca. 30 m hohe Bäume mit reich verzweigter Krone und sekundärem Dickenwachstum. 4.1.1.2 Unterklasse: Pinidae (Koniferen) Die Koniferen ähneln sehr den Cordaiten, allerdings sind hier die weiblichen Blüten stark reduziert und zur Samenschuppe und diese wieder mit dem Tragblatt, der Deckschuppe, zu einem Komplex verwachsen. Nur diese Interpretation erlaubt es, einen Koniferenzapfen als einen Blütenstand und nicht als Einzelblüte mit vielen Fruchtblättern anzusehen. Die staminaten stehen einzeln oder in lockeren Verbänden. An der Blütenachse sind zahlreiche Staubblätter schraubig angeordnet, an deren Unterseite sich die Pollensäcke befinden. 4.1.1.1.1 Ordnung: Voltziales Die sterilen Blätter sowie Fruchtblätter stehen schraubig an der Blütenachse und stellen durch fehlende Verwachsungen im Samenschuppenbereich ein Bindeglied zu den Pinales dar. Sie sind nur fossil bekannt. 4.1.1.1.2 Ordnung: Pinales Zu den Pinales gehören die meisten Familien der heute genutzten Koniferen. Die carpellaten Blüten sind nun durchweg Samenschuppen mit weitgehenden Verwachsungen zum Samen-DeckschuppenKomplex. 1. Familie: Araucariaceae mit einsamigen Deck-Samenschuppen. Die carpellaten Blüten stehen in kugeligen, endständigen Zapfen. Die Tracheiden im Holz besitzen Hoftüpfel in bienenwabenartiger Anordnung. 2. Familie: Pinaceae mit wechselständigen Nadeln, nur mit Langtrieben wie bei Abies, Picea, Tsuga und Pseudotsuga oder mit zusätzlichen Kurztrieben wie bei Cedrus, Larix und Pinus. Außer Larix sind alle immergrün. Die carpellaten Blüten stehen im holzigen, zapfenförmigen Blütenstand mit zweisamigen Samen-Deckschuppen. Diese wachsen während der Reife in die Länge, wobei der Deckschuppenanteil deutlich hervortreten kann (Abies, Pseudotsuga). Die staminaten Blüten tragen zahlreiche Staubblätter, sie fallen nach der Pollination ab. Abies nordmanniana mit reifen Zapfen b: Schuppen von unten; c: Schuppen von oben; ds: Deckschuppe; fs: Samenschuppe sa: Samen mit Flügel (Fl) 3. Familie: Taxodiaceae mit meist mehr als zwei Samenanlagen auf den stark verwachsenen Samen-Deckschuppen. Sie sind teilweise sommergrün (Metasequoia, Taxodium distichum). Im Samen-Deckschuppen-Komplex überragt - 28 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I die Samen - Deckschuppe. Je Samenschuppe sind bis zu neun Samenanlagen in einem holzigen Zapfen vorhanden. 4. Familie: Cupressaceae mit vorwiegend schuppenförmigen, meist kreuzweise gegenständigen Blättern. Die Gattungen Cupressus, Tsuga und Chamaecyparis bilden holzige Zapfen, bei Juniperus entsteht ein fleischiger Beerenzapfen, indem die obersten Schuppenblätter fleischig werden und die Samen einschließen. Juniperus communis a: Zwei mit „Beerenzapfen“; b: staminate Blüte; st: Staubblatt; c: Deckblattkreis mit drei alternierenden Samenanlagen; d: Beerenzapfen 5. Familie: Cephalotaxaceae mit taxusähnlichen schmal-linealischen Blättern. Die staminaten Blüten erscheinen zu mehreren blattachselständig, die carpellaten seitenständig in der Achsel von kurzen, später austreibenden Zweigen. Die Fruchtblätter besitzen zwei Samenanlagen, aus denen sich 2,5 cm große steinfruchtartige Samen entwickeln. 6. Familie: Taxaceae mit der heimischen Eibe (Taxus baccata). Am fertilen Kurzsproß wird nur eine einzige apikale Samenanlage gebildet. Die Blüten sind zweihäusig, sie entstehen in der Achsel von Nadeln. Während der Samenreife bildet sich unterhalb der Samenanlage als Achsenwucherung ein roter, fleischiger, süß schmeckender Becher (Arillus), der als einziger Teil der Pflanze nicht das giftige Taxol enthält. 7. Familie:Podocarpaceae Die Samenschuppe wächst hier bei der Samenreife zu einer einseitigen, fleischigen Samenhülle. Die Blätter sind entweder schuppenförmig, breit-nadelförmig, schmal-blattförmig oder als Phyllocladien (Flachsprosse) ausgebildet. Ihre Heimat ist die Südhemisphäre. 4.2 Unterabteilung: Cycadophytina (Fiederblättrige Nacktsamer) Die der Ernährung dienenden Blätter (Trophophylle) sind fiedrig gebaut, die sporenproduzierenden Sporophylle stehen an Kurztrieben als Gruppen von Pollensäcken und Samenanlagen. 4.2.1 Klasse: Lyginopteridopsida (Samenfarne) Diese ausgestorbene Klasse hatte noch keine Blüten, die Blätter hatten als Tropho-Sporophylle beide Funktionen. Es wird ein zweites Integument um die Samenanlage gebildet, das anfangs cupulaartig gestaltet ist. - 29 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I 4.2.2 Klasse: Cycadopsida Die rezenten Formen dieser Klasse können als lebendes Fossil angesehen werden. Es werden nun typische Mikro- und Makrosporophylle an Sprossen mit begrenztem Wachstum gebildet, die einfache Blüten darstellen. Die Makrosporophyllstände können allerdings manchmal durchwachsen werden. Die Cycadeen erinnern durch den unverzweigten, oft nur kurzen Stamm und einen Wirtel gefiederter Blätter im Aussehen an Palmen. Die diözisch verteilten Blüten sind perianthlos. Bei der Gattung Cycas wird der Vegetationskegel des Makrosporophyllstandes bei der Blütenbildung nicht aufgebraucht, so daß der Trieb das Wachstum hier noch fortsetzen kann. Bei den meisten Gattungen stellt aber der Vegetationskegel sein Wachstum ein. Pro Fruchtblatt werden zwei Samenanlagen gebildet. Frucht- und Staubblätter stehen schraubig an einer langen Blütenachse. 4.2.3 Klasse: Benettitopsida Bei dieser ausgestorbenen Klasse sind die Fruchtblätter stark vereinfacht: Sie bestehen nur aus einer gestielten Samenanlage, die direkt an der Blütenachse sitzt. Hier wird jetzt das erste Mal eine Zwitterblüte mit Perianth gebildet. 4.2.4 Klasse: Gnetopsida Auch diese Klasse bildet zwittrig angelegte Blüten mit Hülle und direkt an der Achse sitzende Samenanlagen. Die Blüten sind aber durch die Ausbildung nur einer Samenanlage und eines Staubblattes stark reduziert. Hierher gehören die Gattungen Welwitschia, Gnetum und Ephedra als Vertreter monotypischer Unterklassen. Die Gametophyten sind hier schon stark reduziert und eine doppelte Befruchtung findet schon statt. Welwitschia besitzt zeitlebens nur zwei meterlange, bandförmige Blätter, die vom Grunde her ständig nachwachsen und vorn absterben. Welwitschia mirabilis a: jüngere, blühende carpellate Pflanze; b: Zweig eines staminaten Blütenstandes; tb: Tragblatt; c: staminate Blüte; äbh: äußere Blütenhülle; ibh: innere Blütenhülle; d: carpellater Blütenstand; e: carpellate Blüte; bh: Blütenhülle - 30 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Entwicklungsstufe : Angiospermae (Bedecktsamer) 4.3 Unterabteilung: Magnoliophytina 4.3.1 Klasse: Magnoliopsida (Dicotyledoneae, Einfurchenpollen-Zweikeimblättrige) Die Keimlinge tragen zwei seitlich angelegte Keimblätter, die Keimwurzel ist langlebig (Allorhizie) und die offenen Leitbündel, deren Kambium ihnen ein sekundäres Dickenwachstum ermöglicht, sind im Kreis angeordnet. Die Blätter sind netzaderig. Die Blüten sind äußerst vielgestaltig: von schraubiger und vielgliedriger bis zu wirteliger und dreizähliger Anordnung. Als Blütenhülle ist ein Perigon ( ohne Differenzierung in Kelch- und Kronblätter) ausgebildet. Die meist nicht in Filament und Anthere gegliederten Staubgefäße sind in großer Zahl vorhanden, die Pollen sind einfurchig. Die Fruchtblätter sind meist frei (apocarp). Vertreter dieser Klasse finden sich in der Familie der Magnoliaceae, die in Süd- und Ostasien sowie in Nordamerika beheimatet sind, bei uns als Ziergehölz (Magnolia) bzw. als Alleebaum (Liriodendron, Tulpenbaum) angepflanzt sind. 4.3.2 Klasse: Rosopsida (Dicotyledoneae, Dreifurchenpollen-Zweikeimblättrige) Die Blüten sind hier wirtelig, meist fünfzählig, die Blütenhülle weist Kelch und Krone auf. Die Staubgefäße sind nun in Filament und Anthere gegliedert. Die Pollen sind dreifurchig und die Fruchtblätter häufig verwachsen (coenocarp).Diese umfangreichste Klasse umfaßt über 300 Familien mit 180000 Arten, wozu auch alle mitteleuropäischen Laubgehölze gehören. Familie: Platanaceae: Die in Mitteleuropa angepflanzten Arten der Gattung Platanus (Platane) besitzen eingeschlechtige Blüten mit einem Perigon in hängenden, kugeligen Blütenständen mit drei bis acht Staubgefäßen bzw. drei bis acht apocarpen Fruchtknoten. Familie: Buxaceae Diese Familie ist bei uns nur mit einer immergrünen Art (Buxus sempervirens, Buchsbaum) vertreten. Die achselständigen, eingeschlechtigen Blüten mit Perigon besitzen mehrere Staubblätter und teilweise verwachsene Fruchtblätter. Familie: Rosaceae Die Rosaceen haben wechselständige Blätter mit Nebenblättern. Die radiären, zwittrigen Blüten zeigen eine sekundäre Vermehrung der Zahl der Staubgefäße. Die Fruchtknoten sind apocarp auf dem verbreiterten Blütenboden sitzend. Häufig beteiligt sich die Blütenachse an der Fruchtbildung. Als Früchte treten Kapseln, Nüsse, Steinfrüchte oder Sammelfrüchte auf. In der heimischen Flora ist die Familie formenreich vertreten, auch mit verholzenden Gewächsen wie den Sorbus-Arten (S. aria, Mehlbeere; S. aucuparia, Eberesche; S. domestica, Speierling; S. torminalis, Elsbeere), den Prunus-Arten (P. avium; Vogelkirsche; P. padus, Traubenkirsche; P. spinosa, Schlehe), Crataegus (Weißdorn) und Malus (Apfel). Familie: Fagaceae Die Blüten der Fagaceen sind eingeschlechtig und einhäusig mit einer unscheinbaren Blütenhülle, die ursprünglich in Dichasien stehen. Die Früchte werden von einer Achsenwucherung (Cupula, Fruchtbecher) umgeben; es sind Nüsse. Die Edelkastanie (Castanea sativa) besitzt steife staminate Blütenstände. Die stachelige Cupula schließt das komplette dreiblütige Dichasium ein und umschließt bei der Reife drei Früchte. Bei der Rotbuche (Fagus sylvatica) befinden sich die staminaten Blüten in Köpfchen, die carpellaten sind zu zweiblütigen Dichasien reduziert. Die Cupula umschließt zwei dreikantige - 31 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Nüsse. Die Dichasien der Eichenarten (Quercus petraea, Traubeneiche; Qu. robur, Stieleiche; Qu. pubescens, Flaumeiche) sind nur noch einblütig, die becherförmige Cupula umschließt eine Nuß (Eichel). Unter den immergrünen mediterranen Eichen ist die Korkeiche (Qu. suber) hervorzuheben, deren Rinde den Naturkork liefert. Familie: Betulaceae Die Blüten sind in walzlichen Kätzchen oder Ähren angeordnet. Sie besitzen eine unscheinbare Blütenhülle und sind eingeschlechtig. Die geflügelte Nuss wird aus zwei Fruchtblättern gebildet. Bei Betula (Birke) und Alnus (Erle) bilden sich die Früchte in der Achsel von Schuppen, die aus der Verwachsung von Vorblättern mit dem Deckblatt hervorgehen. Sie fallen bei Betula bei der Reife ab, bei Alnus bleiben sie verholzend am zapfenähnlichen Fruchtstand. Familie: Corylaceae Die Gattung Corylus (Hasel) bildet sehr kurze carpellate Blütenstände, die von Knospenschuppen umgeben sind. Die staminaten Blüten stehen in hängenden Kätzchen. Die Blüten erscheinen weit vor den Blättern. Die Frucht ist von einer Hülle umgeben, die aus drei verwachsenen Vor- bzw. Tragblättern gebildet wird. Bei der Hainbuche (Carpinus betulus) dient diese Hülle zusätzlich als Flugorgan. Familie: Juglandaceae Diese Familie bildet eingeschlechtige Blüten. Drei bis fünf Perianthblätter sind mit dem Deckblatt und zwei Vorblättern verwachsen. Viele staminate Blüten sitzen dicht in Kätzchen, die am vorjährigen Holz erscheinen, während sich die carpellaten Blüten zu wenigen am diesjährigen Holz bilden. Die Walnuß (Juglans regia) bildet Steinfrüchte. Familie: Ulmaceae Die zwittrigen Blüten stehen in doldigen Blütenständen. Die einfache Blütenhülle ist vier- bis fünfblättrig, Staubblätter sind ebenfalls vier bis fünf vorhanden. Bei den heimischen Ulmenarten U. laevis (Flatterulme), U. glabra (Bergulme) und U. minor (Feldulme) werden breit geflügelte Nüsse gebildet. Familie: Fabaceae Im Gegensatz zur tropischen Baumflora sind die Schmetterlingsblütler in der heimischen nur schwach vertreten. Sie bilden zwittrige, stark zygomorphe Blüten mit doppelter Hülle. Das hintere Kronblatt ist die „Fahne“, die beiden seitlichen die „Flügel“ und die beiden vorderen das „Schiffchen“ der schmetterlingsartigen Blüte. Die zehn Staubgefäße sind teilweise verwachsen. Das oberständige Fruchtblatt bildet eine Hülse. Die aus Nordamerika stammende Robinie (Robinia pseudoacacia) ist bei uns angepflanzt und eingebürgert. Familie: Hippocastanaceae Diese Familie ist bei uns nur durch die vom Balkan stammende angepflanzte Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) vertreten. Sie bildet zwittrige, zygomorphe Blüten im pyramidenförmigen Blütenstand. Die Frucht ist eine stachelige Kapsel. Familie: Aceraceae Zu den heimischen Ahornarten Acer pseudopatanus (Berg-), A. platanoides (Spitz-), A. campestre (Feld-) und A. monspessulanum (Französischer Ahorn) kommen noch einige angepflanzte fremdländische hinzu. Ihnen ist die Bildung eines verbreiterten Blütenbodens (Discus) und von geflügelten Spaltfrüchten gemeinsam. Familie: Tiliaceae - 32 - Professur für Forstbotanik Skript Forstbotanik und Baumphysiologie I Die Tiliaceae (Lindengewächse) bilden ein mit dem Stiel der dichasialen Infloreszenz teilweise verwachsenes flügelartig vergrößertes Vorblatt. Es werden einsamige Nüsse gebildet, in deren Form sich Tilia cordata (Winterlinde) und T. platyphyllos ( Sommerlinde) unter anderem unterscheiden. Familie: Salicaceae In Kätzchen stehen fast perianthlose, eingeschlechtige Blüten, die zweihäusig verteilt sind. Im zweiblättrigen, oberständigen Fruchtknoten entstehen viele langhaarige Samen. Die Gattung Salix (Weiden) ist insektenbestäubend, während die Pappeln (Populus) vom Wind bestäubt werden. Familie: Oleaceae Die Blüten der Ölbaumgewächse sind meist zwittrig und besitzen eine vollständige Hülle. Die Krone ist 4 –12-zipfelig, der Kelch vierzähnig. Bei der gemeinen Esche (Fraxinus excelsior) fehlen allerdings Kelch und Krone, während die Blumenesche (F. ornus) auffallende, tiefgeteilte weiße Blütenblätter und –rispen ausbildet. Entsprechend ist nur letztere insektenbestäubend. Als Früchte treten Kapseln beim Flieder (Syringa vulgaris), Steinfrüchte bei der Olive (Olea europaea), geflügelte Nüsse bei der Esche und giftige Beeren bei der Rainweide (Ligustrum vulgare). Familie: Caprifoliaceae Zu dieser Familie gehören einige heimische Sträucher wie Holunder (Sambucus), Schneeball (Viburnum) und Lonicera-Arten (Waldgeißblatt, Heckenkirsche). Die Blüten sind radiär oder zygomorph. Der Fruchtknoten ist unterständig, die Früchte sind Beeren oder Kapseln. Bei Lonicera verwachsen frühzeitig zwei Fruchtknoten teilweise, so daß charakteristische Doppelbeeren entstehen. 4.3.3 Klasse: Liliopsida (Monocotyledoneae) Die wohl von den Zweikeimblättrigen abstammenden einkeimblättrigen Pflanzen besitzen Blüten, deren Organe in dreizähligen Wirteln angeordnet sind, wobei die Hülle aus gleichgestalteten Perigonblättern besteht. In ihrer Artenzahl umfassen sie etwa nur ein Fünftel (52000) der Angiospermen. Neben der überwiegenden Zahl krautiger Vertreter gibt es einige baumartige Pflanzen, die aber wegen des Fehlens von Kambium in ihren Leitbündeln kein normales sekundäres Dickenwachstum zeigen, sondern ein anomales durch Einschub eines sekundären Verdickungsmeristems mit sekundären Leitbündeln (Dracaena, Drachenbaum) oder primäres Dickenwachstum durch postembryonale Zellvermehrung und -vergrößerung wie bei Palmen (Arecaceae) Eine Besonderheit stellen unter den Grasartigen (Poales) die vorwiegend in den feuchten (Sub)Tropen vorkommenden Bambusarten mit holzigen, oft baumhohen Halmen dar. - 33 -