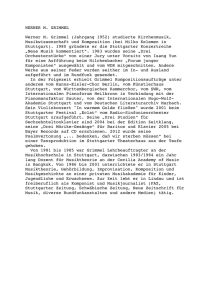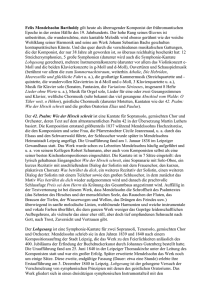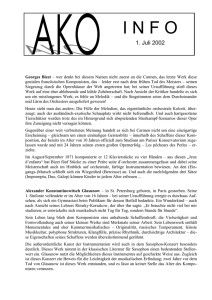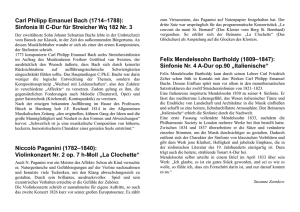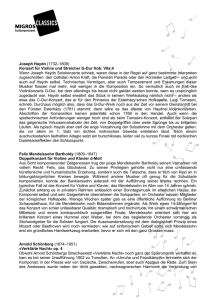pdf-Datei - jürgen hartmann stuttgart
Werbung

1 Jürgen Hartmann _______________________________________________________________ Journalist, Dramaturg, Autor, Drucksachen, Internet Nauheimer Straße 50 70372 Stuttgart Telefon 0711 5058934 und 0177 4915705 Internet www.kulturchronist.de e-mail [email protected] Rezensionen Konzert, Oper, CD 01 Folgt er auf Norrington? Thomas Dausgaard beim RSO Stuttgart 02 Glänzendes Genie. René Jacobs dirigiert Mozarts "Idomeneo" (CD) 03 Nimm den Bassa, Konstanze! Mozarts "Entführung" in Ludwigsburg 04 Eine Opernreise durch Belgien Portraits 05 Die Umarmung des Drachens. Helene Schneiderman feiert ihr 25. Bühnenjubiläum 06 "Gibt es ein sinnlicheres Instrument?" Der Organist Jean Guillou musiziert in Berlin 07 Von Finnland lernen. Der Dirigent Osmo Vänskä 08 Der besondere Griff. Helmuth Rilling wird 70 09 Viel Mut und ein bisschen Heimweh. Die armenische Sopranistin Karine Babajanian Programmheft- und Magazinbeiträge 10 Ansichten von Modernität oder Was macht man mit der Sonate? (Lucerne Festival) 11 Felix Mendelssohn Bartholdy – das doppelte Problem (Forum Bachakademie) 12 Zum 300. Geburtstag der Klarinette (Berliner Philharmoniker) 13 Robert Schumanns Welt und Nachwelt (Forum Bachakademie) 14 Flexibler Nachwuchs. Ein Besuch bei den Hymnus-Chorknaben (Musikfestjournal) 15 Ein buntes Leben. Der SWR beim Musikfest (Musikfestjournal) Kürzere Berichte 16 Das Defilee der Dirigenten oder Wie finde ich einen Chef? (Saison des RSO Stuttgart) 17 Die Schlacht hat begonnen. Sitzung des SWR-Rundfunkrates (2004) 18 Qualität und Spaß. Helmuth Rillings Gächinger Kantorei wird 50 19 Stars und Störche. Das Musikfestival in Colmar Längere Reportagen 20 Zwischen den Welten. Ein junger Mönch am Staatstheater 21 Wie aufregend, ich geh ins Kino! Mit dem Kinomobil Baden-Württemberg auf Tour 2 Rezensionen Oper, Konzert, CD Folgt er auf Norrington? Jubel beim Debüt: Thomas Dausgaard dirigiert erstmals das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart (Rezension für die Stuttgarter Zeitung, veröffentlicht heute) Nicht nur in der Politik sind Personalspekulationen spannend, auch in der Kultur lässt sich die Frage „Wer wird was?" kaum unterdrücken. Im Strudel der Opernkrise ging unter, dass auch beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart (RSO) für 2011 die Neubesetzung des Chefpostens ansteht. Zählt man die freudigen Gesichter im Orchester und den Jubel des Publikums im gut besuchten Beethovensaal zusammen, dürfte der dänische Dirigent Thomas Dausgaard aus dem Stand die Favoritenrolle im Schaulaufen um die Norrington-Nachfolge erobert haben. Der 46-Jährige, der leitende Funktionen in Schweden und Dänemark innehat, eröffnete die Abonnementsreihe des RSO gewiss nicht zufällig mit einem extravaganten Programm. Ein modernes Werk von Dausgaards Landsmann Poul Ruders zum Auftakt, eine komplexe Begleitaufgabe im ersten Klavierkonzert von Franz Liszt und die pompös dimensionierte zweite Sinfonie von Sergej Rachmaninow - was will man mehr von einem ernsthaften Bewerber für höhere Weihen? Dass die enorme Überlänge des Konzerts den Jubel für den Pultdebütanten nicht verknappte, verrät viel über den außergewöhnlichen Abend. Dem „Concerto in Pieces" von Poul Ruders hört man an, dass es für eine der legendär lockeren „Last Night of the Proms" entstanden ist. Der dänische Komponist stellte sich dem Auftrag, eine Art Neuaufguss von Brittens „Orchesterführer für junge Leute" herzustellen, unerschrocken und mit Esprit. Mit vielen Instrumentationstricks, elektronisch garniert, schichtet er Jazziges und Avantgardistisches auf. Das ist im Grunde „very british" - in der englischen Küche nennt man es „Trifle", ein Dessert, das herrlich schmeckt, ohne dass man wirklich weiß, was drin ist. Kurzum: ein musikalischer Spaß erster Güte. Franz Liszts erstes Klavierkonzert entfaltet sich unter den zarten Händen von Lise de la Salle aufs Angenehmste, denn die Französin beherrscht Träumerei und Tragik gleichermaßen, ist gewandt in Ausdruck und Technik. Das RSO schmiegt sich mit überragenden Soli an das Klavier an, Dausgaard erweist sich als aufmerksamer Vermittler zwischen Solistin und Orchester. Sergej Rachmaninows zweite Sinfonie fließt unter seiner inspirierten und dabei immer freundlichen Anleitung wie ein majestätischer Strom musikalischer Gedanken dahin. Anwandlungen von Kitsch veredelt Dausgaard, indem er das Klangbild zu größter Klarheit aufspreizt und nicht routiniert abdunkelt. Herzergreifend war das Klarinettensolo von Robert Oberaigner im dritten Satz, das sich nahtlos in die erstklassige Orchesterleistung einfügte. 3 Glänzendes Genie Mozarts „Idomeneo“ mit René Jacobs - CD-Rezension für die Stuttgarter Zeitung, veröffentlicht am 08.09.2009) In seinem 1984 erschienenen Buch über Mozarts Opern schreibt Stefan Kunze, niemals später habe sich „Mozarts musikalisches Erfindungsgenie glänzender bewährt“ als im „Idomeneo“, um sogleich vor „leeren Beschönigungsformeln“ hinsichtlich der Ausformung der Charaktere zu warnen. Die Fachleute haben sich immer wieder gegenseitig versichert, dass die Oper des jungen Mozart etwas ganz Besonderes sei. Aber ist „Idomeneo“ deshalb ins Standardrepertoire eingegangen? Gute Aufnahmen gibt es: Harnoncourts Pioniertat von 1980, Gardiners Referenzeinspielung zehn Jahre später und Mackerras’ gediegene Interpretation von 2001. Im Booklet der neuen Aufnahme macht sich der Dirigent René Jacobs Gedanken darüber, wie man heutzutage Ungeheuer und göttlichen Verlautbarungen interpretieren könnte, und er kommt zu überzeugenden Einsichten. Das stärkste Plädoyer für diese wahrhaft stürmische Oper ist dennoch Jacobs’ Arbeit am Dirigentenpult – nicht einen Takt der wohl erstmals in voller Länge und Pracht eingespielten Partitur möchte man missen, die Spannung lässt in keinem Augenblick nach, und im Gegensatz zu Kunzes damaligem Verdikt stehen bei Jacobs glaubwürdige Personen auf der imaginären Bühne, deren teils schicksalhafte, teils selbst verschuldete Konflikte man sehr wohl ernst nimmt. Ein zugkräftiger Motor für das homogene, hochklassige Solistenensemble und den ausdrucksstarken Chor ist das phänomenale Freiburger Barockorchester. Man darf sich glücklich schätzen, seinen Mozart so erleben zu dürfen, weit entfernt vom „Mozartglück“ früherer Zeiten, als die Töne aus Salzburg und Wien immer ein wenig süßlich schmeckten. Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo. RIAS Kammerchor, Freiburger Barockorchester, Dirigent René Jacobs. harmonia mundi HMC 902036.38 (3 CD + DVD „Making of“) 4 Nimm den Bassa, Konstanze! Mozarts „Entführung“ bei den Ludwigsburger Festspielen - Rezension für die Stuttgarter Zeitung (leicht gekürzt veröffentlicht am 29.06.2009) Ein Musikerquartett zieht durch die Gänge des Ludwigsburger Schlosses, um das Publikum zur „Entführung aus dem Serail“ zusammenzutrommeln, und nicht ohne Grund wirft die Sängerin Simone Kermes am Schluss der bejubelten Festspielpremiere ihren Blumenstrauß dem Perkussionisten Murat Coskun zu. Unter dessen munterer Anleitung erklingen Wolfgang Amadeus Mozarts „alla turca“-Passagen, die dieser Oper die orientalische Würze geben, endlich einmal so richtig gepfeffert. Dirigent Michael Hofstetter vertraut ganz zu Recht auch hier auf Spezialisten. Von ihm und seinem Orchester gehen im schmucken Schlosstheater die kräftigsten Impulse aus. Mozarts Partitur wird geradezu schmerzhaft aufgeraspelt, und auch Peer Boysens Inszenierung arbeitet die tragischen Anteile des gar nicht heiteren Singspiels heraus. In so mancher Oper würde man der Sopranheldin gerne zurufen: Nimm den Bariton, nicht den Tenor! Aber die Gattungskonvention will es nun mal anders. Mozarts „Entführung“ bietet eine Alternative: Zwar hat der Bassa Selim – in Wirklichkeit ein aus Westeuropa in die Türkei Geflüchteter – Konstanze entführen lassen, aber dass er sie ehrlich liebt, daran besteht kein Zweifel. Den Status als Außenseiter schärft Mozart, indem er den Bassa als Sprechrolle konzipiert, und wie Heio von Stetten in Ludwigsburg dessen tiefe Melancholie ganz leise ausspielt, das geht ans Herz. Viel fehlt wohl nicht, und die tapfere Konstanze gäbe nach: Simone Kermes gestaltet die vertrackte Partie nach mäßigem Beginn zu wahrhaft dramatischer Größe. Mit glühendem Piano, heroischen Koloraturen und unendlichen vokalen Ausdrucksmitteln von Florett bis Machete steigert sie sich in die hoch expressive „Martern-Arie“ hinein, in der Hofstetter im Orchestergraben wahre Urgewalten entfesselt – ein glückhafter Musiktheatermoment, für den allein sich alle Mühe lohnt. Aber Belmonte – der mit wenig lyrischem Schmelz aufwartende Tenor Bernhard Berchtold – kommt zur vermeintlich rechten Zeit und holt sich die abgekühlte Konstanze zurück. Peer Boysens Regie zeigt deutlich, dass das wohl nicht auf Dauer gut gehen wird, und interessanterweise spielt sich beim Dienerpaar Pedrillo und Blonde (Daniel Johannsen und Chen Reiss, beide tadellos singend) das Gleiche ab. Dass Blonde den Reizen des durchaus attraktiven Seraildieners Osmin (vokal korrekt, aber ein bisschen steif: Guido Jentjens) gar nicht abgeneigt ist, ist eine Überraschung der Regie, die durch die Musik eigentlich nicht beglaubigt wird. Peer Boysen hat die „Entführung“ wie ein Puppenspiel inszeniert: Durchdacht schematisch bewegen sich die Figuren, hin und wieder im Zuschauerraum platziert, in einer vom Regisseur selber angemessen historisch gestalteten Bühne und charakteristischen Kostümen von Ulrike Schlemm. Das ist schön, denn es wertet Noten und Worte auf, wenngleich Boysen die gesprochenen Dialoge in allzu karge Telegramme umgemodelt hat. Die humanistische Schlussansprache des Bassa indes verfehlt ihre Wirkung nicht: Mucksmäuschenstill lauscht der ausverkaufte Saal Heio von Stettens eindringlichen Worten. Ungerechtigkeit sei durch Wohltaten besser zu vergelten als durch Rache: Das klingt eine Weile nach. Mindestens bis zur nächsten Nachrichtensendung. 5 Eine Opernreise durch Belgien März 2002 - Langfassung eines Beitrags für die Stuttgarter Zeitung Wie silberne Fäden verschlingen sich die Stimmen von Oleg Riabets, Lawrence Zazzo und Alain Aubin zu einem Ornament, wie es schöner an keinem Brüsseler Jugendstil-Haus gedacht werden könnte. Nur dass musikalische Ornamente, wie sie die drei Countertenöre in Peter Eötvös' Oper "Tri Sestry" kunstvoll gestalten, allzu schnell wieder zerfallen. Allzu vergänglich sind die Opernwunder, von denen "Tri Sestry" am Königlichen Theater La Monnaie in der belgischen Hauptstadt ein ganz besonderes ist. Das Stagione-System kennt Ensembles nur für die einzelne Produktion und leidet nicht unter dem quantitativen Zwang, der das deutsche Opernleben prägt: Die Produktion der Eötvös-Oper wird in Brüseel gerade neun Mal gespielt. Bernd Loebe, derzeit noch künstlerischer Direktor der Brüsseler Oper und als ehemaliger HRRedakteur und designierter Frankfurter Intendant so etwas wie ein Bindeglied zur deutschen Musiklandschaft, weiß sehr genau um die Potenzen von La Monnaie. Das Stagione-System kennt Ensembles nur für die einzelne Produktion und leidet nicht unter dem quantitativen Zwang, der das deutsche Opernleben prägt: „Bei 80 Aufführungen pro Saison gibt es eigentlich keine Ausrede mehr für schlechte Qualität“, meint der betont lässig auftretende Theatermann schmunzelnd. Wenn Loebe seine Pläne für die Oper Frankfurt in seinem Brüsseler Büro erläutert, entfalten sich diese deutlich auf der Folie der paradiesischen Zustände, die die belgische Nationaloper (eine der wenigen Kulturinstitutionen, die in der zentralen Regie des 1994 in einen Bundesstaat umgewandelten Königreichs verblieben sind) vor allem den Künstlern bietet. „Das Haus kann sehr hohe Ansprüche beispielsweise an die Bühnentechnik erfüllen“, erzählt Loebe. Die 1986 beendete Grundsanierung und vor allem Ankauf und Sanierung eines heruntergekommenen Gebäudekomplexes hinter der Oper, der jetzt Büros, Probebühnen und Werkstätten beherbergt, machen die Brüsseler Oper auch in dieser Hinsicht zum Ausnahmefall. Die Produktion von „Tri Sestry“ ist identisch mit der Uraufführung, die 1998 in Lyon herauskam und auch als CD-Mitschnitt verfügbar ist. Loebe und sein Intendant Bernard Foccroulle haben die Übernahme dieser Inszenierung erst vereinbart, nachdem sie den ungewöhnlichen Erfolg in Lyon erlebt hatten. Insofern handelt es sich nicht um eine echte, von mehreren Häusern gemeinsam konzipierte und vorbereitete Koproduktion. Aber auch solche Übernahmen sind gerade im Stagione-System, in dem herausragende Produktionen kaum dauerhafte Wirkung entfalten können, eine gute Sache. Da ein großer Teil der Brüsseler Besetzung an identisch mit der Uraufführung ist und einige andere Partien mit Interpreten besetzt wurden, die diese Produktion in Paris mitgestaltet hatten, reichten zehn Tage Proben aus. Es kommt hinzu, dass Peter Eötvös, der die acht Aufführungen selbst dirigiert hat, ein langjähriger Berater der Brüsseler Oper ist. Bernd Loebe schätzt ihn hoch: Man hänge an seinen Lippen, wenn er dem Orchester die Eigenarten seiner Komposition vermittle. „Ich gönne Eötvös seinen jetzigen Erfolg“, sagt Loebe über den Komponisten, der nach einigen mageren Jahren mit Aufträgen bis 2008 eingedeckt ist. Die Brüsseler Oper ist eine Pralinenschachtel, eins der Foyers trägt sogar den Namen „Bonbonnière“. In diesem Prachtstück würden sogar die „Jungen Wilden“ unter den Regisseuren und Bühnenbildnern zahm, erzählt Bernd Loebe. Er nimmt für sich in Anspruch, seinem Intendanten einiges vom deutschen Musiktheater schmackhaft gemacht zu haben, gesteht aber auch, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnen. Vielleicht wirkt sich der genius loci also auch auf die Bühnenästhetik aus. „Ein Haus zum Wohlfühlen“ sei La Monnaie ohnehin, meint Loebe, dem die freundschaftlichen Beziehungen zu vielen Sängern aber auch die Möglichkeit geben, 6 „Tacheles zu reden“. Die Besetzungspolitik folgt einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: „Sing heute eine kleine Partie, dann bekommst du morgen eine große.“ Auf diese Weise baute Loebe, der in seinem Fach neben (Stuttgarts) Pamela Rosenberg zu den „Headhuntern“ mit der besten Spürnase zählt, viele Sängerinnen und Sänger auf, die heute - berühmt geworden - für die halbe Gage nach Brüssel kommen. „Wenn es auch kein festes Ensemble gibt, wir schaffen auf jeden Fall die Atmosphäre eines Ensembles.“ Während es in der Region Brüssel, die im streitsüchtigen Belgien als zweisprachig etabliert ist, wohl keinen Satz im öffentlichen Raum gibt, der nicht in flämisch und französisch erscheint (sogar die Position der Übertitel bei „Tri Sestry“ wird in der Pause getauscht, um keiner Sprache einen Vorteil zu verschaffen), verzichtet die Vlaamse Opera, das Musiktheater der Region Flandern in Antwerpen mit Zweitsitz in Gent, fast gänzlich auf das Französische - bis auf eine kurze Inhaltsangabe im Programmheft. Antwerpen ist die Hochburg der flämischen Nationalisten, die sich die Zukunft ihrer prosperierenden Region durchaus als eigenständigen Staat innerhalb der EU oder als Bestandteil der Niederlande vorstellen können. In auffälligem Gegensatz zum Brüsseler Pralinenkästchen ist die Oper in Antwerpen auch optisch eine bürgerliche Gründung, bei der Fragmente des Jugendstils und überreiche symbolische Plastik im Zuschauerraum eine vom Aristokratischen abgegrenzte Atmosphäre der Repräsentation erzeugen. Die Vlaamse Opera wird derzeit von der „flämischen Gemeinschaft“ (also der Region Flandern) gemeinsam mit den Städten Antwerpen und Gent finanziert. Dies bedinge eine absolut paritätische Bedienung der Spielstätten, berichtet Intendant Marc Clémeur ist anders als sein Name erwarten lässt waschechter Flame und spricht als ehemaliger Kölner Theaterwissenschaftsstudent perfekt Deutsch. Christine Mielitz’ von der Wiener Volksoper übernommene Inszenierung von Wagners „Meistersingern“ gibt es fünf Mal hier und fünf Mal dort, obwohl die Nachfrage in Antwerpen, wo schon ab 1913 alljährlich der „Parsifal“ zum Karfreitag erklang, größer ist als in Gent. Sollten die aktuellen Überlegungen, die Finanzierung der Kulturinstitutionen zu entflechten und die Museen ganz in städtische, dafür die Oper in regionale Obhut zu nehmen, aus der Vlaamse Opera ein Staatstheater machen, will Clémeur die Aufführungen nach dem Bedarf und nicht nach der äußerlichen Gleichberechtigung ansetzen. Die Opernhäuser in Antwerpen und Gent wurden erst 1989 fusioniert, nachdem Gérard Mortier in Brüssel mit hoher, international beachteter Qualität die Musiklandschaft Belgiens unter Zugzwang gesetzt hatte. Anders als bei den Fusionsprojekten in Deutschland seit 1990 zu beobachten, machte Belgiens damaliger Kulturminister in den beiden flämischen Städten tabula rasa - man ließ sogar Orchestermusiker neu vorspielen und stellte eine ganz neue Mannschaft zusammen. Feste Künstler gibt es auch an der Vlaamse Opera nicht, unter der bewusst unfestlichen, auf jeden Pomp verzichtenden Leitung von Friedemann Layer sangen einige Solisten, die bereits in Wien dabei gewesen waren, gemeinsam mit belgischen Eigengewächsen und weiteren internationalen Gästen. Die Freiheit vom Besetzungszwang ermöglichte es, nicht nur ein Liebespaar mit ungewöhnlich jugendlicher Ausstrahlung zu verpflichten (FMC und JD), sondern auch auf eine gemeinsame Auffassung vom Wagner-Gesang zu achten: Die helle, schlanke Tongebung aller Sänger ließ Wagners Textmassen ungewöhnlich klar über die Rampe kommen. Christine Mielitz hatte übrigens ihre in Wien erprobte Inszenierung, die aus Wagners zwiespältiger Komödie einen vergnüglichen Theaterabend macht, in Antwerpen sechs Wochen lang fleißig geprobt. Clémeur, der sich an deutschen Opernhäusern gut auskennt, hatte eine „kritische“ Inszenierung einkaufen wollen, die jedoch nicht - wie beispielsweise Neuenfels’ umstrittene Stuttgarter Produktion - „das Kind mit dem Bade ausschüttet“. Dem Anspruch, „mit dem halben Etat, aber dafür in zwei Städten Brüsseler Niveau zu erreichen“ (Clémeur), scheint die Flämische Oper mit dieser Produktion sehr nahe zu kommen, zumal Chor und Orchester beachtliche Strahlkraft besitzen. Auch Marc Clémeur kann sich eine künstlerische Entdeckung auf die Fahnen schreiben, hat er doch den Kanadier Robert Carsen als Opernregisseur schon früh nach Belgien verpflichtet und 7 kontinuierlich aufgebaut. Dessen Puccini-Zyklus an der Flämischen Oper wurde durch Koproduktion und Übernahme auch ins deutsche Opernleben eingespeist: Neben der eher matten Hamburger „Tosca“ wurde auch Mannheim mit Carsens psychologisch interessanter „Turandot“ aus Belgien bedacht. Auf der Autobahn von Brüssel nach Lüttich durchquert man mehrfach die Sprachgrenzen, die den belgischen Staat nach seiner Föderalisierung zu einem nach außen kaum noch aussagekräftigen Gebilde gemacht haben. Da die Regionen eine nur einsprachige Ausschilderung als Ehrensache betrachten, wechselt also die Richtungsanzeige mehrfach von Liège nach Luik und zurück - wer nicht genau weiß, dass er ins französischsprachige Lüttich will, könnte durchaus in Verwirrung geraten (allerdings ist die flämische Bezeichnung für das nordfranzösische Lille, nämlich Rijsel, noch um einiges verwirrender). Gegenüber dem ausgefegten Brügge, dem quirligen Antwerpen und dem äußerst lebhaften Brüssel wirkt Lüttich wie das Stiefkind unter den belgischen Großstädten. Einzelne architektonische Glanzstücke aus jüngster Zeit können nicht über die noch immer herüberragende Vergangenheit als verfallende Industriestadt hinwegtäuschen. Auch das Opernhaus hat seine glanzvollen Tage bereits hinter sich und hätte eine optische Auffrischung nötig. Der österreichische Dirigent Friedrich Pleyer, seit 1994 musikalischer Chef der „Opéra Royal de Wallonie“, weiß die tückische, mehr ans Fernsehen als an ein Opernhaus gemahnende Akustik des Hauses aus Erfahrung zu nutzen. Die zweite Vorstellung der neuen Produktion von Richard Strauss’ „Elektra“ - vom Staatstheater Darmstadt übernommen - profitierte von dieser Erfahrung und präsentierte ein auffällig transparentes Klangbild. Rollendebütantin Martine Surais in der Titelpartie hat zwar hochdramatische Kraft, ist sprachlich aber nicht auf der Höhe des Hofmannsthalschen Librettos. Dagegen gibt die auch in Stuttgart bekannte Marcela de Loa als Chrysothemis ein Beispiel an genauer Textbehandlung und klarer Intonation. Die Inszenierung von Friedrich Meyer-Oertel bestätigte wieder einmal, dass die Treffsicherheit der eigentlichen Inszenierung durch eine altbackene Ausstattung (Heidrun Schmelzer) empfindlich beeinträchtigt werden kann. In Lüttich, dessen Oper von der "französischen Gemeinschaft", der Provinz und der Stadt finanziert wird, gibt es zehn Premieren pro Saison, davon sieben Neuinszenierungen, größtenteils als Koproduktionen. Ganz ähnlich sind die Verhältnisse in Brüssel und bei der Vlaamse Opera. Die belgischen Opernhäuser zusammen kommen auf rund 250 Aufführungen pro Saison. Verglichen mit den Gepflogenheiten des deutschen Repertoires ist das nicht viel - Stuttgart beispielsweise bietet in der aktuellen Spielzeit rund 160 Opernvorstellungen. Durchschnittliche und gute Abende gibt es überall. Aber Opernwunder wie Brüssels "Tri Sestry"? Sie erblühen unter den aktuellen Bedigungen im deutschsprachigen Raum doch nur selten. 8 Portraits Die Umarmung des Drachens Mit Stimme und Spielwitz erfreut sie das Publikum: Die amerikanische Sopranistin Helene Schneiderman ist seit 25 Jahren im Ensemble der Stuttgarter Staatsoper (Artikel für die Stuttgarter Zeitung, veröffentlicht heute) Das muss man sich mal vorstellen: Vor 25 Jahren war Helmut Kohl fast noch schlank, seine Partei ruhte sich gemächlich auf einem Wahlergebnis von 49 Prozent aus, das Privatfernsehen schlich sich gerade in die Wohnstuben, und der Wald machte mit dem sauren Regen Bekanntschaft. Zu dieser Zeit zog eine junge Amerikanerin von Heidelberg nach Stuttgart, wo sie der damalige Operndirektor Wolfram Schwinger ins Ensemble geholt hatte. Ein großer Schritt für Helene Schneiderman - und für die Opernwelt. Seit 25 Jahren also ist Helene Schneiderman, 1998 mit dem Titel „Kammersängerin" geschmückt, Stuttgart und seiner Oper treu. Abstecher zu anderen Bühnen, Konzertgastspiele hier und dort sowie eine Lehrtätigkeit am Salzburger Mozarteum haben den Ruhm der Mezzosopranistin vermehrt, ohne sie doch zu einer freischaffenden Tätigkeit verlocken zu können. Ein Ensemble sei eben wie eine zweite Familie, meint die Sängerin und nimmt dafür in Kauf, dass neben spektakulären Hauptrollen immer wieder auch die kleinen Partien, die sogenannten „Wurzen", auf ihrem Programm stehen. Ausgerechnet in der Jubiläumsspielzeit wird der gefeierte Publikumsliebling in keiner einzigen Stuttgarter Premiere zu erleben sein. Immerhin wird ihr jetzt am Sonntag die Aufführung der Händel-Oper „Teseo" gewidmet, zum Silberjubiläum - und als Medea dürfte Helene Schneiderman stimmlich und darstellerisch wie gewohnt glänzen. In dieser sonst nicht sehr aufregenden Inszenierung gibt es einen Moment, der vielleicht ein wenig vom Geheimnis der außergewöhnlichen Sängerin lüftet. Da watschelt nämlich, während Schneiderman ihre große Arie singt, ein ferngesteuerter, blinkender Minidrache auf die Bühne und stiehlt der furiosen Medea die Show. Die Sängerin lässt das geschehen, bis sie nach einer Weile das Tierchen in den Arm nimmt und liebkost - eine Umarmungstaktik, mit der die drohende Rivalität entschärft und nebenbei klargestellt wird, wer in dieser Oper den Ton angibt. Schneiderman weiß durchaus auf der Klaviatur der Diva zu spielen. Da wird beim Fototermin mit der Haartracht kokettiert und das eigentlich längst anstehende Debüt an der Met angemahnt und ein Telefonat mit dem Mann von der Zeitung geht kurzfristig schon gar nicht. Das Sympathische an der temperamentvollen Sängerin ist aber, dass sie von all dem auch Abstand nehmen und über sich selbst lachen kann. „Wenn sie auf die Probe kommt, lockert sich sofort die Atmosphäre", sagt der Solorepetitor Stephen Hess, der langjährige musikalische Gefährte von Schneiderman. Sie verbinde den Spaß an der Arbeit mit höchster Konzentration, stelle sich stilistisch auf jede Anforderung ein und sei vor jeder neuen Partie auch heute noch ehrlich nervös, erzählt Hess. Stuttgarts ehemaliger Opernintendant Klaus Zehelein bewundert insbesondere Schneidermans Wandlungsfähigkeit, die „äußerst seltene Verbindung von musikalischer und szenischer Intelligenz mit fulminanter Gesangstechnik" und den Zusammenklang von Individualität und Gemeinsinn: „Helene war, ist und bleibt hoffentlich das Zentrum des Staatsopernensembles. Sie will immer das Beste für die Kunst erreichen", so Zehelein. Das ist wohl der Kern der Sache: Helene Schneiderman beherrscht ihr Metier, ohne daraus eine Attitüde oder gar Allüre zu machen. Als Zuschauer erinnert man sich auch an die Persönlichkeit - und eben nicht nur an die schönen Töne allein. 9 Auch die Komponistin Adriana Hölszky gerät noch zwanzig Jahre nach der legendären Uraufführung ihrer Oper „Bremer Freiheit", in der Helene Schneiderman die Hauptrolle sang, ins Schwärmen: „Sie hat sich völlig eingesetzt, auch als Mensch, sie hat alle Feinheiten meiner Musik erfasst, sie ist großartig, absolute Spitzenklasse." Seitdem standen für die Sängerin zwar vorwiegend Klassiker wie Händel, Mozart und Rossini auf dem Programm, aber neugierig ist Helene Schneiderman noch immer. Sogar das Twittern hat sie ausprobiert. Da sage noch einer, Kammersängerinnen seien altmodisch. 10 „Gibt es ein sinnlicheres Instrument?“ Jean Guillou musiziert an der Schuke-Orgel der Philharmonie - Beitrag für das Magazin der Berliner Philharmoniker Jean Guillou? Der Jean Guillou? Zwei Augenpaare leuchten auf. Für die Freunde, die häufig in Paris sind, zählt ein Besuch der Messe in St. Eustache zu den größten Erlebnissen, die die französische Hauptstadt bietet. Das hat weniger mit Religiosität zu tun als mit der Bewunderung für den so genannten Titularorganisten der mitten in Paris gelegenen Renaissancekirche. Das eigenartige Amt kann ganz unterschiedlich bekleidet werden: Manche Musiker erscheinen nur selten persönlich am Instrument ihrer Kirche, andere – und zu diesen zählt Jean Guillou – nehmen den Dienst als umfassende Verpflichtung. An St. Eustache ist deshalb nicht nur jede Messe ein musikalisches Fest, meist gekrönt von einer rasanten Orgelimprovisation; Guillou gibt vor den Gottesdiensten sogar ein Extrakonzert mit eloquenter Einführung. In Angers, einer mittelgroßen Departementshauptstadt im Westen Frankreichs, kam Jean Guillou 1930 zur Welt. Wie ihn schon als Kind die „Königin der Instrumente“ fasziniert hat, beschreibt er in seinem Buch „L’Orgue – Souvenir et Avenir“, das auch in deutscher Übersetzung vorliegt: „Vor langer Zeit, als ganz kleines Kind, nahm ich mit einem riesigen Schlüssel in der Hand den Weg auf die Orgelempore. Wie ein Abenteurer, der die schlaftrunkenen Wesen der Unterwelt zum Leben erweckt, wagte ich es, der verheißungsvollen Maschine aus ihrem Schatten heraus entgegenzutreten und eine Stimme wachzurufen; eine Stimme des höchsten Streites, des Vergnügens, der zündenden Kraft.“ Das Orgelspiel brachte sich Jean Guillou selbst bei, und er empfindet diese autodidaktische Ausbildung nicht als Nachteil; im Gegenteil: In vielen Fällen sei dieser Weg der einzige, auf dem sich eine musikalische Persönlichkeit individuell ausformen könne, meint der Musiker, der heute an den großen Orgeln in aller Welt konzertiert. Schon als Zehnjähriger wurde Jean Guillou zum Titularorganisten der Kirche St. Serge in seiner Heimatstadt Angers ernannt und erregte nicht zuletzt mit seiner Improvisationskunst Aufsehen. Auf Empfehlung eines Musikkritikers wurde der kleine Jean dem Komponisten Marcel Dupré vorgestellt, der ihn an die Kollegen Maurice Duruflé und Olivier Messiaen weitervermittelte. Es muss eine aufregende Zeit gewesen sein am Pariser Conservatoire, denn mit Dupré, Durflé und Messiaen fand der junge Guillou Lehrer und Mentoren, die ihm die fruchtbare Verbindung von Orgelspiel, Pädagogik und Komposition vorlebten. Seine pädagogischen Talente waren zunächst abseits von den großen Musikzentren gefragt: 1955 wurde er als Orgelprofessor nach Lissabon berufen. Als Interpret hatte sich Guillou damals bereits einen guten Namen gemacht, wenngleich ihm erst die Berufung an St. Eustache die Tore zur musikalischen Welt angemessen weit aufschloss. Zwischen Lissabon und Paris aber liegt eine Station, die für Guillou für einige Jahre auch privat bedeutsam war und an die er nun nach langer Zeit wieder zurückkehrt: Berlin. Hier war Jean Guillou 1958 zu einem Konzertgastspiel eingeladen, hier absolvierte er anschließend einen längeren Sanatoriumsaufenthalt, der einen praktischen Nebeneffekt hatte: Der Franzose eignete sich die deutsche Sprache perfekt an – zunächst auf der Basis von Karl-May-Romane, die ein Mitpatient in Unmengen verschlang! Guillou blieb fünf Jahre in Berlin und widmete sich verstärkt der Kompositionstätigkeit, die ein überraschend vielseitiges Oeuvre auch abseits der Orgel hervorgebracht hat. So liegen mehrere Sinfonien und weitere Orchesterwerke vor, die in Deutschland noch nicht aufgeführt wurden, während die Orgelstücke von vielen Musikern bewundert und gespielt werden. „Gibt es ein sinnlicheres Instrument als dieses?“, fragt Jean Guillou in seinem Orgelbuch, „schöpft nicht jeder Ton sein Leben aus der Luft, die wir atmen, um sich, erfüllt mit den tiefsten und den höchsten Obertönen, mit den innersten Schwingungen unseres Körpers zu vereinen?“ So eindrucksvoll er „sein“ Instrument bewundert, so kompromisslos ist er, wenn er unterrichtet: 11 „L’habitude“, die Gewohnheit, sei das Allerschlimmste, rügt er den allzu routiniert musizierenden Nachwuchs. Die Kunst der Registrierung indes, die Guillou meisterhaft (und in ihrer individuellen Radikalität immer wieder für Diskussionsstoff sorgend) beherrscht, mag er nicht eigentlich „unterrichten“: Sie sei etwas Höchstpersönliches, ein intimer Dialog zwischen Komponist und Interpret. Der vielseitige Franzose ist ein gefragter Experte für die Konzeption von neuen Orgeln und ein Visionär, der die Zukunft des Instruments durchaus nicht nur in der Kirche sieht. Anknüpfend an antike Vorbilder und Ideen, hat der Franzose eine „Orgel mit variabler Struktur“ erdacht, ein groß dimensioniertes und doch bewegliches Instrument, das die Musik zu den Menschen bringen soll und nicht umgekehrt: „Die mystische oder die mythische Orgel, die eine wie die andere eine Schöpfung des Menschen, wird nur dann Ruhm erlangen, wenn sie sich dem Menschen nähert. Dort wollen wir sie wiedererstehen lassen, in der Nähe des Ohres und des Auges“, erklärt Guillou und träumt lebhaft von einem Konzert mit dieser Orgel auf Berlins Waldbühne. Die Pläne für das variable Instrument sind fertig, der Orgelbauer Klais in Bonn steht bereit, aber noch fehlt der Mäzen, der aus der Vision Wirklichkeit werden lässt. Die Musik, so sagt Jean Guillou, fange erst in dem Moment an zu existieren, in dem sie gehört wird. „So entdecken wir mit dem Vergnügen zu spielen jenes, ein Werk zu schaffen, dieses Werk ans Licht zu bringen, es an ein anderes Licht zu bringen als jenes, von dem es bei jeder seiner vorhergehenden Aufführungen erhellt worden ist“. Und Jean Guillou wäre nicht Jean Guillou, stellte er nicht auch an seine Hörer hohe Ansprüche. Das Publikum gebe es natürlich nicht, aber das wahre, das ideale Publikum sei eines, das dem Musiker „wie bei einem Ritual assistiere“. Nun spielt der visionäre Intellektuelle und charismatische Vollblutmusiker erstmals in einem Recital die Schuke-Orgel in der Berliner Philharmonie – in einem Saal, an dessen Baustelle er in seinen Berliner Jahren vorbeiflanierte: Ein Kreis schließt sich. 12 Von Finnland lernen oder Das nordische Dirigentenwunder Beitrag für das Magazin der Berliner Philharmoniker (September/Oktober 2004) Von Finnland lernen? Zumindest beim alljährlichen Schlagerwettbewerb namens Eurovision Song Contest ist die nordische Nation das, was man auf neudeutsch „loser“ nennt. Fünf Jahrzehnte lang fand man sich meist auf den hinteren Rängen wieder, und heuer blieb der finnische Beitrag – immerhin angelehnt an die weithin unbekannte, aber bemerkenswerte landeseigene Tango-Tradition – bereits im Halbfinale stecken. Womöglich revanchiert sich Europa auf diesem Nebenschauplatz dafür, dass Finnland in der so genannten Ernsten Musik längst Weltgeltung erlangt hat? Dass finnische Komponisten wie Einojuhani Rautavaara, Kaija Saariaho und Magnus Lindberg, insbesondere jedoch Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo, Mikko Franck und der im Oktober bei den Berliner Philharmonikern debütierende Osmo Vänskä im internationalen Musikleben eine so auffällige Rolle spielen, kommt nicht von ungefähr. Die meisten von ihnen wurden an der Sibelius-Akademie in Helsinki ausgebildet, aber das renommierte Institut ist keine einsame, elitäre Kaderschmiede. Europas drittgrößte Musikhochschule krönt vielmehr ein System, in dem der finnische Staat grundsätzlich jedem Kind eine musikalische Ausbildung anbietet. In den 60-er Jahren wurde in dem weitläufigen, dünn besiedelten Land ein dichtes Netz von Musikschulen und Konservatorien geknüpft, getragen von den Gemeinden und von der Regierung in Helsinki mitfinanziert. Alle Schulen haben Klassen mit musikalischem Schwerpunkt, die öffentlichen Büchereien legen Wert auf eine gute Musikabteilung. Das hat zweierlei Auswirkungen: Eine überdurchschnittliche Zahl von jungen Finnen schlägt den professionellen Weg ein und wird durch großzügige Stipendien weiter gefördert, die anderen formen ein offenes und begeisterungsfähiges Publikum für die zahlreichen Orchester, Festivals und Operntruppen. Auch Osmo Vänskä kam in der kleinen Hafenstadt Kotka früh mit diesem System in Berührung. Seine Eltern wollten, dass jedes ihrer Kinder ein Instrument lernt, und Osmo als Jüngster begann mit neun Jahren auf der Geige, bald darauf wechselte er zur Klarinette. Als Instrumentalist kam er zur Sibelius-Akademie, für das Dirigieren interessierte er sich erst später. Dabei lernte er jene Persönlichkeit kennen, die von großer Bedeutung für das finnische „Dirigentenwunder“ ist: Jorma Panula. Lange Jahre prägte Panula die Dirigentenausbildung in Helsinki, seit seiner Pensionierung unterrichtet er auf der ganzen Welt. Dabei spart Panula nicht mit kritischen Worten, wenn ein Dirigent sein Orchester zu stark zu prägen versucht oder, wie sein Schüler Mikko Franck, eine seiner Meinung nach zu frühe und schnelle Karriere macht: „Das beste Alter für einen Dirigenten ist an die 80.“ Davon ist Osmo Vänskä, 1953 geboren, noch eine ganze Weile entfernt. Aber auch er hat bereits Wunder bewirkt. Das Sinfonieorchester der 100.000-Einwohner-Stadt Lahti, das er 1988 übernahm, erzog er zum Spitzenensemble, und als sich die Göteborger Symphoniker für die Fortsetzung eines kompletten Sibelius-Aufnahmezyklus beim kleinen Label BIS zu fein wurden, sprangen Vänskä und sein Orchester mutig ein und stehen heute als Sibelius-Interpreten einzigartig da. Gut 50 CDs sind bisher erschienen, zum 50. Todestag des Komponisten 2007 soll die Edition mit rund 70 Silberscheiben komplett sein. Seit letztem Herbst ist Osmo Vänskä, der vor 30 Jahren Privatunterricht beim philharmonischen Klarinettisten Karl Leister in Berlin nahm und vom Chorpodium der Philharmonie aus Karajan erlebte, Chefdirigent des Minnesota Orchestra und steht damit in einer eindrucksvollen Reihe mit 13 Ormandy, Mitropoulos, Dorati und Marriner. Wiewohl für dieses Engagement sicher künstlerische Gründe ausschlaggebend waren, dürfte sich Osmo Vänskä, dessen Familie aus Karelien stammt und der ausgedehnte Wanderungen und Motorradtouren im winterlich einsamen Lappland liebt, im berüchtigt kalten Minnesota fast wie zu Hause fühlen. Für das „Dirigentenwunder“ macht Vänska übrigens neben der gründlichen, breiten musikalischen Ausbildung letztlich Jean Sibelius verantwortlich, dessen Ruhm schon früher den finnischen Orchesterchefs auf die internationalen Podien geholfen habe. Vielleicht kann ein Volk, das als größten Nationalhelden einen Komponisten verehrt, gar nicht anders, als diesem nachzueifern: „Wir reden zwar nicht viel, aber wir drücken uns durch Musik aus“, meint dazu Vänskäs Kollege Jukka-Pekka Saraste. Von Finnland lernen? Klassische und neue Musik allerorten, glänzende Ergebnisse bei der PISAStudie, nach der Parlamentseröffnung gehen die Abgeordneten in die Oper und nicht in die Kneipe, und schon vor Jahren wählte sich die Nation ein weibliches Staatsoberhaupt - wie schrieb der englische Musikkritiker Norman Lebrecht: „Die Zukunft gehört den Finnen.“ Da darf man doch über Misserfolge mit der leichten Muse souverän hinwegsehen. 14 Der besondere Griff Der Stuttgarter Dirigent Helmuth Rilling wird 70. Feature ddp-Nachrichtenagentur 23.05.03 Der Stuttgarter Dirigent Helmuth Rilling feiert am kommenden Donnerstag seinen 70. Geburtstag. Als Leiter der von ihm gegründeten Bachakademie und durch Tourneen mit seinen Ensembles Gächinger Kantorei und Bach-Collegium Stuttgart ist Rilling weltweit gefragt. In Stuttgart verantwortet er die Bachwoche und das Europäische Musikfest, bei dem Bachs Werk in Zusammenhänge mit romantischer und neuer Musik gestellt wird. Sein Geburtstag wird in Stuttgart mit einem Festgottesdienst, einem Festakt und einem Benefizkonzert begangen. Manchmal greift Helmuth Rilling den Taktstock ganz anders als seine Kollegen. Der Stuttgarter Dirigent, der am kommenden Donnerstag 70 wird, macht den kleinen Stab, der nicht selten für Macht und Distanz gleichzeitig steht, durch eine besondere Haltung der Hand gleichsam kürzer und verringert damit den Abstand zu Chor und Musikern. Das mag nur ein Detail sein und ist dennoch sehr bezeichnend für Helmuth Rillings persönliche und am gemeinschaftlichen Wollen ausgerichtete Art, das Werk von Johann Sebastian Bach – und nicht nur dieses – zu musizieren. Zwar steht die Bach-Pflege im Mittelpunkt von Rillings Wirken als Dirigent und Pädagoge. Die Gründung der Stuttgarter Bachakademie vor über 20 Jahren, die Einspielung aller Bach-Kantaten auf Schallplatte und CD sowie die jährliche Bachwoche dokumentieren diesen Schwerpunkt nach außen. Langweilig wird es Rilling dabei nicht. „Gerade Bach entdecke ich immer wieder neu“, erklärt er und freut sich, wenn auf Tourneen die eigentlich unspektakulären Kantaten besonders nachgefragt werden, wie kürzlich in Mailand geschehen. Dennoch hat sich der Dirigent, der als junger Student 1953 die Gächinger Kantorei gründete und sie schnell zum Spitzenensemble erzog, nie als Bach-Spezialist verstanden, obwohl er die großen Passionen wohl mehrere hundert Male dirigiert hat. Im Gegenteil: Von Anfang an beschäftigte sich Rilling intensiv und gegen den damaligen Zeitgeist mit den großen Oratorien des 19. Jahrhunderts, und mit dem Europäischen Musikfest schuf er sich ein Forum, das die Werke von Bach in größere Zusammenhänge stellt. Dabei macht Rilling auch vor ganz neuer Musik nicht Halt. Das Musikfest 2000 setzte mit der Uraufführung von vier neu komponierten Passionen ein besonderes Zeichen. Spätestens in diesem Jahr setzte auch die internationale Resonanz ein, die sich Rilling für das 1990 gegründete Stuttgarter Festival wünschte. In Sachen Bach gehört die weltweite Nachfrage längst zur Arbeit des Dirigenten –nicht nur auf Tourneen, sondern immer wieder durch Kurse für junge Musikerinnen und Musiker von Krakau bis Caracas. Den dortigen Ablegern der Bachakademie hat der Dirigent die Spenden zugedacht, die er sich an Stelle von Geschenken wünscht – und die Einnahmen des Benefizkonzerts am Abend des Ehrentags, bei dem sich Rilling das Dirigentenpult mit seinem polnischen Kollegen und Freund Krzysztof Penderecki teilt. Im Gespräch strahlt Helmuth Rilling eine charismatische Mischung aus Altersweisheit und fast jugendlichem Schwung aus –für einen Dirigenten ist 70 schließlich kein Alter, in dem man ans Aufhören denkt. Vor allem gelassen geht er auch mit der Diskussion um die historische Aufführungspraxis um, die sich in den 80-er Jahren beinahe zum Glaubenskampf erweiterte. Rilling ließ sich zwar anregen und experimentierte mit alten Instrumenten, geht aber seinen persönlichen Weg unbeirrt weiter – die Macht des Dirigenten nie in den Vordergrund stellend, aber auch nie auf das für ihn Wichtigste an der Musik verzichtend: das Gefühl. 15 Viel Mut und ein bisschen Heimweh Die armenische Sopranistin Karine Babajanian ist neu im Stuttgarter Opernensemble – Beitrag für die Stuttgarter Zeitung (29.10.2003) Falls Karine Babajanian irgendwann einmal im Betriebsbüro der Stuttgarter Oper um Gastierurlaub für einen auswärtigen „Troubadour“ bittet, sollten dort die Alarmglocken schrillen. Die Leonora in Verdis Oper scheint für die armenische Sopranistin, die seit kurzem Ensemblemitglied in Stuttgart ist, eine „Wechselpartie“ zu sein. Von Koblenz, wo sie von 1999 bis 2001 sang, gastierte sie im Bielefelder „Troubadour“ – und erhielt das Angebot für ein festes Engagement. Gleiches in Stuttgart: Im Dezember 2001 sprang Karine Babajanian ganz kurzfristig für Catherine Naglestad ein. „Spät abends bin ich geflogen, vormittags war Probe, abends stand ich auf der Bühne“, erzählt die Sängerin. Aller Hektik zum Trotz wurde es eine tolle Aufführung, und Stuttgart warb Bielefeld kurzerhand seinen Sopranstar ab. Vier Jahre Opernprovinz waren für die 1968 in Armeniens Hauptstadt Eriwan geborene Künstlerin Teststrecke und Verwöhnprogramm zugleich. An einer größeren Bühne hätte sie kaum Gelegenheit gehabt, so verschiedene Partien wie die Figaro-Gräfin, Senta, Jenufa, Desdemona und Agathe zu singen. Im Sommer 2002 hat Karine Babajanian sogar Bellinis Norma ausprobiert – an der südenglischen, von Liebhabern organisierten Dorset Opera, wo es „richtig gemütlich“ gewesen sei. Überall schlossen Publikum und Presse die Sängerin ins Herz. Lobeshymnen wie „vollendetes Puccini-Glück“ oder „Gesangsmagierin“ wollen nun am neuen Wohn- und Arbeitsort Stuttgart ersungen sein. Dazu will die Sopranistin ihr ungewöhnlich breites Repertoire ein wenig umsortieren. „Ich werde mich noch mehr auf das italienische Fach konzentrieren“, sagt Babajanian und überrascht mit einer erfrischend ehrlichen Begründung: „Damit habe ich bisher den größten Erfolg gehabt.“ Ihre von den Kritikern besonders gelobte Koloraturtechnik war Karine Babajanian zunächst eher fremd. „Als ich mit dem Studium angefangen habe, konnte ich nur schöne große Töne singen“, erinnert sie sich. Ihre Lehrerin an der Hochschule in Eriwan habe ihr die stimmliche Beweglichkeit beigebracht: „Das war harte Arbeit!“ Jetzt beherrscht sie Koloratur, lyrische Geschmeidigkeit und dramatische Attacke. Beste Voraussetzungen also für Erfolge von Mozart über den Belcanto und Verdi bis zur veristischen Oper, zumal die Sängerin dem stimmlichen Material eine sehr attraktive äußere Erscheinung mitgeben kann. Ihre Heimatstadt Eriwan, rund doppelt so groß wie Stuttgart, verfügt trotz aller wirtschaftlichen Probleme über ein breit gefächertes Kulturleben. „Wir haben mehrere Orchester, eine Oper, ein Operettentheater, und alles auf hohem Niveau“, erzählt Karine Babajanian. Schon während ihrer Ausbildung stand sie auf der Bühne der Armenischen Staatsoper und sang dort große Partien wie Santuzza und Desdemona. Nach Deutschland kam sie 1998 für ein kleineres Konzert in Hamburg und hörte dort beim ersten Tag eines Gesangswettbewerbs zu. Zufällig lauschte eine Organisatorin an der Tür des Übungsraums, als Karine Babajanian mit einer Landsmännin nur zum Spaß ein Duett sang. Über Nacht fand sie sich selbst im Wettbewerb wieder - „zum Glück konnte ich die Pflichtstücke schon“, lacht sie. Auch eine Agentur wurde in Hamburg auf sie aufmerksam und vermittelte das Engagement nach Koblenz. Erst in dieser Zeit begann Karine Babajanian, Deutsch zu lernen – heute beherrscht sie die schwere Sprache sehr gut und wundert sich im Nachhinein, dass sie im Studium schon so viele deutsche Lieder lernen konnte. 16 Am kommenden Samstag steht in Stuttgart die Premiere von Martin y Solers „Una cosa rara“ an, in der Karine Babajanian die Isabella singt – laut Mitteilung der Operndramaturgie „eine erfolgreiche Powerfrau“ und damit nicht weit vom Charakter der Darstellerin entfernt. Wie vielen anderen Opernfreunden war der Sängerin dieses Werk nur in Form eines kurzen Zitats in Mozarts „Don Giovanni“ bekannt gewesen. Bei Probenbeginn war sie ebenso wie ihre Partner auf der Bühne skeptisch – „wir dachten, es ist eben doch kein Mozart“, erzählt sie. „Aber inzwischen lieben wir alle das Stück“, fügt sie an. Regisseur Jossi Wieler und Dirigent Enrique Mazzola scheinen auch das neue Ensemblemitglied von dem versunkenen Opernschatz überzeugt zu haben: „Sie machen das Werk lebendig“, freut sie sich. In dieser Spielzeit stehen noch Elvira, Mimi und Gräfin auf Karine Babajanians Programm. Rund 30 Abende in Stuttgart sollen es werden, ein paar mehr als ursprünglich geplant. Dennoch zieht die Sängerin die feste Bindung an ein Ensemble der Freiberuflichkeit vor. „Als Gast kann man auch nicht alles machen, was man will“, urteilt sie und freut sich, dass ihr die Stuttgarter Oper Auftritte an anderen Häusern wie Essen, Hannover und wieder Bielefeld ermöglicht. An diesem Ort ihrer bisher größten Erfolge will Karine Babjanian einmal pro Saison eine große Partie erarbeiten und ausprobieren – in dieser Spielzeit wird es die Amelia in Verdis „Maskenball“ sein. Wagemutig war die Sopranistin auch bei der Wohnungssuche in Stuttgart. Sehr optimistisch gab sie eine Anzeige mit der Titelzeile „Sänger-Ehepaar sucht Wohnung“ auf und erhielt prompt das Angebot eines opernbegeisterten Vermieters. Jetzt ist der Stuttgarter Westen auch für ihren in Dortmund engagierten Ehemann und die elfjährige Tochter eine neue Heimat. „Mehr als West, Ost und Mitte kenne ich aber noch nicht“, bedauert Karine Babajanian. Vielleicht hat sie nach der Premiere etwas Zeit, die Stadt über Theater und Probebühne hinaus zu erkunden. Dem immer mal wieder auftauchenden Heimweh nach Armenien werden aber auch die Schönheiten der Schwabenmetropole sicher nicht völlig abhelfen. Jeden Sommer fährt die Sängerin in ihre Heimat, nur dieses Jahr hat es wegen des Umzugs nach Stuttgart nicht geklappt. „Ich habe noch immer viele Kontakte nach Armenien“, erzählt Karine Babajanian, und ihre großen dunklen Augen strahlen: „Sie warten dort auf mich!“ 17 Programmheft- und Magazinbeiträge Ansichten von Modernität oder Was macht man mit der Sonate? Zum Debütkonzert von Boris Giltburg beim Lucerne Festival (Programmheftbeitrag, Konzert am 01.09.2009) „Er kann meine Sachen einfach nicht in Ruhe lassen“, soll Frédéric Chopin über die Interpretationen seiner Stücke durch Franz Liszt gesagt haben. Liszt legte seiner musikalischen Fantasie auch als Pianist keine Zügel an und ergänzte die Klavierwerke des rund ein Jahr Älteren durch persönliche Zutaten. Das Paris der 1830er-Jahre bot beiden viel Raum – die französische Hauptstadt, geprägt durch die in ihren vielfältigen Auswirkungen gern unterschätzte Julirevolution von 1830, war die größte Plattform für die Musik und Musiker jener Zeit. Nun war zwar Frédéric Chopin, der kaum große öffentliche Konzerte spielte, als Virtuose keine Konkurrenz für Liszt. Der ehrgeizige Ungar betrachtete vor allem Sigismund Thalberg (18121871) als Rivalen und eilte beispielsweise 1836 von Genf nach Paris, um in einem eigens angesetzten Konzert seine Überlegenheit zu beweisen. Allerdings war die einige Jahre zuvor begonnene Freundschaft zwischen Liszt und Chopin nicht völlig frei von Konkurrenzdenken. Liszt, der auch als Komponist und Dirigent große Räder schwang, äußerte sich mit kaum verdeckter Herablassung darüber, dass Chopin „nur“ für das Klavier komponierte und die sinfonisch geprägten Großformen nicht bediente. Dies mag zu der Einschätzung von Frédéric Chopin als „Salonkomponisten“ beigetragen haben, der eigentlich bis heute etwas Deklassierendes anhaftet. Dabei wird negiert, dass der Pariser Salon kein Kaffeekränzchen mit musikalischer Untermalung war, sondern eine kulturelle Institution, in der sich musikalische Karrieren ohne Einbuße an vermeintlich „öffentlicher“ Wirkung manifestierten – zumal ein Salon durchaus Ausmaße und Bedeutung eines mittleren Konzertsaales annehmen konnte. Chopin und Liszt beendeten ihre Karrieren als Klaviervirtuosen jeweils zu der Zeit, in der ihre im heutigen Konzert gespielten Werke entstanden: Chopin, um sich auch aus Scheu vor großen Menschenmengen auf den Salon zu beschränken; Liszt, um sich konzentriert der Kompositionstätigkeit und auch der Arbeit als Dirigent zuzuwenden. Für die Klaviermusik insgesamt hatten beide eine ähnlich große Bedeutung wie vor ihnen Ludwig van Beethoven und mit ihnen Robert Schumann, wobei Chopin die lyrischen, innigen Nuancen ausbaute und Liszt die großen, pathetischen Töne. Dass Franz Liszt – vermittelt durch seinen Lehrer Carl Czerny – ein „Enkelschüler“ Beethovens war und als rühriger Pädagoge selbst wiederum viele „Urenkel“ ausbildete, markiert Verbindung und Abgrenzung zugleich. Letztere drückt sich auch durch die Abkehr von der Klaviersonate als Standardgattung aus, die bei Liszt ebenso wie bei Chopin keine zentrale Bedeutung mehr hat. Dass Sergej Prokofjew rund ein Jahrhundert später die zwar nie ganz versunkene, aber doch bedeutungsarm gewordene Gattung der Klaviersonate wieder aufnahm, deutet auf die äußerst reizvolle Dialektik zwischen Tradition und Innovation, die ein anonymer Rezensent der Allgemeinen Musikalischen Zeitung schon 1811 – Beethovens „Appassionata“ war damals einige Jahre alt, Chopin und Liszt kaum in Kinderschuhen – hellsichtig beschrieben hatte: „Uebrigens ist es recht sehr zu loben, dass manche unserer denkenden Componisten Auswege suchen, die gemeyne Sonatenform zu verlassen. Es lässt sich freilich auch in verbrauchten Formen etwas Gutes sagen: aber weniger anziehend ist es doch, und auch gute Köpfe werden dadurch leicht, wenigstens hin und wieder, in einen gewissen bequemen Schlendrian verlockt.“ Davon kann in Beethovens f-Moll-Sonate op. 57, die ihren Beinamen „Appassionata“ erst 1838 durch einen Verleger erhielt, allerdings keine Rede sein. Das Werk, dem fünf Jahre lang keine Klaviersonaten in Beethovens Oeuvre folgen sollten, hat für die seinerzeit nicht mehr unumstrittene Gattung einen hohen Stellenwert. Mit seiner schieren Größe in Ausmaß und 18 Ausdruck fordert es auch für die adäquate Darstellung einen großen Rahmen, also den Konzertsaal, die „Institution Klavierabend“, die zu Beethovens Zeit keineswegs ein selbstverständlicher Bestandteil des sich erst bildenden bürgerlichen Konzertbetriebs war. Alle musikalischen Parameter spannt Beethoven hier auf das Äußerste an: Die Harmonik wird immer wieder verwischt und festigt sich kaum; die musikalische Thematik ist einerseits durch ein das ganze Werk durchziehendes Motiv verklammert, lässt sich andererseits aber nicht mehr in Hierarchien wie „Hauptthema und Begleitung“ oder „Einleitung und Hauptteil“ gliedern. Höchst innovativ ist Beethovens Behandlung der Reprise (ohnehin ein der Sonatenform eingeborenes Problem) im ersten Satz, wo er das Hauptthema in stark veränderter Anmutung wiederkehren lässt und der Coda neuartiges formales Gewicht zuspricht. Die zunächst überraschende Idylle des Mittelsatzes wird durch den unvermittelt hereinbrechenden, dämonischen Furor des Finales zerstört, das zwar erneut die Sonatenform aufscheinen lässt, ihr jedoch kaum noch zu zügelnde Sprengkraft einverleibt. Für Franz Liszt war das Sprengen, oder besser: das Überwinden traditioneller Formen nichts Ungewöhnliches. Gerade in seiner Weimarer Zeit ab 1848 zeigte er sich neben der Dirigententätigkeit auch als Komponist höchst kreativ und schuf unter anderem die zwölf sinfonischen Dichtungen, die historisch betrachtet seine größte Leistung sind, sowie die Faustund die Dante-Sinfonie. Nicht nur mit diesen Werken bereitete Liszt die großen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts vor, auch seine Klaviermusik ist innovativ vor allem in ihrer von außermusikalischen Parametern beeinflussten und orchestralen Wirkungen sich annähernden Klanglichkeit. Unter dieser Perspektive ist „La leggierezza“ ein untypisches, eher gefälliges Stück. Es entstand 1848 als mittlere von drei „Études de concert“ (auch „Caprices poétiques“) und zeigt in seiner brillanten Geläufigkeit mit chromatischen Einsprengseln eine sicher nicht zufällige Ähnlichkeit mit Frédéric Chopins Etuden. Als musikalische Komposition an sich ist auch Chopins g-Moll-Ballade wenig spektakulär. Als instrumentale Form war die Ballade jedoch bis dahin nicht gebräuchlich, und Chopin kann durchaus als ihr „Erfinder“ gelten. Er ließ sich hier – was eher selten geschah – von literarischen Vorlagen aus seiner polnischen Heimat inspirieren, im konkreten Fall wohl von einem litauischen Heldengedicht, dessen Einfluss aber eher allgemein bleibt und das nicht etwa vom Klavier nacherzählt wird. Das rund achtminütige Werk beginnt mit einer düsteren Largo-Einleitung, um sodann das „Sonatenproblem“ musikalisch zu thematisieren. Auffallend ist, nach einer durchaus traditionellen Behandlung von Haupt- und Seitenthema, die Aufwertung der Coda gegenüber der Durchführung und damit eben jene Umgewichtung der Formteile, die sich schon in Beethovens „Appassionata“ manifestierte. Das umfangreiche Oeuvre von Sergej Prokofjew wird von Klaviersonaten umrahmt. Als 18Jähriger hatte der Komponist eine solche (sein op. 1) komponiert, und er hinterließ bei seinem Tode im Jahre 1953 sowohl Fragmente einer zehnten als auch Pläne für eine elfte Klaviersonate. In dieser Konsequenz steht Prokofjew als „Sonatenkomponist“ in seiner Zeit allein da – insbesondere die gesellschaftlichen Veränderungen nach 1918 riefen in vielen Komponisten eine antibürgerliche Haltung hervor, und das Klavierstück, gar die Sonate, galten unter diesem Blickwinkel als überholt. „Nimm keine Rücksichten auf das, was du in der Klavierstunde gelernt hast“, instruierte Paul Hindemith den potenziellen Spieler seiner „Suite 1922“, und man darf dies wohl auch im übertragenen Sinne, als Spitze gegen das „bürgerliche“ Komponieren für Klavier werten. Man kann Sergej Prokofjew, der selbst ein namhafter und virtuoser Pianist war, allerdings nicht wegen seiner Klaviersonaten als Konservativen abstempeln. Sein Biograf Thomas Schipperges unterstreicht: „Früh und durchaus neben der Exaltiertheit seines aphoristischen Klavierstils erschien dem Komponisten (…) auch die Rezeption der Klassiker als eine Möglichkeit des Abweichens von romantisch ausgetretenen Bahnen“. Offenbar hat Prokofjew die Sonatenform als geeignetes Gefäß für seine spezielle stilistische „clarté“ empfunden, die zwar 19 tonale, rhythmische und dynamische Härten ganz und gar nicht ausschließt, sich aber von der verfeinerten Überhitzung der Jahrhundertwende lossagt. So sind die neun vollendeten Klaviersonaten von sehr unterschiedlichem Charakter, als habe der Komponist bei jedem dieser Werke bestimmte Aspekte der Tonkunst bearbeiten wollen. Die Trias der „Kriegssonaten“ (Nr. 5 bis 8), die Prokofjew 1939 – nach über eineinhalb Jahrzehnten Pause in dieser Gattung – begann und die er parallel bis 1944 komponierte, kann man als Triptychon ansehen, ohne dass ihnen eine musikalische Verwandtschaft eingeschrieben wäre. Die Kriegsjahre ab 1941 wirkten auf die ursprünglichen Pläne zur B-Dur-Sonate op. 84 ein, beeinflussten den Kompositionsprozess und dessen Ergebnis. Man kann in den drei Sätzen – ursprünglich sollten es vier werden – durchaus eine „Biografie“ heraushören, aber markanter ist doch die musikalische Meisterschaft als solche. Das Werk beginnt ungewöhnlich, mit einem langsamen Eingangssatz, der zeitweilig große Wucht entfaltet, jedoch im Pianissimo endet. Das musikalische Material ist mit der gleichzeitig entstandenen Oper „Krieg und Frieden“ verwandt. In den zweiten Satz, der ein Menuett vorspiegelt, bricht das Finale plötzlich und kraftvoll ein; ein vitales Rondo, das episodenhaft sowohl lyrische Passagen als auch die für Prokofjew so charakteristischen perkussiven Elemente umfasst. „Mein einziger Ehrgeiz als Musiker war und wäre, meinen Speer in die grenzenlosen Räume der Zukunft zu schleudern“, schrieb Franz Liszt 1874 an seine vormalige Lebensgefährtin, die Fürstin Sayn-Wittgenstein. Dass in diesen grenzenlosen Räumen auch der Rekurs auf nur vermeintlich „alte“ Formen möglich ist, ohne den bereits etablierten Fortschritt zu verraten, hat Sergej Prokofjew in feiner Dialektik gerade mit seinen Klaviersonaten bewiesen. Er befindet sich damit nahe am feinsinnigen Modernitätsbegriff von Charles Baudelaire, den dieser 1863 in seinem Essay „Le peintre de la vie moderne“ folgendermaßen pointierte: „La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable” - Die Modernität ist das Vergängliche, das Flüchtige, die eine Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unwandelbare ist. 20 Felix Mendelssohn Bartholdy – das doppelte Problem I Vor rund 30 Jahren betitelte Carl Dahlhaus ein Symposium in Berlin mit „Das Problem Mendelssohn“. Allerdings zielte der Musikwissenschaftler mit dieser seither gern zitierten Formulierung nicht auf die heikle Rezeptionsgeschichte. Im Gegenteil: Das Symposium sollte die „primär biografisch ausgerichtete“ Mendelssohn-Forschung auf die Werkinterpretation ausrichten. Eine zwiespältige Sache: Einerseits mag die biografische Betrachtung den Blick auf die musikgeschichtliche Stellung von Mendelssohns Werken zeitweise verdeckt haben, andererseits sind gerade bei diesem Komponisten sachliche und persönliche Wertungen eng verknüpft, und das bis heute. Mendelssohns Musik berührt allerdings auch ein immerwährendes Problem der Musikwissenschaft: die Abgrenzung von Klassik und Romantik. Schon unmittelbar nach dem Tode des Komponisten, im November 1847, markierte G. Kühne in der Zeitschrift Europa dieses Thema: „Mendelssohn war der letzte Träger der classischen Nüance in der romantischen Richtung der Musik.“ Robert Schumann, der Mendelssohn bewunderte und sehr persönlich gehaltene Aufzeichnungen über ihn verfasste, hat den Kollegen als „Mozart des 19. Jahrhunderts“ bezeichnet. Später gebrauchte man häufig den Begriff „Klassizist“ oder „klassizistischer Romantiker“. Aber Mendelssohn und Schumann waren immerhin Zeitgenossen von Wagner, Liszt und Verdi, die niemand als Klassiker oder Klassizisten bezeichnen würde. Mendelssohns früher Tod mit Mitte 30 und Schumanns verfallende Schöpferkraft verhinderten indessen, dass sich die beiden Komponisten den musikalischen Neuerungen anschlossen, die im Gefolge der bürgerlichen Revolution von 1848 aufkamen. Mendelssohn war Bewahrer und Erneuerer zugleich. Sein Verhältnis zur Tradition ist von Respekt und Kreativität gekennzeichnet. 1830 schrieb er an Carl Friedrich Zelter: „Freilich kann mir niemand verwehren, mich dessen zu erfreuen und an dem weiter zu arbeiten, was mir die großen Meister hinterlassen haben, denn von vorne soll wohl nicht jeder wieder anfangen aber es soll auch ein Weiterarbeiten nach Kräften sein, nicht ein totes Wiederholen des schon Vorhandenen.“ Carl Dahlhaus hat dargestellt, dass dieser Umgang mit der musikalischen Tradition auf Mendelssohns Kompositionen unterschiedlich gewirkt hat: „Dass Mendelssohn in der Vokalmusik eine Pietät gegenüber der ferneren Vergangenheit wahrte, an die er sich in der Instrumentalmusik nicht gebunden fühlte, bedeutet, dass er Klassizist war, ohne Epigone zu sein.“ Zwar seien Bach und Händel Fixpunkte für Mendelssohns große Oratorien gewesen, Beethoven jedoch habe sich für die Sinfonik nicht als „Klassiker“ geeignet. So wurden (und werden) Mendelssohns fünf reife Sinfonien, denen zwölf jugendliche Streichersinfonien vorausgegangen waren, von Musikhistorikern nicht selten als Randerscheinungen abgetan. Allerdings hat Mendelssohn, wie viel später noch Brahms, tatsächlich mit Idee und Anspruch der sinfonischen Form gekämpft. Die frühen Streichersinfonien ließ er nie drucken, und weder mit der 1830 komponierten „Reformationssinfonie“ noch mit der 1833 abgeschlossen „Italienischen“ war der Komponist zufrieden. Reizvoll ist es, über die Bedeutung von Mendelssohns Instrumentalwerken für die Entwicklung der Programmmusik nachzudenken. Besonders die 1832 uraufgeführten Ouvertüren „Meeresstille und glückliche Fahrt“ und „Die Hebriden“, die von einer literarischen Erzählung oder einem Bühnenwerk unabhängig sind, öffneten neue Perspektiven: „Hätte Mendelssohn seinen einsätzigen Orchesterwerken den glücklichen Titel 'Sinfonische Dichtung' gegeben, den Liszt später erfunden hat, so würde er heute wahrscheinlich als Schöpfer der Programmmusik gefeiert und hätte seinen Platz am Anfang der neuen statt am Ende der alten Periode unserer Kunst. Er hieße dann der 'erste Moderne' an statt der 'letzte Klassiker'“, schrieb Felix 21 Weingartner schon 1898. Auch waren die „Italienische“ und die „Schottische“ Sinfonie als bruchlose Verbindung von nationalromantischem Liedgut und streng sinfonischen Formprinzipien eine durchaus „neue Lösung“ (Wolfram Steinbeck). Und in der 1840 uraufgeführten, von Beethovens Neunter beeinflussten Kantaten-Sinfonie „Lobgesang“ entdeckte schon Schumann etwas, das „im Symphonistischen noch nicht versucht ist, daß sich die drei Orchestersätze ohne Pausen aneinander schließen.“ Was Mendelssohns Zeitgenosse als „glücklich“ bezeichnete, hat Rainer Riehn 1980 als ein „Verfahren der konstruktiven Konstruktion größter Zusammenhänge“ herausgestellt, „das in ausgezeichneten Momenten der späteren Musikgeschichte zum Vehikel des kompositorischen Fortschritts par excellence werden sollte: der Verklammerung der hergebrachten Sätze der zyklischen Form zu einem einzigen übergeordneten Sonatensatz“ – Mendelssohn, the Progressive, sozusagen. II In seiner zum Landesjubiläum 2002 erschienenen „Geschichte von Baden und Württemberg“ schreibt Thomas Schnabel im Zusammenhang mit der kulturellen Gleichschaltung: „Auch der Romantiker Felix Mendelssohn Bartholdy verschwand als Jude 1933 sofort aus den Konzertprogrammen.“ Ein Marburger Professor erwähnt Mendelssohn in einer Seminarbeschreibung im Internet als „den zum Christentum konvertierten Juden“. Weitere Beispiele sind unschwer zu finden – allesamt harmlos und wohlwollend, aber falsch. Felix’ Großvater Moses Mendelssohn (1729-1786), Ikone der Aufklärung und zentrale Figur des Berliner Geisteslebens, hatte sich noch ganz der religiösen Versöhnung und jüdischen Emanzipation verschrieben. Doch nur zwei seiner sechs Kinder blieben Juden, die anderen wurden Christen. Darunter war auch der Vater von Felix, Abraham Mendelssohn (1776-1835), der selbst erst 1822 konvertierte, seine vier Kinder aber protestantisch erziehen ließ. 1816 wurde auch Felix getauft. Den Namen Bartholdy nahm Abraham auf Drängen seines Schwagers an und warf seinem Sohn später vor, den Zusatz ungebührlich zu vernachlässigen. Der Vater bestand auf Bartholdy als wichtigstem Namensbestandteil: „Du kannst und darfst nicht Felix Mendelssohn heißen. Felix Mendelssohn-Bartholdy ist zu lang, und kann kein täglicher Gebrauchsname seyn, du mußt dich also Felix Bartholdy nennen weil der Name ein Kleid ist, und dieses der Zeit, dem Bedürfniß, dem Stande angemessen seyn muß, wenn es nicht hinderlich sein soll.“ Und er setzt fort: „Einen christlichen Mendelssohn gibt es so wenig als einen jüdischen Confucius. Heißt du Mendelssohn so bist du eo ipso ein Jude, und das taugt dir nichts, schon weil es nicht wahr ist.“ Mendelssohns jüdische Herkunft war seiner Karriere nur selten hinderlich. Dieses Problem schuf sich erst die Nachwelt: „Mendelssohn ist von den großen Komponisten des 19. Jahrhunderts der einzige, dessen Einschätzung durch die Nachwelt eine fortwährend schwankende Kurve zwischen völliger Ablehnung und hoher Bewunderung durchlaufen hat“ (Eric Werner). Dies hat damit zu tun, dass sich das neue nationale Gedankengut zunächst nicht mit religiösen Fragen verknüpfte: „Interessanterweise blieb das im Fahrwasser des Wiener Kongresses rasch um sich greifende bürgerliche Nationalbewusstsein in Deutschland mit seinen zahlreichen, einander nicht immer gut gesinnten politischen Einheiten vorläufig im großen und ganzen unberührt von kulturellem Chauvinismus“ (Alexander Ringer). Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde es „Mode, die Juden nicht mehr nur als Angehörige einer anderen Religion, sondern als Glieder einer anderen Nation und schließlich einer anderen Rasse zu bezeichnen“ (Karl-Heinz Köhler). Wir wissen, wohin das führte. Begonnen hat es mit Richard Wagners Aufsatz „Das Judentum in der Musik“. Dort steht, 1850 erschienen: „Dieser [gemeint ist Mendelssohn, d.Red.] hat uns gezeigt, daß ein Jude von reichster spezifischer Talentfülle sein, die feinste und mannigfache Bildung, das gesteigertste zartempfindende Ehrgefühl besitzen kann, ohne durch die Hilfe aller 22 dieser Vorzüge es je ermöglichen zu können, auch nur ein einziges Mal die Tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorzubringen, welche wir von der Kunst erwarten.“ Mit anderen Worten: Deutsche, und deshalb tiefgründige, Musik konnte Felix Mendelssohn Bartholdy nicht schreiben. Das wirkte - und wirkt bis heute, wenn die Vorurteile über Mendelssohns vermeintlich „glatte“ und „oberflächliche“ Musik der Feder allzu rasch entfließen oder seine geistlichen Kompositionen von ernsthaften Schreibern gar mit süßem Backwerk verglichen werden. Carl Dahlhaus, der das „Problem“ Mendelssohn ausschließlich musikalisch verstanden wissen wollte, ließ es Anfang der 70-er Jahre zu, dass sein Kollege Friedrich Krummacher in seinem Beitrag über die Bühnenmusik zu Shakespeares „Sommernachtstraum“ zwar die Komposition Carl Orffs zum selben Theaterstück erwähnt und Orffs polemische Bemerkungen zur Musik Mendelssohns streift. Allerdings verschweigt der Musikwissenschaftler, dass Orff (nach einer Weigerung von Hans Pfitzner) 1938 den Auftrag der Stadt Frankfurt erhielt, eine „Sommernachtstraum“-Musik als rassisch unbedenklichen Mendelssohn-Ersatz zu komponieren, wofür er sich „mit ergebenen Grüßen, heil Hitler“ überschwänglich bedankte. Was Mendelssohns geistliche Werke angeht, hat Joachim Martini herausgearbeitet, dass 1933 nur der Abschluss einer Entwicklung war: „Hier haben allerdings schon seit den frühen zwanziger Jahren die Polemiker unter den Vertretern der Kirchenmusik- und Orgelbewegung dem Boden einen nationalen Humus beigemischt. (…) An ihrer unreflektierten Hinwendung zu den sterilen musikalischen Vorstellungen der Jugendmusikbewegung und an der Adaption ihrer Denkweise hat die protestantische Kirchenmusik bis zum heutigen Tage zu tragen.“ Musikhistorische Veröffentlichungen während des Dritten Reichs verunglimpften Mendelssohn als „Begründer des Sammelsurium-Stils“ oder verweigerten als Verfasser einer „deutschen Musikgeschichte“ überhaupt die Beschäftigung mit seiner Musik. Die Freundschaft mit Schumann wurde verwischt, die Verdienste um Bach geleugnet. Ein halbes Jahrhundert später, Anfang der 90-er Jahre, veröffentlichte Hans Heinrich Eggebrecht ein Buch über die „Musik im Abendland“. Mendelssohn wird darin nur in drei Nebensätzen erwähnt. Ein fundiertes Werkverzeichnis gibt es bis heute nicht. Die Wiederentdeckung und Neubewertung Felix Mendelssohn Bartholdys ist bis auf weiteres mehr Versprechen als Erfüllung. 1959 begann die Arbeit an einer kritischen Gesamtausgabe, intensiviert wurde sie ab 1992 – ein wahrhaftes Jahrhundertwerk, denn erst 2047 soll die Ausgabe abgeschlossen sein. 23 Dieser Klang, dieser überirdische Klang! Der Klarinette zum 300. Geburtstag - Beitrag für das Magazin der Berliner Philharmoniker (Ausgabe September/Oktober) Ein Geburtstagsgruß an die Klarinette ist überfällig, eine Ehrung für ein Instrument, das rätselhaft klingen kann und dunkel, überirdisch schön und – wenn es der Komponist will und der Spieler mittut – auch mal ordinär. Drei Jahrhunderte liegt ihre Erfindung zurück. Zwar wäre die Musikologie keine Wissenschaft, wenn Geburtstag und Ursprung der Klarinette keinen Diskussionsgegenstand bildeten. Aber auch wenn die Enzyklopädie „Musik in Geschichte und Gegenwart“ die Erfindung der Klarinette durch den Nürnberger Instrumentenbauer Johann Christian Denner um 1700 als „nicht völlig gesichert“ in Frage stellt – für hier und heute legen wir fest: Die Klarinette wird 300. Denn wie sonst sollten wir ihr einen würdigen Geburtstagsgruß entbieten? Denner hatte lange mit dem Chalumeau experimentiert, einem einfachen Hirteninstrument, im Deutschen noch heute trotz der möglichen Verwechslung mit einem späteren Blechblasinstrument Schalmei genannt. Er fügte den wenigen Naturtönen, die dieses Chalumeau produzieren konnte, die Möglichkeit des Überblasens in eine höhere Tonlage hinzu – und zwar durch zunächst zwei zusätzliche Löcher, die so genannten Klappen, deren Anzahl spätere Instrumentenbauer im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer weiter erhöhten. Schnell verbreitete sich das neue Instrument, das ursprünglich nur die besonders schwer zu blasenden hohen Trompeten (Clarini) ersetzen sollte. Das berühmte Mannheimer Orchester hatte um 1780 zwei Vollzeitklarinettisten auf seiner Gehaltsliste, und ein Jahrzehnt später komponierte Mozart sein wunderbares, seinerzeit kaum spielbares Klarinettenkonzert für den Freund Anton Stadler. Dass eine Klarinette am besten klingt, wenn sie leise im Ofen knistert, ist ein typischer Musikerwitz, der übrigens auch in einer Variation für Oboe kursiert. Gerade die Klarinette ist klanglich und technisch besonders vielseitig, bewältigt locker vielerlei Artikulationsvarianten und verfügt über dynamische Möglichkeiten vom Unhörbaren bis zum schmerzhaft Lauten. Der faszinierende Klang der Klarinette hat viele unserer heutigen Virtuosen von Anfang an beeindruckt. Ein Student der Musikhochschule in Trossingen habe mit einem Klangbeispiel auf Tonband seine Begeisterung geweckt, erzählt Walter Seyfarth, einer der fünf Klarinettisten der Berliner Philharmoniker. Da war er zwölf und damit just in dem Alter, in dem man die gängige, gut 70 cm lange A- oder B-Klarinette greifen kann. Jörg Widmann, als Klarinettist und Komponist gleichermaßen ein Star der aktuellen Musikszene, ließ sich vom „ungreifbaren Klang“ der Klarinette sogar schon mit sieben Jahren einfangen: „Von da an stand fest: Das wollte ich lernen.“ Gelernt haben der kleine Jörg und der nicht mehr ganz so kleine Walter natürlich das „deutsche System.“ Damit berühren wir ein Problem von historischer Tragweite, wenngleich Spieler wie Widmann, Seyfarth und auch Karl-Heinz Steffens, Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker, damit ganz pragmatisch umgehen. „Natürlich bin ich mit dem deutschen Klangideal groß geworden“, sagt Steffens, der als Zehnjähriger „wie so viele Kinder“ im Blasorchester seines Heimatortes mit dem Instrument Bekanntschaft machte. Als Dozent an der Musikhochschule oder auf Meisterkursen unterrichtet er indessen auch Studenten, die im so genannten „französischen System“ zu Hause sind, und er hat damit ebenso wenig Probleme wie Jörg Widmann, dessen Klarinettenklasse in Freiburg „ungefähr 50/50“ zusammengesetzt ist. Es gibt nämlich in der Geschichte dieses bemerkenswerten Instruments eine Art Schisma – und der religiöse Begriff ist hier gar nicht so fehl am Platze, denn die Auseinandersetzung um die Frage, ob die „deutsche“ oder die „französische“ Schule die bessere oder gar einzig wahre sei, 24 nahm zeitweise Merkmale eines Glaubenskrieges an. Der französische Klarinettentyp, der sich außer in Deutschland und Österreich in der ganzen Welt durchgesetzt hat, wird „BoehmKlarinette“ genannt, obwohl der Instrumentenbauer Louis-Auguste Boehm nur ein Detail, die so genannten Ringklappen, beisteuerte. Dieses Instrument geht vielmehr auf den Klarinettisten Hyacinthe Eléonore Klosé (1808-80) zurück, während der deutsch-baltische Virtuose Iwan Müller (1786-1854) eine Klarinette mit verbesserter Klappenmechanik entwickelte, an die wiederum der Berliner Instrumentenbauer Oskar Oehler (1858-1936) anknüpfte. Dabei sind die technischen Unterschiede zwischen Boehm- und Oehler-Klarinette gar nicht so groß, wie der Streit um das „richtige“ Klangideal vermuten ließe. „Es geht dabei auch um Stilistik und musikalisches Empfinden“, betont Karl-Heinz Steffens. Auf der dunkler klingenden OehlerKlarinette spielt man normalerweise ohne Vibrato, während die französische Schule mit ihrem helleren Klang dieses Stilmittel akzeptiert. Schwierig wird es, wenn sich solche im Grunde technischen Fragen in einer Komposition niederschlagen – Jörg Widmann stieß bei einem Werk von Pierre Boulez auf dieses Problem: „Da konnte man manche Trillerketten auf einem deutschen Instrument kaum spielen.“ Ein Klarinettist spielt im Laufe seiner Karriere eine ganze Reihe von Instrumenten, denn eine einzelne Klarinette wird normalerweise nicht alt. Durch häufiges Spielen nutzt sich das Instrument ab, vor allem kann die Bohrung des meist aus Grenadillholz bestehenden Körpers durch den Speichelfluss beeinträchtigt werden. Sehr oft wechseln muss man in jedem Fall das Blatt, das auf das Mundstück geschraubt oder gebunden wird und mit dem der Klarinettist den Ton eigentlich erzeugt: Hier ist Spürsinn gefragt, sagt Walter Seyfarth, denn die Qualität des Rohrholzes habe über die Jahre wegen der Umwelteinflüsse nachgelassen: „Das ist wie beim Weinanbau, es gibt gute Jahrgänge und schlechte.“ Seyfarths ständiges Instrument stammt aus dem Jahr 2000, aber seine Piccolo-Klarinette von 1979 spielt er bis heute. Jörg Widmann ist „gerade in eine A-Klarinette verliebt“, während Karl-Heinz Steffens sein Verhältnis zum Instrument betont nüchtern einschätzt: „Es ist nur die Basis dafür, gute Musik zu machen.“ Was wünschen die drei Herren der Klarinette zum Geburtstag? „Dass sie sich immer weiterentwickelt, aber die Eigenheiten bleiben – wie in einer großen Familie“, sagt Steffens, und Seyfarth sekundiert mit seiner Hoffnung auf viele Virtuosen mit ausdrücklicher „Hingabe an das deutsche System.“ Jörg Widmann wünscht sich, dass sich niemand auf der Tradition ausruhen möge „und wir die Komponisten ermutigen, weiter für die Klarinette zu schreiben.“ Seine aktuelle Zusammenarbeit mit Wolfgang Rihm und Aribert Reimann sieht Widmann in einer Linie mit den historischen Partnerschaften im Dienste des Instruments – Mozart mit Stadler, Weber mit Baermann, Brahms mit Mühlfeld. Auch Walter Seyfarth wünscht sich „eine Vielfalt an neuen Werken“ – also muss uns um das Engagement der Klarinettisten für das Neue offenbar nicht bange sein. 25 Robert Schumanns Welt und Nachwelt Beitrag für das Forum Bachakademie (August 2004) Das Programm des diesjährigen Europäischen Musikfestes mit seiner Gegenüberstellung von Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann scheint, betrachtet man die zeitliche und auch persönliche Nähe der beiden Komponisten, keine allzu starken Widersprüche aufzuwerfen. Mendelssohn war nur ein Jahr älter als Schumann, sie lebten und arbeiteten parallel und zeitweise sogar am gleichen Ort (Leipzig). Ihr Umgang beruhte auf gegenseitigem Respekt, auf freundschaftlichem Interesse von Seiten Mendelssohns, auf Verehrung gar bei Schumann. Mendelssohn, der fest im praktischen Musikleben stand, schon mit Mitte 20 als Gewandhauskapellmeister in Leipzig erfolgreich war und bald sogar im Ausland als führende Persönlichkeit des deutschen Musiklebens anerkannt wurde, führte Schumanns 1. und 2. Symphonie erstmals auf und war dem Kollegen immer wieder behilflich. Schumann hingegen bewunderte Mendelssohn, als gehöre der einer älteren Generation an; blickte zu ihm auf „wie zu einem hohen Gebirge“, wiewohl seine Betrachtungen von Neid nicht frei waren („In ähnlichen Verhältnissen wie er aufgewachsen, von Kindheit zur Musik bestimmt, würde ich Euch sammt und sonders überflügeln – das fühle ich an der Energie meiner Empfindungen“). Einmal stichelte er gar, Mendelssohn könne von ihm „einiges“ lernen. In der von ihm gegründeten Neuen Zeitschrift für Musik spitzte Schumann seine Bewunderung aber geradezu archetypisch zu: „Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt.“ Damit verdeutlichte er, dass „kaum ein anderer Komponist des 19. Jahrhunderts (…) in seinen Voraussetzungen, in seiner Wirkung, in der Rezeption seiner Werke so mit seiner Zeit – (…) der politischen und musikalischen Epoche zwischen 1815 und 1848 – verwachsen (war) wie Mendelssohn“ (Wulf Konold). Und womöglich markierte Schumann mit dieser Hommage an den fast spielerisch erfolgreichen Kollegen genau das, was ihm fehlte, was er nicht erreichen konnte, und schließlich die Tatsache, dass er selbst über seine Zeit hinausreichte. Also doch Widersprüche, Kontraste. Zunächst rein äußerlich: Felix Mendelssohn Bartholdy war ein Star seiner Zeit, und zwar als Komponist und Dirigent gleichermaßen. Robert Schumanns Werke wurden in ihrer Bedeutung kaum erkannt, in der Praxis kämpfte er mit widrigen Bedingungen und eigenen Unzulänglichkeiten, und nicht zuletzt wurde er in der Öffentlichkeit nicht selten als eine Art Prinzgemahl der berühmten Klaviervirtuosin Clara Schumann wahrgenommen, um die er – gegen deren Vater Friedrich Wieck, der ihn als Schwiegersohn ablehnte – energisch gekämpft hatte. Während Mendelssohn von Anfang an auch für Orchester komponierte und seine 1. Symphonie (der bereits zwölf Streichersymphonien vorausgegangen waren) schon mit 16 vorstellte, tastete sich Schumann – wie später Brahms – nur langsam und mühevoll, über einen ersten misslungenen Versuch 1832/33, an diese Königsdisziplin heran. Sein Leben als Komponist lässt sich ungewöhnlich klar in Abschnitte teilen: In der offiziellen Nummerierung findet sich bis zur Opuszahl 26 ausschließlich Klaviermusik, 1840 – in seinem „Liederjahr“ – erweitert er sein Oeuvre auf die Singstimme, 1841 veröffentlicht er die 1. Symphonie, die als Orchesterwerk noch eine Weile alleine steht, bis zwei Jahre später die erste chorsymphonische Komposition „Das Paradies und die Peri“ folgt. Danach komponiert Schumann zwar regelmäßig für große Besetzungen, im Gesamtwerk aber und in der Rezeption durch die Nachwelt dominieren die Kammermusik und Lied. Gerade Schumanns Symphonien zeigen jedoch, wie der Komponist im Gegensatz zu Mendelssohn nicht in seine Zeit passte, und wie er auch nach seinem Tode 1856 der Musikwelt als Orchesterkomponist lange fremd blieb. Die Tatsache, dass das Zukunftsträchtige dieser Werke kaum erkannt wurde und sie meist nur Achtungserfolge erzielten, hat ihre Gründe wohl 26 auch darin, dass Schumann von den „Neudeutschen“ wie Richard Wagner und Franz Liszt in Sachen Fortschritt scheinbar „überflügelt“ wurde, wie Clara schon 1832 anmerkte, als Roberts erster symphonischer Versuch im Gegensatz zur jugendlichen Symphonie des vier Jahre jüngeren Wagner erfolglos blieb. Hinzu kommt, dass Schumanns frühes Klavierwerk gegen seine späteren Orchesterkompositionen ausgespielt wurde, dass jene auch in biografischer Hinsicht einer glücklicheren Zeit entstammen und außerdem von Claras Glanz als Pianistin profitierten, während diese in latenter Verbindung zu der Geisteskrankheit stehen, die sich bereits in recht frühen Jahren andeutete und nach und nach verstärkte. Dieser Trugschluss betrifft insbesondere – und noch stärker als die Symphonien – jene Orchester- und Chorkompositionen, die nach 1850 entstanden sind und später von der Witwe Clara unter dem Einfluss wohlmeinender Freunde wie Johannes Brahms und Joseph Joachim bewusst zurückgehalten wurden, darunter das 1853 komponierte Violinkonzert, das erst 1937 uraufgeführt werden konnte – übrigens mit medialer Ausschlachtung der „Sensation“ durch die Nationalsozialisten, die Schumann als „deutschen“ Romantiker brauchten, nachdem sie Mendelssohn aus dem Musikleben getilgt hatten. Aber auch die Symphonien, unter denen die „Rheinische“ von 1850, wiewohl als dritte von vier nummeriert, die chronologisch letzte ist (die 4. Symphonie entstand vorher, wurde aber 1851 umgearbeitet und neu beziffert), gerieten in ihrer Verbindung von traditioneller Viersätzigkeit und innovativer, weil satzübergreifender thematischer Struktur unter die Räder der Musikpraxis. Insbesondere Richard Wagner, der glaubte, Schumann habe mit dem symphonischen Anspruch die Grenzen seines Könnens überschritten, hat das Urteil der Nachwelt über diese Werke stark geprägt (interessanterweise nahm er hier eine ähnlich einflussreiche Position ein wie hinsichtlich der Mendelssohn-Rezeption, wenn auch mit ganz anderer Stoßrichtung): „Schöne Akzente, doch solche Leere“ ist nur ein Urteil – in diesem Fall über die „Rheinische“ -, das durch Cosima Wagner überliefert ist. Besonders perfide, weil eine Art Opferrolle Schumanns konstruierend und ihn gegen Mendelssohn gleich doppelt ausspielend, äußerte sich Wagner allerdings in seiner fatalen Schrift „Das Judentum in der Musik“: „In Trägheit versank auch Robert Schumanns Genius, als es ihn belästigte, dem geschäftig unruhigen jüdischen Geiste standzuhalten (…) So verlor er unbewusst seine edle Freiheit, und nun erleben es seine alten, von ihm endlich gar verleugneten Freunde, dass er als einer der Ihrigen von den Musikjuden uns im Triumphe dahergeführt wird.“ In Wagners ideologischen Gefolge redete Friedrich Nietzsche dann Robert Schumann als „deutsches Ereignis“ im Gegensatz zum Europäer Beethoven klein: „Schumann mit seinem Geschmack, der im Grunde ein kleiner Geschmack war (nämlich ein gefährlicher, unter Deutschen doppelt gefährlicher Hang zur stillen Lyrik und Trunkenboldigkeit des Gefühls), beständig beiseite gehend, sich scheu verziehend und zurückziehend, ein edler Zärtling, der in lauter anonymem Glück und Weh schwelgte, eine Art Mädchen.“ Schon bald darauf erkannte Gustav Mahler, dass gerade „Wagners Irrtum und heftige Parteilichkeit bedauerlichen Schaden angerichtet“ hatten, veränderte allerdings als Dirigent selbst die Instrumentation der Symphonien, um die vermeintlichen Ungeschicklichkeiten Schumanns der Kritik zu entziehen. Dabei war er nicht der Einzige: Der Dirigent Felix Weingartner (1863-1942), zeitweise Assistent bei den Bayreuther Festspielen und Nachfolger Mahlers als Operndirektor in Wien, schrieb: „Die Klage, dass Schumanns Symphonien in vielen Partien orchestral wirkungslos sind, ist allgemein und berechtigt. Hier wird die Freude an diesen Werken durch den oft geradezu schlechten Orchestersatz verdorben.“ Und rund ein Jahrhundert später brachte Pierre Boulez, auch er als Komponist und Dirigent gleichermaßen aktiv, die vermeintliche Tatsache zwar in einen Zusammenhang mit Schumanns Absichten, ohne sie indessen in Frage zu stellen: „Vergleicht man das Orchester von Berlioz mit dem von Schumann, der sein Zeitgenosse war, so ist das wie Tag und Nacht. Im einen Fall eine wunderbare instrumentale Vorstellungsgabe, im anderen Fall etwas Mattes, Farbloses. Die Instrumentation bei Schumann entspricht natürlich dem, was er 27 geben wollte, aber man fühlt doch, dass sein Denken auf diesem Gebiet nicht sehr fortgeschritten war.“ (Sicher ist es nur ein Zufall, aber doch ein bemerkenswerter, dass Boulez dies just im Jahr 1976 äußerte, in dem er in Wagners Bayreuth einen sensationellen „Ring“ dirigierte.) Die im Grunde gut gemeinten Retuschen verfestigten letztlich die Meinung, als Orchesterkomponist sei Robert Schumann zweitklassig gewesen. Es ist seltsam: Während Lied, Klavier- und Kammermusik seit ihrer Entstehung bruchlos als Meisterwerke anerkannt sind und Erfolg im Konzertleben feiern, erlitten die „heiklen“ Bereiche von Schumanns Oeuvre – Chormusik und symphonische Werke – gleichsam spiegelbildliche Schicksale. Gerieten einerseits die im 19. Jahrhundert noch populären und oft gesungenen Chorstücke mit dem Rückgang des Laienchorwesens nach und nach in Vergessenheit, wurde Schumann andererseits erst im späten 20. Jahrhundert als originärer Symphoniker und gleichzeitig Bindeglied zwischen Beethoven und Brahms – und damit auch zu Bruckner und Mahler – wirklich begriffen. 28 Flexibler Nachwuchs Ein Besuch bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben (Beitrag für das Journal des Europäischen Musikfest Stuttgart) In schönster Aussichtslage auf den Killesberg residieren sie, die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, und zwar nicht etwa in einer ehemaligen Schule, sondern in einem Anfang der 70-er Jahre in Auftrag gegebenen Neubau vom späteren Olympia- und Bundestagsarchitekten Guenter Behnisch. Das zeigt Stolz und Selbstbewusstsein, und tatsächlich hat sich der Knabenchor, dessen Träger die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart ist, seit seiner Gründung im Jahr 1900 zum gefragten Ensemble entwickelt. In einem Internat, wie bei manchen anderen Knabenchören, leben die rund 200 Jungen und jungen Männer (denn Tenöre und Bässe gibt es auch) aber nicht. Zwei Mal in der Woche ist regelmäßig Probe, hin und wieder gibt es Sondertermine, ansonsten wohnen die Hymnus-Knaben zu Hause, gehen auf verschiedene Schulen und pflegen dort ihre Freundschaften. »Manchmal wundern sich die Mitschüler schon«, gibt Franz zu, der gerade 14 geworden ist und (noch) Sopran singt. Klassische Musik ist eben nicht unbedingt cool unter Jugendlichen, aber davon lässt er sich nicht beirren. Franz hat schon als Kind mit dem Großvater gesungen, spielt seit der 1. Klasse Posaune und wurde bei einem von Chorleiter Hanns-Friedrich Kunz arrangierten Vorsingen in seiner Schule für die Hymnus-Chorknaben »entdeckt«. Früher konnte es bei bis zu sechs Proben wöchentlich recht streng zugehen - heute achten die Verantwortlichen darauf, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Während der Chorfreizeit, von der die Knaben gerade mit großem Hallo zurückgekehrt sind, wurde Fußball gespielt oder eine Nachtwanderung unternommen. Dennoch: Um einige Stunden Probe täglich kamen die jungen Sänger nicht herum. Vorbereitet wurde u.a. der Gottesdienst am letzten Tag des Europäischen Musikfests, bei dem die Hymnusianer die Bachkantate »Der Himmel lacht, die Erde jubilieret« singen werden. Wie Franz ist auch der 13-jährige Leonard seit 1998 dabei. Inzwischen sind sie »Oldies« und gehören zum so genannten C-Chor, der die großen Konzerte und Gottesdienste gestaltet. Eher hinter den Kulissen üben A- und B-Chor, in denen die Knirpse erst einmal an die musikalischen Grundbegriffe herangeführt werden und einfacheres Repertoire lernen. Das bisher größte Erlebnis im Knabenchor war für Franz und Leo eine 10-tägige SkandinavienTournee (auch deshalb unvergesslich, weil auf Franz' T-Shirt die Konzerttermine aufgedruckt sind). Ein ganz anderes Abenteuer steht beiden in naher Zukunft bevor: »Ich komme schon nicht mehr ganz so hoch wie früher« - so kündigt sich der Stimmbruch an, der zunächst einmal eine Zwangspause nach sich zieht. Ob die beiden danach bei den Hymnus-Knaben als Tenor oder Bass weitermachen wollen? »Klar!«, bestätigen sie unsisono. Und noch später, was dann? »Ein Beruf mit Musik wäre schön«, sagt Franz. Leo ist nicht ganz so fest gelegt: »Vielleicht Richter. Aber Hornist oder Dirigent wäre auch toll.« Ist doch sehr flexibel, unser musikalischer Nachwuchs. 29 Ein buntes Leben Der SWR beim Musikfest - Beitrag für das Journal des Europäischen Musikfests Stuttgart am 03.09.2003 Wenn am kommenden Sonntag fünf Sendungen vom Europäischen Musikfest den »Festlichen Radiosommer« beschließen, können Marlene Weber-Schäfer und Thomas Angelkorte, Redakteurin und Tonmeister beim Südwestrundfunk, erst einmal aufatmen. Viel Arbeit liegt hinter ihnen, denn auch für einen so großen Sender ist ein Festival wie dieses kein alltägliches Projekt. »Als erstes zerbrechen wir uns in der Redaktion den Kopf über die Auswahl«, erzählt Marlene Weber-Schäfer. Eine Mischung von Schnipseln unter dem Titel »best of EMS« komme nicht in Frage: »Wir wollen Thematik und Dramaturgie des Musikfests abbilden und ein möglichst geschlossenes Ganzes präsentieren«, betont die Redakteurin. Am besten gefiel ihr die Kombination des Brahms-Requiems mit dem Violinkonzert von Alban Berg samt den darauf vorbereitenden Gesprächskonzerten. Um dieses Paket im SWR2-Programm unterzubringen, hat sich Weber-Schäfer alle Musiktermine am Sonntagnachmittag gesichert. Ganz einfach war das nicht, denn normalerweise sind die Sendezeiten aufgeteilt in Mittagskonzert, Große Interpreten und eine Stunde Jazz. Aber auch beim SWR wäscht eine Hand die andere, und für Sonderprogramme wie zum Europäischen Musikfest räumen die anderen Redaktionen schon mal die sorgsam gehütete Sendezeit - spätere Gegenleistung vorausgesetzt. Die Aufzeichnung der Klavierprogramme als weiterer Schwerpunkt des Musikfests sowie, einer persönlichen Vorliebe der Redakteurin folgend, die der Liederabende von Cornelia Kallisch und Dietrich Henschel komplettieren die umfangreiche Beteiligung des Südwestrundfunks am diesjährigen Musikfest. Alle Aufzeichnungen gehen ins sendereigene Archiv, aus dem sich auch andere ARD-Mitglieder bedienen können. Allerdings geschehe dies eher selten, sagt Weber-Schäfer, denn jeder Sender nehme mit seinen Klangkörpern und regionalen Ensembles relativ viel selbst auf. Neben Aufzeichnungen und Übertragungen von Konzerten gehören zur Aufnahmetätigkeit einer Rundfunkanstalt auch so genannte »Produktionen«, bei denen die Künstler oder Ensembles im Studio aufnehmen, ohne Publikum und mit viel Detailarbeit. Die Weiterverwertung auf CD hingegen ist bisher eher Ausnahme als Regel - wobei die viel beachtete Gründung des Labels »Faszination Musik« durch SWR und Hännsler-Verlag die Richtung zur intensiveren Vermarktung der Radioarchive vorgegeben hat. Verglichen mit dem Großprojekt »Passion 2000« ist Evgeni Koroliovs Klavierprogramm für Thomas Angelkorte rein logistisch kein großer Aufwand. Allerdings kennt der Tonmeister den Perfektionsdrang des Pianisten aus früherer Zusammenarbeit. Auch diesmal geht es nicht ohne Nachaufnahmen ab, die die Dauer des eigentlichen Konzertes schnell überschreiten können. Vor dem Mozart-Saal steht der Ü-Wagen - einer mit analoger Technik, bei dem das Ergebnis der Aufzeichnung eine handliche DAT-Cassette ist. Beim Einsatz digitaler Technik wird direkt auf eine Festplatte gespeichert, wodurch Angelkorte bei der Weiterverarbeitung im Schnittraum viel Zeit spart. Ein Hauptmikrofon und bei großer Orchesterbesetzung mehr als 20 Stützmikrofone garantieren den Ausgleich von Gesamtklang und Detail. Unter Experten ist das Verhältnis von Haupt- und Stützmikros umstritten. Manch einer schwört auf den Grundsatz »weniger ist mehr«, aber Angelkorte betont: »Wenn Sie zu wenig Stützmikrofone verwenden, ist das, als wenn ein Film fast nur in der Totale aufgenommen würde.« 30 Die Tontechnik solle vor allem den individuellen Klang von Musikern und Konzertsaal abbilden, unterstreicht Angelkorte. »Die Klangbalance macht aber trotzdem der Dirigent«, betont der Tonmeister, dessen Arbeit nicht erst mit dem Aufbau der Aufzeichnungstechnik beginnt. Angelkorte besucht Proben und berät sich bei neuer Musik auch direkt mit dem Komponisten. Der kann dem Tonmeister manchmal Kopfzerbrechen bereiten: Tan Dun beispielsweise verwarf bei seiner Passion den gesamten Aufbau des Orchesters, und Angelkorte musste alle Mikrofone neu positionieren. Er ist ein Fan von Live-Übertragungen: »Das ist die größte Aufgabe und Berechtigung für den Rundfunk«, schwärmt er und freut sich, wenn er zwischen all der Ernsten und Neuen Musik auch mal wieder die SWR Big Band betreuen kann: »Das ist ein richtig buntes Leben.« 31 Kürzere Berichte Das Defilee der Dirigenten oder Wie finde ich einen Chef? Zahlreiche Debüts prägen die neue Saison des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart - Bericht für die Stuttgarter Zeitung (veröffentlicht heute) Laut Fremdwörterbuch ist ein „Defilee“ das „feierliche Vorbeischreiten einzelner Personen an hochgestellten Gastgebern“, in alter Militärsprache bedeutete der fast vergessene Begriff einen Engpass, durch den sich die Kolonne schlängeln musste. Stellt man sich die Konzertsaison 2009/10 des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart (RSO) im Zeitraffer vor, wäre das Dirigentenpult der Engpass für eine lange Reihe von Dirigenten, die an den Gastgebern – als die man sich nach Belieben das Orchester oder das Publikum vorstellen darf – vorbeizuschreiten hätten. Es wimmelt in der neuen Spielzeit von erstmalig oder in erster Wiederholung eingeladenen Gastdirigenten, und der Orchestermanager Felix Fischer macht kein Geheimnis daraus, dass dies eine weitere Runde in der Suche nach dem Nachfolger für den Chefdirigenten Sir Roger Norrington bedeutet. Auch angesichts der knapp werdenden Zeit – Norrington scheidet im Sommer 2011 aus – wolle man Sorgfalt vor Eile walten lassen und sich nicht unter Druck setzen, sagt Fischer. Gegebenenfalls werde eben der Erste Gastdirigent Andrey Boreyko in einer cheflosen Saison für Kontinuität sorgen. Es wird also spannend, da man ein weiteres Jahr hindurch vielleicht nicht jeden, aber doch einige der Gäste als Kandidaten für die Chefstelle betrachten darf. Kaum in Frage kommen dafür die französischen Altmeister Michel Plasson und Serge Baudo, die im Oktober bzw. Juni überwiegend Musik aus ihrem Heimatland vorstellen. Auch der erst 16-jährige Venezuelaner Ilyich Rivas, der sich in der Konzertreihe „RSO afterWork“ im April u.a. mit Respighis pompösen „Fontane di Roma“ befassen soll, dürfte noch nicht auf den Posten spekulieren. Horcht man Felix Fischers fein abgestuften Belobigungen, dürfte ein heißer Tipp der Däne Thomas Dausgaard sein, der im Oktober gemeinsam mit der jungen Pianistin Lise de la Salle die Reihe der zehn Abonnementskonzerte eröffnen darf. „Ein ganz wichtiges Debüt“ sei das, so Fischer; Dausgaard sei „ausgezeichnet auch für die zeitgenössische Musik“, außerdem „psychologisch geschickt und teamfähig“ – ein Schelm, der da keine Präferenz heraushören mag. Aber genug der Spekulation! Auch Bertrand de Billy (Dezember, gemeinsam mit Pascal Rogé am Klavier) und Hans Graf (März, mit dem Bratscher Antoine Tamestit) debütieren am Pult des RSO; der Tscheche Jakob Hrusa leitet im Februar erstmals ein Abonnementskonzert, das ein Wiedersehen mit der Geigerin Hilary Hahn ermöglicht. Den Briten Michael Francis, kürzlich virtuos für André Previn eingesprungen, hat sich das RSO für mehrere Termine im März gesichert, und in den Mittagskonzerten gastieren Christopher Hogwood (Oktober), Alexander Liebreich (November) und Marc Albrecht (Juni). Es ist aber nicht nur für Abwechslung an Gesichtern gesorgt. Auch die Programme sind – von thematischen Vorgaben und Zwängen befreit – in der Saison 2009/10 besonders vielfarbig. Sir Roger Norrington bringt seine Brahms-, Schumann- und Bruckner-Zyklen zu Ende und stellt mit Michael Tippetts Oratorium „A Child of Our Time“ im Januar ein weiteres Glanzstück englischer Kompositionskunst vor. Andrey Boreyko hat sich ein eigenwilliges Juni-Programm mit Schostakowitsch, Wagner und Rossini ausgedacht. Solisten wie Daniel Hope (im April mit dem Brahms-Violinkonzert), Jean-Guihen Queyras (Schumanns Cellokonzert im Juli) und Alina Ibragimova (mit Ravels „Tzigane“ im Dezember) gesellen sich zum bunten Defilee, das in den Mittagskonzerten von Kerstin Gebel und in den afterWork-Programmen von Bernadette Schoog, Matthias Holtmann und Malte Arkona moderiert wird. 32 SWR-Musikchefin Dorothea Enderle hob bei der Vorstellung des RSO-Saisonprogramms auch hervor, dass sich die Aufführung zeitgenössischer Musik längst zur Selbstverständlichkeit entwickelt habe und sich nicht nur in Spezialveranstaltungen, sondern auch im Abonnementsbetrieb problemlos manifestiere. In der kommenden Spielzeit prägen einige Werke von Wolfgang Rihm mehrere der Konzertprogramme. So dirigiert Roger Norrington im November Rihms „Two Other Movements“, im Februar steht „IN-SCHRIFT“ auf dem Programm, und zum „attacca-Tag“ am 5. Dezember, für den der Neue-Musik-Redakteur HansPeter Jahn verantwortlich zeichnet, erklingt Rihms „Schattenstück“. Jahn bringt dort und im Konzert zum Eclat-Festival im Februar bewusst „ältere“ Komponisten wie Rihm und HansJoachim Hespos mit jungen Tonsetzern wie Markus Hechtle und Daniel Smutny zusammen. Zehn Uraufführungen sind zu den genannten Anlässen angekündigt, bei denen – wie schon im „Abo plus“-Konzert der RSO-Reihe im März – auch das SWR Vokalensemble mit seinem Leiter Marcus Creed eine herausragende Rolle spielen wird. Fortgesetzt werden die Kinder- und Jugendarbeit, die von der Konzerteinführung über eine Schreibwerkstatt bis zum Tonmeisterworkshop reicht, sowie die Kammermusikreihe „Podium RSO“ im Neuen Schloss, wo sich die Mitglieder des Orchesters in munter wechselnder Besetzung vorstellen. Fleißig ist das RSO auch außerhalb Stuttgarts und weit über das Sendegebiet des SWR hinaus. Stolz gespannt schaut man insbesondere einer weiteren AsienTournee entgegen, die als Höhepunkt das Eröffnungskonzert der Expo 2010 in Shanghai enthält – sozusagen als weltliches Pendant zum unvergessenen Geburtstagskonzert für den Papst vor gut zwei Jahren. 33 Die Schlacht hat begonnen Der SWR-Rundfunkrat beschließt (noch) nicht über die Zukunft der Klangkörper - Artikel für die Esslinger Zeitung (04.12.2004) Es ist noch nicht lange her, da beteuerte SWR-Musikchefin Dorothea Enderle, die Klangkörperfrage stelle sich "derzeit nicht". Die Freude darüber währte nur kurz: Intendant Peter Voß hat die wohl entscheidende Runde in der Diskussion eröffnet, wie viele Klangkörper sich der SWR leisten kann und will. "Es ist meine feste Überzeugung, dass es nicht sechs sein können", stellte Voß gestern bei der Sitzung des Rundfunkrats im Stuttgarter Funkhaus klar. Zumindest vom Rundfunkorchester Kaiserslautern und vom SWR-Vokalensemble Stuttgart scheint sich der Intendant innerlich schon losgesagt zu haben. Während für das RadioSinfonieorchester Stuttgart das Land und die Stadt als Partner gewonnen werden sollen und das SWR-Sinfonieorchester Freiburg/Baden-Baden zu weiterer Rationalisierung aufgerufen ist, ist die Fusion des Kaiserslauterner Ensembles mit dem Orchester des Saarländischen Rundfunks offenbar kaum noch aufzuhalten. Vor allem aber bedeutet die Strategie von Peter Voß das Ende des 36-köpfigen SWRVokalensembles in seiner jetzigen Form: "Die Beibehaltung der gegenwärtigen Struktur des Vokalensembles wäre, unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen des SWR und angesichts der aufgrund der Altersstruktur möglichen Handlungsspielräume, nicht sinnvoll", heißt es so verquast wie lapidar in dem Papier des Intendanten. Falls ein Einstellungsstopp nicht zu nennenswerten Einsparungen führt - was abzusehen ist -, wird der schrittweise Übergang in einen "herausragenden semiprofessionellen Chor" angestrebt. So weit die Ansichten des Intendanten. Nun ist das SWR-Vokalensemble mit 40 Planstellen und knapp 2,7 Millionen Euro Kosten ein verschwindend geringer Promille-Posten im Etat des Senders. Auch die vom Intendanten "immens" genannte Summe von 30 Millionen Euro für alle Klangkörper einschließlich Big Band und Experimentalstudio muss man in das Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro einordnen. Umgekehrt gilt das Vokalensemble, zu dessen Spezialgebieten moderne Werke mit teils exorbitanten Schwierigkeitsgraden zählen, als einer der weltweit besten Chöre überhaupt hoch geschätzt von Komponisten, Dirigenten und Festivalveranstaltern. Damit wäre es bei einer Umwandlung in ein semiprofessionelles Ensemble schnell vorbei. Obwohl Voß gegenüber den Rundfunkräten bestritt, den Programmauftrag neu definieren zu wollen, bedeutet sein Papier einen Bruch mit der Vergangenheit. Da der Intendant "keine ausgeprägte Programmrelevanz" der Klangkörper erkennen kann, ordnet er deren Finanzierung als "freiwillig erbrachte Leistung", als "Mäzenatentum" ein. Wobei Voß auch in anderen Bereichen das Messer ansetzt und soeben das Ende der SWR 3 Arena of Sound in Stuttgart und einer vergleichbaren Veranstaltung in Rheinland-Pfalz angekündigt hat. Dass die Leistungen der Klangkörper nicht ausreichend im Programm abgebildet werden, wird aus deren Umfeld übrigens energisch bestritten. "Die Produktionen des Vokalensembles werden zu hundert Prozent gesendet", betont Christoph Hans, der dem Ende Oktober gegründeten Förderverein des Ensembles vorsteht. Aber genau hier lauert die heikle Frage, die der Intendant für sich selbst bereits beantwortet hat: Voß hält die experimentellen und avantgardistischen Produktionen für verzichtbar, weil er die "Erschließung künstlerischen Neulands" unter den aktuell verschärften Sparzwängen nicht als primäre Aufgabe seines Senders sieht. Beschlossen wurde gestern, nach einer kurzen und von vielen Mitgliedern des Rundfunkrats mit beschämendem Desinteresse verfolgten Aussprache, nichts - noch nichts: Der Hörfunkausschuss 34 soll mit der Fachebene diskutieren und über Konsequenzen Ende Februar in einer Sondersitzung befinden. Nun ist die Zeit für die Lobbyisten gekommen. Die Schlacht hat begonnen, es wird Verwundete geben. 35 Qualität und Spaß Helmuth Rillings Gächinger Kantorei wird 50 - Feature für die ddp-Nachrichtenagentur Der Name des Chores ist es ganz sicher nicht, der die Gächinger Kantorei zu internationalem Ruhm geführt hat. Die bei der Gründung des Ensembles vor 50 Jahren noch zutreffende, bescheidene Benennung führt in anderen Ländern vielmehr zu Erklärungsbedarf, Schreibfehlern und sympathischen Irrtümern: Auf den Internetseiten des Oregon Bach Festivals beispielsweise, bei dem Helmuth Rillings Stammchor im Jubiläumsjahr erstmals auftritt, werden als Herkunftsort des Chores die "Schwäbischen Alpen" genannt. Rilling, der als Student und mit Kommilitonen das Ensemble im Albdorf Gächingen gründete, blieb der Bezeichnung treu, als die Gächinger Kantorei längst in Stuttgart probte und die Welt von Japan bis Amerika bereiste. Und was Helmuth Rilling entscheidet, das stellt bei den Gächingern niemand in Frage: Trotz gelegentlicher Auftritte von Gastdirigenten wird kaum ein Chor dieser Kategorie so stark mit seinem Gründer identifiziert wie dieser. "Es geht um das Jubiläum vom Helmuth" – so wird denn auch Werner Huck von seiner Gattin zum Telefoninterview gerufen. Huck, Jahrgang 1929, ist der Älteste unter den Gächingern und seit über vier Jahrzehnten dabei. Dass von Anfang an nie alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam auftraten, die Gächinger Kantorei auf Projektarbeit statt Vereinsmeierei setzte, war Werner Huck nur recht. Einzelne Konzerte konnte er mit seiner Arbeit bei Post und Telekom nur schwer vereinbaren, aber für die Konzertreisen nahm er sich frei. "Mindestens die Hälfte des Urlaubs ging dafür drauf", erzählt Werner Huck, "die Familie musste oft zurückstehen." Wie fast alle Gächinger hatte Huck schon bei seinem Eintritt in den Chor reichlich Erfahrung, hat privaten Gesangsunterricht genommen und sogar selbst einen kleinen Chor geleitet. Helmuth Rilling – "er hat gelernt, wo es nur ging" – war ihm dabei großes Vorbild, und mit der persönlichen Entwicklung des Dirigenten zum weltweit gefragten Interpreten vor allem der Musik Johann Sebastian Bachs sieht Werner Huck auch den Werdegang der Gächinger Kantorei verknüpft: "Wir sind von Jahr zu Jahr gewachsen", sagt der Senior. Bei ihren Konzerten und Tourneen tritt die Gächinger Kantorei mal als 24-köpfiges Vokalensemble, mal als Hundertschaft auf. Das Reservoir an Sängerinnen und Sängern ist üppig, denn zu den Vorsingen, die mehrmals jährlich stattfinden, melden sich jeweils rund 100 Interessenten an. Organisatorische Basis des Chores ist die Internationale Bachakademie in Stuttgart, die Helmuth Rilling in den 80-ern gründete, instrumentale Partner sind neben dem hauseigenen Bach-Collegium auch größere Klangkörper wie das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart. Vom Gesangsstudenten bis zur privat singenden Hausfrau reicht die Spannweite im Chor, es sind Freundschaften entstanden, Ehen wurden geschlossen und mittlerweile wirken in der Gächinger Kantorei junge Leute mit, "die Helmuth Rillings Enkel sein könnten", wie Andreas Bomba, Mitarbeiter der Bachakademie und selbst als Tenor im Chor aktiv, scherzt. Das trifft zum Beispiel für Gudrun Otto zu. Mit ihrem Geburtsjahr – 1979 – ist sie just jene fünf Jahrzehnte vom Senior Werner Huck entfernt, die die Gächinger Kantorei heuer besteht. Die junge Sopranistin macht gerade ihr Diplom in Weimar und sieht einem Engagement bei den Landesbühnen Dresden ab dem kommenden Herbst entgegen. Das Bach Festival in Oregon wird deshalb ihre vorläufig letzte Reise mit den Gächingern sein, bei denen sie die Verbindung von "Qualität und Spaß" und die charismatische Persönlichkeit von Helmuth Rilling "ohne Show und Brimborium" schätzen gelernt hat. Wie Werner Huck nennt sie die Konzertreise nach Israel als Höhepunkt – aber im Gegensatz zu ihrem älteren Kollegen klagt Gudrun Otto nicht über Einschränkungen im Privaten. "Bei mir ist das eigentlich andersrum", sagt die junge Sängerin, deren Leben durch die Gächinger Kantorei eine besondere Wendung nahm: Während der IsraelTournee lernte sie ihren Freund kennen. 36 Stars und Störche Das Musikfestival im elsässischen Colmar stellt Krzysztof Penderecki in den Mittelpunkt Festivalbericht für die Esslinger Zeitung und Westdeutsche Allgemeine Zeitung (07.07.2003) Manierliche Fassaden, freundliche Menschen und über allem ein stolzes Storchenpaar im luftigen Nest – im elsässischen Colmar scheint die Welt noch in Ordnung. Hier kann man getrost einen Gang herunterschalten, das prächtige Stadtbild auf sich wirken lassen und die kulinarischen Spezialitäten vom Sauerkraut bis zum Munsterkäse genießen. In den ersten zwei Juli-Wochen ist Colmar aber auch Schauplatz eines Musikfestivals, das viele deutsche Besucher anzieht. Es könnten noch mehr sein, denn Festivalchef Vladimir Spivakov versammelt in seinem Programm Stars und Nachwuchs, musikalische Entdeckungen und immer wieder gern Gehörtes. Die Stadtoberhäupter knüpften 1989 mit Spivakovs Berufung an die sommerlichen Konzerte an, die Karl Münchinger und sein Stuttgarter Kammerorchester früher in Colmar gegeben hatten. Die Beziehungen und Überredungskünste des russischen Geigers und Dirigenten erweisen sich Jahr für Jahr als wertvoll. Der bescheidene Etat von einer runden Million Euro ermöglicht trotz mäßiger Eintrittspreise 24 Konzerte verschiedenen Formats mit mehreren Sinfonieorchestern, zwei Chören und in diesem Jahr auch Klavierstars wie András Schiff und Ewa Kupiec. Von der in Frankreich nicht seltenen Festival-Beliebigkeit grenzt sich Vladimir Spivakov durch das Konzept der jährlichen „Hommage“ an einen Großen der Musikwelt ab. Während die so Geehrten bisher meist verstorbene Musiker waren, steht heuer der polnische Komponist Krzysztof Penderecki aus Anlass seines 70. Geburtstags im Mittelpunkt. 13 seiner Werke erklingen in Colmar, und zwar nicht in kleinformatigen Spezialkonzerten, sondern verteilt auf viele Programme – und verständlicherweise garniert mit Zugstücken von Schubert bis Chopin. Natürlich reiste Penderecki zu dieser freundschaftlichen Ehrung an, dirigiert selbst vier Konzerte und nimmt bei jeder Aufführung seiner Stücke den Applaus des kundigen Publikums entgegen. Seine Interpretation von Schuberts 5. Sinfonie – kürzlich auch bei den Stuttgarter Philharmonikern zu erleben – fiel allerdings beim Litauischen Staatsorchester, einem behäbigen Klangkörper mit wenig Neigung zu überschäumendem Engagement, nicht auf fruchtbaren Boden. Ganz anders kommt die Sinfonietta Cracovia daher – das junge Orchester aus der alten Königsstadt Krakau brannte in Pendereckis Concerto grosso für drei Klaviere und Dvoraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ ein klangliches Feuerwerk ab, das seinesgleichen sucht. Festivalchef Vladimir Spivakov ließ bei einem Kammerkonzert mit Schostakowitsch, Schnittke und Dvorak einen wunderbar samtigen Geigenton hören, und der Star des Festivals, András Schiff, wurde für sein entspanntes Bach-Chopin-Programm auf zwei verschiedenen Flügeln mit stehenden Ovationen gefeiert. Das Musikfestival in Colmar, ein heißer Ausflugstipp für württembergische Musikfreunde, dauert noch bis zum 14. Juli. Am kommenden Wochenende dirigiert Penderecki die Sinfonia Varsovia, Vladimir Spivakov steht am Pult des Russischen Nationalorchesters. Zwar ist das sehr gute Programmbuch nur in französischer Sprache erhältlich – als Besucher kommt man jedoch mit Deutsch problemlos durch. 37 Längere Reportagen Zwischen den Welten Ein junger Mönch als Praktikant im Staatstheater - Beitrag für die Esslinger Zeitung, veröffentlicht am 31.10.2003. Nachdruck in der WAZ am 06.12.2003 Die Lehrwerkstatt der Stuttgarter Staatstheater ist ein angenehmer Ort – schöne Stoffe, bunte Utensilien, konzentrierte Atmosphäre und leise Musik. In der ehemaligen Musikhochschule am Urbanplatz lernen 13 junge Leute das Handwerk des Herrenschneiders, und das auf höchstem Niveau. Bundesweit sind die Staatstheater der größte Ausbilder für diesen Beruf, der Bedarf an Maßschneidern für hochwertige Herrenbekleidung ist hoch. Auf den ersten Blick fällt der junge Mann, der am Arbeitstisch links außen in seine Näharbeit versunken ist, unter seinen Mitlehrlingen nicht weiter auf. Nur seine Kleidung wirkt ein wenig dunkel. Dass es sich bei seinem Gewand um ein Ordenshabit handelt, bemerkt man erst, wenn der 22-jährige Bruder Pius aufsteht und zu Lehrmeister Günter Joost geht, um sich Rat zu holen. „Ja, die Kutte ist echt“, das musste Bruder Pius schon öfter versichern. Für fünf Wochen hat sich der junge Benediktiner aus der Erzabtei Beuron verabschiedet und absolviert in der Stuttgarter Lehrwerkstatt ein Praktikum. Von Beuron aus, wo er der einzige Schneiderlehrling ist, suchte er nach einer Möglichkeit, seinen fachlichen Horizont zu erweitern und sich auf die Anforderungen der bevorstehenden Zwischenprüfung umfassend vorzubereiten. Einer der Theaterlehrlinge, Karl Christoph Gebauer, ebenfalls 22 Jahre jung, wird im Austausch einige Wochen im Kloster hospitieren. Rund 1.500 Frauen und Männer leben im deutschsprachigen Raum in Benediktinerklöstern und folgen der im 6. Jahrhundert entstandenen Mönchsregel des Heiligen Benedikt. Die Erzabtei Beuron, zwischen Tuttlingen und Sigmaringen an der Donau gelegen, ist ein einflussreicher und aktiver Stützpunkt des Ordens. Das faszinierte Bruder Pius, der eine Klosterschule in Niederbayern besuchte und zu Hause „gut katholisch“, wie er sagt, erzogen wurde. „Die Mönche in meiner Schule führten ein einfaches Leben und wirkten immer zufrieden“, erinnert sich der junge Mann. Gleichzeitig seien seine Lehrer „cool im Umgang mit jungen Leuten“ gewesen. Von Beuron, wo derzeit 65 Benediktiner leben, erfuhr er durch einen Fernsehbericht. Er entschied sich bewusst für diese Abtei – weil er einen gewissen Abstand von seiner „ersten Heimat“ wollte, aber auch, weil Beuron besonders intensiv die Tradition pflegt. Vor allem der gregorianische Gesang hat es Bruder Pius angetan, und man kann sich seine kernige Stimme mit dem typischen rollenden „R“ gut im Chor vorstellen. Während seiner Stuttgarter Zeit jedoch muss er den klösterlichen Tagesablauf weitestgehend ent­behren. Zwar fährt er zum Wochenende „nach Hause“ – wie er Beuron ganz selbst­verständlich und für den Außenstehenden doch irritierend bezeichnet -, unter der Woche jedoch ist fast alles anders als im Kloster. Dort stehen die Mönche bald nach 4.00 Uhr auf, vor dem Arbeitsbeginn um acht sind bereits zwei der traditionellen Gebete, Morgenhore und Terz, vorüber. In Stuttgart, wo Bruder Pius in einem Sillenbucher Pfarrhaus untergekommen ist, kommt er meist erst abends zum ausführlichen Gebet oder sucht in der Domkirche St. Eberhard stille Einkehr. „Ich bin schon ein bisschen aus der Bahn“, gibt er zu. In die Lehrwerkstatt vermittelt haben den jungen Mönch einer seiner Berufsschullehrer in Balingen und Kurt Schaufenberg, der als Landesinnungsmeister an der Ausarbeitung der einheitlichen Prüfungsaufgaben beteiligt ist. Auf die Frage, wo Bruder Pius sich hinsichtlich bestimmter Verarbeitungstechniken fortbilden könne, schlug Schaufenberg die Staatstheater vor. 38 Gemeinsam mit seinem Beuroner Meister, Bruder Werner, besichtigte Bruder Pius im Juni die Lehrwerkstatt und sorgte dort für einiges Aufsehen. „Es war ganz locker, entgegen allen Vor­urteilen“, erzählt Günter Joost, der die Werkstatt leitet. Sofort plante er mit Bruder Werner den Lehrlingstausch, und mit Karl Christoph Gebauer fand sich schnell ein Auszubildender, der vorübergehend „ins Kloster gehen“ wollte. Die kleine Schneiderei der Erzabtei Beuron, in einem uralten Haus im Klosterareal untergebracht, beherbergt zwar wertvolle historische Gewänder. Die tägliche Arbeit jedoch beschränkt sich meist auf den eigenen Bedarf der Mönche, hinzu kommen Aus­besserungen und Reinigungsarbeiten. Nur hin und wieder fertigte Bruder Werner auch Gewänder für den Bischof an – und dabei ging es natürlich nicht um „weltliche“ Kleidungsstücke wie Weste und Sakko, die zum amtlichen Ausbildungsprogramm des Herrenschneiders gehören. In Stuttgart lernt Bruder Pius genau dies und staunt über das Können seiner zeitweiligen Kolleginnen und Kollegen. „Die sind schon brutal gut“, urteilt er und hofft darauf, dass ihm sein Erzabt ein erneutes Praktikum im nächsten Jahr erlaubt. Ein Mönch, noch dazu ein so junger, sorgt auch – oder gerade – im Großstadtleben für Aufmerksamkeit. Mancher schaut ihm nach, einige Menschen sprechen Bruder Pius auch an. „Es gibt wirklich Leute, die gar nicht wissen, dass es noch Mönche gibt“, erzählt er. Dabei kann gerade Beuron über Nachwuchs nicht klagen. Zwar ist Bruder Pius der Jüngste an Lebensjahren, nach seinem Eintritt 2001 jedoch kamen schon weitere fünf Männer ins Kloster. „Wir leben ja auch nicht hinter dem Mond“, sagt er und schmunzelt über Meinungen, die das heutige Klosterleben mit Eindrücken aus dem Kino gleichsetzen: Der Film „Der Name der Rose“, der im Mittelalter spielt, habe vieles geprägt. Dass es in Beuron sogar Internet gibt, scheint auch Karl Christoph Gebauer ein wenig beruhigt zu haben. Als es um den Austausch ging, habe er gar nicht lange nachgedacht und sein Interesse angemeldet, erinnert er sich: „Erst während der Sommerferien wurde mir klar, dass das mehr ist als ein gewöhnliches Praktikum.“ Über das, was anders sein wird als gewohnt, hat er sich viele Gedanken gemacht. „Man kann abends nicht einfach jemandem etwas erzählen, man ist ganz für sich“, überlegt er. Um das bewusst zu durchleben, will er nicht einmal sein Handy mitnehmen: „Es ist ganz gut, mal nicht immer erreichbar zu sein.“ „Man ist ja auch ein bisschen entmündigt“ – im Gespräch stellt Gebauer das eher als Frage in den Raum, als dass er es behauptet. Seinem Altersgenossen in der Mönchskutte scheint dieser Gedanke vertraut, aber er fasst das Regelwerk, das bei den Benediktinern Handeln und Denken bestimmt, als Halt und nicht als Hindernis auf. Bruder Pius schätzt auch sein so genanntes „Habit“ – es sei schließlich Zeugnis für seinen Glauben, und gleichzeitig Schutz vor Anfechtungen. Dass die Kutte darüber hinaus ein gesellschaftsfähiges Kleidungsstück ist, erweist sich als angenehmer Nebeneffekt. Weder beim Opernbesuch noch bei der Ehrung von drei Auszubildenden des Theaters als so genannte „Kammersieger“ musste er sich über ein angemessenes Outfit Gedanken machen. Allerdings: „Nicht die Kutte macht den Mönch“, sagt Bruder Pius und erläutert, dass man nach sorgfältiger Abwägung auch in der Öffentlichkeit zivil auftreten dürfe. Das hat er während seines Praktikums hin und wieder getan - und wurde prompt von einer jungen Dame um seine Telefonnummer gebeten. Bruder Pius befindet sich derzeit in der so genannten „zeitlichen Profess“, zwischen dem meist einjährigen Noviziat und den „ewigen Gelübden“, die jeder Mönch nach gut vier Jahren in einem besonders festlichen Gottesdienst ablegt. Die Freiheiten des ganz normalen Lebens habe er in der Anfangszeit schon mal vermisst, gibt er zu. Die Spaßgesellschaft und die Warenwelt aber scheinen ihm während seiner Jahre im Kloster fremd geworden zu sein. „Ganz schön viele Leute“, kommentiert er das übliche Gedränge der Stuttgarter Königsstraße, der Unterschied zum 39 Leben in Beuron sei schon „krass“. Das „komische Gefühl“, das er auf der Reise vom Kloster in die Landeshauptstadt hatte, wird auf dem Weg nach Beuron wohl auch Karl Christoph Gebauer spüren. Für ihn handelt es sich letztlich „nur“ um ein mehrwöchiges Praktikum. Bruder Pius hingegen hat eine Lebensentscheidung getroffen. „Man muss wissen, wer man ist“, beantwortet er knapp die Frage nach den Anfechtungen im weltlichen Leben, in das er für einige Wochen wieder eingetaucht ist. Seinen Ordensnamen, es war einer von drei eigenen Vorschlägen, hat er nach Papst Pius X. gewählt, dessen Pontifikat von 1903 bis 1914 dauerte. Der war, sagt das Heiligenlexikon, „ein innerlicher und frommer Mann, einfach und verständl ich in seiner Rede.“ Die Benediktinerregel, dass ein Mönch „ruhig und ohne Gelächter, demütig und mit Würde wenige und vernünftige Worte“ sprechen solle, hat auch Bruder Pius schon längst verinnerlicht. 40 Wie aufregend, ich geh ins Kino! Filmkunst in der Kleinstadt – Baden-Württembergs Kinomobil macht’s möglich - Eine Reportage für die Esslinger Zeitung (17.04.2004) In den 70-er Jahren begann das große Kinosterben. Filmtheater in kleineren Städten wurden geschlossen oder abgerissen. 1988 startete das Kinomobil Baden-Württemberg, um in diesen Gemeinden regelmäßig Filme zu zeigen. Das kleine Team im Stuttgarter Filmhaus betreut inzwischen rund 70 Orte. Drei Filme pro Spieltag werden präsentiert, vom Kinderfilm über den Jugendstreifen bis zum Abendprogramm. Ein Kinomobil-Tag in Besigheim. +++ 12.15 Uhr – Christian Weishäupl kommt ins Büro des Kinomobils BadenWürttemberg im Stuttgarter Filmhaus. Nach ein paar Absprachen mit Geschäftsführerin Anja Grunwald macht er sich mit Linnea Larsson, die beim Kinomobil ein Freiwilliges Kulturelles Jahr absolviert, auf den Weg. Aus dem Tiefgaragenlabyrinth zwischen Friedrich- und Lautenschlagerstraße lenkt Weishäupl den mit Projektor, Filmrollen, Tonanlage und Kabeln vollgestopften VW-Transporter in Richtung Besigheim. +++ Das Weinstädtchen am Neckar ist einer der regelmäßig bespielten Orte, die auf Anja Grunwalds Baden-Württemberg-Karte rot markiert sind. Dorthin fährt das Kinomobil monatlich. Gelb bedeutet alle zwei Monate oder seltener; grün sind jene Orte markiert, die neu hinzugekommen sind oder erst angefragt haben. Anja Grunwald ist seit drei Jahren Geschäftsführerin beim 1988 gestarteten Kinomobil. Ebenso wie ihre Buchhalterin arbeitet sie halbtags. Vollzeitangestellte sind die beiden Vorführer, von Fall zu Fall kommen Aushilfen und Praktikanten hinzu. Gefördert wird das Kinomobil als gemeinnütziger Verein von der landeseigenen Medien- und Filmgesellschaft (MFG). Die rund 70 bespielten Gemeinden garantieren eine Summe von 250 Euro für drei Filme – das heißt: Nur bei geringeren Einnahmen trägt die Gemeinde den Unterschiedsbetrag. +++ 13.00 Uhr – Christian Weishäupl steuert das Kinomobil auf den Parkplatz vor Besigheims Alter Kelter, die in den 80-er Jahren zur Stadthalle umgebaut wurde. Hausmeister Friedrich Gauger bringt einen Rollwagen, mit denen die Gerätschaften in den 1. Stock gebracht werden können. Eine halbe Stunde später steht der Projektor im Rang des Kleinen Saals – „ist leider ein bisschen laut ohne separate Kabine“, entschuldigt sich Weishäupl, Gauger verspricht baldige Abhilfe durch eine Holzkonstruktion. +++ Die Gemeinden knausern. „Manche beklagen sich schon über 50 Euro Zuzahlung“, erzählt die Kinomobil-Chefin. Die verzweifelte finanzielle Lage der Kommunen zeitigt aber auch andere Ergebnisse. „Neu hinzukommende Gemeinden haben sich ausgerechnet, dass sie mit dem Kinomobil ein preiswertes Kulturprogramm bekommen“, sagt Anja Grunwald. Bei jedem Kinomobil-Termin wird jeweils ein Film für Kinder, Jugendliche und erwachsenes Publikum gezeigt. +++ 14.00 Uhr – Die ersten Kinderstimmen im Treppenhaus. „In zehn Minuten könnt Ihr rein“, ruft Christian Weishäupl, legt noch mal Hand an den Projektor und bereitet die Kasse vor. „Wie aufregend, ich geh’ ins Kino“, scherzt eine Mutter. Eine andere moniert, dass im Kindergarten keine Werbezettel für das Kinomobil gelegen hätten, eine dritte beschwert sich über den gegenüber der Ankündigung um einen Euro höheren Eintritt. Der Verleih habe für „Sams in Gefahr“ auf dem höheren Preis bestanden, erklärt Weishäupl der Frau, deren Verständnis begrenzt bleibt. Linnea Larsson lässt vor Filmbeginn die rund 50 kleinen Zuschauer überlegen, was sie sich wünschen würden, hätten sie Wunschpunkte wie das fabelhafte Sams. Nach dem Film sollen sie mit ihren Ideen das Filmplakat bekleben. +++ 41 Eine späte Reaktion auf das Verschwinden der Filmtheater auf dem Land sei das Kinomobil gewesen, sagt Anja Grunwald. In letzter Zeit bemüht sich ihr Team verstärkt um Begleitprogramme. So soll Linnea Larsson während ihres Freiwilligen Jahrs weitere Aktionen wie die mit den Sams-Punkten entwickeln. +++ 16.15 Uhr – Das „Sams“ ist aus der Gefahr gerettet. Christian Weishäupl verliert keine Zeit und spult den Film zurück. Der transportable 35-mm-Projektor aus Mailand ist fünf Jahre alt und 11.000 Euro wert. Er sei kompakt und praktisch, erzählt Weishäupl, aber auch wartungsintensiv: „Da wird man entweder zum Tüftler oder wahnsinnig.“ Während sich im Rang die Filmrollen zurückdrehen, beschriften vor dem Saal die Kinder die Wunschpunkte. Wonach sich die Kleinen sehnen: Gameboy, Pferde – und drei Mal „Geld“. Eine der kleinen Zuschauerinnen zeigt mehr Fantasie und wünscht sich, „dass das Sams mal in die Grundschule Besigheim kommt.“ +++ Den Cinemaxxen kann und will das Kinomobil keine Konkurrenz machen. Bei einem „Nachspieler“ kommen die Filme zwar erst sechs bis acht Wochen nach der Premiere ins Programm. Dafür ist der Verleih günstiger, denn das kommerzielle Interesse flaut zu diesem Zeitpunkt bereits ab. Vor allem bei den Jugendlichen teilt das Kinomobil das Schicksal aller Filmtheater – viele Streifen werden kopiert oder aus dem Internet gesaugt, und der Kinobesuch entfällt. +++ 16.45 Uhr – Die ersten Jugendlichen kreuzen auf. Der Altersunterschied zum Kinderfilm ist gar nicht so groß: Rund 40 junge Leute zwischen zehn und 15 interessieren sich für „Freaky Friday“ mit Jamie Lee Curtis, darunter nur ein einziger Junge. Der Film beginnt, draußen vor dem Saal wird es ruhig. Wie wird man Filmvorführer? „Durch Zufall“, antwortet Christian Weishäupl. Er ging als Schüler bei einem Kinobesitzer in Stammheim in die (inoffizielle) Lehre, hat während des Studiums in vielen Filmtheatern ausgeholfen und ist nach einer Station beim benachbarten Kommunalen Kino jetzt beim Kinomobil angestellt. +++ Für Anja Grunwald ist die „gute Mischung“ im Programm wichtig. Ab und zu fokussiert sie die Auswahl auf Deutsches, auch Baden-Württembergisches. „Da sehen manche zu Unrecht drauf herab“, sagt die Geschäftsführerin. Sie versucht, die Filme zeitnah am aktuellen Kinoprogramm auszurichten. Für Sonderprojekte wie sommerliches Freilichtkino bestellt sie auch Klassiker, vielfach auf Wunsch der Gemeinden, die ansonsten das vom Kinomobil vorgegebene Programm akzeptieren müssen, wenn sie nicht draufzahlen wollen. +++ 19.00 Uhr – Wieder heißt es für Christian Weishäupl: Zurückspulen. Die Tage können lang sein beim Kinomobil, vor allem wenn die Spielorte weit entfernt sind. Von den regelmäßigen Zielen hat Meersburg die größte Entfernung von Stuttgart. Wenn Christian Weishäupl den 40 kg schweren Projektor und die je 15 kg wiegenden Filmrollen ins Auto gewuchtet hat, ist der Dienstschluss manchmal noch fern. Einmal stand er nachts im Stau und war erst um 3.00 Uhr zu Hause. +++ Nicht nur Baden-Württemberg hat ein Kinomobil. Im Berchtesgadener Land beispielsweise ist Elke Lachmann die mobile Vorführerin. Im Auftrag des Kreisjugendamts zeigt sie an einem Dutzend Spielorten Filme für Kinder, bekommt ein festes Honorar und trägt eventuelle Verluste durch geringe Einnahmen selbst. „Da ist ganz schön Druck im Nacken“, sagt die Sozialpädagogin, die schon an ihren früheren Wohnorten Darmstadt und München Kino gemacht hat. Auch für sie sind die Zeiten schwieriger geworden. Das Kinderkino steht selbst in Bayern ganz oben auf der Abschussliste, wenn das kommunale Sparen losgeht. +++ 19.40 Uhr – Für „Blueprint“ mit Franka Potente haben sich mehrere Besigheimer Schulklassen angemeldet, denn das dem Film zu Grunde liegende Buch von Charlotte Kerner ist offizieller Stoff für die Deutschprüfung an Realschulen. Während der Vorführung herrscht gelegentlich Unruhe, in der 42 kurzen Pause, wenn Christian Weishäupl die Filmrolle wechselt, flammen die Handydisplays auf. Wohl nur halb im Spaß meint ein erwachsener Zuschauer später, er müsse eigentlich sein Geld zurückverlangen. +++ Die tollsten Orte sind gut erhaltene, „richtige alte Kinos“, findet Anja Grunwald. LaudaKönigshofen und Creglingen haben solche nostalgischen Spielstätten. Vor Ort gibt es immer wieder freiwillige Mitarbeiter, manchmal macht eine Jugendgruppe für die Zuschauer Popcorn. +++ 22.00 Uhr – Auch der Abendfilm ist vorbei. Christian Weishäupl und Linnea Larsson haben ihren Hunger mit Nudeln vom Pizza-Service gestillt und zusammen mit Hausmeister Gauger den Kabelsalat geordnet. Eine halbe Stunde dauert es, bis das Material im Transporter verstaut ist. Während der Heimfahrt diskutiert man noch über die Filme und die Planung der nächsten Tage. Weishäupl setzt Linnea in Heslach ab und nimmt Kurs auf StuttgartOst. Es wird wohl bald Mitternacht sein, wenn er zu Hause ist. „Blueprint“ hat er nicht mehr zurückgespult. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. +++