2011-10-10 Pohlmann
Werbung
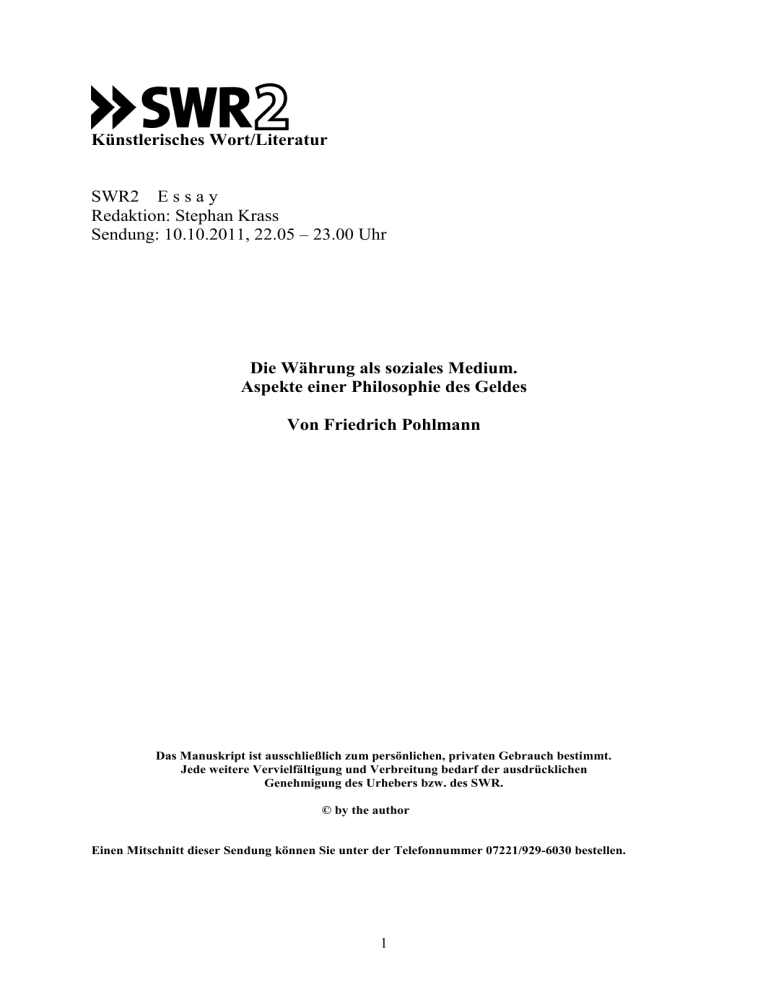
Künstlerisches Wort/Literatur SWR2 E s s a y Redaktion: Stephan Krass Sendung: 10.10.2011, 22.05 – 23.00 Uhr Die Währung als soziales Medium. Aspekte einer Philosophie des Geldes Von Friedrich Pohlmann Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. © by the author Einen Mitschnitt dieser Sendung können Sie unter der Telefonnummer 07221/929-6030 bestellen. 1 In den letzten Jahren wurden wir Zeugen zweier großer Finanzkrisen, derjenigen von 2008, die die Weltwirtschaft an den Rand des Totalzusammenbruchs brachte, und der sehr ungenau „Verschuldungskrise“ genannten Euro-Krise – Krisen, die trotz ihrer ganz unterschiedlichen Entstehungsursachen, sich mittlerweile miteinander verbunden und zu einer Fundamentalkrise des Finanzsystems ausgeweitet haben, die die mächtigsten Volkswirtschaften samt ihren politischen und gesellschaftlichen Systemen substanziell bedroht. Was man in deren Verlauf an Beobachtungen sammeln konnte, hatte oftmals einen über die desaströse Gegenwartsrealität ins Grundsätzliche hinausweisenden Charakter, in ein Terrain der Reflexion im Übergangsbereich zwischen einem aktualitätsbezogenen ökonomischen Fachdiskurs und einer Philosophie des Geldes. Eine Philosophie des Geldes verlängert die Fäden rein ökonomischen Denkens in eine tiefere Erkenntnisschicht und lockert die Grenzen zu anderen Disziplinen, so dass auch deren Perspektiven, beispielsweise solche psychologischer Art, in das Nachdenken über das Geld Eingang finden können. Ich begnüge mich zunächst mit wenigen Hinweisen, welche Merkmale beider Finanzkrisen sich für derartige Reflexionen über das Geld geradezu aufdrängen. Da ist zunächst der Eindruck von einer weitgehenden Ohnmacht politischen Handelns. Die Politiker agieren wie Getriebene, um, so der Jargon, „die Finanzmärkte zu beruhigen“, treffen dabei aber nicht selten Maßnahmen, die Probleme nicht „lösen“, sondern nur auf eine andere, höhere Ebene verlagern, also langfristig krisenverschärfend wirken. Nicht die politischen Akteure „herrschen“ also, sondern ominöse Gebilde namens „Finanzmärkte“, oder noch knapper im Anschluss an den Volksmund: es „herrscht das (große) Geld“. Wie aber läßt sich dieser Topos verstehen? Und: Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Finanz- und den „normalen“ Gütermärkten? Bezeichnet die sogenannte „Herrschaft der Finanzmärkte“ eine neue Stufe in der „Herrschaft des Geldes“, die den ganzen Kapitalismus charakterisiert? Und was hat es mit der vielgeschmähten „Geldgier“, die das Geschehen auf diesen Märkten unzweifelhaft antreibt, genau auf sich? Zweite Erkenntnis beider Finanzkrisen ist die vom „Fluch der guten Tat“, der katastrophalen Folgen, die die ökonomische Umsetzung moralisierender politischer Aktionsprogramme nach sich ziehen können, die Erkenntnis also von der Eigenlogik der Ökonomie, die Gutgemeintes in Plagen zu verwandeln vermag. Die große Finanzkrise von 2008 hatte eine ihrer wichtigsten Wurzeln in Programmen zur Weltverbesserung, die jedem Amerikaner – an erster Stelle den benachteiligten Minderheiten - zu Hausbesitz und Wohlstand verhelfen sollte, und zwar vermittels einer Spezies von Immobilienkrediten, denen eine wundersame Kraft zur quasi-selbsttätigen Tilgung durch endlos steigende Preise der mit ihnen erworbenen Immobilien zugeschrieben wurde. Und der Euro war von Anfang an ein 2 mehr als „nur“ eine Währung, sondern ein politisches Projekt. Ursprünglich als der von den Deutschen zu zahlende Preis für ihre staatliche Einheit erzwungen, avancierte er dann mittels einer verschwommen-harmonistischen Europa-Ideologie zu einem höchst erstrebenswerten Gut, zu einem nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen Gewinn für alle, einem Wundermittel europäischer Völkerverständigung. Mittlerweile freilich dämmert den meisten, dass genau diese ideologische Überfrachtung der Währung – ihr Missverständnis als zwischenstaatlicher Moralbringer – für einen Großteil des ökonomischen Widersinns verantwortlich ist, der in ihren gigantischen Rettungsmaßnahmen steckt; und dass diese „Rettungsschirme“ genau das hervorbringen, was die gemeinsame Währung „ein für alle mal“ aus der Welt schaffen sollte: innerstaatliche Entdemokratisierungen und verschärften Zwist und Neid zwischen den europäischen Völkern. Dritter Aspekt ist die Tatsache, dass, abgesehen von der leicht vorhersagbaren Eurokrise, keine der großen Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte von der ökonomischen Fachwissenschaft prognostiziert wurde. Bedürfen gewisse ihrer Grundaxiome einer Revision? Versteht sie ihren zentralen Gegenstand, das Geld, nicht hinreichend? Apropos „Gegenstand“: Welchen Gegenstandscharakter hat überhaupt das Geld? Ist es ein Ding? Ein Zeichen? Oder im wesentlichen nur eine in sozialer Praxis vollzogene kognitive Operation? Und schließlich der vierte Gesichtspunkt, der den Mechanismus des sich rapide aufzehrenden Vertrauens bei den politischen Bändigungsversuchen beider Finanzkrisen anspricht: Versuchte man zunächst eine Stabilisierung der Finanzmärkte, indem man die Vertrauensverluste im Bankensystem durch Garantien der Staaten, also von politischen Akteuren mit größerem Vertrauensreservoir auszugleichen trachtete, so reproduzierte man in der Folge diese Technik des Vertrauensmanagements auf sukzessive höherer Ebene, indem beispielsweise der Verlust des Vertrauens zu kleineren Ländern durch Garantien mächtigerer kompensiert werden sollte. Das aber führte nur dazu, dass die Garanten selbst mehr und mehr ins sogenannte „Visier der Märkte“ gerieten und immer mächtigeren Akteuren bis hin zum mächtigsten – den USA schrittweise Vertrauen entzogen wurde. In Europa wird mittlerweile die Kreditwürdigkeit Italiens offen angezweifelt und auch diejenige Frankreichs nicht mehr fraglos unterstellt, und wenn der Großteil der Euro-Länder nur noch an den Garantien Deutschlands hängt, dann sind auch diese bald nicht mehr viel wert. Mit der Thematisierung des Vertrauensaspektes ist nun freilich ein Merkmal angesprochen, das die Reflexion über das Geld weit über die Krisen der Gegenwart hinausweist. Der Vertrauensaspekt schlägt eine Brücke in die grundsätzlichste Denksphäre über das Geld, ins Terrain der Deutungen seines „Wesens“, seiner 3 Grundcharakteristika als eines sozialen Konstrukts und Mediums. Mit ihrer Reflexion wollen wir beginnen. Der Frage, was Geld eigentlich „ist“, ist im Laufe einer weit über zweitausendjährigen Geistesgeschichte höchst unterschiedlich nachgedacht worden, aber nur selten erreichten die Antworten die pragmatische Nonchalance Milton Friedman’s, eines der Begründer des sogenannten modernen „Monetarismus“: „Geld“, so Friedman, das sind einfach „die Geldscheine, die wir in der Tasche tragen“, höchst nützliche hergestellte Dinge, die kein Gran geheimnisvoller seien als etwa Schreib- oder Toilettenpapier. Für Karl Marx hingegen wurde das Geld, je mehr er es zu begreifen suchte, zu einem höchst „vertrackten Ding, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken“, womit er, gemessen an philosophischen Ansprüchen, zweifelsohne Recht hat. In der ökonomischen Fachwissenschaft und auch in der Soziologie dominieren seit ihren Anfängen „Erklärungen“ und „Begriffe“ des Geldes, die aus der klassifizierenden Deskription von Geldfunktionen herausdestilliert wurden und oftmals hilfreiche Einsichten vermitteln, aber kaum jemals den Status philosophisch reflektierter Kategorien erreichen. Da wird etwa dem Geld die Funktion eines allgemeinen Tauschmittels, einer Recheneinheit oder eines Wertaufbewahrungsmittels zugesprochen oder es wird als „Zeichen“ für einen davon verschiedenen ökonomischen Wert gedeutet, und im Anschluß an derartige Auflistungen wird dann gewöhnlich implizit oder explizit unterstellt, dieser Funktionen wegen sei das Geld historisch auch „erfunden“ worden. Die Unzulänglichkeit derartiger „Erklärungen“ wurde nur selten erkannt. Wenn man etwa, wie Adam Smith und ein Großteil seiner nationalökonomischen Nachfolger, aus den nützlichen Funktionen des Geldes in differenzierten Tauschwirtschaften seine historische Entstehung „abzuleiten“ versucht, wird übersehen, daß differenzierte Tauschwirtschaften ohne Geld prinzipiell unmöglich sind, also das Abzuleitende bereits voraussetzen. Ein ähnlicher Fehler findet sich bei Karl Marx oder Georg Simmel, die das Geld als reale Vergegenständlichung und Zeichen für einen „Tauschwert“ der Waren deuten, der ihnen als angeblich Gemeinsames auch schon in „geldlosen“ Austauschbeziehungen inhärent sei, ein Fehler deshalb, weil tatsächlich die Begriffe des Wertes und der Wertschöpfung getrennt vom Geld gar nicht denkbar sind. Auch leuchtet sofort die Fragwürdigkeit von Reden vom Wert als einer quasidinglichen Entität und diejenige vom Geld als „Wertaufbewahrungsmittel“ ein, wenn wir uns den rapiden Wertverlust „aufbewahrten“ Geldes während eines Börsencrashs oder einer Inflation vor Augen halten. Auf dem Höhepunkt der Inflation im Jahre 1923 fiel der „Wert“ des Geldes als Zahlungsmittel für ein Brot im Laufe einiger Stunden um Hunderte von Millionen. Fügen wir hinzu, dass auch die Deutung des Geldes als eines Zeichens – sie 4 verdankt sich dem früher üblichen Bezug des Geldes auf einen Goldstandard – fragwürdig ist: Das Geld, egal wie seine materiale Vergegenständlichung – sei es Münze, Banknote oder Rechengeld im Internet – zeigt auf nichts außerhalb seiner selbst, es gibt kein Signifikat, zu dem es ein Signifikant wäre. Zwar sind Preise formal als Zeichen, also semiotisch interpretierbar, weil hier jeweils Warenquantitäten auf Geldquantitäten – und umgekehrt – zeigen. Doch wofür sind Preise „Zeichen“? Nur für andere Preise. Das Geld „zeigt“ nur auf sich selbst, vergleichbar den Zahlen, die auch nur auf andere Zahlen – in den Relationen „größer/kleiner“, „teilbar“ usw. – zeigen. Insofern eignet dem Gelde eine vollkommen leere Identität. Wie sehr das Nachdenken über das Geld von erkenntnishemmenden Konventionen verstellt wird, zeigen übrigens bereits so scheinbar neutrale Floskeln wie die von den Wirkungen oder Funktionen „des“ Geldes, deren auch ich mich hier ganz selbstverständlich bedient habe, erzeugen sie doch den Anschein wirkender Funktionen eines Dings. Aber die Wirkungen und Funktionen, die man sich angewöhnt hat, „dem Gelde“ zuzuschreiben, sind doch nichts anderes als Projektionen von von Menschen beim Geldgebrauch ausgeübten praktischen und kognitiven Prozessen, und die Rückführung jener verdinglichenden Projektionen auf diese Prozesse ist ein wesentlicher Bestandteil der Entschleierung des Geldrätsels und einer Philosophie des Geldes. Die zunehmende Entmaterialisierung des Geldes in der Geschichte der Geldwirtschaft, von der Münze über die Banknote bis hin zum digitalen Buchgeld, mit dem in der Gegenwart der Großteil der Finanzoperationen getätigt wird, bedeutet nicht, dass sich das Geld vollständig von materiellen Verkörperungen abzulösen vermöchte – Geld muss prinzipiell immer auch als quasi-dingliche Entität besessen werden können. Aber seine materielle Verflüchtigung erleichtert doch die Erkenntnis, dass der Geldcharakter des Geldes nie, auch nicht in den Zeiten der Goldmünze, an seiner dinglichen Natur hing: Geld ist, obwohl greifbar, nur ein scheinbares Ding; ist keine physis, sondern eine spezifische Form der Vergesellschaftung, ausschließlich basieren auf gesellschaftlich akteptierten Bedeutungszuschreibungen als eines „Werts“: Geld ist das als allgemeiner Wert geltend gesetzte. Aber das als geltend gesetzte gilt nur, wenn ihm qua Gebrauch Geltung verschafft wird, Geld basiert also auf einer zirkulären Struktur der Anerkennung, die sich in der historischen Realität typischerweise als Wechselspiel zwischen Anerkennungspostulaten seitens der politischen Zentralinstanz und seiner faktischen Legitimierung mittels seines Gebrauchs im Verkehr der Marktteilnehmer konkretisiert hat. Geld im vollen Wortsinn ist eine griechische Erfindung. Das gemünzte Geld, „nómisma“, und das Gesetz, „nómos“, wurden als die beiden Grundlagen der antiken Gesellschaftsordnung der pólis, des Stadtstaates, gedacht, und sie meinen beide, wie unser 5 Wort „Geld“, etwas was „gilt“. Aber diese Geltung bedarf der wieder und wieder erneuerten Beglaubigung im praktischen Handeln, einer Anerkennung „von unten“, deren einzige Basis das Vertrauen ist. So konstituiert das Vertrauen in den Wert des Geldes seinen Wert und damit das Geld als Geld, und wenn man einer Währung das Vertrauen entzieht, sie gewissermaßen durch zunehmenden Nichtgebrauch strafend, dann verliert sie ihren Wert und damit in letzter Konsequenz ihren Geldcharakter und damit auch ihre Macht: Aus „Geld“ ist ein gewöhnliches Ding geworden. Die zirkuläre Struktur der Anerkennung teilt das Geld mit manchen sozialen Phänomenen, an erster Stelle solchen aus dem Bereich der politischen Macht. Ein König beispielsweise ist nicht König, weil seiner Person, so wie es manche politischen Mythologien behaupten, gewissermaßen eine geheimnisvolle Königssubstanz anhaftete, sondern er ist König, weil sich seine Untertanen als Untertanen auf ihn als König beziehen. Je mehr sie ihn in ihren Beziehungen nicht mehr als König und sich als Untertanen anerkennen, desto stärker ist seine Königsstellung bedroht. Und genau das gilt auch für jede Währung und zuletzt für das Geld als solches: Die Geltung des Geldes im Geldgebrauch beglaubigend, verschaffen wir ihm jene Anerkennung, auf der seine universale „Herrschaft“ beruht. Dass in der Geschichte der Geldtheorien sozusagen der „ersten“, derjenigen des Aristoteles, eine Ausnahmestellung zukommt, ist manchmal, und nicht zuletzt auch von Karl Marx, hervorgehoben worden. Es gibt neuere Interpretationen, die sogar eine Überlegenheit der kategorialen Beschaffenheit von Aristoteles’ Geldbegriff über alle seine Nachfolger behaupten, auch über den von Marx, und zwar ironischerweise gerade hinsichtlich jenes Merkmals, in dem Marx selbst im Anschluß an Adam Smith und David Ricardo seinen großen Beitrag zur Aufklärung des Geldrätsels sah, dem Verständnis des „Wertes“. Marx hat den Tauschwert der Waren substanzialistisch gedeutet, als eine ihren Austauschrelationen gewissermaßen vorgelagerte „Kristallisation von Arbeit“, während Aristoteles den Wert ausschließlich als ein Produkt sozialer Zuschreibungen versteht, die in den Austauschbeziehungen qua Geldgebrauch erst entstehen. Das Geld ist also ein messendes Medium, das das zu Messende – den Wert - in den Akten des Messens im Austausch selbst hervorbringt, ist also ein Inbegriff jenes gar nicht so seltenen Typus von Relationen, der seine Relate erst erzeugt. Werfen wir einen etwas längeren Blick auf Aristoteles. Das Geld und den Tausch hat Aristoteles an zwei Stellen untersucht, im ersten Buch seiner Politik und im fünften der Nikomachischen Ethik, aber trotz der in beiden dominierenden unterschiedlichen Perspektiven orientieren sie sich doch an demselben kategorialen Gerüst. Die grundlegende Einheit der Wirtschaft ist für Aristoteles die Hauswirtschaft, der oikos, in dem auch die Lehre 6 vom Wirtschaften, die Oikonomia, die Ökonomie, gründet. Aber das Geld hat nicht im Mikrokosmos des oikos seinen Ursprung – der Zusammenhang der diversen Tätigkeiten innerhalb des oikos selbst ist Produkt eines planenden Bewusstseins -, sondern in jener Sphäre, in der sich die diversen Hauswirtschaften als tauschende gegenübertreten, es fungiert als ein Mittler, der die wechselseitig passende Plazierung ihrer jeweils unterschiedlichen Güterbedürfnisse ermöglicht. Das Geld ist damit gewissermaßen Stellvertreter und Produzent des Zusammenhangs der unterschiedlichen Bedarfs- und Produktionsstrukturen der einzelnen Hauswirtschaften, Ausdruck und Garant also einer größeren Einheit, derjenigen zwischen den Hauswirtschaften, die – so Aristoteles’ bis in unsere Gegenwart aktuelle Kritik am Platonschen Kommunismus – nur höchst unzulänglich nach dem Modell des planenden Bewußtseins innerhalb des oikos verwirklichbar wäre. Aber diesen größeren Zusammenhang stiftet das Geld nur, weil es das als geltend Gesetzte ist, als ein ausschließlich der sozialen Übereinkunft entstammendes kategoriales Novum, und nicht etwa deswegen, weil es seiner Existenz quasi vorgelagerte Wareneigenschaften in eine dinglich faßbare Form brächte. Insofern läßt sich das Geld als ein genialer sozialer Kunstgriff verstehen, als ein höchst nützliches Werkzeug, das aber gerade deswegen, weil es nur sozialer Kunstgriff ist und ihm keine anderweitige „Natur“ eignet, die ihm innere Grenzen setzte, der Möglichkeit des Mißbrauchs offensteht. Ihn erörtert Aristoteles in seiner Analyse von der Kunst des Gelderwerbs, der Chrematistik, die sich grundlegend von der Oikonomia, der Kunst der Haushaltsführung unterscheidet, und die im Wucher, der Obolostatike, seine prägnanteste Form gewinnt. Was es damit auf sich hat, läßt sich am besten mittels einiger Formeln skizzieren, die Karl Marx für den Austausch entwickelt hat. Das Geschehen auf den Warenmärkten stellt sich in seiner formalsten Gestalt als ein endloser Zirkulationsprozeß – Ware-Geld-Ware-Geld-Ware…usw. – dar, und wenn sich das Geld dabei nur auf die Vermittlung verschiedener Waren beschränkt, sie, gemäß den unterschiedlichen Bedürfnissen der Marktteilnehmer „richtig“ plazierend, dann verwirklicht es seine nützliche, durch nichts ersetzbare soziale Werkzeugfunktion. Nun liegt auf der Hand, daß der endlose Zirkulationsprozeß Ware-Geld-Ware usw. aus einer anderen Perspektive auch anders lesbar wird, nicht als Vermittlung von Waren durch Geld, sondern des Geldes durch Waren: GeldWare-Geld-Ware-Geld … eine Lesart, die freilich sinnlos bleibt, solange man die durch die Waren vermittelte Geldquantität als gleich ansetzt. Sinn ergibt sie nur unter der Voraussetzung eines sich dabei permanent vergrößernden Geldquantums: Geld-Ware Mehrgeld usw., einer Formel, die die Grundformel des Handels bezeichnet und als private Akkumulation eines genuin sozialen Mediums deutbar ist. Diese Formel ist durch Weglassung 7 des mittleren Gliedes noch einmal zum zweistelligen Ausdruck Geld-Mehrgeld komprimierbar, der die Geldvermehrung durch die Zinsnahme definiert, die man im größten Teil der Geschichte des Geldes als Wucher bewertete. „Eigentlich“ hat das Geld, so Aristoteles, betrachtet man nur seine soziale Grundfunktion als Tauschmittler, einen nur dienenden Charakter und es ist „unfruchtbar“, aber im vereinseitigten Streben nach Geldbesitz verwandelt es sich aus einem Mittel zum Selbstzweck, und im Zins scheint ihm eine eigentümliche Kraft zur Selbstvermehrung zuzuwachsen, die in der Herkunft des griechischen Wortes für Zins – dem Wort tokos, das sich von tiktein „gebären“ ableitet – besonders sinnfällig wird. In ihm kündigen sich schon die prokreative Aura und die sexuellen Konnotationen an, die in der Folgezeit immer wieder Reden über die scheinbare Kraft des Geldes zur Selbstvermehrung begleitet haben. Aristoteles versucht die eigentümliche Tendenz zur Grenzenlosigkeit zu verstehen, die dem Erwerb des Geldes durch seine Verkehrung von einem Tauschmedium zu einem Selbstzweck zuwächst. Auf dem Gebiet sinnlichen Begehrens ist Schrankenlosigkeit im vollen Wortsinn unmöglich, immer setzt hier die „Natur“ des Begehrenden und die des Begehrten dem Wollen Grenzen, deren Überschreitung Selbstzerstörung bewirkt. Aus der bewußten gemeinschaftlichen Reflexion und Setzung derartiger Grenzen sind soziale Regeln der Moral erwachsen, die die menschlichen Leidenschaften zügeln und ordnen. Aber gerade weil dem Geld keine „innere Natur“ eignet, weil es auschließlich „soziales Konstrukt“ ist, ein vollkommen abstraktes Mittel, dem sich tendenziell jeder Gegenstand sinnlichen Begehrens fügt und das jeden dieser Gegenstände quasi unbegrenzt zu erlangen verspricht, erzeugt es gleichsam eine Lücke, die der vollkommen schrankenlosen Leidenschaft eine Bewegungsform verschafft. Die Pathologie und destruktive Wirkung dieser Leidenschaft enthüllt Aristoteles im Verweis auf die MidasLegende, die unbegrenzte Goldgier des König Midas, die ihn schließlich – nach der Verwandlung auch aller Subsistenzmittel in Geld – bis an den Rand des Hungertodes führt. Bis an die Schwelle der Neuzeit haben alle Gesellschaften durch Tabuierungen und präzise soziale Regelungen der Zinsnahme eine Einhegung dieser Leidenschaft versucht. Aber weil auch in bedarfsorientierten Austauschprozessen als Zwischenstufe jedes Kaufakts ein auf den Gelderwerb als Ziel gerichtetes Interesse zum Tragen kommt und dem Geld in Relation zu allen verfügbaren Waren ein absoluter Mittelcharakter zukommt, der den Geld- gegenüber dem Warenbesitzer privilegiert, war diese Einhegung immer auch ein prekäres Unterfangen. In der Moderne hat man dann mehr und mehr derartige Regeln durch solche ersetzt, die diese schrankenlose Leidenschaft stimulieren, und deshalb ist auch erst hier bei tendenziell allen Gesellschaftsmitgliedern jene Verkehrung entstanden, die Georg Simmel die psychologische 8 Wandlung eines „absoluten Mittels“ in einen „absoluten Zweck“ genannt hat, eine Wandlung, die bedingt, dass nunmehr „jeder erreichte Punkt (des Gelderwerbs) nur als Duchgangsstadium zu einem darüber hinaus liegenden Definitivum empfunden wird“. Wir wollen im folgenden drei Aspekte etwas näher betrachten: die Beziehungen zwischen Geldwirtschaft und persönlicher Freiheit; den spezifischen Charakter des Rationalismus und Intellektualismus, den der Geldgebrauch in der Moderne erzeugt hat; und schließlich eine genauere Bestimmung der Geldgier. Dann kehren wir wieder in die Gegenwart zurück und profilieren einige der Bedeutungsebenen im Topos von der „Herrschaft der Finanzmärkte“. Die Kritik, die das Geld während seiner gesamten Geschichte auf sich gezogen hat und die in der Gegenwart durch die Finanzkrisen wieder kräftig genährt wurde, darf nicht vergessen machen, in welch fundamentaler Weise die moderne Freiheit des Individuums am Geld hängt. Georg Simmel hat das vielfältig demonstriert. Das Geld als Grundbedingung für die endlos verlängerten Ketten marktvermittelter Arbeitsteilung in der Moderne und für die Differenzierung der Gesellschaft in diverse, qua Systemfunktion eigenlogisch funktionierende Teilsysteme macht den Einzelnen zwar in jeder Faser seiner Existenz von einem gar nicht überschaubaren Netz spezialistischer Vorleistungen anderer abhängig, das in der Gegenwart globale Ausmaße besitzt, aber diese ungeheuer gewachsene Abhängigkeit von anderen ging doch einher mit einer außerordentlichen Reduktion der Abhängigkeit von bestimmten Anderen, mit einer Entpersonalisierung der Abhängigkeit, so daß außerhalb der Privatsphäre soziale Abhängigkeiten sich gewöhnlich in spezialistischen Rollenbeziehungen äußern. Sie betreffen nicht die einzelnen als „ganze Personen“, sondern nur gleichsam objektivierte Partikel ihrer selbst. Das ermöglicht ein individuelles „Für-Sich“ der Person, eine individuelle Identität, die von ihren Rollenbeziehungen weitgehend unberührt bleiben kann. Ich skizziere nur einige Facetten der geldvermittelten Entpersonalisierung, ohne die moderne Freiheits- und Individualitätsansprüche gar nicht denkbar sind. Da im Geld gewissermaßen jeder Anbieter wirtschaftlicher Leistungen und jede Ware des Gebietes, innerhalb dessen es gilt, ideell repräsentiert ist und die Quellen seiner Herkunft in ihm selbst vollständig ausgelöscht sind, erzeugt es eine kaum übersehbare Vielfalt sozialer Handlungs- und Wahloptionen. Es löst den Einzelnen aus engen sozialen und örtlichen Bindungen und wirkt als Stimulus räumlicher Mobilität; es befreit ihn von den Zwängen, die das dingliche Eigentum früher immer auf seinen Besitzer ausübte und es stiftet eine große Distanz zwischen Person und Besitz, zwischen Sein und Haben. Und als zentrales Medium und Hebel einer sich immer weiter verästelnden funktionalen sozialen Differenzierung verwandelt es die früher häufig willkürlichen und ungerechten Zumutungen der persönlichen Abhängigkeit in unpersönliche 9 spezialistische Rollenanforderungen, aus denen die „ganze Person“ des einzelnen weitgehend ausgeklammert bleibt und befördert zugleich die Individualität auch im Sinne personaler Differenz und Vielseitigkeit, indem nunmehr die Integration in ganz divergente soziale Kreise und Beziehungen möglich wird, in denen sich die Person zu einem mannigfach differenzierten Individuum, einer „Persönlichkeit“ hochbilden kann. Unsere Vorstellungen und Verwirklichungen individueller Freiheit sind also substanziell mit dem Geld verknüpft. Betrachten wir nun Beziehungen zwischen dem Geld und dem modernen Rationalismus und Intellektualismus. Wer sich mit den kognitiven und emotionalen Auswirkungen der entwickelten Geldwirtschaft befassen will, ihrer Prägekraft für den „geistigen Habitus“ der Gesellschaften der Moderne, muß sich zunächst von dem sowohl in Alltagsauffassungen als auch in den höheren Sphären elaborierter Theoriebildung weitverbreiteten Deutungsfehler lösen, dass Geld eine materielle Entität sei, ein Ding, das dann erst auf irgendwelchen geheimnisvollen Zweit- oder Drittwegen sich des Bewusstseins formend „bemächtige“. Derartige Redeweisen sind Ausdruck jener dualistischen Denkmodelle, die vor allem in ihren marxistischen Varianten – in den Formeln vom „Sein“ und „Bewußtsein“, „Basis“ und „Überbau“, „Materialismus“ und „Idealismus“ oder in der Metapher von der „Wiederspiegelung“ des Objektiven im Subjekt – auf endlose Holzwege geführt haben. Geld „ist“, obwohl greifbar, überhaupt nichts außerhalb des Bewußtseins, ist eine „Kategorie des Denkens“, wie Oswald Spengler pointiert formulierte; eine abstrakt-quantitative Relation, die nur „gilt“, weil und sofern sie in jedem Tausch und in jeder Geldrechnung gleichermaßen handelnd wie denkend als geltend reproduziert wird. Die konventionellen Dualismen vom „Sein und Bewußtsein“ oder „Handeln und Denken“ zeigen ihre Sinnlosigkeit nirgends deutlicher als in Bezug auf das Geld, weil das Handeln mit Geld im Kern ein Denkakt ist, also das Geld nicht als Ding, sondern als „Kategorie des Denkens“ unser Denken prägt. Wie aber läßt sich diese Prägung genauer bestimmen? Was sich im Bewußtsein als Geldstruktur geltend macht, scheint zunächst eine ganz einfache Denkform, der wir gemeinhin schon deswegen wenig Aufmerksamkeit schenken, weil wir uns ihrer permanent in quasi habitualisierter Alltäglichkeit bedienen - in unseren Rechnungen in Geld, den Preisvergleichen oder den Staffelungen zukünftiger Bedürfnisse in Orientierung an unserem Einkommen. Dabei machen wir im Prinzip immer dasselbe: Wir beziehen qualitativ ganz divergente Dinge und Bedürfnisse auf ein vollkommen abstraktes Maß, die Geldeinheit, mittels derer wir sie quantitativ in Beziehung setzen. Aber diese Denkform, in der wir uns qua Geld bewegen, ist tatsächlich von höchster Artifizialität, denn sie ist vollkommen abstrakt, herausgelöst aus jeglicher Verbindung zur sinnlichen Anschaulichkeit: Im Geld rechnend, 10 überspannen wir das Wirkliche mit einem sich ins Mikroskopische verästelnden Netz rein quantitativer Beziehungen, konstruieren eine Schattenwelt reiner Zahlenverhältnisse, der nicht selten ein höherer Wirklichkeitscharakter zugesprochen wird als dem sinnlich Erfahrbaren. Das Geld als Denkform ist also nichts anderes als abstrakt-quantitative Relation, abstraktquantitative Relation freilich auf der Basis eines Apriori – des Glaubens an seinen „Wert“. Diese Denkform aber ist übertragbar, und sie wurde auch aus der ökonomischen Sphäre in andere Denksphären übertragen, und zwar an erster Stelle in diejenige der Mathematik und dann der Naturwissenschaft, und sie hat dadurch an der Herausbildung moderner Weltbildstrukturen einen kaum überschätzbaren Anteil gehabt. Ich muß mich hier auf ganz wenige Hinweise beschränken: Erst im Jahre 1202 hat der Italiener Leonardo Pisano, genannt Fibonacci, bei Versuchen, Warenmengen in Geldarten umzurechnen, in seinem Werk Liber Abaci das moderne mathematische Ziffernsystem begründet, ein Werk, das als eines der wichtigsten der Mathematik überhaupt gilt, aber für Werner Sombart zugleich das Geburtsjahr des modernen Kapitalismus bezeichnet, weil erst auf seiner Grundlage ökonomisch exakte Kalkulationen möglich wurden. Und auch die zentralen Erkenntnismaximen der modernen Naturwissenschaft - die Auflösung substanzialistischer Kausallogiken zugunsten des Ideals quantitativer Meßbarkeit der internen Relationen immer kleinerer Einheiten - haben unübersehbare Strukturerverwandtschaften zum Geld als Denkform. Georg Simmel hat diese Verwandtschaft in vielen Wendungen umkreist, zum Beispiel der folgenden: „Dem Ideal der Naturwissenschaft“, so schreibt er, „die Welt in ein Rechenexempel zu verwandeln, jeden Teil ihrer in mathematischen Formeln festzulegen, entspricht die rechnerische Exaktheit des praktischen Lebens, die ihm die Geldwirtschaft gebracht hat; sie erst hat den Tag so vieler Menschen mit Abwägen, Rechnen, zahlenmäßigem Bestimmen, Reduzieren qualitativer Werte auf quantitative ausgefüllt.“ Kommen wir nun zur Geldgier. Die Geldgier ist eine Leidenschaft, aber eine Leidenschaft mit einem höchst eigenartigen Gepräge, die zudem, das sei sofort unterstrichen, keineswegs als eine individuelle Pathologie gedeutet werden sollte, denn ihre fraglos pathologische Form bei bestimmten Personen und Institutionen darf nicht vergessen machen, dass sie in temperierter Form tendenziell jeden in der modernen Geldwirtschaft erfasst: Die Geldgier ist das „normale“ psychische Korrelat zur modernen „Herrschaft des Geldes“. Machen wir uns zunächst das zentrale Unterscheidungsmerkmal zwischen den Begriffen „Gier“ und „Begierde“ klar: Begierden sind gerichtete Verlangen, denen, man denke zum Beispiel an den Sexualakt oder die Völlerei, immer das Element der zeitweiligen Befriedigung eignet, sie bewegen sich also im Rhythmus der zyklischen Wiederkehr von Bedürfnisspannung und 11 Bedürfnislöschung. Die Gier hingegen ist eine ihrem Wesen nach nicht befriedigungsfähige Leidenschaft, weil sie sozusagen endlos im Modus des Verlangens selbst verbleibt, eine Eigentümlichkeit, die deshalb in der Geldgier ihre quasi idealtypische Verkörperung findet, weil die ungegenständliche Gegenständlichkeit des Geldes, sein Charakter als eines absoluten Mittels, keinen konkreten und mithin begrenzten Nutzen repräsentiert, sondern die reine Potentialität endloser Möglichkeiten. So kennt die Geldgier keine Sättigungsgrenze, im permanenten Verlangen nach mehr Geld ist der zyklische Rhythmus der Begierden in einen linear unendlichen Prozess verwandelt, dem dann jedes Detail des Lebens unterworfen wird. Nun sind derartige psychologische Betrachtungen der Geldgier ganz unzureichend, wenn dabei unterschlagen wird, dass der ihr eignende linear-unendliche Prozesscharakter ja das zentrale objektive Charakteristikum des modernen Kapitalismus selbst ist: Die Formel GeldWare-Mehrgeld… als endlose Bewegung ist der exakte Ausdruck der Geldgier und zugleich die Grundformel für das zentrale Bewegungsgesetz des modernen Kapitalismus, für ein Bewegungsgesetz, das sich in seine strukturellen und institutionellen Mechanismen so eingelagert hat, dass für die Wirtschaftsakteure das Handeln im Sinne der Geldgier gar nicht als eine von mehreren Optionen zur Verfügung steht, sondern funktionale Notwendigkeit bezecinet. Dass man das Wort „Gier“ in anspruchsvolleren sozioökonomischen Fachdiskursen der Gegenwart zu vermeiden trachtet und als einen Abkömmling naiver Denkattitüden belächelt, hat nicht nur mit seinen negativen Konnotationen und moralisierenden Implikationen zu tun, sondern vor allem damit, dass man sich angewöhnt hat, das Wort ausschließlich in seiner psychologisch-personalisierenden Verwendung, im Hinblick auf eine irrationale individuelle Leidenschaft, in den Blick zu nehmen. Dem stellt man dann eine „systemische“ Betrachtungsweise entgegen, die das Handeln wirtschaftlicher Akteure als rationale Reaktionen auf eigenlogische Imperative des ökonomischen Systems verstehbar zu machen versucht. Dabei wird aber nur eine Einseitigkeit mit einer anderen beantwortet, es wird übersehen, dass die Sinnkomponenten des Wortes „Gier“ sehr wohl eine Konvergenz systemischer und psychologischer Perspektiven vorzunehmen gestatten; und es wird gleichermaßen übersehen, dass es im modernen Kapitalismus Systemebenen gibt, in denen das Grundprinzip der Gier in seiner unverstellten Nacktheit eine objektivierte Form gefunden hat und Handlungsmuster der Akteure stimuliert, die mit den gängigen Zuschreibungen ökonomischer ratio nur noch wenig zu tun haben. Diese Systemebenen aber sind, wie gleich noch genauer auszuführen sein wird, die modernen Finanzmärkte. Verbleiben wir aber zunächst noch auf einer grundsätzlicheren Ebene. Im Gegensatz zu den modernen ökonomischen Wissenschaften mit ihren Modellen eines quasi affektneutralen „rationalen 12 Selbstinteresses“ des homo oeconomicus war dem klassischen Liberalismus die starke affektive Komponente einer auf endlose Geldvermehrung fixierten psychischen Disposition noch wohlvertraut und wurde als eine moralisch höchst ambivalent zu bewertende Leidenschaft, das heißt: als Gier gedeutet, freilich als eine quasi gezähmte Gier. Und auch die Inkompatibilität dieser Leidenschaft mit traditionellen Moralordnungen wurde tendenziell erkannt, aber man nahm an, dass in der liberalen Marktwirtschaft diese destruktive Auswirkung kompensiert und sogar überkompensiert werde durch ihren unbeabsichtigten Beitrag für das vielzitierte angebliche „Gemeinwohl“. Dass die Geldvermehrung als Leidenschaft im modernen Kapitalismus normalerweise in verdeckter, gezähmter Form auftritt, gewissermaßen als ein Hybrid aus Emotion und ratio, hat wesentlich damit zu tun, dass ihre Triebkomponente sich gänzlich im Medium präziser rechenhafter Kalkulation entfaltet und in einer gänzlich entpersonalisierten, objektivierten Rechtsordnung: die Leidenschaft verkleidet sich gewissermaßen als formal-rationales Kalkül, das den Anschein emotionsloser Zweckrationalität entstehen läßt, der freilich auch deshalb ganz falsch ist, weil die Fixierung auf das Ziel endloser Geldvermehrung sich stark, wie jedermann weiß, aus einer Quelle der Angst speist, der permanenten hintergründigen Angst vor einem „Wertverlust“ des Geldes dadurch, dass ihm das Vertraeuen entzogen wird. Bis auf ganz wenige noch zu benennende Ausnahmen war allen Religionen bis an die Schwelle der Neuzeit das unaufhebbare Spannungsverhältnis des auf Geldvermehrung fixierten Handelns zur traditionellen Moralordnung voll bewußt, seine Tendenz, letztere seinem eigenlogischen Kalkül zu unterwerfen und ihren inneren Gehalt auszuhöhlen, sein Charakter als ein „Moralzehrer“, wie sich der Ordoliberale Wilhelm Röpke einmal ausgedrückt hat. Von den vielfältigen literarischen Zeugnissen für diese Inkompatibilität sei hier nur auf die Volksmärchen und ihre literarisch anspruchsvolleren Abkömmlinge im 19. Jahrhundert hingewiesen, Das „Kalte Herz“ von Wilhelm Hauff etwa oder Adelbert von Chamissos „Peter Schlemihl“, die sie in eindringlicher Naivität bezeugen. Jedenfalls ist deshalb insbesondere die Zinsnahme in traditionalen Sozialordnungen immer strikt reguliert worden. Der Zins bezeichnet eine objektivierte und zugleich die reinste Form des Geldvermehrungsstrebens, im Zins scheint dem Geld eine geheimnisvolle Kraft zur Selbstvermehrung zuzuwachsen, die sich, wie schon erwähnt, besonders sinnfällig im griechischen Wort für Zins, tokos, das Gebären, auf den Begriff bringt. Jedenfalls entstand aus der Zinsnahme der reine Geldkapitalist als eine eigenständige Personifikation des Geldvermehrungsstrebens, eine soziale Figur, die sich gewissermaßen aus den Ketten des Warenhandelns herauskristalliert und sich den Produzenten und Händlern als Kreditgeber 13 übergeordnet hat. Die Zinsnahme stand unter traditionellen Verhältnissen immer im Ruch des Wuchers, weshalb das reine Geldhandelsgeschäft als eine moralisch höchst fragwürdige Angelegenheit galt. Daß die Juden von früh auf eine besonders enge Affinität zum reinen Geldhandel hatten, die aus der ausdrücklichen religiösen Erlaubnis der Zinsnahme von Glaubensfremden entsprang, hat unübertroffen Werner Sombart in seinem heutzutage kaum mehr bekannten Werk „Die Juden und das Wirtschaftsleben“ von 1911 untersucht. Aber als Geldkaptalisten und Fremde zogen sie einen Doppelverdacht von seiten der Einheimischen auf sich, ohne den die tradtionelle Judenfeindschaft unverstanden bleiben muß, der aber auch eine der Quellen für den modernen Antisemitismus war. Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“, der bis vor einigen Jahrzehnten fester Bestandteil jeder bürgerlichen Privatbibliothek war, zeigt das besonders deutlich. Die ungehemmte soziale Freigabe des Geldvermehrungsstrebens und insbesondere der Zinsnahme ist ein Signum der Moderne, die identisch ist mit der Entfaltung dessen, was Max Weber „Geist des Kapitalismus“ genannt hat. Dass an der Förderung dieses „Geistes“ bestimmte Formen des Protestantismus durch transzendentale Rechtfertigung des Gewinnstrebens und Tabuierung des Sinnengenusses Anteil hatten, soll nicht in Abrede gestellt werden. Man kann den gegenwärtig viel benutzten Topos von der „Herrschaft der Finanzmärkte“ verschieden auslegen, sollte dabei aber folgende Komponenten besonders betonen: Dass seit den 80iger Jahren des letzten Jahrhunderts das Geldkapital – das System aus Zentral- und Privatbanken und Börse – zu einer mittels der Computertechnologie immer dichter vernetzten globalen Institution geworden ist, mit einem über die Mechanismen der Staatsverschuldung massiv gewachsenen Einfluss auf die staatliche Politik und einer ebenfalls massiv gewachsenen Macht über die Unternehmen, bis in deren internes Kontrollsystem hinein. Der Übergang von der Lehre des Keynesianismus zum Monetarismus kann als Indiz für den Übergang vom klassischen Unternehmer- zum Finanzkapitalismus verstanden werden. Als weiterer Bestandteil des Topos darf der Hinweise auf die außerordentliche Ausdehnung des rein spekulativen Geschäfts im Banken- und Börsensystem nicht fehlen, die die Rede vom „Kasinokapitalismus“ anspricht; eine Ausdehnung, durch die die ganz kurzfristig spekulativ erworbene Rendite zu einem Leitmodell für das Gewinnprinzip überhaupt geworden ist. Es hat die Bedeutung des klassischen Unternehmergewinns, der eher auf Langfristkalkulation setzte, zurückgedrängt und auch unter den Normalbürgern einen signifikanten Wandel ökonomischer Mentalitäten bewirkt. Bis vor kurzem dominierte in den Wirtschaftswissenschaften ein Bild von den Finanzmärkten, das sich im Zuge ihrer rapiden 14 Expansion ab den 70iger Jahren - damals erfolgte eine vollständige Freigabe des Handels mit Finanzderivaten - als monetaristische Doktrin gebildet hatte: Dass die Finanzmärkte, gerade aufgrund ihrer Ferne zu den Beschwernissen der Produktion, als ideale Schauplätze der marktliberalen Vorstellungen über Preisbildungsmechanismen und perfekten Wettbewerb aufzufassen seien, ausgestattet mit rational-gewinnorientierten Akteuren; und dass sich in Crashs nur ein heilsamer Anpassungsmechanismus dokumentiere, der unerbittliche Gang ökonomischer Vernunft gewissermaßen. Dieses Bild ist freilich durch die vielen Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte, von denen die Wissenschaft keine prognostiziert hat und die nach ihren mathematisierten Wahrscheinlichkeitskalkülen überhaupt nicht hätten stattfinden dürfen, erheblich erschüttert worden und hat in der Öffentlichkeit, genährt durch publikumswirksame Publikationen von Insidern, zur Herausbildung eines tendenziell gegenteiligen geführt, in dem sie als Inbegriffe der Irrationalität erscheinen und ihre Akteure als Personifikation eines gierund angstgetriebenen Herdenverhaltens. Schauen wir kurz auf einige der wichtigsten Eigentümlichkeiten dieser Märkte. Den charakteristischsten Finanzderivaten, mit denen hier gehandelt wird, fehlt jede Verankerung in einem materiellen Wertsubstrat, ihre Preise beziehen sich nicht auf Güter, sondern selbst wieder auf Preise, ihre erwarteten zukünftigen nämlich, so daß die Preise die Waren selbst sind. So entsteht ein vollkommen selbstreferenzielles Marktgeschehen, dessen entscheidende Komponente die Zeit – die Zukunftserwartung – ist. Damit aber wird die Spekulation zu einem integralen Systemelement finanzökonomischer Transaktionen. Entscheidend wird in diesem System also sozusagen die Bändigung der Zeit, die Reduktion von Ungewißheit bezüglich der Zukunft: Nur wenn, so treffend Joseph Vogl, die Ungewissheit künftiger Preise mit den Preisen für die Ungewissheit dieser Preise verrechnet werden kann, kommt es zur erhofften selbsttragenden Stabilität im System. Komplizierte finanzmathematische Modelle, die der Computer leicht handhabbar macht und Praktiken der Risikoversicherung behaupteten diese Verrechnungsmöglichkeit, wodurch die Erfindung ständig neuer Derivate stimuliert und legitimiert wurde. Nun haben aber nicht nur die tumultösen Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit, sondern insbesondere auch die Pionierarbeiten des polnisch-französischen Mathematikers Benoit Mandelbrot auf dem Gebiet der mathematischen Auswertung von Preisbildungsmechanismen auf den Finanzmärkten erheblich die prinzipiellen Zweifel an dieser Verrechnungsmöglichkeit, diesem Bändigungsversuch von Ungewißheit genährt: Mandelbrot gelang der Nachweis, daß die Preisbildungsmechanismen im Zeitverlauf keineswegs dem wahrscheinlichkeitstheoretischen Modell der gaußschen Normalverteilung folgen, sondern sich in diskontinuierlichen Sprüngen vollziehen, in denen wenige große Abweichungen den 15 Effekt der gesamten Verteilungsstruktur bestimmen. Damit aber würden die konventionellen Gleichgewichtsmodelle der Finanzmathematik obsolet. Tatsächlich enthüllen schon wenige grundsätzliche Überlegungen die prinzipielle Differenz der Preisbildungsmechanismen auf den Finanzmärkten zu denjenigen auf den Warenmärkten. Da der Finanzmarkt als ein System von Antizipationen funktioniert, in dem die Erwartungen zukünftiger Preise Preisbildungen und Kaufentscheidungen bestimmen, hängt hier alles an den Prozessen kollektiver Erwartungsabstimmungen. Dabei kommt es mittels positiver Rückkoppelungsmechanismen und Trendverstärkungen zu konformistischen Meinungsangleichungen: Steigende Preise werden als Spiegel allgemeiner Wertschätzung begriffen und lösen weiter steigende Bewertungen aus, während fallende Preise die Antizipation weiter fallender Preise als gänzlich vernünftig erscheinen lassen. In den Worten Joseph Vogls: „Das ausgleichende Spiel von Angebot und Nachfrage ist verkehrt und liefert den paradoxen Augenschein, dass sich billige Kapitalwerte als teuer, teure aber als besonders günstig und gute Gelegenheit erweisen“. Erschütterungen der Rationalitätsannahmen über die Finanzmärkte werden aber nicht nur durch die Einsicht in derartige Mechanismen befördert, die eher das Bild des Herdenverhaltens nahelegen, sondern auch, wenn man die einzelnen Akteure in diesem System genauer in den Blick nimmt. Es hat in jüngster Zeit nicht nur vermehrt literarische Ausgestaltungen der Figur des Finanzspekulanten und Insiderschilderungen gegeben, sondern auch wissenschaftliche Erfassungsversuche des Phänomens. Der wesentliche Punkt aber läßt sich auch hier in wenigen Worten zusammenfassen. Da auf den Finanzmärkten nicht mit Gütern gehandelt wird, sondern über die Bildschirmrealität des Computers mit Erwartungen und Erwartungserwartungen bezüglich künftiger Preise, und weil über Gewinne und Verluste in extrem kurzfristigen Rhythmen entschieden wird, handeln die einzelnen Akteure in einem institutionellen und mentalen Umfeld, das Züge einer selbstbezüglichen Spielwelt trägt und über permanente Kicks und Thrills die Erwartungslust quasi endlos befeuert. Erwartungsgefühle werden stets aufs Neue und umso stärker stimuliert, je riskanter die Gewinnaussichten und je höher die Belohnungssummen sind, die ein Bonus- und Abfindungssystem mit „offenem Plünderungscharakter“, so Peter Sloterdijk, in Aussicht stellt. Tendenzen zur Risikoausweitung werden im Binnenklima des Systems nicht nur durch die Kontrollillusionen der Finanzmathematik gefördert, sondern vor allem durch die nach den Erfahrungen der jüngsten Finanzkrisen zur Quasi-Gewißheit geronnenen Erwartung, dass das politische System letztlich die Verantwortung für eigene Verantwortungslosigkeiten übernimmt: Das Risiko für das gesamtökonomische System wird also zur zentralen Waffe politischer Erpressung, durch die systemintern das entscheidende Motiv für marktliberale 16 Rationalität – die ökonomische Haftung für die Folgen eigener Entscheidungen – ausgehöhlt wird. In der „Herrschaft der Finanzmärkte“ in der Gegenwart hat das alte alchemistische Ziel, Geld aus Geld zu machen, einen historisch einmaligen Erfindungsreichtum und eine historisch einzigartige Macht entfaltet. Aber gerade die systemstabilisierenden Maßnahmen der Staaten, die diese Machtentfaltung ermöglichen und abstützen, bezeugen noch einmal auf paradoxe Weise den zutiefst zweideutigen Charakter des Geldes als eines endlos begehrten Objektes privater Akkumulation und eines öffentlichen, d.h. alle betreffenden und bewegenden Gutes. 17
