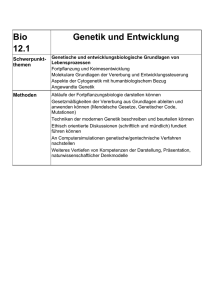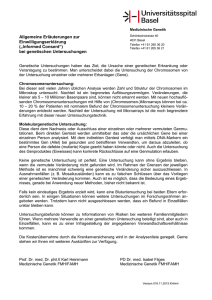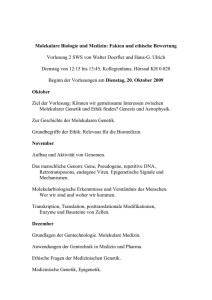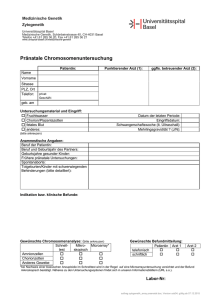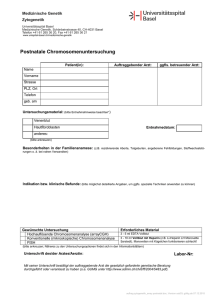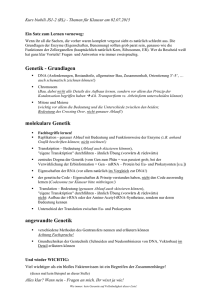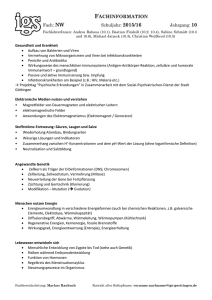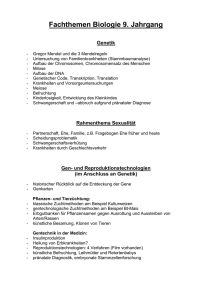PDF-Download - Zentrum für Medizinische Ethik (ZME)
Werbung

Zentrum für Medizinische Ethik MEDIZINETHISCHE MATERIALIEN Heft 171 Public Health Gen-Ethik Peter Dabrock, Peter Schröder August 2006 Autoren: Prof. Dr. theol. Peter Dabrock, M.A., Juniorprofessur für Sozialethik, Philipps-Universität Marburg, FB Ev. Theologie - Sozialethik/Bioethik, Lahntor 3, 35032 Marburg, [email protected], Tel 06421/28-22447, Fax 06421/28-22462, http://www.theologische-bioethik.de/ Dr. phil. Peter Schröder, Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (lögd), Westerfeldstraße 35-37, 33611 Bielefeld, Tel 0521/8007-261, Fax: 0521/8007-202, http://www.phgen.nrw.de/ Inhaltsverzeichnis 1. MEDIZINISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN DURCH GENETIK UND PUBLIC HEALTH GENETIK 1 2. ZUR NOTWENDIGKEIT EINER GESELLSCHAFTLICHEN DEBATTE ÜBER PUBLIC HEALTH GENETIK 4 3. ETHISCHE GRUNDPRINZIPIEN 5 4. PUBLIC HEALTH GENETIK UND SOZIALE GERECHTIGKEIT 24 5. SOZIALETHISCHE PERSPEKTIVEN AUF PUBLIC HEALTH GENETIK 30 6. PRIORISIERUNGSREGEL BEIM GRUNDKONFLIKT AUTONOMIERESPEKT VS. GEMEINWOHL(-PFLICHTIGKEIT) 7. AUSBLICK 33 36 Herausgeber: Prof. Dr. phil. Hans-Martin Sass Prof. Dr. med. Dr. phil. Jochen Vollmann Prof. Dr. med. Michael Zenz Zentrum für Medizinische Ethik Bochum, Ruhr-Universität Bochum, Gebäude GA 3/53,44780 Bochum, TEL (0234) 32-22749/50, FAX +49 234 3214-598 Email: [email protected] Internet: http://www.medizinethik-bochum.de Der Inhalt der veröffentlichten Beiträge deckt sich nicht immer mit der Auffassung des ZENTRUMS FÜR MEDIZINISCHE ETHIK BOCHUM. Er wird allein von den Autoren verantwortet. Das Copyright liegt beim Autor. © Peter Dabrock, Peter Schröder 1. Auflage August 2006 Schutzgebühr: € 6,00 Bankverbindung: Sparkasse Bochum Kto.-Nr. 133 189 035 BLZ: 430 500 00 ISBN:3-931993-52-3 PUBLIC HEALTH GEN-ETHIK Peter Dabrock, Peter Schröder 1. MEDIZINISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN DURCH GENETIK UND PUBLIC HEALTH GENETIK 1.1. Auf dem Weg zur molekularen Medizin Die Medizin entwickelt sich in rasantem Tempo von ihrer morphologischen und phänotypischen Orientierung hin zu einer molekularen und genotypischen Orientierung (vgl. WHO 2002; Paul 2004; Feuerstein, Kollek, Uhlemann 2002; Brand et al. 2004). Neben der Diagnose werden die Prognose und Prädiktion zu immer wichtigeren Aussagegrößen. Richtig ist zwar, dass die Forschung noch lange im Grundlagenbereich verharren wird, dass sie entgegen früheren linearen Erwartungen („ein Gen verursacht eine Krankheit“) auf hochkomplexe Krankheitsätiologien aufmerksam geworden ist (neben wenigen hochpenetranten monogenetischen Erkrankungen gibt es zahlreiche polygen und polymorph verursachte Krankheiten, wobei zudem unterschiedliche Umwelteinflüsse unterschiedlich wirken können. Daraus folgt, dass durch die Wahrnehmung solcher komplexer Krankheitsverursachungen Prognose und Prädiktion immer nur Wahrscheinlichkeitsgrößen sein werden. Dennoch werden nach derzeitiger Einschätzung diese Prädiktionen das Verständnis von Gesundheit und Krankheit und den individuellen wie sozialen Umgang mit diesen Lebensführungsphänomenen nachhaltig prägen und verändern. 1.2. Auf dem Weg zur Public Health Gen-Ethik Nicht nur auf der individuumsbezogenen Ebene, sondern auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Gesundheitsversorgung deuten sich – wenn auch noch sehr schemenhaft – präzisere, schnellere, wirksamere, nebenwirkungsärmere Präventions-, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Einzelne wie für bestimmte Patientenkollektive und bestimmten Umwelteinflüssen ausgesetzten Personen(-kreise) an (French, Moore 2003). Wahrscheinlich werden Menschen und Menschengruppen demnächst durch bestimmte Chip-Technologien Prognosewerte über Krankheitsanfälligkeiten erhalten. Sensible Daten können zum Zwecke von Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung in unterschiedlichsten Formen von Biobanken gespeichert werden. Präventionsempfehlungen an betroffene Individuen und Bevölkerungssubpopulation können mit den ermittelten, gespeicherten und ausgewerteten Daten einhergehen. Diese mögliche Integration genetischen Wissens in die Aufgaben von Public 1 Health, also in die öffentliche Sorge um die Gesundheit aller durch öffentliche oder öffentlich beauftragte Organisationen, nennt man Public Health Genetik. 1.3. Scheitern eindeutiger Handlungsstrategien aufgrund komplexer Risikokommunikation Die in anderen Technikfeldern bewährte Technikfolgenabschätzung (Bora 1999; Grunwald 2003) gerät dort, wo sie nicht nur an technischen, sondern auch an sozialen Folgen der Implementation von Genetik in Klinik und Gesundheitsversorgung interessiert ist, auf dünnen Boden. Denn das Verständnis von Risikokommunikation (vgl. Luhmann 1991; Japp 2000) wird in Zeit-, Sach- und Sozialdimension gleich massiv herausgefordert. So ist noch spekulativ, wann es zu nachhaltigen medizinischen und Gesundheitsversorgungseffekten durch Genetik kommt, so ist noch nicht sachlich und pragmatisch geklärt, wie weit genetische Grundlagenforschung in die medizinische Genetik umgesetzt wird und wie man von humangenetischer Diagnostik zur prädiktiven Genetik und von dort zu individuums- bzw. kollektivbezogenen Handlungsstrategien kommt. Schließlich sind auf der sozialen Ebene die Risiken der Kommunikation zwischen Experten und Laien zu berücksichtigen. Vermittlung, Einsicht und Legitimität können derzeit (nur) aufgrund von Wahrscheinlichkeiten getroffen werden – ob Befürworter oder Gegner dieser Entwicklung, niemand hat eine Alternative. In moraltheoretischer Tradition ist nur dort die vorsichtigere Alternative zu wählen (Tutiorismus), wo hohe Güter auf dem Spiel stehen, die nicht durch Missbrauchseindämmung geschützt werden können. 1.4. Ängste und Befürchtungen gegenüber der molekularen Medizin Aufgrund der komplexen Risikostruktur genetischer Informationen trifft diese insbesondere in Deutschland vor dem Hintergrund der hiesigen Geschichte auf geballte Zurückhaltung, Angst und Skepsis. So wird von nicht wenigen befürchtet, dass die zum Großteil keineswegs Sicherheiten, sondern nur Wahrscheinlichkeiten kommunizierende prädiktive Medizin zur Gefährdung der Privatsphäre, zu Stigmatisierungen und Diskriminierungen auf unterschiedlichsten Ebenen, in unterschiedlichsten Szenarien und gegenüber unterschiedlichsten Gruppen führen kann. Befürchtungen betreffen Arbeits- und Versicherungsverhältnisse wie die Reproduktion, die immer mehr von vermeintlichen „Perfektionsansprüchen“ geleitet werden könnte, wiewohl die überwältigende Zahl von Erkrankungen nicht unmittelbar nur genetisch, sondern immer auch und überwiegend durch Umwelt- und Verhaltenseinflüsse bedingt ist. Aufgrund dieses prädiktiven Drucks sehen manche in der „Genetisierung“ der Gesell2 schaft eine neue, besonders perfide Form von biopolitischer Sozialdisziplinierung nicht nur des Körpers, sondern auch unserer individuellen Lebensweisen wie unseres sozialen Miteinanders auf die Gesellschaft zukommen.1 Andere sehen in einem nach ihrer Auffassung obsoleten genetischen Determinismus eine Hemmschwelle für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz möglicherweise zukünftiger Entwicklungen, die zu Überregulation führen und so medizinischen, ökonomischen und Public Health-Fortschritt gefährden. 1.5. Spezifische Konfliktfelder von Public Health Genetik Neben den vielfach diskutierten, vornehmlich individuumsbezogenen Problemaspekten (vgl. 3.5) künftiger angewandter Genetik (Schutz der Privatsphäre, Vertraulichkeit, informed consent, Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung) transportiert Public Health Genetik weitere spezifische gesellschaftliche Herausforderungen, die alle um den möglichen Konflikt zwischen individuumsbezogenem Autonomierespekt und gesellschaftlichen Gesamtnutzen oder Gemeinwohl gruppiert sind. Im Einzelnen gehören (Michigan Center for Genomics & Public Health o.J.) zu den Konfliktfeldern die folgenden: der spezifisch populationsbezogene Fokus gegenüber dem individualisierenden der traditionellen humangentischen Medizin, der mögliche Vorrang eines kollektiven Wohlfahrtsgedankens gegenüber der individuellen Autonomie, die mögliche Diskriminierung von Populationen, eine drohende Ausweitung gesundheitlicher Ungleichheiten, der Streit um Verteilungsgerechtigkeit, die mögliche Begrenzung des Prinzips der informierten Zustimmung, der Streit um die Güter „individueller Schutz der Privatsphäre“ vs. „Gruppenrechte“, neue strategische Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung, die Beachtung von kulturellen und rechtlichen Besonderheiten, wenn bestimmte Gruppen untersucht werden, die Entwicklung von Kriterien öffentlicher Debatten, eine Ethik unterschiedlicher Präventionsstrategien, das Abwägen der sozialen Vor- und Nachteile von Public Health Genetik, die Bewahrung der Umwelt, das Verhältnis von Zwang und Freiwilligkeit und der Gegensatz von genotypischer vs. phänotypischer Prävention. 1 Insofern diese meistens von Foucault beeinflussten Sozialtheorien die gesamte Moderne unter solchen machtorientierten Diskurspraktiken sehen und im Grunde nie einen konstruktiven Ausweg formulieren (Lemke 2000; Lösch 2001; Gehring 2006), nehmen sie bisweilen den Gestus einer geschlossenen Theorie ein. Positiv gewendet: so richtig es ist, auf implizite Machtmuster in Diskurspraktiken zu achten, so sehr muss man sich bewusst sein, dass es nicht um die Verhinderung, sondern nur um die Kultivierung von Macht bspw. durch Transparenz, Zeit- und Kompetenzbeschränkung etc. gehen kann; meistens stellen die protestkommunikativen Kritiker von Biotechnologie und -politik jedoch nur ihre Kritik am vermeintlichen biopolitischen Syndrom vor, ohne darauf aufmerksam zu machen, dass auch ihre Position nicht machtfrei und diskursiv disziplinierend daher kommt. 3 2. ZUR NOTWENDIGKEIT EINER GESELLSCHAFTLICHEN DEBATTE ÜBER PUBLIC HEALTH GENETIK 2.1. „Man kann nicht nicht antworten“ Will man nicht einem kulturpessimistischen oder technikfeindlichen Fatalismus folgen, der aufgrund seiner Protest- und Verweigerungshaltung meistens nur denen in die Hand spielt, die möglichst weit ihre ökonomischen Interessen durchsetzen wollen2, dann muss der soziale Umgang mit individuumsbezogener wie Public Health bezogener Genetik in der Gesellschaft eingeübt und gestaltet werden. Dazu wird man zuvörderst fragen müssen, welche Vorstellungen von gutem und gerechtem Leben auch in Zukunft prägend sein sollen. Gesellschaftliche Debatten sind von Nöten, in denen im Vollzug deutlich wird, dass eine verantwortliche Zukunftsorientierung einen kritischen Blick zurück voraussetzt. Auf diese Weise kann aus den Quellen des Selbst und der Kulturen geschöpft werden, indem aus in ähnlichen Kontexten begangenen Fehlern gelernt wird und bewährte Muster aufgegriffen werden, um den kommenden Herausforderungen nicht haltlos gegenüber zu stehen. Allerdings geht in der Regel ein solches Sich-Einlassen auf neue Situationen auch einher mit dem Eingeständnis, dass Bewährtes durch neue Ansprüche seinerseits verändert wird, dass Gefundenes von daher neu erfunden werden muss. Schmerzhafte Prozesse von Verlust lassen sich selbst beim Rückgriff auf Bewährtes kaum vermeiden. Die in Deutschland nicht nur, aber auch aufgrund geschichtlicher Erfahrung besonders ausgeprägte Skepsis gegenüber den Entwicklungen der molekularen Medizin mag sich u.a. eben auch aus dieser Verlustangst heraus erklären. Angesichts der Reserve gegenüber den Risiken des molekulargenetischen Fortschritts (vgl. 1.3-1.5) muss man sich aber ebenso Rechenschaft darüber ablegen, dass nicht nur Handlungen, sondern auch Unterlassungen verantwortet werden müssen. Neue Herausforderungen können nicht nicht beantwortet werden. Auch die Unterlassung ist eine Antwort auf Herausforderung. Nun scheint es intuitiv so, dass Unterlassungsgebote weniger dramatisch wirken als Handlungsverbote. Schließlich hat die Forschung bisher kaum Anwendungen auf der klinischen oder Public Health-Ebene aufweisen können. Aus diesem Umstand kann man leicht ein Argument gegen die ohne Zweifel kostenintensive Grundlagenforschung zimmern und bei prognostizierten Risiken daraus gemäß dem Grundsatz, im Zweifel die sichere Variante zu wählen, ein Unterlassungsgebot folgern. Solch eine Reserve gegenüber der Forschung stellt zunächst ein Einstellungsmuster dar, das sich in Deutschland kulturell verdichtet findet. Diesseits berechtigter ethischer Reser2 Dieses Ziel ist im Übrigen nur dann unanständig, wenn elementare Güter anderer verletzt werden. 4 ven ist allerdings zu beachten, dass es nun einmal ein Grundprinzip echter Grundlagenforschung darstellt, dass das Ergebnis noch nicht im Vorhinein feststeht. Wenn mittel- und langfristige Prognosen erfolgreiche Entwicklungen, die nach heutiger Einschätzung zwar ethisch bedenklich, aber nicht völlig verwerflich sind, als nicht völlig utopisch erscheinen lassen, gilt es zudem ehrlich und selbstkritisch im Gedankenexperiment zu fragen, ob man diese Errungenschaften auch im Falle ihres Nutzens noch ablehnen würde. Die Medizinethik sieht in solchem potentiellem moralischen Trittbrettfahrertum zu Recht ein ethisches Problem und diskutiert es unter dem Stichwort der Komplizenschaft (vgl. Kissell 1999). 2.2. Befähigung als notwendige Bedingung der gesellschaftlichen Debatte um Public Health Genetik Gerade weil die Forschung noch nicht anwendungsfähige Ergebnisse bereitstellt, kann die Gelegenheit genutzt werden, in aller Ruhe eine öffentliche Debatte über sachliche, soziale und zeitliche Chancen und Risiken der Gentechnik zu führen. Selten ergab sich in der neueren Technikgeschichte eine derartige Gelegenheit, technische Entwicklungen bereits so frühzeitig in ihrem Wohl und Wehe zu diskutieren und zu bewerten. So sehr Emotionen dabei eine Rolle spielen dürfen, so wenig dürfen sie die Debatte vorrangig prägen. Deshalb muss Wert darauf gelegt werden, dass diese Diskussionen durch Bildung und Förderung auf unterschiedlichsten Ebenen intensiv vorbereitet werden. Man mag an der Effizienz solcher öffentlicher Diskurse zweifeln. Ihr prognostiziertes Ergebnis erscheint ferner unter Berücksichtigung vorhandener Erhebungen empirischer Sozialforschung durchaus offen. Dass durch die verschiedenen Formen öffentlicher Debatten überhaupt eine Öffentlichkeit entsteht, und sei sie unvermeidlich medial vermittelt und unter solchen Bedingungen immer vielfältigen Interessen und Beeinflussungen ausgesetzt, ist ein gesellschaftlicher Wert in sich. Deshalb erscheint nicht ein bestimmtes Ergebnis sozialethisch geboten, sehr wohl aber eine öffentlich geförderte oder gewährte Bereitstellung von Foren, die solche Debatten wirklich und nicht nur formal ermöglichen. Durchaus kontroverse Meinungsbildung erweist sich nämlich als öffentliches Gut einer zivilgesellschaftlich gebundenen, rechtsstaatlichen Demokratie. 3. ETHISCHE GRUNDPRINZIPIEN Weil Public Health Genetik eine öffentliche Aufgabe des freiheitlich demokratischen Rechtsstaats darstellt, dessen Grundlagen nicht suspendiert werden dürfen und sollen, muss die ethische Reflexion mit den allgemeinen ethischen und rechtlichen Normierungen öffentli5 chen Zusammenlebens beginnen. Dabei decken sich manche mit den aus der individuumsbezogenen Humangenetik bekannten Problemen, anderen mit den normativen Implikaten aus den allgemeinen Verfahrensregeln von Screeningverfahren; darüber hinaus ergeben sich spezifische normativ-ethische Herausforderungen aus dem geschilderten Aufgabenprofil von Public Health Genetik. 3.1. Menschenwürde In bioethischen Debatten wird die Menschenwürde zunehmend als ethische und rechtliche Zentralkategorie eingeschätzt (Deutscher Bundestag 2002). Dies gilt seit langem in Deutschland so, wird aber zunehmend als ein europäisches Spezifikum gegenüber dem amerikanischen Bioethikdiskurs betrachtet (Häyry 2003). Aber auch dort gewinnt die Konzeption zusehends an Bedeutung (The Report of the President’s Council 2002). Gerade ihr zunehmender Gebrauch in Fragen des Lebensanfangs (Gebrauch von Embryonen zu Forschungszwecken, Schwangerschaftsabbruch) und des Lebensendes (Hirntodkriterium und Sterbehilfe) verdeutlicht jedoch die begrenzte Wirkung der Menschenwürde-Konzeption. So wird die relativ unstrittige Frage danach, was Menschenwürde meint, in der Bioethik zunehmend verdrängt durch die überaus strittige Vorfrage, wem Menschenwürde zukommt. Mit den neurologischen, reproduktionsmedizinischen und gentechnischen Möglichkeiten verschwimmen nämlich die traditionellen, exakten Extensionsangaben für das Menschenwürde-Konzept. In Frageform formuliert: Ist ein Hirntoter ein Toter oder ein Sterbender, kommt ihm Menschenwürde zu? Wäre dann nicht aber zumindest bei der Organtransplantation, die derzeit ja noch vom Hirntodkriterium abhängt, die erweiterte Zustimmungslösung, ganz zu schweigen von der Informations- oder der Widerspruchslösung, eine Würde-Verletzung und damit ethisch abzulehnen? Will man aber diese Konsequenz ziehen? Oder man stelle die Kardinalfrage zum Lebensbeginn: Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Gibt es einen so offensichtlichen Einschnitt, dass man – in der einprägsamen Formulierung von Robert Spaemann, der diesen Einschnitt bekanntermaßen kategorisch ablehnt – einen Übergang von einem Etwas zu einem Jemand konstatieren könnte (Spaemann 1996)? Sind Embryonen Würde-Träger oder nicht? Ab wann jedoch wären sie es, wenn sie es nicht von Anfang an wären? Aber was ist der Anfang? In Fragen von Public Health Genetik ist dem in der Regel nicht so. Auf diesem Feld der Integration genetischen Wissens in Public Health-Ziele kann auf die ursprüngliche, wenig umstrittene verfassungsrechtliche und fundamentalethische Intension von Menschenwürde zurückgegriffen werden. In diesen Perspektiven versteht man unter Menschenwürde das, was 6 die Menschen einander keineswegs verletzten dürfen, anders formuliert, was jedem, und zwar jedem einzelnen Menschen in seinen Sein und Mitsein wesentlich ist, was ihm unbedingt, unverlierbar, unauslöschlich, unantastbar zu gelten hat (Dabrock et al. 2004; Geier, Schröder 2003). Trotz unterschiedlicher religiöser, theologischer, philosophischer oder weltanschaulicher Begründung kann man dann mit hohem Geltungsanspruch behaupten, dass es die Würde eines Menschen verletzt, wenn wir ihn oder sie demütigen, ihn oder sie verzwecklichen, ihn wie eine Sache behandeln und ihn oder sie als jemand misshandeln. In dieser nach Günter Dürig als „Objekt-Formel“ bezeichneten Definition wird der Sinn der Menschenwürde erstrangig ex negativo, abwehrrechtlich bestimmt. Auf diese Weise entfaltet sie auch vordringlich ihre normative Kraft im Bereich Public Health Genetik. Konkret heißt dies, dass aus der jedem Menschen zukommenden Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und dem daraus abgeleiteten allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG iVm Art. 1 Abs. 1 GG) jedem Menschen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zugesprochen wird (Bundesärztekammer 2003). Das schließt das Recht auf Wissen ebenso ein wie das Recht auf Nichtwissen. Im Zeitalter des molekulargenetischen Wissens ergeben sich aus diesem formalen Recht jedoch spezifische ethische Konflikte und Kollisionen (Schröder 2004). Wenn das in Deutschland (noch) nicht in Kraft getretene Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin des Europarates in Art. 11 jede Form von Diskriminierung einer Person aufgrund ihres genetisches Erbes verbietet und zudem in Art. 12 prädiktive genetische Tests nur zu Gesundheitszwecken und für gesundheitsbezogene Forschung erlaubt, dann werden hier ebenfalls auch ohne explizite Nennung des Würde-Axioms die Grundwerte des Instrumentalisierungs- und Demütigungsverbot verteidigt. Allerdings liegt auch hier der Konflikt erst in der konkreten Identifikation der Situationen und Kriterien, wann Gesundheitszwecke erfüllt sind oder wann Forschung gesundheitsbezogen ist. Ob im Sinne eines signifikanten gesellschaftlichen Gesamtnutzens Tests oder Forschung in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Einzelnen auch nur in engsten Grenzen eingreifen dürfen, wird seit längerem in Deutschland am Beispiel der fremdnützigen Forschung an Nichteinwilligen hochkontrovers diskutiert und immer wieder mit Hinweis auf die NS-Vergangenheit mehrheitlich abgelehnt. Sollte dieser moralische Heroismus zum nachhaltigen Schaden der Betroffenen selbst führen, wird man auch diese Unterlassungen verantworten müssen. So wird wie so häufig im Bereich der Bioethik deutlich, dass ihr eine gewisse kritische Selbstaufklärung über ihre eigenen Kommunikationen gut täte. Deshalb folgen wenige Grundsatzüberlegungen über Leitunterscheidungen angewandter Ethiken, die für Normierungen und Bewertungen von Public Health Genetik relevant erscheinen. 7 3.2. Die sozialethische und zivilgesellschaftliche Grundunterscheidung zwischen Rechtem und Gutem Ob bestimmte Techniken oder Verfahren sozial verantwortet werden können, hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab. Dies gilt auch für die ethische Einschätzung der möglichen Integration von Genetik in Public Health. Auf der rechtlichen und ethischen Grundlage des Menschenwürde-Axioms und neben den noch näher darzulegenden allgemeinen und spezifischen Health Technology Assessment-Kriterien sind spezielle Kriterien angewandter Ethik zu beachten. In der pluralistischen und funktional ausdifferenzierten Gesellschaft kann man nicht davon ausgehen, dass ein allgemeiner breiter Konsens in Fragen nach Zielen und Präferenzen individueller und kollektiver Lebensführungen herrscht. Weil aber das Zusammenleben dennoch die gemeinsame Anerkennung elementarer Werte und Regeln voraussetzt, hat sich in der politischen Philosophie die Unterscheidung zwischen Rechtem und Gutem etabliert (Rawls 1975; Forst 1994; Mack 2002; Gosepath 2004). (Juristische und ethische) Normen des Rechten bringen zum Ausdruck, was sich Menschen mehr oder minder notwendig schulden bzw. zugestehen müssen, wollen sie auch ohne gemeinsame Ziele friedlich nebeneinander leben. Ihre Anerkennung ist daher sowohl dem Würde-Axiom wie dem Stabilitätsgrundsatz einer Gesellschaft verpflichtet. Über das moralisch Gerechte hinaus kann das juristisch Rechte die zu einer Zeit gültigen Normen mit Zwang einklagen. Vorstellungen des Guten dagegen formulieren Werte und Ziele von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen. Akzeptiert man diese in der Geschichte des liberalen, demokratischen Rechtsstaates halbwegs bewährte Grundunterscheidung, dann lassen sich für die Bewertung sozialethischer Konfliktfälle, zu denen auch die Abwägung der Chancen und Risiken von Public Health Genetik zählt, verschiedene Regeln ableiten: • Im Konfliktfall unterschiedlicher Auffassungen gibt es einen Vorrang des Rechten vor dem Guten. • Freiheit gilt so lange wie sie die Freiheit des / der Anderen nicht gefährdet. • Gegenüber Ansprüchen partikularer Gemeinschaftsgüter, die nicht allgemein verbindlich sind, ist zunächst die negative Freiheit jedes Einzelnen zu schützen. • Gebote und Verbote sind rechtfertigungspflichtig, sofern sie nicht unmittelbar einsichtig freiheitsgefährdende Handlungen verhindern sollen. • Wegen des Vorranges der negativen Freiheit besitzen Unterlassungsgebote einen Vorrang vor zum aktiven Handeln auffordernden Handlungsgeboten. 8 • Missbrauchseinschränkung im Einzelfall ist einem allgemeinen Verbot vorzuziehen. • Rechtfertigungspflichtig ist seit der Neuzeit bewährterweise nicht das rechtmäßig erworbene Eigentum, sondern die damit keineswegs ausgeschlossene Redistribution zum Zwecke der Wohlfahrtssteigerung der Gemeinschaft oder einzelner Mitglieder der Gemeinschaft. Sozialtheoretisch bedarf diese Grundunterscheidung zwischen Rechtem und Gutem mit den daraus abgeleiteten Regeln jedoch einer ergänzenden Betrachtung (Mack 2002): Auch wenn Rechtes und Gutes unterschieden werden müssen, so lassen sie sich nicht messerscharf trennen. Was in der einen gesellschaftlichen Formation bereits als Gutes angenommen wird, wird in anderen noch unter das Gerechte gefasst. Staatsziele oder Begriffe wie Solidarität, Nachhaltigkeit oder angemessene Grundversorgung verdeutlichen, dass es zwischen dem unbedingt Einklagbaren einerseits und nur wertbasierten Zielen und Bindungen andererseits Zwischenstufen gibt. Entsprechend kennt die politische Theorie solche Verpflichtungen, die jedoch eine Wertdimension beinhalten. Man spricht von einer „schwachen Theorie des Guten“, von Grundgütern oder Konditionalgütern. Martha Nussbaum zählt dazu (keineswegs mit dem Anspruch, eine erschöpfende Liste zu präsentieren) die Fähigkeiten, nicht frühzeitig sterben zu müssen, sich guter Gesundheit zu erfreuen, die Vermeidung unnötigen Schmerzes, die Nutzung der eigenen Sinne und Gedanken, Bindungen einzugehen, Vorstellungen des Guten zu entwickeln, soziale und umweltbezogene Beziehungen einzugehen, zu lachen, zu spielen, Freude zu empfinden, selbstbestimmt zu leben (Nussbaum 1999; Nussbaum 2006). Für das zivilgesellschaftliche Leben ist diese Einsicht in die Grauzone zwischen Rechtem und Gutem deshalb von enormer Bedeutung, weil sie einen gestaltungsnotwendigen wie gestaltungsfähigen Spielraum lässt. Über ihn werden in der Gesellschaft Deliberationen geführt mit dem Ziel der Einigung oder zumindest Prüfung, welche gesellschaftlichen Grundwerte als verbindlich anzusehen sind. In solchen Diskursen wird bspw. von kontroversen Ausgangspunkten darüber nachgedacht, welcher Umgang mit Behinderung und Behinderten, mit sozial Schwächeren, mit Geschlechterrollen oder mit Familienbildern die gegenwärtige oder die zukünftige Gesellschaft prägen soll. Findet sich ein halbwegs robuster Konsens, ist ein intensives Bemühen um entsprechende Umsetzungsstrategien zu seiner Implementierung angeraten, weil das dahinter stehende Ziel mehrheitlich gewollt ist. 9 3.3. Zur Anwendung der Grundunterscheidung im Blick auf Public Health Genetik Die allgemeinen Überlegungen zum Verhältnis von Rechtem und Gutem erhalten im Bereich von Public Health Genetik eine unverkennbare soziale Sprengkraft. Auf der einen Seite werden im Bereich privatwirtschaftlicher Unternehmungen zahlreiche z.T. nicht valide oder wenig aussagekräftige Verfahren (z.B. Gentests) solange zugelassen oder zumindest im globalen Kontext nicht verhindert werden können, wie ihnen nicht grobe Fahrlässigkeit, unlauterer Wettbewerb oder Sittenwidrigkeit nachgewiesen werden kann. Durch entsprechende Marketingkampagnen werden Menschen beeinflusst, möglicherweise werden sie verunsichert oder ihnen wird – was noch fataler ist – falsche Sicherheit vermittelt. Solange aber diese vermeintlichen Informationen nicht gegen die angesprochenen rechtlichen und sittlichen Minimalbedingungen verstoßen, ist jede einengende Regelung des freien Marktes in der Beweislast. Auf der anderen Seite, die hier vornehmlich interessiert, müssen öffentlich verantwortete und empfohlene genmedizinische Maßnahmen sehr wohl auf ihre Performabilität, soziale Akzeptanz und ethische und rechtliche Richtigkeit befragt werden können. Insofern die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage auf dem freien Markt ihrerseits Einfluss auf die möglicherweise überzogenen Erwartungen der Bürger an öffentliche Gesundheitsversorgungen haben werden, kommt der öffentlich geförderten Gesundheitsmündigkeit (health literacy) im Umgang mit genetischer Information eine enorme Bedeutung zu (Sass 2003; Sass 2006). Gerade angesichts der noch so unsicheren, schwer prognostizierbaren Entwicklungen besteht durchaus ein ethisch gebotener, öffentlicher Bildungsauftrag von Public Health Genetik darin, die Bürger zur eigenverantwortlichen Entscheidung überhaupt erst zu befähigen. Über das Gut öffentlicher Debatten hinaus (vgl. 2.3) geht es bei der Befähigung in diesem Fall darum, eine gerechte Bedingung zur Verfolgung eigener Vorstellungen von Gutem bereitzustellen. Daher mag auf der Schwelle von Rechtem und Gutem in solchen, von unterschiedlichen Vorstellungen des Guten geprägten Debatten darüber kontrovers debattiert werden, • ob durch Public Health Genetik das Verständnis der Gesellschaft von Solidarität, Freiheit und Gleichheit im Umgang mit Gesundheit und Krankheit verändert wird, • ob durch die Berücksichtigung eines genetischen Risikobegriffs das Verhältnis von Solidarität und Eigenverantwortung in der Sozialpolitik neu bestimmt werden muss, • ob wir uns von daher immer mehr zu einer Gesellschaft ungleicher Risikogruppen entwickeln und wie diese neue mögliche Ungleichheit operationalisiert werden soll. In jedem Fall ist bei geplanten rechtlichen Regulierungen der Vorrang des Rechten vor dem Guten zu berücksichtigen. Zugleich darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass das 10 Rechte in ethischer Perspektive nur dann das Gerechte bleibt, wenn es den Bürgerinnen und Bürgern (und nicht nur einflussreichen Lobbygruppen) die Möglichkeit bietet, auf die jeweilige kulturelle Gestaltung des Rechten Einfluss zu nehmen. Diese Einflussnahme setzt ihrerseits die Möglichkeit der Informationsgewinnung wie Kommunikationsbefähigung voraus. 3.4. Mittlere Axiome Auf der rechtsstaatlichen Schwelle von Rechtem und Gutem benötigt man auf der Suche nach einem gesellschaftlichen overlapping consensus kriteriale Mindestbedingungen. Neben der Menschenwürde-Konzeption und der formalen Grundunterscheidung von Rechtem und Guten dienen dabei vor allem die sogenannten Mittleren Prinzipien. Sie artikulieren Standards der Bestimmung des Gerechten, das bei unterschiedlichen Vorstellungen des Guten vorausgesetzt werden muss, wenn man gesellschaftlich bioethische Konfliktfelder zu gestalten sucht. Entsprechend hat auch eine Ethik für Public Health Genetik sie zu berücksichtigen. Bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts gab es kaum methodologische Bemühungen zu ergründen, was (bio-)medizinische Ethik oder Ethik des Gesundheitswesens sein oder wie sie betrieben werden sollte. Ethische Kodizes wurden innerhalb der medizinischen und pflegerischen Professionen erstellt. Generaliter ging es darum, die Gesundheit des Patienten zu fördern und gesundheitlichen Schaden zu minimieren. Durch publik gewordene moralische Vergehen in der medizinischen Forschung (z.B. die Tuskeegee Syphilis Studie, ganz zu schweigen von den Verbrechen nationalsozialistischer „Forscher“ im Dritten Reich) wachgerüttelt, begann eine explizite systematische Auseinandersetzung mit ethischen Grundlagen für Medizin und biomedizinische Forschung. Eine zentrale interdisziplinäre Kommission, die 1974 gebildet wurde, um der gesteigerten Nachfrage nach ethischer Leitung zu entsprechen, war die US-amerikanische National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. In dieser Kommission kristallisierte sich der Wunsch heraus, eine allgemeinverständliche gemeinsame Sprache für Ethik der medizinischen Forschung zu finden. In Prinzipien fand man Vokabular, das dieser Anforderung gerecht werden kann. Der bei der Erstellung des Abschlussberichts – der später als The Belmont Report bekannt wurde – federführende Philosoph dieser Kommission war Tom Beauchamp. Beauchamps Arbeit für die Kommission verlief parallel zu seiner universitären Zusammenarbeit mit James Childress. Als Ergebnisse wurden kurz hintereinander der Belmont Report (1978) mit den Prinzipien „respect for persons“, „beneficence“ und „justice“ und die erste Auflage des von Beauchamp und Childress geschriebenen Buchs Principles of Biomedical Ethics 11 (1979) veröffentlicht. In diesem Buch wird „respect for persons“ zuerst als „autonomy“ und später als „respect for autonomy“ interpretiert und als zusätzliches Prinzip zu „beneficence“ und „justice“ noch „nonmaleficence“ geführt. Principles of Biomedical Ethics liegt derweil in der fünften Auflage vor (Beauchamp, Childress 2001) und gehört zu den einflussreichsten bioethischen Werken, das neben seiner akademischen Wirkung auch als praktisches Lehrbuch explizite Anwendung und Zuspruch erfährt. Die in diesem Buch zuerst so explizierten Prinzipien prägen seitdem bioethische Diskurse und dienen auch als Instrumentarium in Bewertungen von Public Health und Public Health Genetik relevanten Berichten (Droste, Gerhardus, Kollek 2003). Häufig wird der Ansatz allerdings auch auf die Nennung der vier Prinzipien reduziert. An diesen Aspekt knüpft Kritik an, mit der sich auseinandersetzen muss, wer politikberatende Berichte, die sich auf mittlere Prinzipien stützen, verfasst. Bernard Gert, K. Danner Clouser und Charles Culver bemängeln beispielsweise eine in der Praxis häufig beobachtete dogmatische Akzeptanz und unreflektierte Anwendung der vier Prinzipien. Ihnen erscheinen Beauchamp und Childress’ Prinzipien lediglich wie Checklisten, unfundierte Faustregeln oder sogar nur Erinnerungshilfen, da ihrem Ansatz keine umfassende ethische Theorie zugrunde liegt (Gert, Culver, Clouser 1997). Prinzipiismus („principlism“) ist ein Ansatz, definieren Gert et al., der Prinzipien in den Mittelpunkt stellt, ohne eine Theorie vorzuweisen, aus der diese abgeleitet werden. Hier wird einem Anthologie Syndrom stattgegeben, in dem die Prinzipien unverbunden nebeneinander stehen, wodurch moralisches Denken undeutlich dargestellt und die Anwendbarkeit von Prinzipien unmöglich wird. Beauchamp und Childress argumentieren, dass man bioethische Prinzipien nicht allein aus einer Theorie generieren kann. Für sie ist es eindeutig, dass eine prinzipielle Übereinstimmung über ethische Normen auf der Generalisierungsstufe von Prinzipien geschehen kann, unbesehen möglicher Hintergrundtheorien, die ohnehin erst nachträglich von den Theoretikern konstruiert werden, um ihre moralische, prinzipielle Überzeugung zu rekonstruieren. Dass sich Menschen auf Prinzipien einigen können, postulieren Beauchamp und Childress, ist aufgrund der Normen der „common morality“ möglich, die man sich wie eine „initial shared data base” aller Menschen vorstellen muss. Letztlich ist es auch für den Bereich der „public policies“ – und so auch für das konkrete Anliegen, moralische Eckpunkte für die Implementierung von Genetik in die Zielvorstellungen von Public Health festzusetzen – nur notwendig, dass man eine Übereinstimmung über Prinzipien hat und nicht über die Hintergrundtheorien. Insofern ist für Beauchamp und Childress diese mittlere Axiomatik für die Anwendung durchaus ausreichend und eine vielversprechende Ausgangsbasis, die zudem eine weltanschauliche Offenheit in Bezug auf ethische Begründungen respektiert. 12 Dass Beauchamp und Childress Prinzipien fokussieren, liegt also an ihrer Überzeugung, dass Prinzipien auf einem abstrakten Niveau die generellsten und umfassendsten moralischen Normen darstellen. Prinzipien sind für Beauchamp und Childress prima facie gültig. Das bedeutet, dass sie nicht absolut gelten, sondern abgewogen werden können. Wenn aber kein gewichtiger Grund dagegen spricht, gelten sie. Mit dieser moralpragmatischen Regel wird natürlich keine moraltheoretische Begründung geliefert, aber in heuristischer und genealogischer Perspektive die Beweislastigkeitsfrage moralischer Bewertung, aber auch die Frage nach der semantischen Füllung der jeweiligen mittleren Prinzipien gestellt. Ihre Prinzipiengruppe stellt einen Rahmen dar, innerhalb dessen man moralische Probleme identifizieren und über diese reflektieren kann. Dieser Rahmen aus prima facie Prinzipien ist inhaltlich noch nicht besonders gehaltvoll. Diese Prinzipien sind noch „dünn“ und an sich nicht fähig, die moralisch relevanten partikularen Nuancen konkreter Umstände kontextsensibel zu adressieren. Es können zwei Strategien angewandt werden, um Prinzipien stärker oder „dicker“ zu machen: „balancing“ und „specification“. „Specification“ bedeutet, den Geltungsbereich der jeweiligen Norm zu verfeinern. Und „balancing“ meint eine Gewichtung der Normen. Im „balancing“ werden die Normen, die nur ein relatives Gewicht haben, gegeneinander abgewogen. Diese Konfliktlösungsstrategie ist besonders zentral für die Erörterung von Einzelfällen. Spezifikation sehen Beauchamp und Childress hingegen als besser geeignet für die Entwicklung von politischen Handlungsstrategien, weil hier aus den abstrakteren Normen – also beispielsweise den vier Prinzipien – Regeln konkretisiert werden. Die Spezifikation muss so geschehen, dass sie mit den anderen Normen noch kohärent ist. Hierbei werden möglicherweise konfligierende Normen so lange ausdifferenziert, bis der konkrete Konflikt gelöst ist. In einzelnen Fällen würde also ein spezifiziertes Prinzip in seiner Ausformulierung die anderen Prinzipien mit berücksichtigen – beispielsweise indem diese das Prinzip flankieren oder „in check“ halten. Die Spezifikation von Prinzipien ist nach Ansicht von Beauchamp und Childress besonders geeignet, um Leitlinien zu erstellen, weil hier generelle Normen für konkrete Konfliktfelder ausdifferenziert werden. Von europäischen Kritikern wird angemerkt, dass andere Prinzipien, die besonders in Europa gewachsen sind – wie bspw. Solidarität oder Verletzlichkeit – und auch Tugenden bei Beauchamp und Childress nicht hinreichend berücksichtigt werden bzw. anstelle von Prinzipien fokussiert werden sollten. Letztlich, so scheint es, obliegt es aber auch einer Interpretation der Prinzipien, was diese jeweils bedeuten (je nach Interpretation resp. Spezifikation können Solidarität und „justice“ oder Verletzlichkeit und „beneficence“ synonym gebraucht werden). Eine sic et non Entscheidung, entweder auf „europäische“ Prinzipien oder die von Beauchamp und Childress zu rekurrieren, wäre ein 13 Dogma der gegenseitigen Ausschließlichkeit, das für Fortschritt im bioethischen Diskurs wenig hilfreich ist (Häyry 2003). In jedem Fall darf der Rekurs auf mittlere Prinzipien nicht darüber hinweg täuschen, dass die Gesellschaft als ganze sowie durch ihre Bürger, Bürgergruppen, aber auch Interessensverbände vor der Aufgabe steht, den hinter den mittleren Prinzipien stehenden moralischen Vorstellungen wie wohlüberlegten moralischen Urteilen konkretes Leben einzuhauchen. Zu dieser anzuerkennenden Lebendigkeit gehört dann aber auch die Anerkenntnis, dass bisweilen trotz „specification“ und „balancing“ der einzelnen Prinzipien es zwischen ihnen zu tief greifenden Konflikten kommen kann (Leist 1998, 768; Dabrock 2002; Dabrock 2005a). Dennoch helfen die so verstandenen mittleren Prinzipien, im Dickicht angewandter Ethik zur nicht unerheblichen Vorklärung, einen „overlapping consensus“ in einer pluralen Gesellschaft zu finden. Zu ihrem neuzeitlichen Kern zählt dabei vor allem der Autonomierespekt. Entsprechend verwundert seine Bedeutung für Public Health Genetik nicht. 3.5. Normative Implikate für Public Health Genetik aus der individuumsbezogenen Humangenetik 3.5.1. Autonomierespekt durch Informed Consent Mit der Betonung auf „Autonomie“ und Autonomierespekt wurde ein medizinethisches Anliegen verfolgt, das in der Etablierung des Instruments des „informed consent“ in medizinischer Praxis und Forschung eine ihrer wichtigsten Ausprägungen hat. Das Ziel des „informed consents“ ist es, Patienten oder Probanden über Verfahren und Risiken von medizinischen Interventionen hinreichend zu informieren, damit diese wohlinformiert einer Behandlung oder einem Versuch, dessen Chancen und Risiken sie mit Hilfe eines Arztes abschätzen können, aufgeklärt zustimmen. Nach einer informierten Zustimmung soll diese Entscheidung als aufgeklärt und selbstbestimmt, als freiwillig angesehen werden können. Die dahinter liegende Idee ist es, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung („Autonomie“) der Person zu respektieren und mit diesem Modell dem Wandel einer paternalistischen Arztethik zu einer die Würde des Patienten/Probanden respektierenden Ethik zu vollziehen. Man könnte die Notwendigkeit, einen „informed consent“ vor substantiellen Interventionen einzuholen, als eine Spezifikation des Autonomierespekt-Prinzips beschreiben. Bedingungen für einen sinnvollen und effektiven „informed consent“ sind die Fähigkeiten des betreffenden Probanden oder Patienten, die Reichweite eigener Entscheidungen absehen und die Möglichkeit freiwillig entscheiden zu können. Der Arzt muss in einem Aufklärungsgespräch die Informationen offen legen und erklären, die für die geplante Interventi14 on relevant sind – wobei diese Relevanz sicherlich von Arzt zu Arzt verschieden interpretiert wird: Ab welcher Wahrscheinlichkeit sind Risiken wichtig zu kommunizieren? Welche Informationen verunsichern den Patienten so sehr, dass der therapeutische Nutzen einer Intervention fragwürdig wird? Ferner sollte der Arzt, so wird oft gefordert, dem Patienten einen Plan vorschlagen, wie in seinem Fall vorzugehen ist. Dies ist im therapeutischen Arzt-Patienten Verhältnis sicherlich von anderer Bedeutung als im Verhältnis von Forscher zu Proband. Die dem Patienten bzw. Probanden gegebenen Informationen müssen sodann von diesem verstanden werden, soll ein gültiger „informed consent“ stattfinden. Nur dann kann der Patient oder Proband sich autonom für die Intervention entscheiden, den behandelnden Arzt oder Forscher autorisieren und so letztlich die informierte Zustimmung geben (Beauchamp, Childress 2001; Faden, Beauchamp, 1986, S. 235ff). Hier sind Elemente beschrieben, die – wenn sie erfüllt werden – einen „validen“ „informed consent“ darstellen. Ob diese Validität zumindest im therapeutischen Verhältnis immer erreicht wird, darf bezweifelt werden, befindet sich doch ein Patient oft in großer Not und möchte dem Arzt einfach vertrauen. „Machen Sie, was Sie tun würden, wenn Sie an meiner Stelle wären!“ ist vermutlich ein oft gehörter Satz, weil das Vertrauen in die Kunst des Arztes integratives Element der Arzt-Patient Beziehung ist. Trost, Selbstvertrauen und klare Handlungsanweisungen durch den Arzt sind häufig wichtige und gesuchte Kommunikationsformen. Aber es gibt auch Kritik am „informed consent“, der man sich für eine mögliche Nutzung eines „informed consent“ in Public Health Genetik stellen muss. Der „informed consent“ erscheint für Kritiker vielmehr wie ein ritualisierter Vertrauensbeweis des Patienten gegenüber dem Arzt als eine wirkliche, faktische Einwilligung nach Aufklärung (vgl. die Diskussion in Tauber 2003). Gesunde Personen treffen Vereinbarung eher in der Sprache der „Verträge“. Warum sollten gesunde Personen, die in Interaktion treten, also nicht „informed contracts“ etablieren, statt sich des Instruments des „informed consent“ zu bedienen? Der „informed consent“ etabliert einen stillschweigenden (Behandlungs-)Vertrag. Warum diesen nicht explizieren? In der genetischen Forschung treffen sich häufig Gesunde, die ein partnerschaftliches Abkommen schließen können. Natürlich muss ein „informed contract“ die auf für einen „informed consent“ grundlegenden Bedingungen wie Freiwilligkeit und Offenlegung aller relevanter Informationen erfüllen. Bietet ein „informed consent“ zumeist nur die Möglichkeit der Aufklärung und Zustimmung (O’Neill 2002), also der Wahl eines „Alles oder Nichts“, liegt es im Wesen eines 15 Vertrags, Details festzulegen und gegebenenfalls sogar auszuhandeln. Da die Probanden solcher genetischer Studien oft gesund sind, bietet sich für diese mehr Zeit zur Reflexion und freien Entscheidung. Individuell könnte ausgemacht werden, ob Spender über mögliche genetische Ergebnisse, die individuell für sie interessant sein könnten, informiert werden. Auch hat der „informed consent“ selten die Möglichkeit eingeräumt, dass es Möglichkeiten gibt, die in der Forschung gewonnenen Gewebe und Daten für verschiedene, auch noch nicht festgelegte Zwecke über längere Zeiträume zu speichern und zu verwenden. Diesem Aspekt, dass man gewisse Gewebeproben schon aus frühen, alten Studien besitzt, aber nicht weiß, wie oder ob man diese nutzen darf, weil speziell hierfür kein „informed consent“ vorliegt, kann man in einem Kontraktmodell besser begegnen. Der mögliche Nutzen, der sich für Proband und seine Familie aus der Forschung ergeben würde, ist bisher selten im „informed consent“ berücksichtigt worden (Sass 2001; Sass 2006). Die beiden Vertragspartner können die Verträge individuell gestalten. In den Verträgen können sie festlegen, ob oder was Probanden wissen möchten oder ob von den Probanden Interaktion der Forscher in der weiteren Familien gewünscht wird oder nicht. In einem Vertrag können beide Seiten ihre Rechte und Pflichten besonders gut definieren. 3.5.2. Autonomierespekt durch Vertraulichkeit 3.5.2.1. Datenschutz, Schweigepflicht Im Bewusstsein, dass eine „Schweigepflicht des Arztes“ besteht (rechtlich festgeschrieben in § 203 StGB), geben sich die meisten Patienten heutzutage zufrieden, um ein vertrauensvolles und offenes Verhältnis zu ihrem Arzt zu pflegen. In der Regel haben sie keine Angst, dass sie stigmatisiert oder gesellschaftlich gar ausgeschlossen werden, wenn sie wegen tabuisierter Krankheit oder Symptome (zum Beispiel Hämorrhoiden, Verletzung aufgrund ungewöhnlicher sexueller Praktiken oder Fußpilz) bei ihrem Arzt waren. Dass die gewonnenen und dokumentierten Informationen, seien sie direkt gesundheitsbezogen oder familiärsozialer Natur, dabei das intime Verhältnis von Patient und Arzt verlassen, wird oftmals übersehen. Praxismitarbeiter, Apotheker, weitere Ärzte und Pflegepersonal erhalten Einblick in diese Informationen, wenngleich sie die Informationen auch vertraulich handhaben sollen. Für Macklin hat die Annahme, dass genetische Informationen vertraulich behandelt werden sollen, zwei Grundlagen. Eine Grundlage findet diese Annahme darin, dass in westlichen Kulturkreisen die Privatsphäre geachtet wird. So ist es relativ unproblematisch, wenn der Arzt intime Fragen stellt. Die zweite Grundlage dieser Annahme sieht Macklin in der Rolle 16 des Arztes und des Zwecks des Arztbesuchs, dem Patienten zu helfen, also dem Prinzip „beneficence“ zu folgen (Macklin 1992). Es scheint entsprechend nicht unplausibel zu folgern, dass die Schweigepflicht des Arztes und der Datenschutz, so wie es für bisherige medizinische Informationen galt, auch für genetische Informationen aufrecht erhalten wird – und andere Personen einschließt, die die Ergebnisse genetischer Diagnostik erfahren (beispielsweise Labormitarbeiter). Diese Personengruppen können ggf. auch explizit in den Personenkreis aufgenommen werden, den § 203 StGB festschreibt (Deutscher Bundestag 2002). Ärztliche Schweigepflicht und Datenschutz müssen vermutlich für den Bereich der genetischen Intervention nicht strenger reguliert werden als bei anderen medizinischen Interventionen. Datenschutz, Schweigepflicht und Respektierung der Privatsphäre allein können aber nicht die Lösung aller Informationsprobleme für die Konfliktbereiche der genetischen Information sein (Schröder 2004). Einige Herausforderungen werden im Folgenden gezeigt. 3.5.2.2. Datenübermittlung zu Partnern und Verwandten Die Schweigepflichtproblematik ist ein Thema der Bioethik seit den frühen Tagen dieser Disziplin. Prominent diskutiert wurde der „Tarasoff Fall“, in dem der Student Prosenjit Poddar seine Kommilitonin Tatiana Tarasoff nach Vorankündigung bei seinem Psychologen Lawrence Moore, der Tarasoff nicht warnte, tötete. Schweigepflicht, Datenschutz und medizinische Informationen treffen im familiären Kontext, der für die Genetik als Lehre von der Vererbung natürlich von besonderer Wichtigkeit ist, in verschiedenen Konfliktfeldern zusammen. Soll ein Hausarzt einer unwissenden Ehefrau sagen, dass sich ihr Ehemann mit HIV infiziert hat? Wo ist die Grenze der Vertraulichkeit medizinischer Informationen? Wann ist das Potential der Drittschädigung so groß, dass diese Informationen weitergegeben werden müssen und gegen das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Person verstoßen werden kann? Dass dies nur im äußersten Einzelfall geschehen kann, ist allein deshalb offensichtlich, weil ansonsten das notwendige Vertrauensverhältnis von Patient zu Arzt unterwandert und ausgehöhlt würde und ganze gesundheitssystemische Institutionen in Frage gestellt würden. Dass diese Weitergabe von Informationen noch nicht gerechtfertigt ist, wenn es darum geht, im Einzelfall einem Betrieb oder einer Versicherung bessere Bilanzen zu verheißen, scheint plausibel. Es gibt empirische Hinweise, dass im Bereich der genetischen Prädiktion Betroffene dazu tendieren, ihr genetisches Wissen generell den anderen Familienmitgliedern mitzuteilen (Smith, Croyle 1995). Somit kann Information innerhalb der Familie als Stigmatisierungs17 und Diskriminierungsgrundlage dienen. Ein Verweis auf die Möglichkeit, den Status „einfach“ nicht weiter zu sagen, scheint eher für Ausnahmefälle zuzutreffen. Auch ist es im Einzelfall durchaus sinnvoll – ja vielleicht sogar moralisch geboten –, anderen Familienmitgliedern von einem genetischen Status zu erzählen, damit diese entscheiden können, wie sie mit ihrem persönlichen Risiko umgehen. Vielleicht können aufgrund der Informationen Präventionsmaßnahmen folgen oder Lebenspläne geändert werden. Mit der Möglichkeit der genetischen Prädiktion wird es entsprechend auch Problemsituationen im Zusammenhang mit der Schweigepflicht geben. Eine Motivation für eine Person, ihr Wissen über ihre Prädisposition nicht an relevante Verwandte weiter zu geben, kann die Angst vor Exklusion, Vorwürfen, Stigmatisierung und Diskriminierung innerhalb der Familie sein. Eine Frage in diesem Kontext ist dabei, wann es geboten erscheint, seine „Privatsphäre“ mit anderen zu teilen. Zimmerli beantwortet diese Frage wie folgt: „It is quite obvious that every human being has a moral right to preserve his/her genetic privacy, at least to the same extent as he/she has the right to preserve his/her social privacy. However, it is equally obvious that nobody should be entitled to claim genetic privacy if somebody else, and/or a higher value, would be seriously endangered by it. On the basis of this we already see that genetic privacy is not an unconditionally defendable ‚categoric’ good. Given, for example, that knowledge about the genetic constitution of a given person could help to protect other people, or to prevent the person concerned from committing criminal acts, it would not be sufficient to claim individual genetic privacy.“ (Zimmerli 1990, S. 96; HiO) Konfliktfälle können auftreten, wenn der behandelnde Arzt oder Berater erkennt, dass gegen die Interessen eines Verwandten oder Partners vehement verstoßen werden. Soll der Arzt jemandem sagen, dass er im Risiko zu einer Krankheit steht, die man gegebenenfalls positiv beeinflussen kann? Dürfen Kinder testen, wenn Eltern ihren Status nicht wissen wollen? Abgesehen von den plausiblen moralischen Ausführungen, die Zimmerli darstellte, stellt sich die Frage, wie diese Konflikte rechtlich gelöst werden können. Hier besteht Diskussionsund Handlungsbedarf, denn diese Konfliktfälle von Schweigepflicht auf der einen Seite und Schadensverbot und Chancengleichheit auf der anderen Seite werden sehr häufig in Stellungnahmen oder „Policy Papieren“ nicht berücksichtigt. Hier hat der Schweizer Gesetzvorentwurf „Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen“ eine Differenzierung und institutionelle Möglichkeit explizit berücksichtigt, wie mit solchen Konfliktfällen umgegangen werden kann. Es wird vorgesehen, dass Ärzte in Konfliktsituationen eine Entbindung vom Berufsgeheimnis bei einer kantonalen Behörde beantragen können, um überwiegende Interessen von Verwandten oder (Ehe18 )Partnern zu wahren. Die Behörde hat die Möglichkeit, eine Expertenkommission zur Beratung zu hören (Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 2002). 3.5.2.3. Datenübermittlung zu Versicherungen und Arbeitgebern – Das Beispiel gendiagnostischer Prädiktion Wenn sich Gendiagnostik bevölkerungsbezogen ausweitet, werden Konflikte mit Versicherungen und in der Arbeitswelt virulent. Die Initiative „1000 Fragen“ hat im Zusammenhang mit postnataler genetischer Prädiktion eine Frage zum Versicherungswesen auf einem Plakatmotiv dargestellt. Die Frage, die M.S. aus Wetzlar zugeordnet wird, lautet: „Will ich alles wissen oder nur meine Versicherung?“3 Der Versicherer will – so versichern uns Versicherer (vgl. Regenauer 2001) – nicht unbedingt alles wissen (und wenn er wollte, dürfte er auch nicht alles wissen). Der Versicherer will nur wissen, was der Versicherungsnehmer auch weiß, um eine faire Wissensparität zu bekommen. Da der Versicherer aber nicht immer wissen kann, was der Versicherungsnehmer weiß, ergeben sich Probleme. Wer selbst nichts über seinen genetischen Status wissen will, muss eventuell in Kauf nehmen, eine Versicherung nicht oder nur mit Risikoausschluss zu bekommen. Diese Einschränkungen gelten aber nicht nur für Gentests im Kontext der Versicherungen, sondern auch bei der Risikobewertung eines Versicherungsbewerbers für Cholesterinspiegel, Bluthochdruck und für die versicherungsmathematische Einschätzung anderer Risikofaktoren (von Beruf bis Lebensstil). Dies erscheint solange mit einem gerechten Versicherungssystem vereinbar, solange eine Grund(ver)sicherung jedem Menschen garantiert ist, die ihm eine Freisetzung der Handlungsfähigkeit und „Befähigung zu einer längerfristig integral-eigenverantwortlichen Lebensführung zum Zwecke der Teilnahmemöglichkeit an sozialer Kommunikation“ (Dabrock 2001, S. 206; HiO; Dabrock 2005b) ermöglicht. So wäre die Nutzung von Gendiagnostik beziehungsweise die Einbeziehung ihrer Ergebnisse in die medizinische Risikofaktorenabschätzung der privatwirtschaftlichen Versicherer gerechtigkeitstheoretisch zulässig, solange eine Sozialversicherung beziehungsweise gesicherte Privatversicherung Befähigung absichert. Im Bereich der Arbeitswelt ist nach weiterer Verbreitung prädiktiver Gendiagnostik folgendes Szenario denkbar: Ein Bewerber legt ein Gesundheitszeugnis vor, aus dem hervorgeht, dass er für keine spätmanifesten Krankheiten oder Suszeptibilitäten prädispositioniert ist oder dass er andere „gute Gene“ hat. Ein Mitbewerber will aber kein solches Zeugnis vorlegen. Wie sollte der Arbeitgeber mit einer solchen Situation umgehen (dürfen)? Der Arbeits3 http://www.1000fragen.de/index.php?mo=4&pt=3&pi=25 19 platz, um den sich die Bewerber bemühen, bedeutet kein Sicherheitsrisiko bei einem Krankheitsschub oder -ausbruch. Es ist auch kein Beruf, in dem man mit bestimmten arbeitsplatzspezifischen Stoffen, die bei bestimmten Menschen krankheitswertige Reaktionen hervorrufen können, in Berührung kommt. In einem solchen Fall darf der Arbeitgeber wohl nicht verlangen, seine Arbeitnehmer zu testen, oder gendiagnostische Informationen, die vom Arbeitnehmer vorgebracht werden, verwenden. Eine Möglichkeit wäre, dem Arbeitnehmer mit dem Gesundheitszeugnis gesetzlich zu verbieten, dieses vorzuzeigen, wohingegen der Arzt, der den Arbeitnehmer auf seine Eignung untersucht, später nur seine arbeitsplatzspezifische Eignung überprüft. Dem Amts- oder Betriebsarzt kommt daher in Zukunft wohl generell eine neue, besondere Verantwortung zu: Er muss wissen, ob relevante Prädispositionen – um die er vom Arbeitnehmer weiß – ein berufsbezogenes Sicherheits- oder Gesundheitsrisiko ausmachen. Ist dies der Fall, kann er dem Arbeitgeber die Einstellung nicht empfehlen; der Arbeitnehmer sollte aber die Chance erhalten, durch einen Gentest eine mögliche Nichtbetroffenheit nachzuweisen, durch die das Wissen um das familiäre Risiko gegenstandslos wird. Sollte das Ergebnis negativ ausfallen, die Person aber trotzdem aufgrund dieses „Gesundheitsrisikos“ nicht eingestellt werden, läge hier eine klare Diskriminierung vor. In dieser Hinsicht ist diese Untersuchungsmethode nur eine Weiterführung bisheriger Methoden. In Fällen dagegen, in denen kein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko an dem zur Disposition stehenden Arbeitsplatz besteht, muss der Betriebsarzt das Wissen um die Prädisposition des Bewerbers für sich behalten und kann „grünes Licht“ für die Einstellung geben. Die Gesundheitsinformationen, die der Betriebsarzt gewonnen hat, müssen vor dem Arbeitgeber vertraulich behandelt werden. Vergessen werden darf aber nicht, dass für Arbeitnehmer Gendiagnostik vor der Einstellung prinzipiell auch Chancen darstellen kann: „Insgesamt können genetische Analysen bei sinnvollem Einsatz eine wertvolle Hilfe für die Berufs- und Lebensplanung sein.“ (Hennen et al. 2001, HiO) Ein Beispiel wäre, wenn vor der Wahl der Lehre festgestellt werden kann, dass jemand empfindlich auf Stoffe reagiert, mit denen er in dem angestrebten Beruf unweigerlich zu tun hat (Beispiel: Bäckerasthma). Ein allgemeines „Screening“ des Arbeitnehmers auf alle spätmanifesten und multifaktoriellen Krankheiten, die testbar sind, ist im Interesse des Arbeitnehmers nicht sinnvoll. Hier sollten die Interessen des Arbeitnehmers die des Arbeitgebers überwiegen, da ersterer innerhalb des Arbeitsverhältnisses zumeist in einer schwächeren Position ist. Der Arbeitgeber trägt so weiterhin wie bisher das Risiko der Erkrankung seines Arbeitnehmers (wie auch durch Unfall etc.). Sollte der Arbeitnehmer vor seiner Einstellung von einer genetischen Prädisposition wissen, sollte er viel20 leicht sogar lügen dürfen, wenn das Wissen nicht für den betreffenden Arbeitsplatz in Bezug auf Dritte relevant ist (z.B. größeres Unfallrisiko). Zusammenfassend formuliert: Gleiche Chancen muss es für die geben, die für einen Arbeitsplatz gleich qualifiziert sind, unbesehen ihrer allgemeinen gesundheitlichen (probabilistischen) Zukunft – aber nicht unbesehen möglicher arbeitsplatzspezifischer Suszeptibilitäten, die krankheitswertige Auswirkungen für den Arbeitnehmer haben können, oder wenn durch genetische Prädispositionen ein Sicherheitsrisiko besteht. 3.5.3. Verfahrenselemente 3.5.3.1. Arztvorbehalt vs. Arztoption? Vermutlich werden, auch um Public Health Ziele zu verfolgen, Gentests weitere Verbreitung finden. Dabei wird von einigen Personen und Institutionen gefordert, einen Arztvorbehalt für Gentests zu etablieren. Ein Arztvorbehalt, der auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft als unentbehrlich erachtet wird, bedeutet, einen Gentest nur bei ärztlicher Indikation „flankiert durch eine Verschreibungspflicht“ (Taupitz 2000, S. 38; vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2003) als zulässig zu sehen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Ratsuchenden fachkundige Beratung und Interpretation der Ergebnisse bekommen. Auch die Bundesärztekammer votiert für einen Arztvorbehalt. Sie argumentiert mit dem Hinweis, dass genetische Prädiktion kein eindeutiges Wissen liefert und deshalb fachkundiger Interpretation bedarf (Bundesärztekammer 2003). Aber es gibt natürlich auch Einwände gegen einen Arztvorbehalt, die im Folgenden den Vorteilen gegenüber gestellt werden sollen. „Als Einwände gegen einen Arztvorbehalt werden diskutiert: • Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Testwilligen • Die Ausführung des Rechts auf Wissen von Menschen wird eingeschränkt • Ärztinnen und Ärzte werden berechtigt, Befunde zu erheben, die per definitionem medizinisch irrelevant sind • Einschränkung der Berufsfreiheit derjenigen, die genetische Analysen inklusive Beratung ohne ärztliche Approbation anbieten wollen Als Vorteile eines Arztvorbehaltes sind zu bewerten: • Beschränkung der Durchführung von Gentests auf das etablierte System der medizinischen Versorgung 21 • Qualitätssicherung • Der Einzelne wird davor geschützt, mit den Ergebnissen von Gentests unsachgemäß umzugehen (Unterstützung der Selbstbestimmung des Individuums) • Daten fallen unter das Arztgeheimnis • Verhinderung eines ‚freien Testmarktes’“ (Geisler 2001, HiO) Der dritte Einwand scheint wenig plausibel. Ärzten ist es bereits zu Recht gestattet, „medizinisch irrelevante“ Befunde zu erheben beziehungsweise medizinisch irrelevante Handlungen durchzuführen. Als Beispiel sei hier das Polieren von Zähnen genannt. Es erscheint überzeugender, wenn bestimmte „per definitionem medizinisch irrelevant[e]“ Leistungen besser von Ärzten durchgeführt werden als von niemandem oder von „Quacksalbern“ oder „Scharlatanen.“ Der vierte Einwand ist sehr schwach, weil es auch andere Handlungen gibt, die NichtÄrzten verboten sind. Die ersten beiden Einwände hingegen sind gravierender; sie sind allerdings grundlegend identisch: Es geht hier um die Einschränkung der Selbstbestimmung des mündigen Bürgers. Diese Einwände würden dann unterminiert, wenn jeder Bürger bei Ärzten niederschwellig und günstig Gentests durchführen könnte: Entweder sie sind medizinisch indiziert und werden sogar von der Krankenversicherung bezahlt, oder sie werden wie individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL) gehandhabt respektive von einer möglichen individuellen privaten (Zusatz-)Versicherung abgedeckt. Bei einem solchen Modell kommt der Ratsuchende, der die Möglichkeit hat, jede Prädisposition, die testbar ist, zu testen, in den Genuss der Vorteile eines Arztvorbehalts, die Geisler in Punkten zwei bis vier nennt. Eine Schwierigkeit des Arztvorbehalts ist, dass er nicht praktikabel sein beziehungsweise vom Internetmarkt unterminiert werden könnte – vor allem dann, wenn bei einem virtuellen medizinischen Tourismus ausländische Angebote über das Internet auch von deutschen Bürgern bequem genutzt werden können. Diese Unterminierungspraxis könnte allerdings wiederum unterminiert werden, indem man nahezu alle möglichen Tests, also auch die „lifestyle-Tests“, einfach und kostengünstig – beziehungsweise kostenlos bei medizinischer Indikation – beim Arzt bekommt; zumindest eine Beratung, die losgekoppelt von dem käuflichen Erwerb eines Tests ist. Dadurch ist zumindest auch ein sachgemäßeres Verständnis durch die Interpretation des Arztes gegeben, sofern dieser dafür ausgebildet ist. Die krankheitsbezogenen Gentests sollten ohnehin in die grundlegenden medizinischen Versorgungsleistungen aufgenommen werden (beziehungsweise dort bleiben). Wenn sich ein Arztvorbehalt durchsetzt, muss also zugleich gesichert sein, dass alle gesundheitsbezogenen Gentests von der gesetzli22 chen Krankenversicherung abgesichert werden beziehungsweise dies zum Basispaket von privaten Krankenversicherungen gehören sollte und ferner auch nicht solidarisch finanzierte Gentests über den Arzt oder Berater – gegen eigene Bezahlung – erfolgen können, damit sachgemäße Interpretation gewährleistet bleibt. Jedoch liegt dem Arztvorbehalt ein Wertungswiderspruch zugrunde, der sich auf die Mündigkeit des Ratsuchenden bezieht. Mit gleicher Begründung des Arztvorbehalts dürften nämlich auch Schwangerschaftstest, Blutdruckmessgeräte oder ähnliches nicht in Apotheken, Supermärkten und Drogerien verkauft werden, weil diese viele Eigenschaften mit prädiktiven Gentests teilen. Auch wenn ihre Ergebnisse nicht so interpretationsoffen sind, so können sie doch falsch sein (zum Beispiel durch falsche Anwendung) und gerade Schwangerschaftstests können einzelnen (beispielsweise jungen Teenagern) nahezu „fatales Wissen“ liefern, das ebenfalls mehrere Menschen anbelangt. Wenn also problematisch am Arztvorbehalt ist, dass er die Möglichkeit des mündigen Ratsuchenden nicht genügend respektiert und für ihn nur unter Inkaufnahme eines Wertungswiderspruchs argumentiert werden kann, könnte dann ein eingeschränkter Markt mit Zertifizierungsmethoden eine Option sein. Zertifizierte Gentests könnten außerhalb der Arzt- oder Beraterpraxen verkauft oder angeboten werden; zum Beispiel in Apotheken, wo Bürger bereits Blutdruck, Gewicht, Blutzucker etc. messen lassen können. Hier könnte eine „Drogerien“ oder „Apothekenpflicht“ gelten. Dies könnte beispielsweise für Tests gelten, die zwar krankheitswertige Aussagen, aber kein „fatales Wissen“ (wie beispielsweise ein Test auf die Huntingtonsche Krankheit) liefern können – wie dies im Zusammenhang mit den für Public Health Genetik besonders relevanten multifaktoriellen Volkskrankheiten der Fall ist – und deren Ergebnis und dessen Implikationen leicht verständlich für den Laien sind (sofern solche Tests dereinst verfügbar würden). Wenn ein Test, den der Bürger beispielsweise in einer Apotheke durchführt, positiv ist, kann er dies außerdem – genau wie bei diagnostiziertem Bluthochdruck, hohem Blutzucker oder nach festgestellter Schwangerschaft – zum Anlass nehmen, einen Arzt aufzusuchen. Diese zertifizierten Tests, die man dann in Apotheken und/oder Drogerien erwerben könnte, müssten aber nicht wahrgenommen werden und würden vermutlich weniger nachgefragt werden, wenn es weiterhin die Arztoption gibt, die bedeutet, dass alle Gentests niederschwellig über den Arzt zugänglich sind – eine Arztoption wäre also wie ein Arztvorbehalt mit der kleinen Einschränkung, dass zertifizierte Gentests, die kein fatales Wissen liefern können, auch anders erwerbbar sind. 23 3.5.3.2. Was bedeutet Bindung an Gesundheitszwecke für Public Health Genetik? Die Verfügbarkeit genetischer Diagnostik könnte ferner, wie bereits angesprochen, über eine Bindung von Gendiagnostik an Gesundheitszwecke reguliert werden. Bedeutet Bindung an Gesundheitszwecke oder medizinische Zwecke jedoch, nur solche Gentests zu erlauben, die therapeutische oder präventive Maßnahmen nach sich ziehen lassen können, wäre dies wenig plausibel. In dem Fall könnten zum Beispiel außer im Bezug auf Familienplanung keine Tests auf die Huntingtonsche Krankheit zugelassen werden. Gentests auf die Huntingtonsche Krankheit können aber individuell sehr sinnvoll sein, auch um fernab der Familienplanung die eigene Lebensplanung beeinflussen zu können. Und Personen, die schon mit einem solchen familiären Schicksal belastet sind, sollten nicht hier auch noch bevormundet oder gezwungen werden, ihren Wunsch zu pathologisieren, damit ihm Folge geleistet werden kann. Überzeugender ist es, nur diejenigen Tests solidarisch zu finanzieren, die aussagekräftig sind und gesundheitlichen Nutzen mit sich bringen und etwas weitläufiger auch die Lebensplanung beeinflussen können. 4. PUBLIC HEALTH GENETIK UND SOZIALE GERECHTIGKEIT In den bisherigen eher auf die Schutz- und Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen zielenden Ausführungen wurde schon mehrfach vom ethischen Kriterium der Befähigung zur eigenverantwortlichen Lebensführung ausgegangen. Spätestens an dem Punkt, an dem deutlich wird, dass diesem individuumsbezogenen Anspruchsmaß immer auch ein gesellschaftliches Verpflichtungsmaß entspricht, muss sich die Blickrichtung hinwenden zur sozialtheoretischen Begründung des Befähigungskriteriums aus dem sozialethischen Grundkriterium der Gerechtigkeit. Damit bekommt ein weiteres der mittleren Prinzipien für die Ethik von Public Health Genetik materielle Konturen. Dass Gerechtigkeit bei der Gestaltung von Public Health Genetik prägend sein muss, lässt sich durch einen einfachen Syllogismus zeigen: „Gerechtigkeit ist die höchste Tugend sozialer Institutionen.“ (Rawls 1975, S. 17). So steht es auf der ersten Seite eines der einflussreichsten Werke der neueren Philosophiegeschichte: der voluminösen Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls. Public Health Genetik meint – wie erwähnt – die Integration genetischen Wissens in Public Health. Public Health zielt auf die öffentliche Sorge um die Gesundheit aller und wird von öffentlichen oder paraöffentlichen Institutionen verantwortet. Deshalb muss Public Health Genetik wie Public Health sich mit der ersten Tugend sozialer Institutionen, der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen. Entsprechend diesem Syllogismus wird erst die Entfaltung des mittleren Prinzips „Gerechtigkeit“ durch das schon mehrfach erwähnte, aber noch nicht hinreichend begründete Maß der Befähi24 gung dargestellt, um anschließend zu zeigen, wie sich dieses auf die Fragen der Genetik in der öffentlichen Gesundheitsversorgung auswirkt. 4.1. Auszuschließende soziale Verpflichtungsrelationen in der „sozialen Demokratie in den Formen des Rechtsstaats“ Weil die „soziale Demokratie in den Formen des Rechtsstaats“ (BVerfGE 5, 85/198) keine weltanschauliche Werte- und Lebensdeutungsgemeinschaft bildet, sondern weil der moderne Rechtsstaat zunächst nur die Freiheit des einen gegen die Freiheit des anderen zu schützen hat, können in seinem Rahmen moralisch-perfektionistische oder umfassende Programme wie beispielsweise eine bestimmte gesundheitsförderliche Lebensweise nicht verallgemeinert werden. Zudem können pauschale Ansprüche auf strikte soziale Gleichheit auch nicht vor dem eigentumstheoretischen Axiom der Neuzeit bestehen; schließlich implizieren solche Forderungen, sollen sie sozialrechtlich durchgesetzt werden, zwangsbewehrte Umverteilungsstrategien und damit Eingriffe in Eigentum und Freiheit der Bessergestellten. Zudem widersprechen sie dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, der ja festlegt, dass Gleiches gleich und folglich Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Dabei stünden sie ferner kontrovers zum Solidaritätsgrundgedanken, dass der Kranke und nicht der Gesunde der Hilfe (vgl. Mk 2, 17) und folglich ersterer eines größeren Anteiles an möglichen Umverteilungen oder gemeinsamen Ressourcen bedarf. Aber auch andere sozialethischen Alternativkandidaten halten der Prüfung für die Bestimmung sozialer Verpflichtungsrelationen nicht stand: Reine Nutzentheorien können ausgeschlossen werden, weil sie die Suche nach dem Guten nicht mit der Achtung der Rechte jedes Einzelnen verknüpfen (Höffe 1987). Insofern das Verständnis von Wohlergehen stark von subjektiven Empfindungen abhängt, sind darauf aufbauende Theorien nicht verallgemeinerungsfähig (Pauer-Studer 2000) und insofern für die pragmatische Ausgestaltung sozialer Gerechtigkeit unbrauchbar. Radikale Freiheitstheorien blenden die politische Notwendigkeit ab, grundlegende Rechte für jede Person anzuerkennen; sie leben a) theoretisch vom Abgrenzungsgestus gegenüber einem verzeichneten Egalitarismus, der eben nicht eine strikte, sondern nur eine Chancengleichheit zu erreichen sucht, b) politisch-pragmatisch von der Missachtung des Umstandes, dass auf breiter Basis öffentliche Gelder öffentliche Güter (Forschung etc.) investiert wurden, deren Erträge nach dieser Theorie nun rein marktwirtschaftlich abgeschöpft werden sollen. Das ist jedoch eine so nicht zu akzeptierende Ursprungsvergessenheit. 25 4.2. Decent minimum statt minimales Minimum Wenn eine im weltweiten Maßstab betrachtet als halbwegs wohlgeordnet und stabil zu charakterisierende Gesellschaft unter den Rahmenbedingungen des modernen, freiheitlichliberalen, demokratischen, und auch das sei nicht vergessen: sozialen Rechtsstaats gerecht sein will (und sei es unter dem Nutzengesichtspunkt der Bewahrung ihrer Stabilität), dann kann sie das inhaltliche Maß der sozialen Gerechtigkeit nicht als minimales Minimum festlegen (verfassungsrechtlich definiert als Existenzminimum gemäß Art. 1 + 2 GG). Vielmehr muss sie sich um ein decent minimum, ein anständiges Minimum bemühen. Was ein decent minimum auszeichnet, wird zwar gesellschaftlich debattiert und mag sich von Gesellschaftsformation zu Gesellschaftsformation aufgrund seiner konstitutiven Kontextgebundenheit unterscheiden. Seine Bestimmung muss sich jedoch zumindest an den gesellschaftlich vorhandenen Konditionalgütern orientieren. Zu ihnen zählen materielle ebenso wie ideelle Güter wie z.B. Achtung und Anerkennung. Eine Bereitstellung von solchen Konditionalgütern darf sich begründungstheoretisch nicht nur aus politischer Solidarität oder aus der Wohltätigkeit von Bessergestellten ableiten, sondern erfüllt das begründungstheoretisch höher stehende Kriterium eines gerechten Anspruchs. Gegen die minimalistische Variante und für das anständige Mindestmaß sprechen moralische Intuitionen und diverse ethische wie sittlich-politische Rechtfertigungsstrategien: Eklatante Ungleichheiten, die die einen überproportional übervorteilen, während die anderen von fast allen Formen sozialer Kooperation ausgeschlossen würden, führen bei vielen Menschen (zumindest im Nahbereich) zu Protest- oder Empörungsreaktionen. Ein (mehr oder minder) ausgeprägter Sinn für Ungerechtigkeit scheint sich in fast allen bei der Wahrnehmung extremer Ungerechtigkeiten zu regen. Internationale Menschenrechtsabkommen, die inzwischen schon als globales, auf jeden Fall als europäisches Ethos gelten können, leiten aus der allen Menschen zugesprochenen Menschenwürde nicht nur bürgerliche Freiheit, politische und rechtliche Gleichheit, sondern auch das Recht auf Teilhabemöglichkeit am gesellschaftlichen Leben ab. Laut der in vielen Kulturen sich findenden Goldenen Regel als auch insbesondere ihrer moraltheoretischen Vertiefung im kategorischen Imperativ sind solche Handlungen und Entscheidungen zu verallgemeinern, die in jedem Menschen einen Selbstzweck sehen, dem mit innerem Respekt zu begegnen ist. Auch mit vertragstheoretischen Gedankenexperimenten lässt sich weniger emphatisch rechtfertigen, dass auch gemäß eigennützigem Kalkül Anderen Lebenschancen zur Verfügung gestellt werden müssen. Selbst die minimalistische Anspruchstheorie der Gerechtigkeit, die nur das als gerecht betrachtet, was unter Beachtung 26 fairer Verfahren angeeignet oder übertragen wurde, ist so auslegbar, dass zur fairen Prozeduralität die Befähigung zur Aneignung und Übertragung zählt. 4.3. Chancengleichheit als erste Präzisierung des decent minimum Bei der Bestimmung des decent minimum spielt der Verursachungshintergrund ebenso eine Rolle wie der Zweck und das Maß der Zuteilung: Insofern das decent minimum eines liberalen-demokratischen Rechtsstaats zunächst impliziert, dass Autonomierespekt Vorrang vor Umverteilung nach sich ziehenden Gleichheitsansprüchen besitzt, erscheinen vielen (jenseits eines minimalen Minimum) nur solche Ungleichheitsfolgen in der Gesellschaft kompensationsfähig und können als Pflichtgrund für eine Redistribution der Bessergestellten angesehen werden, die aus einer nicht verschuldeten Konstellation resultieren. (Über private Absicherungen und Versicherungen ist damit nichts ausgesagt.) Im Nachgang zu dieser Weichenstellung ist allerdings wiederum strittig, ob das Nichtverschuldungsprinzip nur für gesellschaftlich bedingte Ungleichheiten gilt oder auch schon bei natürlichen Ungleichheiten greift, sofern diese eine bedeutende gesellschaftliche Ungleichheit bewirken (Buchanan et al. 2000; dazu Dabrock 2003). Interessant an dieser Differenz ist die Wahrnehmung der bis heute in den unterschiedlichen Positionen transportierten Menschenbilder. In der nur an gesellschaftlichen Ungleichheiten orientierten Position, dem social structural view, zählt erstrangig nur der kooperationsfähige Mensch. Die Ungleichheit noch nicht oder insbesondere nicht mehr kooperationsfähiger Personen wird eher aus Klugheits- oder Solidaritäts-, denn aus originären Gerechtigkeitsgründen korrigiert, kompensiert oder nivelliert. Im brute luck view, der Position, die jede Form von Ungleichheit, sofern sie nur nicht selbstverschuldet ist, für korrekturbedürftig hält, wird das Menschenbild nicht so sehr vom Gedanken der Kooperationsfähigkeit, sondern grundlegender von realer Kommunikationsfähigkeit bestimmt. Wenn als Hintergrund das Nichtverschuldensprinzip als Bedingung für Umverteilungen gelten mag, so bleibt nach Ablehnung von Nutzen, strikter Gleichheit, Wohlfahrtsgleichheit und radikaler Freiheit als Zweck und Maß des Ungleichheitsausgleichs das im Übrigen von vielen intuitiv akzeptierte Maß der Chancengleichheit. Bei seiner Bestimmung kann es nicht nur aufgrund der Differenz von social structural view und brute luck view zu Divergenzen kommen, auch seine in die Debatte eingebrachten Subkriterien von Ressourcengleichheit, Wohlfahrtschancengleichheit oder Fähigkeitengleichheit sind kaum mehr als Schlagworte, weil sie zwar meistens von einem bestimmten Autor oder einer bestimmten Autorin konzipiert und begründet wurden, aber jeweils eigene Füllungen erlauben. Von daher muss man 27 jeweils ausführen, was man darunter versteht. Allen Formen eines fair equality of opportunity-Ansatzes ist gemeinsam: Sie anerkennen eine Beschränkung und ein Ziel und intendieren so weder eine Versklavung der Talentierten noch knüpft sie eine Eigenverantwortlichkeit lähmende, engmaschige soziale Hängematte. 4.4. Befähigung als Maßangabe für das decent minimum der Chancengleichheit Dem hier vertretenen Modell des Fähigkeiten-Ansatzes (Capabilities-Approach) (Sen 1999; Nussbaum 1999; Nussbaum 2006; Pauer-Studer 2000 ; vgl. auch für eine ähnliche Position Powers, Faden 2006) geht es um die Inklusion der einzelnen Individuen in die Gesellschaft (Dabrock 2005b; Dabrock 2006). Unter Berücksichtigung der notwendigen Bedingung des Würde-Axioms entfaltet er den nicht nur qua Wohltätigkeit gewährten, sondern gerechterweise einklagbaren Anspruch auf soziale Grundgüter (capabilities) nach dem Kriterium, ob mit ihrer Hilfe ein Individuum zur längerfristigen, integral-leiblichen, eigenverantwortlichen Teilnahme an interpersoneller Kommunikation (functioning) befähigt wird. Seine Legitimation zieht dieses Gerechtigkeitsverständnis daraus, dass die grundlegenden Achtungs- und Menschenrechtsindikatoren ‚Würde’ und ‚Freiheit’ solange abstrakt-leere Konzeptionen bleiben, solange sie nicht eine auf die jeweilige Gesellschaft bezogene Befähigung zur realen und nicht nur formalen Freiheit gewähren. Weil der Capabilities-Approach diese reale Freiheit als gerechtigkeitstheoretisches Leitkriterium wählt, fällt er auch nicht in die Normalismusfalle (Waldenfels 1998). D.h.: Er versucht nicht nur, dafür Sorge zu tragen, dass Defizite eines normal competitors in sozialer Kooperation ausgeglichen werden, sondern er fragt auch, wie die Fähigkeiten jedes Individuums möglichst effektiv gefördert werden können – allerdings nicht mit dem Ziel seines subjektiven Wohlergehens, sondern nur zum Zweck der Bereitstellung dessen tragfähiger Bedingungen, nämlich der Teilnahmemöglichkeit an interpersoneller Kommunikation. (Schließlich kann niemand zur Teilnahme an der Gesellschaft gezwungen werden.) Soziale Gerechtigkeit gegenüber einem Behinderten muss sich entsprechend in höherer gesellschaftlicher Zuwendung als gegenüber Nichtbehinderten ausdrücken, sofern er diese zum genannten Zwecke benötigt. Gegen mögliche Missverständnisse sei betont: Geht es um Bedingungen, soziale Kommunikation aufnehmen und pflegen zu können, dann sind keineswegs – wie möglicherweise denkbar – schwerst geistig Behinderte aus diesem Kriterium ausgeschlossen. Sie haben nur andere Formen von Kommunikation! Um auf diese Vielfalt im Kommunikationsverständnis hinzuweisen, wird der hier vertretene Ansatz über das Kriterium integral-eigenverantwortlicher Lebensführung definiert. 28 Trifft zudem die so genannte Wilkinson-These zumindest indirekt (Wilkinson 2001) zu, nach der in solchen Gesellschaften, die eine vergleichsweise hohe gesellschaftliche Stratifikation aufweisen, eine größere gesundheitliche Ungleichheit zu beklagen ist als in solchen, die von weniger Ungleichheiten gekennzeichnet sind, kann man von diesem Effekt bei der Zuteilung sozialer Ressourcen (und das heißt möglicherweise auch solcher für genetische Maßnahmen in Public Health) nicht abstrahieren. D.h.: Zwar ist Freiheit das eigentliche Ziel von Ethik und demokratischem Rechtsstaat, aber durch die Wilkinson-These wird der intrinsische Wertcharakter von Gleichheit zumindest gegenüber der neueren Egalitarismus-Kritik rehabilitiert (Krebs 2000). Diese bezweifelt, dass Gleichheit, die immer eine Relation zwischen zwei Vergleichsobjekten aufbaut, eine sozialethisch oder -politisch legitime Forderung darstellt. Im Umkehrschluss hält sie nur einen menschenrechtlich begründeten absoluten Standard an Lebensbedingungen für einklagbar. Demgegenüber gibt die Wilkinson-These zu bedenken, dass zumindest mit Bezug zur Gesundheit die soziale Relationen berücksichtigende Chancengleichheit sehr wohl eine intrinsisch moralische Bedeutung besitzt. Nicht als moralisches Endziel wie die Freiheit, aber sehr wohl als moralisches und nicht nur außermoralisches Mittel zu diesem Ziel kann man die Gleichheit bewerten, wenn denn Gesundheit ein konditionales Gut ist und die Verteilung dieses Gutes in der Gesellschaft nicht völlig unabhängig davon ist, wie es um die gesellschaftliche Stratifikation in dieser Gesellschaft bestellt ist. Inhaltlich umfasst die freiheitsfunktionale Ausgestaltung des Capabilities-Approach auch die Problemstellung der jüngsten Debatte im Feld der sozialen Gerechtigkeit. In ihr wird debattiert, ob soziale Gerechtigkeit monozentrisch vom Prinzip der Anerkennung (Honneth) oder bifokal vom Doppelprinzip ‚Umverteilung und Anerkennung’ (Fraser) begründet werden soll (Fraser, Honneth 2003). Abgesehen davon, dass der recognition-Ansatz von Honneth unter einen Begriff drei sehr divergente Formen sozial bezeugter Achtung (Liebe, Recht, Leistung) bringen soll, die Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl des Individuums stärken, unterläuft er die bewährte modernitätstypische Unterscheidung zwischen Rechtem und Guten (vgl. Gosepath 2004). So richtig es ist, dass jeder Mensch diese Formen der Anerkennung benötigt, so wenig kann er sie vom (generalisierten) Anderen einfordern. Da aber nur der generalisierte Andere (und nicht der konkrete Andere) derjenige ist, an den (symbolisch) gesellschaftliche Forderungen gestellt werden können, kann die reine Anerkennungstheorie bestenfalls auf die Ebene der schwachen Theorie des Guten reduziert als Begründungselement sozialer Gerechtigkeit fungieren. Zu Recht hat Nancy Fraser hervorgehoben, dass Teilhabemöglichkeit nicht nur über die soziokulturelle Verdrängungs-, sondern auch über ökonomische Verdinglichungsmechanismen gestört oder gar verhindert wird. Damit bes29 tätigt sie die freiheitsfunktionale Gesamtintention des Capabilities-Approach. Sie kann dabei zwischen diesem Grundprinzip und die sozialen Grundgüter nochmals eine Zwischenebene einziehen, die die lange Zeit aggregatorisch wirkende Zusammenstellung der Güterliste von Nussbaum systematisch ordnen und so aufdecken kann, durch welche Mechanismen diese Güter gefährdet werden. Diese präzisierende Differenzsensibilität kann ebenso wie das Grundprinzip der Befähigung für die sozialethische Fragen von Public Health Genetik genutzt werden. 5. SOZIALETHISCHE PERSPEKTIVEN AUF PUBLIC HEALTH GENETIK Ob man die dargestellten allgemeinethischen und sozialethischen Kriterien auf die molekulare Medizin im Allgemeinen wie Public Health Genetik im Besonderen anwenden kann, hängt entscheidend davon ab, wie man genetisches Wissen einschätzt. Hält man es für exzeptionell, müssen verschärfte oder andere Kriterien gesucht werden. Erachtet man es für nicht exzeptionell, kann auf die dargestellten Unterscheidungen zurückgegriffen werden. Deshalb stellt sich die prinzipielle Frage: Ist genetisches Wissen exzeptionell einzuschätzen? (Murray 1997) 5.1. Keine Exzeptionalität, aber Spezifität genetischen Wissens Ohne Zweifel zeichnet sich genetisches Wissen durch Besonderheiten wie lange und (je nach Form) sehr genaue Voraussagekraft aus. Es ist zudem durch seine Bedeutung für reproduktive Entscheidungen wie die Schlussmöglichkeit auf familiäre Charakteristika von symbolischer und sozialer Sprengkraft. Aus den genannten Gründen wie kurzfristigen Nutzenerwägungen von Versicherungen und Arbeitgebern wie unter der Erinnerung an die menschenverachtende Praxis der Eugenik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in den Gräueltaten der Nazis ihren schrecklichen Höhepunkt fand, wie unter kultureller Fortwirkung eines kruden genetischen Determinismus und Reduktionismus ist genetisches Wissen zudem mit Stigmatisierungs- und Diskriminierungsängsten verbunden. All das spricht für die Besonderheit genetischen Wissens. Eine Exzeptionalität, die zudem einen Sonderweg im Umgang mit genetischen Daten gegenüber anderen medizinischen Verfahren rechtfertigen könnte, leitet sich aus den genannten Gründen nicht ab. Lange Vorhersagekraft, Bedeutung für reproduktive Entscheidungen und familiäres Wissen, Stigmatisierungspotential trifft mal mehr, mal weniger auch auf andere medizinische und nicht medizinische Lebensbedingungen zu. Allein die Dichte der Aspekte und die sich daraus ergebende mögliche kumulative Wirkung lässt die Charakterisierung der molekularen Medizin als eines für die Persönlichkeitsrechte der einzel30 nen Gesellschaftsmitglieder wie ganzer Gruppen hochsensiblen Bereichs zu. Gegen die Exzeptionalitätsthese spricht auch die Einsicht in die komplexe Interaktion zwischen Genom, intraorganismischen Prozessen und Umwelt. Wie sollen medizinisch und rechtlich im Umgang mit Krankheit und kranken Menschen genetische von anderen Informationen lupenrein getrennt werden? Neben der Schwierigkeit der Abgrenzung handelt man sich den Vorwurf ein, Betroffene ohne (explizite) genetische Komponente rechtlich weniger zu schützen als solche, die eine genetische Komponente nachweisen können. Genau dieser (dann notwendige) Nachweis kann entweder eine gesellschaftliche Diskriminierung und Stigmatisierung bestätigen und möglicherweise aufgrund des Neides angesichts besseren Schutzes noch verstärken. Wer von daher die Separierung genetischen Wissens von anderen medizinischen Informationen und sei es zum Zwecke der Verhinderung einer fortschreitenden (vermeintlichen) „Medikalisierung“, „Genetisierung“ oder „Molekularisierung“ der Gesellschaft will, verfällt selbst einem genetischen Reduktionismus, den er zu bekämpfen sucht. Statt also genetisches Wissen exzeptionell zu behandeln, sollte man es als einen, wenn auch hochsensiblen Faktor medizinischen Wissens, als einen Baustein im (so) gewünschten Diagnose- und Therapieprozess auf der Individuumsebene und von öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen auf der Public Health Ebene begreifen. 5.2. Konsequenzen des Befähigungsgerechtigkeitsansatzes für den Umgang mit Public Health Genetik 5.2.1. Formale und materiale Rahmenbedingungen außerhalb der Gerechtigkeitsfrage Wenn es in Public Health Genetik um die Integration eines nicht exzeptionellen, aber spezifischen, nämlich genetischen Wissens in die Aufgabenbestimmung von Public Health geht, dann sind neben der Berücksichtigung der genannten ethischen Grundwerte der Würde, der sich daraus ableitenden informationellen Selbstbestimmung wie der zu ihrer Gewährleistung nötigen Datenschutz- und Vertraulichkeitsregeln und vor der Entfaltung des Befähigungskriteriums sozialer Gerechtigkeit noch die Qualitäts- und Effizienzkriterien des HTAAssessment zu beachten. Weil in Zeiten knapper Ressourcen der nicht zielgerichtete Einsatz der (als) vorhanden(en definierten) Mittel die Knappheit verschärft und damit selbst zu einem Gerechtigkeitsproblem wird, müssen nicht nur in ökonomischer Perspektive, sondern auch in ethischer die Ressourcen, die für Public Health Genetik zur Verfügung stehen, effizient und effektiv eingesetzt werden. Die Überprüfung auf Effektivität und Effizienz schließt neben Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualitätssicherung die Frage nach analytischer und klinischer Validität und Reliabilität, 31 nach Sensitivität und Spezifität, nach positivem prädiktivem und negativem Wert ein wie insbesondere im Blick auf Tests und Screeningverfahren die bekannten WHO-Kriterien von Wilson und Junger (Wilson, Junger 1968). Nach ihnen ist über das Gesagte hinaus zu prüfen, ob eine große Relevanz der Erkrankung vorhanden, angemessene Behandlungsmöglichkeiten verfügbar sind, eine Infrastruktur für Diagnostik und Behandlung genutzt werden kann, ein Latenz- oder ein frühes symptomatisches Stadium erkennbar sind, eine hohe Akzeptanz des Screenings angenommen werden kann, ein bekannter Krankheitsverlauf vorausgesetzt wird, eine einheitliche und eindeutige Definition der Zielgruppe erfolgt, ein kostengünstiges Screening in Relation zu möglichen medizinischen Gesamtkosten implementiert, sowie eine Kontinuität des Screeningprogramms gewährleistet werden kann. Obwohl in den hier genannten Rahmenbedingungen (wie bspw. durch die Utilitätskriterien) bereits ethische Fragestellungen angerissen werden, kann man sie unter Berücksichtigung des Befähigungsgerechtigkeitsansatzes noch weiter entfalten. 5.2.2. Entfaltung gemäß Anerkennung und Umverteilung Wenn man nach Nancy Fraser das Kriterium der Befähigung zur Teilnahmemöglichkeit an Kommunikation nochmals unter dem Aspekt von Umverteilung und Anerkennung entfalten kann, dann bedeutet dies: Fokussiert man sich auf den Aspekt der Anerkennung, so sind (wie schon auf der Ebene des allgemeinen Individuumsschutzes gegenüber genetischem Wissen) Stigmatisierung und Diskriminierung zu vermeiden. Das schließt aber unter Beachtung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes auch ein, dass genetisches Wissen, da es nichts exzeptionell anderes als andere brisante Informationen beinhaltet, gleichwertig mit diesen zu betrachten ist. Wenn deshalb andere Informationen aus der Vergangenheit im Lebensversicherungs- und Berufsbereich zur jeweiligen Risikokalkulation oder zur Anstellungsfähigkeit herangezogen werden, ist (vorerst) nicht einzusehen, warum dies nicht auch für genetisches Wissen gelten sollte. Abzulehnen und rechtlich zu verhindern ist dagegen ein Zwang zum Gentest allein zum Zwecke der jeweiligen Vertragsabschlüsse. Nochmals anders verhält es sich im Krankenversicherungsschutz, der jedem eine umfangreiche Grundversorgung gewähren sollte, weil Gesundheit ein konditionales Lebensgut darstellt. Deshalb muss der Kontrahierungszwang zumindest soweit gehen, dass das genannte decent minimum gewährt wird – unabhängig von Informationen aus bereits bekannten genetischen Tests. Neben der Vermeidung von Stigmatisierung und Diskriminierung, die auch gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen gelten muss, zielt die Befähigungsgerechtigkeit auf Umverteilung. Wenn das Maß einer gerechten Gesundheitsversorgung an der alters- und konstitutions32 bedingten, integralen Teilnahmefähigkeit an sozialer Kommunikation festgemacht wird, ist nicht einzusehen, warum genetische Maßnahmen, sofern sie diesem Ziel dienen und den unter 3.2.1 skizzierten Kriterien genügen, von diesem Umverteilungskriterium ausgeschlossen werden sollten. Diese sind dann nochmals mit dem (auf objektiven, subjektiven und sozialen Dimensionen aufruhenden) jeweiligen kulturellen Verständnis von Krankheit und Gesundheit und deren modalen Aspekten wie Tragbarkeit, Dringlichkeit, Beeinflussbarkeit, Konsumferne abzugleichen. Sollten Public Health Genetik Maßnahmen wie andere krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen bewertet werden können (und nicht einem genetischen Exzeptionalismus unterliegen), dann erhalten sie zudem durch die angesprochene WilkinsonThese eine weitere Bedeutung. Wollte man sie (sofern sie den anderen Effizienz-, Qualitätsund Ethikkriterien genügen) nicht unter Maßnahmen des decent minimum fassen, könnte die gesundheitliche Ungleichheit in einer Gesellschaft weiter zunehmen. 5.2.3. Begleitendes Gerechtigkeitsnetzwerk Das an kommunikativer Freiheit orientierte Kriterium der Befähigungsgerechtigkeit wird auch dann nachhaltig in Public Health Genetik pragmatisch umgesetzt werden können, wenn es seinerseits durch ein Netzwerk aus diversen anderen Gerechtigkeitselementen gestärkt wird. Zugleich wird so dem Trug der einfachen Lösung entgegen gesteuert. Solche ergänzenden Gerechtigkeitsaspekte sind (vgl. Dabrock 2003; Dabrock 2005b): - Beteiligungs- und Verfahrensgerechtigkeit, insofern sie Partizipation und Transparenz fördern, selbst wenn sie vordergründig betrachtet Entscheidungsprozesse verlangsamen; - Generationengerechtigkeit, weil angesichts knapper Ressourcen die Chancengleichheit zukünftiger Generationen, die nicht gefragt wurden, ob sie ins Dasein kommen wollten, zur Disposition steht; - Kompensationsgerechtigkeit, weil man diejenigen, die bei möglichen Priorisierungsentscheidungen posteriorisiert wurden, nicht ins Nichts fallen lassen darf; - Leistungsgerechtigkeit, weil gesundheitsbewusstes Verhalten auf der Patientenseite und gute Medizin auf der ärztlichen Seite nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. 6. PRIORISIERUNGSREGEL BEIM GRUNDKONFLIKT AUTONOMIERESPEKT VS. GEMEINWOHL(-PFLICHTIGKEIT) Wenn gleichzeitig individuumsbezogene Schutzstandards, die für Public Health Genetik Maßnahmen zutreffen müssen, und eine gerechte Verteilung gesellschaftlicher Güter, die unter Knappheitsbedingungen effizient einzusetzen sind, greifen sollen, kann es zum Konflikt 33 zwischen Autonomierespekt und Gemeinwohl (und daraus abgeleiteter Gemeinwohlpflichtigkeit) kommen. Wie hoch ist bspw. der Verpflichtungsgrad, an Screeningverfahren teilzunehmen, wie hoch der, seine Daten für Biobanken zur Verfügung zu stellen? Über die anfänglich angesprochene selbstkritische Frage nach eigener oder fremder free-rider-Mentalität hinaus lässt sich cum grano salis unter Beachtung der möglichen Kollision der genannten moralischen und rechtlichen Güter von Autonomierespekt und Gemeinwohl(-pflichtigkeit) folgende Bewertungstendenz bzw. folgendes sozialethisches Stufenmodell einführen (vgl. Brand, Dabrock, Gibis 2003). Es trägt zudem dem allgemeinen Umstand Rechnung, dass im Allgemeinen Bewertungsfragen nicht einfach mit ‚Ja’ oder ‚Nein’ zu beantworten sind: Erfüllt eine Public Health Genetik Maßnahme die eingeführten Effizienz- und Effektivitätskriterien wie Validität, Reliabilität und Spezifität, lässt sich bei begrenztem Aufwand ein hoher individueller Nutzen im Sinne von Vermeidung einer schweren Krankheit und Förderung der individuellen Entwicklungsmöglichkeit sowie ein hoher gesellschaftlicher Nutzen im Sinne der Vermeidung hoher Kosten, die durch verzögerte Diagnosestellung, inadäquate Therapien durch Fehldiagnosen etc auftreten würden, erzielen, und muss man zudem nicht mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung der Betroffenen rechnen, so besteht ein hoher sozialethischer Verpflichtungsgrad. Dieser Verpflichtungsgrad entfaltet sich nach zwei Seiten. Sofern die genannten Kriterien zutreffen, ist zum einen die öffentliche Gesundheitsversorgung zur Bereitstellung und damit gleichzeitig auch zur Sicherstellung dieser Public Health Genetik Maßnahmen verpflichtet – nicht zuletzt auch, um einer Entsolidarisierung entgegen zu wirken. Zum anderen besteht in diesen Fällen auch seitens der betroffenen Individuen angesichts des eher geringen Schadens für sie wie ihre Familie (Eingriff in die formale Selbstbestimmung; minimale Diskriminierungstendenz), aber der hohen ökonomischen Folgen bei Nichtteilnahme eine hohe moralische Verpflichtung zur Teilnahme an der entsprechenden Maßnahme. Obwohl die Teilnahme unter den genannten Bedingungen als ein moralisch-sittlicher Imperativ zu lesen ist, bedeutet dies nicht, ihn notwendigerweise unmittelbar in einen rechtlichen Zwang zu transformieren. Angesichts der bewährten Sinnhaftigkeit einer auf negativer Freiheit und „informed contract“ aufbauenden Rechtskultur kann man darüber nachdenken, auf der rechtlichen Ebene das Prinzip der Freiwilligkeit zu wahren und sich dabei dennoch nicht allein auf die standardisierte nondirektive Beratung zu beschränken. Dass hier nicht einfach ethische Ableitungen greifen, sondern die jeweilige gesellschaftliche Einstellung beachtet werden muss, hängt damit zusammen, dass moralische Fragen im sittlich-politischen Diskurs nicht einfach deduktiv zu handhaben sind, sondern mit kulturellen Standards abgeglichen werden müssen. Denn nur so kann die neben der moraltheoretischen Geltung ebenso wichtige 34 Akzeptanz und Reproduzierbarkeit sittlicher Urteile gewahrt werden. Aus dem so als Metaregel zu Interpretierenden ist umgekehrt aber genauso eindeutig zu schließen: Wo die genannten Rahmenbedingungen schwächer werden, sinkt der Verpflichtungsgrad zur Teilnahme an genetischen Gesundheitsversorgungsmaßnahmen, entsprechend sollte die Beratung nondirektiver durchgeführt werden. Umgekehrt formuliert: Die Ablehnung der Teilnahme wird moralisch weniger begründungspflichtig. Im Übrigen stellt sich die gesundheitsökonomische und damit auch gerechtigkeitspraktische Frage, ob bei Public Health Genetik Maßnahmen überhaupt der hohe Beratungsstandard, wie er aus der medizinischen Humangenetik bekannt ist, aufrecht erhalten werden kann. Sollte dies, was wahrscheinlich ist, kaum möglich sein, wird man zur Festlegung des Beratungsumfangs neben den ökonomischen Zwängen vor allem die jeweils betroffene Eingriffstiefe in die informationelle Selbstbestimmung berücksichtigen müssen. Die vorgeschlagene Priorisierungsregel transportiert keineswegs einen in der weltanschaulich pluralen Gesellschaft inakzeptablen Gesundheitspaternalismus. Das Gegenteil trifft zu: Erst durch die Sicherstellung elementarer Bedingungen (sog. konditionaler Güter) sind verschiedene mögliche Formen des gelingenden Lebens überhaupt realisierbar. Ohne Beachtung dieser primären Grundgüter bleibt ihrerseits die Rede von der Freiheit leer und kann zu Ungunsten der Benachteiligten ausgelegt werden, insofern diese unter einer rein formalen Freiheitsideologie, aber fehlender Gewährung von Chancengleichheit ihre Freiheit realiter nicht ausgestalten können. Diese reale Freiheit wählt der hier als Grundnorm zuvor eingeführte Befähigungsgerechtigkeitsansatz. Zählt man die Verhältnisbestimmung von Gemeinwohl und Eigennutz zu dem ethischen Problemkomplex: „Autonomierespekt vs. Gemeinwohl“, dann ist hierin auch die Frage nach einem direkten oder indirekten benefit-sharing einzelner Teilnehmer oder teilnehmender (Sub)Populationen an Public Health Genetik Maßnahmen zu thematisieren (Nationaler Ethikrat 2004). Wenn aus Biobanken oder pharmakogenetischen Forschungen ein wissenschaftlicher oder finanzieller benefit erwächst, so könnten die Teilnehmer direkt, indirekt oder überhaupt nicht beteiligt werden. Letztere Variante müsste sich dem Vorwurf der Ausbeutung stellen, erstere sieht sich dem Verdacht ausgesetzt, über ökonomische Anreizstrukturen biopolitischer Sozialdisziplinierung (s. Kap. 1.4.) Vorschub zu leisten. Sollte diese Variante des direkten benefits für den Probanden allerdings gewollt sein, böte sich mit dem „informed contract“ ein Instrument, das die Verteilung der benefits im Einzelfall rechtsgültig festschreibt. Bei der mittleren Variante ist zu überlegen, wie (bei allem drohenden trade-off) ein möglichst effektiver und gerechter Weg jenseits von Ausbeutung und Sozialdisziplinierung zu finden ist. Als 35 Faustregel könnte gelten: Nicht Einzelne, sondern dem öffentlichen Gesundheitswesen, dem die Einzelnen zugehören, sollten wissenschaftliche und finanzielle benefits angerechnet werden. Das jeweilige Maß gehört ebenso in die politische Deliberation (unter Beachtung von echten Partizipationsrechten) wie auch deliberativ zu klären ist, ob die benefits dem Gesundheitssystem global zufließen sollen oder solchen weiteren Forschungs- oder Umsetzungsprojekten zu gute kommt, die nahe bei denen angesiedelt sind, in denen die Erträge erzielt wurden. Während man die letztere Möglichkeit generaliter als eine problematische, weil falsche Anreize setzende Strategie einordnen zu gewillt ist, wird man im speziellen bei orphan-drugFragen oder umwelt- oder arbeitsmedizinischen Fragestellungen nochmals diese Möglichkeit nicht prinzipiell ausschließen wollen. 7. AUSBLICK Bringt man das Dargestellte auf den (metaphorischen) Punkt, mag man an die Liedzeile „Bleibt alles anders“ von Herbert Grönemeyer denken. Auf der einen Seite bleibt alles anders. Man kann bei der ethischen Bewertung von Public Health Genetik auf bewährte ethische Kriterien und Urteilsmuster und auf aus bestimmten geschichtlichen Traditionen kommende Vorstellungen über das Menschsein zurückgreifen. Dennoch bleibt alles anders. D.h.: Es kommt oder es kann kommen durch die Entwicklung der Genetik und ihrer möglichen Anwendung auf Public Health zu einer Intensivierung von Konflikten, die die Anwendung dieser althergebrachten ethischen Kriterien noch einmal vor neue Herausforderungen stellt. Inhaltlich im Blick auf das hier Vorgetragene präzisiert: Weil sich auf die Genetik teils überzogene Hoffnungen, teils übertriebene Ängste richten, erscheint der Fähigkeitenansatz durch die konstitutive Integration der Bildungsdimension als eine sinnvolle normativ-ethische Konzeption, um die (zumindest ökonomisch nicht mehr aufzuhaltende) Integration genetischer Maßnahmen in die Gesundheitsversorgung kritisch, aber auch konstruktiv begleiten zu können. 36 LITERATUR Beauchamp TL, Childress JF: Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press. 5.Aufl. 2001 Bora A: Rechtliches Risikomanagement. Form, Funktion und Leistungsfähigkeit des Rechts in der Risikogesellschaft. Berlin: Duncker & Humblot 1999 Brand A, Dabrock P, Gibis B: Neugeborenen-Screening auf angeborene Stoffwechselstörungen und Endokrinopathien – aktuelle ethische Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven. In: Dörries, A et al.: (Hrsg.): Das Kind als Patient - Ethische Konflikte zwischen Kindeswohl und Kindeswille. Jahrestagung der Akademie für Ethik in der Medizin e.V.. Tutzing 2002. Frankfurt/M.: Campus 2003 S. 217233. Brand A, Dabrock P, Paul N; Schröder P: Gesundheitssicherung im Zeitalter der Genomforschung. Diskussion, Aktivitäten und Institutionalisierung von Public Health Genetics in Deutschland. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung 2004. Bundesärztekammer: Richtlinien zur prädiktiven genetischen Diagnostik. In: Deutsches Ärzteblatt 100 (2003), S. 1297-1305. Buchanan A, al.: From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge: Cambridge University Press 2000 Dabrock P: Capability-Approach und Decent Minimum. Befähigungsgerechtigkeit als Kriterium möglicher Priorisierung im Gesundheitswesen. In: Zeitschrift für Evangelische Ethik 46 (2001), S. 202215. Dabrock P: Zum Status angewandter Ethik in Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann. In: Jähnichen T, et al. (Hrsg.): Flexible Welten. Münster: Lit 2002, S. 11-42 Dabrock P: Genetik und soziale Gerechtigkeit. Systematische Überlegungen im Gespräch mit ‚From Chance to Choice’. In: Dabrock P, et al.: (Hrsg.): Kriterien der Gerechtigkeit. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003,S. 192-214. Dabrock, Peter: „Menschenbilder und Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen. Perspektiven theologischer Sozialethik.“ In: Deutsche Medizinische Wochenschrift 128, 2003: 210-213. Dabrock P et al.: Menschenwürde und Lebensschutz. Herausforderungen theologischer Bioethik. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004 Dabrock P: Weniger kann mehr sein. Die bereichernde Belastung des Sinns für Ungerechtigkeit im ethischen Theoriemodell des weiten Überlegungsgleichgewichts. In: Gabriel K, Kruip G (Hrsg.): Sinn für Ungerechtigkeit. Baden-Baden: Nomos 2005a, S. 117-137 Dabrock P: Befähigungsgerechtigkeit als Kriterium zur Beurteilung von Grundversorgungsmodellen im Gesundheitswesen. Anmerkungen und Alternativen zu einem Vorschlag Stefan Husters. In: Rauprich O. et al. (Hrsg.): Gleichheit und Gerechtigkeit in der modernen Medizin. Paderborn: Mentis 2005b, S. 215-247 Dabrock P: Inklusion und soziale Gerechtigkeit. Eine theologisch-sozialethische Suchbewegung zwischen Rawls und Luhmann. In: Thomas G, et al. (Hrsg.): Luhmann und die Theologie. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 2006, S. 125-142 Deutscher Bundestag: Schlussbericht der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin. Berlin 2002 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Prädiktive genetische Diagnostik. Wissenschaftliche Grundlagen, praktische Umsetzung und soziale Implementierung. Stellungnahme der Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung. Bonn, 2003 Droste S, Gerhardus A, Kollek R: Methoden zur Erfassung ethischer Aspekte und gesellschaftlicher Wertvorstellungen in Kurz-HTA-Berichten – eine internationale Bestandsaufnahme. Köln: DIMDI 2003 Faden RR, Beauchamp TL: A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford University Press 1986. 37 Feuerstein G, Kollek R, Uhlemann T: Gentechnik und Krankenversicherung. Neue Leistungsangebote im Gesundheitssystem. Baden-Baden: Nomos 2002 Forst, R: Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994 Fraser N, Honneth A: Umverteilung oder Anerkennung. Eine politisch-philosophische Kontroverse. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2003 French, ME, Moore, JB: Harnessing Genetics to Prevent Disease and Promote Health. Washington: Partnership for Prevention 2003 Geier M, Schröder P: The Concept of Human Dignity in Biomedical Law. In: Sándor J, den Exter, AP (Hrsg.): Frontiers of European Health Law: A Multidisciplinary Approach. Delft: Erasmus University Press-DocVision 2003, S. 146-182 Gehring P: Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens. Frankfurt/M.: Campus 2006 Geisler LS: Der Mensch als gläserner Patient. Referat anlässlich der 4. Fachtagung Gesund in eigener Verantwortung? Patientenrechte in der Diskussion 28./29. September. Dresden 2001 Gert B, Clouser D, Culver C: Bioethics: A Return to Fundamentals. New York: Oxford University Press 1997 Gosepath S: Gleiche Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2004 Grunwald A (Hrsg.): Technikgestaltung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Berlin: Springer 2003 Hennen L, et al.: Das genetische Orakel. Prognosen und Diagnosen durch Gentests – eine aktuelle Bilanz. Berlin: Edition Sigma 2001 Häyry M: European Values in Bioethics: Why, What, and How to Be Used? In: Theoretical Medicine 24 (2003), S. 199-214 Höffe O: Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat. Frankfurt/M: Suhrkamp 1987 Japp KP: Risiko. Bielefeld: Transcipt 2000 Kissell JL: Complicity in Thought and Language: Toleration of Wrong. In: Journal of Medical Humanities 20 (1999), S. 49-60 Kollek R, Feuerstein G, Schmedders M: Pharmakogenetik: Implikationen für Patienten und Gesundheitswesen. Baden-Baden: Nomos 2004 Krebs A (Hrsg.): Gleichheit oder Freiheit. Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000 Leist A: Angewandte Ethik zwischen theoretischem Anspruch und sozialer Funktion. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 5 (1998) S. 753-77 Lemke T: Die Regierung der Risiken. Von der Eugenik zur genetischen Gouvernementalität. In: Bröcking U, et al. (Hrsg.): Gouvernementalität. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000, S. 227-264 Lösch A: Genomprojekt und Moderne. Soziologische Analysen des bioethischen Diskurses. Frankfurt/M.: Campus 2001 Luhmann N: Soziologie des Risikos. Berlin: de Gruyter 1991 Mack E: Gerechtigkeit und gutes Leben. Christliche Ethik im politischen Diskurs. Paderborn: Schönigh 2002 Macklin R: Privacy and Control of Genetic Information. In: Annas G, Sherman E (Hrsg.): Gene Mapping. Using Law and Ethics as Guides. New York: Oxford University Press 1992, S. 157-172 Michigan Center for Genomics & Public Health o.J.: Ethical, Legal and Social Issues in Public Health Genetics (PHELSI). Key Points, URL: http://www.sph.umich.edu/genomics/media/subpage_autogen/PHELSI.pdf. 38 Murray, Thomas: „Genetic Exceptionalism and ‘Future Diaries’: Is Genetic Information Different from Other Medical Information?“ In: Rothstein, Mark (Hg.): Genetic Secrets: Protecting Privacy and Confidentiality in the Genetic Era. New Haven: Yale University Press, 1997: 60-73. Nationaler Ethikrat: Biobanken für die Forschung. Stellungnahme. Berlin: Nationaler Ethikrat 2004 Nussbaum MC: Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Frankfurt: Suhrkamp 1999 Nussbaum MC: Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Belknap Press, 2006 O’Neill O: Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press 2002 Pauer-Studer H: Autonom Leben. Reflexionen über Freiheit und Gleichheit. Frankfurt: Suhrkamp 2000 Paul NW.: Auswirkungen der Molekularen Medizin auf Gesundheit und Gesellschaft. Gutachten Biound Gentechnologie für die Friedrich Ebert Stiftung. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung 2004 Powers M, Faden R: Social Justice: The Moral Foundation of Public Health and Health Policy. Oxford: Oxford University Press 2006 Regenauer A: Gentests und Lebensversicherung. In: Honnefelder L, Propping P (Hrsg.): Was wissen wir, wenn wir das menschliche Genom kennen? Köln: DuMont 2001, S. 289-291 Rawls J: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1975 Rawls J: Politischer Liberalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998 Sass HM: A Contract Model for Genetic Research and Health Care for Individuals and Families. In: Eubios Journal of Asian and International Bioethics 11 ( 2001), S. 130-132 Sass HM: Patienten- und Bürgeraufklärung über genetische Risikofaktoren. In: Sass HM, Schröder P (Hrsg.): Patientenaufklärung bei genetischem Risiko. Münster: LIT 2003, S. 42-55 Sass HM: Diffentialethik. Hg. von E Baumann, A Brink, A May. Münster: LIT 2006 Schröder P: Gendiagnostische Gerechtigkeit. Münster: LIT 2004 Schweizerischer Bundesrat: Botschaft zum Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen. 11. September 2002. http://www.ofj.admin.ch/themen/genomanalyse/bot-genom-d.pdf Sen A: Development as Freedom. New York: Anchor Books 1999 Spaemann R: Personen. Versuche über den Unterschied zwischen etwas und jemand. Stuttgart: KlettCotta 1996 Smith K, Croyle RT: Attitudes toward Genetic Testing for Colon Cancer Risk. In: American Journal of Public Health 85 (1995) S. 1435-1438 Tauber AI: Sick Autonomy. In: Perspectives in Biology and Medicine 46(4) (2003) S. 484-495 Taupitz J: Genetische Diagnostik und Versicherungsrecht. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 2000 The Report of the President’s Council on Bioethics: Human cloning and human dignity. New York: Public Affairs 2002 Waldenfels B: Grenzen der Normalisierung. Studien zur Phänomenologie des Fremden 2. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998 WHO: Genomics and the World Health. Report of the Advisory Comitee on Health Research. Genf: WHO 2002 Wilkinson RG: Kranke Gesellschaften. Soziales Gleichgewicht und Gesundheit. Wien: Springer 2001 Wilson JMG, Jungner G: Principles and practice of screening for disease. Public Health Papers 34. World Health Organization (WHO) Geneva 1968 Zimmerli W: Who has the right to know the genetic constitution of a particular person? In: Chadwick D, et al. (Hrsg.): Human Genetic Information: Science, Law, and Ethics. Chichester: John Wiley & Sons, 1990 S. 93-102. 39 Zentrum für Medizinische Ethik Medizinethische Materialien Eine vollständige Hefteliste senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Heft 156: Kreß, Hartmut: Sterbehilfe - Geltung und Reichweite des Selbstbestimmungsrechts in ethischer und rechtspolitischer Sicht.1. Auflage September 2004, 3. Auflage März 2005. Heft 157: Fröhlich, Günter und Rogler, Gerhard: Das Regensburger Modell zur Ausbildung in klinischer Ethik. Dezember 2004. Heft 158: Ilkilic, Ilhan; Ince, Irfan und Pourgholam-Ernst, Azra: E-Health in muslimischen Kulturen. Dezember 2004. Heft 159: Lenk, Christian; Jakovljevic, Anna-Karina: Ethik und optimierende Eingriffe am Menschen. 2.Auflage Februar 2005. Heft 160: Ilkilic, Ilhan: Begegnung und Umgang mit muslimischen Patienten. Eine Handreichung für die Gesundheitsberufe. 1. Auflage Juli 2003 (Tübingen), 5. Auflage April 2005. Heft 161: Hartmann, Fritz: Vom Diktat der Menschenverachtung 1946 zur "Medizin ohne Menschlichkeit" 1960; Zur frühen Wirkungsgeschichte des Nürnberger Ärzteprozesses. 1. Auflage Februar 2005, 2. Auflage März 2005. Heft 162: Strätling, Meinolfus u.a.: Die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung in Deutschland. Juni 2005. Heft 163: Sass, Hans- Martin: Abwägungsprinzipien zum Cloning menschlicher Zellen. Januar 2006. Heft 164: Vollmann, Jochen: Klinische Ethikkomitees und klinische Ethikberatung im Krankenhaus. Ein Praxisleitfaden über Strukturen, Aufgaben, Modellen und Implementierungsschritte. Januar 2006. Heft 165: Sass, Hans- Martin: Medizinische Ethik bei Notstand, Krieg und Terror. Verantwortungskulturen bei Triage, Endemien und Terror. Februar 2006. Heft 164: Vollmann, Jochen: Klinische Ethikkomitees und klinische Ethikberatung im Krankenhaus. Ein Praxisleitfaden über Strukturen, Aufgaben, Modellen und Implementierungsschritte. 1. Auflage Januar 2006, 4. Auflage April 2006. Heft 165: Sass, Hans- Martin: Medizinische Ethik bei Notstand, Krieg und Terror. Verantwortungskulturen bei Triage, Endemien und Terror. 1. Auflage Februar 2006, 3. Auflage März 2006. Heft 166: Sass, Hans-Martin: Gesundheitskulturen im Internet. E-Health-Möglichkeiten, Leistungen und Risiken. 1. Auflage Februar 2006, 2. Auflage März 2006. Heft 167: May, Arnd T.; Kohnen, Tanja: Körpermodifikation durch Piercing: Normalität, Subkultur oder Modetrend? Mai 2006 Heft 168: Anderweit, Sabine; Ilkilic, Ilhan; Meier-Allmendinger, Diana; Sass, Hans-Martin; Cheng-tek Tai, Michael: Checklisten in der klinisch-ethischen Konsultation. Mai 2006 Heft 169: Kielstein, Rita; Kutzer, Klaus; May, Arnd; Sass, Hans-Martin: Die Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis. April 2006 Heft 170: Brenscheidt, Juliane; May, Arnd T.; May, Burkard; Kohnen, Tanja; Roovers, Anna; Sass, Hans-Martin: Zentrum für Medizinische Ethik Bochum 1986 – 2006. Heft 171: Dabrock, Peter; Schröder, Peter: Public Health Gen-Ethik. 1. Auflage August 2006. Bestellschein An das Zentrum für Medizinische Ethik Ruhr-Universität Bochum Gebäude GA 3/53 44780 Bochum Tel: (0234) 32 22749/50 FAX: (0234) 3214 598 Email: [email protected] Homepage: http://www.medizinethik-bochum.de Bankverbindung: Konto Nr. 133 189 035, BLZ 430 500 01 Sparkasse Bochum Name oder Institut: Adresse: ( ) Hiermit abonniere(n) wir/ich die Reihe MEDIZINETHISCHE MATERIALIEN zum Sonderpreis von € 4,00 pro Stück ab Heft Nr.____. Dieser Preis schließt die Portokosten mit ein. ( ) Hiermit bestelle(n) wir/ich die folgenden Einzelhefte der Reihe MEDIZINETHISCHE MATERIALIEN zum Preis von € 6,00 (bei Abnahme von 10 und mehr Exemplaren € 4,00 pro Stück). Hefte Nummer: _____________________________________________ Zusammenfassung: Die Integration molekulargenetischen Wissens in Public Health stellt die biomedizinische Ethik vor neue Herausforderungen. Es gilt die Spannung zwischen a) der Ausrichtung auf Gruppen und deren Nutzen, wie es Public Health eigen ist, und b) den Individualrechten, wie sie im Bereich der individuumsbezogenen Humangenetik als Standard gelten, wahrzunehmen und ethisch verantwortlich wie pragmatisch umsetzbar zu gestalten. Die Autoren diskutieren in diesem Zusammenhang adäquate ethische Ansätze, mit denen man den sich anbahnenden Konflikte begegnen kann. Neben Erörterungen zum "informed consent" und auch Fragen zur Vertraulichkeit und Datenschutz, führen sie speziell den Befähigungsgerechtigkeitsansatz ein, den sie als angemessene Konkretisierung des Prinzips Gerechtigkeit im Ausgleich zwischen Gruppennutzen und Wahrung individueller Integrität plausibilisieren. Abstract: This paper deals with societal challenges of Public Health Genetics. After describing the challenges of molecular genetics in general and Public Health Genetics in particular, it reflects on ethical norms in this context, including specific discussions of informed consent and confidentiality. A first emphasis is put on the difference between the idea of the good and the right. Then the capabilities approach is introduced as the adequate concept of justice in Public Health Genetics. Considering the conflict between respect for autonomy and common welfare, the implications of the capabilities approach for Public Health Genetics are discussed. ISBN:3-931993-52-3