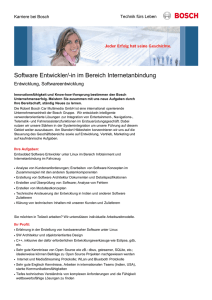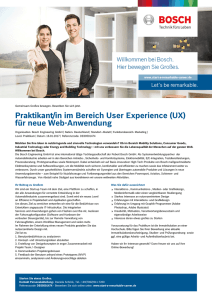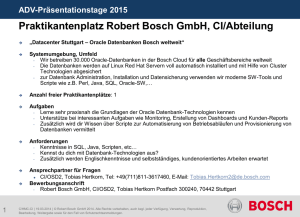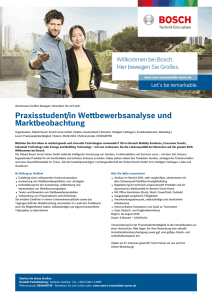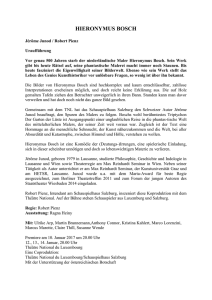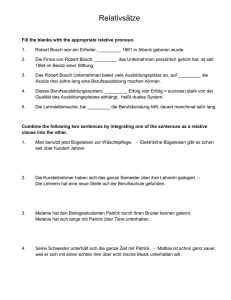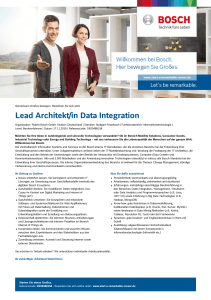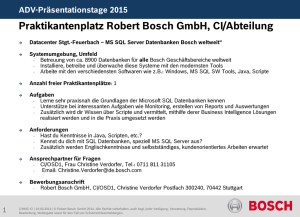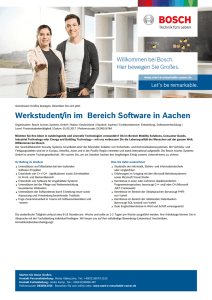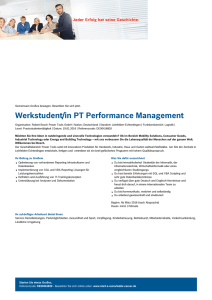Musikstunde: Geigenbauer I
Werbung

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Musikstunde Die Welt des Hieronymus Bosch Zum 500. Todestages des Malers aus Brabant (1) Von Bettina Winkler Sendung: Montag, 08.08. 2016 Redaktion: Bettina Winkler 9.05 – 10.00 Uhr Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Mitschnitte auf CD von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Musik sind beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für € 12,50 erhältlich. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert.Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2 2 „Musikstunde“ mit Bettina Winkler Die Welt des Hieronymus Bosch Zum 500. Todestages des Malers aus Brabant (1-5) SWR2 8. bis 12. August 2016 9h05 – 10h00 Teil 1 – Mehr als ein Monstermaler Signet …mit Bettina Winkler. In dieser Woche will ich Sie in die Welt des Hieronymus Bosch mitnehmen – vor 500 Jahren starb er in seiner Heimatstadt ‘sHertogenbosch in Nord-Brabant. Monstermaler mit Jenseitsvisionen auf Wimmelbildern – das sind gleich drei Klischees, die über diesen Maler kursieren – ob das wirklich so stimmt? Wir werden sehen. Vor allem möchte ich in diesen fünf Tagen Boschs Welt und seine Bilder zum Klingen bringen. Auf unserer SWR2-Seite im Internet finden Sie mehrere Links, mit deren Hilfe sie sich viele der Bilder, von denen ich erzählen werde, anschauen können. Ganz allein bin ich bei meiner Erkundungstour durch Boschs Welt allerdings nicht, denn mir ist eine Begleitung zugeflogen…. G0000625-040, 0'05 Käuzchen ruft (2. Ruf) Indikativ ca. 0‘20 Immer wieder fällt sie mir ins Auge, eine Eule oder eher ein Käuzchen, vielleicht ein Steinkauz – fast auf allen Bildern des niederländischen Malers Hieronymus Bosch begegnet mir dieser Vogel. Mal klar erkennbar, mal gut versteckt. Der spanische Historiker, Dichter und Theologe José de Sigüenza schreibt 1605 über Boschs Bilder: „Ich möchte nur noch bemerken, dass er in fast allen Bildern…das Feuer und die Eule zeigt. (..)Durch die letztere sagt er, dass seine Gemälde Werke des Denkens und des Überlegens sind und dass man sie nachdenklich betrachten muss. Die Eule ist ein Nachtvogel, geweiht der Minerva und der Weisheit, das Symbol Athens, wo die Philosophie blühte, die sich in der Stille und im Schweigen der Nacht erhebt.“ – Das klingt doch vielversprechend. In der christlichen Ikonographie wird die Eule jedoch nicht als Symbol der Weisheit interpretiert. Hier steht sie vielmehr für heimtückisches Verhalten und Sünde, für das Böse, für Torheit oder Trug. Auf einer von Boschs Feder-Zeichnungen steht oder vielmehr sitzt eine fast überdimensionale Eule sogar im Mittelpunkt, der Titel: Der Wald hat Ohren, das Feld hat Augen – ein altes Sprichwort im Sinne von „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“. Aus der Höhle eines abgestorbenen Baumes heraus blickt sie den 3 Betrachter skeptisch von der Seite an, in den Wurzeln sitzt ein Fuchs, der wohl gerade einen Hahn erlegt hat. Im Wald zwischen den Baumstämmen stehen zwei überdimensionale Ohren, aus der Wiese heraus schauen sieben Augen hervor. Ist diese Zeichnung vielleicht eine Art Selbstporträt des Malers und seiner Lebenseinstellung? – das vermutet jedenfalls der Wiener Kunsthistoriker Otto Benesch. Hieronymus nennt sich Bosch, Bosch bedeutet Busch oder Gebüsch, seine Heimatstadt heißt ‘s-Hertogenbosch – übersetzt Herzogenbusch. Der Kunsthistoriker und Medientheoretiker Hans Belting schreibt über dieses Bild, es sei eine subtile Darstellung von Boschs Lebensphilosophie und Überlebensstrategie im gefährlichen Stadtleben. Damit bekommen der tote Baum und die Eule und der Fuchs, die Schutz in ihm suchen, eine ganz eigene Bedeutung. Während die Vögel in den Zweigen über der Eule laut schreien und flattern und so die Aufmerksamkeit und auch die Gefahr auf sich ziehen, verstecken sich Eule und Fuchs in aller Stille. Ein Zeichen von Weisheit? Diese kleine Eule habe ich mir also als Führerin durch die phantastischen Visionen dieses Malers aus Brabant ausgesucht. Teufelsmacher nennt ihn Maurice Gossart in seiner Monographie von 1907, ein Prädikat, das ihm schon seit dem 16. Jahrhundert anhaftet. Karel van Mander schreibt in seinem Malerbuch von 1604: „Wer sollte wohl all die wunderlichen und seltsamen Phantasien aufzählen können, die Hieronymus Bosch in seinem Kopfe gehabt und mit dem Pinsel dargestellt hat, all den Spuk und die Ungeheuer der Hölle, die manchmal mehr grauenerregend als ansprechend anzusehen sind. […] Es ist wunderbar, was hier alles an grotesken Spukgestalten zu sehen ist, und wie schön und natürlich er Flammen, Brände, Glut und Rauch wiederzugeben verstanden hat.“ Die verblüffende Überschwänglichkeit der Phantasie, die unvorstellbare Darstellung auch noch des kleinsten Details lässt die Betrachter von Boschs Bildern immer wieder von neuem staunen. Und es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich ihnen auszuliefern – so wie es der große niederländische Reiseschriftsteller Cees Nooteboom in seinem aktuellen Buch „Reisen zu Hieronymus Bosch – Eine düstere Vorahnung“ tut. Neben all den seltsamen und auch unheimlichen Figuren vergisst man schnell die charakteristischen Menschen-Bilder, die Landschaftsentwürfe im Hintergrund von Boschs Gemälden und die Genre-Szenen, die ihn als ausgezeichneten Beobachter kennzeichnen. Boschs Universum ist voller Bilder, die aus Träumen und Alpträumen zu kommen scheinen. War seine eigene Welt so alptraumhaft? Harry Mulisch hat irgendwann einmal gesagt: „Das Beste ist, das Rätsel zu vergrößern.“ Ich will das Rätsel Bosch nicht unbedingt vergrößern – verkleinern kann ich es schon gar nicht, ich möchte aber seinen Bildern mit Musik antworten. 4 Musik 1 Loyset Compère: O bone Jesu Orlando Consort 07533 hyperion CDA68069, Take 10, 3’10 „O bone Jesu“, eine Motette des franko-flämischen Komponisten Loyset Compère, einem Zeitgenossen von Hieronymus Bosch, es sang das Orlando Consort. Vor 500 Jahren starb der Maler, am 9. August 1516 gab es in der Johanniskirche seiner Heimatstadt ‘s-Hertogenbosch ein Requiem für ihn, das die Liebfrauenbruderschaft, der er seit vielen Jahren angehört hatte, ausrichtete. Den genauen Todestag weiß man nicht. Wahrscheinlich wurde er Opfer einer Rippenfellentzündung, die zu dieser Zeit in ‘s-Hertogenbosch grassierte und an der so viele Menschen starben, „als ob die Pest geherrscht hätte“, wie in der Stadtchronik zu lesen ist. Doch vor dem Sterben kommt erst einmal das Geboren werden – und auch da gibt es keine exakten Angaben, irgendwann um 1450 muss Bosch als fünftes Kind des Malers Anthonius van Aken in ‘s-Hertogenbosch auf die Welt gekommen sein. Anthonius führte bereits in zweiter Generation eine der angesehensten Malerwerkstätten der Stadt, sein Vater, Jan van Aken, hatte sich um das Jahr 1427 aus Nijmwegen kommend als Maler in der Stadt niedergelassen. Und schon dessen Vater, Boschs Urgroßvater Thomas, war Maler. Aus Aachen – woher sich auch der ursprüngliche Familienname van Aken ableitet – war er 1404 in die Niederlande gezogen – also eine richtige Malerdynastie. Boschs Taufname lautete Jheronimus, umgangssprachlich Joen oder Jeroen, sein vollständiger, gelegentlich in Akten gebrauchter Name war Jheronimus Anthoniszoon van Aken. Erst später wählte er mit Blick auf seine Heimatstadt ‘s-Hertogenbosch oder kurz Den Bosch das Toponym „Bosch“ als Namenszusatz und signierte so auch seine Bilder. Als Hieronymus zur Welt kam, lebte noch Karl der Kühne, der übermütige Burgunderherzog. In der Schlacht von Nancy im Januar 1477 verlor er gegen das lothringisch-eidgenössische Heer nicht nur sein Herzogtum, sondern auch sein Leben. Burgund hörte auf, ein selbständiges politisches Gebilde zu sein, und nur durch Heirat mit dem Kaisersohn Maximilian konnte Karls Erbtochter Maria verhindern, dass Burgund und alle Teile der Niederlande, die ihr Großvater und ihr Vater dem Herzogtum einverleibt hatten, an Frankreich fielen. Aus dieser Verbindung zwischen Maria und Maximilian stammte neben Margarete von Österreich auch Philipp der Schöne, der wiederum Johanna von Kastilien, genannt die Wahnsinnige, heiratete. Ihr Sohn war Karl V., jener HabsburgerKaiser, in dessen Reich die Sonne niemals unterging. Bei der Schlacht von Nancy war auch Hayne van Ghizeghem dabei, Komponist und Dichter am Hofe Karls des Kühnen. Nur zwei seiner Lieder sind überliefert: 5 "Amours, amours" und "De tous biens playne" – hier in einer Instrumentalfassung mit Les Flamboyants. Musik 2 Hayne van Ghizeghem "De tous biens playne" (instr.) Les Flamboyants Raumklang RK 2005, Take 1, 1'55 Kämpfe und Schlachten, auf die einfache Bevölkerung kommen sie herab wie unausweichliche Naturgewalten. Erst um 1496 konnten die flämischen Städte und der niederländische Adel mit Maximilian als neuem Landesherrn ihre teils gewalttätigen Auseinandersetzungen beilegen und für Stabilität sorgen. Und bald avancierte ‘s-Hertogenbosch – inmitten sumpfigen Geländes auf einem Decksandrücken südlich von Rhein und Maas gelegen – zu einem militärstrategischen Brückenkopf für die Habsburger. Der britische Maler und Schriftsteller John Ruskin schreibt 1860 über Boschs Zeit: „Während Fra Angelico [der italienische Renaissance-Maler ] in seinem Olivenhain betete und klagte, hatte man auf den nasskalten Feldern Flanderns anderes zu tun – die wilde See mit Deichen zu bannen, endlose Kanäle auszuhaben…frostigen Klee zu pflügen und zu ernten, kräftige Pferde aufzuziehen und fette Kühe, Steinmauern zu errichten gegen Wind und Schnee.“ Brände in den Städten waren damals keine Seltenheit, sie glichen Naturkatastrophen, vor denen es kein Entrinnen gab – am 13.Juni 1463 gab es in ‘s-Hertogenbosch ein verheerendes Feuer, das auch nicht vor Boschs Elternhaus Halt machte. Ein Erlebnis, das den jungen Jeroen wohl sehr beeindruckt hat. Betrachtet man seine Höllen- und Weltuntergangsszenarien, so lodert und brennt es überall im Hintergrund und züngelt zwischen schwarz verkohlten Gebäuden. Das ist schon die Hölle auf Erden, ein Vorgeschmack auf das Fegefeuer, dem die Verdammten und Ungläubigen ausgeliefert sind – und wohl eine eindrückliche Umsetzung der eigenen Kindheitserinnerungen. Musik 3 M0050813-011, 2'23 Pärt, Arvo Arbos. Für Bläser und Schlagzeug Württembergischen; Davis, Dennis Russell Brass Ensemble des Das Brass Ensemble des Württembergischen Staatstheaters unter der Leitung von Dennis Russell Davis mit Arvo Pärts „Arbos“. Es scheint fast so, als hätte Hieronymus Bosch seine Heimatstadt so gut wie nie verlassen. Nur um 1500 gibt es eine Lücke in den wenigen vorhandenen Dokumenten, was aber vielerlei Gründe haben kann. In seinen Bildern kann man 6 keinerlei Einflüsse der neuen Ästhetik der italienischen Renaissance erkennen. Boschs Gemälde sind das Werk eines Forschers, eines Abenteurers im Geiste; alle Utensilien für seine Reisen im Geiste fand er hier vor Ort – so der amerikanische Schriftsteller und Fantasy-Autor Peter S. Beagle. In seiner Heimat trifft der Maler offensichtlich auf ein Umfeld, das es ihm erlaubt, seiner Phantasie und seiner Ästhetik freien Lauf zu lassen. Sicherlich trug dazu auch die Heirat mit Aleyt van der Mervenne um 1480 bei. Sie stammte aus einer begüterten Kaufmannsfamilie und verfügte über Geld, Grundbesitz und eine weitverzweigte Verwandtschaft – also eine richtig gute Partie. Durch zahlreiche Erbschaften fielen ihr diverse Ländereien in der Umgebung von ‘s-Hertogenbosch und ein am Marktplatz gelegenes Haus zu. In dieses Haus „In den Salvatoer“ – „Zum Erlöser“, das nur wenige Schritte von Boschs Elternhaus stand, zog das Ehepaar ein, es bot genügend Platz für eine Malerwerkstatt, deren Mitarbeiter und für zusätzliches Hauspersonal, das dort ebenfalls untergebracht war. Im Gegensatz zu anderen Malern, die auf Aufträge angewiesen waren, konnte es sich Bosch zumindest teilweise erlauben, das zu malen, was er malen wollte, wie Paul Vandenbroeck in einer Abhandlung über Bosch schreibt – und man darf da sicherlich noch ergänzen: so zu malen, wie er malen wollte. Diese in jeglicher Hinsicht lukrative Ehe, die allerdings ohne Kinder blieb, mag mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass Bosch in die renommierte Liebfrauenbruderschaft aufgenommen wurde, die der Johanniskirche angehörte und religiöse mit wohltätigen Zielen verband. Zunächst war er nur einfaches Mitglied, ab 1488/89 durfte er sich frater juratus oder „gezworen broeder“ nennen. Die Verbindungen, die Bosch hier knüpfen konnte, waren nicht nur für seine soziale Stellung innerhalb der städtischen Gesellschaft von Vorteil, hier entstanden auch Kontakte zu potentiellen Auftraggebern. Zu den ersten Aufträgen der Bruderschaft gehörten zwei Altartafeln mit Johannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten, die um 1488 entstanden sind. Johannes der Täufer war zusammen mit der Gottesmutter Maria der Patronatsheilige von SintJan und der Liebfrauenbruderschaft. Regelmäßig luden sich die Mitglieder dieser Gemeinschaft untereinander zu Banketten ein. Zu festlichen Anlässen trugen sie einen Kapuzenmantel, dessen Farbe und Schnitt jeweils zum Johannestag, dem 24. Juni, gewechselt wurde. An diesem roten, violetten, weißen, blauen oder grünen Mantel prangte ein silbernes Abzeichen in Form einer Lilie, das mit einer aus dem Hohen Lied entnommene Devise versehen war: „Sicut lilium inter spinas“ – „Wie die Lilie unter Dornen“. 7 Musik 4 Antoine Brumel „Sicut lilium inter spinas“ Ensemble Alamire, Leitung: David Skinner Obsidian CD715, 1‘44 Das Ensemble Alamire mit Antoine Brumels Motette „Sicut lilium inter spinas“. Die Liebfrauenbruderschaft bestellte aber nicht nur Gemälde bei Künstlern wie Bosch, sondern auch Musik bei verschiedenen Komponisten: von Juni 1489 bis März 1492 war der Komponist Pierre de la Rue für die Bruderschaft tätig, bevor er Mitglied der burgundischen Hofkapelle wurde. Dort diente er unter Maximilian I, Philipp dem Schönen und nach dessen frühem Tod schließlich seiner Schwester Margarethe von Österreich an deren kunstsinnigem Hof in Mecheln. Schnell wurde er zu ihrem Lieblingskomponisten und widmete ihr viele seiner Werke. In dieser Zeit entstand auch die Missa Ave Maria. Musik 5 Pierre de la Rue: Kyrie aus der Missa Ave Maria Capilla Flamenca, Ltg.: Dirk Snellings Musique en Wallonie MEW 0633, CD 1, Take 2, 3’35 Das Kyrie aus Pierre de la Rues Missa Ave Maria mit der Capilla Flamenca. Es gibt noch einen weiteren Sänger, Komponisten und Kalligraphen, der der Liebfrauenbruderschaft angehörte: Petrus Alamire. Eigentlich hieß er Peter Imhoff und stammte aus einer Nürnberger Kaufmannsfamilie. In den „spanischen Niederlanden“ legte er sich das Pseudonym Petrus Alamire zu. Es setzt sich zusammen aus der Bezeichnung des Tones A, gefolgt von den drei Solmisationssilben „la“, „mi“ und „re“, wie sie auch in den Hexachorden der mittelalterlichen Musiktheorie verwendet werden. Schon 1496/97 hatte der Komponist für die Bruderschaft gearbeitet und war bei dieser Gelegenheit auch gleich Mitglied geworden. In seinen umfangreichen Sammelhandschriften finden sich vor allem geistliche Werke von Pierre de la Rue und dessen Zeitgenossen wie Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Johannes Ockeghem oderJosquin Desprez – über 850 Komponisten, und damit sämtliche Stars der franko-flämischen Vokalpolyphonie sind hier versammelt. Aus Alamires eigener Feder ist nur eine einzige Komposition überliefert: Variationen über das Volkslied T’Andernaken - Zu Andernach nah' am Rheine, da fand ich zwei Mädchen sich amüsieren geh'n. Es spielt das Ensemble Piffaro. 8 Musik 6 M0010095-015, 2'42 Alamire, Pierre T'andernaken (Pommer, 2 Posaunen, Dulzian) Renaissance Band, Mitglieder; Kimball, Joan Piffaro - The „T’andernaken“ – Variationen von Petrus Alamire, einem Komponist, der wie Hieronymus Bosch Mitglied der Liebfrauenbruderschaft in ‘s-Hertogenbosch war. Was mach eigentlich meine Begleiterin? Die kleine Eule hat sich in der Zwischenzeit bei den steinernen Gestalten und Verzierungen von Sint-Jan in Boschs Heimatstadt versteckt. Zwischen all den Gnomen, Teufeln und Monstern scheint sie sich wohl zu fühlen. Boschs Monstergeschöpfe sind in dieser Zeit keine Solitäre, das Groteske, Hybride oder Monströse in Form verzerrter Menschendarstellungen, Mischwesen und Fabelwesen markiert die Grenze von der alltäglichen zur jenseitigen Sphäre und bildet theologisch, anthropologisch und moralisch einen Gegensatz zu Gestalt und Handeln Christi als Gottessohn und als idealem Menschen, und zur ursprünglichen Schöpfungsordnung. Diese Drolerien gab es nicht nur im Figurenschmuck von Kirchen, sondern seit dem 14. Jahrhundert auch in der Buchmalerei. Der Historiker Johan Huizinga schreibt in seinem Buch „Herbst des Mittelalters“: „Das Mittelalter vergaß niemals, daß alle Dinge absurd wären, wenn ihre Bedeutung sich in ihrer Funktion erschöpfte und ihrem Platz in der uns erscheinenden Welt, wenn sie in ihrem Kern nicht auf eine Welt jenseits der unseren verweisen würden. … Die an sich widerwärtige Welt wurde nur annehmbar durch ihren symbolischen Gehalt.“ Monster und Höllenqualen waren also keine Erfindung von Hieronymus Bosch, auch der Isenheimer Altar mit der Versuchung des Hl. Antonius von seinem Zeitgenossen Matthias Grünewald ist voll von bösartigen Vögeln mit Hakenschnäbeln und Menschenarmen. Ein Höhepunkt der Erfindung grotesker Figuren ist bei Bosch der sogenannte Baummensch, der im „Garten der Lüste“ auftaucht, von dem es aber auch eine Zeichnung gibt: ein hybrider Riese mit eiförmigem Leib, in dem sich eine Schenke befindet, Beinen in Form von Baumstämmen, die wiederum Boote als Füße haben. Auf der Zeichnung sitzen übrigens gleich zwei Eulen, die die Szenerie beleben: eine auf einer Art Mast, der aus dem Rücken des Baummenschen herausragt, und eine am Boden, die von anderen Vögeln umflogen wird. 9 Musik 7 M0065460-021, 3'44 Janácek, Leos (10) Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen! Andante aus: Auf verwachsenem Pfade 15 kleine Stücke für Klavier Kupiec, Ewa „Das Käuzchen ist nich fortgeflogen“, eines der Klavierstücke aus Leos Janáceks Zyklus „Auf verwachsenem Pfade“, gespielt von Ewa Kupiec. Bosch war Zeitgenosse von Albrecht Dürer, Michelangelo, Leonardo da Vinci und Botticelli. Christoph Columbus entdeckte damals die Neue Welt und Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Die Reformation warf ihre Schatten voraus und der moderne Buchdruck mit beweglichen Metall-Lettern war gerade erfunden worden. Die Renaissance-Humanisten, darunter Erasmus von Rotterdam, dem Bosch vielleicht sogar persönlich begegnet ist, erhofften sich eine optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten durch die Verbindung von Wissen und Tugend. Das sind nur ein paar Fakten, die deutlich machen sollen, in welcher Umbruchzeit Hieronymus Bosch gelebt hat. Zu dieser Zeit ist auch zum ersten und einzigen Mal der Orden vom Goldenen Vlies zu Gast in ‘s-Hertogenbosch, den Philipp der Gute von Burgund schon 1430 gegründet hatte und den die spanischen Habsburger weiterführten. Am 6. Mai 1481 sind die Stadt und die Stiftskirche Sint-Jan Gastgeber für dieses einmalige Ereignis: die 14. Zusammenkunft des Ordens unter dem Vorsitz von Erzherzog Maximilian I von Habsburg, dem späteren römisch-deutschen König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Bei diesem Treffen nimmt der Orden Herzog Philipp von Burgund auf, den nicht einmal drei Jahre alten Sohn Maximilians, der später „der Schöne“ genannt wird. In Spanien nennt man den Niederländer Hieronymus Bosch „El Bosco“. Philipp II., Sohn von Karl V und Enkel von Philipp dem Schönen, Verfechter des wahren katholischen Glaubens in seinen Erblanden, scheint geradezu verrückt nach Boschs Bildern gewesen zu sein. Im Escorial sammelte er mehrere Werke, darunter der Heuwagen, der Garten der Lüste und das Tafelbild mit den sieben Todsünden. Felipe de Guevara, der spanische Humanist und Kunstsammler, schreibt im Jahr 1563 (beschwichtigend) an seinen König: „Ich wage zu behaupten, dass Bosch nichts Unnatürliches in seinem Leben gemalt hat, außer in Sachen der Hölle und des Fegefeuers, wie ich bereits bemerkte. Er bemühte sich zwar, für seine Erfindungen höchst seltsame Dinge zu suchen, aber naturgemäß der Art, dass man es als ein allgemeingültiges Gesetz aufstellen kann.“ 10 Der Historiker Alphonse-Jules von Wauters sieht Philipps II. Beziehung zu Boschs Bildern 1883 in seinem Buch „La peinture flamande“ etwas anders: „…eine glühende und irre Einbildungskraft… Wie es scheint, schätzte Philipp II. die Werke Boschs aufs höchste; die teuflischen Alpdrücke dieses Visionärs mußten ihm ja gefallen, ihm, von dessen Eingebungen sich die Inquisition leiten ließ…“ Und der Schriftsteller Cees Noteboom meint etwas versöhnlicher in seinem jüngst erschienen Buch „Reisen zu Hieronymus Bosch“: „Dass ein frustrierter Mystiker wie Philipp II., der ein Weltreich zu regieren hatte, sich in diesen Bildern verlieren konnte, ist vorstellbar. Staatsräson als Pflicht als Gegenpol zum inneren Hang zum Metaphysischen mit der unberechenbaren Welt des Hieronymus Bosch als Zufluchtsort – das ist denkbar, genauso wie der Gedanke, dass diese so spanische Phantasie aus dem kühlen Norden hier in Spanien ihren eigentlichen Platz gefunden hatte.“ Musik 8 M0076938-011, 2'05 Morales, Cristóbal de; Liturgie Jam Christus astra ascenderat Vesperhymnus zu Pfingsten à 4 (Vokalensemble a cappella) Ensemble Plus Ultra; Noone, Michael Renaissance-Musik aus Spanien, gesungen vom Ensemble plus Ultra: Christobal de Morales Pfingsthymnus „Jam Christus astra ascenderat“. In den folgenden Jahrhunderten geriet Hieronymus Bosch immer mehr in Vergessenheit. Zwar hat sich Francisco deGoya in seinen phantastischen Visionen und seinen schwarzen Bildern von Bosch inspirieren lassen, aber erst die Surrealisten wie Salvador Dali oder Max Ernst suchten dann wieder das Kreative und Ungewöhnliche in seinen Werken. Gerade seine Hybridität begeisterte diese Künstler, die das Unterbewusste erforschen, das Bewusstsein erweitern, Konventionen aushebeln und Ordnungen aufbrechen wollten. Bisweilen glaubte man, Bosch habe bestimmten Sekten angehört und geheime Botschaften in seinen Bildern versteckt, er habe Drogen genommen, um dann seine Visionen zu realisieren. Auch der Liebfrauenbruderschaft dichtete man sektiererische Absichten an. Das alles ist zwar äußerst spannend, Verschwörungstheorien haben ja immer einen ganz besonderen Reiz, muss aber mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Bosch blieb immer ein radikaler Moralist, er ließ sich über die menschliche Natur nicht täuschen. Jeder Betrachter kann seine Weltanschauung in seine Bilderwelt hineintragen, doch Bosch meint mit seinen Bildern immer noch genau die Welt, in der er lebt, eine höchst widerspruchsvolle Welt der Kirchenherrschaft, der Kämpfe des reich und selbstbewusst gewordenen Bürgertums gegen Kirche und Adel, der Verrohung nicht zuletzt des Klerus, der Sektenbildungen, der religiösen Heuchelei, des nun auch in Westeuropa erfolgreichen Humanismus, des wachsenden 11 Widerstandes gegen die Ablasskrämerei, der Hexenprozesse, der Epidemien, der Inquisition. All das spiegelt sich in Boschs Bildern wider. Vieles, was für den damaligen Betrachter auf den ersten Blick verständlich war, müssen wir heute erst wieder mühsam entziffern. Vielleicht kann uns die Musik in den nächsten Tagen helfen, Boschs Welt auf eine andere Art zu begreifen. Musik 9 Jackson Hill: Ma fin est mon commencement New York Polyphony BIS-SACD-1949, Take 15, 5’54 Das war die Musikstunde: Die Welt des Hieronymus Bosch – zum 500. Todestag des Malers aus Brabant, Teil 1: Mehr als ein Monstermaler. Zuletzt sang das Ensemble New York Polyphony ein Stück, das sie bei dem amerikanischen Komponisten Jackson Hill in Auftrag gegeben haben, eine Fantasie über Guillaume Machauts Vertonung des Textes „Ma fin est mon commencement“ – „Mein Ende ist mein Anfang und mein Anfang mein Ende“. Vielleicht tauchen Sie ja morgen wieder zusammen mit mir in Boschs Welt ein, die kleine Eule ist sicherlich auch dabei. Davor empfehle ich Ihnen noch SWR2 Wissen am 9.8. um 8.30 Uhr: Der Maler Hieronymus Bosch – Meister der Fantasiewelten, eine Sendung von Martina Conrad. Am Mikrophon hier und jetzt verabschiedet sich Bettina Winkler. Literatur-Tipps: Belting, Hans: Hieronymus Bosch. Garden of Earthly Delights. Prestel 2002 Borchert, Till-Holger: Bosch. Meisterwerke im Detail. Detsch 2016. Büttner, Nils: Hieronymus Bosch. C. H. Beck Wissen 2012. Fischer, Stefan: Hieronymus Bosch. Das vollständige Werk. Taschen 2016. Fischer, Stefan: Im Irrgarten der Bilder. Die Welt des Hieronymus Bosch. Reclam 2016. Hieronymus Bosch. Visionen eines Genies. Hrsgg. v. Matthijs Ilsink und Jos Koldeweij. Belser 2016 (Het Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch , Katalog) Nooteboom, Cees: Reisen zu Hieronymus Bosch. Eine düstere Vorahnung. Schirmer/Mosel 2016. Unverfehrt, Gerd: Wein statt Wasser. Essen und Trinken bei Jheronimus Bosch. Vandenbroeck & Ruprecht 2003 Verkehrte Welt. Das Jahrhundert von Hieronymus Bosch. Hrsgg. v. Franz Wilhelm Kaiser und Michael Philipp. Bucerius Kunstforum 2016 (Katalog) Internet-Tipps: Bosch beim Google Art Project: www.google.com/culturalinstitute/beta/project/art-project?hl=de Bosch in 3-D: www.bdh.net/work/boschvr/ Bosch unter die Lupe genommen: http://boschproject.org/