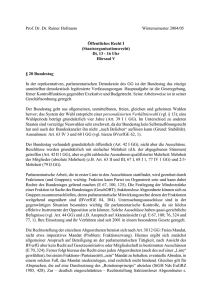Das Grundgesetz als Bewertungsgrundlage für die
Werbung

Das Grundgesetz als Bewertungsgrundlage für die Rentenrechtsanpassung und für Einschnitte bei den sozialen Sicherungssystemen Vorbemerkung von Dieter Bauer Seit der industriellen Entwicklung in Deutschland nach 1848, verbunden mit der Bildung industrieller Zentren, der Konzentration von Arbeitern und damit verbunden der Erwirtschaftung großer Gewinne, findet die Auseinandersetzung zwischen den Arbeitenden und den Besitzern der Produktionsmittel statt. Aus der Erkenntnis, dass die Arbeiter es sind, die den Wohlstand einer Gesellschaft erarbeiten, selbst aber in bescheidenen Verhältnissen leben müssen, mit Hungerlöhnen, ohne Absicherung bei Krankheit, Unfall und Invalidität, Arbeitslosigkeit und im Alter entstand eine Arbeiterbewegung, die sich immer besser organisierte und von den Besitzenden als Bedrohung empfunden wurde. Aus der Erkenntnis, dass das Elend der Arbeiter radikal macht und dadurch der Wohlstand der Besitzenden und die Gesellschaftsordnung bedroht werden, reagierte der Reichskanzler Bismarck mit eiserner Konsequenz: - (Peitsche):Mit dem Sozialistengesetz versuchte er, die Herausbildung einer gut organisierten Arbeiterbewegung zu verhindern – was nicht gelang. (Zuckerbrot): Setzte er gegen den erbitterten Widerstand der Unternehmer und Junker die ersten sozialen Sicherungssysteme durch: 1881 bis 1883 die Krankenversicherung, 1884 die Unfallversicherung und 1889 die Rentenversicherung. (Die reichseinheitliche Arbeitslosenversicherung konnte aufgrund des großen Unternehmerwiderstandes erst 1927 und das Bundessozialhilfegesetz erst 1961 in Kraft treten.) Die Arbeitgeber wurden gezwungen, sich in erheblichem Maße an den finanziellen Lasten der Sicherungssysteme zu beteiligen, indem sie einen Teil des von den Arbeitern erwirtschaftenden Gewinns für die Erhaltung des sozialen Friedens ausgeben mussten. Ohne auf die mehrfache Verschiebung des Kräftegleichgewichts zwischen Arbeiterschaft und Kapital eingehen zu wollen, sollte die Brisanz der Situation heute - und zwar europaweit – unter Berücksichtigung der Entwicklung in Deutschland nach 1932 bewertet werden: - - Kürzung der Arbeitslosenversicherung von 52 auf 6 Wochen bei Halbierung der Zahlbetragshöhe. Aufhebung der Tarifbindung der Löhne mit der Folge Hungerdemonstration, Besetzung von Ämtern, Plünderung, Schusswaffengebrauch gegen revoltierende Erwerbslose, Bandenbildung, Anwachsen der Kriminalitätsrate usw. usw. Zerschlagung der Gewerkschaften, Beschlagnahme ihres Besitzes Anwachsen des Arbeitslosenheeres auf über 8 Millionen Vor dem Hintergrund der gesamten historischen Entwicklung mit den zyklischen Krisen, erwachsen aus einem weltweiten Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage (Überproduktionskrise) erscheint es lächerlich, wolle man die Kosten des Sozialstaates für die Krise verantwortlich machen. Vielmehr sollte man sich bewusst machen, welche Folgen die seit 1990 ungeschminkt betriebene Politik der Kapitalgesellschaften und Unternehmerverbände haben wird, die der Maxime „Maximaler Profit heute“ folgend durch Druck auf die Politik den Abbau aller sozialen Sicherungen betreibend eine neue moderne Sklaverei des 22. Jahrhunderts anstrebt, einer Sklaverei ohne Ketten. Im Folgenden sind einige Auszüge aus der Sammlung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, die vor der Wiedervereinigung 1990 gefällt wurden, dargestellt. Seite 1 Bedenken sollte man auch, dass dieses Grundgesetz in einem Nachkriegsdeutschland entstand, in dem zum Ingangsetzen der Wirtschaft nach den verheerenden europaweiten Zerstörungen und dem unsäglichen Leid und Elend des 2. Weltkrieges jede Hand gebraucht wurde. Vor diesem grauenhaften Hintergrund war der Wille zur Gestaltung einer besseren Welt ein entscheidender Faktor, der sich u. a. in Ludwig Erhards Ausspruch „Wohlstand für alle“ ausdrückt. Heute ist die Situation eine ganz andere. Eine politische Klasse, die sich selbst privilegiert hat, nimmt die Garantien der Artikel 3, 14 und 20 für sich selbst voll in Anspruch, während z. B. im Sozial- und Rentenrecht der Bürger nach Forderungen der Vertreter des Kapitals gehandelt wird (Privatisierung der Vorsorgeleistungen). Leistungseinschnitte werden durch diejenigen betrieben, die sich selbst aus Steuermitteln üppig versorgen ohne selbst Angehörige einer Solidargemeinschaft zu sein. Die folgenden Auszüge habe ich ab 1990 laufend mit der politischen Entwicklung im Sozial- und Eigentumsrecht und später mit der zugehörigen Rechtsprechung verglichen und musste feststellen, dass die Diskrepanz immer größer wird. Diese Verfassung wird nur so viel an sozialer Sicherheit, an Menschenrechten und Menschenwürde garantieren, wie wir, die Betroffenen, politisch erzwingen. Der Umfang der Enteignungen der Beitrittsbürger im Boden-, Sachen- und Rentenrecht nach der Überführung unseres Volkseigentums in Privateigentum von dem die Beitrittsbürger wertmäßig ca. 3% erhielten und die noch immer anhält (z. B. Altschuldenlüge), dürfte der größte Raubzug in der deutschen Geschichte sein. Die folgenden Seiten sind ein Auszug aus „Meine Grundrechte“ von Hubert Weis, 2. Aufl. vom 1.1.1989 vom dtv (heute nicht mehr erhältlich) mit Bezug von GG-Artikel und Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen (BVerfGE). Dieser Auszug ist durch das Scannen der Seiten dieses Buches und Bearbeiten von einem fachkundigen Freund in dieses Format gebracht worden. Artikel 3 GG (Gleichheit vor dem Gesetz) (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. I. Allgemeiner Gleichheitssatz 1. Allgemeine Bedeutung. Das Prinzip der Gleichbehandlung vor dem Gesetz ist eine elementare Selbstverständlichkeit der freiheitlichen Demokratie (BVerfGE 5, 85, 205). Es bedeutet zunächst „gleiches Recht für alle", nämlich gleichmäßige Rechtsanwendung ohne Ansehen der Person. Die Bedeutung des allgemeinen Gleichheitssatzes geht aber über die eher formale Aussage, alle Menschen seien vor dem Gesetz gleich, weit hinaus. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung den Gleichheitssatz zu einem umfassenden Gerechtigkeitsgebot und Willkürverbot für alle Bereiche staatlichen Handelns entwickelt. Nach dieser Rechtsprechung enthält der Gleichheitssatz „die allgemeine Weisung, bei steter Orientierung am Gerechtigkeitsgedanken Gleiches gleich, Ungleiches seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behandeln" (BVerfGE 3, 58, 135). Der Staat darf „weder wesentlich Gleiches willkürlich ungleich noch wesentlich Ungleiches willkürlich gleich behandeln" (BVerfGE 4, 144, 155). Der Gleichheitssatz ist verletzt, „wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für die Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt, kurzum, wenn die Bestimmung als willkürlich bezeichnet werden muss" (BVerfGE l, 14, 52). Seite 2 Der durch diesen Inhalt geprägte allgemeine Gleichheitssatz ist nicht nur von der Verwaltung und den Gerichten zu beachten, also von den Organen, die die geltenden Gesetze gleichmäßig anwenden sollen. Das Willkürverbot gilt vielmehr auch für den Gesetzgeber selbst, also für diejenigen Organe, die die Gesetze erst schaffen, vor denen alle Menschen gleich sind. Mit der Feststellung, eine Maßnahme sei willkürlich, ist kein subjektiver Schuldvorwurf gegenüber den handelnden Personen verbunden. Ob ein Gesetz, eine behördliche Entscheidung oder ein Gerichtsurteil willkürlich ist, hängt also nicht von der subjektiven Einstellung der jeweiligen Abgeordneten. Beamten oder Richter ab; vielmehr geht es nur darum, ob eine Maßnahme in der Situation, in der sie getroffen worden ist, objektiv und eindeutig unangemessen war (BVerfGE 51, l, 27). Der allgemeine Gleichheitssatz schützt Inländer wie Ausländer (Menschenrecht) und wird sogar als überpositiver, also eigentlich auch ohne ausdrückliche Regelung geltender Rechtsgrundsatz bezeichnet, der durch Art. 3 Abs. l förmlich anerkannt worden ist (BVerfGE, l, 208, 243). Die Zielrichtung des Gleichheitssatzes besteht in der Besserstellung Benachteiligter (und nicht etwa in der Schlechterstellung Bevorzugter - auch so könnte ja eine Gleichbehandlung erreicht werden). Wer zu Unrecht bevorzugt wird, ist nicht in seinen Grundrechten verletzt. Bei der Anwendung des Gleichheitssatzes geht es stets um die Frage, ob für die Schlechterstellung einer Personengruppe gegenüber einer vergleichbaren anderen ein sachlich vertretbarer Grund besteht (BVerfGE 22, 387, 415). 2. Bindung des Gesetzgebers. Das Willkürverbot bindet auch den Gesetzgeber. Damit ist der Erlass willkürlicher Gesetze untersagt; gleichzeitig ist dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit eröffnet, gesetzliche Regelungen unter dem Aspekt der Willkür zu überprüfen und wegen Verstoßes gegen das Willkürverbot für nichtig zu erklären. a) Bei der Überprüfung von Gesetzen am Maßstab des Willkürverbotes ist aber große Zurückhaltung geboten. Die zu regelnden Lebensverhältnisse sind niemals völlig identisch, sondern stets nur in einigen Elementen gleich, in anderen aber verschieden. Es ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, welche dieser Elemente als ausschlaggebend, welche Sachverhalte also als gleich oder ungleich und welche Regelungen als gerecht anzusehen sind. Dem Gesetzgeber steht bei dieser Bewertung ein erheblicher Gestaltungsspielraum (Ermessen) zu, innerhalb dessen er frei entscheiden kann (BVerfGE 50, 57, 77). Das Willkürverbot bietet dem Bundesverfassungsgericht nicht die Möglichkeit, pauschal seine Auffassung von Gerechtigkeit an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers zu setzen. Das Gericht kann grundsätzlich nur prüfen, ob der Gesetzgeber die äußersten Grenzen seines Ermessens überschritten hat, nicht aber, ob er im einzelnen die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste aller denkbaren Lösungen gefunden hat (BVerfGE 3, 162, 182). Ein Gesetz ist daher im allgemeinen nur dann willkürlich, wenn sich für die getroffene Regelung ein vernünftiger, sachgerechter Grund schlechterdings nicht erkennen lässt; ihre Unsachlichkeit muss evident sein (BVerfGE 13, 356, 361; 55, 72, 90). In besonderen Fällen kann allerdings ein schärferer Maßstab anzulegen sein(s. u. d). b) Die Maßstäbe dafür, ob ein Gesetz als sachgerecht oder als willkürlich zu qualifizieren ist, sind in erster Linie dem Grundgesetz selbst zu entnehmen. Bei der Bewertung mehrerer Sachverhalte als gleich oder ungleich darf der Gesetzgeber die Wertentscheidungen, die in den Grundrechten zum Ausdruck kommen, und so fundamentale Grundsätze wie das Rechtsstaats- oder das Sozialstaatsprinzip nicht außer acht lassen (BVerfGE 17, 210, 217). Da Ehe und Familie gem. Art. 6 Abs. l unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen, darf der Gesetzgeber also niemanden nur deshalb schlechter stellen, weil er verheiratet oder sonst Familienangehöriger ist. Eine steuerliche Vergünstigung darf Steuerpflichtigen nicht deshalb versagt werden, weil sie Ehegatten sind, selbst wenn hier eine erhöhte Missbrauchsgefahr bestehen mag (BVerfGE 13, 290ff. - Ehegatten-Arbeitsverträge). Ein für Beamte vorgesehener Kinderzuschlag durfte nicht deshalb entfallen, weil das Kind heiratete (BVerfGE 29, l ff.). Mit dem Sozialstaatsprinzip war es nicht vereinbar, bei der Frage, ob die Hinterbliebenenrente einer Kriegerwitwe nach Scheidung einer neuen Ehe wieder auflebt, danach zu differenzieren, ob die Kriegerwitwe schuldig geschieden wurde. Denn die Rente sollte den Unterhalt der Witwe sichern; ihr Verschulden am Seite 3 Scheitern ihrer zweiten Ehe stand mit dem aufgrund ihrer ersten Ehe erworbenen Rentenanspruch in keinerlei Zusammenhang (BVerfGE 38, 187ff.). c) Neben den Wertentscheidungen der Verfassung gehört zu den im Rahmen des Willkürverbots zu beachtenden Maßstäben auch die Eigengesetzlichkeit der jeweils zu regelnden Materie. d) Ob der Gesetzgeber bei Anwendung der genannten Maßstäbe über einen engen oder weiten Ermessensspielraum verfügt, hängt von den Besonderheiten der jeweils geregelten Materie ab. Eng ist der Gestaltungsspielraum etwa im Bereich der Ausübung demokratischer Rechte, der vom Grundsatz formaler Gleichheit beherrscht wird. Daher darf der Gesetzgeber die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an politische Parteien nicht in so großem Umfang zulassen, dass besonders wohlhabende Bürger - im Gegensatz zu den Beziehern kleinerer Einkommen — einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidungen von Parteien erlangen können (BVerfGE 73, 40, 71 ff. - Parteienfinanzierung). Dem gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum sind auch dort engere Grenzen gezogen, wo es um Regelungen mit Auswirkungen auf die durch Art. 12 Abs. l geschützte Berufsfreiheit geht (BVerfGE 62, 256,274). So muss der Gesetzgeber die Chancengleichheit von Studienbewerbern bei der Hochschulzulassung und von Prüflingen bei der Prüfung so weit wie irgend möglich herstellen; differenzierende Bestimmungen können auch schon dann verfassungswidrig sein, wenn sie noch nicht evident unsachlich sind (BVerfGE 33, 303, 345; 37, 342, 353 f.). Ein weiter Gestaltungsspielraum steht dem Gesetzgeber zu, wenn es nicht um staatliche Eingriffe, sondern um den Bereich der gewährenden Verwaltung geht (BVerfGE 61, 138, 147) Beispiele hierfür sind Entschädigungsregelungen (BVerfGE 27, 25 3 , 286), Subventionen (BVerfGE 22, 100, 103), Sozialleistungen (BVerfGE 60, 113, 119), Bestimmungen des Besoldungs- und Versorgungsrechts (BVerfGE 61, 43, 63) oder auch die Gewährung einer Amnestie (BVerfGE 10, 234, 246). Besonders weit ist der Ermessensspielraum bei Wertungen und Abstufungen, die in Gesetzen zur Sanierung des Staatshaushaltes getroffen werden. Eine Willkürgrenze besteht aber auch hier, denn der Gleichheitssatz muss nicht nur bei der Verteilung von Überfluss, sondern gerade auch bei der Verwaltung von Mangel beachtet werden (BVerfGE 64, 158, 169). e) Jede gesetzliche Regelung muss generalisieren. Der Gesetzgeber darf bei seinen Entscheidungen von typischen Fallkonstellationen (Regelfällen) ausgehen und, insbesondere bei der Ordnung von Massenerscheinungen (wie sie z.B. im Bereich des Sozialversicherungsrechts auftreten) entsprechend typisierende Regelungen treffen. Derartige Typisierungen sind schon aus Gründen der Praktikabilität notwendig. Sie können dazu führen, dass in Einzelfällen, nämlich bei seltenen, atypischen Sachverhalten, Härten auftreten, die unvermeidlich sind und hingenommen werden müssen. Allerdings muss nicht jede Härte oder Ungerechtigkeit im Einzelfall akzeptiert werden. Diese Folge einer Typisierung kann vielmehr nur dann gerechtfertigt werden, wenn nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Personen betroffen ist und der Verstoß gegen den Gleichheitssatz nicht gravierende Folgen, etwa in finanzieller Hinsicht, nach sich zieht (BVerfGE 63, 119, 128). f) Der Gleichheitssatz steht Stichtagsregelungen, die dazu führen, dass Sachverhalte vor einem bestimmten Termin anders behandelt werden als spätere Sachverhalte, nicht grundsätzlich entgegen. Allerdings muss die Einführung eines Stichtages überhaupt notwendig, der gewählte Zeitpunkt außerdem auch sachlich vertretbar sein (BVerfGE 58, 81, 126). g) Der Gesetzgeber ist grundsätzlich frei, Gesetze mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und auf diese Weise Sachverhalte nach neuem Recht anders als Sachverhalte nach altem Recht zu behandeln. Dies gilt namentlich dann, wenn sich nicht von Anfang an übersehen ließ, ob ein Gesetz allen von ihm erfassten Sachverhalten gerecht werden würde und sich das Gesetz später als korrekturbedürftig erweist (BVerfGE 13, 39, 43). h) Der Gleichheitssatz bindet den Gesetzgeber nur innerhalb seines eigenen Herrschaftsbereichs. Die Landesgesetze der einzelnen Bundesländer können für die Anwendung Seite 4 des Gleichheitssatzes also ebenso wenig miteinander verglichen werden wie Landesrecht und Bundesrecht; der Gesetzgeber des einen Landes ist nicht verpflichtet, sich im Rahmen seiner Zuständigkeit an den Regelungen eines anderen Landes oder des Bundes zu orientieren (BVerfGE 32, 346, 359f.). i) Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Bestimmungen eines Gesetzes gegen den Gleichheitssatz verstoßen, so kann es entweder die begünstigenden Vorschriften für nichtig erklären oder aber feststellen, dass die Nichtbegünstigung bestimmter Personen verfassungswidrig ist. Das Gericht kann im Regelfall aber nicht einfach die im Gesetz vorgesehene Begünstigung auf die dort nicht berücksichtigten Personen erstrecken, denn es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, wie eine Ungleichbehandlung zu beseitigen ist. Etwas anderes gilt nur, wenn lediglich eine einzige Möglichkeit zur Beseitigung der Ungleichbehandlung besteht oder wenn von vornherein feststeht, wie der Gesetzgeber bei Beachtung des Gleichheitssatzes entschieden hätte (BVerfGE 55, 100, 113). Letzteres kann bejaht werden, wenn ein Gesetz grundsätzlich eine Leistung gewährt und sie nur im Ausnahmefall ausschließt, diese Ausnahme aber willkürlich ist; dann kann der Leistungsanspruch - durch Nichtigerklärung der Ausnahmevorschrift - vom Bundesverfassungsgericht auch auf die durch die Ausnahmevorschrift benachteiligten Personen erstreckt werden (BVerfGE 27, 220, 230f.). Andernfalls bleibt es bei der bloßen Feststellung, dass der Gleichheitssatz verletzt und der Gesetzgeber zu einer Neuregelung verpflichtet ist; die gegen den Gleichheitssatz verstoßende Norm darf aber nicht mehr angewandt werden (BVerfGE 37, 217- sog. Anwendungssperre). 3. Bindung von Regierung und Verwaltung a) Die Ausführungen über die Bindung des Gesetzgebers an den Gleichheitssatz gelten auch für die Regierung, soweit sie Rechtsverordnungen erlässt und damit ebenso wie der Gesetzgeber Recht setzt (normsetzende Exekutive). Der Gestaltungsspielraum der Regierung als Verordnungsgeber ist aber enger als derjenige des Parlaments, weil sie von vornherein nur innerhalb des Rahmens der gesetzlichen Ermächtigungsnorm handeln darf, auf die die jeweilige Verordnung gestützt wird (BVerfGE 58, 68, 79). b) Bei der Rechtsanwendung müssen Regierung und Verwaltung ohne Ansehen der Person vorgehen und „alle Menschen vor dem Gesetz gleich" behandeln. Sie dürfen keine willkürlichen Entscheidungen treffen und müssen die auch für den Gesetzgeber geltenden Maßstäbe beachten. Dies gilt insbesondere dort, wo den Behörden bei ihren Entscheidungen ein gewisses Ermessen eingeräumt ist. Dieses Ermessen ist niemals völlig frei, sondern darf nur unter sachlich vertretbaren Gesichtspunkten ausgeübt worden (BVerfGE 49, 168, 184). Sachlich vertretbar kann nur sein, was mit den Wertentscheidungen der Verfassung - Grundrechte, Rechts- und Sozialstaatsprinzip (s.o. 2b) - in Einklang steht. Entscheidet eine Behörde sich im Rahmen ihres Ermessens regelmäßig für ein bestimmtes Vorgehen und bildet sie so eine entsprechende Verwaltungspraxis, darf sie von dieser Praxis im Einzelfall nicht ohne sachlichen Grund wieder abweichen. 4. Bindung der Gerichte. Ebenso wie Regierung und Verwaltung müssen auch die Gerichte bei der Rechtsanwendung ohne Ansehen der Person vorgehen. Sie müssen das Recht gleichmäßig anwenden, wozu auch eine gleichmäßige Strafpraxis gehört. Die Frage, ob der Gleichheitssatz beachtet worden ist, kann allerdings immer nur hinsichtlich der Entscheidungen ein und desselben Gerichtes gestellt werden; die verschiedenartige Strafpraxis verschiedener Gerichte stellt daher keine Verletzung des Art. 3 Abs. l dar (BVerfGE l, 332, 345). Gerichtsentscheidungen verstoßen gegen den Gleichheitssatz, wenn sie bei der Auslegung eines Gesetzes zu Differenzierungen führen, die der Gesetzgeber selbst nicht hätte vornehmen dürfen und die im Gesetz auch gar nicht ausdrücklich vorgesehen sind (BVerfGE 58, 369, 374). Gerichtsentscheidungen verstoßen auch dann gegen Art. 3 Abs. l, wenn sie willkürlich sind. Dies kann allerdings nur in seltenen Ausnahmefällen bejaht werden. Nicht jede fehlerhafte Rechtsanwendung bedeutet Willkür; vielmehr muss hinzukommen, dass eine Seite 5 Gerichtsentscheidung schlechthin nicht mehr verständlich ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruht. Beispiele hierfür sind ein amtsgerichtliches Urteil, mit dem eine Klage abgewiesen wurde, weil der Kläger keinen Vorschuss für ein Sachverständigengutachten gezahlt hatte, obwohl das Gericht vorher nur den Beklagten zur Vorschusszahlung aufgefordert hatte (BVerfGE 58, 163 ff.), und eine Kostenfestsetzung, nach der die Beklagte der Klägerin mehr Geld erstatten sollte, als diese überhaupt an Kosten aufgewandt hatte, und das, obwohl die Klägerin ein Drittel der Kosten selbst tragen sollte (BVerfGE 62, 189ff.). 5. Gleichheitssatz und Steuergerechtigkeit. Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz als umfassendem Gerechtigkeitsgebot und Willkürverbot hat das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz der Steuergerechtigkeit hergeleitet. Dieser Grundsatz verlangt eine möglichst gleichmäßige Belastung aller Steuerpflichtigen. Mit „gleichmäßig" ist allerdings nicht eine formale Gleichbehandlung von Arm und Reich durch Anwendung desselben Steuersatzes gemeint, sondern eine relative (wertende) Gleichbehandlung in dem Sinne, dass der wirtschaftlich Leistungsfähigere einen höheren Prozentsatz seines Einkommens als Steuer zu zahlen hat als der wirtschaftlich Schwächere (BVerfGE 8, 51, 68 f.). Es ist ein grundsätzliches Gebot der Steuergerechtigkeit, dass die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet wird. Gleich Leistungsfähige müssen gleich, nicht gleich Leistungsfähige müssen unterschiedlich besteuert werden. Aus dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit ergibt sich, dass für die Berechnung der Lohn- und Einkommensteuer solche Ausgaben berücksichtigt werden müssen, die für den Steuerpflichtigen unvermeidbar sind. Hierzu gehören auch Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern. Es ist daher mit dem Gebot der Steuergerechtigkeit nicht vereinbar, dass zwar Ehepaare mit Kindern durch die Anwendung des Splittingtarifs begünstigt werden, bei der Besteuerung Alleinstehender mit Kindern die zwangsläufig entstehenden Kinderbetreuungskosten aber weder als Minderung des steuerpflichtigen Einkommens berücksichtigt noch durch einen sozialrechtlichen Zuschuss ausgeglichen werden. Wie diese verfassungswidrige Besteuerung zu beseitigen ist, hat der Gesetzgeber zu entscheiden (BVerfGE 61, 319, 342 ff.). Er darf eine Gleichbehandlung aber nicht etwa einfach durch einen Abbau der sich aus dem Splittingverfahren ergebenden Vergünstigungen für Ehegatten herbeiführen. Denn das Ehegattensplitting ist „keine beliebig veränderbare Steuervergünstigung, sondern - unbeschadet der näheren Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers - eine an dem Schutzgebot des Art. 6 Abs. l und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ehepaare (Art. 3 Abs. 1) orientierte sachgerechte Besteuerung", also selbst Ausdruck der Steuergerechtigkeit (BVerfGE 61, 319, 347). Artikel 14 GG (Eigentum, Erbrecht und Enteignung) (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 1. Allgemeine Bedeutung. Das Recht auf Eigentum ist ein elementares Grundrecht, das in engem Zusammenhang mit der Garantie der persönlichen Freiheit steht. Die Gewährleistung des Eigentums ergänzt die allgemeine Handlungsfreiheit, jedermann soll im vermögensrechtlichen Bereich ein Freiheitsraum gesichert werden, der eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens ermöglicht. Das Eigentum soll Grundlage privater Initiative und dem Eigentümer in seinem privaten Interesse von Nutzen sein. Denn ohne Eigentum kann niemand am Wirtschaftsleben eigenverantwortlich, autonom und Seite 6 mit privatnütziger Zielsetzung teilnehmen (BVerfGE 42, 64, 76; 52, 1, 30). Das Erbrecht, also das Recht, Vermögen zu erben und zu vererben, sichert den Schutz des Eigentums vor staatlichem Zugriff über den Tod hinaus. Art. 14 schützt nur das Eigentum Privater (Privateigentum), nicht aber das Eigentum staatlicher Stellen. Eine Gemeinde kann sich daher nicht unter Berufung auf Art. 14 dagegen wehren, dass ihr Eigentum durch Maßnahmen der Landesregierung beeinträchtigt wird (BVerfGE 61, 82, 100 ff.). Das Grundrecht auf Eigentum schützt den Bürger vor der Wegnahme von Sachen und Entziehung von Rechten durch den Staat. Es ist eine Bestandsgarantie dafür, dass jeder seine Sachen und Rechte behalten darf, und nicht etwa nur eine Wertgarantie in dem Sinne, dass bei einer Eigentumsentziehung Entschädigung zu leisten ist. legten (BVerfGE 38, 175, 184f.). Es schützt aber nicht vor der Verpflichtung zu Geldleistungen, also insbesondere nicht vor Steuern (BVerfGE 30, 250, 271 f.). Andernfalls müsste nämlich die Steuerpflicht als Enteignung angesehen werden, für die der Staat gem. Art. 14 Abs. 3 Entschädigung, zu leisten hätte, so dass praktisch überhaupt keine Steuer erhoben werden könnte. 2. Begriff des Eigentums. a) Im Bereich des Privatrechts schützt Art. 14 das Eigentum so, wie es vom bürgerlichen Recht und den allgemein gültigen Auffassungen geformt ist (BVerfGE l, 264, 278). In diesem Bereich sind alle Vermögenswerten Rechte Eigentum. Der Schutz erfasst das Eigentum an beweglichen Sachen und an Immobilien. Geschützt wird aber auch das Eigentum an Rechten (Inhaberschaft). Vertragliche Ansprüche wie etwa ein Kaufpreisanspruch sind Eigentum (BVerfGE 45, 142, 179). Aktien und Anteile an Unternehmen fallen unter den Eigentumsbegriff des Art.14 (BVerfGE 50, 290, 341f.). Dasselbe gilt für das sog. geistige Eigentum. Geschützt wird daher das Urheberrecht, das dem Urheber eines literarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Werkes die wirtschaftliche Verwertung seiner Leistung sichert (BVerfGE 49, 382, 392). Geschützt werden auch Patente, die den Erfinder berechtigen, alle anderen von der Benutzung seiner Erfindung auszuschließen (BVerfGE 36, 281, 290). Als weiteres gewerbliches Schutzrecht wird das Warenzeichenrecht, das die ausschließliche Benutzung eines Warenzeichens (Marke) garantiert, von Art. 14 erfasst (BVerfGE 51, 193). Schließlich gehört auch der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb, der rechtlich als eine Zusammenfassung von Sachen und Rechten anzusehen ist, zum Eigentum; bloße Erwerbschancen werden allerdings nicht geschützt (BVerfGE 51, 193, 221 f.). Denn der Eigentumsschutz ist eine Bestandsgarantie, keine Erwerbsgarantie. b) Anders als im Privatrecht sind im Bereich des öffentlichen Rechts die Vermögenswerten Rechte des Bürgers in der Regel nicht durch Art. 14 geschützt. Denn diese Rechte beruhen überwiegend auf staatlicher Gewährung und nicht auf Leistungen des Einzelnen. Der Staat wird nicht durch Art. 14 gehindert, etwa zur Haushaltssanierung bisher bestehende öffentliche Leistungen einzuschränken oder ganz abzuschaffen; andernfalls wäre es unmöglich, die Gesetze an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse anzupassen. Erst wenn eine vom Staat erbrachte Leistung als Gegenwert für eine Leistung des Bürgers anzusehen ist, wird der Anspruch des Bürgers auf die staatliche Leistung von Art. 14 geschützt (BVerfGE 58, 81, 112). Nach diesen Grundsätzen sind Rechtspositionen, die sich aus einer staatlichen Zulassung oder einer staatlichen Aufgabenzuweisung ergeben, kein Eigentum. So wird die Rechtstellung eines Bezirksschornsteinfegers, die durch die Zuweisung eines bestimmten Bezirks mit Kehrzwang und Kehrmonopol gekennzeichnet ist, ebenso wenig durch Art. 14 geschützt wie die Verleihung des Beurkundungsrechts an eine kirchliche Stelle (BVerfGE l, 264, 278; 18, 392, 396). Kein Eigentum sind auch Ansprüche auf Leistungen, die der Staat in Erfüllung seiner Fürsorgepflicht den Bürgern gewährt (BVerfGE 2, 380f.; 53, 257, 292). Dies gilt nicht nur für den Bereich der Sozialhilfe, sondern auch für das Lastenausgleichsrecht oder etwa für den Anspruch auf Wohnungsbauprämie (BVerfGE 11, 64; 48, 403,413). c) Im Bereich des Sozialversicherungsrechts sind die Versichertenrenten und die Rentenanwartschaften aus den gesetzlichen Rentenversicherungen Eigentum im Sinn des Art. 14. Denn die Ansprüche hierauf beruhen nicht ausschließlich auf staatlicher Gewährung, sondern auch auf Leistungen (Beiträgen) des jeweils Berechtigten. Zwar müssen sich Eigenleistung und Höhe des Rentenanspruchs nicht immer entsprechen. Daraus folgt aber nicht ein gänzlicher oder Seite 7 teilweiser Wegfall des Eigentumsschutzes, sondern nur, dass der Gesetzgeber bei der inhaltlichen Gestaltung und auch Änderung eines Rentenanspruchs oder einer sonstigen rentenversicherungsrechtlichen Position umso freier ist, je weniger die jeweilige Rechtsstellung auf eigenen Leistungen des Berechtigten beruht (BVerfGE 53, 257, 293). Dasselbe gilt für den Anspruch von Arbeitslosengeld (BVerfGE 74, 203, 313 f.). 3. Schutz des Erbrechts. Das Erbrecht sichert das Recht des Erblassers, sein Vermögen entsprechend seinem („letzten") Willen zu vererben, und das Recht des Erben, dieses Vermögen nach dem Erbfall zu übernehmen. Für den Erblasser schützt es vor allem die sog. Testierfreiheit, nämlich das Recht, durch ein Testament festzulegen, wem das Vermögen nach dem Tode zufallen soll. Damit wird der enge Zusammenhang zwischen Erbrecht und Eigentumsgarantie deutlich; denn die Testierfreiheit ist nichts anderes als das Recht, letztmalig über das Eigentum zu verfügen. Für die Hinterbliebenen bedeutet die verfassungsmäßige Garantie des Erbrechts, dass gesetzliche Vorschriften über die Erbfolge in den Fällen bestehen müssen, in denen kein Testament errichtet wird. Dementsprechend bestimmt das BGB als gesetzliche Erben den Ehegatten und die Nachkommen oder die sonstigen Verwandten des Erblassers. 4. Inhalt und Schranken des Eigentums. Eigentum im Rechtssinne ist ohne ausführliche gesetzliche Regelungen nicht denkbar. Denn erst aus derartigen Regelungen kann sich ergeben, in welcher Weise bewegliche Sachen, Immobilien und sonstige Vermögenswerte Rechte dem einzelnen Bürger zugeordnet werden und wie weit seine Verfügungsbefugnis jeweils reicht. Da das Grundgesetz derartige Bestimmungen nicht enthält, ist es Sache des Gesetzgebers, Inhalt und Schranken des Eigentums entsprechend den jeweils herrschenden sich wandelnden Anschauungen zu bestimmen (BVerfGE 20, 351, 355). Diese Gestaltungsbefugnis ist allerdings begrenzt. Bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums muss die Substanz des Eigentumsrechts und die Zuordnung des jeweiligen Eigentumsobjektes zu seinem Eigentümer erhalten bleiben. Keinesfalls darf der Gesetzgeber unter dem Etikett einer Inhaltsbestimmung des Eigentums in Wahrheit eine Enteignung durchführen (BVerfGE 42, 263, 295). Inhaltsbestimmung und Enteignung sind vielmehr klar voneinander zu trennen. Unter Inhaltsbestimmung ist die generelle (also auf eine unbestimmte Anzahl von Personen bezogene und abstrakte (also auf eine unbestimmte Anzahl von Fällen bezogene) Festlegung von Rechte und Pflichten hinsichtlich des Eigentums zu verstehen. Demgegenüber ist eine Enteignung dadurch gekennzeichnet, dass einer bestimmten Person oder einem bestimmten oder jedenfalls genau bestimmbaren Personenkreis individuelle und konkrete Eigentumsrechte entzogen werden (BVerfGE 52, l, 27; 58, 300, 330). Mit dieser Abgrenzung ist auch die Grenze zulässiger Inhaltsbestimmungen festgelegt. Auch soweit die Grenze der Enteignung nicht erreicht wird, ist es nicht in das Belieben des Gesetzgebers gestellt, wie Inhalt und Schranken des Eigentums bestimmt werden. Eigentumsbindungen müssen vielmehr sachlich geboten sein und dürfen nicht weiter gehen, als der jeweilige Schutzzweck, der sie rechtfertigen soll, es erfordert. Sie müssen also dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Überschreitet der Gesetzgeber bei einer Inhaltsbestimmung diese Grenze, so kann die - unzulässige Inhaltsbestimmung nicht etwa in, eine - zulässige - Enteignung umgedeutet werden: die Inhaltsbestimmung ist vielmehr nichtig (BVerfGE 52, 1, 27f.). Grundsätzlich ergibt sich aus der Befugnis, Inhalt und Schranken des Eigentums zu bestimmen, für den Gesetzgeber die Aufgabe, das Sozialmodell zu verwirklichen, das einerseits durch die Anerkennung des Privateigentums und andererseits durch dessen Sozialpflichtigkeit geprägt ist. Der Gesetzgeber muss beiden Elementen gleichermaßen Rechnung tragen und die Interessen aller Beteiligten in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen; er darf weder diejenigen, die Eigentum haben, noch diejenigen, die auf die Nutzung fremden Eigentums angewiesen sind, einseitig bevorzugen oder benachteiligen (BVerfGE 52, l, 29). Beispiel für einen derartigen Interessenausgleich ist das Mietrecht, das dem Vermieter von Wohnräumen zwar den Anspruch auf die ortsübliche Vergleichsmiete sichert, aber Kündigungen weitgehend erschwert und solche zum Zwecke der Mieterhöhung ganz ausschließt (BVerfGE 37,132,141 ff.). Seite 8 Eigentumsbindungen gibt es in vielfältiger Form. Bebauungsbeschränkungen für bebaubare Grundstücke (aber nicht totale Bauverbote, die eine Teilenteignung darstellen), landwirtschaftliche Anbaubeschränkungen, allgemeine Veräußerungsverbote, staatliche Preisregelungen, der Mieterschutz und die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb sind Beispiele für Festlegungen von Inhalt und Schranken des Eigentums. 5. Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Aus dem Eigentum ergeben sich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten; sein Gebrauch soll auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2). Diese Sozialpflichtigkeit ist eine Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 1). Sie zieht der umfassenden Gebrauchsund Verfügungsbefugnis des Eigentümers im Interesse des Gemeinwohls Grenzen.. Das Gebot sozialgerechter Nutzung enthält die Absage an eine Eigentumsordnung, in der das Individualinteresse den unbedingten Vorrang vor den Interessen der Gemeinschaft hat (BVerfGE 21, 73, 83). Es verlangt Rücksichtnahme auf diejenigen Bürger, die auf die Nutzung fremden Eigentums angewiesen sind (z.B. Mieter). Es ist aber nicht nur eine Anweisung für das konkrete Verhalten des Eigentümers, sondern in erster Linie eine Richtschnur für den Gesetzgeber bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums. Die Sozialpflichtigkeit ist insoweit der wichtigste Maßstab für die Zulässigkeit von Eigentumsbindungen. Je stärker die Allgemeinheit auf die Nutzung fremden Eigentums angewiesen ist, um so weiter ist der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers; er verengt sich, wenn dies nicht oder nur in begrenztem Umfang der Fall ist (BVerfGE 42, 263, 294). 6. Enteignungen. Eine Enteignung liegt vor, wenn einer bestimmten Person oder einem bestimmten oder jedenfalls genau bestimmbaren Personenkreis individuelle und konkrete Eigentumsrechte entzogen werden, das Eigentum insoweit also weggenommen wird (BVerfGE 52, l, 27). Die Zulässigkeit von Enteignungen stellt die Eigentumsgarantie keineswegs generell in Frage; die Schutzfunktion des Art. 14 Abs. 3 besteht vielmehr gerade darin, dass Enteignungen nur unter den dort vorgesehenen engen- Voraussetzungen möglich sind, über die der Gesetzgeber (und erst recht eine Behörde) sich nicht hinwegsetzen kann. Enteignungen werden normalerweise von einer Behörde durchgeführt (Administrativenteignung); in seltenen Fällen gibt es aber auch Enteignungen durch Gesetz (Legalenteignung). Eine Legalenteignung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Gesetz mit seinem Inkrafttreten unmittelbar individuelle und konkrete Eigentumsrechte entzieht, ohne dass hierfür noch ein Vollzugsakt erforderlich wäre. Legalenteignungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, weil sie den Rechtsschutz des Bürgers weitgehend ausschließen, da gegen Gesetze der übliche Rechtsweg verschlossen ist (es bleibt nur die Verfassungsbeschwerde). Einen derartigen Ausnahmefall hat das Bundesverfassungsgericht beim Hamburger Deichordnungsgesetz 1964 bejaht, weil die Behörden die für den Deichbau notwendigen Einzelenteignungen nicht in angemessener Zeit hätten durchführen können (BVerfGE 24, 367, 398 ff.). Eine Enteignung liegt nicht nur dann vor, wenn das Eigentum vollständig entzogen wird, sondern auch bei einer teilweisen Entziehung (Teilenteignung). So ist die Belastung eines Grundstücks mit einer Dienstbarkeit (§ 1018 BGB), die einen anderen berechtigt, das Grundstück in bestimmter Weise zu nutzen (z.B. eine Schwebebahn darüber zu bauen), eine Teilenteignung (BVerfGE 56, 249, 260 - Bad Dürkheimer Gondelbahn). Eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig. Das Wohl der Allgemeinheit ist vom Gesetzgeber zu konkretisieren. Nur durch Gesetz kann festgelegt werden, welche Gemeinwohlaufgaben eine Enteignung legitimieren und für welche Vorhaben unter welchen Voraussetzungen eine Enteignung zulässig sein soll. Weder Behörden noch Gemeindeverwaltungen haben das Recht, anstelle des Gesetzgebers das Gemeinwohl zu definieren und auf diese Weise eigene Enteignungszwecke zu erfinden (BVerfGE 56, 249, 261 f.). Eine Enteignung erfolgt nur dann zum Wohl der Allgemeinheit, wenn sie für einen konkreten Zweck erforderlich ist. Eine Enteignung nur zur Einsparung öffentlicher Mittel ist unzulässig; die Enteignung ist nämlich kein Instrument zur Vermehrung des Staatsvermögens (BVerfGE 38, 175, Seite 9 180). Es genügt auch nicht, dass eine Enteignung allgemein dem Gemeinwohl wie etwa dem Bau einer U-Bahn dient; vielmehr kommt es darauf an, ob gerade die konkrete Enteignung für den UBahn-Bau notwendig ist (BVerfGE 45, 297, 321 f.). Eine Enteignung erfolgt normalerweise zugunsten des Staates, weil er die Aufgabe hat, das Wohl der Allgemeinheit zu verwirklichen. Ausnahmsweise ist aber auch eine Enteignung zugunsten eines nichtstaatlichen (privaten) Unternehmens zulässig, wenn diesem durch Gesetz eine dem Gemeinwohl dienende Aufgabe übertragen ist (z.B. Energieversorgung - BVerfGE 66, 248, 257). Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit erfordert, dass eine Enteignung stets nur als letztes Mittel (ultima ratio) durchgeführt wird. Sie ist nur dann zulässig, wenn es keine andere rechtlich und wirtschaftlich vertretbare Lösung gibt; sie ist solange unzulässig, wie der Zweck, dem sie dienen soll, auch auf andere, weniger schwer in die Rechte des Bürgers eingreifende Weise erreicht werden kann. Artikel 20 GG (Grundprinzipien der Verfassung, Widerstandsrecht) (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 1. Allgemeine Bedeutung Art. 20 enthält - abgesehen vom in Absatz 4 verankerten Widerstandsrecht - keine Grundrechte. Die Bestimmung enthält aber fundamentale Rechtsgrundsätze wie das Rechtsstaatsprinzip und das Sozialstaatsprinzip, die bei jeder Grundrechtsbeschränkung zu beachten sind und denen insoweit Bedeutung für alle Grundrechte zukommt. Die Verletzung dieser Prinzipien kann zwar nicht isoliert, wohl aber in Verbindung mit dem jeweils anwendbaren Grundrecht gerügt werden; greift kein spezielles Grundrecht ein, ist jedenfalls eine Rüge im Rahmen Auffanggrundrechts des Art. 2 Abs. l (s. o. Art. 216) möglich. 2. Rechtsstaatsprinzip. Zu den Leitgedanken der Verfassung gehört das Rechtsstaatsprinzip, das in Art. 20 Abs. 3 durch die Bindung des Gesetzgebers an die Verfassung und der Exekutive und Rechtsprechung an Gesetz und Recht verankert ist und außerdem in einer Reihe weiterer Bestimmungen des Grundgesetzes Ausdruck findet (Art. 1 Abs. 3: Bindung aller Gewalten an die Grundrechte; Art. 19 Abs. 4: Garantie des Rechtsweges; Art. 28 Abs. 1 S. 1: Verbindlichkeit des Rechtsstaatsprinzips für die Landesverfassungen). Das Rechtsstaatsprinzip enthält keine von vornherein in allen Einzelheiten eindeutig bestimmten Gebote oder Verbote von Verfassungsrang, sondern bedarf der Konkretisierung. Zu seinen wesentlichen Bestandteilen gehören die Idee der Gerechtigkeit und das Prinzip der Rechtssicherheit, der Vertrauensschutz und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Recht auf ein faires Verfahren. a) Die Idee der Gerechtigkeit verlangt Bemühen um Gerechtigkeit nicht nur im allgemeinen, sondern gerade auch im Einzelfall. Damit ist gemeint, dass die Gesetze gerechte Regelungen enthalten müssen und ihre Anwendung im Einzelfall durch Behörden oder Gerichte zu gerechten, also inhaltlich - materiell - richtigen Ergebnissen führen muss (BVerfGE 7, 89, 92). Was im Einzelfall gerecht ist, wird sich jeweils nur unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände sagen lassen. Ein Verstoß gegen das Gerechtigkeitsgebot liegt z.B. vor, wenn gegen einen Straftäter eine schlechthin unangemessene oder sogar grausame Strafe verhängt wird oder das Maß seiner Schuld unberücksichtigt bleibt (BVerfGE 54, 100, 108). Ungerecht wäre es auch, einen Soldaten oder Beamten wegen desselben Dienstvergehens mehrfach disziplinarisch zu bestrafen oder bei Taten, die sowohl ein Dienstvergehen als auch eine Seite 10 Straftat darstellen, eine Disziplinarstrafe und eine allgemeine (Kriminal-) Strafe nebeneinander zu verhängen, ohne die eine auf die andere anzurechnen (BVerfGE 28, 264, 277; 21, 378, 388). b) Das Prinzip der Rechtssicherheit dient dem Rechtsfrieden und der Verlässlichkeit der Rechtsordnung. Es besagt, dass jedes -streitige oder unstreitige - Verfahren, in dem es um die Anwendung von Recht geht, einmal zu einem endgültigen Abschluss kommen muss, dessen Rechtsbeständigkeit gesichert ist. Insofern ist die Rechtssicherheit eine notwendige Bedingung der Freiheit, weil selbstverantwortliche Lebensgestaltung nur auf der Grundlage sicheren Rechts möglich ist (BVerfGE 60, 253, 267ff.). Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Einzelfall geraten miteinander in Konflikt, wenn sich nach dem rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens herausstellt, dass die getroffene Entscheidung etwa ein Verwaltungsakt oder ein Gerichtsurteil - falsch war. Dann geht es um die Frage, ob die falsche Entscheidung aus Gründen der Rechtssicherheit bestehen bleiben oder aus Gründen der Gerechtigkeit .aufgehoben werden soll. Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Einzelfall sind grundsätzlich gleichrangige Prinzipien; das Grundgesetz räumt keinem von ihnen von vornherein den Vorrang ein. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, diesen Konflikt zu lösen und jeweils zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Wiederaufnahme des Verwaltungsoder des Gerichtsverfahrens möglich sein soll (BVerfGE 15, 313, 319). Eine besonders abgewogene Lösung ist in § 79 BVerfGE für die Fälle enthalten, in denen das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für nichtig erklärt. Handelt es sich um ein Strafgesetz, so ist die Wiederaufnahme der betroffenen Strafverfahren zulässig. Handelt es sich um ein anderes Gesetz, so bleiben die hierauf gestützten rechtskräftigen Entscheidungen bestehen. Sie dürfen aber nicht mehr vollstreckt werden. Sind sie aber bereits vollstreckt worden, so kann das Geleistete nicht wieder zurückgefordert werden. c) der Grundsatz des Vertrauensschutzes steht mit dem Prinzip der Rechtssicherheit in engem Zusammenhang. In vielen Fällen bedeutet Rechtssicherheit in erster Linie Vertrauensschutz, nämlich Schutz des Vertrauens des Bürgers darauf, dass an sein Verhalten nicht nachträglich ungünstigere Rechtsfolgen geknüpft werden, als im Zeitpunkt seiner jeweiligen Dispositionen vorhersehbar war (BVerfGE 13, 261, 271). Der Vertrauensschutz bezieht sich also auf rückwirkende, nicht etwa auf zukünftige Rechtsänderungen. Vertrauensschutz setzt schutzwürdiges Vertrauen voraus. Grundsätzlich kann der Bürger darauf vertrauen, dass das geltende Recht nicht später rückwirkend geändert wird. Das gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Das Vertrauen ist nicht schutzwürdig, wenn bereits in dem Zeitpunkt, auf den der Eintritt der Rechtsfolgen eines Gesetzes zurück bezogen wird, mit dieser Neuregelung zu rechnen war. Mit einer Neuregelung muss aber nicht schon deshalb gerechnet werden, weil die Regierung einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt und das Parlament mit Beratungen begonnen hat, sondern erst dann, wenn der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat (BVerfGE 27, 167, 173 f.). Nicht schutzwürdig ist das Vertrauen in eine Rechtslage, die unklar und verworren ist; der Gesetzgeber muss vielmehr die Möglichkeit haben, sie rückwirkend einwandfrei zu regeln (BVerfGE 13, 261, 272). Ebenso wenig kann man sich darauf verlassen, dass eine Rechtsvorschrift aus formalen Gründen nichtig ist und deshalb keine Wirkungen erzeugt. Der Gesetzgeber kann daher Regelungen einer Verordnung, die wegen fehlender gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage nichtig war, rückwirkend in Gesetzesform erlassen (BVerfGE 22, 330, 348). Der Grundsatz des Vertrauensschutzes schließt Gesetze und Verordnungen mit echter Rückwirkung prinzipiell aus. Echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz nachträglich ändernd in bereits abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift. Beispiel hierfür wäre ein Gesetz, das bestimmte Vorgänge nachträglich mit einer Steuer belegt. In vielen Fällen sind Rechtsvorschriften aber weder nur auf vergangene noch nur auf zukünftige Sachverhalte bezogen, sondern auf gegenwärtige, die in der Vergangenheit begonnen haben und erst in der Zukunft abgeschlossen sein werden. Sie wirken also nur teilweise zurück; das Bundesverfassungsgericht spricht in diesen Fällen von unechter Rückwirkung. Beispiele hierfür sind etwa der zukünftige Wegfall einer bisher geltenden Steuervergünstigung (auf die man sich eingestellt hatte) oder Änderungen im Sozialversicherungsrecht, durch die Ansprüche gekürzt Seite 11 werden, die ganz oder teilweise auf in der Vergangenheit geleisteten Beiträgen beruhen, aber erst in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllt werden. Regelungen mit unechter Rückwirkung sind nicht prinzipiell ausgeschlossen. Der Vertrauensschutz geht nicht soweit, dass dem Bürger jegliche Enttäuschung erspart wird. Vielmehr kommt es in derartigen Fällen zunächst darauf an, inwieweit die Rechtsposition des Bürgers nachträglich entwertet wird; entscheidend ist dann die Abwägung zwischen dem Interesse des Einzelnen am Fortbestehen der geltenden Regelung und dem Interesse der Allgemeinheit an einer Änderung (BVerfGE 50, 386, 395 f.). d) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergibt sich nicht nur aus dem Rechtsstaatsprinzip, sondern auch aus dem Wesen der Grundrechte selbst, die als Ausdruck des allgemeinen Freiheitsanspruchs des Bürgers jeweils nur so weit beschränkt werden dürfen, wie es zum Schutz öffentlicher Interessen unerlässlich ist; der Bürger muss vor unnötigen Eingriffen der öffentlichen Gewalt bewahrt bleiben (BVerfGE 19, 342, 348f.; 55, 159, 165). Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betrifft das Verhältnis zwischen Mittel und Zweck. Eine Grundrechtsbeschränkung ist - als Mittel - nur zulässig, wenn sie für den Zweck, dem sie dienen soll, geeignet und erforderlich ist und außerdem bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt bleibt. Ein Mittel ist geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann. Es ist erforderlich, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht, das ebenso wirksam ist, die Grundrechte aber weniger einschränkt; erforderlich ist also immer nur das mildeste wirksame Mittel. Bei der Gesamtabwägung kommt es darauf an, ob Mittel und Zweck in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne); es darf also nicht „mit Kanonen auf Spatzen geschossen" werden (BVerfGE 67, 157, 173). e) Das Recht auf ein faires Verfahren gehört zu den wesentlichen Auswirkungen des Rechtsstaatsprinzips im Bereich von Verfahrensregeln. Es besteht gleichermaßen in allen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, hat aber vor allem im Strafverfahren Bedeutung erlangt. Es besagt, dass niemand, auch nicht der Angeklagte, zum bloßen Objekt eines staatlichen Verfahrens herabgewürdigt werden darf; vielmehr muss dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben werden, zur Wahrung seiner Rechte auf den Gang und das Ergebnis des Verfahrens Einfluss zu nehmen (BVerfGE 57, 250, 274 f.). Das Recht auf ein faires Verfahren umfasst auch das Recht auf Verteidigung. Jedermann hat das Recht, sich im Strafverfahren von einem gewählten Anwalt seines Vertrauens verteidigen zu lassen; daraus folgt allerdings kein Anspruch auf eine beliebige Anzahl von Verteidigern (BVerfGE 39, 156, 163 - gem. § 137 StPO kann man höchstens drei Verteidiger beauftragen). Zum rechtsstaatlichen Strafverfahren gehört außerdem, dass der Beschuldigte, der die Kosten eines Wahlverteidigers nicht aufbringen kann, in schwerwiegenden Fällen von Amts wegen und auf Staatskosten einen Pflichtverteidiger erhält (BVerfGE 39, 238, 243). Ist ein Pflichtverteidiger bestellt, so darf die Verhandlung nicht in seiner Abwesenheit durchgeführt werden (BVerfGE 65, 171, 175 f.). Bei einem der deutschen Sprache nicht mächtigen Angeklagten ist besonders darauf zu achten, dass er - durch Übersetzungshilfen oder durch einen Anwalt - Zugang zu allen verfahrensrelevanten Informationen erhält und sich im Verfahren äußern kann (BVerfGE 64, 135, 145). Das Recht auf ein faires Verfahren schließt es nicht von vornherein aus, dass sog. V-Leute nicht in der Hauptverhandlung, sondern nur außerhalb durch einen beauftragten Richter vernommen werden, auch wenn dann weder der Angeklagte noch sein Verteidiger an der Vernehmung teilnehmen und dem V-Mann Fragen stellen können. Notfalls kann es zulässig sein, die persönliche Vernehmung eines V-Mannes durch das Verlesen seiner schriftlichen Aussage zu ersetzen, wenn der Schutz des V-Mannes anders nicht gesichert werden kann. Der Beweiswert einer Aussage unter derartigen Bedingungen ist aber besonders kritisch zu würdigen, wenngleich ein verfassungsrechtliches Beweisverbot nicht besteht (BVerfGE 57, 250, 292f.). Seite 12 f) Die Unschuldsvermutung steht in engem Zusammenhang mit dem Recht auf ein faires Verfahren. Ihr Inhalt ist in Art. 6 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention mit folgenden Worten umschrieben: „Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist". Gesetzlicher Nachweis der Schuld bedeutet, dass die Schuld in einem gesetzlich geregelten Verfahren nachgewiesen werden muss. Die Unschuldsvermutung gilt m der Bundesrepublik Deutschland nicht nur aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern hat als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips Verfassungsrang. Sie verbietet es, ohne Schuldnachweis gegen einen Beschuldigten eine Strafe oder eine Maßnahme, die ebenso wie eine Strafe wirkt, zu verhängen oder ihn sonst als schuldig zu behandeln (BVerfGE 74, 358, 370). Die Unschuldsvermutung gilt nicht nur im Strafrecht, sondern auch für die Verhängung von Geldbußen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (BVerfGE 9, 167, 170). 3. Sozialstaatsprinzip. Ebenso wie das Rechtsstaatsprinzip gehört auch das Sozialstaatsprinzip, das in Art. 20 Abs.1 verankert ist, zu den Leitgedanken der Verfassung. Seine grundrechtlichen Wirkungen sind aber wesentlich geringer. Während sich aus dem Rechtsstaatsprinzip allgemeine Grenzen für Grundrechtsbeschränkungen ergeben, zielt das Sozialstaatsprinzip zwar auch auf die Abwehr unsozialer Grundrechtseingriffe in erster Linie aber auf zusätzliche Aktivität des Staates, nämlich auf die Herstellung einer gerechten Sozialordnung. Das Sozialstaatsprinzip stellt dem Staat also eine Aufgabe, sagt aber nichts darüber, wie diese Aufgabe im einzelnen zu erfüllen ist; dem Gesetzgeber kommt daher insoweit ein weiter Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 59, 231, 263). Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Unterstützung für diejenigen, die aufgrund persönlicher Lebensumstände oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung gehindert sind (BVerfGE 45, 376, 387). Die Fürsorge für Hilfsbedürftige gehört zu den selbstverständlichen Pflichten des Sozialstaates. Der Staat muss denen, die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht in der Lage sind, sich selbst zu unterhalten, die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein sichern und sich darüber hinaus bemühen, sie so weit wie möglich in die Gesellschaft einzugliedern, ihre angemessene Betreuung in der Familie oder durch Dritte zu fördern und die notwendigen Pflegeeinrichtungen zu schaffen. Wie dies im einzelnen geschehen soll, hat der Gesetzgeber zu entscheiden. Ein Verstoß gegen das Sozialstaatsprinzip liegt erst vor, wenn die gewährte Hilfe im Ergebnis nicht den genannten Anforderungen sozialer Gerechtigkeit entspricht (BVerfGE 40, 121, 133). Das Sozialstaatsprinzip hat Bedeutung für alle Rechtsbereiche. Im Prozessrecht gebietet es - in Verbindung mit dem Gleichheitssatz - die weitgehende Angleichung der Situation von finanzkräftigen und sozial schwachen Bürgern bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes; dies geschieht durch die Bewilligung von Prozesskostenhilfe (BVerfGE 67, 245, 248). 4. Widerstandsrecht. Das in Art. 20 Abs. 4 verankerte Widerstandsrecht ist 1969 im Zusammenhang mit der Notstandsgesetzgebung in das Grundgesetz eingefügt worden. Es dient der Verteidigung der Grundprinzipien der Verfassung. Unternimmt es jemand, „diese Ordnung" - nämlich die in Art. 20 Abs. 1-3 niedergelegte Ordnung - zu beseitigen, sind alle Deutschen zum Widerstand berechtigt, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. Der Widerstand kann also nur das letzte und äußerste Mittel der Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein. Seite 13 Die Verfassungsbeschwerde 1. Allgemeine Bedeutung. Jedermann kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Rechte aus Art. 1-19, 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 verletzt zu sein, Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erheben. Die Verfassungsbeschwerde ist aber weder der einzige noch der vorrangige Rechtsbehelf zur Durchsetzung von Grundrechten. Die Grundrechte sind von jeder Behörde und jedem Gericht zu beachten. Wer sich durch eine staatliche Maßnahme in einem seiner Grundrechte verletzt fühlt, kann nicht sofort Verfassungsbeschwerde einlegen, sondern muss sich zunächst an die zuständigen Gerichte wenden. Die Verfassungsbeschwerde ist nur ein letztes Mittel und kann grundsätzlich erst nach Erschöpfung des Rechtsweges eingelegt werden. Eine Ausnahme gilt nur in den seltenen Fällen, in denen eine Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeutung ist (also eine Vielzahl von Bürgern in ähnlicher Lage betrifft) oder dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde (weil dann eine irreparable Grundrechtsverletzung eintreten könnte). Auf die Europäische Menschenrechtskonvention oder auf Grundrechte in einer Landesverfassung kann die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nicht gestützt werden. Die Einzelheiten der Verfassungsbeschwerde, die in Art. 93 Abs. l Nr. 4a verankert ist, sind in §§ 90ff. BVerfGG geregelt. 2. Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen von Behörden oder Gerichten. Wer glaubt, durch die Entscheidung einer Behörde in seinen Grundrechten verletzt zu sein, muss das zuständige Gericht anrufen; eine Verfassungsbeschwerde kann - abgesehen von den unter 1) genannten seltenen Ausnahmefällen - nicht sofort eingelegt werden. Erst wenn der Rechtsweg erschöpft ist, also die letzte Gerichtsinstanz entschieden (und die behördliche Entscheidung nicht aufgehoben) hat, kann Verfassungsbeschwerde erhoben werden; diese richtet sich dann sowohl gegen die Entscheidung der Behörde als auch diejenige des Gerichtes. Wer glaubt, durch die Entscheidung eines Gerichtes in seinen Grundrechten verletzt zu sein, muss zunächst die nächst höhere Gerichtsinstanz anrufen, bevor er Verfassungsbeschwerde einlegt. Geht es um die Nichtgewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1), muss zunächst eine nachträgliche Anhörung beantragt werden, soweit dies nach den Bestimmungen des Prozessrechts im Einzelfall möglich ist. Bei Verfassungsbeschwerden gegen Gerichtsentscheidungen ist zu beachten, dass das Bundesverfassungsgericht keine „Superrevisionsinstanz" ist. Es hat nur zu überprüfen, ob eine Gerichtsentscheidung speziell gegen Grundrechte verstößt, nicht aber, ob sie allgemeine Rechtsfehler enthält. Dass die Feststellung des Sachverhaltes oder die Auslegung eines Gesetzes durch ein Gericht möglicherweise fehlerhaft war, rechtfertigt noch keine Verfassungsbeschwerde, weil nicht jede fehlerhafte Rechtsanwendung automatisch eine Verfassungsverletzung bedeutet. 3. Verfassungsbeschwerde gegen Rechtsvorschriften. Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen Gesetze, Verordnungen und kommunale Satzungen sind nur zulässig, wenn diese Rechtsvorschriften den Beschwerdeführer unmittelbar, selbst und gegenwärtig betreffen. „Unmittelbar" bedeutet, dass der Bürger ohne zusätzlichen Vollzugsakt einer Behörde betroffen sein muss. Das ist nur ausnahmsweise der Fall. Denn in der Regel müssen die Gesetze durch die Behörden vollzogen (angewendet) werden. So wird etwa ein Steuergesetz erst durch den Steuerbescheid gegenüber dem Bürger vollzogen. Hält jemand ein Steuergesetz für verfassungswidrig, kann er dagegen nicht unmittelbar Verfassungsbeschwerde einlegen. Der Betroffene muss vielmehr den Steuerbescheid vor dem Finanzgericht anfechten, das, wenn es das Steuergesetz für verfassungswidrig hält, die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorlegt; der Betroffene kann sich erst nach der letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung an das Bundesverfassungsgericht wenden. Seite 14 Ausnahmsweise unmittelbar betroffen ist man durch ein Gesetz, das überhaupt keines Vollzugsaktes bedarf (z. B ein Gesetz das genau bezeichnete Grundstücke enteignet), oder durch ein Gesetz, das den Bürger schon vor Erlass eines Vollzugaktes zu später nicht mehr korrigierbaren Entscheidungen zwingt (z.B.. ein Gesetz, das Rentenanwartschaften vermindert, so dass der Betroffene - lange vor Eintritt des Versicherungsfalles und Erteilung eines Rentenbescheides - ggf. für eine zusätzliche Altersversorgung sorgen muss). 4. Form und Inhalt der Verfassungsbeschwerde. Die Verfassungsbeschwerde muss schriftlich eingereicht und begründet werden. Sie muss mindestens eine genaue Bezeichnung des angefochtenen staatlichen Aktes (also der Gerichts- oder Behördenentscheidung mit Datum und Aktenzeichen oder der Rechtsvorschrift), die Nennung des angeblich verletzten Grundrechts und eine in sich verständliche Darlegung derjenigen Umstände enthalten, aus denen sich der Grundrechtsverstoß ergeben soll. Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist möglich, aber nicht erforderlich; jedermann kann die Verfassungsbeschwerde selbst erheben. 5. Fristen. Die Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen von Gerichten oder Behörden ist nur innerhalb eines Monats zulässig. Die Frist beginnt, grob gesagt, mit der Mitteilung der Entscheidung. Im einzelnen gilt folgendes : Die Frist beginnt mit der Zustellung oder formlosen Mitteilung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung, wenn diese Zustellung oder Mitteilung von Amts wegen vorzunehmen ist. Das ist der Regelfall bei allen Urteilen außer Strafurteilen, die in Anwesenheit des Angeklagten verkündet werden, und bei allen Beschlüssen, die nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergehen. In anderen Fällen beginnt die Frist mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn die Entscheidung nicht zu verkünden ist (z.B. bei Urteilen im schriftlichen Verfahren), mit ihrer sonstigen Bekanntgabe an den Betroffenen. Wird dem Betroffenen dabei nicht eine Abschrift der Entscheidung in vollständiger Form erteilt, so kann er die Monatsfrist dadurch unterbrechen, dass er eine derartige Abschrift beantragt. Die Verfassungsbeschwerde gegen eine Rechtsvorschrift muss binnen eines Jahres seit deren Inkrafttreten eingelegt werden. Versäumt man die genannten Fristen, gibt es keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 6. Annahmeverfahren. Das Bundesverfassungsgericht prüft bei jeder Verfassungsbeschwerde zunächst, ob sie angenommen werden soll. Diese Prüfung wird von einem aus drei Richtern bestehenden Ausschuss, der als „Kammer" bezeichnet wird, vorgenommen. Die Kammer kann die Annahme durch einstimmigen Beschluss ablehnen, wenn die Verfassungsbeschwerde unzulässig ist oder aus anderen Gründen keine Aussicht auf Erfolg hat. Der Nichtannahmebeschluss braucht nicht begründet zu werden und ist unanfechtbar. 7. Kosten. Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist grundsätzlich kostenfrei. Das Bundesverfassungsgericht kann aber einem Beschwerdeführer eine Gebühr bis zu DM 1000.auferlegen, wenn es die Annahme einer Verfassungsbeschwerde ablehnt (sog. Unterliegensgebühr). Eine solche Gebühr riskiert, wer eine unzulässige oder offensichtlich unbegründete Verfassungsbeschwerde einlegt. Die Höhe der Unterliegensgebühr ist gesetzlich nicht festgelegt. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe eine Gebühr erhoben wird, trifft das Bundesverfassungsgericht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Bedeutung des Verfahrens für den Beschwerdeführer und seiner Vermögens und Einkommensverhältnisse. Es kann einen Vorschuss auf die Gebühr anfordern. Wer eine Verfassungsbeschwerde einlegt und dann vom Bundesverfassungsgericht die Aufforderung erhält, einen Vorschuss auf die Unterliegensgebühr zu zahlen, muss damit rechnen, dass seine Verfassungsbeschwerde nicht angenommen wird; er sollte sie zurücknehmen, weil nach der Rücknahme keine Gebühr mehr verhängt werden kann (und daher dann auch der Vorschuss Seite 15 entfällt). Wird eine Verfassungsbeschwerde missbräuchlich eingelegt, kann eine Gebühr bis zu DM 5000.erhoben werden. Missbräuchlich ist eine Verfassungsbeschwerde, wenn sie von jedem einsichtigen Bürger als völlig aussichtslos angesehen werden muss oder wenn sie auf wahrheitswidrige Angaben gestützt wird. Hat eine Verfassungsbeschwerde Erfolg, so erhält der Beschwerdeführer seine notwendigen Auslagen ersetzt. Zu diesen Auslagen gehören auch die Kosten für einen Anwalt, weil jeder Beschwerdeführer berechtigt ist, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen, auch wenn kein Anwaltszwang besteht. Da die genannten Gebühren nur in eindeutig aussichtslosen Fällen erhoben werden und auch kein Anwaltszwang besteht, gibt es grundsätzlich keine Prozesskostenhilfe. Seite 16