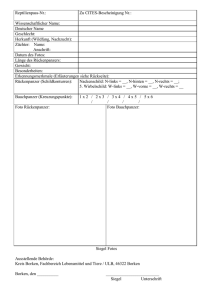Hilfen für Opfer von Katastrophen und gezielter Gewalt Ein Konzept
Werbung

Hilfen für Opfer von Katastrophen und gezielter Gewalt Ein Konzept zur Psychotraumatologischen Versorgung Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau Vorgelegt von Georg Pieper aus Friebertshausen November 2005 Name des Dekans: Prof. Dr. Hans Spada Namen der Gutachtenden: Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel, Psychologisches Institut, Abteilung Rehabilitationspsychologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Zweitgutachter: Prof. Dr. Fritz Mattejat, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Philipps-Universität Marburg Tag der mündlichen Prüfung / des Pomotionsbeschlusses: 16.03.2006 Inhaltsverzeichnis Einleitung A: Psychotraumatologische Behandlung von Katastrophenopfern Überblick über den Wissensstand und die Methoden 1. 2. 15 Einleitung und Definition der Begriffe 15 Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen 17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 17 19 20 27 29 30 Psychologische Auswirkungen einer Katastrophe Differentiell wirksame Merkmale der Katastrophensituation Individuelle und kollektive Risiko- und Schutzfaktoren Bewältigungsstile Die Haltung Betroffener gegenüber psychosozialer Betreuung Zeitliche Entwicklung nach traumatischen Ereignissen Planungsebenen und Behandlungsbausteine 30 2.1 2.2 31 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3. 9 Bewältigung von posttraumatischer Belastung Historische Entwicklung der psychosozialen Katastrophennachsorge Nachsorge unter dem Aspekt des Phasenverlaufs Nachsorge mit dem Fokus auf sozialen Funktionsebenen Psychosoziale Interventionen Einrichtung eines psychosozialen Netzwerks Informationsmanagement und Psychoedukation Psychosoziale Ressourcen und Unterstützungssysteme Klinisch-psychologische Interventionsmaßnahmen 33 35 36 37 38 39 44 46 Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern 54 3.1 55 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Forschungsstand über Gewalt an Schulen Formen und Häufigkeiten Einflussfaktoren Zwischenbilanz zum Forschungsstand Zielgerichtete Gewalt Definition Häufigkeit und Auswirkungen Prävention 55 56 59 60 60 61 61 4 Inhaltsverzeichnis 4. Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen 63 4.1 4.2 4.3 63 64 Symptomatik und Altersverlauf Diagnostik traumatischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen Betreuung und Therapie traumatisierter Kinder und Jugendlicher nach Katastrophen 66 B: Felderfahrungen nach Katastrophen und zielgerichteter Gewalt an Schulen 69 1. Das Grubenunglück von Borken (1988) 69 1.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds 69 Beschreibung des Umfelds Traumatische Stressoren und typische Reaktionen 70 72 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2. Interventionen und deren Implementierung Systemebene Gruppenebene Individuelle Ebene Stand am Ende der Betreuungsarbeit Qualitätssicherung und Evaluation Methode Ergebnisse Schlussfolgerungen und Bewertung Wissenschaftlich-methodische Bewertung Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Konsequenzen für die Praxis 79 79 85 100 103 108 108 119 139 139 151 156 Das ICE-Unglück von Eschede (1998) 159 2.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds 159 Beschreibung des Umfelds Traumatische Stressoren und typische Reaktionen 160 160 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 Interventionen und deren Implementierung Systemebene Gruppenebene Individuelle Ebene Qualitätssicherung und Evaluation Methode Ergebnisse Schlussfolgerungen und Bewertung Wissenschaftlich-methodische Bewertung 161 161 162 169 170 170 171 179 179 5 Inhaltsverzeichnis 2.4.2 2.4.3 3. 181 182 Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen (1999) 183 3.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds 183 Beschreibung des Umfelds Traumatische Stressoren und typische Reaktionen 184 184 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4. Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Konsequenzen für die Praxis Interventionen und deren Implementierung Systemebene Gruppenebene Individuelle Ebene Qualitätssicherung und Evaluation Methode Ergebnisse Schlussfolgerungen und Bewertung Wissenschaftlich-methodische Bewertung der Datenanalyse Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Konsequenzen für die Praxis 188 188 189 199 206 206 211 222 222 227 230 Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt (2002) 231 4.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds 231 Beschreibung des Umfelds Traumatische Stressoren und typische Reaktionen 232 232 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Interventionen und deren Implementierung Systemebene Gruppenebene Individuelle Ebene Qualitätssicherung und Evaluation Methode Untersuchungszeitpunkt 1 Untersuchungszeitpunkt 2 Schlussfolgerungen und Bewertung Wissenschaftlich-methodische Bewertung Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Konsequenzen für die Praxis 233 233 234 244 244 244 245 251 252 252 252 255 6 Inhaltsverzeichnis C: Siebenstufiges kognitiv-behaviorales Behandlungskonzept (SBK) für akute PTBS 257 1. Einleitung und Entstehungsgeschichte 257 2. Theoretischer Hintergrund 259 3. Die sieben Phasen 261 3.1 262 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.7 3.7.1 3.7.2 4. Phase 1: Exploration, Diagnostik und Stabilisierung Theoretischer Hintergrund Beschreibung Wirkweise Durchführungshinweise Kontraindikationen Phase 2: Vermittlung des Therapierationals Theoretischer Hintergrund Beschreibung Wirkweise Durchführungshinweise Phase 3: Kontrollierte Traumaexposition (KTE) 262 263 266 267 267 267 267 268 268 270 270 Theoretischer Hintergrund Beschreibung Wirkweise Durchführungshinweise 270 271 276 278 Phase 4: Exposition in sensu 280 Theoretischer Hintergrund Beschreibung Wirkweise Durchführungshinweise 280 282 282 283 Phase 5: EMDR Theoretischer Hintergrund Beschreibung Wirkweise Durchführungshinweise Phase 6: Exposition in vivo Theoretischer Hintergrund Beschreibung Wirkweise Durchführungshinweise Phase 7: Nachbesprechung, Follow up und Traumaintegration Nachbesprechung Follow up Diskussion und zusammenfassende Bewertung 283 283 284 284 285 285 285 286 286 287 289 289 290 291 7 Inhaltsverzeichnis D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis 293 1. Grundfragen 293 2. Allgemeine Ziele für die Betreuung 297 3. Psychologisch-psychotherapeutische Ziele 299 3.1 3.2 3.3 299 300 302 Kurzfristig Mittelfristig Langfristig 4. Soziale Ziele 304 5. Methoden der Betreuung 306 6. Umgang mit Behörden 308 7. Umgang mit Presse und Medien 309 8. Evaluation der Wirkung von Interventionen 311 9. Qualitätssicherung: Supervision für Traumatherapeuten und andere professionelle Helfer 313 10. Langfristige Betreuung von Katastrophenopfern 314 Literatur 315 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial 337 Anhang B: Borken – Tabellen der Datenanalyse 346 Anhang C: Meißen – Tabellen der Datenanalyse 370 Einleitung Die vorliegende Arbeit zur psychotraumatologischen Versorgung von Katastrophenopfern ist aus der praktischen therapeutischen Arbeit des Autors mit Traumatisierten und Felderfahrungen im Bereich von Großschadensbetreuungen der vergangenen 17 Jahre entstanden. Leitprinzip war dabei, einer kritisch wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen, was in der Praxis oft aus Sach- und Zeitzwängen heraus ohne tiefere Reflektion getan wird und die eigene Arbeit mit den Ergebnissen internationaler Forschungsberichte zu vergleichen. Darüber hinaus ist es das Ziel, basierend auf den eigenen Felderfahrungen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen Hinweise für die Praxis zu geben, um die psychologische Betreuung von Katastrophenopfern zu verbessern. Die praktischen Erfahrungen beziehen sich auf die Betreuung der Opfer und Angehörigen folgender Großschadensereignisse: 1) Das Grubenunglück von Borken, 1988, bei dem eine Braunkohlengrube explodierte, 51 Bergleute den Tod fanden, mehrere verletzt und sechs Bergleute nach 72 Stunden unter Tage eingeschlossen Sein, lebend gerettet wurden. 2) Die ICE-Katastrophe von Eschede aus dem Jahr 1998, bei der ein ICE-Zug nach dem Bruch eines Radreifens entgleiste, gegen einen Brückenpfeiler prallte und 101 Passagiere in den Tod riss sowie 108 Personen zum Teil schwer verletzte. 3) Der Lehrerinnen-Mord in Meißen aus dem Jahr 1999, bei dem erstmalig an einer deutschen Schule eine Lehrerin ermordet wurde, indem ein 15-jähriger Schüler sie vor den Augen seiner Mitschüler mit 21 Messerstichen niederstach. 4) Der Amoklauf eines 17-jährigen Schülers in Erfurt im Jahre 2002, der bewaffnet mit einem Gewehr und einer Pistole innerhalb kürzester Zeit, zwölf Lehrerinnen und Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin, einen Polizisten und am Schluss sich selbst erschoss. Es handelt sich hierbei also um zwei „Großschadensereignisse“ und zwei Vorkommnisse so genannter „zielgerichteter Gewalt“. Die klinische Erfahrung der Betreuung von Opfern und Angehörigen dieser Ereignisse macht deutlich, dass die psychischen Reaktionen der Betroffenen, wie auch die zu beobachtenden Regelmäßigkeiten bei den Aufgaben der Initiierung eines Betreuungsprogramms für beide Ereignisse gleich verlaufen. Deswegen werden in dieser Arbeit Hilfen für Opfer von Katastrophen und gezielter Gewalt gemeinsam formuliert. Beim Beginn dieser Tätigkeiten, 1988, waren die Kenntnisse in der Behandlung traumatisierter Menschen in Deutschland noch sehr dürftig. Die Bedeutsamkeit des Themas der psychologischen Nachbetreuung von Katastrophenopfern und anderen Akuttraumatisierten war noch nicht erkannt und es gab im deutschsprachigen Raum dazu so gut wie keine relevante Fachliteratur. Bei der Betreuung der Betroffenen und Hinterbliebenen des Grubenunglücks von Borken musste auf Erfahrungen der Amerikaner aus der Therapie mit traumatisierten Vietnamveteranen zurückgegriffen werden (Keane & Kaloupek, 1982), sowie auf Erkenntnisse aus der Betreuung von Betroffenen von Bohrturm-Unglücken aus Norwegen (s. 10 Einleitung Sund, Weisaeth, Holen & Malt, 1985; Holen, 1993). Dabei handelte es sich nicht um empirisch überprüfte Therapiemanuale, sondern um Einzelberichte und Fallschilderungen. Die von unabhängigen Beobachtern später als „beeindruckende Pionierleistung“ beschriebene psychologische Betreuung der primären Opfer, der Hinterbliebenen und der Einsatzkräfte von Borken waren „von einer organisierten und strukturierten Nachsorge jedoch noch recht weit entfernt“ (Teegen, 2003), da keine derartigen Erkenntnisse entwickelt waren. Die wissenschaftliche Erforschung der Entstehung, Aufrechterhaltung und Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen wurde in den neunziger Jahren, wie der angloamerikanischen wie auch der deutschen Fachliteratur zu entnehmen ist, entscheidend vorangetrieben. Im Eingangskapitel A wird ein Überblick über den bis heute erreichten Wissensstand und die Methoden zur psychotraumatologischen Versorgung von Katastrophenopfern gegeben. In der vorliegenden Arbeit werden Erfahrungen der in Deutschland erstmals erfolgten psychosozialen Interventionen nach der Katastrophe von Borken unter Punkt B 1 systematisch beschrieben und dazugehörige, bisher nicht veröffentlichte empirische Ergebnisse dargestellt. Im Kapitel B 2 wird die auf den Erkenntnissen des Borken-Projekts basierende zehn Jahre später durchgeführte Betreuung der Opfer und Angehörigen der ICEKatastrophe von Eschede beschrieben. Seit dieser Katastrophe rückte, ausgelöst durch die intensive mediale Berichterstattung und das Gefühl der meisten Menschen, selbst jederzeit Opfer eines derartigen Ereignisses werden zu können, die Notwendigkeit organisierter Betreuung von Katastrophenopfern stärker in das Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit. Besonders die Frage, was mit den „hilflosen Helfern“, also traumatisierten Einsatzkräften zu geschehen habe, wurde in deutschen Print- und Filmmedien breit diskutiert. Seit Ende der 90er Jahre rückte das Thema Gewalt an Schulen und zielgerichtete Gewalt von Schülern gegen Lehrer oder Mitschüler besonders durch die spektakulären Ereignisse von Meißen und Erfurt und durch bekannt gewordene systematische Misshandlungen eines Schülers durch mehrere Mitschüler, die ihre Taten anschließend im Internet veröffentlichten, in das öffentliche Interesse. Die psychologische Betreuung der betroffenen Schüler, Lehrer und der jeweiligen Schulgemeinschaft von Meißen und Erfurt wird in Kapitel B 3 und B 4 beschrieben. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die empirische Überprüfung der Interventionen im Sinne einer kontrollierten Studie in diesem Rahmen als äußerst schwierig darstellt. Zum einen wird von den Auftraggebern, in den hier vorgestellten Fällen der PreussenElektra (Borken), der Deutschen Bahn AG (Eschede), dem Sächsischen Kultusministerium (Meißen) und der Thüringischen Landesregierung (Erfurt) nach einem derartigen Ereignis unmittelbare Hilfe erwartet, die eher ein „Katastrophenmanagement“ und die sofortige psychologische Betreuung der direkt Betroffenen und der Hinterbliebenen erfordert, als den wohlüberlegten Aufbau eines Untersuchungsdesigns. Zum zweiten steht der empirische Wissenschaftler vor der Grenze ethischer Probleme, wenn es darum geht, Betroffene auf Behandlungs- und Kontrollgruppe aufzuteilen, da vom Auftraggeber klar formuliert wird, alle Opfer und Angehörigen kompetent psychologisch bzw. psychotherapeutisch zu behandeln. Und schließlich reagieren die Betroffenen selbst in der Regel mit deutlicher Skepsis und Abwehr, wenn sie zu Beginn der Einleitung Betreuung das Gefühl bekommen, „beforscht“ zu werden. Sie wollen psychologische Unterstützung, Mitgefühl und praktische Hilfen annehmen, aber keine „Versuchsobjekte“ der Wissenschaft sein. Ziel der in dieser Arbeit in Kapitel B dargestellten Evaluation und Qualitätssicherung ist (a) die Inzidenz psychischer Erkrankungen in der Folge der Ereignisse zu erfassen, (b) soweit es möglich ist den Effekt der einzelnen Interventionsmaßnahmen zu evaluieren und (c) auch Aspekte wie seelisches Wachstum und Reifung durch diese Krise zu betrachten. Aus den Betreuungen der von den genannten Großschadensereignissen Betroffenen sind viele wichtige Erkenntnisse entstanden, die nach kommenden Katastrophen genutzt werden können. Aus den durchgeführten therapeutischen Interventionen und den ausgewerteten Befragungen der teilnehmenden Personen über deren Wirksamkeit (dargestellt in Kapitel B) wurde ein Behandlungsmanual entwickelt. Ein Hauptziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines siebenstufigen Behandlungskonzepts (SBK) für Opfer von Katastrophen und gezielter Gewalt und andere Akuttraumatisierte (Kapitel C). Dieses Behandlungsmanual bezieht sich auf die vielfältigen praktischen Erfahrungen mit den Betroffenen der genannten Ereignisse und wurde in der täglichen klinischen Arbeit mit Akuttraumatisierten entwickelt. Es setzt sich zusammen aus bekannten empirisch validierten Komponenten, die alle verschiedene Vor- und Nachteile aufweisen, im wissenschaftlichen Rahmen konzipiert sind, sich jedoch oft nicht mit den konkreten Anforderungen in der klinischen Praxis decken. Aufgrund klinischer Erfahrung wurden die vorhandenen Komponenten klinisch sinnvoll kombiniert. Es ist ein an den Erfordernissen der Praxis und den Bedürfnissen der Katastrophenopfer orientiertes evidenzbasiertes Behandlungsprogramm. Keine der Komponenten könnte allein annähernd das erreichen, was die Kombination ermöglicht. Das Manual ist noch nicht evaluiert, erhebt aber den Anspruch, mit der neuen Kombination evaluierter Komponenten als Gesamtkonzept mehr leisten zu können, als die Summe seiner Teile. Die Frage, unter welchen Randbedingungen das Therapiemanual erfolgreich eingesetzt werden kann, zu welchem Zeitpunkt, wessen Unterstützung gesucht und welchen Widerständen entgegengetreten werden muss, wird in Kapitel D erörtert. Es lassen sich bestimmte Regelhaftigkeiten in den Abläufen nach Katastrophen beschreiben, mit deren Kenntnis sich immer wieder gemachte Fehler in den Betreuungsprogrammen vermeiden lassen. Diese Regelhaftigkeiten beziehen sich sowohl auf Reaktionen der Betroffenen, der hinterbliebenen Angehörigen, der beteiligten Institutionen, der Medien, der psychosozialen Helfer bis hin zu den Verantwortungsträgern der Legislative und der Exekutive. Auch diese übergeordneten Erkenntnisse werden in Kapitel D dargestellt. Systematik und Konzept dieser Arbeit sind also aus der psychotherapeutischen Betreuung mit Traumatisierten entstanden. Ihr eigentlicher Wert liegt weniger in der Beschreibung empirischer Ergebnisse, als in der systematischen Beschreibung der bei der Bewältigung der Katastrophen gesammelten Erfahrungen, die aufgrund der Praxisnähe zu den jeweiligen Ereignissen eine Besonderheit darstellen und auf den daraus gezo- 11 12 Einleitung genen Schlüssen zur psychotraumatologischen Versorgung und Psychotherapie von Opfern von Katastrophen, gezielter Gewalt und anderen Akuttraumatisierten. Danksagungen Selbstverständlich wurde die Betreuung der vielen Betroffenen der genannten Großschadensereignisse nicht vom Autor alleine geleistet. Deswegen möchte ich im Folgenden den entscheidenden Weggefährten bei dieser Arbeit danken, ohne die eine Bewältigung der jeweils komplexen Problem- und Bedürfnislagen nicht möglich gewesen wäre. In Borken war Prof. Schüffel als Initiator des Betreuungsprojekts, derjenige, der mich für die Arbeit mit traumatisierten Menschen erstmals begeisterte und damit meinen beruflichen Werdegang entscheidend beeinflusste. Ihm gebührt mein ganz besonderer Dank. Entscheidende Beiträge zum Gelingen der Arbeit in Borken leisteten Frau Viernau, Frau Römer und Frau Cetinyol von der Werksfürsorge der PreussenElektra, der Bergwerksdirektor Herr Lohr und dessen Ehefrau, die als Lehrerin mit den betroffenen Kindern arbeitete, die beiden Pfarrer Krückeberg und Schwarz, Frau Dipl.Psychologin Karacicek bei der Betreuung der türkischen Hinterbliebenen, sowie alle Mitglieder des Arbeitskreises Stolzenbachhilfe. In Eschede wurde die Betreuung der Hinterbliebenen und Verletzten koordiniert vom Gesundheitsdienst der Deutschen Bahn AG. Herr Prof. Krassney stand unermüdlich als Obmann für alle Betroffenen als Ansprechpartner zur Verfügung. Frau Dipl.Psychologin Künzl-Daldorf betreute mit mir zusammen eine Angehörigengruppe, ich danke ihr für die wunderbare Zusammenarbeit. Viele Psychologen und Ärzte leiteten die betreuten Angehörigen- und Verletztengruppen, tauschten sich kollegial in regelmäßigen Therapeutentreffen aus und trugen damit zur Effektivierung der therapeutischen Arbeit bei. In Meißen wurde die psychologische Betreuung der betroffenen Schule initiiert und hilfreich begleitet von den Mitarbeiterinnen des Kultusministeriums Frau Dipl.-Psychologin Steinert und von Frau Dr. Tischer. Immer unterstützend bei der Umsetzung des Betreuungsprojekts waren der Schulleiter Herr Liesch, Vertreter des Schulamts und die Mitglieder der Steuerungsgruppe mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern. In Erfurt war in die Betreuung der Schule und der betroffenen Angehörigen eine Vielzahl von professionellen und freiwilligen Helfern eingebunden. Federführend waren je nach Zeitpunkt und Lage Mitarbeiter des Sozialministeriums des Landes Thüringen, des Innenministeriums, des Kultusministeriums und der Unfallkasse Thüringen. Die Umsetzung der therapeutischen Arbeit des vom Autor vorgelegten Betreuungskonzepts wurde von über 50 Psychologen aus ganz Deutschland geleistet. Besonders hilfreich bei der Koordinierung und Supervision der Psychologen war dabei Frau Dipl.Psychologin Gröben. Verschiedenen Personen, die Gedankenanstöße für die vorliegende Dissertation gaben und deren Verwirklichung hilfreich unterstützten und geduldig begleiteten gilt mein besonderer Dank: Herr Prof. Mattejat begleitete schon während des Borken Projekts meine Arbeit durch äußerst hilfreiche Supervision und gab die entscheidenden motivierenden Hinweise, über die praktischen Erfahrungen in der Betreuung von Katastro- Einleitung phenopfern eine Dissertation zu erstellen. Herrn Prof. Bengel als Erstbetreuer möchte ich danken für eine kritische und konstruktive Anleitung, die mir als praktisch tätigem Kliniker die Integration eines wissenschaftlichen Herangehens an die Reflektion und Auswertung der eigenen Arbeit ermöglichte. Herr Dipl.-Psych. Jörg Beyer stand hilfreich beratend bei der Auswertung der empirischen Daten zur Seite, Frau Dipl.Psychologin Schumacher danke ich für das psychologische Lektorat. Von Herzen bedanken möchte ich mich bei meiner Frau und meiner Familie, die immer viel Verständnis für meine Arbeit zeigten und mit ihrer Geduld bei meiner häufigen Abwesenheit vom Familienleben die notwendige Voraussetzung schufen, durchzuhalten. Gewidmet ist die Arbeit meinem verstorbenen Vater Josef Pieper. Anmerkung zur Schreibweise Es wird die männliche Schreibweise benutzt, um die Lesbarkeit zu erleichtern. Selbstverständlich sind damit genauso die weiblichen Vertreterinnen der entsprechenden Gruppe gemeint. 13 A: Psychotraumatologische Behandlung von Katastrophenopfern – Überblick über den Wissensstand und die Methoden 1. 2. 3. 4. Einleitung und Definition der Begriffe...............................................15 Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen............................17 Planungsebenen und Behandlungsbausteine .................................30 Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern ...........................................................................................54 Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen..............63 Einleitung und Definition der Begriffe Im Folgenden soll zunächst eine Gegenstandsbestimmung und Klärung der Begrifflichkeiten, die Grundlage der Arbeit sind, vorgenommen werden. In der psychotraumatologischen Forschung stellt sich im Zusammenhang mit Begriffsdefinitionen die Frage, wann von einer Katastrophe gesprochen werden kann, und wann ein traumatisches Ereignis einer anderen Klasse von Situationen zuzuordnen ist. Die Arbeitsgruppe um Norris (Norris, Friedman & Watson, 2002) schlägt vor, enge Definitionskriterien anzuwenden. Danach ist eine Katastrophe durch drei Hauptmerkmale gekennzeichnet, zum einen durch einen plötzlichen Beginn, zum zweiten durch kollektives Erleben und kollektive Betroffenheit, und zum dritten durch ein überdurchschnittlich hohes Ausmaß an Bedrohung und Zerstörung. Ausschlusskriterien sind nach Norris und Kollegen chronisch überdauernde Extrembelastungen und Extrembelastungen aus politischen Konflikten (z. B. bedrohliche Lebensumwelt, Terrorismus als fester Bestandteil des täglichen Lebens, Kriegszustände). Situationen dieser Art bilden eine Klasse traumatischer Erfahrungen mit eigenen Charakteristika, die für eigene Probleme sorgen und spezielle Hilfsmaßnahmen erfordern. Katastrophen, auch als „Großschadensereignisse“ bezeichnet, haben bei aller Unterschiedlichkeit der Geschehnisse einige Gemeinsamkeiten. Im Mittelpunkt stehen die Folgen einer Katastrophe für eine Gemeinschaft von Personen, die häufig, wenn auch nicht ausnahmslos, bereits vor der Katastrophe als Gruppe oder Gemeinschaft von Personen existierte. Eine Naturkatastrophe (z. B. Erdbeben, Überflutung, Sturmkatastrophe) zieht in aller Regel ganze Gemeinden oder Landstriche in Mitleidenschaft; bei technischen Katastrophen (nukleare oder chemische Großschadenslagen) verhält es sich ähnlich; im Fall einstürzender Bauwerke sind die Überlebenden von Hausgemeinschaften als Gemeinschaft betroffen. Katastrophen, die durch Gewaltakte hervorgerufen werden, können ebenfalls größere Gemeinschaften betreffen, die bereits vor dem 16 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Einleitung und Definition der Begriffe Ereignis organisiert waren (vgl. z. B. die Amokläufe zweier Schüler in Meißen und Erfurt, Kapitel B 3 und B 4, oder den Bombenanschlag in Oklahoma City). Unfälle des Verkehrswesens dagegen stellen eher Ausnahmen von dieser Regel dar – auch hier ist eine größere Gruppe von Menschen durch das gleiche Unglück betroffen, Fahrgäste im Eisenbahnverkehr zum Beispiel, Busreisende oder Fluggäste stehen aber zum Zeitpunkt der Ereignisses normalerweise nicht als bereits etablierte Gemeinschaft zueinander in Beziehung (vgl. ICE-Unglück in Eschede, Kapitel B 2). Unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse und extremen Erfahrungen kann es aber in solchen Fällen durchaus zur spontanen Bildung von Not- oder Opfergemeinschaften kommen, die unter Umständen über die akute Krisensituation hinaus Bestand haben. Katastrophen rufen eine Fülle an Extrembelastungen hervor, durch selbst erlebte oder unmittelbar beobachtete Lebensgefahr, durch Verletzung und Verstümmelung, durch den Anblick Toter und Sterbender, durch den Verlust von Angehörigen, Freunden und Bekannten, durch die Zerstörung von Eigentum und damit unter Umständen der persönlichen Existenzgrundlage. Auch die Zerstörung öffentlicher Ressourcen kann eine maßgebliche Rolle spielen und zur Gesamtbelastung beitragen, sowohl kurz- als auch langfristig (Teegen, 2004). Der Unterschied zu individualtraumatischen Erfahrungen besteht aus der Perspektive der Opfer darin, dass sich von Katastrophen Betroffene gemeinschaftlich in einer teils massiv beschädigten oder zerstörten Lebensumwelt wieder finden. Die Zerstörung kann durch eine große Anzahl getöteter Menschen eine soziale Gemeinschaft betreffen, wie z. B. bei der Ermordung von 12 Lehrern des Kollegiums, zwei Schülern und der Schulsekretärin eines Erfurter Gymnasiums im Jahre 2001 (s. Kapitel B 4). Die Zerstörung kann sich aber auch rein auf die materielle oder soziale Umwelt beziehen, wie z. B. bei einem Hurricane oder einer Überschwemmung. Am nachhaltigsten sind Gemeinschaften betroffen, die sowohl durch den Tod vieler ihrer Mitglieder, als auch durch die Zerstörung ihrer materiellen Ressourcen erschüttert werden, wie z. B. beim Grubenunglück in Borken 1988 (s. Kapitel B 1), bei dem 51 von 432 Bergleuten tödlich verunglückten und die Grube so zerstört war, dass sie geschlossen werden musste und somit nicht mehr als Produktions- und Arbeitsstätte in Borken bestand. Dieses stellt eine Situation von eigener Qualität und mit eigenen Risiken und Chancen für das Erleben und die Entwicklung der Betroffenen dar. In diesem Kapitel soll der aktuelle Stand der Literatur mit der Fragestellung aufgezeigt werden, welche Rolle psychosoziale Dienste und die Psychotherapie bei der Aufgabe übernehmen können, betroffene Personen bei der Bewältigung der psychischen Folgen einer Katastrophe zu unterstützen. In der hochkomplexen Situation nach einer Katastrophe kommt der Interventionsplanung eine besonders hohe Bedeutung zu. Psychosoziale Betreuung beginnt mit einer wissenschaftlich gestützten Einschätzung der Risikolage für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Aus der Sicht der Epidemiologie muss deshalb zunächst abgeschätzt werden, welche Auswirkungen eine Katastrophe voraussichtlich auf die Betroffenen hat, inklusive der Frage, welche Untergruppen wahrscheinlich in besonderer Weise betroffen sind, oder, ganz im Gegenteil, welche Gruppen sich vielleicht als besonders widerstandsfähig erweisen, und warum das möglicherweise so ist. Die wichtigsten Leitfragen sind hier: 1) Welche Gruppen von Betroffenen können ausgemacht werden? (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992) A: Behandlung von Katastrophenopfern — Einleitung und Definition der Begriffe 2) Welche Personen und Gruppen sind potentiell gefährdet, traumatische Störungen zu entwickeln? 3) Welche Personen oder Gruppen müssen betreut werden? 4) Welche Hilfspersonen oder Gruppen stehen zur Verfügung oder können mobilisiert werden? 5) Wer kann welche Beiträge zur Bewältigung der Katastrophe leisten? Zur weiteren Vertiefung der Fragen der Einteilung und Identifizierung von Betroffenen siehe Bengel (2003), Gschwend (2002), Teegen (2003, 2004) und Pieper (2003). Aus diesen Erkenntnissen können dann unmittelbar auf den Einzelfall zugeschnittene Maßnahmen abgeleitet werden; Gruppen- und Individualdiagnostik führen auf direktem Weg zu begründbaren Interventionen. Epidemiologische Erkenntnisse können hier als Grundlage der Interventionsplanung dienen. 1. Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Öffentlichkeit allgemein ist die Aufmerksamkeit gegenüber traumatischen Erfahrungen in den letzten zehn bis zwanzig Jahren deutlich gewachsen. Entsprechend intensiv spiegelt sich das Interesse an Traumatisierungen und ihren Folgen in der Forschung wider. Die überwiegende Zahl wissenschaftlicher Beiträge befasst sich allerdings mit individuellen Traumatisierungen und Katastrophen im Sinne des kollektiven Erlebens sind als Forschungsgegenstand demgegenüber deutlich unterrepräsentiert. Dies lässt sich auf einige Besonderheiten von Katastrophensituationen zurückführen. Die Sichtung der derzeit verfügbaren Fachliteratur zu den Folgen von Katastrophen zeigt ein recht eindeutiges, wenn auch hochkomplexes Bild. Die Arbeitsgruppe um Norris fand bei ihren Recherchen für einen Literaturüberblick über die psychologische Katastrophenforschung der vergangenen zwanzig Jahre 160 englischsprachige Beiträge aus 29 verschiedenen Ländern, nicht-englischsprachige Artikel und Beiträge blieben ohne ausreichende empirische Substanz unberücksichtigt (Norris, Friedman & Watson, 2002). Die Spannbreite erfasster Katastrophen ist dementsprechend groß, die Befundlage zu epidemiologischen Aspekten kann mittlerweile als hinreichend aussagekräftig angesehen werden – vielfältig bei einer hinreichenden Menge an übereinstimmenden Ergebnissen, und hinreichend, um einige notwendige Verallgemeinerungen für die psychosoziale Interventionsplanung zuzulassen. 1.1 Psychologische Auswirkungen einer Katastrophe Katastrophen konfrontieren alle Betroffenen mit chaotischen Handlungsbedingungen in einer desorganisierten Umwelt, mit extremer Bedrohung und psychischer 17 18 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Belastung, und häufig auch mit schweren körperlichen Verletzungen und Todesopfern. Obwohl sich das Hauptinteresse der psychologischen Katastrophenforschung auf die traumatischen Störungen konzentriert (Akute Belastungsstörung, Posttraumatische Belastungsstörung), weisen verschiedene Autoren darauf hin, andere psychische Folgen traumatischer Erlebnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Neben Traumatisierungen werden in der Folge von Katastrophen depressive Störungen inklusive Major Depression, Angststörungen inklusive Generalisierter Angst und Panikstörung, sowie Anpassungsstörungen und somatische Probleme regelhaft beobachtet (Norris, Friedman & Watson, 2002; Teegen, 2004). Im Fall von Traumatisierungen durch willkürliche Massengewalt können sich paranoide, von generalisiertem Misstrauen geprägte Denk- und Reaktionsmuster einstellen (Ayalon, 1993). Maercker (2003b) nennt als sehr groben Richtwert eine Komorbitätswahrscheinlichkeit von 50 bis 100%. Dabei weisen viele Patienten mehr als eine komorbide Störung auf. Obwohl traumatische Erfahrungen überwiegend zu posttraumatischen Reaktionen im engeren Sinne führen, haben auch die anderen psychischen Folgen einen nicht unerheblichen Anteil im Leidensspektrum der betroffenen Personen. Aus praktischer Sicht ist anzumerken, dass „nicht-traumatische“ Störungen sowohl komorbid als auch isoliert auftreten können. Je nach Art der Traumatisierung und abhängig von individuellen Randbedingungen ist eine posttraumatische Belastungsstörung keine zwingende Voraussetzung für das Auftreten einer anderen, nicht-traumatischen Störung. Nosologisch und ätiologisch sind allerdings noch viele Fragen ungeklärt (Hyer, Stanger & Boudewyns, 1999; Maercker, 2003b). Durchgängig finden sich z. B. hohe Komorbititätsraten von 30 bis 50% für depressive Störungen, wenn eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt. Die Frage aber, ob Depression als ein Teilphänomen innerhalb der PTBS zu betrachten ist, ob sich Depressionen eher prozesshaft und in sofern sekundär aus einer PTBS entwickeln können, oder ob Depressionen einen in sich eigenständigen und unabhängigen Aspekt innerhalb der pathogenetischen Vorgänge nach einer Traumatisierung bilden, wird zurzeit noch kontrovers diskutiert. Hier kann nur weitere prozessorientierte Forschung Klarheit schaffen (Hyer, Stanger & Boudewyns, 1999; Maercker, 2003b). Dabei treten Störungscharakteristika nicht uniform in Gestalt eines „Trauma-Syndroms“ auf, sondern das individuell ausdifferenzierte Störungsbild ist vielmehr von einer großen Zahl an differentiellen und modifizierenden Faktoren abhängig, die im Folgenden dargestellt werden. „The aftermath is a motion picture, the effects a moving target – meaning that they unfold in ways that we are not yet able to anticipate precisely, despite some commonalities across events.“ (Somasundaram, Norris, Asukai & Murthy, in Druck, zitiert nach Norris, Friedman & Watson, 2002) Definition von traumatischer Belastung: Um der gerade beschriebenen Vielschichtigkeit von Belastungsfolgen gerecht werden zu können, wird in den weiteren Ausführungen unter traumatischen Belastungen nach Durchleben einer Katastrophe zweierlei verstanden. An erster Stelle steht die Symptomatik der PTBS im Sinn der Klassifikationssysteme DSM-IV und ICD-10, mit den Hauptcharakteristika Angst/Hilflosigkeit/Entsetzen, Intrusionen, Hyperarousal und Vermeidung traumarelevanter Reize. An zweiter Stelle sollen die häufigsten komorbiden Störungen berücksichtigt werden, im einzelnen also Depressionen, Angst- und Schlafstörungen, Störungen des Sozialverhaltens (bzw. der sozialen Integration) sowie somatische Störungen und Substan- A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen zabusus – also ganz im Sinne der eben vorgestellten grundsätzlichen Befundlage in der Literatur, und unter ausdrücklicher Betonung des ko-morbiden Charakters dieser Störungen. 1.2 Differentiell wirksame Merkmale der Katastrophensituation Allgemein gültige Quantifizierungen, wie viele Menschen nach einer Katastrophe psychische Belastungsreaktionen in erheblichem Ausmaß entwickeln, machen wegen der Unterschiedlichkeit von Situationen und individuell wirkenden Faktoren wenig Sinn. Stattdessen sollen hier zunächst einige der wichtigsten Erkenntnisse zu differentiellen und modifizierenden Faktoren skizziert werden. So haben Art und Ausmaß der Katastrophe sowie geographische Faktoren, die nun näher erörtert werden, Einfluss auf die Bewältigung der Situation. Dabei lässt sich aus der Kenntnis dieser Zusammenhänge und den epidemiologischen Zahlen die Planung und Durchführung zentraler Interventionsmaßnahmen direkt ableiten. Zum Sprachgebrauch ist anzumerken, dass immer dann, wenn von „posttraumatischer Belastung“ gesprochen ist, die Menge aller möglichen psychischen Auswirkungen gemeint ist, nicht die posttraumatische Belastungsstörung nach ICD-10 oder DSM-IV im engeren Sinn. Art der Katastrophe. Im Vergleich der verfügbaren Literatur findet sich übereinstimmend, dass die Konsequenzen von Katastrophen um so schwieriger zu bewältigen sind, je mehr menschliches Verschulden verantwortlich ist und je mehr willentliche Verursachung eine Rolle spielt. Unabhängig von Dauer oder Schadensausmaß sind Naturkatastrophen leichter zu bewältigen als technische Katastrophen, und diese wiederum leichter als Gewalt- und Terrorakte (vgl. Brewin, Andrews & Valentine, 2000). Norris und Kollegen schätzen aus der herangezogenen Literatur deutliche bis schwere Beeinträchtigungen bei 67% bei Betroffenen nach Massengewaltakten, gegenüber 34% nach Natur- und 39% nach technologischen Katastrophen. Der Beeinträchtigungsindex wird als vierstufiges Rating aus den Originalangaben zu allen berichteten Störungen gebildet. Bei der Einschätzung dieser Angaben im Verhältnis zur auslösenden Katastrophe muss berücksichtigt werden, dass ein Maß für die objektive Schwere von Katastrophen nur mit Einschränkungen aus der Datenlage abgeleitet werden kann. Insofern ist vor allzu wortgenauen Interpretationen der einzelnen Quoten zu warnen. Kritisch muss dabei angemerkt werden, dass unsere Annahmen über die Auswirkungen von Naturkatastrophen im Vergleich zu anderen Katastrophen im Wesentlichen auf westlich geprägten Erfahrungen und Forschungsarbeiten beruhen. Zu bedenken ist hier, dass Naturkatastrophen schweren Ausmaßes in den entwickelten Ländern der nördlichen Hemisphäre vergleichsweise selten sind, während andererseits die allgemeine Versorgungslage ungleich besser ist als z. B. in Entwicklungsländern. Diese Umstände können die Aussage, Naturkatastrophen hätten im Vergleich zu man-madedisasters generell weniger gravierende Auswirkungen, als überdenkenswert und möglicherweise als Methodenartefakt erscheinen lassen. Ausmaß der Katastrophe. Um Hinweise auf den Einfluss zu bekommen, den das Ausmaß einer Katastrophe auf den psychischen Zustand von Betroffenen hat, teilten Norris und Kollegen die vorliegenden Katastrophenstudien in drei Gruppen ein, Katast- 19 20 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen rophen leichten, mittleren und schweren Ausmaßes (Norris, Friedman & Watson, 2002). Sie kommen zu dem Schluss, dass leichte Katastrophen vor allem in Abhängigkeit zu moderierenden sozioökonomischen Faktoren und dem Faktor Zeit keine oder nur milde Auswirkungen haben, die im Wesentlichen aus vorübergehendem Belastungsstress bestehen. Bei Katastrophen mittleren Ausmaßes treten bei etwa 30 bis 40% der Betroffenen klinisch relevante Probleme auf, bei Katastrophen schweren Ausmaßes steigen die Quoten auf bis zu 70%, bei einer gleichzeitig großen Streuung über alle relevanten Störungsbilder und einer ebenfalls breiten Streuung im Schweregrad der beobachteten psychischen Folgen. Gerade hier wird deutlich, wie wichtig eine differenzierte Betrachtung der Umstände ist. Schwere Katastrophen generieren besonders viel Verhaltensvarianz und sind deshalb besonders geeignet, uns etwas über die psychischen Mechanismen der Katastrophenbewältigung mitzuteilen. Geografische Faktoren. Ebenfalls im Informationsangebot von Norris und Kollegen finden sich Vergleiche dreier geografischer Gruppen, der Vereinigten Staaten inklusive ihrer Territorien, der Gruppe der anderen Industrienationen sowie der Gruppe der Entwicklungsländer. Danach waren 78% der Opfer aus Entwicklungsländern ernst bis schwer betroffen, gegenüber 25% der Opfer aus den Vereinigten Staaten und immerhin 48% der Opfer aus anderen Industrienationen. Selbst nach differenzierteren Analysen mit dem Typ der Katastrophe als zweitem Faktor blieben diese Unterschiede im Wesentlichen bestehen (Norris, Friedman & Watson, 2002). Diese Zusammenstellung differentieller Merkmale verdeutlicht die Schwierigkeit Katastrophen zu objektivieren und ist ein Hinweis auf die Wichtigkeit, bei der Betreuung von Katastrophenopfern die jeweiligen individuellen Charakteristika einer Katastrophe zu berücksichtigen. 1.3 Individuelle und kollektive Risiko- und Schutzfaktoren Wie bis hierhin gezeigt wurde, spannen Charakteristika der unterschiedlichen Katastrophensituationen ein Kontinuum unterschiedlichster Einflussgrößen auf, das dafür verantwortlich ist, wie und in welchem Ausmaß der Einzelne mit traumatischem Stress belastet wird. Neben dem Einfluss der bereits aufgezeigten Situationsfaktoren zeigt sich aber durchgängig auch, dass manche Menschen stärker und/oder länger von traumatischen Reaktionen auf die gleiche Katastrophe betroffen sind als andere. Die Unterschiedlichkeit der Befundlage legt deshalb immer wieder die Frage nahe, welche Faktoren auf Seiten der Betroffenen eine Bewältigung der traumatischen Erfahrungen begünstigen oder erschweren. Ausmaß der individuellen Exposition und peritraumatische Belastung. Analog zur Schwere der Katastrophe ist das Ausmaß der individuellen Belastung während der akuten Katastrophenphase ausschlaggebend dafür, wie stark sich traumatische Reaktionen später herausbilden. Stressoren mit dem stärksten Einfluss sind Bedrohung des eigenen oder fremden Lebens, Verletzung, Todesangst, Panik und Entsetzen, Verlust und Trauer, materieller Verlust mit gravierenden existentiellen Folgen, Umsiedlung, sowie allgemein die (gewichtete) Summe der Stressoren, die auf einen Einzelnen einwirken, und die Dauer der Exposition. Exemplarisch seien hier die Arbeiten von Gleser, A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Green und Winget (1981), Maes, Mylle, Delmeire und Altamura (2000) und Norris, Perilla, Riad, Kaniasty und Lavizzo (1999) genannt. Die gleichen Autoren weisen aber darauf hin, dass die genannten Stressoren in aller Regel miteinander konfundiert sind und sich je nach Katastrophenlage gegenseitig mehr oder minder stark überlagern können, worin ein Hauptgrund für die teils inkonsistente Datenlage gesehen werden wird. Adams und Boscarino (2005) beschreiben in ihrer Untersuchung der Folgen des Angriffs auf das World Trade Center, dass bei den Betroffenen um so stärkere psychologische Probleme zu verzeichnen waren, je größer die Exposition zu traumatischen Stressoren war. Eine Personengruppe, die besondere Aufmerksamkeit erfordert, sind die beteiligten Hilfsmannschaften, und zwar um so mehr, je unvorbereiteter sie mit Maximalstressoren konfrontiert werden, je länger sie mit den akuten Folgen der Katastrophe konfrontiert sind – und je mehr sie durch persönliche Bindungen direkt von der Katastrophe betroffen sind (Bartone, Ursano, Wright & Ingraham, 1989; Hodgkinson & Shepherd, 1994; McCarroll, Fullerton, Ursano & Hermsen, 1996; Jones, 1985; Teegen, 2003). Wahrgenommener Kontrollverlust und Selbstaufgabe während des Traumas gehören zu den prognostisch ungünstigsten Faktoren. Im Kontrast dazu stehen subjektiv wahrgenommene Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten, die auch dann als Schutzfaktoren wirken, wenn sie subjektiv nur als gering eingeschätzt werden und aus einer objektiven Perspektive betrachtet vielleicht unhaltbare Fehleinschätzungen darstellen (Ehlers, Maercker & Boos, 2000; Maercker, Schützwohl & Beauducel, 2000). Ein weiterer Faktor mit hohem prädiktivem Wert ist das Ausmaß der akuten Belastungsreaktionen. Aus verschiedenen Untersuchungen mit unterschiedlichen Personengruppen geht hervor, dass insbesondere peritraumatische dissoziative Episoden mit den begleitenden Derealisations- und Depersonalisationserfahrungen die Entwicklung anhaltender posttraumatischer Beschwerden stark begünstigen (Bryant & Harvey, 1997; Holen, 1993; Koopman, Classen, Cardena & Spiegel, 1995; Koopman, Classen & Spiegel, 1994, 1996; Marmar, Weiss, Metzler et al., 1996, 1999; Marmar, Weiss & Metzler, 1998). Hier liegt die Schlussfolgerung nahe, Kontrollverlust und Dissoziation auf einer höheren psychischen Ebene miteinander verbunden zu sehen und als zwei Aspekte ein und desselben psychischen Verarbeitungsmechanismusses zu betrachten. Ausmaß der kollektiven Belastung. Wie oben schon anklang, gibt es auch ein Ausmaß an Belastung, durch das eine Gemeinschaft als ganzes, „oberhalb der individuellen Ebene“, betroffen ist. Methodisch ist dieser Aspekt schwer zu erfassen, da die Betroffenheit einer Gemeinschaft immer auch mit der individuellen Betroffenheit konfundiert ist. Tatsächlich finden sich in entsprechenden Arbeiten bedeutsame Interaktionen zwischen der individuellen Betroffenheit und der Belastung des Gemeinwesens durch die Folgen einer Katastrophe. Personen, die gleichermaßen durch hohe kollektive Zerstörung und besonders hohen persönlichen Verlust betroffen waren, entwickelten im Vergleich zu anderen Subgruppen die stärksten psychischen Belastungsreaktionen (Phifer & Norris, 1989). Selbst nach Kontrolle der individuellen Betroffenheit bleibt aber immer ein substantieller Anteil an Belastung übrig, der ausschließlich darauf zurückzuführen ist, wie stark eine Katastrophe die Gemeinde kollektiv schädigt. Je stärker das beschädigt ist, was eine Gruppe von Menschen als geografische, wirtschaftliche, soziale und emotionale Heimat empfindet, desto stärker wird die Gemeinschaft z. B. mit Trauer, Verlust, Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühlen reagieren. 21 22 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Während individueller Verlust in verschiedenen Arbeiten mit einer Zunahme an negativen Affekten assoziiert war, geht kollektive Zerstörung eher mit einer Abnahme an positiven Gefühlen einher (Phifer & Norris, 1989; Kaniasty, Norris & Murrell, 1990; Smith, Christiansen, Vincent & Hann, 1999). Geschlecht. In der überwiegenden Zahl an Studien, in denen Geschlechtsunterschiede berücksichtigt wurden, wurde eine besondere Vulnerabilität von Betroffenen weiblichen Geschlechts festgestellt. Dieser Effekt wurde gleichermaßen unter Erwachsenen und Kindern, in Industrienationen und Entwicklungsländern beobachtet. Insbesondere das Risiko für Frauen und Mädchen, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, ist nach verschiedenen Studien etwa doppelt so hoch wie bei Männern und Jungen. Verschiedene Arbeiten deuten darauf hin, dass dieses höhere Risiko mit der subjektiven Verarbeitung während der Katastrophe zusammenhängt – eine wichtige Implikation für spätere Interventionen (Garrison, Weinrich, Hardin, Weinrich & Wang, 1993; Gleser, Green & Winget, 1981; Anderson & Manuel, 1994; Goenjian et al., 2001). Zu bedenken ist bei diesem Ergebnis jedoch, dass viele Männer mit verzögerten posttraumatischen Symptomen auf eine Katastrophe reagieren, da sie sich aufgrund ihrer beruflichen Rolle oder ihres Selbstverständnisses als „unerschütterliche Männer“ nicht eingestehen können, psychische Traumafolgen zu zeigen (Pieper & Maercker, 1999) und daher eventuell nicht zu dem gewählten Zeitpunkt der genannten Befragungen auffallen. Schließlich sei erwähnt, dass auch für den Faktor Geschlecht diverse modulierende, respektive interagierende Faktoren wirksam sind. Ergänzende Anmerkungen zu moderierenden Einflussgrößen auf den Faktor Geschlecht folgen im nächsten Abschnitt. Alter. Betrachtet man das Alter als potentiellen Risiko- oder vielleicht Schutzfaktor, bieten sich drei Betrachtungsweisen an, zum einen der Vergleich zwischen Kindern, Jugendlichen und Adoleszenten mit der Gruppe der Erwachsenen, zum anderen die jeweiligen Binnendifferenzierungen, innerhalb der Gruppe der Erwachsenen einerseits und der Nicht-Erwachsenen andererseits. Im Vergleich aller Altersklassen überwiegt der Eindruck, dass Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren besonders gefährdet sind und stärkere Belastungen zeigen als Erwachsene. Für jüngere Kinder und ältere Jugendliche sind die Ergebnisse widersprüchlich, was hauptsächlich auf die geringe Menge an verfügbaren Studien zurückzuführen ist (Bromet, Sonnega & Kessler, 1998; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995; Norris, Friedman & Watson, 2002; Norris, Friedman et al., 2002; Shannon, Lonigan, Finch & Taylor, 1994). Zur Frage des Zusammenhangs der Lebensjahre eines Erwachsenen und der Herausbildung und Chronifizierung posttraumatischer Belastungen liegen zwar mehr Studien vor, aber auch hier lassen sich nur mit Einschränkungen eindeutige Ergebnisse berichten. Eine Vergleichgrundlage können verschiedene Studien zum Einfluss von Großschadensereignissen auf Erwachsene in den Vereinigten Staaten bilden. Danach erreicht das Belastungsrisiko im mittleren Alter ein Maximum und verliert im weiteren Verlauf stetig an Schwere (vgl. z. B. Norris, Kaniasty et al., 2002, Phifer, 1990). Grundsätzlich beziehen sich die hier berücksichtigten Arbeiten auf die Folgen von Großschadensereignissen. Die Belastungsfolgen wurden über klinische Interviews und über standardisierte Selbstbeurteilungsfragebögen erfasst, Teilnehmer wurden in Altersklassen eingeteilt und einmalig befragt. Die vorliegenden Daten beziehen sich so- A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen wohl auf die Symptomatik der PTBS im engeren Sinn als auch auf komorbide Störungen wie Depressionen, Angststörungen und somatische Beschwerden. Als Erklärung werden verschiedene Einflüsse diskutiert. In den mittleren Lebensjahre wird einerseits die persönliche Verantwortung als besonders groß wahrgenommen, weiterhin wirkt sich der erlebte Verlust in den Bereichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit, Eigentum und allgemeine Existenzgrundlagen besonders hart aus, während andererseits die Erwartungen an den persönlichen Einsatz dieser Altersgruppe nach einer Katastrophe besonders hoch sind. Von weitreichender Bedeutung können deshalb die Aussagen von Thompson, Norris und Hanacek (1993) sein. In Anlehnung an ein Summenmodell konnten sie die besondere Belastung von Erwachsenen im mittleren Alter darauf zurückführen, dass diese Personen nach einer Katastrophe mehr Verantwortung übernehmen und mehr Unterstützung für die Gemeinschaft leisten, als sie von dieser zurückerhalten – ein Hinweis auf die Risiken und Chancen sozialer Unterstützung. In welchem Umfang alle diese Aussagen auch für andere westlich geprägte Länder gilt, kann vermutet, aber nicht mit endgültiger Sicherheit gesagt werden. Für nicht westlich geprägte Länder gelten möglicherweise andere, teils entgegengesetzte Regeln, nach denen besonders die älteren oder besonders die jüngeren maximal von posttraumatischem Stress betroffen sind (Norris, Friedman & Watson, 2002). Als wichtige Implikation für die Interventionsplanung kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Alterseffekte maßgeblich von ethnischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen und historischen Faktoren moderiert werden. Eine Interventionsplanung muss deshalb einbeziehen, wo die Katastrophe stattgefunden hat, wie sich die betroffene Gruppe zusammensetzt, und durch welche soziokulturellen Traditionen die betroffene Region geprägt ist. Belastung innerhalb der Familie. Faktoren innerhalb der Familie betreffen drei Bereiche, Effekte, die sich aus der Partnerschaft ergeben, und Effekte, die sich aus der Elternrolle für die Eltern selbst und für ihre Kinder ergeben. Wissenschaftliche Aussagen zum ersten Punkt sind heterogen und wenig eindeutig. Eine partnerschaftliche Bindung scheint entgegen landläufiger Meinung eher einen Risikofaktor darzustellen, vor allem für Frauen, manchmal auch für Männer; partnerschaftlicher Stress nimmt nach Katastrophen potentiell zu; eine gute partnerschaftliche Beziehung kann unter Umständen für Frauen zu einer stärkeren Erhöhung der posttraumatischen Anfälligkeit führen, als im Fall einer weniger guten Beziehung – auch wenn dieser Umstand zunächst erstaunen mag und Replikationen abzuwarten bleiben (Brooks & McKinlay, 1992; Gleser et al., 1981; Norris & Uhl, 1993; Solomon, 2002). In verschiedenen Untersuchungen korrelierte die Elternrolle positiv mit posttraumatischen Belastungen. Effekte dieser Art treten immer dann besonders gravierend in Erscheinung, wenn als Folge einer Katastrophe fortbestehende unsichtbare Bedrohungen antizipiert werden, wie das z. B. nach nuklearen und chemischen Großschadensereignissen der Fall ist. Entsprechende Befunde deuten in solchen Fällen auf ein besonders hohes Risiko von Müttern hin, deren Kinder im schutzbedürftigen Alter sind (Bromet, Parkinson, Schulberg & Gondek, 1982; Bromet et al., 2000; Havenaar et al., 1997; Litcher et al., 2000; Solomon, Bravo, Rubio-Stipec & Canino, 1993). Dass die Sorge der Eltern um ihre Kinder nach einer Katastrophe zu fatalen Wechselwirkungen führen kann, zeigt u. a. die Arbeit von Wasserstein und La Greca (1998). 23 24 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Nach einer Dammbruchkatastrophe in den USA konnten sie die psychische Belastung von Kindern aus der Belastung der Eltern vorhersagen. Norris und Kollegen (Norris, Friedman & Watson, 2002) halten es in ihrer Übersicht für gesichert, dass für Kinder der posttraumatische Stress der Eltern ein starker – und manchmal der stärkste Prädiktor – für die eigene Belastung ist. Prämorbides Funktionsniveau. Immer wieder wird diskutiert, welchen Einfluss eine prämorbid vorliegende allgemeine psychische Vulnerabilität darauf hat, ob eine Person eine posttraumatische Störung entwickelt. Allgemein gelten prämorbid vorliegende Störungen als bedeutsame Prädiktoren für die Entwicklung posttraumatischer Belastungen; etwa 40–50% dieser Personengruppe entwickeln eine Posttraumatische Belastungsstörung. Andererseits sind auch Personen, die vor der Katastrophe psychisch stabil und unauffällig waren, immer noch mit einem Risiko von etwa 25–30% für eine PTBS belastet. Verschiedene Autoren ziehen auch aus diesem Befund den Schluss, prämorbide Belastungen nicht als kausal für eine PTBS zu betrachten, sondern als Bausteine in einem kumulativen Modell der Stressorhäufung zu betrachten (z. B. Bravo, Rubio-Stipec, Canino, Woodbury & Robera, 1990; Asarnow et al., 1999). Persönlichkeits- und kognitive Merkmale. Bedeutsame Persönlichkeitsvariablen für ein höheres Belastungsniveau nach einer Katastrophe sind Neurotizismus (im Sinne von Eysenck als dispositionelle emotionale Labilität), ebenso die Traits Sorge und Angst/Ängstlichkeit. Die psychische Belastung nach einer Katastrophe wird in den vorliegenden Studien unterschiedlich operationalisiert. Neben Indikatoren für PTBS im engeren Sinn finden sich Maße für Depressionen, Angststörungen und andere komorbide Symptome der PTBS (z. B. Carr et al., 1997; McFarlane, 1989; Morgan, Matthews & Winton, 1995). Weiterhin liegen vereinzelte Hinweise aus der Katastrophenforschung vor, die mit allgemeineren Erkenntnissen aus der Forschung zu kritischen Lebensereignissen und dem Locus of Control in Einklang stehen. Demnach sind externale Kontrollüberzeugungen (resp. Fatalismus) ein replizierbarer Risikofaktor für die Ausprägung psychischer Belastungen nach einem Trauma (Marmar, Weiss, Metzler & Delucchi, 1996). Dieser Aspekt wird insbesondere dann therapeutisch beachtenswert, wenn kulturelle oder religiöse Prägungen fatalistische Sichtweisen und Überzeugungen unterstützen und aktives, hilfesuchendes Coping behindern (Maercker & Herrle, 2003; Norris, Friedman & Watson, 2002). Allerdings sollte dieser Aspekt nicht dogmatisch streng ausgelegt werden. Betrachtet man religiöse Einstellungen als Sonderfall externaler Kontrollüberzeugungen, dann gelangt zusätzliche Varianz ins Bild. Maercker und Herrle (2003) fanden z. B. bestätigt, dass eine religiöse Einstellung bei der Bewältigung einer Katastrophe hilfreich sein kann. Der Widerspruch, der sich hier vermeintlich auftut, kann durch Erkenntnisse aus der Forschung zu kognitiven Stilen und Attributionsstilen aufgelöst werden. Aus Studien der Arbeitsgruppen um Foa, Ehlers und Clark kann geschlossen werden, dass möglicherweise nicht der Locus of Control, also die Quelle oder der Ausgangspunkt der Kontrolle der maßgeblich pathogene Faktor ist, sondern die Frage, ob dieser Kontrollinstanz ein positiver oder ein negativer Einfluss auf das eigene Leben zugeschrieben wird (Foa & Riggs, 1994; Foa & Rothbaum, 1998; Foa, Tolin, Ehlers, Clark & Orsillo, 1999). Bezogen auf externale Kontrollüberzeugungen und religiöse Einstellungen würde die differenziertere Sichtweise dann lauten: „Es war Gottes/Allahs/der Götter Willen, A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen es geschehen zu lassen, und (mit seiner/ihrer Hilfe) werden wir das schon schaffen“ (external positiv) vs. „Die Götter strafen mich/uns, wie sollen wir damit fertig werden, und was haben sie außerdem noch mit uns vor“ (external negativ). Mit einem höheren PTBS-Belastungsniveau sind kognitive Faktoren wie negative Selbsteinschätzungen, Selbstbeschuldigungen, Selbstabwertungen und eine pessimistisch veränderte Weltsicht assoziiert (Foa & Riggs, 1994; Foa & Rothbaum, 1998; Foa, Tolin, Ehlers, Clark & Orsillo, 1999; Maercker, 2003b). Hier ist einschränkend anzumerken, dass sich die Studien der Gruppe um Foa auf die Folgen von interpersoneller und sexueller Gewalt konzentrieren, nicht auf Katastrophenopfer. Mit einem geringeren Belastungsniveau (im erweiterten Verständnis, PTBS und komorbide Störungen) sind verschiedentlich die Merkmale wahrgenommene Kontrolle, Selbstwertschätzung, Hoffnung, zuversichtliche Zukunftsorientierung und Optimismus verbunden worden. Es ist besonders hervorzuheben, dass die Überzeugung von den eigenen Bewältigungsmöglichkeiten und die positive Selbstwahrnehmung der eigenen Bewältigungsbemühungen einen stärkeren positiven Einfluss haben als die tatsächlich verfügbaren Fähigkeiten (Norris, Friedman & Watson, 2002). Soziale Unterstützung. Ein weiteres wichtiges Thema ist die soziale Unterstützung, unterschieden in geleistete, erhaltene und wahrgenommene soziale Unterstützung. Obwohl sich das Bild auch hier aus sehr vielen, teils gegensätzlichen Facetten zusammensetzt, lässt sich als Trend ablesen, dass erhaltene soziale Unterstützung einer der wichtigsten Schutz- und Bewältigungsfaktoren ist; dass der positive Effekt von erhaltener Unterstützung durch die subjektiv wahrgenommene Unterstützung moduliert wird; dass ein Nachlassen der wahrgenommenen sozialen Unterstützung mit einem Anstieg der posttraumatischen Symptomlage einhergeht (Carr et al., 1995; Kaniasty & Norris, 1993; Norris & Kaniasty, 1996; Solomon, 1985). Soziale Anerkennung und Wertschätzung sind als Teilaspekte sozialer Unterstützung von entscheidender Bedeutung. Dies beinhaltet Mitgefühl, Verständnis und Achtung für die durchlittenen Erlebnisse genauso wie die Wertschätzung für permanent geleistete Bewältigungsarbeit. Einbezogen und angesprochen sind hier neben der Familie und dem Freundeskreis in einem vernünftigen (nicht selbstschädigenden) Rahmen auch alle anderen sozialen Bezüge, z. B. am Arbeitsplatz und in der lokalen Öffentlichkeit. In einer größeren Zahl von Studien wird berichtet, dass Retraumatisierungen und die Entwicklung einer PTBS-Symptomatik davon abhängen, ob ein offenes, sozial unterstützendes Klima vorliegt oder nicht (Ayalon, 1993; Fontana & Rosenheck, 1994; Maercker & Müller, 2003). Psychosoziale Stressoren und Ressourcen. Einen potentiellen Schutzfaktor stellen die psychosozialen Ressourcen dar, über die eine Gemeinschaft verfügt. Psychosoziale Ressourcen haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie sich posttraumatische Belastungen entwickeln oder rückbilden. Im Katastrophenfall ist aber gerade die Verfügbarkeit solcher Ressourcen häufig in Mitleidenschaft gezogen oder außer Kraft gesetzt. Zusätzlich zum primären, unmittelbaren Schaden liegt im Verlust von Ressourcen das Risiko einer negativen Eigendynamik: je länger psychosoziale Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, desto stärker wird sich ihr Fehlen negativ auf die Wiederherstellung der Betroffenen auswirken, und desto größer wird der Einsatz psychosozialer Bemühungen sein müssen, um diese sekundären Folgen wieder auszugleichen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Ausmaß psychischer Belastung nach einer 25 26 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Katastrophe hoch damit korreliert ist, welchen Verlust an Ressourcen eine Gemeinschaft hinnehmen muss. Genauer betrachtet scheint der Verlust an sozialer Unterstützung einen besonders großen Einfluss zu haben (Kaniasty & Norris, 1993; Norris & Kaniasty, 1996). Als wesentliches und vordringliches Ziel wird deshalb vielfach gefordert, nach einer Katastrophe diejenigen psychosozialen Hilfesysteme mit der größten Bedeutung und dem größten Nutzen für die Allgemeinheit in Stand zu setzen (Hobfoll & Lilly, 1993). Sekundäre Stressoren. Verschiedene Autoren gingen der Frage nach, in welchem Ausmaß sekundäre Faktoren die Entwicklung posttraumatischer Belastung beeinflussen. Exemplarisch genannt sei hier die Längsschnittstudie von Norris, Perilla, Riad, Kaniasty und Lavizzo (1999) zu Effekten von kritischen Lebensereignissen und anderen psychosozialen Stressoren nach dem Hurrikane Andrew, Florida, Ende 1992. Untersucht wurden 241 Einwohner von Dade County, Florida, USA, im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Die Erhebungen fanden sechs und 30 Monate nach diesem Hurrikane statt, die Autoren nutzten verschiedene standardisierte und teilstandardisierte Interviewtechniken und Selbstbeurteilungsfragebögen. Stabilität oder Veränderung psychischer Symptome wurden in dieser Stichprobe in einem hohen Maß durch die Qualität anderer/nicht-traumatischer Stressoren und psychosozialer Ressourcen erklärt. Während die PTBS-Symptome Intrusionen und Arousal eher rückläufig waren, blieben Depressionen und Vermeidungsverhalten eher stabil. Intrusionen und Arousal waren stärker mit Merkmalen des unmittelbaren Katastrophengeschehens assoziiert; Vermeidung und Depressionen zeigten demgegenüber deutliche Zusammenhänge zu sekundären Stressoren und psychosozialen Ressourcen, wie z. B. sinkendem Selbstwertgefühl, kritischen Lebensereignissen (präund post-Trauma), finanzieller oder ökologischer Belastungen, sowie sozialer Einbettung. Maercker (2003b) nennt interpersonale Konflikte (partnerschaftliche Entfremdung, Scheidungen, Ärger am Arbeitsplatz, Frustration auf der Suche nach Gerechtigkeit) als bedeutsame sekundäre Stressoren. Auch hier ergibt sich für die Interventionsplanung die Forderung nach einer präzisen Situationsanalyse und nach der Wiederherstellung und Stabilisierung von Unterstützungs- und Schutzsystemen (Teegen, 2004). Weitere Faktoren. Aus der Frage, welchen Einfluss sozioökonomische Faktoren (Einkommen und gesellschaftlicher Status) auf die Ausbildung posttraumatischer Belastungen haben, ergeben sich häufig besondere methodische Probleme, die eine Untersuchung schwierig und die Interpretation der Ergebnisse uneindeutig machen. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass ein geringeres sozioökonomisches Niveau mit einer Erhöhung des Risikos für psychische Belastungen nach einer Katastrophe einhergeht. Verschiedentlich wird auch berichtet, dass Angehörige ethnischer Minderheiten besonders anfällig für posttraumatischen Stress seien, allerdings sind die Ergebnisse hier sehr heterogen und überwiegend auf den angloamerikanischen Sprachraum bezogen (Thompson, Norris & Hanacek, 1993). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Einfluss verschiedener nichttraumabezogener Risikofaktoren mit mittleren Korrelationen von maximal .20 statistisch zwar signifikant, aber vergleichsweise gering ausfällt. Dem stehen mit r ≈ .20 bis .40 deutlich höhere prädiktive Werte bei den Situations- und Aufrechterhaltungsfunktionen gegenüber (Brewin et al., 2000). Allgemein können solche Befunde als Beleg dafür A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen gesehen werden, dass die objektivierbare Schwere eines Traumas ein wichtiger, aber nicht der einzige Prädiktor für eine posttraumatische Entwicklung ist. Außerdem wird aus diesen Befunden deutlich, dass der größte Anteil der Verhaltensvarianz nach einem Trauma bislang nicht erklärt werden kann. Ob dafür spezifische methodische oder mehr theoretisch-konzeptionelle Faktoren verantwortlich sind ist ebenfalls offen. Besondere Probleme resultieren sicherlich aus der kaum überschaubaren Anzahl an Wechselwirkungen und Konfundierungen zwischen den einzelnen Faktoren – Probleme, die die Forschung genauso betreffen wie den Praktiker und Therapeuten, der in der Vielzahl der Einflussgrößen die Abhängigkeiten und Regelhaftigkeiten erkennen muss (Brewin et al., 2000). Aus denselben Gründen erscheint bei der gegenwärtigen Forschungslage der Versuch wenig sinnvoll, alle Risiko- und Schutzfaktoren in eine gewichtete Rangfolge zu bringen. Norris und Kollegen plädieren dafür, aus pragmatischen Gründen von einem additiven, linearen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren, Schutzfaktoren und posttraumatischer Belastung auszugehen: Je mehr Risikofaktoren vorliegen, und je weniger Schutzfaktoren als Ausgleich vorhanden sind, desto gefährdeter ist ein Betroffener. 1.4 Bewältigungsstile Es ist eine gängige Annahme, von der Gleichung „mehr Coping entspricht weniger posttraumatische Belastung“ auszugehen. Allerdings gibt es für diese Sichtweise keine bzw. wenig wissenschaftliche Evidenz. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein, die Beziehungen zwischen dem Ausmaß an allgemeinen Coping-Bemühungen und posttraumatischen Belastungen sind deutlich häufiger positiv als negativ – „mehr Coping entspricht mehr posttraumatischer Belastung“. Hier scheint eher die Sichtweise angemessen zu sein, dass das Ausmaß an Coping-Bemühungen ein Indikator für den darunter wirkenden, antreibenden posttraumatischen Stress ist. Im übrigen wird leicht übersehen, dass „Coping“ kein in sich geschlossener, wissenschaftlich eindeutig definierter Tatbestand ist, stattdessen ist „Coping“ als Sammelbegriff für eine breite und sehr heterogene Klasse von Verhaltensweisen zu verstehen, in die alles Aufnahme finden kann, was als aktive Auseinandersetzung und Bewältigungsbemühung verstanden werden kann. Hilfreiche Coping-Stile. Aus verschiedenen Arbeiten lassen sich optimistischere Sichtweisen ableiten. So weisen North, Spitznagel und Smith (2001) in einer prospektiv angelegten Studie darauf hin, dass die Coping-Stile „Aktive Bewältigung“ (active outreach), „Pragmatismus und Suche nach Information“ (informed pragmatism) und „Ergebenes Akzeptieren“ (reconciliation) mit einem verringerten Risiko für psychiatrische Störungen einhergehen. Der entscheidende Faktor mag hier zu sein, ob ein Coping-Stil die Möglichkeit einer Integration der traumatischen Erfahrungen in die eigene Lebensgeschichte einschließt oder begünstigt. Aufrechterhaltungsfaktoren vs. Disclosure. Zu den bedeutsamen Aufrechterhaltungsfaktoren gehört das posttraumatische Vermeidungsverhalten mit Gedankenunterdrückung, Gefühlsvermeidung, Vermeidung, über das Trauma zu reden, und impulsives und/oder exzessives Ausweichen in kontraphobische Gefühls- und 27 28 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen Empfindungszustände (Wut, Ärger, Selbstverletzung, Suchtmittelgebrauch) (Maercker, 2003b; North et al., 2001). Dem Sichverschließen vor den traumatischen Erinnerungen stehen als konsequentes Gegenmodell die Strategie des Disclosure oder der Offenlegung bzw. Aufdeckung gegenüber. Das Konzept des Disclosure wurde in den vergangenen etwa zwanzig Jahren maßgeblich von Pennebaker (1985) und Kollegen (Pennebaker et al., 1986, 1988, 1989, 1990, 1993, 1999) geprägt und intensiv erforscht. Ausgangspunkt ist die Hypothese, dass Schreiben oder Reden über traumatische und emotional stark belastende Erfahrungen sowohl die subjektive Befindlichkeit als auch den körperlichen/psychophysischen Gesundheitsstatus verbessert, bis hin zu positiven Auswirkungen auf verschiedene objektive Parameter des Immunschutzes. NichtSprechen (Schweigen, äußere und innere Sprache vermeiden) stellt dagegen einen aktiven Hemmungsprozess dar, der gesundheitlich schädigend ist. Es werden verschiedene Mechanismen diskutiert, wie die Methode salutogenetisch wirksam werden könnte (Campbell & Pennebaker, 2003; Uhlmann, Hughes & Pennebaker, 1995): 1. Förderung der Integration traumatischer Erinnerungen in das autobiografische Gedächtnis durch elaborierte verbale Verarbeitung (und auf diesem Weg die Zusammenführung traumatisch dissoziierter Gedächtnismodalitäten); 2. Im Optimalfall Förderung hilfreicher Kognitionen mit den Mitteln der Sinnsuche, über Kausalattribuierungen, und durch Überprüfung dysfunktionaler Annahmen; 3. Direkte förderliche Effekte von emotionaler Entlastung und positiv veränderter Stimmung auf das Immunsystem, wie sie z. B. aus der Gesundheitspsychologie und der Psychoneuroimmunologie bekannt sind. Häufig wird ein Untersuchungsparadigma mit drei Bedingungen eingesetzt: 1. Schreiben über traumatische oder emotional hoch belastende Erfahrungen; 2. Schreiben über alltägliche, nebensächliche, emotional wenig valente Ereignisse; 3. Kontrollbedingung ohne Schreiben. Abhängige Maße sind wahlweise die Frequenz von Arztbesuchen, immunologische Parameter, oder auch simultan registrierte Parameter der psychophysiologischen Aktivität (Hautleitfähigkeit, Muskeltonus, Puls, Blutdruck etc.) (Uhlmann, Hughes & Pennebaker, 1995). Seit einiger Zeit werden auch EDV-gestütze Verfahren zur syntaktischen, grammatikalischen und semantischen Sprachanalyse eingesetzt (z. B. Latent Semantic Analysis, LSA) (Campbell & Pennebaker, 2003). Zahlreiche Arbeiten bestätigen positive Effekte des Disclosure (Esterling, Antoni, Fletcher, Marguiles & Schneiderman, 1994; Pennebaker, 1985; Pennebaker, Barger & Tiebout, 1989; Pennebaker & Beall, 1986; Pennebaker, Colder & Sharp, 1990; Pennebaker, Kiecolt-Glaser & Glaser, 1988; Pennebaker & Traue, 1993). Ergebnisse aus einer deutschen Studie haben Müller, Beauducel, Raschka und Maercker (2000) vorgelegt. Trotz dieser Belege sind aber die genauen psychologischen und physiologischen Zusammenhänge weitgehend unklar, die Effekte sind zum Teil inkonsistent, zum Teil sind sie schwach. So fanden etwa Pennebaker, Barger und Tiebout (1989) positivere autonome Reaktionsprozesse bei so genannten „high disclosures“ im Vergleich zu „low disclosers“. Auf sprachlicher Ebene stellen sich die positivsten Effekte immer dann ein, wenn im Bericht positive emotionale Aussagen verwendet werden, oder wenn Kausalzusammenhänge hergestellt oder einsichtsvolle Schlüsse gezogen werden A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen (Pennebaker & Seagal, 1999). In einer neueren Arbeit stellten Campbell und Pennebaker (2003) eine Beziehung zwischen fortschreitenden Veränderungen in der sozialen und interpersonellen Wahrnehmung (gemessen durch die Häufigkeit von Pronomen in einem Text) und steigendem Gesundheitsstatus (gemessen durch die Häufigkeit von Arztbesuchen). Aus Sicht der Psychotraumatologie liegt es nahe, hierin Anzeichen für wahrgenommene Kontrolle, für wahrgenommene soziale Einbettung und für die Übernahme einer „Autorenschaft“ über die eigene Biografie zu sehen. Für die Bewältigung eines Traumas werden diese angesprochenen Aspekte als allgemein hilfreich angesehen. Obwohl für die Wirksamkeit von Disclosure zahlreiche Nachweise vorliegen, bleibt es weiterer Forschung überlassen, für genauere Aufklärung zu sorgen, wie und warum Disclosure wirkt. 1.5 Die Haltung Betroffener gegenüber psychosozialer Betreuung Eine Besonderheit von traumatisierten Personen ist ihre Neigung, ihre psychischen Beeinträchtigungen auf von außen verursachte Beschädigungen zurückzuführen, die jenseits eigener Zugriffsmöglichkeiten liegen. Mit diesem externale Attribuierungsstil geht häufig ein Mangel an Aufmerksamkeit für die eigenen Bewältigungsund Veränderungsmöglichkeiten einher. Hinzu kommen eigene und von außen übernommene Erwartungen, mit den Gedanken an das Geschehene aufzuhören und „einfach nicht mehr daran zu denken“ – „das Leben geht weiter“, das Beste sei es, zum Alltag zurückzukehren (Maercker, 2003a). Eine Folge solcher Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster ist einerseits die Schwierigkeit, sich als hilfsbedürftig wahrnehmen zu können und zu wollen, eine weitere Folge kann in der Schwierigkeit bestehen, sich gegen innere Verpflichtungen in die Patientenrolle begeben zu dürfen. Eine besondere Brisanz bekommt die Situation für Betroffene immer dann, wenn Männlichkeits- und Härteideale und eher rigide Gruppenreglements ins Spiel kommen (Ayalon, 1993; Pieper & Maercker, 1999). Orner (2003, zitiert nach Teegen, 2004) berichtet z. B. über die Abwehr von Rettungskräften, nach Einsätzen in Katastrophenszenarios professionelle Helfer aufzusuchen. Nicht unterschätzen sollte man auch die weit verbreitete Assoziation, nur „Verrückte“ würden psychotherapeutische Unterstützung benötigen – für viele Traumatisierte in ihrer besonderen Situation als ungerechtfertigt Geschädigte eine besonders schwere Hürde und ein wichtiger Aspekt für die psychologische Aufklärung von Betroffenen. Die Angst vor Stigmatisierung und vor Selbstabwertung liefert einen weiteren Baustein in diesem diffizilen Puzzle aus Annahmen, Einstellungen und Haltungen (Maercker, 2003a). Betrachtet man die Dynamik des peri- und posttraumatischen Geschehens, so können aber die gerade geschilderten Abneigungen und Abwehrhaltungen auch als Versuch eines Betroffenen umgedeutet werden, den erlebten Kontrollverlust durch Autonomie auszugleichen – ein Verhalten, das im Ansatz positive Aspekte hat und besonders bei Einsatzkräften psychoedukativ und therapeutisch nutzbar gemacht werden kann, wenn man Betroffene Personen über solche Zusammenhänge informiert. In jedem Fall muss die psychosoziale Betreuung auf Hürden dieser Art durch ein besonderes Maß an Sensibilität und Taktgefühl reagieren können, insbesondere in der 29 30 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Die Folgen einer Katastrophe für die Betroffenen hoch vulnerablen Anfangsphase unmittelbar nach Ende des Katastrophengeschehens. Neben einer klaren und strukturierten Informationsvermittlung gehört es zu den wesentlichen Zielen der Nachsorge, Hilfsangebote niedrigschwellig, plausibel vermittelbar und pragmatisch zu gestalten (Orner & Schnyder, 2003; Paton, Violanti & Smith, 2002, Teegen, 2004) und auf die Betroffenen zuzugehen, statt nur Betreuungsangebote bereitzustellen und auf deren Kommen zu warten (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). 1.6 Zeitliche Entwicklung nach traumatischen Ereignissen Der allgemeine Trend in der Mehrzahl der Studien zeigt, dass traumabezogene Symptome über die Zeit abnehmen. Es finden sich aber auch Ausnahmen (Carr et al., 1997; Nader, Pynoos, Fairbanks & Frederick, 1990), in denen Symptomlagen im langfristig stabil blieben oder sogar zur Verschlechterung neigten. Über diese allgemeinen und vagen Aussagen hinaus gibt es aber bei genauer Betrachtung keine wirklich erkennbare Regel. Es gibt streng linear abnehmende Verläufe, stufenförmig abnehmende Verläufe, exponentiell abnehmende Verläufe, etc. Das Bild gewinnt zusätzlich an Komplexität, wenn besondere Personengruppen oder andere differentielle Faktoren zur Datenanalyse herangezogen wurden. Drei weitere allgemeine Schlüsse können mit der gebotenen Vorsicht aus den vorhandenen Daten abgeleitet werden. Zum einen kann als sicher gelten, dass das erste Jahr nach der Katastrophe der Zeitraum ist, in dem sich Symptome aufbauen und ihren Höhepunkt erreichen (Bromet, Parkinson & Dunn, 1990; Phifer & Norris, 1989; Phifer, Kaniasty & Norris, 1988; Shaw, Applegate & Schorr, 1996; Steinglass & Gerrity, 1990; Thompson et al., 1993; Ursano, Fullerton, Kao & Bhartiya, 1995). Zweitens ist die Symptomatik in diesem Zeitraum ein guter Schätzer für den weiteren Verlauf der psychischen Beeinträchtigung (La Greca, Silverman, Vernberg & Prinstein, 1996; McFarlane, 1987, 1989; Nader et al., 1990; Norris, Perilla et al., 1999; Udwin, Boyle, Yule, Bolton & O’Ryan, 2000). Drittens wurden verzögert einsetzende Störungen eher selten beobachtet, obwohl Ausnahmen verschiedentlich beschrieben wurden und deshalb grundsätzlich immer in die eigenen Überlegungen mit einbezogen werden müssen (North, Smith & Spitznagel, 1997; Yule, Bolton, Udwin, O’Ryan & Nurrish, 2000). Auch in den Diagnosekriterien des DSM-IV (Saß, Wittchen & Zaudig, 1998) und des ICD-10-GM (DIMDI, 2003) wird diese Möglichkeit berücksichtigt. 2. Planungsebenen und Behandlungsbausteine Je nach Wahl der Betrachtungsebene lassen sich Hilfs- und Betreuungskonzepte unter dem Aspekt des Phasenverlaufs, auf verschiedene soziale Systeme ausgerichtet und methoden- bzw. maßnahmenorientiert aufschlüsseln. Erst die Kombination und Verschränkung dieser Betrachtungsebenen führt zu einem tragfähigen und A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine hinreichend flexiblen Gesamtkonzept – eine Sichtweise, die sich auch im Aufbau der folgenden Darstellungen wiederfindet. Katastrophennachsorge ist multifaktoriell, multimodal und systemisch (Maercker, 2003b; Teegen, 2004). Multifaktoriell ist sie, weil sie Belastungen auf allen Funktionsebenen der Betroffenen berücksichtigt (z. B. physiologisch, affektiv, kognitiv und behavioral); multimodal, weil verschiedene Mittel und Techniken der psychologischen Betreuung und Behandlung zum Einsatz kommen (z. B. psychologische Begleitung von Betroffenengruppen, Stabilisierung, Konfrontation, kognitive Umstrukturierung); und systemisch ist sie, wenn Probleme auf Gruppen- und Gemeindeebene nicht nur mitbedacht werden, sondern den Rahmen des Betreuungskonzepts vorgeben (z. B. durch Förderung von Gruppenkohäsion und Integration, durch besondere Berücksichtigung von interpersonalen Prozessen in Familien, am Arbeitsplatz etc.). Wo nicht anders angemerkt, richten sich die folgenden Darstellungen nach den Empfehlungen der bereits erwähnten Expertenkommissionen (Hodgkinson & Stewart, 1998; Paton et al., 2002; Weisaeth, 1997; Weltgesundheitsorganisation/World Health Organization, 1999, 2001; Young, Ford, Ruzek, Friedman & Gusman, 1998). 2.1 Bewältigung von posttraumatischer Belastung Wenn posttraumatische Symptome im statistischen Mittel mit der Zeit geringer werden, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, die Notwendigkeit psychosozialer und psychotherapeutischer Betreuung generell in Frage zu stellen. Vergleicht man die Strategien der Psychotherapie mit der verbreiteten Alltagsüberzeugung, „die Zeit wird es schon heilen“, dann können die Unterschiede kaum stärker ausfallen. Kann die Therapieforschung der Aussage, Vermeidung und Ignorieren des Traumas seien gemeinsam mit dem Verstreichen von Zeit heilsam, mit harten Fakten begegnen? Meta-Analysen wie derjenigen von van Etten und Taylor (1998) lässt sich entnehmen, dass die Besserungsraten langfristig mit therapeutischer Unterstützung deutlich höher ausfallen als unter Kontroll-/unterstützter Wartelistenbedingung. Van Etten und Taylor berechneten auf der Grundlage von 61 Behandlungsstudien für Psychotherapien gute bis deutlich sehr gute Effektstärken von .90 bis etwa 1.20, mit einer Effektstärke von .40 wurden schwache Effekte in der Wartelistenbedingung beobachtet. Die Arbeit von van Etten und Taylor (1998) bestätigt aber auch, dass Traumatisierungen und ihre Folgen in ihrer Ansprechbarkeit für psychotherapeutische Maßnahmen komplex und vielschichtig sind. Nicht jede Form der Psychotherapie ist gleich gut geeignet zur Behandlung Traumatisierter. Am besten schneiden kognitiv-behaviorale Therapien ab (KBT), gefolgt von Augenbewegungs-Desensibilisierung und Verarbeitung (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) und mit gewissen Einschränkungen bestimmte psychodynamische Methoden und Hypnose. Auf Seiten der pharmakologischen Methoden sind die Ergebnisse indifferent, van Etten und Taylor ermittelten für Pharmakotherapien schwache Effekte von etwa .50, mit Ausnahme von Serotonin-Uptake-Hemmern, die bei der Behandlung von Depressionen nach einem Trauma Effektstärken bis etwa 1.30 erbrachten. Eine weitere wichtige Aussage machen van Etten und Taylor über die Drop-out-Rate, die mit 14% bei den Psychotherapien deutlich niedriger liegt als bei den Pharmakotherapien (32%). Verschiedene Autoren sprechen sich aber dafür aus, Medikamente als ein Mittel der Stabi- 31 32 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine lisierung zumindest übergangsweise in die Behandlung einzubeziehen, wenn die Umstände dies nahe legen (Maercker, 2003b; Katz, Pellegrino, Pandya, Ng & DeLisi, 2002). Der Behandlungserfolg von kognitiv-behavioralen Therapien und EMDR ließ sich auch im 15-Wochen-Follow-up noch nachweisen; Katamnesen für die anderen Behandlungsmethoden lagen für diese Meta-Analyse nicht vor. Bei der Bewertung dieser Aussagen müssen zwei wichtige Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen beruhen die zugrunde liegenden Untersuchungen auf selektiven Stichproben – es wurden Personen untersucht, die durch ihren traumatischen Druck bereits in eine psychotherapeutische Betreuung gebracht wurden, Personen mit weniger schweren Symptomen werden nicht erfasst. Zum anderen stellt auch die Konzentration des Blicks auf die klinisch-psychotherapeutische Seite der Betreuung von Traumatisierten selbst schon eine Selektion dar – der Einfluss von psychosozialer Betreuung in einer allgemeinen, vor-klinischen Form wird hier nicht berücksichtigt. Insgesamt wird über Betroffene mit vergleichsweise geringen Beschwerden also nichts ausgesagt. Weiter ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Therapie und nicht jedes Therapieschema gleich gut für jede Art von Trauma geeignet ist – allgemeine Erkenntnisse zur generellen Eignung einzelner Therapieformen wurden bereits im Zusammenhang mit der Meta-Analyse von van Etten und Taylor erläutert. Bei der Wahl des therapeutischen Vorgehens spielt z. B. der Zeitpunkt des Therapiebeginns in Relation zum Trauma eine wichtige Rolle: ein lange zurückliegendes Trauma erfordert therapeutische Schwerpunkte, die stärker auf Aufdeckung und kognitive Umstrukturierung ausgerichtet sind, psychopharmakologische Therapien sind hier sicher nur im Ausnahmefall indiziert. Andererseits würde man nach einem vor kurzem erlebten Verkehrsunfall Konfrontationsverfahren und die Bewältigung frischer Erinnerungen, Erfahrungen und Anspannungszustände in den Mittelpunkt stellen. Nach einer überlebten Katastrophe wiederum kann eine pharmakologische Unterstützung hilfreich sein, um für eine Übergangszeit die Handlungsfähigkeit von Betroffenen in einem möglicherweise zerstörten oder beschädigten Lebensumfeld aufrecht zu erhalten, bis die Randbedingungen soweit stabilisiert sind, dass für kognitiv-behaviorale Behandlungsmethoden Raum entsteht. Weiterhin sind die individuellen Möglichkeiten und Neigungen eines Patienten zu berücksichtigen. Und zuletzt kommt es wesentlich auf das Zusammenspiel zwischen der individuell erlebten Schwere des Traumas, der wahrgenommenen sozialen Unterstützung und insgesamt auf Art und Qualität der Einbettung in persönliche Beziehungen an, ob und in welchem Ausmaß sich traumatische Beschwerden mittel- und langfristig zurückbilden können – ob mit oder ohne therapeutischer Unterstützung. In diesem Zusammenhang sei an die fatalen Auswirkungen erinnert, die mangelnde soziale Unterstützung, mangelnde soziale Akzeptanz, die damit einhergehende Stigmatisierung, und die Aufforderung zur Nichtbeschäftigung, also zur Vermeidung des Traumas, auf die posttraumatische Symptomentwicklung aller Betroffener haben. Ein eindrucksvolles Fallbeispiel für die pathogenen Folgen mangelnder Unterstützung durch die soziale Umgebung beschreibt Ayalon (1983, 1993; Ayalon & Soskis, 1986). Ein Bericht in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ über die negativen Auswirkungen einer verdrängenden Grundhaltung für die gesamte Gemeinde nach einem Zugunglück in Radevormwald mit 41 getöten Kindern war für die Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe ein motivationaler Faktor, gegen die Vermeidungshaltung der Betroffenen anzugehen und die Betreuung A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine nach dem Grubenunglück in Borken im Sinne des oben beschriebenen „Disclosure“Ansatzes zu beginnen (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). Grob und mit der gebotenen Vorsicht aus der Arbeit von van Etten und Taylor abgeschätzt, könnte sich in einer Gruppe von Betroffenen das Ausmaß der Belastungen statistisch betrachtet um bis zu einer Standardabweichung in unerwünschter Richtung verschieben, wenn eine angemessene Betreuung ausbleibt: Effektstärke der Besserung der Symptome „ohne Intervention“ (= Wartelisten-Kontrollbedingung) etwa .50, also rund eine halbe Standardweichung; Besserungen der Symptome bei hypothetischer „optimaler Intervention“ (KBT und psychosoziale Unterstützung etc.) etwa eineinhalb Standardweichungen; Differenz beider Effektstärken etwa eine Standardabweichung (unter der Voraussetzung, dass die Varianzen der Gruppen statistisch hinreichend übereinstimmen und die Effektstärken dadurch direkt vergleichbar werden). Als Fazit bleibt zunächst festzuhalten: nur dadurch, dass Zeit vergeht, heilt ein Trauma nicht. Psychosoziale Betreuung ist nötig, und sie ist nützlich. Eine unterstützende Umgebung ist unabdingbar. 2.2 Historische Entwicklung der psychosozialen Katastrophennachsorge Auf die Notwendigkeit psychosozialer Betreuung nach Großschadensereignissen wurde zuerst in den USA aufmerksam gemacht, nach Erfahrungen mit Opfern einer Brandkatastrophe in Boston, 1942 (Lindemann, 1944). Auf diesen Bericht gehen spätere Überlegungen zu Präventions- und Nachsorgekonzepten zurück, die nach Ereignissen in den siebziger Jahren in den USA und in Europa eingesetzt und evaluiert wurden (Green, Grace, Lindy, Titchener & Lindy, 1983; Lindy, Green, Grace & Titchener, 1983). Pionierleistungen auf dem Weg zu einer organisierten und strukturierten Katastrophennachsorge fanden im europäischen Raum Ende der 80er Jahre zum Beispiel nach dem Fährunglück der Herald of Free Enterprise bei Zeebrügge statt. Das daraufhin entstandene Hilfsprojekt führte im europäischen Raum zu weiteren wichtigen Erkenntnissen und kann als gut dokumentiert gelten (Dalgleish, Joseph, Trasher, Tranah & Yule, 1996; Hodgkinson, 1990; Joseph, Yule, Williams & Hodgkinson, 1994; Quintyn, De Winne & Hodgkinson, 1990). Ebenfalls in diesen Zeittraum fielen in Deutschland das Grubenunglück von Borken und die Katastrophe auf der Flugschau von Ramstein. Auch hier wurden die psychosozialen Hilfsmaßnahmen (Betreuung von Opfern, Hinterbliebenen und Rettungskräften) gut dokumentiert und trugen nicht zuletzt zu einer Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung bei (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992; Jatzko, Jatzko & Seidlitz, 1995). Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen konnte z. B. die Organisation der Katastrophennachsorge nach dem Zugunglück in Eschede auf einem spürbar gesteigerten Kompetenzniveau stattfinden (Hüls & Oestern, 1999; Koordinierungsstelle Einsatznachsorge, 2002). Dass und in welchem Umfang auch Rettungskräfte gefährdet sind, nach einem Großschadensereignis an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, doku- 33 34 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine mentiert z. B. die Längsschnittstudie von McFarlane an australischen Feuerwehrleuten (McFarlane, 1986a, 1988, 1990). In Deutschland befasst sich die Arbeitsgruppe um Bengel mit den Auswirkungen des Zugunglücks von Eschede auf die dort involvierten Rettungskräfte (Bengel, 2001; Helmerichs, 2003). In Übereinstimmung mit anderen Studien ermittelten Bengel und Kollegen (2003) ein besonders hohes Risiko, eine PTBS zu entwickeln, bei Einsatzkräften, die als professionelle Ersthelfer vor Ort waren und bei denjenigen, die durch die Bergung von Toten (insbesondere von Kindern) und von Leichenteilen belastet wurden. Hier findet sich die pathogene Bedeutung extremer traumatischer Stressoren bestätigt. Die besonderen und vielschichtigen Anforderungen, nach einem Großschadensereignis eine funktionierende Katastrophenhilfe inklusive eines psychosozialen Nachsorgesystems einzurichten, haben zu Empfehlungen verschiedener Organisationen und Expertenkommissionen geführt (Hodgkinson & Stewart, 1998; Weisaeth, 1997; Weltgesundheitsorganisation, 1999, 2001; Young et al., 1998). Das Disaster Commitee der UNO hat für verschiedene kulturelle Kontexte, insbesondere für Entwicklungsländer, Empfehlungen zur Betreuung auf der Gemeinde-, der Familien- und der individuellen Ebene vorgestellt, die als Rahmenmodell dienen und an verschiedene Situationen angepasst werden können (Somasundaram, Norris, Asukai & Murthy, in Druck, zitiert nach Norris, Friedman et al., 2002). Alle diese Berichte beziehen aktuelle Forschungsergebnisse zu Risiko- und Schutzfaktoren ein (Orner & Schnyder, 2003; Paton et al., 2002). Die Task Force on Crisis and Disaster der European Federation of Psychologists Associations hat einen Bericht an die EU vorgelegt mit eindeutigen Empfehlungen zur kurz- und langfristigen Betreuung von Katastrophenopfern und zu Trainingsmaßnahmen für Therapeuten (Task Force on Crisis and Disaster, 2005). Ohne Frage ist in den vergangenen Jahren das Verständnis für die psychischen Folgen von Katastrophen in Politik, Gesundheitswesen und bei den Rettungsorganisationen gewachsen. Verschiedene nationale und internationale Ereignisse belegen aber auch, dass trotz der gesammelten Erfahrung der letzten Jahrzehnte in jedem Einzelfall viele organisatorische und administrative Hindernisse überwunden und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, um Verantwortungs-, Entscheidungs- und Leistungsträger von der Notwendigkeit und dem langfristigen Nutzen psychosozialer Nachsorge nach einer Katastrophe zu überzeugen (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). Die Annahme – oder die Forderung –, die Zeit würde es schon richten, ist tief im alltäglichen Denken verankert. Im Rahmen der Theorien zur kognizierten Kontrolle oder auch zur Reaktanz liefert die sozialpsychologische Forschung Erklärungsmodelle und Belege dafür, warum Nicht-Betroffene und Betroffene dazu neigen können, Unfassbares und nicht Verhinderbares aus dem Bewusstsein zu drängen, um auf diesem Weg Kontrollüberzeugungen aufbauen oder aufrechterhalten zu können (Dickenberger, Gniech & Grabitz, 1993; Osnabrügge, Stahlberg & Frey, 1993). Von Expertenseite wird unvermindert die Arbeit an empirischer Evidenz eingefordert. Nur mit dem Mittel der kontinuierlichen wissenschaftlichen Prozess- und Ergebnisevaluation können Standards entwickelt werden, die helfen und überzeugen. Die im Katastrophenfall aus dem Handlungsdruck der Situation heraus ad hoc gebildeten psychosozialen Betreuungsteams sind aus sehr pragmatischen Gründen mit dieser Aufgabe in der Regel überfordert. National und international setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Fortentwicklung der Katastrophennachsorge nur möglich ist, wenn A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine zentralisierte Task Forces etabliert werden können, die als Brain Pool auch die Aufgaben der Evaluation übernehmen und/oder überwachen (Teegen, 2004). 2.3 Nachsorge unter dem Aspekt des Phasenverlaufs Die phasenorientierte Planung orientiert sich an der biopsychologischen und der psychosozialen Dynamik, wie sie häufig nach einer Katastrophe beobachtet werden. Betrachtet man den zeitlichen Ablauf der Prozesse nach einer Katastrophe, werden die Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen üblicherweise grob in drei aufeinanderfolgende Zeitabschnitte gegliedert (Teegen, 2004). Orientiert an diesen Phasen werden Katastrophennachsorge und Trauma-Behandlung als dreistufiger Prozess aus Stabilisierung der psychischen Verfassung, Verarbeitung der traumatischen Erfahrungen und schließlich Integration des Traumas in die Biografie und das Selbst- und Weltbild der Betroffenen organisiert. Phase 1. In Phase 1 stehen Rettung, Bergung und medizinische und psychologische Notfallversorgung im Vordergrund. Zweites, aber gleichrangiges Ziel in diesem Zeitfenster ist die Einrichtung aller notwendigen Organisations- und Informationsstrukturen des Katastrophenmanagements. Je nach Sachlage dauert die Akutphase nach der Katastrophe wenige Stunden oder Tage. Belastbare Notfallpläne vorausgesetzt, kann das Katastrophenmanagement etwa in diesem Zeitraum eingerichtet sein. Phase 1 ist bei allen Betroffenen und Beteiligten gekennzeichnet durch ein hohes Ausmaß an Erregung, Aktivierung und Energiemobilisierung. Unter diesem Gesichtspunkt liegt die psychologische Aufgabe darin, Tätigkeiten zu strukturieren und Energie zu kanalisieren, vom Aktionismus zur Aktivität. Wenn nichtprofessionelle freiwillige Ersthelfer involviert sind, sollten sie innerhalb dieses Zeitraums so weit wie möglich durch geschulte und unterwiesene Notfallhelfer und Bergungskräfte ersetzt und gegebenenfalls aus dem Wirkungsbereich der massivsten traumatischen Einflüsse entfernt werden. Eine psychologische Erst- bzw. Nachbetreuung mit Stabilisierung, psychoedukativer und risikodiagnostischer Zielsetzung ist angebracht. Es kann außerdem sinnvoll sein, Freiwillige nicht aus der Tätigkeit heraus in die Untätigkeit zu schicken, sondern ihnen andere, ebenfalls bewältigungsorientierte Aufgaben zuzuweisen, um die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und des zurückkehrenden Kontrollvermögens zu fördern, ohne diese Personen gleichzeitig mehr oder stärkeren traumatischen Stressoren auszusetzen, als sie verkraften können. Phase 2. Phase 2 setzt nach wenigen Tagen ein und kann bis zu vier Wochen dauern. Während in Phase 1 ein hohes Maß an Energie spontan in Rettung, Orientierung und Ordnung des herrschenden Chaos fließt, führen die zunehmend geordneten kollektiven Anstrengungen in Phase 2 unter günstigen Umständen zu einer zuversichtlichen Grundstimmung und einem Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Betroffenen, Einsatzkräften und der Organisationsebene. Die wachsende Ordnung im Chaos kann die gemeinschaftliche Überzeugung entstehen lassen, materielle, physische, psychische und kollektive Ressourcen könnten mit gleich bleibendem Tempo und womöglich vollständig wiederhergestellt werden. Für viele Betroffene ist damit nicht zuletzt die Hoffnung verbunden, das Leben könne nach kurzer Frist so weitergehen, wie es vorher war (Teegen, 2004). Mit zunehmender Erschöpfung der physischen und psychischen 35 36 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Energien, die durch die Maximalbeanspruchung aufgezehrt werden, gehen akute Trauer- und Verzweiflungsreaktionen einher, das Entsetzen der Katastrophenerfahrung kann zu starken akuten Angst- und Unruhezuständen führen. Psychologische Schwerpunkte in dieser Zeit sind die Vermittlung von Stabilisierung und Distanzierung, Information und Psychoedukation, sowie die Stärkung vorhandener sozialer Ressourcen. Phase 3. Phase 3 ist zunächst dadurch gekennzeichnet, dass sich etwa vier Wochen nach der Katastrophe zunehmend Ernüchterung und Desillusionierung durchsetzen. Mit der Erschöpfung der physischen und psychischen Energien, die durch die Maximalbeanspruchung der ersten beiden Bewältigungsphasen aufgezehrt wurden, setzt sich zeitgleich die Erkenntnis durch, wie groß der individuelle und der kollektive Verlust ist, und wie schwer oder unmöglich dieser Verlust ausgeglichen werden kann. Oft lässt jetzt auch die öffentliche Aufmerksamkeit nach, und finanzielle Hilfsmaßnahmen bleiben aus oder lassen aus Sicht der Betroffenen unangemessen lange auf sich warten (z. B. Geschehnisse nach der Hochwasserkatastrophe an der Oder in Sachsen, 2002, vgl. Brösteler, 2003) – insgesamt verstärkt sich der Eindruck, „von Gott und der Welt verlassen zu sein“, Gefühle von Mut- und Hoffnungslosigkeit intensivieren sich, unter Umständen kommt es bei Einzelnen zu sozialen Rückzugsreaktionen. Faktoren dieser Art tragen dazu bei, dass sich die Belastung durch posttraumatische Symptome verstärkt. In den folgenden Monaten können kritische persönliche Lebensereignisse dazu führen, dass die posttraumatische Belastung erstmalig die Schwelle zur klinischen Störung überschreitet oder die Symptomatik sich insgesamt verschlechtert. In dieser Phase beginnt das Risiko der Chronifizierung einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Dem entgegen wirken ausgleichende, stützende, helfende, emotional und sozial stabilisierende Einflüsse. Dazu zählen neben den vertrauten familiären und freundschaftlichen Bindungen auch die beruflichen Aufgaben und Gewohnheiten, und natürlich die zur Verfügung stehenden psychosozialen Betreuungsmaßnahmen. Innerhalb von etwa 18 bis 36 Monaten erholt sich die Mehrheit der Betroffenen, immer in Abhängigkeit zum Zusammenwirken aller individuell beteiligten Faktoren (Baum et al., 1993; Bravo, Rubio-Stipec, Canino, Woodbury & Robera, 1990; Green & Lindy, 1994; La Greca et al., 1996; Silver, Holman, McIntosh, Poulin & Gil-Rivas, 2002). Es sei aber explizit betont, dass es sich hier um eine statistische Aussage handelt, nicht um eine verbindliche psychologische Gesetzmäßigkeit – gerade nach extremen traumatischen Belastungen kann zum einen der Wiederherstellungsprozess deutlich mehr Zeit als drei Jahre beanspruchen, zum anderen ist auch der Begriff der Erholung relativ zu verstehen. Viele Betroffene leiden auch Jahre und Jahrzehnte nach der traumatischen Erfahrung noch unter Restzuständen oder Rezidiven, auch wenn die Funktionsfähigkeit weitgehend wiederhergestellt werden konnte. 2.4 Nachsorge mit dem Fokus auf sozialen Funktionsebenen Psychosoziale Katastrophennachsorge sollte als komplexes und flexibles Netzwerk an Gegenmaßnahmen gegen das Netzwerk an komplexen und interagierenden Belastungsfaktoren nach der Katastrophe verstanden werden. Eine Individualbetreuung macht z. B. nur dann Sinn, wenn die Familie und die Arbeitsumgebung, in die der Einzelne eingebettet ist, in der Lage ist, angemessen mit dem Trauma umzu- A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine gehen. Bei Kindern zum Beispiel erreichen Risiko-Screenings von Situations- und individuellen Belastungsfaktoren geringe empirische Absicherung, hier zeigt sich regelhaft, dass die Belastung der Eltern und ihr Umgang mit dem Trauma als interagierende Einflüsse die besseren Prädiktoren für die Belastung des Kindes sind. Eine Behandlung von Kindern nach einer Katastrophe ist wenig aussichtsreich, wenn nicht die Familien als gleichermaßen mitbetroffene und stützende soziale Systeme in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt werden (Yule et al., 2000). Von den für die psychosoziale Nachsorge verantwortlichen Personen fordert dies die Bereitschaft und die Fähigkeit, systemisch und ökologisch zu denken. Der Entwurf eines psychosozialen Hilfesystems muss sich unmittelbar daraus ableiten lassen, wie sehr und wie schwer eine Gemeinde auf den unterschiedlichen Funktionsebenen von einer Katastrophe betroffen ist und welche Bedürfnisse des Gesamtsystems sich daraus ableiten lassen. Auf kommunaler bzw. Gemeindeebene ist deshalb zunächst für Aufklärung, Kommunikation und Integration zu sorgen. Anschließend müssen alle Schutz- und Stützsysteme sowie die üblichen Dienste des Gemeinwesens wiederhergestellt werden, damit die betroffene Gemeinde so weit wie möglich ihre Selbstständigkeit wiedererlangt (Rettungs- und Gesundheitsdienste, Schulen, Kirchen und religiöse Gemeinschaften, Verwaltung, Versorgung/Handel). Wählt man die Bedürfnisse der betroffenen Gemeinde (oder Region) als Ausgangspunkt, lassen sich eine und zwei Stufen tiefer auf Nachbarschaftsniveau und auf dem Niveau einzelner Familienverbände besondere Belastungen oder besondere Robustheit identifizieren, auf die entsprechend reagiert werden kann. Die besondere Bedeutung einer Betreuung des Einzelnen braucht abschließend nicht besonders hervorgehoben werden; wenn es gelingt, die psychosozialen Rahmenbedingungen günstig zu gestalten, sind die Aussichten für den einzelnen Betroffenen gut, über das Entsetzen der Katastrophe hinwegkommen zu können und sich der Gemeinschaft der Überlebenden anzuschließen. Nicht zuletzt soll erwähnt werden, dass auch Pläne für die gesamtgesellschaftliche Ebene benötigt werden, die politische und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet und die Medien als wichtiges Teilsystem in die psychosozialen Maßnahmen einbeziehen (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, 2005). Der folgende Abschnitt wird sich mit detaillierteren Betrachtungen einzelner Maßnahmen befassen. 2.5 Psychosoziale Interventionen Das Inventar an Methoden der kurz-, mittel- und langfristigen Katastrophennachsorge verteilt sich auf vor-klinische psychosoziale Betreuungsmaßnahmen und auf klinisch-psychologische Interventionen, insgesamt lassen sich vier Schwerpunkte identifizieren. Psychosoziale Betreuung: 1) An erster Stelle steht die teils organisations- teils gemeindepsychologisch geprägte Aufgabe, ein psychosoziales Netzwerk einzurichten und alle an der Katastrophennachsorge beteiligten Instanzen zu integrieren und zu beraten. Für die Wiederherstellung des Sicherheitsgefühls der Betroffenen ist dieser Punkt von hoher therapeutischer Bedeutung. 37 38 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine 2) Als zweites Teilziel kommt einem extensiven Informationsmanagement inklusive Information aller Verantwortungs- und Entscheidungsträger, der Öffentlichkeit und der Medien, und nicht zuletzt der Betroffenen selbst, eine besondere Bedeutung zu. Die Psychoedukation aller primär und sekundär Betroffenen ist besonders hervorzuheben, die Dynamik des traumatischen Geschehens muss mit einem Höchstmaß an Transparenz vermittelt werden. 3) An dritter Stelle steht die (Re-)Aktivierung, Förderung und Stützung von sozialen Schutz- und Unterstützungssystemen (familiärer, beruflicher und sonstiger Art). Die Gemeinschaft soll unter so wenig Fremdeinfluss wie möglich darin unterstützt werden, sich zu reorganisieren, sich als funktionsfähig zu erleben und Bewältigungskompetenzen zu mobilisieren. Klinische Intervention: 4) An vierter Stelle im Maßnahmenkatalog stehen psychodiagnostische und psychotherapeutische Methoden, mit Stabilisierungs- und Distanzierungstechniken für die Akutphase, mit strukturierten und supervidierten Gruppennachbesprechungen, mit Mitteln des Screenings zur Identifikation besonders belasteter Personen, mit den Mitteln der Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe, und schließlich mit den Möglichkeiten klinischer Interventionen mit psycho- und ggf. pharmakotherapeutischen Mitteln. 2.5.1 Einrichtung eines psychosozialen Netzwerks Pläne für den Katastrophenfall regeln im Wesentlichen die Organisation von Evakuierung, Rettung, Bergung, medizinische und notfallpsychologische Erstversorgung; psychologische Erst- und Nachbetreuung wird in den letzten Jahren zunehmend in die Überlegungen einbezogen. Aus einer organisationspsychologischen Sicht müssen während der ersten Phase des Katastrophenmanagements verschiedenste Dienste und öffentliche Entscheidungsträger auf unterschiedlichen regionalen, überregionalen, nationalen und ggf. auch auf internationaler Ebene mobilisiert, vernetzt und mit klaren Richtlinien und Kompetenzen ausgestattet werden. Über die besonderen Anforderungen und Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe berichten z. B. Bowenkamp (2000) und Teegen (2004). Psychosoziale Hilfe muss in einem organisierten und strukturierten Rahmen stattfinden. Der Erfolg aller psychosozialer Hilfsmaßnahmen wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell und wie erfolgreich es gelingt, ein kompetentes, handlungsfähiges und entscheidungsbemächtigtes Krisenmanagement zu etablieren, und wie gut es diesem Krisenmanagement gelingt, alle beteiligten Gruppen zu integrieren und der Aufgabe der Katastrophenbewältigung unterzuordnen (Call & Pfefferbaum, 1999; Gillespie & Murty, 1994; Hodgkinson & Stewart, 1998). Koordination und Kooperation aller beteiligten gesellschaftlichen Gruppen und Kräfte – Rettungsdienste, Polizei, Gesundheitssystem, Administration, u. U. Armee/Bundeswehr und Technisches Hilfswerk und nicht zuletzt die Medien – werden immer wieder angemahnt. Im Kontrast dazu wird die Fachliteratur z. Z. noch von Erfahrungsberichten, Vorschlägen und Mahnungen dominiert, während kontrollierte Studien über organisationspsychologische Strategien für ein gelungenes Krisenmanagement weitgehend fehlen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung für die mittel- und langfristigen Auswirkungen einer Katastrophe auf die Psyche der Betroffenen, dass diese Maßnahmen so A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine schnell und so reibungslos beginnen können, wie die Katastrophensituation es zulässt. Es wurde bereits betont, dass einer der entscheidenden Faktoren des traumatischen Geschehens das Erleben von massivem Kontrollverlust und Hilflosigkeit ist. Zügig anlaufende und reibungslos durchgeführte Hilfsmaßnahmen vermitteln Kompetenz, Schutz und wiederkehrende Sicherheit. Kompetenz und Sicherheit kann der Einzelne, der an den Hilfsmaßnahmen egal auf welcher Ebene beteiligt ist, aber seinerseits nur dann vermitteln, wenn er seine eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielräume kennt, sich der Unterstützung seiner Weisungsgeber sicher sein kann und außerdem ausreichend auf die Belastungen der Katastrophensituation vorbereitet ist (Call & Pfefferbaum, 1999; Gillespie & Murty, 1994; Hodgkinson & Stewart, 1998). Katastrophenpläne variieren, wie es in der Natur der Sache liegt, je nach den Umständen sehr stark. Zu den Aufgaben des Psychologen und entsprechend geschulter Mitarbeiter in den ersten Stunden und Tagen gehört es, abhängig von der Katastrophensituation Personengruppen unterschiedlicher Belastungsstärke zu identifizieren und die Anzahl betroffener Personen, insbesondere in der Hochrisikogruppe, abzuschätzen. Ausgehend davon müssen Art und Umfang von Betreuungsmaßnahmen geplant, benötigtes Personal abgeschätzt, Kosten kalkuliert und Finanzierungspläne erstellt werden. So weit als möglich werden bereits jetzt nicht nur die kurz- sondern auch die mittel- und langfristigen Maßnahmen abgeschätzt. So früh wie möglich sind geeignete Räumlichkeiten für Information, Versammlung und Gruppenbetreuung zu beschaffen. Es ist umgehend Kontakt zu lokalen und externen Experten aufzunehmen, ein psychosoziales Krisenteam ist zu rekrutieren und in die Arbeit einzuweisen (Teegen, 2004). Neben diesen eher organisationspsychologischen Aufgaben steht in der ersten Phase der Katastrophennachsorge natürlich die psychische Erste Hilfe im Vordergrund. Besonders betroffene Personen müssen identifiziert und zunächst mit den Mitteln der Direktintervention, später mit denen der Psychoedukation und gegebenenfalls mit klinischen Mitteln betreut werden (Bowenkamp, 2000). Diese Aspekte werden später vertieft. Dem ebenfalls bereits in der Akutphase beginnenden Informationsmanagement innerhalb des Netzwerks und nach außen ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Das psychosoziale Netzwerk ist als die zentrale Organisationsstruktur der psychosozialen Katastrophennachsorge zu verstehen, und vermutlich entscheidet sich bereits in der ersten Phase nach der Katastrophe, wie erfolgreich die weitere Arbeit sein kann. Der gesamte Prozess der Katastrophenbewältigung baut auf der Kompetenz und der Vertrauenswürdigkeit auf, die während der initialen Phase nach außen vermittelt werden kann. In den anschließenden Wochen, Monaten und unter Umständen Jahren müssen Betreuungsmaßnahmen geplant, angeleitet und supervidiert werden; Schulungen von Mitarbeitern, deren Betreuung und Supervision sind zu leisten; Belastungsund Risikoentwicklungen sind fortlaufend zu beobachten, besondere Ereignisse und Entwicklungen sind zu antizipieren (Jahrestage, Gerichtsprozesse, politische und mediale Nachwirkungen) und mit den entsprechenden psychosozialen Mitteln und Möglichkeiten zu beantworten. 2.5.2 Informationsmanagement und Psychoedukation Ob es gelingt, ein psychosoziales Netzwerk zu organisieren, das für funktionsfähig und vertrauenswürdig gehalten wird, hängt in entscheidendem Maße davon ab, von wel- 39 40 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine cher Güte die eingerichteten Kommunikationsstrukturen und Informationen sind. Der Informationsbedarf nach Großschadenslagen ist bei allen betroffenen und beteiligten Gruppen massiv. Die wichtigsten Regeln für eine gelungene Krisenkommunikation nach Teegen (2004) sind: Krisenkommunikation muss klar, verlässlich und eindeutig sein, sie muss schnell und unmittelbar einsetzen, und sie muss andere in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Mehr aus der Sicht der Betroffenen und Angehörigen betrachtet ist Information ein Mittel der Prävention und langfristig betrachtet eine wichtige Grundlage für die Bewältigungsarbeit. Dazu müssen Betroffene in die Lage versetzt werden, sich mit geringem Aufwand in den einzelnen Phasen nach der Katastrophe ihren Bedürfnissen entsprechend mit vorbereitetem Wissen zu versorgen. Aus therapeutischer Sicht sollen die geschaffenen Informationsstrukturen es ermöglichen, auch langfristig in Kontakt mit Betroffenen bleiben zu können, um z. B. frühzeitig auf ungünstige Entwicklungen aufmerksam zu werden und intervenieren zu können. Call-Center und Hotline. Im Einzelnen bedeutet das, dass unmittelbar nach Bekanntwerden des Notfalls ein Call-Center und eine Hotline einzurichten sind. Hier fließen alle Informationen zusammen und werden sowohl innerhalb des Netzwerks verteilt als auch der betroffenen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Aufbereitung der Information erfolgt kontinuierlich und durch entsprechend geschulte Mitarbeiter, immer in enger Kooperation mit der Einsatzleitung. Bei der Auswahl der Mitarbeiter ist an die ethnische Zusammensetzung der Auskunft Suchenden zu denken, um sprachliche und kulturelle Barrieren nicht zum zusätzlichen Stressor werden zu lassen. Jeder Mitarbeiter, der direkten Kontakt zu Betroffenen oder zur Öffentlichkeit hat, muss über ein entsprechendes Maß an sozialen Kompetenzen verfügen und auf die Besonderheiten traumatischer Ereignisse vorbereitet sein. Er muss gleichzeitig in der Lage sein, klar und kompetent Auskunft zu geben, Verlässlichkeit auszustrahlen, Verständnis und Trost zu vermitteln und Geduld in komplizierten Interaktionen aufzubringen. In der Akutphase nach der Katastrophe muss die Hotline 24 Stunden am Tag erreichbar sein; in den Monaten nach der Katastrophe ist eine Hotline eine wichtige Möglichkeit, um fortlaufend Betreuungs- und Unterstützungsangebote anbieten zu können. Ein Beispiel für die Einrichtung eines Call-Centers inklusive Überlegungen zur Bedarfsplanung findet sich bei Kemmler (2003), der Autor behandelt hier den Fall einer Flugzeugkatastrophe. Von Bedeutung ist das Timing der Informationsvermittlung. Teegen (2004) empfiehlt, erste Informationen innerhalb der ersten halben Stunde bekannt zu machen, diese Aufgabe sollte von einer hochrangigen und im Umgang mit den Medien erfahrenen und souveränen Person übernommen werden. Ein Beispiel für inkompetente und in ihren Folgen schädigende Krisenkommunikation nach einem Flugzeugabsturz mit über 200 Toten beschreibt Cohen (1997). Passagierlisten lagen in diesem Fall erst 24 Stunden nach dem Unglück vor, ein Vertreter der Fluglinie wandte sich erst 2 Tage nach dem Unglück an die betroffenen Angehörigen, und erst nach Tagen wurde mitgeteilt, dass bis zur Bergung der Leichen viel Zeit vergehen würde. Die unmittelbaren und nachvollziehbaren Folgen einer solchen Form von Informationsmanagement gegenüber den Betroffenen sind Hilflosigkeit, Ärger, Misstrauen und insgesamt eine Steigerung der ohnehin schon extremen emotionalen Belastung. Neue Medien und Technologien. Aus verschiedenen Blickwinkeln wird auch über den Einsatz neuer elektronischer Medien und Technologien diskutiert. Hierzu kann z. B. die A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Einrichtung einer zentralen Datenbank zur Erfassung und Identifizierung von Opfern und Angehörigen gehören. Auf der Seite der Vorteile stehen Möglichkeiten der direkten Kontaktaufnahme und der Planung von Langzeitbetreuungsmaßnahmen sowie die schnelle Verfügbarkeit transparenter und konsistenter Information auf den verschiedenen Organisationsebenen. Auf der Seite der Nachteile stehen die datenschutzrechtlichen Interessen der Betroffenen, deren erhöhte Empfindlichkeit nach einer Katastrophe gegenüber Eingriffen in die Persönlichkeitssphäre sowie die Frage nach dem Risiko eines gezielten, technisch nicht zu verhindernden Missbrauchs der Datenquellen. Kompetente informationstechnologische Planung und Unterstützung vorausgesetzt, kann das Internet als flexibles Kommunikationsmedium mit Betroffenen genutzt werden. Über Mailing-Listen, Newsletter und einer nur für das betreffende Ereignis eingerichteten Internet-Site können allgemeine Informationen und Hilfsangebote verteilt werden. Mit Einschränkungen ist auch eine psychosoziale Beratung über E-Mail- oder Chat-Kontakte denkbar. Dabei können möglicherweise Betroffene erreicht werden, die sich einer direkten Kotaktaufnahme verschließen. Möglichkeiten des Missbrauchs sollte mit geeigneten Schutzmechanismen wie passwortgeschützten Zugängen begegnet werden. Vorteilhaft an diesem Ansatz ist einerseits die Möglichkeit, niedrigschwellige Hilfsangebote verfügbar machen zu können (Teegen, 2004), andererseits kann der Personal- und Kostenaufwand für die Bereitstellung und Verteilung von Information gedrosselt werden. Gerade auch der bislang nur unzulänglich abgedeckte Bereich der Evaluation könnte von den Möglichkeiten des Internets profitieren, sei es über den unkomplizierten und kostengünstigen Download von Fragebögen, sei es in der Form von mittlerweile ausgereiften Online-Erhebungsinstrumenten. Entsprechende Dienste bietet z. B. das Zentrum für Evaluation und Methoden der Universität Bonn an (www.zem.uni-bonn.de, E-Mail [email protected]), kommerzielle Entwicklungstools können über SPSS, Inc. (www.spss.com/de, E-Mail [email protected]) bezogen werden. Über Erfahrungen mit dem Internet als Hilfsmittel für die Rekrutierung und Befragung berichten z. B. Teegen und Grotwinkel (2000). Nachteile des Internet als Informationskanal sind in den bestehenden kulturellen, sozialen und Altersbarrieren zu sehen – das Internet ist für viele Menschen derzeit noch ein Stressor mit ganz eigener Bedeutung, und auch die drohende Spaltung der Welt in einen elektronischen und einen nicht-elektronischen Teil wird von verschiedenen Gesellschaftswissenschaftlern mit Sorge beobachtet (z. B. Grahame, Laberge & Scialfa, 2004; Lin, 2003; Morrell, Mayhorn & Bennett, 2000); es finden sich aber auch optimistischere Sichtweise (z. B. Bucur, Renold & Henke, 1999; Loges & Jung, 2001). Wünschenswert wäre es aus all diesen Gründen, einen Psychologen mit Zusatzqualifikation in Datenbank-, Anwendungs- und Webentwicklung in die Personalplanung einzubeziehen und mit den nötigen Entscheidungskompetenzen auszustatten. Dem Ziel, gleichermaßen zielgruppen- und bedarfsgerechte, lauffähige und verantwortliche Software-Lösungen zu implementieren, sie während der Dauer der Betreuungsmaßnahmen zu pflegen und zu aktualisieren, käme man auf diesem Weg sicher näher (J. Beyer, 20.04.2005, persönliche Mitteilung). Kommunikation mit den Massenmedien. Von besonderer Wichtigkeit für ein angemessenes Informationsmanagement ist die Kommunikation mit den Medien. An erster 41 42 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Stelle steht die strikte Abschirmung von Betroffenen und Angehörigen. Berichte über das Verhalten von Medienvertretern wie z. B. nach dem Flugzeugabsturz von Lockerbie beschreiben, in welchem Ausmaß Betroffene durch unverhältnismäßig unsensibles Verhalten zusätzlich belastet und retraumatisiert werden (Deppa & Sharp, 1991). Schwere zusätzliche psychische Belastungen durch Presse und Medien für die Betroffenen des Grubenunglücks von Borken schildern Mathes, Gärtner und Czaplicki (1991). Systematisch untersucht und belegt wurden Zusammenhänge zwischen Verhalten von Medienvertretern und Retraumatisierungen von Betroffenen z. B. von McFarlane (1986b). Die sogenannte Informationspflicht – die von bestimmten Vertretern der Medien als Sensationsinszenierung mit unfreiwillig Mitwirkenden missverstanden wird – hat sich unbedingt den Interessen der Betroffenen unterzuordnen. Es hat sich bewährt, alle Aufgaben des direkten Medienkontakts an einen oder einige wenige spezifisch geschulte und autorisierte Sprecher zu delegieren und jeden Kontakt schriftlich vorzubereiten. Aufgaben und Ziele von Medienkontakten bestehen nicht nur darin, Informationen über aktuelle Entwicklungen und Kenntnisstände weiterzuleiten. Die seriösen Medien haben ihrerseits ein Interesse darin, im Umgang mit den Ereignissen beraten zu werden. Dieser Beratungsbedarf kann, gemeinsam mit dem journalistischen Fachwissen und einem unter Umständen auch längerdauernden Medieninteresse, zu edukativen Informationen der Bevölkerung genutzt werden (Teegen, 2004). Medienkontakte sind Teil der Arbeit am psychosozialen Netzwerk, nicht zuletzt durch die Möglichkeit, ein überregionales Gesamtklima nach der Katastrophe zu gestalten. Bezogen auf die Art und den Inhalt von Informationen ist auf eine verantwortliche und sachliche Berichterstattung hinzuarbeiten. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die Gestaltung visueller Informationen gerichtet werden. Untersuchungen der Berichterstattung über den Terroranschlag auf das World-Trade-Center und anderer terroristischer Gewalttaten belegen, dass wiederholte Bilder des Katastrophengeschehens bei empfänglichen, in ihrer Widerstandskraft geschwächten oder bereits traumatisierten Menschen Angstreaktionen und Intrusionen auslösen können (Silver et al., 2002; Slone, 2000). Nach der Tsunami-Katastrophe vom Dezember 2004 berichteten Angehörige von Personen, die in der Krisenregion vermisst waren, dass sie oft stundenlang vor dem Fernseher saßen, um in Nachrichtensendungen neue Informationen über die Situation ihrer vermissten Nahestehenden zu bekommen. Dabei wurden sie permanent überflutet mit Bildern von Stränden mit Leichen, die sie später nicht mehr losließen (eigener Kontakt mit Angehörigen im Rahmen einer ZDF-Spendengala für Tsunamiopfer). Über das Risiko von Journalisten, durch die Konfrontation mit traumatischen Eindrücken sekundär traumatisiert zu werden, berichten z. B. Teegen und Grotwinkel (2000) und von Siebenthal (2003). Psychoedukation. Die Grenzen zwischen Informationsmanagement und Psychoedukation sind fließend, die Ziele überschneiden sich zu einem guten Teil. Psychoedukation soll Betroffene in die Lage versetzen, die Auswirkungen und Folgen eines traumatischen Ereignisses verstehen und spätere Entwicklungen einschätzen zu lernen. Ein Zitat aus dem Bericht eines Feuerwehrmannes, der bei der Bergung der Opfer des Zugunglücks von Eschede im Einsatz war: „Die Bilder und Erlebnisse von Eschede werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Vieles von den Vorhersagen der Psychologen ist auch bei mir eingetreten. Es war gut, schon im Vorfeld über die möglichen Reaktionen informiert worden zu sein.” (Koordinierungsstelle Einsatznachsorge, 2002) A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Der Bericht dieses Feuerwehrmanns enthält, übersetzt in psychologische Termini, die Aussage, dass die psychologische Vorbereitung subjektiv geholfen hat, ein Gefühl von Kontrolle und Voraussehbarkeit aufbauen und aufrechterhalten zu können. Psychoedukation ist Prävention, und hat zum Ziel, Traumatisierungen, Retraumatisierungen und die Auswirkungen von sekundären Stressoren einzudämmen. Im Zentrum der Psychoedukation steht die Botschaft, dass posttraumatischer Stress eine natürliche Reaktion nach einer Katastrophe ist. Psychoedukation informiert über typische Erlebnisprozesse, über mögliche emotionale, kognitive, körperliche und Verhaltensänderungen, über interpersonelle und berufliche Schwierigkeiten nach einer Katastrophe, sie klärt allgemein über Zusammenhänge und Prozesshaftigkeiten auf. Sie informiert gleichermaßen über günstige Verhaltensweisen, die die posttraumatische Belastungsstärke senken können, und über solche, die als problematisch betrachtet werden. Sie gibt auch Hinweise, wann posttraumatische Belastungen eine kritische Grenze erreichen oder ungünstige Verhaltensweisen das Risiko einer Chronifizierung provozieren. Konsequenterweise bietet sie den Betroffenen auch einen Überblick über Hilfsangebote und Anlaufstellen und informiert über Methoden, die sich weniger gut bewährt haben. Psychoedukation berücksichtigt des Weiteren die besonderen Aufklärungsbedürfnisse einzelner Personengruppen. Auch ein Briefing der Betroffenen zum Umgang mit den Medien sollte Bestandteil der Psychoedukation sein (Maercker, 2003a, b; Teegen, 2004). Mittel zur Umsetzung von Psychoedukation sind Versammlungen, aufsuchende Direktbetreuung und schriftlich aufbereitete Informationen, z. B. über Handouts und Rundschreiben. Rundschreiben oder „Newsletter“ haben sich bewährt, da hier die Forderung nach niedrigschwelligen Hilfsangeboten in besonderem Maß erfüllt ist. Mit Newslettern können auch Personen erreicht werden, die andere Arten des Kontakts nicht annehmen (Teegen, 2004). Aus einer Arbeit von DeWolfe (2000) geht hervor, dass viele Betroffene davon ausgehen, keine psychologische Unterstützung zu benötigen, schriftliche Informationen werden jedoch als sehr hilfreich bewertet. Der Einsatz von Mitteln der Psychoedukation ist nicht auf die Phase unmittelbar nach der Katastrophe beschränkt, Psychoedukation sollte vielmehr antizipierend auf aktuelle Entwicklungen nach einer Traumatisierung abgestimmt werden und darauf reagieren können (siehe dazu Thema Elternbriefe im Kapitel B 4 zum Erfurter Amoklauf). Newsletter können als breit angelegtes und offenes Forum verstanden werden. Neben psychoedukativen Informationen und Kontaktlisten können Berichte über die Planung von Jahrestagen und Gedenkstätten einen Platz finden, Betroffene können über dieses Medium persönliche Erfahrungen wiedergeben (Hodgkinson & Steward, 1998). Kostenfrei nutzbare Informationsblätter und Broschüren stellen z. B. das Amerikanische Rote Kreuz (American Red Cross, ARC, www.redcross.org) und das Nationale Zentrum für Posttraumatische Belastungsstörungen in den USA (National Center for Posttraumatic Stress Disorder, NCPTSD, www.ncptsd.org) zur Verfügung, das Material basiert überwiegend auf dem aktuellen Forschungsstand. Bei guter didaktischer Qualität werden unterschiedliche Katastrophenszenarios abgedeckt, die besonderen Bedürfnisse verschiedener Betroffenengruppen werden berücksichtigt; für Migrantengruppen gibt es gesonderte Materialien in den jeweiligen Heimatsprachen. Ärzte, Psychologen, Therapeuten und andere Berufsgruppen, die nach Großschadensereignissen an Betreuung und Nachsorge beteiligt werden, können sich über die Internatio- 43 44 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine nale Gesellschaft für Psychotraumatologie (International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS, www.istss.org) mit Informationen, Leitlinien und Behandlungsprogrammen versorgen (Teegen, 2004). 2.5.3 Psychosoziale Ressourcen und Unterstützungssysteme Die psychosoziale Betreuung nach Großschadensereignissen zielt darauf ab, vorhandene Ressourcen einer betroffenen Gemeinschaft und die Bewältigungskraft der Betroffenen durch pragmatische und niedrigschwellige Hilfen zu stärken. Dazu müssen zunächst vorhandene psychosoziale Ressourcen identifiziert und (re-)aktiviert werden. In Anlehnung an das von Green und Kollegen (2003) vorgestellte Modell der umgekehrten Pyramide muss auf allen gesellschaftlichen Ebenen (Regional- und Kommunalpolitik, Gesundheitswesen und karitative Vereinigungen, religiöse und soziale Gemeinschaften, nachbarschaftliche Gemeinschaften und Familien) festgestellt werden, welche psychosozialen Strukturen vor dem Unglück bestanden haben, in welchem Zustand sie waren, und in welchem Zustand sie jetzt, nach der Katastrophe sind. Situationsanalysen. Wie in einem früheren Abschnitt belegt wurde, haben der Schaden an kollektiven Ressourcen, der Verlust an sozialen Strukturen und an sozialer Einbettung nach einer Katastrophe deutlich negative Auswirkungen auf die Bewältigungschancen der Betroffenen. Als Leitideen seien hier Entwurzelung und der Verlust der Heimat als Ausdruck für die verletzten Bedürfnisse nach Schutz in der Gemeinschaft, Sicherheit und emotionaler Geborgenheit genannt. Der erste wesentliche Schritt zur Wiederherstellung psychosozialer Ressourcen ist eine Diagnostik der Situation nach der Katastrophe, und zwar sowohl im Sinn einer objektiven als auch einer subjektiven Schadensanalyse. Analog zu der Erkenntnis, dass das objektive traumatische Geschehen nicht zu hundert Prozent deckungsgleich mit dem individuellen Trauma-Erleben ist, gilt auch hier, dass die materielle Bedeutung an zerstörtem kollektiven Lebensraum eine andere sein kann als die ideelle und symbolische Bedeutung. So mag für eine Gruppe von Betroffenen die Zerstörung der örtlichen Sportanlagen eine besonders negative Bedeutung haben, eine andere mag den Verlust der Gotteshäuser als besonders belastend empfinden, während alle sich über die Bedrohung im Klaren sind, die von der Zerstörung des nächstgelegenen Krankenhauses ausgeht. Die materielle, die ideelle und die symbolische Wertigkeit sind nicht zwangsläufig identisch – Situationsanalysen erfordern keine Expertenurteile von oben herab, die Schadenslage sollte durch Ortskundige exploriert werden, und im Idealfall sind Gruppen von Betroffenen strukturiert danach zu befragen (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe,1992; Teegen, 2004). Situations- und Schadensanalysen sind nicht als Status-, sondern als Prozessdiagnostik zu verstehen und mit der sich entwickelnden Lage in den Monaten und Jahren nach einer Katastrophe abzugleichen. Vorhandene Hilfssysteme aktivieren. So weit als möglich sollten vorhandene Hilfssysteme und psychosoziale Strukturen mobilisiert, unterstützt und in die besonderen Anforderungen einer Katastrophennachsorge unterwiesen werden. Als ungünstig bewertet werden muss, wenn bestehende orts- und milieukundige Hilfssysteme übergangen und von neu installierten Hilfsorganisationen bevormundet werden. Der Leitgedanke der Arbeit am System psychosozialer Ressourcen soll Hilfe zur Selbsthilfe sein, damit dem zentralen Erlebnis des traumatischen Kontrollverlusts und der kollektiven A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Hilflosigkeit ein adäquates Gegengewicht der Selbstbestimmung und Bewältigungskompetenz entgegengesetzt werden kann. Im Optimalfall bedeutet das, dass ein Team aus lokalen und auswärtigen Experten die betroffene Gemeinschaft in der Initialphase bei der Planung, Organisation und Durchführung von Betreuungskonzepten berät, Briefings und Trainings durchführt und sich aus dem unmittelbaren Geschehen wieder zurückzieht, sobald die benötigten Betreuungsstrukturen eingerichtet sind (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992; Young & Stein, 1994). Auch das umstrittene Debriefing kann Teil dieser initialen Katastrophennachsorge sein, solange es von qualifizierten Therapeuten durchgeführt und als Teil eines breit angelegten Nachsorgekonzepts und nicht als „Schnellheilmittel“ verstanden wird. Auch wenn die zeitnahe Rekonstruktion der traumatischen Erfahrungen und vor allem die Begrenzung auf nur eine Sitzung kritisch beurteilt werden muss (Bengel, 2003), kann ein Debriefing als Beginn einer langen Reihe von therapeutischen Maßnahmen als sinnvoll, ethisch gerechtfertigt und wirksam angesehen werden (Boscarino, Adams & Figley, 2005). Insgesamt ist zum hier vorgestellten Konzept der psychosozialen Nachsorge und Selbsthilfe allerdings kritisch anzumerken, dass die Konzentration auf die Reaktivierung vorhandener Hilfsstrukturen nicht als Aufforderung verstanden werden darf, sich therapeutischerseits aus jedem Engagement zurückzuziehen und unbewiesenen „Selbstheilungskräften“ das Feld zu überlassen. Es gilt, ein Maß dafür zu finden, wie die nötige therapeutische und psychosoziale Begleitung sichergestellt werden kann, ohne gleichzeitig durch Überengagement Betroffene in die Rolle hilfloser Opfer zu drängen, denen keine eigene Gestaltungsfähigkeit ihres Lebens (mehr) zugetraut wird. Ziele und Schwerpunkte. Ziel all dieser Maßnahmen ist es, natürliche soziale Schutzund Unterstützungssysteme (familiärer, beruflicher und sonstiger Art) zu reaktivieren, zu fördern und für die besonderen Anforderungen einer Katastrophenbewältigung zu trainieren. Angestrebt wird, ein Gefühl für Kontinuität und Einbettung in eine Gemeinschaft aufzubauen bzw. wiederherzustellen. Um die Dynamik der Bewältigung und der Wiederherstellung positiv zu beeinflussen, sollten deshalb natürlich gewachsene Gruppen und Nachbarschaftsverbände als untrennbare Einheit betrachtet werden. Über die naheliegenden Schutz- und Unterstützungsfunktionen hinaus, die vertraute Menschen untereinander übernehmen können, kann sich eine Stärkung des Gruppenbewusstseins positiv bemerkbar machen. Das kann z. B. darin bestehen, den Gedanken eines gemeinsamen Ziels zu vermitteln, oder aber auch darin, konkrete Aufgaben an Gruppen von Betroffenen zu delegieren und ihnen damit die Erfahrung von gemeinschaftlicher Bewältigungskompetenz zu vermitteln. Als Mittel zur Realisierung bieten sich auch hier Informationsmaßnahmen, Psychoedukation und Trainingsmaßnahmen an, es sollte aber wie schon erwähnt strikt darauf geachtet werden, die Selbstbestimmung der ortsansässigen Gruppen zu maximieren. Obwohl bereits belegt wurde, wie schädlich sich eine rigide „Zurück zum Alltag, sprechen wir nicht mehr darüber“-Strategie auf die posttraumatische Gesamtbelastung auswirkt, ist eine derartige Auffassung an dieser Stelle teilweise zu relativieren. Es ist zwar nicht wünschenswert, das Trauma aus dem Alltag auszuschließen und zu versuchen, seine Existenz zu verleugnen. Genau so wenig wünschenswert ist es aber auch, eine Rückkehr in den Alltag zu vermeiden oder den Alltag um das Trauma herum zu organisieren und auf diesem Weg den Bruch in der eigenen Biografie noch zu vertie- 45 46 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine fen. Es ist stattdessen wünschenswert und für den Erholungsprozess förderlich, wenn betroffene Katastrophenopfer ermutigt werden, sich schrittweise wieder ihren alltäglichen Beschäftigungen zuzuwenden und z. B. ihre beruflichen Tätigkeiten wieder aufzunehmen, so bald das möglich ist. Bemüht sich ein Betroffener, das Trauma im Kontakt mit Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen nicht als Tabu zu behandeln, liegen in einer Rückkehr zum Alltag verschiedene Chancen. Betroffene können über die Beobachtung und den sozialen Vergleich feststellen, dass andere Betroffene die gleichen oder ähnlichen Probleme haben, wodurch das Risiko einer Bewegung in die „Innere Emigration“ gemindert wird. Ebenfalls hilfreich kann es sein, die CopingBemühungen anderer Betroffener zu beobachten und in den eigenen Bewältigungsprozess zu übernehmen (Meichenbaum, 1994). Und zuletzt signalisiert eine Wiederaufnahme der alten Lebensgewohnheiten eben auch die teilweise Rückkehr von etwas, was durch die Katastrophe zunächst verloren gegangen ist – Normalität, wenn auch Normalität in einer für die Betroffenen schmerzhaft veränderten Welt. Betroffene müssen in die Lage versetzt werden beides, die Rückkehr der Normalität und die bleibenden Veränderungen, zu erkennen und zu artikulieren. Beides gehört zur Neuordnung der eigenen Welt, die der einzelne Betroffene leisten muss. Die Arbeitsgruppe um Pennebaker hat maßgeblich zu der Erkenntnis beigetragen, dass Disclosure, also Offenheit und Offenlegung im Umgang mit traumatischen Ereignissen in dieser Hinsicht einen zentralen Stellenwert hat. Disclosure fördert die Kontaktbereitschaft mit der sozialen Umwelt, und es sorgt dafür, dass über den einsetzenden Monolog und Dialog eine fortschreitende verbale Verarbeitung der traumatischen Erfahrungen in Gang kommt. 2.5.4 Klinisch-psychologische Interventionsmaßnahmen Der implizite Leitgedanke in allen bisher vorgestellten psychosozialen Hilfsmaßnahmen ist derjenige, Katastrophenopfer intensiv und sachgerecht in einem sub-klinischen Rahmen zu betreuen und vorhandene Bewältigungsmöglichkeiten zu mobilisieren, um nicht klinisch behandeln zu müssen. Aus dieser Vorgehensweise darf nicht der Schluss gezogen werden, klinisch-psychologische Maßnahmen könnten grundsätzlich und in jedem Einzelfall überflüssig gemacht werden, bzw. die Quote an klinisch sich auffällig entwickelnden Personen sei ein Indikator für das Gelingen oder Scheitern eines psychosozialen Betreuungsprojekts. Die epidemiologische Forschung innerhalb der Psychotraumatologie zeigt, dass das Wechselspiel aller beteiligter Faktoren erheblich komplexer ist, und dass sich bestimmte Randbedingungen wie z. B. wirtschaftliche Belastungen der Betroffenen mit therapeutischen Mitteln nicht kontrollieren lassen (van Etten & Taylor, 1998; Orner & Schnyder, 2003; Paton et al., 2002). Risiko- & Belastungsscreenings. Das kurz-, mittel- und langfristige Ausmaß der posttraumatischen Belastung hängt wesentlich von Faktoren ab, die bereits ausführlich erläutert wurden und hier nur kurz wiederholt werden sollen (Maercker, 2003b): • Anzahl an Todesopfern und Verletzten, Art und Schwere von Verstümmelungen und Verletzungen. • Art, Ausmaß und Ausdehnung der Zerstörungen, im Verhältnis zum Grad an Intaktheit und zur Verfügbarkeit von Ressourcen in umliegenden Gebieten. A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine • Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit von sozialen, psychosozialen und medizinischen Hilfssystemen (wann und wie schnell sind professionelle Hilfsorganisationen vor Ort; zwingt die Situation zur Triage oder werden alle Betroffenen versorgt?). • Umfang, in dem das Ereignis mit menschlicher Nachlässigkeit, Vorsatz oder Böswilligkeit assoziiert werden kann (Natur- vs. technische Katastrophen vs. menschliche Gewalt). • Zusammenspiel zwischen dem individuellen Kontakt mit traumatischen Stressoren und dem subjektiven Erleben von Bedrohung und Kontrollverlust (geringer vs. ausgedehnter Kontakt – niedrige vs. hohe erlebte Bedrohung). • Einwirkung sekundärer Stressoren, die sich kausal auf der psychosozialen und sozioökonomischen Ebene aus einer Katastrophe ergeben können (Belastungen in Partnerschaft/Familie und Beruf, finanzielle Belastungen, Arbeitsplatzverlust). • Individuelle/differentielle Faktoren, auch auf Persönlichkeitsebene (Alter, Geschlecht, mit Ängstlichkeit und Kontrollüberzeugungen assoziierte Traits) haben einen vergleichsweise schwachen, aber messbaren zusätzlichen Einfluss. • Es gilt die Faustregel, dass die Summe an identifizierbaren Stressoren ihrerseits einen eigenständigen Stressor darstellt. Im Fall geringer Ausprägungen in diesen Merkmalen oder einer geringen Gesamtmenge an Stressoren können vorübergehende Stressreaktionen angenommen werden, der Aufwand an ratsamer psychosozialer Betreuung wird voraussichtlich gering bleiben. Im Fall von hohen Ausprägungen in einigen dieser Merkmale oder einer großen Menge an unterschiedlichen Stressoren muss von längerfristigen posttraumatischen Belastungen und einem entsprechend hohen Aufwand an Betreuung ausgegangen werden. Sowohl aus präventiven als auch aus therapeutischen Überlegungen heraus ergeben sich zwei Notwendigkeiten. Zum ersten ist es wünschenswert, Personen bezüglich ihres Risiko-Niveaus einzuschätzen, zum zweiten ist es ratsam, sich fortlaufend (und möglichst frühzeitig beginnend) Klarheit darüber zu verschaffen, welches Belastungsniveau bei Betroffenen oder Betroffenengruppen vorliegt. Formal betrachtet ist die Feststellung des Risiko-Niveaus eine status-diagnostische Aufgabe. Mit einer einmaligen Messung sollen solche Variablen möglichst vollständig abgeklärt werden, die zu einem Erkrankungsrisiko beitragen. Belastungsniveaus hingegen können und werden im Verlauf der Tage, Wochen und Monate nach einer Katastrophe variieren, so dass hier eine Verlaufs- oder Prozessdiagnostik mit kurz gehaltenen ScreeningInstrumenten angeraten ist, um einerseits Compliance-Probleme, andererseits Methodenartefakte halbwegs befriedigend zu kontrollieren. Um die Begriffe Risikoscreening einerseits und Belastungsscreening andererseits eindeutig zu handhaben, ist es ratsam, eine kurze Definition einzuführen. In der psychotraumatologischen Literatur ist es üblich, allgemein nur von Risikoscreenings zu sprechen (Norris et al., 2002; Teegen, 2004). Unter dem Begriff „Risiko“ werden alle Variablen subsummiert, die schwere und langanhaltende traumatische Reaktionen begünstigen, also (a) Merkmale des objektiven Geschehens, (b) Merkmale der subjektiven Belastung, (c) sekundäre Merkmale Betroffener wie Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Absicherung etc. In Abgrenzung davon macht es Sinn, Erhebungsinstrumente, die sich schwerpunktmäßig auf die Merkmale unter (b) konzentrieren, als „Belastungsscreenings“ zu bezeichnen und begrifflich hervorzuheben. 47 48 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Zu Risikoscreenings (im allgemeinen Verständnis) werden in der Literatur unterschiedliche Vorschläge gemacht (Basoglu et al., 2001; Breslau, Peterson, Kessler & Schultz, 1999; Brewin et al., 2002; Chou, Su, Ou-Yang, Chien, Lu & Chou, 2003; Meltzer-Brody, Churchill, Davidson, 1999; Norris, 1990). Die Ansätze variieren von Erhebungen soziodemographischer Variablen über Erhebungen zum subjektiven traumatischen Erleben der Katastrophe und zur Registrierung von objektiven Angaben zum Ereignis und dessen Auswirkungen. Alle diese Aspekte finden sich in verschiedenen Mischungen und Gewichtungen, sowie mit unterschiedlicher Ausführlichkeit. Neben ad hoc entwickelten Itemsammlungen, die sich aus den Anforderungen der Situation ergeben, finden sich Vorschläge für standardisierte Instrumente, die sich thematisch eng an den Symptomprofilen für die Akute und die Posttraumatische Belastungsstörung orientieren. Als Beispiel sei zunächst das Trauma Screening Questionnaire (TSQ, Brewin et al., 2002) genannt, das sich auf ein Kurzscreening von Reaktionen posttraumatischer Belastung beschränkt und auf die Erhebung anderer Variablen verzichtet. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Chou et al. (2003), ergänzen ihren Screening-Fragebogen aber um einige Items zu den Symptomen einer Major Depression. Beide Verfahren sind nach dem engeren Verständnis zu den Belastungsscreenings zu zählen. Mit der Impact of Event Scale, revidierte Version (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998) und der Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS, Foa, Cashman, Jaycox & Perry, 1997; deutsch Ehlers, Steil, Winter & Foa, 1996) stehen bewährte Fragebögen in deutscher Bearbeitung zur Verfügung, die zwar zur Diagnostik der PTBS entwickelt wurden, die sich wegen ihrer Kürze aber auch als Screening-Instrumente anbieten. Basoglu et al. (2001) wählen einen breiteren, allgemeineren Ansatz. Neben Symptomen subjektiver traumatischer Belastung erfassen sie mit 28 Items verschiedene soziodemographische Merkmale und Merkmale der objektiven Trauamexposition. Mit dem Kölner Risiko-Index (KRI, Fischer, Bering, Hartmann & Schedlich, 2000) ist ein Instrument zum Risiko-Screening im deutschsprachigen Raum in Entwicklung, Adaptationen für unterschiedliche Einsatzzwecke sind vorgesehen bzw. ebenfalls in Arbeit (Fischer et al., 2000; Walter, 2003). Neben Symptomen von traumatischem und dissoziativem Erleben können mit diesem Instrument auch Situations- und soziale Randbedingen erhoben werden. Für die praktische Betreuung ergeben sich aus Risiko- und Belastungsscreenings zwei Ansatzpunkte. Zum ersten, und nahe liegender Weise, bieten Risiko-Screenings die Möglichkeit, denjenigen Gruppen und Personen, die ein hohes Erkrankungsrisiko haben, aktiv eine intensivere Unterstützung anzubieten (Orner & Schnyder, 2003; Paton et al., 2002). Mehr aus der gemeindepsychologischen Perspektive betrachtet bieten Screenings aber auch wesentliche Hinweise für die Gestaltung des sozialen Netzwerks sowie für die Instandsetzung psychosozialer Ressourcen. Low-risk-Betroffene können z. B. als freiwillige Hilfskräfte wichtige Beiträge zur Wiederherstellung des Gemeinwesens leisten, während High-risk-Betroffene je nach individueller Disposition eher mit leichteren Aufgaben betreut werden bzw. ganz von Hilfsaktivitäten freigestellt werden können. Was dabei dem einzelnen Betroffenen zuzutrauen und zuzumuten ist, kann letztlich nur mit Mitteln der psychologischen Diagnostik entschieden werden. Wünschenswert, aber wegen begrenzter personeller Kapazitäten wohl nur in seltenen Fällen umzusetzen, wäre auch, die anfallenden Daten fortlaufend nicht nur individualdiagnostisch, sondern auch gruppen- respektive inferenzstatistisch auswerten zu kön- A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine nen. Verlaufs- und Reaktionsmuster auf Individual- und auf Gruppenebene können nach Augenschein nur begrenzt erfasst werden, beinhalten aber u. U. für die Dynamik einer Katastrophenbetreuung wichtige Informationen, die andernfalls ungenutzt blieben. Zeitreihenanalysen, Faktoren- oder Clusteranalytische Verfahren, wie sie in gängiger Statistik-Software implementiert sind, bieten bei einem vergleichsweise geringen Aufwand an technischen Ressourcen weitreichende Möglichkeiten der Verlaufskontrolle, der Gruppendiagnostik, und natürlich der Modellbildung. Aktiv aufsuchende Betreuung. Besondere Sensibilität erfordert die Annäherung und Kontaktaufnahme mit Betroffenen. Die Fähigkeit Vertrauen zu fassen und der Glaube an die eigene physische und psychische Unversehrbarkeit der Betroffenen sind durch die Katastrophenerfahrung massiv gestört, eine massive Gegenregulierung durch ein Sich-verschließen ist in der Akutphase nur allzu verständlich. Viele Betroffene sind in der ersten Zeit außerdem zu planvollem Handeln nicht oder nur sehr schwer in der Lage (Maercker, 2003a; Pieper, 2003). Dem steht auf therapeutischer Seite das Ziel gegenüber, einen Kontakt so früh wie möglich anbieten und aufbauen zu können. Aus diesem Konflikt ergibt sich die Frage, ob es aus psychotherapeutischer Sicht besser ist, abzuwarten, aber Verfügbarkeit zu signalisieren, oder ob aktives Zugehen auf Betroffene das angemessene Mittel ist. Einige Antworten auf diese Fragen sollen den therapeutischen Handlungsspielraum genauer ausleuchten. Nach van der Ploeg und Kleijn (1989) war aktiv aufsuchende Betreuung unmittelbar nach der Befreiung aus einer terroristischen Geiselnahme ein wichtiger Prädiktor für gelingende Traumabewältigung. Einen ebenfalls positiven Zusammenhang zwischen aktiver Betreuung von Opfern und langfristig geringerer Symptombelastung belegen die Dokumentationen des Katastrophenmanagements nach dem Fährunglück der Herald of Free Enterprise vor Zeebrügge von 1987 (Dalgleish et al., 1996; Hodgkinson, 1990; Joseph et al., 1994; Quintyn et al., 1990). Bereits erwähnt wurde der Bericht von Orner (2003, zitiert nach Teegen, 2004) über die ablehnende Haltung von Rettungskräften, professionelle Helfer aufzusuchen. Maercker (2003a) betont die zentrale Rolle des Vertrauensaufbaus zwischen Betroffenen und Therapeuten. Notwendig ist es vor allem, die Sicherheits- und Schutzbedürfnisse der Patienten weitestgehend zu respektieren und im Idealfall zu antizipieren. Der Widerspruch zwischen dem Vorteil aktiv aufsuchender Betreuung und respektvoll-abwartender Zurückhaltung kann vom Therapeuten in der Katastrophenbetreuung letztlich nur durch ein professionelles Gespür für das richtige Timing aufgelöst werden (Maercker, 2003a, b; Teegen, 2004). Direktintervention – Begleitung & Unterstützung. Die therapeutische Arbeit beginnt je nach Sachlage bereits in der Akutphase während oder unmittelbar nach dem Ende einer Katastrophe. In dieser Phase geht es vor allem darum, den Betroffenen (Opfern, Angehörigen etc.) Schutz, Sicherheit und Kompetenz zu vermitteln und sie bei der Bewältigung notwendiger Aufgaben zu unterstützen. Hierzu zählt die Begleitung in Krankenhäuser, zu Gesprächen mit der Polizei oder zur Identifizierung von Verstorbenen. Neben praktischen Hilfestellungen ist Solidarität ein wichtiges therapeutisches Signal, das zur Wiederherstellung des Kontrollgefühls beitragen kann (Gschwend, 2002). Drei Aspekte sollen wegen ihrer Wichtigkeit besonders herausgestellt werden. Zum einen sind klare Informationen über den Verlauf einer Katastrophe und über die Umstände des Todes von nahestehenden Personen von großer Bedeutung. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Konfrontation mit traumatischen Eindrücken wie blutver- 49 50 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine schmierten Gepäck- oder Kleidungsstücken oder stark entstellter Toter während einer Identifizierung auf das unvermeidliche Minimum reduziert wird (Teegen, 2004). Und zuletzt ist es für Betroffene äußerst wichtig, in Würde von den Todesopfern Abschied nehmen zu können. Besonders problematische Bewältigungsprozesse sind hier immer dann zu erwarten, wenn eine Bergung aller Todesopfer oder ihre eindeutige Identifizierung durch die Umstände der Katastrophe verhindert wird (hier sei z. B. an das tragische Unglück des russischen U-Boots „Kursk“ erinnert). In jedem Fall ist ein höchstmögliches Maß an Sicherheit darüber herzustellen und zu vermitteln, dass es sich bei einem identifizierten Todesopfer zweifelsfrei um diese Person handelt. Eine nicht seltene Quelle für langanhaltende traumatische Belastung ist die Restunsicherheit (oder Resthoffnung) über das „tatsächliche“ Schicksal einer verlorenen nahestehenden Person. (Vergleiche zur Direktintervention z. B. Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen, BOeP, 2000; Gschwend, 2002; Teegen, 2004). Stabilisierungs- & Distanzierungstechniken. Über die besondere pathogene Bedeutung von dissoziativen Prozessen während der akuten Traumatisierung wurde bereits an anderer Stelle gesprochen. Während der ersten Tage und Wochen nach einer Katastrophe ist es notwendig, sowohl einer Wiederholung oder Verschärfung von dissoziativen Reaktionen als auch dem Risiko von Retraumatisierungen entgegenzuwirken. Allgemein muss dafür gesorgt werden, dass die aufgewühlte Affektlage und die dysfunktionale physiologische Aktivierung zur Ruhe kommt. Um das zu erreichen, müssen Betroffene zweierlei Techniken erlernen. Zu diesem Zweck stehen auf der einen Seite Techniken der affektiven und physiologischen Stabilisierung zur Verfügung. Van der Kolk, van der Hart und Marmar (2000) empfehlen stark strukturierte Tagesabläufe mit geregelten Schlaf- und Wachphasen und körperlicher Aktivität. Außerdem legen die Autoren besonderen Wert auf Übungen zur somatosensorischen Wahrnehmungsfokussierung („Erdung“). Eine zweite Gruppe von Techniken besteht aus Imaginationsübungen, mit deren Hilfe Betroffene lernen können, aktiv gegen die innere Aufruhr vorzugehen und eine Überflutung mit traumatischen Erinnerungen zu kontrollieren und einzudämmen. Im Wesentlichen bestehen diese Techniken aus mentalen Übungen, sich innerlich von den bedrohlichen Gedanken zu distanzieren (indem der innere Film z. B. „weggezoomt“ wird) oder über Imaginationen ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität herzustellen (indem z. B. ein „sicherer Ort“ aufgesucht oder die Bedrohung in einen „Tresor eingeschlossen“ wird). Übungen zur Stabilisierung und Distanzierung finden sich z. B. bei Reddemann (2001). Neben der unmittelbaren Reduktion der Belastung können Betroffene auf diesem Weg hilfreiche Erfahrungen im Bereich der Selbstkontrolle resp. des Kontrollgewinns machen. Wirkmechanismen von Distanzierungs- & Imaginationsübungen sind nach Meichenbaum (1994) ein wachsendes Gefühl von Kontrolle, die veränderte Bedeutung des Traumas und der veränderte innere Dialog darüber, sowie das mentale Üben von Verhaltensalternativen, die zur Entwicklung von Bewältigungsreaktionen und Fähigkeiten beitragen. Debriefing. Unter Debriefing werden strukturierte und streng reglementierte Gruppennachbesprechungen verstanden. Ursprünglich für Einsatzkräfte entwickelt, die traumatischem Druck ausgesetzt sind, wurde Debriefing immer wieder auch zur intensiven Kurzbetreuung von Betroffenen nach einer Katastrophe eingesetzt. Ein maßgeblicher Teil der Forschung zur Akut- oder Frühintervention nach kollektiven Traumata konzent- A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine riert sich auf das Debriefing, und hier wiederum auf das Critical Incident Stress Management (CISM, Everly & Mitchell, 1999/2002) als dem verbreitetsten Verfahren. Die Nützlichkeit von Debriefing wird seit Jahren unvermindert kontrovers diskutiert. Obwohl Betroffene die Wirkung von Debriefing subjektiv überwiegend als hilfreich einschätzen, lässt sich diese positive Sichtweise nicht uneingeschränkt durch die Forschung stützen (Bengel, 2004). Abgesehen von subjektiven Entlastungseffekten verhindert Debriefing auf lange Sicht nicht die Ausbildung posttraumatischer Belastungsstörungen und anderer pathologischer Probleme. In verschiedenen Fällen wurde sogar beobachtet, dass Debriefing unter bestimmten Umständen die Gesamtsymptomatik verschlechtern kann. Als Erklärung wird darüber nachgedacht, ob kurz befristete Interventionen am Beginn eines Erholungsprozesses, der sich erfahrungsgemäß zumindest über Monate erstreckt, überhaupt zu wesentlichen Änderungen führen können. Als zweites wichtiges Argument gegen Debriefing ist die Stimulation und Steigerung des Erregungsniveaus zu sehen, das mit einer emotionalen Selbstöffnung einhergeht, während konstruktive Bewältigungsalternativen im Debriefing-Konzept fehlen bzw. nicht vermittelt werden (Rose, Brewin, Andrews & Kirk, 1999; Mayou, Ehlers & Hobbs, 2000; Teegen, 2004). Von der routinemäßigen Anwendung von Debriefing unmittelbar nach einer Katastrophe wird deshalb von verschiedenen Autoren abgeraten (Litz, Gray, Bryant & Adler, 2002; Rose, Bisson & Wesseley, 2001). Fischer et al. (2000) empfehlen auf der Grundlage solcher Ergebnisse und eigener Untersuchungen, Betroffene, die mittleren und schweren traumatischen Belastungen ausgesetzt waren, in drei Gruppen zu unterteilen: Die Selbsterholungsgruppe verfügt über Ressourcen und Potentiale, das Trauma im Verlauf eines natürlichen Erholungsprozesses ohne bleibende Beeinträchtigungen zu bewältigen. Die Wechslergruppe verfügt ebenfalls über gute Bewältigungsmöglichkeiten, allerdings unter der Voraussetzung, dass nach Beendigung der traumatischen Situation keine weiteren Belastungsfaktoren wirksam sind, z. B. auf familiärer Ebene, am Arbeitsplatz, oder in Form eines Retraumatisierungsrisikos. Die Risikogruppe schließlich ist wegen einer besonderen Häufung negativer Faktoren besonders gefährdet, eine chronifizierte posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Die Autoren empfehlen, psychosoziale und psychotherapeutische Betreuungsmaßnahmen differenziert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Risiken dieser Gruppen abzustimmen. Während die Selbsterholer und die Wechsler von Debriefing voraussichtlich profitieren können, ist ein Debriefing für die Risikogruppe kontraindiziert Fischer und Kollegen (2000). Die Autoren berichten, dass eine Klassifizierung Betroffener mithilfe des erwähnten Kölner Risiko-Index (KRI, Fischer et al., 2000) mit befriedigender Sicherheit von geschulten Helfern und Peers vorgenommen werden kann. Selbsthilfegruppen oder begleitete Betroffenengruppen? Aus gemeindepsychologischer Perspektive ist es wünschenswert, die Gruppenkohäsion und die Autonomie der Gemeinschaft weitestgehend zu fördern. Allgemeines Interventionsziel ist es, den Betroffenen nahe zu bringen, dass die Gemeinschaft grundsätzlich über alle nötigen psychischen Kräfte verfügt, um mit den Folgen der Katastrophe fertig zu werden. Dieser Gedanke führt unmittelbar zur Forderung nach Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene zwar psychoedukativ unterwiesen werden, im Bewältigungsprozess aber sich selbst und ihrer Gruppendynamik überlassen bleiben. Verschiedene Beobachtungen zeigen jedoch, dass in Gruppen von Traumatisierten der verständliche Wunsch nach 51 52 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Gerechtigkeit – die es nicht geben kann – leicht in Opposition zur Notwendigkeit der Bewältigung und Integration in die Biografie gerät, mit fatalen Auswirkungen, wenn Entschädigung für erlittenes Leid zum Leitmotiv der Gruppenarbeit wird. Selbsthilfegruppen drehen sich häufig permanent im Kreis, da sie sich hauptsächlich über das Ausmaß des erlittenen Leids und des Verlustes austauschen, nicht aber an der Entwicklung und Ausdifferenzierung von Bewältigungsmöglichkeiten arbeiten, wie Seybold (1991) eindrucksvoll in ihrer Filmdokumentation des Vergleichs psychologisch geleiteter Katastrophen-Nachsorge und reiner Selbsthilfegruppen nachweisen konnte. Maercker (2003b) schildert die Schwierigkeiten, die sich aus der Einengung und Fixierung auf das Traumathema und aus „querulatorischen“ Auseinandersetzungen, z. B. mit Behörden und Institutionen, ergeben können. Aus solchen Gründen ist davon abzuraten, Gruppen von Betroffenen weitgehend unbetreut sich selbst zu überlassen. Das andere Extrem ist möglicherweise in einer professionellen „Machtübernahme“ in einer Betroffenengruppe zu sehen. Bezugnehmend auf die Berichte von Jatzko (2003) weist Teegen (2004) auf die fehlenden Belege für die Wirksamkeit von „teilweise sehr weitgehenden therapeutischen Interventionen“ innerhalb einer Gruppenbetreuung hin. Weiter fordert die Autorin als Mindestkriterium eine klare zeitliche Begrenzung von betreuten Gruppen, um zu verhindern, dass sich Betroffene auf eine endlose Abhängigkeit einstellen und eine dauerhaft festgelegte Rolle als „Beschädigte“ übernehmen. Ein Vorschlag für ein allgemein gehaltenes Rahmenkonzept kommt von der Arbeitsgruppe um Norris und Friedman. Danach soll professionelle Hilfe unterstützend, beratend und moderierend erfolgen. Konstruktive, problemlösungsorientierte Handlungsstrategien sollten gestärkt, Entscheidungsfähigkeit unterstützt und ausgebaut, günstige Kontrollüberzeugungen sollten gefördert werden (Norris, Friedman & Watson, 2002; Norris, Friedman et al., 2002). Eine konkrete Aufgabe kann z. B. darin gesehen werden, als Therapeut an der Planung zur Einrichtung von Gedenkstätten mitzuwirken (Hodgkinson & Stewart, 1998), die aktuelle Medienberichterstattung und eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen gemeinsam mit der Gruppe aufzubereiten. Kognitiv-behaviorale Therapie. Kognitiv-behaviorale Therapien setzen im wesentlichen an zwei Punkten an, den Furchtstrukturen und dem damit verknüpften Vermeidungsverhalten einerseits, und an den negativen Überzeugungen, Erwartungen und Selbstwahrnehmungen andererseits. Expositionsbehandlungen haben zum Ziel, die durch das Trauma entstandenen Furchtstrukturen aufzulösen. Erreicht wird dies bei der Exposition in sensu durch eine Konfrontation mit den inneren aversiven Reizbedingungen (Erinnerungen, aufdringliche Gedanken und negative Gefühle), bei der Exposition in vivo durch Konfrontation mit den äußeren aversiven Reizbedingungen. Hiermit ist die typische, oft hoch generalisierte Vermeidung von Orten, Situationen und Umgebungsreizen gemeint, die mit dem Trauma assoziiert werden. Während die Exposition in sensu gut erforscht ist, liegen zur Exposition in vivo bei Traumatisierten kaum Belege vor. Im Fall von Katastrophenopfern sind Szenarien denkbar, die eine in vivo-Exposition zumindest schwierig erscheinen lassen. Zur Illustration sei eine Arbeit von Basoglu, Livanou und Salcoglu (2003) erwähnt, die türkische Erdbebenopfer in einer einmaligen Konfrontation in einem Erdbeben-Simulator behandelten. Das Therapierational der Expositionsbehandlung erwartet vom Patienten, in einem geschützten Rahmen das Trauma mit allen somatosensorischen und affektiven Eigenschaften wiederholt zu durchleben, bis eine Habituation erreicht ist (Rothbaum, Foa & Hembree, 2003). A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine Die Techniken der kognitiven Therapie setzen an den negativen Überzeugungen, Erwartungen und Selbstwahrnehmungen an. Angriffspunkte sind hier neben den gerade genannten Symptomen insbesondere Schuld- und Schamgefühle, Rachebedürfnisse, Ärger/Wut und, mit besonderer Bedeutung, Aspekte der Sinnfindung und der Würdigung von Bewältigungserfolgen Maercker (2003b). Ziel der kognitiven Therapie ist eine Umstrukturierung und Normalisierung dysfunktionaler Sichtweisen. Einen kurzen Überblick über gebräuchliche Techniken gibt Maercker (2003b), vom selben Autor stammt die Life-Review-Therapie für Menschen mit länger zurückliegenden Traumatisierungen (Maercker, 2002; Maercker & Zöllner, 2002). Basierend auf dem Störungsmodell von Ehlers und Clark (2000) entwickelte Ehlers (1999) eine Technik zur kognitiven Umstrukturierung, die sich auf die Identifikation dysfunktionaler Einstellungen konzentriert. Über die Wirksamkeit von kognitiv-behavioralen Therapien bei PTBS wurden bereits verschiedene Ergebnisse referiert. Erfahrungen mit der KBT bei akut traumatisierten Personen, also während des ersten Monats nach einer Katastrophe, zeigen ebenfalls gute Wirksamkeit – die klinische Symptomatik bessert sich und lässt sich auch längerfristig in Follow-ups nachweisen (Bryant, Harvey, Dang, Sackville & Basten, 1998; Bryant, Sackville, Dang, Moulds & Guthrie, 1999; Foa, Hearst-Ikeda & Perry, 1995; Echebura, de Corral, Sarasua & Zubizarreta, 1996). Diese Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit der Wirksamkeit von KBT bei längerfristigen und chronifizierten traumatischen Beschwerden. Allerdings gilt hier wie dort die Einschränkung, dass KBT kontraindiziert ist, wenn Bedrohung und traumatische Belastung noch andauern (das Trauma also noch keine biografische Vergangenheit ist), wenn suizidale Neigungen feststellbar sind, und wenn extreme Angstbelastungen mit dem Risiko der Dekompensation vorliegen (Bryant & Harvey, 2000). EMDR. Als Mischung aus kognitiven, konfrontativen und hypnotherapeutischen bzw. Entspannungselementen kann die EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gelten (Shapiro, 1989a, 1989b, 1995). Auch EMDR wird kontrovers diskutiert wird, die bislang vorliegenden Ergebnisse sind noch lückenhaft und uneinheitlich, weisen aber in eine positive Richtung. EMDR wird zur Zeit mit einer gewissen Vorsicht als wirksamer im Vergleich zu Nicht-KBT-Verfahren betrachtet, ist aber klassischen KBT-Verfahren möglicherweise unterlegen (van Etten & Taylor, 1998; Rothbaum, Foa & Hembree, 2003). Interessant ist EMDR als Teil eines Kombinationsansatzes, allerdings stehen auch hier konkrete Ergebnisse bislang aus. Über die Wirkmechanismen der EMDR herrscht weit gehende Unklarheit (Cahill et al, 1999; Rothbaum, Foa & Hembree, 2003). In der Meta-Analyse des NICE-Report werden traumazentrierte kognitiv-behaviorale Therapie und EMDR als gut evidenz-basiert und mit klinisch bedeutsamen Effektstärken beschrieben (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, 2005). Narration und Posttraumatische Reifung. Über Ergebnisse zum Disclosure-Ansatz, den u. a. Pennebaker et al. (1989) vertreten, wurde bereits an anderer Stelle berichtet. In diesem Zusammenhang können auch therapeutische Ansätze gesehen werden, die den Patienten ermutigen, seine Erfahrungen in eine schriftliche Form zu bringen (Lucius-Hoene, 1998, 2002). Hintergedanke hierbei ist, zum einen die verbale Integration zu fördern, andererseits über die intensive Beschäftigung, eine schriftliche Form für sich zu finden, eine elaborierte kognitive Verarbeitung zu fördern und einen individuellen Reifungsprozess anzustoßen (Uhlmann, Hughes & Pennebaker, 1995). Syn- 53 54 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Planungsebenen und Behandlungsbausteine chrone Ableitungen der Elektrodermalen Aktivität ergaben in dieser Arbeit theoriekonform hohe Assoziation mit negativen Emotionen einerseits und mit vorsprachlicher, „ausdruckssuchender“ Aktivierung andererseits. Als Therapeut muss man sich darüber im Klaren sein, dass man den Patienten hier einer Aufgabe mit hohem Schwierigkeitsgrad aussetzt, der er ohne einen „therapeutischen Lektor“ unter Umständen nicht gewachsen ist. Klar sein sollte auch, dass Reifungs- und Sinnfindungsarbeit Aufgaben sind, die erst nach einer hinreichenden Festigung im Bewältigungsprozess in Angriff genommen werden können. Die besondere Bedeutung eines Sinnfindungsprozesses nach dem Trauma beschreibt auf eindrucksvolle Weise Frankl (1973) – in einem Buch über seine eigenen Erfahrungen während der Inhaftierung in einem nationalsozialistischen Vernichtungslager. Aufgabe und Ziel werden in der Psychotraumatologie mit dem Begriff Posttraumatische Reifung oder Posttraumatic Growth umschrieben (Maercker, 2003b). Die Methoden, die in diesem Zusammenhang zu sehen sind („Finding a Mission“, „Testimony“Methode) (Maercker, 2003b), sind hoch speziell und dem empirischen Instrumentarium deshalb nur begrenzt zugänglich, Erfahrungen damit sind eher deskriptiver Natur. Das oft hohe Bedürfnis von Betroffenen, dem „Leben nach der Katastrophe“ einen neuen Sinn zu geben, macht aber deutlich, dass Therapeuten auch in dieser Phase als Begleiter und Gesprächspartner gefragt sind, um z. B. gemeinsam über Reifungs- und Entwicklungsmöglichkeiten nachzudenken (Maercker, 2003b). 3. Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern Spätestens seit dem Beginn der neunziger Jahre ist das Thema Gewalt an Schulen auch in Deutschland verstärkt Gegenstand nicht-wissenschaftlicher und massenmedialer Erörterungen (Fuchs, Lamnek & Luedtke, 2001; Tillmann, 1997). Tillmann und seine Arbeitsgruppe, Fuchs, Lamnek und Luedtke sowie diverse andere Autoren präzisieren, dass sich die öffentliche Diskussion in sehr allgemeiner Form mit Gewalt befasst, die von Schülern ausgeht. Schüler werden als Gewalttäter thematisiert, und es geht um Bedrohen, Zuschlagen und Beschädigen (Tillmann, 1997). Die von Schülern ausgehende Gewalt, wie sie in der Öffentlichkeit gesehen wird, richtet sich gegen Mitschüler, aber auch gegen Lehrer und allgemein gegen Erwachsene. Fuchs und Kollegen (2001) fassen die in der Öffentlichkeit dominierenden Argumente kurz und prägnant folgendermaßen zusammen: (1) Schul- bzw. Jugendgewalt nimmt [permanent, d. Verfasser] zu, (2) die Täter werden immer rücksichtsloser und brutaler, und (3) sie werden immer jünger. A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern 3.1 Forschungsstand über Gewalt an Schulen Wie stellt sich das Problem der Gewalt an Schulen in Zahlen dar? Die hier referierten Aussagen lehnen sich im Wesentlichen an die Übersichten von Tillmann (1997) und Fuchs und seine Mitarbeiter (2001) an. Zur Illustration sollen exemplarisch verschiedene Teilergebnisse u. a. aus der Eichstätter Studie der Arbeitsgruppe um Lamnek (Fuchs et al., 2001) herangezogen werden. Die Eichstätter Studie bezieht sich zwar ausschließlich auf die Verhältnisse an bayerischen Schulen, hat aber den Vorteil, längsschnittlich angelegt zu sein, alle weiterführenden Schulformen inkl. der Berufsschule zu berücksichtigen und auf simultanen Schüler- und Lehrerbefragungen zu beruhen. Die Stichprobenauswahl kann nach soziodemographischen Kriterien als repräsentativ betrachtet werden, das Datenmaterial ist mit der Erhebung von 1999 vergleichsweise aktuell. In der Eichstätter wie auch in anderen Studien wird „Gewalt“ als heterogenes Phänomen operationalisiert und darf nicht pauschal gleichgesetzt werden mit physischer Gewalt gegen Personen. Fuchs et al. (2001) kommen nach einer Faktorenanalyse ihrer Daten zu einer Unterdifferenzierung in verbale und psychische Gewalt, Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen. 3.1.1 Formen und Häufigkeiten Konsistent über verschiedene Studien tritt Gewalt an Schulen hauptsächlich als verbale Gewalt in Erscheinung. Verbale Gewalt umfasst Verhaltensmerkmale wie die Benutzung von Fäkal- und Vulgärsprache, Beleidigen und Beschimpfen, Hänseln und das Verbreiten von Lügen über andere. Tillmann, Holler-Nowitzki, Holtappels, Meier & Popp (1999) fassen verbale Gewalt als Teilaspekt psychischer Gewalt auf, Fuchs und Kollegen betrachten sie als eigenständigen Faktor. Mittlere Häufigkeiten für das Auftreten verbaler Gewalt liegen je nach Studie und Operationalisierung zwischen 20 und 50%. Physische Gewalt gegen Personen tritt gegenüber nicht-physischer Gewalt in vergleichsweise geringem Ausmaß auf. Die Äußerungsformen physischer Gewalt sind unterschiedlich gravierend und beinhalten Rangeleien, Prügeleien und Schlägereien. Schwere Gewaltformen mit devianten und delinquenten Merkmalen, wie Raub, Erpressung, sexuelle Nötigung und Körperverletzung, werden je nach Operationalisierung und datenanalytischer Strategie als eigener Gewaltfaktor betrachtet oder den anderen Faktoren zugeschlagen. Die Anwendung physischer Gewalt wird durchschnittlich von etwa 7 bis 12% der Schüler angegeben. Werden krasse Formen physischer Gewalt wie gemeinschaftliches Verprügeln mit Verletzungsfolge betrachtet, dann differieren die Angaben erheblich. Die Quoten reichen von einem oder zwei bis etwa 15% und mehr (Funk, 1995), auch hier spielen Operationalisierungsfragen eine Rolle. Das Bild für Gewalt gegen Sachen, respektive Vandalismus, sieht ähnlich aus, die Zahlen unterscheiden sich nur unwesentlich von der physischen Gewalt gegen Personen, und auch hier steigt die Streuung der Untersuchungsbefunde mit der Schwere der Gewalt. Verschiedene Befunde deuten außerdem darauf hin, dass die Häufigkeiten, mit der einzelne Gewaltformen angewendet werden, in einem Zusammenhang stehen. Wer physische Gewalt einer bestimmten Art besonders häufig anwendet, der wendet häufig auch andere Formen physischer Gewalt an (Fuchs et al., 2001). Schwere physische 55 56 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern Gewalt mit möglichen Folgen für Leib und Leben stellt eine Ausnahme dar, sowohl innerhalb des Gesamtspektrums der Gewalt an Schulen als auch bezogen auf die absolute Häufigkeiten – allerdings eine Ausnahme mit gravierenden Folgen für jedes betroffene Opfer. Angaben hierzu schwanken in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren beträchtlich. Eine Einschätzung dieses Problems soll deshalb zu einem späteren Zeitpunkt versucht werden. 3.1.2 Einflussfaktoren Faktor Geschlecht. Gewalt ausübend sind überwiegend die Jungen, aber auch Mädchen treten durch gewaltsames Verhalten in Erscheinung. Konsistent über verschiedene Untersuchungen finden sich regelhafte geschlechtsspezifische Muster. Während die Anwendung verbaler Gewalt von Jungen und Mädchen etwa gleich häufig angegeben wird, zeigt sich eine deutliche Jungenlastigkeit, je härter und „physischer“ die Form der Gewalt wird. Hier werden für Mädchen im Vergleich zu Jungen Faktoren von z. B. 1 : 2 für Vandalismus und von etwa 1 : 3 für Prügeleien berichtet. Die Relationen sind über verschiedene Arbeiten relativ stabil und statistisch bedeutsam. Abbildung A 3.1 zeigt die Verteilung der Gewaltformen über das Geschlecht (Fuchs et al., 2001). Faktor Alter. Auch für den Faktor Alter wurden wiederholt regelhafte Unterschiede gefunden. Es zeigt sich, dass die Altersgruppe der Jugendlichen, also derjenigen zwischen etwa 13 bis 14 und 16 bis 17 Jahren, eine besondere Affinität zu gewaltorientiertem Verhalten hat und häufiger gewaltaktiv wird als die vorangegangenen Altersstufen. Bei Adoleszenten ist der Trend dann wieder rückläufig. Die Verteilung hat ihren Gipfel für alle Gewaltformen inklusive verbaler Gewalt bei etwa 15 Jahren und fällt zu beiden Seiten gleichmäßig ab. Die Minimalwerte an den Enden der Altersverteilung stehen zum Maximum etwa in einem Verhältnis von 1 : 2. Faktor Schulform. Damit übereinstimmend sind unterschiedliche Befunde zur Gewalthäufung in den verschiedenen Schulformen. Haupt- und Berufsschulen zeigen sich am stärksten belastet, danach folgen mit geringem Abstand die Realschulen. Gymnasien sind am wenigsten belastet, aber belastet sind sie auch. Am deutlichsten sind die Unterschiede bei physischer Gewalt ausgeprägt. Abbildung A 3.2 gibt einen Eindruck von der Verteilung der Gewaltformen über die Schulformen (Fuchs et al., 2001). Gewalt an Schulen nimmt mit sinkendem Bildungsniveau tendenziell zu. Dieser Effekt negativer Selektion lässt sich weiter verfolgen, wenn auch die Schulen für Lernbehinderte einbezogen werden (Tillmann, 1997). Zu bedenken ist hier, dass nicht die Schulform an sich Schülergewalt bedingt. Vielmehr bilden sich im Faktor Schulform verschiedene psychosoziale und soziökonomische Belastungsfaktoren ab, die an der Entstehung eines Klimas, das Gewalt begünstigt, maßgeblich beteiligt sind. Zu berücksichtigen ist auch ein Hinweis von Fuchs und Kollegen (2001), die die Gewalthäufung eher mit einer Standortfrage als mit der Schulform in Verbindung bringen. Schulen in sozialen Brennpunkten seien grundsätzlich stärker belastet als andere, und gleichzeitig läge dann eben auch eine Konzentration der sozial „unterprivilegierten“ Schulformen vor. Weiter weisen verschiedene Autoren darauf hin, dass ein substantieller Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Lernvermögen einerseits und erhöhter Gewaltneigung andererseits wiederholt nachgewiesen werden konnte (Tillmann et al., 1999). A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern Abbildung A3.1: Häufigkeit der Anwendung verschiedener Gewaltformen durch Schüler (Selbstbericht) – differenziert nach Geschlecht (Näherungswerte in Prozent, nach Fuchs et al., 2001) Abbildung A3.2: Häufigkeit der Anwendung verschiedener Gewaltformen durch Schüler (Selbstbericht) – differenziert nach Schulformen (Näherungswerte in Prozent, nach Fuchs et al., 2001) 57 58 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern Faktor Zeit. Mit ihrer in Deutschland z. Z. konkurrenzlosen Längsschnittstudie versucht die Arbeitsgruppe um Lamnek zu klären, ob und in welchem Umfang die Aussage mit empirischen Erkenntnissen vereinbar ist, Gewalt an Schulen und durch Schüler würde permanent zunehmen, und welche Trends sich in der Entwicklung von Gewalt an Schulen identifizieren lassen (Lamnek, 1995; Fuchs et al., 2001). In der Öffentlichkeit diskutiert werden eine „Wachstums-“ und eine „Verjüngungshypothese“ – „Gewalt nimmt ständig zu, die Täter werden immer jünger.“ (Fuchs et al., 2001). Auf die besonderen Probleme bei der Einschätzung dieser Frage ist bereits ausführlich eingegangen worden. Im Folgenden sollen einige ausgewählte Teilergebnisse erwähnt werden. Gemittelt über alle Schulformen und alle Gewaltformen stellen Fuchs et al. insgesamt einen eher rückläufigen Trend, keinen steigenden, fest. Als problematisch wird nach den Ergebnissen der Eichstätter Studie aber eine gegenläufige Strömung bei den Hauptschulen bewertet. Es bleibt abzuwarten, welches Bild sich nach späteren Erhebungszeitpunkten ergibt. Allgemein scheint es gesichert zu sein, dass sich die Anwendung verbaler Gewalt verschärft hat. Verschiedene Autoren fassen ihre Erkenntnisse dahingehend zusammen, der Ton sei insgesamt härter und rücksichtsloser geworden (Tillmann, 1997; Fuchs et al., 2001). Die Frage, ob Vandalismus und schwere Formen von körperlicher Gewalt zugenommen haben könnten, ist abschließend nicht befriedigend zu beantworten. Möglicherweise gibt es eine Steigerung auf niedrigem Niveau, und möglicherweise wirken sich verschiedene Veränderungen psychosozialer Bedingungen in den letzten Jahren negativ auf das Gewaltklima an unterprivilegierten Schulformen aus. Immerhin gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass sich innerhalb kleiner Subpopulationen – im so genannten „harten Kern“ jugendlicher Gewalttäter inklusive einem Anteil an „Intensivtätern“ – die Zustände verschärft haben. Abbildung A 3.3 fasst die Ergebnisse der von Rostampour und Melzer (1997) cluster-analytisch ermittelten Täter-Opfer-Typologie zusammen. Abbildung A3.3: Cluster-analytisch ermittelte Täter-Opfer-Typologien (nach Rostampour & Melzer, 1997) Bei Kindern unter 12 Jahren wurde ein leichter Trend zu einem vorverlagerten Beginn gewaltsamen Verhaltens befürchtet und gelegentlich auch berichtet. Fuchs und Kollegen (2001) kommen nach den Ergebnissen ihrer Wiederholungserhebung zu der A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern Auffassung, dass ein derartiger „Verjüngungstrend“ zumindest für verbale Gewalt feststellbar sei. Die Autoren schlagen vor, in diesem Ergebnis einen Aspekt eines allgemeinen entwicklungspsychologischen Akzelerationseffekts zu sehen. Für physische Gewaltformen sind die Aussagen wieder uneindeutiger, die Konfundierung mit anderen, z. B. psychosozialen Variablen, und das insgesamt heterogene Gesamtbild lassen stichhaltige Aussagen über eine allgemeine Vorverlagerung nicht zu. Faktoren ohne differentielle Bedeutung und weitere Befunde. Auch im Hinblick auf verschiedene andere populäre Meinungen konnten keine regelhaften Einflüsse auf das Gewaltaufkommen an Schulen nachgewiesen werden. So liegt keine Evidenz dafür vor, dass sich städtische Schulen in der Gewaltproblematik von ländlichen Schulen unterscheiden – einen Ballungsraumfaktor scheint es nicht zu geben. Auch die Schulgröße scheint kein Ausschlag gebender Faktor zu sein. Ob eine Schule eine große Schülerzahl betreut oder nicht, macht nach Forschungslage keinen wesentlichen Unterschied (Tillmann, 1997). Unterschiede im Gewaltaufkommen werden aber verschiedentlich berichtet, wenn die Klassengröße mit berücksichtigt wird. Hier gilt die Faustregel, dass Problemkinder in großen Klassenverbänden weniger optimal beschult werden können und über eine Spirale aus Lernproblemen, Versagenserfahrungen und bereits vorhandenen aggressiven Bewältigungsstrategien zu einem erhöhten Gewaltaufkommen beitragen, worunter wiederum das Klassenklima und die Lernbedingungen leiden (Fuchs et al., 2001). Auf der Grundlage norwegischer Längsschnittuntersuchungen vertritt Olweus (1993, 1997) die Auffassung, der Faktor Klassengröße sei zumindest für den Teilbereich der Täter-Opfer-Problematik von geringfügiger Bedeutung. In den Jahren nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde befürchtet, schulische Gewalt sei in den neuen Bundesländern besonders verbreitet. Hier ist zunächst darauf zu achten, nicht die beiden Sachverhalte „politisch motivierte Jugendgewalt“ und „Gewalt an Schulen“ miteinander zu verwechseln. Wie Schuhbarth in verschiedenen Bundesländer vergleichenden Arbeiten nachweisen konnte, gibt es zwischen Sachsen und Hessen tatsächlich bedeutsame Unterschiede – die aber entgegen dem Klischee zu ungunsten von Hessen ausfallen, zumindest wenn man die härteren Formen schulischer Gewalt wie Raub, Erpressung, Waffenbesitz, Waffengebrauch und Körperverletzung in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. In diesen Disziplinen sind hessische Schulen führend (Schuhbarth, 1995; Schuhbarth, Darge, Mühl & Ackermann, 1997). 3.1.3 Zwischenbilanz zum Forschungsstand Fuchs und Kollegen (2001) sowie Tillmann und Kollegen (1999) kommen in ihrer Gesamtbewertung zu der Auffassung, dass „die Jugend" ganz allgemein besser als ihr Ruf ist, und dass von einer zunehmend steigenden Gewaltbereitschaft und Brutalisierung an deutschen Schulen so pauschal nicht die Rede sein kann (Fuchs et al., 2001). Obwohl „die Jugend “ nicht friedlich ist, ist sie andererseits nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aggressiver als die Gesellschaft, von der sie umgeben ist und durch die sie sozialisiert wird. Wagner und van Dick (2000) sehen keinen Anlass, auf der Basis der verfügbaren Befunde von „amerikanischen Verhältnissen“ an deutschen Schulen zu sprechen. Belege für diese Aussagen finden sich auch in den insgesamt befriedigenden Übereinstimmungen von Lehrer- und Schülerberichten. Die Bundesministerien des Innern und der Justiz schließen sich auf der Grundlage der Arbeit der Experten- 59 60 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern kommission zur Jugendgewalt dieser gemäßigten Auffassung an (BMI und BMJ, 2001a). Zusammenfassend kommen sowohl die einzelnen Forschungsgruppen als auch die Expertenkommissionen des Bundes überwiegend zu der Auffassung, Gewalt unter Jugendlichen sei ein passageres Phänomen im Entwicklungsverlauf, das verschwindet, sobald adäquatere und differenziertere Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung und zur Selbstbehauptung herangereift sind. Übereinstimmend wird aber darauf hingewiesen, dass Gewalt als Mittel zur Konfliktbewältigung Teil des überdauernden Verhaltensrepertoires werden kann, wenn die psychosozialen Randbedingungen dies begünstigen (Fuchs et al., 2001; BMI und BMJ, 2001a resp. 2001b). Auch wenn die Zahl schwerer Zwischenfälle relativ gering ist, so ist die Situation der Opfer schulischer Gewalt in der betroffenen Klasse oder Schule in vielen Fällen jedoch mit gravierenden Folgen für deren psychische Gesundheit verbunden. 3.2 Zielgerichtete Gewalt Zielgerichtete Gewalt im Sinn der vorliegenden Arbeit ist z. Z. kein oder nur ein marginales Thema der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung in Deutschland. Zwar wird zielgerichtete Gewalt in den USA als Problem mit vermutlich eigenständigen qualitativen Eigenschaften wahrgenommen, in Deutschland ist ein entsprechendes Bewusstsein in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aber erst im Entstehen begriffen. Mit zielgerichteter Gewalt von Schülern befassen sich hierzulande hauptsächlich praktisch tätige Psychologen (Therapeuten, Schulpsychologen), Pädagogen, Kriminalisten und politische Entscheidungsträger, und zwar jeweils unter dem Handlungsdruck aktueller Zwischenfälle, vornehmlich also rein reaktiv. 3.2.1 Definition Der Begriff „zielgerichtete Gewalt“ stammt von einer Untersuchung des US-SecretService und dem US-Department Of Education, die mit der „Safe School Initiative“ alle Vorfälle zielgerichteter Gewalt an Schulen eingehend untersuchten, die sich in den USA in den vergangenen 25 Jahren ereigneten (Vossekuil, Fein, Reddy, Borum & Modzeleski, 2002). Es werden darunter Attentate mit Schusswaffengebrauch oder andere Gewalttaten an Schulen verstanden, bei denen die Schule gezielt als Tatort ausgewählt wurde und nicht zufällig zum Schauplatz des Geschehens wurde. Ursprünglich wurde der Begriff „zielgerichtete Gewalt“ im Rahmen einer fünfjährigen Studie des Secret Service geprägt, die das Verhalten derjenigen Täter untersuchte, die Angriffe mit Todesfolge auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Prominente verübten oder versuchten. In Fällen zielgerichteter Gewalt an einer Schule ist das Ziel eine bestimmte Person, wie z. B. ein Mitschüler oder Lehrer oder eine Personengruppe, wie z. B. die Lehrerschaft oder die „Streber“. Auch die Schule selbst kann das Ziel darstellen. A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern 3.2.2 Häufigkeit und Auswirkungen Zielgerichtete Gewalt stellt eine äußerst selten vorkommende Form der Gewalt dar, der jedoch ein hoher Stellenwert eingeräumt werden muss. In den Jahren 1993 bis 1997 betrug laut Abschlussbericht der Initiative für Sicherheit an Schulen (Safe School Initiative) in den USA die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind oder Jugendlicher in den Klassen 9 bis 12 in der Schule mit einer Waffe bedroht oder verletzt wurde, 7 bis 8 Prozent, das entspricht einem Verhältnis von 1 zu 13 oder 14; die Wahrscheinlichkeit, in der Schule in einen physischen Kampf verwickelt zu werden, betrug 15% oder 1 zu 7. Die Wahrscheinlichkeit dagegen, dass ein Schüler durch Mord oder Selbstmord zu Schaden kam, lag nicht höher als eins zu einer Million (Vossekuil et al., 2002). In der Studie des U.S. Secret Service und des Bildungsministeriums wurden für den Zeitraum zwischen Dezember 1974 und Mai 2000 37 Vorfälle zielgerichteter Gewalt an Schulen festgestellt, die von 41 Tätern begangen wurden. Es gibt keine Hinweise, dass zielgerichtete Gewalt in Schulen in den letzten Jahren zugenommen habe. Laut Angaben des „National Crime Victimization Survey“ und des „School Crime Supplement“ bestehen keine Unterschiede in den Raten der von kriminellen Gewalttaten in Schulen Betroffenen zwischen 1989 und 1995 (Snyder & Sickmund, 1999). Weniger als 1% der Tötungen und Suizide von Schulkindern geschehen auf dem Schulgelände, woraus der Schluss gezogen werden kann, dass Schüler generell in der Schule sicherer sind, als beispielsweise auf dem Weg in die oder von der Schule oder als in ihrer Freizeit (Mulvey & Cauffman, 2001). Trotzdem bleiben die Bilder der Schulmassaker von Columbine und Padukah, von Meißen und Erfurt im Gedächtnis der Bevölkerung, was wohl auf die oft zitierte Erkenntnis zurückzuführen ist, dass ein einziger Todesfall als Tragödie dargestellt und empfunden wird, ein millionenfacher dagegen als Statistik (Mulvey & Cauffman, 2001). Neben schwerer körperlicher Verletzung oder dem Tod der direkten Opfer sind die Auswirkungen zielgerichteter Gewalt an Schulen für die mit dem Ereignis Konfrontierten und die Angehörigen in vielen Fällen traumatische Störungen mit langwierigen Verläufen. Jede der in der Vergangenheit untersuchten Gewalttaten hatte langfristige traumatische Auswirkungen auf Schüler und Lehrer, die Gemeinde und die gesamte Nation (Vossekuil et al., 2002). Nach Morgan, Scourfield, Williams, Jasper und Lewis (2003) litten 33 Jahre nach einem Schulmassaker mit vielen getöteten Kindern immer noch 29% der Betroffenen an einer PTBS. 3.2.3 Prävention Um die verheerenden Auswirkungen zielgerichteter Gewalt in Schulen zu verhindern, wude vor allem in den USA die Frage gestellt, wie man hätte erkennen können, dass eine Gewalttat geplant war und was man tun könne, um in Zukunft derartige Taten zu verhindern. Nach dem Massaker an der Columbine High School, im Juni 1999, begann die bereits erwähnte Zusammenarbeit zwischen den beiden US-Behörden Secret Service und Department of Education mit dem Ziel, Antworten auf diese Fragen zu finden. Schwerpunkt der im Ergebnis dieser Zusammenarbeit entstandenen Safe School Initiative war die Untersuchung von Denkweise, Planung und Verhaltensweisen derjenigen Schüler, die diese Gewalttaten ausgeführt hatten. Insbesondere wurden die Verhal- 61 62 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern tensweisen und Äußerungen vor der jeweiligen Tat analysiert, um eventuelle Muster zu erkennen und somit zukünftige Vorfälle verhindern zu können. Die Ergebnisse der Save School Initiative legen den Schluss nahe, „dass zukünftige Gewalttaten unter Umständen verhindert werden können“ (Vossekuil et al., 2002), da: • die meisten Vorfälle zielgerichteter Gewalt an Schulen im Voraus durchdacht und geplant wurden, • das Verhalten der Täter darauf schließen ließ, dass sie eine Gewalttat planten, • bei den meisten Vorfällen Freunde und Mitschüler des Täters im Voraus wussten, dass eine Gewalttat bevorstand, • die meisten Täter vor dem Vorfall Verhaltensweisen zeigten, die anderen Sorgen bereiteten oder auf das Bedürfnis nach Hilfe hindeuteten, • die meisten Täter vor der Tat Schwierigkeiten hatten, mit einem großen Verlust oder einer persönlichen Niederlage fertig zu werden und Selbstmordabsichten oder – versuche gezeigt hatten, • viele Täter sich vor der Tat von anderen schikaniert, verfolgt oder verletzt gefühlt hatten. In den USA war die Angst vor zukünftigen zielgerichteten Attentaten an Schulen die treibende Kraft zur Entwicklung und Implementierung eines „BedrohungsanalyseProgramms“ zur Identifikation gewaltbereiter Schüler, zum Management von Bedrohungssituationen und zur Schaffung eines sicheren Schulklimas (Fein, Vossekuil, Pollac, Borum, Modzeleski & Reddy, 2002). Mit Hilfe der Bedrohungsanalyse wird versucht Schüler zu identifizieren, die aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation eine Gefahr darstellen, da ein Ergebnis der Studie war, dass weniger als 20% der Schulattentäter eine Bedrohung ausgesprochen hatten. Dazu werden hauptsächlich Hinweise von Schülern, Lehrern und Eltern genutzt, die ein jeder Schule zugeordneter Angehöriger der Polizei in Uniform, ein sogenannter „School-Inspector“ sammelt. Auffällige Schüler werden nach dem Prinzip der „Null Toleranz“ dann gegebenenfalls schnell von der Schule entfernt. Vor dem Eintritt in die Schule werden regelmäßige Leibesvisitationen nach Waffen durchgeführt. Mulvey und Cauffman (2001) kritisieren an diesem Vorgehen, dass die Gefahr besteht, bei der Vorhersage eines sehr seltenen Verhaltens wie zielgerichteter Gewalt an Schulen neben der Möglichkeit der Identifikation von tatsächlich gewaltbereiten potentiellen Tätern auch falsch positive herauszufinden. Das sind Schüler, die zwar die gleichen Merkmale zeigen, wie die Täter, jedoch niemals eine solche Tat ausführen würden und damit ungerechtfertigt stigmatisiert werden. Weiterhin negiere der Ansatz des Bedrohungsanalyse-Programms die starken sozialen Aspekte einer Gewalttat in der Schule, wenn nur nach individuellen Merkmalen gesucht werde, da die Mehrzahl der Täter in Peers eingebunden sei. Anstelle von auf einen bestimmten Schüler bezogenen restriktiven Maßnahmen schlagen sie verstärkte Bemühungen um ein Schulklima vor, das sich permanent um die sich verändernden Probleme und Bedürfnisse problematischer Gruppen von Schülern kümmert. Ziel soll dabei die Integration und nicht die Selektion der auffälligen Schüler sein. Empirische Studien belegen die höhere Wirksamkeit von Bemühungen um ein gesundes, vertrauensvolles Schulklima verglichen mit restriktiven Sanktionen, wenn es um die Reduktion von Fehlverhalten und Kriminalität an Schulen geht (Nettles, Mucherah & Jones, 2000). Vossekuil (2002) nennt als Säulen für ein sicheres Schulklima positive A: Behandlung von Katastrophenopfern — Katastrophen im Umfeld Schule durch zielgerichtete Gewalt von Schülern Bindungen zwischen Schülern und Erwachsenen, konstruktive Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern und die unabdingbare Voraussetzung mindestens einer erwachsenen Ansprechperson für jeden Schüler, Beachtung emotionaler Bedürfnisse und direktes Angehen von Hänselei und Mobbing. Als Schlüsselfaktor in der Prävention von Schulgewalt wird auch in Deutschland die Inklusion problembehafteter Schülergruppen in ein unterstützendes Schulklima gesehen (Merten & Scherr, 2004). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Bemühungen um eine erfolgreiche Prävention zielgerichteter Gewalt deutlich von gesellschaftspolitischen Grundüberzeugungen geprägt sind. Sie reichen von dem Versuch, potentielle Täter früh zu identifizieren und von der Schule zu verweisen bis zu umfassenden Schulentwicklungsüberlegungen. Es gibt kein eindeutiges Täterprofil, mit dem zuverlässig zukünftige zu zielgerichteter Gewalt bereite Schüler identifiziert werden können. Stattdessen scheint eine umfassende Berücksichtigung sowohl individueller Problemekonstellationen einzelner Schüler als auch die Betrachtung von Klassensituationen, des Schulklimas und der Qualität des Verhältnisses zwischen Schülern, Lehrern und Eltern notwendig für eine effektive Prävention zielgerichteter Gewalt. 4. Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen Auch in der Betreuung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen steht die Notwendigkeit im Vordergrund, genau zu verstehen, welche subjektive Bedeutung das Trauma für das einzelne Kind hat, und welche Annahmen und Erklärungen es dafür hat, dass die Katastrophe eingetreten ist. Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen zeigen im Vergleich mit Erwachsenen viele Übereinstimmungen, aber auch einige Eigenheiten, deren Kenntnis für eine korrekte Diagnose und Betreuung notwendig ist (Steil, 2004). Es übersteigt den Rahmen dieser Arbeit auf alle diesbezüglichen Spezifika einzugehen. In diesem Zusammenhang sei auf die Arbeiten von Steil (2004) verwiesen. 4.1 Symptomatik und Altersverlauf Wie bei traumatisierten Erwachsenen können als Kernsymptome bei Kindern und Jugendlichen nach einer Traumatisierung Intrusionen, autonome Übererregung, emotionale Taubheit und/oder negativ veränderte Affektivität und Vermeidungsverhalten auftreten. Weiterhin können in Übereinstimmung mit der Akuten Belastungsstörung bei Erwachsenen bereits unmittelbar nach der traumatischen Erfahrung Dissoziationsreaktionen mit Derealisation, Depersonalisation und allgemeiner Unfähigkeit, angemessen zu reagieren, auftreten (Anthony, Lonigan & Hecht, 1999; Steil, 2004). Weitere häufige Symptome sind Alpträume, auch mit wiederkehrender 63 64 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen Thematik, Ein- und Durchschlafstörungen, sowie übermäßige Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit. Komorbide können sich somatoforme Beschwerden und ein insgesamt verschlechterter Gesundheitsstatus entwickeln (Giaconia, Reinherz, Silverman, Pakiz, Frost & Cohen, 1995; Goenjian et al., 1995). Besonders bei kleineren Kindern können Trennungsängste und Regressionen in bereits durchlaufene Entwicklungsphasen beobachtet werden. Bingham und Harmon (1996) äußern die Ansicht, die Belastung würde sich bei Kleinkindern wahrscheinlich vorwiegend in Störungen des Affekts und des Sozialverhaltens, und in einer Dysregulation des Essens oder des Schlafens manifestieren. Ältere Kinder und Jugendliche zeigen u. U. eine eingeschränkte oder verkürzte Zukunftsperspektive („Ich werde sowieso nie die Schule beenden.“ — „Ich werde nie eine Partnerschaft haben/nie heiraten.“ — „Ich werde nie eigene Kinder haben.“ etc.) (Steil, 2004). Die veränderte kognitive Funktionsfähigkeit inklusive der begleitenden Konzentrationsstörungen führt häufig zu Einbrüchen in schulischen Leistungen. Die insgesamt instabile, stark schwankende Emotionalität, depressive Veränderungen und suizidale Handlungen können ein erhebliches Risiko darstellen. Aggressivität, Delinquenz, selbstschädigendes Verhalten, u. U. Drogenmissbrauch werden von verschiedenen Autoren als Versuche gedeutet, einen befristeten Spannungsabbau herbeizuführen (Giaconia et al., 1995; Goenjian et al., 1995; Steil, 2004). Viele dieser Symptome treten in gleicher oder zumindest ähnlicher Weise auch bei Erwachsenen auf. Abhängig vom Entwicklungsstand, speziell der emotionalen, kognitiven und verbalen Reife des Kindes oder Jugendlichen, zeigen sich aber Unterschiede in den Störungsprofilen. Das Mischungsverhältnis internalisierender und externalisierender Probleme bei Kindern unterscheidet sich häufig von dem bei Erwachsenen, woraus sich Verkennungen einer zugrundeliegenden Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen ergeben können. So kann z. B. das chronische Hyperarousal als Hyperaktivität, die geringe Impulskontrolle als Borderline-Verhalten und die Aggressivität als Oppositionelles Verhalten/Trotz fehldiagnostiziert werden (Perrin, Smith & Yule, 2000), insbesondere dann, wenn fehlende kognitive oder verbale Reife, Scham- und Schuldgefühle dazu führen, dass ein betroffenes Kind den Grund seines Leidens nicht adäquat mitteilen kann. Abhängig vom Reifegrad des autobiografischen Gedächtnisses können Kinder möglicherweise bereits ab etwa drei bis vier Jahren eine PTBS entwickeln (Drell, Siegel & Gaensbauer, 1993; Scheeringa, Zeanah, Drell & Larrieu, 1995), wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die autobiografischen Erinnerungen in diesem Alter eher fragmentarischer Natur sind und – weniger noch als bei Erwachsenen – nicht als chronologisch und faktisch exakte Aufzeichnungen einer objektiven Realität verstanden werden dürfen (Pillemer, 1998). 4.2 Diagnostik traumatischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen Die Angemessenheit der Diagnosekriterien von ICD-10 und DSM-IV, die sich hauptsächlich aus den Erfahrungen mit traumatisierten Erwachsenen ableiten, ist A: Behandlung von Katastrophenopfern — Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen aus solchen Gründen häufig angezweifelt worden. Beim ICD-10 wird ein Überdiagnostizieren der Störung als besonders problematisch angesehen (Steil, 2004). Im DSM-IV wird versucht, durch ergänzende Kriterien auf einige Besonderheiten von Traumatisierungen im Kindesalter einzugehen, ohne aber die gesamte Spannbreite der kindlichen Entwicklung abzudecken. Scheeringa und Kollegen (1995) bezweifeln deshalb auch die Sensitivität der Kriterien zumindest für Kinder unter vier Jahren, die in verschiedenen Punkten nicht mit deren Entwicklungsstand und ihren Lebensbedingungen in Einklang stehen (im DSM-IV z. B. A1, Subjektives Erleben des Traumas mit Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen; C7, Gefühl einer verkürzten Lebensperspektive; F, Klinisch bedeutsame Beeinträchtigung in wichtigen Lebensbereichen). Die Autoren schlagen revidierte, am Entwicklungsstand orientierte Kriterien vor, die einer direkten Verhaltensbeobachtung zugänglich sind (z. B. Einschränkung des Spielverhaltens statt C4, Vermindertes Interesse an Aktivitäten, die vor der Traumatisierung wichtig waren; Sozialer Rückzug statt C5, Gefühl der Entfremdung von anderen). Testtheoretische Überprüfungen ihrer Vorschläge weisen auf eine höhere Zuverlässigkeit gegenüber DSM-IV-Diagnosen hin, z. B. lag die Interrater-Übereinstimmung im Mittel bei .75 vs. .50 (Scheeringa et al., 1995; Steil, 2004). Zur konkreten Durchführung der Traumadiagnostik bei Kindern und Jugendlichen hat Steil (2004) einen Leitfaden vorgelegt, der sich an Vorschlägen von March, AmayaJackson und Pynoos (1997), Perrin und Kollegen (2000) und Thornton (2000) anlehnt. Die Autorin empfiehlt die kombinierte Anwendung eines strukturierten diagnostischen Interviews und eines Selbstbeurteilungsverfahrens, ergänzt durch Informationen aus der Verhaltensbeobachtung. Deutschsprachige Selbstbeurteilungsinstrumente für Kinder unter acht Jahren liegen nicht vor. Mit der gebotenen Vorsicht sollten Angaben und Berichte von Eltern und Lehrern in die Diagnostik einbezogen werden. In verschiedenen empirischen Untersuchungen wurde deutlich, dass Eltern und Lehrer dazu neigen, die Belastung betroffener Kinder im Vergleich zu deren eigenen Angaben grob zu unterschätzen (Korol, Green & Gleser, 1999; Martini, Ryan, Nakayama & Ramenofsky, 1990; Sack, McSharry, Clarke, Kinney, Seeley & Lewinsohn, 1994). Deblinger und Kolleginnen fanden heraus, dass Mütter die PTBS-Symptomatik als umso stärker einschätzten, je glaubwürdiger sie die Berichte ihrer Kinder fanden (Deblinger, Taub, Maedel, Lippmann & Stauffer, 1997). Die Exploration des Traumas sollte mit einem freien Bericht des betroffenen Kindes beginnen. Abhängig von Alter und verbalen Fähigkeiten kann das Kind auch gebeten werden, ein Bild zu malen und dazu eine Geschichte zu erzählen. Erst im Anschluss an den freien Bericht sollte der Therapeut Fragen stellen, um sich über relevante Einzelheiten Aufschluss zu verschaffen und Hot-Spots zu identifizieren (Steil, 2004). Eine getrennte Befragung von Kindern und ihren Eltern oder anderen Betreuungspersonen wird dringend empfohlen, um wechselseitige Beeinflussungen zu vermeiden. Die False Memory-Debatte, die etwa Mitte der 90er Jahre begann, hat deutlich gemacht, wie komplex und verantwortungsvoll der Umgang gerade mit kindlichen Erinnerungen ist. In verschiedenen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass das autobiografische Gedächtnis von Kindern um so anfälliger für Verzerrungen und Suggestionen ist, je jünger die Kinder sind, oder (in der Retrospektive) zu der Zeit waren, auf die sich die Erinnerungsleistung – oder eben die Suggestion – bezieht (Hyman & Loftus, 1998; Schacter, 1995; Zola, 1998). Dass selbst für derartige Situationen trainierte Psychologen nicht in der Lage waren, reliabel zwischen wahren und auf Suggestion oder Ver- 65 66 A: Behandlung von Katastrophenopfern — Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen zerrung beruhenden Berichten zu trennen, geht u. a. aus der Arbeit von Ceci, Loftus, Leichtman und Bruck (1994) hervor. 4.3 Betreuung und Therapie traumatisierter Kinder und Jugendlicher nach Katastrophen Die Berechtigung der Forderung nach einem systematischen Ansatz bei der Betreuung von Katastrophenopfern wird besonders deutlich, wenn es um die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen geht. Eltern und Pflegepersonen sind wichtige Interaktionspartner und Modelle, die adaptive Coping-Strategien vermitteln und die für emotionale Sicherheit und Stabilität sorgen können … oder auch nicht. Kinder und Heranwachsende leiten die Interpretation des traumatischen Geschehens und seiner Folgen auch aus den Reaktionen naher Bezugspersonen ab. Über die Assoziation von elterlicher und kindlicher Psychopathologie geben z. B. die Arbeiten der Gruppe um Deblinger ab 1996 und von Steil und Kollegen Auskunft (Steil, Hempt & Deffke, 2001). Bei 7- bis 15-jährigen Opfern eines Verkehrsunfalles trugen z. B. vermeidungsförderndes Verhalten und dysfunktionale Kognitionen der befragten Eltern wesentlich zur Aufklärung der Schwere der posttraumatischen Symptomatik bei (Steil et al., 2001). Psychosoziale Beratung von Eltern und Lehrern. Es wäre jedoch zu kurz gedacht, nur an die Rolle der Eltern oder gleichwertiger Bezugspersonen zu denken. La Greca, Vernberg, Silverman und Prinstein (1994) beschreiben ein Beratungsmodell für Schulen, das Lehrer und nicht klinisch arbeitende Berater darin unterstützen soll, weniger schwer belastete Kinder in ihren Bewältigungsbemühungen zu unterstützen. Kernaspekte dieses Betreuungsmodells sind die Stärkung sozialer Einbindung und Unterstützung und die Hinlenkung zu positiv ausgerichteten Coping-Strategien, und nicht zuletzt die Psychoedukation der Eltern über die Bedeutung und Bewertung von Symptomen. KBT bei Kindern und Jugendlichen. Als beeindruckend wirksam hat sich auch bei Kindern und Jugendlichen die kognitiv-behaviorale Therapie (KBT) erwiesen. Auch die i.d.R. sehr schweren Folgen interpersoneller Gewalt können bei Kindern mit diesen Interventionen dauerhaft gelindert bzw. geheilt werden. Bewährt hat sich ein Behandlungskonzept mit zwei Hauptbestandteilen. 1) Konfrontation mit den traumatischen Erinnerungen in sensu, mit den Zielen der Habituation an die bedrohlichen Erinnerungen, der Elaboration der traumatischen Geschehnisse, und der Integration neuer, korrigierender Erfahrungen. 2) Kognitive Interventionstechniken, mit den Zielen der Identifikation und gezielten Veränderung negativer Kognitionen zum Trauma und seinen Folgen, und der „autobiographischen Korrektur“. Die Wirksamkeit der kognitiv-behavioralen Therapie (KBT) gilt als empirisch nachgewiesen und ist bei Erwachsenen die Behandlungsmethode der Wahl. Auch bei Kindern und Jugendlichen konnten in kontrollierten und randomisierten Studien Erfolg versprechende Ergebnisse erzielt werden. King et al. (1999) geben eine detaillierte Übersicht über die Literatur bis 1999. Am aussagekräftigsten sind sechs kontrollierte und randomisierte Studien zur KBT bei Traumatisierung im Kindesalter: Die behandelten Kinder waren überwiegend Opfer sexuellen Missbrauchs (als schwerste Form einer Traumati- A: Behandlung von Katastrophenopfern — Traumatische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen sierung). Teilweise umfassten die Anordnungen die gleichzeitige Behandlung der Eltern traumatisierter Kinder. Allgemein kam es zu einer bedeutsamen Reduktion von Belastung, von depressiver und ängstlicher Symptomatik, die klinische Relevanz der Behandlungsmethode kann ebenfalls als gegeben betrachtet werden (z. B. Fortfall der Diagnose im Follow up bei 67% Behandlungsgruppe vs. 20% Warteliste nach 12 Wochen) (King et al., 2000). Follow-ups zwischen 12 Wochen und 24 Monaten zeigen eine statistisch bedeutsame, teils exzellente Wirksamkeit (Deblinger, Steer & Lippmann, 1999). Besonders gut untersucht ist ein Therapiemanual der Arbeitsgruppe um Deblinger (Deblinger & Heflin, 1996), hier liegen zusätzlich zu den Untersuchungen der Autorinnen auch Bestätigungen anderer Arbeitsgruppen und Katamnesedaten vor. Kinder und Jugendliche, die durch eine Katastrophe traumatisiert sind, haben ein besonderes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Wiederherstellung des Sicherheitsgefühls, während ihre Eltern häufig durch Sorgen und Mit-Leiden belastet sind. Die Einbindung mindestens eines Elternteils in die Behandlung, oder zumindest ihre Beratung, ist ratsam und hat sich als wichtig für den Behandlungsverlauf herausgestellt (Steil, 2004). Deblinger und Kollegen (1996, 1999) kamen z. B. in ihren Studien zu dem bemerkenswerten Ergebnis, dass ein Elterntraining alleine (ohne Behandlung des traumatisierten Kindes) in der Katamnese 24 Monate nach Therapieende einen vergleichbaren Effekt hatte wie die gleichzeitige Behandlung von Kind und Elternteil. Neben der KBT wird verschiedentlich auch EMDR zur Therapie von traumatisierten Kindern und Jugendlichen angewendet (Greenwald, 1998; Muris & Merckelbach, 1999). Die Wirksamkeit dieser Intervention wurde allerdings bislang kaum in kontrollierten und randomisierten Designs untersucht. Chemtob, Nakashima und Carlson (2002) beschreiben die Behandlung von Kindern, die ein Jahr nach einer initialen Intervention noch deutliche traumatische Beschwerden zeigten. Eine Behandlung mit drei Sitzungen EMDR zeigte eine signifikante, wenn auch eher mäßige Reduktion der TraumaSymptomatik. Pieper (in Druck) beschreibt eine Modifikation des ursprünglich für Erwachsene konzipierten siebenstufigen Behandlungskonzepts für traumatische Störungen (SBK) für Kinder. Die Behandlung besteht aus einer Kombination kognitivbehavioraler Interventionen mit EMDR. Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die Psychotraumatologie auch hier in einer wenig befriedigenden Situation befindet. La Greca (2001) berichtet über lediglich drei kontrollierte Studien über Behandlung von Kindern nach einer Katastrophe; Norris und Kollegen als internationale Expertenkommission reklamieren in ihrer Literaturübersicht mehrfach, wie dringend und notwendig kontrollierte Studien zur Wirksamkeit verschiedener Behandlungskonzepte nach Katastrophen sind, und wie spärlich das verfügbare Material derzeit noch ist (Norris, Friedman & Watson, 2002; Norris, Friedman et al., 2002). Beispielsweise liegen über die Effektivität kognitivbehavioraler Verfahren im Rahmen der Direkt- und Frühintervention bislang keine publizierten Forschungsergebnisse vor. 67 B: Felderfahrungen nach Katastrophen und zielgerichteter Gewalt an Schulen 1. 2. 3. 4. Das Grubenunglück von Borken (1988)...........................................69 Das ICE-Unglück von Eschede (1998) ..........................................159 Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen (1999) ............................................................................183 Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt (2002) ...............................................................................231 1. Das Grubenunglück von Borken (1988) 1.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds Die ausführliche Darstellung des Unglücksvorgangs in Abbildung B 1.1 bezieht sich auf die Einsatzdokumentation des Landrats des Schwalm-Eder-Kreises (1988). Abbildung B1.1: Darstellung des Grubenunglücks von Borken Am 1. Juni 1988, gegen 12.30 Uhr, erschütterte eine heftige Explosion die Umgebung der Stadt Borken in Nordhessen. Über der etwa zwei Kilometer entfernten Zeche Stolzenbach des Braunkohletiefbaus Borken erhob sich eine schwarze Wolke aus Rauch und Kohlenstaub. In der bis in eine Tiefe von 170 m hinab reichenden Grube war es zu einer Explosion gekommen. Aus dem Materialschrägstollen, wie auch aus der Schachthalle des Seilfahrschachtes und den Wetterschächten traten dunkle Rauch- und Staubwolken aus. Die aus der Grube kommende Druckwelle zerstörte den ca. 20 m langen oberirdischen Teil des als Betonröhre ausgebildeten Materialschrägstollens völlig und beschädigte umliegende Grubenanlagen und -gebäude schwer. Acht Grubenarbeiter erlitten durch die aus dem Materialschrägstollen herausgeschleuderten Bauteile sowie die entweichende Hitze und Druckwelle über Tage zum Teil schwerste Verletzungen. Zu den 57 eingefahrenen Bergleuten, Handwerkern und Aufsichtspersonen bestand kein Kontakt mehr. Die Energieversorgung und somit auch die Bewetterung (Zuführung von Frischluft), Entwässerung und Beleuchtung der Grube waren ausgefallen. 70 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Das betriebsinterne Telefon- und Grubenfunknetz sowie die Druckluftversorgung und sämtliche Fördereinrichtungen waren zerstört. Aus den bis in eine Tiefe von ca. 80 m reichenden drei Wetterschächten der Grube waren die dort installierten Notleitern ganz oder teilweise herausgeschleudert worden. Die oberirdischen Gebäudeteile der Wetterschächte wiesen erhebliche Zerstörungen auf. Das Zechengelände wie auch die nähere Umgebung war von einer Staubschicht bedeckt. Unter dem Eindruck des bis in die umliegenden Ortschaften wahrnehmbaren Ereignisses machten sich besorgte Angehörige der in der Grube Stolzenbach Beschäftigten sowie Schaulustige mit Fahrzeugen auf den Weg zum Zechengelände der Grube. Eine Einsatzleitung, bestehend aus dem Leiter des Bergwerkes, dem Bergamt Kassel sowie den Hauptstellen für das Grubenrettungswesen Clausthal-Zellerfeld und Essen ordnete Maßnahmen zur Rettung und Bergung an. Insgesamt waren 29 Grubenwehren einschließlich Tauchergruppe und Einsatzleitung mit insgesamt 807 Mann im Einsatz. Neben der Erkundung und Suche nach Überlebenden bestand deren Hauptaufgabe in dem Erstellen von Wetterverschlägen, um eine möglichst effiziente Wetterführung in der Grube zu ermöglichen. Diese Einsätze waren wegen der nahezu totalen Zerstörung der Strecken und wegen einer sehr hohen Konzentration von Kohlenmonoxyd extrem anstrengend und gefährlich. Von den 57 eingefahrenen Bergleuten waren 51 entweder durch die Wucht der Explosion oder durch das Einatmen der mit Kohlenmonoxyd verseuchten Luft sofort tot. Ein Teil von ihnen wurde in den ersten zwei Tagen geborgen. Sechs Bergleute hatten sich entgegen der Fluchtrichtung (nach Über-Tage) in die Schachtanlage in einen Blindstollen zurückgezogen und dort noch atembare Wetter vorgefunden. Sie harrten dort 65 Stunden aus und konnten schließlich von einem Trupp der Grubenwehr gerettet werden. Die Suche nach den restlichen Vermissten zog sich über lange Zeit hin, erst neun Tage nach der Explosion konnte der letzte Bergmann tot geborgen werden. 1.1.1 Beschreibung des Umfelds Die im Jahre 1988 zur Preussen Elektra AG gehörende Schachtanlage Stolzenbach des Braunkohlebergwerks Borken liegt in Nordhessen, ca. 35 km südlich der Stadt Kassel. Neben einem übertägigen Braunkohleabbau handelte es sich bei der Grube Stolzenbach zusammen mit der rund 50 km entfernt gelegenen Grube Hirschberg um die einzigen noch bestehenden untertägigen Braunkohleabbauorte in Deutschland. Im Tiefbau Stolzenbach wurde aus dem in ca. 60 bis 170 m Tiefe liegenden, 4 bis 6 m starken Kohleflöz seit 1956 Braunkohle gefördert. Die Kohleabfuhr aus den im Weitungs- und Streifenbruchbauverfahren betriebenen Abbauabteilungen erfolgte über Kettenstegförderer und Bandförderanlagen umschlagfrei durch einen Bandschrägstollen bis zu dem übertägigen 600 t fassenden Hochbunker, aus dem die Kohle auf die zum Kraftwerk Borken führende Werkbahn umgeschlagen wurde. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Die in der Grube beschäftigten Bergleute, Handwerker und Aufsichtspersonen kamen zum größten Teil aus der Kleinstadt Borken, die mit Ortsteilen zum Zeitpunkt des Unglücks 15 000 Einwohner zählte, oder umliegenden kleinen Ortschaften. Insgesamt waren bei der Preussen Elektra Ende 1987, also ein halbes Jahr vor der Katastrophe, 432 Mitarbeiter im Bergbau und 429 im Kraftwerk beschäftigt. Durch das Unglück wurden 51 Kumpel mit einem Schlag aus ihrer Mitte gerissen, das bedeutet, 12% aus der Gemeinschaft der Mitarbeiter im Tiefbau waren tödlich verunglückt. Die Atmosphäre in Borken ist dörflich bis kleinstädtisch, d. h. man ist einander bekannt. Wer keinen direkten Angehörigen bei dem Unglück verloren hatte, war befreundet mit einem oder mehreren Betroffenen oder kannte zumindest jemand von ihnen, zum Beispiel über einen Sportverein, die Kirche oder eine andere Verbindung. Besonders die Mitarbeiter des Tiefbaus waren als verschworene Gemeinschaft zu sehen, die meisten Familien kannten sich untereinander. Beispielhaft für die empfundene Nähe und das Verhältnis untereinander sei der Satz eines Bergmanns zitiert, der selber verletzt wurde und dessen Sohn bei dem Unglück umkam: „Ich habe bei dem Unglück einen Sohn und 51 Brüder verloren!“ Das Kohlekraftwerk und der Bergbau galten seit Generationen als Garant für Arbeit und Einkommen. Fast 3 800 Arbeitsplätze hingen direkt oder indirekt von der Preussen Elektra ab. Die Mitarbeiter verdienten gut, die Geschäftsleute schätzten ihre Kaufkraft. Der Konzern zahlte in Borken ca. 90% der Gewerbesteuer. Die Integration der ausländischen, meist türkischen Kollegen stieß auf die üblichen Probleme, hatte aber insgesamt eine gute Qualität. Es gab eine türkische Moschee, türkische Geschäfte, eine türkische Schneiderei, ein Café und die Integration der Kinder in den Borkener Kindergärten, Schulen und Sportvereinen. Das soziale Miteinander wurde besonders gefördert und beeinflusst durch die so genannte „Werksfürsorge“, in der zwei mit sozialarbeiterischen Aufgaben betraute Mitarbeiterinnen des Unternehmens arbeiteten. Die Werksfürsorge gab es in Borken seit den 30iger Jahren. Ihren Ursprung hatte sie als soziale Einrichtung für die Familien von Bergleuten. Sie kümmerte sich um die Kinder der Mitarbeiter, die zur Höhensonne, zu medizinischen Bädern, zum Mittagsschlaf und zum Kakao trinken in ein extra für diese Zwecke unterhaltenes Haus kamen. Die Bedürftigkeit von Witwen wurde überprüft und entsprechende Hilfen in Form von Weihnachts- oder Kohlebeihilfen beantragt. Kinder wurden in Erholungsheime verschickt, eine Werksbücherei eingerichtet, in der Belegschaftsmitglieder kostenlos Bücher ausleihen konnten. Bei schwierigen Familiensituationen wurden von den Werksfürsorgerinnen Hausbesuche durchgeführt und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Belegschaftsmitglieder, besonders die Gastarbeiter kamen in die Werksfürsorge, um Hilfestellungen bei Behördengängen, Ausfüllen von Vordrucken und ähnliches zu erbitten. Später wurde der Betriebsärztliche Dienst der Werksfürsorge zugeordnet. Die Werksfürsorge war so zu einer wichtigen Einrichtung und häufig frequentierten Anlaufstelle für größere und kleinere Nöte der Betriebsmitglieder geworden. Mit dem Grubenunglück wurde das Aufgabengebiet der Werksfürsorge noch umfangreicher: Es galt zunächst, mit den Angehörigen die Formalitäten wie Sterbegeld, Beerdigungen, Umgang mit Lebensversicherungen etc. zu regeln. Anschließend war die Werksfürsorge die zentrale Anlaufstelle für die vom Grubenunglück Betroffenen von 71 72 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken organisatorischen Fragen bis zur psychologischen Betreuung, die ebenfalls im Haus der Werksfürsorge untergebracht wurde. 1.1.2 Traumatische Stressoren und typische Reaktionen Die gesamte Gemeinde war durch das Grubenunglück betroffen. Die Mehrzahl der Bevölkerung hatte entweder direkt einen Angehörigen verloren oder war mehr oder minder intensiv mit einem der Umgekommenen, Verletzten oder Geretteten und deren Familien befreundet oder bekannt. Man wusste zwar, dass die Arbeit unter Tage gefährlich war, aber mit einem Unglück dieses Ausmaßes hatte niemand auch nur im Entferntesten gerechnet. Der von JanoffBulman (1985) beschriebene „Glaube an die eigene Unverwundbarkeit“ als lebenstragende Vorannahme in einem als im Einzelnen gefährlichen, aber letztlich doch sicheren Arbeitsalltag war weit verbreitet. Typische Äußerung der Bergleute in diesem Zusammenhang war: „LKW fahren ist gefährlicher!“ Die Erschütterung und der Zusammenbruch des Vertrauens in die Sicherheit des Arbeitsplatzes im Tiefbau ist als genereller Stressor für die gesamte Gemeinde zu beschreiben. Die Auswirkungen im Gemeindeleben in den ersten Wochen nach dem Unglück waren drastisch: Die Stadt und ihre Menschen wirkten erschüttert und gelähmt. Feste und Feiern wurden abgesagt. Resignation und Verzweiflung herrschten bei den Angehörigen. Die ganze Gemeinde trauerte um die Toten. Die Stadt war von einer allgemeinen Ungewissheit und Angst vor der Zukunft befallen, da schnell klar wurde, dass das Bergwerk früher als ursprünglich geplant geschlossen werden würde. Im Folgenden sollen die Belastungen für die Betroffenen geordnet nach der zeitlichen Perspektive dargestellt werden, aufgeteilt in peri-traumatische Stressoren, also die traumatischen Einflüsse während des Unglücksgeschehens, und post-traumatische Belastungen, die sich in den Wochen nach dem Unglück entwickelten. Anschließend werden typische psychische Reaktionen aufgeführt, die viele Betroffene (nicht alle und nicht alle komplett) entwickelten, aufgeteilt in akut, mittel- und langfristig. Als Betroffene gelten: • Witwen, Eltern und andere Angehörige, • Kinder der umgekommenen Bergleute, • Verletzte und gerettete Bergleute, • Grubenwehren und andere Einsatzkräfte der Bergung, • Betriebsangehörige in Verantwortungspositionen. Witwen, Eltern und andere Angehörige Peri-Traumatische Stressoren: • Langes, zum Teil tagelanges, banges Warten an der Unglücksstelle, Ungewissheit, ob der Mann, Sohn, Bruder oder Vater überlebt hat, B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken • Als sechs Bergleute nach 65 Stunden lebend gerettet werden, Hoffnung auf ein Überleben des eigenen Angehörigen, • Auf dem Zechenhof das Beobachten anderer Betroffener, die weinend und verzweifelt zusammenbrechen, wenn sie die Todesnachricht übermittelt bekommen, • Überbringen der Todesnachricht des eigenen Angehörigen, • Konfrontation mit Leichen, die vom Schacht in die Waschkaue zur Identifikation gebracht werden, • Identifikation von zum Teil stark entstellten Leichen und Abschied nehmen am Sarg, • Presse, die versucht Fotos und Interviews zu bekommen. Post-traumatische Belastungen: • Die eigene Trauer, • Die Trauer der Kinder, • Probleme bei der Identifikation mit der Rolle als allein erziehender Elternteil, • Bei Eltern: Verlust der Zukunftsperspektive durch den Tod des Sohnes, • Häufige Anwesenheit der Presse, Medienpräsenz. Typische Reaktionen akut: • Psychische Schockzustände mit Symptomen wie: Betäubung, Erstarrung, Ungläubigkeit, Verwirrtheit, Zusammenbruch verbunden mit Gefühlsausbruch (seelischer Schmerz, Trauer, Angst, Zorn) und vegetativen Symptomen (Tachykardie, Schwitzen, Blasswerden, Zittern), • Gefühle der Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, Angst und Niedergeschlagenheit, • Dissoziative Zustände wie: Gefühl der Unwirklichkeit (z. B. „wie im Traum“), Derealisationsempfindungen (Umwelt, Gegenstände verändert) Störung des Zeitempfindens (z. B. „wie in Zeitlupe“). Typische Reaktionen mittelfristig: • Zeichen akuter Trauerreaktionen mit: depressiver, ängstlicher, verzweifelter Stimmung, Antriebshemmung, innerer Leere, somatischen Beschwerden (Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Obstipation, Durchfälle, Atembeschwerden), sozialem Rückzug. • Betäubt Sein, nicht wahrhaben wollen, was passiert ist, Verleugnen der Realität, abgestumpft sein, Antriebslosigkeit und Passivität. • Immer wiederkehrende Bilder von besonders schrecklichen Details und Albträume. • Ein- und Durchschlafstörungen, starke körperliche Anspannung, überzogene Schreckreaktionen. • Ständiges Grübeln über die Unglücksursache und was man hätte tun können, um das Unglück zu vermeiden. Typische Reaktionen langfristig: • Anzeichen posttraumatischer Belastungsreaktionen mit: • Intrusionen in Form von: Bildern vom zerstörten Zechengelände, die flashbackartig auftreten und fortlaufenden belastenden Träumen, • intensiven Belastungsgefühlen bei Presseberichten über das Unglück oder sonstigen Hinweisreizen, die an das Grubenunglück erinnern, • Vermeiden von Konfrontation mit Gedanken oder Gefühlen, die mit dem Trauma verbunden sind und Bemühungen, Situationen zu vermeiden, die Erinnerungen 73 74 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken an das Unglück auslösen., z. B. konsequentes weiträumiges Umfahren des Zechengeländes, • andauernden Symptomen erhöhter Erregung gekennzeichnet durch Ein- oder Durchschlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz und einer erhöhten Reaktionsbereitschaft, z. B. beim Hören vom Martinshorn, • Körperliche Beschwerden in Form von: Herzrasen, Schwitzen, Frieren, Kopf-, Bauch-, Rückenschmerzen, Durchfälle, • Anzeichen komorbider Störungen wie: • Depressive Episoden, Angststörungen, Anpassungsstörungen, dissoziative Störungen, somatoforme Störungen. Kinder Peri-Traumatische Stressoren: • Konfrontation mit der Situation auf dem Zechengelände (s. o.) mit der zusätzlichen Problematik, viele Dinge kognitiv nicht einordnen zu können, • Ungewissheit über das Schicksal des Vaters, • Konfrontation mit Leichen in der Turnhalle, in der die verunglückten Bergleute aufgebahrt waren, • Abschied am Sarg des Vaters. Posttraumatische Belastungen: • Angstvoll allein zuhause sein mit den Gedanken an den vermissten Vater, weil die Mutter sich nicht immer um das Kind kümmern konnte, • Trauer über den Verlust des Vaters, die oft nicht gezeigt werden konnte, da die Kinder Angst hatten, die Mutter zu sehr zu belasten und auch sie noch zu verlieren. Typische Reaktionen akut: • starke Verunsicherung, Ängste und Verzweiflung, Typische Reaktionen mittelfristig: • Verlust soeben erlernter Fähigkeiten, wie z. B. Sauberkeit, • Bei kleineren Kindern: zwanghaftes Durchspielen des Unglücks, • Bei Jugendlichen: Wut gegen die Firma, in der ihr Vater umgekommen ist. Typische Reaktionen langfristig: • Verhaltensauffälligkeiten wie: Sozialer Rückzug, Konzentrations- und Leistungsprobleme in der Schule, • Ängste und emotionale Störungen, • Aggressives Verhalten und Störung des Sozialverhaltens, • Unfähigkeit, über das Ereignis und die eigenen Gefühle zu sprechen, • Somatisierungen in Form von: Essstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Husten, Bauchschmerzen, Enuresis, Enkopresis, • Überstarke Angst, der Mutter könne etwas passieren. Verletzte Bergleute Peri-Traumatische Stressoren: • Erleben der Explosion und der Feuerwelle über Tage unter Todesgefahr, B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken • Verletzung der körperlichen Unversehrtheit (Verbrennungen und Verletzungen) durch Feuer und umher fliegende Betonteile, • Konfrontation mit anderen Bergleuten, die schwere Verletzungen erlitten hatten, • Konfrontation mit Leichen und verzweifelten Angehörigen auf dem Zechengelände. Posttraumatische Belastungen: • Der Verlust der vielen Freunde und Kollegen, • Teilweise zusätzlicher Verlust des Sohnes, • Auswirkungen der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auf körperliches und geistiges Befinden und auf die familiäre Situation, • Unsicherheit bezüglich der weiteren beruflichen Perspektive. Typische Reaktionen akut: • Schmerz- und Schockreaktionen, • siehe die Reaktionen bei Angehörigen. Typische Reaktionen mittelfristig: • siehe die Reaktionen bei Angehörigen, zusätzlich: • Stark eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit, auch nach Abklingen der akuten Verletzungen, • Ein- und Durchschlafstörungen, starke körperliche Anspannung, • überzogene Schreckreaktionen (z. B. beim Zuschlagen einer Tür: „Das war der Knall der Explosion!“). Typische Reaktionen langfristig: • Deutliche Anzeichen posttraumatischer Belastungsreaktionen, • Symptome komorbider Störungen wie Depressiver Episoden, Angststörungen, undifferenzierte Somatisierungsstörungen. Gerettete Bergleute Peri-Traumatische Stressoren: • 65 Stunden unter Tage eingeschlossen sein unter Todesangst, • Immer knapper werdende atembare Luft, • Konfrontation mit sterbenden oder schon getöteten Kollegen, • Ungewissheit, vergessen worden zu sein, • Konfrontation mit verzweifelten Frauen und Männern über Tage, die auf überlebende Angehörige warteten. Posttraumatische Belastungen: • Nach der Rettung die Information, dass 51 Freunde und Kollegen bei der Katastrophe umgekommen sind. • Konfrontation mit der Tatsache, dass sie schon für tot erklärt worden waren. • Konfrontation mit der Tatsache, dass man nicht gezielt nach ihnen gesucht, sondern sie im Rahmen einer Erkundungsbohrung gefunden hatte, • Häufige Anrufe von Presse und Fernsehen, die „die Helden von Borken“ präsentieren wollten, • Unsicherheit bezüglich der beruflichen Zukunftsperspektive. 75 76 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Typische Reaktionen akut: • Keine Freude, sondern Schuldgefühle, die einzigen Überlebenden der Katastrophe zu sein, • Symptome erhöhter psycho- physiologischer Erregung; • Dissoziative Symptome wie: Ungläubigkeit und Unfähigkeit, das Geschehene zu begreifen. Typische Reaktionen mittelfristig: • Starkes Rückzugsverhalten aus Angst vor Konfrontation mit den Witwen der umgekommenen Kollegen, • Trauer um die verlorenen Kumpel, • Suizidale Gedanken wie: „Es wäre besser, wir wären bei denen da unten geblieben!“, • Gefühle der Sinnlosigkeit und Leere. Typische Reaktionen langfristig: • Deutliche Anzeichen posttraumatischer Belastungsreaktionen, • Angst vor Dunkelheit und engen Räumen, • Angst unter Tage einzufahren, • Anzeichen komorbider Störungen wie Depressionen, Agoraphobien, undifferenzierte Somatisierungsstörungen. Grubenwehren und andere Einsatzkräfte der Bergung Peri-Traumatische Stressoren: • Einfahren in die Grube unter hoher Gefährdung des eigenen Lebens; • Konfrontation mit schrecklichen Bildern der Zerstörung unter Tage, • Bergen und Transportieren vieler Toter in einer engen Gondel bei direktem Körperkontakt mit den Toten, • Konfrontation mit bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten Leichen, • Bergen einzelner Leichenteile, • Angehörigen die Nachricht überbringen, dass es nur noch Tote gibt, • Konfrontation mit dem Leid und der Verzweiflung der Angehörigen über Tage. Posttraumatische Belastungen: • Verlust der vielen Freunde und Arbeitskollegen, • Die Erkenntnis, Menschen gerettet haben zu wollen, aber nur noch Tote geborgen zu haben, • Sich als hilfloser Helfer zu fühlen. Typische Reaktionen akut: • Erschöpfung nach dem körperlich schweren Einsatz, • Unruhe, starke körperliche Anspannung, Unfähigkeit zur Ruhe zu kommen. Typische Reaktionen mittelfristig: • Intrusionen, Wiedererleben der schrecklichen Bilder unter Tage flash-back-artig tagsüber und in Albträumen in der Nacht; • Sich selbst und die Arbeit der Grubenwehr in Frage stellen, Gefühle der Sinnlosigkeit, • Unruhezustände, • Suizidale Gedanken, sich zu den toten Kollegen hingezogen fühlen. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Typische Reaktionen langfristig: • Deutliche Anzeichen posttraumatischer Belastungsreaktionen, • Anzeichen komorbide Störungen wie Angststörungen, Panikattacken, depressive Episoden und somatoforme Störungen. Betriebsangehörige in Verantwortungspositionen Peri-Traumatische Stressoren: • Konfrontation mit den Vorgängen auf dem Zechengelände am Unglückstag und in den Tagen danach, • Direktes Erleben der Bergungs- und Rettungsvorgänge, • Identifikation der toten Mitarbeiter, • Entscheidungen treffen und verantworten zu müssen, von denen das Leben der Bergleute und der Einsatzkräfte abhing. Posttraumatische Belastungen: • Ständiges Grübeln, ob das Unglück hätte verhindert werden können und ob man zur Verantwortung gezogen wird, • Blicke und Äußerungen von Angehörigen, verantwortlich für den Tod der Bergleute zu sein, • Der Verlust vieler Freunde und Kollegen, die eigene Trauer. Typische Reaktionen akut: • nicht zur Ruhe kommen können, • Arbeiten bis zur Erschöpfung. Typische Reaktionen mittelfristig: • Intrusionen und ständiges Beschäftigen mit den Bildern der zerstörten Grube, den Toten und den Angehörigen, • Schlafstörungen und Unruhezustände, • Grübeln um die eigene Verantwortlichkeit, • Schuldgefühle besonders bei denjenigen, die die Schicht mit einem Kollegen getauscht hatten, der dann an ihrer Stelle umgekommen war, • Sozialer Rückzug, vor allem Vermeiden weiterer Begegnungen mit den Angehörigen. Typische Reaktionen langfristig: • Anzeichen depressiver und somatoformer Störungen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für alle aufgeführten betroffenen Personengruppen das A-Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-IV erfüllt war: 1. Sie waren als Opfer, Zeuge oder in der Konfrontation einem traumatischen Ereignis ausgesetzt, bei dem eine aktuelle Bedrohung von Tod oder ernsthafter Verletzung bestand und intensive Furcht, Hilflosigkeit, oder extremer Schreck erlebt wurden. Besonders diejenigen Personen, die als Einsatzkräfte, Verletzte, Gerettete oder Angehörige auf dem Zechengelände traumatisierende Details gesehen hatten, erfüllten das B-Kriterium: 77 78 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken 2. Das traumatische Ereignis wurde von Ihnen auf verschiedene Weisen (Intrusionen, Flashbacks, Träume, Reaktion auf Auslösereize) wiedererlebt. 3. Viele Betroffene aus allen aufgeführten Gruppen zeigten ständiges Vermeidungsverhalten von traumabezogenen Reizen und eine Betäubung der allgemeinen Ansprechbarkeit. 4. In allen Gruppen zeigten sich andauernde Symptome erhöhter physiologischer Erregung. 5. Die Symptome hielten länger als einen Monat an, bei einigen brach die Symptomatik erst nach einem halben Jahr oder später aus. Bei der Beschreibung der traumatischen Stressoren und der Belastungen für die Betroffenen darf der von Film- und Printmedien ausgehende zusätzliche Belastungsanteil nicht unerwähnt bleiben. In Gesprächen mit den Betroffenen in den ersten Wochen der Betreuung wurde die von Medien- und Pressevertretern ausgehende Belastung häufig thematisiert. Pressevertreter aller regionalen und der meisten überregionalen Zeitungen waren sehr schnell vor Ort und blieben dort während der gesamten Bergungs- und Rettungsmaßnahmen und der Trauerfeier. 1988 war die Anfangszeit der privaten Fernsehanstalten, und diese konkurrierten mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten um Einschaltquoten. Das Grubenunglück war ein Medienereignis ersten Ranges mit Aktivitäten von Journalisten, wie es sie bis dato in Deutschland nicht gegeben hatte. Schon wenige Stunden nach dem Unglück hatten Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen auf einer Wiese Übertragungswagen, Sendemasten, Wohnmobile und Wohnwagen aufgebaut. Ein Hubschrauber eines Privatsenders filmte aus der Luft und übertrug Bilder der Bergungsarbeiten und verzweifelter Angehöriger. Einige versuchten verkleidet als Rot-Kreuz-Helfer, Feuerwehrleute oder als Pfarrer in die Wohnstuben der Angehörigen oder in die Turnhalle, in der die Toten aufgebahrt waren, einzudringen, um dort Fotos zu schießen, die am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlicht wurden. Es gab Szenen, in denen bis in den Privatbereich verfolgte Betroffene aus Verzweiflung und Wut handgreiflich gegen filmende Kameraleute wurden. Viele Betroffene beschrieben, dass sie durch die Presse- und Medienvertreter genauso belastet seien, wie durch das eigentliche Unglück. Zum Jahrestag des Unglücks und in den Jahren danach bekundeten immer wieder Vertreter von Presse, Fernsehen und Film ihr Interesse, die Entwicklung der Katastrophenbewältigung darzustellen. In Absprache mit der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe (s. u.) und der Presseabteilung der Preussen Elektra wählte der Autor der vorliegenden Arbeit wenige seriöse Angebote aus und vermittelte Kontakte zu Betroffenen, die bereit waren, über ihre Situation und Entwicklung Auskunft zu geben. Im Folgenden sollen die auf verschiedenen Ebenen durchgeführten Interventionen dargestellt und typische Probleme bei deren Implementierung erörtert werden. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken 1.2 Interventionen und deren Implementierung 1.2.1 Systemebene Unmittelbar nach dem Unglück wurde die Werksfürsorge über die Ereignisse informiert und leistete psychische erste Hilfe bei den Angehörigen der eingeschlossenen Bergleute. Fachleute aus dem Betrieb (Betriebsarzt, Betriebsleitung und Betriebsrat), und von außen dazu gekommene Helfer (wie der Leiter der psychosomatischen Abteilung der Universität Marburg, Notärzte und DRK-Mitarbeiter) trafen am Unglücksort zusammen, erörterten Hilfsmöglichkeiten und bildeten die Basis der „Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe“, aus der heraus alle späteren Betreuungsmaßnahmen entwickelt wurden. Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe Unter der Projektkoordination des Leiters der Abteilung für Psychosomatik des Zentrums für Innere Medizin der Universität Marburg schlossen sich in der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe freiwillige Helfer aus dem Umfeld des Unglücksbetriebes und der Stadt Borken sowie externe Fachleute zusammen. Die ortsansässigen Helfer waren: • die Werksfürsorgerinnen vom Kraftwerk und Bergbau Borken (KBB) der Preussen Elektra AG, • die Direktion von KBB, • der Betriebsratsvorsitzende von KBB, • der Werksarzt von KBB, • weitere Mitarbeiter von KBB, • praktische Ärzte der Stadt Borken, • Lehrer der Schulen der Stadt Borken, • Pfarrer der Gemeinde Borken, • Vertreter der islamischen Gemeinde Borken, • Vertreter des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die externen Fachleute waren: • der Leiter der Abteilung für Psychosomatik des Zentrums für Innere Medizin der Universität Marburg, • ein Diplom Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, der Autor dieser Arbeit, • eine türkische Diplom Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, • ein Vertreter des Mutterkonzerns, der Preussen Elektra, • eine Professorin für Psychiatrie an der Universität Istanbul als Projektsupervisorin. Durch diese Zusammensetzung der Helfer war die Voraussetzung für eine einerseits Gemeindenahe und -orientierte Hilfe gegeben, andererseits war die Einbeziehung einer umfassenderen fachpsychologischen, psychiatrischen, an den Erkenntnissen der internationalen Forschung zur Betreuung von Katastrophenopfern orientierten Herangehensweise gewährleistet. 79 80 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Eine der Hauptaufgaben der Arbeitsgruppe bestand zunächst darin, die Gruppen der Betroffenen zu definieren und die jeweiligen Hauptbetreuungsaufgaben festzulegen. Folgende Gruppen wurden benannt: • Die 51 Toten, derer in angemessener Art zu gedenken ist, • Die 50 Familien der Toten und ihre 81 Kinder, • Die acht über Tage verletzten Bergleute und deren Familien, • Die sechs geretteten Bergleute und deren Familien, • Die verschiedenen Grubenwehren und andere Akuthelfer, • Arbeitskollegen der getöteten Bergleute, die den Unfall miterlebt hatten, • Betriebsangehörige in besonderen Verantwortungspositionen. Als Hauptbetreuungsaufgabe wurde inhaltlich festgelegt, für die Betroffenen des Grubenunglücks Hilfen anzubieten, „die der Entstehung von Krankheiten und/oder Befindensstörungen sowie psychosozialer Dekompensation entgegenwirken“ (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). Als Maßnahmen wurden im „Hilfsprogramm zur gesundheitlichen Betreuung der Betroffenen des Grubenunglücks in Stolzenbach bei Borken“ genannt: • Hausbesuche durch die Werksfürsorge, teilweise begleitet durch Betriebsrat oder Betriebsleitung, zur Pflege der jahrelangen Kontakte zu den Mitarbeitern und ihren Familien und zur Vermittlung der weiteren Hilfsangebote, • Fallbesprechungen, in denen die Probleme der direkt Betroffenen laufend erfasst werden, insbesondere im Hinblick auf das Entwickeln von posttraumatischen Belastungsstörungen oder anderen komorbiden Störungen, • Einrichten einer Informations- und Beratungsstelle, an die die Betroffenen sich mit Fragen oder Beratungsbedarf wenden können, • Gruppentherapeutische Maßnahmen im Sinn von Nachbesprechungsgruppen zur Verarbeitung der belastenden und traumatischen Erlebnisse, • Werksärztliche und Hausärztliche Untersuchungen mit dem Ziel die Notwendigkeit ambulanter oder stationärer psychotherapeutischer Maßnahmen abzuklären, • Psychotherapeutische Maßnahmen bei behandlungsbedürftigen Störungen, • Einzelmaßnahmen im pädagogischen Bereich durch Zusammenarbeit mit den Lehrern der betroffenen Kinder, • Seelsorgerische Gespräche durch die zuständigen Pfarrer, • Speziell auf die türkische Gruppe zugeschnittene Maßnahmen zur Förderung der Kommunikation und Integration, wie Deutschkurs, Nähkurs, türkisch-deutscher Kochkurs etc. Zu den langfristigen Aufgaben der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, die drei Jahre lang die Entwicklung der Betroffenen verfolgte, gehörte es, die Realisierung der oben genannten Aufgaben zu gewährleisten und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Die Werksfürsorge Durch die Werksfürsorgerinnen des Unternehmens wurden alle Betroffenen des Grubenunglücks regelmäßig kontaktiert. Zusätzlich zu den beiden deutschen Werksfürsorgerinnen wurde nach dem Unglück eine türkische Kollegin eingestellt, um auch die Familien der umgekommenen türkischen Bergleute optimal betreuen zu können. Für B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken die Betreuung wurde hauptsächlich der Weg der aufsuchenden Hilfe gewählt, das heißt, die Werksfürsorgerinnen besuchten die Familien zuhause. Bei den Hausbesuchen wurden einerseits organisatorische Hilfen angeboten, wie z. B. Klärung von Fragen zur Lebensversicherung oder Sterbegeld, oder Beantragungen von finanziellen Unterstützungen beim „Hilfswerk Grube Stolzenbach“ und ähnliches. Darüber hinaus fragten die Werksfürsorgerinnen aber auch immer nach dem Befinden und nach den Sorgen und Nöten der Betroffenen und wurden so für sie mit der Zeit zu wichtigen Ansprechpartnerinnen. Zusätzlich wiesen die Werksfürsorgerinnen auf die weitergehenden Betreuungsangebote hin, insbesondere auf die Möglichkeit, in psychologisch geleiteten Gruppen mit gleichermaßen Betroffenen über das Erlebte und dessen Auswirkungen zu reden. Bei schwierigen individuellen Problemen motivierten die Werksfürsorgerinnen, direkt den Psychologen in der Beratungsstelle zu kontaktieren. Auf diese Weise waren die Werksfürsorgerinnen sozusagen der „Türöffner“ für die psychologischen Angebote und bearbeiteten die üblicher Weise bestehende Skepsis gegenüber externen Psychologen auf eine aus Sicht der Betroffenen unkomplizierte und angemessene Art und Weise. Zusätzlich zu den Hausbesuchen bestand die Möglichkeit für alle Betroffenen, zu Beratungsgesprächen in das Haus der Werksfürsorge zu kommen. Psychologische Betreuung Zur psychologischen und psychotherapeutischen Betreuung der Betroffenen wurden ein deutscher Diplom-Psychologe von der Preussen Elektra mit einem weisungsfreien Vollzeitvertrag und eine türkische Diplom-Psychologin mit einem Teilzeitvertrag für jeweils drei Jahre eingestellt. Die Behandlungsräume für die Psychologen wurden auf Drängen der Vertreter des Unternehmens im Haus der Werksfürsorge eingerichtet, um zu verdeutlichen, dass das Unternehmen nicht nur durch die finanziellen Verpflichtungen zu seiner Verantwortung steht, sondern auch durch das zur Verfügung Stellen von psychologischer Hilfe. Die ursprüngliche von den externen Fachleuten eingebrachte Idee einer eigenen von dem Unternehmen losgelösten psychologischen Beratungsstelle konnte nicht verwirklicht werden. Die Psychologen waren verantwortlich für die Durchführung von Gruppen- und Einzelgesprächen mit den Betroffenen, für psychologische Beratung, für Psychodiagnostik, für Psychotherapie und für den Transfer psychologischer Erkenntnisse unter Wahrung der Schweigepflicht an die Unternehmensleitung, wie z. B. Arbeitsfähigkeit und Einsatzmöglichkeit der geretteten Bergleute. Hausärzte Die Hausärzte waren in die normale Hausärztliche Versorgung der Betroffenen eingebunden. Einige von ihnen engagierten sich in der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe und waren so besser über die allgemeine Belastungssituation ihrer Patienten informiert. Ihrerseits konnten sie die Mitglieder der Arbeitsgruppe in allgemeiner Form aus medizinischer Sicht über die gesundheitliche Entwicklung der Betroffenen aufklären. Dadurch konnten Angebote der Betreuung wie z. B. Kur- oder Ferienangebote besser auf die Betroffenen abgestimmt werden. 81 82 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Lehrer Lehrer der durch das Unglück zu Halbwaisen gewordenen Kinder hatten täglich Kontakt in der Schule und berichteten über Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten bei ihnen. Durch den intensiven Austausch in der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe konnten die Lehrer den Kindern und deren Erziehungspersonen direkte und konkrete Hilfsangebote unterbreiten. Diese bestanden in Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, Gesprächen mit den Müttern und gemeinsamen Gesprächen mit den Kindern und einem Psychologen bzw. mit den Erziehungspersonen und einem Psychologen. Pfarrer Für einen Teil der Betroffenen waren die Pfarrer die natürlichen und ersten Ansprechpersonen für ihre Sorgen und Nöte nach dem Unglück. Für einen größeren Teil von ihnen jedoch war der intensive persönliche Kontakt mit dem zuständigen Pfarrer neu. Die Verbindung war schon in den ersten Tagen auf dem Zechengelände entstanden in der Zeit der Angst und des Wartens, als auch die Helfer durch ihre eigene Hilflosigkeit gelähmt waren und keine Worte mehr für die Angehörigen fanden, nachdem diese gerade vom Tod ihrer Männer bzw. Söhne erfahren hatten. Ein Pfarrer drückte die Bestürzung und Lähmung der Anwesenden, aber auch „ein erstes, vages Gefühl davon aus, dass dieses schwere Schicksal nur miteinander geteilt und gemeinsam getragen auszuhalten sein wird“ (Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). Er brachte dies im 23. Psalm zum Ausdruck, den er verlas. In dieser Situation, in der die meisten anderen Versuche, Worte zu finden für die Betroffenen nur banal und hohl geklungen hätten, wurden einige Pfarrer zu Symbolfiguren der Hoffnung und Bewältigung. Diese Erfahrung setzte sich fort bei den Beerdigungen, wenn die Pfarrer christlich-muslimische Gedenkgottesdienste zum Jahrestag abhielten oder die Gedenkstätte am Unglücksort einweihten. Gemeinsam führten Pfarrer und der Autor auch Veranstaltungen für die Betroffenen durch zu dem Thema „Was geschieht nach dem Tod aus theologischer und psychologischer Sicht“, um auch die für viele Betroffene wichtige Schnittstelle zwischen psychologischen und theologischen Fragen zu thematisieren. Die Pfarrer führten viele Einzelgespräche mit Betroffenen über Glaubensfragen, die sich nach der Katastrophe häufig verändert hatten, sei es in Richtung einer Festigung des Glaubens, sei es in Richtung einer Haltung, nach einer solchen Erfahrung nicht mehr an Gott glauben zu können. Firmenleitung Die Firmenleitung war von Anfang an in die Planung und Realisierung der Betreuungsmaßnahmen integriert und im Arbeitskreis Stolzenbachhilfe vertreten. Hilfen für die Angehörigen sollten nicht nur in die Hände von Fachleuten abgegeben werden, die Firmenleitung und das Unternehmen gestalteten die Betreuung aktiv mit. Für einige Themen war die Firmenleitung der zentrale Ansprechpartner für die Betroffenen. Zum Beispiel war es für die Betroffenen von zentralem Interesse zu erfahren, was der Grund für die Explosion in der Grube gewesen war und durch wessen Schuld sich die Katastrophe ereignet hatte. Nachdem nach monatelangen Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft erklärt worden war, es gebe keinen Schuldigen, die Kohlestaubexplosion sei unvorhersehbar gewesen und die Sicherheitsvorkehrungen seien alle eingehalten B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken worden, entstand bei vielen Betroffenen eine Ratlosigkeit und eine hilflose Wut, eben keinen Schuldigen für den Tod ihrer Männer und Söhne zu haben. Die Firmenleitung lud daraufhin alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung zum Stand der Ermittlungen über die Ursache des Grubenunglücks ein und versprach, dort „vom Juristischen in das Bergmännische und weiter in das Allgemeinverständliche“ übersetzen zu lassen durch einen Bergbeamten vom Bergamt Weilburg. Weiterhin wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt zum Bau der Gedenkstätte und – auf Anregung der Psychologen – speziell für die Kinder eine Information mit Dias zur Arbeitswelt der Väter unter Tage, um ihnen ein Bild zu geben, wie der Alltag ihrer Väter vor deren Tod ausgesehen hatte. Deutsches Rotes Kreuz Der Kreisverband des DRK führte in größeren Abständen regelmäßige „KaffeeNachmittage“ für alle Betroffenen durch. Auf diesen hielt der Kreisvorsitzende immer eine Ansprache, in der er an das Gemeinschaftsgefühl der Betroffenen als wichtigsten Grundstein für Bewältigung des individuellen und kollektiven Leids appellierte. Diesem wurde symbolisch dadurch Ausdruck verliehen, dass alle Betroffenen sich an den Händen fassten und sich eine gute Zeit wünschten. Bei diesen Treffen, von denen in zweieinhalb Jahren neun stattfanden, waren immer ca. 100 Personen anwesend. Weiterhin wurden über das DRK Kurzreisen zur Erholung angeboten und gemeinsame Ausflüge organisiert, die den Betroffenen den Austausch untereinander – Witwen mit Eltern, mit Geretteten, mit Verletzten, mit Betriebsangehörigen usw. – ermöglichten. Zwei Jahre nach dem Unglück organisierte das DRK eine Faschingsveranstaltung für die Betroffenen und lud die Prinzengarde aus der Faschingshochburg Fritzlar ein. Hier kamen die Betroffenen einmal in einer ganz anderen Stimmung zusammen, in einer Situation, in der nicht Trauer und Problembewältigung im Vordergrund standen. Im Folgenden soll noch näher auf Möglichkeiten und Hilfen, die den Betroffenen angeboten wurden, um besser mit den Ereignissen umgehen zu können und auf die Finanzierung der Hilfen eingegangen werden. Gedenkfeiern und Gedenkstätte Eine zentrale Aufgabe der Interventionen auf der Systemebene für die Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe stellten die angemessene Vorbereitung und Durchführung von Gedenkfeiern und der Bau einer Gedenkstätte dar. Eine Woche nach dem Unglück fand eine Trauerfeier in Borken statt, in der über 4 000 Trauergäste von den 51 getöteten Bergleuten Abschied nahmen. Es war die erste christlich-islamische Trauerfeier in der Bundesrepublik überhaupt. Der evangelische und der katholische Bischof und ein muslimischer Geistlicher hielten die Trauerreden, der Vorstandsvorsitzende der Preussen Elektra versprach zu „helfen, wo wir können“, der Bundespräsident bekundete den Hinterbliebenen sein Mitgefühl. Bekanntermaßen stellen die Jahrestage von Katastrophen für die Betroffenen eine große psychische Belastung dar (Norris et al., 2002). Schon viele Tage vor dem Datum fühlen sich die meisten Betroffenen stark angespannt und erleben die Stunden bis zum damaligen Unglück sowie die eigentliche Zeit der Katastrophe vor einem oder x Jahren 83 84 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken sehr intensiv so, „als geschehe alles noch einmal“ (Äußerungen Borkener Betroffener am ersten Jahrestag, 01.06.1989). Zum ersten Jahrestag des Unglücks wurde für alle direkt Betroffenen und Angehörige unter Ausschluss der Medien eine christlich-islamische Gedenkfeier durch die Kirchen in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe im Bürgerhaus Borken organisiert. In dieser von nahezu allen Betroffenen besuchten Gedenkfeier wurde in einem sorgfältig durchgeführten Ritual für jeden umgekommenen Bergmann eine Kerze entzündet und sein Name verlesen. Texte und Gebete zum Thema Tod wurden verlesen, Lieder der Hoffnung gesungen und Predigten von den Vertretern aller drei Konfessionen gehalten. Am zweiten Jahrestag wurde eine Gedenkfeier in der evangelischen Kirche in Borken veranstaltet. Der dritte Jahrestag wurde an der Unglückstelle, auf dem ehemaligen Zechengelände unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der Politik mit Kranzniederlegung abgehalten. Der vierte Jahrestag wurde in kleinerem Rahmen als Gedenkgottesdienst gestaltet. Der fünfte wiederum als größere Gedenkveranstaltung. Ausdrückliches Ziel der Veranstaltungen an den Jahrestagen war die bewusste Aufrechterhaltung der Erinnerung, der Appell, gemeinsam der Toten zu gedenken und sich auf die aus der Katastrophe entstandenen Kräfte zur Bewältigung des Ereignisses zu besinnen. Zur Gestaltung der Gedenkstätte auf dem ehemaligen Grubengelände wurde unter Beteiligung der Firma, des Arbeitskreises, der Stadt und Vertreter der Betroffenen der Vorschlag eines einheimischen Künstlers ausgewählt. In diesem wurden Motive aus dem Bergwerksalltag in einer Gesteinsschichtenfolge aus Züschener Sandstein bildhauerisch gestaltet, z. B. wie die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, schützend ihre Hand über einen unter Tage eingeschlossenen Bergmann hält. An der Stelle, an der sich der Seilfahrtschacht der Grube befand, wurde genau in der Größe des früheren Schachtes ein Bronzering installiert, der die Lebensuhr symbolisiert. Er ist umgeben von einem Kreis aus 12 Laubbäumen. In den Ring sind die Namen aller im Borkener Braunkohlerevier verunglückten Bergleute eingraviert (vgl. Abbildungen A.1 im Anhang A). Vor der offiziellen Eröffnung der Gedenkstätte am dritten Jahrestag wurde diese unter der Leitung der Psychologen und der Werksfürsorge mit den Betroffenen gemeinsam begangen und die Schwierigkeiten, sich mit diesem Ort zu konfrontieren bearbeitet. Freizeit- und Ferienangebote Für alle Betroffenen bestand die Möglichkeit, an Freizeitangeboten teilzunehmen, die den Kontakt untereinander fördern sollten. Durch den Arbeitskreis Stolzenbachhilfe wurden angeboten: • deutsch-türkische Kochkurse, • deutsch-türkische Bastel- und Tanzkurse, • Nähkurse, • Deutschkurse für türkische Frauen. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Ferienangebote konnten aus zahlreichen Einladungen von Hotels, Pensionen, Feriendörfern für die Betroffenen bereitgestellt werden. Finanzierung Aus Deutschland und einigen Nachbarstaaten flossen im Anschluss an das Unglück Spenden durch natürliche und juristische Personen zur Versorgung der Hinterbliebenen und der verletzten und geretteten Bergleute. Betriebsräte und Belegschaften des in der gesamten Bundesrepublik tätigen Unternehmens stellten Gelder für nicht durchgeführte Betriebsfeste, Jubiläen sowie Verabschiedungen zur Verfügung. Die Preussen Elektra AG selbst brachte ein Grundkapital von drei Millionen DM für die Gründung des „Hilfswerks Grube Stolzenbach“ ein. Vorrangiger Zweck des Hilfswerks war „den Witwen, Waisen, Eltern der Verstorbenen, Geretteten, Verletzten des Grubenunglücks in der Grube Stolzenbach finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen“ (Satzung des Hilfswerks Grube Stolzenbach vom 01.07.1988). Insbesondere sollten mit diesen Geldern Schul- und Berufsausbildung der Waisen vom 16. bis zum 25. Lebensjahr gesichert, Erholungsmaßnahmen für die Betroffenen durchgeführt, berufliche Fortbildungs- bzw. Umschulungsmaßnahmen zur Wiedereingliederung in das Berufsleben gefördert und Umzugs- sowie Übersiedlungskosten in die Türkei finanziert werden. Weiterhin wurde durch die Stadt Borken, die umliegenden Gemeinden, den Kreis, die Kirchen, die relevanten Wohlfahrtsorganisationen, die Preussen Elektra, die türkische Gemeinde, die Banken und die Rechtspflege das Kuratorium „Hilfsfonds Grubenunglück Stolzenbach“ gebildet, um die der Stadt Borken zugunsten der Hinterbliebenen zugeflossenen Gelder sowie Sachspenden zu verwalten und zweckentsprechend zu verwenden. Aus diesem Grundkapital wurden alle Betreuungsmaßnahmen für die Bewältigung der Unglücksfolgen finanziert. 1.2.2 Gruppenebene Im Folgenden sollen die Gruppeninterventionen inhaltlich dargestellt werden. Zunächst werden die durch die Systemebene vorgegebenen Problemkonstellationen für die Gruppenarbeit erörtert, anschließend die Zusammensetzung der Gruppen und die Themenbereiche der Gruppensitzungen vorgestellt, der theoretische Hintergrund der Gruppeninterventionen behandelt, eine Übersicht über die Häufigkeit der Gruppensitzungen gegeben, besondere Gruppensitzungen und typische Verläufe beschrieben und zum Abschluss der Stand der Gruppen nach Beendigung der Maßnahmen erörtert. Vorgegebene Problemkonstellationen Durch die Vorarbeit der Werksfürsorgerinnen, die bei ihren Hausbesuchen immer wieder auf die Möglichkeit und die Chance der Teilnahme an psychologisch geleiteten Gruppen hingewiesen hatten, war der Einstieg für die Psychologen wesentlich erleichtert. Die größte Akzeptanz, die Gruppenbetreuung anzunehmen, bestand bei den Müttern von Kindern im schulpflichtigen Alter. Für sie wurden in der Borkener Schule Gruppen unter Leitung des Psychologen zum Austausch über die Probleme angeboten, die durch den Verlust des Vaters in der Familie entstanden waren. Offensichtlich 85 86 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken war hier die Problemlage derart brisant, dass keine Diskussionen über die Rolle des Psychologen und dessen Haltung zur Firma entstand. In diesen Gruppen ging es inhaltlich ausschließlich um die Schwierigkeiten, die die Mütter bei ihren Kindern ausgemacht hatten und nicht um deren eigenen emotionalen Probleme. Die Funktion des Psychologen war eine beratende im Sinne einer Erziehungsberatung. Erst mit dem Anspruch, Gruppen mit Betroffenen zu bilden, in denen sie ihre traumatischen Erfahrungen, ihre Trauer und ihre persönlichen Probleme mitteilen und bearbeiten konnten, stellte sich die Frage nach der Rolle des Psychologen und der Chance bzw. des Risikos sich ihm anzuvertrauen. Der Psychologe war angestellt von der Firma, und die Gruppen sollten in den firmeneigenen Räumen der Werksfürsorge stattfinden. Diese Konstellation rief bei den Betroffenen eine mehr oder minder starke Skepsis hervor, da die Firma in ihren Augen verantwortlich war für den Tod ihrer Angehörigen. Einige Betroffene konnten sich aufgrund dieser Vorgaben nicht für eine Teilnahme an den Gruppen entscheiden. Für diejenigen, die prinzipielle Bereitschaft zeigten, war eine genaue Klärung der Rahmenbedingungen unerlässlich. Grundlegende Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war der Hinweis auf die berufsethische Schweigepflicht und auf den Passus im Arbeitsvertrag des Psychologen, weisungsfrei von jedweden Organen der Preussen Elektra zu arbeiten. Entscheidend war letztendlich jedoch die eindeutige Aussage auf der Beziehungsebene des Psychologen, für die Betroffenen und deren Probleme da zu sein und sich gegenüber dem Unternehmen strikt an seine berufsrechtliche Schweigepflicht zu halten. Zusammensetzung der Gruppen In den Gruppen waren jeweils Betroffene vereinigt, die ähnliche traumatische Erfahrungen bei der Katastrophe gemacht hatten und sich somit in einer vergleichbaren Lebenssituation befanden. Potentielle Teilnehmer wurden von den Werksfürsorgerinnen bei Hausbesuchen auf die Möglichkeit der Teilnahme an einer psychologisch geleiteten Gruppe hingewiesen. In persönlichen Briefen wurden sie dann zu einem ersten Treffen mit genauem Termin und Uhrzeit eingeladen. Die Betreuer gingen also auf die Betroffenen zu und forderten sie auf, aktiv etwas für die Bewältigung der Katastrophe zu tun und etwas zu unternehmen, um ihre Lage nach der Katastrophe zu verbessern, indem sie sich mit den gleichermaßen Betroffenen austauschten und professionelle Hilfe in Anspruch nähmen. Folgende Gruppen wurden gebildet: 1) Gruppe jüngerer Witwen, 2) Gruppe älterer Witwen, 3) Gruppe türkischer Witwen, 4) Gruppe von Müttern und Vätern, 5) Kindergruppen unterteilt nach Alter, 6) Gruppe türkischer Jugendlicher, 7) Gruppe der verletzten Bergleute, 8) Gruppe der geretteten Bergleute, 9) Gruppe der Grubenwehrangehörigen, 10) Gruppe der Betriebsangehörigen. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Rund zwei Drittel der Witwen, Lebensgefährtinnen und Eltern der umgekommenen Bergleute, alle geretteten Bergleute, fast alle Verletzten und Grubenwehrangehörigen der Borkener Grubenwehr und eine Reihe von Betriebsangehörigen in Verantwortungspositionen nahmen das Angebot der betreuten Gruppen an. Aus der Übersicht in Tabelle B 1.1 sind jeweils der Ausgangspunkt, die spezielle Problematik, Aufgabenstellung, Größe und Dauer der einzelnen Gruppen ersichtlich. Gruppe jüngerer deutscher Witwen. In der Gruppe jüngerer deutscher Witwen befanden sich Frauen, deren Kinder noch im Haus waren oder sich in Ausbildung befanden. Ausgangspunkt waren zunächst die Probleme, die sich durch den Tod des Vaters in der Erziehung ergaben, das heißt, die Auffälligkeiten der Kinder standen zunächst im Vordergrund. Wie in anderen Gruppen auch wurden die Betroffenen aufgefordert, einen schriftlichen Bericht über ihre Erlebnisse während des Unglücks anzufertigen, um die Auseinandersetzung mit den traumatischen Erlebnissen anzuregen. Diese Berichte waren häufig Grundlage für die Gruppengespräche zu Beginn der Betreuung. Anhang A, Abbildung A.2 enthält den Bericht einer Witwe dieser Gruppe. Gruppe älterer deutscher Witwen. In der Gruppe älterer deutscher Witwen befanden sich Frauen, deren Kinder schon außer Haus waren. Ausgangspunkt in dieser Gruppe war in erster Linie das Verlassen-Sein vom Partner, mit dem man sich gerade auf ein intensives Zusammenleben vorbereitet hatte, da die Verrentung kurz bevor stand. Zum Teil waren es nur wenige Wochen oder sogar einige Tage bis zum letzten Arbeitstag. Gruppe türkischer Witwen. Die türkischen Witwen hatten sich schon in den ersten Tagen des Unglücks noch auf dem Grubengelände mit eigenen Trauerritualen, z. B. lautem Herausklagen ihres Leids, zusammengeschlossen. Sie äußerten den dringenden Wunsch, auch langfristig als Gruppe zusammenzubleiben und nicht auf die Gruppen mit den deutschen Witwen aufgeteilt zu werden. Um den Frauen die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Muttersprache austauschen zu können und mit Rücksicht auf kulturelle Gepflogenheiten war damit auch klar, dass diese Gruppe nicht von einem deutschen männlichen Psychologen angeleitet werden konnte. Für diese Aufgabe wurde eine türkische Psychologin mit einer halben Stelle eingestellt. Ausgangspunkt der Gruppe war, neben der Trauer um den Verlust des Mannes und den Schwierigkeiten mit den Kindern, vor allem die von den Frauen als überfordernd empfundene Situation, nunmehr das alleinige Recht zu besitzen über die Geschicke der Familie zu entscheiden, in einem Land, dessen Sprache die meisten kaum beherrschten. Für viele stellte sich die Frage, ob sie wieder in die Türkei zurückkehren sollten, um dort den Schutz der Verwandtschaft zu genießen, oder ob sie allein mit den Kindern in Deutschland bleiben sollten. Mütter-Väter-Gruppe. In der Mütter-Väter-Gruppe befanden sich Eltern, deren Söhne noch im Elternhaus gewohnt und noch keine eigene Familie gehabt hatten, als Bergleute gearbeitet hatten und beim Grubenunglück umgekommen waren. In dieser Gruppe häuften sich besonders tragische Fälle, wie beispielsweise: ein junger Mann, der zwischen Abitur und Studium einige Wochen Geld verdienen wollte – am Unglückstag war er zum ersten Mal in die Grube eingefahren; ein anderer junger Bergmann, der zwei Tage nach dem Unglückstag heiraten wollte; das einzige Kind einer allein stehenden Mutter; ein Sohn, der vor wenigen Tagen geheiratet hatte und bald in eine eigene Wohnung ziehen wollte. 87 88 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Tabelle B1.1: Gruppenbetreuung der Betroffenen des Grubenunglücks Hauptthemen zu Beginn Gruppe jüngerer deutscher Witwen der Verlust des Mannes und die eigene Trauer, die Trauer der Kinder, Erziehungsprobleme mit den Kindern, Einsamkeit, Schlafschwierigkeiten, Psychosomatische Beschwerden, Hoffnungslosigkeit. Gruppe älterer deutscher Witwen der Verlust des Mannes und die eigene Trauer, Trauer der (erwachsenen) Kinder, Wut auf die Verursacher des Unglücks, Einsamkeit, Schlafschwierigkeiten, Psychosomatische Beschwerden, Gefühle, als habe man alles nur geträumt, Antriebslosigkeit und Passivität. Gruppe türkischer Witwen der Verlust des Mannes und die eigene Trauer, Trauer der Kinder, Unsicherheit mit der neuen Aufgabe, Familienoberhaupt zu sein, Frage der Rückkehr in die Türkei, Einsamkeit, Schlafschwierigkeiten, Psychosomatische Beschwerden, Antriebslosigkeit und Passivität. Mütter-Väter-Gruppe Fassungslosigkeit, Entsetzen, Identifizieren stark entstellter Leichen, Verlust der Lebensperspektive und des Lebenssinns, Hoffnungslosigkeit, Lebensmüdigkeit, Schlafschwierigkeiten, Psychosomatische Beschwerden, Unwirklichkeitsgefühle, Antriebslosigkeit und Passivität. Größe Frequenz Dauer 10 Frauen Wöchentlich, später 14-tägig, danach 1 x monatlich 3 Jahre 8 Frauen Wöchentlich, später 3-wöchig 3 Jahre 8 Frauen Wöchentlich, später 3-wöchig 3 Jahre 7 Personen Wöchentlich, später 3-wöchig 3 Jahre 89 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Kindergruppen. In drei verschiedenen Kindergruppen wurden die Kinder nach Alter aufgeteilt und betreut. Zu Beginn der Betreuungsarbeit wurden die Kinder nur indirekt über die Mütter betreut, da sich Auffälligkeiten noch nicht sofort zeigten. Die Mütter wurden sensibilisiert für Anzeichen der Trauer bei den Kindern und darauf vorbereitet, dass Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zu erwarten seien. In den später angebotenen Kindergruppen wurde den Kindern die Möglichkeit gegeben, in kindgemäßer Weise in Form von Spielen, Zeichnen, Rollenspielen etc. ihren Gefühlen nach dem Verlust des Vaters, ihrer Trauer und ihren Aggressionen Ausdruck zu geben. Auch viele Fragen über das Unglück wurden mit den Kindern geklärt, da die meisten Kinder sich scheuten, mit ihren Müttern darüber zu reden, um sie zu schonen. Mit wachsendem Abstand zum Unglück wurde es für viele Kinder immer wichtiger, eine männliche Bezugsperson „zum Anfassen“ zu haben, mit der sie auch ganz alltägliche Dinge tun konnten, wie etwa aus der Schule erzählen oder Fußball spielen. Die Kindergruppen wurden von deutschen und türkischen Kindern besucht und von der türkischen Psychologin und dem deutschen Psychologen gemeinsam betreut. Gruppe türkischer Jugendlicher. In dieser Gruppe befanden sich 17- bis 23-jährige türkische Jugendliche, die durch den Tod des Vaters in eine besonders schwierige familiäre Situation geraten waren. Von ihnen wurde viel Unterstützung der Familie, oder sogar die Übernahme der Rolle des Familienoberhauptes erwartet, gleichzeitig litten sie unter der eigenen Trauer. Sie wurden von der türkischen Psychologin betreut. Tabelle B1.1: Gruppenbetreuung der Betroffenen des Grubenunglücks (Forts.) Hauptthemen zu Beginn Kindergruppen Alles, was Kinder interessiert und beschäftigt und zwischendurch Fragen: Zum Unglück, Wie der Vater gearbeitet hat, Wie der Vater umgekommen ist, Wo der Vater nach dem Tod ist, Ängste vor dem Tod der Mutter, Angst vor einer Sonderstellung in der Klasse, Unfähigkeit, die Mutter mit der eigenen Trauer zu konfrontieren. Größe Frequenz Dauer Wechselnd, pro Gruppe ca. 7–10 Kinder Wöchentlich, später 14-tägig 2,5 Jahre Wöchentlich, später 14-tägig 2 Jahre Gruppe türkischer Jugendlicher Trauer um den Verlust des Vaters, 10 Personen Unsicherheit, ob die Familie in Deutschland bleibt, oder zurück in die Türkei geht, Fragen zur eigenen Rolle in der Familie, z. T. traumatische Erlebnisse auf dem Grubengelände. 90 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Tabelle B1.1: Gruppenbetreuung der Betroffenen des Grubenunglücks (Forts.) Hauptthemen zu Beginn Gruppe der verletzten Bergleute Rekonstruktion des Unglücksgeschehens, Traumatische Erlebnisse während des Unglücks, Die körperlichen Schäden und deren Auswirkungen, Der Verlust von Freunden und Kollegen, Die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, Psychosomatische Beschwerden, Auswirkungen auf die Familie. Gruppe der geretteten Bergleute Rekonstruktion des Unglücksgeschehens Die traumatischen Erlebnisse während des Eingeschlossen-Seins, Der Verlust der vielen Freunde und Kollegen, Sich nicht freuen zu können, überlebt zu haben, Schuldgefühle gegenüber den Witwen und Müttern: „Überlebensschuld“, Psychosomatische Beschwerden, Ängste vor Dunkelheit und vor dem Einfahren, Umgang mit dem großen Medieninteresse. Größe Frequenz Dauer 8 Personen Wöchentlich, später 14-tägig, danach 3-wöchig 2 Jahre 6 Personen Wöchentlich, 3,5 Jahre später 14-tägig, danach 4-wöchig Gruppe der Grubenwehrangehörigen 8 Personen Rekonstruktion des Unglücksgeschehens, Traumatische Erlebnisse während des Unglücks (die schrecklichen Bilder unter Tage; Suche nach Überlebenden unter Einsatz des eigenen Lebens; Bergen toter Kollegen und zerfetzter Leichen(teile); das Ausmaß der Zerstörung der Grube; Leid der Angehörigen), Der Verlust der vielen Freunde und Kollegen, Körperliche und psychische Folgeerscheinungen. Gruppe der Betriebsangehörigen Rekonstruktion des Unglücksgeschehens, 7 Personen Traumatische Erlebnisse (z. B. Identifizieren der Toten), Die eigene Verantwortungsposition, die quälende Frage, ob man das Unglück hätte verhindern können, Die eigene Trauer, Verlust von Freunden und Kollegen Konfrontation mit dem Leid und den Anschuldigungen von Angehörigen, Das Gefühl, als sei alles nicht wahr gewesen. 14-tägig 11 Mon. 14-tägig, später 4-wöchig 10 Mon. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Gruppe der verletzten Bergleute. In der Gruppe der verletzten Bergleute waren Männer, die über Tage das Unglück aus nächster Nähe miterlebt hatten und dabei durch Feuer, Rauchschwaden und umher fliegende Betonteile verletzt worden waren. Im Anhang A (Abbildung A.3) befindet sich der Bericht eines verletzten Bergmanns, der zusätzlich durch den Tod seines ebenfalls beim Grubenunglück umgekommenen Sohnes betroffen war. Gruppe der geretteten Bergleute. In der Gruppe der geretteten Bergleute waren die sechs Bergleute vereint, die unter Tage eingeschlossen waren und nach 65 Stunden gerettet worden waren. Sie standen im Rampenlicht der Öffentlichkeit und wurden von Presse und Medien bedrängt, über ihre Erlebnisse zu berichten. In der Gruppe sollte ihnen die Möglichkeit geboten werden, unter sich und abgeschirmt von der Presse, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Gruppe der Grubenwehrangehörigen. In der Gruppe der Grubenwehrangehörigen wurden alle bei dem Unglück zum Einsatz gekommenen Grubenwehrmitglieder angesprochen. Im Jahr 1988 war es noch ungewöhnlich, Einsatzkräfte als „Betroffene“ anzusehen. Dennoch kam auf eine Einladung ein Teil aller im Einsatz gewesenen auswärtigen Grubenwehren zu einem gemeinsamen Treffen nach Borken. In einer beeindruckenden Sitzung berichteten sowohl junge, wie auch erfahrene Einsatzkräfte von sehr belastenden Erfahrungen bei den gefährlichen Einsätzen, hauptsächlich bei der Bergung der 51 Toten. Sie schilderten viele funktionelle Störungen, insbesondere Schlafstörungen und alle Symptome aus dem Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung, die sich in Folge bei ihnen ergeben hatten. Besonders betroffen zeigte sich dabei die Borkener Grubenwehr, da diese bei den Einsätzen keine anonymen Toten bergen musste, sondern ausnahmslos ihr bekannte und befreundete Kumpel. Das Angebot einer kontinuierlich tagenden Gruppe zur Bewältigung der traumatischen Erlebnisse und deren Folgen wollten die auswärtigen Grubenwehrmitglieder jedoch nicht annehmen. Zu unterscheiden ist bei der Gesamtgruppe der Grubenwehrangehörigen nach Pieper und Maercker (1999) zwischen drei Untergruppen: a) einer Gruppe mit effektivem Bewältigungsverhalten ohne PTBS-Symptomatik, b) einer Gruppe mit aktivem Bewältigungsverhalten und PTBS-(Teil-) Symptomatik, die Unterstützung im eigenen sozialen Netz sucht, c) einer Gruppe mit Verleugnung eigener Hilfsbedürftigkeit und PTBS-Symptomatik. Da die meisten Einsatzkräfte eindrücklich ihre PTBS-(Teil-)Symptomatik geschildert hatten, reagierten viele von ihnen im Sinne des von Pieper und Maercker (1999) beschriebenen „Alpha-Männer“ Risikoprofils. Diese Gruppe leugnet bei hohen Männlichkeitsidealen eigene Betroffenheit und verleugnet Hilfsbedürftigkeit nach berufsbedingten Traumata. Bedenkt man, dass bei dem Unglück insgesamt 807 Grubenwehrmänner im Einsatz waren, von diesen bei der oben erwähnten einmaligen Nachbesprechung ca. 50 bis 60 anwesend waren und davon lediglich die Gruppe der besonders stark betroffenen Borkener Grubenwehr eine kontinuierliche Gruppenbetreuung in Anspruch nahm, muss man davon ausgehen, dass eine nicht unerhebliche Zahl von Personen mit PTBS-(Teil-)Symptomatik unversorgt blieb. Dabei muss allerdings der Tatsache Rechnung getragen werden, dass das Bewusstsein für eine Traumatisierungsgefährdung bei Einsatzkräften im Jahre 1988 noch kaum bestand und erst im Jahre 1994 im DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) aufgenommen 91 92 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken wurde. Erst dort wurde definiert, dass die Konfrontation mit einem traumatischen Ereignis, bei dem „intensive Furcht, Hilflosigkeit oder extremer Schreck erlebt wurden“, für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ausreicht. Es entstand schließlich eine Gruppe der besonders belasteten Borkener Grubenwehr, die als Einheimische die Toten alle persönlich gekannt hatte. Die Gruppe hatte die Aufgabe, das Geschehene im geschützten Gruppenrahmen nachzubesprechen, die dadurch entstandenen Gefühle aufzuarbeiten und einen funktionalen Umgang mit den entstandenen Symptomen zu erarbeiten. Gruppe der Betriebsangehörigen. In der Gruppe der Betriebsangehörigen versammelten sich Personen, die das Unglück, sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten aus nächster Nähe miterlebt hatten und dabei in besonderen Verantwortungspositionen gestanden hatten. Sie waren durch die Ereignisse psychisch stark belastet. Ihnen wurde die Gruppe zur Aufarbeitung des Erlebten angeboten. Theoretischer Hintergrund der Gruppeninterventionen Theoretische Grundlage der Gruppeninterventionen war das von Mitchell (1983) entwickelte und der Arbeitsgruppe um Holen (Sund, Weisaeth, Holen & Malt, 1985) nach Industrieunglücken in Norwegen mit Erfolg angewandte Modell der „DebriefingGruppen“. In diesen Gruppen werden möglichst bald nach der Katastrophe mit den Betroffenen die traumatischen Erlebnisse gemeinsam besprochen, um zu verhindern, dass der Einzelne mit der Verarbeitung überfordert ist. In einer in der Regel lediglich einmal stattfindenden Sitzung erhalten die von traumatischem Stress Betroffenen die Möglichkeit, direkt über ihre Erfahrungen zu sprechen, Informationen über die Folgen von Traumata und Anhaltspunkte für den Umgang damit im Sinne einer Psychoedukation zu bekommen. Besonderer Wert wird dabei auf die Trennung der Schilderung von Fakten, Gedanken, Emotionen, Körperreaktionen und der Psychoedukation gelegt. Ein weiterer theoretischer Hintergrund waren die Erklärungsansätze von Horowitz, dessen Informationsverarbeitungsmodell verdeutlicht, dass der Mensch nach traumatischen Erfahrungen nicht in der Lage ist, die Informationen, die auf ihn einströmen, unmittelbar zu verarbeiten (Horowitz, 1976; Horowitz, Wilner, Kaltreider & Alvarez, 1980). Eine erfolgreiche Bewältigung ist abhängig davon, ob er nach den Phasen der Betäubung, der Vermeidung und einer schwankenden Periode in der Lage ist – bei Bedarf mit professioneller Hilfe – und sich traut, die traumatischen Erlebnisse durchzuarbeiten und in der Folge eine vollständige Informationsverarbeitung und damit eine Integration der traumatischen Erfahrung zu erreichen. Aufbau und Struktur der Gruppensitzungen Die Gruppengröße variierte von sieben bis fünfzehn Teilnehmer. Die Treffen fanden anfangs wöchentlich, später 14-tägig, am Schluss dreiwöchig oder einmal im Monat statt. Die Dauer einer Gruppensitzung betrug in der Regel zwei Stunden. In den ersten Wochen waren aufgrund des starken Leidensdrucks vieler Betroffener auch drei bis vier Stunden üblich. In Abwandlung der oben dargestellten einmaligen Frühinterventionen wurden in Borken die einzelnen Phasen des Debriefings zur Grundlage langfristiger Gruppeninterventionen genommen und auf mehrere Gruppensitzungen aufgeteilt. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken In den ersten Gruppentreffen wurde mit den Betroffenen besprochen, welche belastenden und traumatischen Erfahrungen sie gemacht hatten, in den folgenden Wochen, wie sie darauf kognitiv, emotional und physiologisch reagiert hatten und welche Symptomatik sich bei ihnen entwickelt hatte. Ziel war im Sinne des von Pennebaker (1985) beschriebenen Disclosure-Ansatzes, dass Schreiben oder Reden über traumatische und emotional stark belastende Erfahrungen sowohl die subjektive Befindlichkeit als auch den körperlichen/psychophysischen Gesundheitsstatus verbessert (s. Kapitel A 1). Im Weiteren wurden dann psychoedukative Hinweise zum effektiven Umgang mit schweren Belastungen gegeben. Die darauf folgenden Gruppensitzungen waren der Trauerarbeit gewidmet, begleiteten die jeweiligen Bewältigungsstrategien einzelner Gruppenmitglieder, befassten sich mit Krisensituationen Einzelner und hatten den Aufbau einer neuen Zukunftsperspektive zum Thema. Diese inhaltliche Struktur wurde den Interventionen in allen Gruppen zugrunde gelegt, wobei die Gesamtdauer der Arbeit mit jeder Gruppe stark variierte von 10 Monaten bis 3,5 Jahre (vgl. Tabelle B 1.1). Tabelle B 1.2 gibt einen Überblick über Abfolge und Schwerpunkte der Gruppeninterventionen. Häufigkeit der Gruppensitzungen. Aus der folgenden Übersicht geht die Anzahl der Gruppentreffen in den Jahren 1988 bis 1991 hervor. Bei den bestehenden 10 Gruppen wurden Im Schnitt also pro Gruppe 24 Sitzungen durchgeführt. Erstes Jahr 1988/1989 56 Zweites Jahr 1989/1990 104 Drittes Jahr 1990/1991 82 Gesamt 242 Im Folgenden werden typische Entwicklungsverläufe der Gruppen dargestellt und die Inhalte einiger für die Traumabewältigung besonders wichtiger Gruppensitzungen beschrieben. Angehörigengruppen (Witwen, Eltern, Kinder) Die Witwen- und Elterngruppen wirkten zu Beginn wie erstarrt. Im Gegensatz zu den Bergleuten kannten sich die Frauen bzw. Eltern untereinander nur vereinzelt. Es wurde jedoch keine besondere „Kennenlernphase“ durchgeführt. Das Thema war allen klar und als Spannung im Raum bei den ersten Zusammenkünften körperlich spürbar. Bei allen Teilnehmern herrschte sprachloses Entsetzen vor. Nach der Klärung seiner Rolle als dem Unternehmen gegenüber zum Schweigen verpflichtetem Psychologen, stellte dieser jedem Teilnehmer der Gruppe die Frage: „Erzählen Sie bitte, was haben Sie erlebt?“ Diese Frage wirkte bei den Betroffenen wie das Öffnen eines Ventils. Jeder erzählte seine Geschichte, seine traumatischen Erlebnisse, seine Konfrontation mit dem Unglück aus seinem/ihrem Blickwinkel. 93 94 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Tabelle B1.2: Gruppeninterventionen – Abfolge und Leitthemen Phase & Anzahl Sitzungen 1. Faktenphase ca. 4 bis 6 Sitzungen Leitthemen der Gruppensitzungen „Was haben Sie beim Unglück erlebt?“ — „Was haben Sie gesehen, gehört, gerochen, wahrgenommen?“ — „Welche traumatischen Erlebnisse gab es?“ 2. Reaktionsphase I „Was haben Sie damals gedacht?“ 1 Sitzung im Anschluss an Faktenphase 3. Reaktionsphase II ca. 3 bis 5 Sitzungen „Wie haben Sie sich damals gefühlt?“ 4. Reaktionsphase III ca. 3 bis 5 Sitzungen „Wie waren Ihre Körperreaktionen?“ 5. Symptomphase ca. 3 bis 5 Sitzungen “Welche Symptome haben sich bei Ihnen bis heute entwickelt?“ — „Welche Verhaltensweisen haben sich verändert?“ 6. Psychoedukative Phase „Was ist für eine effektive Bewältigung günstig und förderlich, was ist ungünstig und hinderlich?“ ca. 5 bis 7 Sitzungen 7. Trauerarbeit ca. 8 bis 10 Sitzungen „Wen habe ich verloren?“ — „Was hat er mir bedeutet?“ — „Wie lebe ich meine Trauer?“ — Gemeinsame Entwicklung neuer Trauerrituale 8. Voneinander lernen begleitend ab Phase 7 „Was kann ich Anderen empfehlen, was hilft bei der Bewältigung des neuen Alltags?“ — „Was habe ich bei anderen an günstigen Verhaltensweisen beobachtet?“ 9. Symptombehandlung „Wo zeigt sich Vermeidungsverhalten?“ — „Wie kann ich ca. 10 bis 15 Sitzungen es aktiv verändern?“ 10. Umgang mit Krisen und „Bei Krisen in der Gruppe nach Lösungen oder Erleichterungen suchen!“ — „Wie begehe ich den Jahrestag des Belastungen begleitend ab Phase 7 Unglücks, Geburtstag des Verstorbenen und andere schwierige Tage?“ 11. Zukunftsperspektive begleitend ab Phase 9 „Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?“ — „Was kann ich dafür tun, meine Ziele zu erreichen?“ Durch die intensive Beschäftigung mit den traumatischen Erlebnissen, der Konfrontation mit dem eigenen Schmerz und zusätzlich dem Leid der Anderen machten viele Betroffene die Erfahrung, dass sie am Ende eines Gruppenabends, der in der Regel drei bis vier Stunden dauerte, sehr aufgewühlt waren und häufig keinen Schlaf finden konnten. Nicht wenige zweifelten, ob es wirklich der richtige Weg sei, sich dauernd mit den schrecklichen Geschehnissen zu beschäftigen. Es kam immer wieder zu Diskussionen, ob es nicht besser sei, die Vergangenheit ruhen zu lassen, zu versuchen zu verdrän- B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken gen und zu vergessen. Wenn sich einzelne Frauen aus diesen Überlegungen heraus entschieden hatten, an einem Termin nicht die Gruppe zu besuchen und statt dessen zu versuchen, zu vergessen, zu vermeiden und alleine zurecht zu kommen, wurden sie anschließend von den Teilnehmern der Gruppe auf deren eigene Initiative hin aufgesucht und befragt, wie es ihnen gehe. Durch diese Erfahrungen wurde von den Betroffenen bald formuliert, dass es keinen Weg des Vergessens, Verdrängens, Weglaufens gibt, es einem alleine mit der Erinnerung noch schlechter geht, wenn man mit niemandem darüber redet, man sich in Gesellschaft anderer vom Unglück nicht Betroffener häufig unverstanden, allein und nicht dazu gehörend empfindet, es zwar schmerzhaft ist, aber doch gut tut, mit den anderen Betroffenen zu reden und auf diese Weise versucht, das schreckliche Geschehen zu begreifen und zu verarbeiten. Mit der Zeit wuchs in den Gruppen durch diese Erfahrungen das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Beteiligten scheuten sich nicht, immer und immer wieder vom Unglück zu erzählen, trauten sich auch an persönliche und intimere Gedanken und Gefühle heran, die mit dem Unglück zusammenhingen und merkten, wie es ganz langsam leichter wurde, darüber zu reden. Im Sinne des Informationsverarbeitungsmodells von Horowitz (1976; Horowitz et al., 1980) erarbeiteten die Betroffenen in den ersten 10 bis 15 Sitzungen die Informationen über das Unglück und ihre Reaktionen darauf, die sie benötigten, um aktiv mit dem Geschehen und der eigenen Entwicklung umgehen zu können. Im oben dargestellten Schema der Gruppeninterventionen entspricht dieser Prozess den Phasen 1 bis 5 (Faktenphase, Reaktionsphase I, II und III, Symptomphase). Dabei wurde nach Rückmeldung der Gruppenteilnehmer das gegenseitige Verständnis füreinander in der Gruppe im Gegensatz zu den Alltagserfahrungen in der Gemeinde als außerordentlich hilfreich erlebt. Schließlich spürten die Gruppenteilnehmer, dass sie in dem Maß, wie sie es schafften, die Fakten des Unglücks und ihre kognitiven, emotionalen und physiologischen Reaktionen darauf, sowie ihre Symptomatik und ihr verändertes Verhalten zu reflektieren und sich darüber in der Gruppe auszutauschen, seltener und weniger intensiv von der Erinnerung und von „Flashbacks“ überfallen wurden. Sie waren nicht mehr der Erinnerung und dem Wiedererleben machtlos ausgeliefert, sondern konnten mehr und mehr frei entscheiden, ob sie sich bewusst erinnern wollten, oder ob sie das Geschehene eine Zeit lang auf Seite stellen wollten, weil andere nötige Aufgaben zu bewältigen waren. Eine hilfreiche Lernerfahrung war dabei, dass nach den ersten Monaten des intensiven Nachbearbeitens der Geschehnisse nicht mehr die gesamte Gruppensitzung über das Unglück gesprochen wurde, sondern dass auch andere Themen auf der Tagesordnung standen und man sogar zwischendurch zusammen lachen konnte. Der Wechsel von intensiven Gesprächen über traumatische Erlebnisse, posttraumatische Belastungssymptome, Trauergefühlen und lockerem Umgang mit Alltagsthemen kurze Zeit später machte die Auseinandersetzung mit den Katastrophenerfahrungen für die Betroffenen immer normaler. Die Teilnehmer der Gruppe merkten nach einiger Zeit, dass sie es nicht mehr nötig hatten, die Erinnerung an das Unglück zu vermeiden. Durch die aktive Konfrontation mit dem Trauma gewannen sie innere Stärke und erlebten sich im Vergleich mit Betroffenen, die nicht an den Gruppen teilnahmen und die Gespräche über 95 96 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken das Unglück vermieden, bald weiter und freier in der Katastrophenbewältigung. Die Betroffenen beschrieben es als hilfreich, durch die Gruppen aus ihrer anfänglichen Isolation herausgekommen zu sein, miteinander zu reden und auf diese Weise zu versuchen, das erlebte Trauma zu bewältigen, den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten und langsam eine neue Lebensplanung in Angriff zu nehmen. Thema Tod Gemeinsam von den Pfarrern und den Psychologen wurden allen Angehörigen Gruppentreffen zum Thema Tod und Weiterleben nach dem Tod aus theologischer und psychologischer Sicht angeboten. Für viele Angehörige war es ein dringendes Bedürfnis, persönliche Fragen zu diesem Inhalt zu klären und sich mit den anderen Betroffenen auszutauschen, da sie im Alltag häufig merkten, dass das Thema Tod tabuisiert wird und ein Austausch darüber kaum möglich war. Für Psychologen und Pfarrer war es hilfreich, die Folgen der Katastrophe nicht nur aus dem eigenen Blickwinkel zu beurteilen und die Abgrenzung wie auch die Überschneidungen beider Professionen gemeinsam zum Wohle der Angehörigen zu vertreten. Kinder Bei den Kindern machte es keinen Sinn, die Gruppensitzungen in der oben skizzierten strukturierten Form zu gestalten, da sie nicht die dafür notwendige kognitive Reife hatten. Die Kindergruppen waren zunächst stark an den Bedürfnissen der Kinder orientiert und wurden mit altersgemäßen Spielen gestaltet wie: Spiele mit Puppen, Figuren und Gegenständen aus dem Sceno-Kasten (von Staabs, 1978), malen, gestalten mit Knetmasse, Ballspiele, Billard, Kicker, Darts usw. Viele Kinder reagierten anfangs abweisend, wenn sie direkt auf das Unglück und den Verlust des Vaters angesprochen wurden. Mit der Zeit jedoch ergaben sich immer häufiger Situationen, in denen sie vollkommen unvermittelt mitten im Spiel Fragen über das Unglücksgeschehen und den Vater stellten (Beispiele: „Wo ist mein Papa jetzt?“, oder „Hat er da unten keine Luft mehr gekriegt?“, oder „Ist die ganze Grube in die Luft geflogen?“). Kleinere Kinder spielten häufig Szenen nach, die sie mit dem Unglück in Verbindung brachten, wie z. B. Fahren mit einem Krankenwagen mit Sirene, Transportieren von Toten oder Einsturz von kunstvoll mit Bauklötzen errichteten Gebäuden. Da viele Kinder keine richtige Vorstellung davon hatten, wie die Arbeitsplätze ihrer Väter unter Tage ausgesehen hatten, wurde der Bergwerkdirektor gebeten, alte Dias zur Verfügung zu stellen, auf denen die Männer bei den Tätigkeiten unter Tage zu sehen waren. Er selber führte die Dias in einer Kindergruppe vor und beantwortete die Fragen der Kinder. Es handelte sich hierbei um eine Exposition mit Ängsten und Anspannungen auf beiden Seiten: auf Seiten der Kinder die Konfrontation mit dem aus ihrer Sicht für den Tod ihrer Väter verantwortlichen Mann und mit Bildern von der Arbeitswelt unter Tage; auf Seiten des Bergwerkdirektors die Konfrontation mit den Kindern seiner 51 umgekommenen Mitarbeiter und die Auseinandersetzung mit seinen eigenen durch das Unglück ausgelösten Gefühlen. Diese Konfrontation ermöglichte es den Kindern, das Bild vom Bergwerkdirektor als dem für den Verlust der Väter Verantwortlichen zu korrigieren zu der Erfahrung, es mit B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken einem Menschen zu tun zu haben, der selber trauert und die erklären kann, dass das Unglück unvorhersehbar war. Die Kinder konnten Fragen stellen, die hilfreich waren bei der Korrektur unrealistischer quälender Vorstellungen, wie die Väter umgekommen waren, z. B. dass sie tagelang langsam verdurstend und erstickend gestorben seien. Die Kinder wirkten nach dieser Veranstaltung deutlich befreiter. Auch nach anderen Maßnahmen, durch die das Informationsbedürfnis der Kinder gestillt wurde, wie z. B. Besuch des Kraftwerks, wirkten viele Kinder ruhiger und zufriedener. Eine weitere konfrontative Auseinandersetzung mit dem Unglück war die Begehung der Gedenkstätte mit den Kindern vor der offiziellen Eröffnung. Die Kinder schauten sich interessiert die in Stein gehauenen Darstellungen aus dem Leben der Bergleute an und konnten Fragen zum Arbeitsplatz ihres Vaters klären. Am stärksten zog es alle zu dem Bronzering, auf dem sie die Namen ihrer Väter suchten. Fast alle Kinder fassten die Buchstaben des Namens ihres Vaters an und versuchten so auf ihre Weise, das Geschehene zu „begreifen“. Die Kinder stellten viele konkrete Fragen, etwa wo der Eingang der Grube gewesen sei, wo das Haus gestanden habe, wo die Väter sich umgezogen haben und so weiter. Auf diese Weise konnten es die Kinder leichter nachzuvollziehen, was am Unglückstag geschehen war. Nach dem Anschauen der Gedenkstätte wurde den Kindern Gelegenheit gegeben, ihre Gedanken und Gefühle zu diesem Tag in einem Bild auszudrücken. Zwei dieser Bilder sind im Anhang A aufgeführt (Abbildungen A.4 und A.5). Ferner war die Durchführung von leichteren unterhaltenden Veranstaltungen, wie z. B. Faschingsfest, Ausflüge, Zauberer- und Clown-Aufführungen, für die Entwicklung der Kinder wichtig, da sie dort auch ihre Mütter zumindest zeitweise wieder in einer gelösten Stimmung erleben konnten. Viele Kinder litten unter der Angst, die Mutter mit ihrer Trauer zu sehr zu belasten und berichteten, dass sie es unter allen Umständen vermeiden wollten, dass die Mutter es merkte, dass sie nachts heimlich im Bett weinten. Auch Mütter verhielten sich ähnlich und versuchten, ihre Trauer vor den Kindern zu verbergen. Diese Haltungen hatten die Auswirkung, dass oft beide Seiten, Mütter und Kinder vorwurfsvoll voneinander glaubten, der andere trauere schon lange nicht mehr über den Verlust des Vaters der Familie. Aus diesem Grunde wurden Erziehungsberatungsgespräche mit Kindern und deren Müttern geführt, mit dem Ziel, die Trauer voreinander zuzulassen und so wieder besser zueinander zu kommen. Gruppen, die das Unglück unmittelbar erlebt hatten (Verletzte, Gerettete, Grubenwehren) Bei den Betroffenen, die das Unglück unmittelbar aus nächster Nähe miterlebt hatten, bestand das Hauptinteresse darin, nachzuvollziehen, was genau mit ihnen und ihren Kollegen während der Stunden bzw. Tage des Unglücks geschehen war. Da viele von ihnen sich durch das starke Medieninteresse und die hartnäckigen Nachfragen von Reportern und Journalisten gestört und hintergangen fühlten, hatten sie sich innerlich verschlossen und misstrauisch zurückgezogen. Nicht wenige hatten im Stadium der höchsten Betroffenheit und Erregung direkt nach dem Unglück mit Journalisten oder vor laufenden Kameras gesprochen und fühlten sich ausgenutzt, in die Öf- 97 98 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken fentlichkeit gezerrt, falsch dargestellt und schämten sich für das Gesagte oder für Photos in der so genannten „Yellow Press“. Sie hatten den Eindruck, die Umwelt sei lediglich an ihrer „Story“ interessiert, die dazu noch gewinnträchtig vermarktet wurde, nicht jedoch daran, wie es ihnen als Person nach dem Unglück wirklich ging. Deswegen war der geschützte Raum in einer Gruppe mit gleichermaßen Betroffenen eine grundlegende Voraussetzung, um überhaupt das systematische Gespräch zur Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse aufnehmen zu können. Die Gespräche über das Unglück selbst liefen dann in der Regel sachlich unter Zurücknahme beziehungsweise Kontrolle der Emotionen ab. Dafür war die oben skizzierte Struktur der Gruppensitzungen hilfreich, durch die vorgegeben wurde, sich zunächst die Fakten aus den verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen, um es jedem zu ermöglichen, sich einen Gesamtüberblick über das Unglück zu verschaffen. Besonders beeindruckend für alle Beteiligten waren in diesen Gruppen die folgenden Treffen und Gesprächsrunden. Besuch der Unglückstelle mit der Gruppe der verletzten Bergleute. Zur Rekapitulation des Unfallgeschehens wurde mit den inzwischen körperlich genesenen Bergleuten, die während der Explosion über Tage gearbeitet hatten, der Besuch der Unfallstelle durchgeführt. Dort suchte jeder genau die Stelle auf, wo er zum Zeitpunkt der Explosion tätig war. Dadurch konnten auch diejenigen Teilnehmer der Gruppe, die unter einer teilweisen oder auch weit reichenden Amnesie des Unfallgeschehens litten, leichter nachvollziehen, was sie damals gedacht und gefühlt hatten und wie sie sich im Anschluss verhalten hatten. Im Vorfeld war die dafür notwendige Voraussetzung geklärt worden, nämlich dass die Teilnehmer die Lücken schließen wollten und somit diese Intervention als Informationsgewinn und nicht als Retraumatisierung erleben konnten. Die Intervention wurde von den Betroffenen zwar als emotional belastend, aber als außerordentlich förderlich für die Traumabewältigung ausgewertet. Im Anschluss an den Besuch der Unglückstelle konnten die Erlebnisse der Einzelnen ausführlich und im Detail nachbesprochen werden. Treffen der Geretteten mit den Witwen. Die geretteten Bergleute äußerten schon bald nach dem Unglück, dass sie große Schwierigkeiten empfänden, den Witwen der getöteten anderen Bergleute zu begegnen. Sie hatten den Eindruck, diese gönnten ihnen nicht die Rettung und wünschten sich an deren Stelle ihren verunglückten Mann. In der Stadt versuchten die geretteten Bergleute, der Begegnung mit einer Witwe aus dem Weg zu gehen. Sie wechselten die Straßenseite oder flüchteten sich in Geschäfte, weil sie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten. Bei manchen war das Vermeidungsverhalten so ausgeprägt, dass sie gar nicht mehr in die Stadt gingen, um möglichen Begegnungen mit den Witwen zu entgehen. Dazu kam für die Geretteten eine oft empfundene „Überlebensschuld“. Sie äußerten nicht selten, es sei keine Freude, überlebt zu haben und es wäre besser gewesen, sie seien bei ihren Freunden „unten“ geblieben. Es sei eine Qual, andere Menschen zu treffen, weil alle in der Gemeinde wüssten, dass sie die Überlebenden seien, und besonders unerträglich sei es bei den Witwen der umgekommenen Kumpel. Auf Seiten der Witwen wurde das Vermeidungsverhalten der Geretteten als Abweisung interpretiert und als Kränkung empfunden. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Aus diesen Gründen wurde ein Treffen zwischen Witwen und Geretteten in jeder Gruppe vorbereitet und unter großem Erwartungsdruck beider Seiten durchgeführt. Nach Überwindung der anfänglichen Anspannung und Sprachlosigkeit auf beiden Seiten konnten die Geretteten den Witwen gegenüber ihre Schwierigkeiten darlegen und ihre Befürchtungen äußern, die Witwen gönnten ihnen das Leben nicht. Die Witwen ihrerseits konnten den Geretteten erklären, dass sie natürlich lieber ihre eigenen Männer als Überlebende gehabt hätten, aber dass sie doch froh seien, dass wenigstens sechs von allen gerettet worden waren. Darüber hinaus nutzten viele Witwen die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu bekommen, wie es in den Stunden und Tagen nach der Explosion unter Tage ausgesehen hatte, wie die anderen umgekommen waren und ob eventuell ihr Mann von den Geretteten noch gesehen worden war und unter welchen Umständen er gestorben sei. Tränen flossen auf beiden Seiten und es entstand bei allen die Gewissheit, dass man gemeinsam unter der gleichen Situation litt, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Insgesamt war es für alle Beteiligten eine ergreifende und verbindende Begegnung, in der deutlich wurde, wie wichtig es im Sinne einer erfolgreichen Traumabewältigung ist, die Sprachlosigkeit zu überwinden, das erlebte Grauen und die daraus entstandene Problematik in Worte zu fassen und aus der sozialen Isolation herauszutreten. Nach diesem Treffen fiel es allen Beteiligten leichter, auch bei zufälligen Begegnungen aufeinander zuzugehen. Alle hatten das Gefühl, einen schweren, aber äußerst lohnenden Schritt in der Bewältigung der Unglücksfolgen getan zu haben. Treffen der Geretteten mit ihren Rettern. Wie oben beschrieben, war der Einsatz für die Grubenwehren körperlich und psychisch extrem belastend gewesen. Teilweise mussten sie sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens durch die zerstörten und mit Kohlenmonoxyd verseuchten Stollen durchkämpfen, um dann letztlich doch nur Tote bergen zu können. Die Tatsache, zur Rettung Überlebender gekommen zu sein, dann aber nur noch Tote bergen zu können, stellte für sie die größte psychische Belastung dar. In dem ganzen Chaos und Elend gab es jedoch ein herausragendes positives Ereignis, die Rettung der sechs Überlebenden. Für Retter und Gerettete war es ein großes Bedürfnis, sich gegenseitig kennen zu lernen und den Ablauf der Rettung genau nachzubesprechen. Dazu fuhr der Psychologe mit den sechs Geretteten zum Heimatbergwerk der Retter-Grubenwehr nach Bergkamen. In Anlehnung an die bewährte Struktur der Gruppennachbesprechung im Debriefing (s. o.) wurden zunächst auf der Faktenebene alle Erfahrungen, alles, was die Beteiligten gesehen, gehört, gerochen oder sonst wie wahrgenommen hatten, zusammengetragen. Dabei wurde immer nach einem bestimmten Abschnitt von der einen Gruppe „umgeschaltet“ zur anderen Gruppe. Zum Beispiel berichteten die Geretteten zuerst davon, wie sie die Explosion in der Ferne gehört hatten, wie sie erst versucht hatten, sich „Richtung Heimat“ (zum Ausfahrtschacht bzw. zum Schrägstollen, der über Tage führte) zu retten, wie sie die ersten Toten sahen und das Gas bemerkten, sie vergeblich versuchten, einen Kumpel mitzuziehen, der schon vom tödlichen Gas inhaliert hatte, sich dann wieder in den Blindstollen zurückzogen, um von dort zu versuchen, Funkkontakt nach über Tage herzustellen. Dann wurde umgeschaltet zum Rettertrupp. Jeder Einzelne berichtete, wie er vom Notfall benachrichtigt wurde, wie ernst die Stimmung und die Anspannung auf der Fahrt nach Borken war, wie man sich auf den gefährlichen Einsatz vorbereitete und wie man 99 100 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken schließlich zum ersten Mal in die zerstörte Grube einfuhr, noch weit entfernt von den Geretteten, wie immens das Ausmaß an Zerstörung war, wie schwierig es war, sich vorzuarbeiten und wie man auf die ersten Toten traf. Auf diese Weise wurde das gesamte Geschehen aufgearbeitet bis zu dem Punkt, als beide Gruppen sich trafen, die Retter den Geretteten Sauerstoffmasken anlegten und mit ihnen den Rückweg antraten bis zu der Rettungsgondel, die die sechs Bergleute über Tage beförderte. Anschließend wurden Gedanken, Gefühle und danach aufgetretene Symptome ausgetauscht und reflektiert. Die Erfahrung, dass sowohl Gerettete als auch Retter mit ähnlichen Gedanken und Ängsten während der Rettung und nahezu identischen Symptomen nach dem Einsatz zu kämpfen hatten, war für beide Seiten entlastend und verbindend. Besonders beeindruckend fanden alle, dass die Schilderung dieser Abläufe niemanden kalt ließ, sondern dass alle tief bewegt waren und sich auch ihrer Tränen nicht schämen mussten. Bei einem zweiten Treffen fuhren alle gemeinsam in die Grube in Bergkamen ein, um sich die Arbeitsplätze der Retter-Grubenwehr in 1 000 Meter Tiefe aus nächster Nähe anzuschauen. Das gemeinsame „Einfahren“ war für die Geretteten der erste Aufenthalt unter Tage nach dem Unglück und stellte eine Expositionsbehandlung mit den Geretteten gegen ihre nach dem Unfall entstandene Angst vor dem Einfahren dar. Die dabei auftretenden Gefühle und ablaufenden psychischen Prozesse konnten zusammen mit dem betreuenden Psychologen im wahrsten Sinne des Wortes „vor Ort“ bearbeitet werden. Die Tage der gemeinsamen Bearbeitung der Vergangenheit und der aktuellen Beschwerden und des gemeinsamen Einfahrens konnten nicht abgeschlossen werden ohne einen Abschluss mit Grubenwasser (Bergmannsschnaps) und gemeinsamem Umtrunk. Die gemeinschaftlichen Erfahrungen waren so verbindend, dass es in den Folgejahren noch zu zahlreichen Gegenbesuchen und gemeinsamen Fahrten mit vielen Gesprächen kam. 1.2.3 Individuelle Ebene Zusätzlich zu den Gruppeninterventionen wurden mit vielen Betroffenen auf deren Wunsch hin zahlreiche Einzeltermine zur Bearbeitung spezieller Problemfelder durchgeführt. In der Regel ging es dabei um gezielte Interventionen zur Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen und komorbider Störungen und um die Bearbeitung besonders schwieriger individueller Problemkonstellationen. Häufigkeit der Einzelgespräche. Aus der folgenden Übersicht geht die Anzahl der Einzelgespräche in den Jahren 1988 bis 1991 hervor. Erstes Jahr 1988/1989 58 Zweites Jahr 1989/1990 191 Drittes Jahr 1990/1991 183 Gesamt 432 Beispielhaft seien hier kurz die Fälle einiger Witwen, einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, eines Grubenwehrmannes und eines Betriebsangehörigen aufgeführt. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Einzeltherapie Witwen Einzeltherapien bei Witwen wurden beispielsweise bei folgenden Problemkonstellationen durchgeführt: Frauen, die eine Depression entwickelt hatten, Frauen, die unter hartnäckigen psychosomatischen Beschwerden litten, wie beispielsweise monatelange Durchfälle, Schlafstörungen etc., Eine Frau, die gerade in Trennung von ihrem Mann begriffen war, als das Unglück geschah und an starken Schuldgefühlen litt, Eine Frau, die angab, von dem Unglück vorher geträumt zu haben und sich schuldig fühlte, ihren Mann und alle anderen nicht gewarnt zu haben. Die Interventionen waren gesprächspsychotherapeutisch und verhaltenstherapeutisch. Hauptsächlich ging es um die Auseinandersetzung mit dem Unglück, die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse, die Bearbeitung von Schuldgefühlen und die Klärung von Hindernissen, die einem normalen Trauerprozess im Wege standen. Einzeltherapie Mutter Eine Mutter, deren Sohn durch die Explosion bis zur Unkenntlichkeit entstellt war, hatte ihn bei der Identifikation nicht mehr als ihren Sohn erkennen können. Sie litt unter starken Schuldgefühlen, da sie ihrem Jungen die Arbeit auf der Zeche besorgt hatte und der junge Mann vor Beginn seines Studiums dort Geld verdienen wollte. Er war am Unglückstag zum ersten Mal eingefahren. Ihr war versichert worden, dass der entstellte Leichnam wirklich der ihres Sohnes sei und dass er komplett im Sarg liege. Nach der Beerdigung wurde jedoch noch ein Bein von ihm gefunden. Das Grab musste wieder geöffnet und das Bein mit beerdigt werden. Durch die Konfrontation mit dieser Entwicklung geriet die Frau in einen psychischen Ausnahmezustand. Sie zweifelte mehr und mehr daran, ob ihr Sohn tatsächlich in der Grube umgekommen sei und träumte nachts davon, er irre noch durch die Schächte und rufe sie um Hilfe. Die Therapie bestand neben zahlreichen Einzelgesprächen darin, ihr den Tod des Sohnes nachvollziehbar zu machen. Dazu wurde ein Steiger gefunden, der ihrem Sohn unmittelbar vor dem Unglück eine Arbeitsaufgabe übertragen hatte und dann selber ausgefahren war. Der Autor suchte gemeinsam mit der Mutter und dem Steiger in der zerstörten Grube genau die Stelle auf, an der der junge Mann gearbeitet hatte und wo der Leichnam auch gefunden worden war, wie auf Unterlagen nachzulesen war. Dort wurde der Mutter Gelegenheit gegeben, sich den Tod ihres Sohnes zu vergegenwärtigen und sich ein Bild über die Umstände und den Ort des Todes zu machen. Durch diese Expositionsbehandlung war es ihr möglich, den Tod des Sohnes anzunehmen und in einen angemessenen Trauerprozess einzusteigen. Einzeltherapie Grubenwehrmann Der 29-jährige Grubenwehrmann war mit einer auswärtigen Mannschaft zum Einsatz nach Borken gekommen. Er musste Tote bergen, sie in einen Plastiksack verpacken und mit den Toten senkrecht gestellt in einer engen Gondel mit Körperkontakt ausfahren. Über Tage war er mit dem Leid der Angehörigen konfrontiert. Zusätzlich musste er 101 102 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken einzelne Leichenteile bergen. Der Einsatz war wegen des hohen KohlenmonoxydGehalts extrem gefährlich, psychisch belastend und anstrengend. Sein individuelles Trauma bestand jedoch nicht im Erleben der Konfrontation mit den Leichen, sondern darin, dass er sich vorwarf, es nicht geschafft zu haben, den am Schacht wartenden Frauen ein Wort des Trostes zu geben, wenn er mit einer Leiche ausgefahren kam. Einige Monate nach dem Einsatz bekam er Panikattacken beim Einfahren in seine Heimatgrube. Er träumte nachts von seinem Einsatz in Borken und entwickelte das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung mit verzögertem Beginn. Nach mehreren ambulanten und stationären Behandlungen, in denen jedoch die posttraumatische Belastungsstörung weder diagnostiziert noch behandelt wurde, war er nicht mehr in der Lage, unter Tage zu arbeiten und sollte verrentet werden. In der Therapie wurde mit ihm der Einsatz kognitiv nachbesprochen und emotional bearbeitet. Zentral war die Bearbeitung seines Vermeidungsverhaltens auf verschiedenen Ebenen: der Vermeidung von Gedanken an das Unglück, der Vermeidung von Gesprächen über das Unglück, der Vermeidung von Zeitungs- und Fernsehberichten über das Unglück, der Vermeidung des Einfahrens unter Tage. Über die Konfrontation mit Zeitungsartikeln und Videomaterial über das Unglück wurde die Auseinandersetzung aktiv betrieben. Expositionsbehandlungen in einem Bergbaumuseum mit einem nachgebauten Schacht und anschließend in einem Salzbergwerk versetzten ihn wieder in die Lage, einzufahren und seine Tätigkeit als Maurer unter Tage wieder aufzunehmen. Einzeltherapie Betriebsangehöriger Ein für Sicherheit und Ordnung der Grube zuständiger Betriebsangehöriger litt unter starken Schuldgefühlen, dass unter seiner Verantwortung das Grubenunglück geschehen war. Er hatte schlaflose Nächte, träumte immer wieder vom Unglück, litt unter Rückenschmerzen, fühlte sich rast- und ruhelos und grübelte stundenlang über die Ursache des Unglücks. Er erfüllte alle Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung. Einige Zeit später erkrankte er an einem Darmkarzinom. Kognitive Interventionen zur Bearbeitung seiner Schuldgefühle fruchteten wenig. Als nach monatelangen Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben wurde, dass kein schuldhaftes Verhalten einer Person festzustellen sei, sondern die Kohlestaubexplosion unvorhersehbar und somit nicht zu verhindern gewesen wäre, schien die Chance gegeben, dass sich seine Schuldgefühle auflösten. Er beteuerte jedoch immer wieder, er könne mit der „Schuld“, dass in seiner Zeit so etwas Schlimmes passiert sei, nicht leben. Nach der operativen Behandlung seiner Karzinom-Erkrankung wurde mit verstärkten therapeutischen Interventionen, jedoch wenig Erfolg mit ihm an seiner Depression gearbeitet. Er entwickelte wenige Zeit später ein Rezidiv und musste wiederum in die Klinik. Die letzten psychotherapeutischen Versuche fanden in der Klinik statt. Dabei wiederholte er nur immer wieder: „Ich kann mit dieser Schuld nicht leben!“. Einige Wochen später verstarb er. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken An diesem Fall wird deutlich, dass nicht alle Traumatisierten mit psychotherapeutischen Mitteln erreichbar sind. Manchmal scheint die innere Verletzung so stark, dass keine Heilung mehr möglich ist. 1.2.4 Stand am Ende der Betreuungsarbeit Im Folgenden wird der Stand der Traumabewältigung beschrieben, wie er sich nach Beendigung der Betreuungsarbeit, dreieinhalb Jahre nach dem Unglück, den Betreuern darstellte. Es handelt sich um rein deskriptive Daten, die sich aus einer Einschätzung eines Expertenteams bestehend aus den praktisch tätigen psychosozialen Fachleuten in Borken, ergab (s. Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). Eine ausführliche inferenzstatistische Auswertung mit Gruppenvergleichen und der Untersuchung von Zusammenhängen einzelner Merkmale erfolgte erst im Rahmen dieser Arbeit und wird unter Abschnitt B 1.3 vorgestellt. Entwicklung der erwachsenen Betroffenen Erhebungsinstrumente. Die Einschätzung der Traumabewältigung geschah mit Hilfe der siebenstufigen Skala „Phasen der Traumabewältigung“ (PTB-2, Pieper & Schwarz et al., 1991). Die Grundlage für die Phaseneinteilung in sieben Phasen bilden die Arbeiten von Lindemann (1944; 1985) zur Trauerarbeit und die Überlegungen von Peterson, Prout und Schwarz (1991). Unter Traumabewältigung wird eine Entwicklung auf fünf Dimensionen verstanden: 1. Unglück/Verlust: Wie gut hat die von der Katastrophe betroffene Person das Unglück und die damit verbundenen Folgen, z. B. den Verlust eines geliebten Menschen, oder Beeinträchtigung seiner beruflichen Leistungsfähigkeit, verarbeitet? 2. Alltag/Kontakte: Wie gut schafft sie es, ihren Alltag zu bewältigen (z. B. Kindererziehung, Haushalt organisieren) und Kontakte zur Außenwelt aufzunehmen? 3. Körper/Psyche: Wie stark reagiert sie noch mit körperlichen oder psychischen Symptomen auf das Unglück? 4. Freizeit/Entspannung: Wie erfolgreich ist sie in ihrer Freizeitgestaltung und wie gut kann sie sich entspannen? 5. Zukunft: Wie weit ist sie im Aufbau einer Zukunftsperspektive gelangt? Die sieben Phasen der Trauerbewältigung sind in Tabelle B 1.3 dargestellt. Im Idealfall einer Traumabewältigung durchläuft eine betroffene Person nach einem traumatischen Erlebnis alle Phasen in der Reihenfolge von 1 bis 7. Phase 1: vermeiden. Die Person vermeidet unbedingt die Auseinandersetzung mit dem Unglück, sie will den Verlust einer geliebten Person nicht wahrhaben. Alltagsanforderungen werden kaum bewältigt; die Person schließt sich von der Umwelt ab. Sie zeigt häufig eine voll ausgeprägte Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), kann kaum entspannen, hat keine Perspektive für ein eigenständiges Leben und lebt in der Erinnerung vollständig in der Vergangenheit. Phase 2: umgehen. Die Person vermeidet die Auseinandersetzung mit dem Unglück, sie hat den erlittenen Verlust nicht verarbeitet. Sie bewältigt lediglich die wichtigsten Alltagsanforderungen und zieht sich weitgehend 103 104 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken zurück. Sie zeigt deutliche Anzeichen einer PTBS und starke Somatisierung, ist im Freizeitbereich überaktiv oder gelähmt, hat wenig bis keine Zukunftsperspektive. Phase 3: sich sträuben. Die Auseinandersetzung mit dem Unglück wird möglichst vermieden; die Person sträubt sich dagegen, den Verlust zu akzeptieren. Alltagsanforderungen werden weitgehend bewältigt; Kontaktaufnahme von anderen wird vorwiegend als störend empfunden. Die Person zeigt Anzeichen einer PTBS und phasen- oder problemabhängiges Somatisieren. Sie gönnt sich keine Freizeit, hat kein Interesse an einer Zukunftsperspektive. Tabelle B1.3: Phasen der Trauerbewältigung – Abfolge und Bewertungsschema Phase Verhalten Bewertung des Entwicklungsstands 1 2 3 Phase 1 Phase 2 Phase 3 vermeiden umgehen sich sträuben Pathologische TB Sehr schwierige TB Problematische TB unzureichende/ nicht erfolgreiche Trauerbewältigung 4 5 6 7 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 hinnehmen suchen ausprobieren lösen/verwirklichen Passiv durchlaufene TB Gelingende TB Gut gelungene TB Voll gelungene TB erfolgreiche Trauerbewältigung Phase 4: hinnehmen. Die Auseinandersetzung mit dem Unglück und den eigenen Gefühlen wird als notwendig anerkannt, der Verlust wird hingenommen. Alltagsanforderungen werden bewältigt, Kontaktaufnahme von anderen wird zugelassen. Die Person ist initiativlos und anfällig für Erkrankungen, nimmt passiv an Freizeitgestaltung und Entspannung teil (zum Beispiel Fernsehen), hat wenige Zukunftsperspektiven für sich selber, eventuell aber deutlichere Perspektiven für die Kinder. Phase 5: suchen. Die Person sucht die Auseinandersetzung mit dem Unglück und den eigenen Gefühlen und bemüht sich, den Verlust zu begreifen. Alltagsprobleme werden aktiv angegangen, Kontakte allgemein gesucht. Die Person achtet auf Alarmzeichen des Körpers, sucht nach Möglichkeiten, es sich besser gehen zu lassen und nach (neuen) Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Entspannung. Sie hat eine Zukunftsperspektive in der Phantasie, jedoch weder Kraft noch Mut, diese umzusetzen. Phase 6: ausprobieren. Die Auseinandersetzung mit dem Unglück ist weitgehend abgeschlossen. Die Person versucht, das Geschehene zu akzeptieren. Bei Alltagsproblemen werden neue Lösungen ausprobiert. Die Person ist offen für neue Kontakte oder nimmt alte Beziehungen wieder auf. Sie probiert aktiv neue Lebensqualitäten aus, nimmt alte Freizeitaktivitäten wieder auf und probiert neue. Sie hat eine Zukunftsperspektive und unternimmt erste Schritte zu deren Verwirklichung. 105 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Phase 7: lösen/verwirklichen. Die Auseinandersetzung mit dem Unglück ist abgeschlossen. Die Erinnerungen an das Unglück können hervorgeholt und aktiv „beiseite“ gestellt werden. Die Person akzeptiert das Geschehene und hadert nicht mit dem Schicksal. Sie hat eine neue Eigenständigkeit in der Bewältigung von Alltagsproblemen erreicht und nimmt aktiv Kontakte mit einem neuen Rollenverständnis auf. Traurigkeit kann gelebt werden, neuer Lebenswille wächst. Die Person gestaltet ihre Freizeit aktiv, hat eine neue Lebensperspektive entwickelt und beschäftigt sich mit deren Verwirklichung. Nicht jeder Betroffene durchläuft alle Phasen von eins bis sieben. Besonders wenn das Verhalten der Personen von Vermeidung geprägt ist, bleiben sie in einer der Phasen stehen. Die Qualität der Traumabewältigung hängt davon ab, in welcher Phase die Entwicklung stehen geblieben ist. Tabelle B 1.3 gibt einen Überblick über die Sprachregelung, die für die Betroffenen in Borken gefunden wurde. In der Bewertung der erreichten Traumabewältigung zum Ende der Betreuung wurde die Entwicklung einer Person, die nach der Experteneinschätzung bei Phase eins, zwei oder drei stehen geblieben war, als unzureichende oder nicht erfolgreiche Traumabewältigung bezeichnet. Ab Phase vier wurde die Traumabewältigung als erfolgreich definiert. Das vollständige Bewertungsschema ist im Anhang A dargestellt. Ergebnisse. In die erste Einschätzung der Expertengruppe, dreieinhalb Jahre nach dem Unglück waren N = 63 Hauptbetroffene einbezogen, 30 deutsche Witwen, 11 türkische Witwen, 22 Mütter/Väter. Es ergab sich das in Tabelle B 1.4 dargestellte Bild: Tabelle B1.4: Erfolgreiche vs. nicht erfolgreiche Traumabewältigung, dreieinhalb Jahre nach dem Unglück (N = 63) Lebensbereich Unglück/Verlust Alltag/Kontakte Körper/Psyche Freizeit/Entspannung Zukunft Erfolgreich Nicht erfolgreich N Prozent N Prozent 48 62 59 62 54 76.2% 98.4% 93.5% 98.4% 85.5% 15 1 4 1 9 23.8% 1.6% 6.5% 1.6% 14.5% Dreieinhalb Jahre nach der Katastrophe hatten nach Einschätzung der Expertengruppe also rund zwei Drittel (76.2%) der 63 engsten Bezugspersonen der tödlich Verunglückten das Unglück und den Verlust – nach der oben beschriebenen Definition – bewältigt. In den Dimensionen Alltagsbewältigung/Kontaktaufnahme sowie Freizeitaktivitäten und Entspannung konnte bei nahezu allen Betroffenen (98%) eine erfolgreiche Entwicklung festgestellt werden. Bei der Überwindung körperlicher und psychischer Symptomatik in pathologischer Form waren 93% aller Betroffenen erfolgreich. Das bedeutet, sie reagierten nicht mehr körperlich/psychisch in pathologischer Form auf das Unglücksgeschehen. 106 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Der Aufbau einer Zukunftsperspektive gelang rund 85% der Betroffenen. 15% hatten überhaupt noch keine Zukunftsperspektive für sich entwickelt. Von den verletzten Bergleuten hatten 63% das Unglück und die damit verbundenen Folgen erfolgreich verarbeitet, von den geretteten Bergleuten 83%. Betrachtet man die Gruppe der 15 Personen näher, die das Unglück und den Verlust nach dreieinhalb Jahren nicht erfolgreich verarbeitet hatten, stellt sich heraus, dass sie sich aus acht Eltern und sieben Witwen zusammensetzt, entsprechend 40% aller Eltern, beziehungsweise 24% aller Witwen. Aus diesem Befund lässt sich schließen, dass der Prozess der Traumabewältigung für die Eltern konfliktreicher oder zumindest langsamer verläuft als für die Witwen und dass der Verlust des eigenen Kindes schwieriger zu verarbeiten ist als der Verlust des Partners. 12 Personen aus dieser Gruppe waren Deutsche (entsprechend 24% aller betroffenen Deutschen), drei waren Personen mit türkischer Herkunft (23% aller betroffenen Türken). Türken und Deutsche wiesen demnach prozentual in etwa gleiche Werte in der Traumabewältigung auf. Untersucht man, wie viele der 15 Betroffenen mit unvollständiger Traumabewältigung an dem zusätzlich zur allgemeinen sozialen Betreuung angebotenen psycholgischtherapeutischen Gruppenprogramm teilnahmen, ergibt sich folgendes Bild: 6 (nur Eltern) nahmen an keiner therapeutischen Maßnahme teil; 2 begannen eine therapeutische Maßnahme, brachen sie jedoch wieder ab; 7 (2 Eltern) nahmen an einer therapeutischen Maßnahme teil. Unter den 15 Personen mit noch unvollständiger Traumabewältigung waren also zu gleichen Teilen solche, die an zusätzlichen Maßnahmen teilgenommen hatten, wie auch solche, die nie oder nur zeitweise teilgenommen hatten. Im Vergleich dazu nahmen von denjenigen, die das Unglück erfolgreich verarbeitet hatten, zwei Drittel an psychologisch geleiteten Gruppen teil. Zu Beginn der Einschätzung war ein erklärtes Ziel des Arbeitskreises Stolzenbachhilfe gewesen, denjenigen, die noch keine vollständige Traumabewältigung erreicht hatten, weitere therapeutische Hilfestellung anzubieten. Nach entsprechenden therapeutischen Maßnahmen und einer wiederholten Einschätzung ein Jahr später, zeigte eine Reihe von Personen aus diesem Kreis ebenfalls eine positive Entwicklung. Es blieben neun Personen mit nicht erfolgreicher Traumabewältigung übrig, davon waren sieben aus der Elterngruppe, zwei aus der Witwengruppe. Damit bestätigte sich die bereits in der ersten Auswertung festgestellte Tendenz, dass bei Eltern die Traumabewältigung offensichtlich anders verlief als bei den Witwen. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man die von den Betroffenen entwickelte Zukunftsperspektive betrachtet. Unter den neun Personen, die kaum eine Zukunftsperspektive entwickelt hatten, waren acht Eltern und nur eine Witwe. Viele der Eltern gaben an, mit dem Verlust des Sohnes den eigentlichen Sinn des Lebens, die Zukunft, auf die man baute, verloren zu haben. In der Schlusseinschätzung zogen die teilnehmenden Beobachter folgende Bilanz: 86%, das entspricht vier Fünfteln der Hauptbetroffenen, hatten vier Jahre nach der Katastrophe die Auseinandersetzung mit dem Unglück und dem Verlust naher Angehöriger im Sinne der oben gegebenen Definition erfolgreich bewältigt (s. Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe, 1992). B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Entwicklung der betroffenen Kinder Erhebungsinstrumente. Um die psychischen Auffälligkeiten der Kinder nach der Katastrophe einzuschätzen, wurden mit Hilfe der CBCL-Listen (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998) 49 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis siebzehn Jahren durch deren Mütter eingestuft. Die Einschätzung der Mütter erfolgte retrospektiv vier Jahre nach dem Unglück und bezog sich auf zwei Bereiche: 1) Fragen zu psychischen Auffälligkeiten der Kinder im ersten halben Jahr nach dem Unglück, 2) Fragen zu psychischen Auffälligkeiten in den letzten sechs Monaten vor dem Untersuchungsdatum, also dreieinhalb bis vier Jahre nach dem Unglück. Ergebnisse. Drei Hauptergebnisse lassen sich beschreiben: 1) In der Gruppe der 6- bis 11-jährigen Jungen waren im ersten halben Jahr nach dem Unglück (rückblickend beurteilt durch die Mütter) im Schnitt keine gehäuften Auffälligkeiten festzustellen. Dreieinhalb Jahre nach dem Unglück jedoch zeigte diese Gruppe deutlich erhöhte psychische Auffälligkeiten. Sie wies einen Prozentrang von 89 auf, was bedeutet, nur 11 Prozent der gleichaltrigen Normalbevölkerung weist höhere Auffälligkeitswerte auf. In der Gruppe der 6- bis 11-jährigen Mädchen zeigte sich ein ähnlicher Trend, allerdings in abgeschwächter Form. 2) In der Gruppe der 12- bis 17-jährigen Jungen war die Entwicklung genau umgekehrt: deutlich erhöhten Auffälligkeitswerten im ersten halben Jahr nach dem Unglück (Prozentrang 83) stand ein Rückgang der Werte dreieinhalb Jahre nach dem Unglück gegenüber (mit Prozentrang 73 immer noch ein erhöhter Wert). Die Mädchen folgten wiederum dem gleichen Trend, wenn auch weniger ausgeprägt (Rückgang von Prozentrang 73 auf 58). 3) In der Gruppe der untersuchten 49 Kinder und Jugendlichen muss vier Jahre nach dem Unglück bei rund 25 Prozent von einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung ausgegangen werden. Nach kinder- und jugendpsychiatrischen Untersuchungen (Remschmidt & Walter, 1989) ist in der Normalbevölkerung mit rund zehn Prozent behandlungsbedürftigen psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen zu rechnen. Demnach ist die Rate an psychischen Auffälligkeiten vier Jahre nach dem Unglück gegenüber der Normalbevölkerung deutlich erhöht. 107 108 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken 1.3 Qualitätssicherung und Evaluation 1.3.1 Methode Die verheerende Braunkohlestaubexplosion im Tiefbau Stolzenbach der Preussen Elektra in Borken kostete 51 Menschen das Leben, viele wurden verletzt, viele Menschen verloren den Lebenspartner, ein Kind oder einen Kollegen; die Rettungsund Bergungskräfte machten Erfahrungen, auf deren Schrecken sie nicht im geringsten vorbereitet waren – der Verlauf des Unglücks, die vom Ereignis betroffenen Gruppen, deren Reaktionen und die Hilfsmaßnahmen wurden in den vergangenen Abschnitten ausführlich dargestellt. Zum Zeitpunkt des Unglücks, im Juni 1988, und in den folgenden Jahren der Katastrophennachsorge, gab es in Deutschland keine oder doch nur sehr wenige Erfahrungen im Umgang mit den psychologischen Folgen von Großschadensereignissen. Aus dem angloamerikanischen Raum kommend, fanden aber immerhin Erkenntnisse über die damals in Deutschland noch wenig ins öffentliche Bewusstsein gerückte Posttraumatische Belastungsstörung ihren Weg nach Europa und in den deutschen Sprachraum. Ziel und Anlage der Untersuchung Nichtsdestotrotz konnte die Katastrophennachsorge in Borken, die unter der Bezeichnung Arbeitskreis Stolzenbachhilfe organisiert und vom Autor der vorliegenden Arbeit maßgeblich geprägt wurde, auf wenig vorhandene und erprobte Konzepte zurückgreifen. Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt wurde die Notwendigkeit deutlich, parallel zu der sehr fordernden Arbeit mit den Betroffenen Informationen zu sammeln, um einerseits Erkenntnisse über individuelle und Gruppenprozesse im Lauf der Bewältigung der Katastrophe zu gewinnen und andererseits Aufschluss über die Auswirkungen verschiedener Hilfsmaßnahmen zu bekommen. Im Rahmen dieser Betreuungsmaßnahmen wurden systematisch strukturierte Informationen gesammelt und später einer Datenauswertung zugeführt. Es lag im Wesen der Gesamtsituation, dass es sich hierbei um eine rein explorative, populations- und prozessbeschreibende Untersuchung handeln musste – zur Formulierung expliziter Hypothesen a priori über zeitliche Dynamiken, Wirksamkeit und Vergleich einzelner Maßnahmen sowie Charakteristiken und voraussichtliche Entwicklung einzelner Personengruppen fehlten einerseits Ende der 1980er Jahre die theoretischen Grundlagen, anderseits mussten die begrenzten Ressourcen, und nicht zuletzt ethische Forderungen im Umgang mit den Betroffenen bei der Anlage der Untersuchung berücksichtigt werden. Der Zweck der Borken-Studie lag vielmehr darin, einen Beitrag zur Erkundung der Prozesse nach einer Großschadenslage zu leisten. Die Borken-Studie baut auf der Pionier-Arbeit auf, die vom Arbeitskreis Stolzenbachhilfe geleistet wurde, und sollte mit ihren Begrenzungen und methodischen Besonderheiten auch so verstanden werden. Um die Situation der Betroffenen des Grubenunglücks im Verlauf der mehrjährigen psychosozialen Betreuung einschätzen zu können, sollte eine umfassende Beurteilung von Lebensumständen und traumarelevanten Befindlichkeiten vorgenommen und auf B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken wechselseitige Beziehungen untersucht werden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen verschiedene klar voneinander abgrenzbare Gruppen von Hauptbetroffenen. Von besonderem Interesse bei der Planung der Untersuchung erschien die Frage, ob diese Personengruppen sich in ihren jeweiligen Lebensumständen und Bewältigungsverläufen voneinander unterscheiden lassen. Untersuchungsziel der Datenauswertung war die Klärung der Fragen, wie die Betroffenen das Unglück verarbeitet hatten, welche der unterschiedlichen Bedingungen als protektive Faktoren gelten können und welche Maßnahmen von den Betroffenen bei der Bewältigung des Unglücks und des persönlichen Verlustes als hilfreich empfunden wurden. Teilnehmer der Untersuchung Kriterium für die Rekrutierung der Untersuchungsteilnehmer war eine hohe persönliche Betroffenheit durch das Grubenunglück. Zunächst wurde für jeden der 51 bei der Explosion getöteten Bergleute mindestens eine Hauptbezugsperson identifiziert und ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Untersuchung abgeklärt. Diese Hauptbezugspersonen waren entweder die verwitweten Ehefrauen oder bei unverheirateten Bergleuten deren Mütter und Väter. Weiterhin konnten die sechs geretteten Bergleute und sieben der über Tage Verletzte gewonnen werden, an der Untersuchung teilzunehmen. Die Teilnahme war freiwillig und unentgeltlich; es waren keine Bedingungen oder Gegenleistungen damit verbunden. Der für die Datenerhebung notwendige Mehraufwand fiel für die Teilnehmer nicht oder kaum ins Gewicht, da alle damit zusammenhängenden Maßnahmen in die allgemeine Betreuung integriert werden konnten. Insgesamt nahmen 68 Personen aus der Gruppe der Betroffenen teil, die im Rahmen der Katastrophennachsorge nach dem Grubenunglück betreut wurden. Die Untersuchungsteilnehmer wurden nach der Art ihrer Betroffenheit in fünf Gruppen eingeteilt, in Gerettete (n = 6), Verletzte (n = 7), Eltern, die durch die Katastrophe ein Kind verloren hatten (n = 15), sowie je eine Gruppe deutscher (n = 30) und türkischer Witwen (n = 10). Unter der Annahme möglicher soziokultureller Unterschiede wurden die beiden Gruppen der Witwen als eigenständige Teilstichproben betrachtet. Die meisten Betroffenen nahmen an einer psychologischen Gruppenbetreuung teil (n = 45, 66,2%), die übrigen Untersuchungsteilnehmer (n = 23, 33,8%) konnten im Rahmen der psychosozialen Nachsorge auf andere Weise rekrutiert werden. Unter den Teilnehmern waren 19 Männer und 49 Frauen. Die 19 teilnehmenden Männer waren zum Zeitpunkt der ersten Erhebung im Mittel 50,4 Jahre alt (SD = 16 Jahre), die 49 Frauen 44 Jahre (SD = 11 Jahre). Im Rahmen der Katastrophennachsorge wurden verschiedene psychologisch geleitete Gruppen angeboten, in denen die Erfahrungen mit dem Unglück verarbeitet und Bewältigungsstrategien erworben werden sollten. Die Teilnahme wurde allen Betroffenen angeboten und empfohlen, war aber freiwillig. Von den insgesamt 30 Witwen nahmen knapp zwei Drittel (18 Personen, 60%) an den psychologischen Gruppen teil, von den Eltern vier Personen (etwa ein Viertel, 26,6%), die anderen Personen aus diesen beiden Gruppen verzichteten auf eine Teilnahme. Die übrigen Teilnehmer an der Untersuchung nahmen gleichzeitig auch an den psychologisch geleiteten Gruppen teil. Die Teilnahme an der Untersuchung war also nicht abhängig von der Teilnahme an einer der psychologischen Gruppen. Über alle Unter- 109 110 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken suchungsteilnehmer betrachtet stehen Teilnehmer (n = 45) und Nichtteilnehmer an psychologischen Gruppen (n = 23) in einem Verhältnis von 66,2% zu 33,8%. Tabelle B 1.5 gibt einen detaillierten Gesamtüberblick über die Zusammensetzung der BorkenStichprobe. Als weitere Verdichtungsstufe sind die Untersuchungsteilnehmer im unteren Teil der Tabelle nach der Art ihrer individuellen Betroffenheit gruppiert. Die Erhebung einer Kontrollgruppe fand nicht statt, teils aus ethischen Überlegungen, teils wegen Nichtrealisierbarkeit aus organisatorischen und ökonomischen Gründen. Tabelle B1.5: Betroffene des Grubenunglücks von Borken, Häufigkeitsverteilung über verschiedene Gruppierungsfaktoren, getrennt nach Teilnahme vs. nicht Teilnahme an psychologischen Gruppen (N = 68) Gruppierung über … Teilnahme k. Teilnahme „Geschlecht“ Männlich Weiblich 14 (20,6%) 31 (45,6%) 5 (7,4%) 18 (26,4%) 19 (27,9%) 49 (72,1%) 45 (66,2%) 23 (33,8%) 68 (100%) 6 (8,8%) 7 (10,3%) 18 (26,5%) 10 (14,7%) 4 (5,9%) — — — — 12 (17,6%) — — 11 (16,2%) 6 7 30 10 15 (8,8%) (10,3%) (44,1%) (14,7%) (22,1%) 45 (66,2%) 23 (33,8%) 68 (100,0%) 13 (19,1%) 28 (41,2%) 4 (5,9%) — — 12 (17,6%) 11 (16,2%) 13 (19,1%) 40 (58,8%) 15 (22,1%) 45 (66,2%) 23 (33,8%) 68 (100,0%) Gesamt „Betroffenengruppe“ Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern Gesamt „Direkte Betroffenheit & Verlust“ Direkte Betroffenheit; Kollegen verloren Partner verloren Kind verloren Gesamt Gesamt Untersuchungsmaterialien Im Rahmen der Befragung der Betroffenen des Grubenunglücks von Borken wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Selbst- und Fremdbeurteilungsfragebögen eingesetzt. Im Einzelnen waren dies: 1) der Fragebogen zu Phasen der Traumabewältigung (PTB-2, Pieper & Schwartz et al., 1991); 2) die Beschwerden-Liste (B-L, von Zerssen, 1976); 3) der Fragebogen zu Haben, Lieben und Sein (H-L-S, Arbeitskreis Stolzenbachhilfe, 1991a, entwickelt nach Eric Allardt, 1973); 4) der Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück und Verlust (H-VUV, Arbeitskreis Stolzenbachhilfe, 1991b). B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Mit Ausnahme der Beschwerden-Liste von Zerssen (B-L) handelte es sich bei den verwendeten Fragebögen um psychometrische Instrumente, die explizit für den Zweck der Borken-Studie entwickelt wurden. Diese Fragebögen mussten aus ökonomischen Gründen ad hoc während der Betreuungsmaßnahmen, also ohne eine vorgeschaltete psychometrische Entwicklungsphase, konstruiert werden, um mit vertretbarem Aufwand und in hinreichend standardisierter Form Informationen über das Befinden der Betroffenen des Grubenunglücks erheben zu können. Die psychometrischen Eigenschaften (Kennwerte, Gütemerkmale), die für weitergehende Analysen der Daten notwendig waren, konnten erst nach Ende der Betreuung entwickelt werden. Bei der Bestimmung der psychometrischen Eigenschaften wurden drei Ziele verfolgt. Zum einen sollte die grundlegende Frage nach der Dimensionalität jedes Fragebogens geklärt werden. Dies galt insbesondere für die drei selbstentwickelten Fragebögen, wurde aber auch auf die Beschwerden-Liste (B-L) angewendet. Das zweite Ziel war es, mit den Methoden der Item- und Reliabilitätsanalyse das Maß an Homogenität oder Heterogenität der ermittelten Skalen zu klären sowie deren Zuverlässigkeit (Reliabilität) abzuschätzen. Die B-L wurde, neben den drei selbstentwickelten Fragebögen, auch in diesen Auswertungsschritt einbezogen. Drittens sollten aus diesen beiden Schritten Auswertungsvorschriften für die Fragebögen resultieren, mit deren Hilfe die Informationen auf einzelne psychometrische Kennwerte reduziert werden konnten. B-L und H-VUV sind Selbstbeurteilungsfragebögen, die beiden anderen Fragebögen, der PTB-2 und der H-L-S, sind als objektive Fremdbeurteilungsinstrumente konzipiert. Beurteiler waren in diesen beiden letztgenannten Fällen verschiedene Mitglieder des psychosozialen Betreuungsteams innerhalb des Arbeitskreises Stolzenbachhilfe. Psychometrische Eigenschaften, Zweck und Einsatz der Instrumente werden im Folgenden beschrieben, beginnend mit den Belastungsmaßen. Der Fragebogen zu Phasen der Traumabewältigung (PTB-2) Der Fragebogen zu Phasen der Traumabewältigung (PTB-2) besteht aus fünf Items, die alle einer einzigen Dimension zugeordnet werden können. Der PTB-2 ist ein Fremdbeurteilungsfragebogen, der die Qualität der Traumabewältigung in verschiedenen Lebensbereichen erfasst. Im Einzelnen wird die Bewältigung von „Unglück und Verlust“, von „Alltag und Kontakten“, des „körperlichen und psychischen Zustands“, der Bewährung in „Freizeit und Entspannung“, sowie der Art der Einstellung zur eigenen „Zukunft“ beurteilt. Auf einer Skala von 1 bis 7 schätzt der Beurteiler ein, wie gut der Betroffene seine traumatischen Erfahrungen im jeweiligen Bereich bewältigt hat (7 = „bestmögliche Bewältigung“; vgl. auch Anhang B, Tabelle B.2). Trotz der Unterschiedlichkeit der erfassten Lebensbereiche erweist sich der PTB-2 als ein homogenes Instrument, das mit einer Inneren Konsistenz von .86 eine sehr zufrieden stellende Reliabilität erreicht (Cronbachs alpha, N = 66). Als Berechnungsvorschrift wurden folgende Regeln festgelegt: 1) Aus allen Items des PTB-2 wird der Mittelwert berechnet, 2) … wenn mindestens vier der fünf Items beantwortet wurden. In Abgrenzung zu verschiedenen anderen, zum Zeitpunkt der Untersuchung in Deutschland noch nicht gebräuchlichen Instrumenten der Traumadiagnostik leistet der PTB-2 keine Differenzierung in einzelne traumatische Symptombereiche (Hyperarou- 111 112 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken sal, Intrusionen, Vermeidung etc.). Der PTB-2 wurde stattdessen als globales quantitatives Maß für die Bestimmung der zum Messzeitpunkt vorliegenden Bewältigung der Traumatisierung eingeführt, wie sie sich in unterschiedlichen Lebensbereichen manifestiert – der Fokus liegt hier also weniger auf der phänomenologischen Beschreibung der Beschädigung durch das Trauma, sondern vielmehr auf der Beschreibung der Wiederherstellung und Genesung. Die hier gewählte breite Form, ein Trauma-Maß durch Betrachtung sehr unterschiedlicher Bereiche des Verhaltens und Erlebens zu operationalisieren, wird mit der Sorge begründet, das Folgen und Ausmaß der Traumatisierung durch eine Konzentration auf eine vordergründige und offen liegende Trauma-Symptomatik zu unterschätzen. Der Berücksichtigung einer generalisierten Beeinträchtigung durch das Trauma in verschiedenen Lebensbereichen wurde demgegenüber der höhere messtheoretische Nutzen zugeschrieben. Zu bedenken ist auch, dass Ende der 1980er, Anfang 1990er Jahre Klassifikation und Diagnostik traumatischer Störungen nicht den Stand hatten, der heute zum common sense innerhalb der Psychologie gehört. Neben der Einführung eines brauchbaren Traumatisierungsindexes wurde mit dem PTB-2 bezweckt, abzuklären, welche Güte das Item 1 („Bewältigung von Unglück und Verlust“) als Marker- oder Indikator-Item hat, und zwar (a) mithilfe eines Vergleichs mit dem Globalmaß des PTB-2, (b) auf dem Weg einer Messwiederholungsanalyse. Die Beschwerden-Liste (B-L) Neben der Definition und Operationalisierung eines speziellen Maßes zur Bestimmung der Traumatisierung und Traumabewältigung wurde die Bestimmung der allgemeinen psychophysischen Belastung und psychischen Überforderung für notwendig erachtet. Mit der Beschwerden-Liste (B-L, von Zerssen, 1976) stand dafür ein etabliertes Messinstrument mit brauchbaren testtheoretischen Eigenschaften zur Verfügung. In Kombination mit dem PTB-2 sollte die B-L einen Zugang zur statusdiagnostischen Bestimmung des posttraumatischen Leidens öffnen. Die Beschwerden-Liste wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eingesetzt, um zu zwei Zeitpunkten die aktuelle psychophysische Belastung der Betroffenen zu erfassen. Die 24 Items der B-L fragen verschiedene unspezifische Symptome körperlichen oder psychophysischen Missbefindens ab, die Beantwortung erfolgt auf einer vierstufigen Skala (0 = „gar nicht“, 3 = „stark“, vgl. Tabelle B.2 im Anhang B). Die B-L ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, das mit geringem Zeitaufwand von fünf bis zehn Minuten bearbeitet werden kann. Die Verfügbarkeit einer Parallelform bietet eine Möglichkeit, Daten ohne Validitätsverlust zu mehr als einem Messzeitpunkt zu erheben. Die Durchführungs- und Auswertungsobjektivität des Fragebogens kann vorausgesetzt werden. Reliabilitätskennwerte nach Spearman-Brown, Hoyt und Guttman variieren für die Eichstichproben (N = 1.761 bzw. N = 379) im Bereich von .87 bis .96 und können als sehr zufrieden stellend betrachtet werden (von Zerssen, 1976). Die Äquivalenz der Teilformen liegt bei etwa .85, in klinischen Stichproben eher darüber; RetestReliabilitäten in klinischen Stichproben bewegen sich „im mehrwöchigen Intervall“ um .50 (von Zerssen, 1976). Allerdings müssen Dimensionalität und Gesamtvarianzaufklärung des HauptfaktorModells der veröffentlichten Form als nicht völlig bewertet werden. Die Faktorenanaly- B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken se im Rahmen der Testentwicklung erbrachte einen Hauptfaktor mit ca. 30% Varianzaufklärung (sowohl in der Eich- als auch in einer klinischen Vergleichsstichprobe). Der Testautor selbst plädiert dafür, die B-L flexibel zu handhaben und abhängig von der jeweiligen Situation angemessene Subscores zu bilden (von Zerssen, 1976). Eine Validierungsstudie der Beschwerden-Liste an einer 1.492 Personen umfassenden repräsentativen Bevölkerungsstichprobe konnte die Eindimensionalität im Wesentlichen bestätigen (Koloska, Rehm & Fichter, 1989). Die Autorengruppe spricht sich dafür aus, den Summenwert der B-L als Ausdruck für das Ausmaß an allgemeiner psychischer Überforderung zu betrachten. Von einem Coping-orientierten Ansatz ausgehend, sehen die Autoren die Ursache für einen erhöhten B-L-Score in einem Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen der gegenwärtigen Lebenssituation und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Dimensionalität, Varianzaufklärung und Reliabilitäten des im Rahmen dieser Untersuchung überprüften Hauptfaktorenmodells der B-L entsprechen in etwa den von von Zerssen veröffentlichten Daten und bestätigen im wesentlichen das Bild, das in der klinischen Literatur dominiert. Die B-L erfasst in beiden Parallelformen einen sehr heterogenen Merkmalsbereich mit einem schwachen Hauptfaktor, dessen Leistung im Bereich der Varianzaufklärung als mäßig einzustufen ist. Zusätzlich zum Hauptfaktoren-Modell der B-L wurde wegen dieser Unzulänglichkeiten aus den Daten ein Zweifaktorenmodell abgeleitet. Die beiden resultierenden Faktoren lassen sich als Indikatoren für die Merkmalsbereiche (1) „Anspannung/Arousal“, und (2) „Erschöpfung“ interpretieren und sinnvoll mit einer posttraumatischen Symptomatik assoziieren. Die 2-Faktoren-Lösungen erreicht mit Internen Konsistenzen zwischen .79 und .89 gute Werte, die Varianzaufklärung liegt bei 40,1% für die Form B-L’, resp. 38,7% für die Form B-L’ deutlich über dem Hauptfaktorenmodell. Trotz der angestrebten Skalenunabhängigkeit der 2-Faktoren-Lösungen wurde eine Interkorrelation von .52 zwischen den Anspannungs- und dem Erschöpfungsfaktoren beider Parallelformen der B-L berechnet. Diese Kennwerte bestätigen im wesentlichen die Sichtweise, dass die B-L einen sehr heterogenen Merkmalsbereich erfasst. Wegen des Gewinns an zusätzlicher Varianzaufklärung gegenüber dem Hauptfaktorenmodell wurde entscheiden, den Skaleninterkorrelationen unserer 2-Faktoren-Lösungen eine untergeordnete Bedeutung beizumessen (zumal auch diverse allgemein akzeptierte mehrdimensionale Instrumente, wie zum Beispiel das FPI-R, mit ähnlichen methodischen Problemen belastet sind). Für die Skalen der 2-Faktoren-Lösungen werden Mittelwerte berechnet. Für einen gültigen Score wurden die minimal zu beantwortenden Items wie folgt festgelegt: 1) 2-Faktoren-Lösung der Form B-L: Faktor 1 („Erschöpfung“) mind. 13 von 14 Items; Faktor 2 („Anspannung/Arousal“) mind. 8 von 9 Items; 2) 2-Faktoren-Lösung der Form B-L‘: Faktor 1 („Anspannung/Arousal“) mind. 11 von 13 Items; Faktor 2 („Erschöpfung“) mind. 10 von 11 Items. Der Fragebogen zu Haben, Lieben und Sein (H-L-S) Der Fragebogen zu Fragebogen zu Haben, Lieben und Sein nach Eric Allardt (H-L-S) wurde 1991 vom Arbeitskreis Stolzenbachhilfe entwickelt. Der H-L-S wurde mit dem Ziel konstruiert, die Verfügbarkeit von psychosozialen Ressourcen und die Qualität der 113 114 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken vorhandenen Ressourcen zu erfassen, und daraus Hinweise für zukünftig noch zu leistende professionelle Hilfsmaßnahmen zu erhalten. Allgemein formuliert gibt es günstige und weniger günstige Lebensumstände und Rahmenbedingungen, die mit dem Prozess einer Traumabewältigung in Interaktion treten, seinen Verlauf beeinflussen und ihrerseits durch die posttraumatischen Entwicklungen beeinflusst werden. Bei der Formulierung der Ausgangsfassung des H-L-S wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass verschiedene Grundbedürfnisse und Lebensumstände eines Menschen – die Grundbedürfnisse „Haben“, „Lieben“ und „Sein“ im Verständnis von Eric Allardt (1973) – Einfluss darauf nehmen, wie Betroffene einer Katastrophe die damit verbundenen Erfahrungen verarbeiten und bewältigen können. Nach intensiven faktoren-, item- und reliabilitätsanalytischen Untersuchungen wurde die ursprüngliche Klassifikation zugunsten einer methodisch begründbareren aufgegeben. Die relevanten Lebensaspekte sind danach 1) die „psychosoziale Einbettung“ als Maß für die Art und die Güte, in der eine Person in ein Netzwerk aus persönlichen Beziehungen und Bindungen einbezogen ist (Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen); 2) die „materielle und existentielle Absicherung“, z. B. mit Berücksichtung der Sicherheit von Besitz- und Vermögensverhältnissen sowie des Arbeitsplatzes; 3) die „soziale Offenheit einer Person“, als Ausdruck für die Art und den Umfang, in dem eine Person über die eigenen und individuellen Belange hinaus Interesse am Leben anderer zeigt und daran teilnimmt. Versteht man dieses Merkmal als Dimension mit zwei Polen, dann wird hier unserer Auffassung nach der Gegensatz zwischen Offenheit (oder Öffnung) vs. Abkapselung (oder sich Verschließen, Rückzug in eine Haltung der inneren Emigration) abgebildet. Der H-L-S ist ein Fremdbeurteilungsfragebogen, der in der von uns entwickelten und psychometrisch überprüften Form die subjektive Qualität dieser drei Lebensaspekte mit insgesamt 19 Items erfasst. Die Bewertung erfolgt für verfügbare Ressourcen auf einer Skala von 1 („unbefriedigend“) bis 5 („maximal befriedigend“). Für nicht verfügbare Ressourcen (z. B. bei der Frage nach der partnerschaftlichen Beziehung bei Alleinstehenden oder Verwitweten) wird der Wert 0 vergeben (vgl. Anhang B, Tabelle B.2). Die Varianzaufklärung des faktorenanalytisch ermittelten Modells liegt bei rund 45% (N = 66). Die Internen Konsistenzen der beiden ersten H-L-S-Skalen können mit .72 und .78 als gut bewertet werden, die Split-half-Reliabilitäten betragen .81 und .86. Der dritte Faktor, „Soziale Offenheit“, erreicht dagegen nur eine Interne Konsistenz von .44 (korrigierte Split-half-Reliabilität .54). Obwohl dieser dritte Faktor methodisch eher mäßig abgesichert ist, werden seine psychometrischen Eigenschaften für die Zwecke dieser Untersuchung als gerade noch ausreichend bewertet. Es wurden keine bedeutsame Interkorrelationen zwischen den Skalen des H-L-S nachgewiesen (N = 66), die Koeffizienten lagen zwischen -.03 und .04. Es wurde eingangs erwähnt, dass im H-L-S für verschiedene Items auch fehlende Antworten zugelassen waren. Aus dem theoretischen Konzept den psychosozialen Ressourcen folgt, dass Personen mit vielen Ressourcen einen höheren Rang erhalten müssen als Personen, die über weniger Ressourcen verfügen. Aus diesem Grund wurden in der Kodierungsvorschrift 0-Werte für nicht zutreffende/nicht vorhandene B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Ressourcen festgelegt und als gültige Werte behandelt. Für die Skalen des H-L-S wurden die folgenden Berechnungsvorschriften abgeleitet: 1) Aus allen Items einer H-L-S-Skala wird ein Mittelwert berechnet. 2) Eine Forderung nach einer Mindestanzahl zu beantwortender Items für einen gültigen Skalenscore gibt es nicht; eine fehlende Antwort wird als fehlende Ressource betrachtet und mit dem Wert 0 in die Berechnung des Scores einbezogen. Der H-L-S wurde unter zwei Bedingungen angewendet, einer „Fremdbeurteilungsbedingung“ („Wie nimmt der beurteilende Experte die Qualität der Situation des Betroffenen unter Frage xy wahr?“) und einer „geschätzten Selbstwahrnehmungsbedingung“ („Wie schätzt der Beurteiler, dass der Betroffene selbst die Qualität seiner Situation unter Frage xy einordnet? Wie zufrieden oder glücklich ist er in dieser Hinsicht?“). Ziel bei der Einführung dieser beiden Beurteilungsmodi war es, Aufschluss zu erhalten, ob, und wenn ja, in welchem Umfang sich Fremd- und geschätzte Selbsteinschätzung voneinander unterscheiden, und ob sich Verbindungen zur Bewältigungsleistung der Betroffenen herstellen lassen. Die Interkorrelationskoeffizienten eines Vergleichs der Messbedingungen „Fremd-“ und „geschätzte Selbstwahrnehmung“ fallen hoch signifikant aus (zwischen .80 und .95, alle p < .001). Die Korrelationen deuten auf eine hohe Übereinstimmung der beiden Messbedingungen. Einer Erläuterung bedarf die eingangs verwendete Formulierung der subjektiven Qualität eines Lebensbereichs, die gemessen werden sollte. Hierin drückt sich der Versuch aus, Abstand von Bewertungsmaßstäben zu halten, die eine für die Situation eines Betroffenen unangemessene Objektivität vortäuschen. Es sollte erfasst werden, welche Wertigkeit die vorgefundenen Lebensbedingungen als Ressourcen für diese eine betroffene Person haben, und ob sie in ihrer individuellen Situation als qualitativ zufrieden stellend oder weniger zufrieden stellend bewertet werden konnten. Der entgegensetzte – und von uns nicht präferierte – Ansatz hätte sein können, einen „objektiven“ Vergleich zwischen Personen anzustellen, der dann darin hätte bestehen müssen, objektiv festzustellen, wer z. B. das größte Haus, die bequemste Wohnung, die meisten Freunde, das größere Einkommen hat. Die hierin liegende Implikation lautet ausformuliert „ein eigenes Haus ist mehr wert und deshalb hilfreicher als eine eigene Wohnung“, oder „ein Netto-Einkommen ab 3.500,– DM ist hilfreicher als ein Einkommen darunter.“ Schon die Beliebigkeit, mit der hier Kriterien hätten festgelegt werden müssen, zeigt die Problematik einer solchen Sichtweise. Stattdessen wurde der Schwerpunkt darin gesehen, herauszufinden, ob die individuell vorliegenden Lebensbedingungen eines Betroffenen eher als stressaufbauend oder eher als stressmindernd zu bewerten seien. Der Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück und Verlust (H-VUV) Der Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück und Verlust (H-VUV) erfragt mit 15 vorformulierten und 2 wahlfreien Items, als wie hilfreich ein Betroffener den Kontakt mit verschiedenen Personen oder Gruppen oder Hilfsangeboten erlebt hat. Der H-VUV ist als Selbstbeurteilungsinstrument konstruiert, die Skalierung reicht von 1 („hat gar nicht geholfen“) bis 5 („hat sehr viel geholfen“). Nicht beantwortete Items werden, ähnlich wie im Fall des H-L-S, als gültig betrachtet und mit dem Wert 0 als „nicht zutreffend/nicht verfügbar“ kodiert (z. B. Frage nach der „Hilfe durch den Part- 115 116 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken ner“ bei Alleinstehenden; vgl. auch Anhang B, Tabelle B.2). Der H-VUV ist als kurzer Selbstbeurteilungsfragebogen konstruiert, den jeder und jede Betroffene mit einem Aufwand von etwa drei bis fünf Minuten bearbeiten konnte. Der H-VUV war als Instrument zur unstrukturierten Informationssammlung vorgesehen, es gab a priori keine expliziten Vermutungen über dimensionale Eigenschaften. Faktoren-, item- und reliabilitätsanalytisch wurden zwei Skalen ermittelt, die als hinreichend stabil und gut abgesichert gelten können. Die internen Konsistenzen liegen bei .74 und .46, korrigierte Split-half-Reliabilitäten bei .82 und .56. Die erfassten Dimensionen beschreiben (1) „institutionelle und allgemein zugängliche Hilfsangebote“, (2) „Hilfe durch nahe stehende, vertraute Personen“. Diese beiden Faktoren leisten zusammen genommen etwas über 37,4% Varianzaufklärung. Ein dritter Faktor, „Hilfe durch psychologische Interventionen“, fasst zwei Items zusammen („Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“) und hat eher pragmatischen Charakter ohne weitergehende messtheoretische Ansprüche. (Die hierin enthaltene Information kann und soll, wo das sinnvoll ist, für Analysen auf Itemebene ausgeschöpft werden.) Die Interkorrelation zwischen Skala 1 und Skala 2 fiel mit .43 recht hoch aus (p = .003), die völlige Unabhängigkeit der Skalen voneinander muss also angezweifelt werden. Die (provisorische) Skala 3 korrelierte negativ sowohl mit Skala 1 (-.28), als auch mit Skala 2 (-.21), beide Korrelationen sind gering und werden nicht signifikant. Die etwas diffus wirkende faktorenanalytische Lösung des H-VUV wird der geringen Stichprobengröße zugeschrieben, ohnehin ging es bei der Entwicklung vornehmlich um die Datenreduktion und um die Strukturierung der enthaltenen Information. Eins der beiden inhaltlichen Ziele des H-VUV ist es gewesen, grundsätzlich zu erkunden, welche Formen von Hilfe von den Betroffenen des Borkener Grubenunglücks subjektiv als besonders wirksam erlebt wurden, ohne den Fokus zu speziell auf einzelne Hilfsangebote, z. B. den Einfluss des Partners oder den Einfluss der psychologischen Gespräche, zu richten. Eine Abstrahierung und Verdichtung der erfassten Information auf zwei übergeordnete Kategorien, wie sie sich aus den psychometrischen Analysen ergeben haben, wurde als aussichtsreich und informativ bewertet. Das zweite inhaltliche Ziel bestand darin, eine direkte Beziehung zwischen der subjektiv erlebten Wirkung der Hilfe und den beiden hier berücksichtigten Belastungsmaßen, dem Maß für die Traumabewältigung (PTB-2) und dem Maß für die allgemeine psychophysische Belastung und Überforderung (B-L), herstellen zu können. Von dieser Gegenüberstellung wurden wichtige Impulse für die Konzeptbildung traumatherapeutischer Intervention erwartet. Nach Großschadenslagen ist es grundsätzlich wünschenswert, psychosoziale Ressourcen zu mobilisieren und eine Gemeinschaft in den Stand zu setzen, den Bewältigungsprozess als gemeinsame Aufgabe zu betrachten und durch gegenseitige Unterstützung zu fördern. Dies setzt genauere Kenntnisse interindividueller und Intergruppenprozesse voraus, um vor Ort sowohl Erfolg versprechende Möglichkeiten als auch Schwächen und Risiken identifizieren zu können. Mit den genannten methodischen Abstrichen werden die messtheoretischen Eigenschaften des H-VUV als hinreichend beurteilt. Die Skalen-Struktur ist hinreichend eindeutig, hinreichend stabil, und sie führt zu hinreichend bis gut reliablen Skalen, die inhaltlich eindeutig und sinnvoll interpretiert werden können. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Für die beiden (resp. drei) Skalen der H-VUV-Endform wurden Mittelwert-Scores berechnet. Wegen der Besonderheit der Skalen, auch fehlende bzw. nicht bewertete Hilfsangebote als gültig zu behandeln, wurde letztlich jeder Skalenscore als gültig betrachtet, der wenigstens auf einem beantworteten Item pro Fragebogen beruhte – ausgeschlossen werden sollten nur Fragebögen ohne ein einziges bearbeitetes Item. Als Berechnungsvorschrift wurde festgelegt: 1) Für jede Skala des H-VUV wird ein Mittelwert berechnet (Skala 1 insgesamt 8 Items; Skala 2 insgesamt 7 Items). 2) Die Items der provisorischen Skala 3 (psychologische Interventionen) werden ebenfalls zu einem Mittelwert zusammengefasst. Wegen der Implikationen zur Stichprobenzusammensetzung (Item „Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ im Kontrast zur Teilstichprobe der „Nicht-Teilnehmer“) muss aber während der Datenanalyse darauf geachtet werden, wann dieser Kombinationswert sinnvoll verwendet werden kann. 3) Für alle Skalen zusammen wird ein Minimum von einem gültigen Item gefordert. Tabelle B.1 im Anhang B gibt einen Überblick über die wichtigsten psychometrischen Kennwerte der verwendeten Fragebögen; Tabelle B.2, ebenfalls im Anhang B, informiert über Umfang, Skalierung und Berechnungskonventionen der Fragebögen. Ablauf der Datenerhebung Die Erfassung der Daten wurde unmittelbar in die psychosoziale und psychotherapeutische Betreuung der Betroffenen integriert, so dass für die Betroffenen weder eine nennenswerte Mehrbelastung entstand, noch ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit auf die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Untersuchung gelenkt wurde. Alle mit der Datenerhebung befassten Personen waren Mitglieder des Arbeitskreises Stolzenbachhilfe, alle waren an der psychosozialen Betreuung von Betroffenen beteiligt und mit deren jeweiligen Lebensumständen und individuellen Problemen vertraut. Im Einzelnen handelte es sich um eine türkische und zwei deutsche Werksfürsorgerinnen, einen Pfarrer, eine türkische Psychologin, einen deutschen Psychologen (den Autor) und einen Psychosomatiker. Allen Beurteilern waren die Zielsetzung und die Handhabung der verwendeten Messinstrumente bekannt, ein Teil der selbstentwickelten Instrumente war das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen. Die Erhebung der Daten fand zu zwei Zeitpunkten und unter unterschiedlichen Modalitäten statt. Erhebungszeitpunkt 1. Der erste Teil der Datenerhebung fand gegen Ende der Betreuungsmaßnahmen, im dritten Jahr nach dem Unglück, statt. Im Zeitraum zwischen Dezember 1990 und Juni 1991 wurde (1) mit dem PTB-2 der individuelle Stand der Traumabewältigung erfasst, (2) mit dem H-L-S die Qualität der psychosozialen Lebensumstände beurteilt, und zwar sowohl unter der „Fremd-“ als auch unter der „geschätzten Selbstwahrnehmungsbedingung“. Den Ergebnissen der beiden Fragebögen lagen die Beurteilungen durch das Expertenteam zugrunde, in beiden Fällen wurden die aktuell vorliegenden Umstände bewertet. Erhebungszeitpunkt 2. Zwei Jahre später, im fünften Jahr nach dem Unglück, fand eine Nachbefragung der Betroffenen durch den Autor statt, die hauptsächlich den Zweck hatte, den Behandlungserfolg zu überprüfen, gleichzeitig aber dazu genutzt werden 117 118 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken konnte, weitere statistische Informationen zu sammeln. (1) Dazu wurden die Betroffenen zunächst gebeten, auf einem siebenstufigen Rating einzuschätzen, wie gut sie ihrer eigenen Einschätzung nach zu diesem Zeitpunkt die Erfahrung von Unglück und Verlust bewältigt hatten (Item 1 des PTB-2); (2) mit dem H-VUV schätzten die Betroffenen ein, in welchem Umfang ihnen verschiedene Kontaktpersonen und Hilfsangebote bei der Bewältigung ihrer Erfahrungen geholfen haben. (3) Als drittes wurden die Betroffenen gebeten, mit der B-L den Grad ihrer allgemeinen psychophysischen Belastung einzuschätzen, und zwar (a) zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Form B-L), (b) retrospektiv während des ersten Jahres nach dem Unglück (Form B-L‘). Um Missverständnissen vorzubeugen, sei dieser Punkt noch einmal explizit hervorgehoben: Die Form B-L‘ erfasst den retrospektiv eingeschätzten, chronologisch früheren Zeitraum, die B-L erfasst den aktuellen Zustand zum Messzeitpunkt – eine Anordnung, die nicht typisch für ein Messwiederholungsdesign ist. Modalitäten. Während zum Erhebungszeitpunkt 1 ausschließlich Fremdbeurteilungen erhoben wurden, wurden zu Erhebungszeitpunkt 2 ausschließlich Selbstbeurteilungen erfasst. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da zum Erhebungszeitpunkt 1 (im dritten Jahr nach dem Unglück) und in der Zeit davor bei den Betroffenen eine starke Ablehnung gegenüber wissenschaftlichen Untersuchungen bestand. Nach Beendigung der Betreuungsmaßnahmen war die Akzeptanz zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Befragung vorhanden und damit die Möglichkeit einer Selbstbeurteilung in Fragebögen gegeben. Instruktionen wurden mündlich gegeben, im Fall der B-L wurde die schriftliche Instruktion des Fragebogens unverändert übernommen. Unter Berücksichtigung der retrospektiven Erfassung psychophysischer Belastung im ersten Jahr nach dem Unglück ergeben sich drei Messzeitpunkte (die von den Erhebungszeitpunkten zu unterscheiden sind). Tabelle B 1.6 gibt einen zusammenfassenden Überblick über den chronologischen Ablauf der Datenerhebung. Tabelle B1.6: Verwendete psychometrische Maße der Borken-Studie, aufgeschlüsselt nach Bearbeitungsmodus, Erhebungs- und Messzeitpunkten Instrument Fragebogen zu Phasen der Traumabewältigung Beschwerden-Liste Fragebogen zu Haben-Lieben-Sein Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück & Verlust Messzeitpunkt Akronym 1. Jahr 3. Jahr 5. Jahr PTB-2 — fremd B-L/B-L' — H-L-S selbst/ retrosp. (B-L‘) — selbst (PTB-2 Item 1) selbst (B-L) H-VUV — fremd & selbst/geschätzt — — Selbst B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken 1.3.2 Ergebnisse Nach Festlegung geeigneter Kodierungsvorschriften erfolgten Dateneingabe und -auswertung im Wesentlichen mit dem Programmpaket SPSS, Versionen 11 und früher. Im Anschluss an die Eingabe der Rohdaten und eine sorgfältige Konsistenzprüfung des Datenbestands wurden für alle verwendeten Fragebögen Kennwerte nach den an anderer Stelle begründeten Berechnungsvorschriften aggregiert. Analysestrategie Da die Borken-Studie vor allem das Ziel der Datenexploration hatte, standen im Kern vier allgemein formulierte Frageblöcke zur Aufklärung an: 1) Unterscheiden sich Personen, die an einer psychologischen Gruppe teilgenommen haben, in ihrer Belastung (AV = PTB-2, B-L) von denjenigen Personen, die nicht an einer der psychologischen Gruppe teilgenommen haben (UV = Teilnahme vs. nicht Teilnahme)? 2) In welchen Maßen (AV) unterscheiden sich ganz allgemein die erfassten Betroffenengruppen (UV) – unabhängig von Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe –, und erscheinen Unterschiede, wenn sie denn festgestellt werden, so relevant, dass sich die Forderung nach differentiellen therapeutischen und psychosozialen Betreuungskonzepten daraus ableiten lassen? 3) Gibt es Anzeichen für Veränderungen in denjenigen Maßen, die zu mehr als einem Zeitpunkt (AV = PTB-2, B-L) und/oder unter mehr als einer Beobachtungsbedingung (AV = PTB-2, H-L-S Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; UV = Messwiederholung) gemessen wurden, und welche Schlussfolgerungen können daraus für die therapeutischen und psychosozialen Betreuungsmaßnahmen gezogen werden? 4) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Belastungsmaßen (PTB-2, B-L) und Maßen für psychosoziale Lebensumstände und erhaltene Hilfe (H-L-S, H-VUV)? Was kann als besonders hilfreich gelten, können ggf. auch zusätzliche Belastungsund Risikofaktoren identifiziert werden? Alle statistische Analysen wurden mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% gerechnet – ein liberaleres Kriterium wäre zwar der Problematik einer heterogenen Stichprobe mit ihrem voraussichtlich hohen Anteil an Varianz unklärbarer Herkunft reichen Datenlage angemessen gewesen, hätte aber nach unserer Auffassung zu deutlich gegen gängige Konventionen verstoßen. Zur Aufklärung der Datenlage wurden verschiedene varianz- und korrelations- bzw. regressionsanalytische Designs gerechnet, abhängige bzw. Kriteriumsvariablen waren überwiegend die aggregierten Scores der bereits beschriebenen Fragebögen, Analysen über einzelne Items stellten die Ausnahme dar. Im Fall der Varianzanalysen wurde mehrfaktoriellen Designs grundsätzlich der Vorzug vor einfacheren Auswertungsplänen gegeben. Wegen der höheren Robustheit im Fall von problematischen Ausgangsdaten, insbesondere auch bei Verletzungen varianzanalytischer Voraussetzungen, wurden alle Gruppenvergleiche, egal welcher faktoriellen Ordnung, grundsätzlich mit dem Allgemeinen Linearen Modell (General Linear Model, GLM) gerechnet. Diese Wahl ist im vorliegenden Fall allein deshalb ohne Alternative gewesen, da nur die GLM-Implementierung in SPSS die Möglichkeit bietet, die 119 120 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Problematik ungleicher Fallzahlen unter den Faktorstufen und ihren Kombinationen statistisch angemessen zu behandeln (vgl. Tabelle B 1.7 weiter unten). Analog sind die hier berichteten Randmittel die ungewichteten Randmittel, nicht die häufig referierten und von SPSS gelieferten gewichteten Randmittel (vgl. die entsprechenden Passagen bei Bortz, 1993, sowie Bortz & Döring, 1995). Da keine expliziten Annahmen über Art und Richtung von Mittelwertunterschieden geprüft werden sollten, wurden statt geplanter Kontraste vollständige Sätze paarweiser Mittelwertvergleiche über alle Faktorstufen und Interaktionen berechnet, die Irrtumswahrscheinlichkeit der post hoc-Tests wurde nach Bonferroni adjustiert. Eine Korrektur der Freiheitsgrade in den Messwiederholungsanalysen erübrigte sich, da lediglich zwei abhängige Messungen miteinander verglichen werden (Bortz, 1993, S. 326). Bei einer Spannbreite des Alters der Betroffenen von 24 bis 80 Jahren in der Gesamtstichprobe (M = 45;9, SD = 13;3) musste die Möglichkeit einer Konfundierung verschiedener Maße mit dieser Variablen bedacht werden. Genauere Voranalysen zeigten ein uneinheitliches und schwer einzuschätzendes Bild. Korrelationsanalysen zwischen Alter und den Fragebogenmaßen zeigten unterschiedliche, allgemein eher schwache und in keinem Fall signifikante Effekte (mit den stärksten Zusammenhängen im Bereich der B-L). Obwohl das Alter sicher einen gewissen Einfluss hat, kann von einer systematischen Verzerrung der gesamten Datenlage wohl nicht ausgegangen werden. Eine kovarianzanalytische Kontrolle des Alters wurde deshalb verworfen. Um den beschränkten Möglichkeiten konventionellen Signifikanztestens zu begegnen, wurden außer F-Tests auch Teststärken und Effektgrößen angefordert. SPSS berechnet standardmäßig für jeden varianzanalytischen Effekt das partielle eta-Quadrat (etap2) als Ausdruck für die Ähnlichkeit vs. Unterschiedlichkeit der jeweiligen Gruppen bzw. Faktorstufenkombinationen. Es gilt die bekannte Beziehung, dass die im Effekt enthaltene systematische, also auf die Gruppen zurückführbare Unterschiedlichkeit um so größer ist, je größer etap2 wird. Vor der Darstellung der ersten Analyseergebnisse ist es sinnvoll, sich noch einmal die Zusammensetzung der Borken-Stichprobe zu vergegenwärtigen (vgl. Tabelle B 1.7). Wie die unbesetzten Faktorstufenkombinationen zeigen, ist es grundsätzlich nicht möglich, mit der gesamten Stichprobe ein gesättigtes varianzanalytisches Design über alle drei Faktoren „Teilnahme vs. Nicht Teilnahme“, „Betroffenengruppe“ (fünffach gestuft) und „Messwiederholung“ (je Maß zwei Beobachtungen) zu rechnen. Aus diesem Grund wurden zwei unterschiedliche Analyse-Sets abgeleitet. 1) Das erste Set bestand aus den Betroffenen, die sich nach „Teilnahme vs. Nicht Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ differenzieren ließen (N = 45). Dieses Set schränkt die Stichprobe auf die Betroffenengruppen „Witwen“ (N = 30) und „Eltern“ ein (N = 15) und macht so den Faktor „Teilnahme“ interpretierbar. Hier wurden dreifaktorielle Varianzanalysen mit und zweifaktorielle Varianzanalysen ohne Messwiederholungsbedingung gerechnet. Gruppenfaktoren waren die Teilnahmebedingung und der Faktor Betroffenengruppe (je zweifach gestuft). 2) Das zweite varianzanalytische Set bezieht die gesamte Stichprobe ein (N = 68), berücksichtigt also alle Betroffenengruppen, bietet aber keine direkte Möglichkeit, den Einfluss des Faktors „Teilnahme“ aus den Ergebnissen der Betroffenengruppen „Witwen“ und „Eltern“ herauszulösen – dies soll ggf. unter Rückgriff auf die Ergebnisse aus dem ersten Analyseset geschehen. Basisdesigns sind hier zwei- 121 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken faktorielle Varianzanalysen mit bzw. einfaktorielle Varianzanalysen ohne Messwiederholung, Gruppenfaktor ist auch hier der Faktor Betroffenengruppe (je nach abhängiger Variable bis zu fünf Faktorstufen). Tabelle B.3 im Anhang B stellt dar, wie viele verwertbare Fragebögen pro Betroffenengruppe für die Analysen zur Verfügung standen. Der Augenschein zeigt auch ohne intensive Berechnungen optimaler Stichprobenumfänge, dass verschiedene Betroffenengruppen aus einzelnen Analysen ausgeschlossen werden mussten. Explizit durchgeführte Power-Analysen ergaben, dass für die hier vorliegende Datenbasis große Effekte auf dem Niveau von alpha = .05 prinzipiell nachgewiesen werden können. Die teils geringe Besetzung der Faktorstufen wird als noch akzeptabel bewertet. Die negativen Folgen gering besetzter Zellen können bedingt durch das GLM bzw. den F-Test kompensiert werden (Bortz & Döring, 1995, S. 566ff). Das Risiko unangemessener statistischer Entscheidungen ist dabei bei den Haupteffekten, und hier wiederum bei den Analysen ohne Messwiederholungsfaktor, am größten; als vergleichsweise unproblematisch sind Interaktionen zu bewerten. Allgemein ist mit einer unbefriedigenden Teststärke zu rechnen, je kleiner die vorgefundenen Effekte ausfallen. Diese Ausführungen sollen deutlich machen, dass die aus methodischer Sicht nicht optimale Stichprobenzusammensetzung die Frage nach der Entscheidung zwischen zwei grundsätzlichen Alternativen aufwarf: (1) Jeden Versuch einer Analyse von Gruppenunterschieden ganz aufzugeben; (2) im Bewusstsein der problematischen Datenlage Analysen durchzuführen – und mit der gebotenen Vorsicht zu interpretieren –, die dem Umstand der Einzigartigkeit des Borken-Datensatzes Rechnung tragen, ohne dabei ihre methodische Schwächen zu übersehen. Wir haben es für nicht akzeptabel gehalten, die Chance zur Gewinnung dringend benötigter Informationen über traumatische Entwicklungen nach Großschadenslagen zugunsten einer dogmatischen Befolgung methodischer Richtlinien aufzugeben. Die im folgenden dargelegten Ergebnisse basieren teilweise auf Analysen aus dem „Grenzbereich“ des methodisch Akzeptablen, und stellen aber trotz oder gerade wegen dieser Einschränkungen eine wichtige Ergänzung den deskriptiven Schilderungen unserer Erfahrungen in Borken dar – und sollen vor allem auch den Respekt vor den Betroffenen reflektieren und ihr Erleben dokumentieren. Tabelle B1.7: Betroffene des Grubenunglücks von Borken – Anordnung der varianzanalytischen Auswertungsschemata (N = 68) Betroffenengruppe Teilnahme k. Teilnahme Gesamt Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern 6 (8,8%) 7 (10,3%) 18 (26,5%) 10 (14,7%) 4 (5,9%) — — — — 12 (17,6%) — — 11 (16,2%) 6 7 30 10 15 Gesamt 45 (66,2%) 23 (33,8%) 68 (100,0%) (8,8%) (10,3%) (44,1%) (14,7%) (22,1%) 122 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Erläuterungen: (1) Horizontales Raster: Vergleich von Teilnahmebedingung x Betroffenengruppe (Einschränkung auf Witwen und Eltern); (2) Vertikales Raster: Vergleich von Betroffenengruppen (ohne Berücksichtigung der Teilnahmebedingung). Unterschiede zwischen „Teilnehmern“ und „Nicht-Teilnehmern“ an einer psychologischen Gruppe Wie bereits erläutert wurde, musste die Gesamtstichprobe zur Untersuchung des Einflusses der „Teilnahme“ gegenüber der „Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ eingeschränkt werden. Betrachtet werden im Folgenden nur die Teilstichproben „Witwen“ und „Eltern“, weil nur in diesen beiden Gruppen zwischen „Teilnehmern“ und „Nicht-Teilnehmern“ differenziert werden konnte (vgl. Tabelle B 1.7). Außer auf diesen Faktor und seine Wechselwirkungen wird in den folgenden Abschnitten bei Bedarf auch auf den Faktor Betroffenengruppe eingegangen. Unterschiede zwischen den einzelnen Betroffenengruppen werden zwar im zweiten Analyse-Set separat betrachtet, weshalb hier Redundanz vermieden werden soll. Wenn aber im Zusammenhang mit dem Faktor Betroffenengruppe Abweichungen zwischen beiden Analyse-Anordnungen auftreten, können diese nur mit dem unterschiedlichen Auflösungsgrad der Analyse-Sets zusammenhängen. Um die später referierten Ergebnisse der Gesamtstichprobe angemessen bewerten zu können, wird deshalb gelegentlich bereits hier auf Einflüsse des Faktors Betroffenengruppe eingegangen. Die Darstellung der Ergebnisse beginnt mit den Analysen der Belastungsmaße, anschließend werden die Befunde der psychosozialen Schutzfaktoren vorgestellt. Ergebnisse zum PTB-2 PTB-2, Score vs. Messung 2/Item 1. Zur Bestimmung des Einflusses der Teilnahmebedingung auf die Traumabewältigung wurden zwei dreifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung gerechnet (N = 38), abhängige Variable war das Maß zu den Phasen der Traumabewältigung (PTB-2). Der Messwiederholungsfaktor bestand in der ersten Analyse aus den Messzeitpunkten 1 (drittes Jahr nach dem Unglück, Fremdbeurteilung, Score des PTB-2) und 2 (fünftes Jahr nach dem Unglück, Selbstbeurteilung mit dem Item 1 des PTB-2); in der zweiten Analyse wurde der Score des PTB-2 durch das Item 1 („Bewältigung von Unglück und Verlust“) aus der ersten Messung ersetzt und direkt mit Item 2 aus Messung 2 verglichen, um die Analyse weiter zu präzisieren. In beiden Analysen wurden keine Voraussetzungsverletzungen beobachtet, die Ergebnisse beider Varianzanalysen sind interpretierbar. Die unter den einzelnen Faktorstufen beobachteten Mittelwerte liegen alle in der oberen Hälfte der Skala (M = 4.2 bis 5.9). Rein deskriptiv kann die Traumabewältigung aller hier erfassten Betroffenen als befriedigend bis gut gelungen betrachtet werden. Der Faktor „Teilnahme vs. Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ hatte keinen signifikanten Einfluss, die Mittelwerte der Traumabewältigungsscores beider Betroffenengruppen unterschieden sich statistisch nicht voneinander, die vorgefundene Effektgröße bestätigt diese Deutung. Bei ausreichender Teststärke sehr signifikant wurde aber der Faktor Betroffenengruppe (F(1, 34; 95%) = 9.99, p = .003, etap2 = .227). Die deskriptiven Statistiken zeigen, dass B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken die Witwen (M = 5.7) im Vergleich zu den Eltern (M = 4.4) den besseren Wert der Traumabewältigung erreichten. Alle anderen Effekte und Interaktionen wurden in Analyse 1 nicht signifikant. Dies gilt namentlich auch für den Messwiederholungsfaktor. Zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt kommt es zu keiner statistisch bedeutsamen Veränderung der Traumabewältigung. Deskriptive Statistiken und Ergebnisse des F-Tests werden in den Tabellen B.4a und B.4b im Anhang B dargestellt. PTB-2, Item 1, Messung 1 vs. Messung 2. In der zweiten Varianzanalyse wurde unter der Messwiederholungsbedingung das Item 1 aus Messung 1 mit dem gleichen Item aus Messung 2 verglichen („Bewältigung von Unglück und Verlust“). Die beobachteten Mittelwerte liegen wiederum im mittleren bis oberen Bereich der Skala. Auch in diesem Fall wurde der Faktor Teilnahmebedingung nicht signifikant, dafür erwies sich der Faktor Betroffenengruppe wieder als sehr signifikant bei einer gegenüber der ersten Analyse zusätzlich verbesserten Teststärke (F(1, 34; 95%) = 13.41, p = .001, etap2 = .283). Während das über beide Messbedingungen aggregierte Mittel der Witwen im Vergleich zur ersten Analyse nahezu unverändert war (M = 5.6), hatte das Mittel bei den Eltern hier den schlechteren Wert (M = 3.8 vs. M = 4.4, s.o.), woraus sich auch der Anstieg an statistischer Bedeutsamkeit gegenüber Analyse 1 erklärt. Der Effekt ist statistisch als groß einzustufen. Betrachtet man also die Traumabewältigung nur unter dem isolierten Aspekt der Bewältigung von persönlichem Unglück und Verlust, dann zeigt die Gruppe der Eltern schlechtere Werte als unter gleichzeitiger Berücksichtigung verschiedener Alltagsbedingungen, wie sie vom Score des PTB-2 angezeigt wird – dem Item 1 kommt als Indikator der Traumabewältigung eine besondere, eigenständige Bedeutung zu. Mit p = .028 wurde in dieser Analyse der Messwiederholungsfaktor der Traumabewältigung signifikant (Item 1, zwei Messungen; F(1, 34; 95%) = 5.29, etap2 = .135). Der Vergleich der Mittelwerte zeigt eine Verbesserung des zweiten gegenüber dem ersten Messzeitpunkt (5.1 vs. 4.4). Hier liegt ein mittlerer statistischer Effekt vor, allerdings lässt die nicht zufrieden stellende Teststärke keine eindeutige Aussage über die Sicherheit des Ergebnisses zu. Im Vergleich zur ersten Analyse wurde hier ein Unterschied festgestellt, der mit der Bedeutung des Items 1 zusammenhängen muss. Außer den genannten Effekten wurden keine Signifikanzen festgestellt (vgl. Tabelle B.5b im Anhang B), insbesondere zeigten sich in den Interaktionen keine Unterschiede zwischen einzelnen Bedingungen. Zwar fallen in diesem Zusammenhang verschiedene schwach ausgeprägte Effekte auf, die aber wegen unzureichender Teststärke nicht abgesichert werden können. Ergebnisse zur B-L Zur Überprüfung der Frage, ob sich die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe auf die berichteten psychophysischen Beschwerden und die allgemeine psychische Überforderung ausgewirkt haben, wurden ebenfalls verschiedene dreifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung gerechnet (N = 38). Als abhängige Variablen gingen hier die Wiederholungsmessungen der Beschwerden-Liste ein (B-L' vs. B-L). Überprüft wurden das Hauptfaktoren- und die korrespondierenden Skalen des 2-Faktoren-Modells, jeweils univariat behandelt. Abgesehen von einer Ausnahme wurden keine Voraussetzungsverletzungen festge- 123 124 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken stellt. Im Fall des Erschöpfungsfaktors der B-L‘ zeigte der Levene-Test allerdings mit p = .002 eine spürbare Verletzung der Varianzhomogenität an. Ein Blick auf die deskriptiven Kennwerte zeigt eine Spannbreite der Standardabweichungen zwischen 0.5 und 1.2. Die Mittelwerte weisen auf eine eher geringe Grundbelastung hin, auf revidierte Untersuchungen des Erschöpfungsfaktors wurde verzichtet. Die Mittelwerte der Hauptfaktoren B-L und B-L‘ bewegen sich im Bereich zwischen 27 und 42 Punkten, was einer geringen bis mittleren Belastungsstärke entspricht. Für den Anspannungsfaktor liegen die Werte zwischen 1.2 und 2.0, für den Erschöpfungsfaktor zwischen 1.0 und 1.5. Für den Anspannungsfaktor ist eine mittlere bis deutliche Belastung festzustellen, sowohl im ersten als auch im fünften Jahr nach dem Unglück. Der Faktor Teilnahmebedingung wurde in keiner der drei Analysen signifikant, die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe hatte in keinem Fall eine Auswirkung auf das Ausmaß der berichteten Beschwerden. Die Gruppenmittelwerte der Scores liegen alle im mittleren Bereich (Hauptfaktor: Teilnahme M = 31.9, Nicht-Teilnahme M = 33.3; Skala „Anspannung“: Teilnahme M = 1.6 und NichtTeilnahme M = 1.5; Skala „Erschöpfung“: Teilnahme M = 1.1, Nicht-Teilnahme M = 1.3). Unterstützt von den Teststärken spricht die von etap2 angezeigte Gesamtunterschiedlichkeit für eine insgesamt unerhebliche Auswirkung dieses Faktors. Signifikant wurde dagegen für das Hauptfaktorenmodell und den Anspannungsfaktor der Beschwerden-Liste der Unterschied zwischen den Messzeitpunkten, B-L' vs. B-L. Für das Hauptfaktoren-Modell liegt ein hoch signifikantes Ergebnis vor (F(1, 34; 95 %) = 22.33, p < .001). Im 2-Faktoren-Modell wurde die Messwiederholung des Faktors „Anspannung“ mit F(1, 34; 95 %) = 31.27 ebenfalls hoch signifikant (p < .001). Beide Effekte sind bei sehr guter Teststärke als groß zu bewerten. Ein Vergleich der Mittelwerte (Tabellen B.6a, B.7a und B.8a im Anhang B) zeigt durchgängig ein höheres Maß an Beschwerden im retrospektiv beurteilten ersten Jahr nach dem Unglück. Das Hauptfaktorenmodell der B-L macht den Unterschied besonders deutlich: Während der Mittelwert im ersten Jahr nach dem Unglück mit etwa 37.2 eingeschätzt wurde, liegt der Mittelwert gegen Ende der Betreuungsmaßnahmen mit 28.0 Rohwertpunkten deutlich niedriger. Nach den Kriterien des Testautors liegen hier durchgängig erhöhte Werte vor. Signifikant wurde zwar auch die Interaktion zwischen der Messwiederholung des Anspannungsfaktors und dem Faktor Betroffenengruppe (F(1, 34; 95 %) = 4.42, p = .043, etap2 = .115). Da sich dieses Ergebnis mit verlässlicheren statistischen Kennwerten im zweiten Analyse-Set wieder findet, soll dort näher darauf eingegangen werden. Außer den genannten Effekten wurden keine bedeutsamen Ergebnisse im Bereich der B-L beobachtet. Im Hauptfaktorenmodell zeichnet sich zwar ebenfalls ein schwacher Effekt in der Interaktion zwischen Messwiederholung und Betroffenengruppe ab, die Teststärke reicht aber für eine statistische Absicherung nicht aus. Ähnliches gilt für verschiedene Aspekte des Erschöpfungsfaktors. Auch hier liegen verschiedene schwache Effekte vor, die aber wegen mangelnder Teststärke nicht abgesichert werden können. Insgesamt wird aus den Daten geschlossen, dass die Skala „Anspannung“ die größte Bedeutung innerhalb der B-L hat und die Ergebnisse des Hauptfaktorenmodells wesentlich determiniert. Es folgen tabellarische Übersichten über die deskriptiven Statistiken und die Signifikanztests (Tabellen B.6a bis B.8b im Anhang B). B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Ergebnisse zum Fragebogen H-L-S Bei der varianzanalytischen Überprüfung des Frageboges zu Haben-Lieben-Sein (dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung) ergaben sich erste Unterschiede im Zusammenhang mit der Teilnahme-Bedingung (N = 43). Verletzungen von Voraussetzungen wurden für die Skalen „Psychosoziale Einbettung“ und „Soziale Offenheit“ nicht beobachtet, diese Varianzanalysen können als interpretierbar betrachtet werden. Probleme ergaben sich für die Skala „Materielle Absicherung“, hier zeigte der Levene-Test eine Verletzung der Varianzhomogenität an, die aber als tolerierbar bewertet wurde (Fremdwahrnehmung .036, geschätzte Selbstwahrnehmung .038). Die Mittelwerte unter den einzelnen Faktorstufen bewegen sich für die „Psychosoziale Einbettung“ mit 2.4 bis 3.5 im mittleren bis guten Bereich. Die „Materielle Absicherung“ deckt mit einer Spannbreite der Werte zwischen 1.9 und 4.4 annähernd die gesamte Skala ab. Der Wertebereich der Skala „Soziale Offenheit“ bewegt sich zwischen 1.6 und 2.5 und befindet sich damit in der unteren Hälfte der Skala. Psychosoziale Einbettung. Für das Merkmal H-L-S „Psychosoziale Einbettung“ wurde die Interaktion zwischen Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe signifikant (F(1, 39; 95 %) = 4.36, p = .043, etap2 = .101). Die Teststärke erreichte allerdings nicht das nötige Maß, um einen vorliegenden Effekt sicher aufspüren zu können. Es stellte sich deshalb auch als unmöglich heraus, den hier angezeigten Effekt durch Bonferronikorrigierte paarweise Mittelwertvergleiche weiter aufzuklären und diejenigen Mittelwertpaare zu identifizieren, durch die die Signifikanz hervorgerufen wurde. Es liegt allerdings nahe, zumindest das Wertepaar mit der größten Differenz, die Betroffenengruppen Eltern und Witwen unter der Teilnahme-Bedingung, für bedeutsam zu halten. Hier hatten die an einer psychologischen Gruppe teilnehmenden Witwen gegenüber den teilnehmenden Eltern die zufrieden stellendere psychosoziale Einbettung (M = 3.5 vs. 2.5). Witwen und Eltern ohne Berücksichtigung der Teilnahme-Bedingung unterschieden sich dagegen nicht (vgl. Tabelle B.9a im Anhang B). Materielle Absicherung. Sehr deutliche Effekte zeigten sich beim Merkmal „Materielle Absicherung“ des H-L-S (vgl. Tabelle B.10b im Anhang B). Nicht signifikant wurde lediglich die Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Teilnahmebedingung, alle anderen Effekte wurden auf unterschiedlichen Niveaus als bedeutsam angezeigt. Beginnen wir mit der Interaktion zwischen Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe, die hoch signifikant ausfiel (F(1, 39; 95 %) = 19.84, p < .001, etap2 = .337). Die Teststärke ist hier im optimalen Bereich, der Effekt kann als groß klassifiziert werden. Die Interaktion ist vom hybriden Typ, interpretiert werden können die Interaktion selbst und der sehr signifikante Haupteffekt Betroffenengruppe (F(1, 39; 95 %) = 37.42, p < .001, etap2 = .490). Der laut Varianzanalyse hoch signifikante Faktor Teilnahmebedingung (F(1, 39; 95 %) = 10.64, p = .002, etap2 = .214) ist dagegen so stark von den Einflüssen der Interaktion überlagert, dass eine isolierte Interpretation ausgeschlossen ist. Vergleiche der Mittelwert-Paare unter der Interaktion zeigten einen hoch signifikanten Unterschied bei den Eltern (F(1, 39; 95 %) = 18.38, p < .001), die unter der TeilnahmeBedingung einen schlechteren Wert erreichten als unter der Nicht-TeilnahmeBedingung (M = 2.3 vs. 3.9). Ein ebenfalls hoch signifikanter Unterschied findet sich zwischen Eltern und Witwen unter der Teilnahme-Bedingung (F(1, 39; 95 %) = 36.70, 125 126 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken p < .001). Wie sich nach dem vorigen Ergebnis schon vermuten lässt, schneiden die teilnehmenden Eltern auch hier deutlich schlechter ab als die teilnehmenden Witwen (M = 3.9 vs. 4.2). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diejenigen Eltern, die an einer psychologischen Gruppe teilgenommen haben, gegenüber allen anderen Personen durch eine deutlich schlechtere materielle Absicherung gekennzeichnet sind. Obwohl die statistische Aussage durch die geringe Teilstichprobengröße von n = 2 relativiert wird, bleiben die psychosoziale und die therapeutische Implikation von Interesse. Wie schon im Fall der psychosozialen Einbettung mag sich in der materiellen Absicherung ein weiterer differentieller Belastungsfaktor abzeichnen, der die Untergruppe der teilnehmenden Eltern von anderen Personengruppen abhebt. Bedeutsam und interpretierbar ist auch der Mittelwertunterschied zwischen Witwen und Eltern ganz allgemein (M = 4.3 vs. 3.1). Die Eltern erscheinen materiell und existentiell schlechter abgesichert als die Witwen, der Effekt ist als groß zu bezeichnen. Unter Berücksichtigung des Messwiederholungseffekts fand sich eine signifikante Interaktion zweiter Ordnung zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung, Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe (F(1, 39; 95 %) = 5.86, p = .020, etap2 = .131). Der Effekt ist statistisch eher schwach; da die Teststärke hinter den Anforderungen zurück bleibt, wird auf eine Interpretation verzichtet. Nicht signifikant wurde die Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Teilnahmebedingung. Mit p = .010 liegt aber eine bedeutsame Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Betroffenengruppe vor (F(1, 39; 95 %) = 7.34, etap2 = .158). Der Effekt ist von mittlerer Größe, die Teststärke liegt zwar nicht im optimalen, aber noch im tolerierbaren Bereich. Die Interaktion ist vom ordinalen Typ, was eine Interpretation des hoch signifikanten Haupteffekts Fremd- vs. Selbstwahrnehmung möglich macht (F(1, 39; 95 %) = 23.64, p < .001, etap2 = .377). Dieses Teilergebnis steht allerdings nicht im Zentrum der derzeitigen Betrachtungen. Da es sich in vergleichbarer Form im Rahmen des zweiten Analyse-Sets wieder findet, wird dort näher darauf eingegangen. Eine Betrachtung der Interaktionsmittelwerte zeigt, dass eine Ursache für dieses Ergebnis wiederum bei den Eltern zu finden ist. Die Mittelwerte dieser Personen liegen hier bei M = 3.4 unter der Fremdwahrnehmungs- und bei 2.8 unter der geschätzten Selbstwahrnehmungsbedingung (p < .001, etap2 = .312). Die Zufriedenheit mit der materiellen Absicherung fällt unter der geschätzten Selbstwahrnehmung schlechter aus als unter der Fremdwahrnehmungsbedingung. Eine ähnliche Aussage, aber in schwächerer Form, enthält der Mittelwertvergleich der Witwen (M = 4.4 vs. 4.2, p = .018, etap2 = .135). Kritisch ist hier anzumerken, dass der numerische Mittelwertunterschied bei einem statistisch kleinen Effekt und einer beobachteten Teststärke von .67 nicht besonders bedeutsam erscheint. Insgesamt gilt aber, dass unter der geschätzten Selbstwahrnehmung die Werte allgemein niedriger ausfallen, wobei wiederum die Eltern gegenüber den Witwen die schlechteren Werte erreichen. Hoch signifikant fallen auch die Vergleiche der Witwen mit den Eltern unter den beiden Beobachtungsbedingungen der materiellen Absicherung aus. Sowohl unter der Fremdwahrnehmung als auch unter der Selbstwahrnehmung erreichen die Witwen die deutlich besseren Werte. Die Qualität der materiellen Absicherung ist in dieser Gruppe höher als in der Gruppe der Eltern, sowohl nach Expertenurteil als auch nach Selbsteinschätzung (p jeweils < .001, etap2 > .40, vgl. Tabelle B.10a im Anhang B). B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Soziale Offenheit. Als letzte Teilanalyse zum H-L-S soll über den Faktor 3, „Soziale Offenheit“, berichtet werden (vgl. Tabellen B.11a und B.11b im Anhang B). Es wurden keine Voraussetzungsverletzungen beobachtet. Im Bereich der Zwischensubjekteffekte wurden keine bedeutsamen Unterschiede festgestellt, auch der Faktor Teilnahmebedingung wurde nicht signifikant. Ein schwacher Effekt der Betroffenengruppe konnte wegen zu geringer Teststärke statistisch nicht abgesichert werden. Numerisch haben hier wiederum die Witwen den besseren Wert im Vergleich zu den Eltern (M = 2.4 vs. 2.0). Dieser Effekt findet sich mit verbesserten statistischen Kennwerten im zweiten Analyse-Set wieder, dort wird dann näher darauf eingegangen. Signifikant wurden dagegen der Haupteffekt der Messwiederholung, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung, und alle damit zusammenhängenden Interaktionen. Die Interaktion zweiter Ordnung zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung, Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe wurde hoch signifikant (F(1, 39; 95 %) = 16.2, p < .001, etap2 = .293). Hoch signifikant wurden auch die Interaktionen zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Teilnahmebedingung (F(1, 39; 95 %) = 20.11, p < .001, etap2 = .340) sowie zwischen Fremd-/Selbstwahrnehmung und Betroffenengruppe (F(1, 39; 95 %) = 20.61, p < .001, etap2 = .346). Der Effekt der Zweifach-Interaktion kann als groß bewertet werden, eine Betrachtung der Mittelwerte zeigt, dass sich die Werte der Eltern in der Fremdwahrnehmungsbedingung unter Teilnahme (M = 1.8), und in der Selbstwahrnehmungsbedingung sowohl unter Teilnahme als auch Nicht-Teilnahme deutlich von allen anderen Werten abheben (M = 1.6 und 1.8). Wiederum zeigt sich, dass die Gruppe der Eltern über vergleichsweise wenig psychosoziale Ressourcen verfügt. In der Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Betroffenengruppe spiegelt sich dieses Ergebnis in einem signifikanten Unterschied zwischen Eltern und Witwen unter der Selbstwahrnehmungsbedingung wieder (M = 2.3 vs. 1.7), und innerhalb der Gruppe der Eltern in einem hoch signifikanten Unterschied zwischen der Fremd- und der Selbstwahrnehmungsbedingung (M = 2.2 vs. 1.7). Für die bedeutsame Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Teilnahmebedingung ist der Kontrast zwischen dem Mittelwert der fremdbeurteilten Teilnehmer (M = 2.6) und allen anderen Werten verantwortlich (M = 2.0). Unter Berücksichtigung der anderen Teilergebnisse kommt als Ursache nur der nivellierende Einfluss der Eltern unter den unterschiedlichen Interaktionsstufen höchster Ordnung in Frage. Die bislang behandelten Interaktionen lassen eine separate Interpretation des Faktors Fremd- vs. Selbstwahrnehmung zu, der mit p < .001 hoch signifikant ausfiel (F(1, 39; 95 %) = 28.14, etap2 = .419). Mit einem Mittelwert von 2.3 unter Fremdwahrnehmung kontrastiert ein Mittelwert von 2.0 unter der geschätzten Selbstwahrnehmung, der Effekt fällt mit .42 groß aus. Folgt man diesen Ergebnissen, dann drückt sich in dieser Analyse, vor allem aus der (eingeschätzten) Selbstsicht der Eltern betrachtet, eine geringere Offenheit für soziale Beziehungen und gegenüber sozialen, nicht selbstbezogenen Kontexten aus, als das aus der objektiven Sicht der Beurteiler der Fall ist. In einfacheren Worten ausgedrückt, fühlen sich die betroffenen Personen stärker auf sich selbst konzentriert und beurteilen sich selbst in dieser Hinsicht negativer, als es sich von außen betrachtet nachempfinden und an Beobachtungen festmachen lässt. 127 128 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Ergebnisse zum Fragebogen H-VUV Für den Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück und Verlust wurden zwei zweifaktorielle Varianzanalysen und ein Kruskall-Wallis-Test durchgeführt (N = 40). Mit den Varianzanalysen wurden die Skalen 1 und 2 untersucht („institutionelle, allgemein zugängliche Hilfsangebote“ und „Hilfe durch nahe stehende, vertraute Personen“). Der zusätzliche Kruskall-Wallis-Test wurde nötig, da der Levene-Test für die Varianzanalyse 2 mit p = .009 eine bedeutsame Verletzung der Varianzhomogenität anzeigte. Die beabsichtigte Analyse zum Einfluss der „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“ wurde hinfällig, da dieses Item von zu wenigen Personen beantwortet wurde, um Gruppenunterschiede untersuchen zu können. Die Mittelwerte für den Faktor 1, „institutionelle, allgemein zugängliche Hilfsangebote“, bewegen sich zwischen 1.9 und 3.1, was in etwa dem mittleren Bereich der Skala entspricht. Für Faktor 2, „Hilfe durch nahe stehende und vertraute Personen“, liegen die Werte zwischen 2.9 und 3.5, also etwa im oberen Mittelfeld der Skala. Inferenzstatistisch zeigten weder die letztlich verworfene Varianzanalyse noch der nachfolgende Kruskall-Wallis-Test zur „Hilfe durch nahe stehende Personen“ (H-VUV Faktor 2) bedeutsame Effekte an. Unterschiede zeigten sich aber in der Analyse der „institutionellen und allgemein zugänglichen Hilfsangebote“. Mit F(1, 36; 95%) = 7.79 und p = .008 wurde hier die Interaktion zwischen Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe sehr signifikant. Die Teststärke erreicht mit .78 zwar nicht ganz das gewünschte Maß, wird aber als ausreichend betrachtet, um diesen Effekt interpretieren zu können, die Effektgröße liegt im mittleren Bereich (etap2 = .18). Die beiden Haupteffekte Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe wurden dagegen nicht signifikant. Mit Mittelwerten von 1.9 unter der Teilnahme- und 3.1 unter der Nicht-TeilnahmeBedingung unterscheiden sich die Eltern sehr signifikant voneinander (F(1, 36; 95%) = 7.60, p = .009) – teilnehmende Eltern berichten über insgesamt weniger hilfreiche Erfahrungen mit institutioneller und allgemein zugänglicher Unterstützung als nicht teilnehmende. Die Teilnahme an der psychologischen Gruppe wird dagegen von diesen Betroffenen mit M = 4.0 als sehr hilfreich bewertet. Ähnlich deutlich fällt der Unterschied zwischen nicht-teilnehmenden Eltern und Witwen aus, allerdings haben hier die Eltern mit 3.1 gegenüber den Witwen mit 2.1 den besseren Wert (F(1, 36; 95%) = 7.67, p = .009). Es bleibt festzuhalten, dass die nicht-teilnehmenden Eltern die insgesamt hilfreichste Unterstützung durch institutionelle und allgemein zugängliche Hilfsangebote berichten und sich damit deutlich von den anderen Untergruppen abheben. Die Tabellen B.12a bis B.13b im Anhang B dokumentieren die hier berichteten deskriptiven Kennwerte und Signifikanztests zum H-VUV. Unterschiede zwischen Betroffenengruppen Nachdem abgeklärt wurde, welchen selektiven Einfluss die „Teilnahme“ gegenüber der „Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ auf die Betroffenengruppen der Eltern und der Witwen hatte, sollte im zweiten Analyseschritt die gesamte verfügbare Stichprobe auf Gruppenunterschiede untersucht werden. Als Folge der üblichen Dropout-Raten bei längerfristigen Datenerhebungen mussten hier die ursprünglich fünf Betroffenengruppen teilweise auf drei Gruppen reduziert werden. Wegen zu geringer Fallzahlen fielen in einigen Fällen die türkischen Witwen und die Verletzten aus dem B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Analyseschema heraus, was insbesondere im Fall der hochexponierten Gruppe der Verletzten bedauerlich ist (vgl. die Tabellen B 1.7 weiter oben sowie B.3 im Anhang B). Die Analyse folgt dem bereits bekannten Schema. Zuerst werden die Belastungsmaße, anschließend die psychosozialen Schutzfaktoren dargestellt. Ergebnisse zum PTB-2 PTB-2, Score vs. Messung 2/Item 1. Zur Bestimmung des Einflusses der Betroffenengruppe wurden zunächst zwei zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung gerechnet (N = 42), abhängige Variable war das Maß zu den Phasen der Traumabewältigung (PTB-2). In der ersten Analyse bestand der Messwiederholungsfaktor aus dem Score des PTB-2 (Messzeitpunkt 1, drittes Jahr nach dem Unglück, Fremdbeurteilung) und dem Item 1 des PTB-2 zum Messzeitpunkt 2 (fünftes Jahr nach dem Unglück, Selbstbeurteilung). In der zweiten Analyse wurde der Score des PTB-2 durch das Item 1 („Bewältigung von Unglück und Verlust“) der ersten Messung ersetzt und mit Item 2 aus Messung 2 verglichen. Aussagen zur Auswirkung der Messwiederholung enthalten in beiden Fällen sowohl eine Zeit-/Prozesskomponente als auch eine Komponente des Beurteilungsmodus (Fremd- vs. Selbstbeurteilung). Da zum Messzeitpunkt 2 mit N = 42 deutlich weniger Personen zur Verfügung standen als zu Messzeitpunkt 1 (N = 66) und deshalb Verletzte und türkische Witwen aus den Messwiederholungsanalysen ausgeschlossen werden mussten, wurde mit einer weiteren, einfaktoriellen Varianzanalyse die isolierte Bedeutung des Faktors Betroffenengruppe für die Traumabewältigung untersucht, hier aber unter Einschluss aller Betroffenen. In keiner der drei Analysen wurden Voraussetzungsverletzungen beobachtet, die Ergebnisse der Varianzanalysen sind interpretierbar. Die unter den einzelnen Faktorstufen beobachteten Mittelwerte liegen mit 4.3 bis 7.0 (Analyse 1), 4.0 bis 7.0 (Analyse 2), und mit 4.6 bis 5.9 (Analyse 3) alle in der oberen Hälfte der Skala. Insbesondere bei Berücksichtigung der Ergebnisse zum zweiten Messzeitpunkt kann die Traumabewältigung aller hier erfassten Betroffenen als befriedigend bis gut gelungen bewertet werden. Wie bereits im Analyse-Set 1 wurde auch hier der Faktor Betroffenengruppe hoch signifikant (F(2, 39; 95%) = 9.98, p < .001, etap2 = .338). Nicht signifikant wurden der Faktor Traumabewältigung (Messung 1 vs. 2) und die Interaktion zwischen Traumabewältigung und Betroffenengruppe. Zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt kommt es damit auch hier zu keiner statistisch bedeutsamen Veränderung in der Qualität der Traumabewältigung, auch nicht in einzelnen Betroffenengruppen. Deskriptive Statistiken und paarweise Mittelwertvergleiche zum signifikanten Effekt zeigen, dass die Eltern (M = 4.5) im Vergleich zu den Witwen (M = 5.7) den schlechteren Wert der Traumabewältigung erreichten, dieses Ergebnis ist mit p = .001 hoch signifikant. Mit p = .002 fällt auch der Vergleich zwischen Eltern und Geretteten hoch signifikant aus (M = 6.5). Die Geretteten fallen insgesamt durch die höchsten Mittelwerte auf, unterscheiden sich statistisch aber nicht von den Witwen. Deskriptive Statistiken und Ergebnisse des F-Tests dieser Analyse werden in den Tabellen B.14a und B.14b im Anhang B dargestellt. 129 130 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken PTB-2, Item 1, Messung 1 vs. Messung 2. In der zweiten Varianzanalyse wurde der Messwiederholungsfaktor aus dem Item zur „Bewältigung von Unglück und Verlust“ aus Messung 1 und dem gleichen Item aus Messung 2 gebildet, alle anderen Analysebedingungen waren gleich. Auch in diesem Fall erwies sich der Faktor Betroffenengruppe wieder als hoch signifikant (F(2, 39; 95%) = 11.32, p < .001, etap2 = .367). Für diesen Effekt sind, wie schon in Analyse 1, die deutlich schlechteren Mittelwerte der Eltern im Vergleich zu den Witwen und den Geretteten verantwortlich. Außer geringfügigen numerischen Mittelwertunterschieden haben sich hier keine neuen Erkenntnisse ergeben (vgl. Tabelle B.15a im Anhang B), der Effekt ist als groß einzustufen und statistisch gut abgesichert. Signifikant wurde in dieser Analyse auch der Faktor Traumabewältigung (Item 1, 2 Messungen; F(1, 39; 95%) = 5.96, p = .019, etap2 = .133), im Vergleich der beiden Messzeitpunkte zeigten hier alle Gruppen eine Verbesserung der Mittelwerte. Das Ergebnis stimmt mit dem analogen Befund aus dem ersten Analyse-Set überein. Wie bereits dort wird die besondere Bedeutung einer isolierten Betrachtung der Bewältigung von persönlichem Unglück und Verlust deutlich. Erst unter Beschränkung auf diesen Kernaspekt werden prozesshafte Änderungen sichtbar, der Effekt ist statistisch als schwach bis mittel einzustufen. Leider ist aber auch hier die Teststärke nicht ausreichend, um den Befund als gut abgesichert bezeichnen zu können. Nicht signifikant wurde dagegen die Interaktion zwischen Traumabewältigung und Betroffenengruppe, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass einzelne Gruppen ein größeres Maß an Traumabewältigung erreicht hätten als die anderen. Zwar gibt es hier mit etap2 = .03 einen schwachen Effekt, die Teststärke bleibt aber weit hinter den Anforderungen einer statistischen Absicherung zurück. PTB-2, Score. Die einfaktorielle Varianzanalyse des Faktors Betroffenengruppe, ohne Berücksichtigung der Messwiederholung (N = 66), wurde mit p = .028 signifikant, die Teststärke wird als noch ausreichend bewertet (F(4, 61; 95%) = 2.92, etap2 = .161). Die Tabellen B.16a und B.16b im Anhang B stellen die Ergebnisse dieser letzten Teilanalyse zum PTB-2 dar. Bei Betrachtung der paarweisen Mittelwertvergleiche zeigt sich, dass in dieser Analyse der Unterschied zwischen dem schlechteren Wert der Eltern und der besseren Traumabewältigung der Geretteten nicht mehr nachweisbar ist (M = 4.6 vs. 5.9), der Unterschied zwischen Eltern und Witwen ist dagegen nach wie vor bedeutsam (M = 5.6, p = .39), neue Erkenntnisse ergeben sich nicht. Betrachtet man die numerische Größe der Mittelwerte, dann scheint dieses Ergebnis erstaunlich und wenig logisch zu sein; hier wirkt sich erneut die Problematik der teils geringen Stichprobengrößen deutlich aus – die Gruppe der Geretteten ist mit n = 6 im Grunde zu gering, um einen bestehenden Unterschied statistisch absichern zu können. Ergebnisse zur B-L Zur Überprüfung der Frage, ob sich Unterschiede zwischen den einzelnen Betroffenengruppen in den berichteten psychophysischen Beschwerden und der allgemeinen psychischen Überforderung feststellen lassen, wurden drei zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung gerechnet (N = 42). Als abhängige Variablen gingen hier die Wiederholungsmessungen der Beschwerden-Liste ein (B-L' vs. B-L), überprüft B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken wurden das Hauptfaktoren- und die beiden Skalen des 2-Faktoren-Modells, jeweils univariat behandelt. Es wurden die Geretteten, die Witwen und die Eltern miteinander verglichen, Verletzte und türkische Witwen mussten wegen zu geringer Fallzahlen aus den Analysen ausgeschlossen werden. Wie bereits im ersten Analyse-Set wies der Levene-Test auch hier eine Verletzung der Varianzhomogenität im Erschöpfungsfaktor der BL' nach (p = .007). Die Abweichung von den Voraussetzungen wird als zu gravierend betrachtet, um noch vom F-Test kompensiert werden zu können. Da weder die Varianzanalyse noch die Mittelwertverteilung Anzeichen für bedeutsame Unterschiede enthielt, wurde auf weitergehende Untersuchungen des Erschöpfungsfaktors verzichtet. Die hier beobachteten Mittelwerte zeigen mit einer Spannbreite zwischen 1.1 und 1.3 eine gering ausgeprägte Belastung sowohl im ersten als auch im fünften Jahr nach dem Unglück an. Die beim Erschöpfungsfaktor festgestellte Verletzung der Voraussetzungen war stark genug ausgeprägt, um sich auch auf das Hauptfaktorenmodell auszuwirken. Der Levene-Test zum Summenscore der BL' wurde mit p = .019 signifikant, der Summenscore der BL war dagegen unauffällig. Der an sich signifikante Messwiederholungseffekt ist damit nicht interpretierbar (F(1, 39; 95%) = 9.22, p = .004, Teststärke .84). Da aber ein Vergleich der Mittelwerte zwischen der hier vorliegenden Varianzanalyse und der Analyse aus Set 1 keine wesentlichen Unterschiede zeigt, wird auf das dortige Ergebnis verwiesen. Der Trend ist hier wie dort der gleiche, die mittleren Belastungswerte aus dem ersten Jahr nach dem Unglück liegen, über alle Betroffenengruppen gemittelt, höher als die Werte im fünften Jahr, insgesamt hat eine Belastungsreduktion stattgefunden (M = 34.7 vs. 28.1). Hier wie dort gilt aber auch die Aussage, dass das Hauptfaktorenmodell der BL wesentlich von den Problemen im Erschöpfungsfaktor kontaminiert und von den Unterschieden im Anspannungsfaktor determiniert wird. Beim Anspannungsfaktor zeigten sich die methodisch weniger problematischen und inhaltlich interessanteren Aspekte. Voraussetzungsverletzungen wurden keine festgestellt, die Analyse ist interpretierbar. Der Messwiederholungsfaktor wurde signifikant (Anspannungsfaktor BL' vs. BL; F(1, 39; 95%) = 6.84, p = .013, etap2 = .149), die Interaktion zwischen dem Anspannungsfaktor und dem Faktor Betroffenengruppe wurde sehr signifikant (F(2, 39; 95%) = 6.49, p = .004, etap2 = .250). Auch diese Ergebnisse spiegeln prinzipiell die Ergebnisse der analogen Analyse aus dem ersten Set wieder. Die Anspannungsreduktion zwischen den Messzeitpunkten 1 und 2 fällt im vorliegenden Fall zwar numerisch etwas geringer aus (M = 1.6 vs. 1.4), der Effekt ist aber statistisch betrachtet immer noch mittelmäßig stark ausgeprägt. Die nicht optimale Teststärke ist zu bedauern, kann aber hingenommen werden. Die hier beobachtete signifikante Interaktion ist im Gegensatz zum Effekt aus Set 1 ohne Einschränkungen interpretierbar, bei guter Teststärke wird ein mittlerer Effekt angezeigt. Mit einer Spannbreite zwischen 1.2 und 1.9 über alle Teilstichproben und Messzeitpunkte betrachtet, liegt die Belastung eher im mittleren Bereich, einzelne Gruppen sind aber deutlicher belastet als andere, was ja durch die signifikante Interaktion auch signalisiert wird. Während paarweise Vergleiche der Gruppen innerhalb der beiden Messwiederholungszeitpunkte unauffällig bleiben, finden sich verschiedene bedeutsame Unterschiede, wenn man die Werte der einzelnen Gruppen unter den beiden Messzeitpunkten 131 132 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken miteinander vergleicht. Ein hoch signifikanter Unterschied wird für die Witwen angezeigt (M = 1.9 in Messung 1 vs. 1.2 in Messung 2, p < .001). Ähnliches gilt für die Eltern (M = 1.6 unter Messzeitpunkt 1 vs. 1.3 unter Messzeitpunkt 2, p < .029), allerdings fällt hier die Absenkung der Belastungsstärke nicht so deutlich aus wie bei den Witwen. Die Anspannungswerte der Geretteten unterscheiden sich dagegen mit M = 1.4 vs. 1.6 statistisch nicht bedeutsam voneinander. Vergleicht man also die Personengruppen unter den einzelnen Messzeitpunkten, dann unterscheiden sie sich nicht bedeutsam voneinander. Vergleicht man aber die Werte der einzelnen Personengruppen innerhalb der Messwiederholung, dann kommt es zwischen den Messzeitpunkten 1 und 2 für Witwen und Eltern zu einer statistisch bedeutsamen Reduktion der Anspannung, während die Geretteten im fünften Jahr nach dem Unglück – statistisch – unter dem gleichen Maß an Anspannung leiden wie im ersten Jahr nach dem Unglück. Bei dieser Gruppe findet zwischen den beiden Messzeitpunkten numerisch sogar eine Spannungssteigerung statt, nur lässt sich diese nicht von einer zufälligen Schwankung abgrenzen. Als Ursache kann hier ein differentiell nur bei den Geretteten aufgetretener Selektionseffekt oder ein Methodenartefakt vermutet werden, das sich aus der retrospektiven Befragung ergeben hat. Die Anspannungswerte der Geretteten bleiben im mittleren Bereich der Skala und müssen damit auch im fünften Jahr nach dem Unglück als erhöht und als klinisch relevant bewertet werden. Witwen und Eltern bewegen sich dagegen aus dem mittleren Belastungsbereich in die untere Hälfte der Skala. Aber auch diese beiden Gruppen haben im fünften Jahr nach dem Unglück immer noch einen als auffällig einzustufenden Anspannungswert. (Für Eltern und Witwen gilt weiterhin, dass die an anderer Stelle untersuchte Teilnahmebedingung an diesem Ergebnis keinen Anteil hat.) Die Tabellen B.17a bis B.19b im Anhang B dokumentieren die deskriptiven Kennwerte und Signifikanztests der drei besprochenen Analysen zur BL. Ergebnisse zum Fragebogen H-L-S Zur Abklärung der Frage, ob die psychosozialen Merkmale des H-L-S unterschiedlich in den einzelnen Betroffenengruppen ausgeprägt sind, wurde für jeden Faktor je eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung gerechnet (N = 66). Verletzungen der varianzanalytischen Voraussetzungen wurden nicht beobachtet, alle Ergebnisse sind interpretierbar. Es mussten keine Betroffenengruppen aus den Analysen ausgeschlossen werden, es sind Aussagen zu allen Teilstichproben möglich. Psychosoziale Einbettung. Ein Vergleich der Mittelwerte zu Faktor 1 des H-L-S, „Psychosoziale Einbettung“ (Tabelle B.20b im Anhang B), zeigt ein erstaunlich homogenes Bild. Unterschiede zwischen einzelnen Werten finden sich häufig erst in der zweiten Nachkommastelle, die aber in der hier gewählten Darstellung nach Rundung wegfällt. Die Werte bewegen sich im Bereich zwischen 3.0 und 3.4 bei einer durchschnittlichen Schwankungsbreite von etwa 0.75 oder darüber. Qualitativ spricht dieses Ergebnis für eine insgesamt befriedigende bzw. mittlere Güte der psychosozialen Einbettung. Es fanden sich keine signifikanten Effekte im Vergleich der einzelnen Personengruppen bzw. Effekte, die beobachteten Effektgrößen sind ohne praktische Bedeutung, auch in der Unterscheidung zwischen Fremd- und geschätzter Selbstwahrnehmung zeigten sich keine erkennbaren Unterschiede. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Materielle Absicherung. Differenzierter war dagegen das Bild, das sich nach Analyse des Faktors 2 des H-L-S zeigte. Der Mittelwertebereich schwankt zwischen 3.4 und 4.7, was einer befriedigenden bis guten durchschnittlichen materiellen Absicherung in den Teilstichproben entspricht. In dieser Analyse wurde der Faktor Betroffenengruppe sehr signifikant (F(4, 61; 95%) = 4.63, p = .003, etap2 = .233), der Messwiederholungsfaktor Fremd- vs. Selbstwahrnehmung fiel mit p < .001 hoch signifikant aus (F(1, 61; 95%) = 21.17, etap2 = .258). Nicht signifikant wurde die Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und Betroffenengruppe. Ein Vergleich der Mittelwerte aller Betroffenengruppen zeigt als Ursache für den bedeutsamen Zwischensubjekteffekt den Unterschied zwischen Eltern und Witwen an, die mit n = 13 und n = 30 gleichzeitig die größten Gruppen innerhalb dieser Analyse sind. Der Mittelwert der Eltern liegt mit M = 3.6 unter dem der Witwen (M = 4.3), der Unterschied ist nach Bonferroni-Korrektur mit p = .008 sehr signifikant. Weitere bedeutsame Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen werden nicht angezeigt. Ein Vergleich des Kontrasts zwischen Eltern und Witwen mit der Interaktion zwischen Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe aus dem Analyseset 1 macht deutlich, dass der hier gefundene Unterschied auf den insgesamt deutlich abweichenden Wert der Eltern zurückgeführt werden kann, die an einer psychologischen Gruppe teilgenommen haben. Der signifikante Messwiederholungseffekt geht auf den Unterschied zwischen einem Mittelwert von M = 4.1 unter der Fremd- und von 3.8 unter der Selbstwahrnehmungsbedingung zurück. Unter der geschätzten Selbstwahrnehmung wird die materielle und existentielle Absicherung als schlechter eingeschätzt, der hier gemessene Effekt ist von mittlerer Größe. Die beiden Tabellen B.21a und B.21b im Anhang B stellen die Details zu dieser Analyse dar. Soziale Offenheit. Weitere statistisch bedeutsame Effekte zeigten sich beim Faktor 3 des H-L-S, des „Soziale Offenheit“. Voraussetzungsverletzungen wurden keine festgestellt. Die Mittelwerte decken hier den Bereich zwischen 1.7 und 3.6 ab, inhaltlich liegen die Werte damit im unteren und mittleren Bereich der Skala. Bereits im Analyse-Set 1 wurde tendenziell ein Effekt des Faktors Betroffenengruppe erkennbar. Dieser wurde in der vorliegenden Analyse hoch signifikant und fiel bei einer Teststärke von 1.0 groß aus (F(4, 61; 95%) = 11.33, p < .001, etap2 = .426). Paarweise Mittelwertvergleiche zeigen eine Reihe von bedeutsamen Unterschieden, es kristallisieren sich zwei „Obergruppen“ heraus. Es unterscheiden sich die Geretteten und die Verletzten auf der einen Seite von den Witwen, den türkischen Witwen und den Eltern auf der anderen Seite. (Innerhalb dieser beiden Obergruppen gibt es keine bedeutsamen Unterschiede.) Die relativ schwächsten Unterschiede finden sich mit p = .022 zwischen den Verletzten und den Witwen, und mit p = .003 zwischen den Geretteten und den Witwen. Die anderen hier gefundenen Unterschiede sind mit p < .001 hoch signifikant. Während die Mittelwerte der Geretteten und der Verletzten im oberen Drittel der Skala liegen, befinden sich die Mittelwerte der Eltern und der türkischen Witwen im unteren Bereich. Die Mittelwerte der Witwen nehmen die mittlere Position der Skala ein, der Unterschied zu den besseren Werten der Geretteten und Verletzten ist noch groß genug, um diesen Unterschied signifikant werden zu lassen, und zu klein, um sich von den türkischen Witwen und den Eltern zu unterscheiden. 133 134 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Obwohl auch der Faktor Fremd- vs. Selbstwahrnehmung der H-L-S Skala 3 signifikant wurde, sind sowohl die Teststärke als auch die Effektgröße insgesamt nicht stark genug ausgeprägt, um von einem sicher interpretierbaren Ergebnis ausgehen zu können (F(1, 61; 95%) = 4.28, p = .043, etap2 = .066). Nicht signifikant wurde die Interaktion zwischen Fremd- vs. Selbstwahrnehmung und dem Faktor Betroffenengruppe. Eine Darstellung der Ergebnisse findet sich im Anhang B in den Tabellen B.22a und B.22b. Ergebnisse zum Fragebogen H-VUV Zur Abklärung, ob und ggf. welche Unterschiede es im Bereich der subjektiv wahrgenommenen Hilfe bei der Bewältigung von Unglück und Verlust zwischen den einzelnen Betroffenengruppen gibt, wurden zwei zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung gerechnet (N = 44), abhängige Variablen waren die Skalen 1 und 2 des H-VUV, „institutionelle & allgemein zugängliche Hilfsangebote“ und „Hilfe durch nahe stehende, vertraute Personen“. Wegen nicht ausreichender Fallzahlen wurden aus diesen beiden Analysen – wie schon im Fall der B-L – die Betroffenengruppen der Verletzten und der türkischen Witwen ausgeschlossen. Die beobachteten Mittelwerte liegen zwischen 1.0 und 2.7 für Faktor 1 und zwischen 2.4 und 3.4 für Faktor 2. Die „institutionellen & allgemein zugänglichen Hilfsangebote“ wurden als insgesamt eher unzureichend bis knapp befriedigend wahrgenommen, während die „Hilfe durch nahe stehende, vertraute Personen“ mittlere bis gute Werte erreicht. Im Untersuchungsplan vorgesehen waren darüber hinaus die Analyse des Faktors 3 des H-VUV, „Hilfe durch psychologische Interventionen“, und der beiden Items „Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“. Hier lagen leider insgesamt nicht genug Fälle vor, um eine gruppenstatistische Analyse rechtfertigen zu können, Einflüsse dieser Variablen auf die einzelnen Betroffenengruppen konnten nicht geklärt werden. Ihre Bedeutung soll aber im Rahmen der Untersuchung von globalen Zusammenhängen in der BorkenStichprobe berücksichtigt werden. Zu rein deskriptiven Zwecken sollen in Tabelle B.25 (Anhang B) Mittelwerte und Standardabweichungen der beiden Interventionsitems dargestellt werden. Sowohl die psychologischen Einzelgespräche als auch die Teilnahme an einer psychologischen Gruppe wurden subjektiv als sehr hilfreich erlebt, mit einer Ausnahme befinden sich alle Mittelwerte im oberen Bereich der Skala. In der Analyse des H-VUV-Faktors 2, „Hilfe durch nahe stehende, vertraute Personen“, zeigten sich keine signifikanten Effekte, der Levene-Test spricht mit p = .438 für eine Erfüllung der varianzanalytischen Voraussetzungen und damit für die statistische Gültigkeit des Ergebnisses. Alle Betroffengruppen haben in etwa das gleiche Maß an positiv erlebter Hilfe durch nahe stehende Personen erhalten, es gibt hier keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. Allerdings liegt ein schwacher Effekt vor, und auch ein Blick auf die Mittelwertverteilung lässt einen Trend erkennen, der vor allem die Geretteten als benachteiligt herausstellt. Bei der vorliegenden Stichprobenzusammensetzung lässt sich dieser Effekt inferenzstatistisch aber nicht absichern. Im Fall der Varianzanalyse des H-VUV Faktor 1, „institutionelle und allgemein zugängliche Hilfsangebote“, zeigte der Levene-Test mit p = .038 eine Verletzung der Varianzhomogenität an. Diese Verletzung liegt im noch tolerierbaren Bereich, wir betrachten B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken die Analyse als interpretierbar. Der Faktor Betroffenengruppe wird als sehr signifikant angezeigt (F(2, 41; 95%) = 7.63, p = .002, etap2 = .271), die Teststärke ist mit .93 sehr befriedigend. Der bereits in der Analyse zu Faktor 2 angesprochene Trend der Mittelwerteverteilung findet sich auch hier wieder, die schlechtesten Werte berichten die Geretteten, gefolgt von den Witwen; die Eltern berichten die insgesamt besten Werte. Die Mittelwerte der „institutionellen und allgemein zugänglichen Hilfsangebote“ bleiben hinter der „Hilfe durch nahe stehende Personen“ zurück. Paarweise Mittelwertvergleiche zeigen, dass sich Eltern und Witwen statistisch nicht voneinander unterscheiden, bedeutsame und absicherbare Unterschiede gibt es aber zwischen Geretteten und Witwen (M = 1.0 vs. 2.3, p = .005) und Geretteten und Eltern (M = 2.7, p = .001). Die Gruppe der Geretteten hat insgesamt wenig bis gar nicht von institutionellen und ähnlichen Hilfsangeboten profitiert. Relativiert wird diese Aussage durch die kleine Teilstichprobengröße von n = 4, auch wenn diese im varianzanalytischen Design noch gerechtfertigt werden kann. Darstellungen der deskriptiven Statistiken und der Inferenzstatistik finden sich im Anhang B, Tabellen B.23a bis 24b. Zusammenhänge zwischen Belastungsmaßen und psychosozialen Faktoren Nach der Untersuchung von Gruppenunterschieden mit zwei Sets von varianzanalytischen Designs sollte im dritten Analyseschritt abgeklärt werden, ob sich globale Zusammenhänge zwischen Belastungsmaßen einerseits und psychosozialen Faktoren andererseits identifizieren lassen. Auf der Seite der Belastungsmaße liegen zunächst der Score des PTB-2 sowie die beiden Marker-Items zur „Bewältigung von Unglück und Verlust“ vor; danach sind die unterschiedlichen Scores der B-L zu nennen, zum einen die des Hauptfaktorenmodells, zum anderen die der 2-Faktoren-Lösungen. Den Belastungsmaßen stehen auf der Seite der Hilfs- und Schutzfaktoren die Skalen des H-L-S und des H-VUV sowie die zwei Items zu den psychologischen Interventionen gegenüber. Im Sinn einer reinen Bestandsaufnahme und übersetzt in die Terminologie korrelations- und regressionsstatistischer Verfahren liegen insgesamt neun Kriteriumsvariablen und acht Prädiktoren vor. Kanonische Korrelationen Um abzuklären, in welchem Umfang (bzw. ob überhaupt) die Prädiktoren in der Lage sind, die in den Kriteriumsvariablen abgebildete Belastung aufzuklären, sollte eine Kanonische Korrelation durchgeführt werden. Problematisch an der Durchführung dieses Verfahrens war die Stichprobengröße, die für ein Kanonisches Korrelationsdesign mit den beiden vollständigen Variablensätzen gut 200 Personen hätte umfassen müssen, um schwer interpretierbare Schätzfehler der Zusammenhänge zu vermeiden (vgl. Bortz, 1993). Zum aus diesem Grund, zum anderen aber auch wegen verschiedenen Interkorrelationen zwischen einzelnen Variablen innerhalb der beiden Blöcke und der damit verbundenen Suppressionseffekte (z.B. B-L-Hauptfaktoren vs. Unterfaktoren), wurden statt dessen fünf Kombinationen aus Prädiktoren und Kriteriumsvariablen zusammengestellt und mit einer Kanonischen Korrelationsanalyse untersucht. Bei der Zusammenstellung der Variablenkombinationen wurde entschieden, einen vollständigen Satz von Prädiktoren zu bilden und schrittweise mit je einer sinnvollen 135 136 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Teilmenge an Kriteriumsvariablen zusammenzuführen, um möglichst viel Klarheit über die Struktur und den Gesamteinfluss der Schutzfaktoren bekommen zu können. Die Aufklärung von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Belastungsfaktoren wurde im Vergleich dazu als sekundär und wenig aussichtsreich betrachtet. Die drei Maße der PTB-2 sind in hohem Maß auseinander ableitbar, hier ist von einer vollständigen Einbringung ins Analysemodell kein wesentlicher Erkenntniszuwachs zu erwarten. Die B-L wiederum hatte sich im Rahmen der psychometrischen Untersuchungen als eins der schwächsten Instrumente erwiesen. Ein vergleichsweise hoher Anteil an unsystematischer Varianz in Zusammenhang mit einer relativ kleinen Stichprobe lässt nicht erwarten, evtl. vorhandene Zusammenhänge zwischen den Belastungsmaßen auch aufspüren zu können. Stattdessen wäre zu befürchten, dass sich die Fehlervarianz innerhalb der B-L negativ auswirkt und Effekte überdeckt. Es wurden folgende Analyse-Sets gebildet: Prädiktoren-Set (Schutzfaktoren): Scores der Skalen 1 bis 3 des H-L-S („Psychosoziale Einbettung“, „Materielle Absicherung“, „Soziale Offenheit“) unter der Beobachtungsbedingung „Fremdwahrnehmung“ (insgesamt 3 Maße); Scores der H-VUV-Skalen 1 und 2 („Institutionelle Hilfe“, „Hilfe durch nahe stehende Personen“). Sowohl die Skala 3 des H-VUV, „Hilfe durch psychologische Interventionen“, als auch die Einzelitems zu den psychologischen Interventionen („Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“, „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“) konnten in diesen Analysen nicht berücksichtigt werden, weil sonst die Stichprobengröße unter das akzeptable Minimum für eine Kanonische Korrelation geraten wäre. Sets von Kriteriumsvariablen (Belastungsmaße): (1) PTB-2 Score und Item 1 („Bewältigung von Unglück und Verlust“) aus Messung 2; (2) PTB-2 Item 1, Messungen 1 und 2; (3) Summenscores des B-L-Hauptfaktorenmodells (2 Maße); (4) Scores des B-LAnspannungsfaktors (2 Maße); (5) Scores des B-L-Erschöpfungsfaktors (2 Maße). Während die Kanonischen Korrelationen zum Zusammenhang zwischen den Schutzfaktoren und den Maßen der Beschwerden-Liste durchgängig nicht signifikant wurden, zeigten sich interpretierbare Effekte im Zusammenhang mit den Belastungsmaßen des Fragebogens PTB-2. Im Vergleich der beiden Analysen (N = 45) wurde eine geringfügige Überlegenheit des zweiten Modells festgestellt (Belastungen unter Item 1, zwei Messungen, vgl. Anhang B, Tabelle B.26). Inhaltlich entsprechen sich beide, über das erste Modell wird aus diesem Grund nicht weiter berichtet. Mit CR = .557 wurde im Modell 2 die erste Kanonische Korrelation signifikant (p = .006), während die zweite als nicht bedeutsam ausgewiesen wurde. Interpretiert werden können also je ein Kriteriums- und ein Prädiktor-Faktor. Der Prädiktor-Faktor wird im wesentlichen durch die Scores des H-L-S charakterisiert, die Skala 2, „Materielle Absicherung“, hat mit einer kanonischen Faktorladung von -.66 hieran den stärksten Anteil, allerdings dicht gefolgt von den beiden anderen Skalen mit einer Faktorladung von je -.54. Die beiden Scores des H-VUV leisten dagegen mit Faktorladungen um -.10 einen deutlich geringeren und im Prinzip unwesentlichen Beitrag. Der Prädiktor-Faktor besteht hauptsächlich aus Einflüssen des „allgemeinen psychosozialen Backgrounds“, während die verschiedenen Aspekte tatsächlich erhaltener und subjektiv wahrgenommener Hilfe kaum einen Beitrag dazu leisten. Im Kriteriumsfaktor zeigt sich – wenig überraschend – der dominierende Einfluss des Items 1 aus der ersten Messung, drei Jahre nach dem Unglück (Faktorladung von B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken -.92). Die hohe Interkorrelation beider Kriteriumsitems sorgt aber auch beim zweiten Item für eine sehr deutliche Faktorladung. Die durch den Prädiktor-Faktor aufgeklärte Kriteriumsvarianz – das Redundanzmaß – fällt mit rund 24% eher gering aus. Der Anteil der beiden Scores des H-VUV an der Aufklärung der Kriterien fällt mit Koeffizienten unter -.10 zu gering aus, um praktisch bedeutsam zu sein. Wie man aber bereits aus dem Bild der kanonischen Faktorladungen mutmaßen konnte, leisten die Scores des H-L-S den insgesamt stärksten Anteil zur Aufklärung der Kriterien, die Strukturkoeffizienten liegen zwischen -.30 und -.37. Die Beiträge sind von mittlerer Größe. Wie bereits eingangs erwähnt wurde, konnten keine Zusammenhänge zwischen den Schutzfaktoren und den Belastungsmaßen der B-L festgestellt werden. Zumindest in den hier erfassten Zeitfenstern werden keine Einflüsse psychosozialer Schutzfaktoren auf die von der B-L erfasste psychophysische Beschwerdelage sichtbar. Korrelationsanalysen Es wurde bereits mehrfach deutlich, dass die Stichprobenzusammensetzung komplexe Analysen der Items zu psychologischen Interventionen ausschloss. Zum Item der „Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und den damit assoziierten Belastungsmaßen liegen Angaben von N = 27 Personen vor, für das Item zur „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“ existieren N = 18 Beobachtungen. Zur Aufklärung der Bedeutung dieser Items und den erhobenen Belastungsmaßen wurden bivariate Korrelationen (Produkt-Moment-Korrelationen) berechnet, Signifikanztests auf dem Niveau von alpha = .05 wurden eingeschlossen. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in Tabelle B.27 im Anhang B zusammengefasst. Statistisch und numerisch bedeutsame Zusammenhänge ergaben sich zwischen der „Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und den drei Belastungsmaßen des PTB-2. Alle anderen Korrelationen blieben unbedeutend und schwach bis überwiegend verschwindend gering, sowohl, was die Rolle der subjektiv empfundenen „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“, als auch, was die Einflüsse der erlebten Hilfe durch psychologische Interventionen insgesamt auf die psychophysische Beschwerdelage betrifft. Die Korrelationen zwischen der Gruppenteilnahme und den PTB-2-Belastungsmaßen sind dagegen durchweg auf dem .05-Niveau signifikant, die Koeffizienten liegen mit .42 für den PTB-2-Score und mit je .38 für die beiden Items zur Bewältigung von Unglück und Verlust (Messungen 1 und 2) im Bereich mittlerer Zusammenhänge. Die Richtung der Korrelation ist positiv, je mehr subjektiv empfundene Hilfe angegeben wird, desto erfolgreicher ist auch die Traumabewältigung, sowohl insgesamt als auch unter isolierter Betrachtung der „Bewältigung von Unglück und Verlust“. Erwähnenswert scheint noch der Zusammenhang zwischen der „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“ und der drei Jahre nach dem Unglück gemessenen „Bewältigung von Unglück und Verlust“ zu sein (Item 1 des PTB-2 aus Messung 1, N = 18). Die Korrelation fällt hier mit .35 mittelstark aus, erreicht aber das Signifikanzniveau nicht (p = .156). Ein Blick auf das dazugehörige Streudiagramm weist die scheinbar nicht uninteressante Korrelation als Methodenartefakt aus – wenige, stark gestreute Mess- 137 138 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken wertpaarlinge erzeugen einen scheinbaren Trend, der aber zu locker ist, um bedeutsam sein zu können. Auf eine theoretisch denkbare Berechnung von linearen Regressionen zur Abschätzung der Vorhersagekraft der psychologischen Interventionsitems wurde verzichtet – vor dem Hintergrund der geringen Datenmenge und der gerade berichteten Korrelationen würde damit eine Validität der Berechnungen impliziert, die diese nicht haben können. Es wird weder als sinnvoll noch als wünschenswert betrachtet, scheinbar regelhafte und vorhersagetaugliche Formeln aufzustellen, wenn diese letztlich auf einer eingeschränkten Stichprobe beruhen, die durch deutlich erkennbare Anteile unsystematischer Varianz und tendenziell lockere Zusammenhänge gekennzeichnet ist. Die auch ohne weitere Berechnungen erkennbaren Standardschätzfehler dürften sich bei Korrelationen um .30 in einer Größenordnung bewegen, die Vorhersagen mit vertretbaren Konfidenzintervallen unmöglich machen. Weitere Ergebnisse Bevor im folgenden Abschnitt versucht wird, die hier berichteten Teilergebnisse zusammenzuführen und zu einem Gesamtbild zu integrieren, sollen abschließend einige selektive Teilergebnisse berichtet werden, die für die Gesamtinterpretation der Datenlage von Bedeutung sind. H-VUV Scores und Interventionsitems. Im Lauf der faktorenanalytischen Untersuchung des H-VUV entstand der Eindruck, dass die Items zu den psychologischen Interventionen eine Sonderstellung einnehmen könnten. Zur Abklärung wurden weitere ProduktMoment-Korrelationen bestimmt, und zwar zwischen den Interventionsitems einerseits und den Skalen von H-L-S und H-VUV andererseits, um das Ausmaß an Eigenständigkeit oder Gemeinsamkeit besser quantifizieren zu können (vgl. Tabelle B.27 im Anhang B). Während die Zusammenhänge zwischen den beiden psychologischen Interventionsitems und den Belastungsmaßen wie gerade berichtet vergleichsweise locker ausfielen, wurden zwischen den Interventionsitems und den psychosozialen Schutzfaktoren einige vom Betrag her interessante Korrelationen sichtbar. Während die Korrelation zwischen den Skalen 1 und 2 („Institutionelle Hilfe“ und „Hilfe durch nahe stehende Personen“) mit .43 während der Fragebogenentwicklung recht hoch ausfiel, korrelierte die [provisorische] Skala 3 negativ sowohl mit Skala 1 (-.28), als auch mit Skala 2 (-.21). Beide Korrelationen sind als schwach zu bezeichnen. Werden dagegen die beiden Items des „Pseudo“-Faktors 3 („Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“) separat mit den Skalen 1 und 2 korreliert, findet man differenzierte Ergebnisse. Die Korrelation beider Items mit der Skala 1, „Institutionelle Hilfe“, fällt mit jeweils .23 schwach aus, diese beiden Korrelationen sind nicht signifikant. Die Korrelation zwischen der Skala 2, „Hilfe durch nahe stehende Personen“, und dem Item „Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ ist mit -.15 schwach negativ und ebenfalls nicht signifikant (N= = 27). Zusammenhänge zwischen den Interventionsitems und den anderen Hilfsangeboten liegen danach nicht vor. Die engste Assoziation hat das Item zur „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“ zur Skala „Hilfe durch nahe stehende Personen“ (r = .41, p = .087, N= = 18). Je hilfrei- B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken cher nahe stehende Personen bewertet wurden, desto hilfreich war auch der Einfluss in Anspruch genommener psychologischer Einzelgespräche, und umgekehrt. Signifikanz wird aber wegen der geringen Teilstichprobengröße nicht erreicht. H-VUV und H-L-S. Schwache bis mittlere Zusammenhänge um .30 bestehen auch zwischen der „Hilfe durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und den ersten beiden Skalen des H-L-S. Eine schwache Beziehung besteht zwischen der „Hilfe durch psychologische Einzelgespräche“ und der Skala „Materielle Absicherung“ des H-L-S. Keine dieser Korrelationen wurde allerdings signifikant, von systematischen Zusammenhängen zwischen den Interventionsitems und den psychosozialen Maßen kann nicht ausgegangen werden – die hier berechneten Zusammenhänge müssen als zufällig gelten, was auch durch die jeweiligen Streudiagramme nahe gelegt wird. Unter Rückgriff auf den allgemeinen Grundgedanken von Regressionsverfahren (Lineare Regression und Kanonische Korrelation) kann folgender Schluss gezogen werden: Als Prädiktoren sind die Interventionsitems von den anderen psychosozialen Prädiktoren statistisch unabhängig, leisten also einen eigenständigen Beitrag. Dieser Beitrag fällt für den Zusammenhang zwischen der „Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ und der Traumabewältigung nach PTB-2 statistisch bedeutsam aus. PTB-2. Durchgängig zeigt sich, dass der Fragebogen PTB-2 mit seinem unmittelbaren Zugriff auf traumarelevante Aspekte am meisten zur Klärung des Gesamtbildes beiträgt. Von Interesse ist deshalb auch, in welchem Umfang die einzelnen Kennwerte zusammenhängen. Die Korrelation zwischen dem Score der PTB-2 und dem Item 1 aus der gleichen Messung fällt mit .85 hoch signifikant aus (p < .001), das Item ist damit ein zuverlässiger Prädiktor für den Gesamtwert. Die Korrelation zwischen Score und Item 1 aus Messung 2 ist mit .61 deutlich geringer, aber immer noch hoch signifikant. Die beiden Messungen des Items 1 korrelieren zu .56 (p < .001), zur Vorhersage der zweiten Messung erscheint also der PTB-2-Score geringfügig überlegen. 1.4 Schlussfolgerungen und Bewertung 1.4.1 Wissenschaftlich-methodische Bewertung Unterschiede zwischen „Teilnehmern“ und „Nicht-Teilnehmern“ an einer psychologischen Gruppe Mit einem vollständigen Satz von Varianzanalysen wurde für vier Merkmalsbereiche überprüft, ob sich Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer an einer psychologischen Gruppe unterscheiden. Überprüft wurden Belastungsfaktoren (Stand der Traumabewältigung mit dem PTB-2; psychophysische Allgemeinbelastung mit der B-L) und psychosoziale Faktoren (allgemeine/deskriptive psychosoziale Merkmale mit dem H-L-S; subjektiv erlebte Hilfe bei der Traumabewältigung mit dem H-VUV). 139 140 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Belastungsmaße Ohne damit nachträgliche Hypothesen formulieren zu wollen, wäre die Annahme plausibel, dass sich Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer an einer psychologischen Gruppe in ihren Belastungsmaßen unterscheiden, bei Mehrfachmessungen zumindest gegen Ende des Beobachtungszeitraums. Eine der beiden denkbaren Sichtweisen, die sich hier anbieten, würde nahe legen, dass Teilnehmer geringere und Nicht-Teilnehmer höhere Belastungsmaße zeigen, was auf eine Wirksamkeit der Teilnahme an einer psychologischen Gruppe hindeuten würde, dies allerdings unter der Bedingung, dass die Initialbelastung beider Gruppen (a) bekannt, und (b) gleich wäre. Hierzu gibt es eine zweite, alternative Sichtweise, die von der Annahme ausgeht, dass Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer sich bereits a priori in ihrer jeweiligen Belastungsstärke unterscheiden können, in dem Sinne, dass Nicht-Teilnehmer eine geringere Ausgangsbelastung haben als Teilnehmer, was für die letztgenannten dazu führt, das Hilfsangebot einer psychologischen Gruppe anzunehmen und im Idealfall davon zu profitieren. Ausgehend von einem spekulativen idealen Verlauf mit stetig sinkender Belastung könnte eine solche Ausgangssituation darauf hinauslaufen, dass Teilnehmer im Betrag eine größere Belastungsreduktion erleben als Nicht-Teilnehmer, trotzdem aber gegen Ende des Beobachtungszeitraums noch die relativ schlechteren oder die gleichen, wahrscheinlich aber keine besseren Belastungswerte zeigen. Die hier vorliegenden Daten stützen weder die eine noch die andere Sichtweise. In keinem Fall wurden Unterschiede zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern unter der reinen Teilnahmebedingung festgestellt, weder in Bezug auf die Traumabewältigung (Maße des PTB-2, in verschiedenen Auflösungsstufen) noch hinsichtlich der allgemeinen psychophysischen Belastung, oder, wie Koloska, Rehm und Fichter (1989) es interpretieren, der psychischen Überforderung (Maße der B-L, ebenfalls in verschiedenen Auflösungsstufen). Auch innerhalb der Interaktionen zwischen der Teilnahmebedingung und den Faktoren „Betroffenengruppe“ und „Messwiederholung“ wurden keine Unterschiede festgestellt. Für die Maße des Fragebogens PTB-2 wurden – abhängig vom betrachteten Maß – sowohl für Teilnehmer als auch für Nicht-Teilnehmer Werte zwischen 4.4 und 5.1 festgestellt, was einer Traumabewältigung im oberen Drittel bzw. von etwa 70% des erreichbaren Maximums entspricht. Verglichen wurden Eltern (die ein Kind durch das Unglück verloren hatten) und Witwen (deren Partner durch das Unglück ums Leben gekommen war). Der Stand der Trauma- und Trauerbewältigung wurde im dritten und im fünften Jahr nach dem Unglück erhoben; eine Aussage über die Initialbelastung durch Trauma, Verlust und Trauer ist generell für keine Betroffenengruppe möglich, da ein derartiges Maß nicht erhoben wurde. Erklärungen dafür, warum an dieser Stelle keine Unterschiede festgestellt wurden, können in der Kombination der geschilderten Faktoren gesucht werden. Ein erster Ansatz könnte sein, unter Rückgriff auf die Literaturlage Witwen und Eltern als sekundär Traumatisierte aufzufassen. Ohne die erlebte Trauer und den erlittenen Verlust der „Teilnehmer“ und „Nicht-Teilnehmer“ schmälern oder herunterrechnen zu wollen, könnte man – durchschnittlich, je nach Einzelfall – von einer geringeren Initialbelastung und einer qualitativ andersartigen zu leistenden Bewältigungsarbeit ausgehen, verglichen mit denjenigen Personen, die unter dem direkten und unmittelbaren Einfluss der Lebensbedrohung und/oder der Bergungsarbeiten gestanden haben. Bezieht man die B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Messzeitpunkte in die Überlegungen mit ein, dann wäre es denkbar, den Faktor „Teilnahme vs. Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ als sekundär und von anderen Effekten überlagert zu betrachten (Spontanremission/spontane Rückbildung, Wirksamkeit anderer psychosozialer Faktoren, etc.). Allerdings müssten sich dann, wenn dieses Argument zutreffend wäre, zu irgendeinem Zeitpunkt praktisch relevante Unterschiede zwischen einzelnen Betroffengruppen in den Belastungsmaßen der B-L feststellen lassen – und das ist nicht der Fall. Eine der beiden aussagekräftigeren Erklärungen für das Fehlen von Unterschieden zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern wird in der Anordnung der Messzeitpunkte gesehen. Nach aktueller Literaturlage kann man unterstellen, dass drei Jahre nach einem Unglück, unter dem Einfluss psychosozialer Unterstützung und begleiteter Bewältigungsarbeit, wesentliche Anteile eines Traumas und eines schweren persönlichen Verlusts verarbeitet sind. Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer lassen sich möglicherweise deshalb nicht unterscheiden, weil die vorliegenden Daten den Zeitabschnitt erfassen, wo sich die unterschiedlichen Bewältigungskurven – unabhängig von der ursprünglichen Ausgangsbelastung – bereits wieder auf einem gemeinsamen Niveau bewegen. Die guten Bewältigungswerte der beiden Betroffenengruppen können diese Sichtweise stützen. Tatsächlich erreichen sogar die maximal traumatisierten Geretteten sehr zufrieden stellende Traumabewältigungswerte (ohne natürlich bei dieser Gruppe zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern unterscheiden zu können). Ein weiteres stützendes Argument für einen weitgehend durchlaufenen Bewältigungsprozess lässt sich im Abstand der Messzeitpunkte sehen. Die Unterschiede im zweifach gemessenen Item 1 fallen zwar statistisch bedeutsam aus, der Effekt ist aber eher klein, die gemessene Veränderung beträgt 0.7 Punkte (10% der Skalenspannbreite). Die im dritten Jahr zufrieden stellende Traumabewältigung verbessert sich bis zum fünften Jahr nur geringfügig und verharrt, wenn man so will, auf zufrieden stellend hohem Niveau – möglicherweise auch ein Anzeichen für einen weitgehend abgeschlossenen Bewältigungsprozess. Nichts ausgesagt ist damit über die ursprüngliche Ausgangsbelastung von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern – diese ist unbekannt. In Betracht gezogen werden muss aber, und das ist der zweite Erklärungsansatz, die Auswirkung eines weiteren Aspekts, auf den im Folgenden wiederholt näher eingegangen wird. Die Teilnahme oder NichtTeilnahme an einer psychologischen Gruppe war nicht der einzige wirksame Einfluss auf die Traumabewältigung der Betroffenen. Es gibt in den Daten verschiedene teils direkte, teils indirekte (und nicht in jedem Fall bedeutsame) Anzeichen dafür, dass hier ein „kumulatives“ oder „komplementäres“ Modell der Hilfsfaktoren zur Wirkung kam, derart, dass sich psychologische Interventionen und andere psychosoziale Faktoren gegenseitig ergänzt und/oder wechselseitig ausgeglichen haben. Leider erlaubt es die Stichprobenzusammensetzung nicht, diesen Aspekt präziser zu explorieren, hier müssen Schlussfolgerungen und Annahmen ausreichen. Als erstes Argument soll auf die bereits erwähnte Unabhängigkeit der psychologischen Interventionsitems von den anderen Hilfsfaktoren verwiesen werden, bei gleichzeitig hohen Werten für die dadurch erhaltene Hilfe. Weiter ist daran zu denken, dass sich die Aussage über Teilnahme oder Nicht-Teilnahme auf die Wirkung der psychologischen Gruppen bezieht, während aber neun der 23 nicht teilnehmenden Eltern oder Witwen psychologische Einzelgespräche in Anspruch genommen und diese als sehr hilfreich erlebt haben (vgl. Tabel- 141 142 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken len B.25 bis 27 im Anhang B). Der Faktor Teilnahme vs. Nicht-Teilnahme an einer psychologischen Gruppe ist also auch konfundiert mit der Auswirkung der zweiten psychologischen Interventionsform, den Einzelgesprächen, was eindeutige Aussagen über die Wirkung der psychologischen Gruppen erschwert. Was bis hierher über die Qualität der Traumabewältigung gesagt wurde, gilt im Wesentlichen auch für die mit der B-L erfasste psychophysische Belastung und Überforderung. Auf zwei Besonderheiten ist allerdings hinzuweisen. Zum einen wurde versucht, über eine retrospektive Selbsteinschätzung etwas über das Belastungsniveau im ersten Jahr nach dem Unglück herauszufinden. Trotz der Validitätsmängel dieser Herangehensweise wurde deutlich, dass (a) die Belastung aller Betroffenen im ersten Jahr im deutlich erhöhten Bereich war, dass sich (b) sowohl bei Teilnehmern als auch bei Nicht-Teilnehmern zwischen erstem und fünftem Jahr die ursprüngliche Belastung deutlich zurückgebildet hat (B-L Score und Anspannungsfaktor), dass sich aber (c) Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer weder zu Zeitpunkt 1 noch zu Zeitpunkt 2 voneinander unterschieden. Zum anderen wurde festgestellt, dass die Belastung im Bereich der B-L im fünften Jahr nach dem Unglück immer noch im erhöhten Bereich war, was im Kontrast zu den guten Werten im Fragebogen PTB-2 steht. Daraus wird folgendes geschlossen: (1) Die psychovegetative Initialbelastung beider Gruppen, Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer, war in etwa gleich, und sie war, wie die Daten zeigen, deutlich erhöht. Im Verlauf der vier Jahre zwischen den beiden Zeitpunkten hat sich die Belastung in beiden Gruppen etwa im gleichen Umfang zurückgebildet, und obwohl die Nicht-Teilnehmer rein numerisch einen etwas schlechteren Endwert haben, unterscheiden sich beide Gruppen im fünften Jahr nach dem Unglück statistisch nicht voneinander. (2) Die hier festgestellte leicht erhöhte Restbelastung fünf Jahre nach dem Unglück kann wahlweise als Anzeichen für einen noch nicht voll durchlaufenen Bewältigungsprozess oder für eine persistierende erworbene Vulnerabilität angesehen werden, näheres könnten nur Folgeuntersuchungen aufklären. (3) Der Kontrast zwischen der erhöhten Belastung in der B-L und der gelungenen Traumabewältigung nach PTB-2 lässt sich – aus kognitiv-behavioraler Sicht – durch den unterschiedlichen Fokus der beiden Messinstrumente erklären. Zum einen beginnt jeder Traumabewältigungsprozess mit kognitiver Arbeit (Einsicht in das Unabänderliche, Auseinandersetzung mit dem Unglück, Umformung und Entwicklung von Perspektiven etc.), und hier werden häufig die schnellsten und dauerhaftesten Erfolge erzielt. Problematischer, weil weniger der direkten kognitiven Kontrolle unterworfen, ist dagegen die psychovegetative Seite, wie sie von der B-L erfasst wird. Es ist laut Literaturlage nicht außergewöhnlich, dass Traumatisierte, selbst nach erfolgreicher Bewältigungsarbeit, durch wiederkehrende psychovegetative Beschwerden belastet sind. Kognitive Traumabewältigung und psychovegetative Niveau-Änderungen verlaufen nicht zwangsläufig synchron, und sie müssen im Ergebnis nicht deckungsgleich sein. Der Erfolg der Bewältigung kann primär daran gemessen werden, was der Betroffene selbst darüber denkt, bzw. wie er seine Bewältigungsleistung selbst einschätzt – hier sprechen die Daten eine deutliche Sprache, wie sich an den PTB-2-Werten fünf Jahre nach dem Unglück ablesen lässt (Item 1, Selbsteinschätzung). B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Psychosoziale Faktoren Es fällt a priori schwer, Vermutungen über Unterschiede zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern an einer psychologischen Gruppe zu formulieren, die im Zusammenhang mit psychosozialen Schutz- und Stützfaktoren stehen. Im Sinn eines von systematischen Sekundäreffekten freien Untersuchungsdesigns würde sich der klinische Forscher wünschen, dass sich beide Gruppen nicht in diesen Variabeln unterscheiden. Realisieren ließe sich das mit Hilfe einer parallelisierten Zusammenstellung der Gruppen – eine Selektionsanordnung, die hier nicht vorliegt und sich aus ethischen Gründen auch verbieten würde. Ähnlich wie schon bei den Belastungsfaktoren ist aber auch eine andere Variante denkbar und mit einem systemischen Modell vereinbar, das von einer permanenten dynamischen Interaktion zwischen traumatischen Belastungsfaktoren und psychosozialen Randbedingungen ausgeht. Danach wäre es plausibel, dass z. B. diejenigen Personen, die über einen eher „schlechten“ psychosozialen Background mit wenigen Kontakten, wenig Unterstützung, und wenig zu erwartender Hilfe verfügen, sich eher um Unterstützung in einer psychologischen Gruppe bemühen (und u.U. deutlich davon profitieren), während Personen, die in einer besseren Ausgangsposition sind, diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen. In den Daten lassen sich Argumente für beide Ausgangsszenarien finden, die sich zu einem dritten zusammenfügen. In der Skala zur „psychosozialen Einbettung“ des H-L-S wird in der signifikanten Interaktion zwischen Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe ein interessanter, wenn auch schwacher und nur unzureichend absicherbarer Effekt deutlich. Nicht-teilnehmende Witwen haben im Vergleich zu teilnehmenden Witwen den schlechteren Wert; nicht-teilnehmende Eltern haben im Vergleich zu teilnehmenden Eltern den besseren Wert bei deutlicher Homogenität aller Streumaße. Daraus wird geschlossen, dass bei den Eltern die Nicht-Teilnahme durch einen besseren psychosozialen Background kompensiert wurde („Kompensationseffekt“), während in der Gruppe der Witwen die ohnehin bessere psychosoziale Einbettung durch Teilnahme an einer psychologischen Gruppe ergänzt wurde („Kumulationseffekt“). Bezieht man den zeitgeschichtlichen und den sozialen Hintergrund des Borken-Unglücks mit ein – ein Unglück Ende der 1980er Jahre in Deutschland, durch das hauptsächlich Arbeiterfamilien getroffen wurden –, lassen sich aus diesem Muster Vermutungen über die Entscheidungsprozesse ableiten, die bei Eltern und Witwen dazu geführt haben mögen, an einer psychologischen Gruppe teilzunehmen: Not und Mangel an Alternativen bei den Eltern; Einsicht und vergleichsweise höhere Aufgeschlossenheit, vielleicht auch die höhere Erreichbarkeit durch die Solidargemeinschaft der Trauernden bei einem Teil der Witwen, bzw. eine gewisse soziale Isolation bei einem anderen Teil. Weitere Belege für diese Sichtweise fanden sich im Bereich der „materiellen Absicherung“. In der Wechselwirkung zwischen Teilnahmebedingung und Betroffenengruppe zeigt sich das gleiche Gefälle der Mittelwerte wie bei der „psychosozialen Einbettung“, mit einer deutlich schlechteren Ausgangslage bei den teilnehmenden Eltern. Ergänzend wurde hier aber auch deutlich, dass die Eltern insgesamt, teilnehmende und nicht teilnehmende gemeinsam betrachtet, existentiell vergleichsweise schlechter gestellt waren. Den vorliegenden Werten ist aber kein Beleg dafür zu entnehmen, dass dieses „schlechter“ im Sinn von „schlecht“ bzw. „existentiell unzureichend abgesichert“ zu verstehen ist. Die Mittelwerte sind für sich betrachtet durchaus zufrieden stellend. In ei- 143 144 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken nem Summenmodell aller psychosozialen Ressourcen leistet die gemessene Variabilität der „materiellen Absicherung“ aber ihren eigenständigen Beitrag zur Traumabewältigung, wie bei der Erörterung der Zusammenhangsmaße deutlich werden wird. Der letzte hier untersuchte Bereich zu Unterschieden zwischen Teilnehmern und NichtTeilnehmern an einer psychologischen Untersuchung betraf den Einfluss bzw. das Ausmaß subjektiv erlebter Hilfe (Maße des H-VUV). Im Faktor der „institutionellen Hilfe“ wurde eine signifikante Interaktion zwischen Betroffenengruppe und Teilnahmebedingung festgestellt. In den Mittelwerten wird ein ähnliches Muster deutlich wie bereits im Fall des H-L-S. Nicht teilnehmende Witwen berichten gegenüber teilnehmenden Witwen die schlechteren Werte, während die teilnehmenden Eltern gegenüber den nicht teilnehmenden eine deutlich geringere Hilfe durch institutionelle und allgemein zugängliche Angebote angeben. Für die Gruppe der Eltern gilt damit ein weiteres Mal der „Kompensationseffekt“ (psychologische Gruppe gleicht fehlende andere Unterstützung aus), für die Gruppe der Witwen der „Kumulationseffekt“ (psychologische Gruppe leistet einen eigenen Beitrag zur Gesamthilfe). Mutmaßlich können auch hier die bereits in die Diskussion eingebrachten Generationseffekte verantwortlich sein (generationsspezifische Copingstrategien, unterschiedliche Einstellungen gegenüber psychotherapeutischer Hilfe, unterschiedliche Erwartungs- und Forderungshaltungen gegenüber Hilfsangeboten, etc.). Unterschiede zwischen Betroffenengruppen Belastungsmaße Im Bereich der Traumabewältigung fanden sich beachtenswerte Unterschiede zwischen einzelnen Betroffenengruppen. In allen Analysen zur PTB-2 schnitt die Gruppe der Eltern im Vergleich zu den anderen Gruppen schlechter ab. Die Traumabewältigung lag (mit und ohne Berücksichtigung der Messwiederholung) etwa im Mittelbereich bzw. im zweiten Drittel der Skala, der Unterschied wurde im Vergleich zu Witwen und Geretteten bedeutsam. Die beiden letztgenannten Gruppen erreichten Traumabewältigungswerte im oberen Drittel der Skala. Auffallend am Vergleich zwischen den Witwen und der Gruppe der (maximal traumatisierten) Geretteten ist, dass die Traumabewältigungswerte der Geretteten dicht an das Optimum der Skala heranreichten, während die Werte der Witwen geringfügig dahinter zurückblieben. Dieses Ergebnis ist um so erstaunlicher, weil die Geretteten auch fünf Jahre nach dem Unglück noch auffällige psychophysische Belastungswerte hatten, speziell im Bereich der Anspannung und des Arousals, und insgesamt die geringste Belastungsreduktion zeigten. Mit Unterschieden in den psychosozialen Faktoren lässt sich die besonders gelungene Traumabewältigung der Geretteten nicht oder nur unzureichend erklären. Wären die psychosozialen Faktoren für die besseren Bewältigungswerte der Geretteten verantwortlich, müsste diese Gruppe über mehr oder als hilfreicher erlebte Unterstützung durch „institutionelle Hilfsangebote“ und/oder durch „nahe stehende Personen“ berichten. Beides ist nicht der Fall, die Geretteten berichteten im Gegenteil eine im Schnitt deutlich geringer erlebte Unterstützung durch „institutionelle Hilfsangebote“; ein ähnlicher Trend, der allerdings statistisch nicht abgesichert ist, wurde bei der „Hilfe durch nahe stehende Personen“ beobachtet. Bessere Werte im Vergleich zu anderen Perso- B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken nengruppen erreichen die Geretteten allerdings im Merkmal „Soziale Offenheit“, unter dem wir hier eine aktives, nach außen orientiertes Interesse am Leben und an anderen Menschen, und die Fähigkeit zur aktiven Suche nach Hilfe verstehen. Hier drängt sich der Gedanke auf, dass jemand, der sein Leben ein zweites Mal erhält, mit einer besonderen Einstellung und einer anderen Motivation an seine Bewältigungsaufgabe herangeht. Es mag sein, dass der Prozess des posttraumatischen Wachstums nach einer extremen Traumatisierung leichter in Gang gesetzt werden kann als im Fall von (im Vergleich) weniger schweren Traumatisierungen. Schwierig einzuordnen sind in diesem Kontext die Bewältigungswerte von Witwen und Eltern. Während im PTB-2 unter anderem auch die Entwicklung einer Zukunftsperspektive abgefragt wurde, darf ein anderer, implizit hierin enthaltener und möglicherweise differentieller Aspekt nicht übersehen werden. Mit einer Zukunftsperspektive eng verknüpft ist der Aspekt der Lebensbilanz. Um den Unterschied zwischen Eltern und Witwen in einem Satz auf den Punkt zu bringen: Die Möglichkeit einer „Zukunftsperspektive“ und einer posttraumatischen Entwicklung kann im Bewusstsein von Eltern und Witwen einen anderen Stellenwert haben, mit dem Schwerpunkt auf „Bilanz“ bei den Eltern, und mit dem Schwerpunkt auf „Perspektive“ bei den Witwen. Für die Gruppe der Witwen kann man davon ausgehen, dass durch das Unglück ein Lebensabschnitt zu Ende ging, dem aber, abhängig vom Alter zum Zeitpunkt des erlebten Verlustes, weitere Lebensabschnitte folgen können. Für die psychophysischen Belastungsmaße der B-L wurde bereits festgestellt, dass die Geretteten im fünften Jahr nach dem Unglück die schlechteren Werte im Vergleich zu Witwen und Eltern hatten. Auch wenn der Unterschied zwischen den Betroffenengruppen statistisch nicht bedeutsam ausfiel, ist zumindest auffällig, dass sowohl bei Witwen als auch Eltern eine Anspannungsreduktion zwischen erstem und fünftem Jahr nach dem Unglück festgestellt wurde, für die Geretteten dagegen nicht (Messwiederholung). Die Anspannungswerte stagnieren auf einem deutlich erhöhten Niveau, die Anspannungswerte von Witwen und Eltern sind fünf Jahre nach dem Unglück immer noch erhöht gewesen. Es wurde bereits weiter oben darüber nachgedacht, in welchen Aspekten sich Kognitionen (= Traumabewältigung) und psychophysiologische Aktivierungsprozesse (= Anspannungs-/Arousalfaktor der B-L) unterscheiden. Die insgesamt äußerst zufrieden stellende Traumabewältigung und die erhöhten Anspannungswerte erscheinen nicht unvereinbar. Allgemein ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass der faktorenanalytisch ermittelte Anspannungs-/Arousalfaktor an der Aufklärung der psychophysischen Belastung den insgesamt größten Anteil hatte, während das Hauptfaktorenmodell stark von den Störeinflüssen im inhaltlich bedeutungslosen Ermüdungsfaktor überlagert war. Psychosoziale Faktoren Unterschiede zwischen Personengruppen wurden an verschiedenen Stellen festgestellt. Soweit davon auch die Teilnahmebedingung mitbetroffen war, wurden die Ergebnisse bereits erläutert. Insbesondere für die Deutung der „Materiellen Absicherung“ ist der Anteil der Teilnahmebedingung an den Unterschieden zwischen den Betroffenengruppen bedeutsam. Im direkten Vergleich der Betroffenengruppen – ohne die Berücksichtigung anderer Faktoren – erscheinen die Eltern als benachteiligt und schlech- 145 146 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken ter materiell abgesichert. Dieses Ergebnis lässt sich aber maßgeblich auf den schlechten Wert derjenigen Eltern zurückführen, die an einer psychologischen Gruppe teilgenommen haben. Dieser Wert ist allerdings auffällig niedrig, die Werte aller anderen Betroffenengruppen befinden sich in der oberen Hälfte der Skala. Ähnliches gilt für die psychosoziale Einbettung aller Betroffenen. Auch hier gibt es zwischen den Betroffenengruppen keine wesentlichen Unterschiede, die Werte sind hinreichend zufrieden stellend. Exponiert sind allerdings wieder die teilnehmenden Eltern, was aber unter Betrachtung der gesamten Elterngruppe keine Auswirkung mehr hat. Unterschiede im Merkmal der „sozialen Offenheit“ wurden bereits angerissen, als die erfreulich guten Traumabewältigungswerte der Geretteten diskutiert wurden. Es lassen sich hier zwei große Gruppen unterscheiden, Gerettete und Verletzte auf der einen, Witwen, türkische Witwen und Eltern auf der anderen Seite. Während sich die Mittelwerte der Geretteten und der Verletzten im oberen Drittel der Skala bewegen, liegen die Werte der anderen Gruppen deutlich genug darunter, um diesen Effekt statistisch bedeutsam zu machen. Korrelations- bzw. regressionsstatistisch haben alle mit dem H-L-S gemessenen Merkmale einen bedeutsamen Anteil an der Höhe der Traumabewältigung. Die hier festgestellten deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Personengruppen machen deshalb den Faktor „soziale Offenheit“ differentiell besonders interessant. Insbesondere wäre es interessant gewesen, etwas über den Zusammenhang zwischen erlebter Hilfe (z. B. durch psychologische Interventionen) und dem Ausmaß der sozialen Offenheit zu erfahren. Leider reichen die verfügbaren Daten nicht aus, um diesen Aspekt genauer zu erkunden. Im Vergleich der beiden Faktoren des H-VUV fällt verschiedenes auf. Vorher soll aber daran erinnert werden, dass der H-VUV kein Maß für die objektive Menge oder Qualität erhaltener Hilfe darstellt, sondern in Form der Selbstbeurteilung abfragt, was dem Betroffenen seiner Meinung nach wie viel geholfen hat. Zunächst einmal schneidet die durch „Institutionelle Hilfsangebote“ erlebte Unterstützung im Vergleich zur „Hilfe durch nahe stehende Personen“ deutlich schlechter ab, die Werte liegen im ersten Fall in der unteren Hälfte, im zweiten Fall etwa im Mittelbereich der Skala. Diese Aussage bleibt auch dann noch gültig, wenn man den extrem niedrigen Wert der Geretteten in der erhaltenen „Institutionellen Hilfe“ berücksichtigt. Dieser Faktor spielt also in der Wertschätzung der Betroffenen eine deutlich untergeordnete Rolle, auch wenn er laut Kanonischer Korrelationsanalyse einen bedeutsamen Anteil an der erreichten Traumabewältigung hat. Statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Betroffenengruppen gibt es außer dem abweichend niedrigen Wert der Geretteten in der „Institutionellen Hilfe“ nicht. Die berichtete „Hilfe durch nahe stehende Personen“ ist insgesamt zufrieden stellend – wenn auch nicht maximal – und in ihrem Beitrag zur Traumabewältigung ebenfalls bedeutsam. Wiederum fällt hier der geringe Mittelwert der Geretteten auf, der mit 2.4 hinter den Werten der Witwen und Eltern in der unteren Hälfte der Skala zurückbleibt; statistische Signifikanz wird hier nicht erreicht, die Teststärke reicht für eine Absicherung des Effekts nicht aus. Trotz dieser Einschränkung ist die Parallelität der beiden Teilergebnisse auffällig. Unserer Auffassung nach sind die geringen Werte der Geretteten auf zweierlei Effekte zurückzuführen. Zum ersten ist hier ganz allgemein die posttraumatische Isolation zu nennen. Ein maximal Traumatisierter – und um solche Personen handelt es sich bei B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken den Geretteten – wird immer auch mit der Erkenntnis konfrontiert werden, dass er das Erlebte nicht oder nur unvollständig anderen mitteilen und mit anderen teilen kann. Er wird Distanzen zwischen sich und den ihm „nahe stehenden“ Personen erkennen, und er wird erleben, dass die Hilfe, die er von nahe stehenden Personen erhalten kann, begrenzt ist. Seine Erlebnisse bringen es zwangsläufig mit sich, dass er derartige Grenzen erkennen und benennen lernt. Zum zweiten bilden sich speziell in der Skala zur „Institutionellen Hilfe“ subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen ab, die direkt mit „der Firma“ in Zusammenhang stehen. Jedes Unglück braucht einen „Schuldigen“ (oder Verursacher), um unsere auf Kontrollierbarkeit und simple Kausalitäten ausgerichtete Wahrnehmung im Gleichgewicht zu halten. Obwohl im Fall des Borkener Grubenunglücks eine menschliche Verursachung oder technisches Versagen ausgeschlossen werden konnten, bleibt der psychologische Mechanismus davon unberührt. Die wenigen verfügbaren Daten von Geretteten und Verletzten zur „Hilfe durch die Firma“ und „durch den Betriebsrat“ bestehen fast ausnahmslos aus schlechten Bewertungen. Ein differenzierteres Bild mit stärker streuenden Werten zeigen die Beurteilungen durch die anderen drei Betroffenengruppen, aber auch hier überwiegen die weniger guten Beurteilungen. Für den Psychologen stellt sich deutlich die Frage, was in vergleichbaren Fällen getan werden kann und sollte, um betriebsinternen Spaltungen und Frontenbildungen entgegenzusteuern, und wie vermieden werden kann, dass auf Seiten der Betroffenen die verständliche Suche nach „Gründen“ in eine Fixierung auf langfristig schädliche Schuldattribuierungen mündet. Um das Bild des H-VUV abzurunden, soll abschließend erwähnt werden, dass die Hilfe durch psychologische Interventionen im Durchschnitt gut beurteilt wurde. Die Werte bewegen sich im oberen Drittel der Skala und belegen damit im Vergleich der psychosozialen Faktoren die vorderen Positionen. Die deutlich positiven Zusammenhänge zur erreichten Traumabewältigung werden später aufgegriffen. Ergebnisse aus Messwiederholungen Belastungsmaße Eine zentrale Frage im Rahmen psychotraumatologischer Forschung ist die nach Veränderungen in Belastungsmaßen, wahlweise nur über die Zeit betrachtet oder unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Interventionsmaßnahmen. Es wurde verschiedentlich erwähnt, dass es in dieser Hinsicht bedauerliche Lücken in der Borken-Studie gibt, die sich auf den Stand der traumatologischen Forschung im Deutschland Ende der 1980er Jahre und auf den Handlungs- und Ressourcennotstand nach dem Borkener Grubenunglück zurückführen lassen. Eine fortlaufende Erhebung von Belastungsmaßnahmen war aus unterschiedlichen Gründen damals nicht möglich. Damit ist die Frage nach Veränderungen aber nicht unbeantwortbar, es wurden an verschiedenen Stellen bereits einzelne Aspekte dargestellt, hier sollen einige weitere folgen. Zur Traumabewältigung (PTB-2) ist anzumerken, dass Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten im dritten und im fünften Jahr erst sichtbar wurden, als sich die Betrachtung auf das Item zur „Bewältigung von Unglück und Verlust“ konzentrierte. Das globale Maß der Traumabewältigung und die Erfassung der Bewältigung 147 148 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken von Unglück und Verlust im engeren Sinn unterscheiden sich qualitativ voneinander, prozesshafte Effekte und Entwicklungen ließen sich erst dann sauber erkennen, als die beiden Messungen des Items 1 direkt miteinander verglichen wurden. Allerdings stellt sich hier die Frage der praktischen Bedeutsamkeit. Die Unterschiede im zweifach gemessenen Item 1 fallen zwar signifikant aus, die gemessene Veränderung beträgt aber lediglich 0.7 Punkte. An anderer Stelle wurde daraus auf einen weitgehend durchlaufenen Bewältigungsprozess geschlossen. Trotz dieser Einschränkungen, oder vielleicht gerade deswegen, sollte deutlich geworden sein, dass das Item 1, „Bewältigung von Unglück und Verlust“, als Marker- und Indikatoritem eine besondere Bedeutung im Screening haben kann. Aufgrund seiner Konstruktion (Formulierung und Skalierung) eignet es sich auch für Mehrfach-/Veränderungsmessungen gut. Die hier ermittelten psychometrischen Kennwerte können diese Sichtweise stützen, eine zukünftige Überprüfung würde sich aber empfehlen. Auf Veränderungen in den psychophysischen Belastungsmaßen (B-L) soll hier nur kurz eingegangen werden, alles Wesentliche ist bereits an anderen Stellen diskutiert worden. Die aussagefähigsten Informationen zur allgemeinen psychophysischen Belastung wurden im Faktor „Anspannung/Arousal“ entdeckt. Hier fand bei den meisten Betroffenen eine Verminderung der Belastung zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt statt, die Werte verlagerten sich aus der oberen in die untere Hälfte der Skala. Die Werte waren auch zum zweiten Messzeitpunkt noch erhöht. Als Erklärung für diesen Befund, der in einem gewissen Kontrast zu den Werten der Traumabewältigung steht, wird die unterschiedliche Dynamik im kognitiven und im psychophysischen Genesungsverlauf vermutet. Als besonders exponiert zeigten sich hier die Geretteten. Der Erschöpfungsfaktor scheint von Veränderungsprozessen nicht betroffen zu sein, hier liegen die Werte zu beiden Zeitpunkten im unteren Drittel der Skala. Eine Deutung der Ergebnisse über eine reine Deskription hinaus ist wegen der in den Daten sichtbar gewordenen Voraussetzungsverletzungen nicht möglich. Diese Probleme ziehen auch den B-L-Hauptfaktor in Mitleidenschaft, auf dessen Interpretation aber wegen der klaren Ergebnisse im Anspannungsfaktor verzichtet werden kann. Psychosoziale Faktoren Wiederholungsmessungen psychosozialer Faktoren fanden für den H-L-S, nicht aber für den H-VUV statt. Die Messwiederholung bestand allerdings nicht in unterschiedlichen Zeitpunkten, sondern in den unterschiedlichen Beurteilungsbedingungen „Fremdwahrnehmung“ vs. „geschätzte Selbstwahrnehmung“. Ausgangspunkt war die Vermutung, dass eine Einschätzung der eigenen psychosozialen Ressourcen, die durch einen negativen Bias belastet ist, tendenziell als zusätzlicher Stressor wirkt, oder, von einer anderen Seite her betrachtet, einen indirekten Indikator für eine sich negativ entwickelnde Lebensperspektive darstellen kann. Eine im Vergleich zum Expertenurteil positivere Einschätzung könnte wahlweise als Schutzfaktor oder als Anzeichen für einen positiv verlaufenden Genesungsprozess aufgefasst werden. Tatsächlich ergaben sich statistisch bedeutsame Unterschiede in den Skalen „Materielle Absicherung“ und „Soziale Offenheit“. Tendenziell fiel die Selbstwahrnehmung etwas schlechter als die Fremdwahrnehmung aus, insbesondere in Wechselwirkung mit B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken der Teilnahmebedingung traten recht klare Unterschiede hervor. Allerdings waren die numerischen Unterschiede so gering, dass sich die Frage nach der praktischen Bedeutsamkeit stellt. Lediglich die schlechteren Werte der Eltern, die an einer psychologischen Gruppe teilgenommen haben, sollten beachtet werden, allein deshalb, weil sich diese Gruppe auch in anderer Hinsicht von den übrigen Betroffenen abhebt. Zusammenhänge zwischen Belastungsmaßen und psychosozialen Faktoren Für die Aufklärung der Belastungsmaße durch die psychosozialen Schutzfaktoren ergibt sich aus Sicht des Forschers ein zwiespältiges Bild. Die Kanonischen Korrelationen zeigten, dass die psychovegetative oder psychophysische Belastung (B-L) unaufgeklärt bleibt. In den hier erfassten Variablen werden keine systematischen Einflüsse sichtbar, die zur Veränderung der psychophysischen Belastung beitragen. Das gilt auch für die psychologischen Interventionen. Ein etwas anderes, aber ebenfalls nicht völlig „erwartungskonformes“ Bild ergibt sich für die Traumabewältigung. Hier werden Zusammenhänge zum allgemeinen psychosozialen und sozioökonomischen Background sichtbar (H-L-S), aber nicht zur subjektiv erhaltenen Hilfe (H-VUV). Auffallend daran ist, dass auch der direkte Einfluss nahe stehender Personen auf die Traumabewältigung keinen nennenswerten Effekt zu haben scheint. Verschiedene Aspekte, die zur Erklärung beitragen können, wurden bereits weiter oben erörtert. Erwähnt werden soll hier aber ein allgemeines Argument, das sich regelhaft in der psychotraumatologischen Literatur findet und sich mit einer häufigen Beobachtung in therapeutischen Settings deckt. Die Anwesenheit nahe stehender Personen kann Hilfe bedeuten, muss es aber nicht – diese Personen sind einfach da, aber über ihre Verfügbarkeit und ihren Nutzen bei der Überwindung einer Erfahrung extremer Trauer und extremen Schreckens ist damit noch nichts gesagt. Die Anwesenheit nahe stehender Personen kann Entlastung bedeuten, kann aber auch für zusätzliche Belastungen und Stressoren sorgen. Nicht selten sind diese Personen direkt oder indirekt selbst Mit-Leidende, die neben der Möglichkeit der Hilfe auch das Risiko der zusätzlichen Belastung im Bewältigungsprozess mit sich bringen. Und selbst im Fall der Verfügbarkeit der Hilfe durch nahe stehende Personen kann nicht auf deren Wirksamkeit geschlossen werden. Hinsichtlich konkreter Hilfe bei der Traumabewältigung sprechen die Daten dagegen recht klar für die Wirksamkeit der psychologischen Interventionen, insbesondere der psychologischen Gruppen. Bei der Bewertung der Zusammenhänge (um .30) sind verschiedene Details zu berücksichtigen. (a) Die geringe Stichprobengröße macht den Einfluss der psychologischen Einzelgespräche schwer interpretierbar, hier wären mehr Beobachtungen wünschenswert gewesen; (b) die ausgesprochen heterogene Stichprobe sorgt für ein erhebliches Maß an unsystematischer Varianz; (c) nicht zuletzt ist der Beobachtungszeitraum zu berücksichtigen. Die Kenntnis und der Entwicklungsstand kognitiv-behavioraler Methoden in der Traumatherapie war zum Zeitpunkt des Borken-Unglücks mit den heutigen Verhältnissen nicht zu vergleichen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Interkorrelation der beiden Skalen H-VUV. Aus methodischer Sicht könnte man in dieser Korrelation ein Argument gegen die angestrebte Unabhängigkeit der Skalen sehen, die Unabhängigkeitsannahme der Skalen wird nach unserer Auffassung aber auch nicht so sehr in Frage gestellt, dass 149 150 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken das Modell komplett hätte verworfen werden müssen. Die Korrelation spricht stattdessen für einen gewissen inhaltlich plausiblen Zusammenhang zwischen der institutionellen Hilfe einerseits und der Hilfe durch nahe stehende Personen andererseits. Eine Erklärung für die Zusammenhänge zwischen beiden Skalen könnte sich auf differentialpsychologischer Ebene anbieten. Unter Umständen drücken sich hier interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit und in der Bereitschaft aus, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen und von angebotener Hilfe profitieren zu können. Dem liegt natürlich die Annahme zugrunde, dass Betroffene eines Unglücks im Verlauf ihres Bewältigungsprozesses prinzipiell in verschiedenen Lebensbereichen gleichzeitig nach Hilfe suchen – institutionelle Hilfe und Hilfe durch nahe stehende Personen sind komplementär, nicht gegenseitig ausschließend. Es bleibt festzuhalten, dass für den Erfolg der Traumabewältigung ein komplexes Modell verschiedener Einflussfaktoren verantwortlich ist. Aus unseren Daten lassen sich allgemeine psychosoziale Lebensumstände einerseits und psychologische Interventionen auf Gruppenebene andererseits als maßgeblich identifizieren. Diese Faktoren wirken sich aber, wie sich ansatzweise aus den Daten schließen lässt, auf unterschiedliche Betroffenengruppen unterschiedlich aus. Es wurden Anzeichen sowohl für kumulative als auch für komplementäre Effekte innerhalb der Schutz- und Hilfsfaktoren gefunden. Psychologische Interventionen können eine „Pufferfunktion“ übernehmen und stehen natürlich in permanenter Wechselwirkung zu den übrigen Faktoren. Indikatoren für eine vielleicht erhöhte Bedürftigkeit lassen sich im Zusammenspiel mit Generationseffekten aus dem sozioökonomischen Status und der psychosozialen Integration ableiten. Als verlässliches Screening-Maß für die Belastungsstärke kommt der PTB-2 in Frage. Resümee Während in der Traumabewältigung, wie sie hier erfasst wurde, insgesamt sehr zufrieden stellende Werte erreicht wurden, wurden psychophysische Restbelastungen festgestellt, die als Indikatoren für Anspannungs- und Arousalzustände aufgefasst werden können. Besserungen der Symptomatik über die Zeit fanden in beiden Problembereichen statt; eine Ausnahme bilden lediglich die Anspannungswerte der Geretteten die auf einem vergleichsweise hohen Niveau blieben. (Leider kann wegen unzureichender Datenmengen nichts über die zweite Gruppe der Primärtraumatisierten, die Verletzten, ausgesagt werden.) Als Verursacher für die Diskrepanz zwischen befriedigender Traumabewältigung einerseits und psychophysischer Restbelastung durch Anspannungszustände werden unterschiedliche intrapsychische und psychophysiologische Prozesse in den einzelnen Betroffenengruppen vermutet. Die im Vergleich schlechtesten Traumabewältigungswerte erreichten die Eltern, die besten die Geretteten; die Traumabewältigungswerte der Witwen liegen näher an denen der Geretteten als an denen der Eltern, erreichen aber nicht deren hohes Niveau. Hinsichtlich der psychophysischen Anspannung unterschieden sich die Geretteten durch höhere Werte von den anderen Gruppen, Witwen und Eltern liegen zum zweiten Erhebungszeitpunkt etwa auf gleich niedrigem Niveau. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Beide Gruppen, Gerettete und Eltern, werden als besonders exponiert für verlängerte posttraumatische Beschwerden angesehen. Bei den Geretteten ist dafür die initiale Maximalbelastung durch das Unglück verantwortlich, durch die u.a. eine möglicherweise erhöhte Vulnerabilität für dysfunktionale psychophysische Anspannungen angestoßen wurde (auf hohem Niveau stagnierende Werte im hier eingeführten Anspannungsfaktor der B-L). Dem steht aber eine deutlich erkennbare hohe Bewältigungsmotivation gegenüber (Traumabewältigungswerte), die unmittelbar einsichtig aus dem Ereignis der Rettung resultiert. Die vergleichsweise schlechtere Traumabewältigung der Eltern geht vermutlich auf ein vielfältiges Gemisch aus unterschiedlichen Begleitumständen zurück: die sich altersund generationsbedingt stellende Frage nach der „Lebensbilanz“, die im Vergleich geringere psychosoziale Einbettung bei einem Teil der Eltern, und die schlechtere materielle Absicherung. Allerdings muss hier auch darauf hingewiesen werden, dass die gemessene Traumabewältigung der Eltern im Vergleich zu den anderen Gruppen schlechter, aber für sich betrachtet nicht schlecht war. Es wurde jedoch deutlich, dass sich zwischen den einzelnen Betroffenengruppen differentielle Unterschiede abgezeichnet haben, die nur mit einem multimodalen Erhebungsansatz herausgearbeitet werden konnten. Sowohl die Traumabewältigungswerte als auch die Anspannungswerte der Witwen zum letzten Messzeitpunkt sprechen insgesamt für eine auch prognostisch günstige Bewältigungsleistung – für diese Betroffenengruppe kann davon ausgegangen werden, dass sie eine Zukunftsperspektive entwickelt hat. Wesentliche Beiträge zur Aufklärung der Belastung werden hauptsächlich von den allgemeinen psychosozialen Lebensumständen geleistet, wie sie vom H-L-S erfasst werden. Die drei H-L-S-Faktoren sind hier praktisch von gleicher Bedeutung, wenn es um den Zusammenhang zur Traumabewältigung nach PTB-2 geht, die Beziehungen sind positiv. Damit ist die Bedeutung der H-L-S- und der H-VUV-Skalen aber auch schon erschöpft. Die mit dem H-VUV erfassten Aspekte subjektiv erlebter Hilfe haben keinen nachweisbaren Einfluss auf das Maß der Traumabewältigung; es wird vermutet, dass die hier erfasste Hilfe sehr unterschiedliche Anteile enthält, die sich gegenseitig neutralisieren oder Aspekte der „Belastung in der Hilfe“ enthalten. Eine Ausnahme bilden allerdings die psychologischen Interventionen. Zumindest für die „Teilnahme an einer psychologischen Gruppe“ bestehen deutliche positive Zusammenhänge zur Traumabewältigung, für die „psychologischen Einzelgespräche“ gibt es zumindest einen tendenziell bedeutsamen Zusammenhang. Die psychophysische Belastung bleibt vollständig unaufgeklärt und unabhängig von allen untersuchten Schutzfaktoren. Während aus den vorliegenden Daten keine Schlüsse gezogen werden können, ob, und wenn ja unter welchen Einflüssen die Entwicklung psychophysischer Belastung und allgemeiner psychischer Überforderung steht, kann für die Traumabewältigung von einem komplexen Modell unterschiedlicher psychosozialer Faktoren ausgegangen werden, die sich teilweise ergänzen und teilweise ausgleichen können. 151 152 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken 1.4.2 Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Räumlichkeiten für die Betreuung Durch die Installierung der psychologischen Beratungs- und Behandlungsräume im firmeneigenen Haus der Werksfürsorge in Borken wurde für die Betroffenen der Weg zur psychologischen Hilfe anfangs schwieriger, da die meisten sich sehr schwer taten, ihre psychische Befindlichkeit in einem Gebäude zu thematisieren, das dem Betrieb gehört, der aus Sicht der Betroffenen für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich war. Außerdem bestanden Befürchtungen, vertrauliche Dinge könnten an das Unternehmen weitergeleitet werden. Möglicherweise wurde aufgrund dieser Entscheidung ein Teil der Betroffenen nicht erreicht, und sie entschieden sich gegen eine Teilnahme an psychologisch geleiteten Gruppen. Sicherlich ist es für manche Menschen schwierig, sich von der Firma helfen zu lassen, die für den Tod des Mannes oder Sohnes verantwortlich gemacht wird. Es bleibt die Frage, ob es gerechtfertigt ist, diese Personen sich selbst zu überlassen, wenn sie nicht in der Lage sind, Hilfsangebote, die mit der „Verursacher-Firma“ assoziiert werden, anzunehmen und sich isolieren. An diesem Punkt wird erneut die Notwendigkeit deutlich, auf Betroffene nach einer Katastrophe mit Hilfsangeboten zuzugehen, andererseits werden auch Grenzen erkennbar, da jemand, der Hilfe anbietet, auch immer ein Eigeninteresse vertritt, sei es, dass er das Image der Firma wieder aufbessern möchte, sei es dass er wissenschaftliche, politische oder religiöse Interessen verfolgt und sich so in den Augen der Betroffenen „verdächtig“ macht. Langfristig gesehen ermöglichte die Durchführung der psychologischen Betreuung in den Räumen der Werksfürsorge bei vielen Betroffenen einen Abbau der Ressentiments gegen die Firma und eine Auflösung der Rollen in Verantwortliche auf der einen und Opfer auf der anderen Seite. Es entstand ein Klima, in dem alle gemeinsam nach Wegen suchten die Folgen der Katastrophe zu bewältigen und das vielen Betroffenen ermöglichte, mit der Unterstützung des gesamten Helfer-Umfeldes die Opferrolle zu verlassen und sich als Teil einer Gemeinschaft in der Rolle des „aktiven Überlebenden“ (Figley, 1985) zu verstehen. Qualitätssicherung und Evaluation Die Versuche, eine systematische Begleitforschung zu betreiben, wurden von den Betroffenen äußerst skeptisch und meist ablehnend betrachtet. Die Betroffenen hatten ein feines Gespür dafür entwickelt, wer ihnen wirklich helfen wollte und wer ein Eigeninteresse vertrat. Die Sensibilität dafür liegt in der Tatsache begründet, dass Betroffene im Vorfeld negative Erfahrungen mit Pressevertretern gemacht hatten, die ihr Bemühen um dramatische „Stories“ über das Leid der Angehörigen häufig versteckt hatten hinter einem gespielten Engagement um deren Sorgen und Nöte. Das Projekt der Betreuung in Borken wäre fast gescheitert, als den Betroffenen klar geworden war, dass ihre Einladungen in die Universität Marburg und das stundenlange Ausfüllen vieler Fragebögen keine therapeutische, sondern eine wissenschaftlich motivierte Maßnahme war. Von den Betroffenen wurde danach eindeutig formuliert, dass sie nicht „beforscht“ werden wollen und dass sie sich vollkommen zurückziehen werden, wenn die Forschung und nicht die Betreuung im Vordergrund stehen werde. B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken Als der Autor nach Beendigung der Betreuung mit dem offenen Ansinnen auf die Betroffenen zuging, von ihnen Aussagen zu ihren Erfahrungen mit der Traumabewältigung zu erfragen, die auch anderen zukünftigen Katastrophenopfern helfen können, war die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen kein Problem mehr. Festzuhalten bleibt, dass die Betroffenen eindeutig darüber aufzuklären sind, wenn derartige Befragungen eine Forschungsmaßnahme darstellen, um Erkenntnisse für eine optimierte Betreuung bei späteren Katastrophen zu gewinnen. Es darf jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass das erste Ziel darin liegen muss, die Betroffenen therapeutisch zu betreuen und dass dieses Ziel nicht durch Begleitforschung beeinträchtigt werden darf. Presse Wie mehrfach angedeutet waren in Borken Betroffene, Angehörige und Firmenleitung von dem Ausmaß ethisch grenzwertiger und übergriffiger Aktivitäten der Presse vollkommen überrascht. Grenzüberschreitungen bis hin zu kriminellen Akten in Form von Stehlen von Bildern oder dem Versuch, Fotos von Toten zu schießen, indem man sich als Feuerwehrmann oder Pfarrer ausgibt, trafen auch potentielle Helfer, wie Ärzte, Pfarrer, Psychologen ganz und gar unvorbereitet. Betroffene fühlten sich in keiner Weise und von niemandem geschützt. Das führte zu einem ausgeprägten und lang anhaltenden Misstrauen gegenüber allen von außen dazu Gekommenen, also auch den externen Fachleuten. Auch wenn sich in der Folge von Borken ein Teil der Presse selbstkritisch mit den Grenzüberschreitungen auseinandersetzte und ethische Regeln für den Umgang mit Betroffenen von Katastrophen formulierte (s. Mathes, Gärtner & Czaplicki, 1991), muss immer wieder mit derartigen unerfreulichen Phänomenen gerechnet werden. Zusammenarbeit verschiedener Professionen Die Zusammenarbeit mit der Firmenleitung und dem Betriebsrat ermöglichte den Psychologen einen breiteren Einblick in Organisation, Struktur und Abläufe eines Bergbaubetriebes, was sich positiv auf die Arbeit mit den geretteten und den verletzten Bergleuten und mit den Grubenwehren auswirkte. Die Firmenleitung ihrerseits konnte Beratungen durch die Psychologen in eine der psychischen Situation der Betroffenen angemessene Haltung umsetzen. Zum Beispiel wollte die Firmenleitung die sechs geretteten Bergleute in ein von Borken weit entfernt liegendes Werk des gleichen Unternehmens versetzen, entschied sich aber um, nachdem der Psychologe die unzumutbare Belastung nachvollziehbar erläutert hatte, die sich durch einen Wegzug aus der Heimat ergeben hätte, angesichts der ohnehin angespannten psychischen Lage der Geretteten nach dem erlebten Trauma. Die Betroffenen revidierten in den allermeisten Fällen ihr Misstrauen oder sogar Feindbild gegenüber der Firmenleitung nach der Katastrophe durch die Erfahrung der kontinuierlichen gemeinsamen Arbeit der Firma mit allen oben erwähnten Berufsgruppen im Arbeitskreis Stolzenbachhilfe. Die Erfahrung, dass sich Sozialarbeit, Psychologie, Medizin, Pädagogik und das Unternehmen gemeinsam für die Bewältigung der Katastrophenfolgen einsetzen und 153 154 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken nicht gegeneinander konkurrieren, war eine Stütze und Kraft verleihende Ressource für die Betroffenen wie auch für die Helfer. Supervision Schon durch die Zusammenarbeit der genannten verschiedenen Professionen war in Borken eine dauernde kritische Überprüfung des eigenen Standpunktes durch die unterschiedlichen Sichtweisen gegeben. Bei vielen scheinbar nicht mehr zu lösenden Problemen ergaben sich überraschende Lösungen, wenn die Perspektive einer anderen Fachrichtung dazu kam. Darüber hinaus ist jedoch auch die individuelle Supervision entscheidend für die psychische Gesundheit der Helfer. Die intensive Arbeit mit Katastrophenopfern ist belastend, vor allem in der ersten Zeit der Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse mit den Betroffenen. Wer glaubt, die Belastungen, die auf einen als Helfer einwirken, allein tragen zu können, riskiert Sekundärtraumatisierung und gesundheitliche Folgeschäden (Gschwend, 2002). Die schweren Belastungen durch die häufige Zeugenschaft von Leid, Grausamkeit, Verletzung Tod und Zerstörung können bildlich gesprochen nur auf viele Schultern verteilt werden. Ein eindrückliches Beispiel dafür war die Erfahrung des Autors in Borken, der einen sehr erfahrenen Kollegen zur Verarbeitung seiner belastenden Erlebnisse aufsuchte und anschließend immer deutlich erleichtert nach Hause ging. Letztendlich war nur mit dieser Hilfe die kontinuierliche Kraft für die emotional belastende Arbeit im Projekt Borken aufzubringen. Jahre später hörte er von diesem Kollegen, dass dieser das Gefühl hatte, das ganze Grauen, die Toten und die Zerstörung seien auf ihn abgeladen worden und er war nunmehr allein mit der Belastung. Auch bei ihm entstanden wiederum das Bedürfnis und die Notwendigkeit, diese Last in Privatgesprächen und in einer eigenen Supervision „abzuladen“. Hier wird ein wichtiges Prinzip der Traumabewältigung mit Katastrophenopfern deutlich: Der von der Katastrophe Betroffene, will er gesund bleiben oder gesund werden, kann nicht allein mit dem Trauma leben, er muss es mit anderen Katastrophenopfern teilen, an Therapeuten und andere Helfer weitergeben. Auch diese müssen wiederum andere Menschen finden, die das Trauma mit ihnen tragen. Traumabewältigung kann nur in einer solidarischen Gemeinschaft gelingen. Wer glaubt, das entstandene Leid allein schultern zu können, droht krank zu werden und daran zu scheitern. Auch dafür gibt es in Borken sowohl bei den direkt Betroffenen, als auch bei den psychosozialen Helfern einige eindrückliche Beispiele von Menschen, die ernsthafte körperliche und psychische Erkrankungen entwickelten, weil sie als letztes Glied einer Kette es nicht geschafft hatten, die Belastungen weiterzugeben. Außergewöhnliche Psychotherapie-Erfahrungen Intensive, mehrjährige Arbeit mit Katastrophenopfern erfordert von Psychologen immer wieder ein Engagement und ein Sich-Einlassen auf Beziehungen in einer Weise, wie es in normalen Psychotherapien unüblich ist oder nicht denkbar wäre. Schon zu Beginn der Betreuung machten z. B. die Bergleute dem Psychologen klar, es gebe nur zwei Menschen in ihrem Leben, die sie siezen: den Bergwerksdirektor und B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken den Vertreter der Preussen Elektra. Die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war für sie, den Psychologen zu duzen. Ein Psychologe, der distanziert arbeitet, eine wissenschaftliche oder abgehobene Sprache spricht, auf Förmlichkeiten Wert legt, hat in dieser Welt keine Chance. Wichtig für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bergleuten war es, auch gemeinsame Aktivitäten und Rituale durchzuführen. Dazu gehörten: • mehrmaliges gemeinsames Einfahren, nicht nur als Expositionsbehandlung, sondern auch, damit die Bergleute zeigen und erklären konnten, wie die Welt unter Tage aussieht, mit anschließendem „Grubenwasser“ (Bergmannsschnaps), • Gemeinsames Grillen und Bier trinken, • Gemeinsames Feiern mit Rettern und Geretteten, ohne den Vorsatz eine psychologische Gruppenbesprechung durchzuführen. Interessanterweise ergaben sich aber gerade dabei die offensten und tiefsten Gespräche. • Essen gehen mit den Witwen- und Elterngruppen, • Ausflüge mit allen Betroffenen, • Gemeinsames Kaffeetrinken mit allen Betroffenen. Diese im Rahmen einer Therapie außergewöhnlichen Aktivitäten führten zu einem vertieften Verständnis der Gesamtsituation der Betroffenen, stärkten die therapeutische Beziehung und waren für viele Betroffene die Voraussetzung, sich in der Therapie zu öffnen. Zu DRK-Nachmittage Es gab eine Reihe von Ritualen mit beeindruckender Wirkung in Borken, die von NichtPsychologischen Helfern durchgeführt wurden, die auch nicht zum normalen Interventionsrepertoire eines Psychologen gehören und bei allen Teilnehmern sehr gut ankamen. Auf den oben erwähnten Kaffee-Nachmittagen des DRK eröffnete der Leiter des Ortsverbandes mit einigen einladenden Worten und forderte dann alle Teilnehmer auf, sich gemeinsam an den Händen zu fassen und sich Kraft für die anstehenden Aufgaben und eine gute Zeit zu wünschen. Anwesend waren die Betroffenen, die Helfer des Arbeitskreises Stolzenbachhilfe, Vertreter des Unternehmens, des Roten Kreuzes, der Gemeinde und Gäste. Das Ritual wurde von vielen geschildert, als laufe eine „Energiewelle“ durch die Reihen, die bei vielen Teilnehmern zu einem Gefühl der Ergriffenheit und zu Tränen führte, aber auch zu der für viele spürbaren Gewissheit, die Bewältigung der Katastrophe gemeinsam anzugehen und zu schaffen. Zu Gedenkstätte und Jahresgedenken Wie oben bereits erwähnt wurden zu den Jahrestagen jeweils besondere Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Jahrestage stellten für die Betroffenen der Katastrophe von Borken immer eine besondere Belastung dar. Schon Wochen vorher entwickelten viele Betroffene eine Verstärkung ihrer Traumasymptomatik oder zeigten erneut Symptome, die sie bereits aufgegeben hatten. Sie erlebten die Tage vor dem Jahresdatum mit einem in die Vergangenheit gerichteten Bewusstsein und „fieberten“ auf das Ereignis hin. Nicht wenige versuchten Auswege zu finden, dem Druck zu entfliehen, indem sie sich in ihre Wohnungen zurückzogen, oder verreisten. Häufige Rückmeldung der Be- 155 156 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken troffenen war, man brauche keinen Gedenktag, sie dächten sowieso jeden Tag an das Ereignis, sie fürchteten den Rummel und die Presse. Bei dem Gedanken nichts zu tun, den Jahrestag einfach verstreichen zu lassen wie einen ganz normalen Tag, wurde den meisten jedoch klar, dass sie sich dabei noch schlechter fühlen würden und sie Angst hätten, man könne die Toten und sie selber vergessen. An der Frage der Notwendigkeit und der Art der Planung einer Gedenkfeier wird die ganze Ambivalenz der Traumabewältigung nach Katastrophen deutlich. Die Betroffenen schaffen es kaum, aus eigener Kraft einen solchen Tag aktiv anzugehen und ihn zu gestalten, aber ihm aus dem Weg zu gehen oder ihn zu verleugnen, geht noch weniger. In gemeinsamen auswertenden Gesprächen mit den Betroffenen betonten diese, dass die aktive Gestaltung eines Jahrestages, sei es durch Entzünden von Kerzen in der Kirche für jeden Verstorbenen, sei es durch ein verweilendes Gedenken am Unglücksort zur selben Stunde, in der das Unglück vor x Jahren geschah, einen Meilenstein in der Katastrophenbewältigung darstellte. Sie äußerten vor allem nach den ersten zwei bis drei Gedenktagen, so schwer es auch war, jedes Mal ein Stück der Belastung hinter sich gelassen und sich weiter entwickelt zu haben. Auch die Gedenkstätte selbst (Beschreibung siehe oben) bedeutete bis heute für viele Betroffene eine wichtige Stelle des ruhigen Gedenkens nicht nur an den eigenen Verstorbenen, sondern auch an die vielen anderen Freunde und Bekannten. Ein großer Teil der Betroffenen berichtete davon, öfters die innere Auseinandersetzung mit diesem zwiespältige Gefühle auslösenden Ort gesucht zu haben, wenn sie sich beunruhigt und belastet fühlten. Nach einem längeren Verweilen an der Gedenkstätte, mit der Erinnerung an das Unglück und die dabei umgekommenen Menschen, mit Trauern und Gedenken, sei die innere Ruhe wieder zurückgekehrt und sie seien befreit und klarer wieder in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie selber bezeichneten den Gang zur Gedenkstätte als eine immer wieder einsetzbare Strategie zur Traumabewältigung. 1.4.3 Konsequenzen für die Praxis Betroffene statt Patienten Mit der Wortwahl „Betroffene“ konnten sich die in Borken Betreuten besser identifizieren als mit Begriffen wie „Patienten“, „Klienten“, „Ratsuchende“ usw. Der Ausdruck „Betroffene“ macht deutlich, dass sich jeder normale Mensch, der von einer Katastrophe betroffen ist, in einer besonderen Position befindet, in der er auf Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen ist, ohne psychisch krank zu sein. In ihm steckt auch die Erkenntnis, dass Betroffene unter sich eine Gemeinschaft darstellen, die sich gegenseitig versteht, unterstützt und weiterhelfen kann. Als Betroffener kann man sowohl Hilfe benötigen, als auch Experte für die Bedürfnisse der anderen Betroffenen sein. Auf Betroffene zugehen Die normale und übliche Reaktion von Betroffenen ist es, sich zurückzuziehen von der Außenwelt und allein oder im engsten Familienkreis zu versuchen, mit dem Unfassbaren zurechtzukommen. Durch diese Haltung treten schnell Gefühle der Vereinsamung B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken auf. Häufig ziehen Betroffene dann bei kurzen Begegnungen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel beim Einkaufen, bedingt durch unsensible oder unbedachte Äußerungen von Bekannten, den Schluss, niemand verstehe ihre besondere Lage. Dieses führt zu weiterem Rückzugs- und Vermeidungsverhalten, zu Verstärkerverlust und einer Verschärfung der posttraumatischen Symptomatik. Man kann in diesem Zusammenhang in Analogie zum Teufelskreis bei Angstanfällen (Margraf & Schneider, 1990) von einem „Teufelskreis bei Psychotraumata“ sprechen. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, schaffen viele Betroffene nicht aus eigener Kraft. Daher ist es wichtig, auf Betroffene mit konkreten Hilfsangeboten zuzugehen (Beratung, Betreuung, praktische Hilfen, Psychotherapie). Zeitpunkt der Interventionen Therapeutische Interventionen sollten nicht zu früh erfolgen. Die meisten Betroffenen sind in den ersten Wochen beziehungsweise ca. drei bis vier Monaten noch nicht offen dafür. Sie benötigen eine Zeit der Erholung, Beruhigung und Stabilisierung. Und sie brauchen Zeit, um überhaupt kognitiv nachvollziehen zu können, was passiert ist. Therapeutische Angebote, die in dieser Zeit gemacht werden, werden nicht nur abgelehnt, sondern führen häufig sogar dazu, dass Betroffene sich auch in Zukunft einer professionellen Hilfe verschließen. Stattdessen ist es wichtig, dass professionelle Helfer von Anfang an präsent sind im Sinne notfalltherapeutischer Basisunterstützungen (siehe z. B. Dick & Dick-Ramsauer, 1996; Gschwend, 2002), und ihnen praktische Hilfen zu gewähren, zum Beispiel durch Sozialarbeiter beim Regeln von Formalitäten bei Beerdigungen, Umgang mit Behörden, etc. Helfer sollen darauf hinweisen, dass sie für die Betroffenen bei Bedarf zu Verfügung stehen und dass es später konkrete therapeutische Angebote zur Bewältigung des Geschehenen geben wird. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist das oben schon erwähnte Informationsverarbeitungsmodell von Horowitz mit den fünf aufeinander folgenden Phasen, erstens Betäubung, zweitens Vermeidung, drittens schwankende Periode, viertens Übergang und fünftens Integration. Notfalltherapeutische, stabilisierende Interventionen sind sinnvoll während der Phasen eins und zwei bis Phase drei, therapeutisch bearbeitende jedoch erst ab Phase drei bis vier. Betroffene brauchen Zeit, wieder zu sich selber zu finden nach einer traumatischen Erfahrung und Zeit für die „vollständige Informationsverarbeitung“ von in der Regel einem Jahr (Horowitz, 1976). Ziele der Betreuung Oberstes Ziel der Betreuung ist die psychologische Begleitung der Betroffenen auf dem Weg der Verarbeitung der Folgen der Katastrophe für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Durch die Hilfsangebote sollen die Betroffenen nicht zu psychisch kranken Menschen abgestempelt werden, die eine umfassende Psychotherapie benötigen, sondern es ist das Ziel der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass die Betroffenen ihr Funktionslevel, das sie vor dem Trauma hatten, wieder erlangen können. Die traumatische Erfahrung soll integriert und die betroffene Person vom passiven Opfer zum aktiv Handelnden werden, der die Folgen der Katastrophe in sei- 157 158 B: Felderfahrungen — Das Grubenunglück von Borken nem Leben bewältigt. Ziel ist es, aus der Vereinsamung und dem Rückzug herauszukommen und ein in der Gesellschaft lebensfähiges und integriertes Individuum zu werden, das die Tatsache nicht verbergen muss, Betroffener einer Katastrophe geworden zu sein. Ein weiteres Ziel ist die konkrete Bearbeitung komorbider Störungen nach dem Trauma wie Depressionen, Angststörungen, Somatisierungsstörungen und ähnlichen (s. Maercker, 2003a, 2003b). Diese Ziele wurden in der Arbeit in Borken gemeinsam mit den Betroffenen als die wichtigsten herausgearbeitet. Pressearbeit Aus den oben geschilderten Problemen mit der Presse ergibt sich eine wichtige Aufgabe für Notfallpsychologen: sie sollten sich gut vorbereiten auf derartige Situationen, einen erfahrenen Verantwortlichen für die Presse abstellen, die Betroffenen davor warnen, sich in der Akutsituation auf Pressevertreter einzulassen und unter Umständen auch direkt schützend eingreifen, wenn sie sehen, dass Betroffene von der Presse bedrängt werden. Für spätere Abschnitte der Betreuung sollte ebenfalls ein mit Medien erfahrener Helfer für die Kontakte mit der Presse abgestellt werden. In dieser Zeit kann es durchaus sinnvoll sein, sich auf die Zusammenarbeit mit seriös arbeitenden Journalisten und Filmemachern einzulassen und dafür auch die Mitarbeit von Betroffenen zu gewinnen. Multiprofessionelle Traumabewältigung Eine wichtige Erkenntnis in Borken war, dass eine solch schwere Katastrophe nur durch die Zusammenarbeit von Fachleuten aus unterschiedlichen Professionen möglich ist. Günstig erscheint eine Zusammensetzung aus: Firmenleitung, Betriebsrat, Sozialarbeiter, Psychologen, Mediziner, Pfarrer, Lehrer, Vertreter der Gemeinde. In der Betreuung ergeben sich immer wieder problematische Situationen, in denen das Fachwissen bestimmter Gebiete gefragt war, um die Situation zu lösen. Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass es nicht eine leitende Fachrichtung geben muss, sondern dass alle gleichberechtigt an der Lösung der gemeinschaftlichen Aufgabe arbeiten, der Bewältigung der Katastrophenfolgen. Dieses war in Borken im Arbeitskreis Stolzenbachhilfe verwirklicht (s. Kapitel 1.2.1). Nur eine multiprofessionelle Traumabewältigung kann der komplexen Problem- und Bedürfnislage der Betroffenen nach einer Katastrophe gerecht werden. 2. Das ICE-Unglück von Eschede (1998) 2.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds Im Folgenden soll zunächst der Unglücksvorgang näher ausgeführt werden (s. Abbildung B 2.1), wobei sich die Darstellung auf Hüls (1999) auf Berichte aus der „Zeit“ und dem „Spiegel“ und auf interne, unveröffentlichte Berichte der Deutschen Bahn AG bezieht. Abbildung B2.1: Beschreibung des Ereignisses Am 3. Juni 1998, um 10.59 Uhr, verunglückte der ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ in Eschede bei Celle. Bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h entgleiste der Zug an einer Weiche aufgrund eines Radreifenbruchs. Durch den dritten sich querstellenden Reisewagen wurden die Pfeiler der ca. 300 m hinter der Weiche befindlichen Straßenbrücke weggerissen und diese dadurch zum Einsturz gebracht. Der vordere Triebkopf wurde dabei vom restlichen Zug abgetrennt und kam ca. zwei Kilometer hinter dem Bahnhof Eschede unbeschädigt zum Stehen. Die ersten drei Wagen entgleisten und kamen etwa 350 m hinter der Brücke zu Stehen, Wagen vier rutschte quer zu Gleisbett in den angrenzenden Wald, die hintere Hälfte des Wagens fünf wurde durch herabstürzende Brückenteile begraben, der vordere Teil riss ab und kam ca. 100 m hinter der Brücke zum Stehen. Wagen sechs stellte sich quer vor die zusammenstürzende Brücke, die sechs restlichen Wagen wurden durch den hinteren Triebkopf gleich einem Zollstock zusammengedrückt und zum Teil über die Betontrümmer hinweg katapultiert (nach Hüls, 1999). Das Ereignis vollzog sich in dreieinhalb Sekunden. Es kamen 101 Personen ums Leben und 108 wurden zum Teil schwer verletzt. Den zahlreichen Einsatzkräften vor Ort bot sich ein Bild des Grauens: Tote, verstümmelte Leichen, Leichenteile, Schwerstverletzte, leichter Verletzte, Menschen in Panik, Orientierungslose, Anwohner unter Schock, Presse- und Medienvertreter und neugierige Unbeteiligte. Die Belastungen für die nach der Katastrophe eingesetzten zahlreichen Helferinnen und Helfer, wie das Bergen von toten Kindern, völlig verstümmelten Leichen und Leichenteilen machten eine breite psychologische Unterstützung der Einsatzkräfte nach Einsatzende notwendig (Helmerichs, 1999). 160 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede 2.1.1 Beschreibung des Umfelds Unmittelbar zuständig für den Rettungsdienst war eine Rettungsdienstgemeinschaft des Roten Kreuzes und eines freien Anbieters im Landkreis Celle. Von diesem Rettungsdienst ging die Organisation der Rettungsmaßnahmen aus, bei denen dann viele unterschiedliche Rettungsdienste mit insgesamt über 1 800 Helferinnen und Helfer im Einsatz waren. An dieser Stelle soll es aber nicht um die Belastungsverarbeitung der Einsatzkräfte gehen (siehe dazu Koordinierungsstelle Einsatznachsorge, 2002), sondern um die Verletzten, die im Zug gesessen hatten, bzw. die Angehörigen der 101 bei dem Unglück umgekommenen Fahrgäste. Anders als bei einer regionalen Katastrophe wie in Borken, kamen beim ICE-Unglück in Eschede die Betroffenen aus dem gesamten Bundesgebiet, mit verschiedensten beruflichen und privaten Hintergründen und unterschiedlichster sozialer Herkunft. Vom Ausgangspunkt her waren die Bedingungen für die Betreuung der Verletzten und Angehörigen wegen der Heterogenität der Gruppen und der weit auseinander liegenden Wohnorte also wesentlich schwieriger. 2.1.2 Traumatische Stressoren und typische Reaktionen Für die Verletzten lagen die traumatischen Stressoren unmittelbar im Unfall und im Erleben der eigenen Todesgefahr. In der Sprachregelung der Eschede Nachbetreuung der Deutschen Bahn AG wurden alle Personen, die im Zug gesessen hatten und das Unglück überlebt hatten, als „Verletzte“ bezeichnet, auch wenn sie keine körperliche Verletzung davon getragen hatten. Diese Regelung war für Entschädigungszahlungen von großer Bedeutung, soll jedoch für die vorliegende Arbeit nicht übernommen werden. Verletzte im Sinne der vorliegenden Arbeit sind Personen die im verunglückten Zug gesessen haben und eindeutige körperliche Schäden davon getragen haben. Die Erlebnisse und Erinnerungen der Beteiligten waren sehr unterschiedlicher Natur. Manche hatten beim Entgleisen des Zuges in unterschiedlicher Form wahrgenommen, dass es auffällige Geräusche gab und waren dann durch den Aufprall des Zuges entweder im Abteil durch die Luft oder sogar aus dem Abteil hinausgeschleudert worden. Es gab sowohl schwer verletzte Personen, die bewusstlos waren und von ihrer Rettung und Erstversorgung nichts mitbekamen, als auch solche, die gar nicht oder wenig körperlich verletzt waren und viele traumatische Eindrücke von anderen Verletzten und Toten aufnehmen mussten. Die meisten der im Zug gesessenen Personen zeigten unmittelbar nach der erlebten Katastrophe kurzfristig Schockreaktionen, die von leicht bis schwer und sogar lebensbedrohlich reichten (s. Dick & Dick-Ramsauer, 1996), im Sinne des ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation, 1993) akute Belastungsreaktionen mit Zittern, Weinen, Schreien, Angst, Verzweiflung, „Betäubung“ und Depression. Typische Reaktionen vieler Verletzter waren Dissoziierungen des Unfallgeschehens und der unmittelbaren Zeit danach. Es gab Teilamnesien und komplette Amnesien des gesamten Geschehens. In Extremfällen blieb lange Zeit unklar, ob die betreffende Person wirklich im Zug gesessen hatte, wenn zum Beispiel sich jemand drei Tage nach dem Ereignis im mehrere hundert Kilometer vom Unfallort entfernt gelegenen Frankfurt B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede bei der Deutschen Bahn meldete und angab, er sei ein Opfer der Eschede Katastrophe und wisse nicht, wie er vom Unfallort in diese Stadt gekommen sei. Verletzte waren natürlich in erster Linie mit ihren körperlichen Schäden befasst, litten mittel- und langfristig unter quälenden Intrusionen und zeigten darüber hinaus häufig die gesamte Symptomatik posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) oder Teilen davon. Bei vielen Verletzten waren komorbide Depressionen zu verzeichnen. Die Angehörigen der bei dem Unglück Umgekommenen waren in der Regel weit weg vom Unfallgeschehen, wurden aber durch die intensive Fernsehberichterstattung über das Ereignis hautnah informiert. Viele Angehörige hatten, nachdem sie von der Katastrophe z. B. durch eine Radiomeldung oder durch einen Anruf erfahren hatten, den Fernseher eingeschaltet und wie gebannt stundenlang die Übertragungen von der Unfallstelle verfolgt. Dabei waren sie häufig in einer vollkommenen Ungewissheit, ob ihr Familienmitglied sich bei den Verletzten oder den Toten befand, oder ob er überhaupt im Zug gesessen hatte, bis sie dann über die Hotline der Deutschen Bahn AG die schreckliche Gewissheit erfuhren, dass er oder sie umgekommen war. In mehreren Fällen waren die Verwandten unter den Schwer- bzw. Schwerstverletzten und verstarben erst nach einigen Tagen. Die Reaktionen bei vielen Angehörigen waren zunächst intensive Phasen der Betäubung, des Schocks und des nicht wahrhaben Wollens. Tiefe Verzweiflung und Trauer schlossen sich an, sowie langfristig ein vorher nicht erwartetes Ausmaß an posttraumatischer Belastungssymptomatik. Diese Aufteilung in zwei Gruppen, zum einen die Verletzten, die am Unfallgeschehen direkt beteiligten, und zum anderen die Angehörigen dieser Verletzten, die nicht am Geschehen selbst teilhatten, ist im Hinblick auf die im Folgenden beschriebenen Interventionen wichtig. Im Folgenden sollen die Interventionen dargestellt werden, die mit den beiden Gruppen der Verletzten und Angehörigen durchgeführt wurden. 2.2 Interventionen und deren Implementierung 2.2.1 Systemebene Für die Opfer und deren Angehörige wurde mit der Benennung eines Ombudsmannes, dem Vizepräsidenten des Bundessozialgerichts a. D., ein neutraler Ansprechpartner und Berater zur Verfügung gestellt. Damit wurde erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik ein Treuhänder „für die ordnungsgemäße Abwicklung der Folgen eines Unfalls, der in die Sphäre eines Unternehmens fällt, unter Wahrung der Interessen der Beteiligten tätig“ (DB-AG, Geschäftsstelle „Eschede-Hilfe“, 1999). Zur Strukturierung der psychologisch-sozialen Betreuung und Koordinierung der juristischen Betreuung wurde die „Geschäftsstelle Eschede-Hilfe“ gegründet. Deren Ziel war eine Betreuung „unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Traumaforschung und unter Einbezug der Erfahrungen früherer, vom Umfang her vergleichbarer Unglücksfälle (z. B. Borken)“ (DB-AG, Geschäftsstelle „Eschede-Hilfe“, 1999). Dazu 161 162 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede wurde sie beraten vom Autor, der die wichtigsten Erkenntnisse der Betreuungsarbeit des Grubenunglücks von Borken vermittelte. Die Aufgaben des Ombudsmanns bestanden neben der Funktion als Ansprechpartner, Vermittler und gegebenenfalls Mediator für die Betroffenen, im Aufbau der psychologischen Behandlung und der psychosozialen Nachbetreuung der Opfer. Dafür wurden ihm von der Deutschen Bahn AG finanzielle Mittel von zunächst fünf Millionen DM zur Verfügung gestellt. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch das Deutsche Institut für Psychotraumatologie (DIPT) der Universität Köln. In Zusammenarbeit mit dem DIPT knüpfte der Psychologische Dienst der DB-AG ein Netzwerk niedergelassener Therapeuten, die Erfahrungen in der Behandlung von posttraumatischen Stresserkrankungen aufweisen konnten. Die Betroffenen sollten durch die Mitarbeiter des DIPT angeschrieben und danach auf deren Traumabelastung untersucht werden, um dann eventuell bei den niedergelassenen Therapeuten behandelt zu werden. Der Auftrag an das DIPT umfasste also die Erstellung der Diagnostik und die Vermittlung von Therapien. Regional konzentriert wurden den Verletzten und Angehörigen psychologisch geleitete Gruppen zur Aufarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse und ihrer Verlusterfahrung angeboten. Zur Bearbeitung der zum Teil dramatischen Folgen für viele Familien, die das Unglück nach sich gezogen hatte, wurden Sozialarbeiter eingesetzt, die den Betroffenen in Hausbesuchen Unterstützung in lebenspraktischen Angelegenheiten gaben. Die gesamte psychologische Betreuung war auf zwei bis drei Jahre angelegt. In einen eigens eingerichteten Hilfsfond wurden Spenden der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Niedersachsen und des Freistaats Bayern sowie zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung eingezahlt. Die Spenden wurden eingesetzt, „um die nicht wenigen Notstände auszugleichen, die durch normale Entschädigungsregelungen nicht abgedeckt werden und dienten nicht der Tilgung von Schadensersatzansprüchen der Betroffenen. Als keine Notfälle mehr zu erwarten waren, wurde der Restbetrag auf alle Verletzten und auf die Angehörigen der Todesopfer pro Todesfall verteilt“ (Abschlussbericht des Ombudsmannes, Deutsche Bahn AG, 2001). 2.2.2 Gruppenebene Sechs Monate nach der Katastrophe begannen die Gruppenangebote für die Angehörigen, die bei dem Unglück ein Familienmitglied verloren hatten. Es wurde dabei nicht unterschieden, ob es sich um den Verlust des Partners, eines der Kinder oder eines Geschwisterteils handelte. Allen engen Angehörigen eines Verstorbenen wurde das Angebot gemacht, an einer Gruppe in relativer Nähe zum Wohnort teilzunehmen. Die Bezahlung der Gruppenleiter und die Fahrtkosten der Betroffenen zum Ort der Gruppe wurden von der Deutschen Bahn AG übernommen. Die Teilnahme der Angehörigen an den Angeboten für betreute Gruppen war rege, viele von ihnen hatten sie sogar beim Ombudsmann eingefordert. Kurze Zeit später wurden auch allen Verletzten diese Angebote unterbreitet. Im Gegensatz zu den Angehörigen war es bei den Verletzten jedoch wesentlich schwieriger die geplanten Veranstaltungen durchzuführen. Die Motivation zur Aufarbeitung der B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede psychischen Folgen des Unglücks in einer psychologisch geleiteten Gruppe schien bei vielen Verletzten nicht so hoch, beziehungsweise ein großer Teil von ihnen war so mit dem Heilungsprozess der körperlichen Schäden beschäftigt, dass verglichen mit den Angehörigen relativ wenige die angebotenen Gruppen besuchten. Es erfolgte eine getrennte Betreuung der Angehörigen und Verletzten, weil die Erfahrungen in Borken gezeigt hatten, dass die Verarbeitungsprozesse sich in beiden Gruppen deutlich unterschieden. Während bei den Verletzten in erster Linie die traumatischen Erlebnissen und die daraus entstandenen Intrusionen sowie die Folgen ihrer körperlichen Schäden auf ihr weiteres Leben zentrale Themen sind, steht bei den Angehörigen hauptsächlich die Verarbeitung einer Verlusterfahrung und die Begleitung im Trauerprozess im Vordergrund. Daneben quälen viele Angehörige Erinnerungen an traumatische Erlebnisse, zum Beispiel die Identifikation der Leiche und die Tatsache der unwürdigen Umstände, unter denen ihr Verwandter zu Tode gekommen ist. Behandelt man beide Gruppen gemeinsam, ergeben sich leicht Konkurrenzen und Gefühle, nicht verstanden zu werden. So fühlen sich Angehörige nicht im ganzen Ausmaß des durch den Verlust entstandenen Leids verstanden, bzw. Verletzte empfinden die tiefe Dimension ihrer Verletzung nicht ausreichend gewürdigt, wenn von den Angehörigen der „glückliche“ Umstand ihres Überlebens betont wird. Über das gesamte Bundesgebiet verstreut kamen 16 Gruppen für Angehörige und Verletzte mit jeweils sechs bis acht Teilnehmern, das heißt also mit insgesamt 96 bis 128 Teilnehmern zustande. Eine genaue Aufteilung in Angehörige und Verletzte ist aus dem Abschlussbericht des Ombudsmanns nicht zu entnehmen. Angehörigengruppe Kassel Im Folgenden soll beispielhaft für die Gruppeninterventionen eine vom Autor mit einer Kollegin in Kassel durchgeführte Angehörigengruppe näher betrachtet werden. In der Gruppe befanden sich neun Teilnehmer, von denen bei dem Unglück fünf ihre Kinder, eine ihren Ehemann, eine die Mutter und zwei das Enkelkind verloren hatten. Es fanden im ersten Jahr 15 Sitzungen à 1,5 bis 2 Stunden, im zweiten Jahr 9 Sitzungen à 2,5 Stunden, im dritten Jahr 6 Sitzungen à 3 Stunden statt. Die Hauptthemen der Gruppen waren: • Die Erlebnisse am Unglückstag und die Tage danach, • Die Erlebnisse bei der Identifikation der Toten, der Verabschiedung und der Beerdigung, • Vorstellen des Verstorbenen in der Gruppe anhand von Fotos, • Umgang mit Gepäck- und Kleidungsstücken der Getöteten, an denen zum Teil noch Blut klebte, die sie von den Angehörigen der Deutschen Bahn AG bekamen, • Vermittlung der verschiedenen Phasen und Kennzeichen des Trauerprozesses, • Umgang mit der eigenen Trauer und „Normalitäts-Anspruch“ der Umwelt, • Alltagsbewältigung, • Verhalten und Schuldfrage der Deutschen Bahn AG, • Umgang mit dem Jahrestag und dem Denkmal, • Frühere Verlusterfahrungen der Gruppenmitglieder, • Persönliche Haltungen und Vorstellungen zum „Leben nach dem Tod“ und zum eigenen Tod. 163 164 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Als verhaltenstherapeutische Interventionen wurden eingesetzt: • Identifikation und Umgang mit Auslösereizen, die an das Unglück und den Verlust erinnern, • Angstkonfrontationsübung durch Auseinandersetzung mit dem Unglück anhand von Videomaterial, • Erarbeitung hilfreicher Coping-Strategien, • Erkennen und Bearbeiten von Vermeidungsstrategien, • Informationen zum Umgang mit wiederkehrenden Ängsten und Depressionen, • Analyse der Wirkung und Erlernen erfolgreicher Strategien zur Verarbeitung weiterer aktueller Unglücke und Katastrophen, • Planung, Vorbereitung und Durchführung einer gemeinsamen Fahrt mit einem ICE nach Eschede als Angstkonfrontationsübung, • Imaginations- und Entspannungsübungen. Die Gruppenstunden begannen immer mit einer Momentaufnahme des aktuellen Befindens jedes Teilnehmers und dem Besprechen besonderer Ereignisse seit der letzten Sitzung. Anschließend wurde eins der oben genannten Themen näher erörtert, wobei die Gespräche durch die Gruppenleiter nach dem ausführlichen Beleuchten von Problemsituationen psychologisch immer in die Richtung der Bewältigung der Themen geleitet wurden. In diesem Punkt unterscheiden sich die begleiteten Gruppen am deutlichsten von reinen Selbsthilfegruppen von Katastrophenopfern, die häufig beim Besprechen des entstandenen Leids und Unglücks stehen bleiben und sich im Kreise drehen (s. Kapitel A 2). Abgeschlossen wurde jede Gruppenstunde mit einer Imaginations- und Entspannungsübung, in der die Distanzierung von belastenden Themen, das Besinnen auf innere Stärken und das Erwecken von Ressourcen geübt wurden. Typische von den Betroffenen eingebrachte Probleme in den ersten Wochen und Monaten waren: • Schlaflosigkeit, • Erschöpfungszustände, • Depressive Grundstimmung, • Schuldgefühle, • Sinnlosigkeit des eigenen Lebens, • Konzentrationsprobleme und Orientierungslosigkeit, • Abschied vom Verstorbenen, • Neid und Eifersucht auf andere, die ihre Angehörigen (besonders die Kinder) noch haben, • Verhaltensunsicherheiten gegenüber der Deutschen Bahn AG. Von den Gruppenleitern der Gruppe in der Anfangszeit gestellte Fragen nach einer Kennenlern-Phase und nach dem Bericht über die Entwicklung der AngehörigenGruppen in Borken waren: • Wie haben Sie den Unglückstag erlebt? • Wann und wie haben Sie erfahren, dass Sie einen Angehörigen verloren haben? • Wie ging es Ihnen in der Zeit nach dem Unglück gesundheitlich? • Welche neuen Probleme haben sich bei Ihnen ergeben, seit dem Verlust Ihres Angehörigen? • Wie werden Sie mit dem bald kommenden Weihnachtsfest umgehen? B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede In der weiteren Entwicklung standen die Beziehungsklärung zum Verstorbenen und der Umgang mit der Trauer im Vordergrund. Diese Phase wurde mehr und mehr begleitet von Themen, die die Bewältigung der Belastungen zum Ziel hatten. Besonders wichtig waren dabei psychoedukative Interventionen wie Informationen über Traumata und Wissensvermittlung zum Ablauf von Trauerprozessen, Entstehung und Aufrechterhalten von Ängsten, Wirkung von und Umgang mit Vermeidungsverhalten. Im letzten Jahr der Gruppenbetreuung standen konfrontative Übungen zur Angstbewältigung, wie die Fahrt mit einem ICE nach Eschede und Expositionsbehandlungen mit Filmen über das Unfallgeschehen in Eschede im Vordergrund, um extrem starke körperliche und emotionale Reaktionen auf den ICE, die Unfallstelle und auf Unfallberichte in Presse, Funk und Fernsehen zu normalisieren. Diese beiden Expositionsbehandlungen sollen im Folgenden noch ausführlicher dargestellt werden. Expositionsbehandlung mit Filmmaterial vom Unglück Begründung der Intervention. Viele Betroffene klagten immer wieder darüber, dass sie sich starken emotionalen und körperlichen Reaktionen, die sie nicht kontrollieren können, ausgesetzt sehen, wenn sie unerwartet im Fernsehen mit einem Filmbericht des Eschede Unglücks konfrontiert werden. Wie schon aus Behandlungen der Betroffenen aus Borken bekannt war, ist die prolongierte Konfrontation mit Videomaterial des Unglücks und das damit verbundene Habituationserleben gut geeignet, um starke Reaktionen von Betroffenen auf Filmberichte zu normalisieren. Durchführung. Unabdingbare Voraussetzung für eine derartige Konfrontation in der Gruppe ist eine genaue Vorbereitung, in der den Betroffenen die Entwicklung der Angstkurve bei Konfrontation mit Angst auslösenden Stimuli erläutert wird. Sie müssen das Therapierational der konfrontativen Angstbehandlung verstehen und einer solchen Behandlung zustimmen. Es darf kein Gruppenzwang zur Teilnahme bestehen und die Bedenken oder Zweifel jedes Gruppenmitglieds müssen glaubhaft ausgeräumt sein. Der Filmausschnitt, auf dem der Tagesschausprecher über das Unglück informierte und anschließend ein Reporter aktuell von der Unglückstelle berichtete wurde der Gruppe vorgeführt. Anschließend stufte jedes Gruppenmitglied für sich auf einer Skala von 0 bis 10 ein, wie belastend das Anschauen war. Dann wurde der Film zurückgespult und der gleiche Ausschnitt wurde erneut vorgeführt und eingestuft. Es folgten so viele Durchgänge, bis bei allen Teilnehmern eine deutliche Reduktion der Belastung zu verzeichnen war. Den Betroffenen wurde als Hausaufgabe erteilt, sich selber weiter zuhause zu konfrontieren und die Entwicklung der Habituation aufzuzeichnen. Ergebnis. In einer anschließenden Auswertung hatten die Teilnehmer Gelegenheit, ihre Gefühle während der Exposition zu beschreiben und miteinander zu teilen. Übereinstimmend wurde von allen konstatiert, dass mit zunehmender Anzahl von Durchgängen eine distanziertere Betrachtung des Videos möglich war und die heftigen anfänglichen körperlichen und emotionalen Reaktionen sich beruhigten. Als längerfristige Wirkung beschrieben die Gruppenteilnehmer, dass sie sich nicht mehr so heftigen emotionalen und körperlichen Reaktionen ausgesetzt sahen, wenn 165 166 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede sie unvorbereitet im Fernsehen mit Berichten über das Unglück in Eschede oder andere Unglücke konfrontiert wurden. Expositionsbehandlung: Fahrt mit den Betroffenen im ICE nach Eschede Begründung der Intervention. Für die meisten Teilnehmer der Gruppe war schon der Anblick eines ICE Auslöser für belastende körperliche und heftige emotionale Reaktionen. Einen ICE-Bahnhof zu betreten, oder gar in einem ICE zu fahren, stand außerhalb des Vorstellungsvermögens. Außerdem bestand ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten bezüglich der Unfallstelle in Eschede und bestimmten Städten, wie zum Beispiel Hamburg, dem Zielort des verunglückten Zuges. Die meisten Gruppenteilnehmer waren in ihrem Verhaltensspielraum deutlich eingeschränkt, da sie nicht mit einem Zug fahren konnten und durch die Konfrontation mit einem ICE oder einem Bahnhof emotional belastet waren. Besonders der Unfallort Eschede war für die Betroffenen eng assoziiert mit Gefühlen der Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes über sich selbst. Der Unfallort war für viele Betroffene eine Art magischer Ort des Grauens, den man versucht auszublenden, da man sich sicher glaubt, dort nicht bestehen zu können. Genauer nach ihren Phantasien befragt, was dort passieren könne, äußerten Betroffene, sie befürchten dort „zusammen zu brechen“, „durchzudrehen“, „einen Herzanfall zu bekommen“, die Belastung nicht aushalten zu können. Wird das Vermeidungsverhalten bezüglich der Unfallstelle aufrechterhalten, droht jedoch eine Generalisierung der Ängste mit weiterer Verhaltenseinschränkung. Durch eine Exposition an der Unfallstelle können die Betroffenen lernen zu unterscheiden, dass der Unfallort zwar ein trauriger und belastender Ort der Erinnerung ist, an dem etwas schlimmes passiert ist und sie einen lieben Menschen verloren haben, aber kein Ort, der per se für sie eine Gefahr darstellt. Durchführung. Da die Gruppenteilnehmer gelernt hatten, dass diese Auslöser in der Zukunft immer wieder der Grund für intensive Stress- und Belastungsreaktionen sein würden, die Vermeidung der Unfallstelle weiteres Vermeidungsverhalten nach sich ziehen kann und sie das konfrontative Therapierational nachvollzogen hatten und dahinter standen, stimmten sie der geplanten Maßnahme einer Fahrt mit dem ICE zur Unglückstelle Eschede zu. Da die Exposition an der Unfallstelle eine psychische und körperliche Belastungssituation darstellt, gab es folgende Kontraindikationen für eine Teilnahme: • Personen, die an der Richtigkeit des Therapierationals zweifeln, • Personen, die sich in einer psychisch sehr instabilen Situation befinden, • Personen, die körperlich nicht belastbar sind. Aus diesen Gründen konnte zum Beispiel eine Hochschwangere nicht teilnehmen. Obwohl es sich um eine Gruppenfahrt handelte, wurde für jede Person ausgehend von deren Vorgeschichte ein individueller Plan für die Konfrontation entwickelt. So war es zum Beispiel für eine Teilnehmerin wichtig, erst mit Begleitung eines Therapeuten den Schritt auf den ICE-Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe zu schaffen, bevor die anderen Gruppenmitglieder sich trafen. Sie hatte am Unglückstag ihre Tochter, die beim Unglück starb, dort in den ICE gebracht und hatte den Ort seitdem nie wieder betreten. Für eine andere Teilnehmerin musste ein ganz bestimmter Platz und der daneben liegende reserviert werden, da ihre Mutter auf dem Platz mit dieser Nummer gesessen B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede hatte, als sie verunglückte. Für eine weitere Teilnehmerin war die Planung des Aufenthaltes in der Zielstadt des ICE in Hamburg von ausschlaggebendem Interesse, da ihr verunglückter Mann dort am Unglückstag geschäftlich tätig sein wollte und sie diese Stadt mit panischer Angst vermied. Es wurde unterschieden in der Planung der Exposition an der Unfallstelle, die zuerst erfolgte und dem Ausführen von Trauerritualen. Wichtig ist es, zunächst die aufwühlenden Gefühle und Körperreaktionen an dem Ort, an dem der jeweils geliebte Mensch zu Tode kam zuzulassen, den Ort wirklich wahrzunehmen und langsam die Habituation zu spüren. Erst danach ist es sinnvoll, Trauerrituale auszuführen. Würde man diese vorher zulassen, wäre es eine Ablenkung von der mit dem Trauma zusammenhängenden Anspannung und Angst. Eine erfolgreiche Habituation wäre dann nicht möglich. An Trauerritualen wurden von den Angehörigen ausgeführt: • Entzünden von Kerzen an der Unfallstelle für jeden Toten, • Aufstellen von Blumengestecken, oft mit einem Bild des Verunglückten, • Aufsteigen lassen von Gasluftballons mit einem persönlichen Brief an den Verstorbenen, • Singen von sorgfältig ausgesuchten Liedern, • Sprechen von Texten, Gebeten und Gedichten. Anschließend kehrte die Gruppe in ein Gasthaus ein, um gemeinsam zu essen und Kaffee zu trinken. Ergebnis. In der Auswertung berichteten die Teilnehmer, der erste Schritt auf die Unfallstelle sei sehr schwer und die Anspannung während der ersten Zeit sei sehr hoch gewesen. Jeder war auf sich selber und das Nachlassen der Angst und Anspannung sowie seine eigene Habituation konzentriert, fühlte sich aber zusätzlich von den anderen Gruppenteilnehmern unterstützt und getragen. Teilnehmer äußerten große Zufriedenheit und an diesem Ort sein zu können, da sie sich dort ihren an dieser Stelle verstorbenen Angehörigen sehr nahe fühlen konnten. Einhellig wurde von den Gruppenteilnehmern geäußert, es sei einerseits sehr schwierig gewesen, diesen Ort aufzusuchen, andererseits fühlten sie sich nachher wie befreit und waren überzeugt, einen wichtigen Schritt in der Trauma- und Trauerbewältigung geleistet zu haben. Fazit zum Ende der Gruppenbetreuung Als deutlichste Entwicklung wurde von den Gruppenleitern konstatiert, dass die Teilnehmer aus ihrer fassungslosen Sprachlosigkeit herausgekommen waren und für ihre traumatischen Erlebnisse, ihre Trauer, ihre Einsamkeit, ihre Ängste und Depressionen Worte gefunden und miteinander geteilt hatten. Sie waren nicht mehr gefühlsmäßig überflutet, wenn sie an das Unglück und den Verlust ihres geliebten Menschen erinnert wurden, sondern konnten es als Teil ihres Lebens begreifen. Perspektiven für ein zukünftiges Leben mit neuen Zielen waren zu erkennen und bei manchen schon deutlich vorhanden. 167 168 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede In der letzten Gruppenstunde wurden die Teilnehmer gebeten, selbst ein Fazit ihrer Zeit in der Gruppe zu ziehen. Im Kasten in Abbildung B 2.2 sind einige dieser Äußerungen zusammengestellt. Abbildung B2.2: Resümee einzelner Gruppenmitglieder zu ihren Erfahrungen mit der Gruppe „Ich habe meine Trauer ganz anders angenommen. Ich hoffe, dass sie auch in fünf Jahren noch da ist, und dass ich glücklicher mit der Trauer sein kann!“ „Das Wichtigste war die Fahrt nach Hamburg und nach Eschede, ohne das könnte ich heute noch nicht fahren. Schön war die Feier danach: traurig und beglückend!“ „Ich habe die Gruppe wie Freunde und fast wie eine Familie gesehen, zu der man nach Hause kommt.“ „Ich habe gelernt: Alles ist endlich. Und doch ist das Leben schön!“ „Ich kann wieder in der Gegenwart sein und kann es mir erlauben, in die Vergangenheit zu schauen.“ „Als der Ballon mit dem Brief in den Himmel flog, das war eine Kostbarkeit!“ Ein Beispiel für eine gelungene Integration der traumatischen Erfahrungen in ihr Leben stammt von einem Gruppenmitglied, einer Frau, die selber im Zug gesessen hatte und ihr Kind verloren hatte. Sie hatte vor kurzem ein neues Kind geboren und nun das Kinderzimmer des verunglückten Kindes renoviert. Die Decke war früher grün gewesen, jetzt wollte sie sie gelb streichen. In der Mitte des Zimmers ließ sie in der Form eines Schmetterlings eine Figur im ursprünglichen Grün stehen und bemerkte dazu: „Ich stelle mit jetzt immer vor, wie A. (das verunglückte Kind) vom Himmel aus auf das Bett unseres neuen Kindes schaut“. Angebote für spezielle Gruppen Wie aus den Erfahrungen von Borken bekannt war, verläuft der Verarbeitungsprozess des Unglücks und der Trauerprozess für die Eltern, die bei dem Unglück ein Kind verloren haben, häufig anders und komplizierter ab, als bei anderen Angehörigen. Aus diesem Grunde wurden in der Nachbetreuung der Eschede Opfer besondere therapeutische Angebote für die Eltern bereitgehalten. Es wurden mehrere Wochenendveranstaltungen durchgeführt, in denen die verwaisten Eltern sich in einem Hotel trafen und unter psychologischer Leitung ihren Verlust bearbeiten und sich mit Gleichbetroffenen austauschen konnten. Ein gleich geartetes Angebot wurde für Geschwister von tödlich Verunglückten eingerichtet. 169 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede 2.2.3 Individuelle Ebene Viele Betroffene wurden im Einzelkontakt behandelt. Im Gegensatz zu den Gruppen, die in erster Linie einen betreuenden und die Entwicklung der Betroffenen begleitenden Ansatz verfolgten, war der Auftrag auf der individuellen Ebene explizit psychotherapeutisch. Die Vermittlung der Betroffenen zu dem bereits erwähnten Netz ambulanter Therapiemöglichkeiten wurde entweder durch das Sekretariat des Ombudsmanns, den Gesundheitsdienst und die Sozialarbeiter der Deutschen Bahn AG, oder durch das Deutsche Institut für Psychotraumatologie (DIPT) organisiert. Durch die Befragung des DIPT über die psychischen Auswirkungen der Katastrophe auf die Betroffenen konnten besonders schwere Fälle von posttraumatischen Belastungsstörungen direkt angesprochen und in eine Therapie empfohlen werden. Auf diese Weise wurden viele Betroffene erreicht, die nicht in die betreuten Gruppen gegangen waren. Insgesamt wurden durch das DIPT 65 Personen in Einzeltherapien vermittelt. Tabelle B 2.1 gibt einen Überblick über die Anzahl vermittelter Therapien aufgeteilt auf verschiedene Therapiearten (Fischer, Hammel & Lehnen, 2002): Tabelle B2.1: Anzahl vermittelter Therapien, unterteilt nach Therapiearten (nach Fischer, Hammel & Lehnen, 2002) Therapieart Anzahl Ambulante Therapie Traumaspezifisch EMDR unspezifisch gesamt 50 3 6 41 Stationäre Therapie spezifisch unspezifisch gesamt 15 9 6 Inhaltlich handelte es sich bei den Verletzten in der Regel um die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse, die Bewältigung der Auswirkungen ihrer Verletzungen, um ihre eingeschränkte Arbeits- und Leistungsfähigkeit und um Selbstwertprobleme. Bei Angehörigen waren individuell sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Verlust ihrer Verstorbenen und die Auswirkungen auf die Familien zu verarbeiten und Trauerprozesse zu begleiten. In beiden Gruppen waren ausgeprägte posttraumatische Belastungsstörungen und viele komorbide Störungen, hauptsächlich Depressionen, Somatisierungsstörungen und Angststörungen zu behandeln. In den Einzeltherapien befanden sich auch viele doppelt Betroffene, Personen, die sowohl selbst verletzt waren, als auch einen Angehörigen verloren hatten. Ambulante Einzelbehandlungen wurden häufig kombiniert mit stationären Kliniksaufenthalten in psychosomatischen Fachkliniken. 170 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede 2.3 Qualitätssicherung und Evaluation Wie bereits erwähnt, wurde die Begleitforschung durch das Deutsche Institut für Psychotraumatologie (DIPT) in Köln durchgeführt. Die Darstellung der Vorgehensweise und der Ergebnisse der Begleitforschung orientiert sich am Abschlussbericht über das Projekt Eschede-Hilfe des DIPT (Fischer et al., 2002). Ziel war es, alle Betroffenen anzuschreiben, ihnen das Angebot einer Diagnostik für traumatische Störungen zu machen, sie bei Bedarf in eine Therapie zu vermitteln und den Entwicklungsverlauf der Störung zu dokumentieren. 2.3.1 Methode Fragestellung und Hypothesen Die Fragestellung der Studie war in erster Linie an der Beratungs- und Therapienotwendigkeit der Verletzten und der Hinterbliebenen des Unglücks orientiert. Im Auftrag der Deutschen Bahn AG sollten diejenigen Betroffenen, die in der Diagnostik auffällige Werte erzielten, qualifiziert beraten und einer ambulanten oder stationären Therapiemaßnahme zugeführt werden. Eine eher wissenschaftliche Fragestellung befasste sich neben der deskriptiven Statistik mit der Frage der unterschiedlichen Belastungen in den Teilgruppen, das heißt, es wurden Querschnittsvergleiche berechnet, um Aussagen zu treffen sowohl zum Grad der posttraumatischen Belastung im Vergleich der Verletzten mit den Hinterbliebenen, als auch zur Entwicklung der Symptomatik. Teilnehmer der Untersuchung Es handelt sich um eine Stichprobe von N = 90 Betroffenen. Davon waren 40 Verletzte, wobei als verletzt alle galten, die im Zug gesessen hatten, unabhängig vom Ausmaß ihrer Verletzungen. 40 waren Angehörige, hatten also einen Verwandten, der bei dem Unglück getötet worden war. Sieben Personen gehörten beiden Gruppen an, drei waren Angehörige von Verletzten. Tabelle B 2.2 schlüsselt die Stichprobenverteilung nach Männern und Frauen, Verletzten und Hinterbliebenen auf: Tabelle B2.2: Umfänge der Eschede-Teilstichproben, gruppiert nach Betroffenheitsstatus und Geschlecht (nach Fischer, Hammel & Lehnen, 2002) Betroffenheitsstatus männlich weiblich Gesamt Verletzt Verletzt und hinterblieben Hinterblieben Angehörige von Verletzten 22 2 21 0 18 5 19 3 40 7 40 3 gesamt 45 45 90 171 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Untersuchungsmaterialien In einer Erstbefragung wurden N = 90 Betroffene mit einem klinischen Interview und zusätzlich mit folgenden Fragebögen zu ihrem psychischen Zustand nach dem Unglück befragt: • Die Posttraumatic Symptom Scale (PTSS 10, Raphael, Lundin und Weisaeth, 1989) • Die Impact of Event Scale (IES, Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979) • Das Peritraumatic Dissociative Experience Questionaire (PDEQ, Marmar, Weiss und Metzler, 1997) • Das Beck Depressionsinventar (BDI, Beck, Hautzinger, Bailer, Worall & Keller, 1995) Untersuchungsablauf Es gab vier Messzeitpunkte: eine Basiserhebung und drei Nachfolgeuntersuchungen. Die Basiserhebung erstreckte sich über den Zeitraum von vier Monaten bis zu einem Jahr nach dem Unglück. Personen, von denen nur Interviewdaten vorlagen und keine Fragebögen, bleiben unberücksichtigt. Der Zeitablauf der Basiserhebung und der Nachfolgeuntersuchungen ist aus Tabelle B 2.3 ersichtlich: Tabelle B2.3: Erhebungsplan der Eschede-Stichprobe – Basiserhebung und Nachfolgeuntersuchungen (nach Fischer, Hammel & Lehnen, 2002) Art der Erhebung Zeitpunkt Basiserhebung (T0) 1. Nachfolgeuntersuchung (T1) 2. Nachfolgeuntersuchung (T2) 3. Nachfolgeuntersuchung (T3) 4 bis 12 Monate nach dem Unglück 16 Monate nach dem Unglück 23 Monate nach dem Unglück 36 Monate nach dem Unglück 2.3.2 Ergebnisse Deskriptive Statistik In der Basiserhebung wurde zunächst nicht unterschieden zwischen Verletzten und Hinterbliebenen, sondern es wurden die Belastungswerte für die Gesamtstichprobe errechnet. Die Primärsymptomatik der PTBS wurde bei den Betroffenen mit der Post Traumatic Symptom Scale (PTSS 10, Raphael et. al., 1989) und der Impact of Event Scale (IES, Horowitz, 1997) erfasst. Traumasymptomatik nach PTSS 10. In der Stichprobe lässt sich mit der PTSS 10 ungefähr eine Drittelung erkennen zwischen unauffällig (38%), erhöhter Stressreagibilität (34%) und Verdacht auf PTSD (28%, s. Abbildung B 2.3 (1)). Traumasymptomatik nach IES. Eine auffallende Symptomatik (schwere und mäßig auffallende Symptomatik zusammengenommen) in der Impact of Event Scale (IES) zeigt nahezu 70% der Stichprobe. 19% der Betroffenen zeigen eine milde Symptomatik, 12% sind unauffällig (s. Abbildung B 2.3 (2)). 172 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Abbildung B2.3: Prozentuale Verteilung verschiedener Belastungsmaße in der Basiserhebung nach dem Zugunglück von Eschede (N = 90) PTBS-Verdacht. Die Kölner Arbeitsgruppe des DIPT (Fischer et al., 2002) bildete einen Summenwert aus den beiden Fragebögen PTSS 10 und IES und stellte diesen als Indi- 173 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede kator für das Vorhandensein einer PTBS vor. Er wird gebildet, indem man die oberen Bereiche der Auswertungsschemata entlang der Cut-off-Werte addiert, also die Kategorien „Verdacht auf PTSD“ der PTSS 10 (Cut-off: ≥36) sowie „mäßige Symptomatik“ und „schwere Symptomatik“, die zwei oberen Quartile der IES (Cut-off: ≥26), miteinander verknüpft. Dadurch ergibt sich ein PTBS-Verdacht bei 27% der Eschede Stichprobe. Damit liegt das Ergebnis im Rahmen ähnlicher Studien in der Literatur (Norris, Friedman & Watson, 2002) (s. Abbildung B 2.3 (3)). Peritraumatische Dissoziation. Das Ausmaß der peritraumatischen Dissoziation, das heißt von dissoziativen Phänomenen in Form von Wahrnehmungsstörungen in Raum und Zeit bis hin zu Amnesien, gilt als verlässlicher Prädiktor für das Auftreten einer Posttraumatischen Belastungsstörung (Bryant & Harvey, 1997; Holen, 1993; Koopman, Classen, Cardena & Spiegel, 1995; Koopman, Classen & Spiegel, 1994, 1996; Marmar, Weiss, Metzler et al., 1996, 1999; Marmar, Weiss & Metzler, 1998). Ein hoher Wert in der PDEQ muss nach Fischer et al. (2002) als ein Hauptrisikofaktor für das Auftreten einer PTBS angesehen werden. Mit einem aus klinischen Erfahrungswerten selbst festgelegten Cut-off-Wert von 25 wurde ein klinisch auffälliger Wert in der PDEQ bei 62% der Stichprobe (retrospektiv) errechnet (s. Abbildung B 2.3 (4)). Depressive Reaktionen. Ein hoher Anteil von 45% der Betroffenen gemessen mit dem BDI lag mit depressiven Reaktionen im klinisch auffälligen Bereich. 16% davon gaben an, die Symptomatik einer schweren Depression entwickelt zu haben (s. Abbildung B 2.3 (5)). Belastungsunterschiede in Teilgruppen (Querschnittsvergleiche) Im Weiteren interessieren Vergleiche zwischen den Untergruppen Männern und Frauen sowie Verletzte und Hinterbliebene hinsichtlich der Ausprägungen der Traumasymptomatik und der Werte im Depressions-Inventar. Die Signifikanzen wurden mit t-Tests für unabhängige Stichproben berechnet. Darüber hinaus werden die Verlaufsentwicklungen der Betroffenen über mehrere Messzeitpunkte beleuchtet. Querschnittsvergleich Männer – Frauen In der Basiserhebung (T0) ergaben sich auf allen Skalen keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie Tabelle B 2.4 verdeutlicht. Tabelle B2.4: Skala PTSS 10 IES PDEQ BDI Stichprobenumfänge und Mittelwerte der Erhebungsinstrumente in der Eschede Stichprobe, gruppiert nach Geschlecht (nach Fischer, Hammel & Lehnen, 2002) männlich weiblich N M N M 45 26.8 10 45.0 45 42 45 32.7 27.5 14.8 45 43 45 37.0 29.5 17.0 174 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Querschnittsvergleich Verletzte – Hinterbliebene Während auf den Skalen PTSS 10, PDEQ und BDI in der Basiserhebung (T0) keine signifikanten Unterschiede zwischen Verletzten und Hinterbliebenen zu verzeichnen waren, wiesen die Hinterbliebenen im IES-Gesamtscore einen numerisch sichtbar höheren Wert auf, der aber mit p = .07 die Signifikanzgrenze verfehlte (s. Tabelle B 2.5). Für die Basiserhebung kann also festgestellt werden, dass die Hinterbliebenen eine gleich hohe, im IES sogar eine höhere Traumabelastung aufweisen, als die Verletzten. Bei den Nachfolgeuntersuchungen bestätigte sich die Tendenz der höheren Werte im IES der Hinterbliebenen im Vergleich mit den Verletzten, allerdings nicht mehr auf signifikantem Niveau. In der ersten Nachfolgeuntersuchung (T1) ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen Verletzen und Hinterbliebenen auf den Skalen PTSS 10 und BDI mit jeweils signifikant höheren Werten bei den Verletzten (Tabelle 5). Zu den weiteren Nachfolgeuntersuchungen zeigten sich keine Unterschiede mehr. Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Analysen beider Messzeitpunkte im Überblick. Tabelle B2.5: Gruppenunterschiede der Belastungsmaße innerhalb der Messzeitpunkte T0 und T1 (nach Fischer, Hammel & Lehnen, 2002) Verletzte Hinterbliebene N M N M Zeitpunkt T0 PTSS 10 IES BDI 46 46 46 28.2 31.5 15.1 41 41 41 29.8 38.7 17.3 Zeitpunkt T1 PTSS 10 IES BDI 27 27 27 35.4 38.7 20.7 28 28 28 26.6 32.6 14.5 p .04* .03* Erläuterungen: Inferenzstatistische Überprüfung mit dem t-Test für unabhängige Stichproben Verlaufsbeschreibung (Längsschnittvergleiche) Im Folgenden werden einige Ergebnisse zum Verlauf der Entwicklung der Betroffenen über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren (T0 bis T3) beschrieben, wie sie sich in den Fragebogenwerten niedergeschlagen hatten. Die Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu bewerten, da die Teilnahme an den verschiedenen Messzeitpunkten sehr unterschiedlich ausfiel und die Fluktuation der Betroffenen groß war. Ein deutliches Akzeptanzproblem von Katastrophenopfern wissenschaftliche Untersuchungen zu akzeptieren, wird an diesem Punkt erneut deutlich. Aus Tabelle B 2.6 sind die Fluktuationen und die Untergruppenstärken ersichtlich. 175 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Tabelle B2.6: Fluktuationen und Untergruppenstärken der Eschede-Stichprobe (nach Fischer, Hammel & Lehnen, 2002) Untergruppe/Erhebung Gruppenstärke (N) T0 bis T3 teilgenommen Abgänge nach T0 Abgänge nach T1 Abgänge nach T2 Neuzugänge nach T2 25 41 23 24 24 Untersucht wurden in der Eschede Stichprobe folgende Untergruppen im Längsschnitt: A) die Verlaufsergebnisse der drei unterschiedlich hoch belasteten Untergruppen („unauffällig“, „erhöhte Stressreagibilität“, „Verdacht auf PTSD“) gemessen mit der PTSS 10 (s. o.), B) die Untergruppe mit PTBS-Verdacht aus der Basiserhebung (28%, s. o.), C) die Kerngruppe, die bei allen vier Erhebungen mitgemacht hatte. Zu A: Teilgruppe „unauffällig“ Für die Verletzten in der „unauffälligen“ Teilgruppe (PTSS 10-Kriterium 0–22) ergab sich eine signifikante Veränderung im Verlauf. Zwischen T0 und T1 ergab sich ein signifikanter Anstieg auf der Skala BDI (p = .09, N = 7), entsprechend einem Sprung von der Kategorie „keine Depression“ zu „schwach depressiv“ (s. Abbildung B 2.4). Abbildung B2.4: BDI-Mittelwerte bei den Verletzten in der „unauffälligen“ Gruppe (N = 7) Anmerkung: Kriterium „unauffällig“: PTSS 10-Wert in der Basiserhebung (T0) unter 23. Teilgruppe „erhöhte Stressreagibilität“ Die PTSS 10-Werte der Hinterbliebenen mit „erhöhter Stressreagibilität“ (PTSS 10Kriterium 23–35) nahmen zwischen T0 und T3 ab, das Ergebnis ist hoch signifikant (p = .007, N = 8). Eine ähnliche Entwicklung lässt sich mit der IES beschreiben: zwischen T0 und T3 ergab sich auf der Skala IES ein signifikanter Rückgang der Mittelwerte in der Gruppe der Hinterbliebenen (p = .008, N = 8). Das entspricht einem Kategorienwechsel von „mittelschwerem Trauma“ zu „leichtem Trauma“. 176 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Auf der Skala BDI ließ sich zwischen T0 und T3 ebenfalls ein signifikanter Rückgang der Mittelwerte in dieser Gruppe (p = .03, N = 8) verzeichnen. Gleichzeitig stiegen die Mittelwerte bei den Verletzten zwischen T0 und T2 signifikant an (p = .03, N = 8). Der Unterschied bedeutet einen Sprung von der Kategorie „schwach depressiv“ zu „mäßig depressiv“. (Vgl. auch Abbildungen B 2.5 (1 bis 4).) Die Werte der Verletzten der Teilgruppe „erhöhte Stessreagibilität“ stagnierten auf den Skalen PTSS 10 und IES in der Zeit von T0 zu T3. Abbildung B2.5: Mittelwerte von PTSS 10, IES und BDI in der Gruppe mit „erhöhter Stressreagibilität“ Anmerkung: Kriterium „erhöhte Stressreagibilität“: PTSS 10-Wert in der Basiserhebung (T0) zwischen 23 und 35. Teilgruppe „Verdacht auf PTSD“ Bei der mit PTSS 10 in der Basiserhebung hoch belasteten Teilgruppe mit Verdacht auf PTSD (PTSS 10-Kriterium ≥ 36) zeigen sich signifikante Rückgänge der Mittelwerte B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede zwischen den Erhebungen T0 und T3 bei den Hinterbliebenen auf der Skala PTSS 10 (p = .02, N = 7). Auf der Skala des IES ergab sich bei den Hinterbliebenen ebenso ein signifikanter Rückgang der Mittelwerte zwischen T0 und T3 (p = .08, N = 7). (Vgl. auch Abbildungen B 2.6 (1 und 2).) Auf der Skala BDI ließen sich keine Unterschiede feststellen. Abbildung B2.6: Mittelwerte von PTSS 10 und IES in der Gruppe mit „Verdacht auf PTSD“ (N = 7) Anmerkung: Kriterium „Verdacht auf PTSD“: PTSS 10-Wert in der Basiserhebung (T0) ≥ 36. Zu B: Gesamtgruppe PTBS-Verdacht aus der Basiserhebung In dieser Gruppe befanden sich wie oben beschrieben, sowohl Verletzte, als auch Hinterbliebene, da sie bei der Basiserhebung keinen Unterschied hinsichtlich der PTBS aufwiesen. Im Längsschnitt ergaben sich signifikante Rückgänge auf den Skalen PTSS 10 und IES zwischen T0 und T3. Auf der Skala PTSS 10 beträgt die Signifikanz p = .02 (N = 14). Auch auf der IES ergab sich ein signifikanter Rückgang der Werte (p = .02, N = 14). (Vgl. auch Abbildungen B 2.7 (1 und 2).) Zu C: Verlauf der Kerngruppe In der Kerngruppe befinden sich N = 25 Personen, die an allen vier Erhebungen teilgenommen und von vornherein das vollständige Betreuungsangebot erhalten hatten. Auch in dieser Gruppe zeigt sich ein signifikanter Rückgang der Symptomatik bei den Hinterbliebenen, während sich die Werte bei den Verletzten kaum verändern. Der Rückgang der Werte bei den Hinterbliebenen ist hochsignifikant (p = .005, N = 25, vgl. auch Abbildung B 2.8). 177 178 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede Abbildung B2.7: Mittelwerte von PTSS 10 und IES in der Gesamtgruppe mit „Verdacht auf PTSD“ (N = 14) Erläuterungen: Kriterium „Verdacht auf PTSD“: PTSS 10-Wert in der Basiserhebung (T0) ≥ 36. Keine Differenzierung in Verletzte und Hinterbliebene. Abbildung B2.8: IES-Mittelwerte bei den Verletzten und Hinterbliebenen in der Kerngruppe (N = 25) B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede 2.4 Schlussfolgerungen und Bewertung 2.4.1 Wissenschaftlich-methodische Bewertung Zunächst erfolgt eine Zusammenfassung und Bewertung der wichtigsten Ergebnisse aufgeteilt nach verschiedenen Themen. Traumabelastung der Gesamtstichprobe Ein PTBS Verdacht bei einem knappen Drittel (27% Summenwert PTSS 10 und IES) der Gesamtstichprobe entspricht den Erwartungen und deckt sich mit Ergebnissen der Literatur (s. Norris, Friedman & Watson, 2002). Dem steht ein hoher Wert von 62% „klinisch auffälliger“ Personen mit peritraumatischer Dissoziation (gemessen mit dem PDEQ) gegenüber, der nach Fischer et al. (2002) als verlässlicher Prädiktor für eine spätere PTBS zu sehen ist. Das weist auf die Notwendigkeit hin, bei vielen Personen auch mit einem verzögerten Beginn einer PTBS rechnen zu müssen. Kritisch muss dabei angemerkt werden, dass der in der Studie vom DIPT festgelegte Cut-off-Wert mit 25 vielleicht zu niedrig gewählt ist. Der hohe Anteil von 45% klinisch auffälliger Personen mit depressiver Symptomatik (gemessen mit dem BDI) ist ein Indikator für die Schwere dieses Ereignisses, das als die größte Katastrophe in die Geschichte der deutschen Eisenbahn eingegangen ist. Vergleich zwischen Verletzten und Hinterbliebenen (1.) Hinterbliebene zeigen sich in der Basiserhebung genauso hoch belastet (gemessen mit PTSS 10 und BDI), in der Tendenz sogar höher belastet, als die Verletzten (gemessen mit IES). Dieses Ergebnis erstaunt, haben doch die Verletzten den Unfall direkt erlebt und waren oft auch direkte Zeugen schrecklicher Bilder, während die Hinterbliebenen das Ereignis nur am Fernseher verfolgt haben. Wirksam sind hier möglicherweise von Fischer et al. (2002) vermutete „Konstruktionsprozesse im Bewusstsein der Menschen“, die zu ähnlichen Blockierungen führen, wie beim direkten Erleben traumatischer Erlebnisse, bei denen es aufgrund von Überlastungen zur Unterbrechung einer wichtigen Informationsübertragung im Zentralnervensystem kommt, „welche ein Steckenbleiben der Sinnesinformationen, beispielsweise des Auges, vor der verarbeiteten Erfahrung im Großhirn zur Folge hat“ (Fischer et al., 2002). Durch die Mischung der eigenen Konstruktionen mit Medienbildern kann es zu aufdrängenden Bildern bezüglich des Unglücks kommen. Offensichtlich können also Angehörige durch die Konfrontation mit Medienberichten über das Ereignis genauso traumatisiert werden, als seinen sie direkt mit dem Ereignis konfrontiert. (2.) Verletzte zeigen einen signifikanten Anstieg im BDI von T0 zu T1 und weisen im Vergleich mit Hinterbliebenen kurz nach dem Unglück höhere Depressivitätswerte auf (T1, gemessen mit BDI), die Werte nähern sich in den späteren Erhebungen wieder einander an. Offensichtlich lösen die massiven mechanischen Verletzungen des Unfalls schneller depressive Symptomatiken aus, als der Verlust eines Angehörigen. Möglicherweise sind hier Verleugnungsmechanismen der Hinterbliebenen wirksam. Hinterbliebene realisieren häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt die Endgültigkeit 179 180 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede und die Tragweite des Verlustes. Verletzungen hingegen sind unmittelbar zu sehen und zu spüren, sie lassen sich nicht verleugnen. Vielleicht ist hierin auch die Begründung zu suchen, warum Verletzte kaum motivierbar waren, die psychologisch geleiteten Gruppen aufzusuchen: sie waren in erster Linie mit der Sorge und Pflege ihrer körperlichen Verletzungen befasst und litten unter einer depressiven Symptomatik. In einer solchen Situation ist das Angebot einer Traumabewältigungsgruppe nicht das, was Verletzte unmittelbar brauchen und was sie anspricht. (3.) Bei den Hinterbliebenen mit einer initial erhöhten Stressreagibilität ist die Entwicklung der Traumasymptomatik und der Depressivität im Verlauf der Messzeitpunkte rückläufig (T0 bis T3, gemessen mit IES, PTSS 10 und BDI). Auch bei den Hinterbliebenen der initial hoch belasteten Betroffenen zeigen sich signifikante Rückgänge der Werte auf den Skalen PTSS 10 und IES von T0 zu T3. Dieses Ergebnis kann als Hinweis auf die Wirksamkeit der Interventionen (Einzeltherapie, Gruppenbehandlung, aufsuchende Sozialarbeit) gesehen werden, wobei jedoch die Effektstärke einzelner Interventionen oder auch die Wirkung von anderen Einflüssen und Spontanheilungen unklar bleiben. (4.) Im Vergleich dazu stagnieren die Werte der Traumabelastung der Verletzten mit initial erhöhter Stressreagibilität (T0 bis T2, gemessen mit PTSS 10 und IES) und ihre Depressivitätswerte steigen sogar (T0 bis T2, gemessen mit BDI). Bei den initial hoch belasteten Verletzten stagnieren die Werte genauso wie in der Mittelgruppe (erhöhte Stressreagibilität). Dieses Ergebnis kann eine Bestätigung der oben gestellten Vermutung sein, dass die Verletzten aufgrund ihrer besonderen Situation die angebotenen Hilfsmassnahmen nicht in Anspruch nehmen und von daher auch im Gegensatz zu Hinterbliebenen nicht von davon profitieren können. (5.) Auch in der so genannten „Kerngruppe“, einem Kreis von Betroffenen, die an allen vier Erhebungen teilgenommen hatten, zeigt sich die gleiche Tendenz. Während sich die Belastungswerte der Hinterbliebenen auf allen Skalen reduzieren, bleiben die der Verletzten nahezu unverändert. Während Fischer et al. (2002) dieses Ergebnis darauf zurückführen, dass für die meisten Teilnehmer der Untergruppe der Verletzten „das optimale Zeitfenster in Eschede bereits überschritten zu sein“ scheint, ist aus klinischer Sicht und aus Rückmeldegesprächen mit den Betroffenen die Hypothese wahrscheinlicher, dass die Verletzten keine auf sie zugeschnittenen Angebote erhalten haben, die ihnen den Zugang zu professioneller Hilfe erleichtert, beziehungsweise ermöglicht hätte. Insgesamt muss zu der vorgestellten Studie kritisch angemerkt werden, dass die Interpretation der Ergebnisse Einschränkungen unterliegt, da die Stichprobengrößen in den Untergruppen relativ klein sind und eine Kontrollgruppe fehlt. Das Problem der fehlenden Kontrollgruppe liegt jedoch generell in der psychotraumatologischen Katastrophenforschung vor. Unklar bleibt in der Studie, wie viele der untersuchten Hinterbliebenen und Verletzten an den betreuten Gruppen teilnahmen und es wird nicht unterschieden zwischen Teilnehmern ohne beziehungsweise mit ambulanter oder stationärer Psychotherapie. Wesentliche methodische Kritik richtet sich gegen das Vorgehen im Zusammenhang mit der Basiserhebung T0. Fischer und Kollegen geben an, dass diese Daten im Zeit- B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede raum zwischen vier und zwölf Monaten nach dem Unglück erhoben worden seien. Innerhalb dieses Zeitfensters spielt sich jedoch bekanntermaßen die Entwicklung der Kernsymptomatik nach einem Trauma ab und es sind permanente Veränderungen im Gang. Daten, die unkontrolliert innerhalb eines virulenten psychischen Prozesses gesammelt werden, sind für Intra- und Intergruppenvergleiche methodisch nur sehr bedingt verwertbar. Aus diesem Grund unterliegen alle von Fischer et al. (2002) gezogenen Schlüsse der Gefahr, Artefakte zu sein und nicht die wahre Entwicklung der Gruppen darzustellen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die starke Fluktuation in den untersuchten Gruppen. In die Basiserhebung gingen 90 Personen der insgesamt angeschriebenen 220 Personen ein. Während in T1 nur Betroffene angeschrieben wurden, die an der Basiserhebung teilgenommen hatten, wurden in T2 wieder alle angeschrieben und 24 neue Personen wurden in die Studie aufgenommen. Es wird nicht konsequent dargelegt, wie mit Abgängen beziehungsweise Neuzugängen umgegangen wurde. Bei allen Einschränkungen lassen sich dennoch folgende Schlussfolgerungen ziehen: • Intensive Konfrontationen mit Medienberichten können ähnlich traumatogen wirksam zu sein, wie eine direkte Konfrontation im Unfallgeschehen. Diese Erkenntnis sollte berücksichtigt werden in der Definition des DSM-IV, in der der Personenkreis genannt ist, der nachdem er einem traumatischen Ereignisses ausgesetzt war und intensive Furcht, Hilflosigkeit oder extremen Schreck erlebt hat, nämlich Opfer, Zeugen und „anderweitig Konfrontierte“. Diese anderweitig Konfrontierten können eben auch Angehörige der Opfer sein, die mit Fernsehbildern konfrontiert wurden. • Es besteht eine dringende Notwendigkeit, die Hinterbliebenen und engen Angehörigen einer Katastrophe in die Betreuung mit einzubeziehen, da sie genauso belastet sein können, wie die direkt Betroffenen. • Verletzte Opfer der Katastrophe müssen mit spezifischen Betreuungsangeboten angesprochen werden, die eine gezielte Bearbeitung der durch die Verletzung entstandenen Lebensprobleme in Aussicht stellen. • In den Betreuungsangeboten für die Verletzten sollte zu Beginn der Schwerpunkt neben dem Thema des Umgangs mit den körperlichen Verletzungen auf der Prophylaxe beziehungsweise der Bearbeitung depressiver Symptomatik liegen und weniger auf einer Traumabearbeitung. 2.4.2 Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Die psychosoziale Nachbetreuung der Opfer der ICE-Katastrophe von Eschede stand am Anfang vor einer Aufgabe in einer Dimension, die es bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Die Schwierigkeiten lagen in der großen Anzahl zu betreuender Personen mit unterschiedlichsten sozialen Hintergründen und vor allem in der Tatsache, dass die Betroffenen über das gesamte Bundesgebiet verteilt waren. Die Deutsche Bahn AG stellte sich der Verantwortung, ein breites Betreuungsangebot an alle Betroffenen zu richten, ohne die Möglichkeit zu haben, auf feste gewachsene Betreuungsstrukturen zurückgreifen zu können. Mit hohem Engagement wurden dabei vom Gesundheitsdienst der Deutschen Bahn AG Strukturen geschaffen und versucht zusammenzufassen: 181 182 B: Felderfahrungen — Das ICE-Unglück von Eschede • In der Eschede Nachbetreuung waren einerseits viele Gruppen- und Einzeltherapeuten direkt mit den Betroffenen tätig. • Das DIPT war mit der Begleitforschung und Beratung der Betroffenen zur Aufnahme ambulanter oder stationärer Therapie befasst. Es gab kaum Rückmeldungen zu den Therapeuten der psychologisch geleiteten Gruppen. • Der Ombudsmann war als Ansprechpartner für die Betroffenen tätig und hatte die Aufgabe des Aufbaus der psychologischen Behandlung und der psychosozialen Nachbetreuung der Opfer. • Die Therapeuten, die die psychologisch geleiteten Gruppen betreuten, arbeiteten nicht mit einem einheitlichen Therapiekonzept. Was aus damaliger Sicht als vorbildliches und optimales Betreuungskonzept nach einer Katastrophe dieses Ausmaßes galt, ist aus heutiger Sicht in dem Sinne zu kritisieren, dass ein einheitliches Vorgehen für die Betroffenen effektiver und für die beteiligten Therapeuten und Betreuer befriedigender wäre. 2.4.3 Konsequenzen für die Praxis Folgende Konsequenzen sind für die Praxis zu ziehen: 1. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, einen neutralen Ombudsmann als Ansprechpartner für die Betroffenen und für das Unternehmen einzusetzen. 2. Von einem Fachmann für Psychotraumatologie sollte ein verbindliches, an den Erfordernissen der jeweiligen Situation und dem Stand der neuesten Psychotraumatologischen Erkenntnisse orientiertes Betreuungs- und Therapiekonzept entwickelt werden. 3. Die Begleitforschung sollte Teil dieses Betreuungskonzepts sein und sich den Zielen der optimalen Betreuung und Therapie der Betroffenen unterordnen. 4. Externe Therapeuten sollten auf dem Boden dieses Betreuungskonzepts arbeiten und sich regelmäßig über die neueste Entwicklung austauschen. Kurskorrekturen könnten von verantwortlichen Leitern, wie im Fall Eschede von der Leitung des Gesundheitsdienstes der Deutschen Bahn AG im Sinne des Konzepts vorgenommen werden. 5. Erkenntnisse aus der Begleitforschung sollten direkt in die Gruppen- und Einzeltherapien mit einfließen. 3. Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen (1999) 3.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds Im November 1999 ereignete sich der erste Fall zielgerichteter Gewalt mit tödlichem Ausgang eines Schülers gegen eine Lehrerin an einer deutschen Schule: ein 14-Jähriger erstach mit zwei Messern seine Lehrerin vor den Augen seiner Klassenkameraden. Die Beschreibung des Vorfalls in Abbildung B 3.1 rekrutiert sich aus Informationen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. Abbildung B3.1: Beschreibung des Tathergangs Am 9. November 1999, um 8.05 Uhr, stürmte ein Schüler der 9. Klasse des Gymnasiums Franziskaneum in Meißen maskiert mit einer schwarzen Gesichtsmaske und ganz in schwarz gekleidet kurz nach Beginn der zweiten Unterrichtsstunde in seine Klasse. Er hielt zwei Messer in beiden Händen und stürzte sich auf die konsternierte Lehrerin. Der Schüler begann sofort mit beiden Messern auf sie einzustechen. Da sie mit einem der ersten Stiche an der Halsschlagader getroffen worden war, blutete sie stark. Das Blut spritzte an die Tafel. Sie schrie laut und versuchte dem Täter zu entkommen, dieser verfolgte sie jedoch unablässig und fügte ihr insgesamt 21 Messerstiche zu. Die Lehrerin schleppte sich aus dem Klassenzimmer in den Flur, wo sie einer Kollegin in die Arme fiel und dann zusammenbrach. Innerhalb weniger Minuten verstarb sie, die Erste-Hilfe-Versuche einiger Kollegen fruchteten nichts mehr. Der Täter war inzwischen an der sterbenden Lehrerin und den sich um sie kümmernden Kollegin vorbeigelaufen und aus dem Schulgebäude geflohen. Der Mord war vor den Augen der gesamten Klasse 9 geschehen. Die Schüler hatten wie erstarrt da gesessen, einige weinten, einige hatten sich die Augen zugehalten, andere gebannt und ungläubig das Geschehen genau beobachtet. Der Täter, der unmittelbar nach der Tat identifiziert war, da er seine Ausweispapiere auf der Flucht aus der Schule verloren hatte, wurde wenige Stunden später gefasst. Als Motiv für sein Vorgehen gab er an, er habe die Lehrerin gehasst. Diese schwere Form zielgerichteter Gewalt eines einzelnen Schülers gegen eine Lehrerin wirkte auf die betroffene Klasse, die Lehrerschaft und Schülerschaft des Gymnasiums, wie auch auf viele andere Lehrerkollegien und Schüler in ganz Deutschland ähnlich einer der oben beschriebenen Katastrophen. Viele der direkt und indirekt betroffenen Lehrer, Schüler und Angehörigen hatten mit psychischen Problemen zu 184 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen kämpfen, das Sicherheitsgefühl der Betroffenen war erschüttert. Der normale Ablauf des Schulalltags war nicht mehr aufrecht zu erhalten, die Schule stand mit negativen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten reichten nicht zur Lösung der entstandenen Probleme aus. Eine breite Diskussion über Gewalt an deutschen Schulen, den Umgang mit schwierigen Schülern, die Stellung verunsicherter Lehrer und die Änderung pädagogischer Konzepte besonders im Osten der Republik durchzog die Medien und die Fachwelt. 3.1.1 Beschreibung des Umfelds Das Gymnasium Franziskaneum ist ein seit 1905 bestehendes traditionsreiches Gymnasium. Es liegt in der Kleinstadt Meißen in Sachsen, weltbekannt durch seine Porzellanmanufaktur. Im Jahre des Ereignisses, 1999, besuchten 1 097 Schüler die Schule und wurden von 66 Lehrern unterrichtet. Das Gymnasium genoss einen sehr guten Ruf und führte die Schüler nach 12 Jahren zum Abitur. Der Täter kam aus einer unauffälligen Familie, er galt als durchschnittlicher, unproblematischer Schüler. Kurz nach dem Mord wurde die Tatsache bekannt, dass der Schüler vor Klassenkameraden die Tat angekündigt und mit ihnen gewettet hatte, diese durchzuführen. Es war in diesem Zusammenhang zu staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen gegen die „Mitwisser“ gekommen, denen man vorwarf, die Straftat nicht im Vorfeld verhindert zu haben. Diese führten jedoch nicht zu einer Anzeige. In der Öffentlichkeit in Meißen und Umgebung hielt sich jedoch lange der Vorwurf gegen die Klasse, den Mord nicht schon nach der Vorankündigung des Schülers oder spätestens bei der Durchführung verhindert zu haben. 3.1.2 Traumatische Stressoren und typische Reaktionen Im Folgenden werden die traumatischen Stressoren für die von dem Ereignis betroffenen Personengruppen und deren typischen Reaktionen beschrieben. Folgende Betroffenen-Gruppen lassen sich benennen: 1. Die Schüler der Klasse 9, vor deren Augen der Mord geschah, 2. Die Lehrer, die direkt mit der sterbenden Kollegin konfrontiert waren, 3. Schüler der Schule, die auf dem Flur mit der getöteten Lehrerin konfrontiert waren, 4. Hausmeister, die das Blut im Klassenzimmer und Flur wegwischen mussten, 5. Das gesamte Lehrerkollegium des Gymnasiums Franziskaneum, 6. Die Eltern der Klasse 9, 7. Die Familie des Täters. Die aufgeführte Reihenfolge der Betroffenen ist auch als Rangreihe mit absteigendem Risiko zu sehen, eine PTBS zu entwickeln (vgl. die Darstellung der Forschung zu Risikofaktoren, Kapitel A 1). Anmerkung: Eine Ausnahme stellt die Familie des Täters dar. Der Familie des Täters wurden Betreuungsangebote unterbreitet, sie lehnte diese jedoch ab. Sie ist deshalb im Rahmen dieser Arbeit nicht das Ziel weiterer Untersuchungen. B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Tabelle B3.1: Traumatische Stressoren und typische Belastungsreaktionen der Betroffenengruppen nach dem Lehrerinnenmord in Meißen Zu 1: Schüler der Klasse 9 Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Konfrontation mit der Tat: Eindringen des Täters in die Klasse, Maskierung des Täters, Tatwaffe/ Messer, An die Tafel spritzendes Blut, Schreie der Lehrerin, Stark blutende Lehrerin, • Angst und Verunsicherung in der Schule, • Wiederkehrende quälende Bildern der Tat, z. B. von der verletzten, schreienden Lehrerin, • Unruhe, starke Anspannung; Hypervigilanz, Konzentrations-, Ein- und Durchschlafstörungen, • Starke Schreckreaktionen bei plötzlichem Öffnen der Klassentür, • Albträume, • Emotionale und physiologische Reaktionen bei Konfrontation mit schwarz gekleideten Personen, • das Gefühl, niemandem mehr trauen zu können, • Leistungsabfall, • Schuldgefühle, nicht auf die Ankündigungen des Mitschülers reagiert und das Ereignis verhindert zu haben. • Entsetzen, Panik, Todesangst, selber angegriffen zu werden, • Konfrontation mit den Folgen der Tat: Blutspur auf dem Flur, zugedeckte Leiche, fassungslos weinende Lehrer. Zu 2: Lehrer, die mit der sterbenden Kollegin konfrontiert waren Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Hören von lauten Schreien, • Konfrontation mit der stark blutenden sterbenden Kollegin, • Hilflosigkeit beim Versuch, Kollegin zu retten, • Konfrontation mit dem Täter, der nah an ihnen vorbeilief, • Blutspur auf dem Flur, • Angst wieder vor die Klasse treten zu müssen. • Ängste in die Schule zu gehen und vor der Klasse zu stehen, Ängste vor Schülern, Gefühl der Unsicherheit in der Schule, • Überlegungen, welcher Schüler könnte fähig sein zu einer solchen Tat, • Schuldgefühle, der Kollegin nicht geholfen zu haben, • Schlafstörungen, Albträume, Konzentrationsstörungen, • Hypervigilanz, dauernde Anspannung, • Infragestellen der eigenen Berufstätigkeit, • Schreckhaftigkeit bei Schülergeschrei; 185 186 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Zu 2: Lehrer, die mit der sterbenden Kollegin konfrontiert waren (Forts.) Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Vermeidung die Stelle im Flur zu betreten, an der die Kollegin verstarb, • Körperliche Beschwerden: HerzKreislaufprobleme, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, allgemeine Kraftlosigkeit. Zu 3: Schüler, die auf dem Flur mit der sterbenden Lehrerin konfrontiert waren Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Hören von lauten Schreien, • Konfrontation mit der stark blutenden, sterbenden Lehrerin, • Konfrontation mit fassungslosen, weinenden, hilflosen Lehrern, • Konfrontation mit dem Täter, der nah an ihnen vorbeilief, • Blutspur auf dem Flur. • Ängste in die Schule zu gehen, • Misstrauen gegen Mitschüler, Fragen, wer zu einer solchen Tat fähig wäre, • Schuldgefühle und Wut auf die Schüler, die über die Tat informiert waren, • Schlafstörungen, Albträume, Konzentrationsstörungen, • Hypervigilanz, dauernde Anspannung. Zu 4: Hausmeister Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Hören von lauten Schreien, • Konfrontation mit fassungslosen, weinenden, hilflosen Lehrern und Schülern, • Aufgabe, die Blutspur auf dem Flur wegwischen und das Klassenzimmer reinigen zu müssen. • Gefühl der Bedrohung in der Schule, • Misstrauen gegenüber den Schülern, • Wut auf die Schüler, die über die Tat informiert waren, • Schlafstörungen, Albträume, Konzentrationsstörungen, erhöhter Alkoholkonsum, • Hypervigilanz, dauernde Anspannung. Zu 5: Lehrerkollegium Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Indirekte Konfrontation mit dem Ereignis durch den Aufruhr in der Schule und die Medien, • Konfrontation mit erschütterten Kollegen, und verstörten Schülern, die das Ereignis direkt miterlebt hatten. • Ängste in die Schule zu gehen, • Unsicherheitsgefühle gegenüber Schülern, • Wut auf die „Mitwisser“, • Schlafstörungen, • Konzentrationsstörungen B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Zu 5: Lehrerkollegium (Forts.) Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Hinterfragen der eigenen Rolle als Lehrer, der von der Gesellschaft nicht genügend geschützt wird, • Hypervigilanz, dauernde Anspannung, • Angst, es könne wieder etwas passieren in der Schule. Zu 6: Eltern der Klasse 9 Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Indirekte Konfrontation mit dem Ereignis über die Medien, • Konfrontation mit ihren verstörten Kindern, die das Ereignis direkt miterlebt hatten. • Ängste um das Wohlergehen ihrer Kinder, • Verunsicherung wegen deren Mitwisserschaft und Angst vor Konsequenzen, • Angst, es könne wieder etwas passieren in der Schule, • Verunsicherung über den richtigen Umgang mit ihren (traumatisierten) Kindern. Zu 7: Die Familie des Täters Traumatische Stressoren Typische Reaktionen • Indirekte Konfrontation mit dem Ereignis über die Polizei, • Aufmerksamkeit der Medien. • Unverständnis ihrem eigenen Sohn gegenüber, • Schuldgefühle, Verzweiflung, • Verleugnung der Verantwortlichkeit, • sozialer Rückzug, Ablehnung von Hilfsangeboten. 187 188 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen 3.2 Interventionen und deren Implementierung Im Folgenden sollen die Interventionen an der betroffenen Schule nach dem Mord in Meißen auf der Systemebene, der Gruppenebene und der individuellen Ebene dargestellt werden. 3.2.1 Systemebene Folgende Institutionen waren für die notfallpsychologische Bewältigung der Unglücksfolgen und in die Betreuung der Betroffenen in den ersten Tagen involviert: a) die Schulleitung der betroffenen Schule, die unmittelbar nach der Tat dafür verantwortlich war, Rettungswagen und Polizei zu verständigen und die zuständige Schulbehörde zu informieren. b) Das Staatliche Schulamt als Aufsichtsbehörde, das Schulpsychologen abordnete, um die Schüler am Ort des Geschehens zu betreuen. c) Schulpsychologen, die den Auftrag hatten, die notfallpsychologische Erstversorgung der Schüler und Lehrer in der Schule sicher zu stellen. d) Die Fachaufsicht der Schulpsychologen im Kultusministerium, die für eine Qualitätssicherung der psychologischen Maßnahmen verantwortlich war. e) Das Kultusministerium mit der Kompetenz, die Betreuungsmaßnahmen zu implementieren und zu finanzieren. f) Ein „Debriefing-Team“ der Bundeswehr, angefordert vom Kultusministerium, um ein einmaliges Debriefing mit Schülern und Lehrern durchzuführen, die direkt mit der Tat konfrontiert waren. g) Der Autor als externer Krisen- und Katastrophen-Psychologe, der vom Kultusministerium für die fachliche Leitung der Maßnahmen zur Traumabewältigung engagiert wurde. Zur mittel- und langfristigen Betreuung der Betroffenen wurde eine so genannte „Steuerungsgruppe“ ins Leben gerufen, die sich aus folgenden Vertretern beziehungsweise Personen zusammensetzte: • Eine Vertreterin des Kultusministeriums, • Eine Fachaufsicht der Schulpsychologen, • Zwei Schulpsychologen, • Ein Vertreter des Regionalschulamts, • Der Schulleiter, • Zwei Vertreter der Lehrer, • Zwei Vertreter der Schüler (Schulsprecherin und Klassensprecherin der Klasse 9), • Ein Elternvertreter, • Ein Psychologe, der Autor dieser Arbeit. Die Gruppe setzte sich zum Ziel, ein Betreuungsprogramm für die Betroffenen zu entwickeln, die Angemessenheit und Wirksamkeit der allgemeinen und der psychologischen Betreuung von Schülern und Lehrern fortlaufend zu begleiten und zu kontrollieren und die aktuellen Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen zu ermitteln. Die Gruppe B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen tagte vierteljährlich. Zur Konkretisierung der psychologischen Interventionen wurden folgende Aufgaben vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus als Auftraggeber für den Psychologen formuliert: a) Leitung der Steuerungsgruppe; b) Abstimmung der weiteren Interventionen, Supervision und Fortbildung der Schulpsychologen; c) Erarbeitung eines Betreuungsrationals für die Betroffenen auf der Grundlage theoretischer Erkenntnisse aus der posttraumatischen Stressforschung und praktischer Wünsche der Beteiligten; d) Erstellung eines Zeit- und Organisationsplanes für die weitere Arbeit mit den Betroffenen. Durch die Implementierung der Steuerungsgruppe war gewährleistet, dass • aus traumatologischer Sicht mit den Betroffenen die notwendigen Maßnahmen zur Traumabewältigung durchgeführt wurden, • die Betreuung an den Bedürfnissen aller Betroffener ausgerichtet war, • die Schulaufsichtsbehörden in die Planung, Weiterentwicklung und Überprüfung der Wirksamkeit der Betreuungsmaßnahmen involviert waren, • es permanent einen Austausch unter allen Beteiligten gab. Das Betreuungsprogramm. Das von der Steuerungsgruppe entwickelte „Betreuungsprogramm für die Betroffenen der Ereignisse im Franziskaneum in Meißen“ orientierte sich einerseits an den von den betroffenen Lehrern und Schülern selbst geäußerten Wünschen zur Verbesserung der allgemeinen Schulsituation nach der verunsichernden Erfahrung einer zielgerichteten Gewalttat an ihrer Schule, andererseits an den aus traumatologischer Sicht notwendigen psychologischen Maßnahmen zur Traumabewältigung. In der Übersicht in Tabelle B 3.2 sind die wichtigsten Maßnahmen des Betreuungsprogramms auf diesen zwei Ebenen dargestellt, unterteilt in kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen. Zentraler Gedanke der Betreuung war also einerseits eine Entlastung der Schule zum Beispiel durch Bereitstellung neuer Lehrer, um dadurch mehr Möglichkeit zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt an der Schule zu haben und sich der mit den Folgen der erlebten zielgerichteten Gewalt für die Schulgemeinschaft zu befassen. Andererseits sollten gezielte traumatherapeutische Maßnahmen eingesetzt werden, um (a) die Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse mit allen Beteiligten zu fördern, damit sich keine Fehlverarbeitungen etablierten und um (b) denjenigen Schülern und Lehrern gezielte Einzeltherapeutische Hilfen anzubieten, die schon Symptome im Sinne einer PTBS entwickelt hatten. 3.2.2 Gruppenebene Im Folgenden sollen die Gruppeninterventionen erläutert werden, die als Reaktionen auf die oben dargestellten typischen Probleme der einzelnen Gruppen durchgeführt wurden. Dabei wird unterteilt in kurz-, mittel- und langfristige Interventionen. 189 190 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Tabelle B3.2: Übersicht über allgemeine Betreuungsmaßnahmen und psychologische Interventionen Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung des Schulklimas Psychologische Interventionen zur Traumabewältigung kurzfristige Maßnahmen • Entlastung von den Medien durch einen Pressesprecher • Informationsveranstaltungen für Lehrer, Schüler und Eltern zu Belastungsreaktionen nach traumatischen Stresserfahrungen mittelfristige Maßnahmen • Rechtsberatung für Lehrer • Orientierungshilfen für Lehrer zum Umgang mit Gewalt • Ein Erholungstag für die Lehrer durch gemeinsame Ausflugsfahrt • Gesprächsrunden zum Thema Gewalt an der Schule für Lehrer, Schüler und Eltern • Wiedereinführung der „KlassenleiterStunde“, um allgemeine Probleme mit den Schülern besprechen zu können • Psychologische Diagnostik zur Feststellung des Traumatisierungsgrades • Gruppenangebote für Lehrer und Angestellte zur Traumaverarbeitung • Gruppenangebote für Schüler zur Traumaverarbeitung • Psychologische Sprechstunde für Lehrer, Schüler, Eltern und Angestellte der Schule • Gruppen zu themenspezifischen Problemen von Schülern, wie: Schuldgefühle, Ängste, Anspannung, Umgang mit der Familie des Opfers usw. langfristige Maßnahmen • Erhöhung der Lehrerzahl • Einstellung eines Schulsozialarbeiters • Schulentwicklungsmoderation: Gewinnung eines Moderators für die Schule • Maßnahmen zur Wiederherstellung der ehemals guten Außenwirkung der Schule • Aufklärung der Lehrer und Schüler über das Tatmotiv des Täters • Einzeltherapeutische Maßnahmen für besonders schwer belastete traumatisierte Schüler und Lehrer Kurzfristige Interventionen Unter kurzfristigen Interventionen werden Maßnahmen verstanden, die innerhalb der ersten ein bis zwei Wochen nach dem Ereignis durchgeführt werden. Betreuung der Schüler am Unglückstag Durch das staatliche Schulamt wurden zwei Schulpsychologen zur Betreuung der betroffenen Klasse unmittelbar nach bekannt werden des Vorfalls abgestellt. Diese ver- B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen suchten mit den Schülern über deren Erlebnisse ins Gespräch zu kommen und forderten sie auf, ihre Gefühle in Zeichnungen zum Ausdruck zu bringen. Die Schulpsychologen bemängelten später, sie seien für eine derartige Aufgabe nicht ausgebildet gewesen und sie haben sich den Anforderungen nicht gewachsen gefühlt. Weiterhin kam ein Notfallseelsorger der Polizei in die Schule, der über Erfahrungen mit notfallpsychologischen Interventionen im Polizeidienst verfügte. Auch er war für die Schüler der betroffenen Klasse zuständig. Es gab keine notfallpsychologische Betreuung für die Lehrer. Debriefing durch ein Psychologen-Team der Bundeswehr Durch einen vom Kultusminister vermittelten Kontakt wurde zwei Tage nach dem Ereignis ein Psychologen-Team der Bundeswehr per Hubschrauber eingeflogen, die ein CISD-Debriefing nach Mitchell durchführten. Kriterien für Durchführung und Teilnahme waren zum einen das Zeitkriterium, wie von Mitchell definiert, maximal 72 Stunden nach dem Ereignis, zum zweiten, dass alle daran teilnehmen sollten, die vom Ereignis etwas gesehen, gehört oder anderweitig wahrgenommen hatten. Es wurde jeweils getrennt voneinander ein Debriefing für die Schüler und ein Debriefing für die Lehrer als Einzelintervention durchgeführt. Weitere Kontakte der Psychologen der Bundeswehr mit den Betroffenen fanden nicht statt, die Psychologen flogen unmittelbar nach dem Einsatz wieder mit dem Hubschrauber zu ihrem Standort zurück. Nachbesprechung für Verantwortungs- und Entscheidungsträger Mit den Personen aus der sächsischen Staatskanzlei und dem Kultusministerium, die auf der administrativen Ebene mit den Ereignissen konfrontiert worden waren, wurde von Seiten des Autors eine systematische Nachbesprechung der jeweiligen Erlebnisse durchgeführt. Hierbei wurden die Teilnehmer gebeten, vor allem die faktischen Erlebnisse in den Anfangstagen zu schildern. Ebenso bestand die Möglichkeit, aber nicht der Zwang, über die dadurch ausgelösten emotionalen Beteiligungen zu sprechen. Mittelfristige Interventionen Unter mittelfristigen Interventionen werden Maßnahmen verstanden, die drei bis acht Wochen nach dem Ereignis durchgeführt werden. Einmalige Gruppe mit allen betroffenen Lehrern und Schüler- und Elternvertretern Drei Wochen nach dem Ereignis wurden eine Sitzung mit den betroffenen Lehrern, Vertretern der Schüler und Eltern durchgeführt, um deren Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Bewältigung der Ereignisse zu sammeln. Folgende Wünsche wurden dabei von den Betroffenen geäußert, die später ihren direkten Niederschlag im Betreuungsprogramm (s. Anhang A) fanden: 1. Schulorganisatorische Hilfen – Hilfen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen • zusätzliche Stelle für Leitungsaufgaben, • Erhöhung des Stammpersonals, • Klassenleiterstunden mit Zeit für Beziehungspflege, 191 192 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. • Mehr Zeit für die Arbeit der Beratungslehrer, • Schulentwicklung einschließlich Gewaltprävention und Supervision, • Mehr Arbeitsgemeinschaften für Schüler, • Lehrplanentlastung, um mehr Zeit für die Erziehung der Schüler zu haben. Schaffen von Rechtssicherheit • beim Umgang mit gewalttätigen Schülern, • Möglichkeiten der Absicherung der Lehrer (Versicherungsschutz), • Gremium für schnelle Entscheidungen zum Umgang mit gewalttätigen Schülern, • Beratung zum Umgang mit den Medien. Aufklärung über das Tatmotiv des Täters. Unterstützung der Familie des Opfers (Schüler wollten die Familie unterstützen, z. z. B. durch Hilfen im Haushalt). Information von Lehrern, Schülern und Eltern über PTBS. Schulsozialarbeit (speziell für die Klassen 7 bis 9 zur Aufarbeitung von sozialen Problemen). Psychologische Angebote für die Gruppe der betroffenen Lehrer. Psychologische Betreuung der Klasse 9. Psychologischer Ansprechpartner für Lehrer und Schüler, der immer in der Schule anwesend ist. Gemeinsamer Arbeitskreis von Eltern, Schülern und Lehrern zum Thema Gewalt. Schutz vor den Medien. Das negative Bild der Schule in der Öffentlichkeit wieder realistisch darstellen. Gemeinsame Aktivität der Lehrer, z. B. eine Fahrt. Aus den Wünschen wird deutlich, dass viele Lehrer sich sowohl eine psychologische Unterstützung bei der Aufarbeitung der Geschehnisse wünschten, als auch eine grundlegende Entlastung bei der Umsetzung der Lehrpläne. Dabei wurde der Druck thematisiert, die Schüler in zwölf Jahren zum Abitur führen zu müssen und wenig Zeit zu haben, auf allgemeine Probleme der Schüler einzugehen. Die zu DDR-Zeiten bestehende Regelung, eine so genannte „Klassenleiterstunde“ pro Woche als Klassenlehrer zur Verfügung zu haben, in der allgemeine und persönliche Probleme der Klasse oder einzelner Schüler angesprochen werden konnten, wurde wieder herbei gewünscht. Psychodiagnostische Untersuchung Um die psychotherapeutischen Interventionen gezielt bei denjenigen einzusetzen, die durch das Ereignis besonders belastet im Sinne posttraumatischer Belastungsreaktionen waren, wurde eine Fragebogenuntersuchung durchgeführt. Eingesetzt wurden dabei die Impact of Event Scale (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998) und die Beschwerden-Liste (von Zerssen & Koeller, 1976). Mit Hilfe der Ergebnisse der IES-R wurden die betroffenen Lehrer in drei Gruppen aufgeteilt: • leicht Betroffene, • mittel schwer Betroffene • schwer Betroffene. Auf diese Weise konnten für die drei Untergruppen spezifische Betreuungs- und Behandlungsangebote entwickelt werden. Gleichzeitig wurden von den Teilnehmern der B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Fragbogenuntersuchung erfasst, welche persönlichen Ziele sie in Bezug auf das Ereignis hatten und wie nah sie dem Opfer und dem Täter standen. Die Ergebnisse werden im Folgenden unter Abschnitt B 3.3 dargestellt. Elternabende Die Eltern der Schüler waren sehr beunruhigt und in Sorge um ihre Kinder. Einige waren eher der Ansicht, man müsse jetzt so schnell wie möglich den Kindern helfen, zu „vergessen“, andere forderten umfassende psychologische Betreuung für ihre Kinder. Auf Elternabenden für die Eltern der betroffenen Schüler wurde diesen im Sinne psychoedukativer Interventionen ein Modell der Wirkung traumatischer Erfahrungen dargestellt und Möglichkeiten bei der Bewältigung posttraumatischer Belastungsreaktionen aufgezeigt. Ihnen wurden Tipps und Ratschläge zum Umgang mit ihren belasteten Kindern gegeben. Als wichtigste und Erfolg versprechende Strategie wurde den Eltern empfohlen, als Ansprechpartner für ihre Kinder da zu sein und das auch kundzutun, aber nicht von ihren Kindern zu verlangen, mit den Eltern über die Ereignisse zu reden. Die Aufteilung der Schüler in leicht- mittel- und schwer Belastete aufgrund der Fragebogenuntersuchung wurde erläutert und die geplanten Betreuungs- und Therapiemaßnahmen erklärt. Fragen der Eltern wurden beantwortet und ihr Einverständnis zu den geplanten Maßnahmen eingeholt. In Einzelgesprächen erhielten die Eltern die Möglichkeit, jeweils das Ergebnis ihres Kindes zu erfahren und dem Autor spezifische Problemsituationen aus Elternsicht näher zu bringen. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder Elternabende durchgeführt, um über bestimmte Themen zu informieren, wie z. B. komorbide Störungen bei PTBS, vor allem Depression und Angst, über den Umgang mit Vermeidungsverhalten und über adäquate Erziehungshaltungen zum Umgang mit diesen Problemen. Langfristige Interventionen Unter langfristigen Interventionen werden diejenigen Maßnahmen verstanden, die ab zwei Monate nach dem Ereignis begannen. Gruppe für Lehrer und Angestellte In einer Gruppe für die betroffenen Lehrer und Angestellten wurde mit den Teilnehmern das Ereignis nach dem in Borken bewährten Schema nachbearbeitet (s. Kapitel B 1.2.2; Tabelle B 3.3 gibt einen Überblick über Abfolge und Themen der Lehrer- und Angestelltengruppe.) Betroffen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die entsprechenden Personen direkt mit dem Ereignis konfrontiert waren, also die Tat beziehungsweise die sterbende Lehrerin beobachtet oder gehört hatten, oder unmittelbar danach dem flüchtenden Täter, der getöteten Lehrerin oder den verstörten Schülern begegnet waren. Die in der psychodiagnostischen Untersuchung am häufigsten benannten Probleme dieser Gruppe nach den traumatischen Erlebnissen waren: • Ängste vor Schülern, • Verunsicherung mit der Lehrerrolle („Ein Lehrerleben scheint nichts wert zu sein…“), 193 194 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen • • • • • • Wiederkehrende quälende Bilder, z. B. von der sterbenden Kollegin, Allgemein starke körperliche Anspannung, Schuldgefühle, nicht genug geholfen zu haben, Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten, Trauer wegen des Verlustes einer geschätzten Kollegin, Körperliche Beschwerden besonders Herz-Kreislaufprobleme, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, allgemeine Kraftlosigkeit. Ausgehend von dieser Problemdefinition waren die am häufigsten genannten Ziele der Lehrergruppe im Zusammenhang mit dem Ereignis: • Ruhe und Gelassenheit wieder zu finden, • Sich wieder entspannen zu können und loslassen zu können, • Abstand zu dem Ereignis zu bekommen, • Wunsch nach Verständnis und Toleranz zwischen den Lehrern, • Die Angst zu überwinden, vor der Klasse zu unterrichten, • Dass das Lehrer-Schüler-Verhältnis wieder so werde, wie es vor dem Ereignis war, • Gemeinsam mit den Kollegen Wege zur gewaltfreien Konfliktlösung zu finden. Tabelle B3.3: Gruppeninterventionen der Lehrer- und Angestelltengruppe – Abfolge und Leitthemen Phase & Anzahl Sitzungen Leitthemen der Gruppensitzungen 1. Faktenphase 2 Sitzungen „Was haben Sie beim Unglück erlebt?“ — „Was haben Sie gesehen, gehört, gerochen, wahrgenommen?“ — „Welche traumatischen Erlebnisse gab es?“ 2. Reaktionsphase I 1 Sitzung „Was haben Sie damals gedacht?“ 3. Reaktionsphase II 1 Sitzung „Wie haben Sie sich damals gefühlt?“ Im Unterschied zu den Gruppen in Borken waren die Lehrergruppen hier jedoch keine über Monate bestehende Gruppen, sondern lösten sich nach fünf Sitzungen wieder auf. Deutlich wurde, dass die üblicherweise nach der kognitiven Aufarbeitung beginnende Bearbeitung der emotionalen Ebene von den Lehrern und Angestellten nicht in der Gruppe angegangen werden wollte. Auch die in den Borken-Gruppen geleisteten Phasen der „Trauerarbeit“ und der Phase „Voneinander lernen“ waren in der Lehrergruppe Meißen kein Thema mehr. Als Erklärung für diese Reaktion ist denkbar, dass die im täglichen Berufsalltag in einem aufgabenbezogenen Kontext miteinander kommunizierenden Personen dieser Gruppe es zu riskant fanden, ihre persönlichen emotionalen und verletzten Anteile miteinander zu besprechen, aus Angst, im Schulalltag dann angreifbarer zu sein. Wie aus Einzelgesprächen deutlich wurde, war für viele die Offenlegung eines verunsicherten traumatisierten Gefühlszustandes nicht mit der von ihnen erwünschten und selbst wahrgenommenen Position eines souveränen Lehrers oder Lehrerin vereinbar. Auch die Angst von der Schulleitung, der Schulbehörde oder dem betreuenden Psychologen B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen negativ beurteilt zu werden und den veränderten Anforderungen an die Lehrerrolle nicht gerecht zu werden, spielte in dieser neuen Zeit nach der politischen Wende für viele Lehrer mit DDR-Sozialisation eine nicht unerhebliche Rolle. Gruppen für Schüler Die am stärksten betroffene Gruppe von Schülern war die Klasse, in der der Mord geschehen war. Diese Schüler hatten aus nächster Nähe die Tat beobachtet und die meisten von ihnen hatten sich selber in Todesangst befunden, da sie glaubten, der Täter werde auch auf sie losgehen. Als typische Probleme, unter denen diejenigen Schüler litten, die direkt mit der Tat konfrontiert waren, wurden in der psychodiagnostischen Untersuchung festgestellt: • Angst vor erneuten Vorfällen, • Schreckhaftigkeit bei plötzlichen Geräuschen, z. B. Türenknallen, • Verunsicherung gegenüber Mitschülern (weil ein „unauffälliger Schüler“ eine so brutale Tat begangen hatte), • Allgemein starke körperliche Anspannung, • Konzentrationsschwierigkeiten, • Angst, wenn die Tür des Klassenzimmers geöffnet wurde, • Wiederkehrende quälende Bilder, z. B. von der verletzten, schreienden Lehrerin, • Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten, • Schuldgefühle, das Ereignis nicht verhindert zu haben. Ausgehend von diesen Problemen beschrieben die Schüler als ihre wichtigsten Ziele im Zusammenhang mit dem Ereignis: • Normalisierung des Verhältnisses zwischen Schülern und Lehrern, unter anderem, dass Lehrer und Schüler wieder aufeinander eingehen können, • Die Vorwürfe von Lehrern und Außenstehenden sollen aufhören, dass sie bei dem Mord der Lehrerin nicht geholfen haben, • Die Klasse soll zusammen bleiben, • Der Wunsch, mit Freunden über das Ereignis reden zu können, • Der Wunsch, sich mit dem Täter auszutauschen, um dessen Tatmotiv zu verstehen, • Der Wunsch, dass der Täter bestraft werde, • Lernen, das Ereignis zu verarbeiten, über die eigenen Ängste reden zu können und sie verarbeiten zu können, • Konzentrationsschwierigkeiten und Lernprobleme zu überwinden, • Keine Angst mehr haben zu müssen vor Verschlechterung der Leistung. Für die Schüler war es leichter, über ihre Betroffenheit im Klassenverband zu reden. Die Schüler sprachen mit großer Offenheit über ihre erlebte Hilflosigkeit, ihre Ängste, während des Mordes selber auch Opfer zu werden, ihre Fassungslosigkeit, dass ein „ganz normaler Mitschüler“ zu einer solch schrecklichen Tat in der Lage war und ihre Schuldgefühle, auf Andeutungen des Mitschülers, er werde eine Lehrerin umbringen, nicht reagiert zu haben. Deutlich wurde hierbei ein starkes Bedürfnis der Schüler über einzelne Aspekte des Ereignisses ausführlicher zu sprechen, als es im anfangs durchgeführten „Debriefing“ der Fall gewesen war. 195 196 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Tabelle B3.4: Gruppeninterventionen der Schülergruppe – Abfolge und Leitthemen Phase & Anzahl Sitzungen Leitthemen der Gruppensitzungen 1. Faktenphase 3 Sitzungen „Was hast Du beim Unglück erlebt?“ — „Was hast Du gesehen, gehört, gerochen, wahrgenommen?“ — „Welche traumatischen Erlebnisse gab es?“ 2. Reaktionsphase I 1 Sitzung „Was hast Du damals gedacht?“ 3. Reaktionsphase II 1 Sitzung „Wie hast Du Dich damals gefühlt?“ 4. Reaktionsphase III 1 Sitzung „Wie waren Deine Körperreaktionen?“ 5. Symptomphase 1 Sitzung “Welche Symptome haben sich bei Dir bis heute entwickelt?“ — „Welche Verhaltensweisen haben sich verändert?“ 6. Psychoedukative Phase „Was ist für eine effektive Bewältigung günstig und förderlich, was ist ungünstig und hinderlich?“ 1 Sitzung 7. Voneinander lernen „Was kann ich anderen empfehlen, was hilft bei der Bewältigung des neuen Alltags?“ — „Was habe ich bei anImmer wieder Thema, im Verlauf der 2jährigen - deren an günstigen Verhaltensweisen beobachtet?“ Betreuung 3–4 Sitzungen 8. Symptombehandlung 2 Sitzungen „Wo zeigt sich Vermeidungsverhalten?“ — „Wie kann ich es aktiv verändern?“ 9. Umgang mit Krisen & Belastungen 1 Sitzung „Wie begehe ich den Jahrestag des Unglücks?“ 10. Zukunftsperspektive „Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?“ — „Was kann ich dafür tun, meine Ziele zu erreichen?“ Immer wieder Thema, im Verlauf der 2jährigen Betreuung 3–4 Sitzungen Die Mitarbeit der Schüler in diesen Gruppen war engagiert und konstruktiv, sie zeigten durchweg eine kooperative und sachbezogene Haltung. Nach einigen Sitzungen stellte sich jedoch heraus, dass die weniger belasteten Schüler an den Gesprächen kaum noch teilnahmen. Außerdem ergaben sich inhaltliche Themen, die für einen Teil der Schüler wichtiger waren, als für andere, z. B. Umgang mit Ängsten, Entspannungsmöglichkeiten, Umgang mit Intrusionen, Schlafstörungen etc. Aus diesem Grunde wurde die Gesamtgruppe eingestellt, nachdem die Erlebnisse vom Unfalltag ausführlich genug nach besprochen waren, zugunsten der so genannten „Neigungsgruppen“. B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Neigungsgruppen Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen bei den Jugendlichen nach der gemeinsamen Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse im Klassenverband wurden in Absprache mit den Schülern Themen formuliert, denen sich einzelne Untergruppen verstärkt widmen wollten. Dadurch war gewährleistet, dass diejenigen, die sich mit einem Problembereich intensiv auseinandersetzen wollten, sich nicht durch unmotivierte Mitschüler behindert fühlten. Themen, aus denen sich die Neigungsgruppen entwickelten, waren: • Umgang mit Ängsten, • Umgang mit Schlafstörungen, • Erlernen von Entspannungsmethoden, • Umgang mit dem Prozess gegen den ehemaligen Mitschüler und der Notwendigkeit, dort als Zeugen befragt zu werden, • Vorbereitung des Jahrestages des Ereignisses, • Hilfen für die Eltern der ermordeten Lehrerin. Diese Neigungsgruppen waren von unterschiedlicher Dauer, jeweils angepasst an die Fragestellungen der Schüler und konnten bei Bedarf immer wieder neu etabliert werden. Die Gruppen, die von jeweils fünf bis zehn Schülern besucht wurden, entwickelten schnell ein hohes Maß an Intimität. Dort wurden z. B. Entspannungstechniken gelernt, Auslöser von Ängsten identifiziert und Konzepte zum erfolgreichen Umgang mit Problemen wie Panikgefühlen oder Schlafstörungen erarbeitet. Über die eigentliche Intention, Bewältigungsstrategien zum gemeinsamen Thema zu erlernen hinausgehend, sprachen die Schüler oft persönliche Probleme an, was sie sich im Klassenverband nicht trauten. Die Schüler wurden immer wieder aufgefordert, zwischendurch „Hausaufgaben“, bestimmte verhaltenstherapeutische Übungen, durchzuführen. Ein Bespiel dafür ist die Übung, die Angst zuhause allein zu sein zu überwinden. Die Ergebnisse dieser Übungen sollten die Schüler dann per Brief mitteilen. Ein Beispiel ist der in Abbildung B 3.2 abgedruckte Brief einer Schülerin nach Übungen zum Selbstmanagement ihrer Angst. Abbildung B3.2: Brief einer betroffenen Schülerin nach Übungen zum Selbstmanagement der Angst „Sehr geehrter Herr Pieper, …deshalb schreibe ich Ihnen jetzt, um Ihnen zu erzählen, ob Ihre Tipps geholfen haben. Ich erzähle Ihnen noch einmal kurz, worum es ging: Mein Problem war, dass ich wahnsinnige Angst im Dunkeln und allein hatte – auch in unserer Wohnung. Wen ich irgendwelche Geräusche in der Wohnung oder im Haus gehört habe, habe ich mir schon die schlimmsten Situationen ausgemalt. Und nun war es ja so, dass ich in den Sommerferien 10 Tage ganz allein zuhause war, nur, dass ich tagsüber noch arbeiten gegangen bin. Sie hatten mir gesagt, dass ich mir immer wieder Sätze wie „Ich bin hier völlig sicher“ oder „Die Angst hat nichts mit dem Jetzt zu tun, sondern ist nur eine Erinne- 197 198 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen rung vom 09.11.1999“ aufsagen soll, damit sich endlich wieder ein kleines Stück heile Welt um mich entwickelt und damit ich wieder Vertrauen fasse. Ich habe es dann im Sommer so gemacht, dass ich einen großen A4-Zettel genommen habe und ganz groß darauf geschrieben habe: Ich bin hier völlig sicher, die Angst ist nur ein Überbleibsel des 9.11. und hier völlig fehl am Platz! SEI STARK! Das Blatt habe ich auf meinen Nachttisch neben mein Bett gestellt und mir mindestens jeden Abend und in „brenzligen“ Situationen, wo wieder Angst hochkam, durchgelesen. Und: Es hat geholfen! Ich will nicht behaupten, dass ich völlig angstfrei gelebt habe (vor allem nicht vorm Einschlafen), aber es ist jeden Tag etwas weniger geworden, bis ich am Ende richtig gut damit klar kam. Auch das Nachhausegehen, wenn es schon dunkel und spät ist, habe ich jetzt viel besser im Griff, als noch vor einigen Monaten. Dafür wollte ich mich auch noch einmal bedanken – ich meine dafür, dass Sie mir geholfen haben, wieder in einer halbwegs Heilen Welt zu leben, auch wenn ich genau weiß, dass sie trotzdem nie wieder so sein wird, wie vor dem 09.11.1999. Aber das ist auch gut so, ansonsten würde es ja bedeuten, dass ich nichts daraus gelernt habe….“ Expositionsbehandlungen In verschiedenen Problemfeldern hatten sich bei vielen Schülern Ängste und Vermeidungsverhalten entwickelt, welches mit Expositionsbehandlungen therapiert wurde. Für die Meißener Schüler waren folgende Situationen relevant: • Aufsuchen der Stelle, an der die Lehrerin verstarb, an der heute eine Gedenkplakette hängt, • Aufsuchen des Grabes der Lehrerin, • Im Klassenraum sitzen und damit konfrontiert werden, dass die Klassenzimmertür aufgerissen wird (für Schüler und Lehrer), • Im Klassenraum sitzen und mit lauten Geräuschen auf dem Flur konfrontiert werden (für Schüler und Lehrer). Die Expositionsbehandlungen wurden in der Gruppe durchgeführt, diejenigen Schüler, die angaben mit dem jeweiligen Thema kein Problem zu haben, machten in der Regel dennoch mit, weil sie es als sinnvolle Übung für sich ansahen. Beispielhaft sei hier eine mit den Schülern durchgeführte in vivo Expositionsbehandlung beschrieben. Grund für die Exposition war die von vielen Schülern angegebene Angst, die sich jedes Mal einstellte, wenn während des Unterrichts jemand in die Klasse kam. Sie brachten es immer in Verbindung mit dem damaligen Erlebnis, dass der maskierte Schüler die Tür aufgerissen hatte und sich sofort mit den Messern auf die Lehrerin stürzte. Obwohl man in der Schule vereinbart hatte, dass immer an die Tür geklopft werden muss, dass man abwartet und dann erst eintritt, zeigten viele Schüler B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen in dieser Situation immer deutliche psychophysiologische Reaktionen, wie starkes Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, Ängste und Unruhe. Nach einer ausführlichen Besprechung des Ablaufes wurden Schüler und die Klassenlehrerin aufgefordert, ganz normal Unterricht zu führen. Dann betrat der Autor in den unterschiedlichsten Variationen das Klassenzimmer, mal laut klopfend, mal nur die Tür aufreißend, mal mit kurzer Verzögerung, mal mit langen Zeitabständen, usw. Die Schüler und die Lehrerin stuften jeweils auf einer Skala ein (Skala von 0 bis 10; 0 = neutral, 10 = maximale Anspannung und Belastung), wie sehr sie Schreckreaktionen bei sich wahrnehmen konnten. Obwohl die Schüler in dieser Situation vorbereitet waren, dass jemand die Klasse betreten würde, zeigten sie deutliche Schreckreaktionen während der ersten Durchgänge und erreichten hohe Werte auf der Belastungsskala. Nach mehreren Durchgängen, die ca. eine Stunde dauerten, waren die Schreckreaktionen bei allen Schülern deutlich zurückgegangen. In einem zweiten Termin waren schon die Ausgangswerte der Belastung deutlich geringer, als im ersten Termin. Nach wenigen Durchgängen stuften sich alle Schüler in der Belastungsskala auf 0 oder maximal 1 ein. Die erzielten Effekte bei den Meißener Schülern zeigten sich nach sechs Monaten in Nachbefragungen stabil. Auf die gleiche Weise wurden auch die weiteren oben genannten Belastungssituationen durch Expositionsbehandlungen in der Gruppe neutralisiert. 3.2.3 Individuelle Ebene Neben den Gruppentherapeutischen Interventionen wurden spezielle traumatherapeutische Interventionen im Einzelkontakt durchgeführt bei: a) den hoch belasteten Schülern der betroffenen Klasse, b) den hoch belasteten Lehrern, c) Schülern aus anderen Klassen, die mit dem Ereignis konfrontiert worden waren und nicht gemeinsam mit der betroffenen Klasse behandelt werden konnten. Zur Anwendung kamen: • verhaltenstherapeutisch orientierte Einzelgespräche, • narrative Traumabewältigung, • Expositionsbehandlungen, • EMDR, • Offene Sprechstunde. Einzelgespräche Vor allem die Lehrer nutzten die Möglichkeit zu Einzelgesprächen und favorisierten sie vor Gruppengesprächen. In den Einzelgesprächen wurden vor allen Dingen die Auswirkungen der Traumatisierung auf den familiären und privaten Bereich problematisiert. Viele Lehrer zweifelten daran, ob sie weiter in der Lage seien, in ihrem Beruf leistungsfähig zu sein und gleichzeitig die eigenen Kinder und die Familie zu versorgen. Diese Probleme wollten sie in der Regel nicht in der Gruppe behandeln. Einige Lehrer thematisierten, ob sie überhaupt noch den Beruf weiter ausführen könnten. Innerhalb der Einzelbehandlungen wurden auch regelmäßig Expositionsbehandlungen durchgeführt. 199 200 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Narrative Traumabewältigung Die Aufforderung, einen Bericht über die Traumaerfahrung zu schreiben erscheint für viele Betroffene zunächst eine schwierige Aufgabe, die sie kaum glauben, bewältigen zu können. Sie führte in Meißen jedoch bei einigen Lehrern zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Ereignis und den eigenen Reaktionen. Lehrer suchten häufig im Verlauf der zweijährigen Betreuung der Schule Kontakt zum Autor auf und bezogen sich auf ihren Bericht vom Ereignis. Der Vorteil der Methode liegt darin, dass die Schreiber gezwungen sind, sich intensiver mit ihren Gedanken und Gefühlen zu beschäftigen, weil das Schreiben langsamer geht als das Erzählen. Besonders geeignet war dieses Vorgehen für die Lehrer, da sie sich gut darin einfügen konnten, „Hausaufgaben“ zu erledigen. Beispielhaft sei in Abbildung B 3.3 der Bericht einer Geschichtslehrerin aufgeführt, die im Nebenraum Unterricht abhielt, als die Tat geschah. Abbildung B3.3: Bericht einer Lehrerin der Schule „Der 09.11. – ein geschichtsträchtiges Datum. Eigentlich wollte ich zu Stundenbeginn das Datum anschreiben und die Schüler (Kl. 11) die historischen Ereignisse dazu benennen lassen. Aber es ergab sich wohl anders. Ich hatte kurz nach Stundenbeginn gerade die Aufgaben für eine mündliche Leistungskontrolle gestellt, als wir einen Schrei oder besser Geschrei – auch Hilferufe? – hörten. Ich nahm an, es sei eine unbeaufsichtigte, sehr laut tobende (das ist aber die absolute Ausnahme!) Sportklasse auf dem Weg von der Turnhalle zu den Umkleideräumen bzw. umgekehrt, aber irgendwie war es doch zu laut, zu anders. Blicke der Schüler signalisierten mir, dass sie wohl ähnlich dachten. Der Lärm wurde anders, ich weiß nicht mehr, wie anders. Ich öffnete die Tür, sah M.K. und M.B. (Kollegen) in Richtung Lehrerzimmer gehen – das sehe ich aber eher statisch vor mir. Herr L. (Schulleiter) blickte in Richtung Mitte des Treppenflures und rief dringend nach einem Notarzt. Es war etwas Schlimmes passiert – war jemand die Treppe heruntergestürzt? – aber Hilfe war da – und danach das Gefühl „im Hinterkopf“: etwas sehr Schlimmes. Warum ich die Türe wieder geschlossen habe, wie ich es fertig gebracht habe, die Leistungskontrolle fortzusetzen, mich auf das Gesagte konzentrieren konnte, weiß ich nicht mehr. Parallel dazu nahm ich draußen Geräusche wahr, den Notarztwagen oder mehrere. Sie schienen zur Schule zu kommen, aber nicht mehr mit Signal wegzufahren. Also war es doch nicht so schlimm gewesen – Erleichterung !?! Nein, da war noch etwas anderes, was? Ich denke, den Schülern ging es ähnlich, einerseits den Geräuschen draußen „nachhängend“, andererseits aber konzentriert. In das Gespräch mit Schülern vertieft, bemerkten wir das Klingeln nicht – es hatte auch nicht geklingelt. Ich öffnete die Tür, habe ich den Schülern vorab gesagt, dass sie alle im Zimmer bleiben? Alle blieben. Spürten sie etwas? Wohl doch! Ich sehe die weiß-roten Absperrbänder, einen Arzt, einen großen Mann. Ich gehe die 5–6 Schritte, nach denen ich dann den gesamten Flur einsehen kann. Da liegt B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen eine umgeklappte blaue Plastikkiste und darüber und davor eine gemusterte Decke – irgendwie wie aus dem Film. Eine zugedeckte Leiche – aber das denke ich nicht. Ich denke an einen Hund (?) – so ein Quatsch, in der Schule war noch nie ein Hund! Es sieht so klein aus – ein Kind? Mit kaum einem Gedanken dachte ich an meine Kinder, R. (14) hatte Unterricht im anderen Gebäude, P. (17) glaubte ich zuhause. Sie konnten es also nicht sein! Zu der Decke (?) führte eine lang gezogene, immer größer werdende Blutlache. Sie fließt auch nicht mehr, sondern ist wohl schon getrocknet, aber sie glänzt noch. Sie scheint auch ein Stück vor der Decke zu Ende – war kein Blut mehr da? Fragend gehe ich auf einen fast versteinert wirkenden Herrn L. (Schulleiter) zu. Er fragt, ob ich T.s Telefonnummer habe. „Welcher T?“ „T.L.“ (der Sohn der ermordeten Lehrerin) – er war bis vor eineinhalb Jahren mein Schüler. Da ist mir klar, dass das „Etwas“ – ich habe keinen Begriff dafür – S. (die Getötete) ist, war? Ich wollte zu ihr gehen, aber man ließ mich nicht. Ich habe gehört oder gesehen, dass Herr L. (Schulleiter) nickte, als ich ihn fragte, ob das S. (Kollegin) ist. Begriffen habe ich es nicht – bis heute wohl nicht. Weinend hörte ich im Sekretariat auf Herrn L.s Worte, was passiert ist – unfähig zu begreifen. Wie kann ein Mensch das tun, was geht in ihm vor, warum? Hat S. Schmerzen gehabt? War ihr klar, was passieren wird? Sie legte immer großen Wert auf ihr Outfit! Keine 60 Minuten zuvor hatten wir noch die Kombination brauner Sachen zu tiefschwarzen Haaren diskutiert (nach den Herbstferien hatte sie sich die Haare von blond auf schwarz umfärben lassen) und entschieden, welches Geschenk wir einer Kollegin zum Geburtstag machen. Solche Banalitäten angesichts des Unfassbaren! Die nächste Stunde verlangte, Entscheidungen zu treffen. Ich wurde einer ersten Befragung unterzogen, der „Tatort“ musste abgeschirmt werden´, Stellwände mussten aufgestellt werden, mit Tischdecken verhangen. Zurückgekehrt in meine Klasse – tiefe Stille – musste ich sie von dem Geschehen informieren. Nur unter Tränen und größter Anstrengung konnte ich einen Satz formulieren: „S.L. wurde umgebracht“. Viele, auch 17-jährige Jungen, begannen zu weinen. Mit einer Kreislaufschwäche wurde ich ins Krankenhaus gebracht, eine Beruhigungsspritze wirkte und bewirkte eine große Leere – einige Stunden später, nach der Entlassung, musste ich noch mal in die Schule. Der Hausmeister wischte den Gang – eine riesige rosa Fläche! Ich habe bis zur Beerdigung nicht mehr geweint, danach dann erst wieder in der Sylvesternacht und später am Nachmittag des 07.02. Seit dem weine ich öfter, auch jetzt.“ Aus diesem Bericht wird deutlich, wie intensiv die Auseinandersetzung mit dem Trauma während des Schreibens ist und wie stark die Bilder auch während des Schreibens noch präsent sind. Die Schreiberin wechselt unversehens aus der Vergangenheit in das Präsens: „Zu der Decke (?) führte eine lang gezogene, immer größer werdende 201 202 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Blutlache. Sie fließt auch nicht mehr, sondern ist wohl schon getrocknet, aber sie glänzt noch“. Aus diesem Sprachgebrauch wird auch die Wirkung traumatischer Erfahrungen bei vielen Betroffenen deutlich: das Ereignis ist nicht wirklich abgeschlossen, nicht Vergangenheit, sondern hält an, passiert gefühlsmäßig jetzt. Nachdem am Anfang das Geschehen geordnet, nach dem Ereignisfluss linearisiert und im Hinblick auf die eigene Perspektive kommentiert wird bricht der Handlungsstrang nach der Erörterung „wir spürten wohl etwas“ ab, und es kommen stattdessen aneinander gereihte visuelle Bilder. Wüsste man nicht, was geschehen ist, hätte man als Leser keine Chance, das Geschehen nachzuvollziehen. Es ist also ein deutlicher Kohärenzbruch. Auch durch den Wechsel von einzelnen Handlungen, unvermittelter Gedankenwiedergabe und Bildern entsteht der Eindruck von Fragmentierung. Hochauffällig ist, dass der Geschehensablauf selbst – also die Frage, was da passiert ist –, an keiner Stelle nachgeholt wird. Das Geschehen bleibt gewissermaßen anonym, ein Charakteristikum, das man in vielen Traumaerzählungen findet und als Hinweis auf eine Nichtverarbeitung gewertet werden muss (Deppermann & Lucius-Hoene, 2005). Durch derartige schriftliche Berichte ist der Einstieg in eine aktive Auseinandersetzung mit dem Trauma für viele Betroffene begonnen. Durch das Schreiben wird ihnen klarer, dass es ein Ereignis in der Vergangenheit war, mit einem Anfang, einem schrecklichen Höhepunkt und einem Ende. Sie können es als abgeschlossene Geschichte begreifen, erreichen eine gewisse Distanzierung und haben damit die Chance die durch das Trauma ausgelösten kognitiven und emotionalen Verwirrungen zu klären. Expositionsbehandlung Bestimmte Auslöser, so genannte Trigger-Reize haben eine besonders enge Verknüpfung zum Trauma und müssen mit Expositionsbehandlungen neutralisiert werden. In der Regel hat bereits ein Vermeidungsverhalten der betroffenen Person eingesetzt, um sich kurzfristige Erleichterungen zu verschaffen, was die Personen jedoch langfristig in ihrer Handlungsfreiheit und ihrem Aktivitätsspielraum erheblich einschränkt. Beispiel Expositionsbehandlung Lehrer Eine Lehrerin berichtete, dass sie bei jedem Film, in dem ein Messer als Waffe vorkam, oder in dem irgendeine Form von Gewalt mit Schreien vorkam, starke körperliche und psychische Belastungssymptome empfand. Durch derartige Szenen fühlte sie sich retraumatisiert und hatte anschließend schlaflose Nächte, die wiederum eine äußerst ungünstige Voraussetzung für den anstrengenden Schultag darstellten. Versuche, solchen Filmen aus dem Weg zu gehen waren nicht erfolgreich, da sie auch ohne es zu wollen, mit Szenen konfrontiert wurde, die die beschriebenen Symptome auslösten. Die Behandlung bestand darin, mit ihr eine ausgesuchte Szene eines Filmes mit Gewaltszenen in wiederholten Durchgängen anzuschauen und dabei ihre psychophysische Belastung zu beobachten. Die anfänglich sehr hohe Belastung wich einer zunehmenden kognitiven Distanzierung („das ist ja nur ein Film, es erinnert mich an den 09.11.99, aber es ist nur gespielt…“) und einer Abflachung der negativen Emotionen, bis zu einer deutlichen Habituation, die sie als sehr erleichternd empfand. 203 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Beispiel Expositionsbehandlung Schüler Ein Schüler, der sich nach seinem traumatischen Erlebnis einem kleinen medizinischen Eingriff unterziehen musste, geriet in Panik, als er dabei einen mit Blut getränkten Tupfer in einer Schale sah. Er sah die Szenen des Unfalltages vor sich und flüchtete aus dem Behandlungszimmer des Arztes. Jedes Mal in der Folgezeit, wenn er mit eigenem oder fremdem Blut konfrontiert wurde, zeigte er die gleichen heftigen Reaktionen einer Retraumatisierung. Er war nicht mehr in der Lage, sich eine Spritze geben zu lassen, obwohl er vor der Konfrontation mit der Mordtat nie eine Spritzenphobie gehabt hatte. In der Behandlung wurde er mit einer Spritze mit Blut konfrontiert. Beim Anblick der Spritze zeigte er eine so starke körperliche Verspannung/Verkrampfung, dass er kaum noch in der Lage war, zu gehen. Eine langsame Annäherung im Sinne einer systematischen Desensibilisierung ermöglichte es ihm nach 90 Minuten, die Spritze selbst in die Hand zu nehmen. Entscheidend auch bei dieser Behandlung war die kognitive Entkoppelung dieser Situation von der erlebten Traumatisierung. Abbildung B3.4: Brief eines Schülers zu Flashbacks und Vermeidungsverhalten 28. Februar 2000 „Hallo Herr Pieper, wie Sie mir geraten haben, werde ich meine Fragen und Probleme zu Papier bringen und Ihnen per Post zukommen lassen. 1. Frau L. (die getötete Lehrerin) hatte einen weinroten VW Golf, sportlich angelegt, wie ihr ganzes Wesen eben war. Dieser VW Golf bereitet mir nun Probleme. Der Golf stand am 09.11.99 direkt vor dem Schuleingang und ich konnte direkt darauf schauen, als wir im Nebenzimmer waren und nun warten mussten, was denn nun eigentlich geschehen war. Man hatte uns ja nichts gesagt. Auch am 10.11.99 kann es zu dieser „Einschleifung“ gekommen sein. Das Auto stand ganz einsam und ein wenig in der Ecke auf dem Schulhof. Ich musste an diesem Tag verstärkt, d. h. öfter als sonst, in das andere Gebäude unserer Schule und war allein unterwegs, weil der Rest ja in der Klasse saß und ich mich schon wieder auf das Zusammentrommeln aller Klassensprecher konzentrierte und da denkt man schon mal nach. Nach dem 09.11.99 bekomme ich regelmäßig, wenn ich ein Auto diesen Typs und gleicher Farbe sehe, Erinnerungsanflüge (Flashbacks?). Ich werde dann eine ganze Weile wieder den Gefühlen von damals ausgesetzt. 2. Nachts, oder anderweitig im Dunkeln, fühle ich mich „verfolgt“. Verfolgt manchmal von dem Täter oder komischerweise von Frau L. sowohl unversehrt, als auch stark verwundet. Ausgelöst werden diese Gedanken in meinem Gehirn meist, wenn ich vorher Messer angeschaut oder benutzt habe. Ich habe dann oft am Abend große Schwierigkeiten mit dem Einschlafen.“ Beispiel Selbstbeobachtung und Behandlung Schüler Die Behandlung auf der individuellen Ebene erforderte aus ökonomischen Gründen ein hohes Maß an eigenem Engagement von den einzelnen Schülern. Sie wurden bei- 204 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen spielsweise aufgefordert, eigene Verhaltensbeobachtungen durchzuführen und ihre Probleme schriftlich zu formulieren. Als weiteres Beispiel der Behandlung der Schüler auf der individuellen Ebene wird in Abbildung B 3.4 der Brief eines Schülers zum Thema Flashbacks und Vermeidungsverhalten vorgestellt. Aus den von ihm beschriebenen Auslösern „roter VW Golf“ und „Messer“ hatte sich bei ihm ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten entwickelt. Er ging nicht mehr in die Stadt und vermied zuhause die Küche. In einer Variante der Expositionsbehandlung wurde die Exposition vor einem roten VW Golf ebenfalls aus zeitökonomischen Gründen über SMS angeleitet und überwacht: Schüler: „Stehe seit 10 Minuten vor rotem Golf, bin auf 5, reicht das?“ Therapeut: „Versuche weiter runterzukommen, bleib noch 10 Minuten!“ Diese Methode kam bei den Jugendlichen sehr gut an und verhalf vielen, ihr Vermeidungsverhalten aufzugeben. EMDR Allen schwer belasteten Schülern und traumatisierten Lehrern wurden EMDRBehandlungen angeboten und mit vielen von ihnen durchgeführt. Durchweg zeigten sich bei allen Schülern und Lehrern deutliche Verbesserungen der Traumasymptomatik nach ein bis drei Sitzungen, besonders bei den intrusiven Symptomen und bei den Schuldgefühlen. Allerdings muss dabei betont werden, dass die EMDR-Behandlungen nicht die alleinigen therapeutischen Maßnahmen waren, sondern dass sie immer eingebettet waren in die oben beschriebene verhaltenstherapeutische Gesamtstrategie. Das im EMDR als besonders belastend empfundene Ausgangsbild, welches den schlimmsten Teil der traumatischen Erfahrung darstellt, war typischer Weise bei den Schülern: „Ich sitze in meiner Schulbank und sehe, wie das rote Blut aus der Halsschlagader der Lehrerin an die grüne Tafel spritzt“. Diese Bilder waren oft auch diejenigen, die die Schüler in Flashbacks oder Träumen heimsuchten. Durch die EMDR-Behandlung verloren diese Bilder oft an Schärfe und Gefühlsintensität, sie rückten in den Hintergrund oder waren für die Schüler gar nicht mehr fassbar. Als Beispiel sei in Abbildung B 3.5 der Brief einer Schülerin nach einer EMDR-Behandlung aufgeführt, die gerade in die Ferien fahren wollte. Abbildung B3.5: Brief einer Schülerin nach EMDR-Behandlung Meißen, 28.06.2000 „Hallo Herr Pieper, von Freitag bis heute ist überhaupt nichts Außergewöhnliches passiert. Alles ist wie immer – obwohl ich mich immer noch wundere, wie durch ein bisschen „Augen-hinund-herbewegen“ das schreckliche Bild fast verschwinden konnte. Es besteht nur noch aus Schatten und Umrissen und wenn ich nicht wüsste, wie es aussah, ich könnte es mir kaum noch vor dem inneren Auge vorstellen. Einen schönen Urlaub!“ B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord am Gymnasium Franziskaneum in Meißen Bei den Lehrern wurden EMDR-Behandlungen mit Erfolg zur Bearbeitung der Schuldgefühle, nicht oder nicht genügend geholfen zu haben, eingesetzt. Die Behandlung selbst wurde von den Lehrern in der Regel als anstrengend erlebt. Verblüffend für den Therapeuten, wie für die Betroffenen war dann jeweils die letztlich schnelle Distanzierung von anfangs als sehr belastend erlebten Gedanken, Bildern und Selbstbewertungen. Der Aufbau alternativer positiver Selbstbewertungen und angenehmerer innerer Erinnerungsbilder im Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis erwies sich für die Dauer des Beobachtungszeitraums als stabil. Offene Sprechstunde Durch eine offene Sprechstunde können Menschen erreicht werden, die nicht zu den offensichtlich Betroffenen zählen. Zu den in Meißen angebotenen Terminen kamen öfters Schüler und Lehrer, an die man bei der Konzeption eines Betreuungsprogramms kaum gedacht hätte, mit starken Belastungsreaktionen und Einschränkungen der psychischen Gesundheit bis hin zu Suizidalität, zum Beispiel: • eine Schülerin aus einer anderen Klasse, die nicht direkt mit dem Vorfall konfrontiert war, aber durch die Konfrontation mit dem Mord in ihrer unmittelbaren Nähe in eine depressive Identitätskrise mit suizidalen Gedanken geriet. • Ein Schüler, der ebenfalls nicht direkt konfrontiert war und nach seinem Abitur zur Bundeswehr ging. Dort stellte er fest, dass er bei der Ausbildung an der Waffe und dem Gedanken, dass diese Waffe zum Töten von Menschen konstruiert und gebaut war , erstmals und überfallartig an die Ereignisse seiner Schulzeit in Meißen erinnert wurde. Erst jetzt empfand er seine Erlebnisse und die vielen Medienberichte darüber als traumatisch und er beschäftigte sich zum ersten Mal intensiv mit dem Gedanken, was es eigentlich heißt, wenn ein Mensch getötet wird. Seine Verunsicherung war so fundamental, dass er Befehle der Vorgesetzten nicht ausführen konnte, er aus der Bundeswehr ausschied und den Dienst mit der Waffe verweigerte. • Eine Lehrerin, die als Vorgängerin der ermordeten Lehrerin in der Klasse 9 gewesen war. Sie war damals schwanger geworden und deswegen zum Mutterschaftsurlaub ausgeschieden. Sie selber hatte eine positive Beziehung zu dem Schüler, der später zum Mörder wurde und kam mit dem erschrockenen Gedanken, „was wäre gewesen, wenn ich noch in der Klasse gewesen wäre?“ Ihre Angst war jedoch nicht die, dann die Ermordete gewesen zu sein, sondern sie war davon überzeugt, dass es dann niemals zu einem Mord gekommen wäre. Sie fühlte sich schuldig und verantwortlich für die Tat. Zu ihrem Kind hatte sie eine stark ambivalente Beziehung, da sie in ihm die Inkarnation ihrer Schuld sah. „Wenn ich nicht schwanger geworden wäre, würde meine Kollegin noch leben.“ Bei derartigen Problemen, bei denen es oft um irrationale Verbindungen zu der Tat geht, sind offene psychotherapeutische Angebote wichtig. 205 206 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen 3.3 Qualitätssicherung und Evaluation 3.3.1 Methode Die Situation am Meißener Gymnasium nach dem Lehrerinnenmord war primär geprägt durch die direkten traumatischen Folgen der Tat auf die unmittelbaren und die mittelbaren Tatzeugen. Tathergang und Vorgeschichte setzten aber darüber hinaus eine eigenständige gruppendynamische Entwicklung in Gang, durch die die stereotype „rituelle Opposition“ zwischen Lehrern und Schülern, wie sie in mehr oder minder starker Ausprägung wohl an jeder Schule besteht, vertieft wurde. Ziel und Anlage der Untersuchung In Folge des Mordes entwickelten sich zusätzliche Belastungen, Spannungen und eine Stimmung allgemeinen Misstrauens zwischen den Betroffenen, überwiegend zwischen Lehrern und Schülern, aber auch innerhalb beider Gruppen. Aus klinischpsychologischer Sicht war interessant, welchen Einfluss die Entwicklung der sozialen Beziehungen auf die posttraumatischen Belastungen hatte. Hauptanliegen der Untersuchung war aber die gruppenstatistische Evaluation des in Meißen vom Autor angewendeten kognitiv-behavioralen Betreuungskonzepts. Zu diesem Zweck wurden zu drei Zeitpunkten innerhalb von zwei Jahren traumarelevante und allgemeine Belastungsmerkmale erfasst. Zur Erfassung der Zusammenhänge zwischen Belastungsmaßen und der Qualität sozialer Beziehungen wurden geeignete Indikatoren aus dem schulischen Kontext gebildet. Eine Besonderheit der Meißener Situation lag in der Altersverteilung der beiden Betroffenengruppen, Lehrer und Schüler. Erwachsene verschiedenen Alters standen Jugendlichen gegenüber, die zum Zeitpunkt der Traumatisierung alle etwa 14 bis 15 Jahre alt waren. Aus kognitiv-behavioraler Sicht von Interesse war deshalb auch die Frage, ob sich die betreuten Lehrer und Schüler in ihrer posttraumatischen Entwicklung unterschieden. Neben direkten Gruppenvergleichen der Belastungsmaße sollten hier Maße der individuellen Zielerreichung für zusätzliche Informationen sorgen. Teilnehmer der Untersuchung Die vorliegenden Daten wurden durch Fragebogenbefragungen zu drei Zeitpunkten gewonnen, die Rekrutierung der Probanden erfolgte im Rahmen der therapeutischen Betreuungsarbeit. Die Teilnahme war freiwillig, wurde aber allen Betroffenen am Meißener Gymnasium nahe gelegt. Allen Teilnehmern an der Untersuchung wurde die vertrauliche Behandlung und anonymisierte Auswertung der Daten zugesichert. Von allen Probanden wurde eine persönliche bzw. durch eine erziehungsberechtigte Person legitimierte schriftliche Einverständniserklärung eingeholt. Bezogen auf die beiden ersten Messzeitpunkte konnten 16 Teilnehmer an einer Einzeltherapie für die Untersuchung gewonnen werden (zehn Schüler, fünf Lehrer, eine Sek- 207 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen retärin, insgesamt 45,7% der Gesamtstichprobe). Auf Seiten der Nichtteilnehmer an einer Einzeltherapie liegen die Daten von 19 Personen vor (acht Schüler, zehn Lehrer, eine Sekretärin, 54,3% der Gesamtstichprobe). Die beiden Sekretärinnen wurden aus formalen Gründen der Gruppe der Lehrer zugeteilt. Insgesamt nahmen 35 Personen an den beiden ersten Befragungen teil, 18 Schüler und 17 Lehrer (vgl. Tabelle B 3.5). Für den Messzeitpunkt 3 stehen korrespondierende Daten von zehn Personen zur Verfügung (neun Schüler, eine Lehrerin), die Messung fand als Nachuntersuchung mit den unmittelbaren Tatzeugen und deren Klassenlehrerin zwei Jahre nach der Tat statt. Das Kriterium für die Einteilung in Teilnehmer und Nichtteilnehmer an einer Einzeltherapie ergab sich unmittelbar aus der therapeutischen Betreuungsarbeit. Alle Teilnehmer an dieser Untersuchung haben an den angebotenen Gruppenbetreuungsmaßnahmen teilgenommen. Das initiale Ausmaß der traumatischen Belastung führte bei manchen Betroffenen dazu, sich über die Gruppenbetreuungsmaßnahmen hinaus auch einer Einzeltherapie zu unterziehen. Da es sich bei den Probanden um eine anfallende Stichprobe geringer Größe handelte, konnten Teilnehmer und Nichtteilnehmer an einer Einzeltherapie nicht nach deskriptiven Merkmalen wie Alter und Geschlecht parallelisiert werden – die sich daraus ergebenden Unsicherheiten bei der Interpretation der Daten müssen akzeptiert werden. Tabelle B3.5: Betreute Lehrer und Schüler nach dem Lehrerinnenmord von Meißen 1999, Häufigkeitsverteilung über verschiedene Gruppierungsfaktoren, getrennt nach Einzeltherapie vs. nicht Einzeltherapie (N = 35) Gruppierung über … „Betroffenengruppe“ Lehrer Schüler Gesamt „Geschlecht“ männlich weiblich Gesamt keine Einzeltherapie* Einzeltherapie* Gesamt 11 8 (31,4%) (22,9%) 6 10 (17,1%) (28,6%) 17 18 (48,6%) (51,4%) 19 (54,3%) 16 (45,7%) 35 (100,0%) 5 14 (14,3%) (40,0%) 4 12 (11,4%) (34,3%) 9 26 19 (54,3%) 16 (45,7%) 35 (100,0%) (25,7%) (74,3%) Erläuterungen: *Die Gruppen „Keine Einzeltherapie“ und „Einzeltherapie“ haben die gleichen Gruppenbetreuungsmaßnahmen bekommen und unterscheiden sich nur in dem Kriterium, ob sie zusätzlich eine Einzeltherapie in Anspruch genommen haben, oder nicht. Von den 35 Teilnehmern waren 26 weiblichen und neun männlichen Geschlechts. Die Lehrer waren im Durchschnitt 42;10 Jahre alt (s = 7;4 Jahre; Männer M = 45;4, Frauen M = 42;4 Jahre), die Schüler 14;9 Jahre (s = 0;8 Jahre; Jungen M = 14;7, Mädchen M = 14;10 Jahre). 208 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Untersuchungsmaterialien Für die vorliegende Untersuchung wurden aus den verschiedenen Erhebungsinstrumenten, die während des Meißener Betreuungsprojekts zur Anwendung kamen, folgende Informationsquellen ausgewählt: 1) die Beschwerden-Liste (B-L, von Zerssen, 1976), Parallelformen B-L und B-L‘; 2) die Impact of Event Scale, revidierte Version (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998); 3) eine Zusammenstellung von Fragen zur Qualität sozialer Beziehungen im schulischen Umfeld. 4) Ein zweiteiliger Befragungsbogen zu persönlichen Zielen, Teil 1: Festlegung, und Teil 2: Einschätzung der Zielerreichung. Die beiden erstgenannten Fragebögen sind standardisierte psychodiagnostische Selbstbeurteilungsinstrumente, bei den beiden anderen handelt es sich um ad hoc für die Zwecke der Betreuung zusammengestellte Fragebögen. Außerdem wurden verschiedene gängige soziodemographische Informationen abgefragt. Zum Messzeitpunkt 2 wurde außerdem nach der Zufriedenheit mit der psychologischen Betreuung gefragt, um einen denkbaren Zusammenhang zwischen Therapieerfolg und Therapiezufriedenheit untersuchen zu können. Beschwerden-Liste, B-L. Die Beschwerden-Liste (B-L, von Zerssen, 1976) ist ein klinisch-psychologisches Selbstbeurteilungsinstrument zur Feststellung der allgemeinen psychophysischen Belastung. Die B-L liefert bei guter bis sehr guter Reliabilität einen mäßig varianzstarken Hauptfaktor (die psychophysische Belastung). Sie liegt in zwei hinreichend gut übereinstimmenden Parallelformen vor, jede Halbform besteht aus 24 Items. Einige zusätzliche Anmerkungen zu den Eigenschaften der B-L finden sich im Kapitel B 3. Im Unterschied zur Borken-Studie wurde die B-L hier ausschließlich in ihrer veröffentlichten Form, der Hauptfaktorenlösung, benutzt. Eine Extraktion von Unterfaktoren wäre bei einem N von 35 Personen mit sehr unleichmäßiger Altersverteilung methodisch nicht vertretbar gewesen. Impact of Event Scale, revidierte Version, IES-R. Die Impact of Event Scale, revidierte Version (IES-R, Maercker & Schützwohl, 1998) ist ein mehrdimensionales klinisch-psychologisches Selbstbeurteilungsinstrument zur Erhebung posttraumatischer Symptome mit insgesamt 22 Items. Die IES-R besteht in der von Maercker und Schützwohl veröffentlichten Form aus den drei Skalen Intrusion mit sieben Items, Vermeidung (acht Items) und Übererregung (Hyperarousal, sieben Items). Die Antwortskala ist vierfach gestuft und erfasst die Häufigkeit der Symptome innerhalb der vergangenen sieben Tage. Den Werten 0, 1, 3 und 5 entsprechen die Bedeutungen „Symptom liegt überhaupt nicht – … selten – … manchmal – … oft vor“. Aus Gründen der Übereinstimmung mit anderen Untersuchungen, insbesondere mit der ursprünglichen Form, der IES (Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979), schlagen Maercker und Schützwohl eine Formel zur Berechnung eines IES-R-Gesamtwerts aus den drei Subskalen vor. Die Gütekriterien der IES-R sind insgesamt zufriedenstellend. Die internen Konsistenzen der Subskalen liegen zwischen .70 (Vermeidung) und .90, die diagnostische Sensi- B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen tivität des Gesamtwerts ist von vergleichbarer Güte. Kritisiert wird insbesondere die faktorielle Instabilität der Skala Vermeidung und ihre teilweise Assoziation mit Merkmalen emotionalen Numbings, sowie die vergleichweise deutliche Positionsinstabilität, die mutmaßlich mit Merkmalsfluktuationen im Bereich der Vermeidung zusammenhängen könnte (Maercker & Schützwohl, 1998). Hier wird diskutiert, ob Vermeidung als sekundäres oder reaktives Symptom zeitversetzt auf anhaltende Intrusionen und Übererregungszustände folgt, was die beobachteten Positions- oder Zuordnungsinstabilitäten erklären könnte. Unter anderem aus diesen Gründen folgen wir den Empfehlungen der Autoren und berücksichtigen neben dem IES-RGesamtwert explizit auch die drei Subskalen-Scores. Normen liegen für die IES-R zur Zeit nicht vor, für die diagnostische Einschätzung der posttraumatischen Belastung wurde aber von den Autoren ein Cut-off für den Gesamtwert ermittelt. Als Anzeige einer klinisch relevanten Belastung gilt danach ein Score größer als Null, alle Werte kleiner oder gleich Null werden als „nicht belastet“ interpretiert. Diagnostische Kriterien für die drei Subskalen-Scores liegen leider nicht vor. Fragen zur Qualität sozialer Beziehungen. Zur Einschätzung der Qualität sozialer Beziehungen im schulischen Kontext wurden insgesamt zehn unterschiedliche Fragen formuliert und auf zwei Erhebungszeitpunkte verteilt. Gefragt wurde nach „Kontakt, Nähe und Austausch …“ 1) mit dem Täter, 2) mit der verstorbenen Lehrerin, 3, 4) mit den Angehörigen der eigenen Gruppe (gefragt wurde nach „den Kollegen“ resp. „den Mitschülern“; diese Frage wurde zu zwei Zeitpunkten gestellt), 5–7) den Angehörigen der „oppositionellen“ Gruppe (gefragt wurde nach „den Lehrern“ resp. „den Schülern“; diese Frage wurde zweimal zum aktuellen Zustand und einmal retrospektiv zum Zustand vor der Tat gestellt), 8, 9) mit den eigenen Eltern (Frage nur an die Schüler, zweimal zum aktuellen Zustand), 10) mit den Eltern der Schüler (Frage nur an die Lehrer, einmal). Als Beantwortungsmodus wurde die Schulnotenskala gewählt, mit Werten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Vertrautheit der Betroffenen mit diesem Maßstab führte dazu, dass gelegentlich auch halbe Noten vergeben wurden. Halbe Noten wurden als solche akzeptiert und in den Datensatz übernommen. Zielerreichungsmaß. Die Teilnehmer an der vorliegenden Untersuchung wurden gebeten, drei persönliche Ziele zu benennen, die sie im Lauf der folgenden Monate erreichen wollten. Diese persönlichen Ziele sollten im Zusammenhang mit der Bewältigung der traumatischen Ereignisse stehen, enge Vorgaben oder Vorschläge wurden aber nicht gemacht, Auswahl und Formulierung war also vollständig frei. Nach Ablauf des ersten Jahres nach dem Unglück wurden den Teilnehmern die von ihnen formulierten Ziele wieder vorgelegt, anschließend wurden sie gebeten, prozentual einzuschätzen, wie gut sie glaubten, diese erreicht zu haben. Die vorgegebene Antwortskala war in 5%-Schritten abgestuft, beginnend bei 5% (wobei sich aber der eine oder andere Teilnehmer die Freiheit nahm, die nicht vorgesehene 0%-Marke von sich aus zu ergänzen – was als ebenfalls gültiger Wert betrachtet wurde). 209 210 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Aus Fragen zur freien Beantwortung ergibt sich immer die Problematik einer angemessenen gruppenstatistischen Auswertung. Im vorliegenden Fall wäre eine inhaltliche Einteilung aller abgegebenen Antworten in Unterkategorien wenig erfolgversprechend gewesen, die Spannbreite formulierter Ziele war beeindruckend breit und vor allem einzelfalldiagnostisch sehr interessant. Bei Sichtung der Daten stellten sich aber drei Besonderheiten heraus: (1) Nicht alle Teilnehmer hatten sich an die Vorgabe gehalten, drei Ziele zu formulieren – einige formulierten weniger als drei; manche formulierten mehr als drei; bei anderen war klar zu erkennen, dass sich hinter einer Formulierung tatsächlich zwei oder mehr Ziele versammelten, die teilweise nur sehr locker miteinander assoziiert waren und als völlig eigenständig betrachtet werden konnten. (2) Interessanter war die inhaltliche Ausrichtung der Ziele. Es wurde deutlich, dass eine grobe Klassifizierung der Antworten in funktionale (für die Traumabewältigung günstigen), und in dysfunktionale (aus behavioraler Sicht für die Traumabewältigung ungünstigen) Zielen erfolgen musste, um zu einer interpretierbaren Zielerreichung zu kommen. Ein recht häufig beobachtetes Beispiel eines derartigen dysfunktionalen Ziels war der Wunsch, so wenig wie möglich an das Ereignis denken zu wollen, so selten wie möglich daran erinnert und am besten von niemandem darauf angesprochen zu werden. (3) Eine dritte Kategorie stellten Ziele, oder besser Wünsche, dar, die klar außerhalb jeder persönlichen Einflussnahme liegen und deshalb nicht als „Ziel, das ich erreichen möchte“, gewertet werden konnten. Antworten aus dieser Kategorie wurden als „indifferent bzw. nicht klar zuzuordnen“ bewertet. Daraus ergab sich für alle vorliegenden Antworten folgendes Vorgehen: 1. Aus Teilzielen kombinierte Ziele wurden getrennt. 2. Jede Antwort wurde kategorisiert als • funktional, • dysfunktional, oder • indifferent. Alle nach dieser Methode ermittelten gültigen Ratings zu funktionalen und zu dysfunktionalen Zielen wurden – ohne weitere Differenzierung des Themas bzw. des Inhalts – zu je einem Mittelwert der Zielerreichung zusammengefasst. Anschließend wurde die Differenz aus mittlerer funktionaler und mittlerer dysfunktionaler Zielerreichung gebildet, woraus sich ein pragmatisch brauchbarer Schätzwert für das Verhältnis von funktonaler und dysfunktionaler Zielerreichung ergab. Aus verhaltenstherapeutischer Sicht stand dahinter die Überlegung, dass eine Person durch funktionale Zielerreichung in therapeutisch erwünschtem Verhalten bestärkt, durch ein ungünstiges Verhältnis von funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung – oder durch „Erfolg im Erreichen dysfunktionaler Ziele“ – in ungünstigen Verhaltenweisen bestätigt werden kann. Für weitergehende Analysen wurden der Mittelwert zur Erreichung funktionaler Ziele und der Differenzwert herangezogen. Untersuchungsablauf Die Datenerhebung war unmittelbar in die therapeutische Betreuung integriert und fand zu drei Zeitpunkten statt (vgl. auch Tabelle B 3.6). 211 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Erhebungszeitpunkt 1. Die ersten Daten wurden im Februar 2000, drei Monate nach der Tat, erhoben. Es wurden verschiedene soziodemografische Informationen erfasst, und es wurden die erste Serie der Fragen zur Qualität sozialer Beziehungen, die IES-R, und die B-L in der Parallelform B-L‘ vorgelegt. Außerdem wurden die Teilnehmer gebeten, drei persönliche Ziele für das kommende Jahr zu formulieren, die sie im Zusammenhang mit der Bewältigung des Unglücks gerne erreichen würden. Aus dieser Erhebung liegen N = 37 Datensätze vor. Erhebungszeitpunkt 2. Neun Monate später, also etwa ein Jahr nach der Tat, wurden die B-L in der Parallelform B-L, ein zweites Mal die IES-R, und die zweite Serie der Fragen zur Qualität sozialer Beziehungen erhoben. Die Teilnehmer bekamen außerdem die von ihnen formulierten Ziele wieder vorgelegt, mit der Bitte, jetzt prozentual einzuschätzen, wie gut sie jedes einzelne Ziel erreicht hätten. Es wurden N = 35 Datensätze gewonnen. Erhebungszeitpunkt 3. Zwei Jahre nach der Tat wurde einem Teil der ursprünglichen 35 Teilnehmer ein drittes Mal die IES-R vorgelegt. Es handelte sich hierbei um insgesamt 15 Schüler aus der Klasse, in der die Tat stattgefunden hatte, sowie um ihre Klassenlehrerin. Die Übereinstimmungsquote der Fragebögen zwischen den Messzeitpunkten 1 und 2 betrug 94,6% (35 von 37), was im Wesentlichen auf die engmaschige und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der Betreuung zurückgeführt wird. Von den zum Messzeitpunkt 3 erhobenen 15 IES-R-Fragebögen liegen für fünf Schüler keine korrespondierenden Fragebögen aus den Messungen 1 und 2 vor, es konnten also effektiv n = 10 Fragebögen für eine dreifache Messwiederholungsanalyse benutzt werden. Tabelle B3.6: Verwendete psychodiagnostische Maße der Meißen-Studie, aufgeschlüsselt nach Bearbeitungsmodus und Erhebungszeitpunkten Instrument Akronym Beschwerden-Liste Impact of Event Scale, revidierte Version Fragen zur Qualität sozialer Beziehungen Befragungsbögen zur Zielerreichung 3.3.2 Messzeitpunkt nach dem Unglück 3 Monate 1 Jahr 2 Jahre B-L/B-L' IES-R selbst (B-L‘) selbst selbst (B-L) selbst — selbst — Festlegung von 3 Zielen selbst [1 Item retrospekt.] Selbstbeurteilung der Zielerreichung — selbst (n = 10) — — Ergebnisse Dateneingabe und -auswertung erfolgten nach Festlegung geeigneter Kodierungsvorschriften im Programmpaket SPSS, Version 11. Scores wurden aus den Rating-Werten programmgesteuert berechnet. Ursprünglich aus therapeutischen Gründen und für die Studie zu deskriptiven Zwecken 212 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen wurden alle Probanden nach den Trennwerten für B-L und IES-R in Belastungsgruppen eingeteilt. Kriterium für die B-L sind Scores größer oder gleich 22. Die Klassifikation nach den Ergebnissen der IES-R wurde in Anlehnung an Maercker und Schützwohl (1998) vorgenommen, aber aus Gründen der höheren diagnostischen Aussagekraft geringfügig modifiziert. Nach Maercker und Schützwohl gelten IES-R-Scores größer 0 als Indikatoren für eine posttraumatische Belastungsstörung, alle Scores kleiner oder gleich 0 gelten als „nicht belastet“. Ausgehend vom klinischen Bild der Meißener Schüler und Lehrer wurde entschieden, Scores größer als Null als „schwere Belastung“, Scores von 0 bis -.99 als „mittlere“, und Scores kleiner oder gleich -1.0 als „geringe/keine Belastung“ aufzufassen – die Gruppen „mittlere“ und „leichte Belastung“ entsprechen damit dem Kriterium „keine Belastung“ nach Maercker und Schützwohl. Analysestrategie Inferenzstatistisch abgeklärt werden sollten die folgenden Fragen: 1) Verändern sich die Belastungsmaße im Vergleich der Messzeitpunkte 1 und 2, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Einflüsse von Einzeltherapie vs. nicht Einzeltherapie, und der Zugehörigkeit zur Betroffenengruppe der Lehrer oder Schüler? 2) Gibt es (weitere) Veränderungen in den Belastungsmaßen der IES-R, die sich unter Einbeziehung des Messzeitpunkts 3 absichern lassen? 3) Gibt es Zusammenhänge zwischen den Maßen zur Qualität der sozialen Beziehungen und den Belastungsmaßen? 4) Ist es möglich, die Zielerreichung aus der posttraumatischen Belastung abzuleiten; gibt es Unterschiede zwischen Personengruppen? Wichtigster Aspekt der Datenanalyse war die Abklärung der Frage nach Veränderungen in den Belastungsmaßen über die Zeit. Die Belastungsmaße waren nach Kolmogorov-Smirnov-Test hinreichend normal verteilt, es konnten dreifaktorielle Varianzanalysen mit zweifacher Messwiederholung gerechnet werden, im Fall der B-L mit dem Score, im Fall der IES-R sowohl mit dem Gesamtwert als auch mit den Subskalen-Scores für Intrusion, Vermeidung und Übererregung (N = 35) als abhängige Variablen. Unabhängige Variablen waren neben der Messwiederholung die Faktoren „Therapiebedingung“ („Teilnehmer“ vs. „Nichtteilnehmer“ an einer Einzeltherapie) und „Betroffenengruppe“ (Lehrer vs. Schüler). Mit der bereits beschriebenen Teilstichprobe von N = 10 Personen konnten einfaktorielle Varianzanalysen mit dreifacher Messwiederholung für die Scores der IES-R (Intrusion, Vermeidung, Übererregung, Gesamtwert) gerechnet werden. Da bei einer Stichprobengröße von zehn Personen Voraussetzungsüberprüfungen nur von beschränktem Wert sind, wurde entschieden, Freiheitsgrade prinzipiell zu korrigieren. Um den Nachteil dieser Strategie zu kompensieren, u.U. zu konservativ zu entscheiden, wurde als Verfahren die vergleichsweise liberale epsilon-Korrektur nach HuynhFeldt gewählt. Alle Analysen wurden mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von alpha = 5% abgesichert, alle abhängigen Variablen wurden univariat analysiert. Für die dreifaktoriellen Varianzanalysen liegt ein nicht-orthogonales varianzanalytisches Design vor. Grundlage für Mittelwertvergleiche sind die ungewichteten Randmittel, gerechnet wurden Varianzanalysen nach dem Allgemeinen Linearen Modell (Generalized Linear Model, GLM). B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Zur Absicherung der varianzanalytischen Auswertungspläne wurden vor Beginn der Datenauswertung Power-Analysen durchgeführt. Die Zusammensetzung der MeißenStichprobe lässt eine verlässliche statistische Absicherung großer Effekte erwarten, die geringe Fallzahl in der kleinsten Teilstichprobe (n = 6 Personen) kann durch den bekannten Gewinn an Power in Messwiederholungsdesigns teilweise kompensiert werden. Einschränkungen der Aussagekraft sind aber bei den Haupteffekten der Zwischensubjektfaktoren einzukalkulieren – hier sind die Möglichkeiten des GLM an ihren unteren Grenzen angelangt. Die beiden Haupteffekte, „Einzeltherapiebedingung“ und „Betroffenengruppe“, müssen also im Fall ihrer Signifikanz kritisch interpretiert werden. Die Verteilungsformen der Items zur Qualität der sozialen Beziehungen weichen laut Kolmogorov-Smirnov-Test überwiegend deutlich von der Normalverteillungsform ab, hier kommen nur verteilungsfreie Analyseverfahren in Frage. Zur Abklärung von Zusammenhängen mit den Belastungsmaßen der ersten beiden Messzeitpunkte wurden Rangkorrelationen nach Pearson berechnet. Von den Ergebnissen der Rangkorrelationen sollte abhängig gemacht werden, ob logistische Regressionen zur Zuordnung von Belastungsgruppen auf der Basis der Qualität der sozialen Beziehungen für weitere Aufklärung sorgen könnte. Im Fall der beiden Maße zur Zielerreichung (funktionale Zielerreichung, Differenzwert aus funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung) sollten sowohl Gruppenunterschiede (Faktoren „Betroffenengruppe“ und „Therapiebedingung“) als auch Zusammenhänge mit den Belastungsmaßen untersucht werden. Während der Mittelwert der funktionalen Zielerreichung nach Kolmogorov-Smirnov hinreichend gut normalverteilt war, konnte die Normalverteiltheit des Differenzwerts nicht bestätigt werden. Zwar zeigte der Test keine eindeutige Verletzung an (K-S Z = 1.108, p = .172), das Streudiagramm zeigte aber Anzeichen einer rechtssteilen Verteilung. Hier wurden eine zweifaktorielle Varianzanalyse gerechnet, alle Effekte wurden außerdem durch nichtparametrische Tests gegengetestet. Zusammenhänge wurden mit Rangkorrelationen abgeklärt. Analyse der Belastungshäufigkeiten Kurz nach Beginn der Betreuungsmaßnahmen, drei Monate nach der Tat, mussten insgesamt 22 von 35 Personen (62,9%) nach den Kriterien der B-L als schwer belastet gelten, 13 dieser schwer belasteten Personen nahmen an einer Einzeltherapie teil. Zum Messzeitpunkt 2, ein Jahr nach der Tat, war die Belastungsstärke bei sieben dieser 13 Personen (53,8%) soweit reduziert, dass sie als nicht bzw. nur minder schwer belastet nach B-L gelten konnten. Von den neun Personen, die nicht an einer Einzeltherapie teilgenommen hatten, wechselten dagegen im gleichen Zeitraum nur zwei Personen (22,2%) in die Gruppe der laut B-L leicht bzw. nicht Belasteten. Die Klassifikation der Belastungsgruppen nach IES-R wies zu Messzeitpunkt 1 drei Personen ohne Einzeltherapie als schwer belastet aus, drei waren mittel, 13 leicht/nicht belastet. In der Gruppe der Personen mit Einzeltherapie waren zu dieser Zeit acht Personen schwer, sieben mittelschwer und eine Person leicht belastet. Zu Messzeitpunkt 2 wechselten aus der Gruppe der mittelschwer belasteten Personen ohne Einzeltherapie zwei in die Gruppe der leicht/nicht belasteten – bei einer Person hatte sich in der Zwischenzeit der Zustand dagegen verschlechtert. Im Vergleich dazu 213 214 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen verringerte sich bei den Personen mit Einzeltherapie die Gruppe der schwer belasteten um 50% auf vier Personen, die Gruppe der leicht/nicht belasteten Personen wuchs von einer auf zehn an. Tabelle B 3.7 gibt einen Überblick über die Häufigkeitsverteilungen. Tabelle B3.7: Häufigkeitsverteilungen der Belastungsstärke, beurteilt mit der Beschwerden-Liste (B-L) und der Impact of Event Scale, revidierte Version (IES-R), gruppiert nach Teilnahme an Einzeltherapie vs. nicht Einzeltherapie (N = 35) Gruppierung über … k. Einzeltherapie Einzeltherapie Gesamt BL – Messzeitpunkt 1 schwer belastet (Score ≥ 22) leicht belastet (Score < 22) 9 10 (25,7%) (28,6%) 13 3 (37,1%) (8,6%) 22 13 (62,9%) (37,1%) BL – Messzeitpunkt 2 schwer belastet (Score ≥ 22) leicht belastet (Score < 22) 7 12 (20,0%) (34,3%) 6 10 (17,1%) (28,6%) 13 22 (37,1%) (62,9%) IES-R – Messzeitpunkt 1 schwere Belastung (Score > 0) mittlere Belastung (0 bis –0.99) 3 3 (8,6%) (8,6%) 8 7 (22,9%) (20,0%) 11 10 (31,4%) (28,6%) leichte/keine Belastung (≤ –1.0) 13 (37,1%) 1 (2,9%) 14 (40,0%) IES-R – Messzeitpunkt 2 schwere Belastung (Score > 0) 4 (11,4%) 4 (11,4%) 8 (22,9%) mittlere Belastung (0 bis –0.99) 1 (2,9%) 2 (5,7%) 3 (8,6%) leichte/keine Belastung (≤ –1.0) 14 (40,0%) 10 (28,6%) 24 (68,6%) Erläuterungen: (1) Messzeitpunkt 1 drei Monate nach dem Unglück; Messzeitpunkt 2 ein Jahr nach dem Unglück. (2) IES-R Gesamtwert berechnet nach Maercker und Schützwohl, 1998; Klassifikation der Belastungsgruppen Pieper, 2000, in Anlehnung an Maercker und Schützwohl, 1998 – die Gruppen „mittlere“ und „leichte Belastung“ entsprechen dem Kriterium „keine Belastung“ nach Maercker und Schützwohl. Gruppenunterschiede und Veränderungen in den Belastungsmaßen Zur Abklärung von Veränderungen in den Belastungsmaßen wurden dreifaktorielle Varianzanalysen mit zweifacher Messwiederholung gerechnet (N = 35), Gruppenfaktoren waren die Therapiebedingung (zwei Faktorstufen, „Einzeltherapie“ vs. „keine Einzeltherapie“), und der Faktor Betroffenengruppe („Lehrer“ vs. „Schüler“). Abhängige Variablen wurden univariat behandelt. Ergebnisse zur B-L Die Mittelwerte der B-L verteilten sich im Vergleich der einzelnen Faktorstufenkombinationen zwischen 14.2 und 30.7 Punkten (vgl. Tabelle C 1a im Anhang C). Es wurden B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen keine Verletzungen varianzanalytischer Voraussetzungen festgestellt, die Ergebnisse der Analyse sind interpretierbar. Die Interaktion zwischen dem Messwiederholungsfaktor, B-L' vs. B-L, und dem Faktor Therapie-Bedingung wurde signifikant (F(1, 31; 95%) = 7.32, p = .011), der Effekt ist von mittlerer Größe (etap2 = .191). Die Interaktion ist vom ordinalen Typ, die beiden beteiligten Haupteffekte sind ebenfalls statistisch bedeutsam und eigenständig interpretierbar (Messwiederholungsfaktor F(1, 31; 95%) = 29.78, p < .001, etap2 = .49; TherapieBedingung F(1, 31; 95%) = 4.7, p = .038, etap2 = .132). Der Faktor Betroffenengruppe und seine Interaktionen wurden dagegen nicht signifikant (vgl. Tabelle C 1b, Anhang C). Bedeutsam ist zunächst der Einfluss der Therapie-Bedingung. Mit M = 24.9 gegenüber 17.9 haben die Personen mit Einzeltherapie über beide Messzeitpunkte gemittelt die deutlich höheren Belastungswerte im Vergleich zu den Personen ohne Einzeltherapie. Das Verhältnis beider Mittelwerte zueinander entspricht der therapeutischen Indikation. Ebenfalls deutlich fällt der Unterschied zwischen den beiden Messzeitpunkten, ohne Berücksichtigung eines Gruppenfaktors, aus. Die Belastung zu Messzeitpunkt 1 liegt mit M = 24.9 deutlich über der zu Messzeitpunkt 2 (M = 17.8). Der Mittelwert zum Messzeitpunkt 1 überschreitet den Cut-off-Wert der B-L, er muss als Anzeige deutlich erhöhter Belastung gelten. Der Effekt der Belastungsreduktion ist als groß zu bewerten. Die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen Therapie-Bedingung und Messwiederholung bestätigt, dass sowohl bei Personen mit als auch bei Personen ohne Einzeltherapie zwischen den beiden Messzeitpunkten eine bedeutsame Reduktion der Belastung stattfindet (p = .048, etap2 = .120 für Personen ohne, p < .001, etap2 = .493 für Personen mit Einzeltherapie). Die Belastungsreduktion fällt aber für Personen mit Einzeltherapie deutlich größer aus als für Personen ohne Einzeltherapie (10.6 vs. 3.6 Punkte) – während sich die Mittelwerte beider Gruppen zu Messzeitpunkt 1 noch deutlich voneinander unterschieden, war dieser Unterschied zu Messzeitpunkt 2 mit 3.5 Punkten nur noch numerischer Natur, statistisch aber nicht mehr bedeutsam (p = .384). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Belastung aller Personen, egal ob mit oder ohne Einzeltherapie, in der Zeit zwischen den Messzeitpunkten deutlich zurückging, dass aber die initial deutlich höher belasteten Personen mit Einzeltherapie am Ende in etwa das gleiche Belastungsniveau erreicht hatten wie die Personen ohne Einzeltherapie und damit im Betrag die stärkste Besserung zeigten (vgl. auch Abbildung B 3.6 (5)). Zwischen Lehrern und Schülern ist dagegen kein Unterschied in der allgemeinen psychophysischen Belastung feststellbar, auch die Belastungsreduktion zwischen beiden Messzeitpunkten fällt für beide Gruppen etwa gleich aus. Ergebnisse zur IES-R Die Ergebnisse der IES-R sind in wesentlichen Teilen mit denen der B-L vergleichbar. Überwiegend wurden keine Voraussetzungsverletzungen festgestellt, lediglich im Fall der Skala Übererregung zeigte der Levene-Test eine geringfügige Abweichung der Varianzhomogenität an (Messzeitpunkt 1 p = .033; Messzeitpunkt 2 p = .098). Im Gesamtkontext der Belastungsanalysen wird dieser Befund als unerheblich bewertet, da sich die Ergebnisse der Skala Übererregung deckungsgleich zu den übrigen Teilergebnissen verhalten. 215 216 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Abbildung B3.6: Belastungsmaße IES-R und B-L’/B-L – Interaktionen zwischen der zweifachen Messwiederholung und der Therapie-Bedingung (N = 35) B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Wie bei der B-L sind für die Scores IES-R Intrusion, Übererregung und für den Gesamtwert die Interaktionen zwischen Therapie-Bedingung und Messwiederholung, sowie die Haupteffekte Therapie-Bedingung und Messwiederholung statistisch bedeutsam. Die Interaktionen sind vom ordinalen Typ, beide Haupteffekte sind interpretierbar. Abgesehen von geringfügigen numerischen Differenzen in den teststatistischen Kennwerten liegt das gleiche Bild wie bei der B-L vor. In der Quintessenz zeigen Personen mit Einzeltherapie die stärkste Belastungsreduktion (bei höherer initialer Belastung), die Belastungswerte von Personen mit und ohne Einzeltherapie lassen sich zum Messzeitpunkt 2 statistisch nicht mehr voneinander unterscheiden. Einzelheiten können den Tabellen C 2a und C 2b sowie C 4a bis C 5b im Anhang C entnommen werden. Abweichend von den Ergebnissen der B-L wurden aber für diese drei Maße die Wechselwirkungen zwischen Therapie-Bedingung und Betroffenengruppe signifikant. Die Effekte der betroffenen Variablen unterscheiden sich nur geringfügig voneinander, Durchgängige Ursache ist ein recht einheitliches Muster in der Mittelwertverteilung. Zum einen haben Schüler mit gegenüber Schülern ohne Einzeltherapie die höheren Belastungswerte, bei den Lehrern findet sich ein solcher Unterschied nicht. Zum anderen unterscheiden sich, wie sich bereits vermuten lässt, die Lehrer ohne Einzeltherapie von den Schülern ohne Einzeltherapie – auch hier sind die niedrigen Belastungswerte der Schülergruppe für das Ergebnis verantwortlich. Ein weiterer Unterschied zu den Ergebnissen der B-L ergibt sich für die Vermeidungsskala der IES-R – in der dreifaktoriellen Varianzanalyse wurde keiner der Effekte signifikant. Weder unterscheiden sich die Belastungen zu den beiden Messzeitpunkten, noch unterscheiden sich Lehrer von Schülern oder Personen mit von Personen ohne Einzeltherapie, noch gibt es Unterschiede in einer beliebigen Interaktion. Bei einer Verteilung der Mittelwerte von M = 9.3 bis 20.4 muss dafür die teilweise zu geringe Teststärke verantwortlich gemacht werden. Wir halten diesen Befund aber trotzdem und aus einem anderen Grund für einen der wichtigsten der vorliegenden Untersuchung. Dreifache Messwiederholung der IES-R. Im Fall der IES-R konnte für N = 10 Personen eine Serie Varianzanalysen mit dreifacher Messwiederholung gerechnet werden. Nach den errechneten Huynh-Feldt-epsilon ergab sich keine Notwendigkeit für eine Korrektur der Freiheitsgrade (vgl. Tabellen C 6a und C 6b im Anhang C). Für IES-R Intrusion, Übererregung und für den Gesamtwert ergaben paarweise Mittelwertvergleiche ein einheitliches Bild. In Übereinstimmung mit den Varianzanalysen mit zweifacher Messwiederholung fanden zwischen den Messzeitpunkten 1 und 2 statistisch bedeutsame Belastungsreduktionen statt. Diese Unterschiede blieben auch im Vergleich des ersten mit dem dritten Messzeitpunkt erhalten. Zwischen den Messzeitpunkten 2 und 3 kam es allerdings zu keiner weiteren Belastungsreduktion, die statistisch bedeutsam gewesen wäre, obwohl sich rein numerisch auch in diesem Zeitraum ein weiteres Nachlassen der Belastung feststellen lässt. Die Reduktion fällt hier allerdings vergleichsweise gering aus und erreicht lediglich beim Gesamtwert ein Niveau, das von praktischem Interesse ist. Dieses letzte Teilergebnis lässt sich aus dem Beitrag von Intrusion und Übererregung am Gesamtwert nicht ableiten, es ist auf den Einfluß der Vermeidungsskala zurückzuführen. Die dreifache Messwiederholung bestätigt, wie bereits in der dreifaktoriellen Varianzanalyse festgestellt, dass die Belastungsstärke zwischen den Messzeitpunkten 1 und 2 annähernd konstant ist (M = 19.3 vs. 18.1, p = 1.0). Eine bedeutsame und 217 218 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen sehr deutlich ausfallende Belastungsreduktion zeigt sich aber zwischen den Messzeitpunkten 2 und 3 (M = 18.1 vs. 10.0, p = .037). Das Merkmal IES-R Vermeidung verhält sich hier im Vergleich zu den Merkmalen Intrusion und Übererregung exakt entgegengesetzt (vgl. Abbildung B 3.7). Abbildung B3.7: Belastungsmaße der IES-R – dreifache Messwiederholung (N = 10) Unterschiede in der Zielerreichung, Zusammenhänge mit den Belastungsmaßen Neben der Abklärung von Gruppenunterschiede und Veränderungen in den Belastungsmaßen sollte der Einfluß der individuellen Zielerreichung und der Qualität sozialer Beziehungen auf die Belastung erkundet werden. Vor Abklärung der Zusammenhänge wurde je eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit dem Mittelwert der funktionalen Zielerreichung und mit dem Differenzwert aus funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung gerechnet (N = 34), Faktoren waren in beiden Fällen die Therapiebedingung und der Faktor Betroffenengruppe. B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Unterschiede in der Zielerreichung Funktionale Zielerreichung. Voraussetzungsverletzungen wurden in dieser Analyse keine festgestellt. Die Mittelwerte der abhängigen Variablen lagen zwischen 46.3% und 64.9%. Keiner der untersuchten Effekte wurde signifikant. Die Effektgrößen der Haupteffekte sind zwar erwähnenswert, die Spanne zwischen den Mittelwerten erscheint aber aus praktischer Sicht unbedeutend (vgl. Tabellen C 7a und C 7b, Anhang C). Differenz aus funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung. Ein interessantes, methodisch aber nicht eindeutig interpretierbares Bild ergab sich aus der Varianzanalyse des Differenzwertes aus funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung. Die Mittelwerte verteilten sich zwischen -4.4% als kleinstem und 64.9% als größtem Wert. Die dazugehörigen Standardabweichungen betrugen 58.1 und 25.4, der Levene-Test zeigte folgerichtig eine gravierende Abweichung in der Varianzhomogenität an (p = .001). Würde man dieser Analyse folgen, dann wäre der Unterschied innerhalb der TherapieBedingung bei einem mittleren Effekt sehr signifikant (F(1, 3; 95%) = 8.85, p = .006, etap2 = .228). Der Faktor Betroffenengruppe wäre signifikant, ebenfalls bei einem Effekt mittlerer Größe (F(1, 3; 95%) = 6.92, p = .013, etap2 = .188). Nicht signifikant wäre die Interaktion zwischen der Therapie-Bedingung und der Betroffenengruppe – ein Blick auf die Mittelwerttabelle zeigt aber, dass die Unterschiede in den Haupteffekten vermutlich ausschließlich auf den Beitrag des ungünstigen Differenzwerts der Schüler ohne Einzeltherapie zurückzuführen sind, während sich die anderen drei Mittelwerte der Interaktion zumindest aus praktischer Sicht nicht maßgeblich voneinander unterscheiden (vgl. Tabelle C 11a und C 11b im Anhang C). Die Interaktion zwischen Therapie-Bedingung und Betroffenengruppe wurde als interessantestes Teilergebnis einer Gegenprobe mit nichtparametrischen Tests unterzogen. Nach geeigneter Umkodierung (Lehrer und Schüler, jeweils mit und ohne Einzeltherapie) wurde eine Varianzanalyse für Rangdaten nach Kruskall-Wallis gerechnet. Der Test fiel mit p = .048 signifikant aus (Chi-Quadrat = 7.919, df = 3). Anschließende paarweise Vergleiche der Teilstichproben mit dem U-Test von Mann-Whitney bestätigten einen signifikanten Unterschied zwischen den Schülern ohne und den Schülern mit Einzeltherapie (p = .029). Der Vergleich zwischen den Lehrern und den Schülern ohne Einzeltherapie verfehlte mit p = .055 knapp die Signifikanzgrenze, alle anderen Vergleiche blieben unbedeutend. Zusammenfassend lässt sich den Ergebnissen entnehmen, dass sich die Schüler ohne Einzeltherapie von den anderen Betroffenengruppen durch ein insgesamt auffallend ungünstiges Verhältnis von dysfunktionaler und funktionaler Zielerreichung abheben. Zusammenhänge zwischen funktionaler Zielerreichung und Belastungsmaßen Funktionale Zielerreichung und Belastungsmaße. Zur Aufklärung der Frage, ob zwischen der funktionalen Zielerreichung und einzelnen Belastungsmaßen systematische Zusammenhänge bestehen, wurden verschiedene Multiple Regressionen gerechnet. Kriteriumsvariable war der Mittelwert der funktionalen Zielerreichung, die verschiedenen Belastungsmaße aus den ersten beiden Messungen wurden als Prädiktoren aufgefasst. In jedes Regressionsmodell wurden maximal drei Prädiktoren aufgenommen. Es wurden insgesamt vier Modelle analysiert, Modell 1 mit den Subskalenscores der IES-R aus Messung 1; Modell 2 mit den gleichen Maßen aus Messung 2; und die Mo- 219 220 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen delle 3 und 4 jeweils mit einer Kombination aus IES-R-Gesamtwert und B-L-Score aus den Messungen 1 und 2 (N = 34). Es konnten auf diesem Weg weder bedeutsame Regressionsmodelle noch einzelne bedeutsame Prädiktoren ermittelt werden. Auch die simultan berechneten bivariaten Korrelationen zwischen Zielerreichung und Belastungsmaßen brachten keine Anhaltspunkte für systematische Zusammenhänge. Posttraumatische und allgemeine psychophysische Belastung hat nach diesen Ergebnissen keinen Einfluss auf die individuelle Einschätzung der Zielerreichung. Differenzwert der Zielerreichung und Belastungsmaße. Wegen der ingesamt nicht hinreichend abgesicherten Normalverteiltheit des Differenzmaßes der Zielerreichung wurde ein vollständiger Satz Spearman’scher Rangkorrelationen zwischen dieser Variablen und den Belastungsmaßen gerechnet. Auch hier ergaben sich keinen nennenswerte Zusammenhänge. Lediglich die Korrelation zwischen IES-R Übererregung, erste Messung, und dem Differenzmaß der Zielerreichung wurde mit p = .040 signifikant, rho zeigt mit .354 einen Zusammenhang mittlerer Größe an: je größer die Übererregtheit, desto günstiger fällt aus therapeutischer Sicht die selbsteingeschätzte Zielerreichung neun Monate später aus, und desto günstiger ist auch das Verhältnis zwischen funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung. Es handelt sich bei diesem Ergebnis um einen isolierten Befund, dem im vorliegenden Zusammenhang keine weitere Bedeutung beigemessen wird. Zusammenhänge zwischen Belastungsmaßen und der Qualität sozialer Beziehungen In einem zweistufigen Vorgehen wurde zunächst abgeklärt, ob sich bivariate Zusammenhänge zwischen den Belastungsmaßen und den Items zur Qualität sozialer Beziehungen identifizieren lassen. Anschließend wurde mit geeigneten Auswahlen von maximal drei Prädiktoren versucht, ob sich die Belastungsgruppen aus den Maßen zur Qualität sozialer Beziehungen ableiten lassen. Zusammenhänge zu Belastungsmaßen Tabelle C 9 im Anhang C gibt einen Überblick über die Spearman‘schen Rangkorrelationen zwischen den Maßen zur Qualität sozialer Beziehungen und den Belastungsmaßen IES-R und B-L. Obwohl insgesamt wenig bedeutsame Zusammenhänge festgestellt wurden – sowohl aus statistischer, als auch aus praktischer Sicht –, fallen einige interessante Details auf. Kontakt zum Opfer. Zu Messzeitpunkt 1 hat der Kontakt zum Opfer einen Einfluss auf das Vermeidungsverhalten, die Korrelation ist von mittlerer Größe (rho = .432). Je schlechter der Kontakt zum Opfer war, desto mehr Vermeidungsverhalten liegt vor. Dieser Zusammenhang ist zum Messzeitpunkt 2 deutlich schwächer (rho = .211). Da sich das Ausmaß des Vermeidungsverhaltens im Vergleich der ersten beiden Messzeitpunkte nicht wesentlich geändert hat (vgl. Messwiederholungsanalyse) und die Note für den Kontakt zum Opfer eine fixe Größe ist, muss aus diesem Ergebnis geschlossen werden, dass es bei verschiedenen Personen zu Merkmalsfluktuationen gekommen ist – bei manchen Personen ist das Vermeidungsverhalten schwächer, bei B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen anderen stärker geworden, der ursprünglich bedeutsame Zusammenhang zur Qualität des Kontakts zum Opfer wurde auf diesem Weg aufgelöst. Diese Sichtweise wird teilweise gestützt durch die mäßige Korrelation zwischen den beiden Messungen der IES-R Vermeidung (rho = .464), ein Zusammenhang zwischen beiden Messungen ist nachweisbar, aber nicht perfekt. Ein weiterer bedeutsamer Zusammenhang findet sich zwischen der Qualität des Kontakts mit dem Opfer und den Intrusionen zum zweiten, nicht jedoch zum ersten Messzeitpunkt (rho = -.382 vs. -.154). Je besser der Kontakt mit dem Opfer war, desto mehr Intrusionen werden zu Messzeitpunkt 2, also während der bereits in Gang befindlichen Bewältigungsphase, berichtet. Einen systematischen Zusammenhang zwischen Intrusionen und dem Kontakt zum Opfer gibt es in der initialen Belastungsphase dagegen nicht, der Schrecken des Ereignisses wirkte sich in diesem Punkt unabhängig davon aus, ob ein Betroffener einen guten oder einen weniger guten Kontakt zum Opfer hatte. Kontakt zum Täter. Ein Gegenstück zum Kontakt mit dem Opfer findet man in gewisser Weise in der Frage nach dem Kontakt zum Täter. Bei einer ansonsten vergleichbaren Verteilung auf die beiden Messzeitpunkte sind hier die Ladungsmuster umgekehrt gepolt – der Zusammenhang zum Vermeidungsverhalten in der ersten Messung ist negativ (rho = -.364), der Zusammenhang zu den Intrusionen des zweiten Messzeitpunkts ist positiv (rho = .433). Je besser das Verhältnis zum Täter war, desto ausgeprägter ist das Vermeidungsverhalten unmittelbar nach der Tat; je schlechter das Verhältnis zum Täter war, desto stabiler halten sich Intrusionen im Verlauf des Bewältigungsprozesses. Dieser im Vergleich zum Kontakt mit dem Opfer gegenläufige Effekt wird indirekt gestützt und bestätigt durch die Rangkorrelation zwischen beiden Items, das Verhältnis zum Täter und das Verhältnis zum Opfer korrelieren deutlich negativ miteinander (rho = -.670) – ein tendenziell gutes Verhältnis zum Opfer geht mit einem tendenziell schlechten Verhältnis zum Täter einher, und umgekehrt. Kontakt mit den Peers. Im Zusammenhang mit dem Vermeidungsverhalten ist auch das Item zum Kontakt mit den Peers erwähnenswert. Die Korrelation von -.356 zwischen den beiden zu Zeitpunkt 1 erhobenen Maßen deutet auf tendenziell stärker ausgeprägtes Vermeidungsverhalten, bei denjenigen Personen, die ein gutes Verhältnis zu den anderen Gruppenmitgliedern haben (Lehrer oder Schüler) – „wir kommen gut miteinander aus, und wir wollen uns nicht damit beschäftigen.“ Weniger stark ausgeprägtes Vermeidungsverhalten findet sich bei Personen mit weniger gutem Kontakt zur Gruppe, resp. mit weniger starken Bindungen. Auch dieser Zusammenhang ist nur in der Initialphase sichtbar, lässt sich aber zu Zeitpunkt 2 nicht mehr nachweisen. Kontakt zur „oppositionellen“ Gruppe. Als letztes Teilergebnis soll über den Zusammenhang zwischen dem Kontakt zur „oppositionellen“ Gruppe und den Belastungsmaßen berichtet werden. Bedeutsame Zusammenhänge finden sich zwischen dem Kontakt-/Nähe-Rating des zweiten Messzeitpunkts und den Intrusionen und der Übererregung des ersten Messzeitpunkts (rho = -.413, in beiden Fällen). Wer zum ersten Zeitpunkt weniger durch Intrusionen und Übererregung belastet war, berichtete zum zweiten Messzeitpunkt über ein tendenziell gutes Verhältnis zur „oppositionellen“ Gruppe. Wer zum ersten Zeitpunkt stärker durch Intrusionen und Übererregung belastet war, berichtete zum zweiten Messzeitpunkt über ein tendenziell schlechtes Ver- 221 222 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen hältnis zur „oppositionellen“ Gruppe. Die Zusammenhänge zwischen dem Kontakt zur „oppositionellen“ Gruppe und den Belastungsmaßen der zweiten Messung weisen zwar in die gleiche Richtung, erreichen aber weder statistische noch praktische Bedeutsamkeit. Weitere korrelative Zusammenhänge zwischen Items zur Qualität sozialer Beziehungen und Belastungsmaßen wurden nicht gefunden. Tabelle C 9 im Anhang C enthält neben der Auflistung aller Korrelationen auch die Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den Belastungsmaßen und der Bewertung der psychologischen Betreuung. Zwischen dem Ausmaß der Belastung und der Einschätzung der psychologischen Betreuungsarbeit gibt es keine erkennbaren Zusammenhänge, weder zu Messzeitpunkt 1, noch zu Messzeitpunkt 2. Tendenziell urteilten zwar Personen mit stärkeren Belastungen positiver als Personen mit weniger starken Belastungen, diese Zusammenhänge waren aber numerisch schwach und statistisch nicht bedeutsam. Diagnostische Zuordnung zu Belastungsgruppen Der nächste Schritt der Datenanalyse bestand in dem Versuch, die Belastungswerte von IES-R und B-L in dichotome Belastungsgruppen umzukodieren und aus den Maßen zur Qualität sozialer Beziehungen vorherzusagen. Zu diesem Zweck wurden Logistische Regressionen gerechnet, mit den Belastungsgruppen aus Messung 1 und Messung 2 als Klassenvariablen. Als Indikatoren bzw. Prädiktoren wurden die Items zum Kontakt mit dem Täter, mit dem Opfer, mit den „Peers“ und mit der „oppositionellen Gruppe“ ausgewählt. Eine logistische Regression enthielt jeweils zwei oder drei Prädiktoren. Die methodische Güte der so zusammengestellten Regressionsmodelle ist als gering einzuordnen, wurde aber zu explorativen Zwecken als ausreichend bewertet. Es wurden keine interpretierbaren oder praktisch relevanten Ergebnisse gefunden. Keins der gerechneten Modelle war in der Lage, eine akzeptable Menge an richtig positiven Gruppenzuweisungen aus der Qualität sozialer Beziehungen abzuleiten. 3.4 Schlussfolgerungen und Bewertung 3.4.1 Wissenschaftlich-methodische Bewertung der Datenanalyse Entwicklung der posttraumatischen Belastung und Rolle der Einzeltherapie Wechselwirkungen zwischen Betroffenengruppen und Therapie-Bedingung. Die vorliegenden Datenanalysen ergaben für die Belastungsmaße ein insgesamt recht homogenes Bild. Im Vergleich von Lehrern und Schülern wurde fast durchgängig festgestellt, dass Schüler mit gegenüber Schülern ohne Einzeltherapie die höheren Intrusions- und Übererregungswerte in der IES-R hatten, was sich auch im IES-R-Gesamtwert niederschlug. Die Belastungswerte der Schüler mit und ohne Einzeltherapie entsprechen damit ihrer jeweiligen sachlich begründeten Bedürftigkeit. Der gleiche Unterschied ließ sich sich bei den Lehrern nicht feststellen. Dieser Befund kann hier aber lediglich dokumentiert werden, ein Rückschluss auf die Motive und Ent- B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen scheidungsprozesse verschiedener Lehrer, sich trotz einer erhöhten Belastung gegen eine Einzeltherapie zu entscheiden, ist nicht möglich. Wechselwirkungen zwischen Messwiederholungen und Therapie-Bedingung. Ausgehend von einer deutlich höheren initialen Belastung bei Personen mit gegenüber Personen ohne Einzeltherapie kam es im Verlauf von neun Monaten zu signifikanten Belastungsreduktionen bei beiden Personengruppen. Die Belastungsreduktion fiel für Personen mit Einzeltherapie stärker aus, beide Gruppen erreichten ein Jahr nach der Tat in verschiedenen psychometrischen Maßen in etwa das gleiche Belastungsniveau. Diese Aussagen gelten für die allgemeine psychophysische Belastung (B-L), für Intrusionen und Übererregung (IES-R). Wir verstehen die stärkere Belastungsreduktion bei Personen mit Einzeltherapie als direkte Folge des kognitiv-behavioralen Behandlungskonzepts. Da es sich bei der Meißen-Studie nicht um ein parallelisiertes Design handelt und sich die initialen Belastungen beider Personengruppen signifikant voneinander unterscheiden, lässt sich diese Sichtweise nicht direkt und zweifelsfrei aus den Daten ableiten. Unsere Auffassung soll deshalb durch einige Argumente gestützt werden. Setzen wir voraus, dass für alle betroffenen Personen die gleichen psychosozialen Randbedingungen vorliegen, bzw. dass sich Unterschiede in diesen Randbedingungen zufällig verteilen. Ginge man nun von der Annahme aus, dass sich posttraumatische Symptome bei unterschiedlich stark belasteten Personen nach den gleichen intrapsychischen Regeln spontan zurückbilden, dann müsste die Belastungsreduktion bei stark und weniger stark belasteten Personen (hier: Personen mit und ohne Einzeltherapie) in etwa parallel verlaufen – was nicht der Fall ist. Ginge man dagegen von der Annahme aus, dass geringer betroffene Personen in einer günstigeren Ausgangsposition für eine Bewältigung und psychische Widerherstellung sind als stärker belastete Personen, dann wäre auch denkbar, dass sich die Belastungswerte beider Gruppen zu Zeitpunkt 2 stärker voneinander unterscheiden als zu Zeitpunkt 1, weil geringer belastete Personen im gleichen Zeitraum mehr Bewältigungsarbeit leisten könnten. Auch das ist nicht der Fall. Tatsächlich zeigen die Häufigkeitsauszählungen der nach Trennwerten eingeteilten Belastungsgruppen, dass es bei verschiedenen Personen ohne Einzeltherapie zwischen Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 auch zu Verschlechterungen der Symptomatik gekommen sein muss, während sich ein solcher Effekt bei den Personen mit Einzeltherapie nicht beobachten lässt. Eine Ausnahme in diesem Verlaufsmuster bildet die IES R Vermeidung. Im Fall der Vermeidung konnte zwischen den beiden ersten Messzeitpunkten weder ein Unterschied zwischen Personen mit und Personen ohne Einzeltherapie festgestellt werden, noch wurde eine statistisch oder praktisch relevante Reduktion des Symptoms beobachtet. Eine Erklärung für dieses Phänomen wird erst unter Berücksichtigung der dreifachen Messwiederholungsanalyse sichtbar, die mit einer Teilstichprobe von zehn Personen durchgeführt wurde. Die Verlaufsmuster der Belastungsmaße entsprechen zwischen den ersten beiden Messzeitpunkten den Ergebnissen der Varianzanalysen mit zweifacher Messwiederholung. Trotz der eingeschränkten Stichprobe im Fall der dreifachen Messwiederholungen gehen wir deshalb davon aus, dass beide Analysemodelle die gleichen Messwiederholungseffekte abbilden und eine Verallgemeinerung der Unterschiede zwischen zweitem und drittem Messzeitpunkt statthaft ist. Für die psychophysische Belastung, die Intrusionen und die Übererregung kam es zwi- 223 224 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen schen Zeitpunkt 2 und Zeitpunkt 3 zu geringfügigen Belastungsreduktionen, die wir zwar als praktisch bedeutsam einstufen, die aber statistisch unterhalb des Signifikanzniveaus bleiben. Im Gegensatz dazu zeigte sich aber, dass das Vermeidungsverhalten jetzt, zwischen den Zeitpunkten 2 und 3, deutlich und statistisch signifikant nachgelassen hatte. Wir interpretieren diesen Befund als Beleg für die in der Literatur gelegentlich erwähnte Auffassung, dass es sich beim Vermeidungsverhalten um ein sekundäres oder zumindest „abhängiges“ Symptom handelt. Erst wenn die Belastung durch Übererregung und Intrusionen abgenommen hat, verliert auch das Vermeidungsverhalten als kurzfristig belastungssenkende Coping-Strategie einen Teil seiner Bedeutung. Der Abbau von Vermeidungsverhalten unterliegt einer gewissen Verzögerung, als kognitive Strategie bleibt Vermeidungsverhalten auch dann noch befristet aktiv, wenn die ursprüngliche auslösende Belastung bereits nachgelassen hat. Gerade dieser Effekt, der sich in den vorliegenden Daten sehr klar abbildet, verweist auf die besondere therapeutische Bedeutung, Vermeidungsverhalten als isoliertes Symptom zu betrachten und mit behavioralen Methoden aufzulösen. Nicht übersehen werden dürfen im Zusammenhang mit Vermeidungsverhalten verschiedene gruppendynamische Effekte, die in den Daten sichtbar wurden, und die weiter unten erörtert werden sollen. Abgeschlossen werden soll dieser Abschnitt mit einigen Anmerkungen zum diagnostischen Nutzen des IES-R-Gesamtwerts. Die beschriebene Gegenläufigkeit in der Entwicklung von Intrusionen und Übererregung einerseits und Vermeidungsverhalten andererseits kann – je nach Zeitpunkt einer Messung – zu unterschiedlichen diagnostischen Einschätzungen führen, die unter Umständen der individuellen Symptomlage nur bedingt angemessen sind, wenn sie sich nur am Gesamtwert orientieren. Da alle drei Subskalen-Scores in den Gesamtwert einfließen, sind sowohl Unter- als auch Überschätzungen denkbar, je nachdem, in welcher Phase der individuellen posttraumatischen Entwicklung sich eine betroffene Person befindet. Es ist deshalb ratsam, sich bei der Auswertung der IES-R im psychotherapeutischen Alltag nicht auf die Ermittlung des Gesamtwerts zu beschränken. Da für die Subskalenscores der IES-R bislang keine diagnostischen Kriterien verfügbar sind, ist es dringend notwendig, für die drei Skalen eigenständige Trennwerte zu entwickeln, um die diagnostische Sensitivität der IES-R für inter- und intraindividuelle Unterschiede zu erhöhen. Und wir schließen uns der Forderung von Maercker und Schützwohl an – die Traumatherapie benötigt Normen, um effizienter mit der IES-R arbeiten zu können. Unterschiede in der Zielerreichung, Zusammenhänge mit den Belastungsmaßen Die Analysen im Zusammenhang mit den Zielerreichungsmaßen brachten insgesamt keine wesentlichen Erkenntnisse. Zusammenhänge zu den Belastungsmaßen wurden keine festgestellt. Allerdings fiel bei der Gruppe der Schüler ohne Einzeltherapie ein ungünstiges Verhältnis von funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung auf, ein Unterschied, der sich bei den Lehrern in dieser Form nicht feststellen ließ. Ausgehend von einem kognitiven Modell aus interagierenden funktionalen und dysfunktionalen Zielen deutet dieses Teilergebnis darauf hin, dass für einen Teil der betroffenen Schüler der Nutzen funktionaler Ziele durch den Anteil besonders gut erreichter dysfunktionaler Ziele neutralisiert wurde. Kinder und Jugendliche sind reifungsbedingt ohne Anleitung und Information nur eingeschränkt in der Lage, sich der Widersprüchlichkeit von B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen funktionalem (lösungs- und bewältigungsorientiertem) Verhalten einerseits und dysfunktionalem (vermeidungsorientiertem oder passivem) Verhalten andererseits bewusst zu werden. Für die Praxis ist daraus zu lernen, dass die Aufklärung über günstiges und ungünstiges Verhalten nach einer Traumatisierung insbesondere dann intensiv und mit der nötigen Eindeutigkeit betrieben werden sollte, wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind, auch und gerade im Rahmen psychoedukativer Maßnahmen. Allerdings muss bei der Bewertung dieser Ergebnisse berücksichtigt werden, dass die Datengrundlage selbst nicht unproblematisch ist. Obwohl zwischen funktionalen, dysfunktionalen und indifferenten Zielen unterschieden wurde, bleiben andere Fragen unberücksichtigt. Zum Beispiel könnte die Frage gestellt werden, welchen Einfluss die Anforderungsniveaus der gewählten Ziele haben, welchen Unterschied es beispielsweise macht, wenn ein „leichtes“ Ziel gut und ein „schweres“ Ziel unbefriedigend verwirklicht wird. Um systematische Zusammenhänge aufdecken zu können müsste gegebenenfalls auf der Basis der hier vorliegenden Daten und Ergebnisse zukünftig mehr Arbeit in Konzeptbildung und Standardisierung der Zielerreichungsfrage fließen. Zusammenhänge zwischen Belastungsmaßen und der Qualität sozialer Beziehungen Interpretierbare Ergebnisse zwischen Belastungsmaßen und den Maßen zur Qualität sozialer Beziehungen liegen in Form von Rangkorrelationen vor, und die Risiken bei der Interpretation von Korrelationen sind bekannt. Andererseits ist das hier erhaltene Bild so komplex, dass ein gewisses Maß an interpretatorischer Freiheit notwendig ist, um die vorliegenden Details in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Kontakt zum Opfer & IES-R Vermeidung. Es gibt einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem Kontakt zum Opfer und dem Vermeidungsverhalten, allerdings nur zum ersten Messzeitpunkt, während sich der Zusammenhang zwischen beiden Variablen später auflöst. Wenn durch einen schlechten Kontakt zum Opfer Vermeidungsverhalten frühzeitig gefördert wird, stellt sich die Frage, welche Form von Belastung zu diesem Zeitpunkt vermieden werden soll, was also die spezifische Funktion der Vermeidung ist. Wir halten Schuldgefühle für eine plausible Antwort. Kontakt zum Täter & IES-R Vermeidung. Im gleichen Zusammenhang sehen wir das Verhältnis zwischen dem Kontakt zum Täter und dem frühen Einsetzen von Vermeidungsverhalten. Ein guter Kontakt zum Täter begünstigt früheres Einsetzen von Vermeidungsverhalten, ein Zusammenhang, der später verschwindet. Auch hier halten wir Schuldgefühle für einen plausiblen Auslöser, insbesondere auch deshalb, weil der Kontakt zum Opfer und der Kontakt zum Täter in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen (rho = -.670). Kontakt zum Opfer & IES-R Intrusion. Je besser der Kontakt zum Opfer war, desto deutlicher und länger anhaltend prägen sich Intrusion aus – ein Effekt, der im Vergleich des ersten mit dem zweiten Messzeitpunkt sichtbar wird. Unabhängig von den schrecklichen Bildern oder Vorstellungen, die mit der Tat verbunden sind (Messzeitpunkt 1), geht ein guter Kontakt mit einem persönlichen Verlust einher, mit Trauer, mit Erinnerungen, mit Mitgefühl – und mit Empathie für die Leiden des Opfers. Die Häufigkeit der Intrusionen zum zweiten Messzeitpunkt bildet u.a. die Stellung des Opfers im Leben 225 226 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen der Betroffenen ab, und ihre Fähigkeit, sich von den Leiden der ermordeten Lehrerin anrühren zu lassen. Kontakt zum Täter & IES-R Intrusion. Der Zusammenhang des Kontakts zum Täter mit den Intrusionen zum zweiten Messzeitpunkt weist eine gewisse Symmetrie zum zuletzt erläuterten Ergebnis auf, allerdings sind die Verhältnisse hier umgekehrt – schlechter Kontakt zum Täter sorgt für länger anhaltende Intrusionen. Was ist das Wesen dieser wiederkehrenden Bilder? Angst, rückwirkend empfundene Bedrohung? Möglicherweise drücken sich hier der Verdacht, „mich hätte es genauso treffen können“ und das damit empfundene Erschrecken aus. Kontakt mit den Peers & Vermeidungsverhalten. Es wurde weiter oben angekündigt, dass einige Bemerkungen dazu folgen sollten, die den Zusammenhang zwischen der Qualität sozialer Beziehungen (im schulischen Kontext) und dem Vermeidungsverhalten betreffen. Der Kontakt mit den Peers steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Ausmaß des Vermeidungsverhaltens in der Initialphase. Bei einem guten Kontakt zu den Peers liegt systematisch mehr Vermeidungsverhalten vor als bei einem weniger guten. Wir brachten diesen Aspekt bereits mit einer hypothetischen kognitiven Regel in Verbindung – „wir kommen gut miteinander aus, und wir wollen uns nicht damit beschäftigen“. Nicht übersehen werden darf in diesem Zusammenhang, dass durch die Tat das allgemeine Vertrauen zueinander erheblich gestört war. Vermeidung – z.B. unangenehmer oder im Zusammenhang mit einer Traumatisierung riskanter Gesprächsbeiträge – kann ein Mittel sein, die Funktionsfähigkeit der Gruppe zu schützen. Das dieser Effekt später verschwindet, kann mit zweierlei Ursachen zusammenhängen. Zum einen ist es naheliegend, an den vermeidungsabbauenden Einfluss von Psychoedukation, Gruppenbetreuung und Einzeltherapie zu denken. Dieser Einfluss muss aber selektiv gewesen sein, da sich die Gesamtmittel beider Messzeitpunkte nicht unterschieden. Zum anderen – und dieser Ansatz ist vielleicht plausibler – ist Vermeidungsverhalten ein heterogenes Phänomen, dessen einzelne Äußerungsformen u.a. davon abhängen, wie die restliche psychotraumatische Belastung sich entwickelt. Es ist vorstellbar, dass zu Zeitpunkt 2, als Intrusionen und Übererregungszustände bereits erheblich nachgelassen hatten, auch bestimmte Vermeidensstrategien bereits im Rückgang begriffen waren. Es könnte sich, um den später aufgelösten Zusammenhang zum Kontakt zu den Peers zu erklären, bei diesen Anteilen selektiv um solche Verhaltensweisen gehandelt haben, durch die die Stabilität einer Gruppe geschützt werden kann. Kontakt mit der oppositionellen Gruppe, Intrusionen & Übererregung. Weniger kompliziert aufzulösen sind die Zusammenhänge zwischen den initialen Intrusionen und Übererregungszuständen einerseits, und dem Kontakt mit der oppositionellen Gruppe andererseits, wie er zum zweiten Messzeitpunkt sichtbar wurde. Wir sehen auch diese Ergebnisse in einem dynamischen, respektive chronologischen Zusammenhang. Eine hohe initiale Belastung sorgt für schlechte Beziehungen zur oppositionellen Gruppe, und umgekehrt. Aber auch, wenn die Belastung bereits nachgelassen hat, bleibt eine sichtbare Bindung zwischen der Belastung und der Güte des Kontakts zur oppositionellen Gruppe bestehen, die allerdings im vorliegenden Fall unter die Grenze statistischer Bedeutsamkeit gesunken war. B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen 3.4.2 Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten Debriefing und psychologische Frühinterventionen Ende der 90er Jahre herrschte bei vielen Notfall- und Katastrophenpsychologen die Meinung vor, mit einem CISD (Critical Incident Stress Debriefing) könne man bei einem Großteil der Betroffenen das Entstehen einer PTBS verhindern. Inzwischen ist man in dieser Einschätzung wesentlich vorsichtiger geworden, es gibt keine Belege für eine eindeutige positive Wirkung derartiger psychologischer Frühinterventionen (zum aktuellen Diskussionsstand siehe Bengel, 2003). Die Art des in Meißen von Bundeswehrpsychologen durchgeführten Debriefings als alleiniger Interventionsmaßnahme ohne irgendeine Form der Nachbetreuung ist jedoch als wenig sinnvoll und für einige Teilnehmer sogar als schädlich einzustufen. Eine Reihe von Schülern wie Lehrern, die aus subjektiver Sicht das Debriefing durchaus als positiv beschrieben hatten, kamen später in Schwierigkeiten, weil sie glaubten, sie haben bereits eine „Therapie“ gemacht und dürften von daher keine psychischen Probleme mit dem Ereignis mehr haben. Die Meta-Botschaft aus dem Debriefing war für sie, dass das Ereignis psychologisch bearbeitet ist und dass diese Bearbeitung beendet ist. Besonders verstärkt wurde dieser Eindruck durch die Tatsache, dass die Psychologen nach dem Debriefing mit dem Hubschrauber wieder wegflogen. Einige warteten aus diesem Grunde zu lange, um sich psychologische Unterstützung zu holen und ihre Symptome verschärften sich in dieser Zeit. Die in die Schule unmittelbar nach dem Ereignis gerufenen Schulpsychologen waren in keiner Weise auf psychologische Frühinterventionen nach traumatischen Ereignissen vorbereitet. Es muss bedacht werden, dass unsichere und ohne Konzept arbeitende Psychologen von geschockten hilflosen Betroffenen als inkompetent wahrgenommen und oft auch für später folgende Interventionen abgelehnt werden. Hier besteht dringender Schulungsbedarf für Schulpsychologen, um nach traumatischen Ereignissen an Schulen adäquate psychologische Erste Hilfe leisten zu können. Eine wichtige positive Erfahrung in Meißen war die psychologische Nachbesprechung im Kreis der Entscheidungs- und Verantwortungsträger im Kultusministerium kurz nach dem Ereignis. Offensichtlich wuchs durch diese Maßnahme das Verständnis für die psychologische Traumabewältigung und die Verantwortlichen konnten ihre Entscheidungen frei von eigener ungeklärter Betroffenheit fällen. Möglicherweise war durch diesen Beginn der Grundstein gelegt für eine verständnisvolle kooperative Arbeitshaltung, die über den gesamten Betreuungszeitraum vorherrschte. Anfangssituation mit Betroffenen Das erste Zusammentreffen von Psychologen mit Betroffenen und Angehörigen einer Katastrophe steht immer unter einer extremen Anspannung, die Stimmung der Betroffenen schwankt häufig zwischen Unsicherheit, Depression und versteckter oder offener Aggression. Die Betroffenen teilen sich auf in diejenigen, die eher der Meinung sind, man solle das Ganze ruhen lassen, Gras über die Sache wachsen und nicht in alten Wunden rühren, andererseits in Personen, die breite Unterstützung und psychologische Aufarbeitung fordern und in Personen, die ihr Leiden in den Vordergrund stellen und generell bezweifeln, dass Psychologen ihnen helfen können. 227 228 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Beim ersten Treffen in Meißen wurde deutlich, dass es sinnvoll ist, eine gute Balance zu erreichen zwischen der Vermittlung von Expertenwissen über Möglichkeiten und Mechanismen der Traumabewältigung einerseits, andererseits genau die Bedürfnisse der Betroffenen zu erfragen und ihnen Gelegenheit zu geben, diese für sich zu erkennen und zu äußern. Dieses gelang in Meißen auf einer Anfangsveranstaltung mit den betroffenen Lehrern, Schülern, Eltern und Vertretern der Schulbehörde und dem Kultusministerium. Die anfängliche sehr schwere Stimmung in der Gesamtgruppe wurde entlastet durch einen Vortrag des Psychologen über die Wirkweise von Psychotraumata, die Entstehung posttraumatischer Belastungsstörungen und die wichtigsten Möglichkeiten der Traumabewältigung aufgezeigt an den Erfahrungen mit anderen Katastrophenopfer (Borken, Eschede). Anschließend wurde den Betroffenen in Kleingruppen die Gelegenheit gegeben, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, die sie zur Überwindung der Folgen des Ereignisses für wichtig halten. Dabei wurden z. B. von den Schülern gewünscht, die Klasse solle zusammen bleiben, oder von den Lehrern, sie wollen eine gemeinsame Freizeit verbringen – Wünsche, die bei einer Konzeption eines Betreuungsprogramms von Fachleuten leicht übersehen worden wären. Die mit diskutierenden Vertreter der Behörden konnten hinweisen auf Beschränkungen oder Möglichkeiten auf der administrativen Ebene, z. B. Räumlichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten etc. Aus den gesamten Beiträgen wurde dann die erste Fassung eines Betreuungsprogramms erstellt, in dem sich die fachlichen Anforderungen, als auch die Betroffenen mit ihren Wünschen wieder fanden. Die Ausrichtung auf die gemeinsame Bewältigung der Folgen des schweren Ereignisses und nicht auf die erlebte Störung war in Meißen Auftakt zu einer von allen getragenen hoffnungsvollen Zusammenarbeit zur Traumabewältigung und erscheint generell als psychologische Frühintervention sinnvoll. Tatmotiv des Täters – Gerichtsurteil Nach heutigem Wissensstand hinterlässt eine von Menschenhand verursachte Katastrophe, insbesondere eine geplante Gewalttat, für die Opfer tiefere Störungen und ist schwieriger zu verarbeiten, als eine Naturkatastrophe (vgl. Kapitel A 1). Es ist für die Betroffenen schwerer zur Ruhe zu kommen, sich mit der Zerstörung und dem Verlust geliebter Menschen abzufinden, weil es nicht hätte sein müssen, dass das Ereignis passierte. Deswegen suchen die Leidtragenden immer wieder nach Erklärungen, warum ein Mensch eine derartige Gewalttat verübt hat, was ihn dazu veranlasst hat und ob man es eventuell hätte verhindern können. Die Motivation ist dabei die Vorstellung, dass einem das Wissen um die Hintergründe die Verarbeitung erleichtern könne. Für viele Lehrer und Schüler in Meißen war es von Anfang an wichtig, etwas über die Hintergründe zu erfahren, die den 15-jährigen Jugendlichen zu dieser Tat angetrieben hatten. Schon in der Sammlung der anfänglichen Wünsche wurde dieses Anliegen häufig geäußert. Für die Lehrer und Mitschüler des Täters war es natürlich ein Unterschied, ob der Grund für seine Tat in einer psychischen Störung lag, die niemand bemerkt hatte, in einem aufgebauten Hass gegen eine Lehrerin, mit der er nicht zurecht kam, oder in einer Wette, die er mit seinen Klassenkameraden abgeschlossen hatte, um ihnen zu imponieren. Für die betroffene Klasse war es wichtig zu erfahren, ob der Täter durch bestimmte Verhaltensweisen seiner Mitschüler, etwa Mobbing zu der Tat B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen getrieben wurde, oder ob er vorher Anzeichen hatte erkennen lassen, die auf eine kommende zielgerichtete Gewalttat hingewiesen hätte. Es wurden verschiedene Versuche unternommen, Informationen über die Hintergründe der Tat zu bekommen, um diese Unsicherheiten aufzuklären, die jedoch alle scheiterten. Das Gericht begründete seine Verweigerung einer diesbezüglichen Aufklärung mit der Verpflichtung des Schutzes der Persönlichkeitsrechte des Täters, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Gutachter mit seiner Schweigepflicht, die Eltern des Täters verweigerten jedwede Zusammenarbeit. Bei dem Versuch, mit dem Täter im Gefängnis Kontakt aufzunehmen intervenierte der Anstaltspsychologe mit dem Hinweis, die Therapie des Gefangenen dürfe nicht gestört werden. Letztlich blieben dadurch für viele Jugendliche quälende Fragen offen, die zu erheblichen Selbstzweifeln führten. Sie fragten sich, warum sie nicht gemerkt hatten, dass ein Freund, dem sie jahrelang vertraut hatten, zu einer solchen Tat fähig war, und ob ihnen ähnliches mit anderen Freunden wieder passieren könne. Bei einigen Lehrern blieb die Unsicherheit, Schüler hinsichtlich ihrer Gewaltbereitschaft nicht adäquat einschätzen zu können. Manche zogen daraus den Schluss, sich bei Forderungen an Schüler und bei Kritik an deren Verhalten, deutlich mehr zurück zu halten, als sie es früher getan hatten. Hier zeigen sich Bedingungen, die einer traumatherapeutischen Bearbeitung zum Beispiel des zuletzt genannten Vermeidungsverhaltens eindeutige Grenzen setzt. Rolle der Medien Bei allen spektakulären Ereignissen und Katastrophen kämpfen Presse- und Medienvertreter um exklusive Berichterstattung und tun dieses zum Teil mit Mitteln, die für die Betroffenen eine erhebliche Belastung bedeuten. Unmittelbar nach der Tat waren verschiedene Fernsehsender vor Ort, die Interviews mit unter Schock stehenden Jugendlichen zum Teil gegen höhere Geldbeträge durchführten. Einige Schüler sagten, der Täter habe schon Wochen vor dem Mord seine Tat angekündigt und man habe sogar Wetten abgeschlossen. Das führte später zu einer erheblichen Verschärfung der Schüler-Lehrer-Probleme und endete in einer Anklage gegen die Schüler wegen unterlassener Hilfeleistung. Das Schulgebäude war wochenlang von Presse- und TV-Vertretern belagert. Schüler wie Lehrer mussten sich jeden Morgen den Weg durch die Journalisten bahnen und wurden immer wieder zu Stellungnahmen genötigt. Einzelne Schüler wurden zuhause aufgesucht, da die Journalisten herausbekommen hatten, dass sie mit dem Täter befreundet gewesen waren. Dabei passierten die üblichen Pannen, indem z. B. ein Schüler mit Bild in einer großen deutschen Illustrierten abgebildet war mit den Worten: „Ich wusste schon vorher, dass Andy Frau L. umbringen wollte!“ In Wirklichkeit hatte er nie mit dem Täter über dessen Vorhaben gesprochen – eine schwere Belastung für diesen Schüler. Die Presse schürte immer wieder das Vorurteil, die Schüler hätten die Tat verhindern können, wenn sie nur die Äußerungen des Täters ernst genommen hätten oder wenn sie während des Mordes eingegriffen hätten. Dazu kamen Berichte über die Situation der Familie des Opfers, die geschieden war und einen erwachsenen Sohn und die blinde Mutter, und einen krebskranken Vater zurückließ. 229 230 B: Felderfahrungen — Der Lehrerinnenmord in Meißen Lehrer wurden immer wieder zitiert in ihrer Fassungslosigkeit und ihrem Unverständnis, wie es an dieser Schule zu so einer Entwicklung kommen konnte. Nicht wenige Stimmen sowohl der Lehrer, einiger Leserbriefe, als auch der Zeitungskommentatoren wiesen darauf hin, dass es so etwas in der DDR nicht gegeben habe. Insgesamt wurde dadurch das Klima emotional sehr aufgeladen. Die Presse brachte immer wieder Berichte über tiefe Gräben zwischen Lehrern und Schülern und trug so dazu bei, das Misstrauen zwischen Lehrern und Schülern zu verstärken. Besonders kritisch und durchaus gefährlich ist die Tendenz zu bewerten, dass viele Jugendliche dem verlockenden Angeboten von Talkshows und Boulevard-Magazinen zu erliegen, die damit werben, dass man ins Fernsehen kommt, berühmt wird und die dazu noch einen therapeutischen Impetus formulieren, nach dem Motto: „Es ist für Dich gut, wenn Du Deine Geschichte im Fernsehen erzählst und Du kannst damit vielen anderen Menschen helfen...“. Nachdem sie sich zunächst vom Glanz der Medien hatten blenden lassen, wurde die Situation für einige Betroffene nach einem solchen Fernsehauftritt so belastend, dass sie damit kaum noch umzugehen wussten und zum Teil sogar suizidale Tendenzen aufwiesen. Eine sachliche Aufklärung über diese Problematik gehört daher unbedingt zur Psychoedukation bei Katastrophenopfern und Opfern zielgerichteter Gewalt, wenn diese im Interesse der Öffentlichkeit stehen. Jahrestag Zum Jahrestag wurde in einem feierlichen Akt eine von den Meißener Porzellanwerkstätten gefertigte Plakette mit dem Namen der Lehrerin und dem Datum an einer Säule an der Stelle angebracht, an der sie verstorben war. Die Schule blendet dieses Ereignis nicht aus, sondern ruft dazu auf, sich einerseits immer wieder an die getötete Lehrerin zu erinnern und ihr Andenken zu ehren, andererseits nach vorne zu schauen und einen aktiven Schulalltag zu gestalten. Damit ist ein wichtiger Grundsatz der Traumabewältigung verwirklicht, nämlich das Ereignis zu integrieren, und mit der Erinnerung erfolgreich weiterzuleben. 3.4.3 Konsequenzen für die Praxis Für schnelle und unmittelbare notfallpsychologische Interventionen nach traumatischen Ereignissen an Schulen müssen Schulpsychologen qualifiziert werden. Über die notfallpsychologische Betreuung am Unfalltag hinaus sollen sie befähigt werden, psychologische Frühinterventionen in den ersten Tagen durchzuführen und die Bedürfnisse der Betroffenen für eine langfristige Betreuung erkunden. In der Konsequenz aus den Erfahrungen mit der Presse sollten Schulpsychologen von Anfang an die Betroffenen auf die Problematik im Umgang mit Presse und Medien hinweisen. Eine Informationsbroschüre zum Umgang mit Medien für Katastrophenopfer gleich zu Beginn der notfallpsychologischen Betreuung wäre in diesem Zusammenhang sinnvoll und hilfreich. Die Ergebnisse der Befragung der Betroffenen zeigen eindeutig die Richtung und die Reihenfolge therapeutischer Interventionen für Katastrophenopfer auf: zuerst müssen die Intrusionen und die Übererregung positiv beeinflusst werden, erst dann erscheint eine kognitiv – behaviorale Behandlung des Vermeidungsverhaltens sinnvoll. 4. Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt (2002) 4.1 Beschreibung des Ereignisses und des Umfelds Am 26. April 2002 richtete ein 19-jähriger ehemaliger Schüler im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt das größte in Deutschland jemals verzeichnete Schulmassaker an. Die Beschreibung des Ereignisses in Abbildung B 4.1 ist dem vorläufigen Abschlußbericht des Innenministers des thüringischen Innenministeriums vom 24.06.2002 entnommen. Abbildung B4.1: Beschreibung des Tathergangs Der ehemalige Schüler des Gutenberg-Gymnasiums betrat am Morgen des 26. April 2002 gegen 10.45 Uhr mit einem Rucksack und einer grünen Sporttasche die Schule in Erfurt durch den Haupteingang. Im Flur traf er auf den Hausmeister der Schule und fragte diesen, ob sich die Schulleiterin im Hause aufhalte. Der Hausmeister bejahte die Frage und fügte hinzu, dass sie wegen der anstehenden Abiturprüfung nicht zu sprechen sei. Darauf begab sich der Täter in die Herrentoilette, in der er eine schwarze Maske über den Kopf zog und sich mit einer Pistole und einer Pump-Gun bewaffnete. Den mitgeführten Rucksack, die Sporttasche, seine schwarze Jacke mit Geldbörse sowie mehrere hundert Schuss Munition hinterließ er auf der Toilette. Er ging zum Sekretariat und klingelte an der geschlossenen Tür, die von innen mittels elektrischen Türöffners geöffnet wurde. Nachdem der Täter das Sekretariat betreten hatte, erschoss er die stellvertretende Schulleiterin die zu dieser Zeit an ihrem Schreibtische arbeitete, sowie dann im Flur des Sekretariats eine Sekretärin. Anschließend lief der Täter durch das gesamte Schulgebäude durch mehrere Etagen und tötete jeweils mit gezielten Schüssen weitere elf Lehrerinnen und Lehrer, in den meisten Fällen während des Unterrichts und vor den Augen der Schüler. Er feuerte durch eine verschlossene Klassentür wahllos acht Schüsse und traf dabei zwei Schüler tödlich. Einen Polizisten, der ihn stellen wollte, erschoss er aus einem Fenster im ersten Stock. Gegen Ende seines Amoklaufs traf der Täter in einem Raum auf einen Lehrling, der einen Fußbodenbelag verlegte. Der Lehrling sprach ihn an und fragte, ob dies ein übler Scherz sei. Daraufhin nahm der Täter kurz seine Maske ab und sagte sinngemäß, er sei einmal von der Schule verwiesen worden. Daraufhin rannte er weiter durch das Schulgebäude und wurde von einem Lehrer 232 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt gestellt, der ihn mit Namen ansprach. Der Täter schoss nicht mehr, sondern ließ sich vom Lehrer in einen Raum einsperren, wo er sich selbst erschoss. Der Täter hatte in weniger als zehn Minuten zwölf Lehrerinnen und Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizeibeamten getötet. Viele Schüler befanden sich stundenlang in Todesangst, da sie erst vier bis fünf Stunden später aus der Schule evakuiert werden konnten, weil die Polizei noch einen zweiten Täter im Gebäude vermutet hatte. Die polizeiliche Bewältigung der Ereignisse erforderte im Zeitraum vom 26. April bis zum 2. Mai den Einsatz von insgesamt 973 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten. 4.1.1 Beschreibung des Umfelds Das Gutenberg-Gymnasium ist ein 1991 gegründetes Gymnasium in einem dunkelbraunen Gebäude aus der Zeit des Jugendstils. Es ging aus der Gutenberg-Schule hervor, die 1908 erbaut wurde und 1909 den Schulbetrieb aufnahm. Zum Zeitpunkt der Tat wurde die Schule von etwa 750 Schülerinnen und Schülern besucht, die von 50 Lehrern unterrichtet wurden. 4.1.2 Traumatische Stressoren und typische Reaktionen Die traumatischen Stressoren und typischen Reaktionen unterschieden sich nicht grundsätzlich von den in Meißen beschriebenen (s. Abschnitt B 3.1.2). Die Besonderheit liegt in der wesentlich größeren Anzahl von betroffenen Schülern und Lehrern. Da der Täter durch das ganze Schulgebäude auf der Jagd nach Lehrern gewesen war, waren Schüler aus allen Jahrgangsstufen von der fünften bis zur zwölften Klasse mit traumatischen Stressoren schlimmster Art konfrontiert. Schüler mussten aus nächster Nähe mit ansehen, wie ihre Lehrerin oder ihr Lehrer im Klassenraum meist mit mehreren Schüssen hingerichtet wurde. Sie hatten sich danach in der Regel in der Klasse verbarrikadiert und mussten mit der getöteten Lehrperson stundenlang unter Todesangst und in Ungewissheit warten, was weiter geschehen würde. Andere mussten das Schreien eines verletzten Lehrers auf dem Flur anhören, der erst nach Stunden verstarb. Eine Klasse versuchte die stark blutenden Wunden ihrer zwei durch Schüsse schwer verletzten Mitschüler, die noch lebten, zu stillen, während andere Schüler aus der Klasse verzweifelt über Handy die Polizei verständigten oder Anweisungen von Notärzten erhielten. Einige Schüler hatten sich auf die Toiletten geflüchtet, wo sie erst Stunden später von einem Sondereinsatzkommando der Polizei befreit wurden. Lehrer, die vom Täter übersehen worden waren oder keinen Unterricht hatten, mussten ihre verblutenden Kollegen mit ansehen, versuchten ihre Schüler zu schützen und fühlten sich selber vollkommen hilflos und ausgeliefert. Für viele betroffene Schüler und Lehrer hielt die qualvolle Ungewissheit und die Angst über lange Zeit an, da sie erst nach vier bis fünf Stunden vom Sondereinsatzkomman- B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt do der Polizei aus der Schule evakuiert werden konnten. Die meisten Betroffenen standen unter Schock, zitterten, weinten oder waren apathisch und konnten nicht fassen, was geschehen war. In den ersten Wochen und Monaten nach dem Ereignis konnten sich sehr viele Schüler und Lehrer nicht auf den Unterricht konzentrieren, sondern waren mehr mit ihrer Belastungs- beziehungsweise Traumasymptomatik beschäftigt. Unter den Lehrern war ein hoher Krankenstand zu verzeichnen. Nicht wenige Lehrer deuteten an, sich nicht vorstellen zu können, den Beruf weiter auszuüben. Schüler sahen sich ständigen Auslösereizen ausgesetzt, die sie an den Vorfall erinnerten und starke Angst- und Panikreaktionen auslösten: das Unterrichtsfach, das sie damals gerade hatten, der Wochentag, an dem es geschehen war, bestimmte Geräusche in der Schule, die Begegnung mit einem Schüler einer anderen Klasse, mit dem man gemeinsam geflohen war und viele mehr. Vermeidungsreaktionen waren die häufigsten Folgen. Entweder blieben Schüler dem Unterricht fern, oder sie versuchten gezielt diejenigen Situationen zu vermeiden, die ihnen Schwierigkeiten bereiteten. Insgesamt waren sie gedanklich und emotional mehr mit sich selbst und nicht mit dem Unterrichtsgeschehen befasst. Im Folgenden werden die Interventionen nach dem Schulmassaker in Erfurt auf der Systemebene, der Gruppenebene und der individuellen Ebene dargestellt. 4.2 Interventionen und deren Implementierung 4.2.1 Systemebene Folgende Institutionen waren für die notfallpsychologische Bewältigung der Unglücksfolgen und in die Betreuung der Betroffenen in den ersten Tagen involviert: die Polizeidirektion Erfurt und andere Polizeidienststellen mit insgesamt 973 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten, Rettungskräfte des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz der Stadtverwaltung Erfurt, Notärzte, Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehren, Kriseninterventionskräfte der Polizeidirektion Jena, Spontane Helfer, vorrangig Seelsorger, Psychotherapeuten, Mediziner, Sozialpädagogen, Familienberater, Das Innenministerium, Das Sozialministerium, Das Kultusministerium, Für die langfristige Betreuung die Unfallkasse Thüringen, Der Autor als externer Krisen- und Katastrophen-Psychologe, der vom Sozialministerium für die fachliche Leitung der Maßnahmen zur Traumabewältigung und zur Konzeption eines langfristigen Betreuungsprogramms engagiert wurde. 233 234 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt 4.2.2 Gruppenebene Im Folgenden sollen die Gruppeninterventionen erläutert werden, die mit den betroffenen Schülern und Lehrern durchgeführt wurden. Dabei wird unterteilt in kurz-, mittelund langfristige Interventionen. Kurzfristige Interventionen Unter kurzfristigen Interventionen werden Maßnahmen verstanden, die innerhalb der ersten ein bis zwei Wochen nach dem Ereignis durchgeführt werden. Betreuung am Unglückstag Kurz nach Bekannt werden des Ereignisses wurden durch die Polizeidirektion Jena Kriseninterventionskräfte in der Schule eingesetzt. Da das Ereignis sehr schnell durch die Medien bekannt wurde, kamen einige Psychologen zum Ort der Geschehnisse und informierten wiederum andere Kollegen. Die Einsatzleitung der Polizei telefonierte alle psychologischen Praxen in Erfurt an und bat um Unterstützung. Fast alle angeforderten Psychologen unterbrachen ihre normale Arbeit und halfen bei der notfallpsychologischen Betreuung der Schüler und Lehrer. In der ersten Phase standen insgesamt 74 psychologische Helfer zur Verfügung. Später kamen weitere Psychologen hinzu, unter anderem aus den Ländern Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Betreuung fand statt auf einem großen Sportgelände, wohin die Betroffenen durch die Polizei nach der Evakuierung aus der Schule gebracht worden waren. Dort fand auch die Zusammenführung der Schüler mit ihren Eltern und der Lehrer mit Angehörigen statt. Betreuung in den folgenden Tagen Aufgrund der starken emotionalen Betroffenheit bei Schülern und Lehrern und weil die Schule für kriminalpolizeiliche Untersuchungen geschlossen wurde, war eine normale Durchführung des Unterrichts nicht möglich. Schüler, Eltern, Lehrer und Vertreter der Schulbehörde kamen im Rathaus der Stadt zusammen und besprachen dort mit Psychologen, was sie erlebt hatten, ihr Befinden und Fragen, wie es weiter gehen solle. Die ganze Stadt war in einem Ausnahmezustand: die Menschen waren intensiv mit dem Ereignis beschäftigt, legten Blumen vor der Schule und dem Rathaus nieder, standen in langen Warteschlangen, um sich in die Kondolenzbücher der Stadt einzutragen und sahen sich einem großen Medieninteresse mit teilweise sehr aufdringlichen Journalisten ausgesetzt. Eine Hotline einer Firma für interdisziplinäres Notfallmanagement wurde geschaltet, auf der sich jeder melden konnte, der in irgendeiner Weise von den Ereignissen betroffen war. In den ersten Tagen arbeiteten dort 20 Mitarbeiter, die täglich ca. 1 000 Anrufe bearbeiteten. Die Hotline blieb geschaltet bis zu den Sommerferien der Schule. Viele Psychologen mit sehr unterschiedlichen Ansätzen zur notfallpsychologischer Betreuung waren im Einsatz: einige führten Debriefings durch, einige führten nondirektive Gespräche mit den Schülern, einige setzten auf gemeinsame Ausflüge, B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt einige versuchten, Entspannungsübungen zu vermitteln, einige suchten sich die jeweils auffälligsten Schüler heraus, um mit ihnen Einzelgespräche zu führen, einige schlugen Aromatherapie, Homöopathie und andere Heilverfahren vor, die wenig mit wissenschaftlich fundierten Interventionen nach Traumata zu tun haben. Der finanzielle Träger der Betreuung, die Unfallkasse Thüringen, sah sich einer Vielzahl von den jeweiligen Anbietern als „therapeutisch wichtig“ deklarierten Forderungen ausgesetzt. Die Betroffenheit nach dem Ereignis ebenso wie der Wunsch, den Betroffenen zu helfen waren groß, es gab keine Erfahrungswerte aus einem vergleichbaren Ereignis, daher stimmte man nahezu allen Vorschlägen zu. Die Schüler konnten sich zum Beispiel jederzeit vom Unterricht abmelden und zu einem der in der Schule befindlichen zahlreichen Psychologen zum Einzelgespräch gehen, die diese unabhängig vom Ausbildungsstand oder der theoretischen Orientierung durchführen konnten. Sozialarbeiter oder Pädagogen rechneten Betreuungsstunden in der Klasse, Einzelgespräche oder Begleitung bei Klassenfahrten mit der Unfallkasse ab, obwohl sie keinerlei therapeutische Ausbildung, besonders nicht in Traumatherapie nachweisen konnten. Mittelfristige Interventionen Unter mittelfristigen Interventionen werden Maßnahmen verstanden, die drei bis acht Wochen nach dem Ereignis durchgeführt werden. Das Betreuungsprogramm Um die mittel- und langfristige Betreuung besser abzustimmen und einen koordinierten, wissenschaftlich fundierten Weg der Traumabewältigung zu beschreiten, war es nötig ein einheitliches, für alle Therapeuten verbindliches Betreuungskonzept zu formulieren. Das vom Autor im Auftrag des Sozialministeriums konzipierte Betreuungsprogramm basierte auf der Erkenntnis, dass durch das extreme Ereignis zielgerichteter Gewalt die gesamte Schulgemeinschaft betroffen war, da jeder, der zum Tatzeitpunkt in der Schule anwesend gewesen war, mit dem traumatischen Ereignis konfrontiert war. Entweder er hatte die Tötung selbst mit ansehen müssen und befand sich in Todesangst, oder er bekam unmittelbar danach von Augenzeugen die schlimmsten Szenen erzählt. Zu erwarten waren abhängig vom Ausmaß der Traumaexposition, unterschiedliche Ausmaße von Traumatisierungen. Eine aufsteigende Wahrscheinlichkeit, traumatische Reaktionen zu entwickeln, und somit eine Abstufung der Exposition mit traumatisierenden Details, ist folgendermaßen beschreibbar: a) Schüler und Lehrer, die den Täter nicht gesehen haben, nur in der Klasse waren, Schüsse und Schreie gehört, keine Tote gesehen haben. b) Schüler und Lehrer, die den Täter nicht gesehen haben, nur in der Klasse waren, Schüsse und Schreie gehört, beim Evakuieren Tote gesehen haben. c) Schüler und Lehrer, die den Täter von weitem und Tötungen bzw. Tote aus „sicherer“ Entfernung gesehen haben. d) Schüler und Lehrer, die aus unmittelbarer Nähe miterlebten, wie jemand erschossen wurde und selber Todesangst hatten. 235 236 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt e) Schüler und Lehrer, die aus unmittelbarer Nähe miterlebten, wie jemand erschossen wurde, selber Todesangst hatten, und mit der erschossenen Person lange in einem Raum verbleiben mussten bis die Rettung kam. Im Bewusstsein der Tatsache, dass alle Schulmitglieder mehr oder minder stark vom Ereignis betroffen waren, einige jedoch aufgrund der Intensität der Traumaexposition (und anderer Faktoren) besonders prädestiniert für psychische Störungen waren, wurde folgendes Betreuungsprogramm formuliert, das verbindlich für die psychologische Betreuung des ersten halben Jahres war (Original, auszugsweise): Abbildung B4.2: Betreuungsprogramm für das Gutenberg-Gymnasium Betroffenen-Gruppen: Folgende Gruppen sind aus traumatherapeutischer Sicht betroffen und benötigen kurz-, mittel- oder langfristige Nachsorge-Angebote: 1. Schüler des Gutenberg-Gymnasiums, 2. Lehrer des Gutenberg-Gymnasiums, 3. Eltern des Gutenberg-Gymnasiums, 4. Hausmeister und Schulangestellte des Gutenberg-Gymnasiums, 5. Angehörige der getöteten Lehrer und Schüler, 6. Die Familie des Täters, 7. Schüler anderer Schulen in Erfurt, 8. Lehrer anderer Schulen in Erfurt, 9. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erfurt, 10. Einsatzpersonal (Polizei, Rettungsdienste), 11. Psychologen und Ärzte, die am ersten Tag im Einsatz waren. Betreuungskonzept Schule Die folgenden Empfehlungen sind für die Betreuung der Gruppen 1 bis 4, also für die in der Schule tätigen Personen. Durch die Gewalttat in der Schule wurden sowohl die Schulgemeinschaft in ihrer Gesamtheit erschüttert – früher ein Ort der Sicherheit und des Lernens, heute ein Ort der Verunsicherung und der Erinnerung an ein schreckliches Trauma, an dem es nun schwer fällt, zu lehren und zu lernen –, aber auch jeder einzelne Schüler und Lehrer wurde in seiner persönlichen psychischen und körperlichen Stabilität beeinflusst. Schüler, Lehrer, Schulangestellte und Eltern sollen schwerpunktmäßig in der Schule betreut werden. Dadurch wird betont, dass nicht der Einzelne mit seinem Leid „krank“ ist, sondern dass die gesamte Gemeinschaft betroffen ist. Es handelt sich daher vom Sprachgebrauch her auch nicht um „Patienten“, sondern um Betroffene. Diese Betroffenen haben gemeinsam ein Trauma erlebt, eine außergewöhnliche unnormale Erfahrung, auf die sie mit verschiedenen zu erwartenden, angemessenen Belastungssymptomen reagieren. Diese Belastungssymptome sollen durch eine systematische, an den Erfahrungen anderer schwerer Unglücke und Katastro- B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt phen aus dem In- und Ausland orientierten Betreuung, behandelt werden, um Fehlentwicklungen, besonders einer chronischen posttraumatischen Belastungsstörung PTBS (F43.0, ICD-10) vorzubeugen bzw. um akute posttraumatische Belastungsstörungen in ihrer Entwicklung günstig zu beeinflussen. Es wird unterschieden zwischen drei Arten der Betreuung: a) Allgemeine Gruppen-Betreuungsangebote an alle Schüler, Lehrer, Schulangestellten und Schuleltern bezüglich des Amoklaufs, um eine erfolgreiche Verarbeitung dieses Traumas zu ermöglichen bzw. zu fördern. Ziel ist hierbei, dass der Einzelne mit seinen belastenden Erfahrungen nicht alleingelassen wird, was häufig zu einer Überforderung und zu einer Fehlverarbeitung mit psychischen Folgeschäden führt. Jeder soll die Möglichkeit haben, in einem organisierten und strukturierten Rahmen unter fachtherapeutischer Leitung sich mit Anderen über seine Erfahrungen und sein Leid auszutauschen und gemeinsam Bewältigungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Dabei sollen von den Therapeuten Vorschläge für eine effektive Bewältigung angeboten werden, die in ihrer Wirkweise wissenschaftlich fundiert und gesichert sind und sich bei ähnlichen Problemlagen (Borken, Eschede, Meißen) bewährt haben (s. u.). Die Betroffenen der Schule dürfen nicht Versuchsobjekte von unzureichend qualifizierten Behandlern werden oder von wissenschaftlich nicht überprüften Methoden. Sie sollen weiterhin geschützt werden, wissenschaftliche Versuchsopfer zu werden. Der Leitgedanke der Betreuung heißt: Soviel wie nötig, aber sowenig wie möglich, um langfristige psychische Schäden zu verhindern. Alle Maßnahmen dieser Betreuung werden im Gruppensetting in der Schule durchgeführt. Damit wird dokumentiert, dass die gesamte Schulgemeinschaft betroffen ist, und dass diese durch gemeinsame Gesprächsrunden und Aktionen viele Ressourcen reaktivieren kann, die zu einer Wiederherstellung einer gesunden, funktionierenden Schulgemeinschaft führen können. Der einzelne Schüler und Lehrer soll dadurch die Chance haben, an seine alte Stabilität wieder anzuknüpfen. b) Spezielle weitergehende therapeutische Angebote für die Gruppen der hoch belasteten Schüler und Lehrer zur Therapie bereits eingesetzter psychotraumatischer Belastungssyndrome. Erfahrungsgemäß wird dies mindestens ein Drittel der Betroffenen sein. Für diese besonders hoch belasteten Schüler und Lehrer müssen zusätzliche psychotherapeutische Angebote gemacht werden, die dem Stand der heutigen Psychotherapieforschung entsprechen. Ziel ist es dabei, dass die Störungen im Anfangsstadium (in den ersten drei bis acht Monaten) behandelt werden, um eine Chronifizierung der posttraumatischen Belastungsstörung und ein Entwickeln weiterer komorbider psychischer Störungen (Depressionen und Angststörungen) zu verhindern. Die Erfolgsaussichten sind in diesem Stadium als gut zu bezeichnen, wie Therapiestudien und 237 238 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt die Erfahrungen der Betreuung der Meißener Schüler und Lehrer belegen. Diese traumatherapeutischen Interventionen werden teils im Gruppensetting, teils in Einzelsitzungen durchgeführt. Ort der Behandlungen ist jeweils ein geeigneter ungestörter Raum in der Schule bzw. Räume in dem zusätzlich angemieteten Objekt in Schulnähe. c) Über die in Punkt 1 und 2 hinausgehende eigentliche Traumabearbeitung ist eine umfassende und langfristige gemeinsame Arbeit von Schülern, Lehrern und Eltern des Gutenberggymnasiums in Zusammenarbeit mit anderen Schulen der Stadt, des Landes Thüringen wie auch auf gesamtdeutscher Ebene zu leisten, um aktiv mit der durch die Tat entstandenen Verunsicherung umzugehen. Hierzu gehören vor allem auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt und der Umgang mit psychischen Konfliktsituationen von Schülern in der Schule. Diesbezüglich werden Konzepte von der Schulpsychologie vorgelegt. Theoretischer Hintergrund: Das Betreuungskonzept beruht schwerpunktmäßig auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen Theorien und Methoden, die nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand die Methoden der Wahl bei der Therapie posttraumatischer Belastungssyndrome darstellen (s. van Etten & Taylor, 1998; Bengel, 2003; Ehlers, 1999; Maercker, 2003a). Es sollen jedoch auch tiefenpsychologische und psychodynamische Herangehensweisen (s. Fischer & Riedesser, 1998; Reddemann, 2001; Horowitz, 1976) integriert werden. Setting: Die Klassen, beziehungsweise Lehrergruppen werden von jeweils zwei Psychologen betreut. Ein Psychologe kommt aus Erfurt und Umgebung, garantiert dadurch permanente Präsenz und steht für die allgemeine psychotherapeutische Betreuung. Der zweite Psychologe ist traumatherapeutisch spezialisiert und kommt von außerhalb jeweils zu den traumaspezifischen Interventionen dazu. Mit den Schülern und Lehrern soll anfangs hauptsächlich im Gruppensetting gearbeitet werden. Die betreuten Personen werden nicht als Patienten, sondern als Betroffene definiert. Die heilenden Ressourcen der Gruppe sollen aktiviert werden. Oberstes Ziel ist die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit bei gleichzeitiger kontinuierlicher Traumabewältigung. Diese Betreuung kommt allen Lehrern und Schülern zuteil und ist zu unterscheiden von der Behandlung akuter Belastungsstörungen und posttraumatischer Belastungsstörungen, die erwartungsgemäß bei mindestens einem Drittel der Schüler und Lehrer zu erwarten ist. Eingangsschulung – Aufbauschulungen: Die ortsansässigen Therapeuten bekommen eine Eingangsschulung über zwei Ta- B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt ge zum Thema Psychotraumatologie. Inhalte sind die traumatherapeutischen Gruppen- und Einzelinterventionen, die in der Betreuung zur Anwendung kommen. Im folgenden Jahr finden vierteljährliche Schulungen statt zu verschiedenen relevanten Themen der Psychotraumatologie. Konzept-Supervision Alle am Prozess beteiligten Therapeuten treffen sich einmal im Monat zur Supervision, auf der die Verwirklichung des Betreuungskonzepts immer wieder reflektiert wird. Die externen Therapeuten müssen über eine abgeschlossene Therapieausbildung und eine abgeschlossene traumatherapeutische Zusatzqualifikation (z. B. Ausbildung bei Prof. Fischer, beim ITB Pieper, oder in EMDR) verfügen. Diese Fachleute sollen aus festen Arbeitszusammenhängen kommen und sich für die Aufgaben in Erfurt freimachen. So ist gewährleistet, dass sie wirklich nur das therapeutisch absolut notwendige machen und nicht etwa Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für sich selber leisten. Der gesamte Prozess soll wissenschaftlich evaluiert werden (Universität Jena). Alle Einzel- und Gruppeninterventionen sollen auf einem Dokumentationsblatt festgehalten werden. Pressearbeit: Die im Prozess arbeitenden Therapeuten sollen in der Regel keine Pressekontakte haben, um den Kontakt mit den Betroffenen dadurch nicht zu gefährden. Presseinformationen werden durch die Pressestelle des Thüringischen Sozialministeriums in Zusammenarbeit mit Herrn Pieper gegeben. Intention des Konzepts war damit die Verwirklichung eines der zentralen Erkenntnisse der Eschede-Betreuung: zur Evaluation der therapeutischen Interventionen muss gewährleistet sein, dass die große Zahl der Therapeuten auf dem Boden eines für alle verbindlichen Konzepts arbeiten. Auf diese Weise kamen in der direkten Arbeit mit den betroffenen Schülern und Lehrern über 50 Psychologen aus allen Teilen Deutschlands zum Einsatz. Formal verantwortlich für die Umsetzung des Konzepts, das heißt Bestellung, Einsatz der Psychologen und Arbeitsrechtliche Angelegenheiten war die Unfallkasse Thüringen. Umsetzung des Betreuungskonzepts und Probleme der Implementierung Der Schulbetrieb wurde nach zwei Wochen in einer Ersatzschule wieder aufgenommen. Für die Umsetzung des Konzepts wurde in Abstimmung mit dem Kultusministerium festgelegt, dass für jede Klasse für den Zeitraum von zunächst einem halben Jahr eine Doppelstunde pro Woche für die Traumabewältigung zur Verfügung stehen muss. Das Fach „Traumabewältigung“ sollte oberste Priorität haben und in den normalen Unterrichtsablauf integriert, andere Fächer zugunsten der Traumabewältigung alternie- 239 240 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt rend zurückgestellt werden. Zu dieser Doppelstunde sollten der jeweilige „Bezugstherapeut“ und der externe Traumatherapeut in die Klassen gehen und mit den Schülern arbeiten. Zusätzlich zu dieser für alle gemeinsam zu leistenden Bewältigung der psychischen Folgen des Ereignisses sollten die Therapeuten im Anschluss an den Unterricht einzeltherapeutische Maßnahmen mit den Schwertraumatisierten durchführen. Dieser Ansatz stieß bei der Schulleitung auf Widerstand, da sie darin eine zu große Störung des normalen Unterrichtsablaufs sah. Sie wollte die Normalität in der Schule dadurch schnellstmöglich wieder erreichen, indem Unterricht wie früher durchgeführt, und nur nachmittags mit den Schwertraumatisierten therapeutisch gearbeitet werden solle. Sie argumentierte mit einem Druck der Eltern, die sich schon über zu viele ausgefallene Schulstunden beschwert hätten und mit Schwierigkeiten, die Stundenpläne umzugestalten. Ein derartiger Grundkonflikt ist regelhaft bei den meisten Lagen nach Katastrophen beziehungsweise Lagen nach Ereignissen zielgerichteter Gewalt zu finden und folgendermaßen beschreibbar: Sichtweise A: Das Trauma hat die Gemeinschaft getroffen und erschüttert, ein Teil der Betroffenen kommt mit den dadurch entstandenen Belastungen nicht zurecht und reagiert mit traumatischen Störungen. Mit diesen „Schwächsten“ muss psychotherapeutisch gearbeitet werden, sie müssen wieder so hergestellt werden, dass sie sich möglichst ohne Probleme in den schnell wiederherzustellenden Alltagsablauf einordnen können. Die Normalität ist am besten dadurch wieder zu erlangen, indem man sich auf die Arbeit konzentriert, die man immer geleistet hat. Das System, in dem es zu der Gewalttat gekommen ist, wird nicht in Frage gestellt, beziehungsweise es wird nicht problematisiert, warum es in diesem System dazu gekommen ist. Dieser Ansatz besteht in einer rein individualpsychologischen Sichtweise. Sichtweise B: Die durch das Trauma entstandene Erschütterung und Verunsicherung hat zu einem Ausnahmezustand geführt, in dem man nicht so schnell wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Der Prozess, wieder zur Normalität zu gelangen, dauert länger und ist aktiv anzugehen. Normalität bedeutet nicht unbedingt, wieder den gleichen Zustand wie früher zu erreichen. Die Verletzungen aller Betroffenen müssen psychologisch aufgearbeitet werden. Analysen müssen im Bereich, in dem die zielgerichtete Gewalt entstand angestellt und Konsequenzen gezogen werden, die die betroffene Gemeinschaft oder sogar die ganze Gesellschaft mit einbeziehen. Den am schwersten Betroffenen muss effektiv und kurzfristig geholfen werden, es ist die Aufgabe aller Betroffenen dabei zu helfen und langfristig an den Gründen, die zur Katastrophe geführt haben zu arbeiten. Dieser Ansatz schließt eine individualpsychologische, soziale und gesellschaftspolitische Sichtweise mit ein. Die Entscheidung, an welcher Sichtweise ein Betreuungsprogramm orientiert ist, hängst einerseits davon ab, wie stark das Maß an persönlicher Betroffenheit derjenigen Personen ist, die für diese Entscheidung verantwortlich sind, andererseits davon, wie stark sie das System, in dem das traumatische Ereignis stattfand mitgestaltet und getragen haben. Je stärker die eigene Verantwortlichkeit für das System war und je ausgeprägter die eigene Betroffenheit ist, desto mehr wird die Person dazu neigen, die entstandenen Probleme auf einige wenige zu reduzieren, und diese den Psychologen B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt zur „Reparatur“ zu übergeben, damit sie sich in das „bewährte“ System wieder integrieren können. Die besondere Problematik, die sich daraus für die Situation in Erfurt ergab, soll weiter unten unter Abschnitt B 4.5.2 dargestellt werden. Elternabende Auf Schulelternabenden für die Unter-, Mittel- und Oberstufeneltern wurden den Eltern Informationen gegeben zu üblichen psychischen Reaktionen auf ein Trauma, und zu den wichtigsten Erkenntnissen der Traumatologie. Dazu gehörten vor allem, die Reaktionen ihrer Kinder als normale Belastungsreaktionen auf ein Extremereignis darzustellen und vor einem reinen „Vergessen-Wollen“ zu warnen. Möglichkeiten, mit wissenschaftlich überprüften Methoden eine erfolgreiche Bewältigung des Traumas zu fördern wurden aufgezeigt und anhand der Erfahrungen aus anderen ähnlichen Ereignissen, besonders Meißen verdeutlicht. Die Notwendigkeit und die Art und Weise einer diagnostischen Untersuchung des Schweregrades der Traumatisierung mit dem Ziel, Schwersttraumatisierte zu erkennen und besonders zu betreuen wurde erklärt, verbunden mit dem Hinweis, dass die Teilnahme sowohl an der diagnostischen Untersuchung, als auch an der therapeutischen Arbeit nur mit der Einverständniserklärung der Eltern möglich sei. Die Zustimmung der Elternschaft zu der Aufnahme des Fachs „Traumabewältigung“ in den Unterricht geschah mit einer eindeutigen Mehrheit – wenige Eltern hauptsächlich die der Abiturienten äußerten Sorgen, ihre Kinder könnten zuviel Stoff verpassen – das Einverständnis zur diagnostischen Untersuchung gaben über 95%. Ein Kennen lernen der jeweiligen Bezugs- und Traumatherapeuten und genauere Informationen zu den geplanten therapeutischen Maßnahmen fanden auf Klassenelternabenden statt. Feststellung des Schweregrads der Traumatisierung Mit geeigneten Fragebögen, PDS (Steil & Ehlers, 1997), BDI (Beck, Hautzinger, Bailer, Worall & Keller, 1995), SCL-90-R (Franke, 1995), wurden ab Klasse 8 der Schweregrad der Traumatisierung, der Depressivität und der allgemeinen Psychopathologie untersucht (s. Abschnitt B 4.3). Bei den Klassen 5 bis 7 kamen das standardisierte Interview CAPS-C (Steil, Gundlach & Müller, 1998) sowie die CBCL-Listen bei den Eltern dieser Schülergruppe zur Anwendung (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998). Mit Katamnesezeitpunkten nach einem halben und nach einem Jahr sollte die Entwicklung der Traumabewältigung dokumentiert werden. Langfristige Interventionen Unter langfristigen Interventionen werden diejenigen Maßnahmen verstanden, die ab zwei Monate nach dem Ereignis begannen. Gruppenmaßnahmen der Therapeuten in den Klassen Folgende Gruppenmaßnahmen wurden von den jeweiligen Bezugs- und Traumatherapeuten in den Klassen durchgeführt: 241 242 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Stabilisierung. Mit Hilfe von Imaginationsübungen (Reddemann, 2001) sollte eine gewisse Stabilisierung erreicht werden, die die Voraussetzung für weitere therapeutische Arbeit und für ein Einlassen auf den Unterricht darstellt. Distanzierung. Distanzierungsübungen (Reddemann, 2001) sollten helfen, besonders belastende traumatische Erlebnisse, sich aufdrängende Gedanken, Bilder, Erinnerungen für eine begrenzte Zeit auf Seite zu stellen, mit dem Wissen, dass sie später bearbeitet werden. Entspannungsübungen. Durch das Erlernen von Entspannungsübungen wurde den Schülern das Gefühl vermittelt, selber etwas tun zu können gegen das häufig als unerträglich empfundene Gefühl der Machtlosigkeit und der übermäßigen Angespanntheit. Kontrollierte Nachbearbeitung. Anlehnend an Debriefing-Konzepte (Mitchell & Everly, 1996) wurde die traumatischen Erlebnisse in Gruppengesprächen aufgearbeitet. Dabei wurde besonderer Wert auf die Bearbeitung der Kognitionen gelegt. Emotionen und physiologische Begleiterscheinungen wurden kontrolliert begleitet, jedoch nicht forciert, um zu starke Belastungen und das Risiko von Retraumatisierungen zu vermeiden. Dadurch wurde erreicht: a) ein Verstehen der Ereignisse und der eigenen Rolle, b) ein vergrößertes Verständnis für die Anderen, c) durch die Erzählung die Ereignisse zu einer Geschichte der Vergangenheit werden zu lassen und eine distanziertere Haltung zu gewinnen, d) ein größeres Verständnis für den weiteren Prozess der Traumabewältigung, e) eine Möglichkeit für die Leiter, besondere Probleme schwer belasteter Schüler zu identifizieren. Gesprächsgruppen für Schüler. In den Stunden der Traumabewältigung wurden den Klassen Gesprächsrunden zu folgenden Themen angeboten: Umgang mit Angst, Umgang mit Trauer, Möglichkeiten der Kommunikation über eigene und fremde psychische Probleme in der Schule, Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt, Möglichkeiten, auf andere Schüler zuzugehen, bei denen Probleme zu erkennen sind. Expositionsbehandlung in der alten Schule. Mit jeder Klasse fand eine gut vorbereitete und eng begleitete Rückkehr in die Schule statt. Zum einen war es der Wunsch der meisten Schüler, die Schule noch einmal wieder zu sehen, bevor die umfangreichen Umbaumaßnahmen begannen, weil sie sie nicht so in Erinnerung behalten wollten, wie sie sie am Tag des Schulmassakers verlassen hatten. Verglichen mit anderen Unglücken und Katastrophen, aus denen eher eine Vermeidungshaltung der Betroffenen in Bezug auf das Aufsuchen der Unglücksstelle zu beobachten ist, bestand in Erfurt ein starker Wunsch, sogar eine ungeduldige Forderung vieler Schüler, so schnell wie möglich wieder in die Schule hineinzugehen. Es war schwierig, einige Schüler davon abzuhalten, unvorbereitet und ohne theoretisches Wissen über Konfrontation und Habituation den Ort der Traumatisierung aufzusuchen. Im Sinne von kontraphobischem Verhalten (Peterson, Prout & Schwarz, 1991) wollten einige Schüler sich beweisen, dass sie in der Lage seien, in die Schule zu gehen, dass es ihnen nichts ausmache B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt den „Ort des Grauens“ zu betreten. Diese Art Mutprobe, mit der man sich und anderen vielleicht beweisen möchte, dass alles wieder in Ordnung ist und man die Traumatisierung ungeschehen machen möchte wäre eine Scheinbewältigung und birgt ernste Gefahren in sich: die Möglichkeit einer unkontrollierten emotionalen Überflutung mit dissoziativen Bewusstseinszuständen und psychischer Dekompensation ist besonders bei denjenigen Traumatisierten gegeben, die sich selbst gegenüber die psychischen Folgen der traumatischen Belastung nicht eingestanden haben. Um derartige Komplikationen zu vermeiden, ist eine sorgsame theoretische Vorbereitung der Exposition unerlässlich. Zum zweiten war es aus verhaltenstherapeutischer Sicht sinnvoll, am Ort des Geschehens mit den Betroffenen deren Emotionen zu bearbeiten und einen weiteren Schritt des kognitiven Nachvollziehens des Geschehens zu vollziehen. Wie die Erfahrungen aus Borken, Eschede und Meißen zeigten, stellten in den nachträglichen Auswertungen mit den Betroffenen diese Maßnahmen häufig die aus Betroffenensicht wichtigsten Schritte in der Traumabewältigung dar. Aus jeder Klasse wurden kleine Gruppen mit fünf bis zehn Schülern zusammengestellt, die während des Attentats vergleichbare Erlebnisse gehabt hatten. In Gruppengesprächen wurden jeweils diejenigen Situationen identifiziert, die intensiven traumatischen Stress bedeutet hatten. Das konnte z. B. eine Situation sein, in der jemand Todesangst hatte, oder in der er mit ansehen musste, wie ein Lehrer oder Schüler erschossen wurde. Die dazu gehörigen Orte wurden in eine „Traumalandkarte“ eingetragen, die für jeden Schüler erstellt wurde. Ziel der in vivo Exposition war es dann jeweils, diese kritischen Punkte aufzusuchen und dort zu habituieren. Dabei war genau auf die Reaktionen der Teilnehmer zu achten. Zum Beispiel sagte eine Schülerin nach erfolgreich durchgeführter Exposition in ihrem Klassenraum, sie wolle nach einem Gang durch das Schulgebäude beim Hinausgehen nicht noch einmal an ihrer Klasse vorbei, sondern einen anderen Weg gehen. Auf Nachfragen stellte sich heraus, dass sie während der Exposition auf dem Tisch, an dem sie immer gesessen hatte, eine abfällige Bemerkung über ihre später getötete Lehrerin entdeckt hatte, die sie früher einmal dort hin gekritzelt hatte. Das bereitete ihr nun derartige Schuldgefühle, dass sie die erneute Konfrontation mit dem Klassenzimmer vermeiden wollte. Um eine vollständige auf das Klassenzimmer bezogene Habituation zu erreichen, war es wichtig, die Expositionsbehandlung vor dem Tisch mit ihrer abfälligen Kritzelei erneut aufzunehmen. Nach erfolgreicher Habituation aller aus der Gruppe war es erlaubt und erwünscht, vorher sorgfältig vorbereitete Trauerrituale in der Schule durchzuführen, wie z. B. Blumen niederlegen an der Stelle, an der eine Lehrerin verstorben war, einen Brief an einen getöteten Lehrer schreiben, oder ein Musikstück abzuspielen, was an den ermordeten Mitschüler erinnerte. Gruppe für Lehrer Eine regelmäßig tagende Gruppe sollte den Lehrern die Möglichkeit bieten, die Ereignisse aufzuarbeiten, den Trauerprozess zu begleiten und Bewältigungsstrategien zu erarbeiten. Die Lehrer wurden dabei begleitet von zwei Therapeuten, die ausschließlich für die Betreuung der Lehrer zuständig waren und nicht auch in die Schülerbetreuung 243 244 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt involviert waren. Ein vor der Öffentlichkeit und den Schülern geschützter sicherer Rahmen war für die Akzeptanz therapeutischer Angebote für die Lehrer von besonderer Wichtigkeit. In den Gruppensitzungen wurde inhaltlich besonderer Wert gelegt auf den Umgang mit Angst und Verunsicherung, Umgang mit Flashbacks, sinnvolles Verhalten bei Schlafstörungen und Umgang mit Erschöpfungszuständen und körperlichen Beschwerden. Expositionsbehandlungen mit den Lehrern mussten zeitlich immer so eingeplant werden, dass es keine Begegnungen mit Schülern im Schulgebäude gab. 4.2.3 Individuelle Ebene Zusätzlich zu den dargestellten Gruppeninterventionen wurden mit denjenigen Schülern und Lehrern, die sich in der Diagnostik als schwer traumatisiert herausgestellt hatten, einzeln traumatherapeutische Maßnahmen durchgeführt. Zum Einsatz kamen dabei je nach theoretischem Hintergrund der Therapeuten: Kontrolliere Traumaexposition (KTE, s. Abschnitt C 3.5), Exposition in sensu (s. Abschnitt C 3.6), Bildschirmtechnik, EMDR (s. Abschnitt C 3.7), Einzelgespräche (Klientzentriert – tiefenpsychologisch – verhaltenstherapeutisch), Trauma- und Trauerbearbeitungsgespräche, Narrative Traumabewältigung. In den gemeinsamen Konzeptsupervisionen aller im Betreuungsprojekt tätigen Therapeuten wurden die Strategien der Einzel- und der Gruppenbehandlungen immer wieder ausgetauscht und aufeinander abgestimmt. Dadurch war gewährleistet, dass nur solche Therapiemaßnahmen zur Anwendung kamen, die sich innerhalb eines Rahmens der wissenschaftlich fundierten Psychotherapie befinden und dass alle Therapeuten auf der Grundlage des anerkannten Konzepts arbeiteten. 4.3 Qualitätssicherung und Evaluation Da der Autor nach sieben Monaten aus dem Projekt Erfurt ausgestiegen ist, können hier nur die Daten der Eingansmessung und der Zweitdiagnostik dargestellt werden. Eine weitergehende statische Auswertung konnte nicht erfolgen, da der Auftraggeber die Daten schützen und als Verschlusssache behandeln möchte. Da hier nur auf veröffentlichte Ergebnisse zurückgegriffen werden kann, werden nur die Ergebnisse der diagnostischen Untersuchung mit den Schülern dargestellt. Relevant sind die Ergebnisse vor allem hinsichtlich der Häufigkeit traumatischer Folgen verglichen mit den anderen in dieser Arbeit untersuchten Katastrophen. 4.3.1 Methode In einer Eingangsuntersuchung, zwei Monate nach dem Ereignis, sollte der Traumatisierungsgrad festgestellt und weitere komorbide Störungen, besonders Depressionen B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt sowie eventuelle suizidale Tendenzen erfasst werden. Untersucht wurden nur Kinder und Jugendliche, von denen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorlag. Weiterhin wurden Jugendliche ab der 8. Klasse gefragt, ob sie damit einverstanden waren, dass ihre Eltern über die Ergebnisse informiert werden. Die Klassen 8 bis 12 wurden im Klassenverband mit den Fragebögen unter Aufsicht der Psychologen untersucht. In den Klassen 5 bis 7 wurde die Traumasymptomatik im Einzelinterview, die allgemeine psychopathologische Symptomatik über einen Elternfragebogen erfasst. Die Auswertung erfolgte in der Universität Jena unter Leitung von Frau Dr. Steil. In einer zweiten Untersuchung, acht bis elf Monate nach dem Ereignis wurde untersucht, ob sich die Symptome der Betroffenen während der Zeit der psychologischen Interventionen verändert hatten. Eine Kontrollgruppe konnte aus ethischen Gründen nicht untersucht werden, da die Interventionen allen Schülern zuteil kommen mussten. 4.3.2 Untersuchungszeitpunkt 1 Erhebungsinstrumente in den Klassen 8 bis 12 PDS – Fragebogen zur Erfassung der PTBS-Symptomatik (Steil, 1996). Die Diagnose der PTBS erfolgte anhand des DSM-IV, welches konservativer ist als das ICD-10. Das Traumakriterium ist das A-Kriterium im DSM-IV, also das Erleben/Beobachten eines Ereignisses (tatsächlicher/drohender Tod oder Verletzung oder Gefahr der körperlichen Unversehrtheit) sowie eine eigene Reaktion mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Die weiteren diagnostischen Kriterien beinhalten: mindestens eine Art das Ereignis wiederzuerleben, mindestens drei Symptome der Vermeidung, mindestens zwei Symptome von Erregung, Dauer der Symptome länger als 1 Monat, Das Ereignis verursacht Leiden oder führt zu Beeinträchtigungen. Dabei zählt ein Symptom als erfüllt, wenn es im letzten Monat mindestens einmal aufgetreten ist. Die Gesamtschwere der Symptomatik ergibt sich aus dem Mittelwert der 3 Symptomgruppen Wiedererleben, Vermeidung und Erregung und bezieht sich bei den älteren Schülern rein auf die Häufigkeit des Auftretens. Bei den jüngeren Schülern ist sowohl Häufigkeit als auch Intensität angegeben. Da für die Instrumente noch keine deutschen Normwerte vorliegen, wurden Cut-offWerte bestimmt. Lag ein Schüler im Gesamtwert über diesem Cut-off, galt der Schüler als „hochtraumatisiert“. BDI – Fragebogen zur Erfassung der Depressivität und Einschätzung eventueller Suizidalität (Beck et al., 1995). Bezüglich der Summenwerte des BDI ist eine Kategorisierung der Ausprägung nach „unauffällig“ – „mild bis mäßig“ – „klinisch relevant“ möglich. SCL-90-R – Fragebogen zur Erfassung allgemeiner Psychopathologie (Franke, 1995). Erfasst werden mit dem Fragebogen die Dimensionen: • Somatisierung 245 246 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt • • • • • • • • • Zwanghaftigkeit Unsicherheit im Sozialkontakt Depressivität Ängstlichkeit Aggressivität Phobische Angst Paranoides Denken Psychotizismus Globaler Kennwert (Durchschnittliche Belastung). Liegt ein Schüler oberhalb eines T-Wertes von 60, zeigt er eine überdurchschnittliche Symptomatik im Vergleich zu einer Normstichprobe, die allerdings ein höheres Alter aufweist, als die Schüler. Daher wurde als Interpretationshilfe auch der Mittelwert der Klassenstufe herangezogen. Erhebungsinstrumente in den Klassen 5 bis 7 In den Klassen 5 bis 7 konnten die vorgestellten Fragebögen nicht eingesetzt werden, da man in diesem Alter bei einer selbständigen Bearbeitung der Fragen nicht davon ausgehen kann, unverfälschte Antworten zu bekommen. Außerdem bestehen für diese Altersstufe keine Normwerte. Deswegen wurden in Einzelinterviews folgende Instrumente angewendet: CAPS-C – Clinician Administered PTSD Scale für Kinder und Jugendliche, deutsche Version (Steil, Gundlach & Müller, 1998). Die CAPS-C (Originalveröffentlichung Nader, Blake, Kriegler & Pynoos, 1994) ist ein strukturiertes klinisches Interview, welches das Vorhandensein einer Traumatisierung im Sinne des DSM-IV, einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie die Häufigkeit und die Intensität der Symptome der drei DSM-IV-Symptomkategorien Intrusion, Vermeidung und Übererregung bei Kindern und Jugendlichen erfasst. Es wird in der Literatur zur PTBS bei Kindern als Instrument der Wahl für die Diagnostik der Störung eingeschätzt (vgl. March, AmayaJackson & Pynoos, 1997). Das Interview ist für den Einsatz bei Kindern ab dem 8. Lebensjahr konzipiert. Das Kind selbst wird befragt. Child Behavior Checklist – deutsche Version (CBCL, Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998). Es werden die Eltern der Kinder befragt, wie sie deren Verhalten und deren Stimmungen bewerten. Es werden internalisierende Symptome unterschieden von externalisierenden. Internalisierend: • Sozialer Rückzug, • Körperliche Beschwerden, • Angst/Depressivität, • Soziale Probleme. Externalisierend: • Schizoid / Zwanghaft, • Aufmerksamkeitsstörung, • Delinquentes Verhalten, B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt • Aggressives Verhalten. Die Abklärung akuter Suizidalität erfolgte während des Interviews durch den Interviewer, Angaben der Eltern aus dem Elternfragebogen wurden als zusätzliche Information angesehen. Es ist zu bedenken, dass dieser Fragebogen die Nachteile einer Fremdbeurteilung aufweist, z. B. wenn möglicherweise einige Kinder ihre Eltern schützen wollen und Symptome verschweigen oder ein allgemein schlechter Kontakt zwischen Eltern und Kinder vorliegt. Ergebnisse Die Darstellung der Ergebnisse beziehen sich auf den Abschlussbericht der Untersuchung von der Universität Jena (Steil, 2002). Es lagen Fragebögen von N = 634 Schülern vor. PTBS-Symptomatik. Bezüglich der PTBS-Symptomatik wurde bei 46% aller Schüler eine PTBS-Diagnose nach DSM-IV festgestellt. Es ergab sich keine Abhängigkeit in der Diagnosestellung vom Alter, das heißt, höhere Klassen wiesen einen ähnlich hohen Prozentsatz an Diagnosen auf, wie niedrigere Klassen. Bezüglich des Geschlechts ergab sich ein eindeutiges Bild. Bei Mädchen wurde unabhängig von der Klassenstufe öfter eine PTBS diagnostiziert, als bei Jungen (vgl. Tabelle B 4.1). Wiedererleben und Erregung als Aspekte einer PTBS waren bei den Schülern stärker ausgeprägt, als die Kategorie Vermeidung. Dies zeigte sich über alle Klassenstufen und für beide Geschlechter. Wobei auch bezüglich der einzelnen Symptomkategorien eine höhere Schwere für die Mädchen zu verzeichnen war (vgl. Tabellen B 4.2 bis B 4.4). Als besonders stark ausgeprägte PTBS-Symptomatik galt ein Wert eines Schülers, sobald er über dem Cut-off des jeweiligen Fragebogens lag. War die GesamtSymptomatik über diesem Cut-off, wurde dieser Schüler als „hochtraumatisiert“ eingestuft. Auf insgesamt 12 Schüler (2%) traf dieses Kriterium zu. Einen Überblick über die Verteilung der Häufigkeiten geben die Tabellen B 4.5 und B 4.6. Depressivität (nur Klassen 8–12). Gemessen mit dem BDI wurden 62% der Schüler als unauffällig eingestuft. Ungefähr ein Viertel der Schüler fiel in die Kategorie „mild bis mäßig“ und 12% zeigten einen klinisch relevanten Wert (vgl. Tabelle B 4.7). Auch hier zeigte sich keine Abhängigkeit von der Klassenstufe, wohl aber zum Geschlecht: Mädchen wiesen im Mittel höhere BDI-Werte auf als Jungen und fielen häufiger in die oberen Kategorien. Allgemeine Psychopathologie. In den jüngeren Klassen wies keine der Skalen eine im Mittel überdurchschnittliche Belastung auf. In den älteren Klassen zeigte sich eine überdurchschnittliche Belastung bezüglich Ängstlichkeit. Alle anderen Skalen lagen im durchschnittlichen Bereich (gemessen mittels SCL-90-R). 247 248 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Tabelle B4.1: Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12, die nach DSM-IV die Diagnose einer PTBS erfüllen Klassenstufe weiblich Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12 Gesamt Tabelle B4.2: männlich gesamt N (%) N (%) N (%) 25 18 22 29 17 25 40 18 (58%) (44%) (48%) (63%) (68%) (66%) (54%) (45%) 16 13 6 9 8 17 18 4 (51%) (36%) (18%) (26%) (29%) (44%) (42%) (17%) 41 31 28 38 25 42 58 22 (55%) (40%) (35%) (48%) (47%) (55%) (50%) (35%) 194 (55%) 91 (34%) 285 (46%) Schwere der PTBS-Symptomatik und ihrer Symptomkategorien bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 7 (Intensität der Symptome im letzten Monat, gemessen mittels CAPS-C) Klassenstufe & Geschlecht Wiedererleben Vermeidung Erregung PTBS gesamt M SD M SD M SD M SD Klasse 5 weibl. männl. gesamt 1,6 1,4 1,6 (0,8) (0,9) (0,8) 1,0 1,0 1,0 (0,6) (0,9) (0,8) 1,4 1,4 1,4 (0,9) (0,9) (0,9) 1,4 1,3 1,3 (0,7) (0,8) (0,7) Klasse 6 weibl. männl. gesamt 1,8 1,4 1,6 (0,9) (0,9) (0,9) 0,9 0,8 0,8 (0,7) (0,7) (0,7) 1,4 1,1 1,3 (0,9) (0,8) (0,9) 1,3 1,1 1,2 (0,8) (0,7) (0,8) Klasse 7 weibl. männl. gesamt 1,7 0,9 1,4 (0,9) (0,7) (0,9) 0,8 0,5 0,7 (0,5) (0,4) (0,5) 1,5 0,8 1,2 (0,7) (0,7) (0,8) 1,3 0,7 1,1 (0,6) (0,5) (0,6) 249 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Tabelle B4.3: Schwere der PTBS-Symptomatik und ihrer Symptomkategorien bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 7 (Häufigkeit der Symptome im letzten Monat, gemessen mittels CAPS-C) Klassenstufe & Geschlecht Wiedererleben Vermeidung Erregung PTBS gesamt M SD M SD M SD M SD Klasse 5 weibl. männl. gesamt 1,4 1,3 1,4 (0,8) (0,9) (0,8) 0,8 0,7 0,8 (0,5) (0,6) (0,6) 1,4 1,3 1,4 (1,0) (0,9) (0,9) 1,2 1,1 1,2 (0,7) (0,7) (0,7) Klasse 6 weibl. männl. gesamt 1,5 1,1 1,3 (0,9) (0,8) (0,9) 0,7 0,6 0,7 (0,6) (0,6) (0,6) 1,4 1,0 1,2 (1,0) (0,8) (0,9) 1,2 0,9 1,1 (0,8) (0,7) (0,7) Klasse 7 weibl. männl. gesamt 1,5 0,8 1,2 (0,8) (0,6) (0,8) 0,7 0,4 0,6 (0,5) (0,3) (0,5) 1,5 0,7 1,2 (0,8) (0,5) (0,8) 1,2 0,6 1,0 (0,6) (0,4) (0,6) Tabelle B4.4: Schwere der PTBS-Symptomatik und ihrer Symptomkategorien bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 bis 12 (Häufigkeit der Symptome im letzten Monat, gemessen mittels PDS) Klassenstufe & Geschlecht Wiedererleben Vermeidung Erregung PTBS gesamt M SD M SD M SD M SD Klasse 8 weibl. männl. gesamt 1,7 1,0 1,4 (0,7) (0,6) (0,7) 0,9 0,5 0,7 (0,5) (0,4) (0,5) 1,5 1,1 1,3 (0,7) (0,6) (0,7) 1,4 0,9 1,2 (0,5) (0,5) (0,6) Klasse 9 weibl. männl. gesamt 1,4 0,8 1,1 (0,7) (0,6) (0,7) 0,7 0,5 0,6 (0,4) (0,4) (0,4) 1,6 0,9 1,2 (0,6) (0,6) (0,7) 1,2 0,8 1,0 (0,5) (0,4) (0,5) Klasse 10 weibl. männl. gesamt 1,7 1,1 1,4 (0,7) (0,7) (0,8) 0,9 0,7 0,8 (0,7) (0,6) (0,6) 1,6 1,1 1,4 (0,7) (0,7) (0,7) 1,4 1,0 1,2 (0,6) (0,6) (0,6) Klasse 11 weibl. männl. gesamt 1,5 0,9 1,3 (0,7) (0,6) (0,7) 0,9 0,6 0,8 (0,6) (0,5) (0,6) 1,6 1,1 1,4 (0,8) (0,6) (0,8) 1,3 0,9 1,2 (0,6) (0,5) (0,6) Klasse 12 weibl. männl. gesamt 1,5 0,8 1,2 (0,7) (0,6) (0,7) 0,8 0,4 0,7 (0,6) (0,4) (0,6) 1,6 0,6 1,2 (0,8) (0,6) (0,9) 1,3 0,6 1,0 (0,6) (0,5) (0,7) 250 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Tabelle B4.5: Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, die über dem Cut-offWert liegen (gemessen mittels CAPS-C) Klassenstufe & Geschlecht Wiedererleben N % Vermeidung N % Erregung N % PTBS gesamt N % Klasse 5 weibl. männl. gesamt 3 (7%) 2 (6%) 5 (7%) 0 — 3 (10%) 3 (4%) 4 (9%) 2 (6%) 6 (8%) 0 — 1 (3%) 1 (1%) Klasse 6 weibl. männl. gesamt 5 (12%) 3 (8%) 8 (10%) 0 — 1 (3%) 1 (1%) 5 (12%) 2 (6%) 7 (9%) 1 (2%) 1 (3%) 2 (3%) Klasse 7 weibl. männl. gesamt 6 (12%) 0 — 6 (7%) 0 0 0 4 (8%) 0 — 4 (5%) 0 0 0 — — — — — — Erläuterungen: Der Cut-off-Wert entspricht beim PTBS-Gesamtwert der Kategorie „hochtraumatisiert“. Tabelle B4.6: Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12, die über dem Cut-offWert liegen (gemessen mittels PDS) Klassenstufe & Geschlecht Wiedererleben N Vermeidung Erregung % N % N % PTBS gesamt N % Klasse 8 weibl. männl. gesamt 4 (9%) 1 (3%) 5 (6%) 0 0 0 — — — 3 (7%) 0 — 3 (4%) 1 (2%) 0 — 1 (1%) Klasse 9 weibl. männl. gesamt 2 (8%) 1 (4%) 2 (6%) 0 0 0 — — — 3 (12%) 0 — 3 (6%) 0 0 0 Klasse 10 weibl. männl. gesamt 4 (10%) 2 (5%) 6 (8%) 1 (3%) 0 — 1 (1%) 4 (10%) 2 (5%) 6 (8%) 3 (8%) 0 — 3 (4%) Klasse 11 weibl. männl. gesamt 9 (12%) 0 — 9 (8%) 0 — 1 (2%) 1 (1%) 14 (19%) 0 — 14 (12%) 4 (5%) 0 — 4 (3%) Klasse 12 weibl. männl. gesamt 4 (10%) 0 — 4 (6%) 0 0 0 6 (14%) 1 (4%) 7 (10%) 1 (2%) 0 — 1 (1%) — — — Erläuterungen: Der Cut-off-Wert entspricht beim PTBS-Gesamtwert der Kategorie „hochtraumatisiert“. — — — 251 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Tabelle B4.7: Schwere des Grades an Depressivität bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 bis 12 (gemessen mittels BDI) Klassenstufe & Geschlecht „unauffällig“ N „mild bis mäßig“ „klinisch relevant“ % N % N durchschnittl. BDI % M SD Klasse 8 weibl. männl. gesamt 24 (52%) 32 (94%) 56 (70%) 13 (28%) 1 (3%) 14 (18%) 9 (20%) 1 (3%) 10 (13%) 12,0 6,0 9,5 (7,2) (6,2) (7,4) Klasse 9 weibl. männl. gesamt 12 (48%) 22 (79%) 34 (64%) 6 (24%) 4 (14%) 10 (19%) 7 (28%) 2 (7%) 9 (17%) 11,8 7,1 9,3 (7,2) (6,0) (7,0) Klasse 10 weibl. männl. gesamt 13 (33%) 31 (78%) 44 (55%) 18 (45%) 7 (18%) 25 (31%) 9 (23%) 2 (5%) 11 (14%) 13,0 7,1 10,0 (7,2) (5,7) (7,1) Klasse 11 weibl. männl. gesamt 34 (46%) 35 (81%) 69 (59%) 27 (36%) 7 (16%) 34 (29%) 13 (18%) 1 (2%) 14 (12%) 12,6 7,4 10,7 (7,7) (5,2) (7,3) Klasse 12 weibl. männl. gesamt 19 (45%) 23 (92%) 42 (63%) 20 (48%) 1 (4%) 21 (31%) 3 (7%) 1 (4%) 7 (6%) 9,5 4,2 7,6 (5,9) (4,3) (5,9) 245 (62%) 104 (26%) 48 (12%) 9,6 (7,1) Gesamt Erläuterungen: Es gelten folgende diagnostische Klassifizierungen: (1) BDI bis 10 = „unauffällig“; (2) BDI 11 bis 17 = „mild bis mäßig“; (3) BDI von 18 oder höher = „klinisch relevant“ 4.3.3 Untersuchungszeitpunkt 2 Erhebungsinstrumente Acht bis elf Monate nach dem Ereignis wurden den Schülern nur noch zwei Fragebögen vorgelegt: 1) eine von den Untersuchern modifizierte Form des PDS zur Erfassung der PTBSSymptomatik (das Traumakriterium A war nicht vollständig erhalten). 2) die SCL-90-R zur Erfassung der allgemeinen Psychopathologie. Ergebnisse An der Untersuchung nahmen 473 Schüler (279 Mädchen und 194 Jungen) teil. PTBS-Symptomatik. Es wurde bei 93 Schülern (19,7%) eine PTBS-Symptomatik nach DSM-IV festgestellt. Auch in der zweiten Untersuchung zeigte sich eine höhere Betroffenheit bei den Mädchen über alle Klassenstufen. Insgesamt wurde bei 76 (27,2%) der Mädchen eine PTBS nach DSM-IV festgestellt, und bei 17 (8,8%) Jungen. 252 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Allgemeine Psychopathologie. Es zeigte sich insgesamt eine im Durchschnitt altersgerechte Ausprägung psychopathologischer Symptome in der Gesamtschülergruppe mit etwas höheren Durchschnittswerten bei den Mädchen. Vergleich zwischen den Messzeitpunkten. Ein Vergleich zwischen den Messzeitpunkten ist nur bedingt zulässig. An der ersten Untersuchung nahmen 634 Schüler teil, an der zweiten nur noch 473. Es ist nicht bekannt, wie viele der traumatisierten Schüler die Schule verließen. Weiterhin wurde der PDS zur Erfassung der PTBS-Symptomatik für die zweite Untersuchung modifiziert und es wurde nicht mehr unterschieden zwischen den oberen Klassenstufen und den Klassenstufen 5 bis 7, deren PTBSBelastung in der ersten Untersuchung mit dem CAPS-C gemessen worden war. Prozentual wurde bei 46% der Schüler zum ersten Messzeitpunkt eine PTBS-Symptomatik nach DSM-IV festgestellt, gegenüber 19,7% in der zweiten Untersuchung. 4.4 Schlussfolgerungen und Bewertung 4.4.1 Wissenschaftlich-methodische Bewertung Wie bereits angedeutet, ist der Wert der methodischen Ergebnisse gering. Aus dem Vergleich der beiden Messzeitpunkte lassen sich kaum Schlüsse ziehen, da die Messinstrumente verändert wurden. Es lässt sich aus diesen Zahlen weder belegen, auf welche Effekte die Reduktion der Traumasymptomatik zurückzuführen ist, noch ist nachvollziehbar, wie sich die Schüler in dem Jahr der Betreuung entwickelt haben. Festzuhalten bleibt jedoch, dass in der Anfangssymptomatik eine deutlich höhere Belastung zu verzeichnen war, als man es bei Natur- oder technischen Katastrophen kennt. Bei diesen rechnet man mit ca. einem Drittel, die von einer PTBS betroffen gewesen wären. Stattdessen war es knapp die Hälfte (46%) aller Schüler, in einigen Klassen deutlich über 50%. Offensichtlich schlagen sich hier die Art und die Schwere des Traumas nieder. Auf die Tatsache, es mit einer von Menschenhand verursachten bewussten Zerstörung und Tötung von Menschen zu tun zu haben, reagieren die Betroffenen offensichtlich besonders stark im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bei einem Akt zielgerichteter Gewalt von dem Erfurter Ausmaß muss also mit einer deutlich höheren Traumabelastung gerechnet werden, als bisher angenommen. Vergleichbare zukünftige Ereignisse, wie zum Beispiel terroristische Gewalttaten erfordern psychotherapeutische Aufmerksamkeit für etwa die Hälfte der betroffenen Personen. 4.4.2 Erkenntnisse aus unsystematisch gesammelten Daten In der Betreuung der Schüler und Lehrer des Gutenberg-Gymnasiums, der Zusammenarbeit mit den Ministerien und der Unfallkasse und der Kooperation mit über 50 tätigen Psychologen wurden eine Reihe von Erkenntnissen gesammelt, von denen die Wichtigsten im Folgenden dargestellt werden. B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Notfallpsychologische Betreuung am Unfalltag Über 70 Psychologen standen am Unfalltag und in den nächsten Tagen zur Betreuung der Schüler und Lehrer zur Verfügung, schlossen ihre Praxen und widmeten sich ganz der Betreuung vor Ort. Sie taten dies mit großem Engagement und ohne jegliche finanzielle Absicherung. Kritisch muss jedoch angemerkt werden, dass weder die Rekrutierung nach einem schon bestehenden Notfallplan verlief, noch der Einsatz selbst inhaltlich abgestimmt war. Die Psychologen wurden lediglich durch die Polizei gebrieft, dass es sich um Krisenintervention und nicht um Therapie handele. Ansonsten handelte die Polizei aber nach dem Motto: „Das Einzige, was ein Psychologe falsch machen kann ist, wenn er nicht da ist“ (persönliche Mitteilung der Einsatzleitung) und bat alle zu kommen. Von den im Einsatz tätigen Psychologen hatten kaum welche eine notfallpsychologische oder traumatherapeutische Aus- oder Fortbildung. Das Engagement war hoch, die Ideen der Psychologen vielfältig. Letztendlich bleibt jedoch festzustellen, das Gegenteil von gut ist in manchen Fällen gut gemeint. Nicht wenige Schüler, Eltern und Lehrer meldeten später zurück, sie haben sich inadäquat betreut gefühlt, da die Psychologen in dieser Situation ihr Gefühlsleben erforscht hätten. Derartige psychologische Interventionen sind im notfallpsychologischen Kontext kontraindiziert. Einige Schüler schrieben sogar an die Thüringische Staatskanzlei und bezweifelten aufgrund der Erfahrungen mit der psychologischen Betreuung in den ersten Tagen generell die Wirksamkeit psychologischer Hilfe in einer derartigen Situation und auch für die längerfristige Therapie. In Auswertungsgesprächen mit den Psychologen erklärten viele von ihnen, sie haben sich überfordert gefühlt während des notfallpsychologischen Einsatzes. Sie waren es nicht gewohnt, auf Betroffene zuzugehen, da sie üblicherweise in Praxen oder Kliniken in der klassischen „Komm-Struktur“ arbeiten. Die wichtigsten Prinzipien notfallpsychologischer Interventionen waren vielen nicht vertraut. Sie waren auf die Art und Stärke akuter Schockreaktionen der Betroffenen nicht vorbereitet und konnten in vielen Fällen nicht adäquat darauf reagieren. Betroffene in Verantwortungspositionen Sind Institutionen oder Firmen von traumatischen Ereignissen berührt, reagieren diejenigen Personen, die sich in Führungs- und Entscheidungspositionen befinden, in der Regel abhängig von der Persönlichkeit und ihrer Stabilität mehr oder minder stark betroffen und zeigen deutliche Belastungssymptome. Sie werden häufig von den Betreuern vergessen, oder lehnen für sich Betreuungsangebote ab, weil sie glauben, Stärke zeigen zu müssen. Damit sind sie potentiell gefährdet, sich selbst zu überfordern und den Überblick zu verlieren für richtige Entscheidungen. Andererseits sind sie jedoch aufgrund ihrer Sach- und Fachkenntnisse für den Prozess der Bewältigung der Folgen der Katastrophe und der Wiederherstellung der Normalität von außerordentlicher Bedeutung. Hier ist ein sensibles psychologisches Management erforderlich, das den Führungspersonen im Sinne bewährter Coaching-Verfahren Entlastung anbietet und sie funktionsfähig hält. Ab einem gewissen Grad der Betroffenheit jedoch, vor allem, wenn die Führungsperson selbst traumatisiert ist und gar unter Schuldgefühlen leidet, agiert sie unter Um- 253 254 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt ständen für einen erfolgreichen Verarbeitungsprozess kontraproduktiv. Eine solche Situation war in Erfurt gegeben. Man muss davon ausgehen, dass der Täter zum Ziel hatte, die Schulleiterin zu erschießen, um sich dafür zu rächen, dass er von der Schule verwiesen worden war. Seine erste Frage beim Betreten des Schulgebäudes, als er dem Hausmeister begegnete lautete, ob die Schulleiterin im Hause sei (vgl. Abschnitt B 4.1). Statt ihrer fand er im Sekretariat jedoch nur die stellvertretende Schulleiterin und eine Sekretärin, die er beide erschoss. Da er der Schulleiterin nicht habhaft werden konnte, setzte er seinen Amoklauf fort, was er möglicherweise nicht getan hätte, wenn er sie getroffen hätte. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema, die Frage, ob es richtig gewesen war, den Schüler von der Schule zu verweisen, die Tatsache, mit dem Tod so vieler Kollegen und zweier Schüler konfrontiert zu sein und im Zentrum eines immensen Medieninteresses zu stehen, machte die Schulleiterein zu einer psychisch hoch belasteten Frau. In einer derartigen psychischen Drucksituation ist es kaum möglich, frei von eigenen Verstrickungen, durchgängig Entscheidungen zu treffen, die konsequent dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Die von der Schulleiterin für sich selbst gewählte Haltung, mit Härte gegen sich selbst den Problemen zu begegnen, und nicht in einer psychologischen Aufarbeitung der Traumatisierung und der Ursachen, die zu der Tat geführt hatten, den richtigen Weg zu sehen, stellte für viele Lehrer und Schüler eine Überforderung dar. Ihre Forderung, über das Erbringen normaler Schulleistungen so schnell wie möglich zum Alltag zu gelangen, kollidierte unvereinbar mit dem psychologischen Betreuungskonzept einer aktiven Traumabewältigung der gesamten Schulgemeinschaft. Dieser Konflikt prägte das Projekt in Erfurt von Anfang an, setzte den Möglichkeiten der Traumabewältigung enge Grenzen und ließ die Beteiligten aller Seiten ihre Kräfte in unproduktiven, selten offenen Kämpfen, meist verdeckten taktischen Manövern verbrauchen. In derartigen Situationen kann verantwortliches Handeln von Behörden und Ministerien nur darin bestehen, hoch belastete, in die Situation und das eigene traumatische Erleben verstrickte Führungs- und Entscheidungspersonen, zum Wohl der Gemeinschaft wie auch zu ihrem eigenen Schutz aus dem Feld zu nehmen. Qualitätssicherung Bei einem Projekt der Größenordnung von Erfurt, in dem viele verschiedene Institutionen und Professionen zusammenarbeiten und über 50 Psychologen therapeutisch tätig sind, droht die Gefahr, dass in unterschiedliche Richtungen gearbeitet wird. Um gemeinsam für das Ziel der Traumabewältigung zu arbeiten ist es notwendig, klare Strukturen in der Entscheidungskompetenz zu haben. In Erfurt funktionierte das so lange einwandfrei, wie die Polizei mit ihren eindeutigen hierarchischen Befehlsstrukturen den Einsatz koordinierte. Zu späteren Zeitpunkten war nicht immer klar, wer letztendlich die Entscheidungskompetenz hatte: das Sozialministerium, das Kultusministerium, das Innenministerium, die Unfallkasse. Nachdem für den langfristigen Betreuungsprozess entschieden war, dass die Unfallkasse verantwortlich für Durchführung und Qualitätssicherung der Maßnahmen war, wurde deutlich, dass es einer derartigen Institution an Erfahrungswerten und Richtlinien zur qualitätsgesicherten Abwicklung eines Betreuungsprojekts von diesem großen Ausmaß B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt fehlt. Auch der Versuch, immer wieder einen neuen Berater zu engagieren, brachte der Unfallkasse keine durchgängige Linie. Es ist ein Anspruch dieser Arbeit, besonders in den Kapiteln C und D Hinweise zu geben, worauf man bei der psychotraumatologischen Versorgung von Katastrophenopfern achten muss, um eine qualitativ hochwertige, wissenschaftlich überprüfte und den Betroffenen angemessene Betreuung gestalten muss. Belastungen für Therapeuten Besonders in den ersten Monaten der Betreuung meldeten viele Therapeuten zurück, sie empfänden die Arbeit als äußerst anstrengend und belastend. Auch sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen berichteten, sie seien vollkommen erschöpft, wenn sie nach einem Tag in Erfurt wieder nach Hause kämen. In vielen Klärungsgesprächen kristallisierten sich folgende Belastungen heraus: • das Klima in Sitzungen und Gesprächen mit den Verantwortlichen der Schule, mit Elternvertretern, mit der Unfallkasse, mit den Ministerien wurde von vielen als aggressiv empfunden. Offensichtlich setzte sich die Aggressivität der Tat in den Diskussionen und Auseinandersetzungen fort, paradoxerweise gerade bei denjenigen, die helfen wollten. In der Konsequenz war zu beobachten, dass immer wieder einzelne Personen dem Druck nicht mehr stand hielten und krank wurden. • Viele Therapeuten waren nicht vorbereitet auf das Ausmaß und die Ballung von Traumatisierung, Depressivität und Störungsanfälligkeit bei den Betroffenen. Sie schilderten es als ungleich schwieriger, vor einer Klasse mit vielen traumatisierten Schülern zu stehen, als im Einzelkontakt in der Praxis mit traumatisierten Patienten zu arbeiten. • Es bestand eine Art Tabu, über die Gründe zu sprechen, die den Täter zu seinem unmenschlichen Akt der Zerstörung veranlasst haben könnten. Die Geschichte seines Schulverweises, die Frage, wie ein Schüler in einer Klasse so zum Außenseiter werden kann, die Überlegungen, ob ein auf Selektion ausgerichtetes Schulsystem überhaupt in der Lage sein kann, psychische Problemsituationen von Schülern zu erkennen und damit umzugehen wurden nicht thematisiert, beziehungsweise Versuche darüber in offiziellen Sitzungen zu sprechen wurden regelmäßig von der Schulleitung in letzter Konsequenz auch vom Ministerium abgeblockt. Dadurch empfanden viele Psychologen ihre therapeutische Arbeit als unzureichend, als Kurieren an den Symptomen, ohne die Ursachen angehen zu können. 4.4.3 Konsequenzen für die Praxis Für die Praxis ergeben sich aus den Erfurter Erfahrungen folgende Konsequenzen: • Es muss ein Länder bezogenes und bundesweites Rekrutierungssystem für Notfallpsychologen entwickelt werden, auf das Ämter, Behörden und Institutionen bei großen Schadensereignissen und Katastrophen unkompliziert Zugriff haben. • Dafür muss eine genügend große Zahl an Notfallpsychologen ausgebildet werden. Sollten sich zu wenige Psychologen dafür auf freiwilliger Basis melden, ist über eine 255 256 B: Felderfahrungen — Der Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt Verpflichtung zu Bereitschaftsdiensten für notfallpsychologische Einsätze nachzudenken. • Eine Liste besonders erfahrener Psychologen mit notfallpsychologischer, traumatherapeutischer und Katastrophen-Bewältigungskompetenz sollte von einer unabhängigen, eventuell staatlichen Stelle erstellt und den zuständigen Landesregierungen, Ministerien etc. anempfohlen werden, damit sie sich Beratung bei der Konzipierung von Traumabewältigungsmaßnahmen holen können. Dazu gehört auch die Beratung und Empfehlung, ob bestimmte Personen in Verantwortungspositionen aus dem Feld genommen werden müssen. • Werden nach traumatischen Ereignissen größerer Art viele Psychologen zur Traumabewältigung eingesetzt, ist ein einheitliches, für alle verbindliches Betreuungsund Behandlungskonzept zu entwickeln, welches auf Erkenntnissen der Traumatologie und den Erfahrungen bisheriger Katastrophen fußt. • Zur Qualitätssicherung ist eine regelmäßige Konzeptsupervision sinnvoll, in der der Fortschritt der Umsetzung des Betreuungskonzepts überprüft wird. Darüber hinaus sind eine fallbezogene und eine personbezogene Supervisionen notwendig, um individualtherapeutisch optimal zu intervenieren und um Belastungen der Therapeuten zu kanalisieren, damit sie sich nicht zu Störungen der Traumabewältigung entwickeln. C: Siebenstufiges kognitiv-behaviorales Behandlungskonzept (SBK) für akute PTBS Dieses Kapitel ist hier nicht abgedruckt. Es wurde veröffentlicht bei Huber. Titel: Georg Pieper und Jürgen Bengel Siebenstufiges kognitiv-behaviorales Behandlungskonzept (SBK) Behandlungsmanual für Patienten nach Typ-I Traumaerfahrung. Huber 2007 1. 2. 3. 4. 1. Einleitung und Entstehungsgeschichte ..........................................257 Theoretischer Hintergrund...........Fehler! Textmarke nicht definiert. Die sieben Phasen ......................Fehler! Textmarke nicht definiert. Diskussion und zusammenfassende BewertungFehler! Textmarke nicht definiert. Einleitung und Entstehungsgeschichte Das siebenstufige kognitiv-behaviorale Behandlungskonzept (SBK) basiert auf einer 15-jährigen Erfahrung in der Behandlung von Katastrophenopfern und Betroffenen von Unglücken, Übergriffen oder Unfällen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Die vom Autor betreuten Unglücke und Ereignisse waren: • Das Grubenunglück von Borken, 1988 • Betroffene der Flugschaukatastrophe von Ramstein, 1988 • Libanon-Geiseln, 1992 • Betroffene des ICE-Unglücks von Eschede, 1998 • Schüler, Lehrer und Eltern nach der Ermordung einer Lehrerin an einem Gymnasium im Meißen, 1999 • Schüler, Lehrer und Eltern nach dem Amoklauf von Erfurt, 2002 In Folge des Grubenunglücks von Borken 1988 wurde erstmals versucht, effiziente Behandlungsstrategien für die Betroffenen zu entwickeln. Betroffene waren damals sowohl die Hinterbliebenen der 51 bei einer Kohlenstaubexplosion getöteten Bergleute D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Grundfragen ...................................................................................293 Allgemeine Ziele für die Betreuung ................................................297 Psychologisch-psychotherapeutische Ziele ...................................299 Soziale Ziele ...................................................................................304 Methoden der Betreuung................................................................306 Umgang mit Behörden ...................................................................308 Umgang mit Presse und Medien....................................................309 Evaluation der Wirkung von Interventionen ...................................311 Qualitätssicherung: Supervision für Traumatherapeuten und andere professionelle Helfer ..........................................................313 10. Langfristige Betreuung von Katastrophenopfern ...........................314 In den bereits ausführlich beschriebenen Projekten Borken, Erfurt, Meißen und Erfurt wurden vielfältige Erfahrungen in der Betreuung von Betroffenen und ihren Angehörigen gesammelt. Im letzten Kapitel dieser Arbeit sollen auf einer abstrakten Ebene Schlüsse aus diesen Erkenntnissen gezogen werden, um sie für die Bewältigung zukünftiger Katastrophen nutzbar zu machen. 1. Grundfragen Anhand eines 10-Punkte-Leitfadens (s. Abbildung D 1.1) soll dargestellt werden, welche Fragen sich bei der Konzipierung eines Betreuungsprogramms für Opfer und Angehörige von Katastrophen zu welchem Zeitpunkt stellen, wie die zeitliche Abfolge der Interventionen in sinnvoller Weise gestaltet werden sollte und mit welchen Widerständen bzw. Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu rechnen ist. Im Folgenden werden die einzelnen Punkte des in Abbildung D 1.1 vorgestellten 10-PunkteLeitfadens näher erläutert. Wer sind die von der Katastrophe Betroffenen? Unmittelbar sind diejenigen betroffen, die zu Schaden gekommen sind, also verletzte Personen und deren Angehörige und die Angehörigen von getöteten Personen. Weiter 294 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis gibt es in der Regel unverletzte Betroffene, die mit ansehen mussten, wie andere Menschen zu Tode oder zu Schaden kamen und selber intensive Angst dabei erlebten, weil sie selbst bedroht waren. Schließlich sind Augenzeugen zu bedenken, die sich selber nicht in Gefahr waren, aber mit traumatischen Ereignissen konfrontiert wurden. Mittelbar betroffen sind Verantwortungsträger der Institution, Firma oder Einrichtung, die von der Katastrophe getroffen wurde. Darüber hinaus sind die Einsatzkräfte zu berücksichtigen, die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durchführten. Abbildung D1.1: 10-Punkte-Leitfaden zur Konzipierung von Betreuungsmaßnahmen für Katastrophenopfer und deren Angehörige 1. Grundfragen Wer sind die von der Katastrophe Betroffenen? Welche Charakteristika bestimmen das Umfeld? Worin besteht die spezifische Traumatisierung der Betroffenen? Welche professionellen Helfer stehen zur Verfügung? 2. Allgemeine Ziele für die Betreuung Informationsverarbeitung, Aktive Bewältigung, Nutzung der Chancen von Betroffenen-Gruppen, Mit der Katastrophe leben lernen, Klärung der Widerstände, gegen die geplante Betreuungsmaßnahmen stoßen. 3. Psychologisch-psychotherapeutische Ziele Kurzfristig: Notfallpsychologische Betreuung, Psychoedukation, Stabilisierung und Distanzierung. Mittelfristig: Gruppen zum Nachvollziehen des Ereignisses, Narrative Traumabewältigung, Therapeutisches Angebot für Schwertraumatisierte: Siebenstufiges Behandlungskonzept (SBK), Konfrontative Auseinandersetzung. Langfristig: Exposition an der Unfallstelle, Trauerarbeit, Planung und Entwicklung von Perspektiven, Vorbereitung Jahrestag. 4. Soziale Ziele (Re-)Integration in die soziale Gemeinschaft, Einbeziehung der Betroffenen in die Konzipierung und Gestaltung des Betreuungsprogramms, Einbeziehung von Betroffenen die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Katastrophe (Gedenkstätte, Gedenktage), D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Klärung der sozialen Zusammenhänge, in denen die Katastrophe entstanden ist, Auseinandersetzung und Versuche, diese Bedingungen zu beeinflussen. 5. Methoden der Betreuung Informationsveranstaltungen über psychische Folgen bei Betroffenen, Allgemeine soziale Unterstützung, Schaffung von Freiräumen zur psychologischen Bewältigung Gruppenpsychotherapie, Einzelpsychotherapie, Wiederherstellung und Pflege der jeweiligen (Schul-)Gemeinschaft. 6. Umgang mit Behörden Klärung von Zuständigkeiten, Sicherstellung der Finanzierung, Kooperation mit Behörde, Berichterstattung an Behörden. 7. Umgang mit Medien Schutz der Betroffenen, Presseverantwortlicher, Reflektion von Gefahren und Chancen. 8. Evaluation der Wirkung von Interventionen Akzeptanzprobleme bei Betroffenen, Eingangsdiagnostik, Verlaufsdiagnostik, Abschlussdiagnostik, Relevanz für individuelle Therapieangebote. 9. Supervision für Traumatherapeuten und andere professionelle Helfer Konzeptsupervision, Fallsupervision, Individuelle Supervision. 10. Langfristige Betreuung von Katastrophenopfern Umgang mit Gedenk- und Jahrestragen, Gedenkstätte, Rückfallprophylaxe. Welche Charakteristika bestimmen das Umfeld? Die besonderen Charakteristika des Umfeldes sind zu analysieren und zu berücksichtigen. Beispielsweise macht es einen Unterschied, ob es sich um ein einheitliches Berufsfeld im Arbeitermilieu handelt, wie in der Bergmannswelt in Borken, eine Bildungsinstitution, wie eine Schule, oder um eine Gruppe von zufällig zusammen reisenden Personen, die alle in einem verunglückten Zug oder Flugzeug saßen. Je nach Zielgruppe sollte die Sprache und die Art des auf die Betroffenen Zugehens auf diese abgestimmt werden. 295 296 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Worin besteht die spezifische Traumatisierung der Betroffenen? Die Grundfrage ist, ob es sich um ein Naturereignis, wie beim Tsunami in Südostasien 2004, bzw. ein technisches Unglück, wie in Eschede 1999 handelte, oder um eine zielgerichtete, von Menschenhand verursachte Gewalttat, wie dem Amoklauf von Erfurt 2002, oder wie bei dem terroristischen Anschlag auf die Züge in Madrid 2004. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass die Rate psychischer Traumatisierungen umso höher ausfällt, je eindeutiger die Katastrophe nicht nur durch menschliche Fehler oder Nachlässigkeit, sondern durch einen gewollten Akt der Zerstörung verursacht wurde. Weiterhin ist zu unterscheiden, in welchem Ausmaß und wie lange Betroffene selbst Todesangst erlebten und ob sie mit besonders grausamen Details, wie z. B. stark entstellten Leichen konfrontiert wurden. Naturkatastrophen lösen wie in Kapitel A dargestellt wurde nach bisherigem Stand des Wissens nicht so starke Traumatisierungsraten aus, was sich jedoch möglicherweise ändert, wenn man die Auswirkungen einer derartig immensen Katastrophe, wie der Tsunami 2004 auf die Betroffenen genauer untersucht hat. Je nach Art der Katastrophe, dem Ausmaß eigener Bedrohung und der Konfrontation mit traumatisierenden Details ist mit einem Drittel bis der Hälfte von Opfern mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu rechnen. Welche professionellen Helfer stehen zur Verfügung? Zu Beginn sollte festgestellt werden, welche Helfer aus dem psychosozialen Bereich in der betroffenen Region zur Verfügung stehen. Hierbei ist Multiprofessionalität im Sinne von im angloamerikanischen „Mental-health-professionals“ grundsätzlich wünschenswert. In Frage kommen vor allem: • Psychologen • Notfallseelsorger, Pfarrer • Ärzte • Sozialarbeiter • Lehrer • Verantwortungsträger und Mitarbeiter der jeweiligen Institution oder Firma. Kräfte aus der Region haben den Vorteil, die Gegebenheiten vor Ort gut zu kennen und präsent zu sein. Von Betroffenen werden sie oft eher akzeptiert, als auswärtige Fachleute. Wenn nicht genügend Fachkräfte aus der betroffenen Region zur Verfügung stehen, ist in einem zweiten Schritt zu untersuchen, ob mit vertretbaren Kosten und Aufwand auswärtige Kräfte dazu geholt werden müssen. In jedem Fall sollte die Leitung der Betreuungsmaßnahmen in den Händen eines Psychologen oder Arztes liegen, der eine notfallpsychologische und traumatherapeutische Ausbildung nachweisen kann und über Einsatz- und Erfahrungskompetenz verfügt. D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis 2. Allgemeine Ziele für die Betreuung Informationsverarbeitung Eine Katastrophe trifft die Opfer immer plötzlich und unerwartet, in der Regel sind die Menschen für eine solche Situation vollkommen unvorbereitet. Eine Katastrophe übersteigt ihr Vorstellungsvermögen von möglicherweise eintretenden Entwicklungen in ihrem Leben. Die Betroffenen befanden sich alle in einem geplanten Verhaltensablauf, aus dem sie jäh herausgerissen wurden. Von daher ist das, was während der Katastrophe passierte, für viele zunächst einmal nicht nachvollziehbar. Die vielfältigen Informationen, die über sie hereinbrechen, können nicht auf einmal verarbeitet werden. Die häufig beobachtbaren Teilamnesien von Unfall- und Katastrophenopfern deuten darauf hin, dass es sich um einen natürlichen Schutzmechanismus handelt, wenn der Mensch nicht von Anfang an alle Informationen aufnehmen und die gesamte Tragweite der Folgen des Ereignisses überblicken kann. Daher ist es ein vordringliches Ziel in der Arbeit mit Katastrophenopfern, die Informationsverarbeitung zu fördern. Dabei ist darauf zu achten, dass die Informationsverarbeitung dem individuellen Tempo des jeweiligen Menschen bzw. der Gruppe angepasst wird. Sowohl ein zu frühes Forcieren als auch ein langes Hinhalten sind für eine erfolgreiche Traumabewältigung hinderlich. Aktive Bewältigung Das eigentliche Trauma für Katastrophenopfer bestand darin, sich in einer Situation zu befinden, aus der es kein Entrinnen gibt und in der das unerträgliche Gefühl des Kontrollverlusts vorherrschte. Die Menschen hatten keine Kontrolle mehr über die Situation, sondern die Ereignisse beherrschten sie. In der posttraumatischen Belastungsstörung, die sich im weiteren Verlauf entwickeln kann, fühlen sie sich ihren Symptomen ausgeliefert und erleben wiederum Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Häufige Reaktionen von Betroffenen bestehen in sozialem Rückzugsverhalten und dem damit verbundenen Gefühl, von niemandem mehr in ihrem Schmerz und ihrer Problematik verstanden zu werden. Übergeordnetes Ziel der Betreuung muss es daher sein, den Betroffenen nach und nach das Gefühl zurück zu geben, Kontrolle über den Verlauf der weiteren Entwicklung und über ihre Symptomatik zu erlangen. Betroffene sollen möglichst einbezogen werden in die Formulierung der Ziele des Betreuungsprogramms, mindestens müssen sie mit ihnen abgestimmt und ihr Einverständnis muss eingeholt werden. Die Gemeinschaft der Betroffenen soll motiviert und unterstützt werden, gemeinsame Ziele zu erkennen, sich auszutauschen und sich für die Verwirklichung von Gruppenzielen, wie für eigenes Wachstum einzusetzen. Sie sollen aus der Rolle des passiven Opfers einer Katastrophe in die Rolle einer aktiven, die Folgen der Katastrophe bewältigenden Person gelangen. Mit der Katastrophe leben lernen Ein weiteres allgemeines Ziel der Betreuung liegt darin, den Betroffenen von Anfang an klar zu machen, dass es keinen Weg des Ungeschehen Machens, des Vergessens 297 298 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis oder Weglaufens gibt. Die Bewältigung der Katastrophe kann nur darin liegen, sich die Folgen und Zerstörungen genau anzuschauen, daraus Konsequenzen zu ziehen und es zu lernen, mit diesem Ereignis zu leben. Für viele Betroffene scheint dieses Ziel anfangs unerreichbar, da sie glauben, für sie gäbe es keine Perspektive mehr im Leben nach den schrecklichen Erfahrungen, die sie machen mussten. In der Haltung der Betreuer muss deutlich zum Ausdruck kommen, dass sie daran glauben, dass es möglich ist, einen Weg zu finden, mit der traumatischen Erfahrung zu leben, egal wie schlimm die Katastrophe war. Für viele Betroffene stellt eine erfolgreich überwundene traumatische Erfahrung den wichtigsten Wendepunkt in ihrem Leben dar. Durch veränderte Lebensweisen geben sie dem Geschehen einen neuen Sinn. Nicht Wenige bezeichnen ihr neues Leben nach der Überwindung der traumatischen Erfahrung als wertvoller und sinnvoller, als es vorher gewesen war. Implizit enthalten sein muss in diesem Ziel ist allerdings das therapeutische Wissen um dessen Begrenzung. Wenn das Ziel auch prinzipiell erreichbar ist, gibt es doch keine Garantie, dass jeder Betroffene es erreichen kann. Die Erkenntnis dieser Begrenzung stellt eine wichtige Prophylaxe gegen Überforderung und letztlich Burn-Out für Therapeuten dar, die er jedoch nur für sich nutzen und nicht den Betroffenen mitteilen sollte. Wiederherstellung und Pflege der jeweiligen (Schul-)Gemeinschaft Ist die gesamte Gemeinschaft von einer Katastrophe betroffen, wie z. B. die Schulgemeinschaft nach dem Erfurter Amoklauf, besteht ein wichtiges Ziel der Betreuungsarbeit in der Wiederherstellung und Pflege dieser Gemeinschaft. Bestehende und funktionierende Gemeinschaften haben oft Angst, dass sie auseinander brechen, nach einem traumatischen Ereignis oder dass sie getrennt wird und damit der Schutz dieser Gemeinschaft verloren geht. Mit den Betroffenen ist abzuklären, wie wichtig die Gemeinschaft für sie ist und wie die Wiederherstellung und Pflege der jeweiligen (Schul-)Gemeinschaft erreicht werden kann. Klärung der Widerstände, gegen die geplante Betreuungsmaßnahmen stoßen Im Rahmen der Formulierung allgemeiner Ziele der Betreuung sollte sondiert werden, mit welchen Widerständen bei der Implementierung der Betreuungsmaßnahmen gerechnet werden muss. Widerstände sind immer da zu erwarten, wo es im Rahmen einer dahinter liegenden Ideologie oder unausgesprochener Tabus nicht gewünscht ist, dass die Gründe, warum es in diesem Umfeld zur Katastrophe gekommen ist, reflektiert und offen gelegt werden. Je stärker diese Ideologie oder die unausgesprochenen Tabus wirken, desto konsequenter sind von deren Vertretern die Versuche, eine aktive Traumabewältigung im Sinne der beschriebenen allgemeinen Ziele zu unterbinden und eine rein auf die individuelle Ebene reduzierte psychologische Individualbetreuung der Schwerstbetroffenen anzubieten. D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis 3. Psychologisch-psychotherapeutische Ziele Im Folgenden werden die jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Abstand zum traumatischen Ereignis indizierten psychologisch-psychotherapeutischen Interventionen näher beleuchtet. 3.1 Kurzfristig Notfallpsychologische Betreuung Die notfallpsychologische Betreuung am Unfallort muss gewährleistet sein. Dafür muss eine genügende Anzahl notfallpsychologisch qualifizierter Psychologen zur Verfügung stehen, die in die Katastrophenschutzpläne mit eingebunden sind. Inhaltlich sollen die Ängste und Nöte von Betroffenen durch ruhiges Zuhören gemildert, Informationen zum Stand der Dinge gegeben und Grundbedürfnisse, wie trinken, essen, jemanden informieren etc. befriedigt werden. Einfache Fragen zur Klärung von Prioritäten der Wünsche von Betroffenen sollen deren Kontroll- und Kompetenzgefühle stärken. Angehörige von Betroffenen sollen klare Informationen über den Verlauf des Unglücks erhalten, ihr Hoffen und Bangen bei unklaren Situationen soll begleitet werden. Im Falle des Todes sollen ihnen die Umstände erklärt werden und beim würdevollen Abschied von den Toten sollen sie gestützt werden, wenn sie es wünschen. Möglichkeiten der weitergehenden mittel- und langfristigen psychotherapeutischen Betreuung sollen aufgezeigt werden. Psychoedukation In den ersten Tagen nach dem Unglück werden Betroffene aufgeklärt, dass ihre unterschiedlich starken emotionalen und körperlichen Empfindungen angemessene Reaktionen auf einen extremen Stressor darstellen. Die Möglichkeit der Beruhigung einer akuten Belastungsreaktion wird aufgezeigt. Bei länger als vier bis sechs Wochen bestehender Symptomatik wird auf therapeutische Angebote verwiesen. Für das Auftreten verzögerter posttraumatischer Belastungssymptome wird sensibilisiert. Auf die besondere Gefährdung von Abhängigkeiten bei Alkohol- und Medikamentenkonsum wird hingewiesen. Stabilisierung und Distanzierung Wie die Ergebnisse der Meißener Studien gezeigt haben, ist es notwendig, zunächst im Symptombereich der Intrusionen und der Übererregung Beruhigungen zu erreichen, bevor eine erfolgreiche Bearbeitung des Vermeidungsverhaltens ins Auge gefasst werden kann. Erste kurzfristig wirksame psychotherapeutische Interventionen bestehen in der Vermittlung von Stabilisierungs- und Distanzierungsübungen. Mit diesen können Betroffene starke Anspannungen und das Gefühl des unkontrollierbaren ausgeliefert Seins ein Stück weit in den Griff bekommen. Sie erleben Sicherheit, Beruhigung und erkennen Möglichkeiten, belastende Erinnerungen für eine Zeit beiseite zu stellen und 299 300 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis dadurch ein Stück Kontrolle zurück zu gewinnen. Bei der Vermittlung dieser Techniken ist der Hinweis unabdingbar, dass es sich nicht um langfristig wirksame Traumabewältigungsmethoden handelt, sondern um kurzfristige Erleichterungen für die Anfangssituation. 3.2 Mittelfristig Gruppen zum Nachvollziehen des Ereignisses Ab dem Zeitpunkt von ca. sechs bis acht Wochen nach dem Ereignis reichen vielen Betroffenen die kurzfristigen Distanzierungstechniken nicht mehr aus. Sie schwanken zwischen der Angst, von schrecklichen Bildern und Gefühlen unkontrollierbar überrollt zu werden, wenn sie von ihren Erlebnissen berichten – diese Erfahrung machen viele von ihnen durch die Flashbacks – und dem Bedürfnis, sich von dem Erlebten durch Reden innerlich zu distanzieren. Die Arbeit an den Intrusionen wird fortgesetzt in geleiteten Gruppen. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, emotional kontrolliert die traumatischen Ereignisse durchzusprechen, und durch die verschiedenen Blickwinkel der anderen Teilnehmer nachzuvollziehen. Sie machen dabei die hilfreiche Erfahrung, dass sie außerhalb der Gruppensitzungen weniger oft und weniger intensiv von unkontrollierbaren Widererinnerungen überfallen werden, je mehr sie sich dem kontrollierten Prozess der Aufarbeitung stellen. Gleichzeitig erfahren sie ein hohes Maß an Verständnis und Mitgefühl durch die anderen Gruppenmitglieder und fühlen sich dadurch nach dem sozialen Rückzug wieder einer Gemeinschaft zugehörig. Durch das mehrmalige Durchgehen der Ereignisse aus den verschiedenen Blickwinkeln der Teilnehmer und durch häufige Widerholungen wird ein Habituierungsprozess wirksam, der es den Teilnehmern erlaubt, mehr und mehr Distanz zwischen sich und der Katastrophe zu verspüren. Die Tatsache, nach einer gewissen Zeit festzustellen, dass die Gruppe sich nicht nur noch über die Katastrophe austauscht, sondern auch über andere Probleme und Themen, verstärkt diesen Eindruck noch für die Teilnehmer. Die traumatischen Erlebnisse wirken nicht mehr aktuell in Form von unzusammenhängenden Bildern, Gefühlen und Körperreaktionen, sondern werden zu einem zusammenhängenden – wenn auch immer noch belastenden – Ereignis der Vergangenheit, das die Personen kognitiv nachvollziehen und dessen Folgen sie einordnen können. Gruppen für Katastrophenopfer sollen immer über mehrere Stunden abends, oder zum Beispiel über ein Wochenende laufen, besonders wenn die Teilnehmer aus den verschiedensten Teilen der Republik anreisen müssen, wie beispielsweise bei den deutschen Betroffenen der Tsunami-Katastrophe in Südostasien vom Dezember 2004. In einen normalen Praxisalltag mit 90 Minuten sind sie schwer integrierbar. Die Teilnehmer brauchen mehr Zeit, müssen erst Ängste und Zweifel überwinden und können die beruhigende, habituierende Wirkung erst nach zwei bis drei Stunden spüren. D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Narrative Traumabewältigung – Exposition in sensu Die therapeutische Aufgabe, die traumatischen Erlebnisse aufzuschreiben, verstärken den Prozess, aus dem Geschehenen eine zusammenhängende Geschichte werden zu lassen. Die sprachliche Erlebnisdarstellung verlangt vom Erzähler, dass seine Erinnerungen linearisiert, d. h. in eine zeitliche Abfolge gebracht werden müssen, in Beziehungen zueinander gebracht werden, also entweder in kausalen oder finalen Abfolgen, selegiert werden müssen, d. h. es muss im Erzählprozess ständig entschieden werden, was an Erinnerungsfragmenten in die Geschichte integriert werden muss bzw. was außen vor bleiben soll. Der Erzähler muss Motive, Begründungen und Erklärungen für sein Handeln einbauen, er verleiht seiner Geschichte Kohärenz und Sinn. Er begibt sich dadurch in einen komplexen kognitiven Prozess, und schafft damit Erkenntnisse, die für die Traumaverarbeitung sehr hilfreich sein können. Werden in einem zweiten Schritt die geschriebenen Erzählungen in der Gruppe vorgelesen, kommt dann noch die Hörerfunktion hinzu, also die empathische Teilhabe anderer Personen (Lucius-Hoene, 2002; Deppermann & Lucius-Hoene, 2005). Die schriftliche Fassung des Traumas eignet sich in vielen Fällen für eine Exposition in sensu, also dem mehrfachen Vorlesen sowohl durch den Betroffenen, als auch durch andere Gruppenmitglieder oder den Therapeuten und zunehmender Habituation. Die Aufgabe, die Niederschrift des Traumas zuhause wegzulegen in einen Schrank oder ähnliches, nur zu fest vereinbarten Zeiten hervorzuholen und sich mehrfach durchzulesen, fördert das Gefühl der wieder erlangten Kontrolle über die Situation und die eigenen Reaktionen. Therapeutisches Angebot für Schwertraumatisierte: Siebenstufiges Behandlungskonzept (SBK) Das aus den Erfahrungen in der praktischen Arbeit mit Katastrophenopfern entstandene Siebenstufige Behandlungskonzept für traumatische Störungen (SBK) wurde in Kapitel C ausführlich dargestellt. Mit diesem Behandlungsmanual steht für diejenigen Betroffenen einer Katastrophe, die am stärksten psychisch reagiert und eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben (30 bis 50 Prozent) ein effektives und ökonomisches, auf die Symptomatik fokussiertes Therapiekonzept zur Verfügung. Die Behandlungskomponenten sind für die Individualtherapie konzipiert. Für Schwertraumatisierte ist ein Eingehen auf individuelle Details der traumatischen Belastungen Voraussetzung zur Überwindung ihrer Störung. Diese ist im Gruppensetting normaler Weise nicht zu leisten. Außerdem stellt es für viele Gruppenteilnehmer eine zu starke Belastung dar, mit sehr vielen traumatischen Details von Anderen konfrontiert zu werden und ihre psychische Widerstandskraft können überfordert werden. Besonders bewährt hat sich bisher in der klinischen Erfahrung, die Behandlungseinheiten des SBK jeweils im Block über mehrere Stunden einzusetzen. Auf diese Weise wird es für Patienten und Therapeuten leichter, die mit traumatischen Störungen häufig einhergehenden, von Schuld- und Schamgefühlen geprägten Vermeidungs- und Verdrängungstendenzen einvernehmlich und ohne Druck zu überwinden und sich der eigentlichen Aufgabe, der Traumabewältigung zu stellen. 301 302 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Konfrontative Auseinandersetzung Das oberste psychologisch-psychotherapeutische Ziel lautet, die Betroffenen sollen zu einer konfrontativen Auseinandersetzung mit dem Trauma angeleitet, aber nie gegen ihren Willen dazu gedrängt werden. Die Begründung dafür liegt in der Erkenntnis, dass die Betroffenen intrapsychisch sowieso immer die grauenvollen Bilder der Traumatisierung in sich tragen und den extrem belastenden Gefühlen und Körperreaktionen regelmäßig ausgesetzt sind. Wenn im therapeutischen Rahmen zu einer Auseinandersetzung damit angeregt wird, ist dies keine zusätzliche Belastung, sondern eine Entlastungsmöglichkeit für die Betroffenen. Vor allem die bewusste Entscheidung und die gelernte Fähigkeit, sich emotional kontrolliert und in einer sicheren therapeutischen Atmosphäre mit dem Trauma zu beschäftigen und nicht nur dem Wiedererleben in Form von Flashbacks hilflos ausgeliefert zu sein, fördern die Selbstkompetenz und das Gefühl, die Kontrolle zurück gewonnen zu haben. Aus dem unwillkürlichen Wiedererleben des passiven Opfers soll willkürliche Auseinandersetzung mit dem Schmerz und dem erlittenen Verlust des aktiven Überlebenden werden. Zu den konfrontativen psychotherapeutischen Methoden sind zu zählen: • Gesprächsgruppen zum Nachvollziehen des Traumas, • Kontrollierte Traumaexploration und -exposition (KTE), • Exposition in sensu, • Exposition in vivo, • Exposition mit Reizen, die an das Trauma erinnern (z. B. Filmberichte, Zeitungsartikel etc.), • EMDR, • Trauerrituale am Unfallort, • Aktive Gestaltung des Jahrestags der Katastrophe. Ein Katastrophenopfer, das es gelernt hat, seine Schwierigkeiten mit konfrontativer Auseinandersetzung zu überwinden, soll auch später bei erneut auftauchenden Problemen in der Lage sein, sich über den gleichen Weg damit zu beschäftigen und nach Lösungen zu suchen. Insofern stellt die konfrontative Bearbeitung auch eine wichtige Grundlage der Rückfallprophylaxe dar. 3.3 Langfristig Exposition an der Unfallstelle Das Aufsuchen der Unfallstelle und die Bearbeitung der mit diesem Ort verbundenen Erinnerungen, schmerzlichen Gefühle und Ängste stellt ein zentrales Ziel in der verhaltenstherapeutischen Traumabewältigung dar. Für die meisten Betroffenen gehen von der Unfallstelle magische zerstörerische Kräfte aus, die sie glauben, nicht ertragen zu können. Ein Vermeiden dieses Ortes ist für Viele die logische Konsequenz. Auch wenn durch vorherige therapeutische Interventionen auf der kognitiven und emotionalen Ebene und mit Hilfe von EMDR das Trauma schon weitgehend bearbeitet ist, stellt der Besuch der Unfallstelle eine große Herausforderung dar. Stellen sich Betroffene dieser nicht, laufen sie Gefahr, dass sich ihr auf die Unfallstelle bezogenes Vermeidungsverhalten wieder ausweitet und sie Rückschritte machen. D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Durch die Erfahrung, dort verweilen und ihre Anspannung und körperlichen Missempfindungen in den Griff bekommen zu können, spüren die Teilnehmer ein neues Gefühl in sich, nämlich stärker zu sein als die zerstörende Kraft, die während der Geschehnisse auf sie eingewirkt hat. Sie lernen neu, dass es sich nicht um einen „gefährlichen“ Ort handelt, sondern um einen Ort, an dem einmal etwas Schlimmes geschehen ist, und dieser Erinnerung können sie sich stellen. Trauerarbeit Weiteres Ziel der langfristigen Betreuung ist die Unterstützung der Trauerarbeit. Die Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen ist ein langwieriger Prozess. Opfer und Angehörige von Katastrophen machen häufig die Erfahrung, dass die anfängliche große Anteilnahme der Öffentlichkeit schnell wieder abflacht. Nach einer gewissen Zeit des Verständnisses der Gesellschaft, spüren sie bald den Anspruch von außen, wieder zur Normalität zurückzukehren. Daher wird die Trauerarbeit für Viele zu einer individuellen Aufgabe mit wenig Unterstützung der Gesellschaft. Um Fehlentwicklungen vorzubeugen, wird die Trauerarbeit in der Gruppe forciert. Unterschieden werden muss dabei zwischen Angehörigen- und Betroffenengruppen. Steht bei Angehörigen die Trauerarbeit meist von Anfang an im Zentrum, ist sie für Betroffenengruppen oft erst nach Bearbeitung der Traumatisierung möglich. Zentrale Element der Trauerarbeit in der Gruppe stellen das Vorstellen des Verstorbenen anhand von Bildern und Berichten dar, die Klärung der Beziehung, die der Einzelne mit ihm hatte und der Umgang mit Trauerritualen, wie Gestaltung der Grabstätte, Umgang mit den Hinterlassenschaften des Verstorbenen und eventuell Trauerritualen an der Unfallstelle. Entscheidend ist die Haltung der Gruppe, dass es für jeden Teilnehmer möglich ist, immer wieder seine Tiefpunkte und Rückschläge in der Trauerarbeit thematisieren zu können, da Trauerverarbeitung selten linear bewältigend verläuft. Planung und Entwicklung von Perspektiven Bei langfristigen psychologisch-psychotherapeutischen Zielen steht die Entwicklung von Perspektiven für das weitere Leben der Betroffenen im Vordergrund. Für viele Betroffene stellt diese Aufgabe eine ganz besondere Herausforderung dar, da sie anfangs davon überzeugt waren, es gebe keine weitere Lebensperspektive für sie. Das Entwickeln von Lebensperspektiven bedeutet gleichzeitig, sich und anderen einzugestehen, dass man weiter leben möchte. Die Gruppe ist in diesem Zusammenhang der effektivste Motor. Die Gruppenmitglieder lernen voneinander, besonders wenn sie beobachten können, wie ein Betroffener sich etwas traut, was einem anderen größte Schwierigkeiten bereitet. Thematisch handelt es sich beispielsweise um: • wieder ausgehen ins Kino, zum Essen, zu einer Veranstaltung, • Freunde besuchen oder Besuch empfangen, • Eine neue Partnerschaft, • Eine Ausbildung oder Umschulung, • Reisen. 303 304 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis In der Gruppe ist der Aufbau von Aktivitäten und Perspektiven wesentlich einfacher und dynamischer, als in Einzelkontakten. Vorbereitung Jahrestag Die Konzipierung eines Betreuungsprogramms für Katastrophenopfer sollte mindestens bis zur Gestaltung des ersten Jahrestages geplant werden. Die Betroffenen müssen psychoedukativ darauf vorbereitet werden, dass es schon Wochen vor diesem Tag bei Vielen zu Verschlechterungen ihres Zustandes kommen kann, ohne daraus den Schluss ziehen zu müssen, die Personen machen Rückschritte. Auch hier ist die therapeutische Intervention der „Normalisierung des Unnormalen“ ähnlich wie in der Anfangssituation hilfreich. In die aktive Gestaltung des Jahrestages sollen die Betroffenen möglichst intensiv einbezogen werden. Dadurch ist es ihnen auch möglich, sich wiederum mehr auf die Bewältigung dieser Aufgabe zu konzentrieren, als auf die Belastung, die von ihr ausgeht. Für die Begehung des Jahrestages haben sich ökumenische Gedenkgottesdienste, bei Bedarf von Betroffenen interkonfessionell, im Unterschied zu Reden von Politikern, besonders bewährt. 4. Soziale Ziele (Re-)Integration in die soziale Gemeinschaft Oberstes soziales Ziel ist die Reintegration in die soziale Gemeinschaft. Betroffene von Katastrophen ziehen sich häufig zurück, halten keine Kontakte aufrecht und suchen von sich aus seltener Unterstützung. Schnell ergeben sich daraus Gefühle der Isolation, des nicht verstanden Werdens und des nicht dazu Gehörens. Andererseits fällt es vielen Außenstehenden schwer, auf Betroffene zuzugehen, da sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Auf diese Weise drohen Katastrophenopfer mehr und mehr zu Außenseitern zu werden. In der Rolle des Außenseiterdaseins sind jedoch die Chancen zur Überwindung der posttraumatischen Belastungsstörungen wesentlich geringer. Wie in Abschnitt A 2.5.1 dargelegt wurde, ist die Einrichtung eines psychosozialen Netzwerks für eine erfolgreiche Genesung von entscheidender Bedeutung. Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen dienen dem Ziel der sozialen Reintegration der Betroffenen. Einbeziehung der Betroffenen in die Konzipierung und Gestaltung des Betreuungsprogramms Durch die Einbeziehung der Betroffenen in die Konzipierung und Gestaltung des Betreuungsprogramms wird verdeutlicht, dass Nicht-Betroffene und Betroffene gemeinsam daran arbeiten, die negativen Folgen der Katastrophe zu überwinden. Darüber stehendes Ziel ist es dabei, zu der vor dem Unglück bestehenden Art sozialen D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Zusammenlebens zurück zu finden oder sogar durch die gemachte Erfahrung der solidarisch bewältigten schwierigen Zeit zu einem qualitätsmäßig höheren Niveau des gesellschaftlichen Miteinanders. Die Umsetzung und Gestaltung des Betreuungsprogramms erfordert immer wieder Kotaktaufnahme mit Behörden, Institutionen, städtischen Einrichtungen usw., in die Vertreter der Betroffenen mit einbezogen werden können. Einbeziehung von Betroffenen in die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Katastrophe (Gedenkstätte, Gedenktage) Zu den Fragen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Katastrophe • Wie soll der Toten gedacht werden? • Soll es eine Gedenkstätte geben und wie soll sie gestaltet werden? • Wie sollen die Jahrestage und andere Gedenktage begangen werden? • Was kann die Gemeinschaft dafür tun, damit es nicht noch einmal zu einer solchen Katastrophe kommt? • und viele andere… sollen Sichtweisen und Meinungen der Betroffenen eingeholt werden. In Eschede zum Beispiel wurden alle Betroffene vom Obmann schriftlich gefragt, ob sie es wünschen, dass die Namen ihrer verstorbenen Angehörigen und die Geburtsdaten auf der Gedenktafel erscheinen oder nicht. Ein positives Beispiel der Integration in die Planung der Gedenkstätte. Geschieht diese Einbeziehung von Betroffenen nicht, hadern diese oft noch jahrelang mit Entscheidungen, zu denen sie nicht befragt wurden und kommen nicht zur Ruhe, wie beispielsweise in Herborn, wo Betroffene sich schwer damit tun, dass nach einem Tanklastunglück an einer Eisdiele mit mehreren getöteten Jugendlichen, nicht einmal eine Gedenktafel an deren Tod erinnert. Klärung der sozialen Zusammenhänge, in denen die Katastrophe entstanden ist und Versuche, diese Bedingungen zu beeinflussen Die Frage, wie es zu dem Unglück oder der Katastrophe kommen konnte, beschäftigt alle Betroffenen stark. Die konsequente Untersuchung der Gründe, die dazu führten, gehört unbedingt zu einer geradlinigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Unglück. In neu gewonnene Erkenntnisse sollen die Betroffenen offen mit einbezogen werden, indem sie informiert werden und sie ihre Meinungen dazu einbringen können. Für die Traumabewältigung ist das Verstehen der Zusammenhänge wichtig, die zum Unglück führten, unter Umständen auch das Benennen der Schuldigen. Damit ist die Voraussetzung gegeben, kognitiv zu verstehen, zur Ruhe zu kommen und eventuell Schuldigen zu vergeben. Bleiben die Gründe für die Katastrophe im Dunkeln, oder haben Betroffene gar den Eindruck, sie würden bewusst verschwiegen, ist dies ein ständiger innerer Unruheherd und eine starke psychische Belastung für die Betroffenen. Positives Beispiel war in Borken der Versuch, allen Betroffenen die Unglücksursache in einer Informationsveranstaltung vom untersuchenden Staatsanwalt erklären zu lassen. Negative Beispiele waren in Meißen die nicht geglückte Tatmotiv Aufklärung, die durch die Justiz verhindert wurde oder in Erfurt die von der Schulleitung nicht geförderte 305 306 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Auseinandersetzung über die Stellung des Täters in der Schule und die Gründe, die zu seinem Verweis geführt hatten. 5. Methoden der Betreuung Informationsveranstaltungen über psychische Folgeerscheinungen bei Betroffenen Wie schon mehrfach erwähnt ist es unumgänglich, anfangs auf Betroffene mit konkreten Angeboten zuzugehen. Zu Beginn ist es ratsam, Informationsveranstaltungen für alle Betroffene im großen Kreis über psychische Folgeerscheinungen nach Traumatisierungen durchzuführen. Damit soll dreierlei erreicht werden: erstens werden unnötige Sorgen und Ängste abgebaut, die Betroffene bezüglich ihrer Symptomatik der akuten Belastungsstörung aufweisen; zweitens werden sie sensibilisiert für später auftretende Warnsignale einer posttraumatischen Belastungsstörung und drittens werden ihnen Perspektiven aufgezeigt, wie die allgemeinen und psychischen Probleme nach der Katastrophe gemeinsam angegangen werden können. Auf diese Weise wird den starken Hilflosigkeits- und Hoffnungslosigkeitsgefühlen etwas entgegengesetzt. Auf den Informationsveranstaltungen können Betroffene aktiviert werden, indem sie angeregt werden, Fragen und Zweifel anzusprechen, Bedürfnisse zu äußern oder schon selber Gruppen bilden. Allgemeine multiprofessionelle Unterstützung Die Bewältigung aller Katastrophenfolgen für die Betroffenen erfordert eine enge Zusammenarbeit der verschiedensten Professionen. Notwendig sind je nach Art der Katastrophe: • Sozialarbeiter zu Hilfe bei Anträgen, Umgang mit Behörden etc., • Ärzte für die somatische Betreuung, • Psychologen für die psychologisch-psychotherapeutische Betreuung, • Pfarrer für den seelsorgerischen Beistand, • Lehrer zur Unterstützung der Kinder bei Schulproblemen, • Vertreter der Firma oder Institution als Ansprechpartner, • Ansprechpartner bei der Stadt, Kommune oder Land, • Ein neutraler Obmann. Die Vertreter müssen ein Forum haben, auf dem sie sich austauschen und ergänzen, ohne die Schweigepflicht zu verletzen. Für die Betroffenen soll freier und unkomplizierter Zugang zu diesen Personen gewährleistet sein. Schaffung von Freiräumen zur psychologischen Bewältigung Die psychologische Arbeit in Gruppenbetreuung oder Einzeltherapie erfordert Kraft und Konzentration von den Betroffenen. Dafür müssen ihnen Freiräume gewährt werden, D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis durch die auch deutlich wird, dass die psychologische Bewältigung der Katastrophenfolgen gewollt ist. Betroffene sind häufig überfordert, wenn sie im Anschluss an einen Arbeitstag oder einen anstrengenden Schultag noch in die Gruppe zur Traumabewältigung sollen. Zumindest für die Anfangszeit sollte versucht werden, den Betroffenen zu ermöglichen, während der Arbeits- oder Schulzeit diese Gruppen zu besuchen, und z. B. Fahrtkosten zur Gruppe ersetzt zu bekommen, wenn es sich um lange Anfahrtswege handelt. Betroffenen-Gruppen Betroffene erleben das Zusammentreffen mit Personen, die das gleiche Schicksal erlebt haben, meist als hilfreich und unterstützend. In der Anfangssituation einer Betroffenen-Gruppe wird häufig berichtet, dass es sehr belastend ist, die Schicksale der anderen Gruppenteilnehmer genau zu erfahren, und es entsteht für manche ein Gefühl des potenzierten Leids. Aus der Teilnahme am Leid der Anderen erwächst jedoch bei vielen der Mut, selber Probleme anzusprechen und nach Lösungen zu suchen, die man mit niemandem bereden würde, der das Ganze nicht erlebt hat. Es entsteht ein Gruppenkohärenzgefühl, von dem sich viele Betroffene getragen fühlen. In dieser Situation besteht jedoch auch die Gefahr der Polarisierung in Gruppenmitglieder, die sich ineinander einfühlen und „die da draußen, die einen nicht verstehen“. In reinen Selbsthilfe Betroffenen-Gruppen wird die Außenwelt im Extremfall nur noch als feindlich erlebt, während man selbst das verständnisvolle Leiden pflegt. Solche Schicksalsgemeinschaften nach Katastrophen bestehen oft über viele Jahre und stellen den einzigen Kontakt zur Außenwelt für Betroffene dar. Daher ist es wichtig, einen außen stehenden fachlichen Leiter zu haben, der die Gruppe auch immer wieder motiviert und anleitet, den Kontakt zur Gesellschaft zu suchen und zu pflegen. Betroffenen-Gruppen, die aktiv an der Bewältigung ihrer gemeinsamen Schwierigkeiten mit dem Ziel arbeiten, neue Perspektiven in ihrem Leben zu entwickeln und sich gegenseitig unterstützen, über Beruf, Freizeit und Partnerschaft in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen, sind für die Teilnehmer Erfahrungen, in denen sie persönliches Wachstum erlebten und die sie im Nachhinein nicht missen möchten. Einzelpsychotherapie Einzelpsychotherapie kann und muss in vielen Fällen die Gruppenarbeit ergänzen, soll sie aber in der Regel nicht ersetzen. Besonders die Schwertraumatisierten brauchen konkrete traumtherapeutische Interventionen wie z. B. Kontrollierte Traumaexposition und EMDR (s. Kapitel C), die in der Gruppe nicht durchführbar sind. Die Fortschritte aus der Einzelpsychotherapie bringen Betroffene meist von sich aus in die Gruppe, so dass die anderen Gruppenmitglieder letztlich auch von dem verbesserten Zustand der Teilnehmer der Einzeltherapie profitieren. Wie die Ergebnisse aus Meißen zeigen (s. Kapitel B 3), profitieren die Hochtraumatisierten, die zusätzlich Einzeltherapie erfahren, besonders von den therapeutischen Interventionen, nähern sich mit der Zeit dem Stand der Gesamtgruppe an und wirken durch ihre im Vergleich schnellere positive Entwicklung auf die gesamte Gruppe motivierend. 307 308 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Es ist darauf zu achten, dass Einzeltherapiesitzungen nicht zur Konkurrenz der Gruppenarbeit werden und die Teilnehmer an der Einzeltherapie sich in der Gruppe verschließen. 6. Umgang mit Behörden Klärung von Zuständigkeiten Unbedingt muss in der Anfangssituation geklärt werden, wer für die Abwicklung der formalen Dinge zuständig ist. Ist eine Firma, oder ein Unternehmen zuständig, wie in Borken die PreussenElektra, oder in Eschede die Deutsche Bahn, oder ist es eine Behörde, wie in Meißen das Kultusministerium, oder sind es mehrere Behörden und die Unfallkasse oder eine Berufsgenossenschaft. Ungünstig wirkt es sich auf den Prozess der Etablierung eines Betreuungsprogramms aus, wenn die Zuständigkeiten unklar sind, wie in Erfurt, wo Innen-, Sozial-, Kultusministerium und Unfallkasse wochenlang darüber debattierten, wer letztendlich die Durchführung der geplanten Betreuungsmaßnahmen anzuordnen hatte. Aus psychotraumatologischer Sicht muss vor den Behörden betont werden, dass diese Klärungsprozesse zum Wohle der Betroffenen schnell und effektiv abzuschließen sind. Sicherstellung der Finanzierung Ohne eine solide Finanzierung kann ein Betreuungsprojekt nicht durchgeführt werden. Die eingesetzten Psychologen müssen regulär bezahlt werden, von rein auf ehrenamtlicher Basis durchgeführten Betreuungsprojekten ist aus Qualitätsgründen abzuraten. Neben der Klärung, ob eine Stelle leistungspflichtig ist, wie z. B. Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft, sollte von den Planern eines psychologischen Betreuungsprogramms selbstbewusst nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden. In erster Linie bedeutet das, mit der Institution, in deren Verantwortungsbereich das Unglück geschehen ist, darüber zu verhandeln, mit welcher Summe sie bereit ist, sich zu engagieren. Darüber hinaus können und sollen Spendengelder gezielt für die Finanzierung eines Betreuungsprojekts eingesetzt werden. Um eine saubere Verwendung der Gelder zu gewährleisten und jederzeit nachweisen zu können, empfiehlt es sich, ein Kuratorium zu gründen, in dem die Vertreter verschiedener Hilfsorganisationen, der Stadt, der betroffenen Institution usw. vertreten sind. An dieses Kuratorium können dann auch immer Anträge zur Übernahme von Kosten gestellt werden, die man von Anfang an nicht überblicken konnte, wie beispielsweise Notlagen einzelner betroffener Familien. Diese Vorgehensweise war in Borken sehr erfolgreich, weil es möglich war, unkompliziert von finanzieller Seite aus auf neue Problemlagen zu reagieren. D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Kooperation mit Behörden Der kompetente Umgang mit den zuständigen Behörden ist eine entscheidende Voraussetzung für ein Gelingen des gesamten Betreuungsprojekts nach einer Katastrophe. Aus den Erfahrungen der vorgestellten Projekte wurde deutlich, dass die verantwortlichen Behörden in der Akutphase sehr von einer eindeutigen professionellen psychologischen Beratung bezüglich der Betreuung der Katastrophenopfer profitieren. Anfangs sind Verunsicherung und Betroffenheit auch bei den Verantwortlichen in der Regel groß und sie sind dankbar, wenn es ein klares Konzept für die Betreuung von Opfern und Angehörigen gibt. Es ist wichtig, sie von psychologischer Seite zu überzeugen, dass es vielfältige Erfahrungen in der Betreuung von Katastrophenopfern gibt und dass man dafür wissenschaftlich fundierte Konzepte vorlegen kann. Für die Gestaltung von Arbeitsverträgen ist es zweckmäßig, dass die psychologische Leitung weisungsfrei arbeiten kann, was therapeutische Angelegenheiten betrifft und dass die Schweigepflicht gewährleistet ist. Im Verlaufe des Projekts muss der Austausch der psychologischen Leitung mit der Behörde regelmäßig in einem speziell einzurichtenden Gremium erfolgen. Dabei sind vor allem der Gesamtverlauf und die Wirksamkeit der Betreuungsmaßnahmen darzulegen, auf keinen Fall jedoch die Entwicklung von Einzelpersonen. Für das Vertrauensverhältnis zwischen Betroffenen und Therapeuten ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Betroffenen sich sicher sein können, dass keine vertraulichen persönlichen Dinge weitergeleitet werden, sondern dass der Therapeut sich strikt an die Schweigepflicht hält. In diesem Punkt kann es zu Konflikten kommen, wenn z. B. eine Institution wie die Unfallkasse darauf besteht, aus gesetzlichen Gründen zum Nachweis des Versicherungsverlaufs über jeden Betroffenen eine Akte führen zu müssen und dafür Berichte der Therapeuten verlangt. Eine Lösung kann nur in der strikten Trennung liegen zwischen Therapeuten, die für die Betreuung der Betroffenen zuständig sind und einem Psychologen, der in einer Art amtsärztlicher Funktion die für die Dokumentation des Versicherungsverlaufs relevanten Informationen in Gesprächen sammelt, die auch unter dieser Überschrift laufen. 7. Umgang mit Presse und Medien Jedes große Unglück und jede Katastrophe stehen im zentralen Blickfeld der Presse und der Medien. Psychologische Betreuer sind häufig nicht mit den Methoden dieses Berufsstandes vertraut und laufen Gefahr, Fehler zu machen oder zuzulassen, die dem gesamten Betreuungsprojekt empfindlichen Schaden zufügen können. Schutz der Betroffenen An oberster Stelle steht der Schutz der Betroffenen. Besonders in der Akutphase sind Betroffene gefragte Interviewpartner oder oft auch nur gesuchte Opfer, deren Leid und 309 310 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Verzweiflung fotografiert oder gefilmt werden soll. In dieser Situation können Betroffene selber meist nicht einschätzen, was es für sie bedeutet und welche Konsequenzen es nach sich zieht, wenn sie im Schockzustand der Presse Rede und Antwort stehen. Häufig werden Aussagen in der Presse verfälscht oder sie schämen sie sich später für das, was sie im Erregungszustand gesagt haben, oder sie bringen sich gar in Schwierigkeiten, wie das Beispiel der Schüler in Meißen zeigt (s. Kapitel B 3). In Fernsehstudios werden die Betroffenen mit Videos von der Katastrophe konfrontiert – wie z. B. bei der Tsunami-Berichterstattung 2005 –, ohne darauf vorbereitet zu sein und sie drohen retraumatisiert zu werden. Es ist Aufgabe der Notfallpsychologen und der Betreuer in der Akutphase Betroffene so gut es geht davor zu schützen, sie auf diese Belastungen vorzubereiten und ihnen aufzuzeigen, wie sie sich gegenüber der Presse abgrenzen können. Gleiches gilt für die Betreuer. Der für den Einsatz zuständige Psychologe muss die Akuthelfer anweisen, keine Interviews zu geben, da auch sie Gefahr laufen, sich im Zustand der starken Anspannung, Erregung und eigenen Betroffenheit auf eine Weise zu äußern, die für ihn selber, die Betroffenen oder den Betreuungsprozess negative Konsequenzen haben. Auch für die Zeit der psychotherapeutischen Betreuung sollen sich die zuständigen Therapeuten nicht auf Interviews einlassen. Es ergeben sich leicht Missverständnisse, die das Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen stören. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass sich Medienvertreter wiederholt an Psychologen wenden, um Kontakte zu Betroffenen herzustellen, die sie als Interviewpartner haben wollen. Betroffene wollen dann unter Umständen ihrem Therapeuten einen Gefallen tun und sagen gegen ihren Willen zu. Auch daraus können empfindliche Beziehungsstörungen und Belastungen für den Prozess der Traumabewältigung entstehen. Presseverantwortlicher Andererseits ist es in unserer von den Medien geprägten Informationsgesellschaft unrealistisch, sich Presse und Medien gegenüber vollkommen zu verschließen. Es ist daher sinnvoll, einen Presseverantwortlichen zu benennen, der möglichst Erfahrung auf diesem Gebiet hat und über den alle Kontakte zur Presse und den Medien laufen. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, auszuwählen zwischen unseriösen Sensationsreportern und seriösen Vertretern. Er muss sich innerhalb seines Verantwortungsbereichs (Kollegen, Firma, Ministerium o. ä.) absprechen über Sprachregelungen, wie über bestimmte Lagen oder Entwicklungen die Öffentlichkeit informiert wird. Die anderen im Betreuungsprozess beteiligten Betreuer können bei Anfragen von Medienvertretern immer auf den Pressesprecher verweisen und sind somit vor diesen Belastungen geschützt. Gefahren und Chancen Gefahren durch Presse und Medien bestehen vor allem in der Anfangszeit einer Katastrophe, in der häufig Sensationsreporter Geschäft mit dem Leid der Opfer und Angehörigen machen wollen. Darüber hinaus sollte es selbstverständlich sein, sich bestimmten Blättern der so genannten „Yellow Press“ und bestimmten niveaulosen TV Sendern vollkommen zu verschließen. D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Wochen und Monate nach einer Katastrophe, wenn diese von der Öffentlichkeit längst nicht mehr wahrgenommen wird, treten eher seriöse Journalisten auf den Plan, die über die langfristige Verarbeitung einer Katastrophe berichten wollen. Die Erfahrung zeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich auf derartige Projekte einzulassen. Zum einen ist es für Betroffene unter bestimmten Bedingungen produktiv und der Weiterentwicklung zuträglich, vor einer breiten Öffentlichkeit über das Leid zu berichten, das sie durchgemacht haben, aber auch über die Erfolge, die sie bei der Überwindung dieses Zustandes erreicht haben. Auch darin kann ein wichtiger Schritt der Traumabewältigung gesehen werden. Zum anderen weckt eine sensible Berichterstattung über den Traumabewältigungsprozess nach einer Katastrophe eine verständnisvollere Haltung in der Gesamtbevölkerung gegenüber Traumatisierten und ermutigt Betroffene, die sich bisher zurückgezogen haben unter Umständen, selber Hilfe zu suchen. 8. Evaluation der Wirkung von Interventionen Die therapeutischen Angebote für Betroffene von Katastrophen sind in den letzten Jahren ständig verbessert worden, insgesamt steht die Forschung jedoch noch am Anfang. Fragen der differentiellen Indikation beispielsweise sind noch weitgehend ungeklärt, also welche Maßnahme ist für welchen Betroffenen zu welchem Zeitpunkt die Beste? Forschung ist jedoch in diesem Gebiet generell schwierig, da der Versorgungsaspekt der von Betroffenen immer an erster Stelle stehen muss. Akzeptanzprobleme bei Betroffenen Die Betroffenen reagieren meist ablehnend und irritiert, wenn sie den Eindruck erlangen, Fragebögen und psychologische Untersuchungen dienen wissenschaftlichem Interesse und nicht ausschließlich der Frage, welche Therapiemaßnahmen für sie geeignet sind. Erst nach Bewältigung der meisten Schwierigkeiten mit deutlichem zeitlichem Abstand zur Katastrophe sind Betroffene erfahrungsgemäß bereit, an der Frage mitzuarbeiten, was anderen Menschen helfen könne, die in eine ähnliche Lage kommen. Diese Sichtweise ergibt jedoch nur retrospektive Daten, die für die wissenschaftliche Forschung von eingeschränktem Wert sind. In keinem Fall darf die Absicht, auch allgemeine Forschung zu betreiben, nicht dadurch verschleiert werden, indem man versucht, dementsprechende Fragebogenaktionen als therapeutische Interventionen darzustellen. Dieses führte in Borken, wie in Kapitel B 1 dargestellt, fast zu einem Scheitern des gesamten Projekts. Aufgrund dieser Schwierigkeiten sollten Untersuchungen sich weitgehend auf den Bereich beschränken, der für die Therapie der Betroffenen Relevanz hat. 311 312 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Relevanz für individuelle Therapieangebote Die wichtigste zu klärende Frage ist, wie ausgeprägt zeigt sich die traumatische Symptomatik bei welchem Betroffenen? Ziel ist dabei, die Gruppe der Schwertraumatisierten zu identifizieren, um ihr besondere therapeutische Angebote zu unterbreiten. Weiterhin ist es möglich, z. B. mit Hilfe der Ergebnisse der Impact of Event Scale (IES) festzustellen, auf welchen Gebieten der für die Diagnosestellung relevanten Bereiche, Intrusion, Vermeidung und Hyperarousel, die betreffende Person besondere Werte zeigt. Bei Personen mit hohen Intrusionswerten beispielsweise sind eher stabilisierende therapeutische Techniken notwendig, bei einer Person mit starker Übererregung sollten eher Entspannungstechniken im Vordergrund stehen, bei Vermeidern unter Umständen eher konfrontative Techniken. Auch die Diagnostik komorbider Störungen hat unmittelbare therapeutische Relevanz, besonders hinsichtlich der Abklärung suizidaler Tendenzen aber auch in Hinblick auf Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen. Eingangsdiagnostik – Verlaufsdiagnostik – Abschlussdiagnostik Empfehlenswert sind drei Messzeitpunkte zur Untersuchung der Entwicklungsverläufe der Belastungsreaktionen und der traumatischen Störungen. Die Eingangsdiagnostik sollte frühestens sechs bis acht Wochen nach dem Ereignis stattfinden, damit das Zeitkriterium von mindestens vier Wochen zur Vergabe der Diagnose einer PTBS erfüllt ist. Die Dreiteilung der Diagnostik erfüllt verschiedene Zwecke: 1. Feststellung des Traumatisierungsgrades der Gesamtgruppe und Identifikation der Schwertraumatisierung in der Eingangsdiagnostik, 2. Zum zweiten Messzeitpunkt, etwa in der Mitte der Betreuungsmaßnahmen, Erkenntnisse gewinnen, ob noch neue Personen mit verzögertem Beginn einer PTBS dazu gekommen sind und ob die Symptomatik bei einzelnen Gruppen sich verändert hat, das heißt, welche Personen brauchen intensivere Unterstützung, 3. Aussagen nach der Abschlussdiagnostik tätigen zu können, ob die Entwicklung der Traumabewältigung erfolgreich war, bzw. welcher Betroffene noch weitere therapeutische Maßnahmen benötigt. Es spricht nichts dagegen, die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchungen den Betroffenen rückzumelden und mit ihnen zu besprechen. Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen Die Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen ergeben sich aus den praktischen Erfahrungen und orientieren sich an folgenden Kriterien: 1. Die Instrumente müssen einfach verständlich und handhabbar für Betroffene und Durchführende sein. 2. Sie müssen alle Dimensionen der PTBS abdecken und die wichtigen komorbiden Störungen erfassen. 3. Sie müssen am DSM-IV orientiert sein. Eine Selbstverständlichkeit bei der Auswahl geeigneter Verfahren sollte eine gute oder zumindest befriedigende methodische und testtheoretische Absicherung sein. Es ist dringend davon abzuraten, sich dabei ausschließlich an den Kurzbeschreibungen von D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis Fragebögen oder Tests zu orientieren. (Es spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle, ob es sich im Anwendungsfall um Einzelfalldiagnostik oder die Untersuchung von Betroffenengruppen, also größere Informationsmengen, handelt.) Neben der Verwendung dieser standardisierten Fragebögen wird die Erfragung persönlicher Ziele der Betroffenen in Bezug auf das erlebte Unglück empfohlen. Die Aussagen der Betroffenen zu diesem Thema sind zwar weniger für statistische Auswertungen und Gruppenvergleiche geeignet, sind aber eine hilfreiche Grundlage für Auswertungsgespräche auf individueller Basis gegen Ende der Betreuung mit der Frage, ob diese Ziele erreicht wurden, bzw. was noch unternommen werden muss, damit die Ziele erreicht werden. 9. Qualitätssicherung: Supervision für Traumatherapeuten und andere professionelle Helfer Konzeptsupervision Um ein einheitliches therapeutisches Vorgehen zu gewährleisten, wenn mehrere Therapeuten involviert sind, empfiehlt sich eine regelmäßige Konzeptsupervision. Die Konzeptsupervision wird vom psychologischen Leiter des Projekts durchgeführt. In dieser wird einerseits untersucht, ob die im Betreuungskonzept genannten Ziele konsequent verfolgt werden. Dazu ist es sinnvoll, dass die einzelnen Therapeuten jeweils einen Bericht geben, welche therapeutischen Strategien sie in ihrer Gruppe wie angewendet haben und wie sich ihre Gruppe in Bezug auf das jeweilige Ziel entwickelt hat. Andererseits dient die Konzeptsupervision der Weiterentwicklung, Modifizierung und Anpassung des Betreuungskonzepts an die realen Gegebenheiten. Fallsupervision Darüber hinaus muss für die Betreuer-Gruppe eine Fallsupervision durch einen externen Therapeuten angeboten werden. In dieser können Komplikationen in den Entwicklungen der Betroffenen, sowie Korrekturen und effizientere Interventionsstrategien besprochen werden. Individuelle Supervision Schließlich muss jeder Therapeut die Möglichkeit für individuelle Supervision haben. Die Konfrontation mit dem großen Ausmaß an Leid und Verzweiflung der Betroffenen und Angehörigen geht nicht spurlos an den Therapeuten vorbei. Eigene Betroffenheit muss aufgearbeitet werden, um die Therapeuten vor Sekundärtraumatisierungen, die durch die Berichte der Betroffenen bei Therapeuten entstehen können, zu schützen. 313 314 D: Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis 10. Langfristige Betreuung von Katastrophenopfern Umgang mit Gedenk- und Jahrestagen Eine Betreuung von Katastrophenopfern sollte mindestens bis nach dem ersten Jahrestag geplant werden, in der Regel eher bis zum zweiten Jahrestag. Die Jahrestage stellen eine große Belastung für Betroffene und Angehörige dar. Häufig tauchen schon überwunden geglaubte Symptome wieder auf. Die Betroffenen sind auf die Jahrestage sorgsam vorzubereiten und die Gestaltung dieser Tage soll in enger Abstimmung mit ihnen erfolgen. Am ehesten geeignet sind ökumenische Gedenkgottesdienste, je nach Erfordernis mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften (z. B. christlich – muslimisch). Auch wenn die eigentliche Betreuung beendet ist, sollte für die Jahrestage geplant werden, sich wieder gemeinsam zu einer Gedenkfeier zu treffen. Gedenkstätte Es ist für die meisten Betroffenen und Angehörigen außerordentlich wichtig, eine Stätte der Erinnerung an die Katastrophe und des Gedenkens und der Ehre der Toten zu haben. Die Vorstellungen, wie eine solche Gedenkstätte zu gestalten sei, gehen natürlich weit auseinander und man kann es nicht allen Betroffenen recht machen. Dennoch sollten zu Kernfragen der Gestaltung Umfragen unter den betroffenen Personen gemacht werden und der Wille der Mehrheit sollte strittige Fragen entscheiden. Auch wenn am Ende viele Betroffene mit bestimmten Details der Gedenkstätte nicht einverstanden sind, ist es eine eindeutige Erkenntnis aus der Arbeit mit den Betroffenen der in dieser Arbeit dargestellten Katastrophen, dass es wesentlich schlimmer ist für Betroffene, keine Gedenkstätte zu haben, als eine an der sie das ein oder andere auszusetzen haben. Rückfallprophylaxe In der Rückschau der hier verarbeiteten 17-jährigen Erfahrung mit Katastrophenopfern ist der Eindruck entstanden, dass viele Menschen dieses Personenkreises bei erneuten kritischen Lebensereignissen psychisch empfindlicher reagieren, als die Normalbevölkerung. Sie geraten leichter in psychische Krisen, ihre Abwehrkräfte scheinen nicht mehr so stark zu sein. Es ist von daher sinnvoll, in regelmäßigen großen Abständen, z. B. ein mal im Jahr ein Treffen mit den Gruppen zu vereinbaren, in dem man nacheinander schaut und sich austauscht, wie das Leben weiter verlaufen ist. Diese Treffen müssen nicht unbedingt mit Therapeuten verlaufen und wenn die Therapeuten dazu kommen, sollen sie nicht bezahlt werden dafür, sondern aus Interesse an den Menschen kommen. Eine solche Gruppe gibt den Betroffenen viel Halt und gewährleistet außerdem, diejenigen zu motivieren, erneut professionelle Hilfe aufzusuchen, die sie benötigen. Mit dieser Maßnahme können auch längere Zeit nach Beendigung der eigentlichen psychotherapeutischen Interventionen gefährdete Katastrophenopfer und Opfer zielgerichteter Gewalt im Sinne einer Rückfallprophylaxe unterstützt werden. Literatur Adams, R.E. & Boscarino, J.A. (2005). Stress and well being in the aftermath of the World Trade Center attack: the continuing effects of a communitywide disaster. Journal of Community Psychlogy, 33, 175–190. Allardt, E. (1973). About Dimensions of Welfare – An Exploratory Analysis of a Comparative Scandinavian Survey. Helsinki: Finnish Political Science Association. Amelang, M. & Zilinski, W. (1997). Psychologische Diagnostik und Intervention (2., korrigierte, aktualisierte und überarbeitete Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer. American Psychiatric Association, APA. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, D.C.: American Psychiatric Association. Anderson, K. & Manuel, G. (1994). Gender differences in reported stress response to the Loma Prieta earthquake. Sex Roles, 30, 725–733. Anthony, J.L., Lonigan, C.J. & Hecht, S.A. (1999). Dimensionality in Posttraumatic Stress Disorder symptoms in children exposed to disaster: Results from confirmatory factor analyses. Journal of Abnormal Psychology, 108, 326–336. Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist. (1998). Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen; deutsche Bearbeitung der Child Behavior Checklist (CBCL/4–18). Einführung und Anleitung zur Handauswertung (2. Auflage mit deutschen Normen, bearbeitet von M. Döpfner, J. Plück, S. Bölte, P. Melchers & K. Heim). Köln: Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik (KJFD). Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe (Hrsg.). (1992). Nach der Katastrophe. Das Grubenunglück von Borken. Ein Erfahrungsbericht über drei Jahre psychosoziale Hilfe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Arbeitskreis Stolzenbachhilfe. (1991a). Der Fragebogen zu Haben, Lieben und sein nach Eric Allardt – H-L-S [unveröffentlichtes Untersuchungsinstrument für die Borkener Datenerhebung]. Friebertshausen: Georg Pieper. Arbeitskreis Stolzenbachhilfe. (1991b). Der Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück und Verlust – H-VUV [unveröffentlichtes Untersuchungsinstrument für die Borkener Datenerhebung]. Friebertshausen: Georg Pieper. Asarnow, J., Glynn, S., Pynoos, R.S., Nahum, J., Guthrie, D., Cantwell, D. et al. (1999). When the earth stops shaking: Earthquake sequelae among children diagnosed for preearthquake psychopathology. Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1016–1023. Ayalon, O. (1983). Coping with terrorism: the Israeli case. In D. Meichenbaum & M. Jaremko (Eds.), Stress Reduction and Prevention (pp. 293–339). New York, NY: Plenum Press. Ayalon, O. (1993). Posttraumatic stress recovery of terrorist survivors. In J.P. Wilson & B. Raphael (Eds.), International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (chap. 72, pp. 855–866). New York, NY: Plenum Press. Ayalon, O. & Soskis, D. (1986). Survivors of terrorism: A follow-up. In N.A. Milgram (Ed.), Stress and Coping in Time of War: Generalizations from the Israeli experience (pp. 257–274). New York, NY: Brunner/Mazel. Barth, J., Stoffers, J. & Bengel, J. (2003). Efficacy of EMDR in patients with PTSD: a metaanalytic review of randomised controlled trials. VIII European Conference of Traumatic Stress, Berlin, 22.-25. May 2003. 316 Literatur Bartone, P., Ursano, R., Wright, K. & Ingraham, L. (1989). The impact of a military air disaster on the health of assistance workers: A prospective study. Journal of Nervous and Mental Disease, 177, 317–328. Basoglu, M., Livanou, M. & Salcioglu, E. (2003). A single session with an earthquake simulator for traumatic stress in earthquake survivors. American Journal of Psychiatry, 160, 788–790. Basoglu, M., Salcioglu, E., Livanou, M., Özeren, M., Aker, T., Kilic, C. & Mestcioglu, O. (2001). A study of the validity of a screening instrument for traumatic stress in earthquake survivors in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 14, 491–509. Baum, J., Solomon, S.D., Ursano, R., Joseph, B., Leonard, B., Edward, B., Green, B.L., Keane, T.M., Laufer, R., Norris, F., Reid, J., Smith, E.M. & Steinglass, P. (1993). Emergency/disaster studies: Practical, conceptual and methodological issues. In J.P. Wilson & B. Raphael (Eds.), International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (chap. 10, pp. 125–133). New York, NY: Plenum Press. Beck, A.T., Hautzinger, M., Bailer, M., Worall, H. & Keller, F. (1995). Das Beck Depressionsinventar – BDI (2., überarbeitete Auflage). Bern, Göttigen, Toronto: Verlag Hans Huber. Bengel, J. (2001). Psychologische Maßnahmen für Einsatzkräfte bei Katastrophen: Das Zugunglück von Eschede. In A. Maercker & U. Ehlert (Hrsg.), Psychotraumatologie. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie (S. 186–200). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C.J. Hogrefe. Bengel, J. (2003). Notfallpsychologische Interventionen bei akuter Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 185–203). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Bengel, J. (2004). Psychologie in Notfallmedizin und Rettungsdienst. (2., vollständig neu bearbeitete Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Bengel, J., Barth, J., Frommberger, U. & Helmerichs, J. (2003). Belastungsreaktionen bei Einsatzkräften der Zugkatastrophe von Eschede. Notfall und Rettungsmedizin, 6(5), 318–325. Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen, BOeP. (Hrsg.). (2000). Schwerpunktthema: Notfallpsychologie und Psychotraumatologie (Mit 15 Einzelbeiträgen) [Themenheft]. Psychologie in Österreich, 20(5). Bettelheim, B. (1984). Afterword. In C. Vegh (Ed.), I didn’t say good bye: Interviews with Children of the Holocaust. New York, NY: E.P. Dutton. Bingham, R.D. & Harmon, R.J. (1996). Traumatic stress in infancy and early childhood: Expression of distress and developmental issues. In C.R. Pfeffer (Ed.), Severe Stress and Mental Disturbance in Children (pp. 499–532). Washington, DC: American Psychiatric Association. Bortz, J. (1993). Statistik für Sozialwissenschaftler (4., überarbeitete Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Bortz, J. & Döring, N. (1995). Forschungsmethoden und Evaluation (2., vollständig aktualisierte und überarbeitete Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Boscarino, J.A., Adams, R.E. & Figley, C.R. (2005). A prospective cohort study of the effectiveness of employer-sponsored crisis interventions after a major disaster. International Journal of Mental Health, 7, 9–22. Bowenkamp, C. (2000). Coordination of mental health and community agencies in disaster response. International Journal of Emergency Mental Health, 2(3, Fall 2000), 159–165. Bravo, M., Rubio-Stipec, M.C., Canino, G.J., Woodbury, M.A. & Robera, J.C. (1990). The psychological sequelae of disaster stress prospectively and retrospectively evaluated. American Journal of Community Psychology, 1, 661–680. Literatur Breslau, N., Peterson, E.L., Kessler, R.C. & Schultz, L.R. (1999). Short screening scale for DSM-IV posttraumatic stress disorder. American Journal of Psychiatry, 156, 908–911. Brewin, C.R., Andrews, B. & Valentine, J.D. (2000). Meta-Analysis of risk factors for Posttraumatic Stress Disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 748–766. Brewin, C.R., Rose, S., Andrews, B., Green, J., Tata, P., McEvedy, C., Turner, S. & Foa E.B. (2002). A brief screening instrument for post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 181, 158–162. Bromet, E., Goldgaber, D., Carlson, G., Panina, N., Golovakha, E., Gluzman, S., et al. (2000). Children’s well-being 11 years after the Chernobyl catastrophe. Archives of General Psychiatry, 57, 563–571. Bromet, E., Parkinson, D. & Dunn, L. (1990). Long-term mental health conseque nces of the accident at Three Mile Island. International Journal of Mental Health, 19, 48–60. Bromet, E., Parkinson, D., Schulberg, H. & Gondek, P. (1982). Mental health of residents near the Three Mile Island reactor: A comparative study of selected groups. Journal of Preventive Psychiatry, 1, 225–276. Bromet, E., Sonnega, A. & Kessler, R.C. (1998). Risk factors for DSM-III-R posttraumatic stress disorder: Findings from the National Comorbidity Survey. American Journal of Epidemiology, 147, 353–361. Brooks, N. & Mckinlay, W. (1992). Mental health consequences of the Lockerbie disaster. Journal of Traumatic Stress, 5, 527–543. Bryant, R.A. & Harvey, A.G. (1997). Acute stress disorder: A critical review of diagnostic issues. Clinical Psychology Review, 17, 757–773. Bryant, R.A. & Harvey, A.G. (2000). Acute Stress Disorder: A handbook of theory, assessment, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association. Bryant, R.A., Harvey, A.G., Dang, S.T., Sackville, T. & Basten, C. (1998). Treatment of acute stress disorder: A comparison of cognitive-behavioral therapy and supportive counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 862–866. Bryant, R.A., Sackville, T., Dang, S.T., Moulds, M. & Guthrie, R. (1999). Treating acute stress disorder: An evaluation of cognitive behavior therapy and supportive counseling techniques. American Journal of Psychiatry, 156, 1780–1786. Brösteler, E. (2003). Psychologische Betreuung der Flutopfer – Sachsen 2002. Bericht über den Einsatz des Bundesgrenzschutzes (BGS) München in der Forschungskonferenz der Abteilung für Rehabilitationpsychologie der Universität Freiburg i. Br. am 23.07.2003. Bucur, A., Renold, C. & Henke, M. (1999). How do older netcitizens compare with their younger counterparts? CyberPsychology and Behavior, 2(6), 505–513. Bundesministerium des Inneren & Bundesministerium der Justiz, BMI & BMJ (Hrsg.). (2001a, Juli). Erster periodischer Sicherheitsbericht – Kurzfassung. Berlin: Eigenverlag. Online im Internet [Portable Document Format (PDF)], URL: http://www.bmi.bund.de > Publikationen > Innere Sicherheit > Erster Periodischer Sicherheitsbericht (Abruf im März 2003). Bundesministerium des Inneren & Bundesministerium der Justiz, BMI & BMJ (Hrsg.). (2001b, Juli). Erster periodischer Sicherheitsbericht – Langfassung. Berlin: Eigenverlag. Online im Internet [Portable Document Format (PDF)], URL: http://www.bmi.bund.de > Publikationen > Innere Sicherheit > Erster Periodischer Sicherheitsbericht (Abruf im März 2003). Cahill S.P., Carrigan, M.H. & Frueh, B.C. (1999). Does EMDR work? And if so, why? A critical review of controlled outcome and dismantling research. Journal of Anxiety Disorders, 13, 5– 33. 317 318 Literatur Call, J. & Pfefferbaum, B. (1999). Lessons from the first two years of Project Heartland, Oklahoma’s mental health response to the 1995 bombing. Psychiatric Services, 50, 953–955. Campbell, R.S. & Pennebaker, J.W. (2003). The secret life of pronouns: Flexibility in writing style and physical health. Psychological Science, 14(1), 60–65. Carlson, J.G., Chemtob, C.M., Rusnak, K., Hedlund, N.L. & Muraoka, M.Y. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing (EDMR) treatment for combat-related posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 11, 3–24. Carr, V., Lewin, T., Kenardy, J., Webster, R., Hazell, P., Carter, G., et al. (1997). Psychosocial sequelae of the 1989 Newcastle earthquake: III. Role of vulnerability factors in post-disaster morbidity. Psychological Medicine, 27, 179–190. Carr, V., Lewin, T., Webster, R., Hazell, P., Kenardy, J. & Carter, G. (1995). Psychological sequelae of the 1989 Newcastle earthquake: I. Community disaster experiences and psychological morbidity 6 months post-disaster. Psychological Medicine, 25, 539–555. Ceci, S.J., Loftus, E., Leichtman, M. & Bruck, M. (1994). The possible role of source misattributions in the creation of false beliefs among preschoolers. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 47, 304–320. Chambless, D.L., Baker, M.I., Baucom, D.H., Beutler, L.E., Calhoun, K.S. & Woody, S.R. (1998). Update on empirically validated therapies. Clinical Psychologist, 51, 3–16. Chemtob, C.M., Nakashima, J. & Carlson, J.G. (2002). Brief treatment for elementary school children with disaster-related posttraumatic stress disorder: A field study. Journal of Clinical Psychology, 58(1), 99–112. Chou, F.H., Su, T.T., Ou-Yang, W.C., Chien, I.C., Lu, M.K. & Chou, P. (2003). Establishment of a disaster-related psychological screening test. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37(1), 97–103. Cohen, N.L. (1997). Lessons learned from providing disaster counselling after TWA flight 800. Psychiatric Services, 48, 461–462. Connor, K.M. & Davidson, J.R. (1999). Further psychometric assessment of the TOP-8: A brief interview-based measure of PTSD. Depression and Anxiety, 9, 135–137. DIMDI – Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2003). ICD-10GM 2004: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision – German Modification Version 2004. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. Dalgleish, T., Joseph, S., Trasher, S., Tranah, T. & Yule, W. (1996). Crisis support following the Harald of Free Enterprise disaster: A longitudinal perspective. Journal of Traumatic Stress, 9, 833–845. DeWolfe, D. (2000). Field manual for mental health and human service workers in major disasters. Washington, DC: US Department of Health and Human Services. Deblinger, E. & Heflin, A.H. (1996). Treating sexually abused children and their nonoffending parents. Thousand Oaks, CA: Sage. Deblinger, E., Steer, R.A. & Lippmann, J. (1999). Two-year follow-up study of cognitive and behavioural therapy for sexually abused children suffering post-traumatic stress symptoms. Child Abuse & Neglect, 23, 1271–1378. Deblinger, E., Taub, B., Maedel, A.B., Lippmann, J. & Stauffer, L.B. (1997). Psychosocial factors predict-ing parent reported symptomatology in sexually abused children. Journal of Child Sexual Abuse, 6, 35–49. Deppa, J. & Sharp, N.W. (1991). Tragedy in the news – Pan Am 103 under international scrutiny: Reactions of media targets. American Behavioral Scientist, 35, 150–165. Literatur Deppermann, A. & Lucius-Hoene, G. (2005). Trauma erzählen – kommunikative, sprachliche und stimmliche Verfahren der Darstellung traumatischer Erlebnisse. Psychotherapie und Sozialwissenschaft, 7, 35–73. Deutsche Bahn AG. (2001). Abschlussbericht des Ombudsmannes der Deutschen Bahn AG [unveröffentlichter interner Bericht]. Deutsche Bahn AG. Deutsche Bahn AG, Geschäftsstelle „Eschede-Hilfe“. (1999). Organisation der psychologischen und sozialen Betreuung der Deutschen Bahn AG. In E. Hüls & H.-J. Oestern (Hrsg.), Die Katastrophe von Eschede. Erfahrungen und Lehren – Eine interdisziplinäre Analyse (S. 131–135). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Devilly, G.J. & Spence, S.H. (1999). The relative efficacy and treatment distress of EMDR and a cognitive-behavior trauma protocol in the amelioration of post traumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 13, 131–157. Dick, G. & Dick-Ramsauer, U. (1996). Erste Hilfe in der Psychotherapie. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Dickenberger, D., Gniech, G. & Grabitz, H.-J. (1993). Die Theorie der psychologischen Reaktanz. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie, Band I: Kognitive Theorien (S. 243–274). Bern: Verlag Hans Huber. Drell, M.J., Siegel, C.H. & Gaensbauer, T.J. (1993). Post-traumatic stress disorder. In C.H. Zeanah (Ed.), Handbook of Infant Mental Health (pp. 291–304). New York, NY: Guilford Press. Echebura, E., de Corral, P., Sarasua, B. & Zubizarreta, I. (1996). Treatment of acute posttraumatic stress disorder in rape victims: An experimental study. Journal of Anxiety Disorders, 10, 185–199. Ehlers, A. (1999). Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C.J. Hogrefe. Ehlers, A. & Clark, D.M. (2000). A Cognitive Model of Persistent Post Traumatic Stress Disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 319–345. Ehlers, A., Maercker, A. & Boos, A. (2000). Predictors of chronic PTSD following political imprisonment: The role of mental defeat, alienation, and perceived permanent change. Journal of Abnormal Psychology, 109, 45–55. Ehlers, A. & Steil, R. (1995). Maintenance of intrusive memories in posttraumatic stress disorders: A cognitive approach. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 23, 217–249. Ehlers, A., Steil, R., Winter, H. & Foa, E.B. (1996). Deutsche Übersetzung der Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS). Oxford: University, Warneford Hospital. Eschenröder, C. (Hrsg.). (1997). EMDR. Eine neue Methode zur Verarbeitung traumatischer Erinnerungen. Tübingen: DGVT-Verlag, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Esterling, B.A., Antoni, M.H., Fletcher, M.A., Marguiles, S. & Schneiderman, N. (1994). Emotional disclosure through writing or speaking modulates Epstein-Barr virus antibody titers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 10, 334–350. Everly, G.S. & Mitchell, J.T. (1999). Critical Incident Stress Management (2nd Edition). Ellicott City: Chevron Publishing. Everly, G.S. & Mitchell, J.T. (2002). CISM, Stressmanagement nach kritischen Ereignissen. Wien: Facultas. 319 320 Literatur Fein, R., Vossekuil, B., Pollac, B., Borum, R., Modzeleski, W. & Reddy, M. (2002). Threat Assessment in Schools: A Guide to Managing Threatening Situations and to Creating Save School Climates. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of Elementary and Secondary Education, Safe and Drug-Free Schools Program and U.S. Secret Service, National Threat Assessment Center. Figley, C.R. (1985). From Victim to Survivor: Social Responsibility in the Wake of Catastrope. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and it’s wake (pp. 398–416). New York, NY: Brunner/Mazel. Fischer, G., Bering, R., Hartmann, C. & Schedlich, C. (2000). Prävention und Behandlung von Psychotraumen. Untersuchungen des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr, 35, 13– 54. Fischer, G., Hammel, A. & Lehnen, R. (2002). Psychotraumatologische Betreuung der Betroffenen der Zugunglücke von Eschede und Brühl. Abschlussbericht für die Deutsche Bahn AG. Köln, Much: Deutsches Institut für Psychotraumatologie. Fischer, G. & Riedesser, P. (1998). Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Reinhard Verlag (UTB). Flatten, G., Hofmann, A., Liebermann, P., Wölled, W., Siol, T. & Petzold, E. (2001). Posttraumatische Belastungsstörung. Leitlinie und Quellentext. Stuttgart: Schattauer. Foa, E.B. (1997). Trauma and women: course, predictors, and treatment. Journal of Clinical Psychiatry, 58(Suppl. 9), 25–28. Foa, E.B. (2001). A comparison of prolonged exposure and prolonged exposure plus cognitive restructuring in female assault victims with PTSD: Preliminary findings. Paper presented at World Congress of Cognitive and Behavior Therapy, Vancouver, British Columbia. Foa, E.B., Cashman, L., Jaycox, L. & Perry, K. (1997). The validation of a self-report measure of PTSD: The Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS). Psychological Assessment, 9, 445–451. Foa, E.B., Dancu, C.V., Hembree, E.A., Jaycox, L.H., Meadows, E.A. & Street, G.P. (1999). A comparison of exposure therapy, stress inoculation training, and their combination for reducing post traumatic stress disorder in female assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 194–200. Foa, E.B., Hearst-Ikeda, D. & Perry, K.J. (1995). Evaluation of a brief cognitive-behavioral program for the prevention of chronic PTSD in recent assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 948–955. Foa, E.B., Keane, T.M., Friedman, M.J. & Matthews, J. (2000). Effective treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress. New York, NY: Guilford Press. Foa, E.B. & Kozak, M.J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to correcting information. Psychological Bulletin, 99, 20–35. Foa, E.B. & Riggs, D.S. (1993). Post traumatic stress disorder in rape victims. In J. Oldham, M.B. Riba & A. Tasman (Eds.), American Psychiatric Press Review of Psychiatry, Vol. 12 (pp. 273–303). Washington: American Psychiatric Press. Foa, E.B. & Riggs, D.S. (1994). Posttraumatic stress disorder and rape. In R.S. Pynoos (Ed.), Posttraumatic Stress Disorder: A Clinical Review (pp. 133–163). Baltimore: Sidran Press. Foa, E.B. & Rothbaum, B.O. (1996). Posttraumatische Belastungsstörungen. In J. Margraf (Hrsg.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 2 (S. 107–120). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Foa, E.B. & Rothbaum, B.O. (1998). Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD. New York, NY: Guilford Press. Literatur Foa, E.B., Rothbaum, B.O., Riggs, D.S. & Mordock, T.B. (1991). Treatment of posttraumatic stress disorder in rape victims: A comparison between cognitive behavioral procedures and counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 715–723. Foa, E.B., Steketee, G.S. & Rothbaum, B.O. (1989). Behavioral/cognitive conceptualization of post traumatic stress disorder. Behavior Therapy, 20, 155–176. Foa, E.B., Tolin, D.F., Ehlers, A., Clark, D.M. & Orsillo, S.M. (1999). The posttraumatic cognitions inventory (PTCI): Development and validation. Psychological Assessment, 11, 303– 314. Fontana, A. & Rosenheck, R. (1994). Traumatic war stress and psychiatric symptoms among World War II, Korean, and Vietnam War veterans. Psychology and Aging, 9, 27–33. Franke, G. (1995). Die Symptom-Checkliste von Derogatis. Deutsche Version. Göttingen: Beltz Test. Frankl, V.E. (1973). Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Freiburg: Herder. Fuchs, M., Lamnek, S. & Luedtke, J. (2001). Tatort Schule: Gewalt an Schulen 1994–1999. Auf der Grundlage von Erhebungen in Bayern. Opladen: Leske + Budrich. Funk, W. (1995). Gewalt an Schulen: Ergebnisse aus dem Nürnberger Schüler-Survey. In S. Lamnek (Hrsg.), Jugend und Gewalt. Devianz und Kriminalität in Ost und West (S. 119– 138). Opladen: Leske + Budrich. Garrison, C., Weinrich, M., Hardin, S., Weinrich, S. & Wang, L. (1993). Post-traumatic stress disorder in adolescents after a hurricane. American Journal of Epidemiology, 138, 522–530. Giaconia, R.M., Reinherz, H.Z., Silverman, A.B., Pakiz, B., Frost, A.K. & Cohen, E. (1995). Traumas and Posttraumatic Stress Disorder in a community population of older adults. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1369–1380. Gillespie, D. & Murty, S. (1994). Cracks in a postdisaster service delivery network. American Journal of Community Psychology, 22, 639–660. Gleser, G., Green, B. & Winget, C. (1981). Prolonged psychological effects of disaster: A study of Buffalo Creek. San Diego, CA: Academic Press. Goenjian, A., Molina, L., Steinberg, A., Fairbanks, L.A., Alverez, M., Goenjian, H., et al. (2001). Posttraumatic stress and depressive reactions among Nicaraguan adolescents after Hurricane Mitch. American Journal of Psychiatry, 158, 788–794. Goenjian, A., Pynoos, R.S., Steinberg, A.M., Najarian, L.M., Asarnow, J.R., Karayan, I., Ghurabi, M. & Fairbanks, L.A. (1995). Psychiatric co-morbidity in children after the 1988 earthquake in Armenia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1174–1184. Grahame, M., Laberge, J. & Scialfa, C.T. (2004). Age differences in search of web pages: The effects of link size, link number, and clutter. Human Factors, 46(3), 385–398. Green, B.L., Friedman, M., De Jong, J., Solomon, S., Keane, T., Fairbank, J., Donelan, B. & Frey-Wouters, E. (Eds.). (2003). Trauma in War and Peace: Prevention, Practice, and Policy. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Green, B.L., Grace, M.C., Lindy, J.D., Titchener, J. & Lindy, J.G. (1983). Levels of functional impairment following a civilian disaster: The Beverly Hills super club fire. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 573–580. Green, B.L. & Lindy, J.D. (1994). Posttraumatic stress disorder in victims of disaster. Psychiatric Clinic of North America, 17, 301–309. Greenwald, R. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): New hope for children suffering from trauma and loss. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 3, 279– 287. 321 322 Literatur Grubitzsch, S. (1991). Testtheorie – Testpraxis. Psychologische Tests und Prüfverfahren im kritischen Überblick. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag. Gschwend, G. (2002). Notfallpsychologie und Trauma-Akuttherapie – Ein kurzes Handbuch für die Praxis. Bern, Göttigen, Toronto: Verlag Hans Huber. Hahlweg, K. (1996). Fragebogen zur Partnerschaftsdiagnostik (FDP). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C.J. Hogrefe. Hand, I. (1993). Expositionsbehandlung. In M. Linden & M. Hautzinger (Hrsg.), Verhaltenstherapie (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 139–150). Berlin, Heidelberg: SpringerVerlag. Havenaar, J., Rumyantzeva, G., van den Brink, W., Poelijoe, N., van den Bout, J., van Engeland, H., et al. (1997). Long-term mental health effects of the Chernobyl disaster: An epidemiologic survey in two former Soviet regions. American Journal of Psychiatry, 154, 1605– 1607. Helmerichs, J. (1999). Einsatznachsorge beim ICE-Unglück in Eschede. In E. Hüls & H.-J. Oestern (Hrsg.), Die Katastrophe von Eschede. Erfahrungen und Lehren – Eine interdisziplinäre Analyse (S. 119–124). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Helmerichs, J. (2003). Nachsorge für Einsatzkräfte beim ICE-Unglück in Eschede. In M. Zielke, R. Meermann & W. Hackhausen (Hrsg.), Das Ende der Geborgenheit? (S. 97–115). Lengerich: Pabst Verlag. Herrle, J. (1998). Soziale Unterstützungsnetzwerke im psychotherapeutischen Kontext. In B. Röhrle, G. Sommer & F. Netsmann (Hrsg.), Netzwerkorientierte Interventionen (S. 51–75). Tübingen: DGVT-Verlag, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Hessel, A., Schumacher, J., Geyer, M. & Braehler, E. (2001). Symptom-Checkliste SCL-90-R: Testtheoretische Überprüfung und Normierung an einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe. Diagnostica, 47(1), 27–39. Hobfoll, S. & Lilly, R. (1993). Resource conservation as a strategy for community psychology. Journal of Community Psychology, 21, 128–148. Hodgkinson, P.E. (1990). The Zeebrugge disaster III: Psychological care in the UK. Disaster Management, 2, 131–134. Hodgkinson, P.E. & Shepherd, M.A. (1994). The impact of disaster support work. Journal of Traumatic Stress, 7, 587–600. Hodgkinson, P.E. & Stewart, M. (1998). Coping with catastrophe: A handbook of post-disaster psychosocial aftercare (2nd edition). Florence, KY: Taylor and Francis/Routledge. Hofmann, A. (1999). EMDR in der Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome. Stutgart: Georg Thieme Verlag. Holen, A. (1993). The North Sea oil rig disaster. In J.P. Wilson & B. Raphael (Eds.), International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (chap. 39, pp. 471–479). New York, NY: Plenum Press. Horowitz, M.J. (1976). Stress response syndromes. New York, NY: Jason Aronson. Horowitz, M.J. & Reidbord, S.P. (1992). Memory, emotion, and the response to trauma. In S.A. Christianson (Ed.), The Handbook of Emotion an Memory: Research and Therapy (pp. 343–357). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. Horowitz, M.J., Wilner, N. & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A Measure of Subjective Stress. Psychosomatic Medicine, 41, 209–218. Horowitz, M.J., Wilner, N., Kaltreider, N. & Alvarez, W. (1980). Sign and symptoms of posttraumatic stress disorder. Archives of General Psychiatry, 37, 85–92. Literatur Hyer, L., Stanger, E. & Boudewyns, P. (1999). The Interaction of Posttraumatic Stress Disorder and Depression Among Older Combat Veterans. Journal of Clinical Psychology, 55(9), 1073–1083. Hyman, I.E. & Loftus, E.F. (1998). Errors in autobiographical memory. Clinical Psychology Review, 18, 933–947. Hüls, E. (1999). Einsatz Rettungsdienst. In E. Hüls & H.-J. Oestern (Hrsg.), Die Katastrophe von Eschede. Erfahrungen und Lehren – Eine interdisziplinäre Analyse (S. 3–68). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Hüls, E. & Oestern, H.J. (Hrsg.). (1999). Die Katastrophe von Eschede. Erfahrungen und Lehren – Eine interdisziplinäre Analyse. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Ironson, G., Freund, B., Strauss, J.L. & Williams, J. (2002). Comparison of two treatments for traumatic stress: A community-based study of EMDR and prolonged exposure. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 113–128. Jacobson, E. (1990). Entspannung als Therapie. Progressive Relaxation in Theorie und Praxis. München: Pfeiffer. Janoff-Bulman, R. (1985). The aftermath of victimisation: Rebuilding shattered assumptions. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and it’s wake (pp. 15–35). New York, NY: Brunner/Mazel. Jatzko, H., Jatzko, S. & Seidlitz, H. (1995). Das durchstoßene Herz – Ramstein 1988. Beispiel einer Katastrophen-Nachsorge. Edewecht: Stumpf & Kassendey. Jatzko, S. (2003). Opfer und Hinterbliebene: Erfahrungen in der Betreuung von Opfern nach Großkatastrophen. In M. Zielke, R. Meermann, W. Hackhausen (Hrsg.), Das Ende der Geborgenheit? (S. 136–155). Lengerich: Pabst Verlag. Johnson, C.H., Gilmore, J.D. & Shenoy, R.Z. (1982). Use of a feeding procedure in the treatment of a stress-related anxiety disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 13, 235–237. Jones, D. (1985). Secondary disaster victims: The emotional effects of recovering and identifying human remains. American Journal of Psychiatry, 142, 303–307. Joseph, S., Yule, W., Williams, R. & Hodgkinson, P. (1994). Correlates of posttraumatic stress at 30 month. The Harold of Free Enterprise disaster. Behavior Research and Therapie, 32, 521–524. Kaniasty, K. & Norris, F. (1993). A test of the support deterioration model in the context of natural disaster. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 395–408. Kaniasty, K., Norris, F. & Murrell, S. (1990). Perceived and received social support following natural disaster. Journal of Applied Social Psychology, 20, 85–114. Katz, C.L., Pellegrino, L., Pandya, A., Ng, A. & DeLisi, L.E. (2002). Research on psychiatric outcomes and interventions subsequent to disasters: A review of the literature. Psychiatry Research, 110, 201–217. Keane, T.M., Fairbank, J.A., Caddel, J.M. & Zimering, R.T. (1989). Implosive (flooding) therapy reduces symptoms of PTSD in Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 20, 245–260. Keane, T.M. & Kaloupek, D.G. (1982). Imaginal Flooding in the treatment of a Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology 50(1), 138–140. Keane, T.M., Weathers, F.W. & Foa, E.B. (2000). Diagnosis and assessment. In E.B. Foa, T.M. Keane, M.J. Friedman, J. Matthews (Eds.), Effective treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress (pp. 18–36). New York, NY: Guilford Press. 323 324 Literatur Kemmler, R.W. (2003). Krisenmanagement in der zivilen Luftfahrt. In M. Zielke, R. Meermann & W. Hackhausen (Hrsg.), Das Ende der Geborgenheit? (S. 156–159). Lengerich: Pabst Verlag. Kessler, R.C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M. & Nelson, C.B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity sample. Archives of General Psychiatry, 52, 1048– 1060. King, N.J., Tonge, B.J., Mullen, P., Myerson, N., Heyne, D. & Ollendick, T.H. (1999). Cognitivebehavioural treatment of sexually abused children: A review of research. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 27, 295–309. King, N.J., Tonge, B.J., Mullen, P., Myerson, N., Heyne, D., Rollings, S., Martin, R. & Ollendick, T.H. (2000). Treating sexually abused children with posttraumatic stress symptoms: A randomized clinical trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 1347–1355. Koloska, R., Rehm, J. & Fichter, M.M. (1989). Ist die Beschwerden-Liste valide? Diagnostica, 35(3), 248–259. Koopman, C., Classen, C., Cardena, E. & Spiegel, D. (1995). When disaster strikes, acute stress disorder may follow. Journal of Traumatic Stress, 8, 29–46. Koopman, C., Classen, C. & Spiegel, D. (1994). Predictors for posttraumatic stress symptoms among survivors of the Oakland/Berkely, California, Firestorm. American Journal of Psychiatry, 151, 888–894. Koopman, C., Classen, C. & Spiegel, D. (1996). Dissociative responses in the immediate aftermath of the Oakland/Berkeley California firestorm. Journal of Traumatic Stress, 9, 521–540. Koordinierungsstelle Einsatznachsorge (Hrsg.). (2002). Hilfe für Helfer. Einsatznachsorge nach dem ICE-Unglück in Eschede: Dokumentation – Modelle – Konsequenzen. Hannover: Pinkvoss Verlag. Korol, M., Green, B.L. & Gleser, G.C. (1999). Children's responses to a nuclear waste disaster: PTSD symptoms and outcome prediction. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 368–375. La Greca, A.M. (2001). Children experiencing disasters: Prevention and intervention. In J.N. Hughes, A.M. La Greca & J.C. Conley (Eds.), Handbook of Psychological Services for Children and Adolescents (pp.195–222). Oxford: Oxford University Press. La Greca, A.M., Silverman, W.K., Vernberg, E.M. & Prinstein, M.J. (1996). Symptoms of posttraumatic stress in children after Hurrican Andrew: A prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 712–723. Lamnek, S. (1995). Jugend und Gewalt – A never ending Story. In S. Lamnek (Hrsg.), Jugend und Gewalt – Devianz und Kriminalität in Ost und West (S. 11–24). Opladen: Leske + Budrich. Lamprecht, F., Lempa, W. & Sack, M. (2000). Die Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörungen mit EMDR. Psychotherapie im Dialog 1/2000, 45–51. Lande, S.D. (1982). Physiological and subjective measures of anxiety during flooding. Behavior Research and Therapy, 20, 81–88. Levin, P., Lazrove, S. & van der Kolk, B. (1999). What Psychological Testing and Neuroimaging Tell Us about the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder by Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Journal of Anxiety Disorders, 13, 159–172. Lin, D.Y.M. (2003) Age differences in the performance of hypertext perusal as a function of text topology. Behaviour and Information Technology, 22(4), 219–226. Literatur Lindemann, E. (1944). Symptomatology and Management of Acute Grief. American Journal of Psychiatry, 101, 141–148. Lindemann, E. (1985). Jenseits von Trauer – Beiträge zur Krisenbewältigung und Krankheitsverarbeitung. Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen. Lindy, J.D., Green. B.L., Grace, M. & Titchener, J. (1983). Psychotherapy with survivors of the Beverley Hills super club fire. American Journal of Psychotherapy, 37, 593–610. Litcher, L., Bromet, E., Carlson, G., Squires, N., Goldgaber, D., Panina, N., Golovakha, E. & Gluzman, S. (2000). School and neuropsychological performance of evacuated children in Kyiv 11 years after the Chernobyl disaster. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41(March 2000), 291–299. Litz, B., Gray, M., Bryant, R. & Adler, A. (2002). Early intervention for trauma: Current status and future directions. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 112–134. Loges, W.E. & Jung, J.Y. (2001). Exploring the digital divide: Internet connectedness and age. Communication Research, 28, 536–562. Lucius-Hoene, G. (1998). Erzählen von Krankheit und Behinderung. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 48, 108–113. Lucius-Hoene, G. (2002). Narrative Bewältigung von Krankheit und Coping-Forschung. Psychotherapie und Sozialwissenschaft, 4, 166–203. Maercker, A. (2003a). Besonderheiten bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 37–52). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Maercker, A. (2003b). Erscheinungsbild, Erklärungsansätze und Therapieforschung. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 3–36). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Maercker, A. & Herrle, J. (2003). Long-term effects of the Dresden bombing: Relationships to control beliefs, religious belief, and personal growth. Journal of Traumatic Stress, 16, 579– 587. Maercker, A. & Müller, J. (2004). Social acknowledgment as a victim or survivor: A scale to measure a recovery factor of PTSD. Journal of Traumatic Stress, 17, 345–451. Maercker, A. & Schützwohl, M. (1998). Erfassung von psychischen Belastungsfolgen: Die Impact of Event Skala – revidierte Version (IES-R). Diagnostica, 44(3), 130–141. Maercker, A., Schützwohl, M. & Beauducel, A. (2000). Trauma severity and initial reactions as precipitating factors for posttraumatic stress disorder and chronic dissociation. Journal of Traumatic Stress, 13, 651–660. Maercker, A. & Zöllner, T. (2002). Life-Review-Therapie als spezifische Form der Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörung im Alter. Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 23, 213–226. Maes, M., Mylle, J., Delmeire, L. & Altamura, C. (2000). Psychiatric morbidity and comorbidity following accidental man-made traumatic events: Incidence and risk factors. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 250, 156–162. March, J.S., Amaya-Jackson, L. & Pynoos, R.S. (1997). Pediatric Posttraumatic Stress Disorder. In J.M. Wiener (Ed.), Textbook of Child & Adolescent Psychiatry (2nd edition, pp. 507– 524). Washington, DC: American Psychiatric Press. Marcus, S.V., Marquis, P. & Sakai, C. (1997). A controlled study of treatment of PTSD using EMDR in an HMO setting: A clinical outcome study for post-traumatic stress disorder. Psychotherapy, 34(3), 307–315. 325 326 Literatur Margraf, J. (Hrsg.). (1996). Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 1. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Margraf, J. & Ehlers, A. (1995). Das Beck-Angst-Inventar. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Margraf, J. & Schneider, S. (1990). Panik. Angstanfälle und ihre Behandlung (2., überarbeitete Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Margraf, J., Schneider, S. & Ehlers, A. (1994). Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen: DIPS (2. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Marmar, C.R., Weiss, D.S. & Metzler, T. (1997). The peritraumatic dissociative experience questionaire. In J.P. Wilson & T.M. Keane (Eds.), Assessing Psychological Trauma on PTSD: A practioners handbook (pp. 412–428). New York, NY: Guilford Press. Marmar, C.R., Weiss, D.S. & Metzler, T.J. (1998). Peritraumatic dissociation and posttraumatic stress disorder. In J.D. Bremner & C.R. Marmar (Eds.), Trauma, Memory, and Dissociation (pp. 229–247). Washington, DC: American Psychiatric Press. Marmar, C.R., Weiss, D.S., Metzler, T.J. & Delucci, K.L. (1996). Characteristics of emergency service personnel related to peritraumatic dissociation during critical incident exposure. American Journal of Psychiatry, 153(7), 94–192. Marmar, C.R., Weiss, D.S., Metzler, T.J., Delucci, K.L., Best, S.R. & Wentworth, K.A. (1999). Longitudinal course and predictors of continuing distress following critical incident exposure in emergency service personnel. Journal of Nervous and Mental Disease, 187, 15–22. Martini, D.R., Ryan, C. Nakayama, D. & Ramenofsky, M. (1990). Psychiatric sequelae after traumatic injury: The Pittsburgh Regatta accident. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 29, 70–75. Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality (Reviewed edition). New York, N.Y.: Harper & Row. Mathes, R., Gärtner, H.D. & Czaplicki, A. (1991). Kommunikation in der Krise. Anatomie eines Medienereignisses. Das Grubenunglück in Borken. Frankfurt am Main: Institut für Medienentwicklung (IMK). Mayou, R.A., Ehlers, A. & Hobbs, M. (2000). Psychological debriefing for road traffic accident victims. British Journal of Psychiatry, 176, 589–593. McCarroll, J., Fullerton, C., Ursano, R. & Hermsen, J. (1996). Posttraumatic stress symptoms following forensic dental identification: Mt. Carmel, Waco, Texas. American Journal of Psychiatry, 153, 778–782. McFarlane, A.C. (1986a). Long-term psychiatric morbidity after a natural disaster: Implications for disaster planners and emergency services. Medical Journal of Australia, 145, 561–563. McFarlane, A.C. (1986b). Victims of trauma and the news media. Medical Journal of Australia, 145, 664. McFarlane, A.C. (1987). Posttraumatic phenomena in a longitudinal study of children following a natural disaster. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 26, 764–769. McFarlane, A.C. (1988). The aetiology of posttraumatic stress disorders following a natural disaster. British Journal of Traumatic Stress, 5, 575–588. McFarlane, A.C. (1989). The aetiology of posttraumatic morbidity: Predisposing, precipitating and perpetuating factors. British Journal of Psychiatry, 154, 221–228. McFarlane, A.C. (1990). The Australian disaster: The 1983 bushfires. International Journal of Mental Health, 19, 36–47. Literatur Meichenbaum, D. (1986). Warum führt die Anwendung der Imagiation in der Psychotherapie zur Veränderung? In J.L. Singer & K.S. Pope (Hrsg.), Imaginative Verfahren in der Psychotherapie (S. 453–468; Original: The power of human imagination, New York, 1978). Paderborn: Junfermann Verlag. Meichenbaum, D. (1994). A Clinical Handbook/Practical Therapist Manual for Assessing And Treating Adults with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Waterloo, Ontario, Canada: Department of Psychology, Institute Press. Meltzer-Brody, S., Churchill, E. & Davidson, J.R.T. (1999). Derivation of the SPAN, a brief diagnostic screening test for post-traumatic stress disorder. Psychiatry Research, 88, 63–70. Merten, R. & Scherr, A. (Hrsg.). (2004). Inklusion und Exklusion in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Mitchell, J.T. (1983). When disaster strikes: the critical incident stress debriefing process. Journal of Emergency Medical Services, 8, 36–39. Mitchell, J.T. & Everly, G.S. (1996). Critical Incident Stress Debriefing: An Operations Manual for the Prevention of Traumatic Stress among Emergency Services and Disaster Workers. Ellicott City: Chevron Publishing. Morgan, I., Matthews, G. & Winton, M. (1995). Coping and personality as predictors of posttraumatic intrusions, numbing, avoidance and distress: A study of victims of the Perth Flood. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 251–64. Morgan, L., Scourfield, J., Williams, D., Jasper, A. & Lewis, G. (2003). The Aberfan disaster: A thirty three-year follow-up of the survivers. British Journal of Psychiatry, 182, 532–536. Morrell, R.W., Mayhorn, C.B. & Bennett, J. (2000). A survey of World Wide Web use in middleaged and older adults. Human Factors, 42(2), 175–182. Mulvey, E.P. & Cauffmann, E. (2001). The Inherent Limits of Predicting School Violence. American Psychologist, 56(10), 797–802. Muris, P. & Merckelbach, H. (1999). Eye movement desensitization and reprocessing. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 7–8. Müller, J., Beauducel, A., Raschka, J. & Maercker, A. (2000). Kommunikationsverhalten nach politischer Haft in der DDR – Entwicklung eines Fragebogens zum Offenlegen der Traumaerfahrungen. Zeitschrift für Politische Psychologie, 8, 413–427. Nader, K.O., Blake, D.D., Kriegler, J.A. & Pynoos, R.S. (1994). Clinician Administered PTSD Scale for Children (CAPS-C). Current and lifetime Diagnosis Version, and Instruction Manual. Los Angeles, CA: UCLA, Neuropsychiatric Institute and National Center for PTSD. Nader, K.O., Pynoos, R.S., Fairbanks, L.A. & Frederick, C. (1990). Children’s PTSD reactions one year after a sniper attack in their school. American Journal of Psychiatry, 147, 1526– 1530. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). (2005). National Clinical Practice Guideline No 26: Post-traumatic Stress Disorder – The Management of PTSD in Adults and Children in Primary and Secondary Care [Report]. Online im Internet [Portable Document Format (PDF)], URL: http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=262397 (Abruf Oktober 2005). Nettles, S., Mucherah, W. & Jones, D. (2000). Understanding resilience: The role of social resources. Journal of Education for Students Placed at Risk, 5, 47–60. Norris, F.H. (1990). Screening for traumatic stress: A scale for use in the general population. Journal of Applied Social Psychology, 20(20), 1704–1718. Norris, F.H., Friedman, M.J. & Watson, P.J. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part II. Summary and Implications of the Disaster Mental Health Research. Psychiatry, 65(3), 240– 260. 327 328 Literatur Norris, F.H., Friedman, M.J., Watson, P.J., Byrne, C.M., Diaz, E. & Kaniasty, K. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part I. An empirical review of the empirical literature, 1981–2001. Psychiatry, 65(3), 207–239. Norris, F.H. & Kaniasty, K. (1996). Received and perceived social support in times of stress: A test of the social support deterioration deterrence model. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 498–511. Norris, F.H., Kaniasty, K., Conrad, M.L., Inman, G.L. & Murphy, A.D. (2002). Placing age differences in cultural context: A comparison of the effects of age on PTSD after disasters in the U.S., Mexico, and Poland. Journal of Clinical Geropsychology, 8, 153–173. Norris, F.H., Perilla, J., Riad, J., Kaniasty, K. & Lavizzo, E. (1999). Stability and change in stress, resources, and psychological distress following natural disaster: Findings from Hurricane Andrew. Anxiety, Stress, and Coping, 12, 363–396. Norris, F.H. & Uhl, G. (1993). Chronic stress as a mediator of acute stress: The case of Hurricane Hugo. Journal of Applied Social Psychology, 23, 1263–1284. North, C., Smith, E. & Spitznagel, E. (1997). One-year follow-up of survivors of a mass shooting. American Journal of Psychiatry, 154, 1696–1702. North, C., Spitznagel, E. & Smith, E. (2001). A prospective study of coping after exposure to a mass murder episode. Annals of Clinical Psychiatry, 13, 81–87. Nyberg, E. & Frommberger, U. (1998). Clinician Administered PTSD Scale (CAPS). Freiburg: Universitätsklinik. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford, UK: Blackwell Publishing. Olweus, D. (1997). Täter-Opfer-Probleme in der Schule: Erkenntnisstand und Interventionsprogramm. In H.G. Holtappels, W. Heitmeyer, W. Melzer & K.-J. Tillmann (Hrsg.), Forschung über Gewalt an Schulen: Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention (S. 281–298). Weinheim: Juventa Verlag. Orner, R. (2003). Coping and adjustment strategies used by emergency services personnel. European Psychotherapy, 4 (Special Edition), 123. Orner, R. & Schnyder, U. (Eds.). (2003). Reconstructing early interventions after trauma. Oxford: University Press. Osnabrügge, G., Stahlberg, D. & Frey, D. (1993). Die Theorie der kognizierten Kontrolle. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie, Band III: Motivations- und Informationsverarbeitungstheorien (S. 127–174). Bern: Verlag Hans Huber. Paton, D., Violanti, J.M. & Smith, L.M. (Eds.). (2002). Promoting capabilities to manage posttraumatic stress. Perspectives on resilience. Springfield, IL: Charles C. Thomas. Pennebaker, J.W. (1985). Traumatic experience and psychosomatic disease: Exploring the roles of behavioural inhibition, obsession, and confiding. Canadian Psychology, 26, 82–95. Pennebaker, J.W., Barger, S.D. & Tiebout, J. (1989). Disclosure of traumas and health among Holocaust survivors. Psychosomatic Medicine, 51, 577–589. Pennebaker, J.W. & Beall, S.K. (1986). Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease. Journal of Abnormal Psychology, 95, 274–281. Pennebaker, J.W., Colder, M. & Sharp, L.K. (1990). Accelerating the coping process. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 528–537. Pennebaker, J.W., Kiecolt-Glaser, J.K. & Glaser, R. (1988). Disclosure of traumas and immune function: Health implications for psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 239–245. Literatur Pennebaker, J.W. & Seagal, J.D. (1999). Forming a story: The health benefits of narrative. Journal of Clinical Psychology, 55(10), 1243–1254. Pennebaker, J.W. & Traue, H.C. (1993). Inhibition and psychosomatic processes. In H.C. Traue & J.W. Pennebaker (Eds.), Emotion Inhibition and Health (pp. 146–163). Kirkland, WA: Hogrefe & Huber Publishers. Perrin, S., Smith, P. & Yule, W. (2000). Practitioner Review: The assessment and treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 277–289. Peterson, K.C., Prout, M.F., & Schwarz, R.A. (Eds.). (1991). Post-traumatic stress disorder: A clinician's guide. New York: Plenum Press. Phifer, J. (1990). Psychological distress and somatic symptoms after natural disaster: Differential vulnerability among older adults. Psychology and Aging, 5, 412–420. Phifer, J., Kaniasty, K. & Norris, F. (1988). The impact of natural disaster on the health of older adults: A multiwave prospective study. Journal of Health and Social Behavior, 29, 65–78. Phifer, J. & Norris, F. (1989). Psychological symptoms in older adults following disaster: Nature, timing, duration, and course. Journal of Gerontology: Social Science, 44, 207–217. Pieper, G. (2001). Befragungsbogen zu persönlichen Zielen, Teil 1: Festlegung, und Teil 2: Einschätzung der Zielerreichung [unveröffentlichtes Untersuchungsinstrument für die Meißener Datenerhebung]. Friebertshausen: Georg Pieper. Pieper, G. (2003). Betreuung von Katastrophenopfern am Beispiel der Explosionskatastrophe im Braunkohlebergbau Borken. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 205–219). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Pieper, G. & Maercker, A. (1999). Männlichkeit und Verleugnung von Hilfsbedürftigkeit nach berufsbedingten Traumata (Polizei, Feuerwehr, Rettungspersonal). Verhaltenstherapie, 9, 222–229. Pieper, G. & Schwarz, H., et al. (1991). Phasen der Traumabewältigung. Siebenstufige Skala zur Einschätzung der Bewältigung von Unglück und Verlust nach traumatischen Erlebnissen. In Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe (Hrsg.), Nach der Katastrophe. Das Grubenunglück von Borken – Ein Erfahrungsbericht über drei Jahre psychosoziale Hilfe (S. 135ff.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Pieper, G. (in Druck). Posttraumatische Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen. In W. Hiller & S. Sulz (Hrsg.), Lehrbuch der Psychotherapie, Bd. 4: Verhaltenstherapie mit Kindern, Jugendlichen und Familien. München: CIP-Medien-Verlag. Pillemer, D.B. (1998). What is remembered about early childhood events? Clinical Psychology Review, 18, 895–913. Quintyn, L., De Winne, J. & Hodgkinson, P.E. (1990). The Zeebrugge disaster II: The disaster victim identification team – procedures and psychological support. Disaster Management, 2, 128–130. Raphael, R., Lundin, T. & Weisaeth, L. (1989). A Research Method for the Study of Psychological and Psychiatric Aspects of Disaster. Acta Psychiatrica Scandinavica, 88(Suppl. 353), 1– 75. Rauch, S., van der Kolk, B.A., Fisler, R., Alpert, N., Orr, S., Savage, C., Jenike, M. & Pitman, R. (1996). A symptom provocation study using positron emission tomography and script driven imagery. Archives of General Psychiatry, 53, 380–387. Reddemann, L. (2001). Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren [Leben lernen 141]. Stuttgart: Pfeiffer. 329 330 Literatur Reddemann, L. & Sachsse, U. (1997). Stabilisierung. In O.F. Kernberg, P. Buchheim, B. Dulz (Hrsg.), Persönlichkeitsstörungen – Theorie und Therapie, Band 1, Persönlichkeitsstörungen und der Körper (S. 113–147). Stuttgart: Schattauer. Remschmidt, H. & Walter, R. (1989). Evaluation kinder- und jugendpsychiatrischer Versorgung. Analysen und Erhebungen in drei hessischen Landkreisen. Stuttgart: Enke Verlag. Rief, W., Greitemeyer, M. & Fichter, M.M. (1991). Die Symptom Check List SCL-90 R: Überprüfung an 900 psychosomatischen Patienten. Diagnostica, 37(1), 58–65. Rose, S., Bisson, J. & Wesseley, S. (2001). Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews [Online version]. Rose, S., Brewin, C., Andrews, B. & Kirk, M. (1999). A randomized controlled trial of individual psychological debriefing for victims of violent crime. Psychological Medicine, 29, 793–799. Rostampour, P. & Melzer, W. (1997). Täter-Opfer-Typologien im schulischen Gewaltkontext. Forschungsergebnisse unter Verwendung von Cluster-Analyse und multinomialer logistischer Regression. In H.G. Holtappels, W. Heitmeyer, W. Melzer & K.-J. Tillmann (Hrsg.), Forschung über Gewalt an Schulen: Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention (S. 169–190). Weinheim: Juventa Verlag. Rothbaum, B.O. (1997). A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of posttraumatic stress disordered sexual assault victims. Bulletin of the Menninger Clinic, 61, 317–334. Rothbaum, B.O., Foa, E.B. & Hembree, E.A. (2003). Kognitive Verhaltenstherapie bei posttraumatischen Belastungsstörungen. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 75–90). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Rothbaum, B.O., Meadows, E.A., Resick, P. & Foy, D.W. (2000). Cognitive Behavioral Therapy. In E.B. Foa, T.M. Keane & M.J. Friedman (Eds.), Effective Treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies (pp. 60–83). New York, NY: Guilford Press. Sack, M., Lempa, W. & Lamprecht, F. (2001). Metaanalyse der Studien zur EMDR-Behandlung von Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie, 51, 350–355. Sack, W.H., McSharry, S., Clarke, G.N., Kinney, R., Seeley, J. & Lewinsohn, P. (1994). The Khmer Adolescent Project, I: Epidemiologic findings in two generations of Cambodian refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 182(7), 387–395. Saß, H., Wittchen, H.-U. & Zaudig, M. (1998). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen, DSM-IV (2., verbesserte Auflage). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C.J. Hogrefe. Schacter, D.L. (1995). Memory distortion: How minds, brains, and societies reconstruct the past. Cambridge: Harvard University Press. Scheck, M.M., Schaeffer, J.A. & Gillette, C.S. (1998). Brief psychological intervention with traumatized young women: the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Traumatic Stress, 11, 25–44. Scheeringa, M.S., Zeanah, C.H., Drell, M.J. & Larrieu, J.A. (1995). Two approaches to the diagnosis of posttraumatic stress disorder in infancy and early childhood. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 191–200. Schubarth, W. (1995). Gewalt an Schulen im Spiegel aktueller Schulstudien. In S. Lamnek, (Hrsg.), Jugend und Gewalt. Devianz und Kriminalität in Ost und West (S. 139–154). Opladen: Leske + Budrich. Literatur Schubarth, W., Darge, K., Mühl, M. & Ackermann, C. (1997). Im Gewaltausmaß vereint? Eine vergleichende Schülerbefragung in Sachsen und Hessen. In H.G. Holtappels, W. Heitmeyer, W. Melzer & K.-J. Tillmann (Hrsg.), Forschung über Gewalt an Schulen: Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention (S. 101–118). Weinheim: Juventa Verlag. Schützwohl, M. (2003). Diagnostik und Differentialdiagnostik. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 53–73). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Seybold, K. (1991). Ich will immer darüber reden. Ein Vergleich der Katastrophen-Nachsorge nach den Unglücken von Herborn, Borken und Ramstein. Kontakte, ZDF, 1991. Shannon, M.P., Lonigan, C.J., Finch, A.J. & Taylor, C.M. (1994). Children exposed to disaster I: Epidemiology of post-traumatic symptoms and symptom profiles. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 80–91. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for posttraumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principals, protocols and procedures. New York, NY: Guilford Press. Shaw, J., Applegate, B. & Schorr, C. (1996). Twenty-one-month follow-up study of school-age children exposed to Hurricane Andrew. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 359–364. Sherman, J.J. (1998). Effects of psychotherapeutic treatments for PTSD: a meta-analysis of controlled clinical trials. Journal of Traumatic Stress, 11, 413–435. Siebenthal, R. v. (2003). Gute Geschäfte mit dem Tod. Wie die Medien mit den Opfern von Katastrophen umgehen. Basel: Opinio Verlag. Silver, C.R., Holman, A., McIntosh, D.N., Poulin, M. & Gil-Rivas, V. (2002). Nationwide longitudinal study of psychological responses to September 11. Journal of the American Medical Association, 288, 1235–1244. Slone, M. (2000). Responses to media coverage of terrorism. Journal of Conflict Resolution, 44, 508–522. Smith, D., Christiansen, E., Vincent, R. & Hann, N. (1999). Population effects of the bombing of Oklahoma City. Journal of the Oklahoma State Medical Association, 92, 193–198. Snyder, H. & Sickmund, M. (1999). Juvenile offenders and victims: 1999 national report. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Solomon, S. (2002). Gender differences in response to disaster. In G. Weidner, S. Kopp & M. Kristenson (Eds.), Heart Disease: Environment, Stress and Gender. NATO Science Series I: Life and Behavioural Sciences, Vol. 327. Amsterdam: IOS Press. Solomon, S., Bravo, M., Rubio-Stipec, M. & Canino, G. (1993). Effect of family role on response to disaster. Journal of Traumatic Stress, 6, 255–269. Solomon, Z. (1985). Stress, social support and affective disorders in mothers of pre-school children: A test of the stress-buffering effect of social support. Social Psychiatry, 20, 100–105. Somasundaram, D., Norris, F., Asukai, N. & Murthy, R. (in press). Natural and technological disasters. In B.L. Green, M. Friedman, J. de Jong, S. Solomon, T. Keane, J. Fairbank, B. Donelan & E. Frey-Wouters (Eds.), Trauma in War and Peace: Prevention, Practice, and Policy. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Sommer, G. & Fydrich, T. (1989). Soziale Unterstützung: Diagnostik, Konzepte, F-SOZU. Tübingen: DGVT-Verlag, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. 331 332 Literatur Spitzer, C., Freyberger, H.J., Stieglitz, R.D., Carlson, E.B., Kuhn, G., Magdeburg, N. & Kessler, C. (1998). Adaptation and psychometric properties of the german version of the Dissociative Experience Scale. Journal of Traumatic Stress, 11, 799–809. Spitzer, C., Mestel, R., Klingelhöfer, J., Gänsicke, M. & Freyberger, H.J. (2004). Screening und Veränderungsmessung dissoziativer Psychopathologie. Psychometrische Charakteristika der Kurzform des Fragebogens zu dissoziativen Symptomen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 54, 165–172. Staabs, G. von. (1978). Der Scenotest. Beitrag zur Erfassung unbewusster Problematik und charakterologischer Struktur in Diagnostik und Therapie. Bern, Göttigen, Toronto: Verlag Hans Huber. Steil, R. (2002). Abschlussbericht über die psychodiagnostische Untersuchung der Schülerinnen und Schüler am Gutenberg-Gymnasium Erfurt nach dem Amoklauf vom 26.04.2001 [unveröffentlichter Bericht für die Therapeuten des Betreuungsprojekts].Jena: Universität Jena. Steil, R. (2003). Posttraumatische Belastungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 281–307). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Steil, R. (2004). Posttraumatische Belastungsstörung. In S. Schneider (Hrsg.), Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen: Grundlagen und Behandlung (S. 275–310). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Steil, R. & Ehlers, A. (1997). Posttraumatische Diagnoseskala, Fragebogen zu den Folgen eines belastenden Ereignisses [unveröffentlichtes Manuskript]. Jena: Universität Jena. Steil, R., Ehlers, A. & Clark, D.M. (2003). Kognitive Aspekte bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörungen. In A. Maercker (Hrsg.), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen (2., überarbeitete und ergänzte Auflage, S. 91–105). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Steil, R., Gundlach, P. & Müller, S. (1998). Die deutsche Übersetzung der Clinician Administered PTSD Scale für Kinder und Jugendliche [Fragebogen und Handanweisung für den Interviewer] [Unveröffentlichtes Manuskript; Originalpublikation: K.O. Nader, D.D. Blake, J.A. Kriegler & R.S. Pynoos (1994), Clinician Administered PTSD Scale for Children (CAPS-C)]. Jena: Universität Jena. Steil, R., Hempt, A. & Deffke, I. (2001). PTSD in children and adolescents. Vortrag auf dem Weltkongress der Association for the Advancement of Behavior Therapy, Vancouver, Canada, 17.–21.07.2001. Steinglass, P. & Gerrity, E. (1990). Natural disaster and posttraumatic stress disorder: Shortterm versus long-term recovery in two disaster-affected communities. Journal of Applied Social Psychology, 20, 1746–1765. Stork, J. (1996). Fragebogen zur Beurteilung der Suizidgefahr (FBS). Mödling: Dr. G. Schuhfried GmbH. Sund, A., Weisaeth, L., Holen, A. & Malt, U. (1985). Ulykker, katastrofer og stress. Psykiske reaksjoner, hjelp og beredskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Task Force on Crisis and Disaster. (2005). Report of the EFPA Task Force on Disaster, Crisis and Trauma Psychology to the General Assembly July 2005, in Grananda, Spain [Report]. Online im Internet [Portable Document Format (PDF)], URL: http://www.efpa.be/doc/Report Network SG for GA 2005.pdf (Abruf Oktober 2005). Taylor, S. & Thordarson, D.S. (2002). Behavioural treatment of post-traumatic stress disorder associated with recovered memories. Cognitive Behavior Therapy, 31(1), 8–17. Literatur Teegen, F. (2003). Posttraumatische Belastungsstörungen bei gefährdeten Berufsgruppen. Bern: Verlag Hans Huber. Teegen, F. (2004). Psychosoziale Betreuung nach Großschadensereignissen. In J. Bengel (Hrsg.), Psychologie in Notfallmedizin und Rettungsdienst (2., vollständig neu bearbeitete Auflage, S. 115–133). Berlin: Springer-Verlag. Teegen, F. & Grotwinkel, M. (2001). Traumatische Erfahrungen und Posttraumatische Belastungsstörungen bei Journalisten. Eine internet-basierte Studie. Psychotherapeut, 46, 169– 175. Terr, L. (1989). Treating psychic trauma in children. Journal of Traumatic Stress, 2, 3–20. Thompson, J.A., Charlton, P.F., Kerry, R., Lee, D. & Turner, S.W. (1995). An open trial of exposure therapy based on deconditioning for post-traumatic stress disorder. British Journal of Clinical Psychology, 34(Sept. 1995), 407–416. Thompson, M., Norris, F. & Hanacek, B. (1993). Age differences in the psychological consequences of Hurricane Hugo. Psychology and Aging, 8, 606–616. Thornton, L. (2000). The assessment of posttraumatic stress reactions in children and adolescents. In K.N. Dwivedi (Eds.), Posttraumatic Stress Disorder in Children and Adolescents (pp. 113–130). London: Whurr Publishers. Tillmann, K.-J. (1997). Gewalt an Schulen – öffentliche Diskussion und erziehungswissenschaftliche Forschung. In H.G. Holtappels, W. Heitmeyer, W. Melzer & K.-J. Tillmann (Hrsg.), Forschung über Gewalt an Schulen: Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention (S. 11–26). Weinheim: Juventa Verlag. Tillmann, K.-J., Holler-Nowitzki, B., Holtappels, H.G., Meier, U. & Popp, U. (1999). Schülergewalt als Schulproblem. Verursachende Bedingungen, Erscheinungsformen und pädagogische Handlungsperspektiven. Weinheim: Juventa Verlag. Udwin, O., Boyle, S., Yule, W., Bolton, D. & O’Ryan, D. (2000). Risk factors for long-term psychological effects of a disaster experienced in adolescence: Predictors of PTSD. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 969–979. Uhlmann, C., Hughes, C. & Pennebaker, J.W. (1995). Schreiben über traumatische Erlebnisse: Der Zusammenhang zwischen verbalem Ausdruck und autonomer Aktivität. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 3, 84–93. Unnewehr, S., Schneider, S. & Margraf, J. (1995). Kinder-DIPS. Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. Ursano, R., Fullerton, C., Kao, T. & Bhartiy, V. (1995). Longitudinal assessment of posttraumatic stress disorder and depression after exposure to traumatic death. Journal of Nervous and Mental Disease, 183, 36–42. Veronen, L.J. & Kilpatrick, D.G. (1982). Stress inoculation training for victims of rape: Efficacy and differential findings. Paper presented at the Sixteenth Annual Convention of the Association for the Advancement of Behavior Therapy, Los Angeles. Vossekuil, B., Fein, R., Reddy, M., Borum, R. & Modzeleski, W. (2002). The Final Report and Findings of the Safe School Initiative: Implications for the Preventions of School Attacks in the Unites States. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of Elementary and Secondary Education, Safe and Drug-Free Schools Program and U.S. Secret Service, National Threat Assessment Center. Wagner, U. & van Dick, R. (2000). Der Umgang mit Aggression und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Einige psychologische Anmerkungen. Aus Politik und Zeitgeschichte, 19–20, 34–38. 333 334 Literatur Walter, C. (2003). Risikofaktoren psychischer Beeinträchtigung nach Banküberfällen: Validierung und Adaptierung des Kölner Risiko-Index für die spezielle Situation von Banküberfällen. Berlin: WiKu-Verlag. Wasserstein, S. & La Greca, A. (1998). Hurricane Andrew: Parent conflict as a moderator of children’s adjustment. Hispanic Journal of Behavioral Science, 20, 212–24. Weisaeth, L. (1997). Präventive psychosoziale Interventionen nach einer Katastrophe. In T. Sporner (Hrsg.), Stressbewältigung und Psychotraumatologie im humanitären Hilfseinsatz (S. 226–244). Bonn: Betan. Weltgesundheitsorganisation, WHO. (1993). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (2., korrigierte und bearbeitete Auflage; deutsche Bearbeitung von H. Dilling, W. Mombour, M.H. Schmidt & E. Schulte-Markwort). Bern, Göttigen, Toronto: Verlag Hans Huber. Wiersma, D., DeJong, A. & Ormel, J. (1988). The Groningen Social Disabilities Schedule: Development, relationship with I.C.I.D.H., and psychometric properties. International Journal of Rehabilitation Research, 11, 213–224. Wilson, S.A., Becker, L.A. & Tinker, R.H. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychological trauma. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 928–937. Wilson, S.A., Becker, L.A. & Tinker, R.H. (1997). Fifteen-month follow-up of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for posttraumatic stress disorder and psychological trauma. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 1047–1056. World Health Organization, WHO. (1999). Psychosocial consequences of disasters. Prevention and management. MNH/PSF/91, 3, Rev. 1. Geneva: WHO Division of Mental Health. World Health Organization, WHO. (2001). Mental health in emergencies. MSD/MER/03.01. Geneva: WHO Division of Mental Health. Young, B.H., Ford, J.D., Ruzek, J.I., Friedman, M.J. & Gusman, F.D. (1998). Disaster mental health service. A guidebook for clinicians and administrators. Palo Alto: National Center for PTSD. Young, M.A. & Stein, J.H. (1994). Responding to community crisis. In M.B. Williams, J.F. Sommer (Eds.), Handbook of Posttraumatic Therapy (pp. 283–298). Westport: Greenwood Press. Yule, W., Bolton, D., Udwin, O., O’Ryan, D. & Nurrish, J. (2000). The long-term psychological effects of a disaster experienced in adolescence: I. The incidence and course of PTSD. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 503–511. Zerssen, D. von & Koeller, D.M. (1976). Die Beschwerden-Liste [Testmappe mit Manual und je 20 Fragebögen der Formen B-L, B-L' und B-L0. Klinische Selbstbeurteilungs-Skalen (KSB-S) aus dem Münchener Psychiatrischen Informations-System (PSYCHIS München)]. Weinheim: Beltz/Psychologie-Verlags-Union. Zola, S.M. (1998). Memory, amnesia, and the issue of recovered memory: Neurobiological aspects. Clinical Psychology Review, 18, 915–932. van Etten, M.L. & Taylor, S. (1998). Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 5, 126–144. van der Kolk, B.A., Burbridge, J.A. & Suzuki, J. (1997). The psychobiology of traumatic memory: Clinical implications of neuroimaging studies. In R. Yehuda, A.C. McFarlane (Eds.), Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 821: Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder (pp. 99–113). New York Academy of Sciences. van der Kolk, B.A. & Fisler, R.E. (1995). Dissociation and the perceptual nature of traumatic memories: Review and experimental confirmation. Journal of Traumatic Stress, 8, 505–525. Literatur van der Kolk, B.A. & McFarlane, A.C. (2000). Trauma – ein schwarzes Loch. In B.A. van der Kolk, A.C. McFarlane & L. Weisaeth (Hrsg.), Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze (S. 27–45). Paderborn: Junfermann Verlag. van der Kolk, B.A., van der Hart, O. & Marmar, C.R. (2000). Dissoziation und Informationsverarbeitung beim posttraumatischen Belastungssyndrom. In B.A. van der Kolk, A.C. McFarlane & L. Weisaeth (Hrsg.), Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze (Kap. 11, S. 241–261). Paderborn: Junfermann Verlag. van der Ploeg, H.M. & Kleijn, W.C. (1989). Being held hostage in The Netherlands. A study on long-term aftermath. Journal of Traumatic Stress, 3, 153–169. Zola, S.M. (1998). Memory, amnesia, and the issue of recovered memory: Neurobiological aspects. Clinical Psychology Review, 18, 915–932. 335 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.1: Gedenkstätte auf dem Gelände der ehemaligen Grube Stolzenbach Gedenkstätte Stolzenbach, Bronzering: Ein zwölfteiliger Bronzering symbolisiert die Lebensuhr. Umgeben ist er von einem Kreis aus 12 Bergahornbäumen. In den Ring sind die Namen aller im Borkener Braunkohlerevier verunglückten Bergleute eingraviert. Dazu ein Spruch: „Die Toten sind Teil unseres Lebens, so wie jeder Teil der Natur dem Leben dient / Vergänglichkeit ist unser aller irdisches Los, und doch ist das Leben nicht mit dem Tode des einzelnen beendet.“ Gedenkstätte Stolzenbach, Detail: Eine Gesteinsschichtenfolge aus Züschener Sandstein zeigt bildhauerisch gestaltete Motive aus dem Bergwerksalltag. Im Bild: Die heilige Barbara hält schützend ihre Hand über einen unter Tage eingeschlossenen Bergmann. Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.2: Bericht der Witwe eines beim Unglück umgekommenen Bergmanns „Bis dass der Tod Euch scheidet“ Es war vor 4 Jahren, oder war es gestern? Noch immer habe ich den Geruch verbrannter Kohle in der Nase, wenn ich daran denke. Am 1. Juni 1988. Es war gegen 13.00 Uhr, als ich nach vielen Bemühungen den Zechenhof betreten durfte. Ich habe Angst, Angst vor dem, was mich hier erwartet. Angst! Alles, was ich weiß, ist: Eine Explosion. Wie kann das sein? Er hat mir doch immer gesagt, so etwas passiert nur im Steinkohleabbau. Niemals hier bei uns. Worte fallen mir ein, Sätze, die er einmal gesagt hat. „Lkw-Fahren ist gefährlicher.“ Ich weiß, dass ihm nichts passiert ist, weil er viel von seinem Beruf versteht, weil er stark ist und erfahren und weil er für alles immer eine Lösung findet. Irgendwie. Ich laufe herum und suche ihn. Als ich den Kollegen treffe, der in dieser Woche mit ihm zusammenarbeitet, fällt mir ein Stein vom Herzen, und ich laufe zu ihm hin. Er dreht sich langsam zu mir um, und ich sehe in sein Gesicht. Er braucht mir nichts zu sagen, ich weiß es auch so. Er ist noch unten. Ziellos laufe ich hin und her, um jemanden zu finden, der mir etwas genaues sagen kann, aber man weicht meinem Blick aus und geht an mir vorbei. „Wir haben einen Raum hergerichtet für die Angehörigen, dort können Sie sich setzen und warten“ sagt irgend jemand. Ich versuche es, fünf Minuten oder zehn. Man kann nicht sitzen und warten. Vielleicht gibt es irgendwo eine Schaufel zum Graben. Ich muss doch etwas tun können. Irgend etwas, um ihn dort unten herauszuholen, ihm zu helfen. Er kann verletzt sein und mich brauchen, oder frieren. Eine Decke müsste ich ihm bringen können. Dass er lebt, daran glaube ich ganz fest. Wenn man sich liebt, dann spürt man, wenn der andere stirbt. Und wir lieben uns. Seit achtzehn Jahren, als wir uns versprachen, einer ist für den anderen da in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Und jetzt laufe ich herum und kann nichts, gar nichts für ihn tun, nur warten. Warten. Nach und nach kommen noch andere Frauen, Angehörige, Mütter und Väter, Söhne und Töchter. Gesichter, in denen Ruß und Tränen Spuren hinterlassen haben. Ich halte Hände von Leuten, die ich nicht mal kenne und ich spüre, dass mir das gut tut. Zu zweit weint es sich leichter, doch der Stein, der auf dem Herzen liegt und der Kloß im Hals werden auch vom Weinen nicht kleiner. Neben mir steht eine junge Frau, die mir bestimmt zum zehnten Mal erzählt, dass sie doch bald heiraten will. Überall sind Fotografen auf der Jagd nach verzweifelten Menschen, um möglichst „gute“ Fotos zu machen. Auf der Flucht vor ihnen gehe ich wieder in den Raum für die Angehörigen. Hier ist es noch schlimmer. Viele weinen. Türkische Frauen klagen laut ihren ganzen Schmerz heraus. Ich versuche zu trösten und spüre, dass meine Worte für mich selbst bestimmt sind. Nur nicht aufgeben! Irgendwann wird es offiziell. Der Betriebsleiter gibt uns einen Bericht über die Rettungsarbeiten. Voller Hoffnung hören wir zu, aber plötzlich redet er von Toten, die man gefunden hat und dass die Chance, Lebende zu finden, gleich Null ist. Lange brauche ich, um zu begreifen. Ganz langsam wird mir kalt und übel und ich will zur Toilette, um mich zu übergeben, aber meine Beine bewegen sich nicht mehr. Gedanken schießen mir durch den Kopf. Bilder aus den letzten 18 Jahren. Mein halbes Leben habe ich mit ihm verbracht, geliebt, gelacht und geweint. Er darf nicht tot sein! Man will mich nach Hause bringen, es sei schon spät, und ich müsse an meine Kinder denken, die mich brauchen. Ich lasse mich heimfahren, um dort zu warten mit der Familie. Wir haben gewartet, gebetet und verzweifelt gehofft. Mehr als drei Tage lang. Mehr als 80 Stunden, bis ich ihn sehen durfte: Am Samstag, den 4. Juni 1988 um 23.00 Uhr… 338 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.3: Brief eines verletzten Bergmanns, der zusätzlich durch das Unglück seinen Sohn verloren hat 339 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.3: Brief eines verletzten Bergmanns, der zusätzlich durch das Unglück seinen Sohn verloren hat (Forts.) 340 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.3: Brief eines verletzten Bergmanns, der zusätzlich durch das Unglück seinen Sohn verloren hat (Forts.) 341 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.4: Bild eines 10-jährigen Jungen, der seinen Vater verloren hat, drei Jahre nach dem Unglück Drei Jahre nach dem Unglück: Gökhan, 10 Jahre alt, zeichnet die Gedenkstätte Stolzenbachhilfe. Bei seinem Besuch der Gedenkstätte hat Gökhan eine ganz besondere Form der Kontaktaufnahme mit seinem tödlich verunglückten Vater gewählt. Seine Mutter hatte Gökhan zuvor eingeschärft, sich auf dem Gelände der Gedenkstätte anständig zu benehmen und sich auf keinen Fall auf den Bronzering mit dem Namen seines Vaters zu setzen. Gökhan aber geht zielstrebig auf den Bronzering zu, sucht den Namen seines Vaters und setzt sich direkt darauf – mit zufriedenem, beruhigtem Gesicht. Auf die Frage, wie er sich jetzt fühlt, antwortet er mit einem befreiten Lächeln: „Guuut.“ Mit einem sicheren Gespür dafür, was er für seine Trauerbewältigung braucht, setzt sich Gökhan über das Verbot der Mutter hinweg. Allerdings ist das Verbot nicht gänzlich unwirksam. Es setzt sich im Bild um, als ein besonderes Verbotsschild, das Gökhan für die Gedenkstätte erfindet: „Nicht drauf setzen!“ 342 Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial Abbildung A.5: Bild eines 7-jährigen Mädchen, das seinen Vater verloren hat, drei Jahre nach dem Unglück Drei Jahre nach dem Unglück: Sabine, 7 Jahre alt, zeichnet die Gedenkstätte Stolzenbach. Beeindruckt ist Sabine von der Darstellung der Szenen aus dem Bergarbeiterleben. Die Szene, in der der Vater sich von seiner Familie verabschiedet, beschäftigt sie besonders. Das Bild stellt einerseits den ganz normalen, alltäglichen Abschied des Vaters auf dem Weg zur Arbeit dar. Zugleich zeigt es für Sabine aber eben auch einen endgültigen Abschied. Der Bronzering mit den Namen aller in der Grube Stolzenbach verunglückten Bergleute ist für Sabine fast genauso wichtig. Hier sucht und findet sie den Namen ihres Vaters – und hält ihn im Bild noch einmal fest. 343 Tabelle A-1: Schematische Übersicht über die Phasen der Trauerbewältigung (nach Peterson, Prout & Schwarz, 1991) Phasen der Trauerbewältigung Trauerbewältigung (TB) 1 – pathologische TB 2 – sehr schwierige TB 3 – problematische TB 4 – durchlaufene TB 5 – gelungene TB 6 – gut gelungene TB 7 – voll gelungene TB Stichwort vermeiden umgehen sträuben hinnehmen suchen ausprobieren Lösen/verwirklichen Auseinandersetzung mit dem Unglück: … wird unbedingt vermieden … wird vermieden … wird möglichst vermieden … und den eigenen Gefühlen wird als notwendig anerkannt. … und den eigenen weitgehend abgeGefühlen wird gesucht schlossen abgeschlossen. Erinnerungen an das Un– glück können hervorgeholt u. beiseite gestellt werden Der Verlust: nicht wahrhaben wollen … wird nicht verarbeitet sträubt sich gegen das … wird hingenommen Akzeptieren bemüht sich zu begreifen akzeptiert den Verlust u. hadert nicht mit dem Schicksal A Unglück/Verlust B Alltag/Kontakte Alltagsanforderungen: werden kaum bewältigt die wichtigsten werden werden weitgehend bewältigt bewältigt werden bewältigt versucht, sich als verlassene Person zu akzeptieren zusätzlich: Alltagsprob- neue Lösungen leme werden aktiv werden ausprobiert angegangen eigenständige Bewältigung der Alltagsprobleme ist erreicht. Kontakte: sich von der Umwelt abschließen weitgehender Rückzug Kontaktaufnahme von anderen wird als Störung empfunden Kontaktaufnahme von Kontakte werden anderen wird zugelas- allgemein gesucht sen offen für Kontakte, alte aktive KontaktaufnahBeziehungen werden me mit neuem Rollenwieder aufgenommen verständnis C Körper/Psyche voll ausgeprägte PTSD – Depression u.a. komorbide Störungen deutliche Anzeichen von PTSD – starke Somatisierung Anzeichen von PTSD – phasen- o. problemabhängiges Somati– sieren ausgebrannt – passiv – kraft- u. initiativlos – anfällig für Erkrankungen achtet auf Alarmzeiprobiert aktiv neue chen des Körpers – Lebensqualitäten aus sucht nach Möglichkeiten, es sich besser gehen zu lassen Traurigkeit kann gelebt werden – neue Lebensfreude/neuer Lebenswille wachsen D Freizeit/Entspannung keine zielgerichteten Aktivitäten möglich Überaktivität oder Lähmung gönnt sich keine Freizeit passiver Konsum z.B. TV, mitgenommen werden sucht nach (neuen) Möglichkeiten der Gestaltung nimmt alte Aktivitäten auf, probiert neue aus aktive Freizeitgestaltung mit neuem Rollenverständnis E Zukunft keine Perspektive für wenig bis keine Zueigenständiges Leben, kunftsperspektive lebt in der Vergangenheit wenig Zukunftsperspektive kaum Zukunftsperspektive Zukunftsperspektive in der Phantasie vorhanden, keine Kraft o. Mut, sie umzusetzen Zukunftsperspektive vorhanden, erste Schritte zur Verwirklichung unternommen neue Lebensperspektive ist entwickelt, in deren Verwirklichung befindlich KTE – Kontrollierte Traumaexposition für PTBS-Patienten 1. Faktenphase Name: Datum: „Was ist passiert?“ — „Wer war beteiligt?“ — „Was war Ihre Funktion oder Rolle?“ W-Fragen stellen Gefühle flach halten „Emotionale Schleife“: Gefühle kurz begleiten, und immer wieder auf die kognitive Ebene und zu den Fakten zurückführen Wir wollen bis ins Detail wissen, was geschehen ist. Alles. Ereignis bis zu einem eindeutigen abschließenden „Ruhepol“ nach dem Ereignis explorieren 2. Symptomphase „Unter welchen Beschwerden leiden Sie?“ — a) körperlich — b) psychisch 3. Verhaltensphase „Welche neuen Verhaltensweisen / Verhaltensänderungen sind nach dem Trauma aufgetreten?“ — „Haben sich Ihre sozialen Kontakte verändert? — „Gibt es Situationen oder Orte, die Sie seitdem vermeiden? Gibt es neue oder veränderte Verhaltensweisen? Beachte vor allem: Sozialer Rückzug & Vermeidungsverhalten? 4. Bewertungsphase Irrationale Schuldgefühle? Überlebensschuld? Nie direkt nach „Schuld“ fragen! 5. Zusammenfassung „Bitte lehnen Sie sich zurück und kontrollieren Sie mich, ob ich alles richtig verstanden habe!“ — „Korrigieren Sie mich bitte sofort, wenn ich etwas nicht richtig wiederhole!“ Rollentausch: Der Therapeut fasst den „Trauma-Film“ zusammen Emotionen empathisch wieder spiegeln, besonders betonen 6. Individuelles Trauma „Wie bewerten Sie Ihr eigenes Verhalten?“ — „Wie denken Sie über ihre Rolle?“ Wichtig: Das Schlimmste erfragen Abschließend: Bewältigung = Mit dem Trauma leben lernen „Was war für Sie das Schlimmste / Verletzendste / Erniedrigendste?“ Anhang A: Begleit- und Untersuchungsmaterial 346 Anhang B: Borken – Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.1: Psychometrische Skalen-Kennwerte der Fragebögen der BorkenStudie Skala Varianzaufklärung … nach Revision PTB-2 Hauptfaktor 65,3% — 66 .86 .82 .82 66 Beschwerden-Liste, Form B-L 29,42% — 46 .90 .92 .93 39 Form B-L, Faktor „Erschöpfung“ Form B-L, Faktor „Anspannung“ Gesamt 25,15% 13,47% 38,62% 25,17% 14,97% 40,14% 46 46 .89 .79 .90 .80 .91 .81 39 39 Beschwerden-Liste, Form B-L‘ 28,59% — 46 .88 .90 .91 32 Form B-L‘, Faktor „Anspannung“ Form B-L‘, Faktor „Erschöpfung“ Gesamt 20,69% 17,98% 38,67% — — — 46 46 .88 .78 .89 .80 .90 .81 32 32 — — — — — — — — — — — .51 .41 .41 .48 .30 .36 .49 .32 .38 66 66 66 H-L-S 1, „Psychosoziale Einbettung“ H-L-S 2, „Materielle Absicherung“ H-L-S 3, „Soziale Offenheit“ Gesamt 16,25% 13,90% 9,87% 40,02% 18,09% 15,56% 10,93% 44,58% 66 66 66 .72 .78 .44 .80 .86 .54 .81 .86 .56 66 66 66 H-VUV Hauptfaktor 23,18% — 47 .73 .77 .78 47 H-VUV 1, „institutionelle, allgemein zugängliche Hilfsangebote“ H-VUV 2, „Hilfe durch vertraute Personen“ Gesamt 22,51% 24,77% 47 .78 .82 .83 47 11,37% 12,58% 47 .51 .51 .53 47 33,89% 37,35% 47 — — — .74 .81 .82 47 — — — .46 .54 .56 47 H-L-S „Haben“ H-L-S „Lieben“ H-L-S „Sein“ Gesamt H-VUV 1, „institutionelle, allgemein zugängliche Hilfsangeb.“ (Endform) H-VUV 2, „Hilfe durch vertraute Personen“ (Endform) N Cronbachs Guttman … Kristof- N alpha Split-half Korrektur Erläuterungen: Alle Angaben zum H-L-S nach der Fremdwahrnehmungsbedingung 347 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.2: Verwendete psychometrische Maße der Borken-Studie (Skalierung und Art der aggregierten Scores) Instrument Akronym Items Rating Score PTB-2 5 Mittelwert BL/BL' 2 x 24 1–7 (7 = max. pos.) 0–3 (3 = max. neg.) H-L-S 17 H-VUV 13 + 2 wahlfreie (+ 2 Einzel-Items) Fragebogen zu Phasen der Traumabewältigung Beschwerden-Liste Beschwerden-Liste, 2-Faktoren-Lösung Fragebogen zu Haben-Lieben-Sein Fragebogen zu Hilfen bei der Verarbeitung von Unglück und Verlust Tabelle B.3: 0, 1–5 (5 = max. pos.) 0, 1–5 (5 = max. pos.) Summenscore, balanciert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Aufschlüsselung der Borken-Stichprobe nach vorliegenden Daten PTB-2 PTB-2 Item 1, 2. Messung B-L/B-L' H-L-S H-VUV Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern 6 7 30 10 13 4 (2)* 27 (1)* 13 4 (2)* 25 (1)* 13 6 7 30 10 13 4 (2)* 27 (1)* 13 Gesamt 66 47 45 66 47 Erläuterungen: * Gruppen in Klammern werden wegen geringer Größe fallweise ausgeschlossen. 348 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.4a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2; N = 38) Witwen PTB-2 Score PTB-2 U/V (2) Eltern Gesamt M SD M SD M SD k. Teilnahme Teilnahme k. Teilnahme Teilnahme 5.6 5.6 5.7 5.9 (1.1) (0.9) (1.7) (1.1) 4.9 3.8 4.2 4.5 (0.9) (0.3) (1.4) (0.7) 5.3 4.7 5.0 5.2 (1.0) (0.7) (1.5) (0.9) PTB-2 Score PTB-2 U/V (2) 5.6 (1.0) 5.8 (1.4) 4.4 (0.7) 4.4 (1.1) 5.0 (0.8) 5.1 (1.3) k. Teilnahme Teilnahme 5.7 (1.4) 5.8 (1.0) 4.6 (1.2) 4.2 (0.5) 5.1 (1.3) 5.0 (0.8) Gesamt 5.7 (1.2) 4.4 (0.9) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2 (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.4b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2; N = 38) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte PTP-2, Score vs. UV-2 (PTB-2 v1) PTB-2 v1 x T PTB-2 v1 x BG PTB-2 v1 x T x BG Fehler (PTB-2 v1) Power etap2 .755 .003** .538 .061 .867 .093 .003 .227 .011 .14 .710 .065 .004 2.87 .09 1.22 .099 .761 .278 .377 .060 .188 .078 .003 .035 QS df MQS F .19 19.29 .75 65.65 1 1 1 34 .19 19.29 .75 1.93 .10 9.99 .39 .09 1 .09 1.76 .06 .75 20.88 1 1 1 34 1.76 .06 .75 .61 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2 (PTB-2 v1, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 349 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.5a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2; N = 38) Witwen PTB-2 U/V (1) PTB-2 U/V (2) Eltern Gesamt M SD M SD M SD k. Teilnahme Teilnahme k. Teilnahme Teilnahme 5.4 5.4 5.7 5.9 (1.3) (1.5) (1.7) (1.1) 4.0 2.5 4.2 4.5 (1.3) (0.7) (1.4) (0.7) 4.7 4.0 5.0 5.2 (1.3) (1.2) (1.5) (0.9) PTB-2 U/V (1) PTB-2 U/V (2) 5.4 (1.4) 5.8 (1.4) 3.3 (1.1) 4.4 (1.1) 4.4 (1.2) 5.1 (1.3) k. Teilnahme Teilnahme 5.6 (1.5) 5.7 (1.3) 4.1 (1.4) 3.5 (0.7) 4.8 (1.4) 4.6 (1.0) Gesamt 5.6 (1.4) 3.8 (1.1) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2 (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.5b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2; N = 38) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte PTP-2, UV-1 vs. UV-2 (PTB-2 v2) PTB-2 v2 x T PTB-2 v2 x BG PTB-2 v2 x T x BG Fehler (PTB-2 v2) Power etap2 .638 .001** .456 .075 .945 .114 .007 .283 .016 5.29 .028* .608 .135 2.58 1.37 1.37 .118 .249 .249 .345 .207 .207 .071 .039 .039 QS df MQS F .57 34.05 1.45 86.36 1 1 1 34 .57 34.05 1.45 2.54 .23 13.41 .57 5.57 1 5.57 2.72 1.45 1.45 35.81 1 1 1 34 2.72 1.45 1.45 1.05 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2 (PTB-2 v2, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 350 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.6a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, BL' vs. BL; N = 38) Witwen BL' Score BL Score Eltern Gesamt M SD M SD M SD k. Teilnahme Teilnahme k. Teilnahme Teilnahme 42.0 38.1 31.3 26.7 (11.9) (11.5) (16.9) (13.8) 32.9 35.9 26.9 27.0 (18.4) (20.7) (12.7) (14.4) 37.5 37.0 29.1 26.8 (15.5) (16.8) (15.0) (14.1) BL' Score BL Score 40.1 (11.7) 29.0 (15.4) 34.4 (19.6) 27.0 (13.6) 37.2 (16.2) 28.0 (14.5) k. Teilnahme Teilnahme 36.7 (14.6) 32.4 (12.7) 29.9 (15.8) 31.5 (17.8) 33.3 (15.2) 31.9 (15.5) Gesamt 34.5 (13.7) 30.7 (16.9) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (2 Messungen). Nichtorthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.6b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, BL' vs. BL; N = 38) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte BL' vs. BL (BL'/BL) BL'/BL x T BL'/BL x BG BL'/BL x T x BG Fehler (BL'/BL) QS df MQS F p Power etap2 28.10 220.70 125.75 12218.36 1 1 1 34 28.10 220.70 125.75 359.36 .08 .61 .35 .781 .439 .558 .059 .119 .089 .002 .018 .010 1 1279.24 1 12.97 1 48.97 1 4.08 34 57.30 22.33 .23 .86 .07 .000*** .637 .362 .791 .996 .075 .146 .058 .396 .007 .025 .002 1279.24 12.97 48.97 4.08 1948.06 Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (BL'/BL, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 351 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.7a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Anspannung“; N = 38) Witwen BL' Anspannung BL Anspannung Eltern Gesamt M SD M SD M SD k. Teilnahme Teilnahme k. Teilnahme Teilnahme 2.0 1.9 1.2 1.3 (0.4) (0.7) (0.7) (0.7) 1.5 1.7 1.2 1.4 (0.8) (0.7) (0.6) (0.6) 1.8 1.8 1.2 1.3 (0.6) (0.7) (0.6) (0.7) BL' Anspannung BL Anspannung 2.0 (0.6) 1.2 (0.7) 1.6 (0.7) 1.3 (0.6) 1.8 (0.7) 1.3 (0.7) k. Teilnahme Teilnahme 1.6 (0.6) 1.6 (0.7) 1.3 (0.7) 1.6 (0.6) 1.5 (0.6) 1.6 (0.7) Gesamt 1.6 (0.7) 1.5 (0.7) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (2 Messungen). Nichtorthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.7b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Anspannung“; N = 38) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte BL' vs. BL (BL'/BL) BL'/BL x T BL'/BL x BG BL'/BL x T x BG Fehler (BL'/BL) QS df MQS F p Power etap2 .23 .29 .16 25.61 1 1 1 34 .23 .29 .16 .75 .31 .39 .22 .582 .537 .645 .084 .093 .074 .009 .011 .006 4.21 .03 .59 .07 4.57 1 1 1 1 34 4.21 .03 .59 .07 .13 31.27 .22 4.42 .49 1.000 .074 .533 .105 .479 .006 .115 .014 .000*** .643 .043* .488 Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (BL'/BL, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 352 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.8a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Erschöpfung“; N = 37) Witwen BL' Erschöpfung BL Erschöpfung Eltern Gesamt M SD M SD M SD k. Teilnahme Teilnahme k. Teilnahme Teilnahme 1.5 1.2 1.5 1.1 (0.7) (0.5) (0.9) (0.7) 1.1 1.2 1.0 1.0 (0.8) (1.2) (0.6) (0.8) 1.3 1.2 1.2 1.0 (0.7) (0.9) (0.7) (0.7) BL' Erschöpfung BL Erschöpfung 1.3 (0.6) 1.3 (0.8) 1.2 (1.0) 1.0 (0.7) 1.2 (0.8) 1.1 (0.7) k. Teilnahme Teilnahme 1.5 (0.8) 1.1 (0.6) 1.1 (0.7) 1.1 (1.0) 1.3 (0.7) 1.1 (0.8) Gesamt 1.3 (0.7) 1.1 (0.9) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (2 Messungen). Nichtorthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.8b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Erschöpfung“; N = 37) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte BL' vs. BL (BL'/BL) BL'/BL x T BL'/BL x BG BL'/BL x T x BG Fehler (BL'/BL) QS df MQS F p Power etap2 .23 .59 .61 26.09 1 1 1 33 .23 .59 .61 .79 .29 .75 .77 .594 .394 .386 .082 .134 .136 .009 .022 .023 .15 .08 .01 .00 5.44 1 1 1 1 33 .15 .08 .01 .00 .17 .94 .50 .05 .01 .340 .487 .827 .929 .156 .105 .055 .051 .028 .015 .001 .000 Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (BL'/BL, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 353 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.9a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-L-S „Psychosoziale Einbettung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 43) Witwen H-L-S 1 (Fremdwahrn.) k. Teilnahme Teilnahme H-L-S 1 (Selbstwahrn.) k. Teilnahme Teilnahme Eltern Gesamt M SD M SD M SD 3.0 3.5 3.1 3.5 (0.8) (0.9) (0.8) (0.9) 3.4 2.4 3.5 2.5 (0.7) (1.0) (0.6) (0.5) 3.2 3.0 3.3 3.0 (0.8) (1.0) (0.7) (0.7) H-L-S 1 (Fremdwahrn.) H-L-S 1 (Selbstwahrn.) 3.2 (0.9) 3.3 (0.8) 2.9 (0.8) 3.0 (0.6) 3.1 (0.9) 3.1 (0.7) k. Teilnahme Teilnahme 3.0 (0.8) 3.5 (0.9) 3.5 (0.6) 2.5 (0.8) 3.3 (0.7) 3.0 (0.9) Gesamt 3.3 (0.9) 3.0 (0.7) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (2 Messungen). Nichtorthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.9b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: H-L-S „Psychosoziale Einbettung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 43) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S) H-L-S, F/S x T H-L-S, F/S x BG H-L-S, F/S x T x BG Fehler (H-L-S, F/S) Power etap2 .425 .381 .043* .123 .139 .531 .016 .020 .101 1.20 .279 .188 .030 .13 .03 .04 .725 .867 .841 .064 .053 .054 .003 .001 .001 QS df MQS F .82 .99 5.48 49.02 1 1 1 39 .82 .99 5.48 1.26 .65 .78 4.36 .04 1 .04 .00 .00 .00 1.35 1 1 1 39 .00 .00 .00 .03 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 354 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.10a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-L-S „Materielle Absicherung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 43) Witwen H-L-S 2 (Fremdwahrn.) k. Teilnahme Teilnahme H-L-S 2 (Selbstwahrn.) k. Teilnahme Teilnahme Eltern Gesamt M SD M SD M SD 4.3 4.5 4.1 4.4 (0.5) (0.4) (0.7) (0.5) 4.0 2.8 3.7 1.9 (0.4) (0.7) (0.4) (1.2) 4.2 3.6 3.9 3.1 (0.5) (0.6) (0.6) (0.9) H-L-S 2 (Fremdwahrn.) H-L-S 2 (Selbstwahrn.) 4.4 (0.5) 4.2 (0.6) 3.4 (0.6) 2.8 (0.9) 3.9 (0.5) 3.5 (0.8) k. Teilnahme Teilnahme 4.2 (0.6) 4.4 (0.4) 3.9 (0.4) 2.3 (1.0) 4.0 (0.5) 3.4 (0.8) Gesamt 4.3 (0.5) 3.1 (0.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (2 Messungen). Nichtorthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.10b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: H-L-S „Materielle Absicherung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 43) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S) H-L-S, F/S x T H-L-S, F/S x BG H-L-S, F/S x T x BG Fehler (H-L-S, F/S) QS df MQS F 4.71 16.58 8.79 17.28 1 1 1 39 4.71 16.58 8.79 .44 10.64 37.42 19.84 1.49 1 1.49 23.64 .15 .46 .37 2.46 1 1 1 39 .15 .46 .37 .06 2.41 7.34 5.86 Power etap2 .002** .000*** .000*** .889 1.000 .991 .214 .490 .337 .000*** .997 .377 .129 .010* .020* .328 .752 .656 .058 .158 .131 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 355 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.11a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-L-S „Soziale Offenheit“, Fremdvs. Selbstwahrnehmung; N = 43) Witwen H-L-S 3 (Fremdwahrn.) k. Teilnahme Teilnahme H-L-S 3 (Selbstwahrn.) k. Teilnahme Teilnahme Eltern Gesamt M SD M SD M SD 2.2 2.5 2.2 2.4 (0.7) (0.7) (0.8) (0.7) 1.8 2.6 1.8 1.6 (0.8) (0.0) (0.8) (0.6) 2.0 2.6 2.0 2.0 (0.7) (0.5) (0.8) (0.6) H-L-S 3 (Fremdwahrn.) H-L-S 3 (Selbstwahrn.) 2.4 (0.7) 2.3 (0.7) 2.2 (0.6) 1.7 (0.7) 2.3 (0.6) 2.0 (0.7) k. Teilnahme Teilnahme 2.2 (0.7) 2.5 (0.7) 1.8 (0.8) 2.1 (0.4) 2.0 (0.8) 2.3 (0.6) Gesamt 2.4 (0.7) 2.0 (0.6) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (2 Messungen). Nichtorthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.11b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: H-L-S „Soziale Offenheit“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 43) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S) H-L-S, F/S x T H-L-S, F/S x BG H-L-S, F/S x T x BG Fehler (H-L-S, F/S) QS df MQS F p Power etap2 .80 1.72 .01 39.49 1 1 1 39 .80 1.72 .01 1.01 .79 1.70 .01 .378 .200 .924 .140 .246 .051 .020 .042 .000 .92 1 .92 28.14 .000*** .999 .419 .65 .67 .53 1.27 1 1 1 39 .65 .67 .53 .03 20.11 20.61 16.20 .000*** .000*** .000*** .992 .993 .975 .340 .346 .293 Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 356 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.12a: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-VUV Faktor 1, „institutionelle & allgemein zugängliche Hilfsangebote“; N = 40) k. Teilnahme M SD Teilnahme M SD Witwen Eltern 2.1 (0.7) 3.1 (0.8) 2.4 (0.6) 1.9 (1.0) Gesamt 2.6 (0.8) 2.4 (0.8) Gesamt M SD 2.3 (0.7) 2.5 (0.9) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.12b: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: H-VUV Faktor 1, „institutionelle & allgemein zugängliche Hilfsangebote“; N = 40) Quelle der Varianz Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Gesamt QS df MQS F 1.59 .33 3.95 18.28 259.73 1 1 1 36 40 1.59 .33 3.95 .51 3.14 .65 7.79 p .085 .426 .008** Power etap2 .407 .123 .775 .080 .018 .178 Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 357 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.13a: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-VUV Faktor 2, „Hilfe durch vertraute Personen“; N = 40) k. Teilnahme M SD Teilnahme M SD Witwen Eltern 3.3 (0.3) 3.5 (1.1) 2.9 (0.8) 3.2 (0.3) Gesamt 3.4 (0.8) 3.2 (0.7) Gesamt M SD 3.1 (0.6) 3.3 (0.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.13b: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: H-VUV Faktor 2, „Hilfe durch vertraute Personen“; N = 40) Quelle der Varianz Teilnahmebedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Gesamt QS df MQS F p Power etap2 .94 .58 .02 21.70 412.29 1 1 1 36 40 .94 .58 .02 .60 1.55 .96 .04 .221 .335 .850 .228 .159 .054 .041 .026 .001 Erläuterungen: Faktoren: (1) Teilnahme an psychologischer Gruppe (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 358 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.14a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2; N = 42) PTB-2 Score PTB-2 U/V (2) M M SD SD Gerettete Witwen Eltern 6.0 (0.2) 5.6 (0.9) 4.7 (0.9) 7.0 (0.0) 5.9 (1.3) 4.3 (1.3) Gesamt 5.4 (0.8) 5.7 (1.0) Gesamt M SD 6.5 (0.2) 5.7 (1.1) 4.5 (1.1) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (3 Faktorstufen); (2) Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2 (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.14b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/ Messung 2; N = 42) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler Within Subjects-Effekte PTP-2, Score vs. UV-2 (PTB-2 v1) PTB-2 v1 x BG Fehler (PTB-2 v1) Power etap2 .000*** .977 .338 1.44 .237 .216 .036 2.80 .073 .519 .126 QS df MQS F 34.02 66.49 2 39 17.01 1.71 9.98 .84 1 .84 3.26 22.74 2 39 1.63 .58 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen); (2) Phasen der Traumabewältigung, Score vs. Item 1/Messung 2 (PTB-2 v1, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 359 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.15a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2; N = 42) PTB-2 U/V (1) PTB-2 U/V (2) M M SD SD Gerettete Witwen Eltern 5.8 (1.5) 5.4 (1.4) 3.7 (1.4) 7.0 (0.0) 5.9 (1.3) 4.3 (1.3) Gesamt 5.0 (1.4) 5.7 (1.0) Gesamt M SD 6.4 (1.1) 5.7 (1.3) 4.0 (1.3) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (3 Faktorstufen); (2) Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2 (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.15b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2; N = 42) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler Within Subjects-Effekte PTP-2, UV-1 vs. UV-2 (PTB-2 v2) PTB-2 v2 x BG Fehler (PTB-2 v2) Power etap2 .000*** .989 .367 5.96 .019* .663 .133 .58 .567 .139 .029 QS df MQS F 52.95 91.19 2 39 26.48 2.34 11.32 6.42 1 6.42 1.24 42.00 2 39 .62 1.08 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen); (2) Phasen der Traumabewältigung, Item 1/Messung 1 vs. 2 (PTB-2 v2, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 360 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.16a: Einfaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Score; N = 66) Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern M SD 5.9 5.5 5.6 5.5 4.6 (0.7) (1.3) (1.0) (0.6) (1.0) Erläuterungen: Faktor: Betroffenengruppe (5 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design. Tabelle B.16b: Einfaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: Phasen der Traumabewältigung, Score; N = 66) Quelle der Varianz Betroffenengruppe (BG) Fehler Gesamt QS df MQS F 10.62 55.53 1982.08 4 61 66 2.66 .91 2.92 p .028* Power etap2 .753 .161 Erläuterungen: Faktor: Betroffenengruppe (BG, 5 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 361 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.17a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, BL' vs. BL; N = 42) BL' Score M SD BL Score M SD Gerettete Witwen Eltern 30.8 (14.4) 39.5 (11.6) 33.8 (18.3) 29.0 (10.2) 28.3 (14.8) 27.0 (12.6) Gesamt 34.7 (15.0) 28.1 (12.7) Gesamt M SD 29.9 (12.5) 33.9 (13.3) 30.4 (15.7) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (3 Faktorstufen); (2) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.17b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, BL' vs. BL; N = 42) QS df MQS F p Power etap2 Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler 271.45 13089.14 2 39 135.73 335.62 .40 .670 .111 .020 Within Subjects-Effekte BL' vs. BL (BL'/BL) BL'/BL x BG Fehler (BL'/BL) 531.84 194.45 2250.29 1 2 39 531.84 97.23 57.70 9.22 1.69 .004** .199 .841 .333 .191 .080 Quelle der Varianz Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen); (2) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (BL'/BL, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 362 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.18a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Anspannung“; N = 42) BL' Anspannung BL Anspannung M SD M SD Gerettete Witwen Eltern 1.4 (0.8) 1.9 (0.6) 1.6 (0.7) 1.6 (0.6) 1.2 (0.7) 1.3 (0.5) Gesamt 1.6 (0.7) 1.4 (0.6) Gesamt M SD 1.5 (0.7) 1.6 (0.7) 1.4 (0.6) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (3 Faktorstufen); (2) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.18b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Anspannung“; N = 42) QS df MQS F p Power etap2 Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler .64 28.69 2 39 .32 .74 .44 .650 .116 .022 Within Subjects-Effekte BL' vs. BL (BL'/BL) BL'/BL x BG Fehler (BL'/BL) .90 1.70 5.12 1 2 39 .90 .85 .13 6.84 6.49 .013* .004** .722 .883 .149 .250 Quelle der Varianz Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen); (2) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (BL'/BL, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 363 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.19a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Erschöpfung“; N = 41) BL' Erschöpfung BL Erschöpfung M SD M SD Gerettete Witwen Eltern 1.2 (0.5) 1.3 (0.6) 1.1 (0.9) 1.1 (0.5) 1.2 (0.7) 1.0 (0.6) Gesamt 1.2 (0.7) 1.1 (0.6) Gesamt M SD 1.1 (0.5) 1.3 (0.7) 1.1 (0.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (3 Faktorstufen); (2) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.19b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, Faktor „Erschöpfung“; N = 41) QS df MQS F p Power etap2 Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler .48 28.41 2 38 .24 .75 .32 .727 .098 .017 Within Subjects-Effekte BL' vs. BL (BL'/BL) BL'/BL x BG Fehler (BL'/BL) .16 .00 5.93 1 2 38 .16 .00 .16 1.01 .01 .321 .994 .165 .051 .026 .000 Quelle der Varianz Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen); (2) Beschwerden-Liste, BL' vs. BL (BL'/BL, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 364 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.20a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-L-S „Psychosoziale Einbettung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 66) H-L-S 1 (Fremdwahrn.) H-L-S 1 (Selbstwahrn.) Gesamt M SD M SD M SD Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern 3.3 3.0 3.3 3.3 3.3 (0.7) (0.9) (0.9) (0.9) (0.8) 3.4 3.1 3.3 3.3 3.3 (0.6) (0.8) (0.9) (0.6) (0.7) 3.4 3.1 3.3 3.3 3.3 (0.6) (0.9) (0.9) (0.7) (0.7) Gesamt 3.2 (0.8) 3.3 (0.7) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (5 Faktorstufen); (2) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.20b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: H-L-S „Psychosoziale Einbettung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 66) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler Within Subjects-Effekte H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S) H-L-S, F/S x BG Fehler (H-L-S, F/S) QS df MQS F p Power etap2 .76 76.05 4 61 .19 1.25 .15 .962 .080 .010 .12 1 .12 2.70 .106 .366 .042 .04 2.74 4 61 .01 .05 .24 .914 .099 .016 Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 5 Faktorstufen); (2) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 365 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.21a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-L-S „Materielle Absicherung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 66) H-L-S 2 (Fremdwahrn.) H-L-S 2 (Selbstwahrn.) Gesamt M SD M SD M SD Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern 3.7 4.7 4.4 4.1 3.8 (1.0) (0.3) (0.4) (0.5) (0.6) 3.7 4.1 4.3 3.7 3.4 (1.1) (0.6) (0.6) (0.9) (0.9) 3.7 4.4 4.3 3.9 3.6 (1.1) (0.5) (0.5) (0.7) (0.8) Gesamt 4.1 (0.6) 3.8 (0.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (5 Faktorstufen); (2) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.21b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: H-L-S „Materielle Absicherung“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 66) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler Within Subjects-Effekte H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S) H-L-S, F/S x BG Fehler (H-L-S, F/S) QS df MQS F 13.75 45.31 4 61 3.44 .74 4.63 2.27 1 2.27 21.17 .97 6.55 4 61 .24 .11 2.27 Power etap2 .003** .931 .233 .000*** .995 .258 .072 .629 .130 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 5 Faktorstufen); (2) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 366 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.22a: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-L-S „Soziale Offenheit“, Fremdvs. Selbstwahrnehmung; N = 66) H-L-S 3 (Fremdwahrn.) H-L-S 3 (Selbstwahrn.) Gesamt M SD M SD M SD Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern 3.6 3.3 2.4 1.8 2.0 (0.7) (0.7) (0.7) (0.8) (0.8) 3.5 3.3 2.4 1.7 1.7 (0.7) (0.8) (0.7) (0.8) (0.8) 3.6 3.3 2.4 1.7 1.9 (0.7) (0.8) (0.7) (0.8) (0.8) Gesamt 2.6 (0.7) 2.5 (0.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (5 Faktorstufen); (2) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle B.22b: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: H-L-S „Soziale Offenheit“, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung; N = 66) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekt Betroffenengruppe (BG) Fehler Within Subjects-Effekte H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S) H-L-S, F/S x BG Fehler (H-L-S, F/S) QS df MQS F 46.10 62.07 4 61 11.53 1.02 11.33 .20 1 .20 4.28 .18 2.82 4 61 .05 .05 1.00 Power etap2 1.000 .426 .043* .530 .066 .417 .296 .061 p .000*** Erläuterungen: Faktoren: (1) Betroffenengruppe (BG, 5 Faktorstufen); (2) H-L-S, Fremd- vs. Selbstwahrnehmung (H-L-S, F/S, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 367 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.23a: Einfaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-VUV Faktor 1, „institutionelle & allgemein zugängliche Hilfsangebote“; N = 44) M Gerettete Witwen Eltern SD 1.0 (0.2) 2.3 (0.6) 2.7 (1.0) Erläuterungen: Faktor: Betroffenengruppe (3 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design. Tabelle B.23b: Einfaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: H-VUV Faktor 1, „institutionelle & allgemein zugängliche Hilfsangebote“; N = 44) Quelle der Varianz Betroffenengruppe (BG) Fehler Gesamt QS df MQS F 8.44 22.66 264.09 2 41 44 4.22 .55 7.63 p .002** Power etap2 .931 .271 Erläuterungen: Faktor: (1) Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. Tabelle B.24a: Einfaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: H-VUV Faktor 2, „Hilfe durch vertraute Personen“; N = 44) M Gerettete Witwen Eltern SD 2.4 (0.9) 3.0 (0.7) 3.4 (0.9) Erläuterungen: Faktor: Betroffenengruppe (3 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design. Tabelle B.24b: Einfaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: H-VUV Faktor 2, „Hilfe durch vertraute Personen“; N = 44) Quelle der Varianz Betroffenengruppe (BG) Fehler Gesamt QS df MQS F p Power etap2 3.30 25.47 437.74 2 41 44 1.65 .62 2.66 .082 .498 .115 Erläuterungen: Faktor: Betroffenengruppe (BG, 3 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 368 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.25: Items des H-VUV zu psychologischen Interventionen – Mittelwerte und Standardabweichungen Hilfe durch Teilnahme an psychologischer Gruppe Gerettete Verletzte Witwen Türkische Witwen Eltern Tabelle B.26: Hilfe durch psychologische Einzelgespräche N M SD N M SD 4 2 18 1 4 4.50 2.50 3.89 4.00 4.00 0.58 2.12 1.32 — 0.82 1 1 14 1 1 3.00 4.00 4.21 3.00 4.00 — — 0.98 — — Kanonische Korrelation zwischen PTB-2, H-L-S und H-VUV (N = 45) CR 1** Kanonische Korrelationen Signifikanz Varianzaufklärung Prädiktoren Varianzaufklärung Kriterien .557 .006 21.50% 77.70% CR 2 n.s. Redundanz .343 .193 27.30% 22.30% 6.70% 24.10% Faktorladungen Strukturkoeffizienten CR 1 CR 2 CR 1 CR 2 Prädiktor-Variablen H-L-S 1 („Psychosoziale Einbettung“) H-L-S 2 („Materielle Absicherung“) H-L-S 3 („Soziale Offenheit“) H-VUV 1 („Institutionelle Hilfsangebote“) H-VUV 2 („Hilfe durch nahe stehende Pers.“) Kriteriumsvariablen PTB-2, Item 1, Messung 1 PTB-2, Item 1, Messung 2 -.56 -.66 -.54 -.05 -.49 .70 -.31 -.37 -.30 -.02 -.17 .24 -.13 -.10 -.49 -.62 -.07 -.06 -.17 -.21 -.92 -.84 -.40 .54 -.51 -.47 -.14 .19 Erläuterungen: Kriteriumsvariablen: PTB-2 (Item 1, Messungen 1 und 2); Prädiktoren: H-L-S (3 Scores, Fremdwahrnehmungsbedingung) und H-VUV (2 Scores). Die berichteten Redundanzmaße beziehen nur die signifikante kanonische Korrelation ein. Die nicht signifikante zweite Kanonische Korrelation wird nicht interpretiert. 369 Anhang B: Borken, Tabellen der Datenanalyse Tabelle B.27: Bivariate Korrelationen zwischen Belastungsmaßen und H-VUVItems mit psychologischen Interventionen Hilfe durch Teilnahme an psychologischer Gruppe (N = 27) Hilfe durch psychologische Einzelgespräche (N = 18) PTB-2, Mittelwert PTB-2, Item 1, Messung 1 PTB-2, Item 1, Messung 2 .42 * .38 * .38 * .05 .35 -.03 BL Summenscore BL' Summenscore BL Anspannungsfaktor BL' Anspannungsfaktor BL Erschöpfungsfaktor BL' Erschöpfungsfaktor .02 -.05 .05 -.12 -.04 .07 .01 .25 .02 .18 .01 .24 H-L-S 1 („Psychosoziale Einbettung“) H-L-S 2 („Materielle Absicherung“) .30 -.22 .12 .26 H-L-S 3 („Soziale Offenheit“) -.03 .13 H-VUV 1 („Institutionelle Hilfsangebote“) H-VUV 2 („Hilfe durch nahe stehende Pers.“) .23 -.15 .23 .41 Erläuterungen: Angaben zum H-L-S nach der Fremdwahrnehmungsbedingung. Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson. Signifikanztest zweiseitig, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. Anhang C: Meißen – Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.1a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Beschwerden-Liste, B-L' vs. B-L; N = 35) Lehrer B-L' Score B-L Score Schüler Gesamt M SD M SD M SD k. Therapie Therapie k. Therapie Therapie 21.6 29.7 18.0 18.9 (7.1) (11.3) (11.4) (11.7) 17.8 30.7 14.2 20.2 (9.1) (7.6) (11.9) (10.5) 19.7 30.2 16.1 19.6 (8.2) (9.6) (11.7) (11.1) B-L' Score B-L Score 25.6 (9.5) 18.4 (11.5) 24.2 (8.4) 17.2 (11.2) 24.9 (8.9) 17.8 (11.4) k. Therapie Therapie 19.8 (9.5) 24.3 (11.5) 16.0 (10.6) 25.5 (9.2) 17.9 (10.1) 24.9 (10.4) Gesamt 22.0 (10.5) 20.7 (9.9) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, B-L' vs. B-L (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.1b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: Beschwerden-Liste, B-L' vs. B-L; N = 35) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Therapie-Bedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte B-L' vs. B-L (B-L'/B-L) B-L'/B-L x T B-L'/B-L x BG B-L'/B-L x T x BG Fehler (B-L'/B-L) QS df MQS F 808.88 28.57 101.56 5336.83 1 1 1 31 808.88 28.57 101.56 172.16 4.70 .17 .59 834.94 205.13 .12 .01 869.14 1 1 1 1 31 834.94 205.13 .12 .01 28.04 29.78 7.32 .00 .00 p .038* .687 .448 .000*** .011* .947 .986 Power etap2 .556 .068 .116 .132 .005 .019 1.000 .745 .050 .050 .490 .191 .000 .000 Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) Beschwerden-Liste, B-L' vs. B-L (B-L'/B-L, 2 Messungen). Nichtorthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 371 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.2a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: IES-R Intrusion, Messwiederholung; N = 35) Lehrer IES-R Intr. (1) IES-R Intr. (2) Schüler Gesamt M SD M SD M SD k. Therapie Therapie k. Therapie Therapie 15.5 21.5 12.3 9.8 (7.3) (7.5) (5.9) (2.9) 8.4 20.6 3.4 10.6 (5.3) (5.8) (4.1) (7.4) 11.9 21.1 7.8 10.2 (6.4) (6.7) (5.1) (5.6) IES-R Intr. (1) IES-R Intr. (2) 18.5 (7.4) 11.0 (4.7) 14.5 (5.6) 7.0 (6.0) 16.5 (6.6) 9.0 (5.4) k. Therapie Therapie 13.9 (6.7) 15.7 (5.7) 5.9 (4.7) 15.6 (6.6) 9.9 (5.8) 15.6 (6.2) Gesamt 14.8 (6.2) 10.8 (5.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) IES-R Intrusion, Messwiederholung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.2b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: IES-R Intrusion, Messwiederholung; N = 35) Quelle der Varianz Between Subjects-Effekte Therapie-Bedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Within Subjects-Effekte IES-R Intr., Messwhg. IES-R I, MW x T IES-R I, MW x BG IES-R I, MW x T x BG Fehler (IES-R I, MW) QS df MQS F 551.04 266.89 262.11 1436.03 1 1 1 31 551.04 266.89 262.11 46.32 11.90 5.76 5.66 926.88 190.12 .03 12.54 877.10 1 1 1 1 31 926.88 190.12 .03 12.54 28.29 32.76 6.72 .00 .44 Power etap2 .002** .023* .024* .916 .643 .635 .277 .157 .154 .000*** .014* .976 .510 1.000 .709 .050 .099 .514 .178 .000 .014 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) IES-R Intrusion, Messwiederholung (IES-R I, MW, 2 Messungen). Nichtorthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 372 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.3a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: IES-R Vermeidung, Messwiederholung; N = 35) Lehrer IES-R Verm. (1) IES-R Verm. (2) Schüler Gesamt M SD M SD M SD k. Therapie Therapie k. Therapie Therapie 12.0 9.3 14.2 10.3 (8.1) (5.5) (8.6) (13.1) 13.1 20.4 10.5 17.5 (6.4) (7.2) (8.8) (12.4) 12.6 14.9 12.4 13.9 (7.3) (6.4) (8.7) (12.7) IES-R Verm. (1) IES-R Verm. (2) 10.7 (6.9) 12.3 (11.1) 16.8 (6.8) 14.0 (10.8) 13.7 (6.9) 13.1 (10.9) k. Therapie Therapie 13.1 (8.4) 9.8 (10.0) 11.8 (7.7) 19.0 (10.1) 12.5 (8.0) 14.4 (10.1) Gesamt 11.5 (9.2) 15.4 (9.0) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) IES-R Vermeidung, Messwiederholung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.3b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: IES-R Vermeidung, Messwiederholung; N = 35) QS df MQS F p Power etap2 Between Subjects-Effekte Therapie-Bedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler 62.18 254.21 448.40 3511.43 1 1 1 31 62.18 254.21 448.40 113.27 .55 2.24 3.96 .464 .144 .056 .111 .306 .487 .017 .068 .113 Within Subjects-Effekte IES-R Verm., Messwhg. IES-R V, MW x T IES-R V, MW x BG IES-R V, MW x T x BG Fehler (IES-R V, MW) 5.63 2.24 78.78 .88 1560.05 1 1 1 1 31 5.63 2.24 78.78 .88 50.32 .11 .04 1.57 .02 .740 .834 .220 .896 .062 .055 .228 .052 .004 .001 .048 .001 Quelle der Varianz Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) IES-R Vermeidung, Messwiederholung (IES-R V, MW, 2 Messungen). Nichtorthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 373 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.4a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: IES-R Übererregung, Messwiederholung; N = 35) Lehrer IES-R Übererr. (1) IES-R Übererr. (2) Schüler Gesamt M SD M SD M SD k. Therapie Therapie k. Therapie Therapie 14.6 21.0 11.0 8.5 (9.1) (5.8) (7.3) (6.4) 8.0 21.7 3.9 12.0 (3.2) (4.6) (3.5) (4.7) 11.3 21.4 7.4 10.3 (6.8) (5.2) (5.7) (5.6) IES-R Übererr. (1) IES-R Übererr. (2) 17.8 (7.6) 9.8 (6.8) 14.9 (4.0) 7.9 (4.1) 16.3 (6.1) 8.8 (5.6) k. Therapie Therapie 12.8 (8.2) 14.8 (6.1) 5.9 (3.4) 16.9 (4.7) 9.4 (6.3) 15.8 (5.4) Gesamt 13.8 (7.2) 11.4 (4.1) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) IES-R Übererregung, Messwiederholung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.4b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: IES-R Übererregung, Messwiederholung; N = 35) Quelle der Varianz QS df MQS F Between Subjects-Effekte Therapie-Bedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler 688.58 92.93 330.88 1716.60 1 1 1 31 688.58 92.93 330.88 55.37 12.44 1.68 5.98 Within Subjects-Effekte IES-R Übererr., Messwhg. IES-R Ü, MW x T IES-R Ü, MW x BG IES-R Ü, MW x T x BG Fehler (IES-R Ü, MW) 924.46 218.73 5.11 11.83 546.60 1 1 1 1 31 924.46 218.73 5.11 11.83 17.63 52.43 12.41 .29 .67 Power etap2 .001** .205 .020* .927 .241 .658 .286 .051 .162 .000*** .001** .594 .419 1.000 .927 .082 .125 .628 .286 .009 .021 p Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) IES-R Übererregung, Messwiederholung (IES-R Ü, MW, 2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 374 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.5a: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: IES-R Gesamtwert, Messwiederholung; N = 35) Lehrer IES-R Gesamt (1) IES-R Gesamt (2) Schüler Gesamt M SD M SD M SD k. Therapie Therapie k. Therapie Therapie -1.1 -0.2 -1.5 -2.2 (1.7) (1.3) (1.6) (1.6) -2.1 0.7 -3.0 -1.2 (1.0) (1.2) (1.1) (1.5) -1.6 0.3 -2.3 -1.7 (1.4) (1.2) (1.4) (1.6) IES-R Gesamt (1) IES-R Gesamt (2) -0.6 (1.5) -1.9 (1.6) -0.7 (1.1) -2.1 (1.3) -0.7 (1.3) -2.0 (1.5) k. Therapie Therapie -1.3 (1.7) -1.2 (1.5) -2.6 (1.0) -0.2 (1.4) -1.9 (1.4) -0.7 (1.4) Gesamt -1.2 (1.6) -1.4 (1.2) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen); (3) IES-R Gesamtwert, Messwiederholung (2 Messungen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.5b: Dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung – Signifikanztest (Maß: IES-R Gesamtwert, Messwiederholung; N = 35) Quelle der Varianz QS df MQS F Between Subjects-Effekte Therapie-Bedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler 24.58 .43 20.56 100.23 1 1 1 31 24.58 .43 20.56 3.23 7.60 .13 6.36 Within Subjects-Effekte IES-R Gesamt, Messwhg. IES-R G, MW x T IES-R G, MW x BG IES-R G, MW x T x BG Fehler (IES-R G, MW) 28.47 6.75 .08 .43 25.77 1 1 1 1 31 28.47 6.75 .08 .43 .83 34.24 8.12 .10 .51 p .010* .717 .017* .000*** .008** .756 .480 Power etap2 .761 .064 .686 .197 .004 .170 1.000 .788 .061 .107 .525 .208 .003 .016 Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen); (3) IES-R Gesamtwert, Messwiederholung (IES-R G, MW, 2 Messungen). Nichtorthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 375 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.6a: Einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung, univariat – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maße: IES-R Intrusion, IES-R Vermeidung, IES-R Übererregung, IES-R Gesamtwert; N = 10) 1. Messung IES-R Intrusion IES-R Vermeidung IES-R Übererregung IES-R Gesamtwert 2. Messung 3. Messung M SD M SD M SD 17.3 19.3 18.7 0.1 (8.4) (6.4) (6.6) (1.4) 7.9 18.1 10.2 -1.5 (6.4) (8.7) (5.0) (1.2) 6.0 10.0 8.2 -2.4 (3.9) (8.8) (5.8) (1.4) Erläuterungen: IES-R Gesamtwert berechnet nach Maercker und Schützwohl, 1998. Tabelle C.6b: Einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung, univariat – Signifikanztests (Maße: IES-R Intrusion, IES-R Vermeidung, IES-R Übererregung, IES-R Gesamtwert; N = 10) Quelle der Varianz Power etap2 .000*** .988 .578 7.17 .005** .885 .443 310.83 24.20 12.84 .000*** .990 .588 15.38 1.23 12.46 .000*** .988 .581 QS df MQS F IES-R Intr., Messwhg. Fehler (IES-R I, MW) 736.81 538.82 2 18 368.40 29.94 12.31 IES-R Verm., Messwhg. Fehler (IES-R V, MW) 511.80 642.87 2 18 255.90 35.72 IES-R Übererr., Messwhg. Fehler (IES-R Ü, MW) 621.67 435.67 2 18 IES-R Gesamt, Messwhg. Fehler (IES-R G, MW) 30.77 22.22 2 18 p Erläuterungen: Faktoren: Messwiederholungen IES-R Intrusion, IES-R Vermeidung, IES-R Übererregung, IES-R Gesamtwert (IES-R I, IES-R V, IES-R Ü, IES-R G, MW, je 3 Messungen). Korrektur der Freiheitsgrade nicht erforderlich. Nicht-orthogonale Designs, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 376 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.7a: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: funktionale Zielerreichung (Prozent); N = 34) k. Therapie M SD Therapie M SD Lehrer Schüler 52.1 (24.0) 46.3 (28.8) 64.9 (25.4) 55.1 (17.3) Gesamt 49.2 (26.5) 60.0 (21.7) Gesamt M SD 58.5 (24.7) 50.7 (23.8) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.7b: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: funktionale Zielerreichung (Prozent); N = 34) Quelle der Varianz Therapie-Bedingung (T) Betroffenengruppe (BG) T x BG Fehler Gesamt QS df MQS F p Power etap2 956.03 500.10 32.77 16905.28 116782.12 1 1 1 30 34 956.03 500.10 32.77 563.51 1.70 .89 .06 .203 .354 .811 .243 .149 .056 .054 .029 .002 Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 377 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.8a: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Mittelwerte und Standardabweichungen (Maß: Differenz aus funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung (Prozent); N = 34) k. Therapie M SD Therapie M SD Lehrer Schüler 47.1 (28.2) -4.4 (58.1) 64.9 (25.4) 51.3 (19.3) Gesamt 21.4 (45.6) 58.1 (22.5) Gesamt M SD 56.0 (26.8) 23.5 (43.3) Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, ungewichtete Randmittel, Standardabweichungen der Randmittel geschätzt. Tabelle C.8b: Zweifaktorielle Varianzanalyse – Signifikanztest (Maß: Differenz aus funktionaler und dysfunktionaler Zielerreichung (Prozent); N = 34) Quelle der Varianz Therapie-Bed. (T) Betroffenengr. (BG) T x BG Fehler Gesamt QS df MQS F 11004.24 8607.92 2915.52 37299.03 111267.54 1 1 1 30 34 11004.24 8607.92 2915.52 1243.30 8.85 6.92 2.34 p .006** .013* .136 Power etap2 .821 .721 .317 .228 .188 .072 Erläuterungen: Faktoren: (1) Therapie-Bedingung (T, 2 Faktorstufen); (2) Betroffenengruppe (BG, 2 Faktorstufen). Nicht-orthogonales Design, Quadratsummen vom Typ III, alpha = .05, *p < .05 – **p < .01 – ***p < .001. 378 Anhang C: Meißen, Tabellen der Datenanalyse Tabelle C.9: Spearman’sche Rangkorrelationen zwischen den Belastungsmaßen der IES-R und der B-L und den Maßen zur Qualität sozialer Beziehungen im schulischen Kontext Item N IES-R I IES-R V IES-R Ü IES-R G B-L Scores 1. Messzeitpunkt Kontakt zum Opfer Kontakt zum Täter Kontakt zur „Opposition“ …, vor der Tat …, 1. Messung …, 2. Messung Kontakt zu „Peers" …, 1. Messung Psychol. Betreuung 29 30 -.154 .124 .432* -.364* -.094 .183 .014 .037 .019 .018 32 32 32 -.068 .163 -.413* -.028 .256 .005 .020 .128 -.413* -.034 .176 -.367* .073 .237 -.212 33 34 .080 -.296 -.356* .043 -.003 -.254 -.099 -.216 -.042 -.002 2. Messzeitpunkt Kontakt zum Opfer Kontakt zum Täter Kontakt zur „Opposition“ …, vor der Tat …, 1. Messung …, 2. Messung Kontakt zu „Peers" …, 1. Messung Psychol. Betreuung 29 30 -.381* .433* .211 .000 -.207 .330 -.081 .243 .056 .066 32 32 32 -.172 .077 -.225 -.349 -.051 -.161 -.163 .051 -.300 -.274 .034 -.282 -.150 .029 -.188 33 34 .243 -.258 -.102 .063 .096 -.112 .080 -.066 -.051 -.053 Erläuterungen: Maße der IES-R: (1) IES-R I: Intrusion; (2) IES-R V: Vermeidung; (3) IES-R Ü: Übererregung; (4) IES-R G: Gesamtwert. Maße der B-L (B-L Scores): (1) B-L'; (2) B-L.