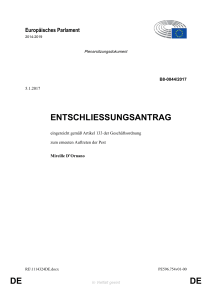Karies, Pest und Knochenbrüche - Wahl / Zink - Beck-Shop
Werbung

Karies, Pest und Knochenbrüche Was Skelette über Leben und Sterben in alter Zeit verraten von Joachim Wahl, Albert Zink 1. Auflage Karies, Pest und Knochenbrüche – Wahl / Zink schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Theiss Verlag, Stuttgart 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 8062 2585 3 24 | Infektionskankheiten 1493 durch spanische Seefahrer von Haiti nach Europa verschleppt und ausgebreitet. 1498 gab es mit Ankunft der Portugiesen Erkrankungsfälle in Indien, später auch in China und Japan (1505). Die ältesten Dokumente, die die Erkrankung in Japan beschreiben, datieren zwischen 1512 und 1513.42 Das Krankheitsbild der Syphilis verläuft in mehreren Stadien. Im Tertiärstadium kommt es in etwa 10 bis 20% der Fälle zu Knochenveränderungen, die überwiegend den Schädel oder die langen Röhrenknochen betreffen. Vor allem im Bereich des Schädeldaches ergibt sich ein charakteristisches Bild, das bereits morphologisch eine weitestgehend sichere Diagnose zulässt. Diese Veränderungen äußern sich in einem typischen Nebeneinander von rundlichen Knochenauflösungen mit reaktiver, aufgeraut wirkender Knochenneubildung, das als »Caries sicca« bezeichnet wird. Letztendlich führt dieser fortschreitende Prozess zu einer runzeligen, zerklüfteten Knochenoberfläche. Am Stirnbein einer jungen Frau aus dem Gebeinhaus in Rain am Lech zeigt sich deutlich das zerklüftete Erscheinungsbildung einer »Caries sicca«. Ebenfalls erscheint der Bereich unterhalb des rechten Auges und des angrenzenden Jochbeins durch die Knochenneubildungen etwas verdickt und aufgeraut. An den Langknochen kommt es bei Syphilis primär zu einer Entzündung der Knochenhaut, die meist auf den Knochenschaft beschränkt bleibt, sich aber bis ins Knochenmark ausbreiten kann. Überwiegend sind die langen Röhrenknochen der unteren Extremitäten betroffen. Der neu gebildete Knochen wird immer wieder in reifen, lamellären Knochen umgebaut, was zu einer Verdickung mit rauer und porös erscheinender Oberfläche führen kann. Im radiologischen Bild zeigt sich sehr deutlich die starke Verdickung des Knochenschaftes etwa in der Mitte des Knochens. Die Knochenhaut wirkt in diesem Bereich verwaschen und nicht mehr deutlich abgrenzbar, der Markraum erscheint ebenfalls verdichtet. Anmerkungen 1 G. Hühne-Osterloh, 1989; G. Boenisch, G. Bräuer, 1986 · 2 R. E. Black, S. S. Morris, J. Bryce, 2003 · 3 WHO, 2007 · 4 D. J. Ortner, 2003 · 5 M. Würmseher, 2007 · 6 K. P. C. A. Gramberg, 1961 · 7 M. Yoeli, 1955 · 8 V. Möller-Christensen, 1983; T. Dzierzykray-Rogalski, 1980 · 9 E. H. Ackerknecht, 1972 · 10 C. Wells, 1964 · 11 C. Roberts, 1986 · 12 V. Möller-Christensen, 1961 · 13 R. Dubos, J. Dubos, 1952 · 14 S. Winkle, 1997 · 15 A. G. Carmicheal, 1993b · 16 K. Manchester, 1992 · 17 C. J. Haas et al., 2000 · 18 A. Castigilioni, 1941; W. D. Johnston, 1993 · 19 Anm. 14 · 20 Anm. 14 · 21 A. Cockburn, 1963 · 22 R. Brosch et al., 2002 · 23 P. Pott, 1779 · 24 V. Formicola, Q. Milanesi, C. Scarsini, 1987 · 25 D. E. Derry, 1938 · 26 P. Sager, M. Schmalzer, V. Möller-Christensen, 1972 · 27 A. Stirland, T. Waldron, 1990 · 28 S. Ulrich-Bochsler et al., 1982 · 29 Major J. Lichtor, A. Lichtor, 1957 · 30 L. Widmer, A. J. Perzigian, 1981 · 31 A. Marcsik et al., 1999 · 32 A. Centurion-Lara et al., 2006 · 34 E. H. Hudson, 1965; C. J. Hackett, 1967 · 34 R. T. Steinbock, 1976 · 35 A. Stirland, 1991 · 36 G. Palfi et al., 1992 c · 37 B. J. Baker, G. J. Armelagos, 1988 · 38 T. E. von Hunnius et al., 2006 · 39 K. J. Reichs, 1989 · 40 D. J. Ortner, 1986 · 41 G. Correal Urrego, 1990 · 42 T. Suzuki, 1991 | 25 Meistens unangenehm, häufig schmerzhaft und manchmal tödlich – Zahnerkrankungen in früher Zeit Das Gebiss des Menschen ist ein Informationsträger par excellence. An keiner anderen Struktur des Skelettes lassen sich vielfältigere Erkenntnisse über seinen Träger gewinnen. Zähne und Zahnhalteapparat liefern auf makroskopischer, histologischer und molekularer Ebene Anhaltspunkte zu Alter, Geschlecht und Migrationsverhalten (über Strontiumisotopie) ebenso zur Ernährung, Verwandtschaft (über DNA- Das Gebiss eines älteren Alamannen aus Konstanz weist verschiedene Befunde auf: Starke Abrasion und Sekundärdentinbildung an den Frontzähnen, kariöse Defekte in verschiedenen Stadien, Anzeichen von Parodontitis, Wurzelvereiterung und Zahnstein. Analysen oder anatomische Varianten)1, Zahn- und Mundhygiene oder zu Entwicklungsstörungen während der Kindheit (s. Kapitel »Knochen und Zähne als Spiegel von Mangelerscheinungen und Stoffwechselstörungen«). Dazu kommen Spuren mannigfacher spezifischer Krankheitszeichen, die zunächst nur als lästig empfunden werden, in fortgeschrittenem Stadium vielfach mit erheblichen Schmerzen einhergehen und von Fall zu Fall sogar schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen können.2 Nach ihrem Durchbruch wirken fortwährend physikalische und chemische Einflüsse auf die Zähne ein. Die Folge sind Abnutzung und Schädigungen verschiedenster Art. Dabei ist Zahnschmelz die härteste Substanz des menschlichen Körpers überhaupt, sodass die Zahnkronen in ungünstigem Liegemilieu häufig auch dann noch überdauern, wenn sich das restliche Skelett längst aufgelöst hat. Das unter der Schmelzkappe befindliche Dentin (Zahnbein) ist ebenfalls widerstandsfähiger als Knochen. Gleichwohl sind Zahnschmerzen ein ständiger Begleiter des Menschen. Am Schädel des ca. 200000 bis 300000 Jahre alten »Rhodesian Man« aus der Broken-Hill-Höhle (heute Kabwe in Sambia) wurden alleine elf kariöse Zähne und mehrere Wurzelabszesse diagnostiziert. Weitere Beispiele sind aus dem Jungpaläolithikum bekannt. Im Mittelalter galten Zahnschmerzen als gottgewollt. Der Schutzheiligen der Geplagten (und Zahnärzte), der Hl. Appolonia – einer nach antiken Quellen schon betagten Jungfrau, die stets mit einer Zahnzange abgebildet wird – waren im Rahmen der Christenverfolgung in Alexandria im Jahr 249 sämtliche Zähne ausgeschlagen worden. Mit dem Scheiterhaufen bedroht, soll sie betend selbst ins Feuer gesprungen sein. Im Alten Ägypten wie auch in der römischen Kaiserzeit war die Upperclass häufiger von Karies betroffen als die sozial weniger Privilegierten, da sie sich eher fein gemahlenes Mehl, Datteln, Honig oder ähnlich kariogene Nahrungsmittel leisten konnten. Von Ludwig XIV (1638–1715), dem »Sonnenkönig«, wird berichtet, dass er sich davon überzeugen ließ, sich zur Erhaltung seiner königlichen Glorie alle Zähne ziehen zu lassen.3 Bei deren Entfernung zerbarst der Unterkiefer und größere Teile des Gaumens brachen 26 | Zahnerkrankungen in früher Zeit Ein überzähliger, sog. Nasenzahn (Mesiodens) im Oberkiefer des 25- bis 30-jährigen Mannes aus dem bandkeramischen Gräberfeld von Schwetzingen. Der linke Unterkieferast ist atrophiert und deformiert, die Seitenzähne infolge Knochenschwunds verkippt und teilweise von Zahnstein überkrustet. Zudem finden sich heftige Entzündungsreaktionen am Gesichtsskelett. Aus Elfenbein geschnitzter, menschlicher Backenzahn mit Darstellung des »Zahnwurms« sowie einer Fegefeuer-Szene aus dem 18. Jh.: Zahnschmerzen werden mit Höllenqualen in Verbindung gebracht. heraus. Fortan war er ständig von fauligem Gestank umgeben, ausgehend von Speiseresten, die sich in seinem Nasen-Rachen-Raum verfangen hatten. Auch Ludwig II von Bayern (1845–1886) war von Zahnschmerzen geplagt.4 Der »Märchenkönig« liebte Süßigkeiten über alles und trug eine Teilprothese im Oberkiefer, nachdem er mit Mitte 20 bereits einige Vorderzähne eingebüßt hatte. Der nach dem Tod des 41-Jährigen angefertigte Sektionsbericht listet einen fast zahnlosen Oberkiefer sowie den Verlust aller Seitenzähne im Unterkiefer auf. denen Parametern ab, insbesondere den Bestandteilen der Nahrung, aber auch genetischen Determinanten wie der Zusammensetzung der Mundflora, Speichelmenge, Härte und Dicke des Zahnschmelzes, eventuellen Fehlstellungen im Gebiss oder Zahnpflegemaßnahmen. Mit Blick auf die Ernährung spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle: Erstens: Sie liefert das Substrat für die in der Plaque vorhandenen Bakterienspezies, Streptokokken, Staphylokokken und Enterobakterien, von denen v.a. die erstgenannten eine besondere Affinität zu niedermolekularen Kohlehydraten wie der Saccharose haben, die von ihnen zu Milchsäure vergoren wird und ihrerseits die Zahnhartsubstanzen demineralisiert.5 Stärke als Polysaccharid benötigt demgegenüber einen deutlich längeren Spaltungsprozess durch das Speichelenzym Amylase. Tierische Kost wie Fleisch, Fisch oder Milchprodukte ist demgegenüber weit weniger kariogen. Es sind also letztlich organische Säuren aus dem Stoffwechsel von Mikroorganismen, die den Zahn zerstören.6 Zweitens: Feste, faserige Nahrungskomponenten polieren die Oberflächen der Zähne, die so den Bakterien weniger Angriffsfläche bieten. Die Art der Zubereitung wirkt sich auf die Kauintensität aus. Zudem hat der Abrieb von Mahlsteinen im Getreidemehl einen gewissen Schleif- und Reinigungseffekt. Karies – Entstehung, Auswirkung und Aufnahmemodus | 27 Drittens: Mangelhafte Versorgung mit Vitamin A, C und/oder D in der Entwicklungsphase bewirkt eine Störung der schmelz- bzw. dentinbildenden Zellen. Die daraus resultierende minderwertige Zahnsubstanz ist leichter angreifbar.7 Im Umkehrschluss liefert die Kariesinzidenz einer Skelettserie zusätzliche Anhaltspunkte zur Rekonstruktion des Nahrungsverhaltens. Damit stellt sie eine wichtige Ergänzung dar zu den klassischen Indikatoren wie der Untersuchung von Tierknochen, Pflanzenpollen, Koprolithen oder Abnutzungsspuren an Zähnen und den zuletzt etablierten Isotopenanalysen (v.a. Calcium, Stickstoff, Schwefel und Strontium) an Knochen, Zähnen oder Haaren.8 Des Weiteren lassen sich Nährwerte oder einzelne Inhaltsstoffe bestimmter Nahrungsmittel berechnen. So liegt z.B. der Saccharosegehalt von Mais deutlich über demjenigen von Weizen und Gerste, hat aber infolge eines höheren Phosphatanteils gleichzeitig eine antikariogene Wirkung.9 Rohrzucker aus dem asiatischen Raum ist in der Antike und im Mittelalter nur für die Oberschicht erschwinglich, gemeine Menschen süßen ausschließlich mit Honig. Rübenzucker wird erst zu Beginn des 19. Jh. industriell hergestellt.10 Unterkiefer eines nach anthropologischen Kriterien senilen Mannes aus der Christuskirche in Konstanz mit vergleichsweise schwacher Zahnkronenabrasion, aber massiven Zahnsteinablagerungen und deutlichen Anzeichen von Parodontitis. Karies – Entstehung, Auswirkung und Aufnahmemodus Als eine der Hauptursachen pathologischen Geschehens im Bereich des Kauapparates kommt der Zahnfäule besondere Beachtung zu. Die damit verbundenen Schmerzen dürften den meisten Menschen bekannt sein. Bis ins 18. Jh. hinein schrieb man diese Pein dem so genannten Zahnwurm zu, erst später konnte nachgewiesen werden, dass sie bakteriellen Ursprungs ist. Kariöse Defekte hängen von verschie- 66 | Vom Schwarzen Tod und alter DNA – Seuchen der Menschheit und ihre Spurensuche in menschlichen Überresten Seit der Antike gehören große Seuchen zum festen Bestandteil der Menschheitsgeschichte, die noch bis ins beginnende 20. Jh. ihre tödlichen Spuren hinterlassen haben.1 Mit keiner Krankheit ist der Begriff »Seuche« wohl enger verbunden als mit der Pest, deren Name sich vom lateinischen »pestis« ableitet und zum Synonym für Unheil, Verderben, Scheusal und großes Leiden geworden ist. Dennoch ist die Pest bei Weitem nicht die einzige Erkrankung, die für frühere Bevölkerungen verheerend war. Neben den im Kapitel »Infektionskrankheiten – Plagen der Menschheit bis in die heutige Zeit« beschriebenen Infektionskrankheiten wie Lepra, Syphilis und Tuberkulose, die zeitweise seuchenhaft verbreitet waren, kam es im Verlauf der letzten 2000 Jahre immer wieder zu schweren Ausbrüchen von Pocken, Fleckfieber, Cholera, Typhus und Masern. Inzwischen geht man sogar davon aus, dass einige Epidemien, die ursprünglich der Pest zugeschrieben wurden, auf diese Infektionskrankheiten zurückzuführen sind. Für die betroffenen Dorf- oder Stadtbevölkerungen waren die Seuchen Ausdruck von Machtlosigkeit und Sinnbild für Untergang und Verderben. Gegenmaßnahmen jedweder Art erwiesen sich als wenig erfolgreich und führten dazu, dass man die Ursachen entweder in bestimmten Personengruppen suchte, wie z.B. bei den so genannten Brunnenvergiftern, sie als Bestrafung Gottes für die Sündhaftigkeit der Menschheit ansah oder sie ganz einfach auf schlechte Luft bzw. üble Ausdunstungen, das Miasma, zurückführte. Ein anderes Verständnis von Krankheit und der damit verbundene Mangel an Wissen über Ursachen und Verbreitung führte zu ungenauen Beschreibungen der Symptomatik und erschwert heute die Rekonstruktion der zugrundeliegenden Erreger von Epidemien bzw. Pandemien anhand historischer Quellen. Einen anderen und unmittelbareren Zugang zu dieser Frage bietet die Untersuchung von Skeletten, insbesondere aus Massengräbern, die im Zuge von schweren Epidemien angelegt wurden, wie etwa die weit verbreiteten Pestfriedhöfe. Obwohl bei Infektionskrankheiten, die einen schnellen tödlichen Verlauf nehmen, offensichtliche Skelettveränderungen in der Regel nicht zu beobachten sind, erlauben moderne molekularbiologische Analysen den direkten Nachweis der Krankheitserreger. Insbesondere die Extraktion von altem bzw. antikem Erbgut (engl. ancient DNA, kurz: aDNA) aus Knochenfunden ermöglicht heutzutage einen detaillierten Einblick in das Auftreten, die Verbreitung und die Entwicklungsgeschichte von Infektionskrankheiten. Diese Methode kann entscheidend dazu beitragen, den tatsächlichen Auslöser einer Seuche zu bestimmen und im günstigsten Fall darüber hinaus sogar noch Rückschlüsse auf die Spezies oder Stammzugehörigkeit des Erregers zu ziehen. Dies soll zunächst am Beispiel der Pest demonstriert werden. Ein typischer Pestarzt mit Schutzanzug und Maske, der auf dieser Abbildung von 1656 als »Der Doktor Schnabel aus Rom« bezeichnet wurde. der Opfer, der damals der in Athen wütenden Seuche zugeschrieben wurde.3 Sie verglichen die mithilfe der aDNA-Untersuchung erzielten Genabschnitte mit vorhandenen Gendatenbanken und kamen zum Ergebnis, dass es sich um den Erreger von Typhus, das »Salmonella typhi«, gehandelt haben könnte. Somit lieferten sie zumindest einen Hinweis, dass die Athener Epidemie in der Tat nicht die Pest war. Jedoch wurden die Ergebnisse erheblich angezweifelt. Im Rahmen einer einfachen stammesgeschichtlichen Analyse der alten Erregersequenzen ließ sich zeigen, dass diese außerhalb von nahe verwandten Salmonellenarten liegen und somit unmöglich von Typhuserregern stammen können.4 Somit bleibt die genaue Ursache der attischen Seuche weiterhin ungeklärt. Die so genannte Justinianische Pest, die nach dem römischen Kaiser Justinian benannt wurde, gilt als erste richtige Pestpandemie, obwohl auch hier zumindest bezweifelt wird, dass ausschließlich der Pesterreger grassierte. Zumindest geht man davon aus, dass Die Pest und ihr Nachweis im Skelettmaterial Die Pest ist eine schwere und unbehandelt meist tödlich verlaufende Infektionskrankheit, die vom Bakterium »Yersinia pestis« hervorgerufen wird. Sie findet sich heute noch in einigen Gebieten der Erde und tritt dort gelegentlich in Form von kleinen Ausbrüchen auf. Die WHO berichtet von etwa 1000 bis 3000 Pestfällen pro Jahr.2 Die Übertragung des Erregers erfolgt über einen Zwischenwirt, meistens Flöhe, oder direkt durch Tröpfcheninfektion. Es existieren vier verschiedene Formen: Die auch als Bubonenpest bezeichnete Beulenpest ist durch die typischerweise am Hals und in der Leistengegend auftretenden Beulen gekennzeichnet; die Lungenpest führt zu einem raschen Tode und kann auf dem Luftweg übertragen werden; bei der Pestsepsis treten die Erreger in den Blutkreislauf ein und verteilen sich im gesamten Körper; und schließlich gibt es die harmlose Variante der Erkrankung, die abortive Pest. Obwohl der Begriff »Pest« für viele Seuchen verwendet wurde, die seit der Antike im Mittelmeerraum aufgetreten sind, geht man heute davon aus, dass es sich bei den Epidemien vor 541 n.Chr. nicht um Pest gehandelt hat. Dies trifft sowohl auf die Beschreibungen der Pest im Alten Ägypten zu als auch auf die große Epidemie von Athen (430–426 v.Chr.). Die von Thukydides überlieferten Symptome weisen in keiner Weise auf Pest hin, erlauben andererseits aber auch keine andere eindeutige Diagnose. Zudem gelang 2007 griechischen Forschern der Nachweis von Salmonellen-DNA in drei Zähnen aus einem Friedhof Die Pest und ihr Nachweis im Skelettmaterial | 67 es sich um die Beulenpest gehandelt hat, die möglicherweise noch von anderen Krankheiten begleitet wurde. Sie nahm ihren Ursprung 541 n.Chr. in Ägypten und erreichte 542 n.Chr. Konstantinopel, wo etwa ein Viertel der Bevölkerung daran zugrunde ging. In den darauffolgenden Jahren kam es immer wieder zu Ausbrüchen mit zahlreichen Opfern, darunter auch in Syrien und Persien, bis die Pest um 770 n.Chr. vorübergehend aus Europa und dem Mittelmeerraum verschwand. Im 14. Jh. kam es dann zu einer verheerenden Pandemie in Europa, die als »Schwarzer Tod« bezeichnet wurde und fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung eliminierte. Man nimmt an, dass sie ihren Ursprung in Asien genommen und durch intensivierte Handelsbeziehungen und mongolische Eroberungszüge ihren Weg nach Europa gefunden hat. So soll bei der Belagerung der Hafenstadt Caffa die Pest im Lager der Tartaren ausgebrochen sein und diese ihre Leichen als frühe Form eines biologischen Kampfstoffes über die Mauern katapultiert haben. Die fliehenden Bewohner der Stadt könnten dann die Pest nach Italien eingeschleppt haben. Tatsache ist, dass sich die Pest von 1347 bis 1352 über fast ganz Europa ausgebreitet und sogar Norwegen und Island erreicht hat. Nach dem Ende der großen Pandemie hielt sich die Pest in Europa und trat immer wieder in Form von mehr oder weniger schweren Epidemien auf, die bis ins 18. Jh. andauerten. Schließlich kam es Mitte des 19. Jh. zu einer dritten und letzten Pandemie, die in Zentralasien begonnen hatte und weltweit etwa 12 Millionen Opfer forderte. Dabei gelang dem französischen Arzt Alexandre Yersin die Entdeckung des Erregers und die Aufklärung des Übertragungswegs. Nachdem der Pesterreger der dritten Pandemie erfolgreich identifiziert worden war, ging man zunächst davon aus, dass er auch für die beiden ersten Pestwellen verantwortlich zu machen sei. Diese Ansicht wurde aber zugleich angezweifelt und gerade für die mittelalterliche Pest immer wieder andere Erreger, wie z.B. Anthrax (Bacillus anthracis), ein Virus oder vielleicht auch ein bereits ausgestorbener Erreger ins Spiel gebracht.5 Erst im letzten Jahr scheinen aDNAUntersuchungen an Skelettmaterial endgültig zu einer Lösung dieser Fragestellung geführt zu haben. Davor hatte über viele Jahre eine heftige Debatte über den Nachweis des Pesterregers in altem Skelettmaterial geherrscht. Bereits 1998 publizierten französische Wissenschaftler ihre Ergebnisse zum Nachweis von Yersina-pestis-DNA in Zahnproben aus südfranzösischen Pestfriedhöfen des 16. und 18. Jh.6 In darauffolgenden Studien konnten sie weitere Belege für die Existenz des Pesterregers in Skelettmaterial erbringen und schlossen daraus, dass die mittelalterlichen Pest- 72 | Zwischen Kräutersud und Aderlass – Einblicke in das frühe Gesundheitswesen »Seit vielen Jahren habe ich die Trepanation mehr gescheuet als die Kopfverletzungen, welche mir vorkamen; sie ist mir in den meisten Fällen als ein sicheres Mittel erschienen, den Kranken umzubringen«, schätzte noch im Jahr 1840 der bekannte Chirurg Prof. J. F. Dieffenbach das große Risiko eines Eingriffs am Schädel ein.1 Doch zahlreiche Beispiele belegen, dass Behandlungen dieser Art bereits in der Jungsteinzeit meistens erfolgreich verliefen. Die Bemühungen, einem kranken oder verletzten Mitmenschen beizustehen, dürften tief verwurzelt sein. Auf emotionaler Ebene sind primär die unmittelbaren (Familien-)Angehörigen angesprochen. Aber es gilt auch, die Arbeitskraft des Betroffenen wiederherzustellen, da sowohl in Jäger- und Sammlergruppen als auch in sesshaften Gesellschaften jedes Mitglied zumindest einen minimalen Beitrag zum Erhalt des Gemeinwesens beitragen kann. Nur ein kleiner Bruchteil der Heilmaßnahmen, die von mehr oder weniger fachkundigen Helfern durchgeführt wurden, ist an (prä-)historischen Skelettresten überhaupt erkennbar. Einige erschließen sich nur indirekt, andere belegen auf eindrückliche Weise die erstaunlichen anatomischen Kenntnisse früher Mediziner. Die Archäologie trägt durch Funde chirurgischer Instrumente, Grabreliefs u.ä. Wesentliches bei, und mit dem Aufkommen von Schriftquellen eröffnen sich zusätzliche Einblicke in die damaligen heilkundlichen Fähigkeiten.2 Sie offenbaren gleichermaßen den zunehmenden Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnisse wie auch den Einfluss von Irr- und Aberglaube über Ursache und Wirkung oder regionale Unterschiede bezüglich der Etablierung der Ärzteschaft bzw. der Auswahl therapeutischer Maßnahmen. Zu den frühesten Zeugnissen dieser Art zählt der babylonische Kodex Hammurapi aus dem frühen 17. Jh. v.Chr., eine steinerne Stele mit Gesetzestexten, in denen nicht nur die Höhe von Arzthonoraren, sondern auch drastische Strafen für Pfusch am Patienten eingraviert sind.3 Ebenso die bekannten ägyptischen Papyri »Ebers« und »Edwin Smith«, die – beide um 1550 v.Chr. – rund 900 Rezepte und Beschreibungen einer Vielzahl verschiedener Krankheiten bzw. Anleitungen zur Wundbehandlungen enthalten.4 In Lehrbüchern vom Ende des 1. Jt. n.Chr. dokumentierten Die Protagonisten | 73 Nach gelungener Wunddesinfektion und lediglich schwachen Entzündungsreaktionen verheilte Abkappung am linken Scheitelbein eines 25- bis 30-jährigen Hinrichtungsopfers aus Schwäbisch Gmünd (17.–18. Jh.). arabische Mediziner alleine 130 verschiedene Augenkrankheiten.5 Etwas später übersetzte ein Benediktinermönch im Kloster Monte Cassino einige der Texte ins Lateinische, und mancher spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Fachautor schmückte sich mit diesen Kenntnissen, indem er schlicht und einfach dort abgeschrieben hat.6 Schon im frühen 17. Jh. äußerte der schwäbische Wundarzt A. J. Ultzheimer, der über mehr als ein Jahrzehnt hinweg drei Kontinente bereist hatte, erhebliche Zweifel, ob seine hiesigen Kollegen alternative Heilmethoden überhaupt in Erwägung ziehen würden.7 Die Protagonisten Die Liste von »Berufsbezeichnungen«, die mit kurativen Tätigkeiten einhergehen, ist lang. Bereits bei paläolithischen Jägern und Sammlern dürfte es in jeder Sippe jemanden gegeben haben, der um die heilende Wirkung bestimmter Kräuter und Hilfsmaßnahmen wusste und dem – wohl nicht zuletzt ob dieser Kenntnisse – magisch-spirituelle Fähigkeiten zugestanden wurden bzw. zumindest in Teilbereichen eine gewisse Führungsrolle zukam. Man könnte ihn am ehesten als Schamanen bezeichnen. Eine Rolle, die vielleicht sogar bevorzugt von Frauen eingenommen wurde, zumal Wiederbelebung, Wiederherstellung eines Kranken oder Verwundeten sowie Fruchtbarkeit auf ähnlichen Vorstellungen beruhen. In traditionell lebenden Gesellschaften finden sich noch heute derartige Grenzgänger, die Psyche und Physis betreffende Erfahrungswerte früherer Generationen mit rituellen Handlungen verbinden. Aus dem Neolithikum sind zahlreiche überlebte Eingriffe am Schädel bekannt, die sich in bestimmten Fundregionen häufen und bereits für diese Zeit auf spezialisierte Operateure schließen lassen.8 Die Bronzezeit ist demgegenüber nur sehr schwach vertreten. Für die Römerzeit weisen Texte und Grabinschriften mehrheitlich auf männliche Ärzte hin. Doch es gab auch weibliche Standesvertreterinnen, wie das Brandgrab einer 30- bis 35-jährigen Frau aus Heidelberg-Neuenheim bezeugt, die mit berufsbezogenen Accessoires ausgestattet war.9 Eine Fülle von Informationen zum Stand der Medizin liefern etwas später die ältesten Rechtsaufzeichnungen der Germanen, die Der sog. Wundenmann aus dem »Feldtbuch der Wundartzney« von Hans von Gersdorff (1517) mit zeitgenössischen Verletzungsursachen und möglichen Lokalisationen. so genannten Leges (z.B. »Pactus legis alamannorum« oder entsprechende westgotische, burgundische, bajuwarische und langobardische Texte) aus dem 5. bis 9. Jh.10 Danach können innerhalb des Gesundheitswesens bereits zwei Strömungen unterschieden werden, eine durch die antike Heilkunde geprägte Versorgung der Oberschicht in Höfen und Klöstern sowie eine vorwiegend mündlich tradierte Volksmedizin, d. h. Laienärzte wie kräuterkundige Frauen mit wundchirurgischen Aufgaben. Die besondere Wertschätzung der Ärzte kommt u.a. dadurch zum Ausdruck, dass ihr Schwur drei andere Zeugenaussagen aufwiegt. Die studierten Ärzte des Mittelalters sind reine Theoretiker, die ihr Wissen ausschließlich aus Büchern schöpfen und Vertreter aller anderen Heilberufe wie Wundärzte, Bader und Barbiere als »niedere Handwerker« betrachten. Mitte des 12. Jh. zählen auch Chirurgen noch dazu. Eine der berühmtesten Ausbildungsstätten dieser Zeit ist die Schule von Salerno. Als Universitätsstudium etabliert sich die Medizin in der zweiten Hälfte des 13. Jh. und wenig später sind auch praktizierende Ärztinnen registriert. Bei den Arabern waren demgegenüber schon 300 Jahre früher Prüfungen für Ärzte vorgeschrieben und im 10. Jh. alleine in Cordoba 50 Krankenhäuser oder in Bagdad über 800 niedergelassene Ärzte bekannt.11 Bei uns sind noch Mitte des 18. Jh. lediglich 33 Amtsärzte für ganz Baden-Württemberg zuständig. Und während