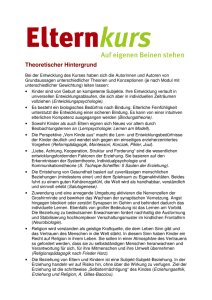Pädagogik - Schulbuchzentrum Online
Werbung

Inhaltsverzeichnis Materialien zu „Pädagogik“, 6. Auflage Inhaltsverzeichnis Zu Kapitel 1: Pädagogik als Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zu Kapitel 2: Die Möglichkeit und Notwendigkeit von Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zu Kapitel 3: Möglichkeiten und Grenzen der Erziehung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zu Kapitel 4: Grundlagen und Aufgaben der Erziehung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zu Kapitel 5: Erziehung aus Sicht der Psychoanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zu Kapitel 6: Lernen im Erziehungsprozess: die Konditionierungstheorien . . . . . . . . . . . . 28 Zu Kapitel 7: Lernen im Erziehungsprozess: kognitive Lerntheorien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zu Kapitel 8: Ziele in der Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zu Kapitel 9: Erzieherverhalten und Erziehungsstile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zu Kapitel 10:Maßnahmen in der Erziehung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zu Kapitel 11:Medien und Erziehung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Zu Kapitel 12:Erziehung in pädagogischen Einrichtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zu Kapitel 13:Erziehung außerhalb von Familie und Schule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zu Kapitel 14:Erziehung unter besonderen Bedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Zu Kapitel 15:Mensch und Sexualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zu Kapitel 16:Alternative pädagogische Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Bildquellenverzeichnis Albert Bandura: Department of Psychology, Stanford University: S. 36 Foto mit freundlicher Genehmigung von Patricia Crittenden, USA: S. 47 Fotolia GmbH Deutschland, Berlin: S. 16 (Oksana Kuzmina), 20 (bilderstoeckchen), 23 (­ xurzon), 58 (detailblick-foto) istock, Canada: S. 2 (AdamGregor), 9 (Rawpixel Ltd), 56 (COSPV), 61 ­(Ocsakayark), 71 (RapidEye), 73 (starfotograf), 78 (airdone) Cornelia Kurtz, Boppard/Bildungsverlag EINS GmbH, Köln: S. 28, 29, 45.1-2, 46 shutterstock, New York: S. 52 (bikeriderlondon) 1 2 Kapitel 1 Materialien Kapitel 1 1.Empirische (erfahrungswissenschaftliche) Methoden der ­Pädagogik Die Beobachtung 5 10 15 Sieht man die Pädagogik als Erfahrungswissenschaft, so ist sie zur Gewinnung von Erkenntnissen auf die Beobachtung angewiesen. Jedes erfahrungswissenschaftlich gewonnene Wissen geht auf eine Beobachtung irgendeiner Art zurück. Insofern können alle anderen Methoden als eine besondere Form der Beobachtung gelten. Beobachtung als wissenschaftliche Methode meint die geplante, gezielte und systematische Wahrnehmung eines bestimmten Teilbereiches der Wirklich­keit mit dem Ziel, diesen Bereich möglichst genau zu erfassen und festzuhalten. Dabei bedient man sich in der Regel geeigneter tech­nischer Hilfsmittel wie beispielsweise Beobachtungsbogen. Der Test Mithilfe eines Tests will man bestimmte psychische Merkmale erfassen und feststellen, in welchem Maße diese Merkmale bei einem Menschen ausgeprägt sind. So will zum Beispiel ein Intelligenztest die Intelligenz (= psychisches Merkmal) eines Menschen erfassen und feststellen, wie ausgeprägt sie bei einem Menschen ist. Ein Intelligenztest misst also die Intelligenz eines Menschen. Test ist die Bezeichnung für ein Messverfahren, mit dessen Hilfe die individuelle Ausprägung eines oder mehrerer psychischer Merkmale eines Menschen festgestellt werden kann. 45 50 55 Das Experiment 20 25 30 35 40 Das Experiment ist eine bestimmte Form der Beob­ achtung: Während sich eine Beobachtung auf eine bereits vorhandene Situation beschränkt, wird beim Experiment die Situation absichtlich herbeigeführt. Wenn ein Forscher beispielsweise in Schulklassen geht und wissen will, wie sich die Lehrer und wie sich in Abhängigkeit davon die Schüler verhalten, so han­delt es sich um eine Beobachtung. Gibt nun der Forscher dem Lehrer genau vor, wie er sich zu verhalten hat, um dann das Schülerverhalten als Reaktion auf das Lehrerverhalten beobachten zu können, so han­delt es sich um ein Experiment. Unter einem Experiment versteht man das absichtliche und planmäßige Herbeiführen eines Vorganges, um ihn gezielt beobachten zu können. Vorteile des Experiments gegenüber der Beobach­tung ergeben sich aus der Möglichkeit, dass der Forscher die Situation selbst bestimmen und ihre Be­ dingungen ­ verändern, variieren sowie eine experimentelle Untersuchung beliebig oft wiederholen kann. Die Befragung bzw. das Interview Die Befragung ist eine sehr weit verbreitete Technik zur Gewinnung von bestimmten Daten. Dabei werden an bestimmte Personen bzw. Personengruppen Fragen ge­stellt, die diese beantworten. 60 3 Kapitel 1 65 70 Die Befragung ist eine Technik zur Erfassung von Da­ten mithilfe der Beantwortung von Fragen, die einem bestimmten Personenkreis gestellt werden. Eine Befragung kann schriftlich oder aber auch mündlich stattfinden. Eine mündliche Befragung wird gewöhnlich „Interview“ genannt. Arbeit eingesetzt, wo sie meist als „Exploration“ bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um ein Ge­spräch, in welchem versucht wird, persönliche Pro­bleme eines Menschen zu erhellen. Quelle: Hobmair, 2010, S. 169–175, gekürzt und verändert Interview ist eine mündliche zweckgerichtete Befra­ gung, um bestimmte Daten zu erhalten. Sehr häufig wird eine Befragung in der Sozialen 2. Handlungs- bzw. Aktionsforschung 5 10 15 20 25 30 Handlungs- oder auch Aktionsforschung zielt darauf ab, als Forschung und nicht erst nach vollzogenem Forschungsprozess in die pädagogische Praxis verändernd einzugreifen. [...] Ein Konzept von Handlungsforschung geht davon aus, Praxisrelevanz und kritische Intentionen zu verbinden und empirische Forschung als eingreifende Praxis zu entwerfen, und wird von drei alternativen Grundannahmen charakterisiert: −− Erstens ist Handlungsforschung in ihrem Erkenntnisinteresse und damit in ihren Fragestellungen von Anfang an auf gesellschaftliche bzw. pädagogische Praxis bezogen, sie will zur Lö­sung gesellschaftlicher bzw. praktisch-pädagogischer Probleme beitragen. −− Zweitens greift Handlungsforschung unmittelbar in die Praxis ein, und sie muss sich daher für Rückwirkungen aus dieser von ihr selbst mitbeeinflussten Praxis auf die Fra­gestellungen und die Forschungsmethoden im Forschungsprozess selbst offenhalten. −− Drittens hebt Handlungsforschung in irgendeinem Grade bewusst und ge­zielt die Scheidung zwischen Forscher und pädagogischem Praktiker auf zuguns­ten eines möglichst direkten Zusammenwirkens von Forschern und Praktikern im Handlungsund Forschungsprozess. 1 siehe Abschnitt 1.3.2 Pädagogische Handlungsforschung wird im Kontext Kritischer Erziehungs­ wissenschaft1 somit als Innovationsforschung verstanden, als Forschung im Zu­ sammenhang mit und zum Zwecke von Reformen im Erziehungsund Bildungs­ wesen. [...] Da Handlungsforschung auf das Prinzip der kommunikativen Beteiligung der Betroffenen an Forschungsprozessen setzt und zugleich die Komplexität des je­weiligen Forschungsfeldes umfassend untersuchen will, werden kommunikati­ ons­ fördernde, qualitative Forschungsmethoden, wie z. B. Gruppendiskussionsver­ fahren oder teil­ nehmende Beobachtung, in Aktionsforschungsprojekten bevorzugt. [...] Quelle: Krüger, 20126, 35 40 45 S. 192 f., leicht verändert Dabei wird in der Tradition der Kritischen ­Erziehungswissenschaft Handlungsforschung durch zwei Merkmale bestimmt: −− Handlungsforschung zielt primär nicht auf Erkenntnis, sondern auf die Lösung praktischer Probleme. [...] −− Handlungsforschung beansprucht, das traditionelle Subjekt-Objekt-Verhältnis zwischen Forscher und Forschungsobjekt (den Versuchspersonen) in ein SubjektSubjekt-Verhältnis umzuwandeln. [...] Quelle: König/Zedler, 20073, S. 132 f. 50 55 4 Kapitel 1 3. Geisteswissenschaftliche Methoden 5 10 15 Die Hermeneutik Die Phänomenologie Ein wissenschaftliches Verfahren, das auf eine rationale und überprüfbare Auslegung und Interpretation der Wirklichkeit – hier der Erziehungswirklichkeit – abzielt, wird hermeneutisches1 Verfahren genannt. Meist wird es auf Textauslegung und Sprachanalyse beschränkt, doch es bezieht sich auch auf die Wirklichkeit als Praxisfeld. Mit Interpretation und Auslegung ist das methodische Vorgehen gemeint, mit welchem der Wissenschaftler die Wirklichkeit in ihrem Sinngehalt erfassen will (vgl. Gudjons, 201211, S. 32). Hermeneutische Verfahren dienen also dazu, die Bedeutung, den Sinn der Wirklichkeit zu erfassen und zu verstehen, es wird nicht nach Ursachen oder Gründen gefragt. Doch wie uns das Gegebene erscheint, stimmt in der Regel nicht mit dem überein, wie es seinem tatsächlichen Wesen entspricht. Wir ­betrachten eine bestimmte Sache nicht unvoreingenommen, Erfahrungen, Vorurteile, Interpretationen, Wertungen und Ähnliches lassen sie uns anders erscheinen, als sie wirklich ist. „Weil das erzieherische Verhältnis von einer spezifischen Qualität ist, ist es letzt­ lich in dieser Qualität nur hermeneutisch zugänglich; insofern wird verständlich, warum der ‚pädagogische Bezug‘ ein ent­ scheidender Grundbegriff der geistes­ wissenschaftlichen Pädagogik geworden (Danner, 20065, S. 108) ist.“ 20 25 30 Hermeneutik ist die Bezeichnung für alle methodischen Verfahren der rationalen und ­ überprüfbaren Auslegung und Interpretation der Wirklichkeit mit dem Ziel, Sinn- und Bedeutungszusammenhänge dieser zu erfassen und zu verstehen. Eine Sache, wie sie uns erscheint 60 65 Der Phänomenologie will nun die „Erscheinungen“ (Erfahrungen, Vorurteile, Wertungen, Interpretationen und dergleichen) in den Griff bekommen, um zum Wesen der Sache, so wie sie wirklich ist, vorzudringen. Es geht also darum, von einer Sache, wie sie uns erscheint, zum Wesen dieser Sache, wie sie wirklich ist, zu kommen. Am Beispiel Schule bedeutet dies, alle Voreingenommenheit, Deutungen usw. zu erfassen, um sie „ausschalten“ zu können und zum Wesen, was Schule wirklich ist, zu kommen. 40 45 50 55 Es gilt also, eine Sache auf das „Wesentliche“ zurückzuführen. Der Ausspruch „Zurück zu der Sache“ kann als Maxime der Phänomenologie gesehen werden. Rückführung das Wesen dieser Sache auf Bei der Phänomenologie als geisteswissenschaftliche Methode geht es um die Rückführung einer Sache auf ihr eigentliches Wesen, um sie so beschreiben zu können, wie sie wirklich ist, und nicht, wie sie uns erscheint. Es wird deshalb auch von einer Wesensschau gesprochen. Bei ihr geht es darum, das Konstante, das Allgemeine einer Sache herauszu1 In einem Gespräch über Schule zum Beispiel wird bald deutlich, dass „Schule“ von jedem anders gesehen wird. Sie wird von jedem so gesehen, wie sie seinem Bewusstsein erscheint. 35 herme-neúein (griech.): auslegen, aussagen kristallisieren. „Dieses Unveränderliche, Konstante, Allgemeine ist das Wesen einer 70 Sache.“ (Zierer u. a., 2013, S. 33) Das Beispiel der Pisa-Studie zeigt deutlich, wie ihre Ergebnisse ideologisch und voreingenommen interpretiert werden. Der eine sieht hierin eine Bestätigung für die Gesamtschule, der andere für eine längere gemeinsame 75 Kapitel 1 Schulzeit usw. Die Phänomenologie will nun die einzelnen Daten mit anderen Daten in Beziehung setzen, um zum Kern, zum Wesen der Sache zu kommen. So könnte etwa deutlich werden, dass die ideologischen und voreingenommenen Deutungen gar nicht zutreffen (vgl. Zierer u. a., 2013, S. 37 f.). 80 Die Dialektik 85 90 95 Die Dialektik1 als geisteswissenschaftliche Methode dient der Erkenntnisgewinnung durch das Aufdecken von Widersprüchen und Gegensätzen. Widerspruch und Gegensatz drängen nach einer Auflösung. Diese besteht in der Aufhebung des Gegensatzes. Aufheben besagt einmal ein Beseitigen des Gegensätzlichen und Widersprüchlichen und zum anderen ein Festhalten am Gemeinsamen, Übereinstimmenden. Auf diese Weise ist es möglich, das Wesen der Dinge zu erhellen und zu Erkenntnissen zu kommen. Die Schule beispielsweise soll den Einzelnen optimal fördern, zugleich hat sie eine Auslesefunktion, weil die Gesellschaft auf qualifizierten Nachwuchs angewiesen ist. Beide Positionen erweisen sich als zutreffend und notwendig, sind aber widersprüchlich. Dieser anfängliche Widerspruch geht in eine Synthese über, bis sich 100 Dialektik These Antithese Synthese neue These 1 dieser „Widerspruch“ als nur scheinbar auflöst. Ähnlich verhält es sich mit der heute sehr intensiv diskutierten Frage, ob Erziehung von der Familie oder von öffentlichen Erziehungseinrichtungen wie Kindertagesstätten übernommen werden soll. Dieser Widerspruch verlangt als Synthese nach einer Lösung, die ihn ­aufhebt. Dialektik ist eine geistes­wis­sen­schaft­liche Methode der Er­kennt­nis­ge­winnung durch das Aufdecken und Aufheben von Widersprüchen und Gegensätzen. Der erste methodische Schritt der Dialektik besteht im Setzen einer These, die durch eine Antithese verneint wird. Diese Verneinung kann ein Widerspruch oder ein Gegensatz sein und ist in­halt­lich an die These gebunden, die sie „auf­zu­heben“ versucht. Der zweite Schritt will die Aufhebung des Ge­ gen­ satzes in der Synthese, die ein Be­sei­ti­gen des Ge­gen­sätz­li­ chen und Wi­­der­sprüch­­lichen sowie ein Be­­ wah­ren des Über­­einstimmenden dar­stellt und einen neu­en, der Erkennt­nis­ge­win­­nung nä­he­ ren Zu­sam­men­hang er­­öff­net. Der Pro­zess setzt sich fort, in­dem die Synthese zu einer neuen The­se wird, die wie­de­rum durch eine An­ti­the­se verneint wird und in einer ­er­neu­ten Synthese en­det. Auf die­se Wei­se kommt man der Er­kennt­­nis­ge­win­nung immer nä­her. Karl Marx geht in seiner Theorie des Historischen Materialismus2 ebenfalls dialektisch vor: Dieser beginnt bei der ursprünglichen Einheit der Menschheit (= These) und entwickelt sich hin zu einem Zustand der Entfremdung – die Menschheit befindet sich in einem Gegensatz zur Natur (= Antithese). Daraus entfaltet sich dann auf einer höheren Ebene die Synthese des Sozialismus als Übergangsstadium zum Kommunismus. In der Pädagogik spielt die Dialektik eine große Rolle, weil sie es insbesondere bei der Setzung von Erziehungszielen oft mit Gegensatzpaaren, Antinomien3, zu tun hat. Erst die Synthese von solchen Gegensatzpaaren bringt eine neue ­Erkenntnis, wie die Erziehung aussehen kann. dialektike´ (griech.): Kunst der Gesprächsführung Nach der Theorie des Historischen Materialismus, der auf Karl Marx (1818–1883) zurückgeht, wird das Leben durch die ökonomischen Verhältnisse bestimmt, insbesondere durch die private Verfügung über die Produktionsmittel, wodurch die Mehrheit der Bevölkerung gezwungen ist, ihre ­Arbeitskraft zu verkaufen. 3 anti (griech.): gegen; nomos (griech.): Gesetz 2 5 105 110 115 120 125 130 135 140 145 6 Kapitel 1 Beispiele für solche Antinomien sind Individualität – Gemeinschaftsfähigkeit, Selbstverwirklichung – Anpassung oder Freiheit – Bindung (vgl. Zierer u. a., 2013, S. 43). 150 155 Der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun veranschaulicht diese Antinomie anhand des von Nicolai Hartmann kreierten Wertequadrats, das von Paul Helwig (1967, S. 65 ff.) bekannt gemacht wurde. Dieses erfordert ein dialektisches Denken. Kein Wert – so Hellwig – ist an sich allein schon, was Individualität er sein soll, er braucht hierzu den positiven Gegenwert. Ein Wert für sich allein verkommt (vgl. Pörksen/Schulz von Thun, 2014, S. 118). Individualität für sich allein verkommt beispielsweise zum Egoismus, sie braucht den Gegenpol der Gemeinschaftsfähigkeit. Gemeinschaftsfähigkeit allein würde zur Aufgabe der eigenen Persönlichkeit führen. Nur ­Individualität – das Ich – und Gemeinschaftsfähigkeit – das Wir – zusammen bezeichnen ein positives Ergänzungsverhältnis. Gegenpole verkommt ohne Gemeinschaftsfähigkeit zum Egoismus 160 165 Gemeinschaftsfähigkeit verkommt ohne Individualität zur Aufgabe der Persönlichkeit 4. Qualitative Forschung 5 10 Qualitative1 Methoden zielen darauf ab, Le­ bens­welten2, soziales Handeln oder Le­bens­ geschichten in den verschiedensten Bereichen von Erziehung und Bildung zu untersuchen. [...] Kennzeichen qualitativ-empirischer Forschung ist vielmehr, dass sie sich am Ziel einer möglichst gegenstandsnahen Erfassung der ganzheitlichen Eigenschaften (qualia) sozialer Felder orientiert. Charakteri­stisch für qualitative empirische Forschung ist zudem, dass sie versucht, durch einen möglichst unvoreingenommenen, unmittelbaren 1 2 Zugang zum jeweiligen so­ zialen Feld und unter Berücksichtigung der Weltsicht der dort Handelnden, aus­gehend von dieser unmittelbaren Erfahrung, Beschreibungen, Rekonstruktionen oder Struk­ turgeneralisierungen vorzunehmen. Das bedeutet auch, dass sie im Ge­gensatz zu dem streng theorie- und hypothesengeleiteten Vor­gehen der quantita­tiven empirischen Forschung bemüht ist, Abstraktionen aus Erfahrung zu gene­rieren und dabei einen Rückbezug auf diese Erfahrungen kontinuierlich aufrecht­zuerhalten. [...] qualitas (lat.): die Beschaffenheit, die Eigenschaft Lebenswelt ist derjenige Ort, an dem das Individuum handelt und ihm gesellschaftliche Verhältnisse widerfahren (vgl. Kapitel 13.1.3). 15 20 7 Kapitel 1 25 30 35 40 45 Es wird unterschieden zwischen Gegenstandsannahmen, dar­aus resultierenden forschungsmethodischen Konsequenzen sowie Vorstellungen über den pragmatischen1 Nutzen qualitativer Methoden [...]. Qualitative Forschung geht von einem Gegenstandsverständnis aus, das die soziale Welt als eine durch interaktives1 Handeln konstituierte2 Welt begreift, die für den Einzelnen, aber auch für Kollektive2 sinnhaft strukturiert ist. Wenn die soziale Welt als sinnhaft strukturierte, immer schon als gedeutete erlebt wird, so ist es im Rahmen von Sozialforschung, die sich am Handeln der Men­ schen orientiert, zunächst wichtig, die soziale Welt aus der Perspektive der Han­delnden selbst zu sehen, d. h. subjektive Sinnstrukturen nachzuzeichnen. Manche Formen qualitativer Forschung beschränken sich hierauf, andere wiederum über­schreiten die Ebene dieses Nachvollzuges, indem sie Regeln, Muster oder Struk­ turen zu erkennen suchen, die die Ebene des subjektiven Sinns überschreiten und insofern dem Handelnden nicht mehr bewusst sind, 1 2 3 gleichwohl aber folgenreiche Bedeutung für sein Handeln haben. [...] Zielt der qualitative Forschungsansatz auf eine möglichst authentische und komplexe3 Erfassung der Perspektiven der Handelnden, so ist zweitens die Offenheit des Feldzuganges eine zentrale Voraussetzung. Qualitative Forschung will dem je­weiligen Gegenstandsbereich keine vorab formulierten Theorie­ konzepte überstül­pen, sondern Verallgemeinerungen und Modelle aus der möglichst unverstellten Er­ ­ fahrung des Forschers im ­Un­ter­suchungsfeld selbst gewinnen. Der For­ schungspro­zess ist zwar durch Fragestellungen angeleitet, diese werden jedoch im Verlauf des Untersuchungsprozesses ständig modifiziert und erweitert. Theorien sind aus dem Erfahrungsprozess, aus dem Material sich entwickelnde Konstruktionen und somit gegenstandsbezogene Theorien. [...] Quelle: Krüger, 20126, S. 204 ff. pragmatisch (griech., pragmatikós): auf das Handeln bezogen, der Praxis dienend interaktiv (lat., interactio): aufeinander bezogenes Handeln zwischen zwei oder mehreren Personen konstituiert (lat., constituere: aufstellen, einsetzen): gegründet, ins Leben gerufen 50 55 60 65 8 Kapitel 2 Materialien Kapitel 2 1.Wie schlechte Förderung die kindliche Hirnentwicklung ­beeinflusst Interview von Miriam Hoffmeyer mit Anna Katharina Braun1 SZ: Die Bildungsforscher richten ihre Auf­ merksamkeit in letzter Zeit verstärkt auf den Kindergarten und die Grundschule. Ist das aus Ihrer Sicht richtig? Braun: Absolut richtig! Erfahrungen und Lernprozesse hinterlassen im kindlichen Ge­ hirn viel massivere und dauerhaftere Spuren als bei Erwachsenen. In den ersten vier bis sechs Lebensjahren entwickelt sich sozusa­ gen die Architektur des Gehirns. Damit wird die emotionale und kognitive Leistungsfä­ higkeit im späteren Leben vorgeprägt. Man könnte das mit der Formatierung einer Fest­ platte vergleichen. Damit kommt der vor­ schulischen und der frühen schulischen Bil­ dung eine viel größere Bedeutung zu als frü­ her angenommen. Eltern, Erzieher und Leh­ rer müssen sich darüber im Klaren sein, dass ihr Tun organische Veränderungen im kind­ lichen Gehirn auslöst. 5 10 15 20 SZ: Ist der Aufbau des Gehirns denn nicht ge­ netisch festgelegt? Braun: Der grobe Schaltplan schon. Aber viele Bereiche des Gehirns werden in ihrer Funktion erst nach und nach perfektioniert, darunter auch das limbische System und der präfrontale Cortex. Diese Hirnregionen sind für die Wahrnehmung und Steuerung von Emotionen zuständig und außerdem auch für Lernen und Gedächtnisleistung. Schon vor der Geburt beginnen die Nervenzellen damit, Kontakte zu anderen Nervenzellen auszubilden, die sogenannten Synapsen. Indem das Kind Sinneseindrücke verarbeitet, Erfahrungen macht, etwas lernt, entstehen nach und nach komplexe neuronale Netz­ werke. Im Alter von etwa vier Jahren ist die Zahl der Synapsen im Gehirn am Höchsten, 25 30 35 1 danach sinkt sie wieder. Denn Synapsen, die nur selten genutzt werden, verkümmern und werden schließlich abgebaut. Das geht nach dem Motto: Use it or lose it. SZ: Welchen biologischen Sinn hat das? Braun: Das Gehirn jedes Menschen passt sich auf diese Weise an seine Umwelt an. Das bie­ tet natürlich Vorteile. Ein Kind, das in der afri­ kanischen Wüste aufwächst, muss andere Verhaltensweisen und Fertigkeiten erlernen als ein Großstadtkind und entwickelt deshalb auch andere Nervennetzwerke. Leider passt sich das junge Gehirn aber auch perfekt an ungünstige Umweltbedingungen an. Defizi­ täre Elternhäuser und mangelhafte Bildungs­ systeme wirken sich zwangsläufig auf die Hirnentwicklung aus. Wenn ein Kind in den ersten Jahren emotional vernachlässigt wird, kann das zu hirnorganischen Schäden führen. So wurde bei einer Adoptionsstudie an rumä­ nischen Waisenkindern eine dauerhaft ver­ minderte Aktivität der Zellen im Präfrontal­ cortex nachgewiesen. Leider sind solche ­Fehlentwicklungen bisher so gut wie irrever­ sibel. SZ: Wie könnte man die Hirnentwicklung denn z. B. im Kindergarten optimal fördern? Momentan wird viel diskutiert, ob den Kindern mehr Programm geboten werden sollte oder ob sie beim Freispiel am meisten lernen. Braun: Eigentlich sucht sich das kindliche Ge­ hirn seine Anregungen selbst. Auch scheinbar sinnloses Spiel wird später in sinnvolle Zu­ sammenhänge einbezogen. Deshalb sollten die Erzieherinnen zwar ab und zu etwas anbieten, aber kein ununterbrochenes Animationspro­ gramm veranstalten. Das Hauptproblem liegt nna Katharina Braun erforscht die biologischen Grundlagen des Lernens. Die Professorin für ZooA logie und Entwicklungsbiologie an der Universität Magdeburg versucht herauszufinden, wie Umweltreize auf die Gehirnentwicklung wirken. 40 45 50 55 60 65 70 75 9 Kapitel 2 80 85 90 95 100 woanders: Die Erzieherinnen sind in ­Deutschland zu schlecht ausgebildet, und sie sind für viel zu viele Kinder zuständig. Sie müssen viel besser auf das einzelne Kind ein­ gehen können. Wenn Erzieherinnen darin ge­ schult würden, Kinder gezielt zu beobachten, könnten sie frühzeitig Defizite etwa beim Spracherwerb oder im emotionalen-sozialen Bereich erkennen. Dann könnte man diese Kinder präventiv fördern, noch bevor sie in die Schule kommen, wo eine Lese-RechtschreibSchwäche oder Verhal­ tensprobleme heute normalerweise erst entdeckt werden. Die früh­ zeitige Förderung ist so essenziell, weil sie in­ nerhalb der Zeitfenster stattfindet, in denen die synaptischen Netzwerke noch gut formbar sind. Deshalb wäre es auch sehr wichtig, schon im Kindergarten auf die besonderen Ta­ lente jedes Kindes einzugehen. SZ: Wichtig für die Hirnentwicklung? Braun: Ja. Im Tierexperiment konnte in den letzten Jahren gezeigt werden, dass Lern­ erfolge zu einem Glücksgefühl führen, wel­ ches über die Ausschüttung körpereigener „Glücks­drogen“ wie zum Beispiel Dopamin vermittelt wird. Auch dieses körpereigene Belohnungssystem entwickelt sich in den ersten Lebensjahren. Es wirkt als Lernmoti­ vation für das ganze Leben. Deshalb brau­ chen K ­ inder das Selbstbewusstsein, dass sie irgendetwas besonders gut können. Wenn Kinder ständig nur auf ihre Schwächen hin­ gewiesen werden, kann die Ausbildung des Belohnungssystems im Hirn gestört werden. Diese Kinder könnten sich längerfristig zu Lernversagern entwickeln. SZ: Und wenn die Motivation stimmt – wie lernt das Gehirn am effektivsten? Braun: Durch Üben und Wiederholen. Haus­ aufgaben sind nützlich! Das kann man sehr gut mit bildgebenden Verfahren sichtbar ma­ chen. Ein neuer Gedächtnisinhalt ist zu­ nächst noch instabil. Wenn das Gelernte nicht innerhalb von 24 Stunden wiederholt wird, ist die Gefahr groß, dass es im Ge­ dächtnis sozusagen überschrieben wird. Wenn ein Schüler also am Nachmittag Fern­ sehsendungen oder Computerspiele konsu­ miert, die in keinem Zusammenhang mit den Lerninhalten des Schulvormittages stehen, ist es recht wahrscheinlich, dass er das Ge­ lernte gleich wieder vergisst. Das ist übri­ gens ein gutes Argument für die Ganztags­ schule. 105 110 115 120 125 130 Quelle: Süddeutsche Zeitung Nr. 139, 20.06.2006, S. 45 2. Welche Menschen braucht die heutige Gesellschaft? −− Die heutige Gesellschaft ist eine Wissensgesellschaft. Von diesem (Nicht-)Wissen hängt das wirtschaftliche Wohlergehen der Gesellschaft und des Einzelnen ab. Das hierzu notwendige Wissen muss das Kind bzw. der Jugendliche im Laufe seines Lebens erlernen. −− Sie ist eine globalisierte Gesellschaft, das bedeutet eine über die Grenzen hinaus wirkende und vernetzte Wirtschaft, Kultur und Politik. Dadurch ist der einzelne Arbeitnehmer auf sich selbst gestellt und muss erlernen, mit den Veränderungen der Globalisierung umzugehen. −− Sie ist eine multikulturelle Gesellschaft. Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Lebenskreisen leben in einer Gesellschaft. Erzieherisch belangvoll ist, dass K ­ inder und 5 10 15 10 Kapitel 2 20 25 30 Jugendliche interkulturelle Kompetenzen erwerben und lernen, respektvoll und tolerant miteinander umzugehen. −− Sie ist eine dynamische, plurale und offene Gesellschaft. In ihr existieren vielgestaltig und nebeneinander Wert- und Normvorstellungen sowie verschiedene Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen. Der Jugendliche muss lernen, damit umzugehen, und aus dieser Vielfalt bestimmte Werte und Normen für sich verbindlich zu machen. Ebenso muss er Kritikfähigkeit er- lernen, um Interessensmanipulationen nicht zu unterliegen. −− Sie ist eine Leistungsgesellschaft, die darauf angewiesen ist, durch Prüfungen und Zertifikate eine bestimmte Ausbildung zu haben und damit für den Fortbestand und Weiterentwicklung unserer Gesellschaft zu sorgen. Die Leistung bestimmt in der Regel auch die berufliche Platzierung und das Einkommen des Einzelnen. 35 40 Quelle: Wiater, 2013, S. 30 ff. und S. 59 3. Weitere Beispiele von verwilderten Kindern Beispiel 1 5 10 15 Ein Beispiel für einen solchen Verlauf ist Anna, das uneheliche und unerwünschte Kind einer Bauerntochter. Nachdem Annas Mutter vergeblich versucht hatte, ihr Kind in einem Pflegeheim unterzubringen, sperrte sie es in ein fensterloses Zimmer auf dem Dachboden. Sie gab ihm gerade genug Milch zu trinken, dass es am Leben blieb, sprach aber nur selten mit ihm, nahm es nie in die Arme und spielte nie mit ihm. Fünf Jahre dauerte dieser entsetzliche Zustand, bis Sozialarbeiterinnen Anna entdeckten. Anna war so apathisch, dass sie zuerst glaubten, sie sei taub, geistig zurückgeblieben oder beides. Sie konnte weder gehen noch reden, sich weder allein anziehen noch selbst essen und nicht einmal kauen. Sie lachte oder weinte nie. Beobachter meinten, sie habe etwas Unmenschliches an sich. Und das stimmte. Annas Sozialisation begann erst mit sechs Jahren, als sie zu einer Pflegestelle kam. Dort erhielt sie Fürsorge und Aufmerksamkeit, so dass sie langsam anfing zu reden, zu laufen und mit anderen Kindern zu spielen. Sie lernte auch, für sich selbst zu sorgen. Kurz, sie entwickelte allmählich menschliche Interessen und Fähigkeiten. Doch sie überwand nie ganz die ersten Jahre der Vernachlässigung. Schließlich starb sie mit elf Jahren an Hepatitis. 20 25 30 Quelle: Geulen, 20073, S. 140. Beispiel 2 35 Im Jahre 1970 brachte eine Frau ein ängstliches Kind auf ein Sozialamt in Los Angeles, welches weder sprechen noch stehen und gehen konnte. Nachforschungen ergaben, dass das Kind sein bisheriges Leben angebunden auf einem Toilettenstuhl verbrachte (vgl. Scheunpflug, 2001, S. 53). Beispiel 3 Urwaldfrau nach Jahren eingefangen 45 50 Phnom Penth (AP) In Kambodscha ist nach 19 Jahren eine Frau aufgetaucht, die die ganze Zeit über in der Wildnis gelebt hat. Dorfbewohner stellten der Frau nach und brachten sie zu ihren Eltern. Rochom P’ngieng ist jetzt 27 Jahre alt und kann nicht mehr sprechen, so dass sie selbst bislang keine Auskunft zu ihrem Schicksal geben konnte, „Sie ist wie ein halber Mensch und ein halbes Tier“, sagte der Polizeichef des Bezirks Oyadao 40 in der Provinz Rattanakiri, Mao San. „Sie ist verdreht. Sie schläft tagsüber und steht nachts auf. “ Der Vater von Rochom P’ngieng sagte, er habe seine Tochter an ihren Gesichtszügen und an einer Narbe am Rücken wiedererkannt. Vater Sal Lou ist Dorfpolizist und gehört zur ethnischen Minderheit der Pnong. Seine Tochter verschwand nach gestrigen Polizeiangaben im Alter von acht Jahren, als sie in der abgelegenen Dschungelregion im Nordosten von Kambodscha Rinder hütete. 55 60 11 Kapitel 2 65 70 ­ ntdeckt wurde sie am 13. Januar von einem E Dorfbewohner, der einen Korb mit Nahrungs­ mitteln in der Nähe seines Bauernhofs vergessen hatte. Als er ihn holen wollte, war ein Teil der Nahrungsmittel verschwunden. „Der Mann be­ schloss, die Gegend abzusuchen und entdeckte einen nackten Menschen“, sagte der Polizist Chea Bunthoeun. Der Dorfbewohner holte seine Freunde, und die Gruppe fing die Frau im Dschungel ein. „Ihre Eltern hatten schon die Hoffnung auf­ gegeben, sie je wiederzusehen“, sagte Chea Bunthoeun. „Der Vater weinte und umarmte sie, als er wieder mit seiner Tochter zusam­ mentraf.“ Die junge Frau hat nach Angaben von Mao San jedoch immer noch große Schwierigkeiten, sich an das Leben im Dorf zu gewöhnen. 75 80 Quelle: Donaukurier, 19.01.2007, S. 6 Beispiel 4 2009 wurde in Chita (Sibirien) ein etwa 5-jähriges Mädchen entdeckt, das unter Hunden aufwuchs und hundeähnliches Verhalten angenommen hatte. 85 4. Misshandlung und Vernachlässigung in Deutschland 5 10 15 Im ersten Lebensjahr sterben in Deutschland mehr Kinder infolge von Vernachlässigung und Misshandlung als in jedem späteren Alter. Auch seelische Misshandlung hinter­ lässt ihre Spuren: Fehlende Zuwendung, Ge­ ringschätzung und massive Kritik schaden dem Selbstwertgefühl sowie der sozialen und emotionalen Entwicklung. Die betroffenen Kinder sind später leicht reizbar und impulsiv, neigen ver­ mehrt zu Kriminalität, Lernstörungen und psychosomatischen Beschwerden. Misshand­ lung und Vernachlässigung wurzeln meist in einer Überforderung der Eltern und ihrer feh­ lenden Sensibilität für kindliche Signale. −− Rund jedes zweite Kind in Deutschland er­ lebt minderschwere Formen von Vernachläs­ sigung, 11 Prozent schwere körperliche und 7 Prozent schwere emotionale Vernachlässi­ gung. −− 15 Prozent erleiden minderschwere und 1,6 Prozent schwere seelische Misshandlungen. −− Die Mehrheit der Eltern wendet körperliche Gewalt in Form von leichten Ohrfeigen oder einem Klaps an; 10 bis 15 Prozent schwer­ wiegendere und häufigere körperliche ­Strafen. −− Jährlich werden 3000 bis 4000 Kinder unter drei Jahren in fremde Obhut gegeben. (www.fruehehilfen.de) 20 25 30 12 Kapitel 3 Materialien Kapitel 3 1. Bereiche der Umwelt Bezüglich der Umwelteinflüsse lassen sich vier erzieherisch bedeutsame Bereiche unterscheiden: die natürliche, die kulturelle, die ökonomische und die soziale Umwelt. 5 −− Mit natürlicher Umwelt bezeichnet man die belebte und unbelebte Natur, in der der Mensch lebt, zum Beispiel die Art der Landschaft, das Klima, die Ernährung sowie tages- und jahreszeitliche Rhythmen. 10 −− Die kulturelle Umwelt meint die vom Menschen geschaffene bzw. veränderte Welt. Dazu gehören beispielsweise Formen der Verständigung wie die Sprache, Wert- und Normvorstellungen, Sitte und Brauchtum, Weltanschauungen und Überzeugungen, Massenmedien, Zeitgeist, Trends, Spielzeug oder Bücher. 15 −− Die ökonomische Umwelt bezeichnet die wirtschaftlichen Gegebenheiten wie etwa Wohnverhältnisse, Wohnbezirk, Wohnraum, Wohneinrichtung, Vermögensverhältnisse und Einkommen. −− Die soziale Umwelt umfasst den Menschen in seinen verschiedenen Organisationsformen und Beziehungen wie beispielsweise in der Familie mit ihren Verhältnissen (etwa vollständige oder unvollständige F ­amilie, Geschwisterkonstellation) im Bekanntenund Freundeskreis, in bestimmten Einrichtungen (zum Beispiel im Kindergarten, im Jugendzentrum, in der Schule), in der Gemeinde, im Stadtteil und in der Gesellschaft. Diese genannten Umweltbereiche überschneiden sich zum Teil und sind ständig Veränderungen unterworfen. Häufig werden die ­kulturellen und sozialen Faktoren zusammengenommen und als soziokulturelle Faktoren ­bezeichnet. 20 25 30 35 Umwelt bedeutet alle Einflüsse, denen ein Lebewesen von der Befruchtung der Eizelle bis zu seinem Tod von außen her ausgesetzt ist natürliche Umwelt umfasst die belebte und unbelebte Natur, in der der Mensch lebt kulturelle Umwelt umfasst die vom Menschen geschaffene bzw. veränderte Welt ökonomische Umwelt umfasst die wirtschaftlichen Gegebenheiten soziale Umwelt umfasst den Menschen in seinen verschiedenen Organisationsformen und Beziehungen 2. Gefälscht und manipuliert 5 0,771 – mit dieser Zahl konnte einfach etwas nicht stimmen. Der britische Schulpsychologe Cyril Burt1 hatte jahrzehntelang versucht, die Erblichkeit von Intelligenzleistungen einzuschätzen. [...] 1 Bei seinen Studien machte sich Burt die Tatsache zunutze, dass eineiige Geschwister genetisch zu beinahe 100 Prozent, zweieiige dagegen nur zu etwa 50 Prozent übereinstimmen. [...] Obwohl Burt im Lauf der Zeit yril Lodowic Burt (1883–1971) war zunächst Dozent für experimentelle Psychologie und für PhysioC logie an der Universität Liverpool, 1913 trat er den Dienst im London County Council bei der Schulaufsichtsbehörde an. Zu seinen Schülern gehören Hans Jürgen Eysenck und Arthur Jensen. 10 13 Kapitel 3 15 20 25 immer mehr Zwillingspaare für seine Forschung heranzog, kam er mit erstaunlicher Regelmäßigkeit auf einen Wert von 0,771 [...], welcher beschrieb, wie sehr sich eineiige Zwillinge in ihrer Intelligenz ähnelten. Damit schien die hohe Erblichkeit der Geistesgaben klar belegt zu sein. Rein statistisch war ein solcher Grad an exakter Reproduzierbarkeit bis auf die dritte Nachkommastelle allerdings extrem unwahrscheinlich. Burt galt als Pionier auf dem Gebiet der Zwillingsforschung und wurde für seine Verdienste sogar geadelt. Doch kurz nach seinem Tod stieß der amerikanische Psychologe Leon Kamin auf die verdächtige Konstante. Nach Kamins Einschätzung hatte Cyril Burt ausgehend von dem gewünschten Ergebnis – einer hohen Erblichkeit der Intelligenz – seine Daten vermutlich rückwirkend schöngerechnet. Das Ganze hatte offenbar den Zweck, die britische Sozial- und Bildungspolitik zu beeinflussen – was Burt auch gelang. Der Forscher hatte sich vehement dafür eingesetzt und schließlich durchgesetzt, dass britische Schüler auf Grundlage von IQ-Tests frühzeitig selektiert und verschiedenen Bildungseinrichtungen zugeführt wurden. Nach Burts Tod waren seine Rohdaten vernichtet worden, die Manipulationsvorwürfe gegen ihn ließen sich daher nie mit Gewissheit klären. Auf Grundlage seiner Arbeiten blieb jedenfalls Millionen Briten ein Universitätsstudium verwehrt. 30 35 40 Quelle: Wolf, 2013, S. 32 f. 45 3. Der freie Wille eines Menschen 5 10 15 Selbststeuerung darf nicht mit Selbstbestimmung gleichgesetzt werden. Selbststeuerung sagt aus, dass das Individuum „von sich aus“ seine Entwicklung beeinflusst, unabhängig davon, ob die Selbststeuerung ein Produkt von Anlage- und Umweltfaktoren ist oder ob in ihr auch ein freier Wille zur Geltung kommt. Es kann beispielsweise möglich sein, dass der Mensch seine eigene Entwicklung von sich aus so und nicht anders beeinflusst, weil er aufgrund seiner Anlagen und den gemachten Umwelterfahrungen gar nicht anders kann. Demnach wäre die Selbststeuerung eine Funktion von Anlage und Umwelt. In diesem Fall liegt keine Selbstbestimmung vor, die als subjektiv erlebte Freiheit wäre ­Illusion. In der Entwicklung eines Menschen kann aber auch ein freier Wille vorhanden sein. Diese Annahme wird als Selbstbestimmung bezeichnet im Sinne von freier Entscheidung gegenüber äußeren und inneren Einflüssen eines Menschen. Anlage und Umwelt würden also nicht festlegen, wie der Einzelne seine Entwicklung beeinflusst, die Selbststeuerung wäre eine Funktion des freien Willens. Die Frage der Selbstbestimmung wird in jüngster Zeit – wieder – heftig diskutiert. Wie in Abschnitt 3.1.2 angemerkt, vertreten e ­ inige Neurowissenschaftler die These, dass der Mensch ein biologisch festgelegtes Wesen ist, dessen Gehirn alle Entscheidungen trifft. Der Mensch verfüge nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über keinen freien Willen, Handlungen würden von Hirnarealen Selbststeuerung kann eine Funktion sein von Anlage und Umwelt oder des freien Willens, der Selbstbestimmung 20 25 30 14 Kapitel 3 35 40 45 50 55 ­ esteuert, deren Impulse nicht bewusst kontg rollierbar seien (vgl. Saß, 2010, S. 38). Dabei wird aus der Beobachtung, dass nicht der „freie Wille“ die neuronale Aktivierung einleitet, sondern umgekehrt diese Aktivierung vor dem Willensakt stattfindet, geschlossen, das menschliche Handeln sei durch Verschaltungen im Gehirn vorherbestimmt. Diese These ist jedoch nicht unumstritten und die meisten Psychologen sind sich darüber einig, dass sich eine solche Frage nicht allein auf der Grundlage der Erforschung der natürlichen Funktionsweisen des Gehirns beantworten lässt. Man wird dem Menschen in seinem Wesen und seiner Ganzheit nicht gerecht, würde man ihn lediglich auf physikalische und chemische Prozesse reduzieren. Und: Es ist nicht das Gehirn, das denkt und entscheidet, es ist der Mensch. Zudem können Individuum und sein Hirn nicht als zwei getrennte Einheiten betrachtet werden. Dies wäre ein Rückfall auf einen schon überwunden geglaubten Leib-Seele-Dualismus. Ob das Hirn unser Handeln oder das Handeln unser Gehirn beeinflusst, dürfte aus ganzheitlicher Sicht zweitrangig und unerheblich sein. „Der Mensch ist ein Bioautomat, zwar hoch komplex und niemals ganz zu erfas­ sen, doch es gibt in diesem System prinzi­ piell keinen Zufall, keinen Einbruch ir­ gendeines nicht durch Naturgesetze erklär­ (Caspary, 2010, S. 42 f.) baren Prinzips.“ Der freie Wille eines Menschen muss in einer Gesellschaft vorausgesetzt werden, auch wenn er nicht beweisbar ist. Ansonsten würden Phänomene wie Verantwortung und Schuld ihren Sinn verlieren. Ein Mensch wäre dann für seine Handlungen nicht verantwortlich, ein Straftäter wie zum Beispiel ein Mörder könnte dann rechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. 60 65 70 75 Kapitel 3 4.Begünstigende und einschränkende Bedingungen der ­Erziehbarkeit 5 Erziehung ist unterschiedlichen Umweltfaktoren ausgesetzt, die sie unterstützen oder ihr entgegenwirken können. Solche Bedingungen liegen jedoch nicht nur in der Umwelt, sie sind auch beim Erzieher und beim zu Erziehenden zu suchen. Letztlich ist es auch die Beziehung zwischen Erzieher und zu Erziehendem, die die Erziehbarkeit begünstigen oder einschränken kann. begünstigende Bedingungen der Erziehbarkeit einschränkende Bedingungen der Erziehbarkeit Umweltfaktoren günstige Familienverhältnisse: harmonische Familienatmosphäre gute ökonomische Verhältnisse günstige Wohngegend kindgerechter Wohnbezirk und -raum anregender Einfluss der Bezugsgruppe günstige gesellschaftliche Verhältnisse ungünstige Familienverhältnisse: spannungsgeladene Familienatmosphäre schlechte ökonomische Verhältnisse ungünstige Wohngegend kinderfeindlicher Wohnbezirk und -raum negativer Einfluss der Bezugsgruppe ungünstige gesellschaftliche Verhältnisse Erzieher positive Einstellung zum Kind realistische Einstellung zur Erziehung ­(„pädagogischer Realismus“) negative Einstellung zum Kind pessimistische Einstellung zur Erziehung („pädagogischer Pessimismus“) zu Erziehender gute anlagemäßige Disposition besondere Begabungen Gesundheit positive Einstellung zu sich und der Welt („optimistische Lebensgrundeinstellung“) starke Vitalität, Willensstärke begrenzte anlagemäßige Disposition geistige und/oder körperliche Behinderungen Krankheit negative Einstellung zu sich und der Welt („pessimistische Lebensgrundeinstellung“) schwache Vitalität, Willensschwäche Beziehung zwischen Erzieher und zu ­Erziehendem positive emotionale Beziehung: emotionale Wärme und Geborgenheit, hohe Wert­schätzung und Verständnis viele Anregungen und Lernhilfen negative emotionale Beziehung: emotionale Kälte, Geringschätzung und Verständnis­losigkeit, Ablehnung und Vernachlässigung wenig Anregung und Lernhilfen 15 16 Kapitel 4 Materialien Kapitel 4 1.Der Begriff „Erziehung“ nach Wolfgang Brezinka Als Erziehung werden jene Sozialen Handlungen bezeichnet, durch die versucht wird, das psychische Dispositionsgefüge anderer Men­ schen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu ver5 bessern oder (hinsichtlich jener Bestandteile, die als wertvoll angesehen wer­den, aber gefährdet sind) zu erhalten. Die neu eingeführten Merk­ male dieser vorläufigen Begriffsbestimmung müssen [...] einzeln er­läutert werden. −− Die Sozialen Handlungen, die als Erziehung bezeichnet werden, zielen auf die psychischen Dispositionen anderer Menschen. Wer erzieht, will [...] die Persönlichkeit des Educanden in irgendei­ner Hinsicht ändern. [...] Es wird nicht an aktuelle seelische Er­l15 ebnisse oder Verhaltensweisen gedacht, [...], sondern an das Ge­füge relativ dauerhafter psychischer Bereitschaften eines Men­schen, die wir als seinem Erleben und Verhalten zugrunde liegend denken. Eine 20 solche aus dem wahrnehmbaren V ­ erhalten erschlossene Bereitschaft zum ­ Vollzug haltens­ bestimmter Erlebnisse oder Ver­ weisen wird „psychische Disposi­ tion“ genannt. Kenntnisse, Hal­tungen, Einstellun­ 25 gen, Handlungsbereitschaften, Gefühls­ bereit­ schaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen usw. müssen als Dispositionen angesehen werden. [...] Es ist [...] von großer Wich­tigkeit, einzusehen, dass sie nicht auf 30 das flüchtige Erleben und (oder) Verhalten, sondern auf Bereitschaften zum Erleben und (oder) Verhalten abzielt. [...] 10 −− Die Sozialen Handlungen, die als „Erziehung“ bezeichnet werden, zielen darauf ab, in anderen Menschen psychische Dispositionen zu schaffen, vorhandene Dispositionen zu ändern oder (unter bestimm­ten Umständen) zu erhalten und den Erwerb un40 erwünschter Disposi­tionen zu verhüten. [...] 35 −− Die Sozialen Handlungen, die als „Erziehung“ bezeichnet werden, sind Versuche, das psychische Dispositionsgefüge anderer Men­ schen zu ändern oder (unter bestimmten Umständen) einige seiner Kompo­nenten zu erhalten. Es ist [...] von größter Bedeutung, schon in die Begriffsbestimmung das Merkmal aufzunehmen, dass mit Er­ ziehung ein Versuch gemeint ist: eine Handlung, durch die der Handelnde versucht, die Persön­ lichkeit des Educanden zu ändern. [...] Ob er mit seinem Handeln tatsächlich eine Änderung bewirken wird, ist zum Zeitpunkt dieses Handelns ungewiss. [...] Es gibt un­ beabsichtigte Wirkungen der Erziehung, ja sogar unerwünschte Wir­kungen oder Nebenwirkungen, die [...] als schädlich oder nach­ teilig für den Educanden zu werten sind. [...] −− Die Sozialen Handlungen, die „Erziehung“ genannt werden, sind durch die Absicht gekennzeichnet, die Persönlichkeit anderer Menschen zu fördern, sei es, sie zu verbessern, sei es, ihre wertvollen Komponenten zu erhalten. [...] Sein Dispositionsgefüge soll nicht bloß irgendwie verändert, sondern in seinem Wert ge­steigert werden. [...] Erziehen heißt in der Absicht handeln, die Persönlichkeit des Educanden zu fördern. [...] 45 50 55 60 65 −− Die Adressaten der Erziehung können Men­schen in jedem Lebensal­ter sein. 70 −− Erzieher kann jeder Mensch sein, der imstande ist, Soziale Handlungen zu vollbringen, die den Zweck haben, die Persönlich­keit anderer Menschen zu verbessern (bzw. sie in ihren wert­vollen Komponenten zu erhalten). 75 Quelle: Brezinka, 19905, S. 79–95, gekürzt 17 Kapitel 4 2. Lob der Disziplin1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Das Wechselspiel von Disziplin und Selbstdisziplin begleitet den Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Mit Recht ist die Spannung zwischen Disziplin und Selbstdis­ziplin, zwischen Zwang und Freiheit ein zentrales Thema aller Erziehung. [...] Disziplin heißt Unterordnung. Ein disziplinierter Mensch ist bereit, seine Triebe und seine Wünsche zugunsten eines höheren Zwecks zu zügeln. Dafür übt er sich in Tu­genden, die deswegen Sekundärtu­gen­den genannt werden, weil sie ihren Wert erst durch den Zweck erhalten, dem sie dienen. Disziplin beginnt immer fremdbestimmt und sollte selbstbestimmt enden, aus Disziplin soll immer Selbstdisziplin werden. Sekundärtugenden bilden das Fundament aller Kultur, der Kultur des Alltags wie der großen Meister­ werke eines Volkes. Ordnungssinn, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Fleiß – ­niemand kann leugnen, dass ohne solche Tugenden das Zusammen­leben der Menschen unerträglich wird und keine schöpferische Leis­ tung zustande kommt. Die Gründe, warum Disziplin in Verruf gekommen ist, liegen in un­ serer Geschichte und sind jeder­ mann bekannt. Die Zeit scheint gekommen zu sein, dass wir wieder beginnen können, selbstverständlich über Autorität, Disziplin und Ordnung zu sprechen. [...] Das Thema „Autorität, Disziplin und Ordnung“ ist seit den siebziger Jahren selten aufgegriffen worden. Wer es tat, galt als konservativ, was bei aufgeklärten Pädagogen so viel hieß wie rückwärtsgewandt, undif­ferenziert, flach in der Argumenta­tion. Ich bekenne mich zu dieser kon­servativen Haltung. Sie beruht auf der Auffassung, dass Erziehung Füh­rung heißt, dass Autorität und Diszi­plin das Fundament aller Erziehung bilden und dass es vor allem darauf ankommt, welchem Menschenbild die Erziehenden folgen. Mein Menschenbild ist christlich inspiriert: Der Mensch ist nicht gut von Natur – wer kann an die Güte des Menschen überhaupt noch 1 2 ernst­haft glauben nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, einem Jahrhundert, dem die Aufklärung vor­anging? –, wir sind eine „gefallene“ Natur, beschädigt von Geburt an und bedürfen der Erziehung, um „kulti­ viert“ zu werden, um zu mensch­ lichen Menschen heranzuwach­sen. Gut und Böse schlummern in der menschlichen Natur. Durch Er­ziehung sollen wir junge Menschen stärken, das Gute in sich zu wecken und das Böse zu zügeln. ­Erziehung bleibt immer eine Gratwanderung zwischen Disziplin und Liebe. Lie­be muss das Movens2 jeder Erziehung sein, denn Disziplin rechtfertigt sich nur durch Liebe zu Kindern. Aber Liebe allein genügt nicht. Heranwachsende Kinder und Ju­gendliche bedürfen der Disziplin, das heißt, sie müssen sich einem äu­ßeren Zwang unterordnen, um in die Kultur ihres Volkes und dessen Moral hineinzuwachsen. Erziehung bedeutet dann auch Gewöhnung, unendliche Wiederholung und Ein­ übung. Damit es nicht zu Dressur ab­gleitet, müssen die Erziehenden sich als höchstes Ziel setzen, die jungen Menschen zu Selbstdisziplin zu füh­ren. [...] Eltern sollten Kinder und Jugend­liche selbstverständlich verpflich­ ten, Konzerte mit ihnen zu besu­chen, Wanderungen zu machen, aber auch Pflichten in Haus und Garten zu übernehmen. Ebenso sollten wir in Schulen und Internaten Schüler au­ßerhalb des Unterrichts verpflichten, an Schulkonzerten, Theater­auf­füh­rungen und Vorträgen teilzunehmen. [...] Dieses „Erziehungsmuster“, dass ein Verhalten angeordnet wird und dann zu einer neuen Einstellung gegenüber der zunächst erzwun­genen Tätigkeit führt, gilt nach mei­ner Auffassung für die Einführung in Kultur jeder Art: Musik lernt man kennen und schätzen durch Üben und durch angeordnete Be­ suche von Konzerten, Zugang zur bildenden Kunst durch fürsorglich „erzwungene“ Besuche in Museen, Nächstenliebe durch die Ver­pflich­tung, anderen zu helfen. [...] Junge Menschen können aber nur erfolgreich Verantwortung über­nehmen, wenn ihre Haupt- er ehemalige langjährige Leiter der Schule „Schloss Salem“ am Bodensee hat mit seinem Buch D „Lob der Disziplin“ (Bernhard Bueb: Lob der Disziplin: Eine Streitschrift, Berlin, List Verlag, 2006) heftige Diskussionen ausgelöst. movere (lat.): bewegen 50 55 60 65 70 75 80 85 90 18 Kapitel 4 95 aufgabe nicht darin besteht, täglich Ordnung und Disziplin herzustellen. Wir ha­ben auch in Salem unsere Schüler in den letzten Jahrzehnten überfor­dert, weil die Übernahme von Ver­ antwortung in zu hohem Maß die Herstellung von Disziplin und Ord­nung bedeutete. Außerdem mangel­ te es ihnen selbst an Disziplin. Denn die Fähigkeit, Disziplin und Selbst­ disziplin zu üben, hing zu sehr von der persön- lichen Biografie ab. [...] Auch Salem wird sein Ziel nur er­reichen können, wenn die Sekundär­ tugenden wieder selbstverständlich anerkannt werden. Die Wieder­ ent­ deckung der Disziplin wird es vielen pädagogischen Einrichtungen erst ermöglichen, ihre Ziele zu verwirk­lichen. 100 105 Quelle: Bueb, 2007, S. 11–14, gekürzt 3. Soziologische Theorien der Sozialisation a) Die struktur-funktionale Theorie Bei der struktur-funktionalen Theorie [...] werden Strukturen (statischer Teil des Systems) und Funktionen (dynamischer Teil des 5 Systems) in ihrer Bedeutung für die Stabilität des Gesamtsystems betrachtet. Es interessieren hier Abläufe in Sub­systemen und der Austausch zwischen ihnen im Hinblick auf Funk­tionieren oder Gefährden des Systems. 10 Der Bestand einer Gesell­ schaft hängt nach Parsons maßgeblich vom Normensystem als Grundlage des Miteinanders der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft ab. Danach sind sowohl die Grundwerte [...] als auch spezielle 15 Normen, wie z. B. Rücksicht­nahme gegenüber alten Menschen, Halten von Ordnung. Es geht also beim Sozialisationsprozess darum, dass die nachwachsende Gene­ ration das Normensystem übernimmt (internalisiert) 20 und nach und nach zu Motiven eigenen Handelns macht. Der Sozialisationsprozess bringt die Übernahme von unterschiedli­chen Rollen mit sich. Hierdurch verinnerlicht der Mensch gesellschaftli25 che Normen und Werte. Aber: Rollen als Erwartungen der Gesellschaft werden nicht einfach im Sinne eines Musters für das ei­gene Handeln übernommen! Sie werden vielmehr – auch wegen ih­ rer Unschärfe, interpretiert. Der mit 30 der Fähigkeit zur Reflexivität ausgestattete Mensch, der sich selbst zum Objekt eigener Überle­gungen machen kann, modifiziert daher natürlicherweise nach eige­nem Verständnis die an ihn herangetragenen Normen und Erwar­ 35 tungen. Ggf. distanziert er sich auch von ihnen. Was bedeutet dieser Ansatz Parsons für das 1 2 pädagogische Handeln? Eine solche Theorie bezeichnet z. B. Verhaltensauffälligkeiten eines Jugendlichen als d ­ ysfunktionale Erscheinungen1. Ihnen muss durch entsprechende Maßnahmen und evtl. durch besondere Institutionen (z. B. Heime der stationären Jugendhilfe) entgegengewirkt werden. 40 b) Der symbolische Interaktionismus Beim Ansatz des symbolischen Interaktionismus2 [...] steht die alltägliche, zumeist über Sprache (d. h. über Symbole der Verständigung) vermittelte Interaktion im Mittelpunkt. Ausgangspunkt ist hier also die Mikroebene mit den Kontakten und Austauschprozessen von Menschen. Ihrem Handeln gilt das beson­dere Interesse. Welche Bedeutung Situationen, Verhaltensweisen, ja auch Gegenstände und Strukturen haben, das wird in Interaktions- ­ und Kommunikationsprozessen wahrgenommen, definiert, bestrit­ ten und ausgehandelt. Diese Prozesse beeinflussen die ­Per­sönlich­keitsentwicklung und machen sinnbezogenes Handeln erst mög­lich. Beim symbolischen Interaktionismus geht es auch darum, dass menschliches Handeln maßgeblich an die Übernahme von Rollen gebunden ist; im Zusammenhang mit diesen Rollen entwickelt sich das menschliche Selbst. Als forschungstheoretisch wichtigeres Thema gilt aber: Der Prozess des Aufbaus von Iden­tität des Individuums geschieht über symbolische Interaktionen. Hierbei wird nicht von einer schematischen Übernahme von Rollen, verbunden mit bestimmten Wertmaßstäben ausgegangen, sondern von einem Prozess mit ysfunktionale Erscheinungen sind unangemessene, nicht realitätsgerechte, selbstschädigende D und nicht zielführende Erscheinungen. siehe auch Abschnitt 4.1.2 45 50 55 60 65 70 19 Kapitel 4 75 80 produktiven Leistungen des Individuums. Bei der Interaktion gilt die Aufmerksamkeit maßgeblich den Motiven des jeweils anderen. Der Einzelne stellt sich hierbei als „Ich“ dar, das von der Situation geprägt wird („me“), aber auch selbst auf die Si­ tuation prägend wirkt („I“). Zudem sind Interaktionen stets eingela­ gert in spezifische Lebenswelten, die eigene Strukturmerkmale (z. B. Erwartungen, Deutungsmuster, Muster des Handelns) aufweisen. c) Die Kritische Gesellschaftstheorie 85 90 Die Kritische Gesellschaftstheorie [...] hat vor allem im Blick, wie durch Fördern einer zwangfreien Kommuni­kationsgemeinschaft aller, die sich über umfassende Lebenswerte verständigt, eine Auffassung überwunden werden kann, welche Umwelt und Mitwelt nur (sozial) technokratisch begreifen kann. Habermas betont die Entwicklung des sprachlich handelnden Subjekts, das unter bestimmten gesell- schaftlichen Bedingungen Ich-­Identität, kommunikative Kompetenz sowie Einfühlungsvermögen (Empathie) erwerben muss. Er schließt damit an die Kernüberlegungen des symbolischen Interaktionismus an. Nach seiner Auffassung ist davon auszugehen, dass nur derjenige, der seine Lebensgeschichte in die eigene Hand nimmt, die Verwirklichung seiner selbst schaffen kann. [...] Die Persönlichkeitsentwicklung in kritischer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich bewirkten Lebensbedingungen setzt be­stimmte Grundqualifikationen voraus, die erworben werden müs­sen: Frustrationstoleranz, Unklarheiten und Mehrseitigkeiten von Rollenerwartungen (Ambiguität1) ertragen können, ein reflektieren­ des Verhältnis gegenüber den Rollen gewinnen, verbunden mit der ­ Fähigkeit zur Distanz von einer Rolle. 95 100 105 110 Quelle: Knapp, 20034, S. 153 ff. 4. Nicht das Leben, nur die Bildung bildet Über unsere Ausgangsfrage, was man lernen müsse, wenn man künftige Anforderungen nicht hinreichend voraussehen kann, hat man nämlich schon im frühen 19. Jahrhundert nach5 gedacht, als die moderne Industriegesellschaft sich gegen die alte Ordnung durchzusetzen begann und deshalb die Zukunft ungewiss wurde. Die Antwort – vorgetragen vor allem von Wilhelm von Humboldt – lautete: Bildung. 10 [...] Sie beruht auf einer simplen Einsicht: Wenn man, wie bis dahin üblich, den Menschen lediglich für seine künftig erwarteten spezifischen Funktionen – etwa als Bauer, Handwerker, Geschäftsmann – ausbildet, dann läuft er 15 Gefahr, Veränderungen in seinem Beruf nicht mehr gewachsen zu sein. Erteilt man ihm jedoch eine grundlegende Bildung im Sinne einer „Allgemeinbildung“, wird er in den Stand gesetzt, auf Veränderungen flexibel zu reagie20 ren. Er verfügt dann über das dafür erforderliche geistige Potenzial. Allgemeinbildung kann ein Mensch in seiner Lebensumwelt allein jedoch nicht erwerben. Sie ergibt sich nicht aus der Summe dessen, was jemand für seine all1 täglichen Funktionen lernt – nicht aus den Erfahrungen der „Lebenswelt“, wie man heute sagen würde. Im Gegenteil: Je allgemeiner jemand gebildet ist, umso mehr kommt dies auch seinen speziellen Tagesaufgaben, etwa im Beruf, zugute. [...] Fazit: Die Schule kann sich nicht allein danach richten, was etwa die Wirtschaft von ihren Absolventen erwartet; denn auch die Unternehmen müssen sich auf ihre gegenwärtige Einschätzung verlassen und können künftige Entwicklungen nicht hinreichend voraussehen. Nicht vom täglichen Leben aus, sondern in Dis­tanz dazu sollen also die allgemeinen Fähigkeiten des Menschen, die die Grundlage für die Erfüllung aller einzelnen Lebensanforderungen bilden, entwickelt werden, und das kann nur durch einen Unterricht geschehen, der dazu anleitet, angemessene Vorstellungen über die Welt zu entwickeln. Das ist die grundlegende didaktische Idee der Bildung. Der Schüler soll sich durch einen „allgemein bildenden“ Unterricht einerseits die Grundlagen der natürlichen und kulturellen Welt zu Ambiguität (lat., ambiguitas): Mehr-, Doppeldeutigkeit 25 30 35 40 45 20 Kapitel 4 50 55 60 65 70 eigen machen und andererseits dabei seine wesentlichen Fähigkeiten zur Entfaltung kom­ men lassen. Das ist nur möglich, wenn der Schüler in Distanz tritt zu seinen lebensaktuellen Rollen und Erwartungen, also nicht da­ rauf fixiert bleibt. Nicht das Leben bildet, sondern nur die Bildung bildet, nämlich als Versuch, sich die objektive Welt – erforscht durch die Wissenschaften – in ihrem Zusammenhang vorzustellen und anzueignen. [...] Es geht um grundsätzlich gleichberechtigte Teilnahme an allem, was die Gesellschaft zu bieten hat – keineswegs nur um berufliche Qualifizierung. [...] Wenn sich aber erst in der Zukunft entscheidet, in welchem beruflichen und kulturellen Rahmen das Kind sich als Jugendlicher oder Erwachsener bewegen wird, entsteht eine eigentümliche Unschärfe. Das Bildungsangebot für alle Kinder muss dann nämlich relativ abstrakt entworfen werden, denn es zielt – z ­ umindest am Anfang – auf den künftigen Philosophieprofessor ebenso wie auf den ungelernten Arbeiter, [...]. Diese Unsicherheit ist der Preis, der für eine demokratisierte Bildung zu zahlen ist. [...] Wie also kann ein Schulunterricht aussehen, der solche Wahlmöglichkeiten nicht der Willkür oder dem Zufall überlässt? Damit ist die Frage nach der Werteerziehung unter den Bedingungen des Pluralismus aufgeworfen. Dafür ist offensichtlich gerade die Distanz des Bildungskonzeptes zum aktuellen Leben von großer Bedeutung, weil sie gleichsam eine Vogelperspektive schafft, von der aus die Optionen gesichtet, überprüft und erörtert werden können. [...] Bildend ist ein Unterricht also nur dann, wenn er sich nicht auf abfragbares Wissen beschränkt [...]. Vielmehr geht es darum, den Schülern eine Aneignung zu ermöglichen, die ihrer inneren Vorstellungswelt zugute kommt. Der bildende Unterricht muss also Zeit, Nachdenklichkeit und Gelassenheit zulassen. Daran mangelt es durchweg, weil die Lehrpläne von der Stofffülle her entworfen werden, als komme es nur darauf an, sich eine bestimmte Menge davon in einer bestimmten Stundenzahl einzuverleiben. Bildender Unterricht wird andererseits aber auch verfehlt, wenn die Orientierung am Schüler übertrieben wird, als könne nur er selbst herausfinden, was für ihn zu lernen wichtig sei. [...] Quelle: Giesecke, 1999, S. 54–59, gekürzt 75 80 85 90 95 100 21 Kapitel 5 Materialien Kapitel 5 1. Der klinische Fall der Anna O. 5 10 15 20 25 „Als das erste Mal durch ein zufälliges, unprovoziertes Aussprechen in der Abendhypnose eine Störung verschwand, die schon länger bestanden hatte, war ich sehr überrascht. Es war im Sommer eine Zeit intensiver Hitze gewesen, und die Patientin hatte sehr arg durch Durst gelitten; denn, ohne einen Grund angeben zu können, war es ihr plötzlich unmöglich geworden zu trinken. Sie nahm das ersehnte Glas Wasser in die Hand, aber sowie es die Lippen berührte, stieß sie es weg wie ein Hydrophobischer. [...] Als das etwa sechs Wochen gedauert hatte, räsonierte sie einmal in der Hypnose über ihre englische Gesellschafterin, die sie nicht liebte, und erzählte dann mit allen Zeichen des Abscheues, wie sie auf deren Zimmer gekommen sei und dass deren kleiner Hund, das ekelhafte Tier, aus einem Glase getrunken habe. Sie habe nichts gesagt, denn sie wolle höflich sein. Nachdem sie ihrem steckengebliebenen Ärger noch energisch Ausdruck gegeben, verlangte sie zu trinken, trank ohne Hemmung eine große Menge Wasser und erwachte aus der Hypnose mit dem Glas an den Lippen. Die Störung war damit für immer verschwunden.“ Quelle: Josef Breuer1, 20117 30 Später stellte sich [...] heraus, dass die Geschichte der Anna O. gar nicht so verlaufen war wie in den „Stu­dien über Hysterie“ dargestellt. Als Freud von „ei­ ner glücklichen Heilung“ sprach und be­haup­te­te, Anna sei „ge- sund und effizient“ daraus her­vor­ge­gangen, hatte er nicht die Wahrheit gesagt. Ber­tha Pappenheim war nicht geheilt, sie erlitt Rück­ fäl­ le und musste sogar ins Krankenhaus eingelie­fert werden. Später jedoch wurde sie auf dem Ge­biet der Sozialarbeit sehr aktiv und engagierte sich ins­besondere in der Frauenfrage. Als Frau­en­recht­le­rin wurde sie so berühmt, dass die Bundesrepublik Deutschland 1954 ihr zu Ehren eine dunkelblaue Sondermarke mit ihrem Porträt herausbrachte. Ideengeschichtlich gesehen ist der Fall Anna O. recht beunruhigend und wirft starke Schatten auf die Entstehungsgeschichte der Psychoanalyse. [...] Sollen wir nun empört sein? Angefangen von Ptolemäus über Galilei und Gregor Mendel, den Begründer der Genetik, bis zum Nobelpreisträger David Baltimore hat es immer wieder Wissenschaftler gegeben, die „geschummelt“ haben. Dafür prägte Richard ­Westfall, der über einige unbekümmerte Operationen von Isaac Newton berichtet, den Begriff „fudge factor“: ein Faktor, den man in die Berechnungen einfügt, damit sie stimmen. Bei Newton spielte dieser Faktor eine entscheidende Rolle. Aufgrund rein spekulativer Theorien „wusste“ er, wie die Ergebnisse aussehen mussten, folglich änderte er den Wert der fraglichen Parameter so lange, bis er das gewünschte Resultat erhielt. Auf diese Weise berechnete er die Schallgeschwindigkeit. 35 40 45 50 55 60 Quelle: Speziale-Bagliacca, 2000, S. 44 ff. 2.Bruder Eichmann – Auszug aus der 5. Szene des gleichnamigen Schauspiels von Heinar Kipphardt Adolf Eichmann (1906–1962) war SS-Ober­ sturm­bannführer und Leiter des Referats für die Or­ganisation der Vertreibung und Deportation der Ju­den. Er war als zentrale Figur mit1 verantwortlich für die Ermordung der Juden im weit­gehend be­setz­ten Europa. 1960 wurde er von israelischen A­gen­ten aus Argentinien entführt und nach Israel ge­ bracht. Ein Jahr J osef Breuer (1842–1925) war ein österreichischer Arzt und Philosoph. Neben Sigmund Freud gilt er als Mitbegründer der Psychoanalyse. 5 22 Kapitel 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 später wurde er zum Tode ver­ur­teilt und durch den Strang hingerichtet. Heinar Kipp­­ hardt schrieb 1982 ein Schauspiel über den Pro­zess von Adolf Eichmann, welches 1983 ur­auf­ge­ führt wurde. Eichmanns Zelle. Eichmann und die Psychiaterin Frieda Schilch. Bewachung wie beschrieben. EICHMANN: Von der Kinderstube angefangen, war bei mir der Gehorsam etwas Unumstößliches, etwas nicht aus der Welt zu Schaffendes. SCHILCH: Warum? EICHMANN: Aus meiner Erziehung, strenge Erziehung, Frau Doktor, von meinem seligen Vater. Trotz liebevoll­ster Zuneigung und Freude an mir, war er sehr streng ge­wesen, gab es keine Widerworte, musste gehorcht werden. SCHILCH: Erinnern Sie sich an bestimmte Sachen? EICHMANN: Bei den Mahlzeiten, zum Beispiel, Tischgebet, Reichen der Speisen, hieß es von Anfang an, was auf den Tisch kam, musste gegessen werden. Wer etwas nicht aß, bekam es bei der nächsten Mahlzeit wieder, bis er es auf­gegessen hatte. So lernten wir Genügsamkeit. SCHILCH: Konnten Sie Wünsche äußern, was Sie gern aßen? EICHMANN: Nein. Wir waren ja acht Kinder, sieben Söhne, eine Tochter. Es war den Kindern nicht erlaubt, während des Essens zu sprechen, nur wenn ein Kind direkt etwas gefragt wurde, durfte es antworten. Wegen schlechter Haltung, um die Arme anzulegen, aß ich eine Zeit mit Kochlöffeln zwischen den Armen und dem Oberkörper. [...] [...] Der Vater war immer die bestimmende Figur gewesen, auch in der zweiten Ehe, und stets von großem Ansehen begleitet. Sehr prinzipienfest und willensstark. SCHILCH: War es für Sie schwer, seinen Erwartungen zu genügen? EICHMANN: Wie ich noch ganz klein war, hatte ich eine Kinderlähmung, Polio, und ich musste neu gehen lernen. Einmal in der Woche prüfte er meine Fortschritte. Ich war sehr bedrückt, wenn er fand, dass ich nicht genug geübt hatte. Das ist meine erste Erinnerung, ziemlich meine erste. Auch in der Schule, lernen, ler- nen, hat es mich oft gequält, dass ich ihm nicht entspreche, als einzi­ger der Söhne, die Matura nicht erreichte, das Abitur. SCHILCH: Was für Strafen gab es? EICHMANN: Schuhputzen, Strafarbeiten, Ausgangssperre, Taschengeldentzug, Stubenarrest –. Das Schlimme für mich war nicht, wenn er schimpfte, sondern von seiner Enttäuschung sprach. [...] SCHILCH: – Wurden Sie strenger als Ihre Geschwister erzo­gen? EICHMANN: Strenger. Obwohl ich kein schwer erziehbares Kind gewesen sein soll, sondern das gerade Gegenteil da­ von, leicht lenkbar und folgsam. Weil ich der Älteste war vielleicht, der Vornamensträger, Adolf oder – ist mir nicht klar warum. SCHILCH: Fanden Sie das ungerecht? EICHMANN: Glaub ich nicht. Ich anerkannte meinen Vater als absolute Autorität, wie ich später auch meine Lehrer und Vorgesetzten als Autorität anerkannte. Als ich zur Truppe kam, schien mir das Gehorchen keinen Deut schwerer als das Gehorchen der Kinderstube. Auch in der Schule, auch in den Berufsjahren, auch da. SCHILCH: Wenn Sie sich von jemandem ungerecht behan­delt fühlten, wie haben Sie da reagiert? EICHMANN: Ich möchte als ein Beispiel erwähnen, was ich später oft den mir unterstellten Offizieren und Unteroffi­ zieren erzählte. Das war in Kloster Lechfeld gewesen, Truppenübungsplatz damals, da war irgendein Vor­kommnis gewesen in der Kompanie, das Bataillon wollte es herauskriegen und fing mit Strafexerzieren an, mit Strafexerzieren und, wie das so üblich war, war es das Robben. SCHILCH: Robben? EICHMANN: Robben. SCHILCH: Von der Robbe? EICHMANN: Robben, das später verboten wurde. Er macht es vor. Vorwärtsbewegung nur auf den Ellbogen, in diesem har­ten, schilfähnlichen Gewächs dort, Kieselsteine, nur Kieselsteine – eine ehemalige Moräne gewesen scheint‘s, und schon nach den ersten Übungen hatten sich die ersten Leute zum Revier gemeldet, sich d. u. schreiben lassen. SCHILCH: Was ist d. u.? EICHMANN: Dienstunfähig, dienstunfähig, 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 23 Kapitel 5 115 120 125 130 135 140 schon nach ein, zwei Stunden, war sehr hart gewesen. Ich hatte damals vor Ingrimm und Zorn – weil ich glaubte, es geschähe uns Unrecht – habe ich verbissen weitergerobbt, gleichgültig, ob ich der Letzte war, denn der Letzte musste immer wieder noch mal ran, und so hatte ich mir meine Ellbogen durchgerobbt, hatte auf Verbinden verzichtet, und mich nach der Mittagspause habe ich mich wieder gemeldet, nachmittags wieder Straf­ exerzieren. Kaum hatten wir die er­ sten ­Robbereien gemacht, waren meine notdürftigen Pflästerchen, die ich drauf hatte, wieder weggerobbt, und die beiden Ellbogen waren frei von Haut, lief das Blut heraus. Kurz und gut, ich blieb hier stur und robbte in meinem Zorn weiter, und so war‘s, da fiel man auf, und da avancierte ich dann nachher. SCHILCH: Wenn ich Sie recht verstehe, Sie wehrten sich gegen ein Unrecht, indem Sie rücksichtslos gehorchten? EICHMANN: Es wäre denkbar gewesen, dass das berühmte Kamel durch das Nadelöhr geht, aber undenkbar, dass ich mir gegebenen Befehlen nicht gehorcht hätte, damals. [...] SCHILCH: Gaben Sie denn so nicht klein bei? [...] EICHMANN: Nein, denn ich machte ja immer so weiter. [...] Ich wurde in dieser Zeit Unterscharführer, bekam ein Sternchen, Unteroffizier also. SCHILCH: Wollten Sie das damit erreichen? EICHMANN: Nein, nein, nein, ich hatte einen 145 solchen Zorn – SCHILCH: Wenn ich Ihre Haltung einmal zu klären versuche, da war erstens, dass sie, trotz aller Wut, gehorchten, das heißt, Sie zeigten der Autorität, dass Sie sie anerkennen – so sehr, dass Sie ihr sogar gehorchten, wenn 150 sie im Unrecht ist, selbst wenn das Sie vernichten würde. Sie signalisierten mit Ih­ rer rück­­halt­losen Unterwerfung gleichzeitig, dass Sie einen Anspruch darauf hätten, von ihr er­ hoben zu werden, zu avancieren, ein Teil der 155 ­Autorität zu werden. Kann man das so sagen? EICHMANN: Ich bin da nicht der nötige Fachmann, Frau Doktor, der diese Sa­chen erklären kann. Ich habe damals stur meinen Befehlen eben Gehorsam geleistet, und darin habe 160 ich – meine Erfüllung gefunden. SCHILCH: Auch wenn Ihnen ein Befehl ganz falsch oder Sie in Gewissenskonflikte brachte? EICHMANN: Hatte ich ihn nicht zu deuten, 165 hatte ich ihn auszuführen, denn die Verantwortung, das Gewissen, muss ja der Befehlsgeber haben, letztlich also die S ­ taatsspitze. Wenn man mir um jene Zeit, in diesem, wie es hieß, Schicksalskampf des deutschen Vol- 170 kes gesagt hätte: Dein Vater ist ein Verräter, also mein eigener Vater ist ein Verräter, und ich hätte ihn zu töten, hätte ich das auch getan. [...] Quelle: Kipphardt, 1988, S. 29–34, gekürzt 3.Narzissmus a) Die Allergrößten 5 10 [...] Als narzisstisch gelten Menschen, die besonderen Wert darauf legen, vor anderen als überlegen, großartig und unerreichbar dazustehen. Sie reden fast ausschließlich von sich, ihren Ideen und Erfolgen. Dagegen bringen sie dem, was andere zu berichten haben, wenig Interesse oder sogar offene Geringschätzung entgegen. Weil sie sich offensichtlich für etwas Besseres halten – und das andere auch gerne spüren las- sen –, werden sie oft als „arrogant“, „überheblich“ oder „eingebildet“ angesehen. [...] Die American Psychiatric Association (APA) hat in ihrem Diagnostischen Manual DSM-IV festgelegt, welche Verhaltensmerkmale eines Menschen die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung begründen: 1.ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit 2. eine starke Beschäftigung mit Fantasien von Erfolg, Macht, Schönheit 3.der Glaube, „besonders“ zu sein und nur mit „ebenbürtigen“ Personen verkehren zu können 15 20 25 24 Kapitel 5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 4.ein Verlangen nach übermäßiger Bewunderung 5. eine Anspruchshaltung, etwa auf bevorzugte Behandlung 6. eine ausbeuterische, manipulative Beziehungsgestaltung 7. mangelndes Einfühlungsvermögen 8. häufige Neidgefühle oder die Überzeugung, andere seien neidisch 9.ein arrogantes, überhebliches Auftreten. Durch diese Kategorien wird ein Typ Mensch beschrieben, der in der Realität nur selten in voller Ausprägung anzutreffen ist. Für die Diagnose genügt es daher, wenn mehr als die Hälfte der Merkmale, also mindestens fünf vorhanden sind. [...] Was die Ursachen dieser Störung betrifft, so konkurrieren im Wesentlichen zwei Theorien miteinander: Die eine besagt, die betroffenen Personen seien in der Kindheit verhätschelt und von den Eltern vor den Einschränkungen und Enttäuschungen des täglichen Lebens bewahrt worden. Daher richteten sie auch als Erwachsene noch entsprechende Erwartungen an ihre Umwelt: Sie haben schlicht keine Erfahrung mit solchen Situationen, in denen es einmal nicht nach ihrer Nase geht. Wie selbstverständlich fordern sie daher – aus ­Gewohnheit – Sonderrechte für sich. Die andere Theorie der Narzissmusentstehung betont dagegen die Abwehrfunktion des arroganten Verhaltens: Kinder haben ein starkes, natürliches Bedürfnis, von den Eltern wahrgenommen und anerkannt zu werden. Ob die Eltern diesem Bedürfnis in hinreichender Weise entsprechen, ist von zentraler Bedeutung für eine gesunde Selbstwertentwicklung. Wer jedoch in dieser Hinsicht geschädigt wurde, etwa durch andauernde Kränkung, Zurücksetzung und Missachtung, der kann sich unter bestimmten Umständen die Strategie aneignen, sich mit Gewalt Achtung zu verschaffen. Der Betroffene dreht gewissermaßen den Spieß um: Anstatt sich minderwertig, schwach und unterlegen zu fühlen, mobilisiert er enorme Kräfte, um zu beweisen, dass er Anerkennung verdient, mithalten kann, vielleicht sogar anderen überlegen ist. Nach dieser Auffassung handelt es sich um eine Überlebensstrategie im Umgang mit einem sehr fragilen Gefühl für den eigenen Wert. Beide Erklärungsansätze sind reine Hypothesen und einer wissenschaftlichen Überprüfung nach den strengen Kriterien der empi­ rischen Psychologie nur schwer zugänglich. Mehrere Beobachtungen sprechen jedoch dafür, dass ohne ein erhebliches Ausmaß von Schädigung keine ausgewachsene narzisstische Persönlichkeitsstörung entstehen kann. [...] 80 85 Quelle: Leising, 2004, S. 30 ff. b) Das Zeitalter der Narzissten Folgt man etwa Christopher Lasch und seinem Buch „Das Zeitalter des Narzissmus“ (1999), dann soll der dominierende Typus unserer Zeit der narzisstische Charakter sein. Er entstand, weil im Zuge der wohlfahrtsstaatlichen Modernisierung die Menschen aus den direkten Sozialformen der industriellen Gesellschaft – Klasse, Schicht, Familie – entlassen und in ein Netz institutio­ nalisierter Gesundheits- und Wohlfahrtsinstitutionen übergeben wurden. Die damit erzeugten bürokratischen Abhängigkeiten, „die Aushöhlung des Selbstvertrauens und der normalen bürger­lichen Fähigkeiten durch das Anwachsen gigantischer Körper­ schaften und der Staats­ bürokratie“ (Lasch, 1999, S. 284) führ­ten zu einem kalten, selbstbezogenen Charakter ohne emotio­nale, moralische oder soziale Bin­dungen. Dazu Lasch (1999, S. 288) selbst: „Unsere Gesellschaft ist also in doppeltem Sinne narzisstisch. Menschen mit narzissti­ scher Persönlichkeitsstruktur spielen [...] in der zeitgenössischen Wirklichkeit eine auffällige Rolle und bringen es häufig zu beträchtlichem beruflichem Ansehen [...]. Die moderne kapitalisti­ sche Gesellschaft [...] kitzelt auch bei jedermann narzisstische Züge heraus und gibt ihnen Nahrung.“ Unter solchen Lebens­ um­ ständen müssen sich auf Dauer ausgeprägt ich­ bezogene Persönlichkeiten entwickeln, öko­nomische und organisatorische Veränderungen fordern geradezu die Entstehung dessen, was in der Psychologie als narzisstische Persönlichkeit beschrieben wird. Übernehmen wir diese Zeitdiagnose für den Moment und behaupten also: Der Narzisst ist der neue Sozialcharakter, seine Emotionalität prägt die Gefühlskultur der Gegenwart. Auch 90 95 100 105 110 115 120 125 25 Kapitel 5 130 nach Berichten von Therapeuten und Unternehmensberatern nehmen narzisstische Störungen in der klinischen Praxis gegenwärtig zu. [...] Der Narzisst also als neuer Sozialcharakter? Eher nicht, denn diesen Typus hatte ja schon Wilhelm Hauff im Sinn, seine Eigenschaften beschreiben präzise den Charakter des Peter Munk nach seiner Herztransplantation. Der Narzisst ist der Sozialcharakter der industriellen Gesellschaft. 135 Quelle: Winterhoff-Spurk, 2005, S. 34 ff. 4. Kritische Würdigung der Psychoanalyse 5 10 15 20 25 Sigmund Freud hat nicht nur die Psychologie insgesamt und vor allem den Be­reich der Entwicklung der Persönlichkeit sehr stark beeinflusst, sondern auch das intellektuelle Leben in unserer Kultur. Für die damalige Zeit waren seine Ideen erschreckend und zugleich aufrüttelnd. Viele andere Theorien wurden zumindest teilweise als Reaktion auf die Psychoanalyse entwickelt. Es ist Sigmund Freuds großes Verdienst, die Erkenntnis von unbewussten Pro­zessen und inneren Kräften für die Entstehung und das Verständ­ nis von psychischen Fehlentwicklungen ausgewertet zu haben. Die Psychoanalyse besitzt einen hohen Erklärungswert, sie ist eine umfassende Theorie, die das komplexe mensch­ liche Erleben und Verhalten erschöpfend beschreiben und erklä­ ren kann. Sie stellt eine systematische und umfassende Kon­zeption dar, die sich zur Analyse von psychischen Vorgängen her­vorragend bewährt hat. Zudem hat sie mit ihren Erkenntnissen über die Veränderung von seelischen Zuständen und Fehlentwicklungen einen großen Einfluss auf die Pädagogik und insbesondere auf die Thera­pie ausgeübt. −− −− −− Doch die Psychoanalyse ist auch vielen Kritiken ausgesetzt, welche ihren Erklärungswert einschränken: 30 35 −− Freud räumt dem Unbewussten einen sehr großen Raum ein, das Bewusstsein habe lediglich die Funktion eines „Pressesprechers des Gehirns“ inne (vgl. Dijsterhuis, 2014, S. 28 f.). Das Bewusstsein ist auf diese Weise lediglich eine Marionette, deren Fäden vom Unbewussten gezogen werden. −− Sie sieht den Menschen als reines Triebwesen. Diese Sichtweise ist jedoch zu sehr ver­ engt; die heutige Psychologie weiß, dass der Organismus nicht nur deshalb aktiv wird, −− um Triebwünsche möglichst um­fassend zu befrie­digen und in­nere Spannungen zu vermindern. Sehr umstritten ist die Annahme eines ­Todestriebes mit seinen aggressiven Äußerungsformen, zumal Freud keine innere organische Quelle bzw. keine psychi­ sche Energie für diesen ange­ben konnte. Modernere Untersuchungen weisen darauf hin, dass Ag­gressionen insbesondere auf Erfahrungen zurückgehen. Die Annahme, dass jedes Erleben und Verhalten determiniert sind, ist nicht nachweisbar und auch sehr umstritten. Zudem wird dem Menschen durch das Fest­ gelegtsein seines Verhaltens so gut wie keine Selbst­ steuerung und Autonomie zu­gestanden. Dem Ich wird in der Psychoanalyse eine schwache Position zugestanden. Das Ich ist, wie es August Flammer (20094, S. 87 f.) formuliert, „wie ein schwacher Politiker, der dauernd Kompromisse eingehen muss, um zu überleben.“ Es ist nicht – wie Freud selbst sagt – „Herr im eigenen Haus“. Heutige Psychoanalytiker haben diesen Punkt aufgegriffen und die Freud‘sche Theorie um eine „Ich-Psychologie“ erweitert. Auch das ursprünglich psychoanalytische Grund­ verständnis vom Kind als einem passiven, hilflosen Wesen hat sich gewandelt hin zu einem aktiven Indi­viduum. Die ursprüngliche Psychoanalyse geht von der primären Feindse­ligkeit der Menschen untereinander aus. Schon der Säugling sei unsozial, potenziell gefährdet und ausschließlich von Trieben gesteuert. Indem die Umwelt, die ja die Feind­schaft verbietet, Beschränkungen auferlegt und Sank­ tio­nen ausübt, lernt man als Reaktion auf die frustrie­renden Ein­wirkungen der Umwelt, sich sozial zu verhalten. 40 45 50 55 60 65 70 75 80 26 Kapitel 5 85 Freud vertritt das Bild eines Kampfplatzes, auf welchem sich Triebe und gesellschaftliche Werte attackieren. Erst heutige Psycho­ana­lytiker korrigieren das Bild vom Menschen als „asoziales“ Wesen. „Homo homini lupus1; wer hat nach all den Erfahrungen des Lebens und der Ge­ schichte den Mut, diesen Satz zu bestrei­ ten? [...] Infolge dieser primären Feindse­ ligkeit der Menschen gegeneinander ist die Kulturgesellschaft beständig vom Zer­ fall bedroht. [...] Die Kultur muss alles aufbieten, um den Aggressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen, [...].“ (Freud, 2012, S. 102) 90 95 100 105 110 115 120 −− Ein weiterer Kritikpunkt betrifft Freuds nicht haltbare Ansichten über Frauen und die weibliche Sexualität. Er führt beispielsweise die „Minderwertigkeit“ der Frau gegenüber dem Mann auf die Penislo­ sigkeit zurück und sieht Persönlichkeitseigenschaften wie Abhän­gigkeit von anderen, Unterwürfigkeit und dergleichen als typisch „weibliche“ Eigenschaften an, die sich aufgrund von biologischen Einflüssen und des Erlebens der Penislosigkeit entwickeln. −− Für viele Wissenschaftler sind die Aussagen der Psychoanalyse zum Teil nicht wissenschaftlich fundiert: Es wird angeführt, dass sich zum einen aus dem Studium von nur sehr wenigen klinischen Fällen und zum anderen aus den Beobachtungen an einer sehr eng umschriebenen Gruppe von Menschen keine allgemeingülti­gen Gesetzmäßigkeiten für das normale Verhalten ableiten lassen. Ihre Aussagen beruhen größtenteils auf Einzelbeobachtungen und gehen mit ihren spekulativen Annahmen weit über den Einzelfall hinaus, ohne dafür Belege zu erbringen (vgl. Hautzinger/ Thies, 2009, S. 6). Zudem sind viele Aussa- 1 gen nicht nachweisbar, sondern lassen sich lediglich durch Interpretation und Deutungen von Be­ richten erschließen, die nicht überprüfbar sind. Viele Prozesse gehen unbewusst vor sich, sodass wissenschaftlich nicht festgestellt werden kann, ob es sie tatsächlich gibt. Es lässt sich neben der Annahme eines ­Todestriebes mit seinen aggressiven Äußerungsformen auch das Festgelegtsein sämtlicher Verhaltensweisen durch seelische Pro­zesse nicht belegen. Vor allem die Libidoentwicklung wird wegen ihrer offenkundigen Schwächen zunehmend auch von heutigen Psychoanalytikern abgelehnt wie etwa die orale Befriedigung durch Nahrungsaufnahme, der Säugling als passives und asoziales Wesen, das ausschließliche Erlernen der Thematik des Hergebens und Festhaltens im übertragenen Sinne, die Kastrationsangst, der Penisneid oder der Ödipuskonflikt bzw. -komplex. Freuds Lehre wurde immer wieder kritisiert, und sie ist auch heftig umstritten. Doch neuere Untersuchungen der Hirnforschung bestätigen viele Aussagen der Psychoanalyse. Das Vorhandensein von unbewussten Prozessen und der Verdrängung sowie vieles, was Freud über den Traum und die Traumdeutung geschrieben hat, findet heute wissenschaftliche Bestätigung. Aufgrund neurobiologischer Erkenntnisse der jüngsten Zeit leugnet heute kein Wissenschaftler mehr die prägende Rolle der Kindheit oder die Existenz des Unbewussten; Gedächtnisforscher arbeiten derzeit ebenso wie Freud mit dem Begriff der Verdrängung, und auch die schon tot geglaubte Annahme, Wünsche seien die Quelle der Träume, hat wissenschaftliche Bestätigung gefunden. Heutige Psychoanalytiker betonen mehr die Entwicklung der Ich-Funktionen, die Entwicklung des Selbstbildes und die Rolle früher Beziehungen, vor allem zu den Eltern bzw. lat.: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf; diese Aussage geht angeblich auf den englischen Philosophen und Staatstheoretiker Thomas Hobbes (1588–1679) zurück. 125 130 135 140 145 150 155 160 165 Kapitel 5 ­nderen Bezugspersonen (Objektbeziehuna gen). Zudem rücken sie den sozialen Gedanken mehr in den Vordergrund. 170 175 Mit dieser neuen Entwicklung nähern sich Psychoanalytiker jedoch mehr und mehr anderen Richtungen der Psychologie an wie etwa der humanistischen Psychologie oder der Individualpsychologie von Alfred Adler, der sich gerade wegen dieser kritisierten Punkte von Freud trennte. Selbst Eva Jaeggi, eine Psychoanalytikerin, die „nach wie vor fasziniert“ ist von den vielfältigen Möglichkeiten, die das psychoanalytische Theoriesystem bietet (Jaeggi, 2011, S. 16), schreibt, 1 dass viele neue Positionen der Psychoanalyse1 in so vielen Punkten von der Freud’schen Konzeption abwichen, dass sie eher in den Bereich der Humanistischen Psychologie hineinreichten als in den der psychoanalytischen (vgl. Jaeggi, 2011, S. 97). So stellt sich die Frage, warum hier von „Weiterentwicklung der Psychoanalyse“ gesprochen wird, wenn Gedankengut aus anderen psychologischen Schulen – möglicherweise in etwas abgewandelter Form – übernommen wird und sich die Psychoanalyse auf diese Weise anderen Richtungen, insbesondere der Individualpsychologie, angleicht. ls Beispiele seien hier genannt Heinz Kohut (1913 – 1981) als der Begründer der Selbstpsychologie, A Heinz Hartmann (1894–1970) mit seiner psychoanalytischen Ich-Psychologie und die Objektbeziehungstheorie, deren Pionierin Melanie Klein (188 –1960) ist. Eva Jaeggi bezieht ihre Äußerungen auf Heinz Kohut. 27 180 185 190 28 Kapitel 6 Materialien Kapitel 6 1.Die Geschichte vom kleinen Albert und der weißen Ratte1 5 10 15 20 25 Von Albert wird berichtet, dass er von Geburt an gesund und eines der am besten entwickelten Kinder war, die je an diesem Hospital untersucht wurden. Zu Beginn der Untersuchung war er neun Monate alt und emotional sehr stabil, weswegen man ihn auch für diese Untersuchung ausgewählt hatte. Bei zahlreichen Tests, bei denen er mit einer weißen Ratte, einem Kaninchen, einem Hund, einem Affen, Masken mit und ohne Haar, Baumwolle usw. konfrontiert wurde, zeigte er niemals Angst. Es wird berichtet, dass das Kind praktisch nie schrie. Lediglich durch laute Geräusche und plötzliches Wegziehen der Unterlage konnte Angst ausgelöst werden. Das laute Geräusch wurde erzeugt, indem man mit einem Hammer auf eine hängende Eisenstange schlug. [...] Im Alter von elf Monaten wurde dem kleinen Albert eine weiße Ratte gezeigt. In dem Augenblick, als das Kind mit der linken Hand nach der Ratte greifen wollte, wurde hinter seinem Rücken auf die Eisenstange geschlagen. Das Kind zuckte heftig zusammen, fiel nach vorn und verbarg sein Gesicht in der Matratze. Als später die rechte Hand die Ratte berührte, wurde wieder auf die Eisenstange geschlagen. Das Kind erschrak wieder sehr und begann zu wimmern. Nach einer Woche wurde eine ähnliche Versuchsserie durchgeführt, an deren Ende Albert sofort zu schreien begann, sobald die Ratte nur gezeigt wurde. [...] Nach fünf Tagen entwickelte Albert ähnliche (teilweise schwächere) Angstreaktionen auch beim Anblick eines Kaninchens, eines Hundes, eines Pelzmantels, bei Baumwolle usw. Die Reaktion konnte wohlgemerkt ausgelöst werden, ohne dass in diesem Versuchsdurchgang auf die Eisenstange geschlagen wurde. [...] Nach einem Monat wurde Albert noch einmal untersucht. Dabei konnte man feststellen, dass sich die bedingten emotionalen Reaktionen erhalten hatten. Lediglich war die Stärke mancher Reaktionen etwas geringer geworden. [...] Albert wurde aus dem Hospital genommen. Deswegen konnte ein Abbau nicht ausprobiert werden. 30 35 40 45 Quelle: Edelmann/Wittmann, 20127, S. 64 f., gekürzt 2. Verhaltenstherapeutische Techniken 5 Psychotherapeutische Techniken können nur von ausgebildeten Fachleuten an­ ge­ wandt werden. Der ver­ant­wor­tungs­vol­le Umgang mit solchen Techniken er­ fordert eine f­undierte psy­cho­lo­gi­sche Ausbildung. der eine Re­aktion auslöst, die mit der un­an­ge­ nehmen bzw. un­er­wünschten emo­tio­nalen Verhal­tens­weise un­ver­ein­bar ist. Zahnarztpraxis Dr. Kiefer a) Auf der Grundlage des klassischen Konditionierens Gegenkonditionierung 10 Nicht erwünschte emotionale Re­ak­ti­­o­nen und Verhaltensweisen können ab­gebaut bzw. erwünschte auf­ge­­baut wer­den, indem Personen, Ob­­jekte oder Situationen, die diese un­­­ an­ge­neh­me bzw. nicht er­wünsch­te Re­ak­ti­on auslösen, mit einem Reiz ver­bun­den werden, 1 „Ich will meinem Sohn einfach die Angst vorm Bohrer nehmen!“ Dieses Experiment wurde 1920 von den beiden Psychologen John B. Watson und Rosalie Rayner durchgeführt. 15 29 Kapitel 6 Peter, ein dreijähriger Junge, hatte Angst vor pelzartigen Gegenständen wie zum Beispiel einem Kaninchen. Um ihm diese Angst zu nehmen, wurde er in einen hohen Stuhl gesetzt und bekam Süßigkeiten, über die er sich sehr freute. Gleichzeitig wurde ihm ein Kaninchen gezeigt. Hatte Peter anfangs noch Angst, wenn das Kaninchen im Raum war, so konnte er dieses am Schluss auf den Schoß und sogar in die Hände nehmen. 20 25 30 35 40 55 60 65 Die Psychologie bezeichnet diese Vorgehensweise als Gegenkonditionierung. Von einer solchen spricht man, indem man mehrmals zeitlich und räumlich gleichzeitig den Reiz, der eine unerwünschte Reaktion zur Folge hat, mit einem Reiz koppelt, dessen Wirkung mit dieser nicht erwünschten Reaktion unvereinbar ist. Desensibilisierung Um die erwünschte Reaktion zu erhalten, hat es sich als sinnvoll erwiesen, den Reiz, der die unerwünschte Reaktion zur Folge hat, schrittweise an den neu­ en Reiz anzunähern, der eine Reaktion erzeugt, die mit diesen unerwünschten Emotionen unvereinbar ist. So wird Peter immer dann, wenn er Süßigkeiten er­hält, ein Kaninchen schrittweise nähergebracht: Be­ findet sich das Kaninchen anfangs noch am Raumende, so wird es ihm bei Erhalt von Sü­ßigkeiten allmählich immer nähergebracht, bis er dieses am Schluss auf den Schoß und sogar in die Hände nehmen kann. 45 50 ­sogenannten virtuellen Realität durchgeführt wer­den. Eine Spinnenphobie1 kann beispiels­ weise geheilt werden, indem man dem Klienten in einer Reihe von Sitzungen zu­nehmend besser erkennbare Bilder von Spin­nen zeigt, die zunächst weiter weg und sehr klein, dann aber immer näher und grö­ßer abgebildet sind. Diese Vorgehensweise wird als sy­ste­ma­ti­ sche Desensibilisierung bezeichnet und bedeutet die schrittweise An­nä­he­rung ei­nes Reizes, der das nicht erwünschte Ver­halten bzw. Erleben zur Folge hat, an den Reiz, des­ sen Re­ aktion mit dem unerwünsch­ ten Ver­­halten bzw. Erleben unvereinbar ist. Gegenkonditionierung und syste­ma­ti­sche Desensibilisierung bedingen sich ge­ genseitig und werden in der Therapie grund­sätzlich mit­ einander angewandt. Eine solche Therapie kann sowohl in der Re­ alität als auch mithilfe von Medien in einer 1 2 Spinnenphobie: Angst vor Spinnen Klient (lat.: cliens): der Hilfesuchende „Lassen Sie uns allein! Ich bin Verhal­tens­ therapeut und helfe meinem Pa­ti­en­ten, seine Höhenangst zu überwinden!“ Reizüberflutung Eine in letzter Zeit sehr häufig benutzte Vorgehensweise zum Abbau unerwünschter ­ emotionaler Reaktionen ist die Reizüberflutung. Hierbei geht der Therapeut im Vergleich zum sys­ te­ matischen Desensibilisieren den um­ gekehrten Weg. Man konfrontiert den handlung Klienten2 gleich zu Beginn der Be­ mit stark Angst ­aus­lö­sen­den Reizen und lässt ihn dabei die Er­fahrung machen, dass seine Be­ fürch­ tungen unbegründet sind und nicht eintreten. Die Behandlung kann mit­hilfe einer gedanklichen Kon­fron­ta­tion mit den jeweiligen Angstreizen er­ folgen oder indem der Klient die­sen in der Realität gegenübertritt. Ein Mann, der Angst hat, über Brücken zu ge­ hen, weil er befürchtet, diese würden einstürzen, muss sich immer wieder unter therapeutischer An­leitung lange auf Brücken aufhalten, bis sich die Erfahrung ihrer Ungefährlichkeit fest in ihm verankert und er die Angst vor ihnen verloren hat. 70 75 80 85 90 30 Kapitel 6 95 100 105 110 b) Auf der Grundlage des operanten Konditionierens Verhaltensformung zu entsprechen, bis schließlich das Endverhalten gezeigt wird. Bei komplexen Verhaltensweisen ist es für ein Kind unmöglich, diese schon beim ersten Versuch perfekt auszuführen. Deshalb sollte man jedes Verhalten, das auch nur annähernd in die gewünschte Richtung geht, positiv verstärken. Eine solche Verstärkung kleiner Teilschritte bezeichnet man als Verhaltensformung bzw. Shaping. Es bedeutet den schrittweisen Aufbau eines Verhaltens, indem man bereits kleine Schritte in Richtung des erwünschten Endverhaltens systematisch verstärkt. Das Kind kann die Schleife allein binden. Verhaltensformung lässt sich folgendermaßen durchführen: −− Nach der Formulierung des gewünschten (End-)Verhaltens wird jedes Verhalten, das dem gewünschten Endverhalten irgendwie ähnelt, sofort und regelmäßig verstärkt. Soll das Kind als Endverhalten das Schuhebinden beherrschen, dann wird es bereits verstärkt, wenn es mit jeder Hand ein Schuhband halten kann. 115 −− Wird allmählich das erwünschte Verhalten verstärkt gezeigt, das innerhalb der gewünschten Verhaltenssequenz einen Schritt bedeutet, so wird es sofort verstärkt. Kann das Kind die Schuhbänder zu einer Schleife übereinanderlegen, erfolgt eine erneute Verstärkung. 120 −− Nun werden die Verhaltensweisen verstärkt, die der letztlich erwünschten nahe- −− Dabei werden die Teilschritte und letztlich das Endverhalten so lange regelmäßig – also immer – verstärkt (kontinuierliche Verstärkung1), bis das jeweils gewünschte Verhalten gezeigt wird. Anschließend wird zu seiner Festigung zu einer gelegentlichen Verstärkung übergegangen (intermittierende Verstärkung1), bis sie schließlich ganz überflüssig wird und das Verhalten aufgrund von Gewöhnung gezeigt wird. Das Kind beherrscht schließlich irgendwann, unterstützt von den jeweiligen Verstärkungen, das Schuhebinden. Ab diesem Zeitpunkt wird es nur noch nach jedem zweiten, dritten oder vierten Mal für seine Leistung verstärkt. Nach und nach wird das Schuhebinden für das Kind keine besondere Handlung mehr, sondern Routine geworden sein. Nun verzichtet der Erzieher ganz auf die Verstärkung. −− Die Teilschritte und das erwünschte Endverhalten werden durch Übung und Wiederholung gefestigt.2 Kinder können die einzelnen Teilschritte, die sie für das Schuhebinden benötigen, trainieren, indem sie zum Beispiel die 24 Säckchen bei einem Adventskalender zuschnüren, nachdem sie in jedes der Säckchen eine kleine Aufmerksamkeit gegeben haben. Manche Kindergärten verfügen über sogenannte Schnürrahmen, mit denen sich das Binden einer Schleife ebenfalls üben und wiederholen lässt. 125 130 135 140 145 150 155 3. Schöne neue Welt 5 Päppler blieb im Entkorkungszimmer zurück, als der BUND und die Studenten mit dem nächstgelegenen Aufzug ins fünfte Stockwerk fuhren. KLEINKINDERBEWAHRANSTALT. NEO-PAWLOWSCHE NORMUNGSSÄLE, verkündete ein Schild an der Tür. Der Direktor öffnete. Sie betraten einen großen kahlen 1 2 vgl. Abschnitt 6.2.5 vgl. Frequenzgesetz in Abschnitt 6.2.1 Raum, sehr hell und sonnig; die ganze Südwand war ein einziges Fenster. Sechs Pflegerinnen [...] waren soeben dabei, Schalen voller Rosen in langer Reihe auf den Boden zu stellen [...]. Die Pflegerinnen standen stramm, als der BUND eintrat. „Stellen Sie die Bücher auf!“, befahl er kurz. 10 31 Kapitel 6 15 20 25 30 35 40 45 50 Schweigend gehorchten sie. Zwischen die Rosenschalen wurden Bücher gestellt, eine Reihe Kinderbücher [...]. „Nun bringen Sie die Kinder!“ Die Pflegerinnen eilten hinaus und kehrten nach ein paar Minuten zurück; jede schob so etwas wie einen hohen stummen Diener vor sich her, dessen vier drahtvergitterte Fächer mit acht Monate alten Kindern beladen waren [...]. „Setzen Sie sie auf den Boden!“ Die Kinder wurden abgeladen. „Nun wenden Sie sie so, dass sie die Blumen und Bücher sehn können!“ Kaum war das geschehen, als die Kinder verstummten und auf die seidig schimmernden Farbklumpen, die bunt leuchtenden Bilder auf den weißen Buchseiten loszukrabbeln begannen. [...] Aus den Reihen der krabbelnden Kinder ertönten kleine aufgeregte Schreie, freudiges Lallen und Zwitschern. [...] Der Direktor wartete, bis alle seelenvergnügt beschäftigt waren. „Und nun passen Sie auf!“, sagte er und gab mit erhobener Hand ein Zeichen. Die Oberpflegerin, die am anderen Ende des Saals vor einem Schaltbrett stand, drückte einen kleinen Hebel nieder. Ein heftiger Knall. Gellendes und immer gellenderes Sirenengeheul. Rasendes Schrillen von Alarmklingeln. Die Kinder erschraken und schrien auf, die Gesichtchen von Entsetzen verzerrt. „Und jetzt“, brüllte der Direktor, denn der Lärm war ohrenbetäubend, „werden wir die Lektion mittels eines elektrischen Schlägelchens einbläuen.“ Er winkte abermals, die Oberpflegerin drückte einen zweiten Hebel nieder. Das Plärren der Kinder hörte sich plötzlich anders an. Verzweiflung, fast Wahnsinn klang aus diesen durchdringenden Schreikrämpfen. Ihre Körperchen wanden und steiften sich, ihre Glieder zuckten wie von unsichtbaren Drähten gezogen. „Wir können durch diesen ganzen Streifen des Fußbodens elektrischen Strom schicken“, brüllte der Direktor erklärend. „Aber jetzt genug!“, bedeutete er der Pflegerin. Die Detonationen hörten auf, die Klingeln verstummten, das Sirenengeheul erstarb Ton für Ton. Die zuckenden Kinderleiber lösten sich aus ihrem Krampf, das irre Stöhnen und Schreien ebbte zu einem gewöhnlichen Angst­geplärr ab. „Geben Sie ihnen nochmals die Blumen und Bücher!“ Die Pflegerinnen gehorchten, aber bei der leisesten Annäherung der Rosen, beim bloßen Anblick der bunten Miezekatzen, Hottehü­ pferdchen und Bählämmer wichen die Kinder schaudernd zurück; ihr Geplärr schwoll sogleich wieder zu Entsetzensgeschrei an. „Beachten Sie das, meine Herren“, sagte der Direktor triumphierend, „beachten Sie das wohl!“ Bücher und Getöse, Blumen und elektrische Schläge – schon im kindlichen Geist waren diese Begriffspaare nun zwanghaft verknüpft, und nach zweihundert Wiederholungen dieser oder ähnlicher Lektionen waren sie untrennbar. Was der Mensch zusammenfügt, das kann Natur nicht scheiden. „So wachsen sie mit einem, wie die Psychologen zu sagen pflegten, ‚instinktiven‘ Hass gegen Bücher und Blumen auf. Wir normen ihnen unausrottbare Reflexe an. Ihr ganzes Leben lang sind sie gegen Druckerschwärze und Wiesengrün gefeit.“ Der Direktor wandte sich an die Pflegerin. „Schaffen Sie sie hinaus!“ Quelle: Huxley, 200966, S. 35 ff., gekürzt 55 60 65 70 75 80 85 90 32 Kapitel 6 4.Kritische Würdigung der Konditionierungstheorien 5 10 Die Forschungs­ansätze des klassi­schen und operanten Konditionierens werden dem Behavioris­mus1, einer von mehreren psychologischen Schulen, zuge­ rechnet. Dieser hat die Psychologie insgesamt und vor allem den Bereich des Lernens nachhaltig beeinflusst. Die Konditionierungstheorien können ein großes Spektrum von Verhaltensweisen ­erklären und besitzen eine große Bedeutung für die Erziehung, die Beratung und die Therapie. Das Menschenbild des Behaviorismus 15 20 25 30 35 40 45 „Die Ratschläge an den Erzieher, die man aus dem von der ‚Lerntheorie‘ entworfenen Bild des Menschen ableiten kann, laufen unmittelbar und zwingend auf eine Ehren­ rettung des alt überlieferten Grundsatzes von ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ hinaus. Dass man neuerdings aufgrund von schlechten Erfahrungen (auch an Tieren) das Zucker­ brot der Peit-sche vorzieht [...], versüßt [...] zwar das Leben, aber es ändert nichts daran, dass nach diesem Grundsatz mani­ (Metzger, 19763, S. 21) puliert [...] wird.“ Der Mensch erscheint nach „reiner“ behavioristischer Auffassung als ein Wesen, das n ­ ahezu Es muss jedoch erwähnt werden, dass sich ausschließlich von Umweltrei­ zen beherrscht die Konditionierungstheorien weiterentwiwird. Einerseits „wartet“ der Mensch, bis er mit ckelt haben und dem Menschen auch kognitiReizen konfrontiert wird, auf die er dann ent- ve Prozesse zugebilligt werden. In jüngster sprechend reagiert; andererseits richtet er sein Zeit gehen auch die Lerntheoretiker davon Verhalten nach Belohnungen und Bestrafun- aus, dass Menschen einen kognitiven Zusamgen, die aus der Umwelt kommen. Aus dieser menhang zwischen Reizgegebenheiten und Sichtweise ist der Mensch von Natur aus ein dem eigenen Verhalten bilden (vgl. Reinecker, „faules Wesen“, das erst durch bestimmte An- 20053, S. 91). reize aktiviert wird (vgl. Mietzel, 20078, S. 323). Nahezu jegliches Verhalten ist nach behavioDementsprechend findet eine einsei­tige Be- ristischer Ansicht erlernt und kann wieder vertonung der Bedeutung von Umweltfaktoren lernt werden. Burrhus F. Skinner beschreibt in für die Entwick­lung statt. Damit berücksich- seinem Buch „Jenseits von Freiheit und Würde“ tigt der Behaviorismus nicht die Möglichkeit, (1982, S. 220) seine Vision einer Gesellschaft, dass der Mensch eine aktive Selbststeuerung in der die Umweltbedingungen so manipuliert besitzt, die ihn aus der passiven Haltung der sind, dass sie das menschliche Verhalten forUmwelt gegenüber herausführt in den Bereich men. Damit verbunden ist eine optimistische der aktiven Auseinandersetzung mit ihr. Grundhaltung im Sinne einer weitgehenden Die Behavioristen haben eine eher mechanisti- Machbarkeit menschlichen Lebens. Entspresche Vorstellung vom menschlichen Verhalten, chend sind die Behavioristen der Auffassung, welches grundsätzlich mit dem „Reiz-­dass Umwelt und Erziehung alles vermag. Reaktions-Schema“ erklärt werden kann: Der Mensch „funktio­niert“ reaktiv, durch Reize aus„Gebt mir ein Dutzend gesunder, wohlge­ gelöst oder auf Verstärkung hin fixiert, ohne bildeter Kinder und meine eigene Umwelt, sich selbst einbringen zu können. Sinn, Wille in der ich sie erziehe, und ich garantiere, und Motiv als Handlungsgründe des Menschen dasß ich jedes nach dem Zufall auswähle werden geleugnet. Skinner ging deshalb auch und es zu einem Spezialisten in irgendei­ davon aus, dass Menschen keinen freien Willen nem Beruf erziehe, zum Arzt, Richter, besitzen und dieser nur Illusion sei. Künstler, Kaufmann oder zum Bettler und Dieses Menschenbild brachte der VerhaltensDieb, ohne Rücksicht auf seine Begabun­ therapie oft die Kritik ein, sie gleiche einer gen, Neigungen, Fähigkeiten, Anlagen und „Dressur“, in der der Mensch wie ein Tier mit die Herkunft seiner Vorfahren.“ (­Watson, Lob und Strafe konditioniert werde. 1997, S. 123) 1 ehavior (engl.): das Verhalten; Anhänger des Behaviorismus erforschen ausschließlich das b ­Ver­halten. 50 55 60 65 70 75 80 85 Kapitel 6 90 95 100 105 110 115 120 Der Erklärungswert der Konditionierungs­ theorien Die Konditionierungs­ theorien haben einen großen Erklärungswert. Viele menschliche Verhaltensweisen und Emotionen sind das Ergebnis von Konditionierungen. Emotionale Reaktionen wie etwa Angst oder Furcht werden auf der Grundlage des Konditionierens erlernt. Auch die Werbung bedient sich seiner, wenn sie ein Produkt mit positiven und begehrenswerten Gefühlen koppelt, um einen Kaufanreiz zu schaffen. Die Bedeutung von Lob und Belohnung, Anerkennung und Erfolg wird von keiner Seite infrage gestellt. Insofern sind die Konditionierungstheorien imstande, eine große Vielfalt von Erlebens- und Verhaltensweisen erklären zu können. Der Erklärungswert des klassischen Konditionierens bleibt jedoch auf solche Lernprozesse begrenzt, bei denen das Verhalten unter der Kontrolle eines vorausgehenden Reizes steht. Alle Lernprozesse, bei denen eine auf das Verhalten folgende Konsequenz die entscheidende Rolle spielt, können nicht mithilfe des klassischen Konditionierens erklärt werden. Der Erklärungswert des operanten Konditionierens zeigt sich bei jenen Lernprozessen, bei denen die Verhaltenskonsequenzen von entscheidender Bedeutung sind. Die Konditionie­ rungstheorien können also nur Lernprozesse aufgrund erfahrener Reize bzw. Verstärkungen erklären. Die Tatsache, dass Menschen durch Be­ obachtung anderer oder durch Einsicht ler- nen, findet im „reinen“ Be­ha­vi­o­ris­mus keine Berücksichtigung. Annahmen über Gefühle, Motive oder Gedanken, die Verhalten beeinflussen, sind nicht unmittelbar beobachtbar und da­ her vom behavioristischen Forschungsinteresse aus­ ­ ge­schlos­­sen. Diese Beschränkung auf beobachtbares Verhalten blendet jedoch Gedanken, Gefühle und Motive menschlichen Handelns völlig aus. Inne­re Vorgänge, wie etwa Gedan­ken und Gefühle, bleiben „im Dunkeln“ verborgen, wie in einer schwarzen Schachtel. Wie jedoch schon erwähnt, haben sich die Konditionierungstheorien weiterentwickelt und heute werden dem Menschen auch kognitive Prozesse zugebilligt. Eine weitere Schwäche des Behaviorismus liegt in der Vorgehensweise, die aus Tierexperimenten gewonnenen Forschungsergebnisse bedenkenlos auf das menschliche Verhalten zu übertragen. Wie jedoch anthropologische Befunde deutlich hervorheben, bestehen grundlegendste Unterschiede zwischen Mensch und Tier, die eine „Gleichsetzung“ von menschlichem und tierischem Verhalten nicht zulassen. Konsequent werden aus ­diesem Grund auch in der behavioristischen Schule kognitive Vorgängen wie etwa das ­ Erkennen, Be­ greifen, Urteilen und Denken schwer vernachlässigt. Ein Tatbestand, der der Spezies Mensch auf keinen Fall gerecht wird. Quelle: Hobmair, Band 1, 20113, S. 158 ff., verändert 33 125 130 135 140 145 150 34 Kapitel 7 Materialien Kapitel 7 1.Banduras Menschenbild und seine Abgrenzung zum Behaviorismus 5 10 15 20 25 30 35 In der Zeit des radikalen Behaviorismus wurden die lerntheoretisch orientierten Ansätze mit einem ganz bestimmten „Image“ assoziiert, das ihnen in der Vorstellung vieler Menschen auch heute noch anhaftet. Wenn ­Lerntheoretiker die Einflüsse der Umweltgegebenheiten auf das Verhalten von (meist tierischen) Organismen studierten, begriffen sie die Umweltgegebenheiten a priori1 als „unabhängige“, dem jeweiligen Organismus unausweichlich vorgegebene Einflussfaktoren, die in ganz einseitiger Weise das Verhalten zu „konditionieren“ vermochten. Das klassische Forschungsparadigma2 war die Skinner-Box. Hier demonstrierten die Experimentatoren, dass sie das Verhalten ihrer Versuchstiere (meist Ratten oder Tauben) durch gezielte Manipulationen von Hinweisreizen und Reaktionskonsequenzen unter nahezu totale Kontrolle von außen bringen konnten. Es entstand die Vision vom Organismus als einer „Lernmarionette“. Da innerpsychische Vorgänge ebenso wie Prozesse der wechselseitigen Einflussnahme zwischen Individuen und ihrer Umwelt zunächst nahezu völlig ausgeklammert blieben, gerieten die Lerntheoretiker zunehmend in das Zwielicht eines absoluten Umweltdeterminismus. Zu diesem Image trugen vor allem Watson und Skinner durch entsprechende Manifeste und zahlreiche Buchveröffentlichungen auch selbst aktiv bei. Inzwischen ist die Forschung längst differenzierter geworden. Albert Bandura gehört zu den führenden Köpfen einer neuen Forschungsrichtung, die sich in drei wesentlichen Punkten vom herkömmlichen behavioristischen Ansatz unterscheidet: 1 2 3 1.Lernen wird an Menschen untersucht und als aktiver, kognitiv gesteuerter Verarbeitungsprozess gemachter Erfahrungen verstanden. Die hierbei wirksamen kognitiven Operationen stellen in allen ihren Einzelheiten den Hauptgegenstand der wissenschaftlichen Forschungsarbeit dar. Ein besonderes Schwergewicht liegt auf der Fähigkeit der Menschen zum symbolischen Lernen und zum „stellvertretenden“ Lernen aus dem Miterleben der Erfahrungen anderer. 2.Das aktuelle Verhalten von Menschen wird nicht mehr als automatisches konditioniertes Reagieren auf determinierende Kontingenzen3 seitens der äußeren Umwelt verstanden. Das Handeln der Menschen wird vielmehr als aktiver Prozess begriffen, bei dem Motivationen, emotionale Empfindungen und komplexe Denkprozesse eine entscheidende Rolle spielen. 3.Da die Menschen nicht mehr als rein passiv formbare Marionetten äußerer Umwelteinflüsse beschrieben werden, ergibt sich ein optimistischeres Menschenbild. B ­andura analysiert gewissermaßen stärker aus der Perspektive des handelnden Menschen selbst als aus der Perspektive des manipulierenden Experimentators. Dem Menschen wird vom Psychologen Albert Bandura nicht mehr die Rolle eines reinen Forschungsobjekts zugewiesen, das man nach Belieben durch Einsatz gezielter Techniken manipulieren kann, ohne sich vorher mit ihm selbst beraten zu haben. Quelle: Bandura, 1991, S. 7 f. a priori: von vornherein, ohne Erfahrungsgrundlage Forschungsparadigma heißt Forschungsbeispiel. „Determinierende Kontingenzen“ bedeutet in diesem Zusammenhang „einflussreiche Beziehungen zwischen Verhalten und den nachfolgenden Konsequenzen“. 40 45 50 55 60 65 70 35 Kapitel 7 2. Rocky: ein klassisches Experiment 5 10 15 20 25 30 35 An den Einzelversuchen nahmen je 33 Jungen und Mädchen im Alter von dreieinhalb bis sechs Jahren teil, die alle den gleichen Kindergarten besuchten. Zu Beginn des Experiments wurden die Kinder nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen mit je elf Jungen und Mädchen eingeteilt. Ein weiblicher Versuchsleiter führte alle Experimente durch. −− In der ersten Phase, der Lernphase (Beobachtungsphase), sah jedes Kind einen speziell für diesen Zweck gedrehten Film, der mithilfe technischer Tricks über den Fernsehschirm ablief. Alle Kinder sahen den gleichen Film; lediglich der Ausgang des Films war für jede der drei Gruppen verschieden. Der Film enthielt vier physische und vier verbale Aggressionsäußerungen, also acht Aggressionen; diese wurden im Film zweimal wiederholt. (1 + 2) „Rocky“, die Modellperson, ging auf eine lebensgroße aufgeblasene Plastikpuppe zu, setzte sich darauf und boxte sie mehrmals auf die Nase. Die begleitende verbale Aggression dazu war: „Puh, direkt auf die Nase, bum-bum.“ (3 + 4)Rocky stellte die Puppe senkrecht auf und schlug mit einem großen Holzhammer auf ihren Kopf ein. Dazu die Worte: „Verdammt … bleib stehen.“ (5 + 6)Mit gut gezielten Fußtritten beförderte er die Puppe quer durch den Raum. Sein Kommentar dazu, in aggressivem Tonfall: „Flieg weg.“ (7 + 8)Schließlich warf Rocky Gummibälle nach der Puppe und rief lauthals bei jedem Wurf: „Päng!“ Der Film fand, je nach experimenteller Gruppe, ein anderes Ende. • D ie elf Kinder der ersten Gruppe sahen, dass Rockys Aggressionen belohnt wurden, d. h., ein Erwachsener überschüttete ihn mit Süßigkeiten und lobenden Worten („großer Held“, „starker Champion“ usw.). • Bei der zweiten Gruppe wurde Rocky bestraft: Der Erwachsene schlug ihn mit einer aufgerollten Zeitung, bezeichnete ihn als „brutalen Kerl“. • Bei der dritten Gruppe blieben Rockys Aggressionen ohne jegliche Konsequenz: Er wurde weder bewundert und gelobt noch bestraft. −− In der zweiten Phase (spontane Imitationsphase) wurden die Kinder einzeln in ein Spielzimmer gebracht, in dem sich neben neutralem Spielzeug (Plastiktiere, Puppenstube usw.) auch die Gegenstände befanden, die vorher im Film zu sehen gewesen waren (lebensgroße aufblasbare Plastikpuppe, drei Gummibälle, Holzhammer). Jedem Kind wurde ausdrücklich erklärt, dass es mit allen Gegenständen spielen dürfe. Daraufhin verließ der Versuchsleiter den Raum und ließ das Kind zehn Minuten lang durch eine Einwegscheibe von einer Person beobachten, die nicht wusste, zu welcher experimentellen Gruppe das Kind gehörte. Ergebnisse kein Ansporn Mittelwert der Ausführung verschiedener Nachahmungsreaktionen positiver Ansporn 4 3 2 1 0 Jungen Mädchen belohntes Modell Jungen Mädchen bestraftes Modell Jungen Mädchen ohne Konsequenzen 40 45 50 55 60 65 70 36 Kapitel 7 75 80 −− In der dritten Phase (Verstärkungsphase) forderte der Versuchsleiter das Kind ausdrücklich auf, Rockys Aggressionsverhalten zu imitieren; außerdem wurde ein motivierender Anreiz gesetzt, d. h., für jede imitative Reaktion erhielt das Kind ein hübsches Abziehbild usw. Die Befunde (= durchschnittliche Anzahl der imitierten aggressiven Verhaltensweisen) zeigen deutlich, dass in der spontanen Imitationsphase (Phase 2) weniger Aggressionen aufge- treten sind als in der Verstärkungsphase (Phase 3), obwohl die Kinder keine Gelegenheit gehabt hatten, den Film zwischen diesen beiden Phasen noch einmal zu sehen. Dieser Unterschied wird bei den Mädchen der zweiten Experimentalgruppe (Modellperson wird bestraft) besonders deutlich. 85 Quelle: Bredenkamp u. a., 1985, S. 9 3.Kognitive Strategien zur Entlastung des Gewissens im Rahmen der Selbst­regulierung 5 10 15 Selbstabschreckende Konsequenzen werden im Allgemeinen dann am stärksten aktiviert, wenn die ursächliche Verbindung zwischen tadelnswertem Verhalten und seinen schädlichen Auswirkungen eindeutig zutage tritt. Es gibt jedoch verschiedene Wege, wie sich ­ kritikwürdiges Verhalten gelegentlich gegen selbstbewertende Konsequenzen abschirmen lässt. Zuallererst kann durch kognitive Umstrukturierung schuldhaften Verhaltens der Anschein der Rechtschaffenheit verliehen werden. Eine Möglichkeit, tadelnswertes Verhalten zu einem persönlich und sozial akzeptablen Verhalten umzudefinieren, besteht darin, es so darzustellen, als diene es moralischen Zwe- 1 2 „Euphemistisch“ heißt „beschönigend“. „Rabulistisch“ heißt „haarspalterisch“. cken. Im Laufe der Zeit haben ehrenhafte, moralische Menschen namenlose Grausamkeiten im Zeichen religiöser Grundsätze, hochmoralischer Ideologien und der sozialen Ordnung verübt. Handlungen, die die Person selbst gutheißt, lassen sich auch dadurch rechtfertigen, dass man sie mit schlimmeren Vergehen gegen die Menschlichkeit vergleicht. Je übertriebener die Vergleichspraxis, umso geringfügiger werden die eigenen tadelnswerten Handlungen erscheinen. Auch euphemistische1 Ausdrucksweisen sind sehr geeignet, tadelnswerte Tätigkeiten zu maskieren oder ihnen sogar einen achtbaren Status zu verschaffen. Durch rabulistische2 20 25 30 37 Kapitel 7 35 40 45 50 55 60 65 Gedankenführung lässt sich aus bösartigem Verhalten wohlmeinendes machen. Wer zu diesem Mittel greift, braucht sich nicht als Urheber der Tat zu fühlen. Moralische Rechtfertigungen und beschönigende Darstellungen sind besonders wirksame Enthemmungsfaktoren, weil sie nicht nur selbstgeschaffene Abschreckungsmittel aus dem Wege räumen, sondern die Selbstbelohnung in den Dienst unmenschlichen Verhaltens stellen. Was eben noch moralisch untragbar war, wird durch solche Umdefinitionen zu einer Quelle der Selbstachtung. Es gibt noch eine weitere Gruppe von Wegen, wie man sich selbst vor Selbstkritik bewahren kann. Man kann beispielsweise die Beziehung zwischen den eigenen Handlungen und den Wirkungen, die diese hervorrufen, verschleiern oder entstellen. Menschen verhalten sich auf eine Weise, die sie normalerweise ablehnen, wenn eine gesetzliche Autorität ihr Verhalten sanktioniert und die Verantwortung für die Handlungskonsequenzen übernimmt. [...] Nach Abschiebung der Verantwortung haben Menschen das Gefühl, man könne ihnen ihre Handlungen nicht persönlich zur Last legen. Auf diese Weise umgehen sie die negative Selbstzensur. Ebenso wenig Grund zur Selbstkritik liegt vor, wenn die Verbindungen zwischen einem Verhalten und seinen sozialen Konsequenzen dadurch verschleiert werden, dass die Verantwortung für das schuldhafte Verhalten vernebelt wird. Durch Arbeitsteilung, Zersplitterung der Verantwortung und kollektives Handeln können Menschen sich schädlich verhalten, ohne dass irgendjemand sich persönlich verantwortlich fühlen muss. Deshalb handeln sie unbedenklicher, wenn die Verantwortung durch kollektive Zweckdienlichkeit verschleiert wird. [...] Verhaltenshemmende Selbstbestrafungsreaktionen lassen sich ferner dadurch schwächen, dass man sich ein falsches Bild von den Konsequenzen seines Handelns macht. Wenn sich Menschen um des persönlichen Nutzens willen oder aus anderen Gründen für Handlungsweisen entscheiden, die sie missbilligen, neigen sie dazu, den Schaden zu verharmlosen, den sie verursachen. Solange sie sich um die schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens nicht kümmern, werden selbstkritische Reaktionen kaum aktiviert werden. Die Stärke von Selbstbewertungsreaktionen hängt zum Teil davon ab, welches Bild sich die Handelnden von den Menschen machen, auf die sich ihr Handeln richtet. Die Misshandlung von Menschen, die gar nicht als Menschen angesehen oder die abgewertet werden, wird weniger Selbstmissbilligung wachrufen, als wenn den Opfern Menschenwürde zugebilligt wird. Werden Menschen als minderwer­ tige Geschöpfe wahrgenommen, werden sie für gefühllos gehalten: Sie brauchen eine grobe Behandlung, damit sie überhaupt reagieren. Die Entmenschlichung der Opfer dient also dazu, die Selbstbestrafung für grausames Handeln zu vermindern [...]. 70 75 80 85 90 95 Quelle: Bandura, 1991, S. 159 f., gekürzt 4.Ein Modell menschlicher Informationsverarbeitung 5 Im Folgenden soll ein Grundmodell mensch­licher Informationsverarbeitung entwickelt werden. In dem Modell werden drei Abschnitte unterschie­ den, die eng miteinander zusammenhängen, sich ge­genseitig beeinflussen und nur analytisch voneinan­der getrennt wer­den können: −− Aneignung −− Speicherung −− Abruf 10 Die Phase der Aneignung, in der Infor­ mations­aufnahme und -verarbeitung stattfin- den, wird auch als Lernen im engeren Sinn, die Phase der Speicherung als Ge­dächtnis im engeren Sinn und die abgerufene Information als Leistung (Performanz) bezeichnet. Am Anfang dieser Sequenz steht die Wahrnehmung der Außenreize. Wahrnehmung ist kein passiver Pro­zess, vergleichbar einer fotografischen Aufnahme. Wenn man von einer Organisation der Wahrneh­ mungsprozesse spricht, dann bedeutet dies besonders psychische Verarbeitung der Eindrücke aufgrund früherer Erfahrungen. Hierbei sind Wissen, Gefühle und 15 20 38 Kapitel 7 25 30 Motive gleichermaßen bedeutsam. Wahrneh­ mung ist häufig bedürfnisgesteuert und s ­ elektiv. Auch wenn das Material nach dieser aktiven Bear­ beitung (Enkodierung) im Langzeitgedächtnis ge­speichert ist, unterliegt es weiteren Veränderungen. Im Gedächtnis erfolgt nicht nur eine mentale Re­ präsentation von Sachwissen, es ist zudem die Vor­aussetzung für die Verhaltensregulation. Entwickelt und Input (Reiz) Informations-Informationsverarbeitungspeicherung Aneignung 45 gespeichert werden auch Handlungskonzepte. Solche Handlungspläne beeinflussen ihrerseits wie­der die Informationsaufnahme. Ein erfolgreicher Abruf (Dekodierung) der Gedächt­nisinhalte nach einer mehr oder minder langen Zeit­spanne hängt eng mit der Art der Verarbeitung bei der Aneignung (Enkodierung) zusammen. Da das Material sehr häufig nicht mehr in allen Einzelhei­ten erinnert wer- Speicherung den kann, ist eine (aktive) Rekon­ struktion notwendig. Lernen, Gedächtnis und Leis­tung nach dem Modell eines Videorekorders zu sehen, ist demnach völlig verfehlt. Ältere Theorien beschreiben das Gedächtnis Output Leistung Abruf als einen eher passiven Speicher und die heutigen Auf­fassungen sehen Gedächtnis als Teil der Informa­ti­ons­ver­ar­beitung. Quelle: Edlemann/Wittmann, 20127, S. 104 f. 35 40 39 Kapitel 8 Materialien Kapitel 8 1.Verschiedene Sichtweisen zur Setzung von Erziehungszielen 5 10 15 20 Wie in Kapitel 1.3.2 ausgeführt, kann man kaum von der Pädagogik schlechthin sprechen, sondern allenfalls von dieser oder jener Auffassung, die uns als Richtungen bzw. Schulen der Pädagogik bekannt sind. Dies hat auch zu unterschiedlichen Sichtweisen im Hinblick auf die Setzung von Erziehungszielen geführt. skriptive) Aussagen treffen. Pädagogische Ziele und Normen können damit weder verbindlich gesetzt noch b ­ egründet werden, sie sind jedoch kritisch überprüfbar. 1. Erziehungsziele in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik1 Sowohl der geisteswissenschaftlichen als auch der empirischen Erziehungswissenschaft wurde vorgeworfen, dass sie bei der Bearbeitung pädagogischer Zielfragen von einseitig bejahenden Positionen ausgehen und ideologiekritische Fragestellungen unberücksichtigt lassen. Diese beiden Probleme werden von der sogenannten Kritischen Erziehungswissenschaft thematisiert. Die Hauptrepräsentanten der Kritischen Pädagogik sind zum Beispiel Wolfgang Klafki und Hermann Giesecke. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen der Kritischen Erziehungswissenschaft lassen sich folgende Gemeinsamkeiten feststellen: −− Sie wollen vorgegebene Lebens- und Erziehungsverhältnisse nicht bejahend überliefern, sondern vorrangig kritisch erneuern und dabei auch Erziehung zur Kritik, zum Ungehorsam und Widerstand einbeziehen. Im Vordergrund steht dabei aber nicht der Konsens, sondern vielmehr die Konfliktaustragung. −− Sie stellen übereinstimmend eine enge Verschränkung von Gesellschaft (Wirtschaft) und Erziehung, von Politik (Macht) und Pädagogik fest. −− Sie nehmen die besseren Alternativen zur Lebens- und Erziehungsrealität vorweg. Sie möchten die idealen (utopischen) Leitvorstellungen mündiger Menschen in einer mündigen Gesellschaft durch Demokratisierung verwirklichen. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik interessiert sich für die erzieherische Praxis und ist für sie verantwortlich. Sie soll die jeweils schon vorhandene Erziehungspraxis und ihre Ziele gemäß den Prinzipien und Regeln der Hermeneutik2 auslegen mit der Absicht, die pädagogisch wichtigen Phänomene und Zusammenhänge, auch die Erziehungsziele und Bildungsideale, besser zu verstehen und den Erziehungspraktikern zum Sinnverständnis und zur Orientierung ihres pädagogischen Handelns zu verhelfen. 2. Erziehungsziele in der erfahrungswissenschaftlichen (empirischen) Pädagogik1 25 30 35 Die empirische Pädagogik ist eine rein beschreibende Erfahrungswissenschaft. Sie kann über ihren Forschungsgegenstand nur informieren, das heißt beschreibende, erklärende und vorhersagende Aussagen machen. Sie kann nur Tatsachen feststellen, die an der Wirklichkeit durch empirische Forschungsmethoden objektiv überprüfbar sind. Alle wertenden bzw. normativen Aussagen werden dagegen der Erziehungspraxis und der Erziehungsphilosophie überlassen bzw. zugewiesen. Dieser durch Wolfgang Brezinka vertretene Ansatz der Pädagogik kann folglich nur beschreibende (deskriptive), aber keine ­ vorschreibenden (prä- 1 2 siehe Kapitel 1.3.2 Hermeneutik: vgl. Kapitel 1, Materialien 3 40 3. Erziehungsziele in der emanzipatorisch ideologiekritischen Pädagogik1 45 50 55 60 65 70 75 40 Kapitel 8 80 −− Sie betrachten es als zentrale Aufgabe, Ideologien (im Sinne falschen Bewusstseins), vor allem bei den Andersdenkenden, zu entlarven. −− Sie plädieren für Emanzipation als oberstes Prinzip und Regulativ der Erziehungsvorgänge und -ziele. −− Sie befassen sich vorrangig mit pädagogischen Zielfragen, dies aber nicht ­wertneu­tral, sondern durch eigenes wertendes Stellungnehmen und Parteiergreifen. vgl. Weber, 19998, S. 464–473, gekürzt und verändert 2. Erziehungsziele von Eltern heute % % Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit 89 88 Verantwortungbewusstsein, Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen 85 83 Höflichkeit und gutes Benehmen 84 77 Gute, vielseitige Bildung 81 32 Durchhaltevermögen, Sachen zu Ende bringen 78 29 Sicheres Auftreten, Selbstbewusstsein 78 56 Hilfsbereitschaft 78 71 Toleranz 69 46 Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz 69 27 Pünktlichkeit 69 29 Gesunde Lebensweise 68 48 Selbstständigkeit 66 72 Sorgfalt, Dinge ordentlich und gewissenhaft tun 63 30 Sparsam mit Geld umgehen 58 33 Neugier, Wissensdurst 56 55 Das Leben genießen 44 54 Freude an Büchern haben, gern lesen 42 28 Technisches Verständnis, mit der modernen Technik umgehen können 37 15 Religiosität, Glaube an Gott 23 8 Interesse für Politik 22 7 Eltern von unter 12-jährigen Kindern in Deutschland Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6241, Mai/Juni 2012 Zahlen: BMFSFJ 2012 (Hrsg.): Familienreport 2012, S. 117 , online abrufbar unter: http:// www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Familienreport2012,property=pdf,­bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 85 41 Kapitel 8 3.Der Wandel von Erziehungszielen aufgezeigt an der ­„Frauenerziehung“ a) Aus „Rat an eine Dame von Stand wegen der Erziehung ihrer Tochter“ von Francois de la Salignac de Lamotte-Fénelon (1651– 1715), Erzbischof: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 „Sie (die Tochter) muss einen Abscheu haben vor der Lektüre verbotener Bücher und nicht einmal die Ursache des Verbotes ergründen wollen. Sie soll lernen, misstrauisch gegen sich selbst zu sein [...], sie mache sich zur Aufgabe, in aller Demut zu Gott zu beten, arm im Geiste zu werden, oft in sich selbst Einkehr zu halten, unwandelbar zu gehorchen, durch vernünftige und wohlwollende Leute selbst in ihren festesten Meinungen sich zurechtweisen zu lassen und zu schweigen, indem sie die andern reden lässt. [...] Beschäftigen Sie Ihre Tochter mit einer weiblichen Arbeit, welche für das Haus von Nutzen ist und sie dran gewöhne, den gefährlichen Verkehr mit der Welt zu entbehren. [...] Das wackere Weib spinnt, schließt sich in seinen Haushalt ein, schweigt, glaubt und gehorcht.“ Aus „Émile“ von Jean-Jacques Rousseau b) (1712–1778): Der Mann „muss aktiv und stark“, die Frau „passiv und schwach“ sein. „Aus diesem festgesetzten Prinzip folgt, dass die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Mann zu gefallen [...]. Da die Frau dazu geschaffen ist, zu gefallen und sich zu unterwerfen, muss sie sich dem Mann liebenswert zeigen [...]. Darum ist es nicht nur von Bedeutung, dass die Frau treu ist, sondern dass sie vor ihrem Gatten, vor ihren Nächsten und vor jedermann auch als treu erscheint; sie muss bescheiden, aufmerksam und zurückhaltend sein [...]. Bei der geistigen Unterschiedlichkeit der Geschlechter leitet sich aus diesen Prinzipien ein neues Motiv für Pflicht und Anstand ab, das besonders den Frauen die gewissenhafteste Achtsamkeit über ihr Verhalten, ihr Benehmen und ihre Haltung vorschreibt. Mit der allgemeinen Behauptung, die beiden Geschlechter seien gleich und ihre Pflichten die gleichen, verliert man sich in leeren Reden, womit man gar nichts sagt, solange man auf unsere Behauptungen nicht zu antworten vermag.“ c) Wilhelm Freiherr von Humboldt (1767– 1835) gibt die „polaristische Geschlechterphilosophie“ des deutschen Idealismus wieder: Die Selbsttätigkeit ist „das erste Kennzeichen der männlichen, Empfänglichkeit das der weiblichen Kraft. Beide Kräfte sind nicht ausschließlich auf die Geschlechter verteilt, sie müssen auch innerhalb eines Menschen wirken, wenn etwas Neues entstehen soll. ,Nur die verschiedene Richtung unterscheidet die männliche Kraft von der weiblichen. Die erstere beginnt vermöge ihrer Selbsttätigkeit mit der Einwirkung, nimmt aber vermöge ihrer Empfänglichkeit die Rückwirkung auf. Die letztere geht gerade den entgegengesetzten Weg. Mit ihrer Empfänglichkeit nimmt sie die Einwirkung auf und erwidert sie mit Selbsttätigkeit’. Das männliche Prinzip ist Kraft, Tätigkeit [...] und sucht außerhalb seiner selbst Stoff zur Wirksamkeit. Das weibliche Prinzip ist Einheit in sich selbst, Fülle und unbestimmte Sehnsucht [...].“ 50 55 60 65 70 d) Friedrich Schlegel (1772–1829) zeigt in seinen Gedanken schon „Emanzipationsideen der Frauenbewegung“ auf: „Was ist hässlicher als die überladene Weiblichkeit, was ist ekelhafter als die übertriebene Männlichkeit, die in unseren Sitten, unseren Meinungen, ja auch in unserer besseren Kunst herrscht!“ – „ In der Tat sind die Männlichkeit und die Weiblichkeit, so wie sie gewöhnlich genommen und getrieben werden, die gefährlichsten Hindernisse der Menschlichkeit, welche nach einer alten Sage in der Mitte einheimisch ist, und doch nur ein harmonisches Ganzes sein kann, welches keine Absonderung leidet. Nur sanfte Männlichkeit, nur selbstständige Weiblichkeit sei die rechte, wahre und schöne. Ist dem so, so muss man den Charakter des Geschlechts, welches doch nur eine angeborene natürliche Profession ist, keineswegs noch mehr übertreiben, sondern vielmehr durch starke Gegengewichte zu mildern suchen [...].“ e) Helene Lange (1848–1930), eine der führenden Personen der Frauenbewegung, schreibt zu diesem Problem: 75 80 85 90 42 Kapitel 8 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 „Aber noch eins unterscheidet die Frau unserer Tage von der der Vergangenheit“, in der „die Frau noch dem Berufsmenschen“ gegenübergestellt wurde. „Das ist anders geworden und wird in Zukunft noch weit mehr anders werden. Zum ersten Male stehen wir in größerer Menge innerhalb eines bestimmten Berufes. Das heißt, wir stehen nicht mehr nur dem Hause, sondern dem öffentlichen Leben verantwortlich gegenüber.“ f) Gertrud Bäumer (1873–1954) legt in ihrer Abhandlung „Das Problem der Frauenbildung“ dar: „Nun ist aber eines sicher: Durch keinerlei Spekulationen kann vorherbestimmt werden, welche zu irgendeiner Zeit ausschließlich von Männern ausgeübten Kulturtätigkeiten auch der Frau ,liegen’. Die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau in der Kultur folgt sicherlich nicht genau der spezifischen Beanlagung der Geschlechter. Sie gehorcht oft äußerem wirtschaftlichem und sozialem Druck. Es ist deshalb nicht gesagt, dass diese oder jene Arbeit der Frau nicht gemäß sei, weil sie während eines – vielleicht sogar sehr langen – geschichtlichen Zeitraums diese Arbeit nicht ausgeübt hat [...]. Und deshalb ist jede Theorie, die im Voraus einen Teil der lebendigen Menschheit auf bestimmte Wirkensweisen festlegt, von Übel. Weil die Frauen in bestimmten gegebenen geschichtlichen Situationen durch diesen oder jenen geistigen Typus ihre Art am vollendetsten ausgesprochen haben [...], ist nicht gesagt, dass unter veränderten sozialen und geistigen Bedingungen der gleiche Typus zustande kommen und noch weniger, dass er wiederum den Gipfel, das Höchsterreichbare bedeuten muss. Die Kon­sequenz ist, dass auch der Frau prinzipiell die Bewegungsfreiheit, die innere Voraussetzungslosigkeit für das Suchen nach ihrer Kulturleistung zugestanden werden muss, die für den Mann selbstverständlich und nie in Frage gestellt sind.“ „Summa: Jeder Begriff der ,weiblichen Eigenart‘ ist ein höchst unsicherer Boden für pädagogische Theorien.“ g) Aus „Bildung des Mädchens im technischen Zeitalter“ von Anne Banaschewski (1960): 145 „1. Die heutige Gesellschaft bietet in Bezug auf die Rolle der Frau ein sehr heterogenes Bild: Niemand bezweifelt mehr, dass die Frauen in das Arbeitsleben einzugliedern sind. Jedes junge Mädchen nimmt nach der Schulzeit heute eine irgendwie geartete Berufsvorbereitung oder Arbeit auf. Zunehmend bleiben immer mehr verheiratete Frauen im Beruf. Durch ihre anthropologische Rolle besteht jedoch für die Frau eine noch nicht gemeisterte Doppelbelastung, die im Ganzen dahin wirkt, sie von den leitenden Positionen, ja, sogar von bescheidenen Führungsaufgaben im Betrieb auszuschließen. In die gleiche Richtung wirken traditionelle Vorstellungen vom Wesen der Frau und ihren Interessen. Beide ­ Phänomene: Doppelbelastung und Ausschluss von Führungsaufgaben sind heute ­ drängende Probleme ,der‘ Frau, die zwar je nach Berufsgruppen verschieden ­gelagert sind, die aber grundsätzlich alle angehen [...]. 2. In der sozialen Selbstdeutung der Frau finden wir gelegentlich noch den Glauben, dass es zu den Aufgaben der Frau gehöre, die Gesellschaft von den strukturellen Nachteilen der Zivilisation zu erlösen. Hier liegt eine Verkennung der Sachgesetze der Arbeitswelt und eine Nachwirkung des romantischen Frauenbildes vergangener Generationen vor, dem wir uns nur allzu gerne wohlig hingeben. Jedoch übernehmen wir uns mit einer solchen fantastischen Zielsetzung. Unsere moderne Daseinsapparatur ist geschlechtsneutral. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass nicht die Frau sie umformen wird, sondern sie die Frau. Wir sollten uns bemühen, stärker den Gewinn dieses Wandels – den wir ja unmittelbar erleben – auch in der Reflexion zu betonen und die notwendigen Konsequenzen für die Erziehung daraus zu ziehen.“ „Das aber heißt, dass das Mädchen in klarer Sicht auf alle Konsequenzen auf ihren spezifischen Doppelberuf (Ehefrau und Mutter auf der einen Seite, ,geschlechtsneutraler Berufsmensch‘ auf der anderen; d. Verf.) vorbereitet werden muss.“ h) Aus „Emma“, Sonderband, Artikel von Ursula Ott (1991): Unter den 32 befragten Neuntklässlerinnen sind nur fünf, bei denen bei der Frage „Wie wünscht Ihr Euch Eure Zukunft?“ der Beruf nicht auf der Hitliste steht. Einige sind wild entschlossen, einen „Männerberuf“ zu ergreifen, eine will stramm „zur Bundeswehr und danach viel Geld 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 43 Kapitel 8 200 205 210 215 verdienen, um die Zukunft abzusichern. Und vielleicht dann eine Familie“. Auf jeden Fall aber wollen die Mädchen „keine typische Hausfrau werden“, „nicht als Heimchen am Herd enden“, „nicht vom Ehemann abhängig sein“. Abhängig sein, so wie die Mutter vom Vater – das ist echt das Allerletzte. Eine 14-Jährige stellt klar: „Als Erstes möchte ich einen Beruf erlernen, damit ich nicht von einem Mann abhängig bin. Heiraten habe ich eigentlich nicht vor, weil ich dann zu viel von einem Mann abhängig bin.“ Und ihre Klassenkameradin erklärt auf die Frage nach der Zukunft kurz und bündig: „Zurzeit: Heirat erst ab 35. Kinder nur vielleicht. So viel verdienen, dass man unabhängig ist!“ „Auf jeden Fall will ich etwas dazu ­beitragen, dass wir mehr Gleichberechtigung bekommen“, verspricht eine aus der 9b. Denn: „Im Moment denke ich, dass ich erst mal eine Art Karriere mache. Also nicht so früh Kinder zu bekommen. Ich möchte viel Geld verdienen und auch Einfluss in der Gesellschaft haben. Das möchte ich durch Arrangement und Stärke erreichen.“ Aber ja nicht durch die Frauenbewegung – „die hört sich albern an. Es sollten lieber super Frauen etwas vollbringen, was Männer noch nie geschafft haben.“ Allerdings, so hat auch die junge Superfrau schon gemerkt: „Man muss Selbstbeherrschung haben, wenn die Männer einen aus der Fassung bringen mit ihren Sprüchen, dass sie besser sind.“ Genau, zeig’s ihnen! 220 225 Quelle: a–g: Klafki u. a., 19702, S. III/35 ff.; Quelle: h: Ott, in: „Emma“, Sonderband: 20 Jahre Frauenbewegung, 1991, S. 40 f. 4.Möglichkeiten der Umsetzung der pädagogischen Mündigkeit Herstellen positiver emotionaler Beziehungen 5 Im Mittelpunkt der Erziehung muss die positive emotionale Beziehung stehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Kinder als Person angenommen und akzeptiert werden, dass ein liebevolles und warmherziges Verhältnis zwischen Erzieher und zu Erziehendem existiert. Raum der Freiheit und der eigenen Entscheidung gewähren 10 15 20 Es ist wichtig, dass Eltern und Erzieher genügend Spielraum lassen, in dem die Kinder eigene Entscheidungen treffen können und vor allem lernen, die Folgen dieser Entscheidungen erleben und tragen zu können. Der Raum der Freiheit und der eigenen Entscheidungen muss für den zu Erziehenden von vornherein so groß wie möglich gegeben sein und entsprechend seinem Alter und Entwicklungsstand ständig erweitert werden. In diesem Raum der Freiheit muss das Kind selbstständig entscheiden, erforschen, experimentieren und sich bestätigen können. Grenzen setzen 25 Der Freiheitsraum des Kindes findet dort seine Grenzen, wo ein Schaden entstehen kann, wo die Freiheit der anderen beginnt und ein reibungsloses Zusammenleben nicht mehr gewährleistet ist. Gebote und Verbote sind wichtige Bestandteile jeder Erziehung. Freiräume allein reichen nicht aus, um Kinder verantwortungsvolles Verhalten zu lehren. Sie müssen auch Grenzen erleben und erfahren, damit ihnen die Zusammenhänge zwischen ihrem Verhalten und den möglichen Folgen deutlich werden. Durch klare Regeln, ­sinnvolle Grenzen und konsequentes Erzieherverhalten vermitteln Eltern und andere Erzieher ihren Kindern zugleich stabile Werte, die ihnen im späteren Leben „Leitsystem“ für die (Nicht-) Richtigkeit ihres Verhaltens geben (Nuber, 2009, S. 22). 30 35 40 Begründung und Rechtfertigung der erzieherischen Einflussnahme Der Erzieher handelt nicht willkürlich („Weil ich es so will!“, „Weil ich es gesagt habe!“); seine Einflussnahme auf den zu Erziehenden lässt sich von der Sache, die Erziehung notwendig macht, und von den Ordnungen des Zusammenlebens her begründen. Erziehungsmaßnahmen sollten für das Kind nachvollziehbar begründet werden. Erst dadurch wird es für den zu Erziehenden möglich, aufgrund eigener Überlegung und Vernunft die Entscheidung des Erziehers nachzuvollziehen und zu verstehen. 45 50 44 Kapitel 8 55 60 Beim Kleinkind muss die Einsicht erst hervorgebracht werden. Entscheidend ist zunächst, dass der Erzieher vor sich selbst seine Einflussnahme sachlich begründen kann, die er dann dem Kind – soweit möglich – nachvollziehbar macht. Entfaltung des kindlichen Neugierdebedürf­nis­ ses 65 70 Erziehung, die als Ziel pädagogische Mündigkeit anstreben will, nimmt jede Gelegenheit wahr, die kindliche Neugier und Wissbegierde sowie die Initiative des Frage- und Problemstellens zu erhalten und zu fördern. Das Kind soll lernen, Probleme der Welt wahrzunehmen und selbstständig bewältigen zu können. Es soll das Bedürfnis und den Mut aufbringen zum lebenslangen Weiter- und ­ Umlernen. Förderung des Zusammenlebens 75 Durch Erziehung soll das Kind die Fähigkeit erwerben, Absichten, Meinungen und Verhal- tensweisen anderer zu verstehen und dieses Verstehen nach außen erkennbar zu machen; es soll die Fähigkeit erwerben, sich für andere einzusetzen, ihnen zu helfen, ihre Lage zu verbessern; es soll lernen, soziale Konflikte auf demokratischem Weg zu regeln und auszutragen. Dabei ist eine Lösung erforderlich, die für alle am Konflikt beteiligten Personen befriedigend ist. 80 85 Entfaltung des schöpferischen Denkens Im Besonderen ist damit die Erziehung zu Ideen und Einfällen gemeint, die zu neuen und originellen Problemlösungen führen, die für das Individuum, für die Gruppe oder für die Gesellschaft eine Bereicherung darstellen können. Diese Möglichkeiten sind „Leitlinien“, die es im jeweiligen Einzelfall und in der jeweiligen erzieherischen Situation unterschiedlich umzusetzen gilt. 90 45 Kapitel 9 Materialien Kapitel 9 1. Die Erziehungsstile nach Kurt Lewin u. a. Merkmale des autoritären Führungsstils (vgl. Weber, 19868, S. 236 f.) 5 −− Der Gruppenleiter legt alle Richtlinien fest, sodass es nur einen Weg zur Erreichung des Zieles gibt. −− Er entscheidet über sämtliche Maßnahmen „Tut mit leid, Frau Direktor, aber wir haben darüber ab gestimmt!“ 10 −− −− 15 −− −− 20 −− 25 30 −− und bestimmt das gesamte Vorgehen, indem er von Fall zu Fall die einzelnen Tätigkeiten, Techniken und Teilaufgaben vorschreibt. Den Kindern ist ihr zukünftiges Tun meist nicht bekannt. Der Leiter übernimmt allein die Verantwortung für das Verhalten der Kinder und das Gelingen des Vorhabens. Er bildet die Arbeitsgruppen und ordnet an, wer mit wem zusammenzuarbeiten hat. Häufig greift der Leiter durch Befehle und unterbrechende Kommandos in das Geschehen ein. Lob und Tadel sind meist persönlich gehalten, das heißt auf die Person und nicht auf die Sache bezogen. Seine nicht k ­ onstruktive Kritik erfolgt ohne objektive Begründung. Die Haltung des Leiters der Gruppe gegenüber ist eher geringschätzend und verständnislos, aber auch unpersönlich. Merkmale des demokratischen Führungsstils (vgl. Weber, 19868, S. 237ff.) −− Der Leiter gibt der Gruppe einen Überblick über die Gesamttätigkeit und das Ziel. −− Die Festlegung der Richtlinien und Arbeitsabschnitte, die Wahl der Techniken und Maßnahmen sind Angelegenheiten von Gruppendiskussionen und -entscheidungen, an denen der Gruppenleiter nur anregend und ermunternd mitwirkt. −− Alle wichtigen Entscheidungen werden in der Gruppe diskutiert. −− Die Gruppe trägt die Verantwortung für das Vorgehen und das Resultat. −− Die Gruppenmitglieder können selbst bestimmen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. −− Der Leiter greift nur äußerst sparsam ein und will die Selbstständigkeit der Kinder provozieren. −− Ge- und Verbote sowie Anweisungen werden vom Leiter sachlich begründet. −− Der Leiter unterstützt und ermutigt die Gruppenmitglieder aktiv. −− Bei der Erteilung von Lob und Tadel ist er objektiv orientiert, das heißt, er gibt nur sachbezogene Hinweise und bemüht sich um konstruktive Kritik. Lob und Tadel erfolgen sachbezogen. −− Bei technischen Problemen gibt der Leiter immer mehrere Lösungsmöglichkeiten, die Auswahl und Entscheidung liegen dann bei den Kindern. 35 40 45 50 55 60 46 Kapitel 9 65 −− Die Haltung des Leiters ist von hoher Wertschätzung und Verstehen gekennzeichnet. −− Der Leiter ist zu persönlichen Gesprächen mit den Kindern über ihre Probleme bereit. Merkmale des Laissez-faire-Führungsstils (vgl. Weber, 19868, S. 239f.): 70 75 80 −− Der Leiter verhält sich weitgehend passiv, er macht nur minimale Vorgaben. −− Die Rolle des Leiters beschränkt sich weitgehend auf das Anbieten unterschiedlicher Materialien. −− Er gewährt völlige Freiheit hinsichtlich der Aktivitäten und Entscheidungen sowohl des Einzelnen als auch der Gruppe. −− Das gesamte Vorgehen wird allein den Kindern überlassen. −− Die Kinder erhalten nur auf ihr ausdrückliches Verlangen hin Informationen durch den Leiter, stets aber nur in einem Ausmaß, in dem sie Auskunft gewünscht haben. −− Die Verhaltensweisen und Arbeitsprodukte der Kinder werden vom Leiter weder provoziert noch qualifiziert. „Müssen wir heute schon wieder spielen, was wir wollen?“ −− Die Arbeitsergebnisse werden kaum bewertet. −− In seinem Erziehungsverhältnis zu den Gruppenmitgliedern verhält er sich mehr neutral. 85 Das typologische Konzept nach Kurt Lewin u. a. autoritärer Erziehungsstil demokratischer Erziehungsstil laissez-faire Erziehungsstil 2. Die Postulate der Bindungstheorie 5 10 Ihre Grundannahmen heben die Bindungstheorie als eine Theorie der normalen und pathologisch abweichenden Entwicklung von anderen Theorien der Persönlichkeitsentwicklung und Psychopathologie ab. Die fünf wichtigsten Postulate sind: 1.Für die seelische Gesundheit des sich entwickelnden Kindes ist kontinuierliche und feinfühlige Fürsorge von herausragender Bedeutung. 2.Es besteht die biologische Notwendigkeit, mindestens eine Bindung aufzubauen, deren Funktion es ist, Sicherheit zu geben und gegen Streß zu schützen. Eine Bindung wird zu einer erwachsenen Person aufgebaut, die als stärker und weiser empfunden wird, so daß sie Schutz und Versorgung gewährleisten kann. Das Verhaltenssystem, das der Bindung dient, existiert gleichrangig und nicht etwa nachgeordnet mit den Verhaltenssystemen, die der Ernährung, der Sexualität und der Aggression dienen. 15 20 47 Kapitel 9 25 30 35 40 3.Eine Bindungsbeziehung unterscheidet sich von anderen Beziehungen besonders darin, daß bei Angst das Bindungsverhaltenssystem aktiviert und die Nähe der Bindungsperson aufgesucht wird, wobei Erkundungsverhalten aufhört [das Explorationsverhaltenssystem wird deaktiviert). Andererseits hört bei Wohlbefinden die Aktivität des BindungsVerhaltenssystems auf und Erkundungen sowie Spiel setzen wieder ein. 4.Individuelle Unterschiede in Qualitäten von Bindungen kann man an dem Ausmaß unterscheiden, in dem sie Sicherheit vermitteln. 5. Mit Hilfe der kognitiven Psychologie erklärt die Bindungstheorie, wie Irüh erlebte Bindungserfahrungen geistig verarbeitet und zu inneren Modellvorstellungen (Arbeitsmodellen) von sich und anderen werden. Obwohl die Bindungsforschung zunächst nur das Verhalten kleiner Kinder bei Trennung untersuchte, wurde sie im Laufe der Zeit, wie die Theorie es vorsieht, auf die ganze Lebensspanne „von der Wiege bis zum Grabe ausgeweitet. Die Bindungstheorie erweist sich stets dort als tragfähig, wo eine schwächere Person unabhängig von ihrem Alter den Schutz und die Fürsorge einer vertrauten stärkeren Person braucht (Bowlby). Im höheren Alter wird jedoch das Bindungsverhalten wahrscheinlich an Jüngere gerichtet werden, die dann als stärker und weiser empfunden werden. 45 50 55 Quelle: Grossmann/Grossmann, 20125, S. 70 f. 3. Bindungstypen 5 10 Mary Ainsworth untersuchte zusammen mit Barbara Wittig in der berühmt gewordenen Baltimore-Studie unterschiedliche Bindungsverhaltensweisen zwischen Bezugsperson und Kleinkind und ihre Auswirkungen auf es. Sie gingen der Frage nach, ob und wie ein Kleinkind seine Bezugsperson – in den Versuchen die Mutter – nach einer kurzen Trennung beim Wiedersehen als Sicherheitsbasis sieht, um zu einer ausgeglichenen Gefühlslage zurückzufinden. Mary Ainsworth (1913–1999) war US-amerikanische Entwicklungspsychologin und arbeitete in London mit John Bowlby, dem Pionier der Bindungsforschung, zusammen. Auf sie geht das Konzept der Feinfühligkeit zurück, und sie untersuchte über längere Zeiträume hinweg das Interaktionsverhalten zwischen Mutter und Säugling. Bekannt wurde Ainsworth durch ihre Untersuchungen in Baltimore – deshalb Baltimore-Studien –, in denen es um die Reaktionen von Kleinkindern auf die Trennung von der Bezugsperson geht. Ainsworth und Wittig ermittelten vier Bindungstypen (vgl. Grossmann/Grossmann, 20064, S. 136 ff.; Brisch, 201010, S. 52f.): −− Die sicher gebundenen Kinder, die ein deutliches Bindungsverhalten zeigen und bei ihrer Rückkehr zu ihrer Mutter laufen, sich freuen, ihr die Arme hinstrecken, auf den Arm genommen und getröstet werden wollen. Sie beruhigen sich aber dann nach kurzer Zeit und wenden sich erneut dem Spielen zu. 1 ambivalent (lat.): in sich widersprüchlich; zwiespältig 15 20 25 30 48 Kapitel 9 35 40 45 50 −− Die unsicher-vermeidend gebundenen Kinder, die kein deutliches Bindungsverhalten zeigen und ihre Mutter beim Wiedersehen ignorieren. Sie wollen nicht auf den Arm genommen und getröstet werden, sie wenden sich eher von ihr ab. −− Die unsicher-ambivalent1 gebundenen Kinder, die einerseits Kontakt mit der Mutter haben wollen, ihn aber zugleich wieder ablehnen und sich ärgerlich zeigen (Strampeln mit den Beinen, Schlagen, Stoßen oder Wegwollen). Sie können auch wenig beruhigt werden und benötigen längere Zeit, um wieder in einen emotional stabilen Zustand zu kommen. −− Die (unsicher-)desorganisiert gebundenen Kinder, die erkennen lassen, dass sie ihre Mutter nur wenig sicherheitsgebend empfinden und sich auch nicht von ihr trösten und beruhigen lassen. Sie zeigen Unterbre- chungen, Zurückweichen oder Vermeidung vermischt mit Ärger und Verzweiflung (zum Beispiel auf den Boden schlagen) während der Annäherung zur Mutter, aggressives Verhalten gegenüber Gegenständen oder auch gegenüber der ­Bindungsperson (sich schreiend verstecken, brüllend neben der Mutter sitzen, ohne Kontakt aufnehmen zu wollen). „Während der desorganisierte Bindungstyp heute die volle Aufmerksamkeit in der Klinischen Praxis für gestörte MutterKind-Beziehungen erhält, gehören die rest­ lichen drei Bindungstypen zur normalen Bandbreite der Bindungsbeziehungen, die ein Kind zu seiner Mutter entwickelt.“ (Ahnert, 2010, S. 53) 55 60 65 70 Bindungstypen sicher gebundene Kinder unsichervermeidend gebundene Kinder unsicherambivalent gebundene Kinder unsicherdesorganisiert gebundene Kinder 4.Die Merkmale des pädagogischen Bezugs nach Herman Nohl 5 10 Der pädagogische Bezug wird nach Herman Nohl durch sechs Merkmale bestimmt: der Verwirklichung bestimmter wirtschaftli­ cher, politischer, persönlicher oder anderer Interessen zu dienen haben. Erziehung hat in jedem Augenblick nur dem Wohle des zu Er­ ziehenden zu dienen, die den jungen Menschen vor Inbeschlagnahme und M ­ anipulation zu bewahren hat; sie hat Orientierungshilfe zu sein, die dem zu Erziehenden im späteren Leben Selbstbestimmung, Verantwortung und relative Autonomie ermöglicht. Erziehung geschieht um des zu Erziehenden w ­ illen. Erziehung unterliegt historischem Wandel. Kinder und Jugendliche dürfen in der Erziehung nicht zu Mitteln werden, die dem Zweck Was als Wohl des zu Erziehenden anzusehen ist, darüber muss unter den Eltern und a ­ nderen Herman Nohl (1879–1960) war deutscher Pädagoge, Philosoph und Professor zunächst an der Universität Jena, später in Göttingen. Während des Nationalsozialismus durfte er seine Professur nicht ausüben. Nohl war ein Hauptvertreter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik (vgl. Kapitel 1.3.2). 15 20 25 49 Kapitel 9 Erziehern immer wieder neu diskutiert wer­den, da sich Wert- und Normvorstellungen im Laufe der Zeit immer wieder ändern und Erziehung deshalb einem historischen Wandel unterliegt. 30 35 Das pädagogische Verhältnis ist ein Verhältnis der Wechsel­wirkung. Die Beziehung zwischen Erzieher und zu Erziehendem darf nicht als einseitiges Beeinflussungsverhältnis aufgefasst werden, in welchem der Erwachsene auf einen nur ­aufnehmenden, reagierenden jungen Menschen einwirkt; es ist von vornherein ein Verhältnis der We­chsel­wir­ kung. 40 Das pädagogische Verhältnis kann nicht erzwungen werden. 45 Die Beziehung zwischen Erzieher und dem zu Erziehenden muss auf Freiwilligkeit beruhen und darf nicht durch Täuschung und Tricks oder gar mit Zwang und Gewalt herbeigeführt werden. Das pädagogische Verhältnis strebt danach, sich aufzulösen und überflüssig zu machen. Erziehung hat vom ersten Tag an die Aufgabe, den jungen Menschen selbstständig zu machen. Daraus ergibt sich als Forderung, dass die Bindung des zu Erziehenden an den Erwachsenen von Anfang an als vorläufig betrachtet und auch so gestaltet werden muss, dass der junge Mensch lernt, sich aus dieser Beziehung schrittweise zu lösen sowie selbstständig und mündig zu werden. 50 55 Im pädagogischen Verhältnis akzeptiert der Erzieher den zu Er­ziehenden und fördert ihn nach seinen Möglichkeiten. Der Erzieher muss seinen zu Erziehenden annehmen, so wie er ist, mit all seinen Schwächen und Fehlern, versucht aber alles irgend­ wie Mögliche zu tun, um ihn entsprechend seinen Möglichkeiten optimal zu fördern. (vgl. Klafki u. a., Band 1, 1986, S. 58–65) 60 50 Kapitel 10 Materialien Kapitel 10 1. Belohnung vermeiden 5 10 15 20 25 Kinder brauchen keine Bestechung, um gut zu sein. Sie wollen selber gut sein. Gutes Benehmen des Kindes resultiert aus dem Bestreben dazuzugehören, nützliche Beiträge zu leisten und mitzuarbeiten. Bezahlen wir ein Kind für gutes Betragen, zeigen wir ihm nur, dass wir seinen guten Absichten nicht trauen. Das ist aber eine Form der Entmutigung. Belohnung gibt einem Kind nicht das Gefühl des Dazugehörens. Sie kann ein Zeichen elterlicher Anerkennung sein, aber nur für einen Augenblick. Und dann? Sind Vater und Mutter immer noch mit mir einverstanden? Wenn wir an die Zahl der Augenblicke denken, haben wir bald keine Belohnung mehr zur Verfügung. Geben wir aber keine besondere Belohnung, glaubt das Kind, seine Bemühungen verschwendet zu haben. Eltern sehen sich einem ernsthaften Problem gegenüber, wenn das Kind sich weigert, mitzuarbeiten, weil es auf die Frage „Was schaut für mich dabei he­ raus?“ keine Antwort erhält. Warum sollte es sich bemühen, wenn es nichts dafür bekommt? Und so entwickelt sich diese materielle Einstellung mehr und mehr – es wird unmöglich, den Appetit nach Bereicherung zu befriedigen. Ein völlig falscher Weg wurde festgelegt, schließlich nimmt der Jugendliche an, dass die Welt ihm alles schuldet. Wenn nicht automatisch etwas dabei herausschaut, wird er es „ihnen schon zeigen“. Das ist das Gefühl des Achtzehnjährigen, in dessen Wertsystem die Befolgung von Verkehrs- und Geschwindigkeitsregeln keinen Raum hat. ­ Warum sollte er ihnen gehorchen? Wo ist die Belohnung? Er hat seinen Wagen. Es macht Spaß, möglichst viel Aufregendes zu erlernen und zu zeigen, was für ein toller Kerl man ist, wenn man tut, was man will, und dabei nicht geschnappt wird. Und falls man gefasst und bestraft wird? Die Aufregung ist es wert. Vater wird auf jeden Fall bezahlen. Das ist die Wirkung von Belohnung und Bestrafung: „Sie haben mir dafür nichts gegeben, ich werde sie dafür bestrafen. Wenn sie mich bestrafen, werde ich mich rächen. Ich werde es ihnen schon zeigen.“ Befriedigung verschafft Beitragen und Mitwirken – ein Gefühl, das unseren Kindern im System der materiellen Belohnung verwehrt ist. Mit unseren fehlerhaften Bemühungen, Mitarbeit durch Bezahlung zu erreichen, versagen wir unseren Kindern die grundlegenden Befriedigungen des Lebens. 30 35 40 45 50 Quelle: Dreikurs/Soltz, 201218, S. 88 f. 2. Ich-Botschaften und das aktive Zuhören 5 10 Thomas Gordon (2014, S. 88) schlägt als Alternative zum Lob bzw. zur Belohnung IchBotschaften und ein aktives Zuhören vor. Ich-Botschaften sind Äußerungen eines Menschen, die persönliche Empfindungen, Gefühle, Bedürfnisse und dergleichen ausdrücken. Dadurch teilt der Erzieher dem zu Erziehenden mit, was er fühlt und denkt und welche Wirkung das Verhalten des Kindes bei ihm ausgelöst hat. Der zu Erziehende erfährt bei Ich-Botschaften, welche Wirkung sein Verhalten beim Erzieher hat, jedoch ohne sich bewertet zu fühlen; er kann sein (Fehl-)Ver- halten selbst beurteilen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aktives Zuhören ist nach Otto Marmet (20144, S. 93) eine Haltung, die sich in folgenden ­Eigenschaften äußert: −− sich auf den anderen einstellen und aufmerksam verfolgen, was er zu sagen hat −− Bereitschaft zum Zuhören signalisieren, welche sich in nonverbalen Signalen wie zum Beispiel Kopfnicken, zugewandter freundlicher Blick oder das Hinwenden des Körpers ausdrückt 15 20 25 51 Kapitel 10 30 −− schweigen können und abwarten, bis der andere ausgesprochen hat, auch wenn man glaubt, ihn schon verstanden zu haben −− sich in seine Welt einfühlen und sich mit dem befassen, was er kundtun will Das Zuhören zeigt dem zu Erziehenden, welche Gefühle der Erzieher an ihm wahrnimmt; er fühlt sich besser verstanden und weiß, dass seine Gefühle akzeptiert werden. 35 „Ein gutes Gespräch besteht zur H ­ älfte (Ernst Ferstl1) aus Zuhören.“ Quelle: Hobmair, 2009, S. 115 3. Logische Konsequenzen 5 10 Entscheidend sind dann logische Konsequenzen. Also nicht nur zu reden und womöglich das Gesagte auch noch ständig mit drohendem Unterton zu wiederholen, sondern zu handeln. Etwa anzukündigen, dass man den Geschwistern das Puzzle wegnimmt, wenn sie weiterhin ständig beim Spielen streiten. Und dies nach ein paar Sekunden Wartezeit dann auch zu tun. [...] Beschreiben Sie zunächst das Problem: „Du hast den Hund nicht gefüttert, obwohl es vereinbart war.“ Und dann die Konsequenz, über die Sie das Kind schon im Vorfeld informiert haben: „Dafür gehst Du heute Abend 30 Minuten eher ins Bett.“ [...] Diskutieren Sie diese Entscheidung nicht, sondern setzen Sie sie ruhig und bestimmt um. Das ist ganz wichtig: Man darf Konsequenzen nicht nur androhen, denn Kinder lernen sehr schnell, Drohungen zu ignorieren, wenn daraus nichts folgt. [...] Und jede Inkonsequenz in der Umsetzung erschwert es Kindern, einzuschätzen, was Eltern von ihnen wollen. Konsequenz hingegen führt dazu, dass sie die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen können. 15 20 Quelle: Hahlweg, 2014, S. 29 f. 4. Kinder lernen im Spiel 5 10 15 Der vierjährige David zieht einen schweren, weit verzweigten Ast hinter sich her. Er nimmt die gesamte Breite des Waldweges ein, Wald sammelt sich an den Zweigen. [...] Dabei kommentiert er sein Handeln: „Ich zieh den Rasenmäher jetzt hier. Der ist ganz schön schwer, aber ich kann das.“ Sein älterer Bruder Jonathan [...] wird einbezogen: „Jonathan, mach mal Platz, ich muss weiterlaufen. Hol dir doch auch einen Rasenmäher. [...]“ Kinder spielen im Wald. Nicht weiter vertiefenswert – oder vielleicht doch? Was können wir beobachten? David ist körperlich aktiv. Es kostet ihn viel Anstrengung, aber er hört nicht auf, denn offensichtlich ist es für ihn sinnvoll, einen Ast durch den Wald zu schleifen. Die Erlebnisse mit seinem Onkel baut er in sein Spiel ein. Er macht sich zum 1 Hauptakteur. Seinem Bruder Jonathan erklärt er, was dieser zu tun hat. Sie führen ein Fachgespräch über die Beschaffenheit ihrer Rasenmäher. David will nicht aufgeben, aber er merkt, dass sein Rasenmäher allmählich schwer wird. Also fordert er die Erzieherin auf, ihn zu unterstützen. Die drei Spielpartner gestalten nun ihr gemeinsames Handeln unter der Regie von David und führen Gespräche über Vergangenes und Zukünftiges. 20 Kinder im Kindergarten nehmen sich nicht bewusst vor, ihren Wortschatz zu erweitern oder ihren Umgang mit anderen Kindern zu trainieren, um sozial kompetent zu werden. Trotzdem lernen sie es: Sie lernen es beiläufig während des Handelns. Indem sie ihre Umgebung mit allen Sinnen erkunden, alle Möglichkeiten ausprobieren und in Aktion treten, erfahren sie etwas über sich und die Welt. Sie 30 Ernst Ferstl (*1955) ist ein österreichischer Autor von Gedichten und Aphorismen. 25 35 52 Kapitel 10 eignen sich nach und nach Fertigkeiten an, um in dieser Welt zurechtzukommen, selbstständig und eigenverantwortlich zu agieren. Und sie können im Spiel auch belastende Themen verarbeiten und erleben dadurch, dass Situationen zu bewältigen sind. Doch was macht diese Szene für David und die beiden anderen Mitakteure so wertvoll? David lernt, denn er setzt sich intensiv mit verschiedenen Themen auseinander und eignet sich dabei sein Welt-Wissen an. Quelle: Evanschitzky, 2013, S. 8 f. 40 45 Kapitel 11 Materialien Kapitel 11 1. Nutzung von Medien www.mpfs.de Geräte-Ausstattung im Haushalt 2014 (Auswahl) 100 100 Handy 99 99 Computer/Laptop 98 97 Fernseher 98 97 Internetzugang 94 Smartphone 81 91 90 Radio 90 91 Digitalkamera 77 MP3-Player 83 72 Feste Spielkonsole 76 62 64 DVD-Player (nicht PC) 58 59 Tragb. Spielkonsole 2014, n=1.200 52 DVD-Rekorder 2013, n=1.200 57 48 Tablet-PC 36 40 DVD-Rekorder mit Festplatte 37 0 25 50 75 100 Quelle: JIM 2014, JIM 2013, Angaben in Prozent Basis: alle Befragten Quelle: JIM-Studie 2014, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, www.mpfs.de www.mpfs.de Gerätebesitz Jugendlicher 2014 99 Handy 96 91 92 90 Internetzugang Smartphone 87 73 Computer/Laptop 78 71 MP3-Player 61 55 Fernsehgerät 58 58 Radio 53 Mädchen 64 Digitalkamera Jungen 42 49 Tragb. Spielkonsole 46 34 Feste Spielkonsole 56 23 22 DVD-Player (nicht PC) 20 21 Tablet-PC 18 16 DVD-Rekorder ohne Festplatte 5 DVD-Rekorder mit Festplatte 8 0 25 50 75 100 Quelle: JIM 2014, Angaben in Prozent Basis: alle Befragten, n=1.200 Quelle: JIM-Studie 2014, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, www.mpfs.de 53 54 Kapitel 11 www.mpfs.de Medienbeschäftigung in der Freizeit 2014 Internet* 81 Handy 13 87 Fernsehen* 6 57 MP3 26 59 Radio* 18 53 Digitale Fotos machen 20 25 Musik-CDs/-kassetten 27 30 Computer-/Konsolen-/Onlinespiele 16 20 Bücher 25 22 Tageszeitung 18 DVD/Video Computer (offline) 22 11 14 8 Tageszeitung (online) 7 Zeitschriften (online) 6 Digitale Filme/Videos machen 3 Hörspielkassetten/-CDs 5 E-Books lesen mehrmals pro Woche 14 10 Zeitschriften/Magazine täglich 18 13 7 7 8 6 3 2 Kino 1 0 25 50 75 100 Quelle: JIM 2014, Angaben in Prozent; *egal über welchen Verbreitungsweg Basis: alle Befragten, n=1.200 Quelle: JIM-Studie 2014, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, www.mpfs.de www.mpfs.de Wege der Internetnutzung 2012 - 2014 - in den letzten 14 Tagen 86 Handy/Smartphone 73 49 82 Computer/Laptop 87 96 22 Tablet-PC 12 8 2014 (n=1.163) 12 Spielkonsole 2013 (n=1.138) 7 7 2012 (n=1.154) 2 MP3-Player/iPod 4 7 5 Fernseher 3 2 0 25 50 75 100 Quelle: JIM 2012 - JIM 2014, Angaben in Prozent Basis: Befragte, die mind. alle 14 Tage das Internet nutzen Quelle: JIM-Studie 2014, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, www.mpfs.de 55 Kapitel 11 Klick-Clique Smartphone-NutZer werden immer jünger, die derate prägen spätestens von der fünften Klasse an die Kindheit. Ohne klare Regeln der Eltern ist das riskant 5 10 15 20 25 30 35 40 Für ein Kind im Jahr 2015 ist es anscheinend so: Entweder man liest die äußerst schwer auffindbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Handy – und stellt dann fest, dass man das Chat-Programm Whatsapp gar nicht installieren darf, weil man noch nicht 16 Jahre alt ist. Oder man pfeift drauf und beginnt munter zu chatten. Mit Freunden, Fremden oder den Jungen aus der letZten Reihe, die über Whatsapp auch solche Videos ver­ schicken, die ein flaues Gefühl im Magen auslösen und die man zu Hause nie sehen dürfte. Wer hätte es gedacht: Der Nachwuchs entscheidet sich in aller Regel für die zweite Möglichkeit. 82 Prozent aller Kinder, die ein Handy mit Apps besitzen, haben Whatsapp installiert. Das belegt eine Untersuchung, die sogenannte KIM-Studie 2014, zum Umgang von sechs- bis 13-jährigen Kindern mit Medien, die der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest kommende Woche veröffentlicht. 1200 Kinder und ihre Eltern wurden befragt. Die Studie zeigt deutlich, dass Smartphones inzwischen von immer jüngeren Kindern genutzt werden – jene Handymodelle bieten. Der Anteil der Sechs- bis 13-Jährigen, die ein Smartphone haben, ist innerhalb der vergangenen zwei Jahre von sieben auf 25 Prozent gestiegen. Innerhalb dieser Gruppe sin des die älteren, die Fünftklässler, die richtig loslegen – unter den Zwölfjährigen hat heute fast jeder ein Handy, die Hälfte ein Smartphone. Wer ­gerade erst eingeschult wurde, besitzt laut der Studie eher noch kein Gerät, viele ältere Grundschüler müssen mit wenig opulenten Modellen, oft den alten Handys der Eltern, vorliebnehmen. Dabei ist ein eigenes Gerät nicht nur der Wunsch vieler Kinder, sondern häufig auch einer der Eltern. Das vermutet Sabine Feierabend von der SWR-Medienforschung, die an der Studie beteiligt war. Je größer der Aktionsradius eines Kindes wird, desto wichtiger ist eine gute Erreichbarkeit für Eltern – denn sie bietet ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Der Sprung zum Smartphone, der oft zeitlich mit dem Wechsel auf eine weiterführende Schule zusammenfällt, ist allerdings Segen und Fluch. Möglich wird dadurch nämlich nicht nur der brave Anruf bei den besorgten Eltern, sondern auch die besagte Whatsapp-Kommunikation und jeder Blödsinn, der im Internet vorhanden ist. Und davon gibt es seine ganze Menge. Spätestens dann sind im Elternhaus Gespräche angebracht über die Risiken des Alleskönners in der Hosentasche. Neben den Inhalten, die auf die Kinder einströmen, von anderen Schülern, von Facebook, Twitter und Instagram, muss es auch um die Daten gehen, die Kinder selbst zurück ins Netz schicken. Die meisten Apps und Handys sind neugierig und interessieren sich für die Aufenthaltsorte und Bewegungen der Nutzer – die Technik macht dabei keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Angebote wie schau-hin info helfen mit Rat; so sollten Eltern und Kinder etwa gemeinsam die Einstellungen zum Datenschutz festlegen. Ein Anfang. Man muss ja nicht gleich verlangen, dass der Nachwuchs die Allgemeinen Geschäftsbedingungen liest. JULIANE VON WEDEMEYER Quelle: von Wedemeyer, 2015, S. 1 45 50 55 60 65 70 75 56 Kapitel 11 2.Wenn Kinder im Netz verletzt werden: Gefahr Cybermobbing Üble Nachrede, Beleidigungen und Nacktbilder im Internet — Experten informierten über die Quälerei im virtuellen Raum und deren reale F ­ olgen VON ULRIKE LÖW 5 10 15 20 25 30 Die Gefahr, im NetZ schikaniert zu warden, ist gerade für Kinder und Jugendliche groß: Eine Diskussionsrunde informierte über Cybermobbing. Sachverstand auf der Bühne, eine gut gefüllte Aula im Fürther Helene-Lange-Gymnasium, eine engagierte Diskussion, kompetent geleitet von Redakteur Johannes Alles – der ­Besuch der Veranstaltung, organisiert von der Schule, dem Elternbeirat sowie dem Fürther Sicherheitsbeirat, lohnte. Der traurige Fakt: Im Internet geht Beleidigen besonders leicht und weil viele Teenager Computer und Smartphones besitzen, holt sie der Stress vom Schulhof auch zu Hause ein. Klaus Lutz, Pädagoge und Medienfachberater des Bezirks Mittelfranken, will Cybermobbing nicht als eigenständiges Phänomen – in Abgrenzung zu Mobbing – sehen: Spannungen zwischen Schülern stammen aus dem echten Leben, und so wird morgens in der Schule und nachmittags eben im Netz gepöbelt, schließlich kennen sich Opfer und Täter meist. Er schildert, wie in einer Klasse ein Streit begann, als zwei Schüler heimlich spickten. Ein Dritter ärgerte sich und lief petzend zum Lehrer – die Schüler wurden bestraft, der Streber später von Klassenkameraden beschimpft. Als ihn auch zu Hause feindselige Nachrichten auf dem Handy erreichten, schlugen seine Eltern bei der Cybermobbing wurde der Klasse der Ausflug ins Schullandheim gestrichen. Lutz kritisiert: Häufig nehmen Erwachsene nur die Spitze des Eisberges wahr, dabei müsse die ganze Geschichte gesehen werden. Herrsche an der Schule ein respektvolles Klima, übertrage sich dies auch in die Freizeit und die Dialoge im Chat. Solche Konflikte sind freilich nicht neu, doch neu ist, dass fiese Schmähungen im Internet ständig und von jedem zu lesen sind – und nur schwer wieder zu tilgen. „Cybermobbing“, so Gernot Rochholz, V ­ ize-Chef der Polizeiinspektion Fürth, „ist kein Straftatbestand“ – aber in Cybermobbing vereinigen sich einzelne Straftaten. Meist sei den Jugendlichen nicht einmal bewusst, dass böse Sprüche im Chat mit harmlosen Blödeleien nichts gemein haben. Beleidigung, üble Nachrede, Bedrohung – und immer wieder ist von Kinderpornografie die Rede, wenn die Vorwürfe Akten füllen und auf dem Schreibtisch von Staatsanwalt Matthias Engelhardt landen. Es sei regelrecht ein Trend, dass sich Jugendliche, quasi als Vertrauensbeweis, Nacktbilder schicken, sagt er. Nicht selten landen die Bilder im Netz. Mit dramatischen Folgen für die Opfer, weiß Kurt Stiermann von der Opferschutzorganisation Weißer Ring. Er schildert, wie ein Mädchen, nachdem ihr Nachtfoto veröffentlicht wurde, wochenlang online attackiert wurde: „Sie hat nicht mehr gegessen, sie fing an, sich zu ritzen. Erst dann wurden ihre Eltern aufmerksam.“ Was also tun gegen Cybermobbing? Ist es sinnvoll, das Handy der eigenen Kinder zu prüfen? Jurist Engelhardt weiß, dass es häufig die Kontrollen wohlmeinender Eltern sind, die Straftäter auffliegen lassen. Doch Pädagoge Lutz warnt vor derartigen Tabubrüchen und empfiehlt offene Gespräche: Wer nicht sicher sei, verhindern zu können, dass der Nachwuchs Aktfotos verschickt, könne zumindest dazu raten, dabei das eigene Gesicht nicht zu zeigen. Und hat das Kind in der virtuellen Welt Mist gebaut, solle man nach Lösungen suchen, statt das Kind abzukanzeln. Darin steckt eine gute Nachricht: Denn dies meint auch, dass Eltern den irrsinnigen technischen Fortschritt nicht verstehen müssen, um Verständnis für ihre Kinder zu haben. Ebenfalls gut: In Kooperation mit dem Weißen Ring werden an der Helene-Lange-Schule Medienscouts ausgebildet, die ihre Mitschüler über Stolpersteine im Internet aufklären sollen. So können sich Betroffene auch Gleichaltrigen anvertrauen. Quelle: Löw, 2015, S. 14 35 40 45 50 55 60 65 70 75 57 Kapitel 11 Risiken Chancen 3.Kategorisierung von Chancen und Risiken der Internetnutzung »Content« Kind als Rezipient »Contact« Kind als Teilnehmer »Conduct« Kind als Akteur Bildung, Lernen und digitale Kompetenz Bildungsressourcen Kontakt mit Gleichgesinnten Eigeninitiative oder gemeinsames Lernen Teilnahme und soziales Engagement Allgemeine Informationen Austausch in Interesensgruppen Konkrete Formen sozialen Engagements Kreativität und Selbstdarstellung Ressourcenvielfalt Eingeladen/inspiriert werden, kreativ zu sein oder mitzumachen Erstellung von benutzergenerierten Inhalten Identität und soziale Beziehungen Bertung (Persönliches/ Gesundheit/Sexualleben usw.) Soziale Netzwerke, Erfahrungen mit anderen teilen Ausdruck eigener Identität Kommerzielle Interessen Werbung, Spam, Sponsoring Verfolgung/Sammlung von persönlichen Informationen Glücksspiel, illegale Downloads, Hacken Aggression/Gewalt Gewaltverherrlichende/ grausame/volksverhetzende Inhalte Mobbing, Belästigung oder Stalking Andere mobben oder belästigen Sexualität Pornografische/ schädliche Inhalte Treffen mit Fremden, missbräuchliche Annäherungsversuche Erstellen/Hochladen von pornografischem Material Werte Rassistische/verzerrte Information/Raschläge (z. B. Werbung für Drogen) Selbstverletzung, ­ungewolltes Zureden/ Überredung Ratschläge z. B. zu Selbstmord/Magersucht geben Quelle: Lampert, 2014, S. 433 4. Fernsehzeiten für Kinder Im Vorschulalter höchstens eine halbe Stunde am Tag Für die täglichen Fernsehzeiten gelten folgende Empfehlungen: 5 –bis 3 Jahre: kein Fernsehen, höchstens im Ausnahmefall; –3 bis 5 Jahre: maximal eine halbe Stunde; –5 bis 7 Jahre: maximal 45 Minuten; –8 bis 10 Jahre: maximal eine Stunde; –10 bis 12 Jahre: maximal 90 Minuten; 10 –12 bis 14 Jahre: maximal 100 Minuten; –ab 14 Jahre: maximal zwei Stunden. Was sonst noch wichtig ist: 1. Sorgen Sie für genügend Ausgleichszeiten. Faustregel: So lange wie ein Kind fernsieht, so viel Zeit sollte es auch mit Bewegung oder Spielen verbringen. 2.Kein Fernsehen morgens vor der Schule beziehungsweise vor dem Kindergarten. 3.Kinder unter 14 Jahren brauchen keinen Fernseher in ihrem Zimmer. 4.Der Fernsehraum sollte nicht dunkel sein, sondern so hell, dass bei dem Licht auch noch gelesen werden könnte. 5.Der Gebrauch des Fernsehers sollte sich unserem Tagesrhythmus anpassen, nicht umgekehrt. Quelle: Donaukurier Nr. 62, 13.03.2008, S. 45 15 20 25 58 Kapitel 12 Materialien Kapitel 12 1. Kinder im „Staatsbesitz“? 5 10 15 20 25 Um es gleich vorab zu sagen: Kinderkrippen wurden geschaffen, um die Bedürfnisse von Familien zu erfüllen, in denen beide Elternteile arbeiten wollen oder müssen, und sie dienen zugleich dem wachsenden Bedarf der ­Gesellschaft und der Wirtschaft an Erwerbstätigen. Sie wurden nicht eingerichtet, um die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen. Dennoch ist es vielen Ländern gelungen, die Qualität dieser Institutionen so weiterzuentwickeln, dass sie den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder Rechnung tragen. Man sollte auch nicht vergessen, dass etwa zehn Prozent aller Kinder, die Krippen und Kindergärten besuchen, von diesen Institutionen allein deshalb profitieren – und vielleicht auch eine etwas glücklichere Kindheit haben –, weil ihnen auf diese Weise ermöglicht wird, bis zu zehn Stunden unter der Woche von ihren dysfunktionalen Familien getrennt zu sein. Politisches Ziel der EU und anderer politischer Organisationen wie etwa der OECD1 ist es heute, so viele Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren wie möglich in Tageseinrichtungen ­ unterzubringen, was für mich eher einer 1 2 Zwangsmaßnahme gleichkommt und mit demokratischen Gepflogenheiten nichts zu tun hat. Die Argumentation ist eindeutig, die Absicht leicht zu durchschauen: Es geht um das politische Interesse des jeweiligen Landes, 30 ökonomisch mit anderen Ländern Schritt zu halten und konkurrieren zu können. Weshalb es notwendig ist, dass Eltern bereits kurze Zeit nach der Geburt wieder produktiv arbeiten können und wir deshalb die Kinderbetreuung 35 am besten gleich in eine fünfjährige Vorschulzeit umwandeln. Das erinnert sehr an die Zeit der frühen Industrialisierung, als die Fabrikbesitzer von einer direkten Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine geträumt haben. 40 Kinder werden zu Investitionsobjekten, und wie bei jeder beliebigen Investition muss auch diese für den Investor profitabel sein! Die „Empfehlungen“ der EU sind natürlich schöner verpackt und präsentieren sich in einer ganz 45 anderen Sprache, aber die Zielvorgabe ist glasklar. Das wirft eine wichtige Frage auf: Gehören die Kinder dem Staat oder ihren Eltern? Natürlich gehören sie niemandem, nur sich 50 selbst, aber wen interessiert das schon! Es bleibt abzuwarten, ob es den Politikern gelingt, die Eltern davon zu überzeugen, sich diesem Industrialisierungsmodell anzupassen. Unsere historischen Erfahrungen mit Kin- 55 dern in „Staatsbesitz“, die in ideologisch fundierten, pädagogisch konformen Tageseinrichtungen großgezogen wurden, sind nicht gerade vielversprechend – um nicht zu sagen beängstigend. Wie zum Beispiel die Einrichtun- 60 gen in der ehemaligen Sowjetunion, der DDR oder das Konzept der israelischen K ­ ibbuzim2. Juul, 20122, S. 5 ff. ECD (engl.: Organisation for Economic Cooperation and Development): Organisation für wirtO schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Kibbuz(im) (hebr.) bezeichnet eine ländliche Gemeinschaftssiedlung vorwiegend in Israel mit kollektiver Wirtschaft und gemeinsamen Eigentum (vgl. Hobmair, 2009, S. 263). 59 Kapitel 12 2.Probleme der erzieherischen Arbeit in Kindertagesstätten a) Probleme der Krippenerziehung 5 10 Die Diskussion um die Betreuung in Kinderkrippen wird sehr ideologisch geführt. „Es ist ein Glaubenskrieg“, stellen Andrea Brandt u. a. (2008, S. 42) fest und schreiben weiter, dass jeder sein eigenes Lebensmodell rechtfertigen möchte. Ein Problem von Kinderkrippen kann die Instabilität in der Betreuung, wie zum Beispiel Krankheitsausfälle oder Urlaub des Personals, sein. Oder die Einrichtung bietet keine optimalen Bedingungen. Nur drei Prozent der Kinderkrippen in Deutschland werden laut einer Studie für gut befunden (vgl. Bartsch u. a., 2013, S. 23). 15 20 25 30 35 Zu einer Schwierigkeit kann es auch kommen, wenn das Kleinkind als Voraussetzung eine unsichere Bindung mitbringt oder die Eingewöhnungszeit nicht ausreichend ist. Sie wird nach Wilfried Datler vom Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien völlig falsch eingeschätzt und Lieselotte Ahnert, renommierte Bildungsforscherin, ebenfalls an der Universität Wien, appelliert: „Nehmt euch genug Zeit für die Eingewöhnung!“ (Ahnert, 2013, S. 16). Eine Studie ergab, dass es mit den vorhandenen Betreuungsangeboten nicht gelingt, die Chancengleichheit zu erhöhen und bildungsferne Schichten zu unterstützen. Die Unterstützung nützt vor allem den gut gebildeten Mittel- oder Oberschichtsfamilien (vgl. Bartsch u. a., 2013, S. 23). Viele Eltern aus unterprivilegierten Schichten können die Kosten für eine Kindertagesstätte nicht aufbringen, sodass gerade diejenigen Kinder, die von ihr am meisten profitieren könnten, diese nicht besuchen können. 40 b) P robleme der erzieherischen Arbeit im Kindergarten 45 −− Probleme können entstehen, wenn sich die Erwartungen des Träger des Kindergartens und der Erziehungsberechtigten widersprechen. −− Probleme können auch entstehen, wenn 1 vgl. Kapitel 10.4.4 die Weltanschauung des Personals bzw. des Träger und die der Erziehungsberechtigten stark voneinander abweichen, sodass eine sinnvolle Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes kaum mehr möglich ist. −− Das Elternengagement und das Interesse der Eltern am Kindergarten sind nicht immer befriedigend; Erzieherinnen beklagen sich oft über mangelndes Interesse der Eltern oder über nur mäßig besuchte ­Elternabende. Die Praxis in vielen Kindergärten belegt, dass Elternabende oder ähnliche Veranstaltungen von den Eltern besucht werden, die sich in der Regel viele Gedanken über die Erziehung ihrer Kinder machen. Gerade Eltern, bei deren Kindern Probleme wie zum Beispiel Sprachstörungen oder Kontaktschwierigkeiten auftreten, erscheinen nur selten. −− Viele Eltern verlangen von ihren Kindern im Vorschulalter schulische Leistungen in Unkenntnis darüber, dass das freie Spiel das Kind mehr fördert als geplante Aktivitäten. Ein Spiel selbst zu gestalten, fordert und fördert das sich entwickelnde Gehirn ungleich mehr, als vorgegebene Regeln zu übernehmen.1 Wissenschaftler und der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte warnen deshalb auch davor, Kindergartenkinder mit Vorschulangeboten zu überfordern. „Nichts kann das Kind in seiner Entwicklung beschleunigen. Und nichts kann das Kind in seiner Entwicklung verbessern. Alles passiert von selbst. Man kann das Rattenrennen ums Superkind getrost absagen.“ (Largo, in: Kullmann, 2009, S. 47, online abruf- 50 55 60 65 70 75 80 bar unter; http://www.spiegel.de/spiegel/print/ d-66284679.html) −− Probleme können sich auch ergeben, wenn im Kindergarten ein anderer Erziehungsstil angewandt wird als im Elternhaus. −− Mögliche Defizite, die sich aus der unterschiedlichen Herkunft der Kinder mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen ergeben können, werden Erzieherinnen in den seltensten Fällen ausgleichen können. Folglich kann bei Schuleintritt nicht von Chancengleichheit gesprochen werden. 85 90 60 Kapitel 12 95 100 105 −− Eine weitere Grenze der pädagogischen Arbeit im Kindergarten liegt in den sehr großen Kindergartengruppen. Häufig besuchen 20 bis 25 Kinder – teils sogar mehr – eine Kindergartengruppe, die in der Regel nur von einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin betreut wird. −− Die Träger der meisten Kindergärten in der Bundesrepublik Deutschland sind die Kirchen; jedoch besuchen auch viele ausländische Kinder den Kindergarten, deren Grundsätze, auch aufgrund ihres Glaubens (zum Beispiel bei Muslimen), von denen der christlichen Kirchen in manchen P ­ unkten abweichen. −− Vor allem viele ausländische Kinder haben keine ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache; es treten Sprachprobleme auf. −− Verhaltensauffällige bzw. „schwierige“ Kinder überfordern häufig die Erzieher. Die Erzieher und Kinderpfleger sind jedoch verpflichtet, sich um alle Kinder ihrer Gruppe zu kümmern. Die Grenze der pädagogischen Arbeit im Kindergarten ist dort, wo sonderpädagogische Maßnahmen notwendig wären. Eine solche Arbeit kann der Kindergarten jedoch nicht leisten. 110 115 3. Probleme der schulischen Arbeit 5 10 15 20 25 30 Keine erzieherische Einrichtung zieht so viel Kritik auf sich und ist mit Problemen erzieherischer Arbeit behaftet wie gerade die Schule. Jede Schulart hat ihre spezifischen Probleme. Streitfragen wie beispielsweise die hierarchische Struktur der Schule und ihre zunehmende Bürokratisierung, „Mammutschulen“, zu wenig Lehrkräfte, zu große Klassen, zu viele Hausaufgaben für die Schüler, immer mehr Unterricht am Nachmittag, mit Lerninhalten überfrachtete Lehrpläne, häufiger Stundenausfall oder unzureichende Förderung von benachteiligten Kindern sind hinlänglich bekannt. Nur auf einige Probleme kann näher eingegangen werden: −− Die Hauptschule hat vor allem in den Städten einen schlechten Ruf und taucht in den Medien gelegentlich mit dem Schlagwort „Restschule“ oder „Sackgasse” auf. Ungleiche Chancen vor allem von Unterschichtskindern, schlechte Zukunftsaussichten der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt, eine mangelnde Integration von Schülern mit Migrationshintergrund oder Probleme in der Familie machen Hauptschulen zu „Brennpunktschulen“. Manche namhafte Pädagogen fordern inzwischen die „Abschaffung der Hauptschule“ – so auch die OECD1, die eine Zusammenlegung von Haupt- und Realschule anmahnt – oder benennen die Hauptschule um, etwa in ­ Mittelschule. Doch der Professor für Schultheorie und -forschung, Dr. Achim Leschinsky (2008, 1 S. 399) meint hierzu: „Ein Ende vielleicht der Hauptschule, aber nicht des ­Problems“. „Keine Schule wird allein dadurch besser, dass man die Klassen mischt und am Eingang ein neues Schild aufhängt.“ (Dahlkamp u. a., 2009, S. 145) −− Schule orientiert sich primär an der Mittelschicht, sodass diejenigen Kinder „bevorzugt“ werden, die aus diesem Milieu kommen. Kinder aus unteren Schichten haben es schwerer, vor allem in einer höheren Schule mitzukommen (vgl. Giesecke, 2009, S. 90 f.). −− Oft geben Lehrer der Selektion Vorrang gegenüber der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Oftmals ist dies „von oben“ erwünscht. −− Auch die frühe „Qual der Schulwahl” nach der 4. Jahrgangsstufe wird heftig kritisiert, da Schule in vielen Bundesländern damit mehr und mehr zum Ausleseinstrument wird und bei den Kindern die Angst erzeugt zu versagen. Oft kann nach vier Schuljahren noch gar keine fundierte Entscheidung für den weiteren schulischen Weg des Kindes getroffen werden. −− Viele Bundesländer haben die Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre verkürzt und das Abitur wird bereits nach der 12. Jahrgangsstufe abgelegt. Man spricht vom G8, welches wegen der sehr hohen Stunden- arl Theodor Jaspers (1883–1969) war deutscher Psychiater, der als Philosoph weit über DeutschC land hinaus bekannt wurde. Er galt als herausragender Vertreter der Existenzphilosophie 35 40 45 50 55 60 65 61 Kapitel 12 zahl und der immensen Stofffülle in Kritik geraten ist. 70 75 80 85 90 −− Kritisiert wird heute mehrfach, dass Schule nicht mehr in erster Linie der Bildung, sondern lediglich nur noch der Ausbildung dient1. Der Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier meint, dass Lerninhalte seit Jahren nach ihrer Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt ausgewählt werden, echte Bildung bliebe auf der Strecke. Der Verzicht auf sie werde die demokratische Grundordnung gefährden, weil politische Urteilsfähigkeit und Kritikfähigkeit fehlten. Kinder werden so zu unkritischen und angepassten Lernmaschinen erzogen, die in das vorhandene Wirtschaftssystem eingepasst werden. Hierzu hat vor allem PISA beigetragen2. Bildung darf jedoch nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen werden, sondern dient in erster Linie der Ausgestaltung des Menschseins, die Zeit benötigt. Diesem Gesichtspunkt muss die Schule Rechnung tragen. „Nicht Menschen werden [in der Schule] erzogen, sondern ‚Humankapital‘3 herge(Wieczorek, 2009, S. 264) stellt.“ 1 −− Ausgelöst durch PISA4 hat sich eine inzwischen wieder aufgeflammte, unversöhnliche Diskussion um die richtige Schulform entfacht, die sehr ideologisch geführt wird und mehr an einen „Glaubenskrieg“ erinnert. Dabei steht die Art des Schulsystems im Mittelpunkt des Streits (mehrgliedriges Schulsystem auf der einen und Gesamtbzw. Einheitsschule auf der anderen Seite).3 Vertreter dieser oder jener Schulform nehmen für sich in Anspruch, Kinder in „ihrer“ Schulform optimal fördern zu können und gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Doch solche Äußerungen sind mit Vorsicht zu genießen, da es zu diesem Thema sehr widersprüchliche, zum Teil auch methodisch fragwürdige Untersuchungen gibt. Auch die PISA-Studie gibt hierüber keine wissenschaftlich fundierte Auskunft. Generell ist nur die Aussage möglich, „dass nicht die Schulform per se eine entscheidende Determinante der Schuleffektivität ist, sondern die jeweilige Ausgestaltung der Lernkultur in jeder einzelnen Schule“ (Köller, 2005, S. 484). −− Die Forderung nach Chancengleichheit in der Schule brachte auch Probleme mit sich. Es wird oft der Einwand vorgebracht, dass Niveau und Bildungsqualität abgesenkt würden und auch „Nicht Geeignete“ weiterführende Bildungseinrichtungen b ­ esuchen. Nicht ganz unschuldig daran ist die OECD, die immer wieder fordert, eine möglichst hohe Abiturientenquote zu erreichen. Die Grundschule wird deshalb immer mehr zu einer Fabrik, die dazu da ist, „aus Kindern Gymnasiasten zu machen“. Doch „der Zweck der Grundschule ist nicht vorrangig die Herstellung zukünftiger Abiturienten“ (Goos, 2014, S. 50). vgl. Kapitel 4.3.2 Man muss bedenken, dass PISA – so der der Journalist und Parteienforscher Thomas Wieczorek – kein Vorhaben eines Humanistischen Bildungsvereins ist, sondern eines der Weltwirtschaftsorganisation OECD, die „Wachstum, Liberalisierung der Finanzmärkte sowie des Handels mit Gütern und Dienstleistungen, außerdem Deregulierung und Privatisierung auf ihre Fahnen geschrieben“ hat (Wieczorek, 2009, S. 252). 3 Unter Humankapital wird der Wert der Qualifikation (Wissen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Können und dergleichen) einer Arbeitskraft für Gesellschaft und Unternehmen verstanden (vgl. Hobmair, 20143, S. 295). 4 siehe Abschnitt 12.3.3 2 95 100 105 110 115 120 125 130 62 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 Kapitel 12 Doch solche Erscheinungen dürfen nicht gegen die Forderung nach Bildungsgerechtigkeit ausgespielt werden. −− Es wird heute eine inklusiven Erziehung gefordert, die eine gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von allen Kindern und Jugendlichen von vornherein vorsieht1. Doch die Lehrer sind hierfür (noch) gar nicht ausgebildet und überfordert. Auch die Rahmenbedingungen für ein inklusives Unterrichten sind (noch) nicht gegeben. Festgestellt wird dabei auch, dass die Schulen zwar inklusiv werden sollen, Beeinträchtigte wie Menschen mit Behinderungen aber von den Testungen wie PISA, TIMSS ausgeschlossen und ihre Leistungen in den Ergebnissen nicht berücksichtigt werden (vgl. Hörmann/ Hopmann, 2011, S. 105). −− Bildungsforscher bedauern, dass Lehrbzw. Bildungspläne oft der Quantität und nicht der Qualität den Vorrang geben. Man spricht hier gelegentlich von Bulimie-Lernen: Der Schüler wird schnell und mit viel Lernstoff gefüttert, welcher dann in Prüfungsarbeiten wieder von sich gegeben und danach wieder vergessen wird. Bildung ist aber mehr, als nur auswendig Gelerntes wiederzugeben. −− Lehrer beklagen sich – wie eine Umfrage ergab –, dass sie das System „Schule“ mürbe macht. Sie können ihre Schüler aufgrund der ständig zunehmenden Bürokratisierung und (unnötiger) Zwänge des Schulalltags nicht so individuell fördern, wie sie das gern tun würden und es den Begabungen der Schüler entspricht. Viele Lehrer haben den Eindruck, im Mittelpunkt stünde die Verwaltung von Schule und nicht die Schüler. Sie fühlen sich in ihrem Engagement ausgebremst, weil sie ständig an ihre Grenzen stoßen. Schul- und Dienstordnungen, Lehrplanvorgaben, von oben erlassene Vorschriften ohne Beteiligung der Betroffenen sowie Verplanung und Sanktionierungen bei Fehlverhalten lassen so gut wie keinen Freiraum für Selbstentfaltung sowohl für Lehrer als auch für Schüler (vgl. Wiater, 2013, S. 36 f.). 1 2 −− Dazu kommt, dass durch von oben ständig verordnete „Reformen“ immer wieder neue Unruhe in die Schulen gebracht wird, statt Lehrer in ihrem Kerngeschäft, dem Unterrichten, zu unterstützen (vgl. Felten/Stern, 2012, S. 143). −− Die Schulen leiden unter einem Lehrermangel, der in Zukunft dramatisch sein wird. Oft kann der reguläre Unterricht in der vorgegebenen Stundenzahl gar nicht abgedeckt werden. Schulexperten erwarten wegen der Unterdeckung in den Kollegien eine gewaltige Bildungskrise. „Das Schicksal einer Gesellschaft wird dadurch bestimmt, wie sie ihre Lehrer ach(Carl Jaspers1) tet.“ −− Auf der anderen Seite sind die Erwartungen an die Schulpädagogen sehr hoch. Es kommen zudem auf die Schule immer mehr erzieherische Aufgaben zu, die früher vom Elternhaus erfüllt wurden und mit denen sie zwangsläufig überfordert sein muss: Diese Aufgaben reichen von der Sozialerziehung, Anstands-, Umwelt-, Medien­ erziehung und wirtschaftlichen Verbraucherbildung (Schüler sollen den Umgang mit Geld lernen) bis hin zur Friedenserziehung. Zudem werden gesellschaftliche Probleme wie Alkohol- und Drogenmiss­ brauch, soziale Auffälligkeiten und Ausländerfeindlichkeit zum Aufgabenbereich der Schule erklärt (vgl. Stein, 2009, S. 73). „Bildung wird zunehmend als Sozialpolitik verstanden, und das hat Auswirkungen auf die Leistungsanforderungen: Sie sinken [...] Die Standards gehen verloren, das Niveau (Dahlkamp u. a., 2009, S. 145 f.) sinkt.“ −− Auch die Hochschule erfährt aufgrund der Einführung des Bachelor- und Masterabschluss2 Kritik: Sie sei zu sehr wirtschaftlich orientiert, zu sehr verschult, und es gehe an den Universitäten nicht mehr um Bildung, sondern nur noch um Ausbildung. Dieter Lenzen von der Universität Hamburg vgl. Kapitel 14.5.3 Der Bachelor ist ein „erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss“, der die Grundlagen vermittelt. Er ist Voraussetzung für den Master, ein forschungs- oder anwendungsorientierter „zweiter Hochschulabschluss“, welcher auf dem Bachelor aufbaut. Bachelor und Master gehen auf den BolognaProzess zurück, welcher die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums beabsichtigt. 185 190 195 200 205 210 215 220 225 63 Kapitel 12 230 235 stellt fest, dass die Hochschule Absolventen produziert, die nicht über den eigenen Tellerrand hinausblickten und fordert, dass sich die Universität wieder auf klassische Bildungsideale zurückbesinnen und selbstständige, kritische Persönlichkeiten formen müsse, anstatt reine Lernfabriken zu betreiben (vgl. Lenzen, 2014). In vielen Studienfächern brechen nicht weniger, sondern mehr Studierende ihr Studium ab. −− Zudem wird vor allem das zu geringe Alter an der Hochschule und beim Verlassen dieser beklagt. Studenten sind oft erst 17 Jahre alt, wenn sie an die Hochschule kommen und verlassen sie wieder mit 21 (vgl. Lenzen, 2014, S. 33 f.). Und eine Tageszeitung betitelte einen Artikel über das immer niedriger werdende Eintrittsalter der Studierenden mit: „Mit Mama an die Hochschule“. 240 245 Studentwohnungen Eltern suchen für ihre Tochter eine Studentenunterkunft (Zi. od. Ap.) zum 15.8. 4. Probleme der Heimerziehung und der Kinder- und Jugendarbeit a) Probleme der Heimerziehung −− Wenige professionelle Erzieher betreuen meist zu viele Kinder. Problematisch ist, dass den Kindern oder Jugendlichen oft eine feste Bezugsperson fehlt; deshalb 5 kann sich kein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit entwickeln. Dieses Problem wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass nach getaner Arbeit die einen Erzieher gehen und die anderen Erzieher kommen 10 (große Fluktuation des Erzieherpersonals). −− Sozial auffällige Kinder oder Jugendliche beeinflussen die anderen ungünstig. Da Kinder/Jugendliche in Heimen in Gruppen zu15 sammenleben, können möglicherweise verhaltensgestörte Kinder/Jugendliche einen negativen Einfluss auf die anderen ausüben. −− Die Heimordnung ist manchmal wichtiger als ein Erfolg in der Erziehung. Sinnloses 20 Festklammern der Erzieher an Regeln der Heimordnung, die für Kinder/Jugendliche schwer oder gar nicht zu verstehen sind, steht einem Erziehungserfolg manchmal 25 im Weg. −− Heimkindern fehlt oft die notwendige Spontaneität. Der starre Tagesablauf, der geplante Wechsel der Erzieher, die Massenpflege usw. begünstigen, dass Kindern/Jugendlichen Kreativität und Spontaneität genommen werden. −− Eine Heimeinweisung erfolgt häufig zu spät. Bis das Jugendamt eine Heimeinweisung anordnet, verstreicht viel Zeit und das sozial abweichende Verhalten kann sich verfestigt haben. −− In manchen Heimen fehlen gut ausgebildete professionelle Fachkräfte und es stehen nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung, sodass beispielsweise notwendiges pädagogisches Material nicht besorgt werden kann. −− Heime haben oft keinen guten Ruf. Dies liegt zum Teil daran, dass Heime häufig als „sehr streng“ bekannt sind und man ins Heim kommt, wenn die Eltern mit ihrem Kind „nicht mehr fertigwerden“ („Dann kommst du ins Heim!“). Zum anderen haben manche Heime in letzter Zeit durch Misshandlungs- und Missbrauchsvorwürfe Vertrauen in der Bevölkerung eingebüßt. 30 35 40 45 50 64 Kapitel 12 b) Probleme der Kinder- und Jugendarbeit 55 60 65 70 75 80 85 90 Probleme der Kinder- und Jugendarbeit entstehen einerseits bei den Kindern und ­Jugendlichen selbst, andererseits bei den Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit oder ihren Trägern. −− Ein zunehmendes Desinteresse vor allem von Jugendlichen an Angeboten und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit kann festgestellt werden. Nach Herrmann (2004) sind die angebotenen Freizeitaktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit aufgrund einer zunehmenden Ausbreitung der elektronischen Medien – Fernsehen, Computer u. a. – in allen Bereichen für die angestrebten Zielgruppen uninteressant. Zudem werden die Wünsche von Kindern und Jugendlichen spezieller, die Kinder- und Jugendarbeit kann oft auf die Vielzahl unterschiedlicher Wünsche nur unzureichend reagieren. −− Wie vielfältig und abwechslungsreich die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind, hängt auch von den finanziellen Mitteln ab, die ihr oft nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. −− Wie viele hauptamtliche und nebenamtliche Mitarbeiter bei den jeweiligen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt werden können, hängt ebenfalls von den finanziellen Mitteln ab. Häufig ist es aus finanziellen Gründen nicht möglich, ausreichend Personal zu haben, was auf Kosten der Qualität in der Kinder- und Jugend­ arbeit geht. −− Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich an den Bedürfnissen und Interessen von Kindern und Jugendlichen. Für die Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie keine fest geregelte Arbeitszeit haben, sodass dieser Beruf vor allem für verheiratete Mitarbeiter mit Kindern nicht sehr attraktiv ist. −− In der Kinder- und Jugendarbeit sind neben Hauptamtlichen viele nebenamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. Doch nur das hauptamtliche Personal, welches meist in der Minderzahl ist, hat eine spezielle Ausbildung zum Erzieher bzw. Sozialpädagogen, was bei den Nebenamtlichen und Ehrenamtlichen nicht der Fall ist. Die Ansprüche in der Kinder- und Jugendarbeit sind jedoch in der heutigen Zeit sehr hoch, sodass diese nur von professionell ausgebildetem Personal erfüllt werden können. −− Die hauptamtlichen Sozialpädagogen bzw. Erzieher sind oft mit Verwaltungstätigkeiten wie beispielsweise Rechenschaftsberichte, Anträge auf Bewilligung von Mitteln u. a. beschäftigt, Zeit, die zwangsläufig von der Arbeit mit den Kindern bzw. Jugendlichen eingespart werden muss. Sozialpädagogen und Erzieher beklagen den immensen bürokratischen Aufwand, der nur auf Kosten der eigentlichen Arbeit betrieben werden kann. −− Die Erwartungen der Träger, der Mitarbeiter und der Kinder bzw. Jugendlichen an die Kinder- und Jugendarbeit sind meist sehr unterschiedlich, können oft nicht „unter einem Hut gebracht“ werden und widersprechen sich manchmal. −− Der Kinder- und Jugendarbeit wird oft mit Vorurteilen begegnet, was eine effektive pädagogische Arbeit erschwert. „Jugendarbeit ist ein geeigneter Platz zum Drogenkonsum“ ist ein solches in der Öffentlichkeit weitverbreitetes Vorurteil, das vor allem Jugendzentren und Jugendtreffs betrifft. 95 100 105 110 115 120 125 65 Kapitel 13 Materialien Kapitel 13 1.Zugänge Leistungsberechtigter zu Hilfen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Grundsätzlich steht Eltern, Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum allgemein fördernder und unterstützender Angebote [...] zur Verfügung, die sie selbstständig und nach eigenem Ermessen nutzen. Zu diesen Leistungen gehören die offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Kindertageseinrichtungen Erziehungs- und Familienberatung, Jugendberatung, Familienbildung sowie die Beratung und Unterstützung für alleinerziehende Eltern u. a. Diese Angebote stellen wichtige Sozialisations- und Bildungsorte für Kinder und Jugendliche bzw. deren Eltern u. a. dar und übernehmen damit auch präventive Funktionen, indem sie das Ziel verfolgen, Problemlagen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. Der Zugang zu diesen Angeboten ist abhängig von einigen Faktoren: Die Kinder, Jugendlichen, Eltern u. a. sollten gut über die Angebotsvielfalt informiert sein, die Zugänge sollten von Freiwilligkeit geprägt und die Angebote gut erreichbar und niederschwellig angelegt sein. Die Infrastruktur ist in den Kommunen und Landkreisen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Im Falle von schwerwiegenden sozialen Problemen, Not-, Krisen- bzw. Belastungs- oder Überlastungssituationen oder wenn das Wohl des Kindes oder Jugendlichen nicht mehr gewährleistet ist, müssen erzieherische Hilfen [...] zum Tragen kommen. Treten solche schwerwiegenden Problem- und Krisensituationen ein, gibt es grundsätzlich drei Wege, auf denen Kinder, Jugendliche oder Erziehungsund Sorgeberechtigte den Weg zu einer erzieherischen Hilfeleistung finden können: −− Selbstmelder −− Hinweise Dritter −− Zusatz- oder Anschlusshilfen Selbstmelder: Eine Zugangsmöglichkeit besteht darin, dass sich ein Kind oder ein ­Jugendlicher oder die Erziehungs- und Sorgeberechtigten selbst an das zuständige Jugendamt wenden. In Notfällen und in akuten Krisensituationen, die von Kindern oder Ju- gendlichen selbst angezeigt werden, müssen Kinder oder Jugendliche auch im Sinne einer Notaufnahme kurzfristig in Obhut genommen werden (§ 42 SGB VIII/KJHG). In Gesprächen mit der zuständigen SozialarbeiterIn im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes wird gemeinsam mit dem Kind oder Jugendlichen herausgearbeitet, welche Probleme vorliegen und welche Veränderungs- bzw. Lösungsmöglichkeiten, ggf. auch mit Unterstützung durch Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, initiiert werden können. Hinweise Dritter: Demgegenüber kann der Fall eintreten, dass Gefährdungsmomente dem Jugendamt von Dritten angezeigt werden. In dieser Situation muss der Allgemeine Soziale Dienst tätig werden und prüfen, ob ein Hilfebedarf bei der benannten Familie besteht. Im Falle einer erheblichen Gefährdung des Kindeswohls müssen sofort Interventionen zum Schutz des Kindes oder des Jugendlichen geleistet werden. Diese können ggf. auch gegen den Willen der Eltern erfolgen. Zusatz- oder Anschlusshilfen: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Familie dem Jugendamt bereits bekannt ist, weil sie z. B. bereits Beratungen oder erzieherische Hilfen gemäß § 27 ff. SGB VIII/KJHG in Anspruch genommen hat. Bei der Zusatzhilfe werden zusätzliche erzieherische Hilfen bspw. mit der gezielten Unterstützung eines Kindes der Familie in die Hilfeplanung mit aufgenommen. Bei der Anschlusshilfe wird im Rahmen der bereits bestehenden Hilfeplanung ein anderes Hilfesetting im Anschluss an eine bereits bestehende Hilfe geplant. Dies geschieht bspw. beim Auszug eines Jugendlichen aus einer betreuten Wohnform, wenn im A ­ nschluss an die stationäre Hilfe gemäß § 34 SGB VIII/KJHG eine ambulante Hilfe gem. §30 SGB VIII/KJHG geleistet wird. Quelle: Rätz/Schröer/Wolff, 2014 S. 83 50 55 60 65 70 75 80 85 66 Kapitel 13 2.Die ökologischen Systeme nach Urie Bronfenbrenner 5 10 15 Urie Bronfenbrenner versteht Ökologie als Lehre vom „Lebensraum“, der in einer wechselseitigen Beziehung mit den darin existierenden Individuen steht. Der Mensch ist in ver­schiedene Systeme einge­bun­den, beeinflusst diese und wird seiner­seits von ihnen in seinem Verhalten gelenkt. In den einzelnen Sy­stemen zeigt sich seine soziale Eingebundenheit insbesondere dort, wo sie durch Tätigkeiten, zwischenmenschliche Beziehungen und Rollen gekenn­ zeichnet ist. Insgesamt unterscheidet Bronfenbrenner fünf ökologische Systeme: −− das Mikrosystem, −− das Mesosystem, −− das Chronosystem, −− das Exosystem und −− das Makrosystem. Das Mikrosystem1 20 25 Das Mikrosystem stellt den un­ mittelbaren Le­bensbereich des sich entwickelnden Menschen dar. Ein Lebensbereich ist dabei ein Ort, an dem Personen leicht in Kon­takt miteinander treten können. Beispiele für solche Lebensbereiche wären das Zim­mer, in dem ein Kind spielt, die Klasse, in der ein Jugendlicher lernt, oder die Familie, in der er aufwächst. Das Mesosystem2 30 35 40 Die Umwelt eines Menschen setzt sich aus vielen Mi­krosystemen wie Familie, Nachbarschaft, Kinder­garten, Schule und Arbeitsplatz zusammen. Diese verschiedenen Mikro­ systeme bestehen jedoch nicht isoliert voneinander, sondern ste­hen miteinander in Verbindung und beeinflussen sich gegenseitig. Besucht ein Kind den Kindergarten, so entstehen vielfältige Kontakte zwischen den beiden Lebensbereichen, Eltern­haus und Kindergarten, die gegenseitige Beeinflussungen nach sich ziehen. So legt die Erzieherin zum Beispiel Wert auf die Einhal­tung der Gruppenregeln und der Öffnungszeiten. Das Kind bringt bestimmte Wün­ ­ sche, Bedürfnisse und Per1 mikrós (griech.): klein mésos (griech.): Mitte 3 chrónos (griech): die Zeit 4 éxo¯ (griech): außen, heraus 2 sönlichkeitsmerkmale mit, auf die die Erzieherin eingehen muss. Diese Wechselbeziehungen zwischen zwei oder mehreren Lebensbereichen, an denen eine Person beteiligt ist, werden Mesosysteme genannt. 45 Das Chronosystem3 50 Während ihrer Entwicklung treten Personen immer wieder in neue Lebensbereiche ein und übernehmen neue Rollen. Der Eintritt in Kindergarten, Schule, Be­rufsleben, aber auch Heirat oder Scheidung sind Beispiele dafür. Solche „Lebensübergänge“ werden als Chronosysteme bezeichnet. Ein Chronosystem ist ein „Lebens­ über­ gang [...], der stattfin­ det, wenn eine Person ihre Position in der öko­logisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle oder ihres Lebensbereichs verändert [...]“ (Bronfenbrenner, 19962, S. 77). 55 60 Das Exosystem4 Einen weiteren Umweltausschnitt stellt das Exosy­stem dar. Es gibt Lebensbereiche, die die Entwicklung einer Per­ son beeinflussen, obwohl diese Person gar nicht an ihnen teilhat. Umgekehrtes gilt genauso: Eine Person beeinflusst einen Le­ bensbereich, an dem sie gar nicht teilnimmt. Die wechselseitige Beeinflussung er­folgt dabei über andere Personen. So stellt zum Beispiel der Arbeitsplatz der Eltern ein Exosystem für das Kind dar, da es an ihm nicht beteiligt ist. Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Lärm sowie körperliche und psychi­ sche Beanspruchung wirken sich auf die Eltern aus und haben Einfluss auf das Erzieherverhalten der Eltern ihren Kindern gegenüber und somit auf die kindliche Entwicklung. Andererseits können zum Beispiel Krankheiten des Kindes die Eltern schwer belasten und sich auf ihr Leistungsvermögen an ihrem Arbeitsplatz niederschlagen. Unter Exosystem versteht man also einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht beteiligt ist, die aber indirekt diese Person beein­flussen und umgekehrt durch diese Person ­beeinflusst werden. 65 70 75 80 85 67 Kapitel 13 Das Makrosystem1 90 95 In der Vielzahl von Mikro-, Meso- und Exosystemen, aus der sich unsere Kultur zusammensetzt, lassen sich Be­ standteile finden, die gleich oder sehr ähnlich sind. Solche ­gemeinsamen Bestandteile können zum Beispiel politische oder religiöse Weltanschauungen sein, die Art und Weise, wie M ­ enschen miteinander umgehen, wie Einrichtungen funk­ tionieren usw. Solche typischen Übereinstimmungen oder Ähnlich­ keiten innerhalb einer Kultur oder eines ihrer Teilbereiche bil­ den das sogenannte Makrosystem. Als Makrosystem bezeichnet man also die grundsätzlich formalen und inhaltlichen Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten, die innerhalb einer Kul­tur oder einer Subkultur bestehen. 100 105 Makrosystem = die formalen und inhaltlichen Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten in den Systemen Exosystem = Lebensbereiche, die indirekt das Individuum beeinflussen und die durch das Individuum beeinflusst werden Mesosystem = Wechselbeziehungen zwischen den Mikrosystemen, an denen sich das Individuum aktiv beteiligt Mikrosystem = der unmittelbare Lebensbereich, in welchem das Individuum lebt Chronosystem = Lebensübergang, der durch einen Wechsel eines Mikrosystems stattfindet 1 makrós (griech.): groß 3. Nische und Habitat 5 Durch die Austauschprozesse zwischen der Person und ihrer Umwelt entsteht eine Nische. Sie kommt zustande durch das Einräumen von Handlungsmöglichkeiten. Nische ist damit das gesellschaftlich zugestandene Handlungsfeld einer Person, ihre Einflussmöglichkeit auf eine Gegebenheit. Jeder Schüler hat in seiner Klasse ein bestimmtes Handlungsfeld, das mehr oder weniger groß sein kann; er übernimmt bestimmte Aufgaben, spielt Rollen usw.; es kann sein, dass die Schule dem Schüler große Einflussmöglichkeiten einräumt, oder auch, dass der Schüler so gut wie keine Möglichkeiten hat, etwas zu verändern. 10 15 1 makrós (griech.): groß Nische bedeutet nicht wie üblich einen Rückzugswinkel, sondern das „Wirkungsfeld einer Person“, ihr gesellschaftlich zugestandenes Handlungsfeld – also, ob ein Mensch an einem bestimmten Platz Einflussmöglichkeiten besitzt oder nicht. Damit umschreibt der Begriff „Nische“ auch das Netz sozialer Beziehungen einer Person, deren aktives Handlungsfeld (vgl. Germain/ Gitterman, 19993, S. 29). Das von der Gesellschaft zugestandene Handlungsfeld einer Person kann groß bzw. gering sein und entsprechend diesen Tatsa- 20 25 68 Kapitel 13 30 35 40 45 50 chen ­unterscheidet man zwischen einer guten oder schlechten Nische: Bei einer schlechten Nische hat das Individuum kaum die Möglichkeit, das Missverhältnis zwischen Person und Umwelt zu ändern, bei einer guten Nische besteht diese Einflussmöglichkeit. Gibt der Lehrer beispielsweise seinen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, etwa die Auswahl des Lernstoffes oder andere wichtige Entscheidungen in der Klasse diskutieren zu lassen, und bezieht er ihre Meinung bei seinen Entscheidungen mit ein, so liegt hier eine gute Nische für den Schüler vor. Hat dagegen der Schüler keinerlei Einflussmöglichkeit auf das Schulleben, auf Lerninhalte und Ähnliches, so handelt es sich um eine schlechte Nische. Für den Sozialpädagogen/-arbeiter liefern die Analyse der Nischenstruktur und die durch das Individuum oder die Gruppe vorgenommene Bewertung wichtige Hinweise für das zu planende helfende Eingreifen. Neue Nischen entstehen dann durch die Begegnung mit herausfordernden Situationen. Beispiele: bauliche Gegebenheiten: Wohnhäuser, Architektur, Fabriken, dörfliche Ansiedlung, „Wohn­ raum­ verdichtung“, soziale Einrichtungen, Ver­ kehrs­ verbindungen, Freizeit-, Arbeitsmöglichkeiten soziale Gegebenheiten: verhaltensbeeinflussende Personen in Familie, Arbeit, im gesellschaftlichen Leben kulturelle Einrichtungen: Bürgerhaus, Theater, ­Museen Dieser verhaltensbeeinflussende Lebensraum eines Menschen mit seinen baulichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten wird als Habitat bezeichnet. Habitat ist der unmittelbare Lebensraum, der das Erleben und Verhalten eines Menschen beeinflusst. Der Sozialpädagoge/-ar­bei­ter rich­tet sein Be­ mü­hen da­rauf, Defizite zu erkennen und zusammen mit den Bür­gern ein an­re­gendes und un­ter­­stü­tzendes Ha­bitat zu ge­stal­ten, was wie­derum gu­te Vo­raussetzungen für Ni­schen­ ­bil­dungen bietet. 60 65 70 75 80 Nische das einer Person gesellschaftlich zugestandene Handlungsfeld, die Einflussmöglichkeiten, die ein Mensch an einem Platz hat gute Nische Der Mensch hat große Handlungs- bzw. Einflussmöglichkeiten, eine bestimmte Situation zu ändern. 55 Menschen „wohnen“ immer in einem bestimmten Lebensraum, der ihr Erleben und Verhalten nicht unerheblich beeinflusst. Dieser Lebensraum umfasst beispielsweise bauliche, soziale und kulturelle Gegebenheiten, die soziale Beziehungen und die Gesundheit von Individuen sowohl ­ unterstützen als auch beeinträchtigen ­können. schlechte Nische Der Mensch hat kaum Handlungs- bzw. Einflussmöglichkeiten, eine bestimmte Situation zu ändern. Aufgaben zur Gestaltung eines Habitats kön­nen zum Beispiel eine Tempo-30-Zone im Wohn­ge­ biet, die Einrich­tung ver­kehrsberuhigter Zo­nen, kul­tu­rel­le Angebote auf dem Land und derglei- 85 chen sein. 69 Kapitel 13 4. Empowerment 5 10 15 20 25 30 35 40 45 In allen in der Literatur zu findenden Definitionsangeboten wird herausgestellt, dass ­Empowerment als Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung und als Stärkung von Eigenmacht verstanden wird. Es bezeichnet biografische Prozesse, „in denen Menschen ein Stück mehr Macht für sich gewinnen – Macht verstanden als Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen [...] oder aber als ­ gelingende Bewältigung alltäglicher Lebensbelastungen [...]“. In diesem weiten Sinne markiert Empowerment also sowohl politische als auch psychosoziale Prozesse der Selbstbemächtigung. Sie können nicht nur von den Menschen selbstbestimmt, sondern ebenfalls professionell – so auch durch die Soziale Arbeit – initiiert und unterstützt werden. [...] Ausgehend von den Ressourcen ihrer Adressatinnen und Adressaten soll sie [...] auf deren Eigensinn beharren und dazu beitragen, dass sie ihre Lebensentwürfe verwirklichen können, sofern damit nicht Gefährdungen für sie selbst oder andere, wie Kinder, verbunden sind. Insbesondere dieser emanzipatorische Anspruch einer so verstandenen empowerment-basierten Sozialen Arbeit stellt die Fachkräfte im erzieherischen Kinderund Jugendschutz vor Herausforderungen. Denn aus einer kritischen Perspektive sind Widersprüche zwischen dem EmpowermentKonzept auf der einen und dem im § 14 SGB VIII geregelten erzieherischen Kinder- und Jugendschutz auf der anderen Seite zu verzeichnen. Solche Widersprüche finden sich in allen Feldern der Sozialen Arbeit: Einerseits werden der institutionelle Rahmen und damit die Handlungsaufträge und -möglichkeiten der Fachkräfte maßgeblich durch sozialpolitische Vorgaben bestimmt, die in die jeweils relevanten Sozialgesetze und Verordnungen eingegangen sind [...]. Andererseits ist aber für Empowerment [...] konstitutiv, dass für Soziale Arbeit der Eigensinn der Subjekte und ihre Lebensentwürfe handlungsleitend sein sollen. Optimistisches Menschenbild und Ressourcenorientierung Für das Empowerment ist ein optimistisches Menschenbild bestimmend. Danach sind alle Menschen handlungsmächtig und -fähig und können ihr Leben auch in prekären Lebenslagen mit belastenden Lebensbedingungen selbst gestalten. Zwar wird die gesellschaftliche Bedingtheit der Menschen und ihrer Lebensbedingungen ausdrücklich berücksichtigt, dennoch wird stärker ihre Selbstbestimmungsfähigkeit herausgestellt, mit der sie ihr Leben kreativ und mit Eigensinn zu gestalten vermögen. [...] Pointiert formuliert werden [...] im Empowerment-Konzept soziale Probleme individualisiert, indem ihre Lösung den betroffenen Menschen übertragen wird, anstatt die sozialstrukturellen Ursachen zu beseitigen. Übertragen auf die Elternarbeit im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz bedeutet dies, dass Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte dazu befähigt werden sollen, positive Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder zu schaffen. Mit dem einseitigen Fokus auf Befähigung und Handlungsmächtigkeit von Eltern geraten jedoch strukturelle Bedingungen wie Armut und Arbeitslosigkeit aus dem Blick, die in erheblichem Maße die positive Entwicklung junger Menschen gefährden können. So gesehen, steht empowerment-orientierte Elternarbeit in der Gefahr, die Eltern zur Lösung ihrer Probleme zu aktivieren und dabei die gesellschaftliche Bedingtheit von Problemlagen zu vernachlässigen. [...] Weitere Widersprüchlichkeiten sind mit der Ressourcenorientierung verbunden. Aufgrund des optimistischen Menschenbildes ist konsequentes ressourcenorientiertes Arbeiten für Empowerment konstitutiv. Ausgehend von einer ausführlichen Ressourcendiagnostik sollen die Adressatinnen und Adressaten nicht mehr länger mit einem Defizitblick betrachtet, sondern in ihren personalen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen umfassend gefördert werden. Prozesse der Selbstbemächtigung können durch Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit wie Elterngespräche [...] oder auch im Sozialraum durch Netzwerkbildung initiiert und unterstützt werden. Letzteres z. B. in Form von Bürgerbeteiligung und sozialpolitischer Einmischung von Elterninitiativen in die Kommunalpolitik. Eine so verstandene und mit einem optimistischen Menschenbild begründete Ressourcenorientierung findet sich jedoch nicht im Gesetz. Dort wird ausdrücklich 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 70 100 105 110 115 120 Kapitel 13 der Schutzauftrag benannt. Ihm soll entsprochen werden, indem Eltern und andere Erziehungsberechtigte „besser“ dazu befähigt werden, ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu bewahren (§ 14 Abs. 2, Satz 2). In dieser Formulierung wird ein Defizitbild von Eltern transportiert, das ihnen mangelhafte Erziehungskompetenzen unterstellt. Bezogen auf Empowerment eröffnet dieses Defizitbild zwei verschiedene Deutungsmöglichkeiten: Zum einen könnten sich die Fachkräfte vor ein Dilemma gestellt sehen. Unter der Annahme, dass sie durch die für ihre Arbeit geltenden gesetzlichen Grundlagen in ihrem beruflichen Selbstverständnis und ihren Deutungsmustern beeinflusst werden, würde dann der Defizitblick im Widerspruch zur Ressourcenorientierung und der damit verbundenen Überzeugung stehen, dass die Eltern über ausreichende Ressourcen verfügen, um ihr Leben selbst gestalten zu können. Zum anderen könnten die Fachkräfte die Ressourcenorientierung als eine von den Wertvorstellungen des Empowerments losgelöste Methode auffassen, die sie dazu nutzen, die Erziehungskompetenzen der Eltern in ihrem Sinne zu verbessern. Dann würde die Ressourcenorientierung auf eine sozialtechnologisch anmutende Strategie reduziert, mittels derer Eltern gezielter beeinflusst und in die von den Fachkräften gewünschte Richtung „verbessert“ werden können. Gleichermaßen defizitorientiert ist das in § 14 SGB VIII anklingende Kindheitsbild. Dort werden Kinder und Jugendliche „als schwache und hilfebedürftige Wesen“ [...] angesprochen, die eines besonderen Schutzes durch ihre Eltern oder andere Erziehungsberechtigte bedürfen. Vernachlässigt werden dabei [...] häufig solche Schutzkonzepte, die auf den Eigensinn und die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen bauen und zur Verständigung darüber anregen, was als Gefahr zu bewerten ist. In einer auf Empowerment basierenden Elternarbeit sind solche Überlegungen gemeinsam mit den Eltern zu diskutieren, um sie zur Selbstbemächtigung und Selbstbestimmung ihrer Kinder anzuregen. Quelle: Enggruber, 2015, S. 8 ff. 125 130 135 140 145 71 Kapitel 14 Materialien Kapitel 14 1.Das Lebensrecht von Menschen mit B ­ ehinderung und ökonomische Aspekte 5 10 15 20 Das Lebensrecht [von Menschen mit Behinderung] wird gegenwärtig auch in Verbindung mit ökonomischen Aspekten infrage gestellt. Der gestiegene Kostendruck wird geltend gemacht. Dabei erhebt sich die Frage, ob tatsächlich im Behindertenbereich die Kosten übermäßig gestiegen sind, ob wirklich eine „Überförderung und Überbetreuung von Behinderten und Schwerstbehinderten“ vorliegt, die beendet werden müsse, wie es ein Bezirkspräsident (1992) forderte. Es ist im Übrigen nicht unmittelbar nachzuvollziehen, gerade von einer Verminderung des Kostenaufwands für Menschen mit Behinderung eine Lösung der großen Finanzierungsprobleme zu erwarten. Tatsche war und ist, wie sehr der ökonomische Faktor in der gesamten Behindertenszene bestimmend geworden ist, und wie unverhüllt die Notwendigkeit einer Kosten-NutzenPrüfung geltend gemacht wird. Es ist zu befürchten, dass dieser Druck vor allem den Bereich treffen wird, in dem der rationale Nut- zen-Nachweis am wenigsten möglich ist. Allein schon die Frage, ob sich der Aufwand „lohne“, ist eine bedrohliche. Sie ist letztlich nicht eingrenzbar und könnte eine gefährliche Eigendynamik entfalten, die am Ende nicht nur die Lebensqualität und das Lebensrecht derer trifft, die am schwersten behindert sind und am wenigsten zum Bruttosozialprodukt beitragen können. Die argumentative Verbindung von Ökonomie und utilitaristischer Ethik ist nicht neu. Man denke an die „unnützen Esser“ und „Ballastexistenzen“ bei Binding und Hoche, die davon sprachen, dass deren „objektiver Lebenswert für die Gesellschaft [...] unter Null sinken könne“. Auch heute lassen sich a ­ naloge Folgerungen vernehmen. So wird in einem 1990 erschienenen Buch eines deutschen Rechtswissenschaftlers (Th. Ramm) lakonisch gefordert: „Künftige soziale Belastungen der Allgemeinheit sind gering zu halten. Daher ist sowohl der Erzeugung oder Geburt [von Kindern mit Behinderung] entgegenzuwirken als auch eine übermäßige Belastung durch die Bildungspolitik zu vermeiden. Maßstab für dieselbe ist, dass jede Ausbildung dem Bedarf entsprechen muss und andererseits der vorhandenen Begabung gerecht werden muss“ [...]. Auch E. Quambusch, ein anderer deutscher Rechtswissenschaftler, macht in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung die finanziellen Grenzen jeder Gesellschaft geltend, die erreicht würden, wenn von ihr „materielle Solidarität zugunsten derjenigen abverlangt wird, die an der Erstellung des Sozialproduktes nicht nennenswert mitwirken“ [...]. 25 30 35 40 45 50 55 60 72 Kapitel 14 65 70 75 80 85 Schon Binding und Hoche hatten nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg auf dieses Argument gesetzt: „Die Frage, ob der für diese Kategorien von Ballastexistenzen notwendige Aufwand nach allen Richtungen hin gerechtfertigt sei, war in den verflossenen Zeiten des Wohlstandes nicht dringend; jetzt ist es ­anders geworden, und wir müssen uns ernstlich mit ihr befassen“ [...]. Haben wir es heute nicht auch mit einem verfließenden Wohlstand zu tun? Es wird ganz offensichtlich das Lebensrecht von der wirtschaftlichen Prosperität abhängig gemacht. Gegenwärtig kommen ökonomische Werte vor allem bei der Anwendung der Gentechnologie stärker ins Spiel. Allein in den USA gab es [...] schon vor Jahren etwa eintausenddreihundert Biotechnologiefirmen mit jährlichen Einkünften von insgesamt dreizehn Milliarden Dollar und über einhunderttausend Beschäftigten. Da das genwissenschaftliche Wissen sich alle zwei Jahre verdoppele, sei mit enorm steigenden Wachstumsraten der Pharma- und Bioindustrie zu rechnen. Uni­ versitätswissenschaft und Gentechnikfirmen seien weithin miteinander verflochten; die meisten Spitzenforscher seien nicht unbeträchtlich an der Gewinnausschüttung der Firmen beteiligt. Ein weltweiter Wettlauf um die kommerzielle Verwertung des menschlichen Genoms habe ­begonnen. Was hier zugleich vor sich geht, ist ein Wandel des Lebenswertes als eines universellen und unbedingten Wertes zu einem Marktwert. Menschliches Leben wird „kommerzielles Gut“, das auf dem Markt gehandelt wird. Dient dieser wirklich und nur der Verbesserung der Lebensqualität im Sinne von mehr „Wohlstand“ – für alle? Baudrillard mahnt, man könne das Gute nicht befreien, ohne gleich auch das Böse freizusetzen. Die liberale Gesellschaft will unter dem Gesichtspunkt der Sicherung ihrer eigenen Lebensqualität selber bestimmen, wem darin Lebensrecht zukommt. Das Ja zum Leben wird von Bedingungen abhängig gemacht; die unbedingte Zugehörigkeit wird ausgehöhlt. 90 95 100 105 Quelle: Speck, 20086, S. 154 f. Gnadentod für Babys 5 10 Ein britischer Medizinerverband hat sich für Euthanasie an schwerstbehinderten Neugeborenen ausgesprochen. In bestimmten Fällen, so lautet ein Vorschlag des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists an die Ärzteschaft, sollten Mediziner Babys aktiv töten dürfen. Damit sollen den betreffenden Familien unter anderem die emotionalen und finanziellen Konsequenzen erspart werden, die das Aufziehen eines sehr schwer behinderten Kindes zwangsläufig nach sich zöge. Die Mediziner schweigen sich darüber aus, welche konkreten Behinderungen ihrer Meinung nach die Tötung rechtfertigten. Der Vorstoß hat Empörung ausgelöst bei vielen Patientenvereinigungen, aber auch Zuspruch gefunden. Aus den Niederlanden – wo Euthanasie unter bestimmten Umständen legal ist – meldete sich der Mediziner Pieter Sauer zu Wort. Nach seinen Angaben ist der Gnadentod auf der Neugeborenenstation auch in Großbritannien längst nicht mehr so selten. Es sei an der Zeit, dass darüber in der Gesellschaft offen gesprochen werde. Quelle: DER SPIEGEL, Nr. 46/2006, S. 167 15 20 73 Kapitel 14 2. Der Umgang zwischen Menschen mit und ohne Behinderung Tröster nennt eine Reihe von verhaltensrelevanten Aspekten, die mit der Art der Behinderung verknüpft sind: 5 10 15 20 25 30 1. D ie Auffälligkeit der Behinderung: Hier handelt es sich um eine bedeutsame Variable1, die mehr meint als die bloße Sichtbarkeit. Die Stufen können unterschieden werden: –– Die Behinderung ist bereits vor der ­Kontaktaufnahme sichtbar, dann erfolgt oft prophylaktische Interaktionsvermeidung2; –– die Behinderung drängt sich erst beim Kontakt überraschend auf, zum Beispiel bei Hör- und Sprachbehinderungen; –– die Behinderung kann zunächst verborgen und bei längerem und intensivem Kontakt kontrolliert offenbart werden. 2. D ie ästhetische Beeinträchtigung: Sie ist meist wichtiger als die funktionale Beeinträchtigung, da sie ein möglicher Auslöser für heftige affektive Reaktionen sein kann. Ästhetische Attraktivität erleichtert generell soziale Kontakte. 3. D ie funktionale Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten: Solche Menschen mit Behinderung belasten Kontakt und Interaktion immer, unabhängig von der Einstellung des Menschen ohne Behinderung. 4. D ie zugeschriebene Verantwortlichkeit: Bei angenommener Schuld des Behinderten für seinen Zustand wird die Interaktion erheblich erschwert, weil eine Ablehnung bis 1 2 hin zu Bestrafungen leichter zu rechtfertigen ist. Diese Variable ist unabhängig von der Auffälligkeit. 35 Interaktionen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung können aus verschiedenen Gründen besonders belastet sein. Aus der Sicht der Menschen mit Behinderung sind es typische Reaktionsformen wie 40 −− −− −− −− Anstarren und Ansprechen, diskriminierende Äußerungen, Witze, Spott und Hänseleien (Ärgern), Aggressivität bzw. Vernichtungstenden zen. Hier handelt es sich um ursprüngliche [...] Reaktionen bzw. um Formen von Triebabfuhr, die Distanz schaffen sollen. Aber auch solche Reaktionsformen, die auf den ersten Blick „positiv“ erscheinen, dienen letzten Endes fast immer der Abgrenzung, so etwa Variable (lat., variare: verändern, verschieden sein): veränderliche Größe prophylaktikós (griech.): vorbeugend; der Begriff „soziale Interaktion“ ist in Kapitel 4.1.2 geklärt. 45 50 74 Kapitel 14 55 60 65 70 −− −− −− −− Äußerungen von Mitleid, aufgedrängte Hilfe, unpersönliche Hilfe (Spenden), Schein-Akzeptierung. Festzuhalten bleibt, dass echtes Engagement für Menschen mit Behinderung ohne ­implizite1 Abwertung, Entlohnung oder Dankbarkeitserwartung vergleichsweise selten vorkommt. Auch freundliches Verhalten mit Sympathiebekundungen wird sehr oft als „Schein-Akzeptanz“ interpretiert und erhöht dann noch die Ambivalenz. [...] Eine wichtige Rolle im kulturhistorisch ­geprägten Verhältnis zu Menschen mit Behinderung hat immer die Frage nach der Zurechnung von Schuld für den unerwünschten ­Zustand gespielt. Das liegt an der Neigung von Menschen, für alles im Leben eine Erklärung, einen Grund zu finden. Zurechnung von Schuld seitens der Menschen ohne ­ ehinderung lässt sich mit der Entlastung B von eigenen Schuldgefühlen und Ängsten erklären. Die Projektion der eigenen Schuld auf den Menschen mit Handicap unter Rückgriff auf soziale Vorurteile hat Selbstschutzfunktion. Darüber hinaus dient dieser Mechanismus der Legitimation künftiger Aufgaben negativer Tendenzen: Wer selbst Schuld hat, braucht schließlich keine besondere Rücksichtnahme zu erwarten. Die Beziehung zwischen Schuldgefühlen und negativen ­ ­Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung ist eine wechselseitige. Die Stabilisierung über Ablehnung ist allerdings nur vorübergehend; sie erzeugt gleichzeitig neue Schuldgefühle und Schuldangst und führt so zu einem verhängnisvollen Kreislauf. 75 80 85 Quelle: Cloerkes, 2001, S. 196 f. 3. Menschen mit einer Behinderung in Deutschland 5 10 15 20 Zum Jahresende 2013 lebten rund 7,5 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das rund 260.000 oder 3,6 % mehr als am Jahresende 2011. 2013 waren somit 9,4 % der gesamten Bevölkerung in Deutschland schwerbehindert. Etwas mehr als die Hälfte (51 %) der Schwerbehinderten waren Männer. Als schwerbehindert gelten Personen, denen von den Versorgungsämtern ein Grad der Behinderung von 50 und mehr zuerkannt sowie ein gültiger Ausweis ausgehändigt wurde. Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf: So war nahezu ein Drittel (31 %) der schwerbehinderten Menschen 75 Jahre und älter; knapp die Hälfte (45 %) ­gehörte der Altersgruppe zwischen 55 und 75 Jahren an. 2 % waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mit 85 % wurde der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit verursacht. 1 4 % der Behinderungen waren angeboren beziehungsweise traten im ersten Lebensjahr auf. 2 % waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen. Zwei von drei schwerbehinderten Menschen hatten körperliche Behinderungen (62 %). Bei 25 % waren die inneren Organe beziehungsweise Organsysteme betroffen. Bei 14 % waren Arme und Beine in ihrer Funktion eingeschränkt, bei weiteren 12 % Wirbelsäule und Rumpf. In 5 % der Fälle lag Blindheit beziehungsweise eine Sehbehinderung vor. ­ 4 % litten unter Schwerhörigkeit, Gleichgewichts- oder Sprachstörungen. Der Verlust einer oder beider Brüste war bei 2 % Grund für die Schwerbehinderung. Auf geistige oder seelische Behinderungen entfielen zusammen 11 % der Fälle, auf zerebrale Störungen 9 %. Bei den übrigen Personen (18 %) war die Art der schwersten Behinderung nicht ausgewiesen. implicitum (lat.): mit enthaltend, mit inbegriffen, nicht ausdrücklich gesagt 25 30 35 40 75 Kapitel 14 11,0 Körperbehinderung Sehbehinderung und Blindheit 4,0 5,0 Sprachbehinderung, Schwerhörigkeit und Taubheit 62,0 Lernbehinderung und geistige Behinderung Quelle: Pressemitteilung vom 29. Juli 2014 – 266/2014, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016; In www.destatis.de / Pressemitteilungen; eigene Darstellung 4. „Mama, ich bin dumm“ 5 10 15 20 25 Vor einem Jahr beschloss Tina Brune, dass es so nicht weitergehe. Die Mutter aus Plettenberg in Nordrhein-Westfalen saß bei der Klassenlehrerin ihres jüngsten Sohnes, um das Deutschdiktat zu besprechen. „Die kleine Hexe“ sollte die Überschrift lauten. Max, ein lernbehinderter Junge mit Seh- und Hörstörungen, hatte nur drei Buchstaben zu Papier gebracht: K, L, H. Die Lehrerin erkannte darin Wortfragmente, die Mutter aber einen Beleg für die hoffnungslose Überforderung ihres Sohnes. Sie meldete ihn von der Schule ab. „Aus meinem fröhlichen war ein trauriges Kind geworden“, sagt die Krankenschwester. Max habe häufig geweint, beim Aufstehen, auf dem Weg in die Schule, beim Abholen, bei den Hausaufgaben. Seine tägliche Klage: „Mama, ich bin dumm.“ Seit der achtjährige Max die Vier-Täler-­ Schule in Plettenberg besucht, eine Förderschule für Lernbehinderte, gehe es ihm besser, sagt seine Mutter. Diese Erfahrung hat sie zu einer Kämpferin gemacht. „Frau Löhrmann, erhalten Sie die Förderschulen in NRW“, so lautet ihr Onlineaufruf, den sie an Nordrhein-Westfalens Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) richtet. 8000 Unterstützer haben bereits unterschrieben, im Herbst will Brune die Petition dem Landtag übergeben. Ihre Initiative rückt eine Schulform in den Blick, die derzeit einen schweren Stand hat. Angesagt ist Inklusion: Behinderte Schüler sollen als Folge einer Uno-Konvention vermehrt an Regelschulen unterrichtet werden. Förderschulen gelten als Einrichtungen von gestern. Den Ton geben Betroffene wie die Mutter des elfjährigen Henri aus BadenWürttemberg vor, die ihren Sohn aufs Gymnasium schicken will, obwohl der Junge mit Down-syndrom dort dem Unterricht nicht folgen könnte. Als Henris Mutter vor awai wochen show von Günther Jauch zu Gast war, flankierten sie dort drei Inklusionsbefürworter und nur ein Skeptiker. Die Redaktion hatte auch bei Tina Brune angefragt, dann aber abgesagt. Andere Gäste würden bereits die Position abdecken, lautete Brune zufolge die Begründung. Vielerorts löst die Inklusion indes Sorgen und Spannungen aus. In Nordrhein-Westfalen etwa tritt zum August ein verändertes Schulgesetz in Kraft, das behinderten Kindern einen Rechtsanspruch auf einen Platz an einer Regelschule garantiert. Für Lern-Förderschulen wie in Plettenberg gilt künftig eine Mindestgröße von 144 Schülern, derzeit hat die Schule 92. 30 35 40 45 50 55 76 Kapitel 14 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ... ... an Förderschulen 355 000 300 000 200 000 100 000 ... an Regelschulen Quelle: Kultusministerkonferenz 60 65 70 Kritiker dieser starren Größenvorgabe wie Udo Beckmann, der Vorsitzende des Verbands Erziehung und Bildung (VBE), sprechen von einer „kalten Schließung“ der Förderschulen. „Die Politik kann nicht einerseits den Elternwillen hochhalten und andererseits den Eltern die Optionen nehmen“, so Beckmann. Eine VBE-Umfrage wies sinkende Zustimmungsraten zur Inklusion in NordrheinWestfalen aus. Und der Verband Sonderpädagogik berichtet von einer wachsenden Zahlernüchterter Inklusionseltern, die ihre Kinder von den Regelschulen nehmen. „Unser Sohn wurde behandelt wie alle anderen Kinder“, sagt Sonja Maibach aus Koblenz, Sozialarbeiterin und Mutter des zwölfjährigen Christian. „Aber er kann nicht alles leisten. „Christian hat eine Lernbehinderung und eine Entwicklungsverzögerung. In der Grundschule hielt er noch mit, doch als er in die Intergrationsklasse einer Realschule wechselte, begannen die Probleme: Der Schulalltag war ihm zu hektisch, der Pausenhof zu laut, die Lehrer zu ungeduldig. Wir sind von der Inklusion enttäuscht“, sagt seine Mutter. Seit Januar besuche Christian eine Förderschule; er habe dort nur noch neun Mitschüler. Marianne Schardt, Sprecherin des Verbands Sonderpädagogik, fordert die Politik auf, die Lehrer besser zu schulen – entsprechend der Ausbildung der Sonderpädagogen. Es gehe eher um die Stärkung des Kindes als nur darum, Wissen zu vermitteln. Doch die Lehrer, die nun mit behinderten Kindern zu tun haben, werden darauf oft nur in Crashkursen vorbereitet. Die Inklusion sei die „größte Herausforderung für unsere Schulen“, sagt Mecklenburg -Vorpommerns BiIdungsminister Mathias Brodkorb (SPD). Seine Kollegin Löhrmann, derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz, appellierte unlängst an den Bund, „seiner Verantwortung bei der Umsetzung der schulischen Inklusion“ nachzukommen, also mehr Geld zu spendieren. Auch wir haben den Anspruch, unsere Schüler in die Gesellschaft zu integrieren“, sagt Peter-Paul Marienfeld, Leiter der Vier-TälerSchule, Marienfeld verweist auf Werkräume und Kurse zur Berufsvorbereitung. Er will der Abwicklung seiner Schule dadurch entgehen, dass sie mit der Förderschule im 25 Kilometer entfernten Lüdenscheid fusioniert, als Filiale muss die Schule nur 72 Schüler haben. Doch angesichts des politischen Willens und sinkender Schülerzahlen sei er sich nicht sicher, wie lange das Aufschub gewähre, sagt ­Marienfeld. Hoffnung habe er auf lange Sicht. Alle Schüler ins Regelschulsystem zu integrieren sei illusorisch, sagt der Schulleiter. „In ein paar Jahren wird uns die Politik wohl wieder einführen, unter neuem Namen.“ Quelle: Friedmann/Greiner, 2014, S. 47 75 80 85 90 95 100 105 110 115 77 Kapitel 15 Materialien Kapitel 15 1. Da hilft nur der Keuschheitsgürtel Zwei Jahrhunderte lang beschwor die Medizin das Grauen der Selbstbefriedigung (Masturbation, oft auch – fälschlicherweise – Onanie genannt). 5 10 15 20 25 30 35 1710 erschien in England das anonym ­verfasste Pamphlet Onanie oder die abscheuliche Sünde der Selbstbefleckung und alle ihre schrecklichen Folgen für beide Geschlechter, betrachtet mit Ratschlägen für Körper und Geist. Es stammt vermutlich von einem ehemaligen Pfarrer namens Bekker, der sich zu dieser Zeit mit Quacksalberei und Wunderheilungen sein Geld verdiente. Vor allem wegen der enormen Verbreitung und Popularisierung dieser in verschiedenen Sprachen übersetzten Schrift wurde die Masturbation alsbald überall in Europa heiß diskutiert und angeprangert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sich die Mediziner mit den unterstellten gesundheitsschädigenden Folgen der Selbstbefriedigung auseinandersetzen mussten. 1758 war es so weit. Unter dem Titel Onanismus – oder eine Abhandlung über Krankheiten, die durch Masturbation entstehen veröffentlichte ein angesehener Schweizer Arzt namens Samuel Auguste Tissot ein Buch mit spektakulärem Erfolg. Nach Tissots Auffassung war die Onanie nicht nur eine Sünde oder ein Verbrechen. Viel gefährlicher sei, dass sie schreckliche Krankheiten wie Schwindsucht, Minderung der Sehkraft, Störungen der Verdauung, Impotenz und Wahnsinn verursachen könne. Binnen weniger Jahre wurde Tissot als Auto­ rität auf diesem Gebiet anerkannt und als Wohltäter der Menschheit gelobt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen Ärzte der gesamten westlichen Welt, die Wurzeln fast aller körperlichen und seelischen Erkrankungen in der Masturbation zu sehen. 1867 fügte Henry Maudsley, der größte britische Psychiater und Gerichtsmediziner seiner Zeit, noch hinzu, dass der „Masturbationswahnsinn“ durch eine besondere „Perversion der Gefühle“ charakterisierbar sei, die in frühen Stadien zu einer entsprechenden Verwirrung des Geistes führe. Später, wenn der Selbstbefriedigung kein Einhalt geboten würde, seien ein Versagen der Intelligenz, nächtliche Halluzinationen, mörderische und selbstmörderische Neigungen beobachtbar. Fürderhin galt die Masturbation im fortgeschrittenen Stadium als unheilbar. Die einzige Kunst der Medizin bestand in dem Versuch, das Leid zu verhüten oder früh zu entdecken. Eltern wurden angewiesen, ihren Kindern die Hände am Bett festzubinden oder ihnen Fausthandschuhe überzuziehen. Bandagen und „Keuschheitsgürtel“ sollten das Berühren der Geschlechtsorgane verhindern. Und wenn alles nichts half, wurden chirurgische Eingriffe empfohlen, wie zum Beispiel das Einsetzen eines Metallrings zur Verhinderung der Erektion (Infibulation) oder das Herausschneiden der Klitoris. Gelegentlich wurde versucht, die Geschlechtsorgane mittels Durchtrennung oder Verätzung von Nerven g ­ efühllos zu machen. Erst beginnend mit der Wende zum 20. Jahrhundert lässt sich beobachten, dass sich die starre Haltung gegenüber der Masturbation lockerte. Es sollte jedoch noch bis zur Mitte des Jahrhunderts dauern, bis sich allgemein durchsetzte, dass Masturbation keinerlei körperlichen oder geistigen Schaden verursacht. 40 45 50 55 60 65 70 Quelle: Fiedler, 2007, S. 57 2. Erziehung und sexueller Missbrauch Sexueller Missbrauch ist in den überwiegenden Fällen eine geplante und keine spontane Tat. Die meisten Täter oder Täterinnen suchen deshalb auch gezielt Opfer, die ihren Vorstellungen entsprechen. Dies sind nicht – entgegen vielen landläufigen Annahmen – ­äußere 5 78 Kapitel 15 10 15 20 25 30 35 40 Merkmale. Für einen Großteil der Täter ist es wichtig, dass sie mit möglichst wenig Entdeckungsrisiko vorgehen können und der Aufwand nicht allzu groß wird, dass der kindliche Widerstand gering ist, die Eltern keine Gefahr darstellen und das Kind nicht redet Welche Kinder entsprechen nun am ehesten diesem „Täterideal“? Bestimmte familiäre Konstellationen, pädagogische Botschaften, erzieherische Ideale und Praktiken können dazu beitragen, dass das Risiko von Mädchen und Jungen, Opfer von sexueller Gewalt zu werden, erhöht wird […] In Familien, in denen ein Kind sexuell missbraucht wird, findet sich häufiger eine traditionelle Geschlechtsrollenaufteilung. Das heißt, in der Regel ist es der Vater oder ein anderer männlicher Familienangehöriger, der sich als überlegen darstellt und dem häufig von anderen Familienmitgliedern größere Rechte zuerkannt werden […] Auch ein sehr autoritärer Erziehungsstil kann fatale Folgen haben. Wenn kindliche Bedürfnisse, Rechte oder Ansprüche ignoriert werden, die von Erwachsenen dagegen höchste Geltung haben, lernen Mädchen und Jungen, dass sie Erwachsenen grundsätzlich Gehorsam schulden. Sie leben häufig in Furcht und Unterdrückung […] Neben diesem familiären Hintergrund spielt auch das Familienklima eine Rolle. Aus der Täterforschung ist bekannt, dass Täter sich häufig gezielt Mädchen und Jungen suchen, die ihr Familienleben als unglücklich empfinden und zu wenig Liebe, Aufmerksamkeit und Interesse bekommen […] Täter suchen Kinder, die keine Freunde haben und bieten ihnen Kontakt, Interesse und ­ eziehung – zuerst einmal. Manche Kinder B sind so unendlich bedürftig, dass sie die sexuelle Gewalt ertragen, um die „Freundschaft“ nicht zu verlieren […] Selbstbewusstsein Eigensinn, Durchsetzungsvermögen sind Schlüsselqualifikationen für Mädchen und Jungen. Fehlen diese, so können Kinder weniger gut ihre Interessen vertreten, sich gegen Erwachsene durchsetzen oder von diesen Unterstützung einfordern […] Alltagsmythen, die Kindern vermittelt werden, verstärken das Unterlegenheitsgefühl. Aussagen wie „Kinder müssen Erwachsenen gehorchen“, „Kinder verstehen das nicht“, „Ich weiß schon, was für dich gut ist …“ dienen der Disziplinierung und Unterordnung der Kinder – und schwächen sie in ihrer Persönlichkeitsbildung […] In manchen Familien herrscht ein eher sexualfeindliches Klima. Das heißt, es wird beispielsweise nicht über Sexualität gesprochen, altersgemäße kindliche Sexualäußerungen werden tabuisiert oder gar bestraft, Körperlichkeit ist mit Scham und Schuldgefühlen verknüpft. Kinder, die so aufwachsen, haben zu wenig oder gar keine Informationen über sexuelle Vorgänge, Verhaltensweisen oder Körperfunktionen. Sie sind neugierig, dürfen aber nicht fragen. Natürlich fällt es ihnen sehr viel schwerer, einen sexuellen Übergriff einzuordnen. Vor allen können sie sich niemandem anvertrauen, weil sie gelernt haben, nicht über sexuelle Dinge zu sprechen […] Viele Erwachsene machen sich nicht bewusst, dass sie die körperliche Selbstbestimmung von Kindern nicht respektieren. Sie berühren wildfremde Kinder auf der Straße, im Bus, im Supermarkt, kneifen in Wangen oder streichen über Haare. In Familien werden Mädchen und Jungen gegen ihren Willen auf den Schoß genommen, geküsst und umarmt, in der Luft geschwenkt und liebkost. All dies mag wohlmeinend sein, aber es ist vor allem auch respektlos. Kinder lernen: „An meinen Körper darf jeder dran, ob ich will oder nicht spielt keine Rolle, wenn ich mich wehre, bin ich unartig und kriege Ärger“ […] Quelle: Braun, 2002, S. 69 ff. (stark gekürzt) 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 79 Kapitel 15 3. Was kann ich tun, wenn ich sexuellen Missbrauch vermute? 1.Ruhe bewahren, überhastetes Eingreifen schadet nur! 5 2. Kollegin oder andere Vertrauensperson suchen, mit der man über die eigenen Unsicherheiten und Gefühle sprechen kann. 3.Den Kontakt zum Mädchen/Jungen vorsichtig intensivieren, um eine positive Beziehung herzustellen. 10 15 20 25 30 4.Das Kind immer wieder ermutigen, über Probleme und Gefühle zu sprechen. In der Gruppe das Thema „Gute und 5. schlechte Geheimnisse“ erarbeiten. Gute Geheimnisse machen Spaß; alle Geheimnisse, die schlechte, komische oder schreckliche Gefühle machen, sind schlechte Geheimnisse. Über sie darf (muss) man sprechen! 6. In der Gruppe das Thema „Angenehme und unangenehme Berührungen“ ansprechen. 7.In der Gruppe (im Spiel, innerhalb der Sexualaufklärung, im Sportunterricht) das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und das Thema „Sexueller Missbrauch“ vorsichtig ansprechen und damit signalisieren: „Ich weiß, dass es sexuellen Missbrauch gibt … Mit mir kannst du darüber reden … Ich glaube betroffenen Mädchen und Jungen.“ 8. Wenn möglich, eine Mitarbeiterin einer Selbsthilfeinitiative oder einer Beratungsstelle hinzuziehen, um mehr Sicherheit zu gewinnen. 9.Hinweise auf den sexuellen Missbrauch aufschreiben (Tagebuch über Verhaltensweisen des Mädchens/Jungen führen). 10. Wenn möglich, Kontakt zur Mutter/Bezugsperson intensivieren, um Belastbarkeit der Mutter/Bezugsperson besser einschätzen zu können (z. B. Zusammenarbeit bei der Vorbereitung von Kindergartenfesten, Gespräche am Elternsprechtag). 11.Kontakt zum Jugendamt aufnehmen (ggf. ohne Namensnennung). 35 40 45 12. HelferInnenkonferenz anstreben, damit alle, die die Familie kennen, gemeinsam eine Strategie absprechen. 13.Niemals eine Familie mit dem Missbrauch konfrontieren, ehe eine räumliche Trennung von Opfer und Täter vorbereitet und möglich ist. 14.Eine eventuelle Anzeige mit einer Anwältin zuvor durchsprechen und gut vorbereiten. Niemand ist zur Anzeige v ­ erpflichtet! Quelle: Enders, 1990, S. 69 f. 50 55 80 Kapitel 15 4. „Altes“ und „neues“ Aids 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Das heutige Erscheinungsbild der Krankheit AIDS, hat sich durch die medi­zinischen Möglichkeiten der Behandlung stark verändert bat. Hierdurch ha­ben sich parallel die Bedürfnisse und der Alltag der Betroffenen gewandelt. Das ,neue‘ AIDS ist aber vor allem eine Realität westlicher Industrieländer. In weiten Teilen der Welt erhält nur ein Bruchteil der Betroffenen eine ange­ messene medizinische Versorgung – dort haben HIV und AIDS ein völlig anderes Erscheinungsbild als bei uns. AIDS ist eine schwere, durch eine Infektion mit dem HI-Virus hervorgeru­ fene Schwächung des Immunsystems. Eine solche Infektion verläuft gene­rell zunächst unspezifisch, das heißt viele Symptome können, müssen aber nicht auftreten. Sind Symptome vorhanden, so kann von diesen nicht auto­matisch auf HIV geschlossen werden. Eine Infektion lässt sich nach circa zwölf Wochen mit einem HIV-Antikörper-Test nachweisen. Nach einer Infektion mit HIV können innerhalb weniger Wochen unspezifi­sche, Grippe-ähnliche Symptome wie z. B. Fieber, Kopf- und Glieder­ schmerzen, Hautausschläge und geschwollene Lymphknoten auftreten. Häufig werden diese Symptome als solche nicht erkannt, bei vielen treten sie auch gar nicht auf. Der weitere Krankheitsverlauf kann über Jahre be-schwerdefrei sein. Jedoch schädigt das Virus in dieser Zeit weiter das Im­munsystem. Unbehandelt wird der Körper immer anfälliger für jede Art von Krankheit; sonst harmlose Infektionen können schwere Erkrankungen hervorrufen. Es kommt gehäuft zum Auftreten von Lungenentzündungen (PcP), Infektionen mit Pilzen und weiteren Viren sowie durch Viren verur­sachten Krebsarten wie dem Kaposi-Sarkom oder dem Gebärmutterhals-krebs – in diesem Stadium spricht man von AIDS. Das ‚neue‘ AIDS meint nun den durch Therapie stark veränderten Verlauf der Krankheit. Durch die derzeit zur Verfügung stehenden Medikamente kann eine HIV-Infektion nicht geheilt werden. Das Virus verbleibt weiterhin im Körper und es besteht dadurch eine blei- bende Ansteckungsgefahr für andere. Jedoch kann der Zustand des Immunsystems weitestgehend stabilisiert bzw. wieder verbessert werden. Die Viruslast kann zwischenzeitlich sogar unter die Nachweisgrenze des entsprechenden Testverfahrens sinken. Mit den Medikamenten kann ein HIV-positiver Mensch meist viele Jahre lang wei testgehend beschwerdefrei leben. Jedoch haben die Medikamente besonders nach längerer Einnahmezeit zum Teil starke Nebenwirkungen. Hierzu zählt unter anderem das Lipodystrophie-Syndrom, welches eine Stoffwechsel- und Fettumverteilungsstörung beschreibt, bei der sowohl die inneren Organe lei­den als auch eine optische Veränderung des Körpers stattfindet. Trotz der Nebenwirkungen sind die derzeit verfügbaren Medikamente eine Erleichte­ rung und Lebenisverlängerung für jene, die sie erhalten. Sie ermöglichen ein relativ normales Leben mit der Krankheit, wenngleich die Ungewissheit über den weiteren Krankheitsverlauf immer auch ein Teil dieser Lebensrealität ist. HIV überträgt sich über Blut, Samen- und Scheidenflüssigkeit sowie Mut­termilch. Wenn eine dieser Flüssigkeiten in den Körper oder auf Schleimhäute gelangt, kann es zu einer Ansteckung kommen. Der mit Abstand häu­ figste Infektionsweg ist ungeschützter Sex. Der zweithäufigste ist in Deutschland die gemeinsame Nutzung von Spritzbestecken bei Drogennut­zem. Das Risiko einer Mutter-KindÜbertragung kann hierzulande durch medizinische Behandlung, Kaiserschnitt und Verzicht auf die Gabe von Muttermilch auf unter zwei Prozent gesenkt werden. In vielen anderen Ländern ist dies jedoch aufgrund mangelnder medizinischer und finanziel­ ler Möglichkeiten ein häufiger Übertragungsweg. In Deutschland lebten Ende 201 1 rund 73.000 Menschen mit HIV/AIDS, jährlich kommt es schätzungsweise zu 2.700 Neuinfektionen‘. Quelle: Corsten, 2013, S. 510 ff. (stark gekürzt, in der Reihenfolge verändert) 50 55 60 65 70 75 80 85 81 Kapitel 16 Materialien Kapitel 16 1. Reformpädagogische Schulkonzepte Die Arbeitsschule 5 10 Die Arbeitsschule zur Bildung breiter Bevölkerungsschichten geht auf Georg ­Kerschensteiner1 zurück und will dem Schüler die Lerninhalte durch manuelle Selbsttätigkeit vermitteln. Heute spielt sie keine Rolle mehr, Elemente der Arbeitsschule finden sich aber im handlungsorientierten Unterricht wieder. Entsprechend wird unter Arbeitsunterricht ein Unterricht verstanden, der sich durch eigenständiges Umgehen der Schüler mit gegebenen oder selbst ausgewählten Materialien und selbstständiges Finden von Ergebnissen auszeichnet. Die Einheitsschule 15 20 Die Einheitsschule entstand aus den Forderungen der Bildungseinrichtung für alle Menschen und der Erziehung ohne Trennung der Geschlechter (Koedukation) und der Konfessionen. Heute ist sie eine Form der Gesamtschule, in der das System der beweglichen Leistungsgruppen mindestens bis zur 9. Jahrgangsstufe etabliert ist.2 Der Jenaplan 25 30 Der Jenaplan stammt von Peter Petersen3 und enthält eine Form schulischen Lernens, welche die Nachteile der herkömmlichen Schule überwinden will: Auflösung der Jahresklassen ­zugun­sten von Gruppen, die drei Jahrgangsstufen umfassen, sowie Absteckung der Lerninhalte durch einen Wochenarbeitsplan (kein 1 2 3 4 nach Fächern geordneter Stundenplan). Gruppenbezogenes Lernen, Gespräch, Arbeit, Spiel und Feiern nehmen einen hohen Stellenwert im Unterricht ein. Zudem werden über die Lernvorgänge im Schuljahr Berichte statt Zeugnisse angefertigt. Schulen, die den Jenaplan verwirklichen, werden Jenaplan-­Schulen ­genannt. 35 Die Daltonplan-Schulen Daltonplan-Schulen gehen auf den Daltonplan – genauer: Dalton Laboratory Plan – von Helen Parkhurst4 zurück, der ein möglichst hohes Maß an In­di­vi­du­a­li­sie­rung und Diffe­ren­zie­rung im Unterricht fordert. Die Jahrgangsklassen werden durch Fach- und Arbeitsgruppen ersetzt, um sich an den Neigungen, Interessen und Fähigkeiten des Schülers zu orientieren. Der Schüler kann unter verschiedenen Angeboten und Unterrichtsmaterialien unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades auswählen sowie Zeitvorgaben, Form der Zusammenarbeit und der Leistungskontrolle selbst bestimmen (freedom). Zu­ dem wird die Zusammenarbeit der Schüler sehr betont (cooperation). Und letztlich spielt das Erlernen der selbstständigen Planung und Organisation des Lernens eine große Rolle (budgeting time). Die erste DaltonplanSchule im deutschsprachigen Raum war die Steyrer Handelsschule, in der unter der Leitung von Helga Wittwers und Georg Neuhausers der Daltonplan umgesetzt wurde. eorg Kerschensteiner (1854–1932), Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in G München, war von 1895 bis 1919 Stadtschulrat in München. vgl. Kapitel 12.3.3 Peter Petersen (1884–1952) war Professor an der Universität Jena. Helen Parkhurst (1887–1973) machte als Lehrkraft an einer Landschule in Waterville (USA) die ersten „Experimente“ für die späteren Daltonplan-Schulen („Waterville-Experiment“). Später wurde sie Direktorin der grundschuldidaktischen Abteilung am „Central Teachers College“ in Wisconsin (USA). 1920 erfolgt die Umsetzung ihrer Ideen – ihres Planes – an der Public High School Dalton (deshalb Daltonplan). 40 45 50 55 60 82 Kapitel 16 2. Das didaktische Material 5 10 15 20 25 Das kleine Kind hat das intensive Bedürfnis nach tätigen Sinneseindrücken. Wir bieten dem Kind Gegenstände dar, die ihm die Möglichkeit geben, viel klarer und viel leichter zu einer Befriedigung dieses Bedürfnisses zu kommen. Wir wissen, dass das Kind mit allen seinen Sinnesorganen die Umgebung erforscht und die Bilder mit Auswahl in sich aufnimmt und ordnet. Da wir aber auch wissen, dass die zu komplizierte Umgebung, die viele und ungeordnete Reize bringt, dem Kind die geistige Arbeit erschwert, kommen wir ihm zu Hilfe, indem wir ihm Bilder darbieten, die geordnet sind und ihm bei der Ordnung helfen. Wir lehren das Kind, indem wir ihm einen Führer geben, der mit seinen instinktiven Bedürfnissen übereinstimmt und der ihm ein Gefühl der Freude gibt, weil er ihm zu befriedigender Arbeit verhilft. Wir bieten dem Kind mit dem Material geordnete Reize an und lehren also nicht direkt, wie man es sonst mit kleinen Kindern zu tun pflegt, sondern vielmehr durch eine Ordnung, die im Material liegt und die das Kind sich selbstständig erarbeiten kann. Wir müssen alles in der Umgebung, also auch alle Gegenstände, so weit für das Kind vor- bereiten, dass es jede Tätigkeit selbst ausführen kann. Wir werden oft damit angegriffen, dass Pädagogen und Psychologen behaupten, unser Material sei darum nutzlos für ein Kind, weil es naturentgegengesetzt sei. Dem Kind müsse alles so natürlich angeboten werden, wie es sich in der Umwelt finde, und wenn man eine Farbe gäbe, so dürfe man die Aufmerksamkeit nicht auf die Farbe selber lenken, weil es ja immer ein Gegenstand sei, dem diese Farbe eigen sei. Farbe und Gegenstand gehörten zusammen, und das Kind müsse die Farbe als eine der vielen Eigenschaften dieses einen Gegenstandes betrachten. Unser Material soll kein Ersatz für die Welt sein, soll nicht allein die Kenntnis der Welt vermitteln, sondern soll Helfer und Führer sein für die innere Arbeit des Kindes. Wir isolieren das Kind nicht von der Welt, sondern wir geben ihm ein Rüstzeug, die ganze Welt und ihre Kultur zu erobern. Es ist wie ein Schlüssel zur Welt und ist nicht mit der Welt selbst zu verwechseln. 30 35 40 45 50 Quelle: Montessori, 20154, S. 23 3. Kritische Würdigung der Montessori-Pädagogik 5 10 15 Montessori-Einrichtungen haben in den vergangenen Jahrzehnten ein verstärktes Interesse erfahren. Dies liegt unter anderem daran, dass dieser Ansatz sowohl in seinen theoretischen Grundlagen als auch im praktischen erzieherischen Handeln eine akzeptable Alternative zur herkömmlichen Pädagogik darstellt. Montessori betonte von Anfang an eine „Pädagogik vom Kinde aus“, in der die zu Erziehenden im Mittelpunkt aller Überlegungen und allen pädagogischen Arbeitens ­stehen. Dabei scheint die Montessori-Pädagogik ein ideales Erziehungskonzept in unserer rationalen, den mündigen Bürger fordernden Lebensund Arbeitswelt zu sein, da sie einen deutlichen Schwerpunkt auf die Förderung kindlicher Selbstständigkeit legt. Sie schafft konsequent eine vorbereitete Umgebung, in der die Übungen des praktischen Lebens und didaktische Materialien dem kindlichen Streben nach Selbsttätigkeit und Autonomie entgegenkommen. In diesem Zusammenhang ist die Möglichkeit der sogenannte Freiarbeit ein Kernstück der Montessori-Schule. Im Verlauf des Vormittags dürfen sich die Schüler für zwei bis drei Unterrichtsstunden nach eigenem Interesse mit einem Thema beschäftigen. Dadurch kann das Kind weitgehend sein eigenes Lerntempo bestimmen, der Lehrer hält sich in dieser Zeit möglichst zurück. So wird den Kindern ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit erlaubt, das sich deutlich und positiv von der Regelschule unterscheidet. Die Sinnesmaterialien helfen dem Kind, seine alltäglich gewonnenen Eindrücke zu ordnen. Gleichzeitig erfahren Heranwachsende durch das Hervorheben einer Materialeigenschaft wie Farbe, Form, Oberflächenbeschaffenheit und dergleichen immer wieder neue geistige 20 25 30 35 83 Kapitel 16 40 45 Anregungen und Motivation, mit den Materialien zu experimentieren. Daneben überzeugen mathematisches Material und Sprachmaterialien durch ihre Anschaulichkeit. Auf diese Weise leistet die Montessori-Pädagogik einen gelungenen Beitrag zur kindgerechten intellektuellen Förderung des Heranwachsenden. Diese auffällige Schwerpunktsetzung hat der Montessori-Pädagogik aber auch den Vorwurf eingebracht, die Kreativitätserziehung der Kinder in den musischen und musikalischen Bereichen zu vernachlässigen. 50 4. Kritische Würdigung der Waldorfpädagogik 5 10 15 20 25 Vergegenwärtigt man sich den Vorwurf des Vernachlässigens musisch und musikalischer Kreativitätserziehung innerhalb der Montessori-Pädagogik, so scheint die Waldorfpädagogik diesen Versäumnissen gebührend Rechnung zu tragen. Sie betont bereits für den Kindergarten die Notwen­dig­keit und die vielfältigen Möglichkeiten einer Kreativitätserziehung im künstlerisch-musi­schen Bereich sowie im Spiel und greift dabei konsequent auf Fantasie anregende Naturmaterialien und Alltagsgegenstände zurück. Im Bereich der Schule stellen Wortgutachten eine sinnvolle Alternative zu den abstrakten Zeugnisnoten der Regelschule, insbesondere für jüngere Kinder, dar. Das Klassenlehrerprinzip bietet den Vorteil einer jahrelangen Zusammenarbeit zwischen Kindern, Lehrern und Eltern, kann aber bei gegenseitigen Spannungen oder Antipathien auf Dauer sehr belastend für alle Beteiligten werden. Während der Epochenunterricht ein differenziertes Auseinandersetzen mit einzelnen Themenbereichen ermöglicht, birgt er auch die Gefahr, dass Schüler im Falle von Krankheit ganze Epochen versäumen, deren Inhalte im laufenden Schuljahr nicht mehr aufgegriffen werden. Die Waldorfschule differenziert nicht – wie das staatliche Schulsystem – in Haupt-, Real- schule und Gymnasium, sondern unterrichtet ihre Schüler bis zum 14./15. Lebensjahr einheitlich. Diese Vorgehensweise erfährt ein geteiltes Echo. Einerseits wird hier der Gefahr einer für den einzelnen Schüler zu frühen Weichenstellung seiner Schullaufbahn begegnet, für andere Schüler mag diese relativ späte Ausrichtung des Unterrichts an einem höheren Bildungsabschluss vielleicht schon ­ zu spät kommen. Da Steiner eine Erziehung des Verstandes und der Urteilskraft erst mit der Geburt des Astralleibs im dritten Jahrsiebt empfiehlt, wird der Waldorfpädagogik vorgeworfen, sie betreibe bis in die Pubertät eine weltfremde, antiintellektuelle Erziehung. Die Waldorf-Pädagogik steht der Benutzung von elektronischen Medien, insbesondere dem Fernsehen, ablehnend gegenüber. In erster Linie sieht sie die Gefahr einer permanenten Manipulation der Kinder, deren Urteilsvermögen und Werthaltungen entwicklungsbedingt noch nicht gefestigt sind. Diese Haltung hat ihr den Vorwurf einer teilweise „weltfremden Pädagogik“ eingebracht. ­Darüber hinaus kritisieren Gegner der Anthroposophie deren mystischen, kosmischübersinnlichen theoretischen Annahmen, die wissenschaftlich nur schwer erfassbar bzw. beweisbar seien. 30 35 40 45 50 55 84 Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis Ahne, Verena: … Eltern sein dagegen sehr; in: Gehirn & Geist, 04/2011, S. 14–21. Ahne, Verena: Immer Stress mit der Krippe; in: Gehirn & Geist, 05/2013, S. 14–19. Ahnert, Lieselotte: Wie viel Mutter braucht ein Kind? Bindung – Bildung – Betreuung: öffentlich und privat, Heidelberg, Spektrum Akademischer Verlag, 2010. AP: Urwaldfrau nach Jahren eingefangen; in: Donau-Kurier, 16/19.01.2007, S. 6. Badry, Elisabeth/Buchka, Maximilian/Knapp, Rudolf (Hrsg.): Pädagogik – Grundlagen und sozialpädagogische Arbeitsfelder, 4. Auflage, München-Unterschleißheim, Wolters Kluwer, 2003. Bandura, Albert: Sozial-kognitive Lerntheorie; Herausgeber der deutschen Ausgabe: Rolf Verres, aus dem Amerikanischen übersetzt von Hainer Kober, Stuttgart, Klett-Cotta, 1991. Bange, Dirk/Körner, Wilhelm (Hrsg.): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch, 2. Auflage, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2002. Bartsch, Matthias/Friedmann, Jan/Kistner, Anna/Tieg, Alexander: Bauen wie blöde; in: DER SPIEGEL, 29/2013, S. 22–26. Brandt, Andrea/von Bredow, Rafaela/Theile, Merlind: Glaubenskrieg ums Kind; in: DER SPIEGEL, 09/2008, S. 40–54. Braun, Gisela: Erziehung und sexueller Missbrauch; in: Bange, Dirk/Körner, Wilhelm (Hrsg.): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch, 2. Auflage, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2002, S. 69–73. Bredenkamp, Jürgen/Weinert, Franz Emanuel/Bredenkamp, Karin: Funkkolleg Pädagogische Psychologie, Studienbegleitbrief, Band 5: Lernen; hrsg. v. Deutschen Institut für Fernstudien, 1985. Breuer, Josef/Freud, Sigmund: Studien über Hysterie, 7. Auflage, Frankfurt a. M., Fischer ­Taschenbuch Verlag, 2011. Brezinka, Wolfgang: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, 5. Auflage, München/Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 1990. Brisch, Karl Heinz: Bindungsstörungen – Von der Bindungstheorie zur Therapie, 12. Auflage, Stuttgart, Klett-Cotta, 2013. Bronfenbrenner, Urie: Ökologische Sozialisationsforschung; in: Kruse, Lenelis/Graumann, Carl-Friedrich/Lantermann, Ernst-Dieter (Hrsg.): Ökologische Psychologie – Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen, 2. Auflage, München, Beltz – Psychologie Verlags Union, 1996, S. 76–79. Bueb, Bernhard: Zur Wiederentdeckung der Disziplin; in: Pädagogik, Verlagsgruppe Beltz, 59. Jahrgang, 01/2007, S. 11–14. Literaturverzeichnis Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Familienreport 2012 – Leistungen, Wirkungen, Trends, Berlin, Dezember 2012. Caspary, Ralf: Alles Neuro? Was die Hirnforschung verspricht und nicht halten kann, Freiburg i. B., Verlag Herder, 2010. Cloerkes, Günther: Sozialpsychologische und soziologische Aspekte des Umgangs zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen; in: Psychomed, E. Reinhardt Verlag, 04/2001, S. 196–202. Corsten, Claudia: HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen; in: Schmidt, RenateBerenike/Sielert, Uwe (Hrsg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, 2. Auflage, Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 2013, S. 506–518. Cortina, Kai S./Baumert, Jürgen/Leschinsky, Achim/Mayer, Karl Ulrich/Trommer, Luitgard (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland – Strukturen und Entwicklungen im Überblick, Reinbek, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2008. Dahlkamp, Jürgen/Friedmann, Jan/Verbeet, Markus: Die neue Hauptschule; in: Der SPIEGEL, 46/2009, S. 142–153. Danner, Helmut: Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik – Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik, 5. Auflage, München/Basel, Ernst Reinhardt V ­ erlag, 2006. Donaukurier Nr. 62, 13.03.2008, S. 45 : Im Vorschulalter höchstens eine halbe Stunde am Tag. Dreikurs, Rudolf/Soltz, Vicki: Kinder fordern uns heraus – Wie erziehen wir sie zeitgemäß? übersetzt von Erik A. Blumenthal, 18. Auflage, Stuttgart, Klett-Cotta, 2012. Edelmann, Walter/Wittmann, Simone: Lernpsychologie. 7. Auflage, Weinheim, Beltz Psychologie Verlags Union, 2012. Enders, Ursula (Hrsg.): Zart war ich, bitter war‘s – Handbuch gegen sexuellen Missbrauch, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1990. Enggruber, Ruth: Empowerment – zwischen emanzipatorischem Anspruch und sozialtechnologischer Indienstnahme für die Elternarbeit im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz; in: Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz, „projugend“, Nr. 1, 2015, S. 8–11, Landesarbeitsstelle Bayern e. V., Verlag Aktion Jugendschutz, München, 2015. Evanschitzky, Petra: Spielen – Warum selbst gewählte Spielsituationen so wichtig sind; in: kindergarten heute, Nr. 8/2013, S. 8 f. Felten, Michael/Stern, Elsbeth: Lernwirksam unterrichten – Im Schulalltag von der Lernforschung profitieren, Berlin, Cornelsen Verlag, 2012. Fiedler, Peter: Da hilft nur der Keuschheitsgürtel; in: Psychologie Heute, 10/2007, S. 57. Flammer, August: Entwicklungstheorien, 4. Auflage Bern, Verlag Hans Huber, 2009. Flieger, Petra/Schönwiese, Volker (Hrsg.): Menschenrechte, Integration, Inklusion – Aktuelle Perspektiven aus der Forschung, Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt, 2011. Freud, Sigmund: Abriss der Psychoanalyse – Das Unbehagen in der Kultur, Ditzingen, R ­ eclam, 2012. 85 86 Literaturverzeichnis Friedmann, Jan/Greiner, Lena: „Mama, ich bin dumm“; in: Der SPIEGEL, 23/2014, S. 47. Germain, Carel B./Gitterman, Alex: Praktische Sozialarbeit. Das „Life Model“ der Sozialen ­Arbeit, Fortschritte in Theorie und Praxis; übersetzt von Beatrix Vogel, 3. Auflage, S ­ tuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1999. Geulen, Dieter: Sozialisation; in: Joas, Hans, Lehrbuch der Soziologie, 3. Auflage, Frankfurt a. M./New York, Campus, 2007, S. 137–158. Giesecke, Hermann: Nicht das Leben, nur die Bildung bildet; in: Psychologie Heute, 09/1999, S. 54–59. Giesecke, Hermann: Pädagogik – quo vadis? Ein Essay über Bildung im Kapitalismus, Weinheim/München, Juventa Verlag, 2009. Goos, Hauke: Du sollst keine Fehler machen! In: Der SPIEGEL, 01/2014, S. 50. Gordon, Thomas: Die Neue Familienkonferenz – Kinder erziehen ohne zu strafen; übersetzt von Annette Charpentier, 21. Auflage, München, Wilhelm Heyne Verlag, 2014. Grossmann, Karin/Grossmann, Klaus E.: Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit, 5. Auflage, Stuttgart, Klett-Cotta, 2012. Gudjons, Herbert: Pädagogisches Grundwissen – Überblick, Kompendium, Studienbuch, 11. Auflage, Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt, 2012. Hahlweg, Kurt: Mit Konsequenz erziehen, in: GEO WISSEN, 10/2014, Nr. 54 Erziehung, S. 29 f. Hautzinger, Martin/Thies, Elisabeth: Klinische Psychologie – Psychische Störungen kompakt, Weinheim/Basel, Beltz Verlag, 2009. Helwig, Paul: Charakterologie, Freiburg i. B., Herder, 1967. Herrmann, Kerry: Offene Jugendarbeit und Heimerziehung – Geschichtliche Entwicklung, Aspekte, Chancen und Probleme, München und Ravensburg, GRIN Verlag, 2004. Hobmair, Hermann (Hrsg.): Kompendium der Pädagogik, Troisdorf, Bildungsverlag EINS, 2009. Hobmair, Hermann (Hrsg.): Kompendium der Psychologie, Troisdorf, Bildungsverlag EINS, 2010. Hobmair, Hermann (Hrsg.): Pädagogik/Psychologie für die berufliche Oberstufe, Band 1, 3. Auflage, Köln, Bildungsverlag EINS, 2011. Hobmair, Hermann (Hrsg.): Psychologie, 5. Auflage, Köln, Bildungsverlag EINS, 2013. Hobmair, Hermann (Hrsg.): Soziologie, 3. Auflage, Köln, Bildungsverlag EINS, 2014. Hoffmeyer, Miriam: Wie schlechte Förderung die kindliche Hirnentwicklung beeinflusst – Ein Gespräch mit Anna Katharina Braun; in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 139, 20.06.2006, S. 45. Hörmann, Bernadette/Hopmann, Stefan T.: Marginalisierungsprozesse von Menschen mit Behinderungen im Rahmen von „School-Accountability“-Maßnahmen; in: Flieger, Petra/ Literaturverzeichnis Schönwiese, Volker (Hrsg.): Menschenrechte, Integration, Inklusion – Aktuelle Perspektiven aus der Forschung, Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt, 2011, S. 105–110. Huxley, Aldous: Schöne neue Welt, 66. Auflage, übersetzt von Herberth E. Herlitschka, Frankfurt a. M., Fischer Taschenbuch Verlag, 2009. Jaeggi, Eva: Zu heilen die zerstossnen Herzen – Die Hauptrichtungen der Psychotherapie und ihre Menschenbilder, Reinbek, Rowohlt Verlag, 2011. JIM-Studie 2014, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, www.mpfs.de. Joas, Hans: Lehrbuch der Soziologie, 3. Auflage, Frankfurt a. M./New York, Campus Verlag, 2007. Juul, Jesper: Wem gehören unsere Kinder? Dem Staat, den Eltern oder sich selbst? Ansichten zur Frühbetreuung, übersetzt von Kerstin Schöps, 2. Auflage, Weinheim/Basel, Beltz Verlag, 2012. Kipphardt, Heinar: Bruder Eichmann – Schauspiel, Reinbek, Rowohlt Verlag, 1988. Klafki, Wolfgang (Hrsg.): Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft – Studienbegleitbriefe, Band 1, 2. Auflage, Weinheim u. a., Beltz Verlag, 1970. Klafki, Wolfgang/Rückriem, Georg M./Wolf, Willi/Freudenstein, Reinold/Beckmann, HansKarl/Lingelbach, Karl-Christoph/Iben, Gerd/Diederich, Jürgen: Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft – Eine Einführung, Band 1, Frankfurt a. M., Fischer Taschenbuch Verlag, 1986. Knapp, Rudolf: Erziehung und Sozialisation; in: Badry, Elisabeth/Buchka, Maximilian/Knapp, Rudolf (Hrsg.): Pädagogik – Grundlagen und sozialpädagogische Arbeitsfelder, 4. Auflage, München-Unterschleißheim, Wolters Kluwer, 2003, S. 147–158. Köller, Olaf: Gesamtschule – Erweiterung statt Alternative; in: Cortina, Kai S./Baumert, Jürgen/ Leschinsky, Achim/Mayer, Karl Ulrich/Trommer, Luitgard (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland – Strukturen und Entwicklungen im Überblick, Reinbek, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2008, S. 458–486. König, Eckard/Zedler, Peter: Theorien der Erziehungswissenschaft, 3. Auflage, Weinheim/ Basel, Beltz Verlag, 2007. Krüger, Heinz-Hermann: Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft, 6. Auflage, Opladen, Verlag Barbara Budrich, 2012. Kruse, Lenelis/Graumann, Carl-Friedrich/Lantermann, Ernst-Dieter (Hrsg.): Ökologische Psychologie – Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen, 2. Auflage, Beltz –Psychologie Verlags Union, München, 1996. Kullmann, Kerstin: Kinder der Angst; Largo, Remo H., in: DER SPIEGEL, 32/2009, S. 38–48. Lampert, Claudia: Kinder und Internet, in: Tillmann, Angela/Fleischer, Sandra/Hugger, KaiUwe (Hrsg.): Handbuch Kinder und Medien, Wiesbaden, Springer VS, 2014. Lasch, Christopher: Das Zeitalter des Narzissmus, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1999. 87 88 Literaturverzeichnis Leising, Daniel: Die Allergrößten; in: Psychologie Heute, Verlagsgruppe Beltz, 07/2004, S. 30–35. Lenzen, Dieter: Bildung statt Bologna, Berlin, Ullstein Buchverlage, 2014. Leschinsky, Achim: Die Hauptschule – Sorgenkind im Schulwesen; in: Cortina, Kai S./Baumert, Jürgen/Leschinsky, Achim/Mayer, Karl Ulrich/Trommer, Luitgard (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland – Strukturen und Entwicklungen im Überblick, Reinbek, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2008, S. 377–399. Löw, Ulrike: Wenn Kinder im Netz verletzt werden: Gefahr Cybermobbing; in: Nordbayerische Nachrichten, 20.03.2015, S. 14. Marmet, Otto: Ich und du und so weiter – Kleine Einführung in die Sozialpsychologie, 4. ­Auflage, Weinheim/Basel, Beltz Verlag 2014. Metzger, Wolfgang: Psychologie für Erzieher I: Psychologie in der Erziehung, 3. Auflage, ­Bochum, Verlag Ferdinand Kamp, 1976. Mietzel, Gerd: Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens, 8. Auflage, Göttingen u. a., Hogrefe Verlag, 2007. Montessori, Maria: Grundlagen meiner Pädagogik; in: Oswald, Paul/Schulz-Benesch, Günter (Hrsg.): Grundgedanken der Montessori-Pädagogik, 4. Auflage, Freiburg i. B., Verlag Herder, 2015, S. 15–35. Nuber, Ursula: Die Spuren der Kindheit, in: Psychologie Heute, Heft 10/2009, S. 21–25. o. A.: Gnadentod für Babys; in: DER SPIEGEL 46/13.11.2006, S. 167, Zugriff unter SPIEGEL ONLINE: www.Spiegel.de/Spiegel/print/d-49533675.html [31.08.2015]. o. A.: Im Vorschulalter höchstens eine halbe Stunde am Tag; in: Donaukurier, 62/13.03.2008, S. 45. Oswald, Paul/Schulz-Benesch, Günter (Hrsg.): Grundgedanken der Montessori-Pädagogik, 4. Auflage, Freiburg i. B., Verlag Herder, 2015. Ott, Ursula: „Erst mal so eine Art Karriere machen!“; in: Schwarzer, Alice (Hrsg.): Schwesternlust und Schwesternfrust: 20 Jahre Frauenbewegung, Köln, Emma-Frauen-Verlag, 1991 (EMMA-Sonderband, [8]), S. 40–41. Pausewang, Freya: Dem Spiel Raum geben – Grundlagen und Orientierungshilfen zur Spielund Freizeitgestaltung in sozialpädagogischen Einrichtungen, Berlin, Cornelsen Verlag, 1997. Pörksen, Bernhard/Schulz von Thun, Friedemann: Kommunikation als Lebenskunst – Philosophie und Praxis des Miteinander-Redens, Heidelberg, Carl Auer Verlag, 2014. Pressemitteilung vom 29. Juli 2014 – 266/2014, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016; In www.destatis.de / Pressemitteilungen; eigene Darstellung. Rätz, Regina/Schröer, Wolfgang/Wolff, Mechthild: Lehrbuch Kinder- und Jugendhilfe – Grundlagen, Handlungsfelder, Strukturen und Perspektiven, 2.Aufl., Weinheim, München, Juventa Verlag, 2014. Literaturverzeichnis Reinecker, Hans: Grundlagen der Verhaltenstherapie, 3. Auflage, Weinheim, Beltz Psychologie Verlags Union, 2005. Saß, Henning: Gewalttaten lassen sich nicht verlässlich vorhersagen; in: Gehirn & Geist, 7-8/2010, S. 36–39. Scheunpflug, Annette: Biologische Grundlagen des Lernens, Berlin, Cornelsen Verlag Scriptor, 2001. Schmidt, Renate-Berenike/Sielert, Uwe (Hrsg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, 2. Auflage, Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 2013. Schwarzer, Alice (Hrsg.): Schwesternlust und Schwesternfrust: 20 Jahre Frauenbewegung, Köln, Emma-Frauen-Verlag, 1991 (EMMA-Sonderband, [8]). Skinner, Burrhus Frederic: Jenseits von Freiheit und Würde. Reinbek, Rowohlt Verlag GmbH, 1982. Speck, Otto: System Heilpädagogik – Eine ökologisch reflexive Grundlegung, 6. Auflage, ­München/Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 2008. Speziale-Bagliacca, Roberto: Sigmund Freud – Begründer der Psychoanalyse; Spektrum der Wissenschaft, Biografie 3/2000, Heidelberg 2000. Stein, Margit: Allgemeine Pädagogik, München/Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 2009. Tillmann, Angela/Fleischer, Sandra/Hugger, Kai-Uwe (Hrsg.): Handbuch Kinder und Medien, Wiesbaden, Springer VS, 2014. Watson, John B.: Behaviorismus, hrsg. von Carl F. Graumann, übersetzt von Lenelis Kruse, Eschborn/Frankfurt a. M., Klotz Verlag, 1997. Weber, Erich: Erziehungsstile, 8. Auflage, Donauwörth, Verlag Ludwig Auer, 1986. Weber, Erich: Pädagogik – Eine Einführung, Band 1, Teil 3: Pädagogische Grundvorgänge und Zielvorstellungen, 8. Auflage, Donauwörth, Verlag Ludwig Auer, 1999. Wedemeyer, Juliane von: Klick-Clique, in: Süddeutsche Zeitung, 21./22. Februar 2015, S. 1. Wiater, Werner: Erziehen und Bilden, Prüfungswissen – Basiswissen Schulpädagogik, Donauwörth, Auer Verlag 2013. Wieczorek, Thomas: Die verblödete Republik – Wie uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen, München, Knaur Taschenbuch Verlag, 2009. Wimmer, Heinz/Perner, Josef: Kognitionspsychologie, Stuttgart, Kohlhammer, 1994. Winterhoff-Spurk, Peter: Kalte Herzen – Wie das Fernsehen unseren Charakter formt, Stuttgart, Klett-Cotta, 2005. Wolf, Christian: Ein unsinniger Streit; in: Gehirn & Geist, Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, 04/2013, S. 32–40. Zierer, Klaus/Speck, Karsten/Moschner, Barbara: Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung, München/Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 2013. 89