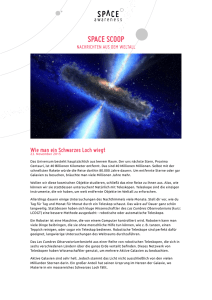Deutscher Ideenkatalog
Werbung

Deutscher Ideenkatalog Inhalt 1. Thema: Transport und Logistik 1.1. Intelligente Fahrstrategie der Automatischen Warentransportanlage (AWT) für Krankenhausgüter 1.2. Robotische Transportvehikel, die mit Menschen im gleichen Arbeitsumfeld agieren können 1.3. Automatische Erfassung von wichtiger Vorratsartikeln (z. B. Kittel, OP-Kleidung) über Sensoren in den Schränken 1.4. Automatisierte Sterilisation (und Transport) von laparoskopischen und chirurgischen Instrumenten 1.5. Automatisierter Patiententransport zum Ort der Bestrahlungstherapie 1.6 Robotische Patiententransportlösung: ein automotiver Stretcher 2. Thema: Robotische Navigation 2.1. Tracking System for Partikel/Protonenbestrahlung 2.2. Anti-Kollisionssystem für Roboter die in Überlappung miteinander und mit Menschen agieren 2.3.Verwendung von Vektordaten für Robotische Navigation 2.4. Erfassung und Vorhersage von Gewebedeformation, z.B. während robotisch navigierter Extraktion von Tumorgewebe 2.5. Bildüberlagerung Video und Röntgen zur Projektion von Eintrittspforten auf der Haut beim Einbringen von Drähten in der Orthopädie / Unfallchirurgie 3. Thema: Labor, Analyse und Produktion 3.1. Robotische Spritzenpräparation für die Qualitätskontrolle bei der Produktion von Radiopharmaka 3.2. Automatische Synthesemodule für die C-11 Tracer-Produktion 3.3. Robotische Reinraumproduktion von Zytostatika in kleinen Dosen 3.4. Roboter für den schnelleren Transport zur Analyse von Laborproben 3.5. Automatisch adjustierbarer Mikroskoptisch für Gewebekulturflaschen 3.6. Robotisches Gerät um die Quantität und Konzentration von Zellproben in einem flüssigen Probe zu bestimmen (z.B. Klassifikation von spermiogrammen) 3.7. Automatisierte Füllstandsanzeige and Anzeige für Kryproben im Stickstofflagerungstank 4. Thema: Rehabilitationstechnik und Pflegetechnik 4.1. Robotisch-navigierte Rehabilitationstechnologie die Bewegungen von schwer bewegungseingeschränkten Patienten erlaubt oder steuert (z.B. Exoskelette) 4.2. Pflege-Roboter, Patienten Baderoboter, Haarwaschroboter 1 5. Thema: Diagnose und Therapie 5.1.“Uro-Boot” Robotisch-navigierte und ferngesteuerte endoskopische Kapsel mit Drahtloser Emission von Bilddaten und integrierter Therapieoption für den Urogenitaltrakt 5.2. OCT 5.3. Intraoperativer positiver LN Detektor/Mixer, 5.4. Gefäßdetektion ähnlich wie “Ro-blood“ 2 1. Thema: Transport und Logistik Einleitung Zu diesem Themenbereich zählen u.a. der Transport und die Bereitstellung von Gütern im Krankenhaus und zu den Stationen, das Bewegen von Personen im Krankenhaus (und in der Pflege), sowie das Lagern von Gütern in Zentrallagern und auf den Stationen. Alle diese Transporte erfordern eine ausgefeilte Logistik und eine angepasste effiziente Technologie, z.B. um intelligentere Nutzung mit besserem Fluss zu ermöglichen oder die Sicherheit der Menschen zu erhöhen. Auch die gleichzeitige Anwesenheit von Robotern oder automatischen Vehikeln im selben Raum wie Menschen stellt eine Herausforderung dar. Die Warenlagerung in Krankenhäusern ist oftmals noch nicht so weit entwickelt wie die industriellen automatisierten Lagerungssystemen, die es bereits gibt (bis auf die Registrierung der gelagerten Waren im Computer), und erfordert viel Personal. Das Identifizieren von Gütern, sie automatisch entnehmen und zu einem definierten Ort zu bringen, sind typische robotische Aufgaben und robotische Lagerungssysteme sind in der Industrie weit verbreitet und erhältlich. Krankenhäuser bräuchten allerdings an die speziellen Vorgaben angepasste Lösungen (u.a. bei der Hygiene). Spezifische Scanner Systeme auf den Stationen wären hilfreich. Auch bei Arzneimitteln gibt es Vorteile „chaotischer Lagerhaltung“, z.B. bei Firmen wie Fresenius und Braun in der Industrie verbreitet, computergesteuert in Apotheken. Für fertige und Groß-Packungen sind diese gut geeignet, jedoch für den Herstellungsbetrieb nicht so geeignet. Ideen: 1.1. Intelligente Fahrstrategie der Automatischen Warentransportanlagen (AWT) für Krankenhausgüter Zur Zeit arbeiten die AWT´s in Kiel und Lübeck mit eher konservativen Fahrstrategien, z.B. werden die Kliniken bei Transportanforderungen nach Priorität geordnet. Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ist generell gut, aber es ist keine Mehrfachbelegung möglich, um eine bessere Auslastung zu erzielen (z.B. wenn Fahrzeuge auf Wegen schon abschnittsweise etwas mitnehmen und übergeben). Es besteht ein Bedarf für eine intelligentere Fahrstrategie der AWT. Dynamischere, verbesserte Fahrzeugbewegungen würden die Kapazitäten erweitern, weil Transportkapazitäten und Wegeoptimierung eine effektivere Nutzung bedeuten. Potentielle Nutzer wären alle Leistungsanbieter im UKSH, die das System schon nutzen: Küche, Wäscherei, Zentrallager, Zentrale Sterilgutaufbereitung. Bereits existierende Lösungen: Intelligente Logistiklösungen und Strategien z.B. nach biologischem Vorbild (z.B. Ameisen). 1.2. Robotische Transportvehikel, die mit Menschen im gleichen Arbeitsumfeld agieren können Die AWT´s arbeiten in einem abgeschlossenen Sicherheits-Bereich schienengeführt an der Decke oder durch Leitungen im Boden geführt, daher der extra Raumbedarf. Bereiche, in denen Warentransporte sich den Raum mit Menschen teilen müssen: wegen der Sicherheitsproblematik gab es in der Praxis hier bisher keine Transportautomatisierung. Probleme bestehen bei mehreren Kliniken des UKSH, die baulich nicht an die AWT angeschlossen sind (z.B. Kinderklinik), diese benötigen alternative Lösungen. Es sind hier intelligente robotische Lösungen gefragt, die es ermöglichen Transportlösungen auch in den von Personen bzw. Patienten benutzten Bereichen einzusetzen bzw. umgekehrt Patiententransporte auch in den Transportkanälen zwischen den Häusern eines Klnikum durchzuführen (derzeit müssen immobile Patienten oft im Rollstuhl bzw. im Auto vom Fahrdienst von einem Gebäude ins Nachbargebäude gebracht werden). Auch für Kliniken bzw. Krankenhäuser, die nicht über eine AWT verfügen, könnte der Einsatz von robotischen 3 Systemen, die sich frei auch auf dem Klinikgelände bewegen können, in Betracht gezogen werden. Vorteil: bessere Nutzung von Raum und Anbindung aller Kliniken möglich Potentielle Nutzer: Alle Leistungsanbieter im UKSH, die das System schon nutzen: Küche, Wäscherei, Zentrallager , Sterilisation, Abfall, aber auch Patienten und Pflegepersonal Eine mögliche Verbesserung der Akzeptanz durch entsprechendes Design der Vehikel möglich. In diesem Feld sind bereits durch intelligente Navigation und durch Sensoren realisierter Kollisionsschutz auf den Weg gebracht, z. B. als Prototyp wie der Care-o-bot des FrauenhoferInstituts Stuttgart (intelligente Navigation, Handreichungsaufgaben durch flexiblen Roboterarm) oder der Casero der deutschen Firma MLR Systems GmbH. Diese können zwischen Personen navigieren ohne mit Ihnen zusammenzustoßen und sind intelligent genug bestimmte Fahrwegsrouten zu lernen und Monitoring Aufgaben wahrzunehmen. Beide wurden schon in Umgebungen wie Pflegeheimen getestet, müssen jedoch noch weiterentwickelt werden, um den Bedürfnissen der Patienten gerechter zu werden. Im Forth Valley Royal Hospital in Larbert, Stirlingshire, einem Krankenhaus in Schottland werden Transportroboter eingesetzt, die Lastkarren gleichend im Regelbetrieb zum Müll entsorgen, Essen transportieren, allerdings immer noch in einem Korridorsystem im Untergrund separat, auch Fahrstühle separat, navigieren in den Gängen mit rotierenden Laser, Sensoren zur Kollisionsvermeidung; auch Putzroboter, die die OP Säle reinigen und Automatisierung der Krankenhausapotheke; Am Magdeburger Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) wurde eine taktile Haut für Roboter entwickelt: es ist ein Sensorsystem, dass Sicherheit gewährleisten soll, auch zur Lenkung des Roboters durch „Schubsen“ verwendbar, oder als Fußbodenbelag für Sicherheitszonen denkbar oder als Monitoring wenn jemand hinfällt; 1.3. Automatische Erfassung von wichtigen Vorratsartikeln (z.B: Kittel, OP-Kleidung) über Sensoren in den Schränken Die Entnahme von Kleidung wird bisher vom Pflegepersonal erfasst und führt zu Bestellung; Bedarf: Scannsystem für Verbrauchsmaterialien und OP Kleidung. Automatische Erfassung, wann ein Lagerartikel im Schrank entnommen wurde, bzw. nicht mehr vorhanden ist und neu bestellt/aufgefüllt werden muss. Das System muss leicht bedienbar sein, aber es gibt Vorgaben für die Autorisation der Bestellung. Abstimmung mit der Lagerhaltung und Logistik wichtig. . Bereits jetzt sind Mitarbeiter der Service GmbH unterwegs, die die vom Personal aufgehängten Code-Schilder scannen (diese werden außen an den Schrank gehängt, wenn sich Artikel leeren) und die Bestellung von den Modulschränken der Stationen aufgeben. Dieses System könnte durch Sensoren in den Fächern ergänzt werden, die eine Automatisierung leisten. 1.4. Automatisierte Sterilisation (und Transport) von laparoskopischen und chirurgischen Instrumenten 1.5. Automatischer Patiententransport zum Ort der Bestrahlungstherapie Bei der Planung des neuen Partikelbestrahlungszentrums in Kiel müssen wegen der „kostbaren“ Bestrahlungszeit und den Anforderungen der Bewegungslosigkeit während der Prozedur die Patienten in einer Vorbereitungsphase in einem Vorraum immobilisiert und vorbereitet werden. Vorbereitung und Überwachung der Lagerung sollen durch eine MTA erfolgen. Es ist eine sehr enge Bestrahlungsplanung im Raum vorgesehen, es muss einen „fliegenden Wechsel“ geben. Dabei soll eine Teil-Automatisierung des Patiententransports mit einer Liege erfolgen, die in den Behandlungsraum über Magnetstreifen eingefahren wird und vom KUKA-Bodenarm-Roboter angehoben und in Position gebracht wird. Unklar ist noch, welches System hierfür benutzt werden wird (z.B. PatLog-System der Firma ONCOlog Medical QA AB, Schweden). Anmerkung: Wie kann man Akzeptanz durch Design oder „menschliche Elemente“ verbessern? 4 1.6. Robotische Patiententransportlösung: ein automotiver Stretcher Problem: In der Klinik müssen die Patienten zu einer Operation bisher vom Bett im Zimmer auf den Stretcher zum OP in die Vorbereitungsräume gebracht werden. Manchmal wird dort schon die Regionalanästhesie durchgeführt, auch werden sie dort zunächst „geparkt“. Von dort geht es auf den OP Tisch. Danach in den Aufwachraum und wieder auf Station zurück. Zur Zeit gibt es u.a. Rollboards und mechanische und elektrische Hilfen zum Umbetten, meist sind 2-3 Personen nötig. Lösung/Idee: ein Stretcher mit Eigenantrieb, der 2-3 m hinter einem herfährt und folgt (wie ein Golfcaddy), denkbar auf einem Isoschienensystem. Es wäre weiterhin ideal nur 1 Medium zu haben, also wenn der Stretcher sich gleich als OP Tisch verwenden ließe, dann wären weniger Personen zum Umlagern nötig und weniger schwere Hebetätigkeit für das Personal. OP Tische haben jedoch einige Vorgaben: z.B. muss der Chirurg mit den Beinen ergonomisch darunter passen, der Tisch muss höhenverstellbar sein, Hygieneaspekte sind zu beachten, manchmal erforderlicher Einsatz von Wärmematten, Nässeaufnahme problematisch, der OP-Tisch muss eine Kippfunktion haben, denn bei minimalinvasiven Eingriffen mit Laparoskopien lagern die Patienten z.T. kopfüber im Winkel von 30% gekippt (denn besonders bei Eingriffen im kleinen Becken muss der Darm aus dem Weg); auch z.B. für HNO Eingriffe würde ein Stretcher gehen; Ebenfalls eine Herausforderung ist die Lagerung/Transport und Untersuchung von stark adipöse Patienten: z.B. im CT, MRT, auf OP Liegen usw. Das Bewegen von Personen in der Pflege erfolgt derzeit bereits mit einer Vielzahl möglicher Liftersysteme (z.B. Hänge- oder Gurtlifter, motorisierte Lifter mit Steuerung per Handbedienung), die das Personal unterstützen und entlasten können. Dies umfasst u.a. den Transport vom Bett in den Rollstuhl, vom Zimmer zum Bad und in die Badewanne/Dusche und jeweils zurück oder heraus. Der Transport kann in liegender oder sitzender Position erfolgen. Für das Krankenhaus umfassen solche Transportvorgänge außer den o.g. noch den Transport der Patienten innerhalb des Krankenhauses im Rollstuhl oder zwischen den Kliniken auf Tragen in Autos. Das Pflegepersonal hat bei der Bedienung der Lifter und der Vorbereitung der Patientenaufnahme z.B. Netze am Patienten anzubringen und die Lifter zur und in die Dusche oder Badewanne hinein zu leisten.Probleme ergeben sich bei schwergewichtigen Patienten (Netz unterlegen, heben, bewegen), bei den Badeliftern z.B. beim Transfer, beim Kleidung ausund anziehen, bei der Reinigung bei Mehrfachgebrauch. Schwierigkeiten beim Bewegen von Personen ergeben sich auch dadurch dass es keinen Allzwecklifter gibt, und verschiedene Geräte benötigt werden. Die Servicerobotik hat Verbesserungspotential, z.B. wenn autonom navigierende Lifter einfach angefordert werden könnten oder Multifunktionslifter die Anzahl der Geräte reduzieren könnten. Auch eine teilautomatische Aufnahme von Personen mit sensorbasierter Unterstützung (z.B. Personenlageerkennung, Bewegungsanpassung) könnte die Anzahl der benötigten Pflegekräfte und deren körperliche Belastung reduzieren. Dies alles ist auch im Krankenhaus relevant. 5 2. Thema: Robotische Navigation Einleitung: Die Robotische Navigation stellt besonders angesichts sich bewegender Komponenten des menschlichen Körpers, z.B. Atmung, Herzschlag oder Verformung von Gewebe bei Operationen eine Herausforderung dar. 2.1. Tracking System für Partikel/Protonenbestrahlung Problem: Wegen der großen Anforderung an die Zielgenauigkeit und Präzision der Bestrahlung bedarf der Bereich der Vorausberechnung und ggf. Kompensation von Bewegungen des Menschen (z.B. verursacht durch Atmung und Herzschlag) während einer roboterassistierten Therapie zur Steuerung von robotischen Instrumenten großer Aufmerksamkeit. Solcher Bedarf besteht auch für den Bereich der Partikelbestrahlung, da hier entweder mit „Gating“ gearbeitet wird, d.h. Freigabe der Strahlung nur wenn das Strahlenziel in der richtigen Position ist, also ohne Navigationsunterstützung der Strahlenquelle, dabei geht Bestrahlungszeit verloren, oder der Patient in Narkose bestrahlt wird. Ein „Tracking“ d. h. die Bestrahlung folgt der Atmung und dem Herzrhythmus des Patienten ist zur Bewegungskontrolle der robotisch unterstützten Partikeltherapie bisher nicht verfügbar. Bereits existierende Lösungen Das sog. Cyberknife verfügt über ein Tracking 2.2. Anti-Kollisionssystem für Roboter, die in Überlappung miteinander und mit Menschen agieren Problem: Im geplanten Partikelzentrum bei der Behandlung agieren zwei Roboter mit dem Patienten im Behandlungsraum, insgesamt wären im Zentrum sieben Roboter im Einsatz: in drei Behandlungsräumen je ein bodenmontierter KUKA-Roboterarm für die Patientenpositionierung (Behandlungsliege) und ein deckenmontierter C-Bogen Röntgenroboter, sowie im oberen Stockwerk 1 C-Bogen. Wichtig ist dabei Kollisionsschutz. Z. Zt. gibt es eine Vorgabe von einem kastenförmigen Bereich in dem der Mensch vermutet wird; Bereits bei der Vorbereitung CT und Immobilisierung im Vorraum wäre eine Positionsangabe gut. Lösung / Idee: Sensoren (z.B. Infrarotsensoren) auf der Körperoberfläche, diese dürfen aber nicht mit in den Strahl kommen, da Abweichungen von 5 mm schon problematisch für diese Form der Bestrahlungstherapie sind (Bragg Peak der Konformalität) 2.3. Verwendung von Vektordaten für Robotische Navigation Idee: die Datenquellen von feature Vektoren, die nach Dimensionsreduktion, d.h. feature extraction für eine Ähnlichkeitssuche im Netz (Vectorial Web Search) verwendet werden, um eine Behandlungsmethoden-Optimierung zu erreichen, könnten für eine Robotersteuerung genutzt werden. 2.4. Erfassung und Vorhersage von Gewebedeformation, z.B. während robotisch navigierter Extraktion von Tumorgewebe Problem: bei Entnahme von Tumorgewebe kommt es zur Deformation des verbleibenden Gewebes aufgrund des Drucks, z.B. im Hirn, dadurch treten Verschiebungen, die Bilddatenabgleich zu präöoperativ erhobenen Daten erschweren. Lösung: Es besteht Bedarf nach einer guten Bildverarbeitungstechnologie, die sich für die Steuerung von robotergestützen Operationstechniken anwenden lässt. Auch in diesem Bereich wird auf OCT als Methode verwiesen, Resektionsränder von Tumoren besser untersuchen zu können. Sowie nach einer Vorausberechnung solcher Deformationen, zum Vergleich/Abgleich mit präoperativ erhobenen Bilddaten. 2.5. Bildüberlagerung Video und Röntgen zur Projektion von Eintrittspforten auf der Haut beim Einbringen von Drähten in der Orthopädie / Unfallchirurgie 6 Beim Einbringen von Drähten z.B. zum Reponieren von Gelenken wäre es günstig, nicht nur die Röntgenbilder zu haben, sondern diese mit Landmarken mit Videobildern zu überlagern, um die Eintrittspforten auf der Haut sichtbar zu machen, mit denen man dann den optimalen Weg durchs Gewebe und zu den Knochen findet. Dies auch im Zusammenhang mit Versuchen zur „Augmented Reality“ und Planungsprogrammen für OP Techniken; 3. Thema: Labor, Analyse und Produktion Einleitung: Die Produktion von Medikamenten hat hohe Anforderungen an die Produktsicherheit (Asepsis) und Schutzvorschriften, u.a. wird in Reinräumen und hinter Schleusen gearbeitet; viele Vorgänge sind bereits automatisiert aber trotzdem z.B. bei der Qualitätskontrolle noch personalintensiv. In großen Krankenhäusern müssen jeden Tag hunderte von Proben transportiert und verarbeitet werden. Die Wartezeit auf die Ergebnisse der Analysen ist eine kritische Größe. Auch viele Notfallsituationen erfordern eine schnelle Diagnostik. Dasselbe gilt für Gewebeproben z.B. aus Tumoroperationen, wo schnelle intraoperative Schnitte für die Bestimmung von Tumorrändern zur Bestimmung des weiteren Vorgehens ausgewertet werden müssen. Z. Zt. werden Proben oftmals vom Personal eingesammelt und zu Fuß oder mit dem Auto ins Labor oder die Pathologie gebracht. Wertvolle Zeit geht verloren, Kosten könnten durch Automatisierung eingespart werden. Stichworte: Point of Care Diagnostik und Telemedizin/Telediagnostik. Die Kultivierung und Analyse von Zellen und Geweben in den verschiedenen Laboren haben ebenfalls einen großen Bedarf an Automatisierung. 3.1. Robotische Spritzenpräparation für die Qualitätskontrolle bei der Produktion von Radiopharmaka Problem: Die Radiopharmakaproduktion hat hohe Anforderungen an die Produktsicherheit (Asepsis) und Strahlenschutzvorschriften, um das Personal vor Stahlung zu schützen.Es wird in Reinräumen und hinter Schleusen gearbeitet; Abfüllung am offenen Vial unter Reinraumbedingungen Klasse A, weitgehend automatisiert aber trotzdem Personalintensiv mit Mensch: zur Qualitätskontrolle werden einzelne Spritzen aufgezogen, Bleiverkleidung nötig, dies soll durch einen Roboter geschehen. Wunsch: Roboter für die Qualitätskontrolle zum Aufziehen der Spritzen Es bestehen schon ähnliche Lösungen für einen Roboterarm z.B. der „Theodorico“ aus Italien, die jedoch sehr teuer sind. 3.2. Automatische Synthesemodule für die C-11 Tracer-Produktion Problem: Die Radiopharmakaproduktion hat hohe Anforderungen an die Produktsicherheit (Asepsis) und Strahlenschutzvorschriften, es wird in Reinräumen und hinter Schleusen gearbeitet; Abfüllung am offenen Vial unter Reinraumbedingungen Klasse A, weitgehend automatisiert aber trotzdem Personalintensiv, es besteht Bedarf bei der Herstellung von Tracern für ein C-11 Syntheseroboter. Es existieren bereits automatisierte Syntheseapparate für verschiedene andere Tracer, dabei sind Ventile automatisiert ansteuerbar, überall Schaltventile eingebaut. Es besteht Potential bei Synthesemodulen; besonders aufwändig ist dabei der Chargenwechsel in Leitungen, die Restaktivität muss erst abklingen, dieses kostet viel Zeit und es besteht eine Abfallproblematik. Es müssen alle Vorgänge genau dokumentiert werden und die Datenerhebung und speicherung muss ausreichend sein. 3.3. Robotische Reinraumproduktion von Zytostatika in kleinen Dosen Problem: Die Zytostatika Herstellung bedeutet Arbeit mit toxischen Stoffen: problematisch wegen der Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter und wegen der Fließbandarbeit in der Produktion, Personalfindung dort sehr schwierig wegen des Restrisikos. Weiterhin ist Reinraum 7 für Produktschutz notwendig; da dort die Belastung für Mitarbeiter hoch ist, und die Hygiene besser mit Robotern zu gewährleisten ist; Abfüllanlage zur Zytostatika Herstellung mit Abfüllsystem und Pumpensystem Problem dabei: Pro Arzneistoff (z.T. hochtoxisch) wird 1 Automat benötigt, aber große Bandbreite von Stoffen; auf Anforderung z.B. der Chemotherapie-Ambulanz u.a. müssen ca. 25 Arzneistoffe jeweils frisch und in kleinen Mengen pro Vormittag produziert werden; auf Bestellung während der Patient wartet; Automaten sind unflexibel, Schläuche sind Problem, sensible Substanzen und teuer, d.h. Reste im Schlauch sind teuer; große Volumina sind o.k. Roboter-Wunsch: Wunsch: Roboter für die Reinraumproduktion, dabei Abfüllung von kleinen Volumina ca. 1-2 ml, diese Abfüllung ist nicht gerätefähig, wegen der Ungenauigkeiten, aber davon werden z.T. sehr große Stückzahlen (20.000) benötigt. Volumina ab 5 ml sind nicht so problematisch. Es existieren Lösungen wie Spritzenpumpen, jedoch sehr teuer. Es gibt auch sog. Compounding Systeme mit Mehrkanalmischgeräten, z.B. für die parenterale Ernährung. Eine automatisierte Präparation von Zytostatika gibt es auch, ähnlich wie für Parenterale Ernährung, eine Firma aus Lüdenscheid bietet das weltweit einzige halbautomat. Gerät für die Cytostatika Produktion für den onkologischen Markt („Diana Onco Plus“). Auch eine automatisierte Befüllung auch kleinerer Mengen ab 1 ml ist denkbar. Die robotische Befüllung würde hierbei die Genauigkeit und die Sicherheit erhöhen. 3.4. Roboter für den schnelleren Transport zur Analyse von Laborproben Gewünscht werden automatisierte Pipeline-Systeme für Blutproben, Urinproben etc., Rohrpostsysteme Generell unterliegen die Hersteller und Anbieter solcher bereits existierender Rohrpostsysteme (z.B. Aerocom, Swisslog und Timedico) nicht einer dem Medizinproduktegesetz vergleichbaren gesetzlichen Regulierung bezüglich der Qualitätsvorgaben oder dem Nachweis der „Unbedenklichkeit“ was die mögliche Veränderung von Proben durch den Transport in einem solchen System angeht. Dafür sind die Labore zuständig, diese unterliegen einer Akkreditierung und müssen Qualitätsvorgaben einhalten. Die Labore kontrollieren den Zustand der Proben, z.B. Bestimmung möglicher Hämolyse durch Messung des Hb (Photometrisch). Dokumentation erfolgt im Labor. In Kiel leistet das Institut für Klinische Chemie (Zentrallabor) u.a. Analysen im Bereich der Klininischen Chemie, Proteinchemie, Hämatologie, Endokrinologie und therapeutisches Drug Monitoring. Die Blutproben der Stationen werden stündlich von Kurieren abgeholt, damit keine langen Standzeiten bestehen. Es können auch Eiltransporte angefordert werden. Kiel hat sehr gute Werte für die Zeiten. Beispielsweise wären schon 3 Stunden Standzeit zu lang für bestimmte Werte (Gerinnung). Aus Vollblut können 10-12 Parameter gemessen werden, alle Vitalwerte, Elektrolyte, Glucose, Nierenwerte, Hb und Blutgasanalyse. Kalium-Werte müssen manchmal in 15 Min. zur Verfügung stehen. Für die Messung von Blutgasen stehen POCT (Point of Care Testing) Systeme zur Verfügung, die nur von angemeldeten Benutzern verwendet werden, Qualitätskontrolle und EDV-Netzwerk für alle Geräte erfolgt zentral. Beispiel: das dänische Tubensystem „Tempus 600“, TIMEDICO 4 cm Durchmesser, unter 30 sec zum Labor unterwegs, mehrere Aufgabe aber 1 Endstation („Back to back“ System), wäre in Kiel nutzbar für die Anbindung der Frauenklinik mit ihren Blutproben, für die Urologie und Chirurgischen Fächer für die Schnellschnittanalyse aus dem OP zur Pathologie; Problem: Qualität, bei starker Beschleunigung könnte Hämolyse der Blutproben einsetzen; System ist noch nicht so ausgereift, Evaluationsbedarf, Ansprüche in Deutschland an die Qualität generell sehr hoch; 3.5. Automatisch adjustierbarer Mikroskoptisch für Gewebekulturflaschen Herausforderung: bei der Analyse von Zellkulturen (z.B. Tumorgewebe), die sich in Zellkulturgewebeflaschen mit Nährflüssigkeit befinden, müssen die Flaschen (unterschiedliche 8 Volumengrößen: 25, 75 und 175 cm²) mit einem Auflicht-Mikroskop (Zeiss, Axiovert 25) betrachtet werden, welches keinen fahrbaren Tisch aufweist. Um das Blickfeld zu verändern, muss die Flasche mit der Hand angefasst und bewegt werden, welches immer eine Kontaminationsgefahr der Zelllinie bedeutet. Lösung: Automatisch fahrbarer Mikroskoptisch, damit die Zellkulturflasche nicht per Hand bewegt werden muss. Möglicherweise kombiniert mit einer Steuerung über einen PC mit einem robotischem Analysegerät zur Erfassung, wie hoch die Konfluenz ist (spezielle Anforderungen jeweils für unterschiedliche Zellkulturen, z.B. wenn 80-90% Konfluenz wird eine Aufteilung der Zellinie eingeleitet, bei adhäsiven Zellen müssen diese durch Enzymbehandlung gelöst werden (Trypsinierung). Detektion der Konfluenz über den von Zellen unbedeckten Boden) Vorteil: weniger Kontaminationsgefahr der Zellinien, zeitnahe Trypsinisierung gewährleistet 3.6. Robotisches Gerät um die Quantität und Konzentration von Zellproben in einem flüssigen Probe zu bestimmen (z.B. Klassifikation von Spermiogrammen) Bedarf: Zur Zeit Erfassung durch Mitarbeiter, wie hoch die Zellzahl und die Qualität von Zellproben (z.B. Spermaklassifizierung) ist. Gewünscht wird ein automatisches Zellzählgerät. Lösung: es gibt den sog. Coulter Counter und den Casy, beides Systeme, die Zellen über die Änderung elektrischer Felder in Flüssigkeiten detektieren und zählen können, u.a. eingesetzt bei Blutproben; z.T. sind diese im UKSH schon in anderen Abteilungen vorhanden, bzw. Neuentwicklungen bestimmter Systeme werden getestet (Klinische Chemie) 3.7. Automatisierte Füllstandsanzeige and Anzeige für Kryproben im Stickstofflagerungstank Bedarf: Zur Zeit werden Kryoproben der Reproduktionsmedizin (z.B. Hodengewebe oder Ejakulat) im Stickstofftank eingefroren und es wird per Hand in eine Tabelle eingetragen, auch um sie wieder zu finden. Es ist dann aber nicht klar, wie voll die einzelnen Zylinder sind, um neue Proben einzufrieren, dazu müssen diese immer aus dem Tank herausgenommen werden, dies kann ungünstig sein und unterbricht die Kühlung. Idee: eine automatische Erkennung, wie voll die einzelnen Zylinder sind, z.B. über Magnetismus oder eine PC Programm, Registrierung/ Darstellung am Tank mit Grün/Rot ob voll oder befüllbar. 4. Thema: Rehabilitationstechnik und Pflegetechnik In unserer alternden Gesellschaft entstehen schnell wachsende Herausforderungen der Bereitstellung und Finanzierung angemessener Pflege für die Älteren, Behinderte und immobile Krankenhauspatienten. Gleichzeitig verändern sich auch die Erwartungen der Personen, die gepflegt werden. Viele Menschen wünschen sich möglichst viel Autonomie zu Hause oder in den Pflegeeinrichtungen, sie möchten möglichst unabhängig vom Pflegepersonal sein, wenn es um Herausforderungen geht wie aus dem Bett aufzustehen (z.B. nachts), die Toilette zu benutzen, sich zu säubern und zurück ins Bett oder den Rollstuhl zu gelangen. Robotisch unterstützte Pflege und Rehabilitation hat Vor- und Nachteile. Viele halbautomatische Lösungen sind auf dem Weg so wie die Patienten-Waschmaschine (Baderoboter), verschiedene Toilettensysteme und Lifter. Viele der weiterentwickelten Geräte kommen aus Japan, welches vor noch ausgeprägteren demographischen Herausforderungen steht wie Deutschland. 4.1. Robotisch-navigierte Rehabilitationstechnologie, die Bewegungen von schwer bewegungseingeschränkten Patienten erlaubt oder steuert (z.B. Exoskelette) Bedarf an robotergesteuerte Rehabilitationstechnik, die Bewegungsanreize für die Patienten über einen längeren Zeitraum geben, nicht nur ein oder zweimal in der Therapie am Tag (Z.B. über den ganzen Tag, Exoskelette, Laufgeräte oder Sensor-Matten, Matratzen…), da meist über 85 jährige Patienten, oft multimorbide in der Station sind; 9 4.2. Pflege-Roboter, Patienten-Baderoboter (robotische Badekabine), Haarwaschroboter Lösungen: Frau Prof. Karen Shire (Soziologie) von der Universität Duisburg Essen hat zusammen mit Fraunhofer Institut für Produktautomatisierung und 2 Partnern: Serviceroboter: Casero und Care-o-bot 3 in Stuttgarter Pflegeheim getestet; Taktile Haut für Assistenzroboter; 5. Thema: Diagnose und Therapie 5.1. “Uro-Boot” Robotisch-navigierte und ferngesteuerte endoskopische Kapsel mit drahtloser Emission von Bilddaten und integrierter Therapieoption für den Urogenitaltrakt 5.2. Optische Kohärenztomographie (OCT) Die OCT ist eine innovative, lichtbasierte und nicht invasive Bildgebungstechnik zur Gewebedarstellung und und Tumordetektion. Sie kann sowohl für Diagnsotik als auch für intraoperative Anwendungen genutzt werden, in Kombination mit einem Operationsmikroskop oder endoskop, um Gewebe oder Zellschichten zu analysieren (z.B. Epitheliale Läsionen oder atherosklerotische Plaques). OCT hat ein großes Anwendungsspektrum, welches gerade erst anfängt, realisiert zu werden. Die möglichen Einsatzgebiete reichen von Ophthalmologie, Laryngoskopie, und Herzchirurgie über Neurochirurgie bis hin zur Urologie (z.B. die Erkennung von Blasenkrebs) und darüberhinaus. Sie kann auch genutzt werden, um ein intraoperatives Assessment von Krebsresektionsrändern zu leisten. Robotisch assistierte OCT könnte zukünftig noch mehr Vorteile erzielen. 5.3. Intraoperativer positiver LN Detektor/Mixer, Die reliable Identifikation von Tumorzell positiven Lymphknoten ist eine der großen Herausforderungen der Tumorchiurgie in den meisten Chirurgischen Disziplinen. Um die Lebenserwartung der Patienten zu steigern ist es erforderlich, möglichst alle positiven Lymphknoten zu entfernen, während eine Übertherapie zu vermeiden ist. Die Herausforderung ist, den Ort der LK zu identifizieren, da diese oftmals schwierig aufzufinden sind und zu erkennen, welche LK tumorzell-positiv sind, um zu entscheiden, wie weit die Lymphadenektomie gehen muss. Idealerweise sollte diese Diagnose bereits intraoperativ möglich sein. Bis jetzt ist es möglich, die LK in präoperativen MRI Bildern zu visualisieren, aber dies bietet nur eine Annäherung an das Wissen um die Lage während des eingriffs. Sentinel LK können präoperativ mit radioaktiv markierten Substanzen in einem Szintigramm und unter Verwendung einer Gammazähler-Kamera intraoperativ sichtbar gemacht werden. Bezüglich der Identifizierung und Quantifiziereung einer positiven Tumorlast gibt es bereits einige automatisierte Systeme zur mRNA Amplifikation (e. g. by Sysmex & AmpTech), die dieses Thema einbeziehen, aber kein system kann bisher die LK beurteilen in weniger als 20 Min und für eine größere Anzahl von LK bisher. Außerdem können nur individuell aufbereitete und von Fettgewebe freipräparierte LK beurteilt werden. Könnte dieser Prozess weiter optimiert werden und ein verlässliches LK Beurteilungsverfahren durch robotische Systeme entwickelt werden?. 5.4. Gefäßdetektion ähnlich wie “Ro-blood“ Am MMMI (Maersk McKinney Möller Institut) in Odense wurde kürzlich ein sog. “Ro-blood” Gerät für automatisierte Blutprobenabnahme entwickelt. Dieses robotische Gerät ist in der Lage, die Blutgefäße im Unterarm mittels Near-Infrared-Licht (NIR) sichtbar zu machen und zu treffen. Das Prinzip, auf dem diese Erfindung beruht, Gefäßdetektion mit NIR, könnte in anderen chirurgischen Eingriffen von Nutzen sein, möglicherweise in Kombination mit zusätzlichen Bildgebungsverfahren, chirurgischen Manipulatoren oder gesteuerte Robotern. 10