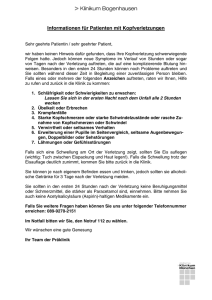Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Schädelhirntraumatikern
Werbung

Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Schädelhirntraumatikern Projekt C4 Abschlussbericht Projektleiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Friedrich Balck Medizinische Psychologie Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Andreas Dinkel Medizinische Psychologie Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden Ein Projekt des Reha-Forschungsverbundes Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS); gefördert durch den Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF); Förderkennzeichen 01 1027 96 20 Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Schädelhirntraumatikern Friedrich Balck, Andreas Dinkel Universitätsklinikum Dresden Medizinische Psychologie Dresden, im Dezember 2003 Vorwort Die Durchführung eines Projektes, das sich über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren erstreckt, ist auf die Zusammenarbeit vieler Personen angewiesen. Daher gilt unserer ausdrücklicher Dank den folgenden Einrichtungen und Personen. Für die Kooperation bei der Rekrutierung der Stichprobe danken wir Frau Prof. Dr. G. Schackert, Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Herrn Prof. Dr. H. Zwipp, Klinik und Poliklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie und Herrn Dr. M. Ragaller, Klinik und Poliklinik für Anaesthesiologie und Intensivtherapie, alle am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden. Für ihre Mitarbeit bei der Gewinnung der Stichprobe danken wir insbesondere Frau Dr. C. Bonk, Herrn Dr. S.-A. May und Herrn Dr. H. Theilen. Ferner danken wir den beteiligten Reha-Kliniken für ihre freundliche Kooperation: Frau Dr. U. Schüwer, Klinik Schloß Pulsnitz, Pulsnitz sowie Herrn Dr. Pause, Klinik Bavaria, Kreischa. Insbesondere gilt unser Dank Frau Dipl.-Psych. J. Wachsmann, Herrn Dr. H. Niemann und Herrn Dipl.-Psych. S. Kolodzie. Für die Hilfe bei der Erstellung von Untersuchungsmaterialien, der Dateneingabe und Datenauswertung danken wir den beteiligten studentischen Hilfskräften, Praktikanten und Diplomanden. Schließlich gilt unserer besonderer Dank den Patienten und ihren Partnern, die in einer schwierigen und belastenden Situation bereit waren, sich Zeit zu nehmen, um die Untersuchungsmaterialien zu bearbeiten und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Diese Erfahrungen waren in vielen Fällen sehr beeindruckend und erhellten die ganze Bandbreite von Bewältigungsmöglichkeiten. Inhaltsverzeichnis 1. Die wissenschaftliche Darstellung des Projektes.....................................................4 1.1 Zusammenfassung ................................................................................................4 1.2 Ziele und Einführung ...........................................................................................10 1.2.1 Schädelhirntrauma – Die Situation des Betroffenen .........................................13 1.2.1.1 Folgen des Schädelhirntraumas ....................................................................13 1.2.1.2 Korrelate und Prädiktoren der Adaptation nach SHT.....................................25 1.2.1.3 Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung und Adaptation nach SHT ...........34 1.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung ....................................................................46 1.2.2 Schädelhirntrauma – Die Situation der Familie.................................................50 1.2.2.1 Auswirkungen eines SHT auf einzelne Familienmitglieder ............................51 1.2.2.2 Auswirkungen eines SHT auf die Paarbeziehung..........................................58 1.2.2.3 Auswirkungen eines SHT auf das Familiensystem ........................................59 1.2.2.4 Familiäre Merkmale und Adaptation nach SHT .............................................61 1.2.2.5 Zusammenfassende Bewertung ....................................................................67 1.2.3 Zusammenfassende Bewertung des Forschungsstandes zur Rolle sozialer Faktoren im Adaptationsprozess nach SHT ..............................................................69 1.3 Fragestellung der eigenen Untersuchung............................................................73 1.4 Studiendesign......................................................................................................75 1.4.1 Erhebungsinstrumente......................................................................................77 1.4.1.1 Erfassung von Partnermerkmalen .................................................................77 1.4.1.2 Erfassung von Patientenmerkmalen ..............................................................85 1.4.2 Konstruktion des komplexen Outcome-Kriteriums............................................91 2 1.4.3 Datenmanagement und Datenanalyse .............................................................95 1.5 Durchführung der Untersuchung .........................................................................97 1.5.1 Stichprobe ......................................................................................................106 1.6 Ergebnisse.........................................................................................................119 1.6.1 Einfluss sozialer Merkmale auf das generellen Anpassungsniveaus der Patienten sechs Monate nach Verletzung ...............................................................................119 1.6.1.1 Charakterisierung der Partnerstichprobe .....................................................119 1.6.1.2 Patientenoutcome nach sechs Monaten – komplexes Kriterium zu T2........126 1.6.1.3 Interkorrelationen der Prädiktorvariablen (Angehöriger) ..............................129 1.6.1.4 Zusammenhänge zwischen Prädiktor- und Moderatorvariablen auf Seiten des Angehörigen und dem globalen Patientenoutcome .................................................132 1.6.1.5 Prädiktion des Patientenoutcomes sechs Monate nach Verletzung ............138 1.6.1.5.1 Prädiktion des komplexen Kriteriums........................................................138 1.6.1.5.2 Prädiktion der Einzelkomponenten des komplexen Kriteriums .................140 1.6.2 Einfluss sozialer Merkmale auf das generellen Anpassungsniveaus der Patienten zwölf Monate nach Verletzung.................................................................................149 1.6.2.1 Charakterisierung der Partnerstichprobe .....................................................149 1.6.2.2 Patientenoutcome nach zwölf Monaten – komplexes Kriterium zu T3.........153 1.6.2.3 Interkorrelationen der Prädiktorvariablen (Angehöriger) ..............................156 1.6.2.4 Zusammenhänge zwischen Prädiktor- und Moderatorvariablen auf Seiten der Angehörigen und dem globalen Patientenoutcome .................................................158 1.6.2.5 Prädiktion des Patientenoutcomes zwölf Monate nach Verletzung .............163 1.6.2.5.1 Prädiktion des komplexen Kriteriums........................................................163 1.6.2.5.2 Prädiktion der Einzelkomponenten des komplexen Kriteriums .................164 1.6.3 Prädiktion der Veränderung im generellen Anpassungsniveau ......................174 3 1.6.4 Prädiktion der globalen Lebensqualität (12-Monats-Katamnese) ...................178 1.6.5 Prädiktion der Aktivitätsstörung aus Partnersicht (12-Monats-Katamnese) ....182 1.6.6 Drop-out Analyse ............................................................................................186 1.7 Diskussion und Ausblick ....................................................................................187 1.8 Überlegungen und Vorbereitungen zur Umsetzung der Ergebnisse..................226 1.9 Literatur .............................................................................................................227 1.10 Publikationen während des Förderzeitraums...................................................249 1.10.1 Publikationen mit direktem Bezug zum Projekt.............................................249 1.10.1.1 Zeitschriftenartikel......................................................................................249 1.10.1.2 Abstracts in Zeitschriften ...........................................................................249 1.10.1.3 Gastherausgeberschaften in Zeitschriften .................................................250 1.10.1.4 Beiträge in Kongress- und Tagungsbänden ..............................................250 1.10.1.5 Abstracts in Kongress- und Tagungsbänden.............................................251 1.10.2 Publikationen ohne direkten Bezug zum Forschungsprojekt ........................252 1.10.2.1 Zeitschriftenartikel......................................................................................252 1.10.2.2 Herausgeberwerke ....................................................................................254 1.10.2.3 Beiträge in Herausgeberwerken ................................................................255 1.11 Anhang ............................................................................................................262 4 1. Die wissenschaftliche Darstellung des Projektes 1.1 Zusammenfassung Schädigungen des zentralen Nervensystems sind eine wesentliche Ursache für massive und dauerhafte Beeinträchtigungen von Menschen. Unter diesen Schädigungen nimmt das Schädelhirntrauma (SHT) einen bedeutsamen Platz ein. Jährlich erleiden etwa 300 000 Personen in Deutschland ein SHT. Fortschritte in der Akutmedizin haben die Letalität reduziert, was jedoch auf der anderen Seite einen höheren Bedarf an Rehabilitationsplätzen zur Folge hat. Die Rehabilitation nach SHT ist nicht nur für die Schwerstverletzten ein anstrengender Weg, auch für Menschen mit weniger schweren Verletzungen ist sie häufig mühsam und hat nicht immer zur Folge, dass das prä-morbide Funktionsniveau erreicht wird. Häufig bestehen Beeinträchtigungen in kognitiven Funktionen. Daneben weisen viele Patienten eine negative psychische Befindlichkeit auf und klagen über neurobehaviorale Symptome wie Reizbarkeit und Erschöpfbarkeit. Diese und andere Folgen, wie z.B. Persönlichkeitsveränderungen, erschweren die Rückkehr in den Beruf. Die Folgen gestalten den Umgang mit anderen Menschen schwierig, so dass Betroffene häufig eine Reduktion des sozialen Netzwerks erfahren. Für Familienmitglieder folgt nach dem initialen Schock die Frage nach den Folgen. Im Verlauf der Rehabilitation und erst recht nach deren Ende müssen sie sich mit den Auswirkungen des SHT auseinandersetzen. Da die überwiegende Mehrzahl der Patienten von der Familie versorgt wird, steht die Familie vor der Notwendigkeit, sich dem veränderten Funktionsniveau des Betroffenen anzupassen. Während die Belastungen von Familien nach SHT Gegenstand vieler Studien sind, liegen vergleichsweise wenige Untersuchungen vor, die sich mit der Frage des Einflusses familiärer Merkmale auf die Adaptation der Patienten beschäftigen. Die existierenden Studien erbrachten widersprüchliche Ergebnisse, wenngleich in vielen Arbeiten ein allzu positiver Tenor bzgl. des förderlichen Einflusses sozialer Unterstützung auf den Patientenoutcome vorherrscht. Eine genauere Kenntnis hinsichtlich des Effektes sozialer Variablen ist aber sehr wünschenswert, da Familienmitglieder die zentralen Bezugs- und Betreuungspersonen von SHT-Patienten 5 sind. Hier besteht ein Potenzial für eine Sicherung und Optimierung des Rehabilitationserfolgs. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich das Projekt C4 des RehaForschungsverbundes Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS) – "Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Schädelhirntraumatikern" – mit der Frage, ob soziale Faktoren im Längsschnitt einen prädiktiven Wert hinsichtlich des globalen Funktionsniveaus von SHT-Patienten aufweisen. Wir untersuchten, ob das in der ersten Phase nach der Verletzung gezeigte Hilfeverhalten der Partner der Patienten einen prädiktiven Wert hinsichtlich verschiedener Patientenoutcome-Maße sechs und zwölf Monate nach der Verletzung aufweist. Zusätzlich wurde überprüft, ob dieser Zusammenhang durch andere individuelle und paar- sowie familienbezogene Variablen moderiert wird bzw. ob diese Variablen einen direkten Zusammenhang mit dem Outcome aufweisen. Im Unterschied zu den vorliegenden Studien wurden zusätzlich zu bekannten Teilkonstrukten sozialer Unterstützung sowie gängigen familiären Merkmalen weitere aus unserer Sicht relevante, bisher jedoch bei Studien zur prädiktiven Rolle sozialer Faktoren bei SHT noch nicht untersuchte Konstrukte berücksichtigt. Zusätzlich untersuchten wir Korrelate der Art und des Ausmaßes der geleisteten Unterstützung sowie die psychische und somatische Befindlichkeit der Angehörigen kurz nach der Verletzung. An der Studie nahmen N = 71 Patienten mit mittelschwerem bis schwerem Schädelhirntrauma (SHT) bzw. mittelschwerer bis schwerer Subarachnoidalblutung (SAB) sowie die Partner dieser Patienten teil. Bei der 6-Monats-Katamnese konnten die Angaben von 58 Paaren berücksichtigt werden; in die 12-Monats-Katamnese gingen die Daten von 42 Paaren ein. In der Studie wurden verschiedene quantitative und qualitative Verfahren eingesetzt. Den Partnern wurden verschiedene, zum Teil neu entwickelte, Selbstbeurteilungsverfahren vorgelegt. Ferner wurden sie mit Hilfe eines Leitfadeninterviews befragt. Die Angaben im Interview wurden von Ratern anhand eines definierten Schemas eingeschätzt. Zur Erfassung von Zielen supportiven Verhaltens wurde ein Card Sorting-Verfahren entwickelt. Der Patientenoutcome wurde fast ausnahmslos mittels Selbstbeurteilungsverfahren zu kognitiven Beeinträchtigungen, psychischem und physischem Befinden, Alltagsaktivitäten und Lebensqualität erhoben. Die verschiedenen Maße wurden zu einem einzelnen komplexen Kriterium kombiniert. 6 Die Datenanalyse wurde mittels korrelativer und regressionsanalytischer Methoden durchgeführt. Zum Zeitpunkt der ersten Befragung, im Mittel 5.5 Wochen nach der Verletzung des Patienten, wiesen 50 % der Partner eine klinisch relevante Beeinträchtigung der psychischen Befindlichkeit auf. Dabei stand die Beeinträchtigung durch Angst gegenüber einer depressiven Symptomatik im Vordergrund. Trotz dieser deutlichen psychischen Beeinträchtigung konnte keine erhöhte Rate an Personen mit einer beeinträchtigten physischen Befindlichkeit eruiert werden. Die Partner nehmen den Patienen zum ersten Befragungszeitpunkt als sehr hilfsbedürftig war. Sie denken in der Mehrzahl, dass ihre Hilfe zu dem erhofften Ergebnis führen wird und glauben, dass der Patient in hohem Maße bereit ist, ihre Hilfe anzunehmen. Im Vergleich zu der sehr positiven Ergebniserwartung wird das Wissen um adäquate supportive Handlungen niedriger beurteilt. Dies weist auf einen suboptimalen Kenntnisstand bzgl. adäquaten Hilfeverhaltens auf Seiten der Angehörigen hin. Hinsichtlich des Ausmaßes der sozialen Unterstützung zeigt sich eine gewisse Divergenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung. Dies spiegelt sich auch in der signifikanten, jedoch recht moderaten Korrelation zwischen diesen beiden Merkmalen wider. Bezüglich des supportiven Verhaltens, das auf Basis der Äußerungen der Partner fremdeingeschätzt wurde, zeigt sich analog zum Ausmaß der fremdbeurteilten Unterstützung eine niedrige Korrelation mit der Selbsteinschätzung des Ausmaßes an sozialer Unterstützung durch die Partner. Inhaltlich ist anzumerken, dass die meisten supportiven Handlungen, die kurz nach der Verletzung durchgeführt wurden, dem Bereich "praktischen Hilfe" zuzuordnen sind. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen praktischem supportivem Verhalten und der Funktion supportiven Verhaltens "Einflussnahme auf den Genesungsprozess". Je bedeutsamer diese Funktion für das eigene supportive Handeln bewertet wird, desto mehr Hilfe wird geleistet. Die höchste Priorität für das eigene supportive Handeln hat jedoch das Ziel, dem Patienten Beziehungssicherheit zu vermitteln. Ein weiteres wesentliches Ergebnis im Zusammenhang mit dem konkreten supportiven Verhalten ist die große Variabilität, die sich in den Angaben der Partner widerspiegelt. So schwankt die Anzahl der genannten Gesamthandlungen zwischen 3 7 und 31. Bezüglich der Variabilität des supportiven Verhaltens zeigt sich, dass die Handlungen zwischen einer und elf der von uns definierten Kategorien supportiven Verhaltens zuzuordnen waren. Insgesamt weisen alle deskriptiven Ergebnisse zu den verschiedenen von uns erhobenen Aspekten sozialer Unterstützung auf eine hohe interindividuelle Variabilität. Es ergaben sich Zusammenhänge zwischen unterstützungsbezogenen Bewertungen und supportivem Verhalten. Ein höheres Wissen um hilfreiche Handlungen, eine stärker ausgeprägte Selbstwirksamkeit und ein wahrgenommenes hohes Ausmaß des Patienten, die Hilfe anzunehmen, standen in Zusammenhang mit einem höheren Ausmaß an von den Partnern selbsteingeschätzter sozialer Unterstützung. Ebenso bestehen positive Korrelationen zwischem positivem dyadischen Coping, abhängigem Bindungsstil, Beziehungsqualität, familiärer Kohäsion und selbstbeurteiltem Ausmaß sozialer Unterstützung. Diese Zusammenhänge konnten für das fremdbeurteilte Ausmaß sozialer Unterstützung sowie für die fremdbeurteilten supportiven Handlungen nicht repliziert werden. Stattdessen gaben Partner zum ersten Erhebungszeitpunkt umso mehr supportive Handlungen an, je mehr Angst sie erlebten und je stärker die Beeinträchtigung der funktionalen Selbständigkeit des Patienten war. Weiterhin wurde die geleistete Unterstützung umso vielseitiger gestaltet, je stärker der Patient in seiner funktionalen Selbständigkeit beeinträchtigt war. Es zeigen sich somit Hinweise auf eine "Dissoziation" zwischen kognitiv repräsentierter und geleisteter Unterstützung. Zwischen diesen beiden besteht kein linearer Zusammenhang, und kognitiv repräsentierter und tatsächlich geleisteter Unterstützung liegen unterschiedliche Determinanten zugrunde. Bezüglich der zentralen Frage der Studie, ob sich der Patientenoutcome durch Partnervariablen vorhersagen lässt, erbrachten die zunächst durchgeführten korrelativen Analysen ein konsistentes Muster für beide Katamnesezeitpunkte. Das selbstbeurteilte Ausmaß an sozialer Unterstützung weist keinen Zusammenhang mit der Adaptation des Patienten auf. Ebenso besteht kein Zusammenhang zwischen dem fremdbeurteilten Ausmaß an sozialer Unterstützung und der Patientenadaptation. Stattdessen zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem konkreten supportiven Verhalten der Angehörigen zum ersten Erhebungszeitpunkt und dem 8 Patientenoutcome, wobei diese Zusammenhänge für die 6-Monats-Katamnese deutlicher ausfielen als für die 12-Monats-Katamnese. Für die 6-Monats-Katamnese zeigten alle Subkategorien supportiven Verhaltens, bis auf die Subkategorie "supportive praktische Handlungen", eine signifikante Assoziation mit dem Patientenoutcome. In Bezug auf die 12-Monats-Katamnese ergaben sich signifikante Zusammenhänge für die supportiven emotionalen Handlungen und die Vielseitigkeit der supportiven Handlungen. Dieser Zusammenhang ist wie folgt: Je mehr supportive Verhaltensweisen die Partner kurz nach der Verletzung des Patienten zeigten, desto negativer war die Adaptation der Patienten 6 und 12 Monate nach Verletzung. Dieses Ergebnis gewinnt dadurch an Bedeutung, dass es sich hierbei um prospektive Zusammenhänge handelt, dass keine gemeinsame Methodenvarianz vorliegt – die supportiven Verhaltensweisen wurden auf Basis von Selbstauskünften der Partner im Interview fremdbeurteilt, während die Outcome-Maße durch die Patienten beurteilt wurden – und dass die Rater, die die Einschätzung der supportiven Handlungen vornahmen, blind waren gegenüber den Ergebnissen in den OutcomeMaßen. Bei der Prädiktion des Patientenoutcomes durch die Partnervariablen bestätigte sich die zentrale Rolle der fremdbeurteilten Maße supportiven Verhaltens. Sie erwiesen sich konsistent als Prädiktoren des Patienten-Outcomes. Insbesondere die Vielseitigkeit der supportiven Verhaltensweisen auf Seiten der Partner ist ein negativer Prädiktor des Patientenoutcomes. Unseres Erachtens besteht die angemessene Interpretation der Befunde unserer Studie darin, die negative Wirkung eines hohen Ausmaßes an supportiven Verhaltensweisen bzw. der Vielseitigkeit des Hilfeverhaltens als einen Ausdruck eines überfürsorglichen Verhaltens zu begreifen, das die Eigenmotivation und den Selbstwert des Patienten beeinträchtigt. Ferner ergaben sich Hinweise darauf, dass längerfristig auch prä-morbide familiäre Merkmale, hier die familiäre Kohäsion, einen Einfluss auf den Patientenoutcome haben. Wahrscheinlich können sich etablierte Interaktionsmuster, die vor der Verletzung bestanden, in ihrem Einfluss erst dann (erneut) manifestieren, wenn die direkten Verletzungsfolgen, wie z.B. Koma, Gedächtnisstörungen u.ä., sowie die Notwendigkeiten, die sich in der ersten Zeit aufgrund der Verletzung ergeben, wie z.B. 9 stationäre Rehabilitation, organisatorische Anforderungen u.ä., in ihrer Dominanz nachlassen. Auch wenn unsere Studie einigen methodischen Einschränkungen unterliegt, so lassen sich die Ergebnisse zum großen Teil schlüssig interpretieren, woraus sich Konsequenzen für die Reha-Praxis ergeben. Unseres Erachtens gehörte dazu u.a., dass • Partnern von Patienten mit SHT (und SAB) psychotherapeutische Interventionen angeboten werden sollten, die in erster Linie eine Reduktion der Angst bzw. deren angemessene Bewältigung als Ziel haben. • Partnern edukativ vermittelt werden sollte, wie sie dem Patienten adäquat Hilfe leisten können. • Partnern vermittelt werden sollte, dass sie möglichst nicht in einen Aktionismus verfallen sollten. Stattdessen sollte herausgearbeitet werden, in welchem Bereich der Patient vor allem Hilfe benötigt und wie diese adäquat zu erbringen ist. • auf die Gefahr von überfürsorglichem Verhalten aufmerksam gemacht werden sollte. 10 1.2 Ziele und Einführung Jedes Jahr erleiden in Deutschland etwa 300 000 Personen ein Schädelhirntrauma (SHT) (Kasten et al., 1997). Das SHT ist auch die häufigste Indikation für die neurologische Frührehabilitation in Deutschland (von Wedel-Parlow & Kutzner, 1999). Nach Kraus und McArthur (1996) kann die Inzidenz eines SHT in Industrienationen mit etwa 200 pro 100 000 Einwohnern angenommen werden, wobei dies eine konservative Schätzung darstellt. Von den Patienten, die lebend das Krankenhaus erreichen, haben 80 Prozent eine leichte, 10 eine mittelschwere und weitere 10 Prozent eine schwere Hirnschädigung erlitten. Weltweit stellen Verkehrsunfälle die häufigste Ursache eines SHT dar. Dementsprechend ist es nahe liegend, dass die höchste Inzidenz des SHT in der Altersgruppe bis 30 Jahre zu finden ist, da hier die höchste Verkehrsunfallhäufigkeit besteht. Ein zweiter Häufigkeitsgipfel besteht bei der Altersgruppe ab 60 Jahren, was insbesondere auf Sturzunfälle älterer Menschen zurückzuführen ist. Hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses dominieren Männer gegenüber Frauen in einem Verhältnis von 2-3 : 1. Die Mortalitätsrate beträgt sogar 3,5 : 1. Dies weist auf schwerere Verletzungen bei Männern hin (vgl. Kasten et al., 1997; Kraus & McArthur, 1996; Pickett, Ardern & Brison, 2001). Wie Eker et al. (2000) feststellen, haben Fortschritte in der Akutbehandlung des SHT dazu beigetragen, die akute Mortalität zu senken. Dies bedeutet aber auf der anderen Seite einen gestiegenen Bedarf an Rehabilitationsplätzen für schwer beeinträchtigte Menschen. Die Effektivität neurologischer Rehabilitation nach SHT war und ist Gegenstand vieler Studien. Eine kritische Betrachtung dieser Arbeiten liefert jedoch eher ernüchternde Ergebnisse. Wie ein systematischer Review (Chestnut et al., 1999) zeigt, liegt nur für eine sehr begrenzte Anzahl an Interventionen überzeugende Evidenz vor. Ein Grund hierfür ist die methodologische Schwäche vieler Arbeiten. Methodische Schwachpunkte finden sich allerdings generell bei Interventionsstudien bei SHT, also auch bei Studien aus dem Bereich der Akuttherapie (vgl. Dickinson, Bunn, Wentz, Edwards & Roberts, 2000; Harris, Colford, Good & Matz, 2002). Ein anderes Beispiel liefern Lombardi, Taricco, De Tanti, Telaro und Liberati (2002), die bei ihrem Bemühen, 11 einen systematischen Review über die Effektivität sensorischer Stimulation bei komatösen Patienten zu erstellen feststellen mussten, dass lediglich drei Studien ihren Einschlusskriterien genügten. Diese umfassten insgesamt N = 68 SHT-Patienten. Die Studien zeigten deutliche methodische Schwächen – so z.B. in den Angaben der Outcome-Maße – so dass eine quantitative meta-analytische Auswertung nicht möglich war. Chestnut et al. (1999) bemerken, dass die Ergebnisse ihres systematischen Reviews nicht gegen die Effektivität von Rehabilitationsmaßnahmen sprechen – aber halt auch nicht dafür. Daher sollten Entscheidungen für oder gegen eine Therapieoption auf klinischer Nützlichkeit und klinischem Pragmatismus beruhen. Für die generelle Wirksamkeit der Rehabilitation nach SHT spricht sich auch Cope (1995) aus, obwohl auch er anerkennt, dass viele Studien, die positive Effekte der Rehabilitation aufzeigen, Schwächen haben. Gründe für diese Schwächen sind ethische Problemen, die die Durchführung randomisierter kontrollierter Studien erschweren, und Faktoren, die direkt mit der Erkrankung zusammenhängen. So treten Schwierigkeiten bei der Rekrutierung der Patienten und bei der Bildung homogener Gruppen auf. Daneben ist die interindividuelle Variabilität der Krankheitsverläufe sehr hoch, so dass statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Effekte schwer zu erzielen sind. Nichtsdestotrotz spricht die klinische Erfahrung dafür, dass auch bei sehr schwer verletzten Patienten nach langer und intensiver Rehabilitation noch Verbesserungen zu erzielen sind (vgl. Burke et al., 2000; Gray, 2000; McMillan & Herbert, 2000; Wilson, Powell, Brock & Thwaites, 1996). Dies betont auch Wade (2002), der bemerkt, dass Rehabilitation als Ganzes wirkt und dass die fehlende Evidenz aus randomisierten Studien oder systematischen Reviews für einzelne Interventionen nicht gegen die Wirksamkeit spezifischer Interventionen bei spezifischen Patienten und den Rehabilitationsprozess als spezifische Form multiperspektivischer Problemlösung spricht. Das Ziel der Rehabilitation ist die Maximierung der Partizipation des Betroffenen am gesellschaftlichen Leben, die Minimierung seiner Beschwerden, ebenso wie die Minimierung der Belastungen und Beschwerden der Familienmitglieder und Betreuungspersonen des Patienten (Wade & de Jong, 2000). Wie Frank (1994) betont, stellt die Familie einen nicht zu unterschätzenden Faktor in der Rehabilitation dar. 12 Familienmitglieder sind eine Quelle emotionaler, praktischer und finanzieller Unterstützung. Andererseits stellt die Betreuung eines beeinträchtigten Menschen aber auch Anforderungen an Familienmitglieder, die zu Belastung und Überlastung führen können. Der Autor bemerkt, dass die Literatur voll ist mit Ratschlägen, die Familie in die Rehabilitationsbehandlung einzubeziehen, wobei dies noch zu wenig geschehe. Er stellt fest: "The emerging body of data on family systems functioning and TBI [traumatic brain injury; die Autoren] suggests effective rehabilitation in the future my be dependent on our ability to understand the dynamics of the family system" (Frank, 1994, S. 194). Auch im Rahmenkonzept des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger heißt es zu diesem Thema: "Angehörige und weitere Bezugspersonen sollten immer dann in die Behandlung einbezogen werden, wenn der Rehabilitationserfolg wesentlich auch von ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zur Mitwirkung abhängt" (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, 1996, S. 654). Die vorliegende Studie hat zum Ziel, die Rolle sozialer Merkmale für den Rehabilitationserfolg nach SHT zu untersuchen und so einen Beitrag zu leisten für die effektivere Einbeziehung und Betreuung der Familie im Rehabilitationsprozess zugunsten der Angehörigen und der Betroffenen. 13 1.2.1 Schädelhirntrauma – Die Situation des Betroffenen 1.2.1.1 Folgen des Schädelhirntraumas Ein Schädelhirntrauma (SHT) ist eine durch eine externe mechanische Krafteinwirkung herbeigeführte Schädigung des Hirngewebes. Die direkte Konsequenz einer solchen Krafteinwirkung ist eine Veränderung des Bewusstseinszustandes, d.h. in der Regel eine sehr kurze oder auch sehr lang andauernde Bewusstlosigkeit. Bei den neuropathologischen Folgen sind zwei oft kombinierte Hauptformen zu unterscheiden. Dies sind zum einen fokale kontusionelle Läsionen und intrakranielle Blutungen, zum zweiten die diffuse axonale Schädigung, die als die bedeutendste singuläre Folge einer traumatischen Hirnverletzung angesehen wird (vgl. Teasdale, 1995). Nach Kraus und McArthur (1996) kommen auf eine Person mit direktem letalen Ausgang der Verletzung 5,3 Personen, die wegen eines SHT stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die größte Gruppe der stationär behandelten Personen sind Betroffene mit einem leichten SHT. Die überwiegende Mehrzahl dieser Personen trägt keine dauerhaften gravierenden Schäden davon, wobei die verbleibende Minderheit teilweise beträchtliche Einschränkungen berichtet. Größere Einschränkungen erfährt die Gruppe der Betroffenen mit mittelschwerem und schwerem SHT. Für diese Gruppe wird im folgenden ein kurzer Überblick hinsichtlich der vielgestaltigen Folgen eines SHT geliefert, wobei Studien bei Kindern und Jugendlichen mit SHT ausgeklammert werden. Mortalität Personen, die ein schweres SHT erlitten haben, zeigen nach einer Studie von Lewin, Marshall & Roberts (1979) eine um vier bis fünf Jahre kürzere Lebenserwartung. Auch Baguley, Slewa-Younan, Lazarus und Green (2000) fanden eine gegenüber der Allgemeinbevölkerung signifikant erhöhte Mortalitätsrate bei Personen mit schwerem SHT (1,5 vs. 5,7 Prozent), wobei das Follow-up-Fenster im Durchschnitt fünf Jahre betrug. Die größere Rate an Todesfällen bei SHT-Patienten ist dabei vor allem in den 14 ersten zwölf Monaten nach der Verletzung zu beobachten. Als mögliche Ursache hierfür kommen die verschiedensten Faktoren in Frage, die weniger direkte, sondern eher indirekte Folgen des SHT darstellen. Mögliche vermittelnde Mechanismen reichen nach Ansicht der Autoren von einem niedrigen sozioökonomischen Status über psychische Störungen, eine geringere soziale Integration, Arbeitslosigkeit bis hin zu reduzierter Mobilität und Apolipoprotein E-Status (vgl. Crawford et al., 2002; Liberman, Stewart, Wesnes & Troncoso, 2002). Daneben ist auch der Suizid zu nennen. Wie Teasdale und Engberg (2001) zeigen, ist die Suizidrate bei Personen mit akuter Hirnschädigung gegenüber der Allgemeinbevölkerung signifikant erhöht. Als Grund hierfür sehen sie die negativen physischen, psychischen und sozialen Konsequenzen, die bei Personen mit schwereren Verletzungen zu beobachten sind und die bei einem Teil der Betroffenen das Gefühl der Hoffnungs- und Ausweglosigkeit bedingen (vgl. Simpson & Tate, 2002). Globaler Outcome Eine häufig benutzte Skala zur Beurteilung des globalen Outcomes nach SHT stellt die Glasgow Outcome Scale dar (Jennett & Bond, 1975). Diese umfasst die fünf Stufen "gute Erholung", "mäßige Behinderung", "schwere Behinderung", "vegetativer Zustand" und "Tod". Diese Skala kam z.B. in einer Studie von Gonser (1992) zum Einsatz. Hier zeigte sich, dass zwei bis vier Jahre nach der Verletzung 55 % der Patienten eine gute Erholung aufwiesen, 31 % waren mäßig und 12 % schwer behindert; 2 % verblieben in einem "vegetativen Status" (vgl. zu der Diskussion um diesen Begriff z.B. Giacino et al., 2002; Kallert, 1994). Hellawell, Taylor und Pentland (1999a) fanden sechs Monate nach Verletzung eine gute Erholung bei 23 % der Patienten mit schwerem und bei 49 % mit mittelschwerem SHT. Diese Rate blieb über den Zeitraum von zwei Jahren nahezu unverändert. Günstigere Ergebnisse berichten Masson et al. (1996), die fünf Jahre nach Verletzung bei 94 % der mittelschwer und 41 % der schwer Verletzten eine gute Erholung fanden. Tate, Fenelon, Manning und Hunter (1991) berichten sogar, dass sechs Jahre nach schwerem SHT 52 % eine gute Erholung aufwiesen. Von den verbliebenen wiesen 30 % eine moderate und 18 % eine schwere Behinderung auf. 15 Physische Beeinträchtigungen Die Auswirkungen eines SHT auf die Aktivitäten des täglichen Lebens untersuchten u.a. Dikmen, Machamer und Temkin (1993). In ihrer Studie bei Patienten mit schwerem SHT konnten ein Monat nach Verletzung 35 % der Patienten selbständig und ohne Einschränkungen gehen. Nach einem Jahr betrug dieser Anteil 58 % und nach zwei Jahren 67 %. Ähnliche Ergebnisse berichten Ponsford, Olver und Curran (1995) für den Zeitpunkten zwei Jahre nach Verletzung. In ihrer Stichprobe mit überwiegend mittelschwer und schwer Verletzten konnten 97 % ohne Einschränkungen gehen. Daneben waren 93 % unabhängig (mit oder ohne Hilfsmittel) bzgl. Nahrungsaufnahme, 87 % bzgl. Anziehen und 88 % in Bezug auf persönliche Hygiene. Mehr als die Hälfte der Personen konnte unabhängig öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass fünf Jahre nach Verletzung der Anteil an Personen, die selbständig Aktivitäten des täglichen Lebens durchführen konnten, noch zugenommen hatte (Olver, Ponsford & Curran, 1996). Auch Hillier, Sharpe und Metzer (1997) fanden, dass fünf Jahre nach Verletzung die Mehrzahl der Betroffenen ein hohes Maß an Selbständigkeit aufwiesen. Die größten Einschränkungen in der Mobilität gab es beim Laufen. Hier gaben 25 % an, dass sie zwar Gehen, jedoch nicht Laufen konnten. Daneben waren 16 % nicht in der Lage, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Vier Prozent waren nicht oder nur mit Unterstützung in der Lage, sich anzuziehen. Dies traf bei fünf Prozent für das Einkaufen zu und bei acht Prozent für das Kochen. Kognitive Beeinträchtigungen Levin et al. (1990) berichten, dass ein Jahr nach Verletzung die Ergebnisse der neuropsychologischen Untersuchung vor allem Auffälligkeiten in den Bereichen Gedächtnis und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung aufzeigten. Gonser (1992) berichtet, dass zwei bis vier Jahre nach Verletzung 64 % der Betroffenen über Lern- und Gedächtnisstörungen klagten, 57 % über Konzentrationsstörungen und 45 % über eine eingeschränkte Kapazität der Informationsverarbeitung. In der neuropsychologischen Untersuchung ergaben sich Auffälligkeiten vor allem in den 16 Bereichen Konzentration, verbales und visuell-figurales Lernen und Gedächtnis sowie konzeptuelles Denken. Eine hohe Rate an beeinträchtigten Personen fanden auch Tate et al. (1991). In dieser Studie zeigten etwa sechs Jahre nach Verletzung 70 % der Betroffenen eine als auffällig einzustufende Leistung in mindestens einem der untersuchten neuropsychologischen Bereiche. Dabei waren nur vergleichsweise wenige Personen auffällig in den basalen neuropsychologischen Fertigkeiten. Nur acht Prozent zeigten deutliche Beeinträchtigungen der Orientierung, und etwa genauso viele der visuellen Wahrnehmung. Dagegen wiesen 66 % Probleme im Bereich Lernen und Gedächtnis auf, und 34 % zeigten eine verlangsamte Informationsverarbeitung. Weiterhin wurde deutlich, dass nur wenige Betroffene ein generalisiertes Muster an kognitiven Beeinträchtigungen aufwiesen (11 %). Bei etwa 30 % ergaben sich Auffälligkeiten in zwei oder drei Bereichen, am häufigsten lag aber eine selektive Beeinträchtigung vor (32 %) – hier vor allem im Bereich Lernen und Gedächtnis. In einer Studie bei Betroffenen mit schwerem SHT mit langem Follow-up Zeitraum (10 bis 20 Jahre) fanden Hoofien, Gilboa, Vakil und Donovick (2001), dass die generelle intellektuelle Funktionsfähigkeit im unteren Normbereich lag. Die deutlichsten singulären Auffälligkeiten ergaben sich in den Bereichen verbales Lernen und verzögerter Gedächtnisabruf. Persönlichkeitsveränderungen Wie Tyerman & Humphrey (1984) berichten, erfahren Personen mit SHT deutliche Änderungen im Selbstkonzept. 72 % der Betroffenen in ihrer Studie gaben an, sich in Folge der Verletzung "als Person" deutlich verändert zu haben. Die Betroffenen erlebten sich u.a. besorgter, hilfloser, ungeschickter, unruhiger und abhängiger. Sie beschrieben sich allerdings positiver als ein imaginierter "typischer SHT-Betroffener" und genauso wie eine "typische Person", was als ein Mechanismus zur Erhaltung des Selbstwertes angesehen werden kann. Das Gefühl, nicht mehr dieselbe Person zu sein wie vor der Verletzung, berichteten auch Betroffene in der qualitativen Studie von Nochi (1998). Neben diesem Thema kristallisierten sich zwei weitere Aspekte eines veränderten Selbsterlebens heraus: zum einen der Verlust eines klaren Wissens über 17 sich selbst, zum zweiten einen Verlust an persönlicher Wertschätzung und Anerkennung durch Dritte ("loss of self in the eyes of others"). Auch Gonser (1992) berichtet, dass etwa zwei Drittel der Personen seiner Stichprobe angaben, ein anderer Mensch als früher zu sein, 43 % berichteten ein verändertes Antriebsverhalten und 36 % fühlten sich im sozialen Kontakt unterlegen. In der Studie von Kant, Duffy und Pivovarnik (1998) zeigten insgesamt 70 % der Betroffenen deutliche Anzeichen von Apathie, etwa 11 % ohne gleichzeitiges Vorhandensein einer relevanten depressiven Symptomatik. Santoro und Spiers (1994) konnten aufzeigen, dass Personen nach SHT deutliche Probleme in der sozialen Interaktion aufweisen. Diese ist gekennzeichnet durch eine Reduktion in der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Der resultierende egozentrierte Interaktionsstil wurde von Angehörigen als deutliche Persönlichkeitsveränderung beschrieben. Auch Bond und Godfrey (1997) konnten Defizite in der Interaktion nach SHT aufzeigen. In ihrer Studie wurde deutlich, dass die Interaktion mit einer Person mit SHT als weniger interessant, angemessen und "belohnend" erlebt wird. Zuletzt soll darauf hingewiesen werden, dass auch im Bereich der Sexualität Veränderungen auftreten können. Diese kann reduziert, gesteigert oder auch verändert sein, was von dem Betroffenen als fremd erlebt werden kann und auch für den Partner ein Problem darstellen kann. Beispielsweise gaben in der Studie von Olver et al. (1996) ein Viertel der Betroffenen Veränderungen im sexuellen Bereich an, die meisten einen Libidoverlust (vgl. Aloni & Katz, 1999). Psychische Beschwerden Psychische Beschwerden nach SHT wurden in einer Reihe von Studien untersucht. Bowen, Neumann, Connner, Tennant und Chamberlain (1998) erhoben die generelle psychische Beanspruchung. Etwa sechs Monate nach der Verletzung wurden 30 % als klinisch deutlich auffällig und weitere 8 % als leicht auffällig klassifiziert. Die meisten weiteren Studien untersuchten speziell das Ausmaß der Depressivität nach SHT. In der Untersuchung von Kersel, Marsh, Havill und Sleigh (2001) bei Patienten mit schwerem SHT wurden sechs und zwölf Monate nach Verletzung jeweils 24 % der Betroffenen als klinisch auffällig (leicht bis deutlich) klassifiziert. Corrigan, Smith-Knapp 18 und Granger (1998) führten eine Querschnittstudie durch, in der sie jedoch die Stichprobe hinsichtlich der Zeit seit Entlassung aus stationärer Rehabilitation stratifizierten (6 Monate bis 5 Jahre). Sie berichten, dass 36 % der Betroffenen eine signifikante depressive Symptomatik aufwiesen, wobei keine signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit des Follow-up-Zeitraums bestanden. Eine deutlich höhere Rate erzielten Glenn, O'Neil-Pirozzi, Goldstein, Burke und Jacob (2001), in deren Studie 59 % der Betroffenen als leicht bis schwer depressiv klassifiziert wurden. Die Personen in dieser Studie wurden im Mittel 3,5 Jahre nach Verletzung befragt; 44 % der Befragten wiesen eine mittelschwere bis schwere Verletzung auf. Ebenso berichten Douglas und Spellacy (2000) über eine hohe Rate an Depressivität bei Betroffenen mit schwerem SHT ca. sieben Jahre nach Verletzung. Hier zeigten 57 % eine auffällige Symptomatik. Kreutzer, Seel und Gourley (2001) untersuchten speziell die Prävalenz einzelner Depressionssymptome im Mittel 2,5 Jahre nach Verletzung. Das dominierende affektive Symptom war Frustriertsein, das von 85 % angegeben wurde. Daneben äußerten z.B. 22 % das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und 17 % gaben an, im Rahmen ihrer depressiven Stimmung zumindest manchmal physisch aggressiv gegenüber anderen zu reagieren. Im Bereich somatischer Symptome äußerten 75 % entweder psychomotorisch agitiert oder verlangsamt zu sein. Das häufigste Symptom im kognitiven Bereich war Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, welche von 40 % benannt wurden. Eine Studie sehr mit langem Follow-up-Zeitraum stellt die bereits erwähnte Untersuchung von Hoofien et al. (2001) dar, in der Betroffene mit schwerem SHT im Mittel 14 Jahre nach der Verletzung befragt wurden. Die Autoren berichten über den Anteil an Personen, der ein Ausmaß an psychischen Beschwerden angab, welches über dem 95. Perzentil der Nomierungsstichprobe liegt. Dabei zeigte sich, dass 28 % der Betroffenen unter einer generellen psychischen Symptomatik litten, die als klinisch relevant einzustufen war. Auf Skalenebene ergaben sich die höchsten Raten für Feindseligkeit (52 %), Depressivität (45 %) und Angst (44 %). Daneben erhoben die Autoren Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Hier zeigte sich, dass 14 % symptomatisch die Kriterien einer PTBS erfüllten. 19 Psychische Störung Neben Studien zum Ausmaß psychischer Beschwerden, die keine definitive Aussage über das Vorliegen einer psychischen Störung erlauben, liegen auch Untersuchungen vor, die anhand der Kriterien gängiger Diagnosesysteme die Prävalenz psychischer Störungen nach SHT untersuchten, wobei die meisten Arbeiten sich speziell dem Vorliegen einer Depression widmeten. Fedoroff et al. (1992) fanden einen Monat nach SHT bei 25 % der Patienten eine depressive Störung. In einer prospektiven Studie untersuchten Gomez-Hernandez, Max, Kosier, Paradiso und Robinson (1997) die Prävalenz von Major und Minor Depression (DSM-IV) nach 1, 3, 6, 9 und 12 Monaten. Die jeweiligen Prävalenzraten sind in Tabelle 1 dargestellt. Die initiale Stichprobe bestand zu über zwei Dritteln aus Patienten mit mittelschwerem um schwerem SHT. Tabelle 1: Prävalenz (%) von Major und Minor Depression (DSM-IV) im Verlauf eines Jahres nach Verletzung (in: Gomez-Hernandez et al., 1997) 1 Monat 3 Monate 6 Monate 9 Monate 12 Monate (n = 65) (n = 48) (n = 42) (n = 43) (n = 37) Major Depression 29 21 28 12 22 Minor Depression 6 15 9 21 5 Deb, Lyons, Koutzoukis, Ali und McCarthy (1999) berichten die Prävalenz verschiedener psychischer Störungen (nach ICD-10) ein Jahr nach SHT, wobei ihre Untersuchungsstichprobe (N = 164) zum größten Teil aus Personen mit einem leichten SHT (82 %) bestand. Insgesamt wiesen 18 % der Betroffenen eine ICD-10 Diagnose auf. Die häufigste Diagnose war Depressive Episode (14 %), gefolgt von Panikstörung (9 %). Diese waren auch die beiden einzigen psychischen Störungen, bei denen sich die Prävalenz innerhalb der SHT-Stichprobe von der Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung unterschied: Die Prävalenz war in der SHT-Stichprobe neun bzw. sieben Mal höher als in der Allgemeinbevölkerung. 20 In der Studie von Hibbard, Uysal, Kepler, Bogdany und Silver (1998) wurde die Prävalenz psychischer Störungen (DSM-IV) mehrere Jahre nach SHT untersucht. Bei etwa zwei Dritteln der Personen (N = 100) lag das Ereignis mehr als sechs Jahre zurück. Die Stichprobe bestand vornehmlich aus Personen mit mittelschwerer und schwerer Verletzung. Die Autoren berichten Prävalenzraten für psychische Störungen, die vor der Verletzung bestanden und für Störungen, die nach der Verletzung einsetzten sowie deren Remissionsraten. Die häufigste neu aufgetretene Störung war Major Depression, die bei 48 % der Stichprobe einsetzte und an der zum Zeitpunkt der Studie 38 % noch litten. Die zweithäufigste neu aufgetretene psychische Störung war Depression und Angst gemischt (25 %), gefolgt von Posttraumatische Belastungsstörung (17 %) und Zwangsstörung (14 %). Die höchste Remissionsrate zeigte sich bei Panikstörung (64 %), die niedrigste bei Dysthymie und Generalisierte Angststörung (jeweils 0 %), wobei diese beiden Störungen nur in seltenen Fällen neu aufgetreten waren (2 bzw. 8 %). In der Arbeit von Hibbard et al. (2002) wird die Prävalenz von Achse II-Störungen in dieser Stichprobe berichtet. Von den 100 Personen wiesen 76 keine Persönlichkeitsstörung vor dem SHT auf. 55 % dieser 76 Betroffenen entwickelten eine Achse II-Störung nach der Verletzung, wobei die Mehrzahl die Kriterien für zwei oder mehr Persönlichkeitsstörungen erfüllte. Die häufigste Diagnose war Borderlinestörung (28 %), gefolgt von selbstunsichere (26 %) und zwanghafte (24 %) Persönlichkeitsstörung. In einer Studie von van Reekum, Bolago, Finlayson, Garner und Links (1996), die Betroffene im Durchschnitt ca. fünf Jahre nach SHT befragten, wiesen 39 % eine Persönlichkeitsstörung auf, wobei hier keine Unterscheidung zwischen vor Verletzung bestehenden und neu aufgetretenen Störungen getroffen wurde. Alle Personen mit Achse II-Störung wiesen gleichzeitig Achse I-Störungen auf (vgl. auch Supprian, Müller, Hofmann & Becker, 1996). Neurobehaviorale Symptome Unter dem Begriff "neurobehaviorale Symptome" werden kognitive, psychische und physische Beeinträchtigungen sowie Veränderungen im Erleben und Verhalten 21 nach SHT subsummiert. Es handelt sich somit um eine Zusammenfassung vieler in den voran stehenden Abschnitten angeführter Symptome, die den Betroffenen als subjektive Beschwerdenliste präsentiert werden, wobei aber auch als Fremdrating konzipierte Verfahren existieren (z.B. Levin et al., 1987). Beispielsweise gaben in einer Untersuchung von van Zomeren und van den Burg (1985) bei Betroffenen mit schwerem SHT zwei Jahre nach Verletzung 54 % an, unter Vergesslichkeit zu leiden, 39 % berichteten Reizbarkeit und 16 % Gleichgültigkeit, welches das seltenste Symptom darstellte. In der Studie von Deb, Lyons und Koutzoukis (1999), deren Stichprobe zu drei Vierteln aus Patienten mit leichtem SHT bestand, gaben ein Jahr nach der Verletzung 17 % deutliche Schlafprobleme an, welches das am häufigsten als deutliches Problem eingeschätzte Symptom darstellte. Danach folgten Ungeduld, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen, die von je 14 % als ein deutliches Problem erlebt wurden. Dikmen, Machamer und Temkin (1993) untersuchten neurobehaviorale Symptome in einer zweijährigen Längsschnittstudie. Einen Monat nach Verletzung war das am häufigsten angegebene Symptom Erschöpfbarkeit (fatigue), welches von 62 % der Betroffenen genannt wurde; dem folgten Gedächtnisprobleme (56 %), Schwindel und Konzentrationsschwierigkeiten (je 50 %). Ein und zwei Jahre nach Verletzung stellten Gedächtnisprobleme und Reizbarkeit die am häufigsten genannten Beschwerden dar (1 Jahr: 52 bzw. 45 %; 2 Jahre: 61 bzw. 50 %). Weiterhin konnten LaChapelle und Finlayson (1998) zeigen, dass die Erschöpfbarkeit von SHT-Patienten signifikant stärker ausgeprägt ist als bei einer gesunden Kontrollgruppe. Soziale Funktionsfähigkeit Die bisherigen Ausführungen haben verdeutlicht, dass bei einem nicht unerheblichen Teil der Betroffenen physische und kognitive Beeinträchtigungen auch lange Zeit nach der Verletzung noch vorliegen. Weiterhin äußert ein großer Teil subjektive Beschwerden, und viele Betroffene zeigen deutliche Veränderungen im Erleben und Verhalten, die sich zum Teil als psychische Störung manifestieren. Es ist offensichtlich, dass die Auswirkungen eines SHT die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die soziale Funktionsfähigkeit in beträchtlichem Maße 22 einschränken können. Beispielsweise gaben in der Studie von Ponsford et al. (1995) zwei Jahre nach Verletzung nur 10 % der Betroffenen an, dass sie unabhängig ihren Freizeitaktivitäten nachgingen; etwa die Hälfte konnte unabhängig anderen Freizeitaktivitäten nachgehen, die sie nach der Verletzung neu entwickelt hatten. Nach fünf Jahren konnte etwa ein Viertel unabhängig früheren Freizeitaktivitäten nachgehen, und etwa zwei Drittel gaben an, neue Aktivitäten entwickelt zu haben (Olver et al., 1996). In einer Studie von Lehmann et al. (1997) bei Patienten mit schwerem SHT gaben etwa sechs Jahre nach Verletzung 36 % eine Veränderung der Urlaubsgewohnheiten, 43 % eine Abnahme der Hobbies und 68 % eine Abnahme sportlicher Aktivitäten an. Hallett, Zasler, Maurer und Cash (1994) berichten, dass alle Teilnehmer ihrer Studie mindestens einen Rollenverlust angaben, etwa zwei Drittel gaben den Verlust von drei oder vier Rollenfunktionen an. Am häufigsten wurde der Verlust des Arbeitsplatzes berichtet, gefolgt von dem Verlust von Hobbys und dem Verlust der Rolle eines Freundes. 46 % berichteten, eine Rolle neu gewonnen zu haben – am häufigsten die Rolle des "home maintainer". Da die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ein Hauptziel der Rehabilitation darstellt, ist es nicht verwunderlich, dass eine Reihe von Studien dieses Outcome-Maß näher untersucht hat. Sander, Kreutzer, Rosenthal, Delmonico und Young (1996) analysierten in einer querschnittlichen Analyse eine in Bezug auf die Zeit seit Verletzung stratifizierte Stichprobe. Dabei zeigte sich, dass vor der Verletzung 51 % der Stichprobe im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt waren. Ein Jahr nach der Verletzung waren dies 23 %, nach zwei Jahren betrug der Anteil 17 % und nach drei 25 %. Für eine Subgruppe der Stichprobe lagen tatsächliche längsschnittliche Daten vor. Hier betrugen die Raten für die entsprechenden Zeitpunkte nach Verletzung 38 %, 24 % und 38 %. Drei Viertel der Personen, die ein Jahr nach Verletzung beschäftigt waren, waren dies auch drei Jahre nach SHT. Brooks, McKinlay, Symington, Beattie und Campsie (1987) berichten eine Abnahme in der Berufstätigkeit von 89 % der Stichprobe vor der Verletzung zu 29 % zwei bis mehr als sechs Jahre nach Verletzung. In einer deutschen Studie von Pössl, Jürgensmeyer, Karlbauer, Wenz und Goldenberg (2001) zeigte sich, dass 37 % sieben bis acht Jahre nach Verletzung einer beruflichen Tätigkeit auf dem 23 Niveau vor SHT nachgingen, 28 % wurden im Verlauf von zwei Jahren nach SHT berentet. Aufgrund der hier bisher angeführten Ergebnisse ist es nicht erstaunlich, dass ein Großteil der Betroffenen eine Reduktion des sozialen Netzwerks erlebt. So gaben in der Untersuchung von Finset, Dyrnes, Krogstad und Berstad (1995) 57 % der Betroffenen an, dass sich ihr soziales Netz deutlich reduziert habe. Hackl et al. (1986) fanden, dass 21 % eine Abnahme der Anzahl an Freunden berichteten, gegenüber 13 %, die eine Zunahme angaben. 20 % gaben an, dass sich das Verhältnis zu den Freunden verschlechtert habe, gegenüber 11 %, die eine Verbesserung berichteten. In einer Untersuchung von Annoni, Beer und Kesselring (1991) äußerten drei Jahre nach Verletzung etwa die Hälfte der Personen, dass sich ihr Sozialleben deutlich verschlechtert habe, und ein Fünftel hatte seit dem Ereignis kaum noch soziale Kontakte. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass die Familie zur zentralen Quelle sozialer Interaktion des Betroffenen wird. So äußerten 41 % in der Studie von Hackl et al. (1986), dass die Bindung an die Familie enger geworden sei, und z.B. Zencius und Wesolowski (1999) fanden, dass das soziale Netz von SHT-Patienten in erster Linie aus Familienmitgliedern besteht. In der Studie von Hoofien et al. (2001) gaben 31 % an, keine Freunde außerhalb der Familie zu haben, und 8 % gaben an, überhaupt keine signifikante Beziehungsperson zu haben. Allerdings zeigen Studien, dass auch die familiäre Situation Veränderungen unterliegt, was mit den Belastungen der Familienmitglieder in der Betreuung von SHT-Patienten in Verbindung gebracht wird. Beispielsweise fanden Wood und Yurdakul (1997), dass im Mittel acht Jahre nach Verletzung 49 % der Partner sich von dem Betroffenen haben scheiden lassen oder sich getrennt hatten. Es zeigte sich, dass eine Trennung am seltensten während der ersten zwei Jahre nach Verletzung auftrat und am häufigsten fünf bis sechs Jahre nach SHT. Kersel et al. (2001) fanden, dass nach schwerem SHT im Verlauf eines Jahres bei 38 % der Betroffenen eine Beendigung der Partnerschaft stattfand, wobei nahezu alle Trennungen in dem Zeitraum 6 Monate bis 1 Jahr nach Verletzung auftraten. 24 Lebenszufriedenheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität In den letzten Jahren wird die Lebensqualität zunehmend als wichtiges Maß des Rehabilitationserfolges angesehen. Dieser Parameter umfasst verschiedene Dimensionen, z.B. die Zufriedenheit mit dem physischen und psychischen Befinden, den sozialen Beziehungen und der persönlichen Leistungsfähigkeit. Damit stellt dieses Maß einen integrativen Indikator dar, der viele der oben angeführten Bereiche beinhaltet. Daneben existieren auch Studien, die eindimensional die globale Lebenszufriedenheit z.B. mittels nur eines Items erfassen, und auch Arbeiten, die speziell die gesundheitsbezogene Lebensqualität i.S. des subjektiven Gesundheitszustandes betrachten. Im Bereich SHT liegen einige Studien zu allen diesen Konzeptualisierungen vor. Beispielsweise fanden Galski, Tompkins und Johnston (1998) eine im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe reduzierte Lebensqualität bei SHT-Patienten im Mittel ca. ein Jahr nach Verletzung. In einer Längsschnittstudie fanden Corrigan, Bogner, Mysiw, Clinchot und Fugate (2001) nur sehr geringe Veränderungen in der allgemeinen Lebenszufriedenheit zwischen den Zeitpunkten ein und zwei Jahre nach Verletzung. In der Untersuchung von Heinemann und Whiteneck (1995), die mittels eines Items die allgemeine Lebensqualität bei Betroffenen ca. fünf Jahre nach Verletzung erhoben, äußerten 10 % hervorragend, 20 % meistens zufrieden, 35 % unentschieden, 6 % unzufrieden und 4 % äußerst unzufrieden. Koskinen (1998) untersuchte die Lebenszufriedenheit zehn Jahre nach schwerem SHT. Hier gaben 73 % an, im allgemeinen zumindest ziemlich zufrieden und 13 % sehr unzufrieden zu sein. Die beiden am positivsten beurteilten Bereiche waren Selbstversorgung und Familienleben, am unzufriedensten waren die Betroffenen mit den Bereichen Freunde, Sexualität und Freizeit. Neben diesen Studien existiert eine Arbeit, in der ein Instrument genutzt wurde, dass speziell für den Einsatz bei behinderten Menschen entwickelt wurde und auch positive Dimensionen, die sich auf psychisches Wachstum und Selbstaktualisierung beziehen, beinhaltet (Collins, Lanham & Sigford, 2000). Auch das Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, das gegenwärtig am weitesten verbreitet ist – der SF-36 (Bullinger & Krichberger, 1998) – kam bei SHT-Patienten zum Einsatz (vgl. Corrigan et al., 1995; Fann, Katon, Uomoto & Esselman, 1995; Findler, 25 Cantor, Haddad, Gordon & Ashman, 2001; Steadman-Pare, Colantonio, Ratcliff, Chase & Vernich, 2001; Wilson, Pettigrew & Teasdale, 2000). Wie zu erwarten, geben Personen mit SHT einen signifikant schlechteren subjektiven Gesundheitszustand im SF-36 an als Personen ohne Behinderung (Findler et al., 2001). 1.2.1.2 Korrelate und Prädiktoren der Adaptation nach SHT Die voran stehenden Ausführungen verdeutlichen, dass ein SHT massive Auswirkungen auf Befinden und Lebensführung der Betroffenen haben kann. Dabei ist die deskripte Erfassung der Adaptation von SHT-Patienten selbstverständlich nur der erste Schritt. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, welche Faktoren mit verschiedenen Kriterien der Adaptation in Zusammenhang stehen und welche Merkmale einen prognostischen Wert in Bezug auf den Outcome haben. Entsprechende Kenntnisse sind notwendig für die frühest mögliche Prognose, die konkrete Rehabilitation und die bedarfsgerechte Versorgung der Betroffenen. Dabei ist es nahe liegend, dass sich in Abhängigkeit der betrachteten Outcome-Maße unterschiedliche Merkmale als prognostisch relevant erweisen. Wie Zasler (1997) bemerkt, ist bei dem aktuellen Erkenntnisstand die Prognose eines guten bzw. schlechten Outcomes leichter zu treffen als die Vorhersage eines "mittleren". Ferner sind frühe Prognosen ungenauer als spätere. Schließlich gilt es auch im Bewusstsein zu haben, dass eine perfekte Vorhersage aufgrund der vielen biologischen und psychosozialen Einflussfaktoren, welche die Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen beeinflussen, nicht möglich ist. Angesichts der Verschiedenheit der möglichen Adaptationskriterien, die oben dargestellt wurden, kann auch nicht erwartet werden, ein konsistentes Prädiktormuster für die Mehrzahl der Kriterien zu finden. Wie Oder, Goldenberg und Deecke (1991) bemerken, können prognostische Faktoren für die Rehabilitation – und auch Adaptation – nach SHT in unmittelbar wirksame, d.h. unfallbezogene Faktoren, und mittelbar wirksame, d.h. personenbezogene Faktoren, eingeteilt werden. Zu den unmittelbar wirksamen sind zu zählen: • Typ der traumatisch bedingten Hirnschädigung 26 • sekundär-traumatische Hirnschäden • klinisch-neurologische Parameter des Akutstadiums (z.B. Tiefe und Dauer der Bewusstlosigkeit, Schweregrad der Verletzung) • sekundäre hypoxische Hirnschädigungen • Zeit nach traumatischer Hirnschädigung • Ergebnisse apparativer Untersuchungen Als mittelbar wirksame Faktoren können angesehen werden: • Alter • Prämorbide Persönlichkeitsfaktoren • Einstellung des Betroffenen zur Rehabilitation (wenn es um den konkreten Erfolg der akuten oder auch post-akuten Rehabilitation geht) • psychosoziale Faktoren (z.B. prämorbide soziale Kontakte, bestehendes Arbeitsverhältnis, unterstützendes soziales Netz) • zerebrale Vorschädigung (früherer Unfall oder Erkrankung) Hinsichtlich der unmittelbaren, unfallbezogenen Faktoren gilt, dass diese meist als prognostische Faktoren für globale Outcome-Maße herangezogen werden. Im Folgenden wird näher auf die Bedeutung des Schweregrades eines SHT eingegangen. Beispielsweise konnten Signorini, Andrews, Jones, Wardlaw und Miller (1999a) aufzeigen, dass der Glasgow Coma Scale-Score (GCS) (Teasdale & Jennett, 1974), der ein Maß für die Tiefe der Bewusstlosigkeit darstellt und zur Einteilung der Schwere eines SHT genutzt wird, der Injury Severity Score (ISS) (Baker, O'Neill, Haddon & Long, 1974), der ein Indikator für die Schwere des polytraumatischen Verletzungsmusters darstellt, die Pupillenreaktivität und das Vorhandensein von Hämatomen unabhängige signifikante Prädiktoren der Mortalität ein Jahr nach SHT darstellten. Ferner konnten sie die negative Wirkung sekundärer Insulte auf das Überleben ein Jahr nach Verletzung aufzeigen (Signorini, Andrews, Jones, Wardlaw & Miller, 1999b). Der GCS-Score als Indikator der Schwere eines SHT ist eines der am häufigsten betrachteten prognostischen Merkmale. Allerdings weist Zasler (1997) darauf hin, dass schon bei diesem groben Maß unterschiedliche Zusammenhänge auftreten, je nach dem ob der 27 beste oder schlechteste Prä-Beatmungsscore oder der beste oder schlechteste PostBeatmungsscore genutzt wird. Beispielsweise fanden Zafonte et al. (1996) nur moderate Zusammenhänge zwischen dem initialen und niedrigsten 24-Stunden-GCS-Score und funktionaler Selbständigkeit nach stationärer Rehabilitation. Auch van der Naalt, van Zomeren, Sluiter und Minderhoud (1999) fanden, dass der GCS-Score bei Einlieferung keinen Zusammenhang mit globalem Outcome ein Jahr nach Verletzung aufwies. Dagegen erwies sich die Dauer der posttraumatischen Amnesie (PTA), die als ein weiteres Maß für die Schwere eines SHT herangezogen werden kann, als signifikanter Prädiktor. Hingegen unterschieden sich Patienten mit mittelschwerem SHT von solchen mit schweren – klassifiziert nach GCS bei Einlieferung – 6, 12 und 24 Monate nach Verletzung im globalen Outcome und neuropsychologischen Beeinträchtigungen in der Studie von Hellawell et al. (1999a). Levin et al. (1990) fanden, dass der niedrigste PostBeatmungs-GCS-Score einen signifikanten Prädiktor des globalen und neuropsychologischen Outcomes ein Jahr nach SHT darstellte. Eine schlechtere Performanz in neuropsychologischen Testverfahren bei Betroffenen mit schwerem im Vergleich zu Personen mit mittelschwerem bis leichtem SHT fanden auch Novack, Alderson, Bush, Meythaler und Canupp (2000) 6 und 12 Monate nach Verletzung (vgl. auch Asikainen, Kaste & Sarna, 1998). Angesichts der Tatsache, dass bereits bei der Betrachtung relativ globaler Outcome-Maße nur begrenzte Zusammenhänge mit dem Schweregrad der Verletzung zu verzeichnen sind, ist es nicht erstaunlich, dass auch nur begrenzt Zusammenhänge der Schwere eines SHT mit konkreteren psychosozialen Kriterien zu verzeichnen sind. Dikmen et al. (1994) konnten zeigen, dass der GCS-Score bei Aufnahme einen signifikanten Prädiktor der Berufstätigkeit ein bis zwei Jahre nach SHT darstellt. Sander et al. (1996) fanden, dass Personen mit längeren Aufenthalten im Akut-Krankenhaus – was als ein grober Indikator der Verletzungsschwere angesehen werden kann – eine niedrigere Wahrscheinlichkeit hatten, in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren. In der Studie von Fann et al. (1995) unterschied sich die Gruppe der Patienten mit depressiver/Angststörung und die Gruppe ohne psychische Störung nicht in der Schwere der Verletzung. In der Untersuchung von Simpson und Tate (2002) wies die Schwere der Verletzung keinen prädiktiven Wert in Bezug auf Suizidalität nach SHT auf. In der Studie von Hibbard et al. (1998) zeigte sich lediglich für die Komorbidität von 28 Depression und Angststörung nach SHT ein Zusammenhang mit der Schwere der Verletzung, hier erfasst über die selbstberichtete Dauer der Bewusstlosigkeit. Ebenso berichten van Reekum et al. (1996) einen Zusammenhang zwischen Schweregrad und Angststörung. Hingegen zeigte sich kein Zusammenhang zwischen diesem Maß des Schweregrades und dem Vorhandensein von Achse-II-Störungen nach SHT (Hibbard et al., 2000; van Reekum, 1996). Hinsichtlich Depression nach SHT fanden GomezHernandez et al. (1997) keinen Unterschied im Schweregrad der Verletzung. Bei Studien, die nicht auf der Ebene psychischer Störungen, sondern auf der Ebene von Symptomen angesiedelt sind, zeigten sich divergierende Ergebnisse. In der Untersuchung von Bowen et al. (1998) zeigten sich keine Zusammenhänge zwischen Schweregrad und Depressivität, während Glenn et al. (2001) eine höhere Depressivität bei leichtem SHT fanden. Allerdings unterscheiden sich diese Studien deutlich in Bezug auf den Zeitpunkt nach SHT. Hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität fanden Findler et al. (2001) einen schlechteren Status bei Personen mit leichtem im Vergleich zu Personen mit mittelschwerem und schwerem SHT. Dieser Unterschied war jedoch nicht mehr signifikant, sobald das Ausmaß der Depressivität statistisch kontrolliert wurde. Wie Dikmen, Ross, Machamer und Temkin (1995) zusammenfassend feststellen, zeigt der Schweregrad einer Verletzung stärkere Zusammenhänge zwischen eher objektiven Indikatoren psychosozialen Outcomes (wie z.B. Berufstätigkeit) als zu subjektiven, selbstbeurteilten psychosozialen Einschränkungen. Hinsichtlich klinisch-behavioraler Manifestationen des SHT konnten van der Naalt, van Zomeren, Sluiter und Minderhoud (2000) zeigen, dass Patienten, die Unruhe und Agitiertheit während des Akutaufenthaltes zeigten, einen schlechteren globalen Outcome ein Jahr nach Verletzung aufwiesen. Fedoroff et al. (1992) fanden Zusammenhänge zwischen Lokalisation der Hirnschädigung und Major Depression. Über die Bedeutung der Ergebnisse apparativer Untersuchungen berichten z.B. Steinmeier, Bonk, May und Reiss (2001). Bezüglich der Zeit seit Verletzung zeigte sich in verschiedenen Untersuchung kein Zusammenhang zwischen diesem Maß und psychischen Störungen (Fann et al., 1995; Hibbard et al., 1998; 2000). Landsman et al. (1990) berichten ebenfalls nichtsignifikante Zusammenhänge zwischen Zeit seit 29 Verletzung, die in ihrer Studie zwischen 3 und 39 Monaten nach SHT betrug, und dem Ausmaß psychischer Beschwerden. Dagegen bestand ein Zusammenhang zwischen der Zeit seit SHT und Problemen bzgl. Berufstätigkeit. Ebenso konnten Wood und Yurdakul (1997) die Bedeutung der Zeit seit Verletzung aufzeigen: Mit zunehmender Zeit seit Verletzung erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass die bestehende Partnerschaft aufgelöst wird. Betrachtet man die mittelbar wirksamen, personenbezogenen Faktoren, so kann man eine weitere Unterteilung in soziodemographische, prämorbide und postmorbide Merkmale treffen. Unter den möglichen demographischen Merkmalen ist der Einfluss des Geschlechts bislang vergleichsweise wenig untersucht worden. Wie Groswasser, Cohen und Keren (1998) bemerken, dürfte ein Grund hierfür sein, dass etwa drei Mal so viele Männer wie Frauen unter den SHT-Patienten sind. Da Männer zudem eher schwerere Verletzungen erleiden als Frauen (Kraus & McArthur, 1996) gilt es zudem bei entsprechenden Untersuchungen, diese Konfundierung zu kontrollieren. In der Studie von Groswasser et al. (1998) unterschieden sich männliche und weibliche Patienten weder im Alter noch im Schweregrad der Verletzung. Die Autoren untersuchten die Rolle des Geschlechts für ein spezifisches Outcome-Maß, die Fähigkeit zur Erwerbstätigkeit (bzw. Wiederaufnahme des Schulbesuchs), die am Ende der stationären Rehabilitation eingeschätzt wurde. Sie fanden einen signifikant besseren Outcome bei weiblichen Patienten. Als eine mögliche Ursache hierfür diskutieren sie den protektiven Effekt des Progesterons. Betrachtet man andere Adaptationskriterien, ergeben sich jedoch auch andere Ergebnisse. Beispielsweise zeigen verschiedene Studien, dass Geschlecht kein entscheidender Faktor für das Auftreten von psychischen Störungen nach SHT ist (Deb et al., 1999; Fann et al., 1995; Fedoroff et al., 1992; Gomez-Hernandez et al., 1997; Hibbard et al., 1998). Allerdings fanden Hibbard et al. (2000), dass mehr Männer als Frauen nach SHT eine narzisstische bzw. eine antisoziale Persönlichkeitsstörung aufwiesen, wobei letztere bereits vor SHT häufiger bei Männern vorlag; und Hibbard et al. (1998) berichten, dass mehr Frauen als Männer eine Angststörung nach SHT entwickelten. Hinsichtlich des Ausmaßes depressiver Symptome bzw. allgemeiner psychischer Belastung zeigte sich kein Zusammenhang mit 30 dem Geschlecht in der Untersuchungen von Bowen et al. (1998) und Landsman et al. (1990), während weibliches Geschlecht in der Untersuchung von Glenn et al. (2001) einen Prädiktor der Depressivität darstellte. Dieser Zusammenhang war jedoch nur signifikant, wenn das gesamte Spektrum depressiver Symptomatik betrachtet wurde. Wenn die Analysen nur bei Personen mit mittelschwerer bis schwerer depressiver Symptomatik durchgeführten wurden, hatte das Geschlecht keinen Einfluss. Hinsichtlich des Alters fanden die meisten Studien keinen Zusammenhang mit psychischer Erkrankung bzw. depressiver Symptomatik (Bowen et al., 1998; Fann et al., 1995; Fedoroff et al., 1992; Gomez-Hernandez et al., 1997; Hibbard et al., 1998; 2000; Landsman et al., 1990), wohingegen Glenn et al. (2001) einen quadratischen (parabolischen) Zusammenhang zwischen Alter und Depressivität fanden. Einen deutlichen Einfluss übt das Alter jedoch auf die Erwerbstätigkeit nach SHT aus. In der Untersuchung von Lehmann et al. (1997) kehrten von den unter 30-jährigen etwa die Hälfte in den früheren Beruf zurück, und zwei Prozent waren zum Zeitpunkt der Befragung berentet. Dagegen nahmen von den über 30-jährigen 37 % ihre vorherige Beschäftigung wieder auf, und 13 % bezogen eine Rente (vgl. Dikmen et al., 1994). Wie Goleburn und Golden (2001) in einem Review feststellen, zeigen ältere Patienten ein höheres Risiko eines negativen Outcomes im Vergleich zu jüngeren Patienten mit derselben Schwere der Verletzung. Ältere Patienten haben eine höhere Mortalitätsrate, eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, in ihre alte Wohnsituation zurückzukehren – viele werden direkt im Anschluss an die Rehabilitation oder in den Monaten und Jahren nach Verletzung in einem Heim untergebracht – und sie weisen ein höheres Risiko eines deutlicheren Abbaus der intellektuellen Fähigkeiten auf. Allerdings weisen die Autoren auch darauf hin, dass viele der von ihnen untersuchten Studien methodische und konzeptuelle Schwächen aufweisen und dieses Thema somit noch eindringlicher zu untersuchen ist. Bezüglich prämorbider Faktoren zeigt sich z.B., dass Personen, die vor der Verletzung dauerhaft beschäftigt waren, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch nach SHT wieder einer Arbeit nachzugehen (Dikmen et al., 1994). Bowen et al. (1998) fanden, dass Erwerbslosigkeit vor SHT einen signifikanten Prädiktor genereller psychischer Belastung sechs Monate nach der Verletzung darstellte. 31 Malia, Powell und Persönlichkeitsmerkmalen Tordoe (Sinn (1995) für untersuchten Humor, die Bedeutung Optimismus, von Gelassenheit, Kontrollüberzeugung) für die Adaptation nach SHT, die von den Betroffenen retrospektiv für die Zeit vor der Verletzung eingeschätzt wurden. Zwar zeigte sich eine signifikante Korrelation mit dem Ausmaß an Gelassenheit vor der Verletzung, allerdings wies dieses Merkmal in der Regressionsanalyse nur einen sehr begrenzten prädiktiven Wert auf. Ein prämorbider Faktor, der übereinstimmend einen negativen Einfluss auf die Adaptation ausübt, ist prämorbide Alkoholabhängigkeit. Wie Hibbard et al. (1998) aufwiesen, liegt diese häufiger bei Männern vor (vgl. Bombardier, 2000; Brooks et al., 1989). Hinsichtlich der Rolle prämorbider psychischer Störungen fanden Fedoroff et al. (1992) eine höhere Rate an Major Depression unter Betroffenen mit bekannter psychischer Störung vor der Verletzung, allerdings verschwand dieser Unterschied, wenn Personen mit Substanzmissbrauch aus der Analyse ausgeschlossen wurden. Auch GomezHernandez et al. (1997) fanden keinen Zusammenhang zwischen psychischer Störung in der Vorgeschichte und psychischer Störung nach SHT, wohingegen Deb et al. (1999) über einen signifikanten Zusammenhang berichten. Dagegen berichten Hibbard et al. (1998) eine höhere Rate an Neuerkrankungen an Major Depression nach SHT unter den Betroffenen, die vor der Verletzung keine Achse-I-Störung aufwiesen. In Bezug auf postmorbide Merkmale liegt eine sehr große Anzahl an Studie vor. Bei diesem Komplex geht es um das gegenseitige "Zusammenspiel" verschiedener Parameter. So kann ein bestimmter Parameter, der in einer Studie als Outcome diente, in anderen Studien als Prädiktor für weitere Adaptationsmerkmale gelten. Beispielsweise fanden Landsman et al. (1990), dass Personen, die nach SHT Probleme im Bereich Berufstätigkeit aufwiesen, eine negativere psychische Befindlichkeit angaben (siehe auch Hoofien et al., 2001). Ebenso berichteten Personen, die subjektiv eine stärkere Auswirkung des SHT wahrnahmen, ein negativeres psychisches Befinden. Kreuter, Dahllöf, Gudjonsson, Sullivan und Siösteen (1998) berichten, dass ein guter physischer Gesundheitszustand einen signifikanten Prädiktor der Zufriedenheit mit dem Sexualleben darstellte. McCleary et al. (1998) fanden, dass Personen mit einem guten globalen Outcome (GOS) auch in einem geringeren Maße depressive Symptome angaben. Hoofien et al. (2001) fanden, dass Probleme im sozialen Bereich der 32 Aktivitäten des täglichen Lebens in Zusammenhang standen mit einer schlechteren psychischen Befindlichkeit. Jorge, Robinson, Starkstein und Arndt (1994) wiederum konnten zeigen, dass das Vorliegen einer Major Depression einen signifikanten Prädiktor des psychosozialen Outcomes nach einem Jahr darstellte. Van Zomeren und van den Burg (1985) konnten einen Zusammenhang zwischen neurobehavioralen Symptomen und Wiederaufnahme der Berufstätigkeit aufzeigen. In der Studie von Vilkki et al. (1994) erwiesen sich neuropsychologische Maße als Prädiktoren des psychosozialen Funktionsniveaus (Berufstätigkeit und soziale Aktivitäten), und in der Untersuchung von Skell, Johnstone, Schopp, Shaw und Petroski (2000) als Prädiktoren der psychischen Befindlichkeit. Corrigan et al. (1998) untersuchten den prädiktiven Wert demographischer und verletzungsbezogener Daten, wozu neben der Schwere der Verletzung u.a. auch die funktionale Selbständigkeit bei Aufnahme und Entlassung aus der Rehabilitation gezählt wurde. Dabei zeigte sich, dass die spätere funktionale Selbständigkeit gut vorhergesagt werden konnte, die soziale Funktionsfähigkeit konnte begrenzt vorhergesagt werden, während nur eine minimale Varianzaufklärung bei der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, der Lebenszufriedenheit und dem psychischen Befinden mit den betrachteten Prädiktorvariablen erzielt werden konnte. Auch in der Längsschnittstudie von Corrigan et al. (2001) konnte nur eine vergleichsweise geringe Varianzaufklärung in Bezug auf Lebenszufriedenheit ein und zwei Jahre nach SHT erzielt werden. Für beide Zeitpunkte stellten sich eine fehlender Substanzmissbrauch vor SHT und Berufstätigkeit zum Zeitpunkt der Befragung als Prädiktoren heraus. Ein Jahr nach SHT war zudem die funktionale Selbständigkeit zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Rehabilitation ein signifikanter Prädiktor; zwei Jahre nach SHT zusätzlich soziale Integration und die Abwesenheit depressiver Stimmung. Steadman-Pare et al. (2001) untersuchten die Lebensqualität bei Betroffenen zwischen 8 und 24 Jahren (M = 14) nach SHT. Das Regressionsmodell erbrachte eine vergleichsweise hohe Varianzaufklärung von 55 %. Dabei steuerte alleine die subjektive psychische Gesundheit (SF-36-Skala) einen Beitrag von 43 % bei, gefolgt von dem subjektiven allgemeinen Gesundheitszustand mit 5 %. Die weiteren signifikanten Variablen waren u.a. Geschlecht – Frauen gaben eine höhere Lebensqualität an – und Arbeitsfähigkeit, wobei die Varianzanteile weniger als 5 33 % beitrugen. Der Schweregrad der Verletzung hatte keinen Einfluss auf die Lebensqualität. Wie diese Studien zeigen, reicht es nicht aus, lediglich die Bedeutung pathophysiologischer Mechanismen für die Adaptation nach SHT zu untersuchen. Dies meinen auch Martelli, Zasler und MacMillan (1998). Sie betonen die Notwendigkeit eines biopsychosozialen Modells, wonach Vulnerabilitätsfaktoren, Stress und Bewältigung eine wesentliche Rolle für das Outcome nach SHT spielen. Dieses Modell postuliert, dass die multiplen Folgen eines SHT – sowohl singulär als auch in Kombination – massive Belastungsfaktoren darstellen und nicht nur die Bewältigungskapazitäten eines Individuums herausfordern, sondern gleichzeitig zu einem Verlust an Ressourcen durch die Verminderung prämorbid vorhandener Fähigkeiten sowie sozialer und finanzieller Unterstützung führen. Demnach ist für die Adaptation nach verantwortlich, so SHT die eine komplexe Ausprägung Interaktion verschiedener aus mittelbaren individueller Faktoren Merkmale des Betroffenen und die Umwelt, in der er sich nach der Verletzung befindet. Ein ähnliches Modell des Anpassungsprozesses nach SHT liefern Godfrey, Knight und Partridge (1996) und Kendall und Terry (1996). Der Perspektive, dass das Individuum ein aktiver Gestalter seiner Adaptation ist, tragen einige wenige Studien Rechnung, die z.B. das Bewältigungsverhalten nach SHT untersucht haben. Beispielsweise fanden Curran, Ponsford und Crowe (2000), dass die Bewältigungsformen Sich sorgen, Wunschdenken und Selbstbeschuldigung mit einem höheren Ausmaß an Depression und Angst in Zusammenhang standen. In einer Studie von Webb, Wrigley, Yoels und Fine (1995) wurde versucht, das komplexe Zusammenwirken verschiedener Variablen zu berücksichtigen. Die Autoren verwendeten ein pfadanalytisches Modell, das die Analyse direkter und indirekter Wirkmechanismen eines hypothetisierten kausalen Modells erlaubt. Es zeigte sich, dass Berufstätigkeit den stärksten Prädiktor der Lebensqualität darstellte. Familiäre Unterstützung führte indirekt zu einer höheren Lebensqualität, indem diese die Impairments reduzierte, die Wahrscheinlichkeit einer Berufstätigkeit und die funktionale Selbständigkeit erhöhte. 34 Dieses letzte Ergebnisse verdeutlicht die Relevanz umweltbedingter Faktoren. Es ist weithin anerkannt, dass soziale Unterstützung eine wichtige Rolle im Auseinandersetzungsprozess mit Belastungen zählt, worunter auch Krankheit zu fassen ist (vgl. Sarason, Sarason & Gurung, 2001; Schwarzer & Leppin, 1991). Auch im Rehabilitationskontext geht man davon aus, dass soziale Unterstützung ein wichtiger Parameter für die Erzielung eines optimalen Outcome und dessen Aufrechterhaltung darstellt, wobei die Studien hier häufig hinter bereits bestehenden theoretischen und empirischen Erkenntnissen zurückbleiben (vgl. Chwalisz & Vaux, 2000). Im folgenden wird ein Überblick über den empirischen Stand zur Rolle sozialer Unterstützung bei SHT gegeben. 1.2.1.3 Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung und Adaptation nach SHT In einem globalen Sinn können objektive und subjektive Konzepte soziale Unterstützung unterschieden werden (McNally & Newman, 1998). Unter der ersten Perspektive werden strukturelle Merkmale betrachtet, d.h. das Ausmaß der sozialen Integration einer Person. Hierzu können verschiedene Aspekte des sozialen Netzwerks des Individuums analysiert werden. Als einfachster Indikator kann der Familienstand angesehen werden. Hier zeigen Ergebnisse, dass allein stehende und allein lebende Personen einen schlechteren subjektiven Gesundheitszustand angeben und eine höhere Morbidität aufweisen (z.B. Helmert & Shea, 1998). Die subjektive Konzeptualisierung sozialer Unterstützung betont die Funktion sozialer Beziehungen und Austauschprozesse sowie deren kognitive Repräsentation und Interpretation. Zu den gängigen Unterscheidungen zählen die Differenzierung nach der emotionalen, informativen und instrumentellen Funktion sozialer Unterstützung. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen wahrgenommener und erhaltener Unterstützung, die zumeist aus der Sicht des Empfängers der Unterstützung beurteilt wird. Sowohl strukturelle als auch qualitative Aspekte sozialer Unterstützung können zudem von der Person hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit diesem Merkmal beurteilt werden. Empirische Ergebnisse zeigen, dass der deutlichste Zusammenhang zwischen wahrgenommener Unterstützung und Adaptation besteht, d.h. eine höhere 35 wahrgenommene Verfügbarkeit sozialer Unerstützung steht in ein einem Zusammenhang mit einer positiveren Adaptation. Im Bereich SHT liegen vergleichsweise wenige Studien vor, die sich mit der Frage der Wirkung der verschiedenen Aspekte sozialer Unterstützung auf die Adaptation der Betroffenen beschäftigen. In der folgenden tabellarischen Übersicht werden die zentralen Ergebnisse dieser Studien zusammen gefasst (vgl. Tab. 2). Dabei wird zwischen den verschiedenen Merkmalen sozialer Unterstützung unterschieden. Die Einteilung orientiert sich an der Gliederung von Untersuchungsverfahren bei Laireiter (1992), d.h. Verfahren, die zunächst eine Auflistung von potentiellen oder tatsächlichen Unterstützungspersonen fordern bzw. sich auf diese beziehen, werden dem sozialen Netzwerk zugeordnet. Bei der Betrachtung der vorliegenden Arbeiten zeigt sich zunächst, dass die meisten Studien Merkmale des sozialen Netzwerks zum Gegenstand haben. In 20 von 23 Untersuchungspopulationen wurden Charakteristika des sozialen Netzes betrachtet, zwei thematisieren die Rolle wahrgenommener Unterstützung, und in einer Studie werden beide Aspekte untersucht. Bei den Studien, die das soziale Netzwerk im Mittelpunkt hatten, war in 13 Fällen der Familienstand bzw. vorhandene Partnerschaft der einzige Indikator des sozialen Netzes. Bei 6 Studienpopulationen wurden prospektive Längsschnittstudien durchgeführt, die einen Follow-up-Zeitraum von einem Monat bis zwei Jahren haben. In einem Fall handelt es sich um eine Longitudinalstudie, bei der zum ersten Erhebungszeitpunkt jedoch eine große Variabilität hinsichtlich der Zeit seit Verletzung besteht (Kaplan, 1990). In einer Untersuchung wurde ein kombiniertes Vorgehen realisiert, d.h. ein bei einem Teil der Stichprobe wurde eine prospektive Longitudinalstudie durchgeführt, eine andere Stichprobe unterschied sich hinsichtlich der Zeit der Verletzung, wurde aber katamnestisch einheitlich sechs Monate nach der Erstbefragung nachuntersucht (Kozloff, 1987). Die Querschnittstudien sind hinsichlich der Zeit seit Verletzung äußerst heterogen. Teilweise weisen die Untersuchungspopulationen einen Range von über 20 Jahren seit Verletzung auf. Die Stichprobengröße variiert zwischen 13 und 895 Personen (Ausgangsstichprobe bei Längsschnittstudien), wobei die Stichprobengröße in 18 von 36 23 Untersuchungspopulationen weniger als 100 Personen beträgt. Von diesen 18 Studien weisen 15 eine Stichprobe von weniger als 70 Personen auf. Bei der Studie mit der größten Stichprobe (N = 895) handelt es sich um eine Abstractpublikation, die daher nur sehr wenige Informationen liefert (Sokol, Heinemann, Bode, Shin & de Venter, 1999). Als Outcome-Maße wurden in den meisten Studien Aspekte der psychischen Befindlichkeit berücksichtigt. Daneben wurde in einigen Studien die Lebensqualität als Kriterium betrachtet und in anderen die Berufstätigkeit. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen sozialer Unterstützung und Adaptation zeigen sich nur wenige signifikante Ergebnisse. Bezüglich des Merkmals Familienstand zeigen neun Studien nicht-signifikante Ergebnisse. Sechs Untersuchungen finden Zusammenhänge zwischen Familienstand bzw. bestehender Partnerschaft und Outcome-Maßen, wobei diese jedoch nicht durchweg im Sinne eines günstigen Einflusses einer Partnerschaft zu interpretieren sind. Steadman-Pare et al. (2001) fanden in einer Querschnittstudie einen korrelativen Zusammenhang zwischen Familienstand zum Zeitpunkt der Untersuchung und Lebensqualität in dem Sinne, dass verheiratete Personen eine höhere Lebensqualität angaben. Die Korrelation betrug r = .15, allerdings ging diese Variable nicht in die Regressionsgleichung ein. Somit stellte der Familienstand keinen relevanten Prädiktor der Lebensqualität dar. Ein vergleichbares Ergebnismuster berichten auch Kreuter, Sullivan, Dahllöf und Siösteen (1998). In der Querschnittstudie von Brown und Vandergoot (1998) unterschied sich die Gruppe der getrennten, geschiedenen oder verwitweten Betroffenen von allein stehenden – aber nicht von verheirateten – bzgl. der allgemeinen Lebensqualität. Diese Gruppe gab auch mehr nicht-erfüllte Bedürfnisse an als allein stehende und verheiratete Personen. Demgegenüber steht ein Ergebnis der Längsschnittstudie von Corrigan et al. (2001). Vergleichbar mit zwei der zuvor angeführten Studien stellte auch hier der aktuelle Familienstand keinen Prädiktor der Lebensqualität ein bzw. zwei Jahre nach Verletzung dar. Allerdings war der Familienstand nach zwei Jahren ein signifikanter Prädiktor der Veränderung der Lebensqualität im Zeitraum von einem zu zwei Jahren nach Verletzung. Personen, die zwei Jahre nach Verletzung verheiratet waren, gaben 37 eine größere Reduktion Regressionsmodells der lediglich Lebensqualität ein an. Varianzaufklärung Jedoch von wurde 8 % mittels erreicht. des Eine weitergehende Erklärung für diesen negativen Effekt der Partnerschaft auf den Verlauf der Lebensqualität liefern die Autoren nicht. Eine weitere Studie, die einen negativen Zusammenhang zwischen Partnerschaft und Adaptation fand, stammt von Moore, Stambrook, Gill & Lubusko (1992). In dieser Querschnittstudie zeigte sich, dass Personen mit einer Partnerschaft mehr Angst, Depressivität, Ärger, Erschöpfbarkeit und eine negativere emotionale Gesamtbefindlichkeit angaben als Personen ohne Partnerschaft. Daneben gaben SHT-Betroffene mit Partner mehr Probleme hinsichtlich Freizeitaktivitäten und weniger Probleme hinsichtlich Mobilität und Körperhygiene an als SHT-Betroffene ohne Partner. Als mögliche Erklärung hierfür führen die Autoren an, dass unter einer familienentwicklungspsychologischen Perspektive diese Ergebnisse plausibel erscheinen, da Familien vor bestimmten Entwicklungsaufgaben stehen. Erleidet ein Elternteil ein SHT, so resultieren tief greifende Auswirkungen und Belastungen, die mit diesen Entwicklungsaufgaben kollidieren. Bei allein stehenden Betroffenen, die somit lediglich Teil der Ursprungsfamilie sind, resultieren die Beeinträchtigungen "nur" in einem persönlichen Entwicklungsrückschritt. Alternativ bieten die Autoren als Erklärung an, dass SHT-Betroffenen mit einem Partner mehr Rückmeldung über ihre Beeinträchtigungen erhalten, sich mehr darüber austauschen und eine stärkere Bewusstheit über ihre Einschränkungen besitzen – und daher eine negativere Befindlichkeit zeigen als allein stehende. Demgegenüber steht der positive Effekt der Partnerschaft in Bezug auf physische Merkmale, da hier evtl. ein höheres Maß an Training vorliegt als bei allein stehenden. In den Studien, welche die Größe des sozialen Netzwerks, das Ausmaß an Unterstützung durch das soziale Netzwerk oder die Zufriedenheit mit der Unterstützung durch das soziale Netzwerk betrachteten, zeigen sich in einigen Arbeiten positive Zusammenhänge. Allerdings fanden Leach, Frank, Bouman und Farmer (1994) keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Unterstützung durch das soziale Netz und Depressivität, Fedoroff et al. (1995) keinen Einfluss der Größe des sozialen Netzwerks auf die Rate an Major Depression einen Monat nach SHT, MacMillan, Hart, Martelli und Zasler (2002) keinen Zusammenhang zwischen Netzwerkgröße und Berufstätigkeit, und 38 Kozloff (1987) fand keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Strukturmerkmalen des sozialen Netzwerks und globalem Outcome. Betrachtet man die Studien, welche einen positiven Zusammenhang erzielten genauer, so relativieren sich die Ergebnisse. Beispielsweise betrug die Stichprobengröße in der Untersuchung von Hammell (1994) N = 15 SHT-Patienten, und die Autorin führte lediglich eine Korrelationsanalyse durch. Die Studie von Holosko und Huege (1989) umfasste N = 20 Betroffene. Auch hier wurden lediglich Korrelationen angegeben. In der soeben erwähnten Studie von MacMillan et al. (2002) zeigte sich, dass die Netzwerkgröße einen Prädiktor des Ausmaß an neurobehavioralen Symptomen (Fremdrating durch Angehörige) darstellte, wobei auch hier eine eher kleine Stichprobe befragt wurde (N = 45). Weiterhin handelt es sich bei diesen drei erwähnten Studien um Querschnittstudien, die Betroffene mit unterschiedlichen Follow-upZeiträumen zusammenfassen. So betrug z.B. die Zeit seit Verletzung in der Untersuchung von MacMillan et al. (2002) zwischen 2 und 25 Jahre. Eine Längsschnittstudie mit einem positiven Ergebnis stammt von Kaplan (1990). In dieser Untersuchung wurde aber kein prospektives Design realisiert: Die Ausgangsstichprobe umfasste Betroffene, deren Verletzung zwischen 10 und 30 Monate zurücklag. Ein Jahr nach dem ersten Erhebungszeitpunkt waren die Personen eher wieder berufstätig, die zum ersten Zeitpunkt ein höheres Maß an Unterstützung durch das soziale Netz angegeben hatten. Neben der Einschränkung im Design ist hier erneut die Stichprobengröße als beschränkender Faktor zu nennen, die in dieser Studie N = 36 Personen betrug. Bei den drei Studien, die die Rolle wahrgenommener Unterstützung untersuchten, handelt es sich in allen Fällen um Querschnittuntersuchungen. In der Studie von Smith, Magill-Evans und Brintnell (1998) stellte ein Gesamtindex wahrgenommener Unterstützung einen signifikanten Prädiktor der Lebensqualität dar. Die Stichprobengröße betrug N = 43 Betroffene, die im Durchschnitt 8 Jahre nach SHT befragt wurden. In der Studie von Steadman-Pare et al. (2001) zeigte sich eine positive Korrelation zwischen wahrgenommener emotionaler, instrumenteller und finanzieller Unterstützung und Lebenszufriedenheit, wobei nur emotionale Unterstützung einen signifikanten Prädiktor der Lebenszufriedenheit darstellte. Die Stichprobengröße in 39 dieser Studie betrug N = 275 Betroffene, die zwischen 8 und 24 Jahren (M = 14) nach SHT befragt wurden. Die Untersuchung von Pelletier und Alfano (2000) zeigte einen signifikanten Zusammenhang zwischen einem höheren Maß wahrgenommener Unterstützung und einem niedrigeren Maß an depressiver Symptome. Jedoch betrug die Stichprobengröße hier lediglich N = 13 Personen; zudem wird keine konkrete Aussage über die verwendeten Erhebungsinstrumente gemacht. 40 Tabelle 2: Übersicht der Studien zu sozialem Netzwerk, sozialer Unterstützung und Adaptation nach SHT Autor Bowen et al. (1998) Merkmal sozialer Studien- Stich- Zeit seit Unterstützung design probe (N) Verletzung Netzwerk LS 99 6 Monate Ergebnisse Familienstand vor Verletzung kein Zusammenhang mit allgemeiner psychischer Belastung Brown & Vandergoot Netzwerk QS 430 (1998) M = 10 Jahre Getrennte, geschiedene oder verwitwete Range 1-53 Patienten geben eine niedrigere allgemeine Lebensqualität an als allein stehende (aber nicht als verheiratete); getrennte, geschiedene oder verwitwete Betroffene geben mehr nicht-erfüllte Bedürfnisse in wichtigen Bereichen der Lebensqualität an als allein stehende und als verheiratete Betroffene Corrigan et al. (2001) Netzwerk LS 218 1, 2 Jahre Familienstand kein Prädiktor der Lebensqualität 1 und 2 J. nach Verletzung, aber wichtigster Prädiktor der Veränderung der Lebensqualität. Betroffene, die 2 J. nach Verletzung verheiratet waren, zeigten eine Abnahme der Lebensqualität zwischen den beiden Zeitpunkten Douglas & Spellacy (2000) Netzwerk QS 35 M = 84 Monate Range 42-124 Familienstand kein Prädiktor der Depressivität 41 Fortsetzung Tabelle 2 Fann et al. (1995) Fedoroff et al. (1992) a Netzwerk Netzwerk QS LS 50 66 M = 33 Monate Familienstand keinen Einfluss auf Rate an Range 1-128 Depression / Angststörung 1 Monat Familienstand und Größe soziales Netzwerk keinen Einfluss auf Rate an Major Depression Gomez-Hernandez et Netzwerk LS 65 al. (1997) Greenspan et al. (1996) Netzwerk LS 395 3, 6, 9, 12 Familienstand keine Auswirkung auf Rate an Monate Major Depression 1 Jahr Familienstand 1 Jahr nach Verletzung kein Zusammenhang mit Rückkehr in Berufstätigkeit Hammell (1994) Netzwerk QS 15 M=? Größe des Netzwerks und die Zufriedenheit mit Range 4-311 diesem korreliert mit Angst und Depressivität Monate Hicken et al. (2002) Netzwerk QS 57 1 Jahr Familienstand kein signifikanter Prädiktor der allgemeinen Lebenszufriedenheit Holosko & Huege Netzwerk QS 20 (1989) M = 5.5 Jahre Soziale Unterstützung korreliert mit SD, Range = ? Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit (positiver Zusammenhang); weiterhin Korrelation mit Ausmaß der Beeinträchtigung (je höher desto mehr Unterstützung) Jorge et al. (1993a) a Netzwerk LS 66 1, 3, 6, 12 Depressive geben 3 und 6 Monate nach Monate Verletzung ein kleineres soziales Netz an 42 Fortsetzung Tabelle 2 Jorge et al. (1993b) a Netzwerk LS 66 1, 3, 6, 12 Familienstand keinen Einfluss auf akuten Monate (innerhalb eines Monats) und verzögerten (3 Monate oder später) Beginn einer Depression; Betroffene, die verzögert eine Depression entwickeln geben ein kleineres soziales Netz an als Betroffene, die keine Depression entwickeln; Betroffene, die akut eine Depression entwickeln unterscheiden sich nicht von Betroffenen, die verzögert eine Depression entwickeln bzgl. des sozialen Netzes Kaplan (1988) Netzwerk LS 25 14 Monate Familienstand vor Verletzung keinen Einfluss auf Rückkehr in Berufstätigkeit Kaplan (1990) Netzwerk LS 36 M = 17 Monate Betroffene, die zum ersten Zeitpunkt mehr Range 10-30; Unterstützung durch das soziale Netzwerk 1 Jahr nach angeben, sind ein Jahr später eher wieder erstem Zeitpunkt berufstätig als Betroffene, die ein niedrigeres Maß angeben Kozoloff (1987) Netzwerk LS 14 (longi- M = 17 Monate Kein Effekt sozialer Netzwerkparameter (Größe, tudinal) (longitudinal); Dichte, Anzahl Verwandter,...) auf globalen 23 (pro- M = 3 Monate Outcome spektiv) (prospektiv); 6 Monate nach 1. Zeitpunkt 43 Fortsetzung Tabelle 2 Kreuter et al. (1998) Netzwerk QS 92 Md = 9 Jahre Patienten mit einer bestehenden Beziehung Range 1-20 berichten weniger Beeinträchtigungen im physischen und sozialen Bereich, Patienten mit einer Beziehung berichten eine höhere allgemeine Lebensqualität; kein Unterschied zwischen Patienten mit und ohne Beziehung in der Depressivität; vorhandene Beziehung jedoch kein signifikanter Prädiktor der Lebensqualität Leach et al. (1994) MacMillan et al. (2002) Netzwerk Netzwerk QS QS 39 45 M = 45 Monate Kein Zusammenhang zwischen Unterstützung SD = 68 durch das soziale Netzwerk und Depressivität M = 10 Jahre Soziales Netzwerk korreliert nicht mit Status der Range 2-25 Erwerbstätigkeit und Lebenssituation (unabhängig bis Heimunterbringung); Soziales Netzwerk Prädiktor des neurobehavioralen Status aus der Sicht der Angehörigen (besseres soziales Netz aus Sicht der Betroffenen steht in Zusammenhang mit geringerem Ausmaß an neurobehavioralen Problemen aus Sicht der Angehörigen) 44 Fortsetzung Tabelle 2 Moore et al. (1992) Netzwerk QS 98 M = ca. 45 Betroffene, die sich in einer Partnerschaft Monate (k.A. für befanden, gaben mehr Angst, Depressivität, Gesamtgruppe) Ärger, Ermüdbarkeit und generelle emotionale Range <12->70 Belastung an als Betroffene, die in keiner Partnerschaft lebten; Betroffene mit Partnerschaft gaben weniger Probleme im Bereich Körperhygiene und Bewegung und mehr Probleme im Bereich Freizeitaktivitäten an Sokol et al. (1999) Netzwerk QS 895 ? Bestehende Partnerschaft signifikanter Prädiktor einer höheren Lebenszufriedenheit; Partnerschaft kein Prädiktor der Rückkehr in das Berufsleben Steadman-Pare et al. (2001) Netzwerk QS 275 b M = 14 Jahre Familienstand korreliert mit Lebenszufriedenheit Range 8-24 (Betroffene mit einer Beziehung geben eine höhere Lebenszufriedenheit an), ist jedoch kein signifikanter Prädiktor Wagner et al. (1990) Netzwerk QS 40 M = 3 Jahre Zufriedenheit mit dem sozialen Netzwerk und Range <2->7 Anzahl der Freunde im sozialen Netzwerk Prädiktoren des globalen psychosozialen Outcomes 45 Fortsetzung Tabelle 2 Pelletier & Alfano Wahrgenommene (2000) Unterstützung QS 13 M = 4 Jahre Wahrgenommene Unterstützung durch Freunde SD = 2.6 korreliert nicht signifikant mit Depressivität und subjektiver Belastung; Wahrgenommene Unterstützung durch die Familie korreliert negativ mit Depressivität (mehr Unterstützung geht mit niedrigerer Depressivität einher), aber nicht signifikant mit subjektiver Belastung Smith et al. (1998) Wahrgenommene QS 43 Unterstützung M = 8 Jahre Wahrgenommene Unterstützung signifikanter Range 1-18 Prädiktor der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (mehr Unterstützung geht mit einer höheren Lebensqualität einher) Steadman-Pare et al. (2001) b Wahrgenommene QS Unterstützung 275 M = 14 Jahre Verfügbarkeit emotionaler, instrumenteller und Range 8-24 finanzieller Unterstützung korreliert positiv mit Lebenszufriedenheit, Korrelation informative Unterstützung nicht signifikant; nur emotionale Unterstützung signifikanter Prädiktor der Lebenszufriedenheit Anmerkungen. LS: Längsschnittstudie; QS: Querschnittstudie; M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; k.A.: keine Angabe a, b Hierbei handelt es sich um dieselbe Stichprobe. 46 1.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung Der Überblick zu den Folgen eines SHT verdeutlicht, dass diese sehr vielfältig sind und sich auf die unterschiedlichsten Bereiche erstrecken. Dabei gilt es zu bedenken, dass diese Bereiche unterschiedliche Abstraktionsebenen umfassen. So ist trotz eines guten globalen Outcomes, wie er z.B. mittels GOS erfasst wird, durchaus wahrscheinlich, dass die betroffene Person objektive Einschränkungen im Funktionsniveau aufweist und subjektiv unter massiven Beschwerden leiden kann. Die in der Übersicht dargestellten Folgen eines SHT tangieren die drei Ebenen der ICIDH-2, zwischen denen nicht notwendigerweise ein linearer Zusammenhang besteht. So zeigt sich beispielsweise, dass ein Großteil selbst schwer verletzter SHT-Patienten ein hohes Maß an funktionaler Selbständigkeit erreicht. Ebenso gilt aber, dass sehr viele Betroffene neuropsychologische Defizite aufweisen und z.B. auch Jahre nach der Verletzung über subjektive Beschwerden klagen. Konsistent zeigt sich, dass ein SHT für viele Personen mit Rollenverlusten einhergeht, von denen der Arbeitsplatzverlust sicherlich eine besondere Stellung einnimmt. Hinsichtlich der Prädiktoren der Adaptation nach SHT ist festzustellen, dass verletzungsbezogene Merkmale vor allem für die Vorhersage des globalen Outcomes herangezogen werden können. Für die Prädiktion der psychosozialen Adaptation leisten verletzungsbezogene Merkmale in der Regel nur einen geringen oder keinen signifikanten Beitrag. So finden beispielsweise nur wenige Studien Zusammenhänge zwischen dem Schweregrad der Verletzung und psychischen Beschwerden, psychischen Störungen oder Lebensqualität nach SHT. Daher argumentieren einige Autoren für eine stärkere Berücksichtigung umweltbedingter Merkmale, wie z.B. soziale Unterstützung. Bezüglich der vorliegenden Studien zur Rolle des sozialen Netzwerks und der sozialen Unterstützung für die Adaptation nach SHT zeigen sich insgesamt wenig positive Ergebnisse – auch wenn dies bei vielen Autoren anders klingt. So meint z.B. Kozloff (1987, S. 23): "In conclusion, social support has a positive effect on the process of long-term recovery from head injury". Damit widerspricht der Autor den quantitativen Ergebnissen seiner eigenen Untersuchung, in der sich keine signifikanten Effekte von 47 Strukturparametern des sozialen Netzes auf die globale psychosoziale Anpassung fanden. Zwar liefern qualitative Ergebnisse seiner Studie Hinweise für die Bedeutsamkeit sozialer Unterstützung, da die Betroffenen und deren Familienmitglieder diese als sehr hilfreich und wichtig einschätzten. Jedoch ist die Schlussfolgerung des Autors angesichts der Befundlage allzu positiv. Dabei stellt Kozloff keinen Einzelfall dar. In vielen klinisch-theoretisch orientierten Arbeiten wird ausgesagt, dass soziale Unterstützung eine relevante Variable im Adaptationsprozess ist. In den empirischen Arbeiten, die einen positiven Effekt sozialer Unterstützung aufzeigen konnten, wird ebenfalls eine sehr positive Interpretation vorgenommen. Statt als Hinweis, werden die Ergebnisse als deutlicher Beleg des positiven Effektes sozialer Unterstützung ausgewiesen. Dies liegt sicherlich zum Teil darin begründet, dass in vielen Studien aus anderen Bereichen eine positive Wirkung sozialer Unterstützung auf Adaptationsmerkmale aufgezeigt werden konnte und Autoren somit schnell ihre positiven Ergebnisse in die generelle Befundlage einordnen. Bei genauerer Betrachtung sollte die Schlussfolgerung u.E. etwas vorsichtiger ausfallen. Dies liegt zum einen daran, dass viele Studien keinen bedeutsamen Einfluss verschiedener Merkmale sozialer Unterstützung auf die Adaptation aufzeigen konnten. Zum anderen unterliegen die Studien, die einen positiven Zusammenhang fanden, in der Regel starken methodischen Einschränkungen (dies gilt jedoch auch für die Untersuchungen, die keine positiven Effekte fanden). In den meisten Fällen handelt es sich um Querschnittstudien, die keine Aussagen über kausale Mechanismen erlauben. Daneben berücksichtigen die meisten Untersuchungen in diesem Bereich kleine Stichproben, was zur Folge hat, dass die Anwendung bestimmter statistischer Verfahren aufgrund der Stichprobengröße als kritisch eingeschätzt werden kann (z.B. multivariate Analysen), die Anwendung der Stichprobengröße angemessener Verfahren jedoch häufig nur wenig Aufhellung der Zusammenhänge erbringt (z.B. Korrelationsanalyse). Dieses Problem ist jedoch nicht auf Studien zum Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und Adaptation nach SHT beschränkt, sondern gilt für die gesamten psychosozialen Forschungsbemühungen bei SHT – aber auch bei anderen Bereichen, wie die Beispiele der eingangs erwähnten systematischen Reviews zeigen. Hinzu kommt, dass viele Studien nur das sehr rudimentäre Merkmal Familienstand als Indikator der sozialen Integration verwenden. Die entsprechenden Arbeiten haben in der 48 Regel nicht die Rolle sozialer Merkmale für die Adaptation als zentrale Forschungsfrage, sondern berichten entsprechende Ergebnisse am Rande. Bei den Arbeiten, die sich primär mit dieser Fragestellung beschäftigen ist jedoch anzuführen, dass hier nahezu ausschließlich eher wenig bekannte, gering verbreitete Instrumente zum Einsatz kommen, die in der Publikation häufig nicht konkret dargestellt werden, so dass es schwer fällt zu beurteilen, welche Merkmale sozialer Unterstützung erhoben werden. In der Untersuchung von Pelletier und Alfano (2000) wird sogar überhaupt nicht erwähnt, wie wahrgenommene Unterstützung erhoben wurde. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei diesem Forschungsfeld um ein komplexes Gebiet handelt, in dem Stichproben schwer und aufwendig zu rekrutieren sind. Daher ist es häufig pragmatischer, Querschnittuntersuchungen durchzuführen, die jedoch sehr oft den Nachteil mit sich bringen, dass keine homogene Stichprobe gebildet werden kann, da die Zeit seit Verletzung häufig einen Range von mehreren Jahren aufweist. Zur Verdeutlichung der Schwierigkeiten bei entsprechenden Forschungsbemühungen seien folgende Beispiele genannt: In der Studie von Santoro und Spiers (1994) zur Rolle sozial-kognitiver Faktoren bei Persönlichkeitsänderung nach SHT betrug die Stichprobengröße N = 10 Personen, in der Studie von Spence, Godfrey, Knight und Bishara (1993) zu sozialen Fertigkeiten nach SHT N = 14, und in der Studie von Koskinen (1998) zur Lebensqualität nach SHT N = 15. Die Studie von Hoofien et al. (2001) umfasste Personen, bei denen die Verletzung zwischen 5 und 25 Jahre zurücklag, und nur 50% der von ihnen anvisierten Personen waren für die Studie zu gewinnen. Von diesen wurden 25 % aufgrund der Fragestellung ausgeschlossen. In der Studie von Corrigan et al. (1998) nahmen lediglich 24 % der anvisierten Personen an der Untersuchung teil. In der Arbeit von Gomez-Hernandez et al. (1997) betrug die Ausgangsstichprobe N = 65 Patienten. Zu den Follow-up-Zeitpunkten 3, 6, 9 und 12 Monate wurden jeweils mindestens N = 60 Patienten gesehen, jedoch für nur N = 29 Patienten lagen Daten für alle Zeitpunkte vor. In der Längsschnittstudie von Corrigan et al. (2001) betrug der Drop-out im Verlauf von 2 Jahren 39 %. Pelletier und Alfano (2002) rekrutierten eine Stichprobe von N = 19 Patienten und N = 22 Familienmitgliedern aus konsekutiven Aufnahmen eines großen städtischen Rehabilitationskrankenhauses innerhalb eines Zeitraums von 4 (!) Jahren. Bei der Studie von Pössl et al. (2001) zur 49 Stabilität der Berufstätigkeit nach Hirnschädigung hatte ein Großteil der Stichprobe ein SHT erlitten, in die Untersuchung gingen aber auch Personen mit zerebrovaskulärer Erkrankungen und anderen erworbenen Hirnschädigungen ein. 50 1.2.2 Schädelhirntrauma – Die Situation der Familie Angesichts der dargestellten weit reichenden Folgen eines SHT ist es nahe liegend, dass sich auch Auswirkungen auf die Familie des Betroffenen zeigen. Aufgrund der neurobehavioralen Veränderungen können die Familienangehörigen den Betroffenen als fremd erleben. Durch die häufig eintretende Abnahme der sozialen Aktivitäten und der Berufstätigkeit verbringt der Betroffene im Unterschied zum Zeitpunkt vor der Verletzung mehr Zeit zu Hause. Die Reduktion des sozialen Netzwerks hat zur Folge, dass die Familie zur Hauptquelle sozialer Interaktionen des Betroffenen wird. Dies bedeutet für die Familie u.a., dass der Alltag neu organisiert werden muss, Rollen neu zu verhandeln sind und eine neue Abstimmung der individuellen Bedürfnisse erfolgen muss (vgl. Balck & Dinkel, 2000). Im Unterschied zu anderen Erkrankungen gibt es im Fall des SHT bereits seit den 70er Jahren Studien, die über die Auswirkungen eines SHT auf die Familienmitglieder und damit verbundenen Belastungen berichten (Lezak, 1987; Panting & Merry, 1972; Romano, 1974). Diese Arbeiten hatten zwar zahlreiche methodische Schwächen, jedoch brachten sie erste wichtige Erkenntnisse und warfen weiterführtende Fragen auf, die seitdem in einer Reihe von Studien näher untersucht worden sind. Daneben wurden auch schon früh Angehörige in Untersuchungen einbezogen, da sie als Informanten über den Gesundheitszustand des Patienten genutzt wurden (z.B. McKinlay, Brooks, Bond, Martinage & Marshall, 1981; Oddy, Humphrey & Uttley, 1978). Ein Grund hierfür ist, dass SHT-Patienten evtl. aufgrund der Verletzungsfolgen nicht in der Lage sind, Auskunft zu erteilen. Ein anderer Grund ist, dass die Angaben von Angehörigen als reliabler angesehen wurden, da nach einem SHT den Betroffenen das Ausmaß ihrer Einschränkungen nicht unbedingt in vollem Umfang bewusst sein muss (vgl. McGlynn & Schacter, 1987). Die Diskrepanz zwischen der Einschätzung des Betroffenen und von Angehörigen wurde in einigen Studien näher untersucht. Dabei zeigt sich, dass nicht generell davon ausgegangen werden kann, dass Betroffene zu einer Dissimulation der Probleme neigen, wobei die Übereinstimmung für verschiedene Problembereiche unterschiedlich ausfällt (vgl. Cusick, Gerhart & Mellick, 2000; Lanham, Weissenburger, Schwab & Rosner, 2000; Leathem, Murphy & Flett, 1998; Santos, 51 Castro-Caldas & De Sousa, 1998; Sbordone, Seyranian & Ruff, 1998; 2000; Seel, Kreutzer & Sander, 1997). Im folgenden wird näher auf die Situation der Familie nach einem SHT eingegangen und ein kurzer Überblick zu Auswirkungen eines SHT auf einzelne Familienmitglieder, die Paarbeziehung und das Familiensystem eingegangen. Daran anschließend wird der Forschungsstand zur Rolle familiärer Faktoren für die Adaptation nach SHT referiert. 1.2.2.1 Auswirkungen eines SHT auf einzelne Familienmitglieder Belastungen und Rollenveränderungen Als eine der wichtigsten frühen Studien zum Themenfeld SHT und Familie ist die Arbeit von Oddy, Humphrey und Uttley (1978b) anzusehen, da es sich um die erste prospektive Untersuchung handelt, in der zudem standardisierte Verfahren eingesetzt wurden. Die Autoren untersuchten 54 SHT-Patienten und deren Angehörige 1, 6 und 12 Monate nach Verletzung. Zu den Follow-up-Zeitpunkten gab jeweils mehr als die Hälfte der Angehörigen an, deutliche Belastungen in Folge des SHT zu erleben. Als primäre Ursache der Belastung wurde der aktuelle Zustand des Betroffenen benannt. Dies beinhaltete u.a. unkontrolliertes Verhalten des Betroffenen und die physische Belastung der eigenen Bewältigungsbemühungen. Die zweithäufigste Ursache der erlebten Belastung bestand in Angst und Sorgen um die weitere Zukunft des Betroffenen. In der Studie von Marsh, Kersel, Havill und Sleigh (1998a;b) wurde u.a. die Belastung von Angehörigen durch Veränderungen des Patienten und Veränderungen im eigenen Lebensstil sechs und zwölf Monate nach SHT untersucht. Zum ersten Zeitpunkt wurde durch die Angehörigen die soziale Isolation des Betroffenen als die am meisten belastende Folge genannt. Von den näher untersuchten behavioralen Veränderungen wurde Aggressivität als die am meisten belastende Folge erlebt. Als die am meisten belastenden persönlichen Folgen der Angehörigen wurde eine gestiegene Medikamenteneinnahme und die Zunahme physischer Krankheit angegeben. Ein Jahr nach SHT wurden die emotionalen Veränderungen des Betroffenen als die 52 gravierendste Folge angegeben, und unter den behavioralen Folgen erhielten Ärgerausbrüche des Betroffenen das höchste Belastungsrating. Unter den persönlichen Folgen wurde zu diesem Zeitpunkt die fehlende Zeit für eigene Interessen als die am meisten belastende Folge benannt. In der Studie von Wallace et al. (1998) gaben ein Jahr nach SHT ein Drittel der befragten 61 Angehörigen keine negativen Veränderungen in Folge des SHT an, 47 % einige, 17 % deutliche und 3 % sehr deutliche negative Veränderungen. Deutliche Veränderungen in der Ausübung verschiedener Rollen bei Angehörigen fanden auch Frosch et al. (1997). Ferner fanden sie Hinweise darauf, dass umso mehr Rollenveränderungen erlebt werden, je weniger soziale Unterstützungssysteme zur Verfügung stehen und je mehr behaviorale Veränderungen auf Seiten des Betroffenen auftreten. Wahrgenommene Beeinträchtigungen auf Seiten des Betroffenen und soziale Unterstützung stellten in der Studie von Wallace et al. (1998) Prädiktoren der Veränderungen im Lebensstil der Angehörigen dar. Einen positiven Effekt sozialer Unterstützung (korrelativer Zusammenhang) auf das Ausmaß der Belastung von Angehörigen fanden auch Leathem, Heath und Woolley (1996) in ihrer Studie bei 29 Angehörigen, die im Mittel 3,5 Jahre nach SHT befragt wurden. In den Studien von Allen, Linn, Gutierrez und Willer (1994) sowie von Minnes et al. (2000) wurde untersucht, ob sich Eltern und (Ehe-)Partner hinsichtlich ihrer Belastung durch die Betreuung eines SHT-Patienten unterscheiden. Beide Studien fanden geringfügige Unterschiede zwischen beiden Gruppen, wobei die Ergebnisse beider Studien unterschiedlich sind. Überstimmend zeigte sich jedoch, dass Schweregrad der Verletzung und Zeit seit Verletzung keinen bzw. nur einen geringen Zusammenhang mit Belastungen von Angehörigen nach SHT aufweisen und dass die wahrgenommenen Beeinträchtigungen des Betroffenen, vor allem kognitive und behaviorale, in einem deutlichen Zusammenhang mit Belastungen von Angehörigen stehen. Psychische Befindlichkeit In einer Reihe von Studien wurde die psychische Befindlichkeit von Familienangehörigen nach SHT untersucht. Tabelle 3 liefert eine Übersicht zu den 53 Ergebnissen vorliegender Querschnittuntersuchungen. Die meisten Studien beschränken sich auf die Erfassung von Depressivität und Angst; in einigen wenigen werden zusätzliche Aspekte psychischer Befindlichkeit untersucht. Die Rate an klinisch relevanter depressiver Symptomatik schwankt zwischen 21 % (Gervasio & Kreutzer, 1997) und 76 % der Angehörigen (Mintz, van Horn & Levine, 1995). Allerdings sind die Ergebnisse schwer miteinander zu vergleichen, da unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kamen und dort, wo dieselben Verfahren benutzt wurden z.T. unterschiedliche Falldefinitionen vorlagen, d.h. verschiedene Cut-off-Werte für die Definition klinisch relevanter Ausprägung herangezogen wurden. Beispielsweise erhielten Mintz et al. (1995) in ihrer Studie eine Differenz von 24 % in der Rate an auffälliger Depressivität bei Angehörigen in Abhängigkeit des betrachteten Erhebungsinstrumentes. Ebenso schwanken die (Ausgangs-)Stichprobengrößen und die Zeit seit Verletzung beträchtlich zwischen den Untersuchungen. In der Untersuchung von Mintz et al. lag die Stichprobe bei N = 21 Angehörigen; in der Arbeit von Perlesz, Kinsella und Crowe (2000) bei N = 147, wobei diese zwischen primären, sekundären und tertiären Betreuungspersonen unterschieden, definiert durch das Ausmaß und Engagement, das die Angehörigen in die Betreuung investierten. So galten N = 72 Personen als primäre Betreuungspersonen. In den Untersuchungen, die sowohl Depressivität als auch Angst bei Familienmitgliedern erhoben, dominierte in drei Studien Angst gegenüber Depressivität (Gervasio & Kreutzer, 1997; Kreutzer, Gervasio & Camplair, 1994a; Perlesz et al., 2000), und in zwei Studien war die Rate an Angehörigen mit depressiver Symptomatik höher als die Rate an Angehörigen mit klinisch relevanter Angstsymptomatik (Linn, Allen & Willer, 1994; Mintz et al., 1994). Neben diesen Querschnittstudien liegen auch einige prospektive Längsschnittuntersuchungen zur psychischen Befindlichkeit von Familienmitgliedern nach SHT vor. Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeiten werden zusammenfassend in Tabelle 4 dargestellt. 54 Tabelle 3: Übersicht der Querschnittstudien zur Rate psychischer Auffälligkeit bei Angehörigen von SHT-Patienten (Prozent klinisch auffälliger Personen) Autor Douglas & Spellacy Stich- Zeit seit probe (N) Verletzung 35 M = 84 Monate 116 (1997) Kolakowsky-Hayner & Depressivität: 60 Range 42-124 (2000) Gervasio & Kreutzer Ergebnisse 28 M=? Allg. psych. Belastung: 24 Range 10->115 Depressivität: 21 Monate Angst: 31 ? Allg. psych. Belastung: 28 c Depressivität: 29 c Kishore (1999) Angst: 38 c Kreutzer et al. (1994a) 62 M = 16 Monate Allg. psych. Belastung: 33 Range 1.5-60 Depressivität: 23 Angst: 32 Linn et al. (1994) Mintz et al. (1995) Perlesz et al. (2000) 60 21 147 M = 70 Monate Depressivität: 73 SD = 65 Angst: 55 M = 4.5 Jahre Depressivität: 52 bzw. 76 a Range, SD = ? Angst: 48 bzw. 43 a M = 19 Monate Depressivität: 38 b Range 12-60 Angst: 44 b Anmerkungen. M: Mittelwert; SD: Standardabweichung a In dieser Studie wurden Depressivität und Angst mit zwei verschiedenen Fragebögen erhoben. b Nur primäre Betreuungspersonen. c Ungefähre Angabe (aus Abbildung rekonstruiert), da keine genauen Werte mitgeteilt werden. 55 Tabelle 4: Übersicht der prospektiven Längsschnittstudien zur Rate psychischer Auffälligkeit bei Angehörigen von SHT-Patienten (Katamnesezeitpunkt in Monaten) Autor Stich- Befinden 1 3 6 12 Allg. psych. Belastung 40 37 29 Depressivität 20 23 26 Angst 34 41 38 Depressivität 37 32 Angst 39 35 20 24 probe (N) Livingston et al. 57 (1985) Marsh et al. 69 (1998a;b) Oddy et al. 54 Depressivität 39 (1978b) Die Ausgangsstichproben der Studien von Livingston, Brooks und Bond (1985), Marsh et al. (1998a;b) und Oddy et al. (1978b) liegen alle unter N = 70 Personen. Auch hier sind die Ergebnisse nur bedingt vergleichbar, da unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden. Die Rate an Angehörigen mit einer klinisch relevanten Ausprägung psychischer Belastung liegt in den verschiedenen Untersuchungen zwischen 20 % (Livingston et al., 1985; Oddy et al., 1978b) und 41 % (Livingston et al., 1985). In der Studie von Livingston et al. (1985) dominierte Angst gegenüber Depressivität, während in der Untersuchung von Marsh et al. (1998a;b) die Rate für beide Symptombereiche vergleichbar war. Hinsichtlich Längsschnittuntersuchungen des insgesamt zeitlichen Verlaufs geringfügige zeigten sich Veränderungen, in den wobei die Zusammenschau der Studien kein konsistentes Veränderungsmuster erkennen lässt. In Bezug auf mögliche Prädiktoren der psychischen Befindlichkeit zeigte sich weder in den Querschnittstudien (Gervasio & Kreutzer, 1997; Linn et al., 1994; Kreutzer et al., 1994b) noch in den Längsschnittstudien (Livingston et al., 1985; Oddy et al., 1978) ein Einfluss des Schweregrads des SHT auf die psychische Befindlichkeit von Angehörigen. Livingston et al. (1985) fanden keinen signifikanten Unterschied in der Rate an psychischer Auffälligkeit zu den verschiedenen Follow-up-Zeitpunkten. Oddy et al. (1978) fanden einen signifikanten Rückgang der psychischen Belastung zwischen 56 einem und sechs Monate nach SHT, jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den Zeitpunkten sechs und zwölf Monate nach Verletzung. Auch in der Querschnittstudie von Gervasio und Kreutzer (1997) zeigte sich kein Zusammenhang zwischen psychischer Befindlichkeit und Zeit seit Verletzung. Linn et al. (1994) fanden, dass (weibliches) Geschlecht einen signifikanten Prädiktor depressiver und Angstsymptomatik darstellte. Hinsichtlich Depressivität trug weiterhin das Ausmaß sozialer Aggression des SHT-Patienten signifikant zur psychischen Belastung bei, während die Ehedauer einen zusätzlichen signifikanten Prädiktor der Angstsymptomatik darstelle – je länger die Paare verheiratet waren, desto weniger Angst wurde angegeben. In der Studie von Kreutzer et al. (1994b) zeigte sich, dass das Ausmaß neurobehavioraler Probleme des Betroffenen den konsistentesten Prädiktor der psychischen Befindlichkeit der Familienangehörigen darstellte. Weiterhin konnten Perlesz et al. (2000) zeigen, dass primäre gegenüber sekundären und tertiären Betreuungspersonen eine schlechtere psychische Befindlichkeit aufweisen. Schließlich wurde häufiger untersucht, ob sich Mütter und Ehefrauen bzw. Lebenspartnerinnen Beeinträchtigung von SHT-Patienten unterscheiden. Die in Annahme dem Ausmaß einer höheren an psychischer Belastung von Partnerinnen und Ehefrauen gegenüber Müttern wurde schon früh – ausgehend von klinischen Beobachtungen – aufgestellt. Dies wird damit begründet, dass Müttern die Rolle der Betreuungsperson bekannt ist und sie diese nach einem SHT wieder einnehmen, während für Partnerinnen diese Rolle häufig nicht dem Entwicklungsstand der Beziehung entspricht – sehr häufig handelt es sich bei den betroffenen um junge Familien – bzw. für Partnerinnen ein Verlust spezifischer Merkmale einer Partnerbindung auftritt, so dass diese höher belastet sein sollten und auch eine negativere psychische Befindlichkeit aufweisen sollten. Die empirischen Ergebnisse weisen zum großen Teil in diese Richtung. Die deutlichste Unterstützung erfährt diese Hypothese durch die Untersuchung von Gervasio und Kreutzer (1997). Ihrer Ansicht nach sind die weiteren vorliegenden inkonsistenten Ergebnisse auf zu kleine Stichproben und zu kurze Beobachtungszeiträume zurückzuführen, da sich die Unterschiede u.U. erst im längeren zeitlichen Verlauf herauskristallisieren, wenn insbesondere jüngere Partner die veränderte Beziehungssituation als zunehmend belastend erleben. 57 Psychische Störung Hinsichtlich psychischer Störung bei Angehörigen von SHT-Patienten liegt u.W. nur eine Studie vor. Gillen, Tennen, Affleck und Steinpreis (1998) untersuchten N = 59 Familienmitglieder im Durchschnitt 18,5 Monate (Range 2-72) nach SHT und erneut 6 Monate später. Die Autoren erhoben die Prävalenz von Major Depression (DSM-III-R). Zum ersten Zeitpunkt wiesen 47 % der Betreuungspersonen eine depressive Störung auf, von denen 31 % nach dem SHT ihres Familienmitglieds erstmalig eine Major Depression entwickelten. 6 Monate später wiesen 43 % eine Major Depression auf. 65 % Prozent der Angehörigen, die zum ersten Zeitpunkt eine Diagnose aufwiesen, hatten auch zum zweiten Zeitpunkt eine depressive Störung. 17 % der Angehörigen, die zum ersten Zeitpunkt keine Diagnose aufwiesen, wurden zum zweiten Zeitpunkt mit Major Depression diagnostiziert. Weder Zeit seit Verletzung noch Beziehungsstatus zum Betroffenen oder das vom Angehörigen eingeschätzte Ausmaß der emotionalen Veränderungen und der Impulskontrolle stellten Prädiktoren des Auftretens einer Major Depression dar. Dagegen stellte die Diagnose einer Major Depression in der Vorgeschichte den einzigen signifikanten Prädiktor unter der betrachteten Variablen dar. Lebenszufriedenheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität Studien zur Lebensqualität von Familienangehörigen von SHT-Patienten liegen bislang kaum vor. Eine prospektive Längsschnittstudie von Hickey, O'Boyle, McGee und McDonald (1997) zeigte eine reduzierte Lebensqualität von Angehörigen (N = 40) im Vergleich zu den Normwerten gesunder Probanden. Weiterhin zeigte sich keine signifikante Veränderung in der Lebensqualität der Angehörigen im Verlauf des ersten Jahres nach der Verletzung. Die wahrgenommene Anzahl physischer und sozialer Probleme einen bis zwei Monate nach Verletzung stellten dabei einen signifikanten Prädiktor der Lebensqualität der Angehörigen ein Jahr nach SHT dar. Daneben liegt eine Querschnittstudie von McPherson, Pentland und McNaughton (2000) vor, in der der SF-36 bei N = 70 Angehörigen von hirngeschädigten Patienten (davon 60 % SHTPatienten) zwischen 15 und 18 Monaten nach Entlassung des Patienten aus stationärer 58 Rehabilitation zum Einsatz kam. Die Ergebnisse wiesen auf eine reduzierte gesundheitsbezogene Lebensqualität der Angehörigen gegenüber der Allgemeinbevölkerung hin, wobei diese Unterschiede nicht statistisch geprüft wurden. Der Schweregrad der Verletzung wies keinen Zusammenhang mit der Lebensqualität auf. Auch das Ausmaß der funktionalen Selbständigkeit des Betroffenen, erhoben mittels Barthel-Index (Mahoney & Barthel, 1965) zeigte keinen Zusammenhang mit den SF-36 Werten, was vermutlich auf einen Deckeneffekt des Barthel-Index zurückgeführt werden kann. Allerdings zeigten andere Maße der psychosozialen Beeinträchtigung des Betroffenen einen signifikanten Zusammenhang mit der Lebensqualität der Angehörigen in dem Sinne, dass diese umso niedriger war, je beeinträchtigter der Patient war. Weiterhin ergab sich, dass Partner gegenüber Eltern in den Skalen Körperliche Schmerzen, Vitalität und emotionale Rollenfunktion signifikant niedrigere Werte aufwiesen. 1.2.2.2 Auswirkungen eines SHT auf die Paarbeziehung Bezüglich der Auswirkungen eines SHT auf die Paarbeziehung liegen nur wenige Studien vor. So zeigte sich, dass Partnerinnen von Patienten mit schwerem SHT eine niedrigere Beziehungsqualität angaben als Partnerinnen von Patienten mit mittelschwerem oder leichtem SHT und als Partnerinnen von Patienten nach traumatischer Rückenmarksverletzung (Peters, Stambrook, Moore & Esses, 1990; Peters et al., 1992). Allerdings handelt es sich hierbei um eine Querschnittstudie mit einem Range von mehreren Jahren nach Verletzung. Livingston et al. (1985) fanden in ihrer prospektiven Studie eine Verschlechterung in der partnerschaftlichen/ehelichen Rollenfunktion vom Zeitpunkt drei Monate zum Zeitpunkt sechs Monate nach Verletzung; zwölf Monate nach SHT zeigte sich keine Veränderung zum vorangegangenen Zeitpunkt. Curtiss, Klemz und Vanderploeg (2000) fanden bei N = 20 Partnern Hinweise auf eine Veränderung paarstruktureller Merkmale in den ersten Wochen nach SHT. Hinsichtlich der Frage der Auflösung einer Beziehung nach einem SHT wurde bereits in frühen Studien darauf hingewiesen, dass viele Beziehungen den Belastungen 59 nach einem SHT nicht gewachsen sind und beendet werden, allerdings liegen hierzu kaum nähere Daten vor. Die genaueste Analyse wurde in der oben bereits erwähnten Studie von Wood und Yurdakul (1997) vorgenommen, in deren Stichprobe sich insgesamt 49 % der Paare 5 bis 8 Jahre nach SHT getrennt hatten. Immerhin entscheidet sich auch ein Großteil der Partner, sich nicht von dem Betroffenen zu trennen. Allerdings geben die Autoren selber zu bedenken, dass neben einem gewissen Anteil an Paaren, die eine gute Beziehung aufweisen, sich darunter auch ein Teil an Paaren befinden dürfte, der unzufrieden ist und in belastenden Beziehungen lebt. Zusammengenommen lässt aber auch diese Studie keine Aussagen darüber zu, ob Trennungen nach SHT signifikant häufiger sind als in der Allgemeinbevölkerung, da offizielle Statistiken nur Scheidungen, aber keine Trennungen berücksichtigen. Wurden nur die Scheidungen betrachtet, so lag die Rate bei Paaren nach SHT nicht über, sondern unter der offiziellen (britischen) Statistik. Daneben liegen zwei qualitative Studien vor, die sich u.a. mit Veränderungen auf der Paarebene nach SHT beschäftigen. In der Untersuchung von Gosling und Oddy (1999) wurden N = 18 Paare 1 bis 7 Jahre nach SHT befragt. Dabei zeigte sich, dass Ehefrauen eine gravierende Rollenveränderung wahrnahmen und sich mehr als ein Elternteil wahrnahmen, was für viele nicht vereinbar war mit einer sexuellen Beziehung zu dem Betroffenen. Die meisten Partnerinnen hatten keine Hoffnung auf Veränderungen in der Zukunft, und für viele bestand der einzige positive Aspekt der Beziehung in einem "Commitment" für die Beziehung und einem Zugehörigkeitsgefühl. In einer qualitativen österreichischen Studie kam es bei 24 % der befragten Betroffenen zu der Auflösung einer bestehenden Beziehung, und 35 % berichteten von gravierenden Veränderungen in der Beziehung (Katzlberger & Oder, 2000). 1.2.2.3 Auswirkungen eines SHT auf das Familiensystem Angesichts der berichteten Auswirkungen auf individuelle Familienmitglieder und die Paarbeziehung ist zu erwarten, dass nach einem SHT auch auf der Ebene des Familiensystems Veränderungen auftreten. Dieser Fragestellung gingen Kreutzer et al. (1994a) bei N = 60 Angehörigen nach. Sie fanden, dass 56 % Angehörigen, die im Mittel 60 16 Monate nach SHT befragt wurden, in der Globalbeurteilung ihrer Familie über dem kritischen Wert lag, der ein negatives familiäres Funktionsniveau anzeigt. Auch in den erfassten familienstrukturellen Dimensionen gaben gegenüber der Allgemeinbevölkerung mehr Angehörige von Personen mit SHT eine negative familiäre Funktionstüchtigkeit an. Am auffälligsten war dabei die Dimension Kommunikation, in der drei Viertel der Angehörigen Probleme berichteten. Dies war auch der Bereich mit der größten Differenz zwischen Angehörigen von SHT-Patienten und Familien der Allgemeinbevölkerung (74 % vs. 32%), dicht gefolgt von der Dimension Affektive Beteiligung (59 % vs. 19 %). Der einzige Bereich, in dem die Angehörigen von SHTPatienten ähnliche Werte wie Familien der Allgemeinbevölkerung angaben, war Problemlösen. Eltern und Partner unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer Einschätzung der familiären Situation. Ebenso wie in anderen Bereichen ergab sich auch hier kein Zusammenhang mit dem Schweregrad des SHT (Kreutzer et al., 1994b). Stattdessen erwiesen sich erneut neurobehaviorale Veränderungen als signifikante Prädiktoren des familiären Funktionsniveaus. Daneben zeigten einige neuropsychologische Maße, ebenso wie die Zeit seit Verletzung, einen Zusammenhang mit familienstrukturellen Dimensionen. So schätzten Angehörige von Betroffenen, bei denen das SHT länger zurücklag, das familiäre Funktionsniveau günstiger ein. Deutlich negativere Einschätzungen der Familiensituation im Vergleich zu Referenzwerten fanden auch Gan und Schuller (2002) im Mittel 5 Jahre nach SHT, jedoch nur im Urteil der Angehörigen, wohingegen die Betroffenen kaum relevante Veränderungen angaben. Douglas und Spellacy (1996) betrachteten eine Stichprobe von N = 30 Patienten und Angehörigen, die im Durchschnitt 7 Jahre nach SHT befragt wurden. Hier bewegte sich die Einschätzung des familiären Funktionsniveaus im Normbereich; Betroffene und Angehörige unterschieden sich nicht signifikant in ihren Urteilen. Die Autoren selbst geben zu bedenken, dass alleine die Tatsache, dass diese Familien noch immer existierten, einen Hinweis dafür darstellen könnte, dass es sich bei ihrer Stichprobe um "Erfolgsgeschichten" handelt, d.h. um eine sehr selektive Gruppe von Familien. Signifikante Prädiktoren des familiären Funktionsniveaus waren in dieser Studie u.a. das Vorhandensein sozialer Unterstützung und das Ausmaß neurobehavioraler Symptome des Betroffenen. Einen deutlichen Zusammenhang zwischen neurobehavioralen Symptomen und familiärer Funktionstüchtigkeit fanden auch Groom, Shaw, O'Connor, 61 Howard und Pickens (1998), wohingegen der Schweregrad des SHT auch bei dieser Untersuchung keinen Einfluss hatte. 1.2.2.4 Familiäre Merkmale und Adaptation nach SHT Zur Frage des Einflusses familiärer Merkmale auf die Adaptation nach SHT liegen nur sehr wenige Studien vor. Eine Zusammenfassung der entsprechenden Arbeiten findet sich in Tabelle 5. Pelletier und Alfano (2000) fanden in einer Studie mit N = 13 Paaren im Mittel ca. vier Jahre nach Verletzung signifikante Korrelationen zwischen konfrontativem Bewältigungsverhalten des Partners und der subjektiven Belastung des Betroffenen. Ferner zeigte sich, dass die subjektive Belastung des Partners durch die physischen Beeinträchtigungen des Patienten signifikant mit einer erhöhten Depressivität und subjektiven Belastung des SHT-Patienten in Zusammenhang standen. In einer Studie mit N = 39 Patienten mehrere Jahre nach Verletzung fanden Leach et al. (1994) einen Zusammenhang zwischen familiären Bewältigungsformen – aus der Sicht des Patienten – und Depressivität des Betroffenen. Diese Studie lieferte Hinweise, dass die Fähigkeit der Familie, soziale Unterstützung zu generieren, mit einem niedrigeren Ausmaß an Depressivität des Betroffenen einhergeht. Ausgehend von einer familienentwicklungspsychologischen Perspektive untersuchten Moore, Stambrook und Peters (1993) die Rolle zentripetaler und zentrifugaler familiärer Faktoren auf die Adaptation von SHT-Patienten. An der Studie nahmen N = 65 Paare teil, die im Mittel etwa vier Jahre (Range 4-93 Monate) nach SHT befragt wurden. Als zentripetale Faktoren wurde das familiäre Bewältigungsverhalten, die partnerschaftliche Beziehungsqualität und die Ehedauer betrachtet. Zentrifugale Faktoren waren Anzahl der Kinder, Alter des ältesten Kindes und Ausmaß der finanziellen Belastung nach SHT. Den größten prädiktiven Wert für die emotionale Befindlichkeit und Lebensqualität des SHT-Patienten wies die finanzielle Belastung auf. Teilweise wirkte das Alter des ältesten Kindes als Prädiktor, wobei sich zeigte, dass mit niedrigerem Alter des Kindes mehr Probleme auf Seiten des Betroffenen bestanden. Daneben wirkte das Ausmaß der familiären Bewältigungsbemühungen günstig auf die psychische Befindlichkeit des 62 Betroffenen (Fremdrating des Partners), und eine höhere Beziehungsqualität ging mit geringeren Problemen im Freizeitbereich (Fremdrating des Partners) einher. Weitere Studien, die familiäre Strukturmerkmale berücksichtigten, stammen zum einen von Kaplan (1991). In dieser Studie zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen familiärer Kohäsion und Problemen in den Bereichen Emotionalität und sozialem Verhalten des Betroffenen 3 Jahre nach SHT. Je höher die Kohäsion durch die primären Betreuungspersonen eingeschätzt wurde, desto weniger Probleme äußerte der Betroffene in diesen Bereichen. Daneben zeigte sich ein positiver Einfluss familiärer Kohäsion auf den aktuellen beruflichen Status. Außerdem zeigte sich u.a. ein signifikanter Zusammenhang zwischen familiärem Konflikt und Problemen im Bereich physischer Leistungsfähigkeit. Zum anderen ist hier eine aktuelle Studie von Sander et al. (2002) zu erwähnen. Sie untersuchten N = 37 Patienten und deren Familienmitglieder. Die familienstrukturellen Merkmale wurden zu Beginn der postakuten stationären Rehabilitation erhoben. Anhand der Angaben der Familienmitglieder wurden Familien in "gesund" und "gestört" hinsichtlich ihres generellen Funktionsniveaus eingeteilt. Es zeigte sich ein Einfluss des familiären Funktionsniveaus auf die Verbesserung in den Beeinträchtigungen (allgemein, funktionale Beeinträchtigung, Berufsfähigkeit) des Patienten. Patienten aus gut funktionierenden Familien verbesserten sich deutlicher während des Rehabilitationsaufenthaltes. Schließlich ist die oben bereits erwähnte Studie von Webb et al. (1995) zu nennen, die in einem pfadanalytischen Modell den positiven Effekt familiärer Zufriedenheit (bzw. Unterstützung) auf die Lebensqualität von SHT-Patienten, vermittelt über eine positivere Mobilität des Betroffenen, aufzeigen konnten. Allerdings ist nicht klar, ob sich das Ergebnis auf die 1- oder 2-Jahres-Angaben bzgl. des familiären Merkmals stützen, und der Publikation ist nicht zu entnehmen, wie familiäre Zufriedenheit (bzw. Unterstützung) operationalisiert wurde; der Verweis auf die entsprechende Literaturquelle bring dabei keine Aufhellung. 63 Tabelle 5: Überblick der Studien zum Einfluss familiärer Merkmale auf die Adaptation von SHT-Patienten Autor Kaplan (1991) Familiäre Merkmale Studien- Stich- Zeit seit Ergebnisse design probe (N) Verletzung Familienstrukturelle QS 25 Patienten 3 Jahre Merkmale (LS) a 25 primäre Betreuungspersonen) korreliert negativ mit Betreuungs- Emotionalität und sozialem Verhalten des personen Betroffenen, d.h. je höher Kohäsion, desto Familiäre Kohäsion (Angabe der weniger Probleme. Familiärer Konflikt korreliert positiv mit physischen Einschränkungen des Patienten, d.h. je mehr Konflikt, desto beeinträchtigter. Religiöse Orientierung sowie familiäre Organisation korrelieren negativ mit Emotionalität und sozialem Verhalten. Familiäre Kohäsion hat einen Einfluss auf Wiedereingliederung (Beruf/Schule) Leach et al. (1994) Familiäre Bewältigungsstrategien QS 39 Patienten M = 45 Monate Fähigkeit der Familie, soziale Unterstützung zu SD = 68 generieren, hat einen Einfluss auf die Depressivität des Betroffenen, d.h. je mehr soziale Unterstützung generiert wird, desto niedriger die Depressivität des Betroffenen 64 Fortsetzung Tabelle 5 Moore et al. (1993) Zentripetale (familiäre Bewältigungsstrategie, QS 65 Paare M = 46 Monate Zentripetale Faktoren: Ausmaß familiärer (Range 4-93) Bewältigungsbemühungen und Beziehungsqualität, Beziehungsqualität (Partnerangaben) Ehedauer) und Prädiktoren allg. psychischer Beschwerden und zentrifugale (Anzahl der Freizeitaktivitäten des Betroffenen der Kinder, Alter des (Partnerangaben), d.h. je höher ausgeprägt, ältesten Kindes, desto weniger Probleme auf Seiten des finanzielle Belastung Betroffenen; keine signifikanten Prädiktoren nach SHT) familiäre wenn Patientenangaben betrachtet werden Merkmale Zentrifugale Faktoren: Finanzielle familiäre Belastungen Prädiktor einer negativeren Anpassung (Partner- und Patientenangaben); Alter des ältesten Kindes Prädiktor einer schlechteren Anpassung im (psycho)-sozialen Bereich, d.h. je jünger das älteste Kind, desto mehr Probleme (Partner- und Patientenangaben) 65 Fortsetzung Tabelle 5 Pelletier & Alfano Individuelles (2000) QS 13 Patienten M = 4 Jahre Bewältigungsverhalten der Familienmitglieder Bewältigungsverhalten 13 Familien- SD = 2.6 korreliert nicht mit Depressivität des Patienten; der Familienmitglieder, mitglieder Konfrontative Bewältigung korreliert positiv mit Wahrgenommene subjektiver Belastung des Patienten (r = .60); Belastung der Wahrgenommene Belastung der Familienmitglieder Familienmitglieder aufgrund der physischen Beeinträchtigungen des Patienten korreliert negativ mit Depressivität und wahrgenommener Belastung des Patienten (r = -.62 bzw. -.69), d.h. je höher die Belastung der Familienmitglieder, desto niedriger Depressivität und Belastung des Patienten Sander et al. Familienstrukturelle (2002) Merkmale LS 37 Patienten M = 607 Tage Patienten aus als "gesund" eingeschätzten 37 Familien- Range 67- Familien (Angabe Familienmitglieder) zeigen mitglieder 1676; M = 41 eine stärkere Verbesserung zwischen Tage (Range Rehabilitationsbeginn und Follow-up hinsichtlich 26-129) nach genereller Beeinträchtigung, funktionaler Entlassung aus Beeinträchtigung und Berufsfähigkeit als post-akuter Patienten aus Familien, die als "gestört" Rehabilitation eingeschätzt werden 66 Fortsetzung Tabelle 5 Webb et al. (1995) ?b LS 116 Patienten 1, 2 Jahre Familiäre Zufriedenheit übt indirekt einen Einfluss auf die Lebensqualität aus über Reduktion von Impairments und Verbesserung der funktionalen Selbständigkeit 2 Jahre nach Verletzung Anmerkungen. LS: Längsschnittstudie; QS: Querschnittstudie; M: Mittelwert; SD: Standardabweichung a b Hierbei handelt es sich um eine Längsschnittstudie, allerdings wurden die familiären Merkmale nur zum Follow-up Zeitpunkt erhoben. Im Artikel wird sowohl von "family satisfaction" als auch von "family support" gesprochen, die Operationanlisierung ist aber unklar; ein entsprechender Verweis auf die Literaturquelle klärt die Frage nicht auf. 67 1.2.2.5 Zusammenfassende Bewertung Die vorliegenden Studien zur Situation der Familie nach SHT zeigen, dass dieses ein bedeutsames Ereignis für die gesamte Familie darstellt. In der Folge eines SHT sind Familienmitglieder mit Anforderungen konfrontiert, die sich für viele zu Belastungen ausweiten. Dies zeigt sich u.a. in den Studien zur psychischen Befindlichkeit von Familienangehörigen. Allerdings ist hier anzumerken, dass – ebenso wie in Untersuchungen zur Adaptation von Betroffenen – eine große Heterogenität hinsichtlich Zeit seit Verletzung, verwendete Untersuchungsinstrumente und Stichprobengröße besteht. Weiterhin handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um Querschnittstudien. Die vorliegenden prospektiven Untersuchungen zur psychischen Befindlichkeit von Angehörigen weisen im Verlauf des ersten Jahres nach SHT eine vergleichsweise konstante Rate an Personen aus, die als klinisch auffällig einzustufen sind. Trotz methodischer Schwächen der Studien zeigt sich relativ konsistent, dass die Befindlichkeit von Angehörigen weniger mit objektiven Parametern, wie dem Schweregrad der Verletzung, der Zeit seit Verletzung und Einschränkungen der funktionalen Selbständigkeit des Betroffenen zusammenhängt, sondern deutlicher mit subjektiven Parametern wie der wahrgenommenen Belastung und dem Ausmaß an neurobehavioralen Folgen des Betroffenen. Diese scheinen auch von besonderer Bedeutung für Belastungen der Paarbeziehung und der Familienstruktur zu sein. Dementsprechend ist es nahe liegend, dass einige Beziehungen diesen Belastungen nicht standhalten und aufgelöst werden. In diesem Fall scheint Zeit jedoch eine wichtige Variable zu sein. Wie die Analyse von Wood und Yurdakul (1997) zeigte, spielt sowohl die Beziehungsdauer vor SHT als auch die Zeit, die seit der Verletzung vergangen ist, eine Rolle. Während die ersten zwei Jahre noch eher als durch Hoffnung auf Verbesserung gekennzeichnet sind, scheint danach eher Ernüchterung einzutreten, so dass im Zeitraum zwei bis fünf Jahre nach Verletzung Beziehungsauflösungen am wahrscheinlichsten sind. Ein Grund hierfür ist, dass die Beziehungen häufig nicht mehr die Charakteristika einer Partnerschaft aufweisen (vgl. auch Gosling & Oddy, 1999). Daneben gibt es aber auch Beziehungen und Familien, die bestehen bleiben. Darunter sind solche, bei denen es den Beteiligten gelingt, eine gute 68 Funktionstüchtigkeit zu erzielen – auf die positiven Adaptationsergebnisse, die häufig übersehen werden, hat z.B. Adams (1996) aufmerksam gemacht – und solche, die trotz Belastungen und negativen Veränderungen aufrechterhalten werden. Auch in Bezug auf das familiäre Funktionsniveau legen die vorhandenen Studien nahe, dass vornehmlich die neurobehavioralen Folgen einen entscheidenden Zusammenhang mit familiären Belastungen aufweisen. Kausale Aussagen sind aufgrund des Mangels an Längsschnittstudien nur schwer zu treffen. Insgesamt fällt auf, dass mehr Studien zu den Auswirkungen eines SHT auf die Familie vorliegen als Studien, die den Einfluss familiärer Parameter auf die Adaptation des Betroffenen untersuchen. Bei den wenigen hierzu vorliegenden Arbeiten handelt es sich nahezu ausschließlich um Querschnittstudien mit z.T. sehr niedrigen Stichprobengrößen. Diese Studien fanden signifikante Zusammenhänge zwischen familiären Merkmalen und der Adaptation des Betroffenen, allerdings sind aufgrund der geringen Anzahl an Studien, die zudem unterschiedliche Aspekte und Verfahren berücksichtigten, keine systematischen Zusammenhänge erkennbar. Theoretisch ließen sich auch die Studien zu Patientenmerkmalen und familiärer Belastung ebenfalls hier einordnen (z.B. Groom et al., 1998; Kreutzer et al., 1994b), da es sich hierbei um Querschnittstudien handelt, die keinen definitiven kausalen Schluß erlauben. So wäre theoretisch ebenso denkbar, dass eine niedrigere familiäre Funktionsfähigkeit einen Einfluss auf neurobehaviorale Symptome des Betroffenen ausübt. Insgesamt liegen somit Hinweise auf einen Einfluss familiärer Merkmale auf die Adaptation von SHTPatienten vor, die bislang jedoch nicht konsistent und überzeugend sind. Bezüglich der Schwierigkeiten bei der Durchführung entsprechender Studien gelten die oben angeführten Probleme hier in gleicher Weise (z.B. Dauer der Stichprobengewinnung, Teilnahmerate). Erschwerend kommt bei Studien zum Thema Familie und SHT jedoch hinzu, dass neben Betroffenen auch Familienmitglieder für die Teilnahme gewonnen werden müssen – sofern die Aussagen zu familiären Merkmalen nicht (ausschließlich) auf der Sichtweise des SHT-Patienten beruhen sollen. 69 1.2.3 Zusammenfassende Bewertung des Forschungsstandes zur Rolle sozialer Faktoren im Adaptationsprozess nach SHT Der Stand der Forschung hinsichtlich des Einflusses des sozialen Netzwerks und sozialer Unterstützung bei SHT ist insgesamt ernüchternd. Im Ergebnis zeigt die Mehrzahl der Studien keinen positiven Einfluss sozialer Unterstützung auf die Adaptation nach SHT. Diese Aussage wird eingeschränkt durch die betrachteten Parameter sozialer Unterstützung. In vielen Fällen stellt der Familienstand das einzige Merkmal sozialer Integration dar. Dieser ist allerdings nur ein äußerst schwacher Indikator des sozialen Netzwerks. Die Forschungslage bei SHT ist somit deutlich insuffizienter als z.B. bei Schlaganfall. Hier liegen prospektive Studien mit hohen Fallzahlen vor, die einen positiven Einfluss des Familienstandes und des sozialen Netzwerks, vor allem auf funktionale Selbständigkeit und Lebensqualität des Patienten, aufzeigen konnten (vgl. Dinkel & Balck, 2001a). Deutlich in der Minderheit sind Studien, in welchen die Rolle wahrgenommener Unterstützung bei SHT untersuchen – dem Merkmal sozialer Unterstützung, welches in der Regel die konsistentesten Zusammenhänge mit Adaptationsmerkmalen aufweist (z.B. Ren, Skinner, Lee & Kazis, 1999). Die vorliegenden Studien finden zwar signifikante Zusammenhänge mit der Anpassung nach SHT, jedoch handelt es sich dabei ausschließlich um Querschnittstudien. Hier ist die Situation vergleichbar mit der Forschungslage bei Schlaganfall. Auch bei diesem neurologischen Störungsbild dominieren zahlenmäßig Studien, die Netzwerkparameter untersuchen gegenüber solchen, die wahrgenommene Unterstützung betrachten (vgl. Dinkel & Balck, 2001a). Im Unterschied zu Schlaganfall liegt bei SHT keine Studie vor, die den Einfluss erhaltener Unterstützung untersucht. Ebenso liegt bei SHT, wiederum im Unterschied zu Schlaganfall, keine Untersuchung vor, die das Augenmerk auf überfürsorgliches Verhalten oder negative Aspekte sozialer Interaktion legt. Sozialer Konflikt tritt zwar seltener auf als positive soziale Interaktion, ist in der Wirkung auf Anpassungsmerkmale jedoch häufig gewichtiger (vgl. Dinkel & Balck, 2001a). Bei Schlaganfall existieren zudem Studien, die nicht nur die Wirkung überfürsorglichen Verhaltens auf den Patienten untersuchen, sondern auch Determinanten dieses "negativen Hilfeverhaltens" 70 identifizieren (Thompson & Sobolew-Shubin, 1993; Thompson, Galbraith, Thomas, Swan & Vrungos, 2002). Studien bei SHT, in denen die geleistete Unterstützung untersucht wird, fehlen völlig. Es ist bislang nicht bekannt, wie Betreuungspersonen einem SHT-Patienten konkret Hilfe leisten. Dies ist insofern eine andere Perspektive, als hier nicht der Empfänger sozialer Unterstützung im Mittelpunkt steht, sondern der Geber der Unterstützung. Entsprechende Studien liegen z.B. bei Herzinfarkt vor. Hier konnten Coyne und Smith (1991) beispielsweise aufzeigen, dass protektives Abfedern durch den Partner einen positiven Zusammenhang mit Adaptationsmerkmalen des Patienten aufweist, für den Partner jedoch mit psychischen Kosten verbunden ist. Das Zusammenspiel von protektivem Abfedern, aktiver Beteiligung und überfürsorglichem Verhalten wurde von Kuijer et al. (2000) bei Krebspatienten und deren Partnern untersucht. Studien, die soziale Unterstützungsprozesse in einer kontextuellen Perspektive unter Einschluss der Perspektive des Unterstützenden und Unterstütztem betrachten – wie sie vor allem für Krebs (z.B. Bolger, Foster, Vinokur & Ng, 1996) und Herzinfarkt (z.B. Bennett & Connell, 1999; Pistrang, Clare & Baker, 1999) vorliegen – existieren bei SHT nicht. Ebenso liegen keine Erkenntnisse hinsichtlich des Verlaufs der Unterstützung und Determinanten der Unterstützung bei SHT vor. Beispielsweise konnten Bolger et al. (1996) zeigen, dass Partner von Brustkrebspatientinnen nicht gleich bleibend viel Unterstützung leisten (können), sondern dass diese im zeitlichen Verlauf abnimmt, wenn die Partner keinen Erfolg ihrer Unterstützungsbemühungen feststellen. Collins und Feeney (2000) und Simpson, Rholes, Orina und Grich (2002) konnten ferner zeigen, dass Bindungsstile einen Einfluss auf Art und Ausmaß der geleisteten Unterstützung ausüben. Die differentielle Wirksamkeit emotionaler und instrumenteller Unterstützung in Abhängigkeit von Bindungsstilen konnten Mikulincer und Florian (1997) aufzeigen. Ein weiterer vernachlässigter Aspekt in der Forschung zu Rolle sozialer Unterstützung bei SHT ist die Frage, inwieweit Merkmale der Beziehung zwischen dem Patienten und der Betreuungsperson vor der Verletzung das Hilfeverhalten nach SHT beeinflussen (vgl. Horowitz & Shindelman, 1983; Williamson & Schulz, 1995). 71 Schließlich liegen bei SHT keine Studien vor, welche die subjektive Konzeptualisierung von Hilfeverhalten thematisieren, wobei diese Perspektive in der Unterstützungsforschung generell unterrepräsentiert ist. Beispielsweise konnten Wrubel, Richards, Folkman und Acree (2001) zeigen, dass "stille" Definitionen, d.h. unterschiedliche subjektive Repräsentationen, darüber vorliegen, was Hilfeverhalten ausmacht. Wrubel und Folkman (1997) konnten weiterhin zeigen, das Partner von AIDS-Patienten Hilfeleistungen erbringen, die in Instrumenten zur Erfassung sozialer Unterstützung häufig nicht repräsentiert sind – dies gilt umso mehr, wenn Verfahren zur Erfassung von Alltagsunterstützung im Kontext von Unterstützung nach konkreten belastenden Ereignissen wie z.B. Krankheit eingesetzt werden. Hinsichtlich der Bedeutung familiärer Strukturmerkmale bzw. des generellen familiären Funktionsniveaus zeigen die bei SHT vorliegenden Studien in der Regel signifikante Zusammenhänge mit der Adaptation des Betroffenen. Allerdings liegen nur wenige Längsschnittstudien vor, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschränkt wird. Entsprechende Befunde, wonach das familiäre Funktionsniveau einen Einfluss auf den Status des Betroffenen ausübt, finden sich auch bei prospektiven Längsschnittstudien bei Schlaganfall (z.B. Evans, Bishop & Haselkorn, 1991; Evans et al., 1987; vgl. Dinkel & Balck, 2001a). Deutliche Hinweise für die Relevanz des familiären Funktionsniveaus für die Anpassung nach SHT liefern vor allem Studien mit Kindern und Jugendlichen, die ein SHT erlitten haben (Dinkel & Balck, 2001b). Hier liegen mehrere Längsschnittstudien vor (z.B. Rivara et al., 1993; Yeates et al., 1997), auf die an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen wird, da ein deutlicher Unterschied zwischen SHT bei Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen besteht. Charakteristisch für ein SHT bei Kindern/Jugendlichen ist, dass die Verletzung in eine inhärente, fortlaufende individuelle Entwicklung eingreift. Während bei Erwachsenen die grund legende Frage von Outcome-Studien ist, inwieweit das prämorbide Niveau erreicht wird, ist bei Kindern das prämorbide Niveau nicht identisch mit dem letztendlich erreichten Fertigkeitenniveau, selbst wenn es zu einer "vollständigen" Genesung kommt. Aufgrund dieses strukturellen Unterschiedes sind Studienergebnisse Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen nach SHT nur schwer vergleichbar. bei 72 Auffällig ist, dass bei SHT zwar Studien vorliegen, die familiäre Merkmale betrachten, jedoch keine, die paarstrukturelle Merkmale oder die generelle partnerschaftliche Beziehungsqualität untersuchen. Während aus anderen Bereichen Belege für einen negativen Einfluss von parterschaftlichem Stress und einer niedrigen Beziehungsqualität vorliegen (z.B. Cano, Weisberg & Gallagher, 2000; Orth-Gomér et al., 2000), existiert keine Studie, die den Einfluss der prämorbiden Beziehungsqualität auf die Adaptation nach SHT untersucht hat. In Bezug auf die Rehabilitationsforschung stellen Chwalisz und Vaux (2000, S. 543) fest: "Social support appears extensively in the disability literature. However, much of the research has been atheoretical, ignoring developments in social support theory and research". Dies gilt auch für die Forschung bei SHT, die bislang zwar Hinweise auf die Relevanz sozialer Faktoren erbracht hat, die jedoch kein konsistentes Muster erkennen lassen. Auffallend ist dabei, dass u.W. bislang keine Studie aus dem deutschsprachigen Raum vorliegt, welche die Bedeutung sozialer Merkmale für die Adaptation nach SHT untersucht hat. 73 1.3 Fragestellung der eigenen Untersuchung Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Studie lautet: Welchen Beitrag leisten soziale Faktoren für die Adaptation des Betroffenen nach SHT? Die zu berücksichtigenden sozialen Faktoren lassen sich dabei unterscheiden in Merkmale der sozialen Unterstützung und Merkmale der partnerschaftlichen Beziehung sowie der familiären Struktur. Unter den Merkmalen sozialer Unterstützung soll dabei das von der Betreuungsperson geleistete Ausmaß an Hilfe betrachtet werden. Hier ist nahe liegend, dass ein Zuwenig an Hilfe nicht zu einer Verbesserung der Adaptation des Patienten beiträgt, während ein hohes Ausmaß an Hilfe einen positiven Effekt haben sollte. Zu Bedenken ist jedoch ferner, dass ein Zuviel an geleisteter Hilfe einen negativen Effekt haben kann, wie z.B. vorliegende Studie zu überfürsorglichem Verhalten nach Schlaganfall verdeutlichen. Die geleistete Hilfe kann sich auf einen oder wenige Bereiche erstrecken, oder aber auch in sehr vielen Bereichen auftreten. Dies bedeutet, dass ein Unterschied in der Vielseitigkeit der geleisteten Hilfe vorliegen kann. Dabei ist es möglich, dass supportives Verhalten, das auf einen eng umschriebenen Bereich begrenzt ist, besonders hilfreich sein kann, da dann die Kapazitäten auf den wesentlichen Bereich konzentriert werden – sofern die Hilfe in dem tatsächlich wesentlichen Bereich geleistet wird. Genauso ist denkbar, dass supportives Verhalten in möglichst vielen Bereichen sehr effektiv ist, da dadurch ein synergistischer Effekt erzielt werden kann. Weiterhin erscheint es uns wesentlich, die subjektiven Vorstellungen der Betreuungspersonen hinsichtlich des eigenen Hilfeverhaltens zu untersuchen. Angesichts eines SHT einer nahe stehenden Person finden sich Betreuungspersonen i.d.R. mit einer Situation konfrontiert, die für sie völlig neuartigen Charakter hat. Hier sind interindividuell unterschiedliche Vorstellungen bzgl. der Form der zu erbringende Hilfe zu erwarten. Dabei kann vermutet werden, das bestimmte Vorstellungen über das eigene Helfen adäquater sind als andere, was sich in dem konkret geleisteten Hilfeverhalten niederschlagen sollte. 74 Diese drei Komponenten sozialer Unterstützung stellen die Prädiktorvariablen der Untersuchung dar. Neben diesen Prädiktorvariablen sollen verschiedene Moderatorvariablen betrachtet, da wir annehmen, dass die Wirkung der Prädiktorvariablen unterschiedlich ausfallen kann in Abhängigkeit verschiedener bestehender Rahmenbedingungen. Eine Gruppe möglicher relevanter Moderatorvariablen sind individuumsbezogene Merkmale. Hier sind zunächst unterstützungsbezogene Einstellungen zu nennen, die sich auf die subjektive Bewertung der unterstützenden Person bzgl. der Notwendigkeit, Wirksamkeit und Akzeptanz von supportivem Verhalten beziehen. Weitere relevante individuelle Merkmale sind Aspekte des Wohlbefindens der Betreuungsperson. So lässt sich annehmen, dass ein hohes Maß an psychischer Belastung einer adäquaten Unterstützung eher entgegensteht, oder aber dass Hilfeverhalten im Dienste der eigenen Befindlichkeitsregulation eingesetzt wird, sich somit primär an den eigenen Bedürfnissen orientiert und u.U. für den Betroffenen wenig hilfreich ist. Neben diesen individuellen sollten auch beziehungsbezogene Merkmale von Bedeutung sein. So lässt sich beispielsweise annehmen, dass unterstützendes Verhalten einer Person mit einem sicheren Bindungsstil kontinuierlicher und adäquater geleistet werden kann, da diese eher an Bedürfnissen des Patienten orientiert ist. Weiterhin ist beispielsweise denkbar, dass supportives Verhalten im Kontext einer Beziehung, die sich durch eine niedrige Beziehungsqualität auszeichnet, ambivalenter und inkonsistenter geleistet wird und somit in geringerem Maß zu einer positiven Anpassung beiträgt. Entsprechendes gilt z.B. auch für supportives Verhalten im Kontext einer niedrigen familiären Kohäsion. 75 1.4 Studiendesign Die dargestellte Fragestellung soll in einer prospektiven Längsschnittstudie bei SHT-Patienten und deren Partnern untersucht werden. Es handelt sich um eine naturalistische Studie mit einer anfallenden Stichprobe. Der erste Untersuchungszeitpunkt (T1) soll möglichst frühzeitig (ca. 4 Wochen) nach der stationären Aufnahme des Patienten in die Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden stattfinden. Die Follow-up Zeitpunkte sind: • T2: 6 Monate nach Verletzung • T3: 12 Monate nach Verletzung • T4: 18 Monate nach Verletzung Die angestrebte Stichprobengröße beträgt N = 60 Ehepaare. Ursprünglich wurde im Projektantrag die Anzahl von 50 männlichen Patienten und deren Partnerinnen angestrebt. Der Bewilligungsbescheid enthielt jedoch den Wunsch, zusätzlich eine kleine Gruppe von Patientinnen und deren Partner zu rekrutieren (N = 10), so dass die Stichprobengröße auf 60 festgesetzt wurde. Die Paare sollen in die Studie aufgenommen werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: • Der Patient soll ein SHT 2. Grades erlitten haben. • Es soll sich um ein gedecktes (geschlossenes) SHT handeln. • Die Ehedauer soll mindestens 3 Jahre betragen. • Die Beziehung soll aktuell bestehen. • Das Alter des Patienten soll zwischen 20 und 55 Jahren liegen. Als Ausschlusskriterien sollen gelten: • Komadauer über 7 Tage, • aphasische Störung, • vorrangige Schädigung des Frontalhirns, 76 • prämorbid keine psychiatrische Störung oder chronische somatische Erkrankung des Patienten, • prämorbid keine psychiatrische Störung oder chronische somatische Erkrankung des Partners, • ggf. vorhandene Kinder sollten keine Behinderung aufweisen. 77 1.4.1 Erhebungsinstrumente Die Partner des Patienten wurden zu T1 mittels eines halbstrukturierten Leitfadeninterviews befragt (s. Anhang), in dem Aspekte der Veränderung, der Belastung und der Unterstützung angesprochen wurden. Die ersten drei Fragen des Interviews waren mit den Angehörigenprojekten des Reha-Forschungsverbundes BerlinBrandenburg-Sachsen (BBS) abgestimmt. Weiterhin kam ein selbstentwickeltes Card Sorting-Verfahren zum Einsatz, und den Partnern wurden verschiedene Fragebögen vorgelegt. Eine Gesamtübersicht der verwendeten Verfahren liefert Tabelle 10. 1.4.1.1 Erfassung von Partnermerkmalen Merkmale der Unterstützung Das Ausmaß der geleisteten Unterstützung wurde mittels Selbst- und Fremdeinschätzung erfasst. Da die Items der vorliegenden deutschsprachigen Verfahren für den Einsatz unter den Umständen dieser Untersuchung ungeeignet erschienen, konstruierten wir eine neue Skala zur Erfassung sozialer Unterstützung. Die Selbsteinschätzung sozialer Unterstützung geschah mittels vier Items, die auf einer 6-stufigen Skala (1, "überhaupt nicht" bis 6, "in sehr starkem Maß") durch die Partner direkt nach dem Interview beantwortet wurden. Die vier Items bilden grob zentrale Aspekte sozialer Unterstützung ab: emotionale Unterstützung ("Inwieweit versuchen Sie, auf die Stimmung Ihres Partners Einfluss zu nehmen?"), informative Unterstützung ("Inwieweit sind Sie bemüht, Ihren Partner mit Informationen zu versorgen?") und instrumentelle Unterstützung ("Inwieweit helfen Sie Ihrem Partner bei Dingen, die er nicht alleine machen kann?"). Zusätzlich wurde mittels eines Items konkrete Hilfe bei der Genesung abgefragt und somit der Krankheits- bzw. Verletzungsaspekt berücksichtigt ("Inwieweit versuchen Sie, auf die Genesung Ihres Partners Einfluss zu nehmen?"). Die Auswertung erfolgt über den Mittelwert dieser zu einer Skala (SU-S) zusammengefassten Items (s. Anhang). Die interne Konsistenz in der Gesamtstichprobe (T1) betrug Alpha = .53. 78 Die Fremdeinschätzung des Ausmaßes geleisteter Unterstützung geschah mittels eines Raters, der die entsprechenden vier Aspekte auf einer 4-stufigen Skala (0="gar nicht", 1="in geringem Ausmaß", 2="in mittlerem Ausmaß", 3="in hohem Ausmaß") einschätzte, zusätzlich stand die Kategorie "nicht einschätzbar" zur Verfügung. Das Rating wurde nach dem Anhören des kompletten Interviews durchgeführt. Die Beschreibung der Entwicklung des Ratings sowie die Ratinganleitung finden sich im Anhang. Die vier Items wurden ebenfalls zu einer Skala zusammengefaßt (SU-I). Die Auswertung erfolgt über den Mittelwert der Skala. Die interne Konsistenz der Skala in der Gesamtstichprobe (T1) lag bei Alpha = .56. Die Art der Unterstützung wurde erfasst, indem supportive Verhaltensweisen, die die Partner im Interview nannten, notiert wurden. Dies bedeutet, dass alle Tonbänder von Projektmitarbeitern angehört wurden und während dieses Vorgangs die von den Partnern im Gespräch genannten unterstützenden Handlungen schriftlich fixiert wurden. Die Durchführungsanweisung dieser Transkription findet sich im Anhang. Die genannten Handlungen wurden einer von 14 Kategorien zugeordnet (vgl. Anhang). Die Entwicklung des Kategoriensystems ist im Anhang dargestellt. Dreizehn dieser Kategorien wurden für die statistische Auswertung zu 3 Dimensionen zusammengefasst: • Supportive emotionale Handlungen (SU-EM): Hier gehen die fünf Kategorien "Emotionskontrolle", "Persönlicher Kontakt", "Zuneigung", "Empathie" und "Einflussnahme auf Stimmung" ein. Beispiele für entsprechende supportive Handlungen sind: (Emotionskontrolle); lässt sich täglicher eigene Besuch schlechte Stimmung (Persönlicher nicht Kontakt); anmerken Körperkontakt aufnehmen (Zuneigung); Patienten sagen, dass man zu ihm hält (Empathie); Trost spenden (Einflussnahme auf Stimmung). • Supportive praktische Handlungen (SU-PR): Hier gehen die fünf Kategorien "Feedback", "Praktische Hilfe", "Unterstützung der medizinischen Behandlung/des Genesungsverlaufs", "Positive Bewertung und Aktivierende Inangriffnahme" sowie "Zukunftsperspektiven" ein. Beispiele für entsprechende supportive Handlungen sind: Fortschritte aufzeigen, die der Patient gemach hat (Feedback); Patienten aus dem Bett helfen (Praktische Hilfe); Hilfe bei der Ergotherapie (Unterstützung der 79 Behandlung); Mut zusprechen (Positive Bewertung und Inangriffnahme); sich mit Patienten unterhalten wie es weiter geht (Zukunftsperspektiven). • Supportive soziale Handlungen (SU-SO). Diese Dimension umfasst die drei Kategorien "Information/Einbindung in Familie und soziales Umfeld", "Weiterführung des bisherigen Lebensstils" und "Anpassung des Wohnumfelds an vorhandene Beeinträchtigungen". Beispiele für supportive Handlungen aus diesem Bereich sind: Informationen über familiäre Angelegenheiten geben (Information/Einbindung in Familie und soziales Umfeld); Bemühungen, das Leben normal weiter laufen zu lassen (Weiterführung des bisherigen Lebensstils) und Bad umbauen (Anpassung des Wohnumfelds an Beeinträchtigungen). In die Auswertung ging die Anzahl der genannten Handlungen je Kategorie ein. Zusätzlich wurde ein Gesamtscore gebildet, der die Anzahl der Handlungen dieser drei Kategorien sowie die Anzahl der Handlungen der Kategorie "nicht zuzuordnen" umfasst (SU-HA). Diese Scores stellen somit ebenfalls einen Indikator des Ausmaßes sozialer Unterstützung dar, der jedoch auf konkreten Angaben beruht. Weiterhin wurde ein Index der Flexibilität und Vielseitigkeit der Unterstützung gebildet Dieser (SU-V). basiert auf der Summe der zutreffenden 14 Handlungskategorien. Dies bedeutet, dass die Anzahl der unterschiedlichen Kategorien, der die notierten supportiven Verhaltensweisen zugeordnet wurden, berechnet wurden. Die intendierte Unterstützung wurde mittels eines Card Sorting-Verfahrens erhoben. Dazu wurden 30 Aussagen formuliert, die ein Ziel der eigenen Unterstützungshandlungen darstellen. Ausgehend von einer Klassifizierung von Aymanns (1992) orientierten wir uns zunächst an drei Funktionen sozialer Unterstützung: • Sicherung der Rahmenbedingungen für die Auseinandersetzung mit krankheitsbedingten Problemen (SU-F1), die die Subfunktionen a) Stützung des emotionalen Gleichgewichts, b) Stützung des Selbstwertgefühls und der 80 Identitätswahrnehmung, c) Vermittlung partnerschaftlicher Bindungssicherheit umfasst; • Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse durch direkte Einflussnahme des sozialen Stützsystems (SU-F2), die die Subfunktionen a) Bereitstellen von Information und Beratung, b) Handlungsmotivierung und Hilfe bei der Handlungsplanung, c) Bestärken und Vermittlung von Rückmeldung beinhaltet; • Ausgleich krankheitsbedingter Defizite und Funktionsbeeinträchtigungen (SU-F3). Bei dieser Funktion liegen keine definierten Subkategorien vor. Zu jeder der drei Subfunktionen der Funktionen F1 und F2 wurden je zwei Zielaussagen formuliert, so dass je Funktion 6 Zielaussagen vorlagen. Ebenso wurden 6 Zielaussagen für die Funktion F3 formuliert. Daneben führten wir ergänzend zu Aymanns zwei weitere Funktionen ein. Da die dritte Funktion Kompensation von Defiziten fokussiert und somit wenig Spielraum für die Verbesserung von Beeinträchtigungen lässt, definierten wir als vierte Funktion: • Einflussnahme auf den Genesungsprozeß (SU-F4). Dies sollte für die befragten Partnern insofern eine relevante Dimension darstellen, da zum ersten Befragungszeitpunkt die Verletzung erst kurz zurückliegt und eine Verbesserung der beeinträchtigten Leistungsbereiche des Patienten, auch angesichts der in der Regel nachfolgenden Rehabilitationsmaßnahme, in vielen Fällen realistische Perspektive darstellt. Zusätzlich nahmen wir als fünfte Funktion auf: • Regulierung der eigenen Befindlichkeit (SU-F5). Dies trägt der Perspektive Rechnung, dass supportive Handlungen auch "egoistisch" motiviert sein können und Unterstützung unter der Maßgabe geleistet wird, sich selbst besser zu fühlen; entweder, da hierdurch persönlichen Wertvorstellungen entsprochen wird, oder da die Unterstützung zu einer Befindensverbesserung des Adressaten supportiver Handlungen führt und somit ein "Spill-over" der Befindlichkeit vermieden wird. 81 Ebenso wie für die anderen Funktionen, so wurden auch für die Funktionen F4 und F5 je 6 Zielaussagen formuliert, so dass das Card Sorting aus insgesamt 30 Zielaussagen besteht. Jede Aussage außer die der Funktion F5 wurde mit der Wendung eingeführt "Mein Partner soll ...". Beispiele für die Zielaussagen sind: Mein Partner soll merken, dass ich zu ihm halte (SU-F1); Mein Partner soll ein Problem nach dem anderen angehen (SU-F2); Mein Partner soll so gut es geht seinen alten Freizeitaktivitäten nachgehen können (SU-F3); Mein Partner soll nicht so vergeßlich sein (SU-F4); Ich möchte nicht mehr so viel Angst haben (SU-F5). Eine ausführliche Darstellung der spezifischen Zielaussagen sowie eine Übersicht der Zuordnung zu den Funktionen finden sich im Anhang. Die Zuordnung der Zielaussagen zu den Funktionen wurde von uns nach einer Expertendiskussion a priori vorgenommen. Die Durchführung des Card Sortings war in drei Teile untergliedert. Der erste Schritt verlangte von den Partnern, aus den 30 Karten die 10 auszusuchen, die am ehesten mit den von ihnen angestrebten Zielen ihres Hilfeverhaltens dem Patienten gegenüber übereinstimmten. Die Partner wurden aufgefordert, nach Möglichkeit 10 Karten zu wählen, wobei es auch möglich war, weniger als 10 Karten zu wählen. Zusätzlich wurde ihnen mitgeteilt, dass sie die Möglichkeit hätten, bis zu 3 eigene Zielaussagen zu formulieren, sollten sie merken, dass für sie wesentliche Bereiche fehlen würden (vgl. Instruktionen im Anhang). Im zweiten Schritt wurden die Partner aufgefordert, die von ihnen gewählten Karten in eine Rangreihe hinsichtlich der von ihnen eingeschätzten Wichtigkeit dieser Ziele zu sortieren. Der dritte Schritt sah vor, dass sie für die drei wichtigsten Ziele notierten, was sie unternehmen könnten, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Auf diesen letzten Aspekt wird hier im Folgenden nicht näher eingegangen. Die Auswertung des Card Sortings geschah, indem der Rangplatz der gewählten Karten notiert wurde; nicht gewählte Karten erhielten den tied rank 20. In der Folge wurde pro Funktion individuell ein mittlerer Rangplatz über die entsprechenden zugehörigen Zielaussagen berechnet und in einen standardisierten Wert transformiert. Dies geschah mittels folgender Formel: 100 – (xi –3.5)/16.5 * 100) = z. Dabei ist xi der individuelle mittlere Rangplatz. Die Transformation bedingt eine Standardisierung auf den Wertebereich 0 bis 100, wobei 0 keine Bedeutsamkeit der dieser Funktion anzeigt und 100 sehr hohe Bedeutsamkeit der Funktion anzeigt. Je höher der Wert, desto mehr 82 Bedeutung wird den Zielen der jeweiligen Funktion für das eigene supportive Handeln (i.S. einer Intention) beigemessen. Individuelle Merkmale Unterstützungsbezogene Bewertungen wurden zu T1 mittels 4 Items erfasst. Das erste Item B-H ("Was glauben Sie, wie sehr ist Ihr Partner im Moment auf Ihre Hilfe angewiesen?") thematisiert die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit des Patienten. Das zweite Item B-W ("Wie klar sind Ihre Vorstellungen darüber, was für Ihren Partner besonders hilfreich ist?") fragt nach dem Wissen um hilfreiche Handlungen. Das dritte Item B-E ("Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass Ihre Hilfe für Ihren Partner die von Ihnen erwartete Wirkung hat?") stellt eine Einschätzung der Selbstwirksamkeitserwartung bzgl. der eigenen supportiven Handlungen dar. Das vierte Item B-A ("In welchem Ausmaß ist Ihrer Meinung nach Ihr Partner dazu bereit, Ihre Hilfe anzunehmen?") fragt nach der Akzeptanz der Hilfe durch den Patienten. Alle vier Items wurden auf einer fünfstufigen Skala von 1 (z.B. "gar nicht angewiesen") bis 5 (z.B. "sehr angewiesen") beurteilt (s. Anhang). Körperliche Beschwerden wurden zu T1 mittels der Kurzform des Gießener Beschwerdebogens (GBB-24; Brähler & Scheer, 1995) erhoben. Der GBB-24 ist ein reliables und valides Instrument, das 24 körperliche Symptome beschreibt, deren Auftreten auf einer fünfstufigen Skala eingeschätzt werden soll. Die Partner beurteilten das Auftreten der Symptome für den Zeitraum der vergangenen sieben Tage. In die Auswertung ging der Summenwert der Gesamtskala ("Beschwerdedruck") ein. Die interne Konsistenz der Gesamtskala betrug in der Gesamtstichprobe der Partner (T1) Alpha = .86. Das Ausmaß der Angst wurde zu T1 mittels des Beck Angst-Inventar (BAI; Margraf & Ehlers, in Vorb.) erhoben. Das BAI besteht aus 21 Items, die somatische und kognitive Angstsymptome beinhalten. Auf einer vierstufigen Skala wird die Intensität der Symptome für die vergangene Woche eingeschätzt. Die Auswertung erfolgt über den 83 Summenwert der 21 Items. Reliabilität und Validität des BAI konnten in einer Reihe von Studien aufgezeigt werden (vgl. Margraf & Poldrack, 2000). Die interne Konsistenz betrug in unserer Gesamtstichprobe der Partner (T1) Alpha = .91. Depressivität wurde zu T1 mittels des Beck-Depressions-Inventar (BDI; Hautzinger, Bailer, Worall & Keller,1995) erhoben. Das BDI ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Erfassung der Depressivität, dessen Reliabilität und Validität in zahlreichen Studien nachgewiesen werden konnte (vgl. Hautzinger et al., 1995). Das BDI besteht aus 21 Items, die als Aussagegruppen vorgegeben werden; es soll diejenige Aussage gewählt, die das Befinden während der vergangenen sieben Tage am besten beschreibt. Auch hier erfolgt die Auswertung mittels des Summenwertes. Die Reliabilität lag in unserer Gesamtstichprobe der Partner (T1) bei Alpha = .84. Beziehungsbezogene Merkmale Das Konfliktpotential der Beziehung (KON) wurde zu T1 mittels 5 Items erfasst, die eine modifizierte Skala von Balck (1982) darstellen (s. Anhang). Die ersten drei Items thematisieren die Häufigkeit von erregten Auseinandersetzungen und Ärger zwischen den Partner und werden auf einer 6-stufigen Skala (mit verschiedenen Antwortmodalitäten) eingeschätzt. In den Summenscore geht weiterhin das fünfte Item ein, in dem danach gefragt wird, wie sehr es als belastend erlebt wird, dass Tabuthemen zwischen den Partnern nicht besprochen werden. Das Item wird ebenfalls auf einer 6-stufigen Skala beurteilt (gar nicht bis sehr), geht aber nur in den Gesamtscore ein, wenn zuvor der Aussage zugestimmt, dass Tabuthemen zwischen den Partnern existieren (Item 4). Die Beurteilung erfolgte für die Zeit vor der Verletzung. Es wurde ein Summenscore gebildet, wobei ein höherer Summenwert ein stärkeres Konfliktpotential anzeigt. Die interne Konsistenz der Skala betrug in der Gesamtstichprobe der Partner (T1) Alpha = .73. Der Bindungsstil wurde mittels der Beziehungsspezifischen Bindungsskalen (BB; Asendorpf, Banse, Wilpers & Neyer, 1997) erhoben. Die BB bestehen aus 14 Items, die 84 auf einer Skala von 1 bis 5 eingeschätzt werden und zwei Skalen zugeordnet sind. Die erste Skala besteht aus 6 Items und ist durch die beiden Pole sicher vs. ängstlich gekennzeichnet. Der zweiten Skala sind 8 Items zugeordnet. Die beiden Pole dieser Skala sind abhängig vs. unabhängig. Die Reliabilität und Validität der BB konnten in der Studie von Asendorpf et al. (1997) nachgewiesen werden. Die Beurteilung erfolgte durch die Partner zum Zeitpunkt T1 für die Zeit vor der Verletzung. Die Auswertung erfolgt, indem für beide Skalen Mittelwerte berechnet werden, wobei ein höherer Wert eine stärkere Ausprägung des erstgenannten Pols der Skala anzeigt (d.h. sicher bzw. abhängig). Die interne Konsistenz der Skala sicher-ängstlich (BB-S) lag in der Gesamtstichprobe (T1) bei Alpha = .62; die der Skala abhängig-unabhängig (BB-A) bei Alpha = .79. Dyadisches Coping bezeichnet die Bewältigungsbemühungen eines oder beider Partner, bei Belastungen des jeweils anderen Partners oder bei Belastungen, die das Paar betreffen (dyadischer Streß), eine neue Homöostase zwischen den Partnern oder dem Gesamtsystem herzustellen. Das Konzept wurden von Bodenmann (1992) entwickelt und hat sich als ein wesentliches Merkmal für die Stabilität und Qualität von Beziehungen gezeigt (vgl. Bodenmann, 2000). Zur Erfassung des dyadischen Copings nutzten wir den Fragebogen zum dyadischen Coping in der generellen Tendenz (FDCT2; Bodenmann, 1995). Dieser erfasst mittels 48 Items verschiedene Formen des dyadischen Coping, wie z.B. emotionales supportives dyadisches Coping und gemeinsames sachbezogenes dyadisches Coping. Daneben finden auch "negative" Formen Berücksichtigung, beispielsweise ambivalentes dyadisches Coping. Weiterhin beinhaltet der Bogen Items zur Stresssignalisierung und Nutzung externer sozialer Unterstützung. Die Items werden auf einer vierstufigen Skala beurteilt ("nie", "manchmal", "häufig", "meistens"). Es werden Mittelwerte für die beiden Skalen positives dyadisches Coping und negatives dyadisches Coping berechnet. Ein höherer Wert zeigt dabei ein höheres positives bzw. negatives dyadisches Coping an. Die Partner beurteilten die Items zum Zeitpunkt T1 für die Zeit vor der Verletzung. Die interne Konsistenz der Skala positives dyadisches Coping (FDCT-P) lag in der Gesamtstichprobe (T1) bei Alpha = .92. Die Skala negatives dyadisches Coping (FDCTN) wies ein Alpha von .56 auf. 85 Die Beziehungsqualität wurde zu T1 mittels der deutschen Form der Dyadic Adjustment Scale (DAS; Hank, Hahlweg & Klann, 1990) erhoben. Der Fragebogen besteht aus 32 Items mit unterschiedlichem Antwortformat. Die DAS ist international das gebräuchlichste Verfahren zur Erfassung der Beziehungsqualität. Die interne Konsistenz der Gesamtskala ist als sehr gut einzustufen (α = .96, Hahlweg, Klann & Hank, 1992). Die Partner wurden instruiert, die Beziehungsqualität vor der Verletzung einzuschätzen. Die Auswertung erfolgt über den Summenwert, wobei ein höherer Score eine höhere Beziehungsqualität anzeigt. Die interne Konsistenz der Gesamtskala lag in der Gesamtstichprobe (T1) bei Alpha = .91. Die familiäre Struktur wurde zu T1 mittels der deutschen Version der Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES II; von Schlippe, 1986) erhoben. Der Fragebogen erfasst mittels 28 Items die beiden familienstrukturellen Dimensionen Adaptabilität (Veränderungsfähigkeit) und Kohäsion (emotionale Bindung). Der Fragebogen kam in einigen deutschsprachigen Studien (in seiner Kurzform) zum Einsatz (z.B. Aymanns, 1992; Schulz, Schulz, Schulz & von Kerekjarto, 1998). Die Items werden auf einer fünfstufigen Skala ("trifft fast gar nicht zu" bis "trifft fast völllig zu") beurteilt. Für beide Skalen wurden Mittelwerte berechnet. Ein höherer Wert gibt dabei die Ausprägung in Schlüsselrichtung wieder, d.h. hohe Kohäsion bzw. hohe Adaptabilität. Auch hier erfolgte die Einschätzung der Partner für die Zeit vor der Verletzung. Die Reliabilität der Skala Kohäsion (FACES-K) betrug in der Gesamtstichprobe (T1) Alpha = .79; interne Konsistenz der Skala Adaptabilität (FACESA) betrug Alpha = .65. 1.4.1.2 Erfassung von Patientenmerkmalen Bei der Erfassung von Adaptationsmerkmalen des Patienten kamen Verfahren zum Einsatz, die auf unterschiedlichen Ebenen gemäß ICIDH-2 (World Health Organization, 1998) anzusiedeln sind. Es wurde somit ein multidimensionales Vorgehen realisiert und Merkmale erhoben, welche die Ebene der Schäden, der Aktivität und der Partizipation berücksichtigen. 86 Kognitive Beeinträchtigungen wurden zu T2 und T3 mittels des AufmerksamkeitsBelastungs-Test d2 (Brickenkamp, 1994) und des Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT; Wilson, Cockburn & Baddeley, 1992) erhoben. Der d2 ist ein seit langem eingesetzter Durchstreichtest zur Erfassung der Aufmerksamkeit, dessen Reliabilität und Validität ausgiebig belegt ist (vgl. Brickenkamp, 1994). Der RBMT ist ein Gedächtnistest, der sich durch alltagsnahe Aufgaben auszeichnet. Der Test berücksichtigt folgende Gedächtnisleistungen: Namens- und Gesichtergedächtnis; Behalten eines Weges sowie verbaler Informationen und Absichten; Orientierung inklusive Datum. Die meisten Aufgaben verlangen eine zeitlich verzögerte Reproduktion. Zwischen Darbietung einer Aufgabe und Reproduktion derselben werden jeweils andere Aufgaben dargeboten, wodurch eine Ablenkung von der jeweiligen Zielaufgabe erreicht werden soll. Aufgrund dieser Struktur des Tests ergeben sich insgesamt 12 Items. Die Rohwerte der Items können in einen standardisierten Profilwert (Wertebereich 0-2) oder in einen Screeningwert (0/1) umgewandelt werden. Die Summe der Profilwerte kann somit zwischen 0 und 24, die der Screeningwerte zwischen 0 und 12 variieren. In der vorliegenden Studie wurde der Profilwert genutzt. Der RBMT liegt in vier Parallelversionen vor, wodurch eine wiederholte Testung von Personen unter Ausschluss von Übungseffekten ermöglicht wird. Zu den Zeitpunkten T2 und T3 kamen die Parallelversionen 2 bzw. 3 zum Einsatz. Hinweise für die Reliabilität und Validität des Tests liegen vor (vgl. Wilson et al., 1992). Die psychische und somatische Befindlichkeit wurden zu T2 und T3 mit denselben Verfahren erhoben, die auch bei den Partnern zum Einsatz kamen, d.h. den Patienten wurden der BAI, der BDI und der GBB-24 vorgelegt. Die interne Konsistenz der drei Verfahren lag in der Patientenstichprobe (T2) bei Alpha = .93, Alpha = .88 und Alpha = .92. Zur Erfassung spezifischer Beschwerden kam der Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ; King, Crawford, Wenden, Moss & Wade, 1995) zum Einsatz. Der RPQ erfasst mittels 16 Items typische Symptome des postkontusionellen Syndroms, die vor allem nach einem leichten SHT auftreten können (z.B. 87 Kopfschmerzen, Übelkeit, Vergesslichkeit). Die Patienten werden dabei aufgefordert, sich mit der Zeit vor der Verletzung zu vergleichen und eine Einschätzung vorzunehmen, inwieweit es nach der Verletzung zu einer Veränderung bei diesen Beschwerden gekommen ist (tritt überhaupt nicht auf; tritt auf, aber nicht stärker als vorher; ist ein geringfügiges Problem; ist ein mittleres Problem; ist ein deutliches Problem). Je höher der Summenwert der Skala ist, desto größer sind die Beeinträchtigung durch Beschwerden nach SHT. King et al. (1995) berichten eine hohe Test-Retest- bzw. Interrater-Reliabilität. Zwar ist der RPQ primär zum Einsatz bei Patienten mit leichtem SHT entwickelt und in verschiedenen Studien eingesetzt worden (z.B. McCullagh, Ouchterlony, Protzner, Blair & Feinstein, 2001; Rapoport & Feinstein, 2001), es liegen aber auch Studien vor, bei denen ein Teil der Patienten ein mittelschweres bzw. schweres SHT erlitten hatte (King, Crawford, Wenden, Moss & Wade, 1997). Die Patienten beurteilten die Beschwerden zu den Zeitpunkten T2 und T3. Da keine deutschsprachige Version des RPQ verfügbar war, wurde der Fragebogen durch die Forschungsgruppe des vorliegenden Projektes ins Deutsche übersetzt (s. Anhang). Die interne Konsistenz des RPQ betrug bei der Patientenstichprobe zum Zeitpunkt T2 Alpha = .89. Die funktionale Selbständigkeit des Patienten wurde zu T2 und T3 mittels des Barthel-Index (BI; Mahoney & Barthel, 1965) erhoben, der die international am häufigsten eingesetzte Skala zur Erfassung von Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) darstellt (Wallesch & Hasenbein, 2001). Die interne Konsistenz betrug in der Patientenstichprobe zu T2 Alpha = .97. Als ein differenzierteres Maß der Aktivitätsstörung wurde zusätzlich die Marburger Kompetenz Skala (MKS; Gauggel, 1998) eingesetzt. Diese liegt sowohl in einer Selbstbeurteilungs- als auch in einer Fremdbeurteilungsversion vor. Zu dem Zeitpunkt T3 schätzten sowohl die Patienten (MKS-S) als auch die Partner (MKS-F) die 30 Items des Fragebogens ein. Diese beinhalten sowohl eher motorische (z.B. Zubereiten einer Mahlzeit, Anziehen, Zähneputzen) als auch eher kognitive Aktivitäten (z.B. Gestaltung des Tagesablaufs, Eigeninitiative, Verfolgen des Tagesgeschehens). Die Items werden auf einer fünfstufigen Skala ("keine Probleme" bis "sehr große 88 Probleme") eingeschätzt. Ein hoher Summenwert der MKS zeigt an, dass geringe Probleme mit Aktivitäten des täglichen Lebens bestehen. Gauggel, Peleska und Bode (2000) berichten eine hohe Retest- und Interrater-Reliabilität; Cronbachs Alpha betrug .94 für die Selbsteinschätzung (Schlaganfallpatienten) und .95 für die Fremdeinschätzung (Professionelle). Die interne Konsistenz betrug in unserer Studie Alpha = .95 für die Selbsteinschätzung (Stichprobe T3) und Alpha = .97 für die Fremdeinschätzung (Partnerstichprobe T3). Weiterhin kam der Rivermead Head Injury Follow up Questionnaire (RHFUQ; Crawford, Wenden & Wade, 1996) zum Einsatz. Dieser Fragebogen ist ebenfalls auf der Ebene der Aktivitätsstörungen (disability) angesiedelt. Er erfasst mittels 10 Items Veränderungen in Aktivitäten des täglichen Lebens. Analog zum RPQ werden die Patienten aufgefordert, sich mit ihrem Zustand vor der Verletzung zu vergleichen. Die Items werden auf einer fünfstufigen Skala eingeschätzt (keine Veränderung; keine Veränderung, aber es fällt schwerer; eine leichte Veränderung; eine mittlere Veränderung; eine deutliche Veränderung). Die Patienten sollen einschätzen, inwieweit nach SHT eine Veränderung in ihrer Fähigkeit auftrat, bestimmte Aufgaben auszuführen (z.B. Gespräch mit einer Person folgen, Freizeitvergnügen zu genießen, mit familiären Anforderungen umgehen). Die Auswertung erfolgt über die Bildung eines Summenscores, wobei ein höherer Wert ein höheres Ausmaß an Problemen anzeigt. Der Fragebogen wurde primär für den Einsatz bei Patienten mit leichtem und mittelschwerem SHT entwickelt und in verschiedenen Studien eingesetzt (McCullagh et al., 2001; Rapoport & Feinstein, 2001). Crawford et al. (1996) liefern Hinweise für die Reliabilität und Validität des Verfahrens. Die Patienten bearbeiteten den Bogen zu den Zeitpunkten T2 und T3. Da keine deutschsprachige Version des RHFUQ verfügbar war, wurde der Fragebogen durch die Projektmitarbeiter ins Deutsche übertragen (s. Anhang). Die interne Konsistenz des RHFUQ betrug in der Stichprobe zum Zeitpunkt T2 Alpha = .89. Zur Erfassung der Lebensqualität kam der WHOQOL-BREF (Angermeyer, Kilian & Matschinger, 2000) zum Einsatz. Der Fragebogen besteht aus 26 Items, die auf fünfstufigen Skalen beurteilt werden. Er erfasst die Lebensqualität in den Bereichen physisch, psychisch, soziale Beziehungen und Umwelt. Zusätzlich kann ein Gesamtwert 89 berechnet werden. Die Skalenwerte stellen standardisierte Werte im Wertebereich von 0 bis 100 dar, wobei ein höherer Wert eine höhere Lebensqualität anzeigt. Cronbachs Alpha der verschiedenen Subskalen liegt zwischen .76 und .88 in einer deutschlandrepräsentativen Stichprobe der Allgemeinbevölkerung (Angermeyer et al., 2000). Der Fragebogen wurden den Patienten zum Zeitpunkt T3 vorgegeben. Weiterhin wurde zu den Zeitpunkten T2 und T3 im Rahmen eines kurzen (T2) bzw. ausführlicheren (T3) sozialmedizinischen Bogens der berufliche Status der Patienten erfragt. Tabelle 6 gibt einen Überblick der eingesetzten Erhebungsinstrumente 90 Tabelle 6: Übersicht der eingesetzten Erhebungsverfahren T1 T2 T3 Patient Partner Patient Partner Patient Partner Ausmaß Unterstützung – Selbstrating x (SU-S; eigener Fragebogen) Ausmaß Unterstützung – Fremdrating x (SU-I; Interview) Ausmaß Unterstützung – Handlungen x (SU-EM,...; Interview) Vielseitigkeit Unterstützung (SU-V; x (SU-F1,...; x Unterstützungsbezogene Bewertungen x Interview) Intendierte Unterstützung Card Sorting) (B-H,...; eigener Fragebogen) Angst (BAI) x x x Depressivität (BDI) x x x Somatische Beschwerden (GBB-24) x x x x x Aufmerksamkeit (d2) x x Gedächtnis (RBMT) x x Funktionale Selbständigkeit (BI) x x Postkontusionelle Beschwerden (RPQ) Bindungsstil (BB) x Dyadisches Coping (FDCT-2) x Beziehungsqualität (DAS) x Familienstruktur (FACES-II) x Aktivitäten des täglichen Lebens (MKS) Aktivitäten des täglichen Lebens x x x (RHFUQ) Lebensqualität (WHOQOL-BREF) Sozialmedizinischer Status (Eigener Fragebogen) Anmerkung. Erläuterungen zu den Verfahren finden sich im Text. x x x 91 1.4.2 Konstruktion des komplexen Outcome-Kriteriums Aufgrund der Vielzahl der untersuchten Adaptationsmerkmale wurde eine Analyse auf einem aggregierten Datenniveau vorgenommen. Dazu wurde ein komplexes Kriterium entwickelt, in das die berücksichtigten Outcome-Maße einfließen. Es wurde eine vierstufige Einteilung gewählt, die das Ausmaß der Beeinträchtigung darstellt: unauffällig, leicht auffällig, deutlich auffällig, sehr deutlich auffällig. Diese Kategorien erhielten Werte von 0 (sehr deutlich auffällig) bis 3 (unauffällig). Für die jeweiligen Kriterien wurden Wertebereiche bzw. Merkmalsausprägungen definiert, die einer der vier Kategorien des komplexen Kriteriums zugeordnet wurden. Bei der Definition der den Kategorien entsprechenden Wertebereichen bzw. Merkmalsausprägungen wurde wie folgt vorgegangen: • d2: Hier wurden die Wertebereiche anhand der Standardwerte der Gesamtleistung (Gesamtzeichen minus Fehler) festgelegt (vgl. Brickenkamp, 1994). • RBMT: Hier wurden die im Handbuch (Wison et al., 1992) genannten Cut-off-Werte für die entsprechenden Beeinträchtigungen herangezogen. • BAI: Bei dem BAI wurden Summenscores verwendet und die vom Originalautor empfohlenen Grenzwerte herangezogen (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988). • BDI: Ebenso wurden bei dem BDI Summenscores verwendet und der vom Autor der deutschen Version empfohlenen Einteilung gefolgt (vgl. Hautzinger et al., 1995). • GBB-24: Beim GBB-24 wurden Summenscores genutzt und die im Handbuch genannten Grenzwerte für Quartile berücksichtigt (vgl. Brähler & Scheer, 1995). • RPQ: Bei dem RPQ wurde eine Einteilung anhand der Summenscores vorgenommen. Die Enteilung basiert auf der Anzahl der Items und der möglichen Antwortkategorien. Würde beispielsweise ein Patient durchweg die Kategorie "tritt auf, aber nicht stärker als vorher" wählen, so erhielte er ein Summenwert von 16 Punkten. Entsprechend wurde dies als Grenzwert für "unauffällig" i.S. des komplexen Kriteriums definiert. • BI: Bei der Definition der Wertebereiche des BI wurde auf Empfehlungen aus vorliegenden Publikationen zurückgegriffen (vgl. Arbeitsgruppe Schlaganfall Hessen (ASH), 2001; Roberts & Counsell, 1998; Sulter, Steen & De Keyser, 1999). Die 92 Einteilung erfolgte anhand des Summenscores. Der BI liegt für alle Patienten vor, da er auf den Angaben des Partners basiert. • RHFUQ: Die Definition der Wertebereiche beim RHFUQ basiert auf Summenscores und geschah analog des Vorgehens beim RPQ. • MKS: Bei der MKS wurde die Selbsteinschätzung der Patienten herangezogen. Für die Definition der Wertebereiche wurden vorhandene deskriptive Daten (Gauggel & Peleska, 1999) berücksichtigt, d.h. Mittelwert und Standardabweichung des Summenscores von neurologischen Rehabilitationspatienten. • WHOQOL-BREF: Die Auswertung des WHOQOL-BREF geschieht, indem die individuellen Scores auf einen Wertebereich von 0 bis 100 transformiert werden. Ausgehend von den vorliegenden bevölkerungsrepräsentativen Daten wurde für die Definition der Wertebereiche der Mittelwert und die Standardabweichung der Daten der Allgemeinbevölkerung berücksichtigt. Patienten, die sich innerhalb einer Standardabweichung unter dem Mittelwert der Allgemeinbevölkerung befanden, wurden als unauffällig eingestuft. Die weiteren Kategorien des komplexen Kriteriums entsprechen jeweils einer Reduktion der Lebensqualität um eine weitere Standardabweichung. Für die Bildung des komplexen Kriteriums wurden die vier Subskalen des WHOQOL-BREF berücksichtigt. • Der berufliche Status wurde vom Patienten bzw. Partner erfragt. Die Definition der relevanten Merkmalsausprägungen i.S. des komplexen Kriteriums geschah nach inhaltlich-logischen Gesichtspunkten. Neben Summenscores wurde auch die Kategorie "nicht einschätzbar" verwendet, wodurch berücksichtigt wird, dass einige Patienten nicht in dem Zustand waren, um das entsprechende Verfahren zu bearbeiten. In diesem Fall wurde als Ergebnis "nicht einschätzbar" gewertet, was einer Eingruppierung in die Kategorie "sehr deutlich auffällig" i.S. des komplexen Kriteriums entspricht. Eine Übersicht der resultierenden Wertebereiche bzw. Merkmalsausprägungen pro Kategorie des komplexen Kriteriums liefert Tabelle 7. 93 Tabelle 7: Übersicht der definierten Wertebereiche bzw. Merkmalsausprägungen pro Kategorie des komplexen Kriteriums unauffällig leicht auffällig deutlich sehr deutlich (0) (1) auffällig (2) auffällig (3) 1 d2 1 ≥ 90 80-89 70-79 ≤ 69 bzw. n.e. 2 RBMT 2 ≥ 22 17-21 10-16 ≤ 9 bzw. n.e. 3 BAI 2 ≤8 9-15 16-22 ≥ 23 bzw. n.e. 4 2 ≤ 10 11-17 18-24 ≥ 25 bzw. n.e. 1./2 3. 4. n.e. BDI 3 5 GBB-24 6 RPQ 2 ≤16 17-32 33-48 ≥49 bzw. n.e. 7 BI 2 ≥ 86 61-85 30-60 ≤ 29 2 ≥ 110 90-109 70-89 ≤ 69 bzw. n.e. 9 RHFUQ 2 ≤ 10 11-20 21-30 ≥ 31 bzw. n.e. 10 WHOQOL-PHYS 4 ≥ 60 42-59 24-41 ≤ 23 bzw. n.e. 11 WHOQOL-PSYCH 4 ≥ 58 42-57 26-41 ≤ 25 bzw. n.e. ≥ 53 34-52 15-33 ≤ 15 bzw. n.e. ≥ 56 42-55 28-41 ≤ 27 bzw. n.e. voll im alten/ eingeschränkt arbeitsunfähig/ vorhandene äquivalenten berufstätig/ Berentung Pflegestufe Beruf arbeitslos infolge 8 MKS 12 WHOQOL-SOCIAL 13 WHOQOL-ENVIR 4 14 Beruflicher Status 4 Verletzung Anmerkung. d2: Aufmerksamkeits-Belastungstest-Test d2-Gesamtleistung; RBMT: Rivermead Behavioural Memory Test; BAI: Beck Angstinventar; BDI: Beck Depressionsinventar; GBB-24: Gießener Beschwerdebogen Kurzform; RPQ: Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire; BI: BarthelIndex, MKS: Marburger Kompetenz Skala; RHFUQ: Rivermead Head Injury Follow-up Questionnaire; WHOQOL-PHYS: WHOQOL physisch; WHOQOL-PSYCH: WHOQOL psychisch; WHOQOL-SOCIAL: WHOQOL pesönliche Beziehungen; WHOQOL-ENVIR: WHOQOL Umwelt; n.e.: nicht einschätzbar 1 Standardwerte; 2 Summenwerte; 3 Quartile; 4 transformierte Werte (basierend auf Summenscores) 94 Das komplexe Kriterium ergibt sich aus der Summation der Werte 0 (unauffällig) bis 3 (sehr deutlich auffällig) pro Einzelkriterium. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle Verfahren auch zum Zeitpunkt T2 eingesetzt wurden (z.B. MKS). Weiterhin liegen vor allem für die beiden neuropsychologischen Verfahren Missings vor, da diese bei den Patienten z.T. nicht eingesetzt wurden. Dies liegt darin begründet, dass in einigen Fällen Patienten zu erschöpft waren. Das Standardvorgehen sah vor, dass diese Verfahren nach dem Interview und nach der Bearbeitung der weiteren Verfahren durchgeführt wurden. Ein weiterer Grund ist, dass auf Seiten der Patienten (bzw. Partner) zeitliche Gründe gegen eine komplette Durchführung sprachen. Daneben bestanden z.T. auch zeitliche Einschränkungen auf Seiten des Interviewers. Die meisten Paare wurden für die Katamnesen zu Hause aufgesucht. Dabei geschahen fast alle Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da viele Paare in kleinen Ortschaften und z.T. in großer Entfernung von Dresden wohnten, und darüber hinaus die meisten Befragungen am späten Nachmittag durchgeführt wurden, bestanden aufgrund der Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel häufig zeitliche Einschränkungen, die dazu führten, dass die neuropsychologischen Verfahren nicht zum Einsatz kamen. Um diesen Aspekten Rechnung zu tragen, wurde daher der Summenscore des komplexen Kriteriums sowohl zu T2 als auch zu T3 an der Anzahl der pro Patient in das Kriterium eingehenden Einzelkriterien relativiert. 95 1.4.3 Datenmanagement und Datenanalyse Hinsichtlich des Datenmanagements wurde eine Qualitätskontrolle der Dateneingabe vorgenommen. Dies bedeutet, dass alle laufenden Eingaben durch einen Projektmitarbeiter kontrolliert Datenauswertung eine wurden. Ferner Plausibilitätskontrolle wurde vor der vorgenommen. abschließenden Dazu wurden die Datensätze nach möglichen Ausreißerwerten überprüft. Die Datenauswertung erfolgte mittels SPSS 6.1.1 für Macintosh. Die statistische Untersuchung der Fragestellung erfolgte mittels regressionsanalytischer Methoden. Dabei bildete das komplexe Kriterium das zentrale Outcome-Maß auf aggregiertem Datenniveau. Es wurden logistische Regressionen gerechnet, so dass die Notwendigkeit bestand, das vierstufige komplexe Kriterium zu dichotomisieren. Das entsprechende Vorgehen wird weiter unten beschrieben. Als Prädiktoren wurden die Merkmale der Unterstützung durch die Partner betrachtet. Die weiteren Partnervariablen stellen potentielle Moderatorvariablen dar. Vor der Durchführung der Regressionsanalysen wurde untersucht, ob die Prädiktorvariablen einen statistischen Zusammenhang mit dem Kriterium aufweisen. Ferner wurden die potentiellen Moderatorvariablen dahingehend untersucht, ob sie einen statistischen Zusammenhang mit dem Outcome-Kriterium und den Prädiktorvariablen aufweisen. Um als Moderatorvariable in Betracht zu kommen, sollte die Variable einen nichtsignifikanten (oder möglichst niedrigen) Zusammenhang mit dem OutcomeKriterium, jedoch einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Prädiktorvariable aufweisen. Aufgrund des aggregierten Datenniveaus des komplexen Outcome-Kriteriums wurden Spearman-Korrelationen berechnet. Der zweite Analyseschritt untersuchte Zusammenhänge zwischen sozialen Faktoren und Einzelkomponenten des komplexen Kriteriums. Dazu wurden Variablen, die einen ähnlichen Bereich erfassen, zu einem eigenständigen komplexen Kriterium zusammengefaßt. Dabei wurde analog des oben beschriebenen Vorgehens verfahren. Statistische Zusammenhänge wurden erneut mittels Spearman-Korrelationen berechnet. Anschließend wurden logistische Regressionen durchgeführt, weshalb auch hier eine Dichotomisierung der Outcome-Maße vorgenommen wurde. 96 Der dritte Analyseschritt untersuchte Korrelate und Prädiktoren der Veränderungen im komplexen Kriterium vom Zeitpunkt T2 zum Zeitpunkt T3. In die Berechnung gingen diejenigen Variablen ein, die zu beiden Katamnesezeitpunkten erhoben wurden. Statistische Zusammenhänge wurden mittels Spearman-Korrelationen überprüft. Für die Prädiktion wurde auf die logistische Regression zurückgegriffen. In einem letzten Auswertungsschritt wurden die Analysen auf der Ebene von Einzelmerkmalen wiederholt. Dabei beschränkten wir uns auf die Betrachtung von 2 Variablen: Die MKS wurde gewählt, da sie das differenzierteste der verwendeten Maße zur Erfassung von Aktivitäten des täglichen Lebens darstellt. Für diese Analyse wurden die Angaben der Fremdbeurteilung durch die Partner herangezogen, da somit auch für Patienten, die aufgrund ihres Zustandes keine Selbsteinschätzung geben konnten, Daten vorliegen. Schließlich wurde die Globalbeurteilung der Lebensqualität (WHOQOLBREF GLOBAL) als Einzelkriterium gewählt, da dieses ein integratives Maß darstellt, in das viele der im komplexen Kriterium vertretenen Merkmale einfließen. Die statistische Analyse erfolgte schrittweise (wie beschrieben). Die Ermittlung statistischer Zusammenhänge erfolgte mittels Pearson-Korrelationen und linearer Regression. 97 1.5 Durchführung der Untersuchung Das Projekt startete am 15. 10. 1998 mit der Einstellung des wissenschaftlichen Mitarbeiters. Vor Beginn der Datenerhebung wurde die Kooperation mit der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie sowie der Klinik und Poliklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums Dresden aufgebaut. Zudem erfolgte die Kontaktaufnahme und der Kooperationsaufbau mit den beiden neurologischen Rehabilitationskliniken im Umfeld Dresdens, der Klinik Schloß Pulsnitz, Pulsnitz, und der Klinik Bavaria, Kreischa. Weiterhin bestand vor der konkreten Datenerhebung die Notwendigkeit, den Schweregrad des SHT zu operationalisieren. Zwar stellt die Einteilung des SHT in drei Grade (1. Grad: leicht; 2. Grad: mittel; 3. Grad: schwer), die auf einen Vorschlag von Tönnis und Loew aus dem Jahr 1953 zurückgeht (zit.n. Schirmer, 1994), eine in der klinischen Praxis häufig genutzte Graduierung dar. Sie hat jedoch den Nachteil, dass eine genaue Einteilung im Grunde erst retrospektiv erfolgen kann, da u.a. die Dauer der Rückbildung neurologischer Symptome zur Schweregradabschätzung herangezogen wird. Wie Schirmer (1994) feststellt, ist diese Einteilung in den letzten Jahren weitestgehend aufgegeben worden. In internationalen Arbeiten wird vor allem die Glasgow Coma Scale (GCS; Teasdale & Jennett, 1974) zur Beurteilung des Schweregrades eines SHT genutzt. Mithilfe dieser Skala wird eine Bewertung der Komatiefe vorgenommen, die als ein Indikator der Schwere der Verletzung fungiert. Beurteilt werden die Bereiche Augenöffnen, beste verbale und beste motorische Reaktion. Die Skala hat einen Wertebereich von 3 bis 15 Punkten. Es hat sich eingebürgert, einen Summenwert von 3 bis 8 Punkten als einen Indikator für ein schweres SHT, einen Summenwert von 9 bis 12 Punkten als einen Indikator für ein mittelschweres SHT, und einen Summenscore von 13 bis 15 Punkten als einen Indikator für ein leichtes SHT anzusehen (vgl. Williamson, Scott & Adams, 1996). Somit wurde das Einschlusskriterium "SHT 2. Grades" dahingehend konkretisiert, dass Personen mit einem initialen GCS-Score von 9-12 Punkten in die Studie aufgenommen werden sollten. 98 Die Phase der Datenerhebung begann planungsgemäß am 01. Februar 1999. Einen Tag darauf wurde durch den Ansprechpartner der Klinik und Poliklinik für Unfallund Wiederherstellungschirurgie der erste potentielle Studienteilnehmer gemeldet. Dadurch entstand der Eindruck, die Studie würde einen guten Start nehmen und die kooperierenden Kliniken könnten das Routinescreening, d.h. die Erhebung der relevanten (individuellen) Einschlusskriterien, übernehmen. Während der folgenden 10 Wochen gab es jedoch keine weitere Meldung hinsichtlich eines potentiellen Studienteilnehmers. Um dieser unerwarteten Situation zu begegnen, wurden folgende Änderungen vorgenommen: • Es war vorgesehen, Patienten mit einem SHT zweiten Grades in die Studie aufzunehmen, was einem mittelschweren SHT entspricht. Während die Einteilung eines SHT nach Grad 1 bis 3 eine gängige klinische Einteilung ist, erweist sie sich für die operationale Definition eines SHT als zu ungenau. Daher wurde die international übliche Einteilung nach GCS gewählt. Nach internationaler Konvention entspricht ein mittelschweres SHT einem GCS-Summenscore von 9 bis 12. Die ersten drei Monate der Datenerhebung zeigten, dass diese Spanne zu eng gewählt war. Daher wurde zum 01.05.99 entschieden, Patienten mit schwerem bis mittelschwerem SHT in die Studie aufzunehmen, d.h. Patienten mit einem GCSScore von 3 bis 12. • Nach Rücksprache mit der kooperierenden Klinik für Neurochirurgie wurde entschieden, aufgrund eines ähnlichen klinischen Bildes Patienten mit Subarachnoidalblutung (SAB) in die Studie aufzunehmen. Analog zu der Gruppe der SHT-Patienten wurden somit seit dem 01.05.99 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer spontaner SAB, d.h. mit einem Hunt und Hess-Score (Hunt & Hess, 1968) von 2 bis 5, sowie deren Partner für die Teilnahme an der Studie angesprochen. Patienten mit einem Hunt und Hess-Score von 1 wurden nicht berücksichtigt, d.h. Patienten mit einer leichten SAB. Analog zum Vorgehen bei SHT wurden Patienten mit mittelschwerer SAB (Hunt und Hess 2 und 3) und schwerer SAB (Hunt und Hess 4 und 5) unterschieden. • Ein Teil der Einschlusskriterien wurde modifiziert. So wurde die Altersspanne des Patienten auf 20 bis 60 Jahre ausgedehnt. Weiterhin wurde das Beziehungskriterium geändert. Der Patient musste nun nicht mehr verheiratet sein, sondern für die 99 Studienteilnahme reichte es aus, wenn er sich aktuell in einer Beziehung befand, die seit mindestens einem Jahr, nicht wie ursprünglich festgelegt seit drei Jahren, bestand. • Die Ausschlusskriterien wurden fallengelassen. Da es sich um eine naturalistische Beobachtungsstudie handelt, wurde entschieden, die tatsächlich vorhandene Variabilität in Kauf zu nehmen. • Es wurde kein Prozedere entwickelt, das zu einem gewichteten Geschlechterverhältnis von 50 Männern und 10 Frauen in der Studienpopulation führen sollte. Dies bedeutet, dass potentielle Studienteilnehmer unabhängig von ihrem Geschlecht i.S. einer anfallenden Stichprobe für die Teilnahme angesprochen wurden. Aufgrund der epidemiologischen Verteilung der Verletzungen wurde erwartet, dass auch im Falle einer unselektierten anfallenden Stichprobe männliche Verletzte den größeren Anteil der Stichprobe ausmachen sollten. Da eine Stichprobe von nur 10 weiblichen Verletzten, wie dies im Bewilligungsbescheid als Auflage mitgeteilt wurde, statistisch schwer zu berücksichtigen wäre, wird das von uns gewählte Vorgehen eher als Vorteil angesehen. Es wurde erwartet, dass in der Gesamtstichprobe mehr als 10 Frauen vertreten sein würden, so dass es gerechtfertigt wäre, das Geschlecht als Variable in die gesamten Auswertungen einfließen zu lassen. Der Verlauf der ersten drei Monate zeigte weiterhin, dass ein Routinescreening und eine Meldung potentieller Studienteilnehmer durch die kooperierenden Kliniken im klinischen Alltag mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht aufrechterhalten werden konnten. Dies hatte zur Folge, dass ein neues Screening-Vorgehen entwickelt werden musste, welches nun komplett vom Projekt durchgeführt wurde und sich als sehr zeitaufwendig erwies. Das Screening wurde über die zentrale Rettungsstelle des Universitätsklinikums durchgeführt. Dort wurden anhand der Aufnahmebücher alle Personen mit den Eingangsdiagnosen SHT, Polytrauma, Schädelfraktur und SAB registriert. Weiterhin ist dort das Geburtsdatum der Patienten notiert, so dass bereits in der Rettungsstelle eine Vorauswahl der Patienten getroffen werden konnte. Bei Patienten, die eine der vier genannten Eingangsdiagnosen und das entsprechende Alter 100 aufwiesen, wurde deren Aufenthaltsort (Klinik, Station) festgestellt und im folgenden die weiteren Einschlusskriterien Aufnahmebüchern der geprüft. entsprechenden Zusätzlich Stationen wurde der regelmäßig kooperierenden in den Kliniken recherchiert und evtl. noch nicht identifizierte Patienten ausfindig gemacht. Im Rahmen dieses Vorgehens wurde zusätzlich die Kooperation mit der Klinik und Poliklinik für Anaesthesiologie und Intensivtherapie des Universitätsklinikums Dresden aufgebaut. Nach diesen Modifikationen erhöhte sich die Stichprobe kontinuierlich, jedoch weiterhin recht langsam. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen sind die Unfallzahlen in Sachsen rückläufig, so dass die große Gruppe der Personen mit SHT infolge eines Verkehrsunfalls abnimmt. Zum anderen übt vor allem das Einschlusskriterium „in Beziehung lebend“ einen restriktiven Einfluss aus, da gerade in der Gruppe der Personen, die am häufigsten ein SHT erleiden (20-30jährige Personen) dieses Kriterium häufig nicht erfüllt ist. Drittens lehnte ein vergleichsweise großer Teil der Patienten bzw. Partner die Teilnahme an der Studie ab. Dies fällt bei einer Untersuchung, die von vornherein eine mittlere Stichprobengröße anstrebt, besonders ins Gewicht. Neben diesen Modifikationen der Studienkriterien wurde zusätzlich versucht, eine Kooperation mit zwei städtischen Krankenhäusern aufzubauen, um so den Einzugsbereich zu vergrößern. Dazu muss allerdings angemerkt werden, dass nicht angenommen werden konnte, dass dies zu einer deutlichen Veränderung führen würde, da das Universitätsklinikum bei den beiden für die Studie betrachteten Patientengruppen bereits die Hauptversorgung leistet. Die Kooperationsgespräche fanden im Februar bzw. März 1999 statt. Beide Krankenhäuser willigten zunächst in eine Kooperation ein. In beiden Fällen ergab sich jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht die Möglichkeit, ein Routinescreening durch Projektmitarbeiter durchzuführen. Es wurde vereinbart, dass Mitarbeiter der städtischen Krankenhäuser sich melden, wenn ein potentieller Studienteilnehmer aufgenommen worden sei. Trotz einiger anfänglicher Kontakte kam es im Weiteren nicht zu einer tragfähigen Kooperation. Obwohl wiederholt Anfragen durch den Projektmitarbeiter durchgeführt wurden, führte dies nicht zu weiteren Meldungen potentieller Studienteilnehmer. Da sich die Datenerhebung deutlich verzögerte, wurde Ende 2001 als letzte Möglichkeit zur Beschleunigung der Stichprobengewinnung, Kontakt mit einer der kooperierenden Reha-Kliniken aufgenommen, zu der ein sehr guter Kontakt bestand. 101 Da die Reha-Klinik natürlich auch Patienten behandelt, bei denen die Akutversorgung in einem anderen Krankenhaus als dem Universitätsklinikum Dresden geleistet wurde, sollte so versucht werden, zusätzlich Studienteilnehmer zu gewinnen, auch wenn dafür der bis dahin stringente Zugangsweg über nur ein Akutkrankenhaus aufgegeben werden musste. In den folgenden Wochen wurden durch die Reha-Klinik einige Patienten gemeldet, die die Einschlusskriterien potentiell erfüllten. Bei der Kontaktaufnahme zeigte sich, dass ein Teil der Angesprochenen die Kriterien komplett erfüllte. Jedoch war keines dieser Paare zu einer Studienteilnahme bereit. Es entstand der Eindruck, dass eine Anfrage zur Studienteilnahme bei diesen Paaren skeptisch bewertet wurde, da sie nicht von einem Mitarbeiter der Reha-Klinik ausging und z.T. auch eine geraume Zeit nach der Verletzung erfolgte. Aufgrund der dargestellten Probleme bei der Stichprobengewinnung wurde beim Förderer ein Verlängerungsantrag gestellt, dem dann entsprochen wurde (Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 30.08.2002). Das Projekt erhielt die Auflage, eine Übererhebung zu T1 durchzuführen, um so – trotzt des sich abzeichnenden Drop-outs im Studienverlauf – eine genügend große Stichprobe für die Auswertung zur Verfügung zu haben. Ferner wurde vereinbart, dass der Zeitpunkt 1 Jahr nach Verletzung (T3) den zentralen Katamnesezeitpunkt darstellt, auf den sich die Auswertungen zu beziehen haben. Die Projektverlängerung und Übererhebung zu T1 sollte dazu führen, dass zu diesem Zeitpunkt eine Stichprobe von N = 60 Paaren vorliegt, die in die Auswertung eingehen. Die Projektverlängerung wurde auch dazu genutzt, weiterhin Katamnesen zum Zeitpunkt T4, d.h. 18 Monate nach Verletzung, durchzuführen. Ferner wurde aufgrund des langen Projektzeitraumes ein zusätzlicher Katmnesezeitpunkt (T5) – zwei Jahre nach Verletzung – eingeführt, der ursprünglich nicht vorgesehen war. Dies geschah auf dem Hintergrund, die Projektlaufzeit optimal zu nutzen. Diese Befragung wurde von Beginn an ausschließlich postalisch durchgeführt und wird auch weiterhin fortgesetzt. Der ursprüngliche Antrag sah einen Zeitraum von 2 Jahren vor, in dem die Datenerhebung stattfinden sollte. Da in diesem Zeitraum die 18-Monats-Katamnese inbegriffen war, blieb rein rechnerisch ein Zeitraum von 6 Monaten für die Gewinnung 102 der Gesamtstichprobe zu T1. Wie ausgeführt, konnte dieser Zeitplan nicht eingehalten werden. Der tatsächlich realisierte Studienverlauf ist in der folgenden Abbildung 1 dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Datenerhebung zu T1 drei Jahre lang andauerte, damit die Erhebung zu T1 realisiert und den Auflagen des Bewilligungsbescheids bestmöglich entsprochen werden konnten. Schließlich konnten zwischen Februar 1999 und Februar 2002 N = 71 Paare in die Studie aufgenommen werden (vgl. das folgende Kapitel für die genaue Darstellung der Stichprobe). Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Abfassung des Projektberichtes noch nicht alle Paare die 12-Monats-Katamnese durchlaufen haben. Jedoch wurde vom Förderer mit Bewilligung des Verlängerungsantrages mitgeteilt, dass eine Berichterstellung zum Ende des Jahres 2002 erfolgen solle. Mit Ablauf der Förderungsdauer wurden somit insgesamt N = 60 Paare im Rahmen der 12-MonatsKatamnese angesprochen, von denen jedoch nicht alle an der Katamnesebefragung teilnahmen. Die realisierte Stichprobengröße zu T3 beträgt daher aufgrund des Dropouts im Studienverlauf N = 43. Die noch ausstehenden Katamnesen der Zeitpunkte T3, T4 und T5 werden auch nach Ablauf der Förderung postalisch durchgeführt. Dies wird durch den Umstand erleichtert, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter des Projektes auch nach Studienförderungsende an der Medizinischen Psychologie des Universitätsklinikums Dresden beschäftigt ist, jedoch seit Mitte des Jahres 2002 in deutlich reduziertem Umfang. Abschließend ist zu erwähnen, dass sich trotz dieser umfangreichen Änderungen im Projektverlauf die grundlegenden Ziele und die Fragestellung der Untersuchung nicht geändert haben. Ganz im Gegenteil wurden diese Anstrengungen unternommen, um die Projektziele realisieren zu können. 103 Abbildung 1: Realisierter Verlauf des Projektes '99 1. Q. 2. Q 3. Q 4. Q '00 1. Q. 2. Q 3. Q 4. Q '01 1. 2. Q 3. Q 4. Q Q. '02 1. '03 2. Q 3. Q 4. Q Q. 1. '04 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q Q. T1 T2 T3 Datenerhebung T4 T5 Förderungsdauer Bericht - - - - - 104 Die konkrete Datenerhebung gestaltete sich wie folgt. Entsprechend des beschriebenen Vorgehens wurde ein Screening der im Universitätsklinikum Dresden aufgenommenen Patienten durchgeführt. Wenn der Patient sich in einem Zustand befand, der darauf schließen ließ, dass er kognitiv in der Lage war, den Zweck und Ablauf der Studie nachzuvollziehen, wurde er angesprochen und um Teilnahme gebeten. Willigte der Patient in die Teilnahme ein, wurde die Befragung durchgeführt. Im Anschluss wurde der Partner angesprochen und um Teilnahme gebeten. War der Patient in einem Zustand, in dem er nicht angesprochen werden konnte (z.B. komatös) oder bei dem nicht sicher davon auszugehen war, dass er den Zweck und Ablauf kognitiv nachvollziehen könnte (z.B. schweres Durchgangssyndrom), wurde zuerst der Partner angesprochen und um Teilnahme gebeten. Zum Teil wurde der Partner auch aus pragmatischen Gründen (z.B. Patient befand sich bereits in Reha) als erstes angesprochen. Es wurde darauf geachtet, dass die Anfrage zur Teilnahme an der Studie zu einem Zeitpunkt geschah, zu dem das Überleben des Patienten als sehr wahrscheinlich galt. In einigen Fällen baten Partner darum, den Patienten zum ersten Zeitpunkt nicht zu befragen, da dies aus ihrer Sicht eine zu große Belastung für den Patienten darstelle. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Die Befragung der Patienten geschah zum ersten Zeitpunkt entweder am Krankenbett im Universitätsklinikum oder in einem zur Verfügung gestellten Raum in einer der kooperierenden Rehabilitationskliniken. Die Angehörigen wurden in Räumen der Medizinischen Psychologie des Universitätsklinikums, in zur Verfügung gestellten Räumen der Reha-Kliniken oder zu Hause befragt. In einem Fall fand eine Befragung in einem Café statt. Zu den Katamnese-Zeipunkten zu Hause aufgesucht, in einigen Fällen fand die Befragung in einer Reha-Klinik statt, und in sehr wenigen Fällen in Räumen der Medizinischen Psychologie. Nahezu alle Fahrten zu den Wohnungen der Studienteilnehmer wurden mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Die meisten der teilnehmenden Paare lebten in Sachsen, allerdings befinden sich in der Studienstichprobe auch Paare aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und NordrheinWestfalen. Alle Befragungen wurden durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Projektes durchgeführt. In einigen wenigen Fällen konnte aus organisatorischen Gründen bzw. aufgrund eines entsprechenden Wunsches des Paares zum Zeitpunkt T3 105 kein persönlicher Kontakt realisiert werden. In diesen Fällen fand eine postalische Befragung statt. Zum Zeitpunkt T1 wurden den Patienten Fragebögen vorgegeben, wobei die Anzahl der zu erfassenden Merkmale bewusst gering gehalten wurde, um die Patienten nicht zu überfordern. Mit den Partnern wurde zum Zeitpunkt T1 ein Gespräch geführt. Zusätzlich wurden ihnen die oben beschriebenen Fragebögen vorgelegt. Zu den Katamnese-Zeitpunkten kamen bei den Partnern jeweils ein Interview und verschiedene Fragebögen zum Einsatz, worauf hier nicht näher eingegangen wird. Bei den Patienten kamen, sofern es deren Zustand zuließ, ebenfalls ein Interview und die dargestellten Fragebogenverfahren zum Einsatz. Alle Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet. In Abhängigkeit der Belastbarkeit des Patienten und Partners sowie der zur Verfügung stehenden Zeit des Projektmitarbeiters (Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln) geschah die Bearbeitung der Fragebögen in Anwesenheit des Interviewers. War dies nicht möglich oder wurden nicht alle Fragebögen bearbeitet, verblieben diese bei den Betroffenen und wurden in einem vorfrankierten Rückumschlag zugesandt. In den meisten Fällen trafen die Fragebögen innerhalb von 5 Tagen ein. War dies nicht der Fall, wurden die Betroffenen telefonisch und ggf. schriftlich an die Rücksendung erinnert. Bei einigen wenigen Fällen zum Zeitpunkt T1 und bei den meisten Katamnesen waren beide Partner bei dem Interview anwesend. Die Interviews wurden jedoch mit beiden Partnern getrennt geführt. Bei der Durchführung der Katamnesen wurde darauf geachtet, dass die angestrebten Zeiträume (6, 12 und 18 Monate nach Verletzung) eingehalten werden. Dies ließ sich aus organisatorischen Gründen jedoch nicht stringent realisieren, so dass eine gewisse Varianz hinsichtlich der Zeit seit Verletzung bei der Durchführung der Follow-up Befragungen besteht. Die 6-Monats-Katamnese wurde durchschnittlich 29.3 Wochen (SD = 2.1, Range 26-34) nach Verletzung durchgeführt. Die mittlere Zeit seit Verletzung betrug bei der 12-Monats-Katamnese 55.8 Wochen (SD = 2.3, Range 5263). 106 1.5.1 Stichprobe Zwischen Februar 1999 und Februar 2002 durchliefen insgesamt 2458 Patienten das Screening. Darunter sind 13 Personen, die während einer kurzen Zeitspanne des Jahres 1999 aus zwei städtischen Krankenhäusern gemeldet wurden. Hierunter wiederum war eine Person, welche die Einschlusskriterien erfüllte, jedoch nicht zur Teilnahme bereit war. Alle folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Personen, die das Screening am Universitätsklinikum Dresden durchliefen. Dies sind N = 2 471 Patienten. Zwei Drittel dieser Patienten wurden in der Rettungsstelle mit der Eingangsdiagnose SHT geführt. Die ursprüngliche Stichprobe reduzierte sich deutlich durch das Alterskriterium. Dieses wurde von N = 940 Personen erfüllt. Eine weitere deutliche Reduktion erfolgte durch das Schweregradkriterium. Es wurden N = 111 Patienten mit einem GCS-Score von 3 bis 12 und N = 83 Patienten mit einem Hunt und Hess-Score von 2 bis 5 identifiziert. Insgesamt wurden N = 103 Patienten, die sämtliche Einschlusskriterien erfüllten, für die Teilnahme an der Studie angesprochen (bzw. deren Partner, wenn die Patienten nicht ausreichend ansprechbar waren). Von diesen nahmen N = 71 an der Studie teil, was einer Teilnehmerrate von 68,9 % entspricht. Die enorme Diskrepanz zwischen registrierten und angesprochenen Patienten erfordert einige klärende Ausführungen. Ein wesentlicher Punkt für die hohe Anzahl an Patienten, die das Screening durchliefen, liegt in dem Screeningprozedere begründet. Das Screening geschah in erster Linie, wie erwähnt, über die Rettungsstelle des Universitätsklinikums. In dem Aufnahmebuch (stationäre Patienten) werden u.a. Name, Alter und Eingangsdiagnose der Patienten notiert. Die hohe Zahl an Personen der Screeningstichprobe ergibt sich in erster Linie aus der Eingangsdiagnose "SHT 1. Grades". Diese war sehr häufig vertreten. Unter den Patienten mit dieser Eingangsdiagnose befinden sich solche, die eine leichte Gehirnprellung erlitten haben, aber auch sehr viele, die eine Gehirnerschütterung erlitten haben, z.B. im Rahmen eines Sturzes oder eines Schlages gegen den Kopf. Nahezu alle dieser Patienten wurden direkt auf eine reguläre Station, nicht auf die Intensivstation, der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie aufgenommen. Auf der anderen Seite waren einige Verletzungen so schwer, dass die Patienten an den Folgen ihrer Verletzungen 107 verstarben. Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Eingangsdiagnose "Polytrauma" sowohl Patienten umfasst, die gleichzeitig ein SHT aufweisen, als auch solche, die ein Polytrauma ohne begleitendes SHT erlitten haben. Schließlich zeigte sich in einigen Fällen, dass die Eingangsdiagnose "SAB" nicht mit der endgültigen Diagnose übereinstimmte. Insgesamt stellt die hohe Anzahl an Personen der Screeningstichprobe somit keine reliable Inzidenz der berücksichtigten Diagnosegruppen dar, und aufgrund der Ungenauigkeit dieser ersten Diagnose resultiert eine Screeningstichprobe, in der sich sehr viele Patienten befinden, die "fälschlicherweise" als potentielle Studienteilnehmer registriert wurden. Von den 32 Patienten bzw. Partnern, welche die Einschlusskriterien erfüllten und für die Teilnahme an der Studie angesprochen wurden, jedoch nicht an der Studie teilnahmen, wurden folgende Gründe für die Nicht-Teilnahme angeführt: • kein Interesse an der Studie (n = 13) • zu belastet, um an der Studie teilzunehmen (n = 7) • keine Zeit (n = 5) • keine Reaktion auf telefonische / schriftliche Anfrage (n = 2) • (Ehe-)Partner hat sich vor der Verletzung des Patienten von diesem getrennt (n = 2) • Partner spricht nicht ausreichend deutsch (n = 1) • Partner hat vor kurzem selber eine Hirnschädigung erlitten und ist nicht fähig, an der Studie teilzunehmen (n = 1) • Partner hat der Teilnahme zugestimmt, allerdings verstirbt der Patient, bevor es zu einem ersten Kontakt kommt (n = 1) Die soziodemographischen Merkmale der teilnehmenden Patienten (Gesamtstichprobe sowie in die Katamnesen eingehenden Patienten) sind in Tabelle 8 zusammenfassend dargestellt (Erhebungsbogen siehe Anhang). 59.2 % der Patienten der Gesamtstichprobe waren männlichen und 48.2 % weiblichen Geschlechts. Das Durchschnittsalter der Patientenstichprobe betrug 44.7 Jahre. Drei Viertel der Patienten waren mit ihrem Partner verheiratet, 88.7 % der Paare lebten in einem gemeinsamen Haushalt. Über drei Viertel der Patienten war vor der Verletzung berufstätig, 4.2 % 108 waren vor der Verletzung bereits berentet (EU-/BU-Rente). Alle Patienten wiesen die deutsche Staatsangehörigkeit auf. Betrachtet man Unterschiede in den soziodemographischen Merkmalen zwischen der Gesamtstichprobe und den in die Katamnesen eingehenden Teilstichprobe, so gibt es Hinweise darauf, dass in den Katamnesen mehr Paare vertreten sind, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Ferner sind in den Katamnesestichproben weniger Patienten mit Hauptschul- oder Volksschulabschluss vertreten, dagegen mehr Patienten mit einem Schulabschluss der Polytechnischen Oberschule und der Fachhochschule als in der Gesamtstichprobe. Weiterhin nimmt der Anteil an Patienten mit Lehre oder Fachschule als höchster Berufsausbildung im Katamnesezeitpunkt ab, hingegen der Anteil an Patienten mit Fachhochschule zu. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in den Katamnesestichproben im Vergleich zur Gesamtstichprobe kein Patient vertreten ist, der seine Erwerbstätigkeit als Selbständiger ausübt. Schließlich ist der Anteil an Patienten mit einem Einkommen von 2 000 bis 3 000 DM zu den Katamnesezeitpunkten geringer als in der Gesamtstichprobe, der Anteil an Patienten mit einem Nettohaushaltseinkommen von 3 000 bis 5 000 DM höher. Die verletzungsbezogenen Merkmale der Patientenstichprobe sind in Tabelle 9 zusammengestellt. Die Gesamtstichprobe stellt sich folgendermaßen dar: 43.7 % der Patienten hatten ein SHT erlitten, und 56.3 % eine spontane (nicht-traumatische) SAB. In 53.5 % der Fälle handelte es sich um eine mittelschwere Verletzung, und in 46.5 % der Fälle um eine schwere. Wie bereits erwähnt, wurden hier gemäß internationaler Gepflogenheit SHT-Patienten mit einem initialen GCS-Score von 3-8 als schwer und 912 als mittelschwer klassifiziert. Der initiale GCS-Score lag in 61.3 % der Fälle als Angabe aus dem Protokoll des Notarzteinsatzes vor, in 38.7 % der Fälle wurde er unter Hinzuziehung eines Arztes aus den verfügbaren Informationen rekonstruiert. Bei den SAB-Patienten wurden solche mit einem Hunt und Hess-Score von 2-3 als mittelschwer und von 4-5 als schwer klassifiziert. Ein entsprechendes Vorgehen findet sich auch in der internationalen Literatur (vgl. Kremer, Groden, Hansen, Grzyska & Zeumer, 1999; Proust et al., 1997). Männer und Frauen unterschieden sich hinsichtlich der Art der Verletzung: n = 26 Männer gegenüber n = 5 Frauen erlitten ein SHT, und n = 16 Männer gegenüber n = 24 Frauen eine SAB. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (Chi2 (1, N = 71) = 13.91, p < .001). Hingegen bestand kein Unterschied zwischen männlichen 109 und weiblichen Patienten hinsichtlich der Schwere der Verletzung (Chi2 (1, N = 71) = 1.49, p > .05). Ebenso bestand kein Unterschied im Schweregrad bei den beiden Verletzungsarten (Chi2 (1, N = 71) = .58, p > .05). Dieses Ergebnismuster zeigt sich auch dann, wenn nur die Patienten betrachtet werden, die in die Katamnese zu T2 bzw. T3 eingehen. Weiterhin bestand kein Zusammenhang zwischen Schweregrad der Verletzung und Teilnahme an der Katamnese. Die Verletzungsursache der SHT-Patienten (Gesamtstichprobe) war in über zwei Drittel der Fälle ein Verkehrsunfall. Daneben kam es in zwei Fällen zu einem Arbeitsunfall (Sturz von der Leiter bzw. von Metallträger am Kopf getroffen). In sieben Fällen resultierte das SHT aus einem Sturz (z.B. Sturz von Pferd, Sturz vom Balkon, Sturz vom Fahrrad ohne Beteiligung Dritter). 110 Tabelle 8: Soziodemographische Merkmale der Patienten der Gesamtstichprobe (N = 71), der in das komplexe Kriterium zu T2 eingehenden Stichprobe (N = 58) und zu T3 eingehenden Stichprobe (N = 42) Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Geschlecht; n (%) männlich 42 (59.2) 35 (60.3) 25 (59.5) weiblich 29 (40.8) 23 (39.7) 17 (40.5) 44.7 (10.7) 44.4 (11.1) 43.9 (11.3) ledig 9 (12.7) 8 (13.8) 5 (11.9) verheiratet 53 (74.6) 42 (72.4) 32 (76.2) geschieden/getrennt 8 (11.3) 7 (12.1) 4 (9.5) verwitwet 1 (1.4) 1 (1.7) 1 (2.4) Ehedauer 20.9 (10.1) 20.8 (10.1) 20.2 (10.2) Partnerschaftsdauer 7.0 (7.0) 7.5 (7.2) 6.3 (4.7) 0 8 (11.3) 7 (12.1) 5 (11.9) 1 22 (31.0) 17 (29.3) 12 (28.6) 2 29 (40.8) 23 (39.7) 17 (40.5) >2 12 (16.9) 11 (19.0) 9 (19.1) ja 63 (88.7) 52 (89.7) 39 (92.9) nein 8 (11.3) 6 (10.3) 3 (7.1) Alter zum Zeitpunkt der Verletzung / Jahre; M (SD) Familienstand; n (%) Beziehungsdauer zum Zeitpunkt der Verletzung / Jahre; M (SD) Anzahl Kinder; n (%) Gemeinsamer Haushalt mit Partner; n (%) 111 Fortsetzung Tabelle 8 Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Haushaltsgröße / Anzahl Personen; n (%) 1 4 (5.6) 3 (5.2) 1 (2.4) 2 23 (32.4) 19 (32.8) 12 (28.6) 3 32 (45.1) 26 (44.8) 22 (52.4) 4 9 (12.7) 7 (12.1) 5 (11.9) >4 3 (4.2) 3 (5.1) 2 (4.8) 1 4 (5.6) 3 (5.2) 1 (2.4) 2 45 (63.4) 38 (65.5) 29 (69.0) 3 20 (28.2) 16 (27.6) 11 (26.2) 4 4 (2.8) 1 (1.7) 1 (2.4) Hauptschule/Volksschule 16 (22.5) 10 (17.2) 4 (9.5) Realschule 8 (11.3) 6 (10.3) 5 (11.9) Polytechnische Oberschule 31 (43.7) 27 (46.6) 21 (50.0) Fachhochschule 4 (5.6) 4 (6.9) 4 (9.5) Abitur 11 (15.5) 10 (17.2) 7 (16.7) keine 1 (1.4) 1 (1.7) 1 (2.4) Lehre 41 (57.7) 33 (56.9) 22 (52.4) Fachschule 11 (15.5) 8 (13.8) 5 (11.9) Fachhochschule 8 (11.3) 7 (12.1) 7 (16.7) Universität 6 (8.5) 6 (10.3) 4 (9.5) keine 5 (7.0) 4 (6.9) 4 (9.5) Anzahl erwachsener Personen (≥ 18 J.) im Haushalth; n (%) Schulbildung; n (%) Berufsausbildung; n (%) 112 Fortsetzung Tabelle 8 Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Erwerbstätigkeit vor Verletzung; n (%) ja, ganztags 51 (71.8) 39 (67.2) 30 (71.4) ja, mindestens halbtags 6 (8.5) 5 (8.6) 3 (7.1) ja, weniger als halbtags 2 (2.8) 2 (3.4) 1 (2.4) nein, Hausfrau/Hausmann 1 (1.4) 1 (1.7) 1 (2.4) nein, in Ausbildung 2 (2.8) 2 (3.4) 2 (4.8) nein, arbeitslos 6 (8.5) 6 (10.3) 4 (9.5) nein, EU/BU-Rente 3 (4.2) 3 (5.2) 1 (2.4) Arbeiter 37 (52.1) 31 (55.4) 22 (55.0) Angestellter 28 (39.4) 25 (44.6) 18 (45.0) Beamter - - - - - - Selbständiger 4 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 1000-2000 2 (2.8) 2 (3.4) 1 (2.4) 2000-3000 17 (23.9) 11 (19.0) 6 (14.3) 3000-4000 23 (32.4) 19 (32.8) 15 (35.7) 4000-5000 16 (22.5) 14 (24.1) 11 (26.2) 5000-6000 7 (9.9) 7 (12.1) 5 (11.9) 6000-7000 2 (2.8) 2 (3.4) 2 (4.8) >7000 4 (5.6) 3 (5.2) 2 (4.8) Berufliche Stellung vor Verletzung; n (%) Nettohaushaltseinkommen vor Verletzung / DM; n (%) 113 Tabelle 9: Übersicht der verletzungsbezogenen Merkmale der Patienten der Gesamtstichprobe (N = 71), der in das komplexe Kriterium zu T2 eingehenden Stichprobe (N = 58) und zu T3 eingehenden Stichprobe (N = 42) Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Schädigung; n (%) SHT 31 (43.7) 27 (46.6) 20 (47.6) SAB 40 (56.3) 31 (53.4) 22 (52.4) mittelschwer 38 (53.5) 31 (53.4) 21 (50.0) schwer 33 (46.5) 27 (46.6) 21 (50.0) mittelschwer 15 (48.4) 12 (44.4) 9 (45.0) schwer 16 (51.2) 15 (55.6) 11 (55.0) mittelschwer 23 (57.5) 19 (61.3) 12 (54.5) schwer 17 (42.5) 12 (38.7) 10 (45.5) Verkehrsunfall als Autofahrer 13 (41.9) 12 (44.4) 9 (45.0) Verkehrsunfall als Motorradfahrer 5 (16.1) 3 (11.1) 2 (10.0) Verkehrsunfall als Radfahrer 3 (9.7) 3 (11.1) 1 (5.0) Verkehrsunfall als Fußgänger 1 (3.2) 1 (3.7) 1 (5.0) Arbeitsunfall 2 (6.5) 2 (7.4) 2 (10.0) Sonstiges 7 (22.6) 6 (22.2) 5 (25.0) Schweregrad alle Patienten; n (%) Schweregrad SHT-Patienten; n (%) Schweregrad SAB-Patienten; n (%) Verletzungsursache SHT-Patienten; n (%) 114 Die soziodemographischen Merkmale der teilnehmenden Partner sind in Tabelle 10 dargestellt. In allen Fällen handelte es sich heterosexuelle Paare, so dass – in Bezug auf die Gesamtstichprobe – entsprechend 29 männliche und 42 weibliche Partner an der Studie teilnahmen. Das Durchschnittsalter betrug 44.3 Jahre. Da nicht alle Paare verheiratet waren und in einem gemeinsamen Haushalt lebten, gibt die Tabelle 9 auch einen Überblick zu Merkmalen, in denen sich die Partner von den Patienten unterscheiden können, wie z.B. Familienstand, Anzahl der Kinder und Haushaltsnettoeinkommen. Betrachtet man die Stichprobenzusammensetzungen, so zeigt sich, dass zu den Katamnesezeitpunkten weniger Partner mit Haupt- oder Volksschule sowie einem Schulabschluss der Polytechnischen Oberschule vertreten sind als in der Ausgangsstichprobe, hingegen nimmt der prozentuale Anteil der Partner mit Abitur zu. Weiterhin sind in den Katamnesestichproben weniger Partner mit einer Lehre als Berufsausbildung vertreten und mehr Partner mit einem Universitätsabschluss als in der Ausgangsstichprobe. Ferner sind in den Katamnesestichproben weniger Partner vertreten, die ihre Erwerbstätigkeit ganztags ausüben als in der Gesamtstichprobe. Ein Trend zeigt sich auch bzgl. der beruflichen Stellung. So sind in den Katamnesestichproben der Partner weniger Selbständige, dagegen mehr Angestellte vertreten. Als letzter Trend zeigt sich, dass in den Katamnesestichproben der Anteil der Partner mit einem Nettohaushaltseinkommen von 1 000 bis 3 000 DM niedriger, und der Anteil der Partner mit einem Einkommen von 6 000 DM und mehr höher ist als in der Gesamtstichprobe zu T1. Partner von Patienten mit mittelschwerer Verletzung unterschieden sich nicht von den Partnern von Patienten mit schwerer Verletzung in Bezug auf das Alter (44.7 vs. 44.6, t (69) = .04, p > .05). Ebenso gab es keinen Unterschied zwischen der Zeit seit Verletzung und Befragung zu T1 zwischen den Partnern von mittelschwer und schwer verletzten Patienten (M = 38.2 vs. M = 41.9, t (69) = -1.00, p > .05). Dasselbe Ergebnismuster zeigt sich, wenn die Auswertung auf die in die Katamnesen eingehenden Partner beschränkt wird. Die Partnerstichprobe, die in die T2-Analyse eingeht, wurde zum ersten Erhebungszeitpunkt im Mittel 39.4 Tage nach Verletzung befragt (SD = 15.7, Range 12-85), die Partnerstichprobe der T3-Analyse wurde im Mittel 38.3 Tage nach Verletzung befragt (SD = 16.4, Range 12-85). 115 Die Durchführung einer Verweigereranalyse ist auf die Merkmale Geschlecht und Alter des Patienten beschränkt, da für die Nicht-Teilnehmer an der Studie nur diese Angaben verfügbar sind (diese Angabe liegen aufgrund eines Organisationsfehlers nur für 31 der Verweigerer vor). Hier zeigt sich weder ein Unterschied im Alter zwischen den teilnehmenden (Gesamtstichprobe) und nicht-teilnehmenden Patienten (t (100) = -.23, p > .05), noch besteht ein Unterschied in der Geschlechterverteilung zwischen den teilnehmenden (Gesamtstichprobe) und nicht-teilnehmenden Patienten (Chi2 (1, N = 102) = .67, p > .05). 116 Tabelle 10: Soziodemographische Merkmale der Partner der Gesamtstichprobe (N = 71), der in das komplexe Kriterium zu T2 eingehenden Stichprobe (N = 58) und zu T3 eingehenden Stichprobe (N = 42) Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Geschlecht; n (%) männlich 29 (40.8) 23 (39.7) 17 (40.5) weiblich 42 (59.2) 35 (60.3) 25 (59.5) 44.3 (10.6) 44.2 (10.9) 43.9 (11.2) ledig 7 (9.9) 7 (12.1) 4 (9.5) verheiratet 53 (74.6) 42 (72.4) 32 (76.2) geschieden/getrennt 9 (12.7) 7 (12.1) 5 (11.9) verwitwet 2 (2.8) 2 (3.4) 1 (2.4) 0 8 (11.3) 8 (13.8) 5 (11.9) 1 23 (32.4) 17 (29.3) 14 (33.3) 2 31 (43.7) 24 (41.4) 17 (40.5) >2 9 (12.7) 9 (15.4) 6 (14.3) 1 4 (5.6) 3 (5.2) 1 (2.4) 2 25 (35.2) 21 (36.2) 13 (31.0) 3 29 (40.8) 23 (39.7) 20 (47.6) 4 9 (12.7) 7 (12.1) 5 (11.9) >4 4 (5.6) 4 (6.8) 3 (7.2) Alter zum Zeitpunkt Verletzung / Jahre; M (SD) Familienstand; n (%) Anzahl Kinder; n (%) Haushaltsgröße; n (%) 117 Fortsetzung Tabelle 10 Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Anzahl erwachsener Personen (> 18 J.) im Haushalt; n (%) 1 5 (7.0) 3 (5.2) 1 (2.4) 2 47 (66.2) 40 (69.0) 30 (71.4) 3 16 (22.5) 13 (22.4) 9 (21.4) 4 2 (2.8) 1 (1.7) 1 (2.4) >4 1 (1.4) 1 (1.7) 1 (2.4) Hauptschule/Volksschule 10 (14.1) 9 (15.5) 5 (11.9) Realschule 14 (19.7) 9 (15.5) 8 (19.0) Polytechnische Oberschule 28 (39.4) 22 (37.9) 14 (33.3) - - - - - - 19 (26.8) 18 (31.0) 15 (35.7) Lehre 39 (54.9) 32 (55.2) 22 (52.4) Fachschule 12 (16.9) 7 (12.1) 6 (14.3) Fachhochschule 5 (7.0) 5 (8.6) 3 (7.1) Universität 12 (16.9) 11 (19.0) 9 (21.4) keine 3 (4.2) 3 (5.2) 2 (4.8) Schulbildung; n (%) Fachhochschule Abitur Berufsausbildung; n (%) 118 Fortsetzung Tabelle 10 Gesamtstichprobe Stichprobe T2 Stichprobe T3 Erwerbstätigkeit vor der Verletzung; n (%) ja, ganztags 44 (62.0) 33 (56.9) 23 (54.8) ja, mindestens halbtags 8 (11.3) 8 (13.8) 5 (11.9) ja, weniger als halbtags 2 (2.8) 2 (3.4) 2 (4.8) nein, Hausfrau/Hausmann 4 (5.6) 4 (6.9) 3 (7.1) nein, in Ausbildung 9 (12.7) 7 (12.1) 5 (11.9) nein, arbeitslos 2 (2.8) 2 (3.4) 2 (4.8) nein, EU/BU-Rente 2 (2.8) 2 (3.4) 2 (4.8) Arbeiter 30 (42.3) 24 (43.6) 17 (42.5) Angestellter 26 (36.6) 24 (43.6) 18 (45.0) Beamter 1 (1.4) 1 (1.8) 0 - Selbständiger 11 (15.5) 6 (10.9) 5 (12.5) 1000-2000 4 (5.6) 3 (5.2) 1 (2.4) 2000-3000 16 (22.5) 11 (19.0) 7 (16.7) 3000-4000 22 (31.0) 18 (31.0) 13 (31.0) 4000-5000 15 (21.1) 13 (22.4) 10 (23.8) 5000-6000 7 (9.9) 7 (12.1) 5 (11.9) 6000-7000 3 (4.2) 3 (5.2) 3 (7.1) >7000 4 (5.6) 3 (5.2) 3 (7.1) Berufliche Stellung vor der Verletzung; n (%) Nettohaushaltseinkommen vor der Verletzung / DM; n (%) 119 1.6 Ergebnisse 1.6.1 Einfluss sozialer Merkmale auf das generellen Anpassungsniveaus der Patienten sechs Monate nach Verletzung 1.6.1.1 Charakterisierung der Partnerstichprobe Als erster Schritt der Ergebnisdarstellung wird im folgenden eine Charakterisierung der Partner hinsichtlich der sozialen Unterstützung, der supportiven Handlungen (emotional, praktisch und sozial) und der fünf intendierten Unterstützungsfunktionen vorgenommen. Zudem wird die körperliche sowie psychische Verfassung und die Qualität der Paarbeziehung beleuchtet. Dazu wird eine Übersicht der statistischen Kennwerte der Partnervariablen zu T1 geliefert. Dargestellt werden die Angaben von N = 58 von 71 Partnern, für die Angaben zur 6-Monats-Katamnese vorliegen. Zur Veranschaulichung werden für die eingesetzten Verfahren Vergleichswerte aus anderen Untersuchungen Verteilungskennwerte erleichtert angeführt, wird. Bei so den dass die Verfahren, Einordnung bei denen der keine Vergleichswerte angegeben sind, handelt es sich um Eigenkonstruktionen, die für die vorliegende Studie entwickelt wurden. Eine Ausnahme bildet jedoch der FDCT-2. In der Publikation zu diesem Verfahren werden keine Verteilungskennwerte für die von uns genutzten Skalen genannt. Unseres Wissens liegen keine Studien vor, denen sich Vergleichswerte für dieses Verfahren entnehmen ließen. In den zahlreichen Studien der Arbeitsgruppe von Bodenmann, dem Testautor des FDCT-2, wurde abgewandelte und weiterentwickelte Versionen des FDCT-2 benutzt, wodurch die entsprechenden Werte keinen direkten Vergleich zu unseren Ergebnissen zulassen. Soziale Unterstützung Mittelwert, Standardabweichung und Wertebereich der Variablen, die die Merkmale sozialer Unterstützung beschreiben, sind in den Tabellen 11 und 12 120 dargestellt. Mit Ausnahme der Intendierten Unterstützung (Card Sorting-Verfahren) liegt die Stichprobe in den auf Fremdbeurteilung beruhenden Merkmalen zur sozialen Unterstützung bei N = 57. Für das selbsteingeschätzte Ausmaß sozialer Unterstützung liegt die Stichprobe aufgrund unzulässiger fehlender Werte bei N = 55. Es zeigt sich, dass die Partner in der Selbsteinschätzung ein hohes Ausmaß an geleisteter Unterstützung angeben. Auf einer Skala von 1 bis 6 liegt der Mittelwert bei M = 5.3. Die Fremdeinschätzung der geleisteten Unterstützung erbringt durchschnittlich ein mittleres Ausmaß an Hilfe. Auf einer Skala von 0 bis 3 liegt der Mittelwert bei M = 1.5. Es besteht somit eine deutliche Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung der geleisteten Hilfe und der Fremdeinschätzung. Art der Hilfe Bezüglich der Art der Unterstützung ergibt sich, dass supportive praktische Handlungen (SU-PR) am häufigsten und supportive soziale Handlungen (SU-SO) am seltensten genannt wurden. Im Durchschnitt wurden pro Partner 16 supportive Handlungen genannt. Zu beachten ist jedoch, dass bei der Anzahl und Art der supportiven Handlungen eine große interindividuelle Variabilität besteht. So schwankt beispielsweise die Gesamtzahl supportiver Handlungen zwischen 3 und 31. Ebenso besteht eine hohe Variabilität hinsichtlich der Vielseitigkeit der supportiven Handlungen (SU-V). Partner deckten mit ihrem Hilfeverhalten zwischen einer und elf Kategorien ab. Im Durchschnitt wurden durch die supportiven Handlungen sechs Kategorien abgedeckt. 121 Tabelle 11: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Variablen zur sozialen Unterstützung (N = 58) M SD Range Selbsteinschätzung SU-S a 5.3 0.7 2.8-6.0 Fremdeinschätzung SU-I b 1.5 0.6 0.3-2.8 4.8 3.3 0-16 8.4 4.2 1-20 1.9 1.7 0-6 15.7 6.9 3-31 6.1 1.9 1-11 Soziale Unterstützung Supportive Handlungen Emotional SU-EM b Praktisch SU-PR b Sozial SU-SO b Gesamtscore SU-HA b Vielseitigkeit SU-V b Anmerkung. a N = 55, b N = 57 Tabelle 12: Mittelwert (M), Standabweichung (SD) und Range der Variablen zur intendierten Unterstützung (N = 58) M SD Range Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 57.9 13.5 29.3-83.8 Optimierung patientenseitiger 35.0 15.7 0.0-69.7 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 25.6 13.7 0.0-56.6 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 14.2 13.2 0.0-51.5 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 10.7 11.9 0.0-42.4 Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 Intendierte Unterstützung Die intendierte Unterstützung wurde mittels eines Card Sorting-Verfahrens aus 30 Karten erhoben. Bei der intendierten Hilfe wird die Funktion SU-F1 ("Sicherung der Rahmenbedingungen"), die sich verkürzt als Funktion emotionaler Unterstützung beschreiben lässt, als am wichtigsten für das eigene supportive Handeln beurteilt. Dies 122 bedeutet, dass die Partner mit ihrer Hilfe vor allem Ziele erreichen wollen, welche die partnerschaftliche Beziehung und das emotionale Befinden des Patienten betreffen. Als zweitwichtigste Funktion erwies sich die Funktion SU-F2 ("Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse"), die sich verkürzt als Funktion praktischer Unterstützung kennzeichnen lässt. Am unwichtigsten für das eigene Hilfeverhalten wurde die Funktion SU-F5 ("Regulierung der eigenen Befindlichkeit") eingeschätzt. Unterstützungsbezogene Bewertungen Die Partner schätzen die Hilfebedürftigkeit (B-H) des Patienten sehr hoch ein. Der Mittelwert beträgt M = 5.4 auf einer Skala von 1 bis 6. Die Mittelwerte für die Fragen nach dem Wissen um hilfreiche Handlungen (B-W), nach der Erfolgserwartung (B-E) und nach der Akzeptanz der geleisteten Hilfe liegen vergleichbar hoch (s. Tabelle 13). Dies bedeutet, die Partner sind sich recht sicher in ihrer Einschätzung, welche Unterstützung für den Patienten besonders hilfreich ist; sie sind in hohem Maße davon überzeugt, dass ihre Hilfe zu dem von ihnen erhofften Ziel führt; und sie sind sich sehr sicher, dass der Patient die Hilfe auch annehmen wird. Körperbeschwerden, psychische Befindlichkeit der Partner Um die Ausprägung der somatischen und psychischen Befindlichkeit beurteilen zu können, bietet sich ein Vergleich der Ergebnisse der Partner mit vorliegenden Daten der Allgemeinbevölkerung an. Hinsichtlich der somatischen Beschwerden zeigt sich, dass die Partnerstichprobe ein sehr ähnliches Ausmaß an somatischen Beschwerden aufweist wie die Allgemeinbevölkerung (vgl. Brähler, Schumacher & Brähler, 2000) (s. Tab. 13). Bei den somatischen Beschwerden ergibt eine Kategorisierung keine erhöhte Prävalenz der Beeinträchtigung durch körperliche Symptome: 46.4 Prozent der Partner befinden sich im dritten bzw. vierten Quartil der Symptomausprägung, wobei aufgrund der verwendeten Skala 50 Prozent zu erwarten wären. 123 Tabelle 13: Mittelwerte, Standardabweichungen und Range der Verfahren zur Erhebung individueller Merkmale; Vergleichswerte (Quelle: Testautor sofern nicht anders vermerkt) und Angehörigenstichprobe (N = 58) Vergleichswerte M SD Angehörigenstichprobe M SD Range Hilfsbedürftigkeit B-H 5.4 1.0 3-6 Wissen B-W 4.8 1.3 2-6 Erfolg B-E 5.1 1.1 2-6 Akzeptanz B-A 5.4 0.9 3-6 Unterstützungsbezogene Bewertungen Befindlichkeit 14.01 12.7 14.3 11.3 0-45 Angst BAI 3.5 5.8 11.5 10.2 0-47 Depressivität BDI 6.5 5.2 10.4 6.7 0-28 Körperliche Beschwerden GBB Anmerkung. 1 Brähler et al. (2000) Die Mittelwerte im Beck Depressions-Inventar und im Beck-Angst-Inventar sind gegenüber der Allgemeinbevölkerung erhöht (s. Tab. 13). Zieht man von den Autoren angegebene Cut-off-Werte für eine klinisch relevante Ausprägung psychischer Beschwerden heran, so ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt 50 % der Partner zeigen eine auffällige Angstsymptomatik. Wird die Kategorisierung weiter aufgegliedert, so zeigt sich, dass 20.7 % eine leichte und 29.3 % eine deutliche Beeinträchtigung durch Angstsymptome angeben. Dagegen weisen 36.2 % eine leichte und 13.8 % eine deutliche Beeinträchtigung durch depressive Beschwerden auf. Insgesamt beträgt die Prävalenz einer klinisch ausgeprägten Depressivität – ebenso wie bei der Angst – 50 %. Die Prävalenzraten sind zur Veranschaulichung in Abbildung 2 dargestellt. 124 40 30 20 10 0 K rperliche Beschwerden Angst Leicht Depressivit t Deutlich Abbildung 2. Prävalenz leichter und deutlicher Beeinträchtigung durch körperliche Symptome (GBB), Angst (BAI) und Depressivität (BDI) in der Partnerstichprobe (N = 58) Die Paarbeziehung der Schädelhirntrauma-Patienten Die statistischen Kennwerte der beziehungsbezogenen Verfahren sind in Tabelle 14 dargestellt. Bei den beziehungsbezogenen Merkmalen liegt die Stichprobengröße aufgrund von Missings in den beiden FACES-Skalen bei N = 56 (Kohäsion) bzw. N = 55 (Adaptabilität). Die statistischen Kennwerte der beziehungsbezogenen Variablen (DAS, Faces, Dyadisches Coping, Konfliktpotential) verdeutlichen, dass die Paarbeziehung vor der Verletzung im Durchschnitt durch ein niedriges Konfliktpotential (KON) und durch eine hohe Beziehungsqualität gekennzeichnet war. 10.3 % der Partner gaben einen Summenwert < 100 in der DAS an, was traditionell als Grenzwert für eine belastete Paarbeziehung angesehen wird. Die Mittelwerte in den Bindungsskalen sind vergleichbar denen, die von Asendorpf et al. (1997) mitgeteilt werden. Weiterhin zeigt sich ein hohes Maß an positivem und ein niedriges Maß an negativem dyadischen Coping. Bezogen auf die Gesamtfamilie geben die Partner eine hohe familiäre Kohäsion und ebenso eine hohe familiäre Adaptabilität im FACES an. 125 Tabelle 14: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Verfahren zur Erhebung beziehungsbezogener Merkmale; Vergleichswerte (Quelle: Testautor sofern nicht anders vermerkt) und Angehörigenstichprobe (N = 58) Vergleichswerte M SD Angehörigenstichprobe M SD Range Konfliktpotential KON 5.4 3.2 3-17 Positives dyadisches Coping FDCT-P 2.2 0.4 1.4-3.0 Negatives dyadisches Coping FDCT-N 0.6 0.3 0.0-1.4 Bindung sicher BB-S 4.4 0.5 4.7 0.4 3.7-5.0 Bindung abhängig BB-A 3.3 0.6 3.7 0.7 2.1-5.0 Beziehungsqualität DAS 115.1 12.3 121.6 14.6 83-146 Familiäre Kohäsion FACES-Ka 3.81 0.6 4.4 0.4 3.4-5.0 Familiäre Adaptabilität FACES-Ab 3.01 0.5 4.1 0.4 3.3-5.0 Anmerkung. a N = 56, b N = 55 1 Schulz, Schulz, Schulz & von Kerekjarto (1998b), FACES III (Kurzform FACES II) Zusammenfassung zu den personen- und beziehungsbezogenen Variablen Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Partner der Ansicht sind, sie leisten ein sehr hohes Maß an sozialer Unterstützung, wohingegen in der Fremdbeurteilung im Durchschnitt ein mittleres Maß an sozialer Unterstützung deutlich wird. Es besteht eine hohe interindividuelle Variabilität in der Anzahl und Vielseitigkeit supportiver Handlungen, wobei Hilfeverhalten im praktischen Bereich dominiert. Am bedeutsamsten für das eigene Hilfeverhalten sind Ziele im Bereich der Sicherung der Rahmenbedingungen, d.h. im Vermitteln von Beziehungssicherheit und emotionaler Stützung. Die Partner schätzen den Patienten als sehr hilfebedürftig ein und sind sich recht sicher, dass sie die richtige Hilfe geben können, die zum gewünschten Ergebnis führen und vom Patienten auch akzeptiert wird. Diese Unterstützung des Patienten geschieht auf dem Boden einer deutlichen psychischen, nämlich ängstlichen und depressiven, nicht jedoch körperlichen Belastung und vor dem Hintergrund einer mehrheitlich guten Paarbeziehung und hohem familiären Zusammenhalt. 126 1.6.1.2 Patientenoutcome nach sechs Monaten – komplexes Kriterium zu T2 Im Folgenden wird die Konstruktion des komplexen Outcome-Kriteriums auf Seiten des Patienten für die Zeit 6 Monate nach Verletzung beschrieben. Auf dieses Kriterium wird im weiteren die Prädiktion durchgeführt. Die deskriptiven Kennwerte der einzelnen Patientenvariablen, die in dieses komplexe Kriterium eingehen, sind in Tabelle 15 dargestellt. Der Barthel-Index (BI) liegt dabei für alle Patienten vor, da er als Fremdbeurteilung durch den Interviewer aufgrund der Angaben des Partners und/oder des Patienten eingeschätzt wurde. Die niedrige Stichprobengröße im d2 sowie im RBMT resultiert, wie bereits oben ausgeführt, aus logistischen Gründen (Zeitmangel) oder Erschöpfung des Patienten (die Verfahren wurden am Ende der Befragung vorgelegt). Die Abweichungen der Stichprobengröße in den weiteren Verfahren sind dem Zustand des Patienten geschuldet, d.h. der Betroffene war nicht in der Lage, die Instrumente zu bearbeiten. Tabelle 15: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Variablen des komplexen Kriteriums (Summenscores außer wenn gekennzeichnet); Vergleichswerte (Quelle: Testautor sofern nicht anders vermerkt) und Patientenstichprobe Vergleichswerte Patientenstichprobe M SD M SD Range Aufmerksamkeit d2 a 100x 10 102.1 12.2 79-125 Gedächtnis RBMT b 22.2x 1.9 19.1 4.5 1-24 Angst BAI c 3.5x 5.8 8.1 9.1 0-39 x 5.2 7.9 7.1 0-35 12.7 17.4 14.1 0-52 Depressivität BDI c 6.5 Körperliche Beschwerden GBB d 14.0 1,x Posttraumatische Symptome RPQ e 8.42,y 11.6 18.0 12.6 0-47 Funktionale Selbständigkeit BI f 89.93,y 26.8 83.7 30.0 5-100 4,y 12.6 14.5 10.2 0-35 Alltagsaktivitäten RHFUQ d 19.6 Anmerkung. a N = 28; b N = 25; c N = 45; d N = 46; e N = 47; f N = 58 1 Brähler et al. (2000); 2 Ingebrigtsen, Waterloo, Marup-Jensen, Attner & Romner (1998); Lippert-Grüner, Wedekind, Wenzel, Lefering & Klug (2002); 4 McCullagh et al. (2001) x Basis: Allgemeinbevölkerung; y Basis: klinische Gruppe 3 127 In Tabelle 16 ist der Anteil an Patienten angegeben, der in dem jeweiligen Verfahren anhand der definierten Cut-off-Werte als "unauffällig", "leicht", "deutlich" bzw. "sehr deutlich auffällig" eingeschätzt wurde. Mit Ausnahme des d2 und des RBMT wurde die Kategorisierung für alle 58 Patienten vorgenommen. Wie oben erwähnt, wurden Patienten, die nicht in der Lage waren, ein Verfahren zu bearbeiten, als "sehr deutlich auffällig" klassifiziert. Die Abweichung im d2 und im RBMT ergibt sich, da diese Verfahren nicht allen Patienten vorgelegt wurden. Tabelle 16: Anteil an Patienten (Prozent) in den Kategorien des komplexen Kriteriums (N = 58) unauffällig leicht deutlich sehr auffällig auffällig deutlich auffällig a 60.0 7.5 2.5 30.0 18.9 40.5 5.4 35.1 Angst BAI 46.6 19.0 8.6 25.9 Depressivität BDI 58.6 10.3 6.9 24.1 Körperliche Beschwerden GBB 39.7 22.4 17.2 20.7 Posttraumatische Symptome RPQ 44.8 24.1 12.1 19.0 Funktionale Selbständigkeit BI 77.6 3.4 8.6 10.3 Alltagsaktivitäten RHFUQ 32.8 24.1 13.8 29.3 Erwerbstätigkeit 10.3 8.6 81.0 0.0 Aufmerksamkeit d2 Gedächtnis RBMT b Anmerkung. a N = 40; b N = 37 Die Bereiche mit sehr hohen Anteilen an unauffälligen Patienten sind funktionale Selbständigkeit (BI), Aufmerksamkeit (d2 Gesamtleistung) und Depressivität (BDI). Die Bereiche mit den höchsten Anteilen an sehr deutlich auffälligen Patienten sind Gedächtnis (RBMT), Aufmerksamkeit (d2) und Veränderungen in Aktivitäten des täglichen Lebens (RHFUQ). Die Patientenstichprobe ist somit durch eine vergleichsweise hohe körperliche Mobilität gekennzeichnet, wobei trotzdem deutliche Beeinträchtigungen in der Fähigkeit vorliegen, in gewohnter Weise am Alltag teilnehmen 128 zu können. Die körperlichen Beschwerden stehen gegenüber der Beeinträchtigung des psychischen Befindens im Vordergrund. Bildung des Kriteriums Aufgrund der durchgeführten statistischen Aggregation besteht die Schwierigkeit, eine Häufigkeitsverteilung des Komplexen Kriteriums anzugeben, da die bei der Ursprungszuordnung für die einzelnen Verfahren vorgenommene ganzzahlige Zuordnung nach der Aggregation nicht mehr besteht. Um trotzdem einen Eindruck der Verteilung des globalen Outcomes zu vermitteln, wurde die Kategorisierung für das aggregierte komplexe Kriterium wie folgt vorgenommen: unauffällig: 0-0.5; leicht auffällig: > 0.5-1.5; deutlich auffällig: > 1.5-2.5; sehr deutlich auffällig: > 2.5. Nach dieser Einteilung ergibt sich folgendes Bild: 36.2 % der Patienten fallen in die Kategorie "unauffällig", 36.2 % sind "leicht auffällig", 8.6 % sind als "deutlich auffällig" und 19.0 % als "sehr deutlich auffällig" einzustufen (vgl. Abb. 3). 40 35 Prozent 30 25 unauff llig leicht auff llig deutlich auff llig sehr deutlich auff llig 20 15 10 5 0 Komplexes Kriterium Abbildung 3: Anteil der Patienten (N = 58) in den Kategorien des Komplexen Kriteriums sechs Monate nach Verletzung 129 1.6.1.3 Interkorrelationen der Prädiktorvariablen (Angehöriger) Um eine Prädiktion der Angehörigenvariablen zum Zeitpunkt T1 auf das komplexe Kriterium des Patienten sechs Monate später durchführen zu können, wird zunächst die Unabhängigkeit der Prädiktorvariablen des Angehörigen durch die Berechnung der Interkorrelationen geprüft. Da die Prädiktorvariablen ähnliche Merkmalsbereiche umfassen, war von teilweise hohen Interkorrelationen auszugehen. In einem zweiten Schritt werden die Zusammenhänge zu den Moderatorvariablen geprüft. Die Interkorrelationen der Prädiktorvariablen sind in Tabelle 17 dargestellt. Es zeigt sich nur eine niedrige Korrelation zwischen dem von den Partnern selbsteingeschätzten Ausmaß an sozialer Unterstützung (SU-S) und dem Fremdrating des Ausmaßes sozialer Unterstützung (SU-I) von r = .34. Entsprechend bestehen auch nicht-signifikante bis niedrige Korrelationen zwischen der Selbsteinschätzung der Partner (SU-S) und der Anzahl an supportiven Handlungen (SU-EM, SU-PR, SU-SO, SU-HA). Die höchste Korrelation besteht zwischen dem selbsteingeschätzten Ausmaß und der Gesamtsumme supportiver Handlungen (r = .36). Hingegen liegen niedrige bis moderate Korrelationen zwischen den einzelnen Inhaltskategorien supportiver Handlungen vor, während die einzelnen Inhaltskategorien in der Mehrzahl deutlich mit dem Gesamtscore (SU-HA) sowie dem Vielseitigkeitsindex (SU-V) korrelieren. Betrachtet man den Zusammenhang zwischen den Intentionen supportiven Handelns und der tatsächlich geleisteten Unterstützung, so zeigen sich nur zwei signifikante Zusammenhänge. Partner, die mit ihrer Hilfe vor allem die "Sicherung der Rahmenbedingungen" (SU-F1) anstreben, leisten weniger praktische supportive Handlungen. Hingegen besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Funktion "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" (SU-F4) und der Anzahl an praktischen supportiven Handlungen, d. h. je bedeutsamer diese Funktion für das eigene supportive Handeln eingeschätzt wird, desto mehr praktische Hilfe leisten die Partner. Die Interkorrelationen der fünf Funktionen supportiven Handelns zeigen signifikante negative Korrelationen zwischen den Funktionen "Sicherung der Rahmenbedingungen" (SU-F1) und "Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse" (SU-F2), 130 welche sich verkürzt als "informative Funktion" beschreiben lässt, die jeweils negativ mit den Funktionen "Ausgleich krankheitsbedingter Defizite (SU-F3) und "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" (SU-F4) zusammenhängen. Insgesamt sprechen die Korrelationen für die Distinktheit der untersuchten Merkmalsbereiche. So liegt die Korrelation zwischen selbstbeurteilter sozialer Unterstützung und fremdbeurteilten supportiven Handlungen niedriger als zwischen fremdbeurteilter sozialer Unterstützung und fremdbeurteilten supportiven Handlungen, was aufgrund der Methodenvarianz zu erwarten war. Weiterhin bestehen teilweise hohe Korrelationen innerhalb der Kategorien supportiver Handlungen, jedoch kaum signifikante Korrelationen zu den Bereichen intendierter Unterstützung. 131 Tabelle 17: Interkorrelationen (Pearson) der Prädiktorvariablen (N = 55-57) SU-I SU-EM SU-PR SU-SO SU-HA SU-V SU-F1 SU-F2 SU-F3 SU-F4 SU-F5 SU-S .34 * .30 * .32 * .12 .36 ** .23 .01 .02 .03 -.07 .02 SU-I - .52 *** .60 *** .17 .67 *** .52 *** -.18 .07 .20 .11 -.23 - .29 * .30 * .76 *** .67 *** .00 .05 .03 -.03 -.04 - .02 .78 *** .45 *** -.34 * .11 .22 .32 * -.19 - .43 ** .45 *** .14 .11 -.10 -.02 -.04 - .77 *** -.19 .14 .13 .16 -.15 - -.07 .23 .04 .02 -.18 - -.05 -.36 ** -.41 ** -.26 - -.41 ** -.34 ** -.18 - .10 -.25 - -.16 SU-EM SU-PR SU-SO SU-HA SU-V SU-F1 SU-F2 SU-F3 SU-F4 SU-F5 - Anmerkung: SU-S: Soziale Unterstützung-Selbsteinschätzung; SU-I: Soziale Unterstützung-Fremdeinschätzung Interviewrating; SU-EM: Supportive Handlungen-Emotional; SU-PR: Supportive Handlungen-Praktisch; SU-SO: Supportive Handlungen-Soziale; SU-HA: Supportive Handlungen-Gesamtscore; SU-V: Supportive Handlungen-Vielseitigkeit; SU-F1: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 1; SU-F2: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 2; SU-F3: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 3; SU-F4: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 4; SU-F5: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 5 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 132 1.6.1.4 Zusammenhänge zwischen Prädiktor- und Moderatorvariablen auf Seiten des Angehörigen und dem globalen Patientenoutcome Nachfolgend wurden Korrelationen zwischen den Prädiktor- und den Moderatorvariablen auf Seiten des Angehörigen berechnet. Zusammenhänge zwischen diesen Variablen sind zum einen inhaltlich bedeutsam, da sie Hinweise auf Determinanten und Bedingungen der von uns herangezogenen Prädiktoren liefern, d.h. sie verdeutlichen, vor welchem Hintergrund oder aufgrund welcher Bedingungen die Merkmalsausprägungen der Angehörigen in den Prädiktorvariablen variieren. Zum anderen sind eventuelle Zusammenhänge aus statistischen Gründen von Interesse, da aufgrund der Vielzahl der von uns betrachteten Variablen eine Auswahl an relevanten Variablen getroffen werden soll. Diese wird dann in die statistische Prädiktion eingehen. In Tabelle 18 sind die Korrelationen zwischen den Prädiktor- und Moderatorvariablen der Angehörigen dargestellt. Zusätzlich wurden vier Verletzungs- bzw. Patientenmerkmale in die Korrelationsberechnung aufgenommen: der Schweregrad der Verletzung, das Ausmaß der funktionalen Selbständigkeit zu T1, das Geschlecht des Patienten und das Alter des Patienten. Dies geschieht, da eventuelle Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalen und den Prädiktorvariablen des Angehörigen Hinweise auf Bestimmungsmerkmale des Ausmaßes an Unterstützung liefern. Es bestehen signifikante Korrelationen zwischen dem selbsteingeschätzten Ausmaß an sozialer Unterstützung (SU-S) und individuellen sowie beziehungsbezogenen Variablen. Partner leisten umso mehr Unterstützung, je höher sie ihr Wissen um hilfreiche Handlungen einschätzen, je sicherer sie sich sind, dass ihre Unterstützung eine positive Wirkung haben wird, und je eher sie der Meinung sind, dass der Patient die Unterstützung annimmt. Weiterhin geben die Partner ein höheres Maß an Unterstützung an, je mehr positives dyadisches Coping die Beziehung kennzeichnet, je abhängiger sie in ihrem Bindungsstil sind, je höher die Beziehungsqualität der Beziehung eingeschätzt wird und je höher die familiäre Kohäsion in der Familie beurteilt wird. Wie bereits erwähnt, wurden diese beziehungsbezogenen Variablen von den Partnern für die Zeit vor der Verletzung eingeschätzt. 133 Tabelle 18: Korrelationen zwischen Prädiktor- und Moderatorvariablen (N = 54-58) SG BI G AL B-H B-W B-E B-A GBB BAI BDI KON FD-P FD-N BB-S BB-A DAS FA-K FA-A SU-S -.06 .15 -.03 .07 .10 .31* .36** .33* .10 .08 -.06 -.17 .30* .07 .16 .35* .28* .37** .17 SU-I .11 -.16 -.17 -.03 .24 .17 .20 .35** .32* .38** .19 .02 .22 -.14 -.08 .00 .06 .13 .25 SU-EM .20 -.31* .01 -.09 .21 -.10 .04 .14 .28* .29* .15 .04 .17 -.23 .06 .10 .17 .13 .19 SU-PR .06 -.09 -.07 -.05 .03 .21 .13 .12 .16 .19 .10 .13 -.00 .01 -.07 -.12 -.05 -.01 .15 SU-SO .04 -.14 -.08 .05 .30* -.02 .05 -.11 .14 .06 .03 .16 .08 .08 -.13 -.01 -.09 .04 -.09 SU-HA .13 -.27* -.06 -.08 .20 .06 .10 .09 .26* .26* .13 .13 .08 -.11 -.05 -.06 .01 .07 .18 SU-V .20 -.27* .01 .11 .23 -.01 .08 .08 .18 .21 -.05 -.02 .13 -.11 .17 .02 .19 .21 .27* SU-F1 .08 -.08 .13 -.00 .08 .00 .08 -.10 -.10 -.01 -.03 .08 -.01 -.06 -.17 .14 .06 .06 -.02 SU-F2 .03 -.05 -.10 -20 -.37** -.19 -.27* -.05 -.09 -.02 -.20 -.07 -.15 .10 -.01 -.24 .04 .22 .08 SU-F3 -.01 .14 .06 .16 .19 .13 .07 -.03 .00 -.11 -.12 .04 .05 -.03 .19 -.01 -.00 -.06 .16 SU-F4 .10 -.17 .14 .19 .07 .06 .05 .07 .03 .03 .10 .09 -.04 .05 -.02 -.03 -.19 -.24 -.18 SU-F5 -.15 .02 -.13 -.13 .06 -.10 -.03 .02 .16 .13 .32* .01 .18 .07 .02 .12 -.03 -.07 -.18 Anmerkung. SU-S: Soziale Unterstützung-Selbsteinschätzung; SU-I: Soziale Unterstützung-Fremdeinschätzung Interviewrating; SU-EM: Supportive Handlungen-Emotional; SU-PR: Supportive Handlungen-Praktisch; SU-SO: Supportive Handlungen-Sozial; SU-HA: Supportive HandlungenGesamtscore; SU-V: Supportive Handlungen-Vielseitigkeit; SU-F1: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 1; SU-F2: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 2; SU-F3: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 3; SU-F4: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 4; SU-F5: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 5; SG: Schweregrad Verletzung; BI: Barthel-Index; G: Geschlecht des Patienten; AL: Alter des Patienten; B-H: Bewertung Hilfsbedürftigkeit; B-W: Bewertung Wissen; B-E: Bewertung Erfolg; B-A: Bewertung Akzeptanz; GBB: Gießener Beschwerdebogen24; BAI: Beck Angst Inventar; BDI: Beck Depressions Inventar; KON: Konfliktpotential; FD-P: Fragebogen zum dyadischen Coping-Positives dyadisches Coping; FD-N: Fragebogen zum dyadischen Coping-Negatives dyadisches Coping; BB-S: Beziehungsspezifische Bindungsskalen-Sicher; BB-A: Beziehungsspezifische Bindungsskalen-Abhängig; DAS: Dyadic Adjustment Scale; FA-K: FACES-Kohäsion; FA-A: FACES-Adaptabilität; * p < .05; ** p < .01 134 Diese dargestellten signifikanten Zusammenhänge zeigen sich jedoch mit einer Ausnahme nicht, wenn das fremdeingeschätzte Ausmaß an sozialer Unterstützung (SUI) betrachtet wird. Die Ausnahme besteht in einer signifikanten Korrelation zwischen fremdbeurteilter Unterstützung und der Bewertung der Akzeptanz der Hilfe durch den Patienten. Stattdessen zeigen sich zwei signifikante Zusammenhänge, die wiederum nicht bestehen, wenn die selbsteingeschätzte Unterstützung betrachtet wird. So leisten Partner mehr Unterstützung im Fremdurteil, je höher ihre eigene Angst und je höher ihre eigenen körperlichen Beschwerden sind. Ein entsprechender Zusammenhang zu diesen beiden individuellen Merkmalen besteht zudem zu der Anzahl an supportiven emotionalen Handlungen (SU-EM) sowie zu der Gesamtzahl supportiver Handlungen (SU-HA). Außerdem leisten die Partner umso mehr supportive emotionale Handlungen, je stärker die Funktionsbeeinträchtigung des Patienten zum Zeitpunkt der Befragung ist. Weiterhin besteht ein Zusammenhang zwischen funktionaler Selbständigkeit und der Gesamtzahl supportiver Handlungen und der Vielseitigkeit supportiver Handlungen: je niedriger die funktionale Selbständigkeit des Patienten, desto mehr supportive Handlungen und desto vielseitiger das Hilfeverhalten des Angehörigen. Schließlich korreliert die Variabilität supportiver Handlungen positiv mit der familiären Adaptabilität vor der Verletzung. Zusammengefasst zeigt sich als grobes Muster, dass das selbsteingeschätzte Ausmaß an sozialer Unterstützung vor allem mit selbsteingeschätzten beziehungsbezogenen Variablen zusammenhängt, wohingegen das fremdeingeschätzte Ausmaß sowie die Art der Unterstützung vor allem mit patientenbezogenen (funktionale Selbständigkeit) und individuellen Partnermerkmalen (Befindlichkeit) korreliert. Bezüglich der intentionalen Variablen des Hilfeverhaltens zeigen sich signifikante Zusammenhänge für zwei Funktionen. Partner messen der Funktion "Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse" (SU-F2) umso weniger Bedeutsamkeit für ihr supportives Handeln bei, je weniger sie der Meinung sind, der Patient sei auf ihre Hilfe angewiesen und je weniger sie davon überzeugt sind, dass ihre Hilfe die von ihnen erwartete Wirkung haben wird. Ein weiterer signifikanter Zusammenhang besteht mit der Funktion "Regulierung der eigenen Befindlichkeit" (SU-F5). Partner messen dieser Funktion umso mehr Bedeutsamkeit für ihr Hilfeverhalten bei, je depressiver sie sind. 135 Im nächsten Analyseschritt wurden Spearman-Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen sowie den Moderatorvariablen der Angehörigen und dem komplexen Kriterium auf Seiten des Patienten berechnet. Diese Korrelationsanalyse weist auf, welche Angehörigenvariablen mit dem globalen Patientenoutcome assoziiert sind und stellt den wichtigsten Schritt für die Auswahl relevanter Prädiktorvariablen dar. Tabelle 19 zeigt die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und dem Kriterium. Es ergeben sich vier signifikante Korrelationen. Ein positiver Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl supportiver emotionaler, supportiver sozialer und der Gesamtzahl supportiver Handlungen und dem globalen Patientenoutcome. Ferner korreliert die Variabilität supportiver Handlungen positiv mit dem Outcome. Da das komplexe Kriterium in der Weise kodiert ist, dass ein höherer Wert eine höhere Auffälligkeit anzeigt, bedeuten diese signifikanten Korrelationen: Je mehr supportive Handlungen die Partner zu T1 zeigen, desto schlechter ist der globale Patientenoutcome sechs Monate nach der Verletzung. Die Korrelationen zwischen den Angehörigen-Moderatorvariablen und dem Komplexen Kriterium sind in Tabelle 20 dargestellt. Hinsichtlich der Partnermerkmale zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der wahrgenommen Beeinträchtigung des Patienten (B-H) und dem komplexen Kriterium. Je hilfsbedürftiger der Patient zu T1 vom Partner eingeschätzt wird, desto schlechter ist der Outcome sechs Monate später. Weiterhin besteht ein Zusammenhang zwischen dem initialen Ausmaß an Angst sowie dem Ausmaß an körperlichen Beschwerden der Partner und dem Patientenoutcome in dem Sinne, dass dieser umso schlechter ist, je mehr Beschwerden die Partner zu T1 angaben. 136 Tabelle 19: Korrelation Prädiktoren und komplexes Kriterium (Spearman-Korrelation; N = 55-58) Komplexes Kriterium Soziale Unterstützung Selbsteinschätzung SU-S .04 Fremdeinschätzung SU-I .20 Supportive Handlungen Emotional SU-EM .32 * Praktisch SU-PR .17 Sozial SU-SO .37 ** Gesamtscore SU-HA .36 ** Vielseitigkeit SU-V .37 ** Intendierte Unterstützung: Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .01 Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 -.17 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 .03 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 .29 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 -.04 Anmerkung. * p < .05; ** p < .01 137 Tabelle 20: Korrelationen (Spearman) zwischen den Moderatorvariablen und dem komplexen Kriterium auf Seiten des Patienten nach 6 Monaten (N = 58) Angehöriger Komplexes Kriterium Unterstützungsbezogene Bewertungen Hilfsbedürftigkeit B-H .37 ** Wissen B-W -.13 Erfolg B-E .01 Akzeptanz B-A -.13 Befindlichkeit Körperliche Beschwerden GBB .29 * Angst BAI .27 * Depressivität BDI .19 Beziehungsbezogene Merkmale Konfliktpotential KON .14 Positives dyadisches Coping FDCT-P .12 Negatives dyadisches Coping FDCT-N .01 Bindung sicher BB-S -.04 Bindung abhängig BB-A .04 Beziehungsqualität DAS -04 Familiäre Kohäsion FACES-K -.04 Familiäre Adaptabilität FACES-A -.06 Anmerkung. * p < .05; ** p < .01 138 1.6.1.5 Prädiktion des Patientenoutcomes sechs Monate nach Verletzung 1.6.5.1.1 Prädiktion des komplexen Kriteriums Den abschließenden Auswertungsschritt stellt die Prädiktion des globalen Patientenoutcomes mittels der aufgrund der bisherigen Analysen identifizierten relevanten Angehörigenvariablen zum Zeitpunkt T1 dar. Da das komplexe Kriterium nicht intervallskaliert ist, wird für die statistische Prädiktion die Methode der logistischen Regression herangezogen. Um diese Auswertung durchführen zu können, wurde das komplexe Kriterium dichotomisiert. Patienten mit einem Wert von 0 bis 1.49 wurden als "weniger auffällig" ("0") und Patienten mit einem Wert im Bereich von 1.50 bis 3 als "deutlich auffällig" ("1") klassifiziert. Es wurde eine sequentielle logistische Regression durchgeführt, indem Variablengruppen des Angehörigen blockweise eingegeben wurden. Innerhalb jedes Blocks wurde eine schrittweise Vorwärtsregression durchgeführt, wobei die WaldStatistik benutzt wurde. Das Signifikanzniveau für die Aufnahme einer Variable wurde auf .10 und für den Ausschluß einer Variable auf .20 festgelegt. Damit wurde den Interkorrelationen der Prädiktorvariablen Rechnung getragen und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Variable nicht "vorzeitig" ausgeschlossen wird, indem sie durch eine hoch korrelierende Variable "verdrängt" wird (vgl. Tabachnik & Fidell, 2001). Da ein theoretisches Modell vorlag, wurde eine sequentielle logistische Regression durchgeführt. Im ersten Schritt wurden lediglich die Prädiktorvariablen berücksichtigt. Der zweite Block beinhaltete die Moderatorvariablen. Im dritten und letzten Block wurde der Einfluß von Interaktionseffekten geprüft. Für die logistische Regression wurden nur Variablen berücksichtigt, die signifikant mit dem komplexen Kriterium korrelierten. Für die Analyse von Interaktionseffekten wurden die Variablen herangezogen, die nach den ersten beiden Blöcken der logistischen Regression einen signifikanten Einfluss auf das Kriterium aufwiesen. Dazu wurde die Interaktion der resultierenden signifikanten Variablen in die Regression eingegeben. Zusätzlich wurde eine Interaktion definiert, wenn eine signifikante Korrelation zwischen der entsprechenden Prädiktorvariablen und einer Moderatorvariable bestand, auch wenn die Moderatorvariable selbst nicht in die Regression aufgenommen worden war. 139 Durch die Dichotomisierung des komplexen Kriteriums wurden 41 Patienten (71.9 %) als weniger auffällig und 16 Patienten (20.1 %) als deutlich auffällig eingestuft. Ein Patient ging aufgrund fehlender Werte (auf Seiten der Partner) nicht in die Regressionsanalyse ein, so dass diese für insgesamt 57 Patienten durchgeführt wurde. Das finale Modell der logistischen Regression ist in Tabelle 21 dargestellt. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 57) = 6.05, p < .05). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifkation von 70.2 % der Fälle. Tabelle 21: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage des komplexen Kriteriums zu T2 durch Partnermerkmale zu T1 (N = 57) Variable Supportive Handlungen Vielseitigkeit SU-V Constant B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a .41 .18 1.51 5.23 * -3.58 1.23 8.43 ** Anmerkungen. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Die Regression zeigt einen signifikanten Einfluß der Variabilität supportiver Handlungen auf den Outcome sechs Monate nach akuter Hirnschädigung. Je vielfältiger die supportiven Bemühungen der Partner zu T1 sind, d. h. je vielfältiger die Bereiche, in denen die Partner supportive Handlungen zeigen, desto schlechter ist der Outcome des Patienten zu T2. Individuelle und beziehungsbezogene Variablen tragen nicht zur Prädiktion des Patientenoutcome bei. Ebenso ergibt sich kein signifikanter Interaktionsterm. Abschließend unternahmen wir für die signifikante Prädiktorvariable einen Mittelwertsvergleich. Dabei zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Partnern von Patienten mit einem besseren und solchen mit einem schlechteren Outcome hinsichtlich der Anzahl der Kategorien supportiven Verhaltens, d. h. der Variabilität supportiver Handlungen (M = 5.7, SD = 1.8 vs. M = 7.1, SD = 1.7; t (55) = 2.52, p < .05). Partner von Patienten mit einem schlechteren Outcome zeigten supportive Handlungen, die sich mehr Kategorien zuordnen ließen, als Partner von Patienten mit einem besseren Outcome. 140 1.6.5.1.2 Prädiktion der Einzelkomponenten des komplexen Kriteriums Im Anschluß wurde der Frage nachgegangen, ob sich einzelne Komponenten des Outcomekriteriums durch die Partnervariablen vorhersagen lassen. Dazu wurden Outcomevariablen, die einen ähnlichen Bereich erfassen, zu einem eigenen komplexen Kriterium zusammengefasst. Dabei wurde analog des oben beschriebenen Vorgehens verfahren. Es wurden vier Subkategorien definiert. Diese umfassen die Bereiche kognitive, psychische und somatische Störungen sowie Funktionsfähigkeit/Aktivitäten. Im einzelnen wurden die Variablen d2 und RBMT zu KK-kognitiv (Komplexes Kriteriumkognitiv), BAI und BDI zu KK-psychisch (Komplexes Kriterium-psychisch), GBB und RPQ zu KK-somatisch (Komplexes Kriterium-somatisch) sowie BI und RHFUQ zu KKAktivität (Komplexes Kriterium-Aktivitäten) zusammengefasst. Zusätzlich wurde als einzelne Variable der Status der Erwerbstätigkeit (KK-Erwerb) berücksichtigt. In Tabelle 22 sind die Interkorrelationen dieser Subkategorien sowie die Korrelationen der einzelnen Subkategorien mit dem globalen komplexen Kriterium (KK) aufgeführt. Es zeigen sich hohe Interkorrelationen und hohe Korrelationen mit dem globalen komplexen Kriterium. Eine Ausnahme ist die Subkategorie "Status der Erwerbstätigkeit", die lediglich positive Korrelationen mit der Subskala KK-kognitiv und mit dem globalen komplexen Kriterium aufweist. Die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und den Subkategorien sind in Tabelle 23 dargestellt; die Korrelationen zwischen den Moderatorvariablen und den Subkategorien des komplexen Kriteriums liefert Tabelle 24. Die signifikanten Zusammenhänge zwischen den Prädiktorvariablen und den Subkategorien entsprechen einem Muster, wie es bereits für das globale komplexe Kriterium beschrieben wurde. So bestehen vor allem signifikante Zusammenhänge zwischen den fremdbeurteilten supportiven Handlungen und den Subkategorien. 141 Tabelle 22: Interkorrelationen (Spearman-Korrelationen) der Subkategorien und des globalen komplexen Kriteriums Subkategorien KK-kognitiv KK-psychisch KK- KK- psychisch somatisch .71 *** .72 *** .71 *** .46 ** .85 *** - .84 *** .86 *** .17 .92 *** - .80 *** .20 .90 *** - .20 .90 *** - .38 ** KK-somatisch KK-Aktivität KK-Erwerb Komplexes Kriterium KK-Aktivität KK-Erwerb Anmerkung. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 Im Unterschied zu den Ergebnissen für das globale Outcomemaß bestehen signifikante Zusammenhänge zwischen der Funktion supportiven Verhaltens "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" (SU-F4) und Outcome-Subkategorien "psychisch", "somatisch" und "Aktivität" jeweils in dem Sinne, dass eine höhere Bedeutsamkeit zu T1 mit einem schlechteren Outcome zu T2 in Verbindung steht. Interessanterweise liegen durchgängig negative Korrelationen zwischen der Subfunktion "Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse" (SU-F2) und den Subkategorien vor, die jedoch keine statistische Signifikanz erreichen. Auch die signifikanten Zusammenhänge zwischen den Moderatorvariablen und den Subkategorien spiegeln im wesentlichen die Ergebnisse wider, wie sie für das globale Outcomemaß gefunden wurden. Der konsistenteste Zusammenhang besteht auch hier zwischen der Einschätzung der Hilfsbedürftigkeit des Patienten (B-H) und dem Outcome in dem Sinne, dass der Outcome in den Subkategorien umso schlechter ist, je hilfsbedürftiger der Patient zu T1 eingeschätzt wurde. 142 Tabelle 23: Korrelationen (Spearman) der Prädiktorvariablen mit den Subkategorien des komplexen Kriteriums (N = 55-58, außer wenn angezeigt) KK-kognitiv a KK-psychisch KK-somatisch KK-Aktivität KK-Erwerb Selbstbeurteilung SU-S .04 .00 .05 .00 .21 Fremdbeurteilung SU-I .09 .23 .07 .25 -.12 Emotional SU-EM .24 .32 * .18 .38 ** .04 Praktisch SU-PR .12 .16 .14 .21 .01 .30 * .29 * .33 * .31* .27 * .24 .35 ** .25 .42 ** .07 .33 * .35 ** .32 * .41 ** -.04 Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .07 -.07 .03 -.07 .09 Optimierung patientenseitiger -.03 -.17 -.14 -.16 -.24 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 -.01 .03 -.08 .16 .10 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 .21 .31 * .27 * .31 * .05 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 -.17 -.01 .02 -.08 .09 Soziale Unterstützung Supportive Handlungen Sozial SU-SO Gesamtscore SU-HA Vielseitigkeit SU-V Intendierte Unterstützung Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 Anmerkung. a N = 42-44; * p < .05; ** p < .01 143 Tabelle 24: Korrelationen (Spearman) der Moderatorvariablen mit den Subkategorien des komplexen Kriteriums (N = 55-58, außer wenn angezeigt) KK-kognitiv a KK-psychisch KK-somatisch KK-Aktivität KK-Erwerb Hilfsbedürftigkeit B-H .37 * .26 * .28 * .29 * .20 Wissen B-W -.31 * -.09 -.08 -.18 .03 Erfolg B-E .02 -.07 .03 -.11 .20 Akzeptanz B-A -.19 -.21 -.17 -.23 .15 Körperliche Beschwerden GBB .10 .25 .26 * .22 .23 Angst BAI .13 .21 .22 .22 .11 Depressivität BDI .08 .13 .20 .21 .08 Konfliktpotential KON .20 .08 .13 .17 -.03 Positives dyadisches Coping FDCT-P .05 .12 .08 .08 .08 Negatives dyadisches Coping FDCT-N .24 .02 -.01 -.12 .12 Bindung sicher BB-S -.10 -.07 -.08 .02 -.05 Bindung abhängig BB-A .02 .00 .06 .02 .23 Beziehungsqualität DAS -.09 -.06 -.07 -.02 .02 Familiäre Kohäsion FACES-K -.11 -.08 -.10 -.04 .13 Familiäre Adaptabilität FACES-A -.18 -.07 -.11 .02 -.15 Unterstützungsbezogene Bewertungen Befinden Beziehungsbezogene Merkmale Anmerkung. a N = 42-44; * p < .05 144 Durch welche Angehörigenvariablen werden die differenzierten OutcomeKriterien vorhergesagt? Um diese Frage zu beantworten wurden analog des oben beschriebenen Vorgehens logistische Regressionen für die Subkategorien des komplexen Kriteriums durchgeführt. In die logistische Regression der Subkategorie "kognitiv" gingen 44 Patienten ein. Von diesen wurden 30 (68.2 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 14 (31.8 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das finale Modell ist in Tabelle 25 dargestellt. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 44) = 6.04, p <. 05). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifkation von 81.8 % der Fälle. Tabelle 25: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-kognitiv zu T2 (N = 44) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V .55 .22 1.73 6.36 * Unterstützungsbezogene Bewertung -.73 .31 .48 5.41 * -73 1.83 Angehörigenvariablen Wissen B-W Constant .16 Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Die Regression ergibt zwei signifikante Prädiktoren für die kognitiven Störungen. Erneut zeigt sich, dass der Patientenoutcome sechs Monate nach Verletzung umso schlechter ist, je mehr Bereiche die supportiven Handlungen der Partner zu T1 abdecken. Weiterhin besteht ein Einfluss unterstützungsbezogener Einstellungen. Je unsicherer sich die Partner zu T1 sind, welche Handlungen für den Patienten hilfreich sind, desto schlechter ist der Outcome im kognitiven Bereich sechs Monate nach der Verletzung. Signifikante Interaktionen waren nicht zu beobachten. Der folgende Mittelwertsvergleich erbrachte für beide Variablen einen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe der Partner von Patienten mit besserem und mit schlechterem 145 Outcome in dieser Subkategorie: SU-V: M = 5.5, SD = 1.7 vs. M = 7.1, SD = 1.9; t (42) = -2.81, p < .01; H-2: M = 5.2, SD = 1.1 vs. M = 4.2, SD = 1.4; t (42) = 2.49, p < .05. Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-psychisch ist in Tabelle 26 dargestellt. In die Regression gingen 57 Patienten ein. Von diesen wurden 38 (66.7 %) als "besserer Outcome" ("0") und 19 (33.3 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 57) = 12.11, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 70.2 % der Fälle. Tabelle 26: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-psychisch zu T2 (N = 57) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V .49 .19 1.63 6.54 * Intendierte Soziale Unterstützung .05 .03 1.06 4.66 * -4.67 1.47 Angehörigen Variablen Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 Constant 10.09 ** Anmerkungen: a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Das Ergebnis der Regression zeigt den bereits beschriebenen Effekt, wonach eine größere Variabilität der supportiven Handlungen der Partner zu T1 mit einem schlechteren Outcome nach sechs Monaten zusammenhängt. Ferner erbringt die Regression einen signifikanten Effekt der intendierten Unterstützung. Je mehr Bedeutsamkeit Partner zu T1 der Funktion "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" für ihr supportives Handeln beimessen, desto schlechter ist der Outcome in der Subkategorie KK-psychisch sechs Monate nach Verletzung. Es ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Der Mittelwertvergleich erbrachte erneut signifikante Gruppenunterschiede bei beiden Variablen: SU-V: M = 5.7, SD = 1.9 vs. M = 7.0, SD = 1.6; t (55) = -2.68, p < .05; SU-F4: M = 11.7, SD = 14.1 vs. M = 19.4, SD = 10.0; t (55) = -2.12, p < .05. 146 Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-somatisch ist in Tabelle 27 dargestellt. In die Regression gingen N = 57 Patienten ein. Von diesen wurden N = 33 (57.9 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 24 (42.1 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 57) = 12.80, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifkation von 73.7 % der Fälle. Tabelle 27: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-somatisch zu T2 (N = 57) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportives Handlungen-Sozial SU-SO .51 .19 1.66 7.38 ** Intendierte Soziale Unterstützung .05 .03 1.06 4.50 * -2.09 .67 Variable Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 Constant 9.81 ** Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Die Regression erbringt ein signifikantes Ergebnis für die Variable SU-SO. Es zeigt sich ein Einfluß supportiver Handlungen auf das Outcome, wie er bereits bei den voran stehenden Regressionen beschrieben wurde. Je mehr Handlungen die Partner in Bereich "sozial" zu T1 zeigen, desto schlechter ist der Outcome in der Subkategorie KKsomatisch sechs Monate nach Verletzung. Ebenso ergibt sich ein signifikanter Einfluß der intentionalen Variable intendierte Unterstützung SU-F4, wie er für die Subkategorie KK-psychisch beschrieben wurde. Je mehr Bedeutsamkeit Partner der Funktion "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" für ihr supportives Handeln beimessen, desto schlechter ist der Outcome in der Subkategorie KK-somatisch nach sechs Monaten. Es ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Der folgende Mittelwertvergleich erbrachte für beide Variablen einen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe der Partner der Patienten mit besserem und der Gruppe der Partner der Patienten mit schlechterem Outcome in der Subkategorie KK-somatisch: 147 SU-SO: M = 1.3, SD = 1.4 vs. M = 2.6, SD = 2.0; t (39.3) = -2.74, p < .01; SU-F4: M = 11.3, SD = 13.0 vs. M = 18.3, SD = 13.0; t (55) = -2.01, p = .05. Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-Aktivität ist in Tabelle 28 dargestellt. In die Regression gingen N = 57 Patienten ein. Von diesen wurden N = 38 (66.7 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 19 (33.3 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 57) = 13.66, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 73.7 % der Fälle. Tabelle 28: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-Aktivität zu T2 (N = 57) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportive Handlungen-Emotional SU-EM .32 .11 1.37 8.25 ** Intendierte Soziale Unterstützung .05 .03 1.06 4.00 * -3.16 .90 Variable Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 Constant 12.41 *** Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 Die Regression erbringt ein signifikantes Ergebnis für die Kategorie supportiven Handelns "emotional". Je mehr Handlungen Partner zu T1 in diesem Bereich ausführen, desto schlechter ist der Outcome in der Subkategorie KK-Aktivität sechs Monate nach Verletzung. Ferner zeigt sich der bereits dargestellte negative Effekt der intentionalen Variable "Einflussnahme auf den Genesungsprozess". Es ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Der folgende MIttelwertvergleich erbrachte für die Variable SU-EM ein signifikantes Ergebnis: M = 3.9, SD = 2.4 vs. M = 6.7, SD = 4.1; t (24.1) = 2.70, p < .05. Für die Variable SU-F4 zeigte sich dagegen lediglich ein Trend: M = 12.1, SD = 13.6 vs. M = 18.6, SD = 11.8; t (55) = -1.77, p = .082. 148 Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-Erwerb ist in Tabelle 29 dargestellt. In die Regression gingen N = 57 Patienten ein. Von diesen wurden N = 11 (19.3 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 19 (80.7 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Die logistische Regression erbringt keinen signifikanten Effekt für die betrachtete Variable. Das Constant-only-Modell liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 80.7 % der Fälle (vgl. Tabelle 28). Tabelle 29: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-Erwerb zu T2 (N = 57) Variable B S.E Constant 1.43 .34 Anmerkungen: a Chi-Quadrat (df = 1); *** p < .001 Odds Ratios Wald-Statistik a 18.17 *** 149 1.6.2 Einfluß sozialer Merkmale der Angehörigen auf das generelle Anpassungsniveau der Patienten zwölf Monate nach Verletzung 1.6.2.1 Charakterisierung der Partnerstichprobe Als erster Schritt der Ergebnisdarstellung der Zusammenhänge zu dem generellen Anpassungsniveau des Patienten nach 12 Monaten wird im folgenden erneut eine Übersicht der statistischen Kennwerte der Partnervariablen zu T1 geliefert. Dargestellt werden die Angaben von N = 42 Partnern. Dabei handelt es sich um die Partner derjenigen Patienten, für die eine Auswertung der 12-Monats-Katamnese möglich ist. Mittelwert, Standardabweichung und Wertebereich der Variablen zur sozialen Unterstützung sind in den Tabellen 30 und 31 dargestellt. Mit Ausnahme der intendierten Unterstützung liegt die Stichprobe in den auf Fremdbeurteilung beruhenden Merkmalen zur sozialen Unterstützung bei N = 41. Dies liegt, wie bereits oben dargestellt daran, dass bei der Partnerin des ersten Patienten, der an der Studie teilnahm, diese Angaben nicht erhoben wurden. Für das selbsteingeschätzte Ausmaß sozialer Unterstützung liegt die Stichprobe aufgrund unzulässiger fehlender Werte bei N = 40. Eine Übersicht der statistischen Kennwerte der individuellen Merkmale liefert Tabelle 32. Die statistischen Merkmale der beziehungsbezogenen Verfahren sind in Tabelle 33 dargestellt. 150 Tabelle 30: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Variablen zur sozialen Unterstützung M SD Range 5.3 0.6 3.8-6.0 1.6 0.6 0.5-2.8 5.5 3.4 1-16 9.0 4.3 2-20 2.1 1.7 0-6 Gesamtscore SU-HA b 17.2 6.9 5-31 Vielseitigkeit SU-V b 6.5 1.8 3-11 Soziale Unterstützung: Selbstbeurteilung SU-S a Fremdbeurteilung SU-I b Supportive Handlungen: Emotional SU-EM b Praktisch SU-PR Sozial SU-SO b b Anmerkung. a N = 40, b N = 41 Tabelle 31: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Variablen zur intendierten Unterstützung (N = 42) M SD Range Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 58.2 13.3 34.3-83.8 Optimierung patientenseitiger 35.2 15.9 0.0-69.7 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 24.7 14.5 0.0-56.6 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 16.1 13.6 0.0-51.5 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 10.0 11.8 0.0-42.4 Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 Bei den beziehungsbezogenen Merkmalen liegt die Stichprobengröße aufgrund von Missings in den beiden FACES-Skalen bei N = 40 (Kohäsion) bzw. N = 39 (Adaptabilität). Betrachtet man die Verteilungskennwerte der Substichprobe, die in die Analysen zu T3 eingeht, mit der Partnerstichprobe der T2-Analysen, so sind kaum Unterschiede in 151 den Werten festzustellen. Dies bedeutet, dass die Charakterisierung, die für die Partnerstichprobe der T2-Analysen getroffen wurde, im wesentlichen auch auf die Substichprobe der 12-Monats-Katamnese zutrifft. Insgesamt sind nur zwei deutliche Unterschiede festzustellen: Zum einen gibt die Substichprobe T3 im Mittel mehr supportive Handlungen (SU-HA) an (M = 17.2 versus M = 15.7). Zum zweiten liegt der Mittelwert im Beck Angst Inventar höher als in der T2Stichprobe (M = 13.0 versus M = 11.5). Zum Vergleich wurde die Prävalenz einer leichten bis deutlichen Beeinträchtigung durch Angst- und depressive Symptome in der T3-Stichprobe berechnet. Dabei zeigte sich, dass in der Substichprobe der Partner, die in die T3-Analysen eingingen, die Prävalenz zu T1 höher lag als in der Substichprobe der Partner, die für die T2-Analysen betrachtet wurden. Konkret betrugen die Prävalenzen in der T3-Stichprobe 28.6 Prozent für leichte Angstsymptomatik und 31.0 für deutliche Angstsymptomatik. Die Gesamtprävalenz für Angst lag somit bei 59.6 Prozent. Hinsichtlich der Depressivität waren 45.2 Prozent der Angehörigen als leicht und 9.5 Prozent als deutlich auffällig einzustufen, was eine Gesamtprävalenz von 54.7 Prozent ergibt. Zur Erinnerung: In der Substichprobe der Partner, die in die T2-Analysen eingingen, betrug die Gesamtprävalenz für Angst und Depressivität in beiden Fällen 50 Prozent. Der hiermit aufgeworfenen Frage der systematischen Verzerrungen durch Dropout wird in einem späteren Kapitel nachgegangen. 152 Tabelle 32: Mittelwerte, Standardabweichungen und Range der Verfahren zur Erhebung individueller Angehörigenmerkmale (N = 42) M SD Range Hilfsbedürftigkeit B-H 5.3 1.0 3-6 Wissen B-W 4.9 1.3 2-6 Erfolg B-E 5.2 1.1 2-6 Akzeptanz B-A 5.5 0.8 3-6 Körperliche Beschwerden GBB 15.5 11.4 0-45 Angst BAI 13.0 10.5 0-47 Depressivität BDI 10.8 5.8 0-24 Unterstützungsbezogene Bewertungen Befinden Tabelle 33: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Verfahren zur Erhebung beziehungsbezogener Angehörigenmerkmale (N = 42) M SD Range Konfliktpotential KON 5.6 3.3 3-17 Positives dyadisches Coping FDCT-P 2.2 0.4 1.4-3.0 Negatives dyadisches Coping FDCT-N 0.6 0.3 0.0-1.4 Bindung sicher BB-S 4.7 0.4 3.7-5.0 Bindung abhängig BB-A 3.7 0.6 2.1-5.0 121.0 12.8 94-143 4.4 0.4 3.4-5.0 4.1 0.4 3.3-5.0 Beziehungsqualität DAS Familiäre Kohäsion FACES-K a Familiäre Adaptabilität FACES-A Anmerkung. a N = 40, b N = 39 b 153 1.6.2.2 Patientenoutcome nach zwölf Monaten – komplexes Kriterium zu T3 Tabelle 34 zeigt Mittelwert, Standardabweichung sowie den Range der Variablen, die in das komplexe Kriterium 12 Monate nach Verletzung eingingen. Die Gründe für die unterschiedlichen Stichprobengrößen bei den einzelnen Verfahren entsprechen denen, die für den Zeitpunkt T2 angeführt wurden. In Tabelle 35 ist für die jeweilige Kategorie des komplexen Kriteriums der Anteil an Patienten für jede einzelne Variable dargestellt. Der höchste Anteil an "unauffälligen" Patienten findet sich im Bereich funktionale Selbständigkeit (BI), Aufmerksamkeit sowie in den verschiedenen Domänen der Lebensqualität. Der höchste Anteil an "sehr deutlich auffälligen" Patienten findet sich in den Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Aktivitätsstörung (MKS-S) und Angst. Die Abweichungen der Stichprobengrößen im d2 und im RBMT ergeben sich erneut daraus, dass diese Verfahren nicht allen Patienten vorgelegt wurden. Der größte Anteil an als unauffällig einzustufenden Patienten befindet sich erneut, wie schon nach sechs Monaten, in den Bereichen Konzentration und funktionale Selbständigkeit. Weiterhin zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Patienten ihre Lebensqualität als nicht eingeschränkt beurteilt, wobei deutliche Unterschiede in Abhängigkeit der betrachteten Domäne zu verzeichnen sind. Am niedrigsten ist der Anteil im Bereich physische Lebensqualität (54.8 %), am höchsten im Bereich umweltbezogene Lebensqualität (73.8 %). Die Bereiche mit dem höchsten Anteil an Personen, die ein Jahr nach Verletzung als deutlich bis sehr deutlich auffällig einzustufen sind, sind die Erwerbstätigkeit, die Aktivitätsstörung und die körperlichen Beschwerden. Auch ein Jahr nach Verletzung zeigt sich somit, dass trotz hoher funktionaler Selbständigkeit und vergleichsweise hoher Lebensqualität nichts desto trotz Beeinträchtigungen in verschiedenen anderen Bereichen vorliegen. Zu bedenken gilt es hierbei erneut, dass die Ergebnisse keine "wahre" Prävalenzangabe darstellen, da die Patienten, die keine Auskunft in einem der Selbstbeurteilungsbögen geben konnten, als "sehr deutlich auffällig" eingestuft wurden. 154 Tabelle 34: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Variablen des komplexen Kriteriums bei Patienten sowie Vergleichswerte (sofern nicht bereits angegeben: Quelle Testautor) Vergleichswerte M SD Aufmerksamkeit d2 a Gedächtnis RBMT Angst BAI b c Depressivität BDI c Körperliche Beschwerden GBB d Posttraumatische Symptome RPQ c Funktionale Selbständigkeit BI e Alltagsaktivitäten MKS-S f Alltagsaktivitäten RHFUQ 96.71 19.9 c M SD Range 104.5 10.2 84-122 19.7 3.2 12-24 8.4 11.2 0-39 7.8 7.5 0-32 16.4 15.0 0-55 17.0 13.2 0-52 84.4 29.4 5-100 98.4 20.0 53-120 16.0 10.0 0-34 2 17.7 72.0 16.9 42.9-100 Lebensqualität psychisch QOL-PSYCH c 74.02 15.6 71.7 16.1 25.0-100 Lebensqualität sozial QOL-SOCIAL c 71.82 18.5 75.6 17.0 41.7-100 2 14.2 72.0 13.6 40.6-100 Lebensqualität physisch QOL-PHYS c Patientenstichprobe Lebensqualität Umwelt QOL-ENVIRON 76.9 c 70.4 Anmerkung. QOL-PHYS: WHOQOL-BREF Physisch; QOL-PSYCH: WHOQOL-BREF Psychisch; QOLSOCIAL: WHOQOL-BREF Soziale Beziehungen; QOL-ENVIRON: WHOQOL-BREF Umwelt a N = 19; b N = 15; c N = 33; d N = 34; e N = 42; f N = 32 1 Basis: klinische Gruppe; 2 Basis: Allgemeinbevölkerung 155 Tabelle 35: Anteil an Patienten (%) in den Kategorien des komplexen Kriteriums (N = 42, außer wenn angezeigt) unauffällig leicht deutlich sehr auffällig auffällig deutlich auffällig Aufmerksamkeit d2 a 66.7 3.7 0.0 39.6 17.4 34.8 13.0 34.8 Angst BAI 52.4 14.3 4.8 28.6 Depressivität BDI 59.5 9.5 7.1 23.8 Körperliche Beschwerden GBB 45.2 9.5 26.2 19.0 Posttraumatische Symptome RPQ 45.2 23.8 7.1 23.8 Funktionale Selbständigkeit BI 73.8 7.1 9.5 9.5 Alltagsaktivitäten MKS-S 33.3 23.8 11.9 31.0 Alltagsaktivitäten RHFUQ 21.4 26.2 23.8 28.6 Lebensqualität physisch QOL-PHYS 54.8 23.8 0.0 21.4 Lebensqualität psychisch QOL-PSYCH 66.7 9.5 0.0 23.8 Lebensqualität sozial QOL-SOCIAL 69.0 9.5 0.0 21.4 Lebensqualität Umwelt QOL-ENVIRON 73.8 2.4 2.4 21.4 Erwerbstätigkeit 14.6 7.3 51.2 26.8 Gedächtnis RBMT b Anmerkung. QOL-PHYS: WHOQOL-BREF Physisch; QOL-PSYCH: WHOQOL-BREF Psychisch; QOLSOCIAL: WHOQOL-BREF Soziale Beziehungen; QOL-ENVIRON: WHOQOL-BREF Umwelt a N = 27; b N = 23 Um, wie auch zu T2, einen Eindruck der Verteilung des globalen Outcomes zu vermitteln, wurde die Kategorisierung für das aggregierte komplexe Kriterium erneut wie folgt vorgenommen: unauffällig: 0-0.5; leicht auffällig: > 0.5-1.5; deutlich auffällig: > 1.52.5; sehr deutlich auffällig: > 2.5. Nach dieser Einteilung ergibt sich folgendes Bild: 42.9 Prozent fallen in die Kategorie "unauffällig", 33.3 Prozent sind "leicht auffällig", 2.4 Prozent sind als "deutlich auffällig" und 21.4 Prozent als "sehr deutlich auffällig" einzustufen. Im Vergleich zum Zeitpunkt T2 haben sich vor allem Veränderungen in den Kategorien unauffällig und deutlich auffällig ergeben. Während der Anteil an Personen, 156 die nach der vorgenommenen Klassifizierung als "unauffällig" einzustufen sind, zugenommen hat, hat sich der Anteil an Personen in der Kategorie "deutlich auffällig" verringert. 50 Prozent 40 unauff llig leicht auff llig deutlich auff llig sehr deutlich auff llig 30 20 10 0 Komplexes Kriterium Abbildung 4: Anteil der Patienten (N = 42) in den Kategorien des Komplexen Kriteriums zwölf Monate nach Verletzung 1.6.2.3 Interkorrelationen der Prädiktorvariablen (Angehöriger) Zur Prüfung der Voraussetzungen der Prädiktion wurden die Interkorrelationen zwischen den Prädiktorvariablen berechnet. Diese sind in Tabelle 36 dargestellt. Das Ergebnismuster signifikanter Korrelationen stimmt in sehr hohem Ausmaß mit dem Ergebnismuster in der Partnerstichprobe der T2-Analyse überein und wird hier nicht erneut näher dargestellt. 157 Tabelle 36: Interkorrelationen (Pearson) der Prädiktorvariablen (N = 40-42) SU-I SU-EM SU-PR SU-SO SU-HA SU-V SU-F1 SU-F2 SU-F3 SU-F4 SU-F5 SU-S .42 ** .31 .31 * .22 .40 * .24 .01 .20 .01 -.23 .01 SU-I - .50 ** .51 ** .27 .63 *** .55 *** -.18 .32 * .15 .06 -.34 * - .25 .25 .74 *** .64 *** .11 .13 .07 -.15 -.10 - .06 .77 *** .45 ** -.39 * .28 .14 .30 -.27 - .43 ** .51 ** .30 .08 -.10 -.05 -.21 - .79 *** -.11 .26 .09 .08 -.28 - .01 .24 .06 -.12 -.19 - -.08 -.34 * -.45 ** -.10 - -.41 ** -.39 * -.28 - .12 -.36 * - -.14 SU-EM SU-PR SU-SO SU-HA SU-V SU-F1 SU-F2 SU-F3 SU-F4 SU-F5 - Anmerkung. SU-S: Soziale Unterstützung-Selbsteinschätzung; SU-I: Soziale Unterstützung-Fremdeinschätzung Interviewrating; SU-EM: Supportive Handlungen-Emotional; SU-PR: Supportive Handlungen-Praktisch; SU-SO: Supportive Handlungen-Soziale; SU-HA: Supportive Handlungen-Gesamtscore; SU-V: Supportive Handlungen-Vielseitigkeit; SU-F1: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 1; SU-F2: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 2; SU-F3: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 3; SU-F4: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 4; SU-F5: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 5 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 158 1.6.2.4 Zusammenhänge zwischen Prädiktor- und Moderatorvariablen auf Seiten der Angehörigen und dem globalen Patientenoutcome Tabelle 37 zeigt die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und den Moderatorvariablen für diejenigen Partner, die für die 12-Monats-Katamnese betrachtet werden. Das Ergebnismuster entspricht in wesentlichen Teilen dem zu T2, geringfügige Abweichungen in der Höhe der Korrelation und/oder der Signifikanz dürften auf die im Vergleich zu der T2-Analyse reduzierte Stichprobengröße zurückzuführen sein. Allerdings sind im Vergleich zu der Korrelationsmatrix zu T2 zwei Veränderungen aufgetreten, die u.E. möglicherweise einen systematischen Effekt anzeigen. Auffällig ist, dass die signifikanten Korrelationen zwischen dem selbsteingeschätzten Ausmaß sozialer Unterstützung und den beziehungsbezogenen Merkmalen, wie sie noch für die Partnerstichprobe des Zeitpunktes T2 bestanden, bei der Partnerstichprobe der 12Monats-Katamnese nicht zu beobachten sind. Stattdessen bestehen bei dieser Substichprobe zwei signifikante Zusammenhänge, die in der Partnerstichprobe der 6Monats-Katamnese nicht auftraten. So besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Funktion supportiven Verhaltens "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" (SU-F4) und der Beziehungsqualität sowie der familiären Kohäsion. Dies bedeutet, dass Partner umso weniger die Verbesserung der Beeinträchtigungen als Ziel ihres supportiven Handelns sehen, je niedriger sie die Beziehungsqualität und die familiäre Kohäsion vor der Verletzung einschätzen. 159 Tabelle 37: Korrelationen zwischen Prädiktorvariablen und Moderatorvariablen (N = 37-42) SG BI G AL B-H B-W B-E B-A GBB BAI BDI KON FD-P FD-N BB-S BB-A DAS FA-K FA-A SU-S -.06 .09 -.10 -.09 .06 .31 .34* .14 .15 .14 -.10 -.12 .25 -.02 .03 .19 .21 .25 .04 SU-I .11 -.25 -.05 -.00 .13 .07 .14 .31 .32* .37* .12 -.06 .11 -.22 -.05 -.13 .11 .15 .22 SU-EM .18 -.48** .14 -.05 .27 -.20 -.10 .10 .22 .24 .18 .03 .06 -.34* -.03 -.01 .12 .13 .17 SU-PR .05 -.15 .03 -.05 -.07 .20 .07 -.05 .05 .06 -.03 .05 -.13 -.05 -.05 -.28 .02 -.05 .07 SU-SO .03 -.04 -.07 .16 .36* .03 .07 -.12 .04 -.09 -.09 .18 .05 -.00 -.29 .02 -.10 .16 .06 SU-HA .12 -.34* .04 -.03 .16 .04 .03 -.03 .13 .11 .02 .05 -.05 -.23 -.11 -.19 .06 .10 .17 SU-V .25 -.45** .05 .19 .25 -.02 .07 -.05 .08 .13 -.00 -.10 .03 -.27 .05 -.06 .21 .29 .35* SU-F1 .09 -.15 -.07 -.06 .18 -.11 .08 -.12 -.13 .03 .04 .20 .18 .06 -.25 .16 -.01 .07 -.04 SU-F2 .10 -.02 -.11 -.16 -.34* -.01 -.09 .15 -.17 -.05 -.23 -.19 -.03 .02 -.03 -.15 .25 .39* .30 SU-F3 .06 .03 .10 .16 .15 .05 .07 -.12 .08 -.09 -.07 .02 -.03 -.05 .23 -.07 -.01 -.07 .09 SU-F4 .08 -.15 .25 .16 .10 .02 -.03 -.08 .04 -.02 .01 .22 -.16 .11 -.05 -.13 -.34* -.37* -.25 SU-F5 -.22 .15 -.13 -.10 -.01 -.03 -.11 .08 .12 .09 .30 -.16 .11 -.08 .13 .20 .07 -.09 -.15 Anmerkung: SU-S: Soziale Unterstützung-Selbsteinschätzung; SU-I: Soziale Unterstützung-Fremdeinschätzung Interviewrating; SU-EM: Supportive Handlungen-Emotional; SU-PR: Supportive Handlungen-Praktisch; SU-SO: Supportive Handlungen-Sozial; SU-HA: Supportive Handlungen-Gesamtscore; SU-V: Supportive Handlungen-Vielseitigkeit; SU-F1: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 1; SU-F2: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 2; SU-F3: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 3; SU-F4: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 4; SU-F5: Intendierte Soziale Unterstützung-Funktion 5; SG: Schweregrad Verletzung; BI: Barthel-Index; G: Geschlecht des Patienten; AL: Alter des Patienten; B-H: Bewertung Hilfsbedürftigkeit; B-W: Bewertung Wissen; B-E: Bewertung Erfolg; B-A: Bewertung Akzeptanz; GBB: Gießener Beschwerdebogen-24; BAI: Beck Angst Inventar; BDI: Beck Depressions Inventar; KON: Konfliktpotential; FD-P: Fragebogen zum dyadischen Coping-Positives dyadisches Coping; FD-N: Fragebogen zum dyadischen Coping-Negatives dyadisches Coping; BB-S: Beziehungsspezifische Bindungsskalen-Sicher; BB-A: Beziehungsspezifische Bindungsskalen-Abhängig; DAS: Dyadic Adjustment Scale; FA-K: FACES-Kohäsion; FA-A: FACES-Adaptabilität; * p < .05; ** p < .01 160 Im nächsten Analyseschritt wurden Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen (Angehörige) und dem komplexen Kriterium berechnet. Es zeigen sich zwei signifikante Korrelationen zwischen Variablen aus dem Bereich der fremdeingeschätzten Unterstützung und dem Outcome. Das globale Anpassungsniveau 12 Monate nach Verletzung ist umso schlechter, je mehr supportive emotionale Handlungen Partner zu T1 zeigen und je vielseitiger die Hilfe der Partner zu T1 eingestuft wird. Ferner besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Funktion supportiven Verhaltens "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" und dem komplexen Kriterium. Je höher die Bedeutsamkeit dieser Funktion zu T1 eingeschätzt wird, desto schlechter ist der Outcome des Patienten 12 Monate nach Verletzung (vgl. Tabelle 38). Die Korrelationen zwischen den Moderatorvariablen und dem komplexen Kriterium sind in Tabelle 39 dargestellt. Hier zeigt sich erneut der bereits für den Zeitpunkt T2 beobachtete Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Hilfsbedürftigkeit des Patienten und dem globalen Outcome. Je hilfsbedürftiger die Partner den Patienten zu T1 einschätzen, desto schlechter ist der Outcome zwölf Monate nach Verletzung. Hingegen sind die bei der 6-Monats-Katamnese vorliegenden Zusammenhänge zwischen den körperlichen Beschwerden sowie der Angst der Partner zu T1 und dem globalen Outcome ein Jahr nach Verletzung nicht mehr zu beobachten. Stattdessen ergibt sich eine signifikante Korrelation zwischen der Einschätzung der adäquaten Hilfe für den Patienten und dem Kriterium. Je unsicherer sich die Partner zu T1 in ihrer Einschätzung um ein adäquates Hilfeverhalten sind (B-W), desto schlechter ist der Patientenoutcome 12 Monate nach Verletzung. 161 Tabelle 38: Korrelation Prädiktoren und Komplexes Kriterium (Spearman-Korrelation; N = 40-42) Komplexes Kriterium Soziale Unterstützung Selbsteinschätzung SU-S -.15 Fremdeinschätzung SU-I .03 Supportive Handlungen Emotional SU-EM .35 * Praktisch SU-PR .07 Sozial SU-SO .30 Gesamtscore SU-HA .27 Vielseitigkeit SU-V .46 ** Intendierte Unterstützung Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .04 Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 -.21 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 .04 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 .34 * Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 -.13 Anmerkung. * p < .05; ** p < .01 162 Tabelle 39: Korrelationen (Spearman) zwischen den Moderatorvariablen und dem Komplexen Kriterium (N = 42) Komplexes Kriterium Unterstützungsbezogene Bewertungen Hilfsbedürftigkeit B-H .39 * Wissen B-W -.31 * Erfolg B-E -.04 Akzeptanz B-A -.27 Befinden Körperliche Beschwerden GBB .19 Angst BAI .15 Depressivität BDI .14 Beziehungsbezogene Merkmale Konfliktpotential KON .24 Positives dyadisches Coping FDCT-P -.02 Negatives dyadisches Coping FDCT-N -.10 Bindung sicher BB-S .00 Bindung abhängig BB-A -.03 Beziehungsqualität DAS -.12 Familiäre Kohäsion FACES-K -.26 Familiäre Adaptabilität FACES-A -.03 Anmerkung. * p < .05 163 1.6.2.5 Prädiktion des Patientenoutcomes zwölf Monate nach Verletzung 1.6.2.5.1 Prädiktion des komplexen Kriteriums Im folgenden wurde eine logistische Regression analog der beschriebenen Analysen zur Prädiktion des komplexen Kriteriums zu T2 durchgeführt. Die Dichotomisierung des komplexen Kriteriums führte dazu, dass für die erste logistische Regression N = 31 Patienten (75.6 %) als weniger auffällig und N = 10 Patienten (24.4 %) als deutlich auffällig eingestuft wurden. Ein Patienten ging aufgrund fehlender Werte (auf Seiten der Partner) nicht in die Regressionsanalyse ein, so dass diese für insgesamt N = 41 Patienten durchgeführt wurde. Das finale Modell der logistischen Regression ist in Tabelle 40 dargestellt. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 41) = 8.05, p < .01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifkation von 82.9 %. Tabelle 40: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage des komplexen Kriteriums zu T3 (N = 41) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V .50 .24 1.64 4.12 * Unterstützungsbezogene Bewertung -.93 .36 .39 6.60 * -.22 2.03 Variable Wissen B-W Constant .01 Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05 Die logistische Regression erbrachte einen negativen Einfluß der Vielseitigkeit der Unterstützung. Je mehr Bereiche Partner mit ihrer Hilfe zu T1 "abdeckten", desto schlechter war der Outcome ein Jahr nach Verletzung. Ferner zeigte sich, dass der Outcome umso negativer ausfiel, je geringer die Partner zu T1 ihr Wissen hinsichtlich hilfreichen supportiven Verhaltens einschätzten. Abschließend wurde erneut ein Mittelwertegleich durchgeführt, der für beide Variablen ein signifikantes Ergebnis liefert: 164 SU-V: M = 6.2, SD = 1.8 vs. M = 7.5, SD = 1.6; t (39) = -2.05, p < .05; B-W: M = 5.2, SD = 1.1 vs. M = 4.0, SD = 1.2; t (39) = 2.99, p < .01. 1.6.2.5.2 Prädiktion der Einzelkomponenten des komplexen Kriteriums Im Anschluß an diese Regression wurden erneut Zusammenhänge zwischen Einzelkomponenten des komplexen Kriteriums untersucht. Dabei wurde analog des oben beschriebenen Vorgehens verfahren. Im einzelnen wurden die Variablen d2 und RBMT zu KK-kognitiv (Komplexes Kriterium-kognitiv), BAI und BDI zu KK-psychisch (Komplexes Kriterium-psychisch), GBB und RPQ zu KK-somatisch (Komplexes Kriterium-somatisch) sowie BI und RHFUQ zu KK-Aktivität (Komplexes KriteriumAktivitäten) zusammengefasst. Zusätzlich wurde die Variablen WHOQOL-PHYS, WHOQOL-PSYCH, WHOQOL-SOCIAL und WHOQOL-ENVIR zu KK-Qualität zusammengefasst. Status der Erwerbstätigkeit wurde wie auch zu T2 als Einzelvariable betrachtet (KK-Erwerb). Tabelle 41 zeigt die Interkorrelationen dieser Subkategorien sowie die Korrelationen der einzelnen Subkategorien mit dem globalen komplexen Kriterium zu T3. Die Korrelationen sind vergleichbar dem Korrelationsmuster zu T2. Eine Ausnahme besteht bei den Korrelationen der Subkategorie KK-Erwerb. Während zu T2 lediglich die Subkategorie KK-kognitiv einen signifikanten positiven Zusammenhang mit dem Erwerbsstatus aufwies, korrelieren ein Jahr nach Verletzung auch alle weiteren Subkategorien Zusammenhang signifikant besteht mit dem erneut Status zwischen der dem Erwerbstätigkeit. kognitiven Der Status höchste und der Erwerbstätigkeit (r = .57, p < .01). Die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und den Subkategorien sind in Tabelle 42 dargestellt; die Korrelationen zwischen den Moderatorvariablen und den Subkategorien des komplexen Kriteriums liefert Tabelle 43. Dabei zeigt sich für die Prädiktoren eine konsistente Korrelation vor allem der Vielseitigkeit der supportiven Handlungen mit den Subkategorien des komplexen Kriteriums. Daneben weist vor allem die Variable Emotionale supportive Handlungen SU-EM Zusammenhänge mit den 165 Subkategorien auf. Ebenso wie zu T2, bestehen signifikante positive Korrelationen zwischen der Funktion SU-F4 der intendierten Unterstützung (Einflussnahme auf den Genesungsprozess) und Outcomekategorien. Im Unterschied zu T2 bestehen durchgängig negative Korrelationen zwischen dem selbstbeurteilten Ausmaß an sozialer Unterstützung und den Subkategorien. Allerdings erreichen die Korrelationen nur in einem Fall statistische Signifikanz (r = -.39, p < .05). Der signifikante negative Zusammenhang zwischen selbstbeurteiltem Ausmaß sozialer Unterstützung und der Subkategorie Erwerbstätigeit zeigt an, dass der berufliche Status ein Jahr nach Verletzung umso günstiger ist, je mehr Unterstützung Partner zu T1 angeben. Tabelle 41: Interkorrelationen (Spearman-Korrelationen) der Subkategorien und des globalen komplexen Kriteriums zu T3 (N = 41-42, außer wenn angezeigt) KK- KK- KK- KK- psychisch somatisch Aktivität Qualität KK-kognitiv a .81 *** .79 *** .72 *** .78 *** .57 ** .84 *** KK-psychisch - .91 *** .83 *** .87 *** .38 * .92 *** - .86 *** .84 *** .31 * .92 *** - .88 *** .43 ** .95 *** - .37 * .91 *** - .53 *** KK-somatisch KK-Aktivität KK-Qualität KK-Erwerb Anmerkung. a N = 26-27; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 KK-Erwerb Komplexes Kriterium 166 Tabelle 42: Korrelationen (Spearman) der Prädiktorvariablen mit den Subkategorien des komplexen Kriteriums (N = 39-42, außer wenn angezeigt) KK- KK- KK- KK-Aktivität KK-Qualität KK-Erwerb kognitiva psychisch somatisch Selbstbeurteilung SU-S -.17 -.08 -.06 -.10 -.08 -.39 * Fremdbeurteilung SU-I -.09 .04 .07 .05 .06 -.09 Emotional SU-EM .36 .33 * .24 .32 * .36 * .32 * Praktisch SU-PR -.04 .13 .14 .06 .11 .10 Sozial SU-SO .36 .19 .31 * .22 .28 .04 Gesamtscore SU-HA .19 .25 .27 .25 .31 * .24 .46 * .42 ** .45 ** .44 ** .45 ** .18 Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .25 .06 .03 -.05 -.01 -.29 Optimierung patientenseitiger -.29 -.13 -.07 -.25 -.23 -.10 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 .05 -.02 -.02 .15 .17 .02 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 .23 .26 .26 .38 * .29 .45 ** Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 -.14 -.13 -.20 -.14 -.16 .06 Soziale Unterstützung Supportive Handlungen Variabilität SU-V Intendierte Unterstützung Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 Anmerkung. a N = 25-27; * p < .05; ** p < .01 167 Tabelle 43: Korrelationen (Spearman) der Moderatorvariablen mit den Subkategorien des komplexen Kriteriums zu T3 (N = 39-42, außer wenn angezeigt) KK- KK- KK- KK-Aktivität KK-Qualität KK-Erwerb kognitiva psychisch somatisch .51 ** .24 .27 .39 * .30 * .24 Wissen B-W -.30 -.31 * -.27 -.29 # -.28 -.19 Erfolg B-E .05 -.03 .01 -.07 -.02 -.20 Akzeptanz B-A -.23 -.20 -.18 -.30 * -.25 -.18 Körperliche Beschwerden GBB -.04 .16 .15 .28 .16 .05 Angst BAI -.07 .15 .12 .19 .03 .05 Depressivität BDI -.04 .02 .02 .05 -.07 -.01 Konfliktpotential KON .29 .18 .21 .22 .16 .20 Positives dyadisches Coping FDCT-P .03 -.10 -.02 .07 -.11 -.11 Negatives dyadisches Coping FDCT-N -.03 -.09 -.17 -.11 -.14 .11 Bindung sicher BB-S .06 -.12 .01 .08 -.06 -.01 Bindung abhängig BB-A .08 .05 .02 -.04 -.07 -.15 Beziehungsqualität DAS .14 -.16 -.11 -.07 -.16 -.17 Unterstützungsbezogene Bewertungen Hilfsbedürftigkeit B-H Befinden Beiehungsbezogene Merkmale Familiäre Kohäsion FACES-K -.08 -.31 * -.19 -.16 Familiäre Adaptabilität FACES-A .02 -.07 .03 .03 Anmerkung. a N = 25-27; # p < .06; * p < .05; ** p < .01 -.30 # -.09 -.36 * -.10 168 Bei den Moderatorvariablen korrelieren vor allem die unterstützungsbezogenen Bewertungen mit den Subkategorien (vgl. Tab. 43). Dabei zeigen sich für die Bewertungen Wissen um hilfreiche Handlungen (B-W) und Akzeptanz der Hilfe durch den Patienten (B-A) durchgängig negative Korrelationen, die jedoch nicht für alle Subkategorien statistische Signifikanz erreichen. Dieses Korrelationsmuster deutet darauf hin, dass der Outcome ein Jahr nach Verletzung umso schlechter ist, je geringer Partner zu T1 ihr Wissen um hilfreiche Handlungen einschätzen und je weniger sie der Ansicht sind, dass der Patienten ihre Hilfe annehmen wird. Weiterhin weist die familiäre Kohäsion (FACES-K) begrenzte Zusammenhänge mit den Outcomekategorien auf, wobei auch hier durchgängig negative Korrelationen bestehen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Outcome umso schlechter ist, je niedriger die familiäre Kohäsion beurteilt wird. Im folgenden werden die Ergebnisse der logistischen Regressionen dargestellt, die analog des oben beschriebenen Vorgehens für jede der Subkategorien des komplexen Kriteriums durchgeführt wurden. In die logistische Regression der Subkategorie KK-kognitiv gingen N = 26 Patienten ein. Von diesen wurden N = 18 (69.2 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 8 (30.8 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das finale Modell ist in Tabelle 44 dargestellt. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 26) = 8.38, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifkation von 80.8 % der Fälle. Tabelle 44: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-kognitiv zu T3 (N = 26) Variable Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V Constant Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05 B S.E .91 .38 -6.59 2.57 Odds Ratios Wald-Statistik a 2.47 5.61 * 6.55 * 169 Die Regression ergibt einen signifikanten Prädiktor. Wie zu T2 zeigt sich, dass der Outcome zwölf Monate nach Verletzung in der Subkategorie KK-kognitiv umso schlechter ist, je mehr Bereiche die supportiven Handlungen der Partner zu T1 abdecken. Signifikante Interaktionen waren nicht zu beobachten. Der folgende MIttelwertevergleich lieferte ein signifikantes Ergebnis: M = 5.4, SD = 1.3 vs. M = 7.4, SD = 1.7; t (24) = -3.14, p < .01. Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-psychisch ist in Tabelle 45 dargestellt. In die Regression gingen N = 39 Patienten ein. Von diesen wurden N = 25 (64.1 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 14 (35.9 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 39) = 7.33, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 79.5 % der Fälle. Tabelle 45: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-psychisch zu T3 (N = 39) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V 1.43 .45 4.19 10.06 ** Familiäre Kohäsion FACES-K -3.37 1.48 .03 5.18 * Constant 4.35 4.95 Variable .77 Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Das Ergebnis der Regression zeigt den wiederholt beschriebenen Effekt, wonach eine größere Variabilität der supportiven Handlungen der Partner zu T1 mit einem schlechteren Outcome zusammenhängt. Ferner erbringt die Regression einen signifikanten Effekt der Variable FACES-K. Das Modell zeigt den negativen Einfluß einer geringeren familiären Kohäsion auf den Outcome in der Subkategorie KK-psychisch zwölf Monate nach Verletzung. Die familiäre Kohäsion wurde von den Partnern zu T1 für die Zeit vor der Verletzung eingeschätzt. Es ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Der folgende Mittelwertevergleich erbrachte für die Variable SU-V ein signifikantes Ergebnis: M = 5.8, SD = 1.4 vs. M = 7.8, SD = 1.7; t (39) = -4.06, p < .001. 170 Hingegen unterschieden sich Partner von Patienten mit besserem Outcome nicht von solchen mit schlechterem Outcome bezüglich der prämorbiden familiären Kohäsion: M = 4.4, SD = .50 vs. M = 4.3, SD = .33; t (35.9) = .98, p > .10. Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-somatisch ist in Tabelle 46 dargestellt. In die Regression gingen N = 41 Patienten ein. Von diesen wurden N = 24 (58.5 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 17 (41.5 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 41) = 7.80, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 65.9 % der Fälle. Tabelle 46: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-somatisch zu T3 (N = 41) Variable Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V Constant B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a .55 .22 1.74 6.12 * -4.01 1.53 6.86 ** Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Die Regression erbringt ein signifikantes Ergebnis für die Variable SU-V. Es zeigt sich erneut der negative Einfluß der Vielseitigkeit der supportiven Handlungen auf den Outcome. Es ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Der Mittelwertevergleich erbrachte ein signifikantes Ergebnis: M = 5.9, SD = 1.7 vs. M = 7.4, SD = 1.6; t (39) = 2.90, p < .01. Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-Aktivität ist in Tabelle 47 dargestellt. In die Regression gingen N = 41 Patienten ein. Von diesen wurden N = 27 (65.9 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 14 (34.1 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 41) = 4.71, p <. 05). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 78.1 % der Fälle. 171 Tabelle 47: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-Aktivität zu T3 (N = 41) B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V .67 .30 1.95 5.03 * Intendierte Unterstützung Einflussnahme .09 .04 1.09 5.66 * -.95 .47 .39 4.05 * -1.72 3.06 Variable auf den Genesungsprozess SU-F4 Unterstütungsbezogene Bewertung Akzeptanz B-A Constant .32 Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05 Die Regression zeigt den bekannten negativen Einfluß der Variabilität supportiven Handelns. Weiterhin zeigt sich der ebenfalls bereits mehrfach zu T2 beschriebene negative Einfluß der Funktion supportiven Verhaltens "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" (SU-F4). Ferner ergibt sich ein Zusammenhang mit einer unterstützungsbezogenen Bewertung. Je weniger der Patient aus Sicht der Partner zu T1 bereit ist, die Hilfe des Partners anzunehmen, desto schlechter ist der Outcome in der Subkategorie KK-Aktivität zwölf Monate nach Verletzung. Auch hier ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Die anschließend durchgeführten Mittelwertvergleiche erbrachten lediglich für die Variable SU-F4 ein signifikantes Ergebnis: M = 12.9, SD = 13.8 vs. M = 22.4, SD = 11.7; t (39) = -2.18, p < .05. Für die Variable SU-V zeichnet sich ein Trend ab: M = 6.1, SD = 1.9 vs. M = 7.2, SD = 1.5; t (39) = -1.83, p = .075. Zudem unterschieden sich beide Partnergruppen mit einer schwachen Tendenz hinsichtlich der unterstützungsbezogenen Bewertung (B-A): M = 5.7, SD = .06 vs. M = 5.1, SD = 1.1; t (17.2) = .094. Tabelle 48 zeigt das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-Qualität. In die Regression gingen N = 39 (76.9 %) Patienten ein. Von diesen wurden N = 30 (23.1 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 9 als "schlechterer 172 Outcome" ("1") eingestuft. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 39) = 5.46, p <. 05). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 82.1 % der Fälle. Tabelle 48: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-Qualität zu T3 (N = 39) Variable Supportive Handlungen-Gesamtscore B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a .14 .07 1.15 4.57 * -3.88 1.40 SU-HA Constant 7.76 ** Anmerkung. a Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05; ** p < .01 Die logistische Regression zeigt einen signifikanten Einfluß der Gesamtzahl supportiven Verhaltens. Je mehr supportive Handlungen Partner zu T1 zeigen, desto schlechter ist der Outcome in der Subkategorie Lebensqualität zwölf Monate nach Verletzung. Es ergaben sich keine signifikanten Interaktionen. Der abschließende Mittelwertevergleich lieferte einen Trend: M = 16.1, SD = 5.8 vs. M = 20.5, SD = 8.8; t (39) = -1.81, p = .074. Das finale Modell der logistischen Regression für die Subkategorie KK-Erwerb ist in Tabelle 49 dargestellt. In die Regression gingen N = 37 Patienten ein. Von diesen wurden N = 8 (21.6 %) als "besserer Outcome" ("0") und N = 29 (78.4 %) als "schlechterer Outcome" ("1") klassifiziert. Das Modell ist signifikant (Chi2 (1, N = 37) = 10.66, p <. 01). Es liefert eine korrekte Gesamtklassifikation von 81.1 % der Fälle. Tabelle 49: Finales Modell der logistischen Regression zur Vorhersage der Subkategorie KK-Erwerb zu T3 (N = 37) Variable Supportive Handlungen-Emotional SU-EM Constant a Anmerkung. Chi-Quadrat (df = 1); * p < .05 B S.E Odds Ratios Wald-Statistik a .72 .32 2.06 5.13 * -1.76 1.19 2.21 173 Die Regression erbringt ein signifikantes Ergebnis für die Variable SU-EM. Es zeigt sich, dass der Outcome hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zwölf Monate nach Verletzung umso schlechter ist, je mehr supportive emotionale Handlungen Partner zu T1 zeigen. Es ergaben sich erneut keine signifikanten Interaktionen. Der Mittelwertevergleich war signifikant: M = 2.8, SD = 1.6 vs. M = 6.4, SD = 3.3; t (29.4) = 4.51, p < .001. 174 1.6.3 Prädiktion der Veränderung im generellen Anpassungsniveau des Patienten Im nächsten Schritt wurde die Veränderung im generellen Anpassungsniveau zwischen den beiden Katamnesezeitpunkten untersucht. Dazu wurde das komplexe Kriterium modifiziert. Da nicht alle Patienten den d2 und den RBMT bearbeitet hatten und da ein Unterschied in der Zusammensetzung des komplexen Kriteriums zu beiden Katamnesezeitpunkten besteht, wurden für die Analyse der Veränderung nur die Variablen berücksichtigt, die für alle Patienten zu den Zeitpunkten 6 und 12 Monate nach Verletzung vorlagen. Bei der Veränderungsanalyse gingen somit folgende Variablen in das Komplexe Kriterium ein: • GBB-24 • RPQ • BAI • BDI • BI • RHFUQ • Status Erwerbstätigkeit Die Einteilung in die Kategorien unauffällig, leicht auffällig, deutlich auffällig und sehr deutlich auffällig geschah analog der in Tabelle 10 dargestellten Vorgehensweise. Da bei diesem Vorgehen alle Variablen für alle betrachteten Personen vorliegen, besteht keine Notwendigkeit, den resultierenden Summenscore anhand der in das Kriterium eingehenden Variablen zu standardisieren. Dies bedeutet, dass für die Veränderungsanalyse eine Summation der 7 Variablen erfolgte und anschließend die Differenz zwischen den Werten des Zeitpunktes T3 und des Zeitpunktes T2 gebildet wurde. Ergibt die Differenz ein Ergebnis mit negativem Vorzeichen, so heißt dies, dass sich die Person zwischen den Zeitpunkten 6 und 12 Monate nach Verletzung in ihrem generellen Anpassungsniveau verbessert hat. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der so gebildeten Kriterien sowie der Differenz der beiden Werte ist in Tabelle 50 dargestellt. In die Veränderungsanalyse gehen die Daten von N = 42 Patienten ein. 175 Tabelle 50: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range des komplexe Kriteriums-Veränderungsanalyse (KK-V) (N = 42) M SD Range KK-V T2 8.8 6.7 1 – 20 KK-V T3 8.3 6.8 0 – 21 KK-V T3-T2 -.4 2.8 -10 – 5 Um das Ausmaß an Veränderung zu veranschaulichen werden Personen, deren Veränderungsscore innerhalb der Standardabweichung des mittleren Veränderungswertes (± 2.8) liegt, als unverändert beurteilt. Personen, deren Wert mehr als eine Standardabweichung im positiven Bereich liegt, gelten als verschlechtert; Personen mit einem Wert größer einer Standardabweichung im negativen Bereich gelten als verbessert. Demnach sind 3 Patienten (7.1 %) als gebessert, 33 Patienten (78.6 %) als unverändert und 6 Patienten (14.3 %) als verschlechtert hinsichtlich ihres globalen Status einzustufen. Dies wird in Abbildung 5 nochmals veranschaulicht. 80 60 verschlechtert unver ndert gebessert 40 20 0 Komplexes KriteriumVer nderungsscore Abbildung 5: Veränderung im globalen Outcome der Patienten (N = 42) zwischen 6 und 12 Monate nach Verletzung unter Nutzung der Standardabweichung des mittleren Veränderungsscores 176 Im folgenden wurden die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und dem Veränderungswert KK-V T3-T2 berechnet. Da aufgrund der Differenzbildung von einem metrischen Niveau auszugehen ist, berechneten wir Pearson-Korrelationen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 51 dargestellt. Es ergeben sich keine signifikanten Zusammenhänge. Die Pearson-Korrelationen zwischen den Moderatorvariablen und dem Veränderungswert des komplexen Kriteriums sind in Tabelle 52 dargestellt. Wie schon bei den Prädiktorvariablen, ergeben sich auch bei den Moderatorvariablen keine signifikanten Korrelationen zu dem Veränderungswert. Tabelle 51: Korrelationen (Pearson) zwischen den Prädiktorvariablen und dem Veränderungswert des komplexen Kriteriums KK-V (N = 40-42) KK-V T3-T2 Soziale Unterstützung Selbstbeurteilung SU-S -.02 Fremdbeurteilung SU-I -.04 Supportive Handlungen Emotional SU-EM .15 Praktisch SU-PR .11 Sozial SU-SO -.05 Gesamtscore SU-HA .15 Vielseitigkeit SU-V .15 Intendierte Unterstützung Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .09 Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 .23 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 -.18 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 -.13 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 -.06 177 Tabelle 52: Korrelationen (Pearson) zwischen den Moderatorvariablen und dem komplexen Kriterium -Veränderungswert KK-V (N = 42) KK-V T3-T2 Unterstützungsbezogene Bewertungen Hilfsbedürftigkeit B-H .08 Wissen B-W -.10 Erfolg B-E .05 Akzeptanz B-A .22 Befinden Körperliche Beschwerden GBB -.03 Angst BAI .08 Depressivität BDI .00 Beziehungsbezogene Merkmale Konfliktpotential KON .19 Positives dyadisches Coping FDCT-P -.27 Negatives dyadisches Coping FDCT-N -.16 Bindung sicher BB-S -.07 Bindung abhängig BB-A -.09 Beziehungsqualität DAS -.18 Familiäre Kohäsion FACES-K -.18 Familiäre Adaptabilität FACES-A -.07 Wir führten eine multiple lineare Regression zur Prädiktion des Veränderungswertes des komplexen Kriteriums durch. Wie aufgrund der fehlenden signifikanten korrelativen Zusammenhänge zu erwarten, ergab sich kein signifkanter Prädiktor. 178 1.6.4 Prädiktion der globalen Lebensqualität (12-Monats-Katamnese) Zusätzlich zu der aggregierten Datenanalyse wurden Zusammenhänge zu der Globalbeurteilung der Lebensqualität der Patienten im WHOQOL-BREF 12 Monate nach der Verletzung berechnet. Diese wird mit zwei Items Maß dar, da es ahe li und stellt ein integratives ahe liegt, dass in die Beurteilung viele der hier berücksichtigten Einzelkriterien einfließen (vgl. Angermeyer et al., 2000). Die Verteilungskennwerte der Globalbeurteilung der Lebensqualität der Patienten zu T3 sind in Tabelle 53 dargestellt. Die Daten lagen für N = 33 Patienten vor. Der Vergleich mit den Normwerten zeigt eine unwesentlich geringere mittlere globale Lebensqualität (Norm: M = 67.6; SD = 17.9). Tabelle 53: Mittelwert (M), Standardabeichung (SD) und Range der globalen Lebensqualität (N = 33) und Vergleichswerte (Quelle: Testautor) Vergleichswerte Globale Lebensqualität WHOQOL- Patientenstichprobe M SD M SD Range 67.61 17.9 61.7 20.7 25-100 BREF GLOBAL Anmerkung. 1 Basis: Allgemeinbevölkerung Tabelle 54 zeigt die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und der globalen Lebensqualität. Am deutlichsten korreliert das Merkmal supportive emotionale Handlungen (SU-EM) mit dem Kriterium. Dabei zeigt sich – analog des bisher beschriebenen Ergebnismusters – dass die globale Lebensqualität ein Jahr nach Verletzung umso schlechter eingeschätzt wird, je mehr supportive Handlungen Partner zu T1 durchführen. Ein entsprechender signifikanter Zusammenhang besteht für die Merkmale Gesamtzahl der geleisteten supportiven Handlungen und Vielseitigkeit der supportiven Handlungen. 179 Tabelle 54: Korrelationen zwischen Prädiktoren und der globalen Lebensqualität (Pearson-Korrelation; N = 31-33) WHOQOL-BREF GLOBAL Soziale Unterstützung Selbstbeurteilung SU-S .07 Fremdbeurteilung SU-I -.17 Supportive Handlungen Emotional SU-EM .-52 ** Praktisch SU-PR .-05 Sozial SU-SO -.18 Gesamtscore SU-HA -.39 * Vielseitigkeit SU-V -.38 * Intendierte Unterstützung Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .01 Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 .01 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 -.07 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 -.14 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 .09 Anmerkung. * p < .05; ** p < .01 Die Korrelationen zwischen den Moderatorvariablen und der globalen Lebensqualität sind in Tabelle 55 dargestellt. Dabei zeigt sich lediglich ein Trend zwischen der Bewertung der Hilfsbedürftigkeit des Patienten zu T1 und dem Kriterium. Je hilfsbedürftiger Partner den Patienten zu T1 einschätzen, desto niedriger ist die globale Lebensqualität des Patienten ein Jahr nach Verletzung. 180 Tabelle 55: Korrelationen (Pearson) zwischen den Moderatorvariablen und der globalen Lebensqualität (N = 32-33) WHOQOL-BREF GLOBAL Unterstützungsbezogene Bewertungen Hilfsbedürftigkeit B-H -.33 # Wissen B-W .08 Erfolg B-E .17 Akzeptanz B-A .30 Befinden Körperliche Beschwerden GBB -.12 Angst BAI -.28 Depressivität BDI .11 Beziehungsbezogene Merkmale Konfliktpotential KON -.12 Positives dyadisches Coping FDCT-P -.09 Negatives dyadisches Coping FDCT-N -.18 Bindung sicher BB-S .14 Bindung abhängig BB-A .29 Beziehungsqualität DAS .15 Familiäre Kohäsion FACES-K .05 Familiäre Adaptabilität FACES-A .08 Anmerkung. # p = .57 Tabelle 56 zeigt das Ergebnis der hierarchischen linearen Regression. Als signifikanter Prädiktor der globalen Lebensqualität erwies sich das Ausmaß der supportiven emotionalen Handlungen der Partner zu T1. Je mehr supportive emotionale Handlungen Partner angaben, desto niedriger war die globale Lebensqualität der Patienten ein Jahr nach Verletzung. Die aufgeklärte Varianz betrug 25 %. 181 Tabelle 56: Ergebnis der multiplen linearen Regression der Prädiktion der globalen Lebensqualität (N = 32) B SE B ß R2 Supportive Handlungen-Emotional SU-EM -3.62 1.09 -.52 ** .25 Constant 79.77 6.40 Anmerkung. ** p < .01 182 1.6.5 Prädiktion der Aktivitätsstörung aus Partnersicht (12-Monats-Katamnese) Das zweite Einzelkriterium, für das eine getrennte Analyse durchgeführt wurde, ist das Ausmaß der Aktivitätsstörung aus Partnersicht. Diese wurde mittels der Fremdbeurteilung der Marburger Kompetenz Skala (MKS) erhoben. Die MKS liefert eine differenziertere Beurteilung des Ausmaßes der Aktivitätsstörung als z.B. der BarthelIndex (BI) oder der Rivermead Head Injury Follow-Up Questionnaire (RHFUQ). Zudem stellt die Fremdbeurteilung eine Ergänzung der in erster Linie auf Selbstbeurteilungen basierenden Maße des komplexen Kriteriums dar. In der Tabelle 57 sind die Verteilungskennwerte der Fremdeinschätzung der MKS für N = 39 Patienten angeführt. In drei Fällen sahen sich die Partner nicht in der Lage, die MKS zu bearbeiten, da sie die Items aufgrund des Zustandes des Patienten nicht adäquat beurteilen konnten. Der Mittelwert der MKS-F ist niedriger als der von Gauggel und Peleska (1999) berichtete mittlere Wert einer SHT-Stichprobe (M = 93.5; SD = 26.6). Die von Gauggel und Peleska berichteten Referenzwerte entstammen einer Patientenstichprobe, die (vermutlich) zum größten Teil während einer stationären Rehabilitationsmaßnahme befragt wurde; bei etwa zwei Drittel ihrer Patienten lag die Verletzung ein Jahr oder kürzer zurück. Die Stichprobe unserer Studie ist somit im Mittel stärker beeinträchtigt als die Vergleichsstichprobe. Tabelle 57: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Range der Aktivitätsstörung aus Partnersicht (MKS-F) (N = 39) sowie Vergleichswerte (Quelle: Testautor) Vergleichswerte Aktivitätsstörung Fremdbeurteilung MKS-F Patientenstichprobe M SD M SD Range 90.11 24.0 82.5 27.4 29-119 Anmerkung. 1 Basis: klinische Gruppe Die Korrelationen zwischen den Prädiktorvariablen und dem fremdbeurteilten Ausmaß der Aktivitätsstörung sind in Tabelle 58 aufgeführt. Es zeigen sich zwei signifikante negative Korrelationen zwischen der Gesamtzahl supportiver Handlungen 183 der Partner und der Vielseitigkeit der supportiven Handlungen. Angesichts der Kodierung der MKS, wonach ein höherer Wert eine bessere Funktionstüchtigkeit anzeigt, bedeutet dies – in Übereinstimmung mit dem generellen Ergebnismuster – dass die Aktivitätsstörung ein Jahr nach Verletzung umso deutlicher ausgeprägt ist, je mehr supportive Handlungen zu T1 insgesamt geleistet wurden und je vielseitiger diese angelegt waren. Tabelle 58: Korrelationen zwischen Prädiktoren und der Aktivitätsstörung aus Sicht der Partner (MKS-F) (Pearson-Korrelation; N = 36-38) MKS-F Soziale Unterstützung Selbstbeurteilung SU-S .14 Fremdbeurteilung SU-I -.04 Supportive Handlungen Emotional SU-EM .-29 Praktisch SU-PR .-27 Sozial SU-SO -.06 Gesamtscore SU-HA -.34 * Vielseitigkeit SU-V -.39 * Intendierte Unterstützung Sicherung der Rahmenbedingungen SU-F1 .06 Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse SU-F2 .24 Ausgleich krankheitsbedingter Defizite SU-F3 -.17 Einflussnahme auf den Genesungsprozess SU-F4 -.28 Regulierung der eigenen Befindlichkeit SU-F5 .12 Anmerkung. * p < .05 Bezüglich der Korrelationen zwischen den Moderatorvariablen und dem fremdbeurteilten Ausmaß der Aktivitätsstörung ergibt sich lediglich ein signifikanter Zusammenhang zu der Bewertung der Akzeptanz der Hilfe. Die positive Korrelation bedeutet, dass Patienten aus der Sicht ihrer Partner zwölf Monate nach Verletzung eine 184 umso höhere Funktionstüchtigkeit zeigten, je mehr die Partner zu T1 der Ansicht waren, dass der Patient ihre Hilfe akzeptiert. Tabelle 59: Korrelationen (Pearson) zwischen den Moderatorvariablen und der Aktivitätsstörung aus Sicht der Partner MKS-F) (N = 36-38) MKS-F Unterstützungsbezogene Bewertungen Hilfsbedürftigkeit B-H -.23 Wissen B-W .19 Erfolg B-E .14 Akzeptanz B-A .42 ** Befinden Körperliche Beschwerden GBB -.31 Angst BAI -.18 Depressivität BDI -.07 Beziehungsbezogene Merkmale Konfliktpotential KON -.19 Positives dyadisches Coping FDCT-P .00 Negatives dyadisches Coping FDCT-N -.13 Bindung sicher BB-S .07 Bindung abhängig BB-A .17 Beziehungsqualität DAS .17 Familiäre Kohäsion FACES-K .16 Familiäre Adaptabilität FACES-A .08 Anmerkung. ** p < .01 In Tabelle 60 ist das Ergebnis der hierarchischen linearen Regression dargestellt. Dabei erwiesen sich die Vielseitigkeit der Unterstützung und die unterstützungsbezogene Bewertung als signifikante Prädiktoren der durch die Partner beurteilten Aktivitätsstörung des Patienten zu T3. Die Varianzaufklärung betrug 23 %. 185 Tabelle 60: Ergebnis der multiplen linearen Regression der Aktivitätsstörung aus sicht der Partner (N = 38) B SE B ß R2 Supportive Handlungen-Vielseitigkeit SU-V -5.97 2.41 -.39 * .13 Unterstützungsbezogene Bewertung Akzeptanz B-A 13.84 5.67 .36 * .23 Constant 36.06 37.54 Anmerkung. * p < .05 186 1.6.6 Drop-out Analyse Um die Möglichkeit einer systematischen Verzerrung der Ergebnisse aufgrund des Ausfalls eines Teils der initialen Stichprobe zu untersuchen, wurde ein Drop-outAnalyse durchgeführt. Dazu wurden Mittelwertvergleiche für die individuellen und beziehungsbezogenen Variablen durchgeführt. Es ergaben sich mit einer Ausnahme keine signifikanten Unterschiede in diesen Variablen zwischen den Partnern, die an der 6- bzw. 12-Monats-Katamnese teilnahmen und denjenigen, welche die Teilnahme ablehnten. Die Ausnahme fand sich bei der Variable Bindung. Danach wiesen die Partner, die an der 12-Monats-Katamnese teilnahmen, einen sichereren Bindungsstil auf als diejenigen, welche die Teilnahme verweigerten (M = 4.5, SD = .50 vs. M = 4.7, SD = .34; t (69) = -2.07, p < .05). Aufgrund des sehr geringen Unterschiedes in den Mittelwerten sehen wir dieses Ergebnis als unbedeutend an. Zu bedenken ist ferner, dass es sich dabei aufgrund des statistischen Vorgehens (multiple Mittelwertvergleiche) um einen Zufallseffekt handeln kann. 187 1.7 Diskussion und Ausblick Schädigungen des zentralen Nervensystems sind eine wesentliche Ursache für massive und dauerhafte Beeinträchtigungen von Menschen. Unter diesen Schädigungen nimmt das Schädelhirntrauma einen bedeutsamen Platz ein. Jährlich erleiden etwa 300 000 Personen in Deutschland ein SHT. Vor allem die Akutversorgung der mittelschwer- bis schwer- und schwerstgeschädigten Personen erfordert einen hohen personellen und technischen Aufwand, verbunden mit den entsprechenden Kosten. Fortschritte in der Akutmedizin haben dazu geführt, dass mehr und mehr Personen mit schweren Verletzungen im Leben gehalten werden können. Insbesondere für diese Personen folgt der Akutversorgung eine lange Zeit der Rehabilitation. Jedoch ist die Rehabilitation nicht nur für die Schwerstkranken ein anstrengender Weg, auch für Menschen mit weniger schweren Verletzungen ist die Rehabilitation häufig mühsam und führt bei weitem nicht in jedem Fall zu einem Ergebnis, welches dem Funktionsniveau vor der Verletzung entspricht. Häufig bestehen Beeinträchtigungen in kognitiven Funktionen. Daneben weisen viele Patienten eine negative psychische Befindlichkeit auf und klagen über neurobehaviorale Symptome wie Reizbarkeit und Erschöpfbarkeit. Diese und andere Folgen, wie z.B. Persönlichkeitsveränderungen, erschweren die Rückkehr in den Beruf. Die Folgen gestalten den Umgang mit anderen Menschen schwierig, so dass Betroffene häufig eine Reduktion des sozialen Netzwerks erfahren. Für Familienmitglieder folgt nach dem initialen Schock, den viele angesichts einer plötzlich einsetzenden und potentiell lebensbedrohlichen Verletzung erleben, die Frage nach den Folgen. Im Verlauf der Rehabilitation und erst recht nach deren Ende müssen sie sich mit den Auswirkungen des SHT auseinandersetzen. Da die überwiegende Mehrzahl der Patienten von der Familie versorgt wird, steht die Familie vor der Notwendigkeit, sich dem veränderten Funktionsniveau des Betroffenen anzupassen. Die Belastungen, die sich hieraus ergeben, sind Thema zahlreicher Untersuchungen, in denen sich konsistent zeigt, dass primär das Ausmaß der neurobehavioralen Symptome entscheidend ist für das Ausmaß an Belastung von Familienmitgliedern und der Familie als Ganzes. Im Vergleich zu der Frage der Belastungen von Familien nach SHT liegen weit weniger Studien vor, die sich mit der Bedeutung sozialer Faktoren für das 188 Funktionsniveau von SHT-Patienten beschäftigen. Wie unser Literaturüberblick zeigte, ist der Forschungsstand hierzu deutlich unbefriedigend. Betrachtet man die empirischen Untersuchungen zur Rolle sozialer Unterstützung, so zeigen sich insgesamt inkonsistente Ergebnisse. Methodisch gesehen weisen viele Studien Schwächen auf; es liegen in erster Linie Querschnittstudien vor. Erstaunlicherweise ist der Grundtenor in vielen klinisch-theoretischen Arbeiten jedoch sehr positiv – viele Autoren sehen es als belegt an, dass soziale Unterstützung eine wichtige Determinante für die Adaptation des SHT-Patienten darstellt. Bei genauerer Betrachtung der empirischen Arbeiten wird jedoch deutlich, dass ein Großteil der Studien sozialstrukturelle Parameter betrachtet – häufig lediglich den Familienstand als groben Indikator der sozialen Integration. Untersuchungen zu der Relevanz funktionaler Aspekte sozialer Unterstützung – z.B. zur Rolle wahrgenommener sozialer Unterstützung als dem Merkmal, welches die konsistentesten Beziehungen zu Adaptationsmerkmalen aufweist – liegen kaum vor. Andere Facetten des übergeordneten Konstruktes soziale Unterstützung, wie z.B. überfürsorgliches Verhalten, wurde bisher bei SHT nicht untersucht. Hinsichtlich der Untersuchung familiärer Strukturmerkmale ist festzustellen, dass zwar einige Studien Hinweise für einen Einfluss familiärer Charakteristika auf die Adaptation nach SHT aufzeigen, insgesamt ist die Befundlage aber auch hier unzureichend. Kurz zusammengefasst wurde bisher nicht überzeugend aufgezeigt, dass bestimmte soziale Merkmale konsistent einen prädiktiven Wert für das Funktionsniveau von SHT-Patienten aufweisen, so dass hier ein deutlicher Forschungsbedarf besteht. Eine genauere Kenntnis entsprechender Zusammenhänge ist sehr wünschenswert, da Familienmitglieder die zentralen Bezugs- und Betreuungspersonen von SHT-Patienten sind. Somit besteht hier ein Potenzial für eine Sicherung und Optimierung des Rehabilitationserfolgs. Eine entsprechende Edukation und Anleitung von Angehörigen sowie die Bearbeitung von partnerschaftlichen oder familiären Hindernissen für ein positives Rehabilitationsergebnis des Patienten im Rahmen der stationären Rehabilitation könnten dabei entsprechende Ansatzpunkte darstellen. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich das Projekt C4 des RehaForschungsverbundes Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS) – "Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Schädelhirntraumatikern" – mit der Frage, ob soziale 189 Faktoren im Längsschnitt einen prädiktiven Wert hinsichtlich des globalen Funktionsniveaus von SHT-Patienten aufweisen. Wir untersuchten, ob das in der ersten Phase nach der Verletzung gezeigte Hilfeverhalten der Partner der Patienten einen prädiktiven Wert hinsichtlich verschiedener Patientenoutcome-Maße sechs und zwölf Monate nach der Verletzung aufweist. Zusätzlich wurde überprüft, ob dieser Zusammenhang durch andere individuelle und paar- sowie familienbezogene Variablen moderiert wird bzw. ob diese Variablen einen direkten Zusammenhang mit dem Outcome aufweisen. Im Unterschied zu den vorliegenden Studien wurden zusätzlich zu bekannten Teilkonstrukten sozialer Unterstützung sowie gängigen familiären Merkmalen weitere aus unserer Sicht relevante, bisher jedoch bei Studien zur prädiktiven Rolle sozialer Faktoren bei SHT noch nicht untersuchte Konstrukte berücksichtigt. Zum einen handelt es sich dabei um das Konstrukt der intendierten Unterstützung. Ausgehend von der Annahme, dass Personen ein subjektives Konzept bezüglich ihres supportiven Verhaltens aufweisen, untersuchten wir die Bedeutsamkeit verschiedener Funktionen supportiven Handelns. Dazu wurde ein Card Sorting-Verfahren entwickelt, welches die relative Bedeutsamkeit einzelner Ziele verschiedener Funktionsdimensionen abbildet. Die mathematische Verrechnung der den verschiedenen Zielen zugeordneten Rangplätzen erlaubt dann eine Aussage über die Bedeutsamkeit der verschiedenen Funktionen supportiven Handelns. Zum zweiten untersuchten wir tatsächlich geleistete Hilfe. Dazu wurden die Interviews, die mit den Angehörigen geführt wurden, unter Nutzung eines Auswertungsleitfadens ausgewertet. Handlungen, die von Angehörigen explizit im Sinne helfenden Verhaltens genannt wurden oder solche, deren supportiver Charakter sich implizit erschließen ließ, wurden notiert und im weiteren nach einem Kategoriensystem kodiert. Somit unterscheidet sich unsere Studie in mehreren wesentlichen Punkten von denen, die bisher zur Frage der Rolle sozialer Faktoren nach SHT vorlagen. Zum einen verfolgten wir im Unterschied zu der Mehrzahl der existierenden Untersuchungen ein Längsschnittdesign. Auch wenn der erste Untersuchungszeitpunkt nicht unmittelbar nach Eintreten des SHT durchgeführt wurde, so ist der Zeitraum zwischen Verletzung und Erstbefragung der Angehörigen vergleichsweise kurz – im Mittel 5.5 Wochen seit Verletzung des Patienten – so dass die vorliegende Studie als prospektive 190 Longitudinalstudie angesehen werden kann. Aufgrund des vergleichsweise kurzen Abstandes zwischen Verletzung und Erstbefragung ist u.E. die Erhebung von prämorbiden partnerschaftlichen und familiären Merkmalen, wie wir sie vorgenommen haben, hinreichend zuverlässig, obwohl auch in diesem Fall eine Verzerrung bei der retrospektiven Beurteilung des prä-morbiden Niveaus durch die Partner aufgrund der aktuell bestehenden und erst vor kurzem eingetretenen Situation – der Verletzung des Patienten – möglich ist. Jedoch ist die vorliegende Studie u.W. die erste, die längsschnittlich die Bedeutung prä-mobider partnerschaftlicher und familiärer Charakteristika für die Adaptation nach SHT untersucht. Weiterhin führten wir bisher nicht untersuchte soziale Merkmale ein – intendierte Unterstützung und geleistete Unterstützung im Sinne supportiven Verhaltens. Damit legen wir den Schwerpunkt im Unterschied zu den vorliegenden Studien nicht auf sozialstrukturelle sondern auf funktionale Parameter. Außerdem betrachten wir im Unterschied zu der dominierenden Forschungstradition im Bereich soziale Unterstützung nicht den Empfänger sozialer Unterstützung sondern den Hilfeleistenden. Ein weiterer Unterschied zu den meisten der bislang vorliegenden Studien besteht darin, dass wir theoretische Überlegungen zur Wirkungsweise sozialer Faktoren anstellten. Wir gingen davon aus, dass supportives Verhalten entscheidend ist für das Funktionsniveau nach SHT und dass die Wirkung supportiven Verhaltens durch individuelle und familiäre Merkmale moderiert wird. Die Relevanz unseres Untersuchungsansatzes für die Rehabilitationspraxis ergibt sich zum einen durch die betrachteten Parameter, zum anderen durch das Längsschnittdesign. Von besonderer Bedeutung ist u.E. dabei die Berücksichtigung konkreten supportiven Verhaltens. Dieses wurde von uns zum ersten Untersuchungszeitpunkt erhoben, d.h. zu einem Zeitpunkt, als sich der Großteil der Patienten noch in der Akutbehandlung oder bereits in der Rehabilitationsklinik befand. Eine Kenntnis über die Relevanz des zu diesem Zeitpunkt von Angehörigen gezeigten supportiven Verhaltens für das spätere Funktionsniveau des Patienten ist u.E. von Bedeutung, da es gute Interventionsmöglichkeiten eröffnet und für Professionelle in der Rehabilitation vergleichsweise leicht zu erfassen ist, z.B. über direkte Beobachtung und strukturierte Exploration. Ferner sollte das konkrete supportive Verhalten einer 191 therapeutischen Intervention leichter zugänglich sein als paar- oder familienstrukturelle Merkmale. Bevor wir im Weiteren auf die konkreten Ergebnisse eingehen, soll vorweg ein methodischer Aspekt unserer Untersuchung diskutiert werden. Ursprünglich war vorgesehen, ausschließlich SHT-Patienten in die Studie aufzunehmen. Wie wir im Abschnitt 1.5 dargestellt haben, ergab sich aufgrund der zögerlichen Stichprobengewinnung die Notwendigkeit zu Änderungen, um das Studienziel zu erreichen. Daher hatten wir uns entschlossen, zusätzlich zu SHT-Patienten auch Patienten mit einer Subarachnoidalblutung (SAB) und deren Partner in die Studie aufzunehmen. Wie Dombovy, Drew-Cates und Serdans (1998) betonen, handelt es sich bei der SAB zwar um einen Subtyp des Hirninfarktes, allerdings ist eine SAB aufgrund der Pathologie und der resultierenden neurologischen und neuropsychologischen Defizite eher als ein eigenständiges Ereignis aufzufassen, das mehr dem SHT als dem Hirninfarkt ähnelt. Hinweise für eine Übertragbarkeit von Ergebnissen bei SHT und SAB zeigen sich auch in empirischen Studien. So nutzten beispielsweise Buchanan, Elias und Goplen (2000) in einer Studie bei SAB-Patienten und deren Partnern einen Fragebogen zu Persönlichkeitsveränderungen, der ursprünglich in Untersuchungen bei SHT-Patienten eingesetzt wurde (vgl. auch Hellawell, Taylor & Pentland, 1999b). Ebenso liegen Untersuchungen vor, in denen – wie in unserer – SHT- und SABPatienten (sowie deren Partner) betrachtet wurden (Hellawell & Pentland, 2001). Obwohl somit in unserer Studie eine heterogene Patientenstichprobe hinsichtlich der Ätiologie der Hirnschädigung vorliegt, erscheint es plausibel anzunehmen, dass – aufgrund der ähnlichen Defizite – die im Literaturteil dargestellten Ergebnisse bezüglich SHT und Familie im Großen und Ganzen auch für Familien mit einem SAB-Patienten zutreffen dürften. Auch wenn zweifelsfrei eine Einschränkung der externen Validität vorliegt, nehmen wir somit an, dass unsere Ergebnisse im wesentlichen für Familien mit SHT-Patienten (und Familien mit SAB-Patienten) zutreffend sind. 192 Die prä-morbide Beziehung zwischen Partner und Patient Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der vorliegenden Studie gegenüber anderen bislang durchgeführten Untersuchungen ist die Betrachtung prä-morbider partnerschaftlicher und familiärer Merkmale. In unserer Studie wurden die Partner zum ersten Untersuchungszeitpunkt nach dem Konfliktpotential der Beziehung, ihrer Beziehungsqualität, dem generellen dyadischen Coping, ihrem Bindungsstil sowie zu ihrer Einschätzung der familiären Kohäsion (emotionale Bindung) und Adaptabilität (Veränderungsfähigkeit) befragt. Dies wurde von den Partnern retrospektiv für die Zeit vor der Verletzung des Patienten angegeben. Da die Partner im Durchschnitt etwa 5.5 Wochen nach der Verletzung des Patienten befragt wurden, erscheint es angemessen, von einer realistischen Beurteilung der prä-morbiden Beziehungs- und Familienmerkmale durch die Partner auszugehen. Trotz der vergleichsweise kurzen retrospektiven Spanne besteht trotzdem die Möglichkeit eines Bias bei der Beurteilung dieser Merkmale. So könnte aufgrund der potentiellen Lebensbedrohlichkeit der Verletzung des Patienten und des potentiellen Endes der Beziehung, der aktuellen Hilfsbedürftigkeit des Patienten sowie aufgrund des imaginierten zukünftigen Investments in Form von Hilfe und Betreuung die Beziehung positiver beurteilt werden als dies vor der Verletzung geschehen wäre. Dies lässt sich jedoch im vorliegenden Fall nicht kontrollieren. Ein Vergleich der deskriptiven Kennwerte der entsprechenden Verfahren mit Daten aus anderen Untersuchungen liefert keine deutliche Hinweise auf einen Positiv-Bias bei der Beurteilung der prä-morbiden Beziehungs- und Familienmerkmale durch die Partner. Insgesamt ist die Partnerstichprobe durch eine mehrheitlich gute Paarbeziehung mit einem starkem Ausmaß an positivem dyadischen Coping und hohem familiärem Zusammenhalt zu charakterisieren. Inwieweit unsere Stichprobe sich hinsichtlich partnerschaftlicher und familiärer Merkmale von den in anderen Studien betrachteten unterscheidet, ist aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht zu sagen. Die Arbeiten, die speziell partnerschaftliche Merkmale untersuchten, fokussierten in der Regel die langfristigen Veränderungen im Umgang der Partner miteinander und Auswirkungen der Verletzung auf die Beziehungsqualität (vgl. Gosling & Oddy, 1999; Peters et al., 1992). 193 Die Befindlichkeit der Partner zum Zeitpunkt der Erstbefragung Die Partner wurden zum ersten Zeitpunkt im Mittel etwa 5.5 Wochen nach der Verletzung des Patienten befragt, mit einer Spanne von 12 bis 85 Tagen nach der Hirnschädigung. Damit ist unsere Untersuchung eine der Studien mit der frühesten Befragung von Angehörigen von SHT- und SAB-Patienten nach der Verletzung des Patienten. Da die Drop out-Analyse für die Prädiktor- und Moderatorvariablen keinen Unterschied erbringt, beziehen wir uns in den folgenden Ausführungen aufgrund der größeren Datenbasis auf die Substichprobe der T2-Analyse. Betrachtet man somit bei den 58 Partnern der Substichprobe T2 die Prävalenzraten der leichten versus moderaten bis deutlichen psychischen Beeinträchtigung, zeigt sich bei 50 % der Partner eine auffällige Angst- bzw. depressive Symptomatik. Zwar liegt eine identische Gesamtprävalenz für Angst und Depressivität vor, bei genauerer Betrachtung ergeben sich jedoch Unterschiede in den Schweregraden. So zeigen 20.7 % der Partner eine leichte Angstsymptomatik gegenüber 36.2 % an Partnern mit einer leichten depressiven Symptomatik. Dagegen dominiert in der Kategorie mittlere bis deutliche Beeinträchtigung Angst gegenüber Depressivität: Mehr als doppelt so viele Partner sind deutlich durch Angstsymptome als durch depressive Symptome beeinträchtigt (29.3 % versus 13.8 %). Diese Prävalenzraten verdeutlichen, dass in den ersten Wochen nach Verletzung ein hoher Betreuungsbedarf für Angehörige besteht. Dieser betrifft sowohl Angst als auch Depressivität, wobei mehr Personen stärker durch Angst als durch depressive Symptome beeinträchtigt sind. Dies dürfte auf die Unsicherheit in dieser ersten Phase nach der Verletzung zurückzuführen sein, welche die meisten der Partner erleben. Angesichts der Schwierigkeit einer klaren Prognosemitteilung durch Professionelle sieht sich ein Großteil der Partner mit einer unklaren Zukunft bzgl. des Zustandes des Patienten und der Auswirkungen auf den Alltag konfrontiert. Da Unkontrollierbarkeit und Unvorhersagbarkeit relevanter Lebensbereiche wichtige Determinanten der Angstreaktion sind (Margraf & Poldrack, 2000), erscheint die Reaktion von Angehörigen sehr nachvollziehbar. Eventuell sind diese beiden Konstrukte auch entscheidend für die beobachteten interindividuellen Unterschiede – denn schließlich zeigt die Hälfte der Partner keine ausgeprägte Angst und depressive Symptomatik. Zwar wird in der 194 internationalen Literatur darauf hingewiesen, dass sich Angehörige kurz nach der Hirnschädigung des Patienten in einem Schockzustand befinden, angespannt sind und dementsprechend Unterstützung benötigen (Cope & Wolfson, 1994). Aufgrund fehlender Studien zur psychischen Befindlichkeit von Angehörigen in der frühen Phase nach Verletzung ist aber kaum etwas über die relevanten Determinanten des Ausmaßes an psychischen Beschwerden bekannt. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf, sowohl in der unmittelbaren Akut-Phase als auch in der Phase der (Früh)-Rehabilitation. Ein Vergleich unserer Ergebnisse zur psychischen Befindlichkeit von Partnern von Patienten mit einer Hirnschädigung mit der internationalen Literatur ist kaum möglich, da kaum Studien vorliegen, die wie unsere in den ersten Wochen nach Verletzung durchgeführt wurden. In der Studie von Oddy et al. (1978b) wurden 54 Angehörigen einen Monat nach SHT befragt. Die Prävalenzrate bzgl. Depressivität betrug in dieser Untersuchung 39 % und lag somit niedriger als in unserer Studie, wenn das gesamte Schweregradspektrum betrachtet wird. Eine weitere Arbeit, die zu Vergleichszwecken herangezogen werden kann, stammt von Livingston et al. (1985). In ihrer Studie ergaben sich drei Monate nach Verletzung Prävalenzraten von 34 % für Angst und 20 % für Depressivität – somit ebenfalls geringere Raten als in unserer Untersuchung. Allerdings zeigte sich in dieser Untersuchung zu allen Zeitpunkten, d.h. 3, 6 und 12 Monate nach Verletzung, eine höhere Prävalenzrate von Angst gegenüber Depressivität. Dies ist insofern mit unseren Ergebnissen vereinbar, als in unserer Studie mehr Partner deutlich durch Angstsymptome als durch depressive Symptome beeinträchtigt waren. Insgesamt legen diese Ergebnisse nahe, dass Partner von Patienten mit einer Hirnschädigung von Beginn an vor allem durch Angstsymptome beeinträchtigt werden und dass ein Großteil der Partner auch während des ersten Jahres nach der Verletzung darunter leidet. Dies untermauert zum einen die Notwendigkeit eines frühen therapeutischen Angebotes für Angehörige und verdeutlicht zum anderen die Notwendigkeit, Prädiktoren der psychischen Befindlichkeit zu identifizieren, um so ein empirisch fundiertes Betreuungskonzept anbieten zu können. Während die Hälfte der Partner in den ersten Wochen nach der Verletzung des Patienten eine Beeinträchtigung der psychischen Befindlichkeit erlebte, zeigte sich keine erhöhte Beeinträchtigung durch körperliche Beschwerden. Dies ist aus zwei Gründen besonders hervorzuheben. Der eine Aspekt ist methodischer Natur. So sind Angst und 195 Depressivität neben kognitiven und behavioralen auch durch somatische Symptome gekennzeichnet und werden somit in den entsprechenden Erhebungsverfahren abgefragt. Da ein Großteil der Partner durch Angst und Depressivität beeinträchtigt ist, könnte erwartet werden, dass auch eine erhöhte Beeinträchtigung durch körperliche Beschwerden vorliegt, die dann evtl. als Ausdruck einer gemeinsamen Methodenvarianz zu werten wäre. Der zweite Aspekt ist theoretischer Natur. Demnach könnte eine höhere Beeinträchtigung durch körperliche Symptome erwartet werden, da den Partnern nach der Verletzung des Patienten mehr Aufgaben zufallen, z.B. Haushaltsführung und Wahrnehmen von Terminen. Weitere Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit sind die – meist häufigen – Besuche im Krankenhaus. Insgesamt gesehen handelt es sich bei den ersten Wochen nach der Verletzung um eine stressreiche Zeit, die von den meisten Partnern viel Organisation erfordert, insbesondere wenn die Entfernung zum Krankenhaus groß ist, die Anreise problematisch oder wenn die Berufstätigkeit fortgesetzt wird. Diese (anzunehmende) körperliche und, wie gezeigt, tatsächlich vorliegende psychische Belastung könnte auch Ausdruck in körperlichen Beschwerden finden. Dies ist jedoch nicht der Fall, d.h. die Stichprobe als Ganzes ist nicht durch eine erhöhte Prävalenz im Bereich der starken Beeinträchtigung durch körperliche Beschwerden gekennzeichnet. Mögliche Gründe hierfür können sein, dass es den Partner gelingt, Erholungsphasen in ihren Alltag einzubauen oder aber dass aufgrund der hohen Anforderungen und der Orientierung auf den Zustand des Patienten eine Veränderung in der interozeptiven Wahrnehmung einsetzt. So könnte eine externe Aufmerksamkeitsorientierung und die damit verbundene Vermeidung der Wahrnehmung des eigenen körperlichen Befindens es den Angehörigen erleichtern, die vielen Anforderungen während dieser Zeit zu bewältigen. Die Nicht-Wahrnehmung des körperlichen Befindens könnte somit einen stabilisierenden Effekt haben. Ein anderer Grund für das Befundmuster ist eher methodischer Natur. Wir betrachteten in unseren Analysen den Gesamtscore des Gießener Beschwerdebogens. Eventuell besteht jedoch eine selektive Beeinträchtigung des körperlichen Befindens, die bei der Betrachtung des Gesamtbefindens nicht deutlich wird. Dies wird von uns in nachfolgenden Analysen geprüft werden. 196 Unterstützungsbezogene Bewertungen der Partner zum Zeitpunkt der Erstbefragung Die unterstützungsbezogenen Bewertungen der Partner wurden mit vier Items erfragt. Das erste Item bezog sich dabei auf die Hilfsbedürftigkeit des Patienten. Diese Einschätzung lässt sich auch als subjektive Beurteilung des Schweregrads der Verletzung des Patienten auffassen. Es zeigt sich, dass die Partner im Mittel eine hohe Hilfsbedürftigkeit sehen, d.h. die Mehrzahl der Partner erlebt subjektiv einen hohen Schweregrad der Verletzung des Patienten. Als zweite relevante subjektive Einschätzung erhoben wir das Wissen um hilfreiche Unterstützungsmaßnahmen. Je geringer das selbst eingeschätzte Wissen um hilfreiche Handlungen ist, desto hilfloser sollte sich die Person fühlen, was die Wahrscheinlichkeit für inadäquate Hilfsmaßnahmen erhöhen dürfte. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Mehrzahl der Partner der Ansicht ist, "in etwa" zu wissen, was für den Patienten besonders hilfreich ist (Mittelwert von 4.8 auf einer Skala von 1 bis 6), aber nicht in besonders hohem Ausmaß. Dies ist angesichts der Tatsache, dass die meisten Partner sich zum ersten Mal mit dieser Situation konfrontiert sehen, verständlich. Trotzdem sind sich die Partner in überwiegendem Maße recht sicher, dass ihre Hilfe zu dem von ihnen erhofften Erfolg führen wird, wie das Ergebnis der dritten unterstützungsthematischen Bewertung zeigt. Diese subjektive Einschätzung kann auch als Selbstwirksamkeitseinschätzung aufgefasst werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung von supportiven Handlungen ist aber auch die Akzeptanz der Hilfe durch den Empfänger der Hilfe. Insbesondere Menschen mit einem hohen Autonomie- und Kontrollbedürfnis fällt es schwer, sich durch andere helfen zu lassen, was wiederum ein Erschwernis für potentielle Unterstützungspersonen darstellt. Die Angaben der Partner bezüglich dieser Frage zeigen, dass die meisten sich sehr sicher sind, dass ihre Hilfe von dem Patienten akzeptiert wird. Die Ergebnisse der unterstützungsbezogenen Bewertungen legen somit nahe, dass die Partner subjektiv den Patienten als sehr schwer verletzt und als sehr hilfsbedürftig wahrnehmen. Zwar bestehen einige Defizite hinsichtlich des Wissens um adäquate Hilfsmaßnahmen, jedoch schreiben sich die Partner eine recht hohe Selbstwirksamkeit bezüglich ihrer Hilfe zu. Diese sich andeutende Diskrepanz zwischen einem sub-optimalen Wissensstand und einer hohen Selbstwirksamkeit bezüglich der 197 Unterstützung des Patienten kann als ein Mechanismus zur Aufrechterhaltung von Hoffnung und Optimismus, und somit auch als eine Form der Motivierung zu unterstützendem Verhalten, aufgefasst werden. Angesichts der Tatsache, dass die Mehrzahl der Patienten als in hohem Maße hilfsbedürftig eingeschätzt wird, liegt es nahe, dass die Partner sich auf eine längerfristige Betreuung des Patienten einstellen. Eine positive Einschätzung der Selbstwirksamkeit in Bezug auf die eigene Betreuungsqualität dürfte hierbei sehr förderlich sein, um die entsprechende Ausdauer aufzubringen und auch eventuelle Rückschläge zu verkraften. Als Konsequenz für die Reha-Praxis erscheint uns das Ergebnis, wonach ein sub-optimaler Kenntnisstand hinsichtlich adäquater Hilfsmaßnahmen vorliegt, besonders wichtig. Hier ist ein Ansatzpunkt für therapeutische Interventionen zu sehen, die – soweit dies begründet möglich ist – Angehörigen edukativ vermitteln, auf welche Art und Weise sie dem Patienten helfen können. Eine weitere Möglichkeit, Angehörige in ihrem Wissen um angemessene Hilfe zu fördern, dürfte in der Beteiligung von Angehörigen an therapeutischen Maßnahmen, wie z.B. Ergo- und Physiotherapie, liegen. Art, Ausmaß und Determinanten sozialer Unterstützung und supportiven Verhaltens Das zentrale Anliegen dieser Untersuchung war, verschiedene Aspekte der Unterstützung der Partner von hirngeschädigten Patienten zu erfassen und in ihrer Wirkung auf die Adaptation der Patienten zu untersuchen. Dazu wurden kognitive Repräsentationen von eigenem Hilfeverhalten, subjektive Selbsteinschätzungen des Ausmaßes an Unterstützung – sowie Fremdeinschätzungen dieses Ausmaßes – und Fremdbeurteilungen des konkreten supportiven Verhaltens erfasst. Bevor im nächsten Schritt die Wirkung dieser Variablen auf die Adaptation der Patienten diskutiert wird, sollen zunächst die deskriptiven und korrelativen Ergebnisse zu diesen verschiedenen Facetten der Unterstützung näher betrachtet werden. Die von uns mittels des neu entwickelten Card Sortings erhobenen Ziele supportiven Verhaltens und die daraus abgeleitete Bedeutsamkeit von Funktionen supportiven Verhaltens für das eigene Handeln, was wir als intendierte Unterstützung bezeichnen, stellt eine kognitive Repräsentation des eigenen supportiven Verhaltens 198 dar. Das Card Sorting erfordert von den Partnern, Ziele in ihrer Wichtigkeit miteinander zu vergleichen und eine Projektion in die nähere Zukunft vorzunehmen. Somit wird eine Verbindung zwischen den Dimensionen eigenen Handelns, Ziel und Zeit hergestellt. Die kognitive Repräsentation lässt sich dabei in die Aussage fügen: Ich unternehme x, damit ich Ziel y zum Zeitpunkt z erreiche. Wie unsere Ergebnisse zeigen, wird die Funktion 1 – Sicherung der Rahmenbedingungen für die Auseinandersetzung mit krankheitsbedingten Problemen – von den Partnern als am wichtigsten für das eigene supportive Handeln eingeschätzt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Subfunktion "Vermittlung partnerschaftlicher Bindungssicherheit". Die Karten mit den entsprechenden Zielaussagen dieser Subfunktion wurden am häufigsten auf die ersten drei Rangplätze sortiert. Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund der Lebensbedrohung und der potentiell dauerhaften massiven Einschränkungen des Patienten verständlich. Da diese Verletzung potentiell das Ende der Beziehung beinhaltet – durch Tod oder, im weiteren Sinn, durch einen Verlust der kognitiven Fähigkeiten und der Identität des Patienten – steht zuallererst die Beziehung auf dem Spiel. Die Partner möchten daher mit ihrer Hilfe an erster Stelle dem Patienten das Gefühl geben, dass sie für ihn da sind und zu ihm halten. Wie Aymanns (1992) herausstellt, kann bei Patienten mit chronischen Erkrankungen, die Funktionseinbußen oder Veränderungen im körperlichen Aussehen zur Folge haben, die Sorge entstehen, dass das partnerschaftliche Beziehungsgefüge in Frage gestellt werden könnte, wodurch eine existentielle Bedrohung aufgrund des Verlustes an emotionalen Bindungen sowie Selbstwertzweifel entstehen. Herschbach (1985, zit. n. Aymanns, 1992) zeigte in einer Studie bei Krebspatienten, dass bei dieser Erkrankungsgruppe in der Tat solche beziehungsbezogenen Sorgen dominierten. Bei unserer Stichprobe scheint es so zu sein, als würden die Partner durch eine Perspektivenübernahme diese Sorgen auf Seiten der Patienten nachvollziehen können bzw. bei Patienten, die zum Zeitpunkt der Partnerbefragung noch bewusstlos waren, dies als wesentlichen Aspekt ansehen, den es dem Patienten trotz fehlendem Bewusstsein zu vermitteln gilt. Diese Funktion supportiven Verhaltens dominiert deutlich gegenüber den anderen vier von uns erhobenen. Interessanterweise wird die Funktion "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" zum ersten Erhebungszeitpunkt in ihrer Bedeutsamkeit für 199 das eigene supportive Verhalten deutlich weniger wichtig eingeschätzt, wobei jedoch insgesamt gilt, dass eine große Variationsbreite zu beobachten ist. Hinsichtlich des Ausmaßes der sozialen Unterstützung zeigt sich eine gewisse Divergenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung. Dies spiegelt sich auch in der signifikanten, jedoch recht moderaten Korrelation von r = .34 zwischen diesen beiden Merkmalen wider. Während die Partner angeben, in sehr hohem Ausmaß Unterstützung zu leisten, zeigt sich im Fremdrating im Durchschnitt ein mittleres Ausmaß. Diese Diskrepanz kann methodisch bedingt sein, da für das interviewbasierte Fremdrating Definitionen für die einzelnen Abstufungen vorgenommen wurden, die eventuell zu eng gefasst waren. Ein anderer Grund kann darin liegen, dass die Partner in der Interviewsituation teilweise einen zu kleinen Ausschnitt ihres Unterstützungsverhaltens berichteten, was zu einer Unterschätzung im Fremdrating führte. Ein dritter Grund kann in einer tatsächlich bestehenden Diskrepanz zwischen der eigenen Bewertung des Hilfeverhaltens und der "tatsächlich" geleisteten Hilfe gesehen werden. Bezüglich des supportiven Verhaltens, das auf Basis der Äußerungen der Partner fremdeingeschätzt wurde, zeigt sich analog zum Ausmaß der fremdbeurteilten Unterstützung eine niedrige Korrelation mit der Selbsteinschätzung des Ausmaßes an sozialer Unterstützung durch die Partner. Die Korrelation der Selbsteinschätzung mit der Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens ist nicht signifikant. Dagegen zeigen sich signifikante moderate bis hohe Korrelationen zwischen der Fremdeinschätzung des Ausmaßes an sozialer Unterstützung und der Einschätzung der supportiven Handlungen. Dies spricht zum einen für die Validität unserer Erhebungsmethode, zum anderen aber auch für das Vorliegen einer gemeinsamen Methodenvarianz, was sich z.B. in der signifikanten Korrelation von r = .52 zwischen fremdeingeschätztem Ausmaß der sozialen Unterstützung und der Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens zeigt. Inhaltlich ist anzumerken, dass die meisten supportiven Handlungen, die kurz nach der Verletzung durchgeführt wurden, dem Bereich "praktischen Hilfe" zuzuordnen sind. Dies widerspricht im ersten Moment dem Ergebnis, wonach die Partner mit ihrer Hilfe primär eine emotionale Funktion, insbesondere die Vermittlung partnerschaftlicher Bindungssicherheit, verbinden. Hierbei ist jedoch erstens zu bedenken, dass praktische Handlungen leichter zu benennen sind als Handlungen, die eine emotionale Funktion 200 erfüllen. Zweitens gilt, dass dieselbe Handlung mehrere Funktionen erfüllen kann, d.h. auch eine praktische, instrumentell orientierte Handlung kann gleichzeitig dem Ziel dienen, z.B. Bindungssicherheit aufzuzeigen. Drittens muss berücksichtigt werden, dass die supportiven Handlungen sich auf den aktuellen Zeitpunkt der Befragung beziehen, während die Partner sich bei der Erhebung der Ziele ihres supportiven Verhaltens mittels Card Sorting auf die nähere Zukunft beziehen sollten. Dementsprechend zeigen sich auch praktisch keine signifikanten Korrelationen zwischen den Funktionen sozialer Unterstützung und den weiteren Maßen sozialer Unterstützung. Die Ausnahme besteht in einer positiven Korrelation zwischen der Funktion 4, "Einflussnahme auf den Genesungsprozess", und dem supportiven praktischen Verhalten. Hier zeigt sich, dass Partner, die mit ihrer Hilfe vor allem eine Verbesserung des Zustandes des Patienten intendieren, tatsächlich auch mehr praktische Hilfe leisten. Gleichzeitig besteht eine signifikante negative Korrelation zwischen der Funktion 4 und den supportiven emotionalen Handlungen, d.h. Partner, die der Funktion 4 mehr Bedeutung beimessen, leisten weniger Hilfe im emotionalen Bereich. Ein weiteres wesentliches Ergebnis im Zusammenhang mit dem konkreten supportiven Verhalten ist die große Variabilität, die sich in den Angaben der Partner widerspiegelt. So schwankt die Anzahl der genannten Gesamthandlungen zwischen 3 und 31. Bezüglich der Variabilität des supportiven Verhaltens zeigt sich, dass die Handlungen zwischen eine und elf der von uns definierten Kategorien supportiven Verhaltens zuzuordnen waren. Insgesamt weisen alle deskriptiven Ergebnisse zu den verschiedenen von uns erhobenen Aspekten sozialer Unterstützung auf eine hohe interindividuelle Variabilität. Eine wichtige Aufgabe zukünftiger Forschungsbemühungen in diesem Bereich wäre somit die Bestimmung relevanter Determinanten sozialer Unterstützung und supportiven Handelns zur Klärung dieser Varianz. Erste Hinweise auf relevante Einflussfaktoren ergeben sich dabei bereits aus unseren Ergebnissen. Bezüglich der intendierten Unterstützung ergaben sich wenige signifikante Korrelationen. So korrelierte die Funktion 2 – "Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse durch direkte Einflussnahme", welche die Subfunktionen "Bereitstellen von Information und Beratung", "Handlungsmotivierung und Hilfe bei der Handlungsplanung" sowie "Bestärken und Vermittlung von Rückmeldung" beinhaltet – 201 negativ mit zwei unterstützungsthematischen Bewertungen. Je weniger hilfsbedürftig die Partner den Patienten ansahen und je geringer sie den Erfolg ihrer Hilfsmaßnahmen einschätzten, desto weniger bedeutsam wurde diese Funktion für das eigene supportive Handeln beurteilt. Prägnanter ausgedrückt könnte dies lauten: Wenn der Patient es nicht braucht bzw. wenn der Partner es nicht kann, dann wird das Ziel, Unterstützung zu leisten, damit der Patient informiert, motiviert und aktiv ist, in geringerem Maß angestrebt. Daneben zeigte sich eine weitere sinnvolle Korrelation: Je depressiver der Partner war, desto stärker war das Ziel seiner Unterstützung "egoistisch" motiviert, d.h. Unterstützung wurde auch mit dem Ziel geleistet, die eigene Befindlichkeit zu regulieren. Weitere Zusammenhänge zwischen unterstützungsthematischen Bewertungen und sozialer Unterstützung zeigten sich bei der Selbstauskunft des Ausmaßes an sozialer Unterstützung. Ein höheres Wissen um hilfreiche Handlungen, eine stärker ausgeprägte Selbstwirksamkeit und ein wahrgenommenes hohes Ausmaß des Patienten, die Hilfe anzunehmen, standen in Zusammenhang mit einem höheren Ausmaß an sozialer Unterstützung. Ebenso zeigten sich hier positive Korrelationen zu positivem dyadischen Coping, abhängigem Bindungsstil, Beziehungsqualität und familiärer Kohäsion. Es lässt sich schlussfolgern, dass Partner aus Beziehungen, die vor der Verletzung durch einen hohen Zusammenhalt und durch ein hohes Maß an Unterstützung gekennzeichnet waren, auch in der für sie neuen, anstrengenden und bedrohlichen Situation der Hirnschädigung des Patienten ein höheres Maß an Hilfe leisteten, d.h. es zeigt sich ein Effekt des prä-morbiden familiären und dyadischen Funktionsniveaus auf das Ausmaß an Unterstützung nach der Hirnschädigung. Die Tatsache, dass keine signifikante Korrelation zwischen dieser Selbsteinschätzung der sozialen Unterstützung und der funktionalen Selbständigkeit des Patienten (Barthel-Index) besteht, lässt zwei Erklärungen zu: Entweder äußert sich in dieser aktuellen Situation das "dispositionelle" Unterstützungsniveau der Partnerschaft, d.h. Partner, die sowie immer viel Hilfe geben, geben auch nach der Verletzung des Patienten viel Hilfe, und dies unabhängig von der funktionalen Selbständigkeit des Patienten. Oder aber die Einschätzung der Partner bezüglich ihres aktuellen Ausmaßes an sozialer Unterstützung wird durch das kognitive Schema der prä-morbiden Unterstützungserfahrungen (oder auch nur ihrer Repräsentation) beeinflusst, d.h. 202 Partner glauben, dass sie aktuell viel Hilfe leisten, wenn sie auch prä-morbid viel Hilfe geleistet haben (oder dies für sich annehmen). Diese alternativen Erklärungen lassen sich aufgrund unserer Daten nicht definitiv entscheiden, jedoch zeigen unsere Ergebnisse, die mittels Fremdrating gewonnen wurden, dass hier scheinbar unterschiedliche Prozesse vorliegen. So konnten beispielsweise die soeben diskutierten Ergebnisse zwischen Ausmaß sozialer Unterstützung und prä-morbiden sowie unterstützungsthematischen Bewertungen bei den fremdbeurteilten Maßen nicht repliziert werden. Lediglich eine dieser Zusammenhänge zeigte sich bei dem fremdbeurteilten Ausmaß sozialer Unterstützung: Partner, welche die Bereitschaft des Patienten, die Hilfe anzunehmen, als hoch einschätzten, zeigten auch bei der Fremdbeurteilung ein höheres Ausmaß an sozialer Unterstützung. Die wesentlicheren Zusammenhänge bei den fremdbeurteilten Maßen zeigten jedoch zwei andere Variablen: Das Ausmaß der Angst – und der körperlichen Beschwerden – der Partner sowie die funktionale Selbständigkeit des Patienten. Je geringer die funktionale Selbständigkeit des Patienten war und je mehr Angst der Partner erlebte, desto höher war das fremdbeurteilte Ausmaß an sozialer Unterstützung. (Den positiven Zusammenhang zu körperlichen Beschwerden sehen wir hier und im folgenden als Scheinkorrelation an. Diese dürfte darin begründet sein, dass ein Teil der Items des GBB den Items des BAI ähnelt bzw. identisch ist, so dass dieser Zusammenhang ein Epiphänomen darstellt, dass auf die gemeinsame Methodenvarianz zurückzuführen ist.) Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch bezüglich der (fremdbeurteilten) tatsächlich geleisteten supportiven Handlungen. Die Anzahl an emotionalen supportiven Handlungen sowie die Gesamtzahl der supportiven Handlungen war umso höher, je beeinträchtigter der Patient war und je mehr Angst der Partner hatte. Weiterhin zeigte sich, dass die geleistete Unterstützung umso vielseitiger gestaltet wurde, je stärker der Patient in seiner funktionalen Selbständigkeit beeinträchtigt war. Zu bedenken ist dabei, dass die Rater dieser fremdbeurteilten Aspekte sozialer Unterstützung blind waren in Bezug auf alle weiteren hier diskutierten Daten (natürlich mit Ausnahme von Hinweisen, welche die Partner während des Gesprächs gaben), wodurch diese Ergebnisse an Zuverlässigkeit gewinnen. Im Ergebnis zeigen sich somit interessante Hinweise auf eine "Dissoziation" zwischen kognitiv repräsentierter und geleisteter Unterstützung. Unsere Ergebnisse 203 deuten darauf hin, dass hier kein linearer Zusammenhang besteht und dass kognitiv repräsentierter und tatsächlich geleisteter Unterstützung unterschiedliche Determinanten zugrunde liegen. Ferner konnten wir den Einfluss unterstützungsbezogener Bewertungen auf die kognitiv repräsentierte Unterstützung aufzeigen. Diese wurde bisher kaum untersucht, und wenn, dann aus der Perspektive des Empfängers der Unterstützung, wie z.B. Aymanns (1992) in einer Studie bei Krebspatienten. Insgesamt verdeutlichen unsere Ergebnisse zum einen die Notwendigkeit, zwischen kognitiv repräsentierter und geleisteter Unterstützung zu unterscheiden. Zum anderen erscheint es uns notwendig, zukünftig die relevanten Determinanten dieser beiden Aspekte sozialer Unterstützung näher zu untersuchen. Einfluß sozialer Merkmale auf die globale Adaptation der Patienten Die zentrale Fragestellung der Untersuchung betrifft die Frage nach der prädiktiven Valenz sozialer Faktoren für die Adaptation von Patienten mit akuter Hirnschädigung. Die Operationalisierung von Adaptation erfolgte dabei durch eine Reihe von Variablen zu kognitiven, physischen, somatischen, psychischen und sozialen Aspekten. Aufgrund der von uns vorgenommenen Kategorienbildung, bei der Personen, die nicht in der Lage waren, eines der entsprechenden Selbstbeurteilungsverfahren zu bearbeiten, als "sehr deutlich auffällig" klassifiziert wurden, sind unsere Ergebnisse zur Adaptation der Patienten nur schwer mit der internationalen Literatur zu vergleichen. Allerdings zeigt sich auch bei unseren Ergebnissen das im Theorieteil dargestellt Ergebnismuster, wonach viele Personen eine gute funktionale Selbständigkeit erreichen. So wurden in unserer Studie ein halbes Jahr und ein Jahr nach Verletzung jeweils etwa drei Viertel der Patienten als "unauffällig" im Barthel-Index klassifiziert. Entsprechend der internationalen Literatur fanden wir aber gleichzeitig einen hohen Anteil an Personen, die deutliche Beeinträchtigungen im kognitiven, psychischen und sozialen Bereich beklagen. Die korrelativen Analysen zwischen den Prädiktorvariablen und dem aggregierten Adaptationskriterium erbrachten ein konsistentes Muster für beide Katamnesezeitpunkte. Es zeigte sich deutlich, dass das selbstbeurteilte Ausmaß an 204 sozialer Unterstützung keinen Zusammenhang mit der Adaptation des Patienten aufweist. Ebenso ergab sich kein Zusammenhang zwischen dem fremdbeurteilten Ausmaß an sozialer Unterstützung und der Adaptation. Stattdessen zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem konkreten supportiven Verhalten der Angehörigen und der Patientenadapatation, wobei diese Zusammenhänge für die 6Monats-Katamnese deutlicher als für die 12-Monats-Katamnese ausfielen. Für die 6-Monats-Katamnese zeigten alle Subkategorien supportiven Verhaltens eine Assoziation mit dem Outcome bis auf die Subkategorie "supportive praktische Handlungen". In Bezug auf die 12-Monats-Katamnese zeigten sich dann nur noch signifikante Zusammenhänge für die supportiven emotionalen Handlungen und die Vielseitigkeit der supportiven Handlungen. Dieser Unterschied kann zum einen darin begründet liegen, dass der Effekt der supportiven Verhaltensweisen mit der Zeit teilweise nachlässt, zum anderen kann der Unterschied in den korrelativen Zusammenhängen zwischen den beiden Katamnesezeitpunkten der niedrigeren Stichprobe zur 12-Monats-Katamnese geschuldet sein. Betrachtet man die Höhe der Korrelationen der beiden Variablen, die zur 12-Monats-Katamnese nicht mehr signifikant sind, so erscheint uns die zweite Interpretation die nahe Liegendste zu sein. Auffällig ist dabei, dass zu beiden Zeitpunkten die Variable "supportive praktische Handlungen" nicht mit der Adaptation des Patienten korreliert. Dies heißt, dass die supportiven Handlungen, die zum ersten Zeitpunkt kurz nach der Verletzung zahlenmäßig am häufigsten durchgeführt werden und das Hilfeverhalten der Partner sozusagen dominieren, für die langfristige Adaptation des Patienten nicht entscheidend sind. Bezüglich der intendierten Hilfe ergaben sich mit einer Ausnahme keine signifikanten Zusammenhänge mit der Adaptation. Dies ist insofern nicht weiter erstaunlich, als diese Variable Ziele des eigenen supportiven Verhaltens beinhaltet und keine Aussagen über Ausmaß und Häufigkeit von sozialer Unterstützung. Zusammengefasst bedeuten diese korrelativen Ergebnisse, dass das Ausmaß an konkretem supportivem Verhalten der Partner, welches sie kurz nach der Verletzung des Patienten an den Tag legen, im Zusammenhang steht mit der Adaptation der Patienten sechs und zwölf Monate nach der Verletzung. Dieser Zusammenhang ist dergestalt, dass je mehr supportive Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, um so negativer die Adaptation der Patienten ausfällt. Dieses Ergebnis gewinnt dadurch an 205 Bedeutung, dass es sich hierbei um prospektive Zusammenhänge handelt, dass keine gemeinsame Methodenvarianz vorliegt – die supportiven Verhaltensweisen wurden auf Basis von Selbstauskünften der Partner im Interview fremdbeurteilt, während die Outcome-Maße bis auf den Barthel-Index durch die Patienten selbstbeurteilt wurden – und dass die Rater, die die Einschätzung der supportiven Handlungen vornahmen, blind waren gegenüber den Ergebnissen in den Outcome-Maßen. Wie lässt sich dieses Ergebnis nun interpretieren? Unserer Ansicht nach ist eine nahe liegende Erklärung, dass diese Zusammenhänge Ausdruck von überfürsorglichem Verhalten sind. So kann ein hohes Ausmaß an supportivem Verhalten im emotionalen und sozialen Bereich, ebenso wie das Bemühen, dem Patienten in möglichst vielen Aspekten Hilfe zu leisten (siehe den signifikanten Zusammenhang mit der Variabilität des supportiven Verhaltens) die Motivation des Patienten, aktiv an der Verbesserung seines Gesundheitsstatus zu arbeiten, untergraben. Unsere Ergebnisse lassen dabei offen, ob die Partner, die kurz nach der Verletzung ein hohes Ausmaß an supportivem Verhalten zeigen, dies auch im gesamten Verlauf der ersten zwölf Monate nach der Verletzung tun. Dies würde bedeuten, dass der Patient sich während der gesamten Zeit mit überfürsorglichem Verhalten konfrontiert sieht. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Partner im Ausmaß ihrer supportiven Handlungen im Verlauf eines Jahres nachlassen, der Patient jedoch zu Beginn ein hohes Ausmaß an supportivem Verhalten erfahren hat und daher kurz nach der Verletzung die Entwicklung von Eigeninitiative behindert wurde, die sich auch im Verlauf des Jahres nicht kompensatorisch aufholen ließ. Auf jeden Fall deuten die Ergebnisse darauf hin, dass in zukünftigen Studien der Frage von überfürsorglichem Verhalten oder nicht-hilfreichem Verhalten mehr Bedeutung geschenkt werden sollte und dies konkret erfasst werden müsste. Unsere Operationalisierung von supportivem Verhalten stellt kein direktes Maß für überfürsorgliches Verhalten dar, so dass die von uns angestellten Überlegungen als Hypothese aufzufassen sind. Ein weiteres Ergebnis, das sich konsistent für beide Katamnesezeitpunkte zeigt, ist der fehlende familienbezogenen Zusammenhang Variablen und zwischen prä-morbiden Patientenoutcome. Weder beziehungsdie und prä-morbide 206 Beziehungsqualität noch die familiäre Kohäsion wiesen einen Zusammenhang mit dem globalen Outcome des Patienten auf. Hinsichtlich der Bedeutung der prä-morbiden Beziehungsqualität lassen sich keine Vergleiche mit der internationalen Literatur vornehmen, da bislang keine Studien vorlagen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. In Bezug auf familiäre Variablen reiht sich unser nicht-signifikantes Ergebnis in die uneindeutige internationale Befundlage ein. Allerdings gewinnt unser Ergebnis durch das prospektive Design an Aussagekraft gegenüber den Ergebnissen einer Reihe internationaler Studien, die auf Querschnittuntersuchungen basieren. Dagegen wiesen individuelle Merkmale statistisch signifikante Zusammenhänge auf. So zeigten sich bei der 6-Monats-Katamnese Zusammenhänge zwischen der durch die Partner zu T1 eingeschätzte Hilfsbedürftigkeit des Patienten sowie der eigenen Angst (und körperlichen Beschwerden; siehe dazu die Ausführungen oben) kurz nach der Verletzung. Der erste Befund ist recht plausibel, da die eingeschätzte Hilfsbedürftigkeit ein Ausdruck des subjektiven Schweregrads der Verletzung ist, der zumindest in Teilen mit der objektiven Verletzungsschwere übereinstimmen sollte. Somit hatten schwerer verletzte Patienten – aus der Sicht der Partner – sechs Monate später einen schlechteren Outcome. Der zweite Befund kann so interpretiert werden, dass ein höheres Ausmaß an Angst zu einem höheren Ausmaß an supportivem Verhalten führt – wie dies die Korrelationsanalysen nahe legen – und auf diese Weise mit der schlechteren Adaptation nach sechs Monaten in Verbindung steht. Dies ist ein postulierter Wirkmechanismus, der sich nicht direkt durch unsere Ergebnisse belegen lässt und der in weiteren Studien näher überprüft werden sollte. Für die 12-Monats-Katamnese zeigte sich dieser beschriebene Zusammenhang mit der initialen Angst der Partner nicht, stattdessen ergab sich eine signifikante Korrelation mit dem von den Partnern initial eingeschätzten Wissen über hilfreiche Handlungen. Je geringer Partner ihren Kenntnisstand zu T1 beurteilten, desto schlechter war der Outcome der Patienten zwölf Monate nach der Verletzung. Die korrelativen Analysen erbrachten bezüglich dieser Variable keine Zusammenhänge zu dem initial gezeigten supportiven Verhalten. Jedoch ist denkbar, dass Partner, die initial ihr Wissen um die geeigneten Hilfsmaßnahmen als gering beurteilen, auch im Verlauf des Jahres nach der Verletzung häufiger ein Gefühl von Hilflosigkeit angesichts der Situation des Patienten erleben und nicht recht wissen, wie sie dem Patienten helfen können. Dies 207 könnte zur Folge haben, dass sie keine, zu wenig oder auch zu viel Hilfe leisten, oder aber nicht-hilfreiche Handlungen unternehmen. Dieses Ergebnis unterstreicht die bereits oben angesprochene Notwendigkeit, Partnern von hirngeschädigten Patienten bereits in der frühen Phase nach der Verletzung edukativ zur Seite zur stehen und ihnen zu vermitteln, wie sie dem Patienten adäquat helfen können. Um zu erfahren, welche dieser längsschnittlichen Zusammenhänge die größte prädiktive Wirkung aufweisen, führten wir im Folgenden logistische Regressionen durch. Diese erforderten, dass das aggregierte Outcomemaß dichotomisiert wird, was einen gewissen Informationsverlust bedeutet. Da das Outcomekriterium außerdem sich aus mehreren Konstrukten zusammensetzt, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind und unterschiedlich erhoben wurden – zumeist jedoch über Selbstbeurteilung – verzichten wir darauf, die odds ratios der logistischen Regression zu interpretieren. Dies würde angesichts eines komplexen Maßes, dass ein Indikator für die "globale Adaptation" darstellt, aus unserer Sicht eine Überinterpretation bedeuten. Entscheidender ist für uns, welche der Variablen, die längsschnittliche korrelative Zusammenhänge aufweist, einen prädiktiven Wert hat. Bei der Durchführung der logistischen Regression beschränkten wir uns auf die Variablen, die einen statistisch signifikanten korrelativen Zusammenhang aufwiesen, um die Zahl der Variablen angesichts der Stichprobengröße nicht zu groß werden zu lassen. Die von uns hypothetisierte moderierende Funktion der individuellen und beziehungsbezogenen Variablen konnte dabei in keinem Fall aufgezeigt werden. Das Ergebnis der logistischen Regression zeigte einen signifikanten Effekt der Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens, sowohl bei der 6-Monats-Katamnese als auch bei der 12-Monats-Katamnese. Für das Outcome nach sechs Monaten und einem Jahr ist es also entscheidend, in wie vielen Bereichen Partner kurz nach der Verletzung Unterstützung leisten. Der nach der logistischen Regression durchgeführte Mittelwertvergleich erbrachte einen signifikanten Unterschied, wenn auch die Differenz zwischen beiden Gruppen, d.h. Partner von Patienten mit gutem Outcome vs. Partner von Patienten mit einem schlechten Outcome. nicht besonders groß war. Erstaunlich ist nichtsdestotrotz, dass die Vielseitigkeit des Verhaltens, erhoben in der ersten Phase nach der Verletzung, einen prädiktiven Wert bis zu einem Jahr aufweist. Es erscheint 208 somit weniger entscheidend zu sein, wie viel supportives Verhalten Partner zeigen, sondern eher der Umstand, in wie vielen Bereichen die Partner Hilfeverhalten zeigen. Denkbar ist dabei, dass der initial beobachtbare geringe Unterschied zwischen den beiden Gruppen sich im Verlauf des Jahres vergrößert. Dieses Ergebnis passt insofern in unsere bisherige Gesamtdiskussion, als dass das Leisten von Unterstützung in vielen Bereichen eine Form von überfürsorglichem Verhalten darstellen kann. Bedenkt man, dass das supportive Verhalten in Zusammenhang steht mit der Angst der Partner, so ist denkbar, dass die Angst einen Trigger darstellt, möglichst viel zu unternehmen, was leicht dazu führen kann, auch in möglichst vielen Bereichen etwas zu unternehmen. Dies zum einen, um dem Partner zu helfen, und zum anderen vielleicht auch, um etwas gegen die eigenen Angst zu unternehmen. In diesem Sinne würde sich die Vielseitigkeit als Folge eines angstmotivierten – und damit vielleicht auch unreflektierteren und ungerichteteren – hohen Ausmaßes an Hilfeverhalten ergeben. Eine zweite Möglichkeit ergibt sich, wenn man erneut die korrelativen Zusammenhänge betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Vielseitigkeit nicht direkt mit der Angst der Partner korreliert, sondern mit der funktionalen Selbständigkeit des Patienten. In diesem Sinne ergibt es sich als eine logische Folge, dass Patienten, die stärker eingeschränkt sind, auch in mehr Bereichen Unterstützung benötigen, was Ausdruck findet in der höheren Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens. Die beiden dargestellten Wirkweisen schließen sich jedoch u.E. nicht gegenseitig aus. Stattdessen erscheint es uns angemessener, von zwei relevanten Determinanten auszugehen: der "subjektiven" Notwendigkeit zu helfen, die durch die Angst der Partner bedingt wird, und der "objektiven" Notwendigkeit, die durch die funktionale Selbständigkeit des Patienten bedingt wird. Dies führt zu einem hohen Ausmaß an supportivem Verhalten und auch dazu, dass in vielen Bereichen Hilfeverhalten gezeigt wird. Eine höhere Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens wirkt dabei prädiktiv auf das Outcome sechs und zwölf Monate nach der Verletzung. Dies interpretieren wir als ein Ausdruck überfürsorglichen Verhaltens, das die Motivation des Patienten untergräbt und seine Eigenaktivität behindert. Die signifikante Korrelation zwischen der Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens und der initialen funktionalen Selbständigkeit des Patienten weist jedoch 209 noch auf eine andere alternative Interpretation hin. Wenn dem Patienten in vielen Bereichen Hilfe geleistet wird, weil er eine niedrige funktionale Selbständigkeit aufweist, so kann dies als ein angemessenes Hilfeverhalten aufgefasst werden. Demzufolge könnte die Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens, sofern es an der funktionalen Selbständigkeit des Patienten orientiert bleibt, auch während des gesamten Katamnesezeitraumes als angemessen betrachtet werden, und nicht als überfürsorglich. Dies würde allerdings bedeuten, dass die funktionale Selbständigkeit der entscheidende Faktor für das Outcome ist. Der prädiktive Effekt der Vielseitigkeit des supportiven Verhaltens würde verschwinden, sobald die funktionale Selbständigkeit zu T2 und T3 betrachtet werden würde. Gegen die dominierende Rolle der Einschränkung der funktionalen Selbständigkeit spricht jedoch, dass Angehörige – wie im Theorieteil dargestellt – weniger diese patientenseitigen Beeinträchtigungen als Belastung empfinden, als vielmehr die neurobehavioralen Folgen der Verletzung (z.B. Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen, Impulskontrollstörungen). Außerdem zeigen Studien – so auch unsere – dass viele Patienten ein hohes Maß an funktionaler Selbständigkeit wiedergewinnen. Bedenkt man zudem, dass die funktionale Selbständigkeit nur eine unter mehreren Ebenen unseres aggregierten Outcome-Maßes darstellt, und dass das Ausmaß an praktischen supportiven Handlungen keinen Zusammenhang mit dem Outcome aufweist, erscheint es unwahrscheinlich, dass sich das supportive Verhalten während des Katamnesezeitraums ausschließlich an der funktionalen Beeinträchtigung des Patienten orientiert. Somit ist es aus unserer Sicht auch unwahrscheinlich, dass die von uns gefundenen Zusammenhänge auf einen grundlegenden Einfluss der beeinträchtigten funktionalen Selbständigkeit zurückgeführt werden können. Einfluß sozialer Merkmale auf Sub-Kategorien der Adaptation der Patienten Um mögliche bestehende Unterschiede in der Relevanz sozialer Faktoren für verschiedene Bereiche der Adaptation der Patienten aufzudecken und so zu einem differenzierteren Bild zu gelangen, teilten wir das globale aggregierte Outcome-Maß in aggregierte Sub-Kategorien auf. Daraus resultierten die Bereiche Kognition, Psyche, 210 Soma, Aktivität und Erwerbstätigkeit, zum Zeitpunkt T3 zwölf Monate nach der Verletzung zusätzlich auch noch Lebensqualität. Diese Sub-Kategorien zeigten zu beiden Katamnesezeitpunkten fast ausnahmslos hohe Interkorrelationen. Eine Ausnahme dabei stellt die Kategorie Erwerbstätigkeit dar. Diese korrelierte sechs Monate nach der Verletzung lediglich mit der Sub-Kategorie Kognition. Zwölf Monate nach der Verletzung zeigten auch die weiteren Sub-Kategorien signifikante Zusammenhänge mit der Erwerbstätigkeit, allerdings bestand die höchste Korrelation noch immer mit der Sub-Kategorie Kognition. Dieses Ergebnis repliziert internationale Studien, wonach die kognitive Leistungsfähigkeit als eine der wesentlichsten Determinanten für die berufliche Wiedereingliederung nach SHT anzusehen ist. Die durchgeführten Korrelationsanalysen replizieren die oben beschriebenen Zusammenhänge und bestätigen somit das generelle Muster auch für die SubKategorien. Dieses generelle Muster wird jedoch durch einzelne weitere signifikante Assoziationen ergänzt. So zeigen sich – im Unterschied zu der Analyse des globalen Outcome-Maßes – bei der 6-Monats-Katamnese signifikante Zusammenhänge zwischen der Funktion supportiven Verhaltens F4 – Einflussnahme auf den Genesungsprozess – und den aggregierten Subkategorien Psyche, Soma und Aktivität. Diese Variable ist auch ein signifikanter Prädiktor in den jeweiligen logistischen Regressionen, zusätzlich zu den supportiven Verhaltensweisen. Zur Erinnerung: Die supportiven Verhaltensweisen reflektieren das zum Zeitpunkt T1 gezeigte Hilfeverhalten der Angehörigen, die Funktion F4 die Bedeutsamkeit der entsprechenden Funktion für das eigene zukünftige Hilfeverhalten. Das Ergebnis bedeutet somit, dass das Outcome in den Sub-Kategorien sechs Monate nach Verletzung umso schlechter ist, je mehr supportives Verhalten die Partner zu T1 zeigen und je mehr sie zum Zeitpunkt T1 zukünftig mit ihrer Hilfe zur Genesung des Patienten beitragen wollen. Dieses Ergebnis reiht sich in unsere generelle Interpretation ein und liefert einen Hinweis darauf, dass Partner, die aktuell viele supportive Verhaltensweisen zeigen, auch im Verlauf des Katamnesezeitraumes viele Hilfsmaßnahmen unternehmen. Dieses werten wir als Ausdruck von überfürsorglichem Verhalten, das die Eigenaktivität des Patienten behindert, was sich in einem schlechteren Outcome im Bereich Aktivität äußert. Der negative Einfluss auf die Sub-Bereiche Psyche und Soma kann dadurch zustande 211 kommen, dass das überfürsorgliche Verhalten den Selbstwert des Patienten untergräbt und so zu einer schlechteren psychischen Befindlichkeit beiträgt. Die schlechtere psychische Verfassung sowie das niedrigere Aktivitätsniveau des Patienten könnten sich wiederum in einer schlechteren somatischen Verfassung widerspiegeln. Außerdem kann eine negative Bewertung des eigenen Aktivitätsniveaus zu einer schlechteren psychischen Befindlichkeit beitragen. Die hier aufgezeigten Wirkungszusammenhänge sind jedoch als vorläufig anzusehen und bedürfen weiterer Überprüfung. Bei den soeben diskutierten Ergebnissen ist allerdings zu bedenken, dass im Unterschied zu der Prädiktion des globalen Outcomes, bei der die Vielseitigkeit der Hilfsmaßnahmen sich als zentraler Prädiktor erwies, bei den drei diskutierten SubKategorien unterschiedliche Aspekte des supportiven Verhaltens die Prädiktorfunktion übernahmen: bei dem Bereich "Psyche" zwar erneut die Vielseitigkeit der Hilfe, bei dem Bereich "Soma" jedoch das Ausmaß an supportiven sozialen Verhaltensweisen, und bei dem Bereich "Aktivität" das Ausmaß an supportiven emotionalen Verhaltensweisen. Beim letzten Bereich wäre inhaltlich eher die Kategorie supportive praktische Hilfsmaßnahmen zu erwarten gewesen – wobei diese, wie schon beim globalen Kriterium, mit keiner der Sub-Kategorien signifikant korrelierte. Dies könnte darauf hindeuten, dass es weniger entscheidend ist, wie viel die Partner dem Patienten praktisch "abnehmen" – hier könnte es sich evtl. sogar um ein adäquates Ausmaß an Unterstützung handeln, dass nicht negativ auf den Bereich "Aktivität" wirkt. Die negative Wirkung scheint eher durch eine Beeinträchtigung der Motivation oder des Selbstwertes zustande zu kommen, die evtl. negativ auf die Eigenaktivität des Patienten wirkt. Erstaunlicherweise äußert sich ein hohes Ausmaß an supportiven emotionalen Handlungen jedoch nicht in einer schlechteren psychischen Verfassung sechs Monate nach Verletzung. In diesem Fall war, wie gesagt, erneut die Vielseitigkeit der Hilfe entscheidend. Nicht recht zu erklären ist auch der Befund, wonach ein hohes Ausmaß an supportiven sozialen Handlungen negativ auf das Outcome im Bereich der somatischen Befindlichkeit wirkt. Für die Sub-Kategorie "Kognition" ergab sich, dass neben der Vielseitigkeit der Hilfe die unterstützungsbezogene Bewertung des Wissens um adäquate Hilfe entscheidend war. Dies ist insofern nachvollziehbar, als es den Partnern leichter fallen 212 sollte, Patienten praktische und auch emotionale Hilfe zu leisten. Hier dürfte das Wissensdefizit, trotz der neuen und unvertrauten Situation der Hirnschädigung, nicht allzu groß sein, da auch vor der Verletzung Situationen bestanden haben werden, in denen Unterstützung in diesen Bereichen, wenn auch aufgrund anderer Belastungen, geleistet wurde. Hingegen dürften die meisten Partner kaum Erfahrungen damit haben, Unterstützung bei kognitiven Beeinträchtigungen zu leisten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein kurz nach der Verletzung subjektiv empfundenes Wissensdefizit der Partner prospektiv einen negativen Einfluss auf den Outcome im Bereich Kognition aufweist. Zwar haben wir das subjektive Wissen global nur mit einem Item erfasst, jedoch legen unsere Ergebnisse nahe, dass ein subjektiv erlebtes Wissensdefizit bezüglich angemessener Hilfe bei den kognitiven Beeinträchtigungen von entscheidender Bedeutung ist. Dies bedeutet, dass in der Rehabilitation Angehörigen vermittelt werden sollte, wie sie dem Patienten in diesem Bereich helfen können und evtl. auch mit ihm kognitive Funktionen trainieren können. Schließlich gilt es festzustellen, dass für die Sub-Kategorie "Erwerbstätigkeit" kein signifikanter Prädiktor identifiziert werden konnte. Dies ist insofern nachvollziehbar, als nur ein geringer Teil der Patienten sechs Monate nach Verletzung bereits wieder berufstätig ist; die Mehrzahl ist noch arbeitsunfähig. Insgesamt bestätigen die Analysen der Sub-Kategorien den generellen Trend und erhellen einige differenzierte Zusammenhänge, wobei jedoch nicht alle signifikanten Ergebnisse schlüssig interpretiert werden können. Die Analysen der Sub-Kategorien für den Zeitpunkt der 12-Monats-Katamnese bestätigen ebenfalls den generellen Trend. Die Korrelationsanalysen zeigen im Wesentlichen das für die 6-Monats-Katamnese beschriebene Muster. Eine interessante Veränderung besteht jedoch darin, dass die prä-morbide familiäre Kohäsion schwach signifikante Zusammenhänge mit den Subkategorien "Psyche", "Lebensqualität" und "Erwerbstätigkeit" aufweist. Dies deutet auf einen Einfluss prä-morbider familiärer Faktoren hin, der erst längerfristig zum tragen kommt und sich dergestalt äußert, dass eine prä-morbid bestehender niedrigerer familiärer Zusammenhalt längerfristig negativ auf Adaptationsbereiche wirkt. 213 Die Interpretation der logistischen Regressionen wird dadurch erschwert, dass einige der signifikanten Prädiktoren in den nachfolgend durchgeführten Mittelwertvergleichen keine statistische Signifikanz erreichen. Daher sollen im folgenden nur einige Aspekte herausgegriffen werden. Ein wesentliches Ergebnis ist die dominierende Rolle der Vielseitigkeit der Unterstützung, die einen Prädiktor der Subkategorien Kognition, Psyche, Soma und Aktivität darstellt. Für die ersten drei SubKategorien ist dies der einzige Prädiktor. Für den Bereich Psyche ergibt sich zwar zusätzlich ein signifikantes Ergebnis für die familiäre Kohäsion, der nachfolgende Mittelwertvergleich ist jedoch nicht signifikant. Wir werten dies – auch angesichts der korrelativen Ergebnisse – als einen Hinweis darauf, dass prä-morbide familiäre Faktoren möglicherweise erst längerfristig an Bedeutung für bestimmte Bereiche der Adaptation gewinnen. Dies ist insofern plausibel, als dass das Auftreten einer Erkrankung "zentripetal" wirkt und Familien zunächst eher zusammenschweißt. In der ersten Zeit steht die erkrankte Person im Vordergrund und die mit der Erkrankung verbundenen Notwendigkeiten. Konflikte werden im Dienste der Bewältigung der aktuellen Anforderungen beiseite geschoben. Dies ändert sich häufig erst wieder nach einer familiären Adaptationsphase. Dann greifen habituelle familiäre Muster wieder stärker, und in Abhängigkeit des Status des Erkrankten können Probleme, die prä-morbid bereits bestanden, auch intensiviert werden. Dieses Ergebnis unserer Studie weist somit auf die wichtige Frage des langfristigen Einflusses prä-morbider familiärer Merkmale hin. Für die Sub-Kategorie Lebensqualität liefert das Ergebnis einen Hinweis darauf, dass die Gesamtzahl der supportiven Handlungen von Bedeutung ist, was wir im Sinne unserer generellen Interpretation der Bedeutung überfürsorglichen Verhaltens werten. Im Unterschied zur 6-Monats-Katamnese erzielten wir für die 12-Monats-Katamnese einen signifikanten Prädiktor der Kategorie Erwerbstätigkeit. Hier zeigte sich, dass der Status umso niedriger im Sinne unserer Klassifizierung ist, je mehr emotionale supportive Handlungen die Partner zu T1 unternahmen. Dies interpretieren wir, wie schon oben, als einen negativen Einfluss dieser Hilfe auf die Motivation zur Eigenaktivität des Patienten. 214 Prädiktion der Veränderung in der globalen Anpassung Interessanterweise konnten wir keine signifikanten Assoziationen und keine relevanten Prädiktoren der Veränderung im globalen Outcome zwischen T2 und T3 aufdecken. Ein Grund dafür kann in einer relativen Stabilität des Outcome zwischen sechs und zwölf Monate nach Verletzung gesehen werden, so dass eine vergleichsweise geringe Varianz vorliegt. Ebenso besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich die relevanten Prädiktoren für das Outcome und für die Veränderung unterscheiden und wir somit u.U. die für die Veränderung relevanten Merkmale in unserer Studie nicht berücksichtigt haben. Dies sollte daher in zukünftigen Studien näher untersucht werden. Prädiktion der globalen Lebensqualität und der fremdbeurteilten Aktivitätsstörung Neben den aggregierten Outcome-Maßen haben wir als Ergänzung auch zwei weitere Einzelmaße der 12-Monats-Katamnese in die Analysen einbezogen. Dabei handelt es sich zum einen um die globale Lebensqualität, welche die Patienten – sofern es ihnen möglich war – selbst einschätzten. Dieses Maß wurde von uns herangezogen, da in die Beurteilung der globalen Lebensqualität viele Aspekte, die auch in das aggregierte Globalkriterium im Sinne einer mathematischen Verrechnung eingehen, einfließen sollten. Zum zweiten betrachteten wir das Ausmaß der Aktivitätsstörung, wie sie von den Partnern wahrgenommen wird. Dies geschah vor allem unter dem Gesichtspunkt, eine Ergänzung zu den selbstbeurteilten Variablen, die in das globale aggregierte Kriterium einflossen, zu haben und so mögliche weitere Hinweise auf differenzierte Zusammenhänge erzielen zu können. Die Muster der korrelativen Zusammenhänge ähneln sehr dem bereits beschriebenen, mit einer Ausnahme, auf die weiter unten näher eingegangen wird. Auch die relevanten Prädiktoren replizieren im Wesentlichen die bereits bekannten Zusammenhänge. 215 Bezüglich der globalen Lebensqualität erwies sich die Kategorie "supportive emotionale Handlungen" als einziger relevanter Prädiktor. Je weniger Handlungen die Partner in diesem Bereich zu T1 durchführten, desto höher war die globale Lebensqualität der Patienten ein Jahr nach Verletzung. Mit diesem einen Prädiktor konnte eine Varianzaufklärung von 25 % erzielt werden. Als mögliche Wirkungsweisen dieses Zusammenhangs lassen sich hier erneut überfürsorgliches Verhalten sowie Untergrabung der Motivation und des Selbstwertgefühls des Patienten anführen. Hinsichtlich der fremdbeurteilten Aktivitätsstörung konnte durch die beiden signifikanten Prädiktoren eine Varianzaufklärung von 23 % erzielt werden. Bei dem ersten Prädiktor handelt es sich um die Vielseitigkeit der Unterstützung, deren Rolle im Adaptationsprozess wir ausführlich diskutiert haben. Der zweite relevante Prädiktor – die unterstützungsthematische Bewertung der Bereitschaft des Patienten, die geleistete Hilfe anzunehmen – ist spezifisch für dieses Outcome-Maß; in den anderen Analysen hatte diese Variable keinen prädiktiven Wert. Das Ergebnis zeigt, dass das Outcome der Patienten in diesem Bereich ein Jahr nach Verletzung umso besser ist, je mehr die Partner zu T1 der Ansicht sind, dass der Patient bereit ist, ihre Hilfe anzunehmen. Da es sich bei dieser Einschätzung um eine Bewertung handelt, in welche die gemeinsame Beziehungsgeschichte und die Erfahrung um vergangene Belastungssituationen und deren gemeinsame Bewältigung eingehen, könnte diese Einschätzung ein Ausdruck der partnerschaftlichen Nähe, des Verständnisses füreinander und der Perspektivenübernahme darstellen. Insofern wäre diese Variable in gewisser Weise Ausdruck einer positiven Partnerschaft. Diese Interpretation ist gut vereinbar mit dem positiven Zusammenhang, den wir für die Variable familiäre Kohäsion gefunden haben. Diese beiden Ergebnisse würden somit einen Hinweis auf die längerfristige Bedeutung partnerschaftlicher und familiärer Variablen darstellen. Eine andere Interpretation ist, dass Partner, die kurz nach der Verletzung bei dem Patienten eine hohe Bereitschaft sehen, die geleistete Hilfe anzunehmen, im Verlauf des Jahres nach der Verletzung evtl. adäquater Hilfe leisten, besser über Hilfe kommunizieren können, oder aber dass bei diesen Paaren die geleistete Hilfe nicht als Angriff auf den Selbstwert erleben. 216 Da wir keine Analyse für die von den Patienten selbstbeurteilte Aktivitätsstörung durchgeführt haben, ist unklar, ob sich dieses Ergebnis auch dann zeigen würde, wenn man die Patientensicht heranziehen würde. Ebenso ist unklar, ob sich dieses Ergebnis auch bei anderen Outcome-Maßen zeigen würde, wenn sie nur aus der Partnersicht beurteilt wären, oder ob dieses Ergebnis spezifisch ist für die Aktivitätsstörung. Auf jeden Fall deuten die Ergebnisse darauf hin, dass unterschiedliche Perspektiven zu anderen Ergebnissen führen können. Auch deutet dieses Ergebnis, ebenso wie die diskutierte positive Rolle der familiären Kohäsion, darauf hin, dass im Verlauf des Jahres nach der Hirnschädigung "konkurrierende" Prozesse ablaufen. Solchen, die positiv auf die Adaptation wirken, stehen möglicherweise negativ wirkende entgegen. Insgesamt weisen unsere Ergebnisse auf ein komplexes Geschehen im familiären Adaptationsprozess nach akuter Hirnschädigung hin, dessen weitere detaillierte Aufhellung weiterführender Studien bedarf. Methodische Einschränkungen Neben den methodischen Stärken, die unsere Studie aufweist – das prospektive Design sowie der multimethodale und –dimensionale Ansatz – sind auch einige methodische Probleme und Einschränkungen zu nennen. Zum einen mussten einige Instrumente neu entwickelt werden, so z.B. der Fragebogen zum selbstbeurteilten Ausmaß der sozialen Unterstützung oder der Konfliktbogen. Diese lehnen sich an bereits vorhandene Verfahren an, jedoch ist – trotz u.E. gegebener "face validity" – die Validität der Verfahren nicht geprüft. Hinzu kommt, dass einige der eingesetzten Verfahren eine vergleichsweise niedrige interne Konsistenz aufweisen, so z.B. die Skala negatives dyadisches Coping oder die Adaptabilitätsskala des FACES. Allerdings handelt es sich z.B. beim FACES um ein Verfahren, dessen Reliabilität in anderen Studien aufgezeigt werden konnte, wodurch die Stichprobenabhängigkeit der Reliabilität deutlich wird. Angesichts des vorhandenen Forschungseinsatzes der beiden zuletzt genannten Skalen gehen wir davon aus, dass es sich im Grunde um reliable Verfahren handelt. 217 Ein weiterer Punkt betrifft das von uns neu entwickelte Card Sorting. Dieses wurde a priori nach theoretischen Gesichtspunkten entwickelt und teilt damit das Problem aller Maße, die auf diese Weise konstruiert werden: Es ist unklar, ob die theoretische Struktur sich auch empirisch replizieren lässt. Dies müsste in weiteren Studien mit diesem Ansatz weiter untersucht werden. Weiterhin gilt es zu bedenken, dass unsere zentrale Variable, das supportive Verhalten, durch ein Fremdrating von Interviewaussagen gewonnen wurde, die nicht in transkribierter Form vorlagen. Zwar wurden Ankerpunkte und Beispiele definiert, welche die Auswertung des Interviews strukturieren sollten, jedoch besteht natürlich die Möglichkeit von Verfälschungstendenzen. Ein wesentlicher Punkt ist schließlich das aggregierte Outcome-Maß. Um unsere Daten einer statistischen Analyse zugänglich zu machen, die auf Mehrfachtestungen weitestgehend verzichtet, entschlossen wir uns zur Datenaggregation. Dabei entsteht das Problem, dass unterschiedliche Konstrukte und Konstruktebenen miteinander kombiniert werden, so dass letztendlich ein Konglomerat entsteht, welches inhaltlich nicht näher bezeichnet werden kann als "globales Outcome". Um dieses Problem ein wenig zu entschärfen, haben wir als zusätzliche Analysen die Konstrukte weiter ausdifferenziert und auch Einzelkonstrukte zur Analyse herangezogen. Die Analysen erbrachten dabei jeweils ein vergleichbares Muster, so dass unsere zentrale Globalauswertung gestützt wird. Zum Schluss ist als Einschränkung noch die Stichprobenzusammensetzung und –größe zu nennen. Der erste Punkt wurde oben diskutiert. Wir gehen aufgrund bereits vorliegender Untersuchungen davon aus, dass unsere Ergebnisse im Wesentlichen auf Familien mit SHT-Patienten – aber auch auf Familien mit SAB-Patienten – übertragbar sind. Zweifelsfrei wäre eine Replikation der Ergebnisse mit einer homogenen Patientenstichprobe jedoch sehr wünschenswert. Der zweite Punkt betrifft die Stichprobengröße. Aufgrund des Drop-out reduzierte sich diese deutlich im Verlauf der Untersuchung. Die Drop-out-Analyse erbrachte jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen der Gesamtstichprobe und den Katamnesestichproben. Um die Daten möglichst vollständig auszuschöpfen, beschränkten wir uns nicht ausschließlich auf die Paare, für die sowohl T2 als auch T3 Datensätze vorlagen. Daher unterscheidet sich die Stichprobengröße zu beiden Katamnesezeitpunkten. Unter dem Blickwinkel der 218 international durchgeführten Forschung ist festzustellen, dass die Stichprobengröße der vorliegenden Studie vergleichbar ist mit der Mehrzahl dieser Untersuchungen. Insgesamt gesehen weist unsere Studie somit einige Stärken, aber auch bestimmte Schwächen auf. Um die Stabilität unserer Ergebnisse zu prüfen, wären daher Replikationsstudien wünschenswert, in denen idealer weise die in unserer Untersuchung bestehenden Einschränkungen aufgehoben werden würden. Zweifelsfrei handelt es sich dabei jedoch um sehr aufwendige Studien, die viel organisatorische Tätigkeit, Flexibilität und Ausdauer erfordern, wie unsere Untersuchung gezeigt hat. 219 Zusammenfassende Gesamtdiskussion Im Folgenden möchten wir in Kürze die wesentlichen Erkenntnisse unserer Studie herausstellen. • Die Hälfte der Partner weist in den ersten Wochen nach der Verletzung des Patienten eine beeinträchtigte psychische Befindlichkeit auf. • Bezüglich des Schweregrads der psychischen Beschwerden ist ein größerer Teil der Partner stärker durch Angstsymptome als durch depressive Symptome beeinträchtigt. • Es gibt Hinweise darauf, dass die Partner in der ersten Phase nach der Verletzung ihren Wissensstand um adäquate hilfreiche Handlungen als suboptimal beurteilen. • Die Partner geben in der Selbstbeurteilung an, dem Patienten ein hohes Maß an sozialer Unterstützung zu leisten. • Die Zusammenhänge zwischen der selbstbeurteilten sozialen Unterstützung und prämorbiden beziehungs- sowie familiären Merkmalen weisen darauf hin, dass in der Selbstwahrnehmung eine Kontinuität zwischen Unterstützungleistungen, wie sie in Belastungssituationen vor der Verletzung gewährt wurden, und der Unterstützung in der neuen und unbekannten Situation der akuten Hirnschädigung des Patienten hergestellt wird. Partner aus prä-morbid guten und kohäsiven Beziehungen leisten – in der Selbstwahrnehmung – auch nach der Verletzung des Patienten ein hohes Maß an Unterstützung. • Die niedrigen Korrelationen zwischen dem selbstbeurteilten und dem fremdbeurteilten Ausmaß an sozialer Unterstützung weisen auf Diskrepanzen hin, welche die Frage aufwerfen, ob die Selbsteinschätzung der Partner bezüglich ihrer Unterstützung nicht eine kognitive Konstruktion darstellt, die eine – evtl. selbstdienliche oder motivierende – Kontinuität zwischen prä-morbiden Erfahrungen und der gegenwärtigen Situation darstellt. • Es liegen unterschiedliche Korrelate der selbsteingeschätzten und fremdbeurteilten Unterstützung vor, die auf eine "Dissoziation" dieser beiden Konstruktfacetten hindeuten. • Betrachtet man die konkreten supportiven Handlungen, welche die Partner kurz nach der Verletzung durchführen (soweit sie diese im Interview angeben), so zeigen sich 220 vor allem Zusammenhänge zu der funktionalen Selbständigkeit des Patienten und der eigenen Angst der Partner. • Die korrelativen Hinweise werten wir im Sinne "objektiver" und "subjektiver" Notwendigkeit zu supportiven Handlungen. Es werden umso mehr supportive Handlungen gezeigt, je stärker der Patient in seiner funktionalen Selbständigkeit beeinträchtigt ist und mehr Angst der Partner erlebt. • Das selbsteingeschätzte Ausmaß sozialer Unterstützung sowie prä-morbide beziehungs- und familiäre Merkmale haben keinen bzw. nur einen geringen prädiktiven Wert hinsichtlich des Patienten-Outcomes nach sechs bzw. zwölf Monaten. • Als zentrale Prädiktoren des Patienten-Outcomes erweisen sich die fremdbeurteilten Maße supportiven Verhaltens, insbesondere die Vielseitigkeit der supportiven Verhaltensweisen. • Unseres Erachtens besteht die angemessene Interpretation der Befunde unserer Studie darin, die negative Wirkung eines hohen Ausmaßes an supportiven Verhaltensweisen bzw. der Vielseitigkeit des Hilfeverhaltens als einen Ausdruck eines überfürsorglichen Verhaltens zu begreifen, das die Eigenmotivation und den Selbstwert des Patienten beeinträchtigt. • Es ergeben sich Hinweise, dass die Bedeutung prä-morbider familiärer Merkmale, in unserem Fall die familiäre Kohäsion, mit der Zeit seit Verletzung zunimmt. Wahrscheinlich können sich etablierte Interaktionsmuster, die vor der Verletzung bestanden, in ihrem Einfluss erst dann (erneut) manifestieren, wenn die direkten Verletzungsfolgen, wie z.B. Koma, Gedächtnisstörungen u.ä., sowie die Notwendigkeiten, die sich in der ersten Zeit aufgrund der Verletzung ergeben, wie z.B. stationäre Rehabilitation, organisatorische Anforderungen u.ä., in ihrer Dominanz nachlassen. • Weiterhin ergeben sich Hinweise darauf, dass ein initialer suboptimaler Wissensstand der Partner, vor allem im Bereich der Hilfe bei kognitiven Beeinträchtigungen des Patienten, sich längerfristig negativ auswirkt. • Insgesamt weisen die Ergebnisse auf ein komplexes Geschehen im Verlauf des ersten Jahres nach der Verletzung hin. Es kann angenommen werden, dass sowohl angemessene hilfreiche Handlungen als auch unangemessene, überfürsorgliche 221 Handlungen der Partner auftreten. Dies kann parallel oder nachfolgend der Fall sein. Von entscheidender Bedeutung für den Outcome sind jedoch die unangemessenen Handlungen. In unserer Studie ließen sich Prädiktoren eines ungünstigeren Outcomes identifizieren; jedoch keine "positiven" Prädiktoren, d.h. solche, die einen besseren Outcome prädizieren. Aufgrund der von uns vorgenommenen Operationalisierungen lassen sich unsere Ergebnisse nur schwer mit der internationalen Literatur zur Wirkung sozialer Faktoren bei SHT vergleichen. Im Unterschied zu einigen Arbeiten konnten wir einen längsschnittlichen Einfluss sozialer Merkmale auf den Outcome des ersten Jahres nach Verletzung aufzeigen. Wiederum im Unterschied zu einigen vorliegenden Studien konnten wir jedoch nicht die positive Wirkung sozialer Merkmale für den Outcome nachweisen, sondern wir identifizierten Prädiktoren eines ungünstigeren Outcomes. Der schwache Einfluss prä-morbider familiärer Variablen in unserer Studie reiht sich in die divergente internationale Ergebnislage zu dieser Frage ein. Bedenkt man, dass es sich bei der von uns untersuchten Patientengruppe um Menschen handelt, die in den meisten Fällen eine massive biologisch manifeste Schädigung erlitten haben, welche in vielen Fällen zu einer deutlichen Beeinträchtigung nicht nur der physischen sondern auch der kognitiven Fertigkeiten geführt hat, so stellt sich die generelle Frage, ob eine deutliche Wirkung sozialer Faktoren auf den Outcome überhaupt zu erwarten ist. Diese Patientengruppe unterscheidet sich von vielen anderen durch den Umstand, dass Einsichtsfähigkeit, soziale Fertigkeiten, Perspektivenübernahme und andere für das Empfangen und Bewerten von Hilfe – ebenso wie für das Geben von Unterstützung – wichtige Fertigkeiten beeinträchtigt sein können. Sicherlich haben die Schädigung und deren Folgen ein hohes Maß an Eigendynamik. Umso erstaunlicher erscheint es uns, dass Unterstützungsmerkmale, die wir kurz nach der Verletzung des Patienten erhoben haben, einen prädiktiven Wert hinsichtlich des Outcomes sechs und zwölf Monate nach Verletzung haben. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass bestimmte sozialer Merkmale eventuell erst längerfristig von Bedeutung 222 sind. Dies wird in zukünftigen Analysen unserer Daten mit dem vollständigen T3Datensatz sowie den Daten der 18-Monats-Katamnese noch zu prüfen sein. Dass wir keinen positiven Effekt sozialer Merkmale i.S. der Aufdeckung von den Outcome förderlichen Aspekten identifizieren konnten, ist nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Hier ist es notwendig, sich näher mit den verschiedenen Konzepten sozialer Unterstützung auseinander zu setzen. Der häufig replizierte Befund, wonach soziale Unterstützung positiv auf die Adaptation wirkt, beruht in erster Linie auf Studien, die den Empfänger der Unterstützung nach dessen wahrgenommener Verfügbarkeit sozialer Unterstützung befragten. Schon früh konnte dagegen in Studien aufgezeigt werden, dass der tatsächliche Erhalt sozialer Unterstützung aus Empfängersicht mit Kosten verbunden ist und zu einer Beeinträchtigung des Selbstwertes führen kann (vgl. Sarason et al., 2001). Zieht man Studien heran, die soziale Unterstützung aus der Perspektive desjenigen, der die Hilfe leistet, betrachten, so zeigt sich eine Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen. So fanden beispielsweise Bolger et al. (1996) bei Partnern von Brustkrebspatientinnen, dass die von den Partnern geleistete Unterstützung keinen Effekt auf die Adaptation der Patientinnen hatte und dass die geleistete Unterstützung im Verlauf des untersuchten 6-Monats-Zeitraumes abnahm. Die Tatsache, dass wir vor allem "negative" Prädiktoren identifizierten, also solche, die eine Verschlechterung vorhersagten, ist konsistent mit vielen Befunden der Bewältigungsforschung, in der ebenfalls vor allem Prädiktoren identifiziert wurden, die mit einem schlechteren Outcome in Verbindung stehen, und deutlich weniger Prädiktoren eines verbesserten Outcomes (vgl. Muthny, 1997). Ebenso gibt es in der Literatur Beispiele für eine stärkere Bedeutung fremdeingeschätzter Variablen gegenüber Selbsturteilen. Beispielsweise fand Faller (2001), dass vor allem die Intervieweinschätzung des Bewältigungsverhaltens von Lungenkrebspatienten prädiktiv für die Überlebenszeit war. Unsere zentrale Interpretation, wonach die negative Wirkung eines hohen Ausmaßes an supportivem Verhalten als Ausdruck eines überfürsorglichen Verhaltens des Partners zu werten ist, erfährt Stützung durch Studien bei Schlaganfallpatienten und deren Partnern. So konnten Thompson, Sobolew-Shubin, Graham und Janigian (1989) sowie Thompson und Sobolew-Shubin (1993) die negative Wirkung überfürsorglichen 223 Hilfeverhaltens auf die Adaptation der Patienten aufzeigen. Die letztgenannte Studie brachte außerdem das interessante Ergebnis, wonach das überfürsorgliche Verhalten aus einer negativen Haltung des Partners gegenüber dem Patienten resultierte, die umso ausgeprägter war, je mehr kognitive Beeinträchtigungen der Patient aufwies (vgl. auch Thompson et al., 2002). Dies passt zu unserem Befund und unserer Interpretation, wonach ein suboptimaler Wissensstand bezüglich supportivem Verhalten, insbesondere die Hilfe bei kognitiven Beeinträchtigungen des Patienten, als kritisch anzusehen ist. Auch unsere Interpretation, wonach überfürsorgliches Verhalten sich negativ auf die Eigenmotivation des Patienten auswirkt, wird durch Studien bei Schlaganfallpatienten gestützt. So fanden Maclean, Pound, Wolfe und Rudd (2000) in einer qualitativen Studie, dass Schlaganfallpatienten über einen negativen Einfluss überfürsorglichen Verhaltens auf ihre Motivation zur aktiven Teilnahme am Rehabilitationsprozess berichten. Auch wenn unsere Ergebnisse zweifelsfrei der Replikation bedürfen, so lassen sie sich doch zum großen Teil schlüssig und plausibel interpretieren, und es liegen Ergebnisse aus anderen Bereichen vor, welche die von uns vorgenommene Interpretation stützen. Nichtsdestotrotz lässt unsere Studie Fragen unbeantwortet bzw. wirft neue auf. Zu den offenen und weiterführenden Fragen zählen z.B.: • Was sind weitere Determinanten der selbst- bzw. fremdbeurteilten Unterstützung? • Wie wirken sich die unterstützungsbezogene Bewertungen im einzelnen auf den Prozess der Unterstützung aus? • Gibt es moderierende Variablen des Einflusses des supportiven Verhaltens? • Wie stellt sich das supportive Verhalten im weiteren Verlauf, d.h. nach der T1Einschätzung, dar, und hat es eine andere Wirkung auf den weiteren Outcome als das zu T1 erhobene supportive Verhalten? • Wie wirken soziale und verletzungsbezogene Variablen zusammen in ihrer Bedeutung für den Patienten-Outcome? • Welchen Einfluss hat die vom Patienten wahrgenommene Unterstützung auf den Patienten-Outcome? • Welche Wirkung hat das Unterstützen des Patienten auf die Partner selber? 224 Für die Beantwortung dieser und anderer Fragen sind weitere Studien, idealer weise prospektive Längsschnittstudien, notwendig, die sich den Fragen unterschiedlichen Instrumentarien aus unterschiedlichen Perspektiven nähern. mit 225 Implikationen für die Reha-Praxis Wie wir festgestellt haben, bedürfen unsere Ergebnisse der Replikation, jedoch lassen sie sich im Wesentlichen schlüssig interpretieren. Daher möchten wir abschließend einige Implikationen unserer Ergebnisse für die Reha-Praxis aufzeigen. Unserer Ansicht nach lassen sich folgende Empfehlungen treffen: • Partnern von Patienten mit SHT (und SAB) sollten psychotherapeutische Interventionen angeboten werden, die in erster Linie eine Reduktion der Angst bzw. deren angemessene Bewältigung als Ziel haben. • Partnern sollte edukativ vermittelt werden, wie sie dem Patienten adäquat Hilfe leisten können. • Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei auf der Vermittlung von adäquater Hilfe bei den Folgen der kognitiven Beeinträchtigungen bzw. deren adäquaten Trainings liegen. • Partnern sollte vermittelt werden, dass sie eine angemessene, nicht übersteigerte Hilfe bei den physischen Beeinträchtigungen des Patienten leisten sollten. • Partnern sollte vermittelt werden, dass sie möglichst nicht in einen Aktionismus verfallen sollten und in vielen Bereichen Hilfe leisten. Stattdessen sollte herausgearbeitet werden, in welchem Bereich der Patient vor allem Hilfe benötigt und wie diese adäquat zu erbringen ist. Im Endeffekt geht es um die Differenzierung von wesentlichen und notwendigen bzw. Erfolg versprechenden Hilfebereichen. • Mittelfristig erscheint eine initial bestehende hohe Motivation der Partner, Einfluss auf den Genesungsprozess zu nehmen, einen Risikofaktor darzustellen. Unter Anerkennung der Motivation und der Bereitschaft des Partners, ein hohes Investment zu leisten, sollte dabei auf die Gefahr von überfürsorglichem Verhalten aufmerksam gemacht werden. • Mittelfristig scheint eine hohe familiäre Kohäsion sich günstig auf Teilbereiche des Outcomes auszuwirken. Daher sollten Professionelle betroffene Familien auf dieser Dimension einschätzen, um so mögliche "Risikofamilien", die durch ein niedriges Maß an Kohäsion gekennzeichnet sind, frühzeitig zu identifizieren und ihnen ggf. beraterisch zur Seite zu stehen. 226 1.8 Überlegungen und Vorbereitungen zur Umsetzung der Ergebnisse Zur Vorbereitung der Umsetzung der Ergebnisse wurden Zwischenergebnisse der Studie auf verschiedenen Kongressen präsentiert. Ferner wurde durch die Mitarbeiter des Projektes eine Tagung zum Thema "Forschungsperspektiven in der neurologischen Rehabilitation" ausgerichtet. An dieser Tagung stellten verbundübergreifend Projekte zur neurologischen Rehabilitation ihre Ergebnisse vor. Diese wurden ausführlich mit Professionellen aus der Reha-Praxis diskutiert. Wie wir ausgeführt haben, ergeben sich aus den Ergebnissen dieses Projektes Schlussfolgerungen für die Reha-Praxis. Um hier erste Schritte in Richtung Umsetzung der Ergebnisse einzuleiten, wird der Abschlußbericht den Ärztlichen Leitern der beteiligten Reha-Kliniken zur Verfügung gestellt. Ferner soll in einem Treffen von Professionellen der Akut- und Reha-Kliniken über die Ergebnisse und deren Implikationen diskutiert werden. Dabei soll ein Schwerpunkt auf den Sichtweisen der in den Kliniken Tätigen zur Möglichkeit der Implementierung von Vorschlägen dieses Projektes gelegt werden. Diese Diskussion soll auch auf Hindernisse einer Implementierung der von uns angeführten Vorschläge aufmerksam machen. In einem weiteren Schritt beteiligt sich das Projekt C4 bereits an Überlegungen zur Umsetzung der Ergebnisse der Angehörigenprojekte aus den beiden Förderphasen. Es wurde ein gemeinsamer Vorschlag zur Entwicklung von Empfehlungen zur Angehörigenbeteiligung in der Rehabilitation erarbeitet und zur Förderung im Rahmen der 3. Förderphase eingereicht. des Förderschwerpunktes Rehabilitationswissenschaften 227 1.9 Literatur Adams, N. (1996). Positive outcomes in families following traumatic brain injury (TBI). Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 17, 75-84. Allen, K., Linn, R. T., Gutierrez, H. & Willer, B. S. (1994). Family burden following traumatic brain injury. Rehabilitation Psychology, 39, 29-48. Aloni, R. & Katz, S. (1999). A review of the effect of traumatic brain injury on the human sexual response. Brain Injury, 13, 269-280. Angermeyer, M. C., Kilian, R. & Matschinger, H. (2000). WHOQOL-100 und WHOQOLBREF. Handbuch für die deutschsprachigen Versionen der WHO Instrumente zur internationalen Erfassung von Lebensqualität. Göttingen: Hogrefe. Annoni, J. M., Beer, S. & Kesselring, J. (1991). Folgen des schweren Schädel-HirnTraumas. Eine epidemiologische Studie in Kanton St. Gallen. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 121, 207-213. Arbeitsgruppe Schlaganfall Hessen (ASH) (2001). Stationäre Rehabilitationsbehandlung nach Schlaganfall. Ergebnisse der Hessischen Schlaganfall-Datenbank. Aktuelle Neurologie, 28, 413-420. Asendorpf, J. B., Banse, R., Wilpers, S. & Neyer, F. J. (1997). Beziehungsspezifische Bindungsskalen für Erwachsene und ihre Validierung durch Netzwerk- und Tagebuchverfahren. Diagnostica, 43, 289-313. Asikainen, I., Kaste, M. & Sarna, S. (1998). Predicting late outcome for patients with traumatic brain injury referred to a rehabilitation programme: A study of 508 Finnish patients 5 years or more after injury. Brain Injury, 12, 95-107. Aymanns, P. (1992). Krebserkrankung und Familie. Zur Rolle familialer Unterstützung im Prozeß der Krankheitsbewältigung. Bern: Huber. Baker, S. P., O'Neill, B., Haddon, W. & Long, W. B. (1974). The Injury Severity Score: A method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. Journal of Trauma, 14, 187-196. Balck, F. (1982). Zufriedenheit in der Zweierbeziehung. Eine empirische Untersuchung zu Konfliktstrategien zum Konfliktverhalten zufriedener und unzufriedener Freundes- und Ehepaare. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Hamburg. 228 Balck, F. & Dinkel, A. (2000). Schädelhirntrauma und Familie – Auswirkungen einer akuten Hirnschädigung auf Familienmitglieder und das Familiensystem. Kontext, 31, 180-193. Baguley, I., Slewa-Younan, S., Lazarus, R. & Green, A. (2000). Long-term mortality trends in patients with traumatic brain injury. Brain Injury, 14, 505-512. Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G. & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897. Bennett, P. & Connell, H. (1999). Dyadic processes in response to myocardial infarcation. Psychology, Health and Medicine, 4, 45-55. Bodenmann, G. (1992). Bewältigung von Streß in Partnerschaften. Der Einfluß von Belastungen auf die Qualität und Stabilität von Paarbeziehungen. Bern: Huber. Bodenmann, G. (1995). Die Erfassung von dyadischem Coping: Der FDCT-2 Fragebogen. Zeitschrift für Familienforschung, 7, 119-148. Bodenmann, G. (2000). Streß und Coping bei Paaren. Göttingen: Hogrefe. Bolger, N., Foster, M., Vinokur, A. D. & Ng, R. (1996). Close relationships and adjustment to a life crisis: The case of breast cancer. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 283-294. Bombardier, C. H. (2000). Alcohol and traumatic disability. In R. G. Frank & T. R. Elliott (Eds.), Handbook of rehabilitation psychology (pp. 399-416). Washington, DC: American Psychological Association. Bond, F. & Godfrey, H. P. D. (1997). Conversation with traumatically brain-injured individuals: A controlled study of behavioural changes and their impact. Brain Injury, 11, 319-329. Bowen, A., Neumann, V., Conner, M., Tennant, A. & Chamberlain, M. A. (1998). Mood disorders following traumatic brain injury: Identifying the extent of the problem and the people at risk. Brain Injury, 12, 177-190. Brähler, E. & Scheer, J. (1995). Der Gießener Beschwerdebogen. Handbuch (2. Aufl.). Bern: Huber. Brähler, E., Schumacher, J. & Brähler, C. (2000). Erste gesamtdeutsche Normierung der Kurzform des Gießener Beschwerdebogens GBB-24. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 50, 14-21. 229 Brickenkamp, R. (1994). Test d2. Aufmerksamkeits-Belastungs-Test. Handanweisung (8. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. Brooks, N., McKinlay, W., Symington, C., Beattie, A. & Campsie, L. (1987). Return to work within the first seven years of severe head injury. Brain Injury, 1, 5-19. Brooks, N., Symington, C., Beattie, A., Campsie, L., Bryden, J. & McKinlay, W. (1989). Alcohol and other predictors of cognitive recovery after severe head injury. Brain Injury, 3, 235-246. Brown, M. & Vandergoot, D. (1998). Quality of life for individuals with traumatic brain injury: Comparison with others living in the community. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 13, 1-23. Buchanan, K. M., Elias, L. J. & Goplen, G. B. (2000). Differing perspectives on outcome after subarachnoid hemorrhage: The patient, the relative, the neurosurgeon. Neurosurgery, 46, 831-840. Bullinger, M. & Kirchberger, I. (1998). SF-36. Fragebogen zum Gesundheitszustand. Göttingen: Hogrefe. Burke, D., Alexander, K., Baxter, M., Baker, F., Connell, K., Diggles, S., Feldman, K., Horny, A., Kokinos, M., Moloney, D. & Withers, J. (2000). Rehabilitation of a person with severe traumatic brain injury. Brain Injury, 14, 463-471. Cano, A., Weisberg, J. N. & Gallagher, R. M. (2000). Marital satisfaction and pain severity mediate the association between negative spouse responses to pain and depressive symptoms in a chronic pain patient sample. Pain Medicine, 1, 35-43. Chestnut, R. M., Carney, N., Maynard, H., Mann, N. C., Patterson, P. & Helfand, M. (1999). Summary report: Evidence for the effectiveness of rehabilitation for persons with traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 14, 176-188. Chwalisz, K. & Vaux, A. (2000). Social support and adjustment to disability. In R. G. Frank & T. R. Elliott (Eds.), Handbook of rehabilitation psychology (pp. 537-552). Washington, DC: American Psychological Association. Collins, N. L. & Feeney, B. C. (2000). A safe haven: An attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 1053-1073. 230 Collins, R., Lanham, R. A. & Stigford, B. J. (2000). Reliability and validity of the Wisconsin HSS Quality of Life Inventory in traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 1139-1148. Cope, D. N. (1995). The effectiveness of traumatic brain injury rehabilitation: A review. Brain Injury, 9, 649-670. Cope, D. N. & Wolfson, B. (1994). Crisis intervention with the family in the trauma setting. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 9, 67-81. Corrigan, J. D., Bogner, J. A., Mysiw, W. J., Clinchot, D. & Fugate, L. (2001). Life satisfaction after traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 16, 543-555. Corrigan, J. D., Smith-Knapp, K. & Granger, C. V. (1998). Outcomes in the first 5 years after traumatic brain injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 79, 298-305. Coyne, J. C. & Smith, D. A. (1991). Couples coping with myocardial infarcation: A contextual perspective on wives' distress. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 404-412. Crawford, F. C., Vanderploeg, R. D., Freeman, M. J., Sing, S., Waisman, M., Michaels, L., Abdullah, L., Warden, D., Lipsky, R., Salazar, A. & Mullan, M. J. (2002). APOE genotype influences acquisition and recall following traumatic brain injury. Neurology, 58, 1115-1118. Crawford, S., Wenden, F. J. & Wade, D. T. (1996). The Rivermead head injury follow up questionnaire: A study of a new rating scale and other measures to evaluate outcome after head injury. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 60, 510-514. Curran, C. A., Ponsford, J. L. & Crowe, S. (2000). Coping strategies and emotional outcome following traumatic brain injury: A comparison with orthopedic patients. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 1256-1274. Curtiss, G., Klemz, S. & Vanderploeg, R. D. (2000). Acute impact of severe traumatic brain injury on family structure and coping responses. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 1113-1122. 231 Cusick, C. P., Gerhart, K. A. & Mellick, D. C. (2000). Participant-proxy reliability in traumatic brain injury outcome research. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 739-749. Deb, S., Lyons, I. & Koutzoukis, C. (1999). Neurobehavioural symptoms one year after a head injury. British Journal of Psychiatry, 174, 360-365. Deb, S., Lyons, I., Koutzoukis, C., Ali, I. & McCarthy, G. (1999). Rate of psychiatric illness 1 year after traumatic brain injury. American Journal of Psychiatry, 156, 374-378. Dickinson, K., Bunn, F., Wentz, R., Edwards, P. & Roberts, I. (2000). Size and quality of randomised controlled trials in head injury: Review of published studies. British Medical Journal, 320, 1308-1311. Dikmen, S., Machamer, J. & Temkin, N. (1993). Psychosocial outcome in patients with moderate to severe head injury: 2-year follow-up. Brain Injury, 7, 113-124. Dikmen, S. S., Ross, B. L, Machamer, J. E. & Temkin, N. R. (1995). One year psychosocial outcome in head injury. Journal of the International Neuropsychological Society, 1, 67-77. Dikmen, S. S., Temkin, N. R., Machamer, J. E., Holubkov, A. L., Fraser, R. T. & Winn, H. R. (1994). Employment following traumatic head injuries. Archives of Neurology, 51, 177-186. Dinkel, A. & Balck, F. (2001a). Die Bedeutung sozialer Faktoren für die Adaptation nach Schlaganfall und Schädelhirntrauma. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 14, 295-306. Dinkel, A. & Balck, F. (2001b). Familiäre Aspekte bei Schädelhirntrauma im Kindes- und Jugendalter – ein Überblick. Vortrag auf dem Wissenschaftlichen Kongreß der Österreichischen Gesellschaft für Interdisziplinäre Familienforschung (ÖGIF), 23.24.11.2001, Klagenfurt, Österreich. Dombovy, M. L., Drew-Cates, J. & Serdans, R. (1998). Recovery and rehabilitation following subarachnoid hemorrhage. Part I: Outcome after inpatient rehabilitation. Brain Injury, 12, 443-454. Douglas, J. M. & Spellacy, F. J. (1996). Indicators of long-term family functioning following severe traumatic brain injury in adults. Brain Injury, 10, 819-839. 232 Douglas, J. M. & Spellacy, F. J. (2000). Correlates of depression in adults with severe traumatic brain injury and their carers. Brain Injury, 14, 71-88. Eker, C., Schalén, W., Asgeirsson, B., Grände, P.-O., Ranstam, J. & Nordström, C.-H. (2000). Reduced mortality after severe head injury will increase the demands for rehabilitation services. Brain Injury, 14, 605-619. Evans, R. L., Bishop, D. S. & Haselkorn, J. K. (1991). Factors predicting satisfactory home care after stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72, 144-147. Evans, R. L., Bishop, D. S., Matlock, A.-L., Stranahan, S., Halar, E. M. & Noonan, W. C. (1987). Prestroke family interaction as a predictor of stroke outcome. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 68, 508-512. Fann, J. R., Katon, W. J., Uomoto, J. M. & Esselman, P. C. (1995). Psychiatric disorders and functional disability in outpatients with traumatic brain injuries. American Journal of Psychiatry, 152, 1493-1499. Fedoroff, J. P., Starkstein, S. E., Forrester, A. W., Geisler, F. H., Jorge, R. E., Arndt, S. V. & Robinson, R. G. (1992). Depression in patients with acute traumatic brain injury. American Journal of Psychiatry, 149, 918-923. Findler, M., Cantor, J., Haddad, L., Gordon, W. & Ashman, T. (2001). The reliability and validity of the SF-36 health survey questionnaire for use with individuals with traumatic brain injury. Brain Injury, 15, 715-723. Finset, A., Dyrnes, S., Krogstad, J. M. & Berstad, J. (1995). Self-reported social networks and interpersonal support 2 years after severe traumatic brain injury. Brain Injury, 9, 141-150. Frank, R. G. (1994). Families and rehabilitation. Brain Injury, 8, 193-195. Frosch, S., Gruber, A., Jones, C., Myers, S., Noel, E., Westerlund, A. & Zavisin, T. (1997). The long term effects of traumatic brain injury on the roles of caregivers. Brain Injury, 11, 891-906. Galski, T., Tompkins, C. & Johnston, M. V. (1998). Competence in discourse as a measure of social integration and quality of life in persons with traumatic brain injury. Brain Injury, 12, 769-782. Gan, C. & Schuller, R. (2002). Family system outcome following acquired brain injury: Clinical and research perspectives. Brain Injury, 16, 311-322. 233 Gauggel, S. (1998). Manual zur Marburger Kompetenz Skala (MKS). Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Marburg. Gauggel, S. & Peleska, B. (1999). Deskriptive Statistiken zur Marburger Kompetenz Skala (MKS). Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Marburg. Gauggel, S., Peleska, B. & Bode, R. K. (2000). Relationship between cognitive impairments and rated activity restrictions in stroke patients. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 710-723. Gervasio, A. H. & Kreutzer, J. S. (1997). Kinship and family members' psychological distress after traumatic brain injury: A large sample study. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 12, 14-26. Giacino, J. T., Ashwal, S., Childs, N., Cranford, R., Jennett, B., Katz, D. I., Kelly, J. P., Rosenberg, J. H., Whyte, J., Zafonte, R. D. & Zasler, N. D. (2002). The minimally conscious state. Definition and diagnostic criteria. Neurology, 58, 349-353. Gillen, R., Tennen, H., Affleck, G. & Steinpreis, R. (1998). Distress, depressive symptoms, and depressive disorder among caregivers of patients with brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 13, 31-43. Glenn, M. B., O'Neil-Pirozzi, T., Goldstein, R., Burke, D. & Jacob, L. (2001). Depression amongst outpatients with traumatic brain injury. Brain Injury, 15, 811-818. Godfrey, H. P. D., Knight, R. G. & Partridge, F. M. (1996). Emotional adjustment following traumatic brain injury: A stress-appraisal-coping formulation. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 11, 29-40. Goleburn, C. R. & Golden, C. J. (2001). Traumatic brain injury in older adults: A critical review of the literature. Journal of Clinical Geropsychology, 7, 161-187. Gomez-Hernandez, R., Max, J. E., Kosier, T., Paradiso, S. & Robinson, R. G. (1997). Social impairment and depression after traumatic brain injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 78, 1321-1326. Gonser, A. (1992). Prognose, Langzeitfolgen und berufliche Reintegration 2-4 Jahre nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma. Nervenarzt, 63, 426-433. Gosling, J. & Oddy, M. (1999). Rearranged marriages: Marital relationships after head injury. Brain Injury, 13, 785-796. Gray, D. S. (2000). Slow-to-recover severe traumatic brain injury: A review of outcomes and rehabilitation effectiveness. Brain Injury, 14, 1003-1014. 234 Greenspan, A. I., Wrigley, J. M., Kresnow, M., Branche-Dorsey, C. M. & Fine, P. R. (1996). Factors influencing failure to return to work due to traumatic brain injury. Brain Injury, 10, 207-218. Groom, K. N., Shaw, T. G., O'Connor, M. E., Howard, N. I. & Pickens, A. (1998). Neurobehavioral symptoms and family functioning in traumatically brain-injured adults. Archives of Clinical Neuropsychology, 13, 695-711. Groswasser, Z., Cohen, M. & Keren, O. (1998). Female TBI patients recover better than males. Brain Injury, 12, 805-808. Hackl, J. M., Benzer, A., Putz, G., Mitterschiffthaler, G., Prugger, M. & Rumpl, E. (1986). Inwieweit gelingt eine Reintegration bei Patienten nach einem schweren SchädelHirn-Trauma (SHT)? Anaesthesist, 35, 171-176. Hahlweg, K., Klann, N. & Hank, G. (1992). Zur Erfassung der Ehequalität: Ein Vergleich der "Dyadic Adjustment Scale" (DAS) und des "Partnerschaftsfragebogens" (PFB). Diangostica, 38, 312-337. Hallett, J. D., Zasler, N. D., Maurer, P. & Cash, S. (1994). Role change after traumatic brain injury in adults. American Journal of Occupational Therapy, 48, 241-246. Hammell, K. R. W. (1994). Psychosocial outcome following severe closed head injury. International Journal of Rehabilitation Research, 17, 319-332. Hank, G., Hahlweg, K. & Klann, N. (1990). Diagnostische Verfahren für Berater. Materialien zur Diagnostik und Therapie in Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Weinheim: Beltz. Harris, O. A., Colford, J. M., Good, M. C. & Matz, P. G. (2002). The role of hypothermia in the management of severe brain injury. A meta-analysis. Archives of Neurology, 59, 1077-1083. Hautzinger, M., Bailer, M., Worall, H. & Keller, F. (1995). Beck-Depressions-Inventar (BDI). Testhandbuch (2. Aufl.). Bern: Huber. Heinemann, A. W. & Whiteneck, G. G. (1995). Relationships among impairment, disability, handicap, and the life satisfaction in persons with traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 10, 54-63. Hellawell, D. J. & Pentland, B. (2001). Relatives' reports of long term problems following traumatic brain injury or subarachnoid haemorrhage. Disability and Rehabilitation, 23, 300-305. 235 Hellawell, D. J., Taylor, R. & Pentland, B. (1999a). Cognitive and psychosocial outcome following moderate or severe traumatic brain injury. Brain Injury, 13, 489-504. Hellawell, D. J., Taylor, R. & Pentland, B. (1999b). Persisting symptoms and carers' views of outcome following subarachnoid haemorrhage. Clinical Rehabilitation, 13, 333-340. Hibbard, M. R., Bogdany, J., Uysal, S., Kepler, K., Silver, J. M., Gordon, W. A. & Haddad, L. (2000). Axis II psychopathology in individuals with traumatic brain injury. Brain Injury, 14, 45-61. Hibbard, M. R., Uysal, S., Kepler, K., Bogdany, J. & Silver, J. (1998). Axis I psychopathology in individuals with traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 13, 24-39. Hicken, B. L., Putzke, J. D., Novack, T., Sherer, M. & Richards, J. S. (2002). Life satisfaction following spinal cord and traumatic brain injury: A comparative study. Journal of Rehabilitation Research and Development, 39, 359-366. Hickey, A. M., O'Boyle, C. A., McGee, H. M. & McDonald, N. J. (1997). The relationship between post-trauma problem reporting and carer quality of life after severe head injury. Psychology and Health, 12, 827-838. Hillier, S. L., Sharpe, M. H. & Metzer, J. (1997). Outcomes 5 years post-traumatic brain injury (with further reference to neurophysical impairment and disability). Brain Injury, 11, 661-675. Holosko, M. J. & Huege, S. (1989). Perceived social adjustment and social support among a sample of head injured adults. Canadian Journal of Rehabilitation, 2, 145-154. Hoofien, D., Gilboa, A., Vakil, E. & Donovick, P. J. (2001). Traumatic brain injury (TBI) 10-20 years later: A comprehensive outcome study of psychiatric symptomatology, cognitive abilities and psychosocial functioning. Brain Injury, 15, 189-209. Horowitz, A. & Shindelman, L. W. (1983). Reciprocity and affection: Past influences on current caregiving. Journal of Gerontological Social Work, 5, 5-20. Hunt, W. E. & Hess, R. M. (1968). Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. Journal of Neurosurgery, 28, 14-20. 236 Ingebrigtsen, T., Waterloo, K., Marup-Jensen, S., Attner, E. & Romner, B. (1998). Quantification of post-concussion symptoms 3 months after minor head injury in 100 consecutive patients. Journal of Neurology, 245, 609-612. Jennett, B. & Bond, M. (1975). Assessment of outcome after severe brain damage. A practical scale. Lancet, 1, 480-484. Jorge, R. E., Robinson, R. G., Arndt, S. V., Starkstein, S. E., Forrester, A. W. & Geisler, F. (1993a). Depression following traumatic brain injury: A 1 year longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 27, 233-243. Jorge, R. E., Robinson, R. G., Arndt, S. V., Forrester, A. W., Geisler, F. & Starkstein, S. E. (1993). Comparison between acute- and delayed-onset depression following traumatic brain injury. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 5, 43-49. Jorge, R. E., Robinson, R. G., Starkstein, S. E. & Arndt, S. V. (1994). Influence of major depression on 1-year outcome in patients with traumatic brain injury. Journal of Neurosurgery, 81, 726-733. Kallert, T. W. (1994). Das "apallische Syndrom" – zu Notwendigkeit und Konsequenzen einer Begriffsklärung. Nervenarzt, 62, 241-255. Kant, R., Duffy, J. D. & Pivovarnik, A. (1998). Prevalence of apathy following head injury. Brain Injury, 12, 87-92. Kaplan, S. P. (1988). Adaptation following serious brain injury: An assessment after one year. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 19, 3-8. Kaplan, S. P. (1990). Social support, emotional distress, and vocational outcomes among persons with brain injuries. Rehabilitation Counseling Bulletin, 34, 16-23. Kaplan, S. P. (1991). Psychosocial adjustment three years after traumatic brain injury. Clinical Neuropsychologist, 5, 360-369. Kasten, E., Eder, R., Robra, B.-P. & Sabel, B. A. (1997). Der Bedarf an ambulanter neuropsychologischer Behandlung. Zeitschrift für Neuropsychologie, 8, 72-85. Katzlberger, F. & Oder, W. (2000). Psychosoziale Folgen schwerer Hirnverletzungen. Interviews mit Patienten und Angehörigen im Vergleich. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 50, 209-214. 237 Kendall, E. & Terry, D. J. (1996). Psychosocial adjustment following closed head injury: A model for understanding individual differences and predicting outcome. Neuropsychological Rehabilitation, 6, 101-132. Kersel, D. A., Marsh, N. V., Havill, J. H. & Sleigh, J. W. (2001). Psychosocial functioning during the year following severe traumatic brain injury. Brain Injury, 15, 683-696. King, N. S., Crawford, S., Wenden, F. J., Moss, N. E. G. & Wade, D. T. (1995). The Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire: A measure of symptoms commonly experienced after head injury and its reliability. Journal of Neurology, 242, 587-592. King, N. S., Crawford, S., Wenden, F. J., Moss, N. E. G. & Wade, D. T. (1997). Interventions and service need following mild and moderate head injury: The Oxford Head Injury Service. Clinical Rehabilitation, 11, 13-27. Kolakowsky-Hayner, S. A. & Kishore, R. (1999). Caregiver functioning after traumatic brain injury. NeuroRehabilitation, 13, 27-33. Koskinen, S. (1998). Quality of life 10 years after a very severe traumatic brain injury (TBI): The perspective of the injured and the closest relative. Brain Injury, 12, 631-648. Kozloff, R. (1987). Networks of social support and the outcome from severe head injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2, 14-23. Kraus, J. F. & McArthur, D. L. (1996). Epidemiologic aspects of brain injury. Neurologic Clinics, 14, 435-450. Kremer, C., Groden, C., Hansen, H. C., Grzyska, U. & Zeumer, H. (1999). Outcome after endovascular treatment of Hunt and Hess grad IV or V aneurysms. Comparison of anterior versus posterior circulation. Stroke, 30, 2617-2622. Kreuter, M., Dahllöf, A.-G., Gudjonsson, G., Sullivan, M. & Siösteen, A. (1998). Sexual adjustment and its predictors after traumatic brain injury. Brain Injury, 12, 349368. Kreuter, M., Sullivan, M., Dahllöf, A. G. & Siösteen, A. (1998). Partner relationships, functioning, mood and global quality of life in persons with spinal cord injury and traumatic brain injury. Spinal Cord, 36, 252-261. 238 Kreutzer, J. S., Gervasio, A. H. & Camplair, P. S. (1994a). Primary caregivers' psychological status and family functioning after traumatic brain injury. Brain Injury, 8, 197-210. Kreutzer, J. S., Gervasio, A. H. & Camplair, P. S. (1994b). Patient correlates of caregivers' distress and family functioning after traumatic brain injury. Brain Injury, 8, 211-230. Kreutzer, J. S., Seel, R. T. & Gourley, E. (2001). The prevalence and symptom rates of depression after traumatic brain injury: A comprehensive examination. Brain Injury, 15, 563-576. Kuijer, R. C., Ybema, J. F., Buunk, B. P., De Jong, G. M., Thijs-Boer, F. & Sanderman, R. (2000). Active engagement, protective buffering, and overprotection: Three ways of giving support by intimate partners of patients with cancer. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 256-275. LaChapelle, D. L. & Finlayson, M. A. J. (1998). An evaluation of subjective and objective measures of fatigue in patients with brain injury and healthy controls. Brain Injury, 12, 649-659. Laireiter, A. (1992). Begriffe und Methoden der Netzwerk- und Unterstützungsforschung. In A. Laireiter (Hrsg.), Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung. Konzepte, Methoden und Befunde (S. 15-44). Bern: Huber. Landsman, I. S., Baum, C. G., Arnkoff, D. B., Craig, M. J., Lynch, I., Copes, W. S. & Champion, H. R. (1990). The psychosocial consequences of traumatic brain injury. Journal of Behavioral Medicine, 13, 561-581. Lanham, R. A., Weissenburger, J. E., Schwab, K. A. & Rosner, M. M. (2000). A longitudinal investigation of the concordance between individuals with traumatic brain injury and family or friend ratings on the Katz Adjustment Scale. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 1123-1138. Leach, L. R., Frank, R. G., Bouman, D. E. & Farmer, J. (1994). Family functioning, social support and depression after traumatic brain injury. Brain Injury, 8, 599-606. Leathem, J., Heath, E. & Woolley, C. (1996). Relatives' perceptions of role change, social support and stress after traumatic brain injury. Brain Injury, 10, 27-38. 239 Leathem, J. M., Murphy, L. J. & Flett, R. A. (1998). Self- and informant-ratings on the Patient Competency Rating Scale in patients with traumatic brain injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 20, 694-705. Lehmann, U., Gobiet, W., Regel, G., Al Dhaher, S., Krah, B., Steinbeck, K. & Tscherne, H. (1997). Funktionelles, neuropsychologisches und soziales Outcome polytraumatisierter Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma. Unfallchirurg, 100, 552-560. Levin, H. S., Gary, H. E., Eisenberg, H. M., Ruff, R. M., Barth, J. T., Kreutzer, J., High, W. M., Portman, S., Foulkes, M. A., Jane, J. A., Marmarou, A. & Marshall, L. F. (1990). Neurobehavioral outcome 1 year after severe head injury. Experience of the Traumatic Coma Data Bank. Journal of Neurosurgery, 73, 699-709. Levin, H. S., High, W. M., Goethe, K. E., Sisson, R. A., Overall, J. E., Rhoades, H. M., Eisenberg, H. M., Kalisky, Z. & Gary, H. E. (1987). The Neurobehavioural Rating Scale: Assessment of the behavioural sequelae of head injury by the clinician. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 50, 183-193. Lewin, W., Marshall, T. F. & Roberts, A. H. (1979). Long-term outcome after severe head injury. British Medical Journal, 2, 1533-1538. Lezak, M. D. (1978). Living with the characterologically altered brain injured patient. Journal of Clinical Psychiatry, 39, 592-598. Liberman, J. N., Stewart, W. F., Wesnes, K. & Troncoso, J. (2002). Apolipoprotein E ∈4 and short-term recovery from predominantly mild brain injury. Neurology, 58, 1038-1044. Linn, R. T., Allen, K. & Willer, B. S. (1994). Affective symptoms in the chronic stage of traumatic brain injury: A study of married couples. Brain Injury, 8, 135-147. Lippert-Grüner, M., Wedekind, C., Wenzel, S. C., Lefering, R. & Klug, N. (2002). Intermediate and long-term outcome in traumatic brain injury is not influenced by additional multiple organ injury. Zentralblatt für Neurochirurgie, 63, 116-119. Livingston, M. G., Brooks, D. N. & Bond, M. R. (1985). Patient outcome in the year following severe head injury and relatives' psychiatric and social functioning. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 48, 876-881. 240 Lombardi, F., Taricco, M., De Tanti, A., Telaro, E. & Liberati, A. (2002). Sensory stimulation of brain-injured individuals in coma or vegetative state: Results of a Cochrane systematic review. Clinical Rehabilitation, 16, 464-472. MacMillan, P. J., Hart, R. P., Martelli, M. F. & Zasler, N. D. (2002). Pre-injury status and adaptation following traumatic brain injury. Brain Injury, 16, 41-49. Mahoney, F. I. & Barthel, D. W. (1965) Functional evaluation: The Barthel Index. Maryland State Medical Journal, 14, 61-68. Malia, K., Powell, G. & Torode, S. (1995). Personality and psychosocial function after brain injury. Brain Injury, 9, 697-712. Margraf, J. & Ehlers, U. (in Vorbereitung). Das Beck Angst-Inventar. Bern: Huber. Margraf, J. & Poldrack, A. (2000). Angstsymptome in Ost- und Westdeutschland: Eine repräsentative Erhebung. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 29, 157-169. Marsh, N. V., Kersel, D. A., Havill, J. H. & Sleigh, J. W. (1998a). Caregiver burden at 6 months following severe traumatic brain injury. Brain Injury, 12, 225-238. Marsh, N. V., Kersel, D. A., Havill, J. H. & Sleigh, J. W. (1998b). Caregiver burden at 1 year following severe traumatic brain injury. Brain Injury, 12, 1045-1059. Martelli, M. F., Zasler, N. D. & MacMillan, P. (1998). Mediating the relationship between injury, impairment and disability: A vulnerability, stress and coping model of adaptation following brain injury. NeuroRehabilitation, 11, 51-66. Masson, F., Maurette, P., Salmi, L. R., Dartigues, J.-F., Vecsey, J., Destaillats, J.-M. & Erny, P. (1996). Prevalence of impairments 5 years after a head injury, and their relationship with disabilities and outcome. Brain Injury, 10, 487-497. McCleary, C., Satz, P., Forney, D., Light, R., Zaucha, K., Asarnow, R. & Namerow, N. (1998). Depression after traumatic brain injury as a function of Glasgow Outcome Score. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 20, 270-279. McCullagh, S., Ouchterlony, D., Protzner, A., Blair, N. & Feinstein, A. (2001). Predicition of neuropsychiatric outcome following mild traumatic brain injury: An examination of the Glasgow Coma Scale. Brain Injury, 15, 489-497. McGlynn, S. M: & Schacter, D. L. (1987). Unawareness of deficits in neuropsychological syndromes. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 11, 143-205. 241 McKinlay, W .W., Brooks, D. N., Bond, M. R., Martinage, D. P. & Marshall, M. M. (1981). The short-term outcome of severe blunt head injury as reported by relatives of the injured. Journal of Neurology, Neurosurgey, and Psychiatry, 44, 527-533. McMillan, T. M. & Herbert, C. M. (2000). Neuropsychological assessment of a potential "euthanasia" case: A 5 year follow up. Brain Injury, 14, 197-203. McPherson, K. M., Pentland, B. & McNaughton, H. K. (2000). Brain injury – the perceived health of carers. Disability and Rehabilitation, 22, 683-689. Mikulincer, M. & Florian, V. (1997). Are emotional and instrumental supportive interactions beneficial in times of stress? The impact of attachment style. Anxiety, Stress and Coping, 10, 109-127. Minnes, P., Graffi, S., Nolte, M. L., Carlson, P. & Harrick, L. (2000). Coping and stress in Canadian family caregivers of persons with traumatic brain injuries. Brain Injury, 14, 737-748. Mintz, M. C., van Horn, K. R. & Levine, M. J. (1995). Developmental models of social cognition in assessing the role of family stress in relatives' predictions following traumatic brain injury. Brain Injury, 9, 173-186. Moore, A. D., Stambrook, M., Gill, D. D. & Lubusko, A. A. (1992). Differences in longterm quality of life in married and single traumatic brain injury patients. Canadian Journal of Rehabilitation, 6, 89-98. Moore, A. D., Stambrook, M. & Peters, L. (1993). Centripetal and centrifugal family life cycle factors in long-term outcome following traumatic brain injury. Brain Injury, 7, 247-255. Novack, T. A., Alderson, A. L., Bush, B. A., Meythaler, J. M. & Canupp, K. (2000). Cognitive and functional recovery at 6 and 12 months post-TBI. Brain Injury, 14, 987-996. Nochi, M. (1998). "Loss of self" in the narratives of people with traumatic brain injuries: A qualitative analysis. Social Science and Medicine, 46, 869-878. Oddy, M., Humphrey, M. & Uttley, D. (1978a). Subjective impairment and social recovery after closed head injury. Journal of Neurology, Neurousurgery, and Psychiatry, 41, 611-616. Oddy, Humphrey, M. & Uttley, D. (1978b). Stresses upon the relatives of head-injured patients. British Journal of Psychiatry, 133, 507-513. 242 Oder, W., Goldenberg, G. & Deecke, L. (1991). Prognostische Faktoren für die Rehabilitation nach schweren Schädelhirnverletzungen. Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 59, 376-386. Olver, J. H., Ponsford, J. L. & Curran, C. A. (1996). Outcome following traumatic brain injury: A comparison between 2 and 5 years after injury. Brain Injury, 10, 841-848. Orth-Gomér, K., Wamala, S. P., Horsten, M., Schenck-Gustafsson, K., Schneiderman, N. & Mittleman, M. A. (2000). Marital stress worsens prognosis in women with coronary heart disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of the American Medical Association, 284, 3008-3014. Panting, A. & Merry, P. H. (1972). The long-term rehabilitation of severe head injuries with particular reference to the need for social and medical support for the patient's family. Rehabilitation, 82, 33-37. Pelletier, P. M. & Alfano, D. P. (2000). Depression, social support, and family coping following traumatic brain injury. Brain and Cognition, 44, 45-49. Perlesz, A., Kinsella, G. & Crowe, S. (2000). Psychological distress and family satisfaction following traumatic brain injury: Injured individuals and their primary, secondary, and tertiary carers. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 15, 909929. Peters, L. C., Stambrook, M., Moore, A. D. & Esses, L. (1990). Psychosocial sequelae of closed head injury: Effects on the marital relationship. Brain Injury, 4, 39-47. Peters, L. C., Stambrook, M., Moore, A. D., Zubek, E., Dubo, H. & Blumenschein, S. (1992). Differential effects of spinal cord injury and head injury on marital adjustment. Brain Injury, 6, 461-467. Pickett, W., Ardern, C. & Brison, R. J. (2001). A population-based study of potential brain injuries requiring emergency care. Canadian Medical Association Journal, 165, 288-292. Pistrang, N., Clare, L. & Baker, C. (1999). The helping process in couples during recovery from heart attack: A single case study. British Journal of Medical Psychology, 72, 227-237. Ponsford, J. L., Olver, J. H. & Curran, C. (1995). A profile of outcome: 2 years after traumatic brain injury. Brain Injury, 9, 1-10. 243 Pössl, J., Jürgensmeyer, S., Karlbauer, F., Wenz, C. & Goldenberg, G. (2001). Stability of employment after brain injury: A 7-year follow-up study. Brain Injury, 15, 15-27. Proust, F., Toussaint, P., Hannequin, D., Rabenenoina, C., Le Gars, D. & Fréger, P. (1997). Outcome in 43 patients with distal anterior cerebral artery aneurysms. Stroke, 28, 2405-2409. Rapoport, M. J. & Feinstein, A. (2001). Age and functioning after mild traumatic brain injury: The acute picture. Brain Injury, 15, 857-864. Ren, X. S., Skinner, K., Lee, A. & Kazis, L. (1999). Social support, social selection and self-assessed health status: Results from the veterans health study in the United States. Social Science and Medicine, 48, 1721-1734. Rivara, J. B., Jaffe, K. M., Fay, G. C., Polissar, N. L., Martin, K. M., Shurtleff, H. A. & Liao, S. (1993). Family functioning and injury severity as predictors of child functioning one year following traumatic brain injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 74, 1047-1055. Roberts, L. & Counsell, C. (1998). Assessment of clinical outcomes in acute stroke trials. Stroke, 29, 986-991. Romano, M. D. (1974). Family response to traumatic head injury. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6, 1-4. Sander, A. M., Caroselli, J. S., High, W. M., Becker, C., Neese, L. & Scheibel, R. (2002). Relationship of family functioning to progress in a post-acute rehabilitation programme following traumatic brain injury. Brain Injury, 16, 649-657. Sander, A. M., Kreutzer, J. S., Rosenthal, M., Delmonico, R. & Young, M. E. (1996). A multicenter longitudinal investigation of return to work and community integration following traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 11, 70-84. Santoro, J. & Spiers, M. (1994). Social cognitive factors in brain injury-associated personality change. Brain Injury, 8, 265-276. Santos, M. E., Castro-Caldas, A. & De Sousa, L. (1998). Spontaneous complaints of long-term traumatic brain injured subjects and their close relatives. Brain Injury, 12, 759-767. Sarason, B. R., Sarason, I. G. & Gurung, R. A. R. (2001). Close personal relationships and health outcomes: A key to the role of social support. In B. R. Sarason & S. 244 Duck (Eds.), Personal relationships: Implications for clinical and community psychology (pp. 15-41). Chichester: Wiley. Sbordone, R. J., Seyranian, G. D. & Ruff, R. M. (1998). Are the subjective complaints of traumatically brain injured patients reliable? Brain Injury, 12, 505-515. Sbordone, R. J., Seyranian, G. D. & Ruff, R. M. (2000). The use of significant others to enhance the detection of malingerers from traumatically brain injured-patients. Archives of Clinical Neuropsychology, 15, 465-477. Schirmer, M. (1994). Neurochirurgie. Eine Einführung (8. Aufl.). München: Urban und Schwarzenberg. Schulz, K.-H., Schulz, H., Schulz, O. & von Kerekjarto, M. (1998). Familienstruktur und psychosozialer Stress in Familien von Krebspatienten. In U. Koch & J. Weis (Hrsg.), Krankheitsbewältigung bei Krebs und Möglichkeiten der Unterstützung (S. 141-160). Stuttgart: Schattauer. Schulz, K.-H., Schulz, H., Schulz, O. & von Kerekjarto, M. (1998b). Krebspatienten und ihre Familien. Wechselseitige Belastung und Unterstützung. Stuttgart: Schattauer. Schwarzer, R. & Leppin, A. (1991). Social support and health: A theoretical and empirical overview. Journal of Social and Personal Relationships, 8, 99-127. Seel, R. T., Kreutzer, J. S. & Sander, A. M. (1997). Concordance of patients' and family members' ratings of neurobehavioral functioning after traumatic brain injury. Archives of Phyiscal Medicine and Rehabilitation, 78, 1254-1259. Signorini, D. F., Andrews, P. J. D., Jones, P. A., Wardlaw, J. M. & Miller, J. D. (1999a). Predicting survival using simple clinical variables: A case study in traumatic brain injury. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 66, 20-25. Signorini, D. F., Andrews, P. J. D., Jones, P. A., Wardlaw, J. M. & Miller, J. D. (1999a). Adding insult to injury: The prognostic value of early secondary insults for survival after traumatic brain injury. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 66, 26-31. Simpson, G. & Tate, R. (2002). Suicidality after traumatic brain injury: Demographic, injury and clinical correlates. Psychological Medicine, 32, 687-697. Simpson, J. A., Rholes, W. S., Orina, M. M. & Grich, J. (2002). Working models of attachment, support giving, and support seeking in a stressful situation. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 598-608. 245 Skell, R. L., Johnstone, B., Schopp, L., Shaw, J. & Petroski, G. F. (2000). Neuropsychological predictors of distress following traumatic brain injury. Brain Injury, 14, 705-712. Smith, J. L., Magill-Evans, J. & Brintnell, S. (1998). Life satisfaction following traumatic brain injury. Canadian Journal of Rehabilitation, 11, 131-140. Sokol, K., Heinemann, A. W., Bode, R. K., Shin, J. Y. & de Venter, L. (1999). Community participation after TBI: Factors predicting return to work and life satisfaction [Abstract]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80, 974. Spence, S. E., Godfrey, H. P. D., Knight, R. G. & Bishara, S. N. (1993). First impression count: A controlled investigation of social skill following closed head injury. British Journal of Clinical Psychology, 32, 309-318. Steadman-Pare, D., Colantonio, A., Ratcliff, G., Chase, S. & Vernich, L. (2001). Factors associated with perceived quality of life many years after traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 16, 330-342. Steinmeier, R., Bonk, C., May, S.-A. & Reiss, G. (2001). Prognosefaktoren beim Schädel-Hirn-Trauma. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 14, 265-269. Sulter, G., Steen, C. & De Keyser, J. (1999). Use of the Barthel Index and Modified Rankin Scale in acute stroke trials. Stroke, 30, 1538-1541. Supprian, T., Müller, U., Hofmann, E. & Becker, T. (1996). Psychiatrische Folgeerkrankungen nach Schädel-Hirn-Trauma – eine Literaturübersicht. Psychiatrische Praxis, 23, 161-167. Tate, R. L., Fenelon, B., Manning, M. L. & Hunter, M. (1991). Patterns of neuropsychological impairment after severe blunt head injury. Journal of Nervous and Mental Disease, 179, 117-126. Tate, R. L., Lulham, J. M., Broe, G. A., Strettles, B. & Pfaff, A. (1989). Psychosocial outcome for the survivors of severe blunt head injury: The results from a consecutive series of 100 patients. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 52, 1128-1134. Teasdale, G. M. (1995). Head injury. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 58, 526-539. 246 Teasdale, G. & Jennett, B. (1974). Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet, 2, 81-84. Teasdale, T. W. & Engberg, A. W. (2001). Suicide after traumatic brain injury: A population study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 71, 436440. Thompson, S. C., Galbraith, M., Thomas, C., Swan, J. & Vrungos, S. (2002). Caregivers of stroke patient family members: Behavioral and attitudinal indicators of overprotective care. Psychology and Health, 17, 297-312. Thompson, S. C. & Shobolew-Shubin, A. (1993). Overprotective relationships: A nonsupportive side of social networks. Basic and Applied Social Psychology, 14, 363-383. Tyerman, A. & Humphrey, M. (1984). Changes in self-concept following severe head injury. International Journal of Rehabilitation Research, 7, 11-23. van der Naalt, J., van Zomeren, A. H., Sluiter, W. J. & Minderhoud, J. M. (1999). One year outcome in mild to moderate head injury: The predictive value of acute injury characteristics related to complaints and return to work. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 66, 207-213. van der Naalt, J., van Zomeren, A. H., Sluiter, W. J. & Minderhoud, J. M. (2000). Acute behavioural disturbances related to imaging studies and outcome in mild-tomoderate head injury. Brain Injury, 14, 781-788. van Reekum, R., Bolago, I., Finlayson, M. A. J., Garner, S. & Links, P. S. (1996). Psychiatric disorders after traumatic brain injury. Brain Injury, 10, 319-327. van Zomeren, A. H. & van den Burg, W. (1985). Residual complaints of patients two years after severe head injury. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 48, 21-28. von Wedel-Parlow, F.-K. & Kutzner, M. (1999). Neurologische Frührehabilitation. In P. Frommelt & H. Grötzbach (Hrsg.), Neurorehabilitation. Grundlagen, Praxis, Dokumentation (S. 65-89). Berlin: Blackwell. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (1996). Rahmenkonzept zur medizinischen Rehabilitation in der gesetzlichen Rentenversicherung. Empfehlungen des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger. Deutsche Rentenversicherung, 51, 633-665. 247 Vilkki, J., Ahola, K., Holst, P., Öhman, J., Servo, A. & Heiskanen, O. (1994). Prediction of psychosocial recovery after head injury with cognitive tests and neurobehavioral ratings. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 16, 325-338. von Schlippe, A. (1986). Systemisches Bewältigungspotential in Familien mit einem asthmakranken Kind. Forschungsberichte aus dem Fachbereich Psychologie (Nr. 52), Universität Osnabrück. Wade, D. T. (2002). Rehabilitation is a way of thinking, not a way of doing. Clinical Rehabilitation, 16, 579-581. Wade, D. T. & de Jong, B. A. (2000). Recent advances in rehabilitation. British Medical Journal, 320, 1385-1388. Wagner, M. T., Williams, J. M. & Long, C. J. (1990). The role of social networks in recovery from head trauma. International Journal of Clinical Neuropsychology, 12, 131-137. Wallace, C. A., Bogner, J., Corrigan, J. D., Clinchot, D., Mysiw, W. J. & Fugate, L. P. (1998). Primary caregivers of persons with brain injury: Life change 1 year after injury. Brain Injury, 12, 483-493. Wallesch, C.-W. & Hasenbein, U. (2001). Assessment in der neurologischen Rehabilitation. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 14, 270274. Webb, C. R., Wrigley, M., Yoels, W. & Fine, P. R. (1995). Explaining quality of life for persons with traumatic brain injuries 2 years after injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 76, 1113-1119. Williamson, D. J. G., Scott, J. G. & Adams, R. L. (1996). Traumatic brain injury. In R. L. Adams, O. A. Parsons, J. L. Culbertson & S. J. Nixon (Eds.), Neuopsychology for clinical practice. Etiology, assessment, and treatment of common neurological disorders (pp. 9-64). Washington, DC: American Psychological Association. Williamson, G. M. & Schulz, R. (1995). Caring for a family member with cancer: Past communal behavior and affective reactions. Journal of Applied Social Psychology, 25, 93-116. 248 Wilson, B., Cockburn, J. & Baddeley, A. (1994). Der Rivermead Behavioural Memory Test. Deutsche Übersetzung der zweiten Auflage des englischen Originaltests. Bury St Edmunds: Thames Valley Test Company. Wilson, J. T. L., Pettigrew, L. E. L. & Teasdale, G. M. (2000). Emotional and cognitive consequences of head injury in relation to the Glasgow outcome scale. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 69, 204-209. Wilson, S. L., Powell, G. E., Brock, D. & Thwaites, H. (1996). Vegetative state and response to sensory stimulation: An analysis of 24 cases. Brain Injury, 10, 807818. Wood, R. L. & Yurdakul, L. K. (1997). Change in relationship status following traumatic brain injury. Brain Injury, 11, 491-502. World Health Organization (1998). Internationale Klassifikation der Schäden, Aktivitäten und Partizipation. Beta-1 Entwurf, Deutschsprachige Version. Frankfurt: VDR. Wrubel, J. & Folkman, S. (1997). What informal caregivers actually do: The caregiving skills of partners of men with AIDS. AIDS Care, 9, 691-706. Wrubel, J., Richards, T. A., Folkman, S. & Acree, M. C. (2001). Tacit definitions of informal caregiving. Journal of Advanced Nursing, 33, 175-181. Yeates, K. O., Taylor, H. G., Drotar, D., Wade, S. L., Klein, S., Stancin, T. & Schatschneider, C. (1997). Preinjury family environment as determinant of recovery from traumatic brain injuries in school-age children. Journal of the International Neuropsychological Society, 3, 617-630. Zafonte, R. D., Hammond, F. M., Mann, N. R., Wood, D. L., Black, K. L. & Millis, S. R. (1996). Relationship between Glasgow Coma Scale and functional outcome. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 75, 364-369. Zasler, N. D. (1997). Prognostic indicators in medical rehabilitation of traumatic brain injury: A commentary and review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 78 (Suppl 4), S12-S16. Zencius, A. H. & Wesolowski, M. D. (1999). Is the social network analysis necessary in the rehabilitation of individuals with head injury? Brain Injury, 13, 723-727. 249 1.10 Publikationen während des Förderzeitraums 1.10.1 Publikationen mit direktem Bezug zum Projekt 1.10.1.1 Zeitschriftenartikel Balck, F. & Dinkel, A. (2003). Rehabilitation und Familie [Editorial]. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 16, 115. Dinkel, A. & Balck, F. (2003). Krankheit, Rehabilitation und Familie. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 16, 116-121. Dinkel, A. & Balck, F. (im Druck). Bedürfnisse der Angehörigen von SchädelhirntraumaPatienten im Rehabilitationsprozess: ein Literaturüberblick. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 16, 138-156. Balck, F., Dinkel, A. & Schmidt, R. (2001). Forschungsperspektiven in der neurologischen Rehabilitation [Editorial]. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 14, 263-264. Dinkel, A. & Balck, F. (2001). Die Bedeutung sozialer Faktoren für die Adaptation nach Schlaganfall und Schädelhirntrauma. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 14, 295-306. Balck, F. & Dinkel, A. (2000). Schädelhirntrauma und Familie – Auswirkungen einer akuten Hirnschädigung auf Familienmitglieder und das Familiensystem. Kontext, 31, 180-193. 1.10.1.2 Abstracts in Zeitschriften Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Quality of life one year after acute brain damage in patients and their spouses: Preliminary results [Abstract]. European Journal of Public Health, 12 (4 Suppl), 51. 250 1.10.1.3 Gastherausgeberschaften in Zeitschriften Balck, F. & Dinkel, A. (2003). Rehabilitation und Familie [Themenschwerpunkt]. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation. Balck, F., Dinkel, A. & Schmidt, R. (2001). Forschungsperspektiven in der neurologischen Rehabilitation [Themenschwerpunkt]. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 14 (56). 1.10.1.4 Beiträge in Kongress- und Tagungsbänden Balck, F. & Dinkel, A. (2002). Einfluss sozialer Merkmale auf die Adaptation sechs Monate nach akuter Hirnschädigung. In Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), 11. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 4. bis 6. März 2002 in München (S. 384-385). Frankfurt: VDR. Balck, F. & Dinkel, A. (2001). Was wollen Angehörige hirngeschädigter Patienten mit ihrer Unterstützung erreichen? In Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), 10. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 12. bis 14. März 2001 in Halle/Saale (S. 317-319). Frankfurt: VDR. Balck, F. & Dinkel, A. (2000). Angehörige im Rehabilitationsprozeß – Determinanten supportiven Verhaltens. In Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), 9. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 13. bis 15. März 2000 in Würzburg (S. 228-229). Frankfurt: VDR. Dinkel, A. & Balck, F. (2000). Psychische Befindlichkeit der Partner von Patienten mit Hirnschädigung in der frühen Phase nach dem Ereignis – Erste Ergebnisse. In Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), 9. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 13. bis 15. März 2000 in Würzburg (S. 445-447). Frankfurt: VDR. 251 Balck, F. & Dinkel, A. (1999). Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Patienten mit mittelschwerem Schädelhirntrauma: Bericht über ein laufendes Projekt. In Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), 8. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 8. bis 10. März 1999 auf Norderney (S. 295-296). Frankfurt: VDR. Dinkel, A. & Balck, F. (1999). Familien von Schädelhirntrauma-Patienten. In G. Krampen, H. Zayer, W. Schönpflug & G. Richardt (Hrsg.), Beiträge zur Angewandten Psychologie. 5. Deutscher Psychologentag und 20. Kongress für Angewandte Psychologie des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP e.V.) in Berlin 1999 (S. 489-491). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag. 1.10.1.5 Abstracts in Kongress- und Tagungsbänden Balck, F. & Dinkel, A. (2003). Depressive and anxiety symptoms in brain-injured patients and their spouses 6 months after the incident. In W. I. Steudel (Hrsg.), 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurugie 2003: Abstracts (S. 118). Aachen: Shaker. Balck, F. & Dinkel, A. (2002). Assessing subjective goals of supportive behavior in spouses of brain injured patients using a card sorting-procedure [Abstract]. In S. Walper & J. Roos (Eds.), 4th conference of the International Academy of Family Psychology, Heidelberg, Germany. Families in context: International perspectives on change. Abstracts (p. 170). Martinsried: ars una. Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Soziale Unterstützung nach akuter Hirnschädigung: Welche Ziele verbinden Partner von Patienten mit ihrer Hilfe? [Abstract]. In F. Balck, H. Berth & A. Dinkel (Hrsg.), medizinpsychologie.com. State of the Art der Medizinischen Psychologie 2002 (S. 33-34). Lengerich: Pabst. Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Lebensqualität ein Jahr nach akuter Hirnschädigung: Erste Ergebnisse mit dem WHOQOL-BREF [Abstract]. In F. Balck, H. Berth & A. Dinkel 252 (Hrsg.), medizinpsychologie.com. State of the Art der Medizinischen Psychologie 2002 (S. 34-35). Lengerich: Pabst. Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Psychosoziale Anpassung sechs Monate nach akuter Hirnschädigung [Abstract]. In H.-J. Hannich, U. Hartmann & U. Wiesmann (Hrsg.), Inkorporation – Verkörperung – Leiblichkeit. Interdisziplinäre Perspektiven. Beiträge der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie vom 7. bis 9. Juni 2001 in Greifswald (S. 114). Lengerich: Pabst. 1.10.2 Publikationen ohne direkten Bezug zum Forschungsprojekt 1.10.2.1 Zeitschrftenartikel Berth, H., Dinkel, A. & Balck, F. (im Druck). Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Durchführung und Ergebnisverwendung genetischer Untersuchungen. Ergebnisse einer Repräsentativstudie. Journal of Public Health. Berth, H., Dinkel, A., Kreuz, F. R. & Balck, F. (im Druck). Der Genetische Wissensindex (GeWi) – Ein Instrument zur Erfassung des allgemeinen Wissens über Genetik. Zeitschrift für Medizinische Psychologie. Dinkel, A., Berth, H. & Balck, F. (im Druck). Prävalenz psychischer Beschwerden und problematischen Essverhaltens bei weiblichen und männlichen Medizinstudierenden. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Dinkel, A., Berth, H., Exner, C., Rief, W. & Balck, F. (im Druck). Deutsche Adaptation der Restraint Scale zur Erfassung gezügelten Essverhaltens. Diagnostica. Balck, F. (2003). Evidenzbasierte Psychotherapieverfahren bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Medizinische Welt, 54, 372-385. Balck, F. (2003). Interventionen in der Familientherapie. Kontext, 34, 372-385. 253 Berth, H., Dinkel, A. & Balck, F. (2003). Chancen und Risiken genetischer Diagnostik. Ergebnisse einer Umfrage in der Allgemeinbevölkerung und bei Medizinstudierenden. Zeitschrift für Medizinische Psychologie, 12, 177-185. Dinkel, A., Berth, H., Exner, C., Rief, W. & Balck, F. (2003). Psychische Symptome bei Studentinnen in Ost- und Westdeutschland: Eine Replikation nach 10 Jahren. Verhaltenstherapie, 13, 184-190. [IF: 0.372] Wiegand-Grefe, S., Zander, B., Balck, F., Wirsching, M. & Cierpka, M. (2003). Präsentierte Probleme in der Familientherapie: Spektrum im Familienzyklus, Klassifizierung und Effektivität ihrer Behandlung. Kontext, 34, 351-371. Balck, F. & Berth, H. (2002). Die Bedeutung der Familie beim Umgang mit hereditären Krebserkrankungen – Ein Überblick zu Forschungsergebnissen am Beispiel des erblichen Darmkrebs. Kontext, 33, 5-23. Berth, H., Balck, F. & Dinkel, A. (2002). Attitudes toward genetic testing in patients atrisk for HNPCC/FAP and the German population. Genetic Testing, 6, 273-280. [IF: 1.444] Berth, H., Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Gesundheit durch Gentests? Akzeptanz und Befürchtungen gegenüber genetischen Untersuchungen in einer deutschlandrepräsentativen Stichprobe. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 10, 97-107. Berth, H., Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Die Akzeptanz genetischer Untersuchungen durch ältere Menschen. Ergebnisse einer deutschlandrepräsentativen Erhebung. Zeitschrift für Gerontopsychologie und –psychiatrie, 15, 53-60. Berth, H., Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Gentests für alle? Ergebnisse einer Repräsentativerhebung. Deutsches Ärzteblatt, 99, A1030-A1032. Berth, H., Dinkel, A. & Balck, F. (2002). Vor- und Nachteile von Gentests aus der Sicht der deutschen Bevölkerung. Bauchredner – Journal der Deutschen Morbus Crohn/Colitis Ulcerosa Vereinigung DCCV e.V, 70, 46-49. 254 Meyer, W. & Balck, F. (2001). Resuscitation decision index: A new approach to decision-making in prehospital CPR. Resuscitation, 48, 255-263. [IF: 1.760] Wiegand-Grefe, S., Zander, B. & Balck, F. (2001). Zur Effektivität Systemischer Therapie. Kontext, 32, 290-304. Wietersheim, J. v., Scheib, P., Keller, W., Osborn, W., Pritsch, M., Balck, F., Fritzsche, K., Dilg, R. & Schmelz-Schumacher, E. (2001). Die Wirksamkeit psychotherapeutischer Maßnahmen bei Morbus Crohn. Ergebnisse einer randomisierten, multizentrischen Studie. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 51, 2-9. [IF: 0.346] Zander, B., Balck, F., Rotthaus, W. & Strack, M. (2001). Effektivität eines systemischen Behandlungsmodells in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 50, 325-341. [IF: 0.360] Meyer, W. & Balck, F. (2000). Affektive Reaktionen von Ärzten bei präklinischen Reanimationen. Notfall und Rettungsmedizin, 3, 13-21. Balck, F. (1999). Berufliche Rehabilitation bei chronisch psychisch Kranken. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, 48, 31-33. Meyer, W. & Balck, F. (1998). Bewältigungsstrategien im Rettungsdienst. Notfallmedizin, 24, 150-154. 1.10.2.2 Herausgeberwerke Berth, H., Balck, F. & Brähler, E. (Hrsg.) (im Druck). Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie von A bis Z. Göttingen: Hogrefe. 255 Berth, H. & Balck, F. (Hrsg.) (2003). Psychologische Tests für Mediziner. Heidelberg: Springer. Balck, F., Berth, H. & Dinkel, A. (Hrsg.) (2002). medizinpsychologie.com. State of the Art der Medizinischen Psychologie 2002. Lengerich: Pabst. 1.10.2.3 Beiträge in Herausgeberwerken Dinkel, A. (im Druck). Coping. In H. Berth, F. Balck & E. Brähler (Hrsg.), Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie von A bis Z. Göttingen: Hogrefe. Dinkel, A. (im Druck). Familie und Gesundheit. In H. Berth, F. Balck & E. Brähler (Hrsg.), Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie von A bis Z. Göttingen: Hogrefe. Dinkel, A. (im Druck). Krankheit, chronische. In H. Berth, F. Balck & E. Brähler (Hrsg.), Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie von A bis Z. Göttingen: Hogrefe. Dinkel, A. (im Druck). Krankheitsbewältigung. In H. Berth, F. Balck & E. Brähler (Hrsg.), Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie von A bis Z. Göttingen: Hogrefe. Dinkel, A. (im Druck). Unterstützung, soziale. In H. Berth, F. Balck & E. Brähler (Hrsg.), Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie von A bis Z. Göttingen: Hogrefe. Balck, F. (2003). Onkologische Palliativ-Pflege: Wie belastet sind die Angehörigen? In H. Günther & G. Ehninger (Hrsg.), Anthropologische Grundlagen und aktuelle Herausforderungen in der Onkologie (S. 74-83). Regensburg: Roderer. 256 Balck, F. (2003). LEZU. Lebenszufriedenheitsfragebogen. In J. Schumacher, A. Klaiberg & E. Brähler (Hrsg.), Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden (S. 195-199). Göttingen: Hogrefe. Balck, F. & Cierpka, M. (2003). Problemdefinition und Behandlungsziele. In M. Cierpka Hrsg.), Handbuch der Familiendiagnostik (2. Aufl.) (S. 107-122.). Berlin: Springer. Berth, H. & Balck, F. (2003). Zur Evaluation psychologischer Webseiten am Beispiel der Medizinischen Psychologie. In G. Krampen und H. Zayer (Hrsg.), Psychologiedidaktik und Evaluation IV. Neue Medien, Konzepte, Untersuchungsbefunde und Erfahrungen zur psychologischen Aus-, Fort- und Weiterbildung (S. 309-323). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag. Berth, H. & Balck, F. (2003). Die Bedeutung psychologischer Tests im medizinischen Alltag – Einführung. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 1-5). Berlin: Springer. Berth, H. & Balck, F. (2003). Grundlagenwissen zu psychologischen Testverfahren. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 712). Berlin: Springer. Berth, H. & Balck, F. (2003). Zum Aufbau der Testbeschreibungen. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 13-15). Berlin: Springer. Dinkel. A. (2003). WST. Wortschatztest. Schmidt, K.-H. & Metzler, P. Weinheim: Beltz. 1992. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 32). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). Test d2. Aufmerksamkeits-Belastungs-Test. Brickenkam, R. 9. überarbeitete und neu normierte Aufl. Göttingen: Hogrefe. 2002. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 34-35). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). FAF. Fragebogen zur Erfassung von Aggressivitätsfaktoren. Hampel, R. & Selg, H. Göttingen: Hogrefe.1975. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 50-51). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). SAM. Fragebogen zur Erfassung dispositionaler Selbstaufmerksamkeit. Filipp, S.-H. & Freudenberg, E. Göttingen: Hogrefe. 1989. 257 In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 68-69). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). TAS-26. Toronto-Alexithymie-Skala-26. Deutsche Version. Kupfer, J., Brosig, B. & Brähler, E. Göttingen: Hogrefe. 2001. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 70-71). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). FLZ. Fragebogen zur Lebenszufriedenheit. Fahrenberg, J., Myrtek, M., Schumacher, J. & Brähler, E. Göttingen: Hogrefe. 2000. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 78-79). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). PLC. Profil der Lebensqualität chronisch Kranker. Siegrist, J., Broer, M. & Junge, A. Weinheim: Beltz. 1996. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 80-81). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). SEL. Skalen zur Erfassung der Lebensqualität. Averbeck, M., Leiberich, E., Grote-Kusch, M. T., Olbrich, E., Schröder, A., Brieger, M. & Schumacher, K. Frankfurt am Main: Swets. 1997. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 82-83). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). SF-36. Fragebogen zum Gesundheitszustand. Bullinger, M. & Kirchberger, I. Göttingen: Hogrefe. 1998. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 84-85). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). WHOQOL-100 und WHOQOL-BREF. Handbuch für die deutschsprachigen Versionen der WHO Instrumente zur internationalen Erfassung von Lebensqualität. Angermeyer, M. C., Kilian, R. & Matschinger, H. Göttingen: Hogrefe. 2000. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 86-87). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). SOMS. Das Screening für somatoforme Störungen. Rief, W., Hiller, W. & Heuser, J. Bern: Huber. 1997. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 106-107). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). EWL. Die Eigenschaftswörterliste. Janke, W. & Debus, G. Göttingen: Hogrefe. 1978. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 142-143). Berlin: Springer. 258 Dinkel, A. (2003). ADS. Allgemeine Depressions Skala. Hautzinger, M. & Bailer, M. Weinheim: Beltz. 1993. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 156-157). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). STAXI. Das State-Trait-Ärger-Ausdrucks-Inventar. Schwenkmezger, P., Hodapp, V. & Spielberger, C. D. Bern: Huber. 1992. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 176-177). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). BEFO. Berner Bewältigungsformen. Heim, E., Augustiny, K., Blaser, A. & Schaffner, L. Berin: Huber. 1991. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 192-193). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). SVF. Streßverarbeitungsfragebogen. Janke, W., Erdmann, G. & Kallus, K. W. 2. erw. Aufl. Göttingen: Hogrefe. 1997. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 206-207). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). TSK. Trierer Skalen zur Krankheitsbewältigung. Klauer, T. & Filipp, S.H. Göttingen: Hogrefe. 1993. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 208-209). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). UBV. Fragebogen zum Umgang mit Belastungen im Verlauf. Reicherts, M. & Perrez, M. Bern: Huber. 1993. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 210-211). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). VEV. Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens. Zielke, M. & Kopf-Mehnert, C. Weinheim: Beltz. 1978. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 212-213). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). RBMT. Der Rivermead Behavioural Memory Test. Wilson, B.R., Cockburn, J. & Baddeley, A. Deutsche Übersetzung der zweiten Auflage des englischen Originaltests: Beckers, K., Behrends, U. & Canavan, A. Bury St. Edmunds: Thames Valley Test Company. 1992. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 250-252). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). TBF-12. Tinnitus-Beeinträchtigungs-Fragebogen. Greimel, K. V., Leibetseder, M., Unterrainer, J., Biesinger, E. & Albegger, K. Frankfurt am Main: 259 Swets. 2000. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 272-273). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). TF. Tinnitus-Fragebogen. Goebel, G. & Hiller, W. Göttingen: Hogrefe. 1998. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 274-275). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). FB. Die Familienbögen. Ein Inventar zur Einschätzung von Familienfunktionen. Cierpka, M. & Frevert, G. Göttingen: Hogrefe. 1994. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 278279). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). FBH. Fragebogen zur Bewältigung von Hautkrankheiten. Stangier, U., Ehlers, A. & Gieler, U. Göttingen: Hogrefe. 1996. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 280-283). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). FEE. Fragebogen zum erinnerten elterlichen Erziehungsverhalten. Schumacher, J., Eismann, M. & Brähler, E. Bern: Huber. 2000. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 284-285). Berlin: Springer. Dinkel, A. (2003). FPD. Fragebogen zur Partnerschaftsdiagnostik. Hahlweg, K. Göttingen: Hogrefe. 1996. In H. Berth & F. Balck (Hrsg.), Psychologische Tests im medizinischen Alltag (S. 290-291). Berlin: Springer. Siegel, A., Soeder, U., Manz, F. & Balck, F. (2003). Kosten-Nutzwert-Analyse zweier Rückenschulprogramme. In F. Hofmann, G. Reschauer & U. Stößel (Hrsg.), Arbeitsmedizin im Gesundheitsdienst (S. 190-199). Freiburg im Breisgau: Edition FFAS. Balck, F. (2002). Entwicklung und Evaluierung eines Fortbildungsprogrammes für Leiterinnen und Leiter von Krebs-Selbsthilfegruppen. In Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.), Selbsthilfegruppenjahrbuch (S. 60-75). Gießen: Focus. Balck, F., Berth, H. & Dinkel, A. (2002). medizinpsychologie.com – Zur Einführung. In F. Balck, H. Berth & A. Dinkel (Hrsg.), medizinpsychologie.com. State of the Art der Medizinischen Psychologie 2002 (S. 7-9). Lengerich: Pabst Science Publishers. 260 Manz, R., Soeder, U., Siegel, A. & Balck, F. (2002). Vergleichende Evaluation einer Rückenschule mit einem kombinierten psycho-edukativen Behandlungsprogramm. Maßnahmen für Patienten mit akuten Rückenschmerzen. In U. Walter, M. Drupp & F. W. Schwartz (Hrsg.), Prävention durch Krankenkassen. Zielgruppen, Zugangswege, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (S. 251-262). Weinheim: Juventa. Scheib, P. & Balck, F. (2002). Prozess- und Ergebnisforschung der Familientherapie. In M. Wirsching & P. Scheib (Hrsg.), Paar- und Familientherapie (S. 651-663). Heidelberg: Springer. Herrle, J., Soeder, U., Manz, R. & Balck, F. (2001). "Rückenschmerzen bewältigen" – Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm als Element der Chronifizierungsprophylaxe bei Rückenschmerzen. In R. Manz (Hrsg.), Psychologische Programme für die Praxis (S. 127-152). Tübingen: DGVT-Verlag. Manz, R., Soeder, U. & Balck, F. (2001). Evaluation eines psycho-edukativen Behandlungsprogramms für Patienten mit akuten Rückenschmerzen. In R. Manz (Hrsg.), Psychologische Programme für die Praxis (S. 153-178). Tübingen: DGVT-Verlag. Soeder, U., Manz, R. & Balck, F. (2001). Ein Evaluationsansatz für manualgestützte Verfahren in der Gesundheitsförderung und Prävention. In R. Manz (Hrsg.), Psychologische Programme für die Praxis (S. 179-204). Tübingen: DGVT-Verlag. Balck, F. (2000). Sozialmedizinische Bedeutung von Nierenerkrankungen. In K.-M. Koch (Hrsg.), Klinische Nephrologie (S. 11-13). München: Urban & Fischer. Balck, F. (2000). Psychologische und sozialpsychologische Probleme – Aspekte der Betreuung. In K.-M. Koch (Hrsg.), Klinische Nephrologie (S. 809-814). München: Urban & Fischer. Balck, F. (2000). Beziehungen zwischen Einstellungen zur Organtransplantation und zum Arztberuf bei Medizinstudenten. In H. W. Künsebeck & F. Muthny (Hrsg.), Einstellungen zur Organspende und ihre klinische Relevanz (S. 5-21). Lengerich: Pabst. 261 Balck, F. & Ulbrich, C. (1999). Kausalattributionen und Kontrollüberzeugungen im Krankheits- und Genesungsprozeß chronisch Kranker. In F. Kröger & E.-R. Petzold (Hrsg.), Selbstorganisation und Ordnungswandel in der Psychosomatik. Konzepte systemischen Denkens und ihr Nutzen für die Psychosomatische Medizin (S. 404-423). Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften. Schückel, K. & Balck, F. (1998). Supervision auf onkologischen Stationen. In H. Günther & G. Ehninger (Hrsg.), Krankheitsbewältigung und Lebensqualität – Herausforderung für Patient, medizinische Helfer und Gesellschaft (S. 44-57). Regensburg: Roderer. 1.11 Anhang Verzeichnis: Neu entwickelte Erhebungsinstrumente – Partner: • Soziodemographischer Bogen (Partner und Patient) • Items Konfliktpotential KON • Items unterstützungsbezogene Bewertungen (B-H; B-W; B-E; B-A) • Soziale Unterstützung-Selbstbeurteilung SU-I • Card Sorting (Instruktionen; Dokumentation Rangreihe; Items des Card Sorting) • Interviewleitfaden (Eingangsfragen; Interview zur sozialen Unterstützung) • Anleitung zur Auswertung des Partnerinterviews zur sozialen Unterstützung • Auswertungsbogen Rating Interview zur sozialen Unterstützung • Definitionen der einzelnen Kategorien supportiven Verhaltens • Beispiele für die einzelnen Kategorien supportiven Verhaltens • Entwicklung des Kategoriensystems Aus dem Englischen übersetzte Erhebungsinstrumente – Patient: • Deutsche Version des Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire • Deutsche Version des Rivermead Head Injury Follow-up Questionnaire Soziodemographischer Bogen Sind Sie männlich weiblich .................................................................................................................................................................... Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? deutsch nicht-deutsch .................................................................................................................................................................... Wann sind Sie geboren? Monat Jahr ⇒ Alter .................................................................................................................................................................... Wie ist Ihr Familienstand? ledig verheiratet geschieden / getrennt lebend verwitwet .................................................................................................................................................................... Wenn verheiratet ⇒ Wie lange sind Sie bereits verheiratet? Jahre ⇒ Ist dies Ihre erste Ehe? ja nein ⇒ Wieviele? Wenn nicht verheiratet ⇒ Wie lange Sind Sie bereits mit Ihrem Partner zusammen? Jahre .................................................................................................................................................................... Haben Sie Kinder? ja ⇒ In welchem Alter? ⇒ Wieviele? nein .................................................................................................................................................................... Wenn Kinder vorhanden sind ⇒ Sind darunter auch Kinder aus einer früheren Ehe / Beziehung? ja ⇒ Leben die Kinder aus Ihrer früheren Partnerschaft bei Ihnen? ja nein nein .................................................................................................................................................................... Leben Sie und Ihr Partner in einem gemeinsamen Haushalt? ja nein Wieviele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? Insgesamt Personen .................................................................................................................................................................... Wieviele davon sind 18 oder älter? Personen .................................................................................................................................................................... Welchen höchsten Schulabschluß haben Sie? Hauptschule / Volksschule Realschule / Mittlere Reife Polytechnische Oberschule Fachhochschulreife Abitur / allgemeine Hochschulreife anderen Schulabschluß keinen Schulabschluß .................................................................................................................................................................... Welche Berufsausbildung haben Sie abgeschlossen? Lehre (beruflich-betriebliche Ausbildung) Fachschule (Meister-, Technikerschule, Berufs-, Fachakademie) Fachhochschule, Ingenieurschule Universität, Hochschule andere Berufsausbildung keine Berufsausbildung .................................................................................................................................................................... Sind Sie zur Zeit erwerbstätig? ja, ganztags ja, mindestens halbtags ja, weniger als halbtags nein, Hausfrau / Hausmann nein, in Ausbildung nein, arbeitslos / erwerbslos nein, Erwerbs-, Berufsunfähigkeitsrente nein, Altersrente nein, anderes .................................................................................................................................................................... In welcher beruflichen Stellung sind Sie hauptsächlich derzeit beschäftigt bzw. (falls nicht mehr berufstätig) waren Sie zuletzt beschäftigt? Arbeiter Angestellter Beamter Selbständiger Sonstiges .................................................................................................................................................................... Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushaltes insgesamt? bis 1 000 1 000 bis unter 2 000 2 000 bis unter 3 000 3 000 bis unter 4 000 4 000 bis unter 5 000 5 000 bis unter 6 000 6 000 bis unter 7 000 7 000 und mehr Items Konfliktpotential KON 1. Wie oft ungefähr kam es in den letzten sechs Monaten vor der Verletzung Ihres Partners zu einer erregten Auseinandersetzung zwischen Ihnen? nie einmal in drei Monaten einmal pro Monat mehrmals pro Monat einmal pro Woche mehrmals pro Woche 1 2 3 4 5 6 2. Wie oft ungefähr haben Sie sich in den letzten sechs Monaten vor der Verletzung Ihres Partners über ihn / sie geärgert? selten alle zwei Wochen einmal pro Woche mehrmals pro Woche einmal am Tag mehrmals am Tag 1 2 3 4 5 6 3. Wie oft ungefähr hat Ihr Partner sich in den letzten sechs Monaten vor der Verletzung über Sie geärgert? selten alle zwei Wochen einmal pro Woche mehrmals pro Woche einmal am Tag mehrmals am Tag 1 2 3 4 5 6 4. Gibt es zwischen Ihnen und Ihrem Partner Themen, die schwierig sind und nicht mehr angesprochen werden, sozusagen Tabuthemen? ja nein 5. Wenn es solche Themen gibt, wie sehr belastet es Sie, daß diese Themen nicht besprochen werden? gar nicht 1 2 3 4 5 6 sehr Unterstützungsbezogene Bewertungen Bitte schätzen Sie die folgenden Aussagen auf der Skala von 1 bis 6 ein. Hilfsbedürftigkeit B-H Was glauben Sie, wie sehr ist Ihr Partner im Moment auf Ihre Hilfe angewiesen? gar nicht angewiesen 1 2 3 4 5 6 sehr angewiesen Wissen B-W Wie klar sind Ihre Vorstellungen darüber, was für Ihren Partner besonders hilfreich ist? völlig unklar 1 2 3 4 5 6 sehr klar Erfolg B-E Wie sehr sind Sie davon überzeugt, daß Ihre Hilfe für Ihren Partner die von Ihnen erwartete Wirkung hat? gar nicht überzeugt 1 2 3 4 5 6 sehr überzeugt Akzpetanz B-A In welchem Ausmaß ist Ihrer Meinung nach Ihr Partner dazu bereit, Ihre Hilfe anzunehmen? gar nicht bereit 1 2 3 4 5 6 sehr bereit Soziale Unterstützung-Selbstbeurteilung SU-I Nachdem Sie im Gespräch mitgeteilt haben, ob und wie Sie versuchen, Einfluß auf Ihren Partner zu nehmen, bitten wir Sie, dies nun für die verschiedenen Aspekte zusammenfassend einzuschätzen. überhaupt in sehr starkem nicht 1. Inwieweit versuchen Sie, auf die Stimmung 1 Maß 2 3 4 5 6 Ihres Partners Einfluß zu nehmen? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inwieweit sind Sie bemüht, Ihren Partner 1 2 3 4 5 6 mit Informationen zu versorgen? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Inwieweit helfen Sie Ihrem Partner bei 1 2 3 4 5 6 Dingen, die er nicht alleine machen kann? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Inwieweit versuchen Sie, Einfluß auf die weitere Genesung Ihres Partners zu nehmen? 1 2 3 4 5 6 Instruktionen Card Sorting „Nach einer Kopfverletzung ist der Betroffene häufig auf Hilfe angewiesen – der eine mehr, der andere weniger. Sie sehen hier 30 Karten, auf denen jeweils eine Aussage notiert ist. Die Aussagen beziehen sich darauf, was man mit seiner Unterstützung erreichen will. Uns geht es darum, was Sie mit Ihrem Hilfeverhalten erreichen möchten. Schauen Sie sich die 30 Karten bitte in Ruhe an, und überlegen Sie, welche Aussagen für Sie zutreffen. Wählen Sie bitte die 10 Karten aus, die Ihnen am wichtigsten sind, das heißt, die 10 Aussagen, die am ehesten mit dem übereinstimmen, was Sie mit Ihrer Unterstützung erreichen wollen. Einige Aussagen werden für Sie vielleicht nicht ganz genau passen. Wählen Sie dann bitte die Karten mit den Aussagen, die für Sie am ehesten zutreffen. Sollten Sie merken, daß einige Aspekte, die Ihnen sehr wichtig sind, ganz fehlen, können Sie bis zu 3 eigene Aussagen notieren. Unter den 30 Aussagen befinden sich auch einige, die sich nicht auf Ihren Partner, sondern auf Sie beziehen. Damit ist gemeint, daß man dem Partner manchmal auch vor allem darum hilft, um dadurch sich selbst zu helfen. Sollte dies für Sie zutreffen, können Sie diese Karten genauso auswählen wie die anderen“. „Nachdem Sie nun die 10 Aussagen ausgewählt haben, die Ihnen am wichtigsten sind, geht es darum, diese 10 Aussagen noch einmal zu sortieren. Legen Sie die 10 Karten bitte in eine Reihe. Ganz oben soll die Aussage liegen, die angibt, was Sie an erster Stelle mit Ihrer Unterstützung erreichen möchten. Die nächste Karte soll dann das zweitwichtigste Ziel angeben, die dritte das drittwichtigste und so weiter“. Ziel-Rangreihe Card Sorting Position: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zusätzliche Ziele: A: B: C: Karte: Items des Card Sorting Die Karten wurden den Partnern in standardisierter Reihenfolge präsentiert. In Klammern ist die Item-Nummer angegeben. Items der Funktion SU-F1 "Sicherung der Rahmenbedingungen für die Auseinandersetzung mit krankheitsbedingten Problemen" Subfunktionen: 1. Stützung des emotionalen Gleichgewichts 2. Stützung des Selbstwertgefühls und der Identiätswahrnehmung 3. Vermittlung partnerschaftlicher Bindungssicherheit 1. Mein Partner soll nicht mehr so niedergeschlagen sein. (21) Mein Partner soll optimistischer in die Zukunft blicken. (11) 2. Mein Partner soll das Gefühl haben, daß ich ihn akzeptiere so wie er ist. (14) Mein Partner soll weniger an sich selbst zweifeln. (18) 3. Mein Partner soll merken, daß ich zu ihm halte. (3) Mein Partner soll das Gefühl haben, daß er wichtig für mich ist. (20) Items der Funktion SU-F2 "Optimierung patientenseitiger Auseinandersetzungsprozesse durch direkte Einflußnahme des sozialen Stützsystems" Subfunktionen: 1. Bereitstellen von Information und Beratung 2. Handlungsmotivierung und Hilfe bei der Handlungsplanung 3. Bestärken und Vermittlung von Rückmeldung 1. Mein Partner soll wissen, wie es weitergeht. (17) Meinem Partner soll klar sein, wie er eine Verbesserung seines Zustands erreichen kann. (9) 2. Mein Partner soll ein Problem nach dem anderen angehen. (1) Mein Partner soll sich mit Problemen und Schwierigkeiten auseinandersetzen. (2) 3. Mein Partner soll seine früheren Aufgaben wieder anpacken. (26) Mein Partner soll nicht aufgeben, wenn Probleme und Schwierigkeiten auftauchen. (23) Items der Funktion SU-F3 "Ausgleich krankheitsbedingter Defizite" Mein Partner soll neue Freundschaften aufbauen. (13) Mein Partner soll trotz seiner Einschränkungen ein möglichst normales Leben führen können. (15) Mein Partner soll so gut es geht seinen alten Freizeitaktivitäten nachgehen können. (30) Mein Partner soll eine angemessene berufliche Tätigkeit ausüben können. (27) Mein Partner soll keine finanziellen Probleme haben. (16) Mein Partner soll neue Interessen entwickeln. (5) Items der Funktion SU-F4 "Einflussnahme auf den Genesungsprozess" Mein Partner soll sich besser konzentrieren können. (10) Mein Partner soll nicht so vergeßlich sein. (7) Mein Partner soll nicht so reizbar sein. (25) Mein Partner soll nicht so schnell ermüden. (28) Mein Partner soll sich wieder normal unterhalten können. (29) Mein Partner soll sich wieder normal bewegen können. (24) Items der Funktion SU-F5 "Regulierung der eigenen Befindlichkeit" Ich möchte nicht mehr so viel Angst haben. (12) Ich möchte wieder ruhig schlafen können. (6) Ich möchte mehr Zeit für mich haben können. (8) Ich möchte meinen eigenen Interessen nachgehen können. (4) Ich möchte nicht mehr so angespannt sein. (22) Ich möchte wieder guter Laune sein. (19) Interviewleitfaden Eingangsfragen 1. Was hat sich bei Ihnen durch die Verletzung Ihres Partners verändert? 2. Was beschäftigt Sie am meisten? 3. Hat es in letzter Zeit etwas gegeben, das Sie belastet? Interview zur sozialen Unterstützung 1. Wenn sich der Patient noch im Krankenhaus befindet: Wie häufig besuchen Sie Ihren Partner? Wie häufig telefonieren Sie mit Ihrem Partner? Was machen Sie, wenn Sie Ihren Partner besuchen? Worüber unterhalten Sie sich vor allem? 2. Sprechen Sie über den Unfall / die Hirnblutung? 3. Versuchen Sie, auf die Stimmung Ihres Partners Einfluß zu nehmen? (Trost, Hoffnung, Aufmunterung,...) 4. Sind Sie bemüht, Ihren Partner mit Informationen zu versorgen? (Allgemeine/Familiäre Ereignisse, Behandlung, Ratschläge,...) 5. Helfen Sie Ihrem Partner bei Dingen, die er nicht alleine machen kann? (Aufstehen, Gehen, Essen,...) 6. Versuchen Sie, Einfluß auf die weitere Genesung zu nehmen? (Üben,...) Anleitung zur Auswertung des Partnerinterviews zur sozialen Unterstützung • "Die Auswertung des Interviews sieht zwei Teile vor: Zum einen das Notieren supportiver Verhaltensweisen, zum anderen ein Rating, in welchem Ausmaß der Partner Unterstützung leistet. • In die Auswertung geht das komplette Interview ein, d.h. auch der erste Teil, der das Interview zum Belastungserleben darstellt. Dies hängt damit zusammen, daß bereits in diesem Teil Aussagen zu supportiven Verhaltensweisen vorkommen können. • Zum Notieren der supportiven Verhaltensweisen: Als supportive Verhaltensweisen gelten im gesamten Interview Handlungen, die offensichtlich einen supportiven Charakter aufweisen, d.h. für den Patienten gemacht werden oder an seinen Bedürfnissen orientiert sind. Bei einigen Verhaltensweisen wird dies nicht eindeutig zu beurteilen sein (z.B. “wir gehen Kaffee trinken, wir gehen spazieren”). Hier gilt folgende Regelung: Werden diese Aussagen in Bezug auf eine der vier direkten Fragen zur Unterstützung gemacht (d.h. im Interview ab der Frage “Versuchen Sie, auf die Stimmung Ihres Partners Einfluß zu nehmen?”), dann gelten diese “nicht eindeutigen” Aussagen als supportive Verhaltensweisen und werden als solche notiert. Werden diese Aussagen im Interview vor diesen vier direkten Fragen gemacht (z.B. auf die Frage “Was machen Sie, wenn Sie Ihren Partner besuchen?”) dann gelten die “nicht eindeutigen” Aussagen nicht als supportive Verhaltensweisen, es sei denn, der Partner gibt eine Funktion an, die unterstützenden Charakter hat (z.B. “Wir gehen spazieren, damit er sich orientieren kann, ... damit das Laufen besser wird, ... damit er wieder Muskeln aufbaut”). Für das ganze Interview gilt, daß wenn der Partner seinen Handlungen eine Funktion unterstellt, die Funktion ebenfalls notiert wird (z.B. “Ich bringe Fotos mit, damit er sich wieder erinnern kann”). • Bestätigung von Intervieweraussagen: Faßt der Interviewer Handlungen zusammen oder macht einen „Vorschlag“ („wenn ich Sie richtig verstehe machen Sie...“, „kann man sagen, daß Sie ... machen“ o.ä.) und bestätigt der Partner diese, so werden die vom Interviewer „vorgeschlagenen“ Handlungen als supportive Verhaltensweise notiert (falls sie nicht bereits vom Partner genannt wurden und somit notiert sind). • Transkription der supportiven Verhaltensweisen: Die supportiven Handlungen werden möglichst wortgenau notiert und auf dem Auswertungsbogen mit numerischen Aufzählungszeichen versehen (1., 2., ...). Werden in einem Satz mehrere Handlungen genannt, stellt jede “Sinneinheit” eine neue supportive Handlung dar und wird somit unter einer eigenen numerischen Aufzählung notiert (z.B. “Ich wasche ihn und gebe ihm das Essen” stellt zwei getrennte Handlungen dar). Werden diesselben Handlungen mehrmals genannt, dann werden sie nur einmal notiert, es sei denn, es werden unterschiedeliche Funktionen genannt. In diesem Fall wird die Handlung doppelt notiert mit der entsprechenden Funktion. Bei der Frage nach der Einflußnahme auf den Genesungsprozeß kommt evtl. zuerst die Antwort “nein”. Danach wird in der Regel gefragt, ob eine Form von Üben stattfindet. Werden darauf supportive Handlungen genannt, so werden diese notiert. • Interviewerfragen: Die Fragen des Interviewers werden nicht notiert. Es wird auf dem “Transkriptbogen” lediglich ein Hinweis vermerkt, wann die direkten Fragen zur Unterstützung einsetzen, und zwar hinter der ersten supportiven Handlung, die auf die Frage genannt wird (z.B. 23. ihn zum Lachen gebracht (Interviewer-E)). Als Kürzel gelten E für emotionale, I für informative, P für praktische Unterstützung und G für Einflußnahme auf Genesung. • Verständnisschwierigkeiten: Wenn Aussagen des Partners augrund der Aufnahmequalität oder der Aussprache nicht verständlich sind, jedoch angenommen werden kann, daß supportive Handlungen genannt werden, dann wird die Aussage so gut es eben geht unter Angabe der Stelle im Interview (Zeitangabe, abzulesen am Zeitraster des Tonbandes) am Ende der Seite angeführt. • Die supportiven Handlungen werden direkt in den Rechner in eine Datei eingegeben. Für jede neue Person wird mittels der Funktion “Abschnittsende” eine neue Seite definiert. Die erste Handlung des Raters besteht darin, die Kopfzeile auf die neue Seite zu kopieren und die Codenummer anzugeben. In dieser Datei stehen somit nur supportive Handlungen, alle anderen Angaben und Ratings werden auf einem anderen Auswertungsbogen notiert. • Rating der sozialen Unterstützung: Es wird eingeschätzt, in welchem Ausmaß der Partner soziale Unterstützung in den Dimensionen emotional, informativ und praktisch (instrumentell) leistet. Diese Einschätzung stellt primär eine Fremdbeurteilung dar, d.h. der Rater nimmt eine Einschätzung vor, so daß Diskrepanzen zwischen Angaben und subjektiver Einschätzung des Partners und dem Rating durch den Beurteiler möglich sind. Der Beurteilung liegen nicht nur die genannten supportiven Handlungen zugrunde, sondern auch der “Kontext”. In das Rating geht somit das gesamte Interview ein. Berücksichtigt werden dabei neben konkreten Handlungen und Häufigkeitsangaben des Partners auch die Art und Weise, wie er etwas sagt (z.B. sehr bestimmt, zögerlich). Die möglichen Kategorien sind gar nicht; in geringem Ausmaß; in mittlerem Ausmaß; in hohem Ausmaß; nicht einschätzbar. Genauere Beschreibungen der Kategorien finden sich auf dem Auswertungsbogen. • Rating der emotionalen Unterstützung: Hierunter wird die Einflußnahme auf die Stimmung und die emotionale Befindlichkeit verstanden. Die Stimmung wird direkt beeinflußt, oder es wird dem Patienten die Möglichkeit gegeben, sich emotionale Erleichterung zu verschaffen. • Rating der informativen Unterstützung: Hierunter wird das Vermitteln von Information (allgemein, familiär), Informationen über die Behandlung, Ratschläge und Rückmeldungen (Feedback) des Partners an den Patienten verstanden. • Rating praktische (instrumentelle) Unterstützung: Hierunter wird die Unterstützung bei praktischen Problemen / Schwierigkeiten verstanden. Dazu zählt das Übernehmen von Handlungen, die der Patient aufgrund von Einschränkungen nicht leisten kann. • Rating der Dimension “Einflußnahme auf den Genesungsverlauf”: Hierunter werden Handlungen verstanden, die unternommen werden, um eine Verbesserung von Beeinträchtigungen zu erreichen. Eventuell gibt der Partner an, er sei der Meinung, Einfluß auf den Genesungsprozeß zu nehmen – indem er z.B. emotionale Unterstützung leistet. Dies ist nicht unter dieser Kategorie zu werten, sondern geht in die Kategorie emotionale Unterstützung ein. Sagt der Partner, er versuche auf den Genesungsprozeß Einfluß zu nehmen, beschreibt aber keine Handlungen und gibt keinen Hinweis darauf, daß er etwas unternimmt, um bestehende Einschränkungen (z.B. Gedächtnis, Sprache, Motorik,...) zu verbessern, so wird dies als keine bzw. geringe Unterstützung gewertet. • Zusätzliche Auswertung (1): Aus dem Interview zum Belastungserleben soll notiert werden, ob eine “Hintergrundbelastung” vorliegt. Dies bedeutet, daß die Antwort auf die Frage “Hat es in letzter Zeit etwas gegeben, das Sie belastet?” ausgewertet werden soll. Zum einen soll notiert werden, was die Hintergrundbelastung darstellt (Thema), zum zweiten soll der Belastungsgrad eingeschätzt werden. Als Hintergrundbelastung gelten nur Probleme/ Belastungen, die nicht mit der Verletzung des Patienten identisch sind. Die möglichen Kategorien dabei sind: nein; ja, geringe Belastung; ja, mittlere Belastung; ja, schwere Belastung; ja, Belastungsgrad nicht einschätzbar; Aussage nicht einschätzbar. Entscheidend ist hier die subjektive Einschätzung des Partners. • Zusätzliche Auswertung (2): Häufigkeit der Besuche im Krankenhaus pro Woche. “Kein Besuch” wird mit 0 kodiert. Wird eine Spanne von 1 genannt, wird die höhere Zahl notiert (z.B. “3-4 mal pro Woche” = 4), wird eine Spanne größer 1 genannt, wird der Mittelwert notiert (z.B. “2-4 mal pro Woche” = 3). Es wird die aktuelle Besuchshäufigkeit gewertet. Wenn der Partner angibt, der Patient sei vor einem oder zwei Tagen verlegt worden und infolge dessen eine Veränderung der Besuchshäufigkeit auftritt, wird die aktuelle Häufigkeit gewertet, sofern dazu eine Angabe gemacht wird. Dagegen wird eine auf die Zukunft projizierte Veränderung (“Wenn mein Partner in der Reha sein wird, werde ich ihn ... besuchen”) nicht gewertet. • Zusätzliche Auswertung (3): Bei einigen Partnern wird gefragt, ob und wie häufig sie mit dem Patienten telefonieren. Die Auswertung geschieht analog zu der Auswertung der Besuchshäufigkeit. Ob der Patient oder der Partner anruft, ist für die Auswertung unerheblich. In die Auswertung gehen nur Telefonate mit dem Partner ein, Telefonate mit dem Personal oder dem Arzt werden nicht gewertet. Wenn telefonieren aufgrund des Zustands des Patienten nicht möglich ist, so wird dies nicht mit 0 gewertet, sondern es wird “nicht möglich” notiert. • Zusätzliche Auswertung (4): Es wird die Gesamtdauer des Interviews (Interview zum Belastungserleben und Interview zur sozialen Unterstützung) notiert. Die Dauer läßt sich anhand der Zeitmarkierungen auf dem Tonband bestimmen. • Zusätzliche Auswertung (5): Es wird notiert, ob Teile des Interviews fehlen und ob andere Auffälligkeiten festzustellen sind. Weiterhin wird die Aufnahmequalität des Interviews angegeben (gut / schwer verständlich, unverständlich und daher nicht oder nur teilweise auswertbar (welche Teile nicht auswertbar; wenn schwer verständlich: Interviewer, Partner oder Interview insgesamt)." Auswertungsbogen Rating Interview soziale Unterstützung – T1 Code: Rater: Rating soziale Unterstützung: Gar nicht 1. Emotionale Unterstützung 0 In geringem In mittlerem Ausmaß Ausmaß 1 2 In hohem Ausmaß Nicht einschätzbar 3 -99 ...................................................................................................................................................... 2. Informative Unterstützung 0 1 2 3 -99 ...................................................................................................................................................... 3. Praktische Unterstützung 0 1 2 3 -99 ...................................................................................................................................................... 4. Einflußnahme auf Genesung 0 1 2 3 -99 Nein ja, geringe Belastung ja, mittlere Belastung ja, hohe Belastung ja, aber nicht einschätzbar 0 1 2 3 -99 Hintergrundbelastung: Thema Hintergrundbelastung: Besuchshäufigkeit pro Woche: Telefonkontakt pro Woche: Gesamtdauer Interview (min): Tonqualität des Interviews: Andere Auffälligkeiten: Definitionen der einzelnen Kategorien supportiven Verhaltens 1. Emotionskontrolle Der Partner kontrolliert im Kontakt mit dem Betroffenen seine eigenen Emotionen und seine Befindlichkeit. 2. Persönlicher Kontakt Der Partner hält persönlichen Kontakt mit dem Betroffenen. 3. Zuneigung Der Partner zeigt dem Betroffenen seine Zuneigung und Liebe. 4. Empathie Der Partner unternimmt Handlungen, die in besonderer Weise an den Bedürfnissen des Betroffenen orientiert sind und ihm verdeutlichen, daß der Partner zu ihm steht. 5. Einflußnahme auf Stimmung Der Partner unternimmt Handlungen, die eine Veränderung der Stimmungslage des Betroffenen bewirken sollen. 6. Feedback Der Partner gibt dem Betroffenen Rückmeldungen über dessen Handlungen und die Entwicklung des Genesungsprozesses. 7. Praktische Hilfe Der Partner leistet praktische Hilfe bei Dingen, die der Partner aufgrund einer Beeinträchtigung nicht völlig selbständig erledigen kann. 8. Unterstützung der medizinischen Behandlung / des Genesungsverlaufs Der Partner unternimmt Handlungen, die mit den Rahmenbedingungen der medizinischen Behandlung zusammenhängen (Organisation und Koordination) oder die ein Training beeinträchtigter Funktionen (z.B. Gedächtnis, Sprache, Motorik) darstellen oder die auf die Linderung von Schmerzen oder anderen Beschwerden zielen. 9. „Positive“ Bewertung und aktivierende Inangriffnahme Der Partner unternimmt Handlungen, die sich auf die Einschätzung von Situationen und Problemen durch den Betroffenen beziehen und unterstüzt einen offenen, aktiven Umgang mit der Erkrankung, den Folgen und möglichen Problemen. 10. Zukunftsperspektiven Der Partner unternimmt Handlungen, die dem Betroffenen die Entwicklung neuer Zukunftsperspektiven und neuer Ziele erleichtern soll und betont gemeinsame Zunkunftsziele. 11. Information / Einbindung in Familie und soziales Umfeld Der Partner unternimmt Handlungen, die dem Betroffenen deutlich machen, daß er ein Teil der Familie ist und als solches bestimmte Aufgaben und bestimmte Ansprüche hat. Der Partner unternimmt Handlungen, die dem Betroffenen verdeutlichen, daß er in ein soziales Netzwerk eingebunden ist. 12. Weiterführung des bisherigen Lebensstils Der Partner kümmert sich während des Krankenhausaufenthaltes des Betroffenen um Dinge und Bereiche, die dem Betroffenen wichtig sind und unternimmt Handlungen, die ihm und dem Betroffenen die Weiterführung des bisherigen Lebensstils ermöglichen. 13. Anpassung des Wohnumfelds an vorhandene Beeinträchtigungen Es werden Veränderungen in und um die Wohnung vorgenommen, die eine Anpassung an vorhandene Beeinträchtigungen des Betroffenen darstellen. 14. Nicht zuzuordnen Beispiele für die einzelnen Kategorien supportiven Verhaltens 1. Emotionskontrolle - Partner beginnt bewusst keinen Disput - lässt sich eigene schlechte Stimmung nicht anmerken 2. Persönlicher Kontakt - fährt jeden Tag in die Klinik - Unterstützung durch Anwesenheit 3. Zuneigung - Körperkontakt aufnehmen - küsst Patienten 4. Empathie - für Patienten da sein - fragt Patienten nach seinen Wünschen 5. Einflussnahme auf Stimmung - mit Optimismus aus Tief herausholen - sagt Patienten, dass dieser keine Angst haben muss 6. Feedback - Fortschritte aufzeigen, die der Patient gemacht hat - dem Patienten sagen, dass er es schon weit geschafft hat 7. Praktische Hilfe - dem Patienten bei Aufstehen helfen - den Patienten anziehen 8. Unterstützung der medizinischen Behandlung / des Genesungsverlaufs - unterhält sich mit Patienten von der Seite, die der Arzt wünscht - zeigt Patient Bilder 9. „Positive“ Bewertung und aktivierende Inangriffnahme - Patienten Mut machen - ermuntert Patienten zur Selbständigkeit 10. Zukunftsperspektiven - zeigt Positives für Zukunft auf - motiviert durch Ziel, in Urlaub zu fahren 11. Information / Einbindung in Familie und soziales Umfeld - richtet Patient Grüße von Freunden aus - bringt Post mit, damit Patient über alles Bescheid weiß 12. Weiterführung des bisherigen Lebensstils - sagt Patient, dass er sich wegen zu Hause keine Sorgen machen braucht - hat Leitung der Firma übernommen und beruhigt Patienten, dass alles klappt 13. Anpassung des Wohnumfelds an vorhandene Beeinträchtigungen - besorgt Rollstuhl für Patienten - versucht Wohnung zu renovieren, damit Patient dann das Zuhause genießen kann 14. Nicht zuzuordnen - schöpft alle Möglichkeiten aus - erklärt wie es läuft Entwicklung des Kategoriensystems Die Entwicklung des Kategoriensystems zum Rating supportiver Handlungen basiert auf Angaben der Partner von Patienten bzgl. möglicher supportiver Handlungen zur Erreichung der drei Ziele supportiven Verhaltens, welche im Card Sorting auf die Rangplätze 1 bis 3 sortiert wurden. Es wurden die Angaben der ersten 28 Partner zu T1 betrachtet. Ein Partner konnte keine Angaben machen, ein weiterer notierte einfach nur "ja", was sofort als "nicht auswertbar" eingestuft wurde. Die Angaben der verbliebenen 26 Partner wurde für jede gewählte Karte aufgelistet. Der wiss. Projektmitarbeiter entwickelte auf der Grundlage der inhaltlichen Ähnlichkeit der Angaben ein erstes Kategoriensystem. Als heuristische Regel galt, die Angaben nach den übergeordneten Gesichtspunkten "Handlungen mit Fokus auf Partner", "Handlungen mit Fokus auf Patient" und "Handlungen mit Fokus auf soziales Umfeld" zu gruppieren. Es wurde ein vorläufiges Kategoriensystem mit 21 Kategorien gebildet. Diese wurden durch einen Satz inhaltlich charakterisiert. Anhand dieser näheren Kennzeichnung der Kategorien wurden alle Partnerangaben durch den wiss. Mitarbeiter und zwei studentische Hilfskräfte den Kategorien zugeordnet. Als "Sinneinheiten" galten zusammenhängend notierte Halbsätze und Stichworte der Partner. Diese Aussagen wurden darauf hin untersucht, ob sie inhaltlich unterschiedliche Einzelhandlungen beinhalteten, die ggf. verschiedenen Kategorien zuzuordnen wären. Die Rater beurteilten die Angaben unabhängig voneinander. Insgesamt lagen 235 Aussagen vor, worunter sich auf Mehrfachnennungen befanden. Für 217 Items lag eine Einschätzung von allen drei Ratern vor. 61 % der Items wurden von allen drei übereinstimmend einer Kategorie zugeordnet, 29 % wurden von zwei der drei Ratern derselben Kategorie zugeordnet. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde analysiert, für welche der Kategorien die Zuordnung in hohem bzw. niedrigem Maße übereinstimmte. Kategorien mit hoher Übereinstimmung wurden als hinreichend genau definiert und identifizierbar eingeschätzt und beibehalten. Schwach definierte Kategorien wurden nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammengefasst. Dies resultierte in einem neuen System mit 14 Kategorien (inkl. einer Restkategorie). Diese 14 Kategorien, die anhand der Antworten der Partner bzgl. möglicher (somit "hypothetischer") Verhaltensweisen zur Erreichung der wichtigsten Ziele ihres supportiven Verhaltens entwickelt wurden, wurden dann auch für das Rating der konkreten Verhaltensweisen, welche die Partner im Interview zur sozialen Unterstützung angaben, herangezogen. Deutsche Version des Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire von King, Crawford, Wenden, Moss & Wade (1995) Einige Personen haben nach einer Kopfverletzung oder nach einem Unfall Beschwerden, die ihnen Sorgen oder Unannehmlichkeiten bereiten. Wir möchten gerne von Ihnen erfahren, ob die unten genannten Beschwerden zur Zeit bei Ihnen auftreten. Da viele der Beschwerden auch unter normalen Umständen immer wieder mal auftreten, bitten wir Sie, sich bei Ihrer Einschätzung mit Ihrem Zustand vor der Kopfverletzung bzw. dem Unfall zu vergleichen. Markieren Sie bitte bei jeder Aussage die Zahl mit einem Kreis, die Ihrer Einschätzung am ehesten entspricht. 0 = tritt überhaupt nicht auf 1 = tritt auf, aber nicht stärker als vorher 2 = ist ein geringfügiges Problem 3 = ist ein mittleres Problem 4 = ist ein deutliches Problem Im Vergleich mit der Zeit vor der Kopfverletzung / dem Unfall, leiden Sie jetzt an: 1. Kopfschmerzen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 2. Schwindelgefühle 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 3. Übelkeit und / oder Erbrechen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 4. Geräuschempfindlichkeit, 0 1 2 3 4 leicht erregbar durch laute Geräusche ...................................................................................................................................................... 5. Schlafstörungen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 6. Müdigkeit, schnellere Ermüdbarkeit 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 7. Reizbarkeit, schnell verärgert 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 8. Gefühl tiefer Traurigkeit, zum Weinen zu Mute 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 9. Frustriertsein oder Ungeduld 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 10. Vergeßlichkeit, schwaches Gedächtnis 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 11. Schwaches Konzentrationsvermögen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 12. Verlangsamtes Denken 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 13. Verschwommensehen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 14. Lichtempfindlichkeit, 0 1 2 3 4 leicht erregbar durch starke Helligkeit ...................................................................................................................................................... 15. Doppeltsehen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 16. Nervöse Unruhe 0 1 2 3 4 Treten bei Ihnen irgendwelche andere Beschwerden auf? Geben Sie bitte an, um welche es sich handelt, und schätzen Sie sie ein. 1. 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 2. 0 1 2 3 4 Deutsche Version des Rivermead Head Injury Follow-up Questionnaire von Crawford, Wenden & Wade (1996) Einige Personen haben nach einer Kopfverletzung oder nach einem Unfall Schwierigkeiten, die ihnen Sorgen oder Unannehmlichkeiten bereiten. Wir möchten gerne von Ihnen erfahren, ob Sie Probleme mit den unten aufgelisteten Aktivitäten haben. Vergleichen Sie sich bei Ihrer Einschätzung bitte mit Ihren Fähigkeiten und Ihrem Zustand vor der Kopfverletzung bzw. dem Unfall. Markieren Sie bitte bei jeder Aussage die Zahl mit einem Kreis, die Ihrer Einschätzung am ehesten entspricht. 0 = keine Veränderung 1 = keine Veränderung, aber es fällt schwerer 2 = eine leichte Veränderung 3 = eine mittlere Veränderung 4 = eine sehr deutliche Veränderung Im Vergleich mit der Zeit vor dem Unfall / der Kopfverletzung, a) hat es eine Veränderung gegeben ...? 1. in Ihrer Fähigkeit, ein Gespräch mit einer Person zu führen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 2. in Ihrer Fähigkeit, an einem Gespräch mit zwei oder mehr 0 1 2 3 4 Personen teilzunehmen ...................................................................................................................................................... 3. bei der Verrichtung alltäglicher häuslicher Arbeiten 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 4. in Ihrer Fähigkeit, Ihre früheren sozialen 0 1 2 3 4 Aktivitäten auszuüben ...................................................................................................................................................... 5. in Ihrer Fähigkeit, Ihre früheren Freizeitvergnügen zu genießen 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 6. in Ihrer Fähigkeit, Ihr früheres Arbeitspensum / Ihren 0 1 2 3 4 früheren Arbeitsstandard beizubehalten ...................................................................................................................................................... 7. in Ihrem Empfinden, daß Arbeit Sie ermüden läßt 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 8. in Ihren Beziehungen mit Ihren vorherigen Freunden 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 9. in Ihrer Beziehung mit Ihrem Partner 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 10. in Ihrer Fähigkeit, mit familiären Anforderungen und 0 1 2 3 4 Ansprüchen umzugehen b) Gibt es andere Schwierigkeiten ? Geben Sie bitte an, um welche es sich handelt, und schätzen Sie sie ein. 1. 0 1 2 3 4 ...................................................................................................................................................... 2. 0 1 2 3 4