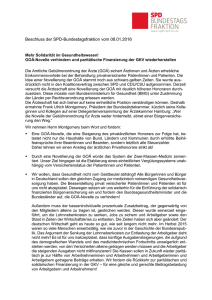Auswirkungen auf Labormarkt und Versorgungs
Werbung

Reform der Gebührenordnung für Ärzte Auswirkungen auf Labormarkt und Versorgungsstrukturen in Deutschland Kontaktinformationen Über die Autoren Berlin Düsseldorf Peter Behner Geschäftsführer +49-30-88705-841 peter.behner @strategyand.de.pwc.com Dr. Sven Uwe Vallerien Geschäftsführer +48-211-3890-260 sven.vallerien @strategyand.de.pwc.com Stefan Danner Geschäftsführer +49-30-88705-868 stefan.danner @strategyand.de.pwc.com Frankfurt Holger Schmidt Geschäftsführer +49-30-88705-861 holger.schmidt @strategyand.de.pwc.com Dr. Rainer Bernnat Geschäftsführer +49-69-97167-414 rainer.bernnat @strategyand.de.pwc.com München Marcus Bauer Geschäftsführer +49-89-54525-0 marcus.bauer @strategyand.de.pwc.com Dr. Christian R. Becker ist Manager bei PwC Strategy& in München, PwCs Strategieberatungsgeschäft. Als Facharzt für Innere Medizin berät er Klienten in allen Sektoren der Gesund­heitsindustrie, im Bereich der Gesundheitsversorgung, Kranken­ versicherung, im Öffentlichen Sektor und gemeinnützigen Gesund­heits­ organisationen. Lukas Lange ist Consultant bei PwC in Frankfurt. Er ist als Berater im Transaktionsumfeld branchenübergreifend tätig. Dr. Bruno Rosen ist Geschäftsführer der accantes GmbH und besitzt über 17 Jahre Erfahrung in geschäftsführenden und beratenden Funktionen in der Medizintechnik und Pharmazeutischen Industrie. Danksagung Die Autoren möchten der zentralen Rolle von zahlreichen Teilnehmern an Treffen und Gesprächspartnern in ganz Deutschland Rechnung tragen. Ohne ihre sachkundigen Erkenntnisse wäre die Studie in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen. 2 Strategy& Inhalt 1. Zielsetzung und Inhalt der Studie.................................................. 7 2. Markt für labordiagnostische Leistungen in Deutschland................ 9 3. GOÄ-Reform – Hintergrund und Verhandlungsstand.................... 16 4. Mögliche Auswirkungen der GOÄ-Reform auf die Laborversorger..... 18 4.1 Methodik und Annahmen unseres Simulationsmodells........... 18 4.2 Wirtschaftliche Effekte einer GOÄ-Veränderung.................... 19 5. Zusammenfassung und Ausblick.................................................. 25 6. Appendix..................................................................................... 28 Strategy& 3 Executive summary Vor der Therapie einer Erkrankung steht die ärztliche Diagnose. Der Weg hin zu dieser ist ohne eine hochentwickelte Labordiagnostik heute nicht mehr vorstellbar. Rund 70% der medizinischen Diagnosen werden maßgeblich unter Zuhilfenahme einer umfassenden labor­me­ dizinischen Untersuchung gestellt. Auch die Beurteilung chronischer Krankheits­ver­läufe ist zumeist ohne Labordiagnostik nicht möglich. Laborverlaufspara­meter werden hierbei zur zeitlichen Verlaufs­beur­ teilung benötigt. Der Nutzen der Labordiagnostik für die Qualität des gesamten Krankheits­manage­ments eines Patienten ist in allen medizinischen Fachkreisen unbestritten. Seit dem Jahre 2010/2011 verhandeln der Verband der Privaten Kranken­ versicherung und die Bundesärztekammer über die komplette Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Der Reformprozess befindet sich in der Endphase. Im Rahmen des Reformprozesses wird auch die Labordiagnostik (Kapitel M) neu bewertet. Von der Vergütungsreform des Kapitels M der GOÄ werden alle Ärzte betroffen sein, die Laborleistungen zur Patientenversorgung erbringen. Die Gruppe der Laborversorger umfasst laborfachärztliche Labore, Krankenhauslabore, Laboreigenerbringer und alle niedergelassenen Ärzte, die Laborleistungen in der eigenen Praxis erbringen oder als Mitglied einer Laborgemeinschaft beziehen. In der Öffentlichkeit werden die möglichen Auswirkungen der geplanten Vergütungsreform auf die Laborversorger und die Patienten bisher wenig diskutiert. Mit der hier vorliegenden Studie sollen die betreffenden Wirkzusammenhänge transparent aufgezeigt und damit ein Beitrag zu einer informierten Diskussion der Betroffenen geliefert werden. In Gesprächen mit Marktteilnehmern im Laborbereich wurde deutlich, dass mit einer erheblichen Absenkung der GOÄ-Vergütung im Kapitel M gerechnet wird. Im Bereich der Basislaborleistungen (MII) wird eine Ab­senkung von bis zu 60% befürchtet. Bei den Speziallaborleistungen (MIII und MIV) wird eine verminderte Absenkung von bis zu 30% diskutiert. 4 Strategy& In Bezug auf die Vorhalteleistungen (MI) wird spekuliert, dass deren Vergütung nicht wesentlich von dem bisherigen Niveau abweichen wird. Welche Folgen hat eine Absenkung der GOÄ-Vergütung für die einzelnen Laborversorger und die Patienten? Laborfachärztliche Labore müssen substantielle Einbußen bei den Honoraren hinnehmen. Die Reaktionsmöglichkeiten zur Kostensenkung bei gleichzeitigem Erhalt der Versorgungsqualität sind aufgrund des bereits sehr hohen Rationalisierungsgrades im deutschen Labormarkt beschränkt. Maßnahmen zur Reduktion von Durchführungskosten mittels Erhöhung von Serienlängen oder zur Reduktion von Proben­ logistikkosten könnten sich in einer verzögerten Verfügbarkeit von Labordiagnosen niederschlagen. Darüber hinaus sind Einsparungen im Personalbereich zu erwarten, die mit einem Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen. Einige laborfachärztliche Labore werden vom Markt verschwinden. Dies wird eine weitere Konsolidierung des Marktes zur Folge haben, die wiederum mit einem weiteren Arbeitsplatzabbau einhergeht. Eine Niederlassung wird durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer unattraktiver. Viele jüngere Laborfachärzte werden deshalb noch häufiger ein Anstellungsverhältnis vorziehen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass Innovationen verlangsamt in den deutschen Markt eingeführt werden. Forschung und Entwicklung werden potenziell sukzessive ins Ausland verlagert und der Anschluss an wegweisende Zukunftsfelder, wie beispielsweise die therapiebegleitende Diagnostik („Companion Diagnostics“), möglicherweise verpasst. Zudem könnten sich durch das neue europäische Medizinproduktegesetz regulatorische Hürden und mit diesen verbundene Kosten weiter erhöhen und ein Innovationsstopp damit wahrscheinlicher werden. Die Qualität und die Verfügbarkeit der Laborversorgung geraten damit insgesamt in Gefahr. Krankenhauslabore sind aufgrund ihres relativ hohen Anteils an abge­ rech­neten Basislaborleistungen (MII) stärker als die laborfachärztlichen Labore von der diskutierten Absenkung der Vergütung betroffen. Durch diese würde ein wichtiger Beitrag zur Deckung der Laborkosten für sie wegfallen und die finanzielle Gesamtsituation der Krankenhäuser sich damit verschlechtern. Eine Absenkung der GOÄ-Vergütung wird diejenigen Krankenhäuser im Besonderen tangieren, deren Ergebnis­ situation ohnehin angespannt ist. Als mögliche Reaktion ist zu erwarten, dass Krankenhauslabore vermehrt Untersuchungen mit geringer Serienlänge an externe Labore abgeben. Auch ein Outsourcing des kompletten Labors wird als mögliche Reaktion genannt. Einige Leiter klinischer Labore sehen die zunehmende Fremdvergabe kritisch. Sie befürchten, dass dabei die diagnostische Qualität sinken könnte, weil ein direkter persönlicher Kontakt zwischen Strategy& 5 Kliniker und Laborarzt nicht mehr gegeben ist. Auch bei einem Out­sourcing des Labors an einen externen Anbieter wird die größere Schnittstelle zwischen Kliniker und Laborarzt als Risikofaktor angesehen. Leiter von laborfachärztlichen Laboren, die Krankenhäuser mitversorgen, erachten die zunehmende Fremdvergabe und das Outsourcing des krankenhauseigenen Labors als weniger problematisch. Sie betonen, dass durch gute Service- und Beratungsleistungen ein Verlust an diagnostischer Qualität vermieden werden kann. Eine hohe Serviceleistung und -qualität können dabei insbesondere in Ballungszentren sichergestellt werden. Mit wachsender geografischer Distanz zwischen Labor und Krankenhaus und in strukturschwachen Regionen wird dies jedoch zunehmend schwieriger. Die Kostenoptimierung an dieser Schnittstelle würde damit eine gegenläufige Entwicklung zu dem Trend darstellen, dass insbesondere bei komplexen Krankheitsbildern klinische Fachärzte zukünftig noch mehr als bisher mit ihren Kollegen aus der Labormedizin interdisziplinär zusammenarbeiten müssen, so u. a. auch im direkten Gespräch. Die Absenkung der Vergütung von Basislaborleistungen trifft neben den Krankenhäusern insbesondere diejenigen Ärzte, die Laborleistungen als Mitglied einer Laborgemeinschaft beziehen und abrechnen. Für viele niedergelassene Ärzte macht der Umsatz mit Laborleistungen aus der Laborgemeinschaft einen wesentlichen Teil ihres Praxisumsatzes aus. Eine Absenkung der Vergütung von Basislaborleistungen wird daher insbesondere angesichts der angespannten Niederlassungssituation von Hausärzten von Leistungserbringern kritisch gesehen. Sollte neben der Absenkung der GOÄ-Vergütung zudem im EBM (dem Vergütungskatalog für kassenärztliche Leistungen) die Quotierung oder das Mengengerüst weiterhin sinken, würde sich die wirtschaftliche Situation aller Labore weiter verschlechtern und die beschriebenen strukturellen Veränderungen sowie negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität weiter vorangetrieben. 6 Strategy& 1. Zielsetzung und Inhalt der Studie Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist verpflichtend für alle patien­ tenbezogenen Abrechnungen ärztlicher Leistungen, die nicht über den einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechnet werden. So ist auch die Vergütung von ambulant und stationär veranlassten Laborleistungen im privatärztlichen Bereich durch die GOÄ festgelegt. Die letzte Neufassung (Novellierung) der GOÄ stammt aus dem Jahr 1982/83, inflationsbedingte Preisanpassungen wurden darin 1996 vorgenommen. Aus Sicht der Marktteilnehmer besteht insofern ohne Zweifel ein Bedarf hinsichtlich einer Aktualisierung von Struktur und Vergütung der GOÄ, da diese weder in Bezug auf den aktuellen Stand labordiagnostischer Methoden und innovativer Parameter noch in Bezug auf deren kalkulatorische Kostenbasis zeitgemäß sind. Insbesondere bedürfen die Laborleistungen (Kapitel M der GOÄ) aus Sicht der privaten Krankenversicherung (PKV) im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und deren EBM-Vergütungs­ niveau einer strukturellen und preislichen Anpassung. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit dieser GOÄ-Reform kommuniziert, dass die PKV die ärztliche Zuwendung und Zeit stärker honorieren will als bisher und im Gegenzug technische Leistungen, wie etwa Labormedizin oder Radiologie, nicht in gleichem Maß priorisiert. Sollte eine Absenkung der seit 1996 unveränderten Vergütung privatärzt­ licher Laborleistungen erfolgen, könnten sich die ökonomischen Rahmenbedingungen, unter denen bisher eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung stattfindet, verschlechtern. Die Labordiagnostik ist essentieller Bestandteil einer zeitnahen und präzisen Diagnostik und Therapie. Ergäben sich durch die wirtschaftlichen Veränderungen auch strukturelle Veränderungen im ambulanten und stationären Labormarkt, könnten Qualitätsbeeinträchtigungen in Bezug auf die Behandlung der Patienten nicht ausgeschlossen werden. Eine GOÄ-Reform tangiert damit letztendlich auch die Patienten und die Versorgungsqualität der Bevölkerung in Deutschland. Offizielle Informationen über die bisher erreichten Verhandlungsergebnisse hinsichtlich des Kapitels M der GOÄ (Vergütung von Laborleistungen) sind nur sehr begrenzt vorhanden. Ebenso liegen aktuell keine veröffentlichten Strategy& 7 Analysen möglicher Anpassungen und Konsequenzen für die Laborund Versorgungslandschaft vor. Ziel dieser Studie ist es, mögliche Auswirkungen einer GOÄ-Reform auf diese aufzuzeigen. Damit soll allen eingebundenen Marktteilnehmern eine Diskussionsbasis an die Hand gegeben werden, um vorausschauende und informierte Entscheidungen treffen sowie die Reform-Debatte ggf. aktiv mitgestalten zu können. Die vorliegende Studie wurde von Strategy&, der internationalen Strategieberatung von PwC, durchgeführt. Neben der Recherche und Analyse des aktuellen Informationsstandes zur GOÄ-Reform erfolgte eine qualitative Befragung von 17 Marktteilnehmern (siehe Abbildung 7 im Appendix) zu Status, Bedeutung und möglichen Auswirkungen dieser Reform auf den deutschen Labormarkt und die Versorgungslandschaft. Hierbei wurden Leiter medizinischer Labore unterschiedlicher Größe und rechtlicher Formen, klinisch tätige Ärzte sowie Experten aus Industrie, Wissenschaft, Politik, Selbstverwaltung und Krankenversicherungen in Deutschland von Strategy& befragt. Die Studie liefert einen Überblick über den Status quo des Marktes für labordiagnostische Leistungen in Deutschland sowie die Struktur der gegenwärtigen Anforderungs- und Leistungsbeziehungen verschiedener Marktteilnehmer untereinander. Mögliche Auswirkungen einer GOÄReform werden für ausgewählte Laborversorger quantifiziert und deren Ausmaß hinsichtlich wirtschaftlicher und struktureller Effekte diskutiert. Neben dieser mikroökomischen Betrachtung werden potenzielle Auswirkungen auf die Versorgungslandschaft im Ganzen skizziert. 8 Strategy& 2. Markt für labordiagnostische Leistungen in Deutschland Stellenwert labordiagnostischer Untersuchungen Labormedizinische Untersuchungen sind entscheidend für die Differen­ tial­diagnostik sowie das Monitoring von Erkrankungen und ihren Vorstufen. 70% aller Diagnosen werden maßgeblich auf der Basis von Laboruntersuchungen gestellt. Ein modernes Management chronischer Erkrankungen − beispielsweise von Diabetes mellitus − ist ohne labordiagnostisches Monitoring nicht mehr denkbar. Die Bedeutung eines optimalen diagnostischen Prozesses wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass gemäß einer Studie im JAMA (2009) Fehler im diagnostischen Prozess für mehr als 40.000 Todesfälle jährlich und 47% der ernsthaften Behinderungen (USA) verantwortlich sind. Das Spektrum labordiagnostischer Untersuchungen ist mit 5.000 bis 6.000 Parametern groß. Es umfasst u. a. die Bereiche Klinische Chemie, Hämatologie, Gerinnung, Immunologie, Infektionsdiagnostik, Molekularbiologie und Molekulargenetik, die mikrobiologische Diagnostik sowie angrenzende Gebiete wie die Zytologie. Zugleich unterliegt die Labordiagnostik einer kontinuierlichen Weiterent­wicklung durch neue Erkenntnisse in Bezug auf die Pathomechanismen von Erkrankungen. Bekannte und etablierte Parameter verlieren nicht ihren Stellenwert, denn ihre diagnostische Trennschärfe und ihr prognostischer Wert sind in der Medizin unumstritten. Derzeit werden zahlreiche neue Testverfahren entwickelt. Ein wesentlicher Treiber dafür ist die Evolution von Arzneimittelprodukten innerhalb der „personalisierten Medizin“, die gezielt zur Behandlung bestimmter Patientengruppen herangezogen werden. Die therapie­beg­leitende Diagnostik („Companion Diagnostics“) bildet einen wichtigen Bestandteil der personalisierten Medizin. Die Einführung spezifischer labor­diag­ nostischer Tests in die Routine erfordert hohe Investitionen und stellt damit eine große Herausforderung für die Labormedizin dar. Strategy& 9 Struktur der Laborlandschaft, Leistungsbeziehungen und Vergütungssystematik Laborleistungen können grundsätzlich entweder durch Selbstmessung des Patienten oder durch folgende Laborversorger erbracht werden: • haus-/fachärztliches Praxislabor • Ärzte in Laborgemeinschaft • Laboreigenerbringer • laborfachärztliches Labor • Krankenhauslabor Die Abrechnung von Laborleistungen ist für Kassenpatienten durch den einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) geregelt. Für Privatpatienten findet die GOÄ Anwendung. Die derzeitige Abrechnungssystematik für Laborleistungen nach GOÄ ist in deren Kapitel M mit den Unterkapiteln I–IV zusammengefasst. Das Unterkapitel MI umfasst die Vorhalte­leistungen, das Unterkapitel MII die Basislaborleistungen, die Unterkapitel MIII und MIV die Speziallaborleistungen. Abbildung 1 Leistungsbezug privatärztlicher Laborleistungen und deren Abrechnung nach GOÄ Selbstmessung Patient Haus-/fachärztliches Praxislabor Ärzte in Laborgemeinschaft Laboreigenerbringer Laborfachärztliches Labor Krankenhauslabor MI MII MII, MIII, MIV MII, MIII, MIV MII, MIII, MIV Leistungsanforderung Abrechnung nach GOÄ Quelle: Strategy& Analyse 10 Strategy& Nach § 1 Abs. 1 GOÄ bildet die GOÄ die verpflichtende Basis für alle Abrechnungen von Laborleistungen gegenüber Patienten, sofern keine anderen Regelungen greifen, wie z. B. der EBM. Seit der letzten GOÄNovellierung (1996) sind zahlreiche neue Methoden in die Laborroutine eingeführt worden, für die derzeit im Wesentlichen sogenannte Analogziffern abgerechnet werden. In Abbildung 1 werden vereinfachend privatärztliche Leistungs­be­zie­hun­ gen (MI bis MIV) zwischen Patient und Laborversorgern dargestellt. Haus- und fachärztliches Praxislabor Niedergelassene Ärzte haben das Recht, für gesetzlich und privat versicherte Patienten ein Labor vorzuhalten (Vorhalteleistung: MI und Teile aus EBM 32.1), mit dem man patienten- und zeitnah eine Auswahl von Laborparametern messen kann („Praxislabor“). Diese Vorhalteleistungen erfordern ebenso aufwändige Qualitäts­siche­rungs­ maßnahmen nach Rili-BÄK, wie sie für eine Laborgemeinschaft oder ein laborfachärztliches Labor gelten. Das Unterkapitel MI der derzeit geltenden GOÄ umfasst 30 diagnostische Tests, die als Querschnitt den Unterkapiteln MII–MIV entnommen werden. Voraussetzung für eine MI-Abrechnung ist, dass die Messung in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang mit der Behandlung eines Patienten im Praxislabor erbracht wird (Point-of-Care-Testung). Die Leistung kann von jedem Arzt direkt mit dem Patienten abgerechnet werden. Die Vergütung von Leistungen im Praxislabor ist auskömmlicher als die der Leistungen von MII–MIV, da von höheren Durchführungskosten ausgegangen wird. Ärzte in Laborgemeinschaft Alle Arztgruppen sind ermächtigt, Leistungen nach GOÄ, Unterkapitel MII, aus einer Laborgemeinschaft zu beziehen und dann als eigene Leistung direkt mit dem Patienten abzurechnen. Bei einer Laborgemein­ schaft handelt es sich um eine Gemeinschaftseinrichtung von Ärzten, die den Zweck hat, labormedizinische Analysen in einer gemeinschaftlich genutzten Betriebsstätte zu erbringen. Im EBM-Bereich wurde 2008 die Direktabrechnung eingeführt, um Mengenanreize einzudämmen. Daher rechnet die Laborgemeinschaft direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Die direkte Abrechnung mit dem Patienten ist seitdem nur noch für Leistungen möglich, die nach der GOÄ, Unterkapitel MII, abgerechnet werden. Laboreigenerbringer Zusätzlich zu dem laborfachärztlichen Labor erbringen qualifizierte Fachärzte als sogenannte Laboreigenerbringer ebenfalls Laborleistungen. Strategy& 11 Diese Eigenerbringer sind ermächtigt, fachspezifische Untersuchungen aus den GOÄ-Unterkapiteln MII–MIV und den Abschnitten 32.2 und 32.3 des EBM durchzuführen und abzurechnen. Voraussetzung ist die „labormedizinische Fachkunde“ innerhalb des fachärztlichen Hauptgebiets. Laborfachärztliches Labor Die Grundstruktur von laborfachärztlichen Labore ist jeweils identisch, dennoch gibt es Unterschiede in Bezug auf deren Rechtsform und Angebotsprofil. Bei einer Gesamtanzahl von ca. 5.000–6.000 Labor­pa­ rametern ist es verständlich, dass nicht jedes Labor alle diesbezüglichen Untersuchungen anbieten kann. Ein breites Labor­netzwerk stellt eine flächendeckende Versorgung sicher, ohne dass Einsender oder Patienten den logistischen Aufwand als nachteilig empfinden. Laborfachärztliche Labore schließen sich u. U. zusammen, wobei eine Bündelung untersuchungstechnischer Kompetenzen stattfindet, ohne dass dies derzeit zu Service- oder Leistungs­ein­schrän­kungen führt. Diese Bündelung erfolgt aus qualitativen und wirtschaftlichen Gründen (z. B. Erhöhung von Serienlängen zur Senkung von Durchführungskosten). Laborfachärztliche Labore bieten das Spektrum von GOÄ, Unterkapitel MII–MIV, sowie EBM, Abschnitte 32.2 und 32.3, an. An das labor­ fachärztliche Labor überwiesene MII–MIV-Leistungen werden direkt mit den Privatpatienten abgerechnet. Neben der Versorgung von niedergelassenen Ärzten nehmen viele laborfachärztliche Labore als Outsourcingpartner auch an der Versorgung von Krankenhäusern teil. Laborgemeinschaften sind häufiger an Facharztlabore angegliedert, nutzen gegen Entgelt die Infrastruktur dieser Labore und beziehen die technischen Leistungen von ihnen. Hierfür werden entsprechende Verträge geschlossen, sodass die Laborgemeinschaft die auf sie entfallenden Kosten trägt. Krankenhauslabor Wenn ein Privatpatient die ambulante oder stationäre Versorgung im Krankenhaus in Anspruch nimmt und dabei eine labordiagnostische Untersuchung anfällt, wird die betreffende Untersuchung entweder im krankenhauseigenen Labor oder in einem externen Labor durchgeführt. Für stationäre Patienten sind Laborleistungen in den DRGs (Diagnose­be­ zogene Fallgruppen) inkludiert. Stationäre Laborwahlleistungen werden separat nach GOÄ abgerechnet. Grundsätzlich können Krankenhäuser alle Leistungen nach EBM und GOÄ, Unterkapitel MI–IV, abrechnen. Hierbei werden Leistungen der Unterkapitel MII–MIV vom Krankenhauslabor und Leistungen des Unterkapitels MI von anderen Abteilungen des Krankenhauses abgerechnet. 12 Strategy& Laborspezifische Fachärzte in Deutschland In Deutschland gibt es derzeit insgesamt rund 1.100 berufstätige Fachärzte für Labormedizin und rund 700 berufstätige Mikrobiologen. Im ambulanten Sektor arbeiten mehr Laborärzte in einem Anstellungs­verhältnis als in Selbständigkeit (siehe Abbildung 2). Als ein wesentlicher Treiber struktureller Veränderungen im Labormarkt wird die Nachwuchssituation in Bezug auf Fachärzte für Labormedizin und Mikrobiologie gesehen. Die Ausbildung zum Facharzt für Labormedizin hat offensichtlich über die nähere Vergangenheit an Attraktivität verloren. Auch die Abwertung zahlreicher Lehrstühle für Labormedizin in Universitätskliniken zu Servicestellen reduziert teilweise die Attraktivität dieses Fachgebiets. Jedoch ist zu beobachten, dass der Beruf des Labormediziners – auch begründet durch die Personalknappheit – immer wertvoller wird. Konsolidierungsprozess im Labormarkt In den letzten Jahren ist die Anzahl wirtschaftlich eigenständiger Labore zurückgegangen. Ursachen hierfür sind der wirtschaftliche Druck durch die Honorarpolitik im GKV-Bereich, Nachfolgefragen und der Erwerbsdruck durch Finanzinvestoren. Politische Entscheidungen Abbildung 2 Verteilung der Laborärzte und Mikrobiologen nach Tätigkeitsgebieten 1,524 460 1,064 1,079 114 348 1,064 270 731 106 284 144 731 396 Laborärzte Strategy& Tätigkeitsgebiet 154 Berufstätig Nicht Berufstätig Niedergelassen Angestellt ambulant Krankenhaus Sonstige 327 Mikrobiologen Tätigkeitsgebiet Quelle: Ärztestatistik der Bundesärztekammer zum 31. Dezember 2014 13 haben zu einer Öffnung des Marktes für internationale Finanzinvestoren geführt. Der Einstieg von Finanzinvestoren, die durch Übernahmen und Zukäufe einen aggressiven Expansionskurs verfolgten, führte zum Aufbau sehr großer Laborstrukturen. So teilen heute die fünf größten Laboranbieter etwa 40–50% des für laborfachärztliche Labore zugänglichen Markts unter sich auf. Die andere Hälfte des Marktes wird von Einzellabors oder mittelständischen eigentümergeführten Verbünden geprägt. Ausgaben für labordiagnostische Leistungen in Deutschland Aus der Gesundheitsausgabenrechnung des statistischen Bundesamtes geht hervor, dass sich das Gesamtmarktvolumen ärztlicher Labor­leistun­gen im Jahr 2013 auf 7,9 Mrd. € belief. Histologische, zytologische und zytogenetische Leistungen werden in der Gesundheitsausgaben­rechnung ebenfalls den Ausgaben für Laborleistungen zugewiesen. Abbildung 3 zeigt, wie sich diese Ausgaben auf die einzelnen Kosten­träger verteilen. Von den 7,9 Mrd. € entfallen 5,4 Mrd. € auf die gesetzlichen Kranken­ kassen und 1,4 Mrd. € auf die privaten Krankenversicherungen. Die Ausgaben der Arbeitgeber in Höhe von 0,6 Mrd. € umfassen im Wesentlichen Leistungen der öffentlichen Beihilfe. Ausgaben privater Haushalte (0,2 Mrd. €) beziehen sich auf Zuzahlungen und Selbstbehalte privat Krankenversicherter sowie Wahlleistungen gesetzlich Versicherter. Unter „Sonstige“ werden die Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung und der öffentlichen Haushalte zusammengefasst. Die Ausgaben für Privatversicherte und Privatzahler summieren sich auf rund 2,2 Mrd. € (siehe Abbildung 3, Seite 15). 14 Strategy& Abbildung 3 Ausgaben für Laborleistungen nach Kostenträgern im Jahr 2013 Die Kategorie „Arbeitgeber” enthält im Wesentlichen die Ausgaben der öffentlichen Beihilfe 1 in Mrd. € Ausgaben der privaten Haushalte umfassen im Wesentlichen Zuzahlungen und Selbstbehalte privat Krankenversicherter und Wahlleistungen gesetzlich Versicherter 2 5,4 Primär Privatversicherte und Privatzahler ~2,2 Mrd. € 7,9 Unter „Sonstige“ werden die Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung, gesetzlichen Rentenversicherung und der öffentlichen Haushalte zusammengefasst 3 1,4 0,6 ∑ GKV PKV Arbeitgeber1 0,2 Private Haushalte2 0,3 Sonstige3 Quelle: Statistisches Bundesamt, Strategy& Analyse Strategy& 15 3. GOÄ-Reform – Hintergrund und Verhandlungsstand Die GOÄ, nach der ärztliche Leistungen vergütet werden, sofern nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt wird, stammt in ihrer derzeitigen Struktur und Vergütungshöhe aus dem Jahr 1996 und ist unverändert in Gebrauch. Die GOÄ ist somit Abrechnungsbasis für die PKV, für beihilfeberechtigte Beamte, für die Heilfürsorge und für Selbstzahler. Den Gebührenordnungspositionen wurden Punktwerte zugeordnet, jeder Punkt wird mit 5,83 Cent bewertet. Im Kapitel M der GOÄ sind alle Laborleistungen erfasst. Die GOÄ ist eine Rechtsverordnung des Bundes, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Seit 2010/2011 wird zwischen der Bundesärztekammer (BÄK) und dem Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) verhandelt. Da die Beteiligten in Bezug auf den Stand der GOÄ-Reform Stillschweigen vereinbart haben, sind keine belastbaren Informationen hierzu vorhanden. Für die BÄK ist es ein Balanceakt, die Erwartungen aller ärztlichen Berufsgruppen an eine neue GOÄ zu erfüllen. Seitens der Vertreter der BÄK wird stets betont, dass es bei der Reform keine Verlierer unter den Arztgruppen geben soll. Zahlreiche Marktteilnehmer sehen dies skeptisch und halten eine Absenkung der Honorare im Bereich der Labormedizin zugunsten der „sprechenden Medizin“ für wahrscheinlich. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) fordert einen Konsens von BÄK, PKV und Beihilfe. Dies ist ein fragiler Prozess, denn jede Detail­ei­ni­ gung gilt nur dann, wenn BÄK und PKV auch über das gesamte Reformpaket Einigkeit erzielt haben. Am 31.03.2015 wurde dem BMG das sogenannte GOÄneu-Informationspaket von der BÄK und der PKV vorgelegt: Es umfasst die Top-400-Gebührenordnungspositionen, die vollständigen Kapitel B und M sowie den Entwurf des Paragraphenteils der neuen GOÄ. Bisher nicht endgültig verhandelt ist die Bewertung der einzelnen Positionen in Euro. „Es gibt einen Konsens zwischen der Bundes­ ärztekammer, dem PKV-Verband und der Beihilfe, dass die neue GOÄ auf einer betriebs­wirt­schaft­lichen Basis fußen soll“, so die PKV in 16 Strategy& einer Mitteilung vom 04.06.2014. Dafür seien zum Beispiel Miete, Einkommen des Praxispersonals, medizinische Geräte und ärztliche Tätigkeit an sich berücksichtigt. „Das Ergebnis dieser Bewertung ist offen“, so der PKV-Bericht. Bekannt ist u. a., dass die derzeit ca. 920 GOÄ-Positionen im Kapitel M auf deutlich über 1.100 Positionen ausgeweitet werden, wodurch vermutlich die Anzahl analog abrechenbarer Positionen sinkt. Des Weiteren stimmen alle Leistungserbringer darin überein, dass sie spürbare Absenkungen der GOÄ-Vergütung, vor allem in den Unterkapiteln MII und MIII/MIV, befürchten. Die Struktur des Kapitels M ist neu festgelegt worden, die Speziallaborleistungen (Unterkapitel MIII/MIV) werden zukünftig in einem Unterkapitel zusammengefasst. Darüber hinaus spekulieren einige Marktteilnehmer darüber, dass analog zum EBM aus bestimmten bisher einzeln abgerechneten Positionen Komplexe gebildet werden, z. B. im Bereich Hämatologie oder Mikrobiologie. Auch mutmaßen die interviewten Marktteilnehmer über eine mögliche Mengensteuerung bezüglich der GOÄ-Leistungen, die im Sinne von gestuften diagnostischen Algorithmen oder einer krankheitsbezogenen Komplexbildung erfolgen könnte. Bezüglich des Rechtsverordnungsverfahrens stehen folgende weitere Schritte an: • straffe und vertrauliche Fortführung aller Arbeiten gemäß BMGForderung zunächst ohne die Beteiligung weiterer Verbände • Verbändeanhörung inklusive schriftlicher Stellungnahmen durch das BMG • Regierungs- und Bundesratsbeschluss Q2-Q3/2016 • frühestes Inkrafttreten wird für Q4/2016 bzw. Q1/2017 prognostiziert Falls die GOÄ-Reform verabschiedet wird, ist eine 3-jährige Einführungs­ phase vorgesehen, in der noch Veränderungen vorgenommen werden können. Dazu sollen eventuelle Reaktionen der Anbieter engmaschig beobachtet werden. Strategy& 17 4.Mögliche Auswirkungen der GOÄ-Reform auf die Laborversorger 4.1 Methodik und Annahmen unseres Simulationsmodells Um die Effekte einer GOÄ-Honoraranpassung in Bezug auf die mit Laborleistungen befassten Marktteilnehmer darzustellen, wird ein Modell verwendet, das eine quantitative Einschätzung der Auswirkungen auf den Gesamtumsatz von laborfachärztlichen Laboren und Krankenhauslaboren sowie die MII-Umsätze von Ärzten in einer Laborgemeinschaft erlaubt. Annahmen zur GOÄ-Honoraranpassung Im Modell werden Vergütungsanpassungen in Form von Prozentwerten für die einzelnen Unterkapitel des Kapitels M unterstellt. Für das Unterkapitel MII wird eine Absenkung von 60% angenommen, für die Unterkapitel MIII/MIV eine Absenkung von 30%. Diese Vergütungsan­ passungen werden als Grenzfallszenario eingeschätzt. Die Vergütungs­ anpassungen im Unterkapitel MI sind bisher nicht quantifizierbar. Informationen zufolge wird die Anzahl der Parameter, die im Praxislabor abgerechnet werden können, möglicherweise von bisher 30 Parametern auf rund 40 erhöht. Annahmen zum GOÄ-Anteil an den Laborumsätzen Der reale Anteil des GOÄ-Umsatzes am Gesamtumsatz eines Labors variiert gemäß unseren Interviewpartnern zwischen rund 3% und über 40%. Dieser Umstand ist im Wesentlichen durch die regionale Varianz des Anteils privatversicherter Patienten bedingt. Für die Modellberechnung wird für das laborfachärztliche Labor ebenso wie für das Krankenhauslabor ein approximativer GOÄ-Anteil von durchschnittlich 25% angenommen. Die höhere Vergütung von Laborleistungen in der GOÄ im Vergleich zum EBM führt dazu, dass bereits bei 10% vollversicherten Privatpatienten die GOÄ-Umsätze eines Labors rund 25% seiner Gesamtumsätze ausmachen können. 18 Strategy& Bei den Umsätzen, die ein Nichtlaborfacharzt aus einer Laborgemeinschaft erzielt, ergibt sich ein anderes Bild. Seit der Reform zur Direktabrechnung von Laborgemeinschaften können die Mitglieder der Laborgemeinschaft nur noch Leistungen für privat Versicherte selbst abrechnen. Folglich handelt es sich bei den Umsätzen, die aus einer Laborgemeinschaft erzielt werden, zu 100% um GOÄ-Umsätze. Zusammensetzung der GOÄ-Umsätze Ein laborfachärztliches Labor hat typischerweise einen hohen MIII/MIVUmsatzanteil von rund 90%. Nur maximal 10% seiner GOÄ-Umsätze entfallen auf MII-Leistungen. Dies mag zunächst überraschend niedrig erscheinen, da Basislaborleistungen wegen häufiger Inanspruchnahme das Standardgeschäft der Labordiagnostik darstellen. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Großteil dieser Leistungen in Laborge­mein­ schaften erbracht wird und somit nur ein relativ kleiner Rest an die laborfachärztlichen Labore überwiesen wird. Krankenhauslabore bieten ein breites, auf das jeweilige Krankenhausprofil abgestimmtes Leistungsspektrum an. Unsere Interviews ergaben, dass sich in den Laboren von Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung die GOÄ-Umsätze ungefähr zu 65% auf die Basisleistungen (MII) und zu 35% auf die Speziallaborleistungen (MIII/MIV) verteilen. Bei den Umsätzen einer Laborgemeinschaft handelt es sich zu 100% um MII-Leistungen. 4.2 Wirtschaftliche Effekte einer GOÄ-Veränderung Eine Anpassung der Vergütung von bis zu –60% im Basislaborbereich und von bis zu –30% im Speziallaborbereich stellt einen drastischen Einschnitt in die Ertragssituation von laborfachärztlichen Laboren, Krankenhauslaboren und Ärzten, die Leistungen aus einer Labor­ gemeinschaft beziehen, dar. Die konkreten Auswirkungen auf die Umsatzerlöse der einzelnen Laborversorger und der daraus zu erwartenden Konsequenzen werden nachfolgend dargestellt. Laborfachärztliches Labor Abbildung 4 zeigt die Effekte, die eine Vergütungsanpassung von –60% in MII und von –30% in MIII/MIV auf den Gesamtumsatz von laborfachärztlichen Laboren hat. Unter Annahme der abgebildeten Umsatzverteilung sinkt der Gesamtumsatz des laborfachärztlichen Labors um 8%. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten zur Erbringung der Laborleistungen zunächst unverändert sind. Der Wegfall eines Strategy& 19 Abbildung 4 Effekt einer Vergütungsanpassung von -60% in MII und -30% in MIII/IV auf den Gesamtumsatz eines laborfachärztlichen Labors Umsatzverteilung im Status quo 25% Anteil GOÄ am Gesamtumsatz Aufteilung GOÄ Umsatz 10% MII 90% MIII/IV Wirkung der GOÄ-Anpassung auf den Gesamtumsatz 100% Status quo -8% 92% Nach GOÄ-Anpassung Quelle: Strategy& Berechnung substantiellen Teils des Umsatzes wirkt sich direkt auf die Ertragskraft der Labore aus. Aufgrund des bereits sehr hohen Rationa­lisie­rungs­grades im deutschen Labormarkt sind wirtschaftliche Gegenmaßnahmen nur begrenzt möglich. Maßnahmen zur Reduktion von Durchführungs­ kosten mittels Erhöhung von Serienlängen oder zur Reduktion von Probenlogistikkosten könnten sich in einer verzögerten Verfügbarkeit von Labordiagnosen niederschlagen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass Labore Kürzungen im Personalbereich durchführen werden. Die Personalkosten stellen einen der größten Kostenblöcke im Labor dar und der Abbau von Personal könnte eine mögliche Reaktion auf einen Einbruch der Umsatzerlöse sein. Für Labore mit geringer Ertragskraft, die nicht über ausreichend Rationalisierungsreserven verfügen, bedeutet der beschriebene Umsatzrückgang, dass die wirtschaftliche Fortführung des Labors in Frage gestellt wird. Aufgrund der demografischen Struktur stehen viele niedergelassene Laborärzte vor der Frage einer Nachfolgeregelung. 20 Strategy& Die Schwächung der Ertragskraft durch eine drastische Reduktion der GOÄ-Honorare birgt das Risiko, dass sich weniger junge Laborärzte dazu bereit erklären, eine Praxis zu übernehmen. Labore, die keinen Nachfolger finden, werden vom Markt verschwinden, mit der Folge, dass sich die bereits fortgeschrittene Konsolidierung weiter fortsetzt. Eine zunehmende Konsolidierung wird mittelständische Strukturen schwächen und den Arbeitsplatzabbau weiter vorantreiben. Neben dem Risiko der wirtschaftlichen Unternehmensfortführung sind bei einem Einbruch der Ertragskraft auch die Fähigkeit und die Bereitschaft der Labore, in neue Technologien und Innovationen zu investieren, in Frage gestellt. Um innovative Verfahren anbieten zu können, sind zum Teil hohe Anfangsinvestitionen notwendig. Sind die Labore nicht mehr in der Lage, ausreichend Kapital anzusparen, oder ist eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht mehr gegeben, so werden diese Investitionen ggf. unterlassen. Auch Ersatzinvestitionen werden möglicherweise hinausgezögert und die Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Labordiagnostik dadurch gefährdet. Ein andauernder Investitionsstau könnte sich mittelfristig in einer Verringerung der Versorgungsqualität niederschlagen. Krankenhauslaboratorien Krankenhauslabore werden von der erwarteten GOÄ-Anpassung stärker betroffen sein als laborfachärztliche Labore. Der Grund dafür liegt in deren höherer Abhängigkeit von MII-Leistungen. Unter der angenommenen Umsatzverteilung sinken die Gesamterlöse des Krankenhauslabors um rund 12% (siehe Abbildung 5, Seite 22). Für ein Krankenhaus bedeutet ein solcher Rückgang, dass ein wesentlicher Beitrag zur Deckung der Laborkosten entfällt. Eine Absenkung der GOÄ-Vergütung wird diejenigen Krankenhäuser im Besonderen tangieren, deren Ergebnissituation ohnehin schon angespannt ist. Wenn die GOÄ Umsätze sinken, muss man weitere Untersuchungen an externe Labore geben oder Bereiche/ das Labor outsourcen. Chefarzt eines Krankenhauses Mögliche Reaktionen in regionalen Häusern zur Senkung der Laborkosten wären in erster Linie die zunehmende Fremdvergabe von diagnostischen Tests mit geringer Serienlänge oder Anforderungen in Bezug auf spezielles Know-how externer Labore. Als weitere Reaktionsmöglichkeit zur Einsparung von Kosten ist das Outsourcing des Labors an einen externen Anbieter zu sehen. Nach Untersuchungen von Löffert und Damerau (2014) führen 72% der Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung die klinische Chemie intern durch. Nur noch 12% besitzen eine eigene interne Mikrobiologie. Molekulare Diagnostik oder Spezialdiagnostik wird zu rund 70% im externen Labor durchgeführt. Strategy& 21 Einige Marktteilnehmer aus dem klinischen Umfeld stehen dem Outsourcing des Krankenhauslabors kritisch gegenüber und sehen darin das Risiko eines Verlusts an medizinischer Kompetenz. Sie befürchten, dass die diagnostische Qualität sinken könnte, weil ein direkter persönlicher Kontakt zwischen Kliniker und Laborarzt nicht mehr gegeben ist. Auch befürchten sie, dass wegen der längeren Transportwege zur Probenübermittlung die Schnelligkeit der Probenbearbeitung und Resultatgewinnung durch ein Outsourcing gefährdet werde. Die Bedeutung zeitkritischer mikrobiologischer Proben und zeitkritischer Befundübermittlung zeigt sich in einer OutcomeStudie zur Sepsis (Schmitz, 2013). Jedes Krankenhaus mit Notfalloder chirurgischen Patienten ist grundsätzlich mit dem Thema Sepsis konfrontiert. Die Schnelligkeit der Probenbearbeitung und Resultat­ gewinnung ist wegen ihrer essentiellen Rolle für die klinische Differential­diagnostik die wichtigste Forderung an die Labormedizin einer Klinik. Leiter von laborfachärztlichen Laboren, die Krankenhäuser mitversorgen, halten die Fremdvergabe und das Outsourcing des Labors für weniger problematisch. Sie sehen in dieser Entwicklung sogar eine Chance, Outsourcing des Labors ist für kleine „Sparten-­ kranken­häuser“ eine Option. Bei breit aufgestellten Häusern der Grund-­ und Regelversorgung geht dabei jedoch Qualität verloren. Manager eines Labors in einem Schwerpunktkrankenhaus Abbildung 5 Effekt einer Vergütungsanpassung von -60% in MII und -30% in MIII/IV auf den Gesamtumsatz eines Krankenhauslabors Umsatzverteilung im Status quo 25% Anteil GOÄ am Gesamtumsatz Aufteilung GOÄ Umsatz 65% MII 35% MIII/IV Wirkung der GOÄ-Anpassung auf den Gesamtumsatz 100% -12% 88% Status quo 22 Nach GOÄ-Anpassung Quelle: Strategy& Berechnung Strategy& zusätzliche laborfachärztliche Expertise einzukaufen. Betont wird, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit externen Anbietern im Wesentlichen von der individuellen Ausgestaltung der Logistik- und Serviceleistungen abhängig ist. Eine hohe Qualität in Service und Logistik kann insbesondere in Ballungszentren sichergestellt werden. Mit wachsender geografischer Distanz und in strukturschwachen Regionen wird dies jedoch zunehmend schwieriger. Bei der Frage nach dem Outsourcing des Labors ist als weiterer Aspekt zu berücksichtigen, dass eine wesentliche Funktion der Labormedizin und Mikrobiologie in der Klinik die Beratung der klinischen Disziplinen in Bezug auf die Implementierung und Aufrechterhaltung von Hygienestandards ist. Diese Funktion muss bei einer Auslagerung des Labors ebenfalls über die Serviceleistungen der externen Anbieter abgedeckt werden oder intern differenziert organisiert werden. In welchem Ausmaß eine Absenkung der GOÄ-Vergütung für Labor­ leistungen den Trend zum Outsourcing vorantreiben wird, ist nicht eindeutig erkennbar. Ärzte in einer Laborgemeinschaft Ärzte, die Leistungen aus einer Laborgemeinschaft beziehen, sind am stärksten von GOÄ-Anpassungen betroffen. Laborgemeinschaften wurden als „Schlachtfeld“ der Verhandler bezeichnet: Man senkt MII massiv ab (Leidtragende sind Hausärzte, Internisten und andere Ärzte in einer Laborgemeinschaft) und kompensiert dies durch die Aufwertung anderer ärztlicher Leistungen. Die Umsätze aus der Laborgemeinschaft sind zu 100% Leistungen aus dem Unterkapitel MII. Eine Absenkung der Vergütung von 60% schlägt damit vollständig auf die Umsätze durch (siehe Abbildung 6, Seite 24). Der GOÄ-Umsatz des zuweisenden Arztes als Mitglied einer Labor­ gemeinschaft ist Teil seines eigenen Praxisumsatzes. Die zuweisenden Ärzte sind erheblich betroffen und erzielen einen um 60% niedrigeren GOÄ-Umsatz aus MII-Leistungen. Nach Aussagen eines Hochschullehrers für Allgemeinmedizin sowie von Hausärzten spielt die Aufrechterhaltung dieser, nicht zu unterschätzenden, zusätzlichen Einnahmequelle für die Wirtschaftlichkeit vieler Praxen eine tragende Rolle. Hinsichtlich der allgemeinen Problematik der hausärztlichen Versorgung in struktur­ schwachen Gebieten – die keinen dort unterdurchschnittlichen GOÄAnteil impliziert – ist nachvollziehbar, dass sich ein Vergütungsrückgang negativ auf die Niederlassungssituation niederschlagen kann. Strategy& Mit massiven Verlusten in MII sinkt der Praxisumsatz beim Hausarzt erheblich. Facharzt für Labormedizin 23 Bei einer drastischen Absenkung der MII-Vergütung sind historisch bereits beobachtete, medizinisch jedoch nicht vertretbare Folgen denkbar: Betroffene Ärzte könnten versuchen, durch Mengenausweitung den Preisrückgang zu kompensieren. Mengenausweitungen wegen Veränderungen der Vergütung konnten in der Vergangenheit etwa nach der Absenkung des Wirtschaftlichkeitsbonus 2013 beobachtet werden. Niedergelassene Ärzte könnten als weitere Gegenmaßnahme vermehrt Laborleistungen im Praxislabor durchführen, oft unter deutlich geringerer Berücksichtigung eines regelhaften Qualitätsmanagements. Dieser Entwicklung würde gegebenenfalls dadurch Vorschub geleistet, dass in der neuen GOÄ mehr Parameter für das Praxislabor vorgesehen sind. Dies könnte zu einer Fehlsteuerung führen, bei der nicht nur das Risiko einer rein finanziell induzierten Mengenausweitung kritisch zu sehen ist. Werden vermehrt Leistungen im Praxislabor erbracht, die zuvor unter laborfachärztlicher Aufsicht erbracht wurden, wird dem Patienten der Zugang zu laborfachärztlicher Expertise erschwert. Laborärzte sehen in diesem Zusammenhang beispielsweise für Parameter wie HbA1c, der in die neue GOÄ als Vorhalteleistung (MI) aufgenommen werden soll, ein Risiko. Abbildung 6 Auswirkung einer Vergütungsanpassung von -60% in MII auf die Umsätze aus einer Laborgemeinschaft Umsatzverteilung im Status quo Anteil GOÄ am Gesamtumsatz aus Laborgemeinschaft 100% Aufteilung GOÄ Umsatz 100% MII Wirkung der GOÄ-Anpassung auf den Umsatz aus einer Laborgemeinschaft 100% -60% 40% Status quo 24 Nach GOÄ-Anpassung Quelle: Strategy& Berechnung Strategy& 5.Zusammenfassung und Ausblick Sollte es zu einer substantiellen Absenkung der GOÄ-Vergütung im Kapitel M kommen, sind eine Vielzahl wirtschaftlicher und struktureller Veränderungen im Labormarkt zu erwarten. Laborfachärztliche Labore werden zu Kosteneinsparungen gezwungen. Das Potential, Kosten­ein­ sparungen bei gleichbleibender Versorgungsqualität durchzuführen, ist aufgrund des bereits sehr hohen Rationalisierungsgrades im deutschen Labormarkt begrenzt. Werden Untersuchungen zur Erhöhung von Serienlängen seltener durchgeführt oder die Logistikleistungen in Bezug auf die Abholung der Proben eingeschränkt, hat dies Folgen für die zeitliche Verfügbarkeit von Labordiagnosen, insbesondere in strukturschwachen Regionen. Auch ein Abbau von Arbeitsplätzen ist zu erwarten. Labore, die nicht über ausreichend Potential für Kosteneinsparungen verfügen, werden vom Markt verschwinden und die bereits fortgeschrittene Konsolidierung im Labormarkt schreitet weiter voran. Eine zunehmende Konsolidierung wird nicht ohne Folgen für die mittelständische Struktur bleiben und geht mit dem Verlust weiterer Arbeitsplätze einher. Der ebenfalls zu verzeichnende Trend einer zunehmend erforderlichen ärztlichen Kollaboration zwischen einem Facharzt für Labormedizin und dem beauftragenden Kollegen bei komplexen differentialdiagnostischen Erwägungen würde damit konterkariert. Die finanzielle Belastung von Krankenhäusern im Zusammenhang mit der Erbringung von Laborleistungen wird zunehmen. Ursächlich hierfür ist ein verringerter Beitrag zur Deckung der Laborkosten durch reduzierte GOÄ-Umsätze. Auch Krankenhäuser, die ihr Labor ausgelagert haben, müssen mit steigenden Kosten rechnen, weil Outsourcing-Partner ebenfalls unter Druck geraten und diesen durch höhere Preise für die erbrachten Leistungen zu kompensieren versuchen. Mögliche strukturelle Veränderungen bei der Erbringung von Laborleistungen in Krankenhäusern sind in der zunehmenden Fremdvergabe von Tests mit geringer Serienlänge und einem zunehmenden Trend zum Outsourcing des Labors zu sehen. Strategy& 25 Kliniker befürchten hierbei, dass es zu einem Abfluss medizinischer Kompetenz und einer Verringerung diagnostischer Qualität im Krankenhaus kommen könnte. Bei der Erbringung der Laborleistungen durch externe Anbieter kann aber auch ein Zugang zu professionalisierten und speziellen Beratungsleistungen eröffnet werden. Ob ein externer Anbieter hinsichtlich Beratungsleistungen ein hohes Niveau gewährleisten kann, hängt im Wesentlichen von der individuellen Vereinbarung von Servicedienstleistungen ab und bleibt abzuwarten. Für niedergelassene Ärzte, die Mitglied einer Laborgemeinschaft sind, ist im Rahmen der GOÄ-Reform ein signifikanter Einbruch der Erträge aus Laborleistungen zu erwarten. Für die Wirtschaftlichkeit vieler Arztpraxen sind diese Erträge von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Hinsichtlich der allgemeinen Problematik in Bezug auf die hausärztliche Versorgung in strukturschwachen Gebieten besteht daher das Risiko, dass sich ein Vergütungsrückgang von MII-Leistungen negativ auf die Niederlassungssituation auswirkt. Versuche zur Kompensation der entgangenen Umsätze könnten zu einer vermehrten Durchführung von Laborleistungen im Praxislabor führen. Zudem könnte es zu einer nicht medizinisch begründeten Mengenausweitung kommen. Auch bei den Laboreigenerbringern besteht die Gefahr, dass es möglicherweise zu einer Mengenausweitung als Kompensation für geringere Umsätze kommt. Bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage von Laboren sinkt deren Fähigkeit, Kapital anzusparen, das für Investitionen in innovative Verfahren benötigt wird. Die Einführung von innovativen Verfahren in der Labormedizin wird dadurch verlangsamt und das Potential dieser Verfahren kann in diesem Fall nicht oder nur verzögert genutzt werden. Innovationen, etwa im Bereich der therapiebegleitenden Diagnostik („Companion Diagnostics“), bieten die Möglichkeit einer zielgerichteten Behandlung und haben das Potential, sowohl den Therapieerfolg zu erhöhen als auch die makroökonomischen Behandlungskosten zu reduzieren. Werden die dazu benötigten aufwändigen labordiag­no­sti­ schen Tests nicht oder nur verzögert angeboten, besteht das Risiko, dass dieses Potential ungenutzt bleibt. Es sollte also sowohl im Interesse der Patienten als auch im Interesse des gesamten Gesundheitssystems liegen, einen Innovationsstopp in der Labordiagnostik zu vermeiden. Die gegenwärtige methodische Ausgangslage einer Neubewertung von GOÄ-Laborleistungen muss sich der Kritik stellen, den essentiellen Wertbeitrag der Labordiagnostik zu unterschätzen. Diagnostische Leistungen werden nach unmittelbaren Kostenkriterien bewertet. Durch eine Kopplung der laborärztlichen Leistung an die Vergütung des jeweiligen Tests wird implizit die ärztliche Leistung entwertet. Das kann weder im Interesse behandelnder Ärzte, die auf die Unterstützung ihres Handelns durch den Labormediziner angewiesen sind, noch im 26 Strategy& Sinne des Patienten sein, dessen diagnostischer Behandlungspfad auch vom Laborarzt und von der Qualität der labordiagnostischen Leistungserbringung abhängt. Sollten neben einer Absenkung der Laborvergütung in der GOÄ die Quotierung und das Mengengerüst im EBM weiterhin sinken, würde sich die gesamtwirtschaftliche Lage aller Labore zusätzlich verschlechtern. Dies würde sowohl die Konsolidierung weiter vorantreiben als auch die Investitions- und Innovationsproblematik weiter verschärfen und damit letztlich ein zukünftiges effektives Patienten-Therapiemanagement, basierend auf qualitätsgesicherten Diagnosen, in Deutschland in Gefahr bringen. Strategy& 27 6. Appendix Abbildung 7 Interviewpartner1 1. Geschäftsführer eines laborfachärztlichen Labors 2. Geschäftsführer eines Labors in einer Laborkette 3. Geschäftsführer eines Labors in einer Laborkette 4. Ärztlicher Leiter eines externen Krankenhaus-Labors einer Laborkette 5. Ärztlicher Leiter und Eigentümer eines laborfachärztlichen Labors (MVZ) 6. Leiter des Labors einer Universitätsklinik 7. Vorstand eines Verbandes A 8. Vorstand eines Verbandes B 9. Vorstand eines Verbandes C 10. Internistischer Hausarzt 11. Spezialist Leistungs-Management einer Krankenversicherung 12. Leiter eines laborfachärztlichen Labors mit Krankenhausversorgung (MVZ) 13. Leiter eines laborfachärztlichen Labors (MVZ) 14. Ärztlicher Leiter eines Krankenhauslabors und Leiter der strategischen Planung einer Krankenhauskette 15. Eigentümer eines laborfachärztlichen Labors 16. Hochschullehrer Allgemeinmedizin/Hausarzt Teilweise Mehrfachinterviews pro Gesprächspartner 1 Quelle: Strategy& Analyse 17. Experte für Laborkostenrechnung 28 Strategy& Quellen Ärzte Zeitung 09.09.2015: Windhorst rudert beim Honorarplus zurück – Chaos um GOÄ-Novelle. 1 2 Ärzte Zeitung online 14.05.2015: GOÄ-Reform biegt auf Zielgerade ein. A. Bobrowski: Anforderungen an die Vergütung aus Sicht der Laborärzte. Vortrag, VDGH-Diagnostika-Forum am 29.01.2015 in Berlin. 3 P. Borges: Quo Vadis Labormarkt: Trends und Perspektiven. Vortrag, VDGH-Diagnostika-Forum am 28.01.2011 in Berlin. 4 5 Bundesärztekammer: Ärztestatistik 2014. Berlin 2015. 6 G. Elbel: Markt für klinische Labordiagnostik in Deutschland. Deloitte 2010. J. Flintrop: Gemeinsam zur neuen GOÄ. Deutsches Ärzteblatt 2014, 111(22):988-991. 7 U. Früh: Laborkostenkalkulation. Vortrag, DELAB-Fachtagung am 11.06.2010 in Mainz. 8 9 K. Gaede: Labormedizin UK Aachen – Die Unerschrockenen. KMA 09/2011. T. Keßler: Ausgaben für Laborleistungen im ambulanten Sektor. WIPDiskussionspapier 04/2010. Wissenschaftliches Institut der PKV, Köln 2010. 10 B. Kleinken: Die neue GOÄ – was können wir erwarten? AAA Abrechnung Aktuell Ausgabe 08/2015. 11 R. König: Labordiagnostik – Unterschätzte Expertise. KMA Sonderdruck Diagnostik, personalisierte Medizin 06/2013. 12 S. Löffert, M. Damerau: Die Bedeutung der Labordiagnostik für die Krankenhausversorgung. Deutsches Krankenhausinstitut e.V., Düsseldorf 2014. 13 Medical Tribune Nr. 38, 18.09.2015: Dr. Windhorst kündigt beachtliche Honorarsteigerung an. 14 Strategy& 29 M. Müller: Aktuelles aus der EBM-/GOÄ-Honorarpolitik. Vortrag, DELAB Fachtagung am 03.07.2015 in Mainz. 15 M. Müller: Labormedizinische Patientenversorgung, Struktur – Kosten – Wertschöpfung. Vortrag, Update Innovationsforum am 20.03.2012 in Berlin. 16 M. Müller: Fachkompetenz ist wichtiger als Größe. Triliumreport Sonderheft Labormedizin 01/2012. 17 D. E. Newman-Toker, P. J. Pronovost: Diagnostic Errors – The Next Frontier for Patient Safety, JAMA 2009, 301(10)9:1060-1062. 18 J. Rathenberg, B. Ivandic und C. Wohlfart: Systematik der korrekten Laborabrechnung – rechtliche Rahmenbedingungen. J Lab Med 2014, 38(4):179-205. 19 R. PH. Schmitz et al.: Quality of blood culture testing – a survey in intensive care units and microbiological laboratories across four European countries. Critical Care 2013, 17:R248. 20 Statistisches Bundesamt: Gesundheit Ausgaben 1995 bis 2013. Fachserie 12 Reihe 7.1.2, Wiesbaden 2015. 21 Statistisches Bundesamt: Gesundheitsausgabenrechnung, Methoden und Grundlagen 2008. Wiesbaden 2011. 22 23 B. Wiegel: Qualität braucht vor allem Ressourcen. BDL aktuell 03/2015. T. Windhorst: Sachstand GOÄneu. Vortrag, 118. Deutscher Ärztetag am 12.05.2015 in Frankfurt am Main. 24 30 Strategy& Abkürzungen BÄK = Bundesärztekammer BMG = Bundesministerium für Gesundheit EBM = Einheitlicher Bewertungsmaßstab GKV = Gesetzliche Krankenversicherung GOÄ = Gebührenordnung für Ärzte KV = Kassenärztliche Vereinigung MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum PKV = Private Krankenversicherung PoC = Point-of-Care, Point-of-Care-Testing (patientennahe Labordiagnostik) Rili-BÄK = Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen DRGs = Diagnosis Related Groups (Diagnosebezogene Fallgruppen) Strategy& 31 Strategy& is a global team of practical strategists committed to helping you seize essential advantage. We do that by working alongside you to solve your toughest problems and helping you capture your greatest opportunities. These are complex and high-stakes undertakings — often game-changing transformations. We bring 100 years of strategy consulting experience and the unrivaled industry and functional capabilities of the PwC network to the task. Whether you’re charting your corporate strategy, transforming a function or business unit, or building critical capabilities, we’ll help you create the value you’re looking for with speed, confidence, and impact. We are part of the PwC network of firms in 157 countries with more than 208,000 people committed to delivering quality in assurance, tax, and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at strategyand.pwc.com. www.strategyand.pwc.com © 2016 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. Mentions of Strategy& refer to the global team of practical strategists that is integrated within the PwC network of firms. For more about Strategy&, see www.strategyand.pwc.com. No reproduction is permitted in whole or part without written permission of PwC. Disclaimer: This content is for general purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.