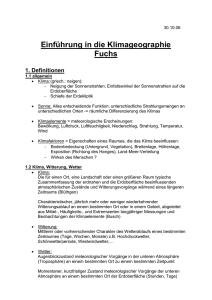Aus meinen Funkwetterberichten
Werbung

Aus meinen Funkwetterberichten (Auswahl) Hochdruckgebiete In unserer Vorstellung und Erwartung verbinden wir ein Hoch meist mit schönem Wetter. Darin werden wir am heutigen spätsommerlichen Sonntag uns alle bestätigt fühlen. Aber vor allem in der kalten Jahreszeit und deren Randbereichen zum Frühjahr und Herbst herrscht bei hohem Luftdruck oftmals gar kein so schönes Wetter. Bei hohem Luftdruck befinden wir uns nämlich meist nicht im Zentrum des Hochs, sondern vielfach in seinen Randgebieten, und dort kann das Wetter recht verschiedene Gesichter zeigen. Ein Hoch wird im Durchschnitt von drei Tiefdruckgebieten umkreist, deren Einflüsse sich bisweilen recht deutlich bemerkbar machen. Ein Hoch verdanken wir somit stets den Tiefdruckgebieten seiner Umgebung, die ihre Luft in die höheren Atmosphäreschichten pumpen. Von dort sinken sie dann nach unten. So ist die Ostseite eines Hochs in unseren Breiten die kalte Flanke. Die Winde wehen dann aus nordwestlichen bis nordöstlichen Richtungen und führen maritime bis kontinentale Luftmassen aus dem Polargebiet bzw. aus Skandinavien oder Nordostrussland heran. Zur Erinnerung: Aus einem Hoch strömen die Winde im Uhrzeigersinn heraus, neigen also stets zu Rechtskurven. Die dazu gehörigen Isobaren weisen sog. "antizyklonale Krümmungen" auf. Die Westseite der Antizyklone (ein anderer Name für Hochdruckgebiet) ist hingegen die warme Seite. Luft aus Süden und Südwesten strömt in Deutschland ein. Warmluftadvektion kann dann zu Inversionen führen. An der Nordseite des Hochs kann sich - wenn auch in abgeschwächter Form - eine Westwinddrift einstellen mit Bewölkung und starkem Wind. An der Südseite des Hochs kommt es zu kontinentalen Ostwinden. Im Sommer wird es dann oftmals heiß, trocken und sonnig, aber im Winter bisweilen bitterkalt und neblig, vor allem wenn sich noch feuchte Mittelmeerluft über den Alpenkamm nach Norden bewegt. Nur wenn wir im Zentrum des Hochs liegen, was gar nicht so oft vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines strahlendblauen Himmels und von Trockenheit am größten. Aber auch hier bildet das Wetter im Winter oftmals Einschränkungen. Die Sonne strahlt nämlich nur dann vom blauen Himmel bis zum Erdboden, wenn die Luft sehr trocken ist, vor allem trocken auch noch bis in die Niederungen hinein. Ansonsten bildet sich Bodennebel mit einer Inversionsschicht. Dieser Nebel kann sehr hartnäckig sein und sich tagelang halten, denn die Sonne als kleines Fünkchen am Himmel hat im Winter zu wenig Energie, den Nebel aufzulösen. Kühlt sich die Luft in den langen Nächten noch weiter ab, wird der Taupunkt ständig unterschritten und es kommt zu Nebelnässen oder sogar zu Sprühregen. Die Beschriftungen "Schönes Wetter", "Beständig" oder "Sehr trocken" auf manchen älteren Barometern sollte man daher ruhig vergessen. Die Begriffe "Hoch" und "Tief" reichen völlig aus. Denn auf diese Bezeichnungen ist Verlass, vorausgesetzt, das Barometer wurde entsprechend geeicht, nämlich auf den auf Meereshöhe reduzierten, also relativen Luftdruck. Azorenhoch In meinen Funkwetterberichten ist oft die Rede vom Azorenhoch oder Keil des Azorenhochs sowie von seinem Gegenstück, dem Islandtief. Beide Luftdruckgebilde bestimmen recht verlässlich das Wettergeschehen in Europa. Sie sorgen nämlich dafür, dass bei uns eine atlantische westliche Drift vorherrscht, was dazu führt, dass unsere Sommer und Winter im Allgemeinen von den Temperaturen her gemäßigt ausfallen, also im Sommer nicht zu heiß, im Winter nicht zu kalt werden. So war das zumindest vor unserer derzeitigen eventuellen Klimaänderung. Es ist übrigens im Wesentlichen der Golfstrom, der jenen Wettermotor in Gang hält. Das ganze lässt sich nachschlagen unter dem Stichwort "maritimes Klima." (Meeresklima) Die Entstehung jener beiden Luftdruck-"Giganten" wird vornehmlich durch die Ausbildung kalter und warmer Meeresströmungen, also durch unterschiedlich temperiertes Oberflächenwasser des Atlantiks, mitbestimmt, wie das ja auch beim "El Nino" im Pazifik der Fall ist. Bei uns hat man nun eine Periode von etwa 20 Jahren festgestellt, in der sich das Azorenhoch und das Islandtief abschwächen. Man spricht in diesem Fall von einer "niedrigen nordatlantischen Oszillation." Vor allem wegen der damit verbundenen Schwäche des Azorenhochs können Stürme, die normalerweise auf dem Atlantik toben, dann auch Südwesteuropa erreichen und dort zu Unwettern führen, wie wir sie manchmal in Portugal und Spanien erlebt haben. Eine weitere Folge wäre eine Reihe relativ kalter Winter in Mittelund Osteuropa. Es könnte nun sein, dass eine Klimaerwärmung jener normalen Klimaschwankung, also der erwähnten niedrigen "nordatlantischen Oszillation", entgegenwirkt und zu einer sich verstärkenden Ausbildung von Azorenhoch und Islandtief führen, also zu einer starken "nordatlantischen Oszillation". Dies hätte zur Folge, dass es künftig wieder häufiger kühle Sommer und milde Winter gäbe. Die Westwinddrift würde somit allgemein kräftiger und verlässlicher. Das wäre dann eine gute Nachricht für alle Energiegewinnungen, die mit der Ausnutzung des Windes zu tun haben. Zurzeit sind dies aber alles nur Spekulationen - in ca. 30 Jahren wissen wir mehr darüber, denn 30 Jahre beträgt der Zeitraum, den man mindestens benötigt, um einigermaßen verlässliche Aussagen über eine mögliche Klimaänderung zu machen. Auf das Azorenhoch und das Islandtief können wir uns auf jeden Fall weiterhin verlassen. Ob sich jedoch die von ihnen erzeugte Westwinddrift künftig verstärkt oder abschwächt und welche Zeiträume dies umfasst, bleibt abzuwarten. Das Wetter in Europa wird sich wohl weiterhin zwischen maritimen und kontinentalen Einflüssen gestalten. Allein in Deutschland können wir dabei über 10 verschiedene Luftmassen registrieren, die zum Teil sehr unterschiedliche Auswirkungen auf unser Wetter haben. Zu diesem Thema habe ich mich in meinen Beiträgen bereits früher mehrmals geäußert. Indian Summer ohne "Alte Weiber" Nun hat uns gestern nach dem meteorologischen vor drei Wochen auch der kalendarische Herbst erreicht. Und pünktlich ist wieder die Rede vom so genannten "Altweibersommer", den viele von uns herbeisehnen. Der Altweibersommer zählt zu den sich regelmäßig wiederholenden Wetterereignissen, den sog. "Singularitäten", wie z.B. auch das Weihnachtstauwetter, die Eisheiligen, die Schafskälte und der Siebenschläfer. Es handelt sich um einen Wärmerückfall, der in fast jedem Jahr im Zeitraum zwischen dem 23. September und dem 1. Oktober auftritt und wofür in aller Regel ein Festlandshoch über Osteuropa verantwortlich ist, das trockene und warme Kontinentalluft nach Mitteleuropa einströmen lässt. In jener Zeit fängt das Laub an, sich bunt zu färben. Mit "alten Weibern" hat jene Wetterphase allerdings gar nichts zu tun. Schon seit Jahrtausenden ranken Sagen und Mythen um den Begriff des Altweibersommers. Zu jeder Zeit und in jedem Land wurden die Ursprünge des Wortes anders gedeutet: Die im Volksglauben gängigste Erklärung war folgende: Die winzigen Fäden, die in den letzten Septembertagen durch die Lüfte fliegen und natürlich von jungen Spinnen stammen, wurden als das Werk von Elfen angesehen. Im nordischen Mythos sind es die sog. "Nornen", drei Göttinnen mit den Namen "Urt", "Werdoni" und "Skult", übersetzt: "Vergangenheit", "Gegenwart", "Zukunft". Jene total alterungs-resistenten Damen spinnen den Schicksalsfaden eines jeden Menschen bis zu seinem Tode. Soweit zum Mythos. Eine besonders stark ausgeprägte Form des Altweibersommers gibt es in Nordamerika. Dort heißt er "Indian Summer" (Indianersommer). Während sich bei uns im Frühherbst die Blätter verfärben, erlebt die amerikanische Ostküste einen fast explosionsartig auftretenden Farbenrausch. Dieser gilt als weltweit einmalig. Mitte August beginnt das Farbenspiel in Kanada und wandert dann weiter südwärts über Georgia bis nach Texas, das es im November erreicht. Am schönsten ist es in den Neuenglandstaaten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire und Rhode Island, vor allem aber in Vermont. Nach den ersten kalten frostigen Nächten wird es oft wieder wärmer mit Temperaturen um 20 Grad unter blauem Himmel, so dass die Farben dann besonders intensiv strahlen. Die nordamerikanische Flora ist weitaus vielfältiger als die in Deutschland und Europa. Es gibt fünfzehn Mal so viele Baumarten wie in Westeuropa. Dazu gehören allein 70 verschiedene Eichenarten - bei uns sind es nur drei. Dass der Farbenrausch an der Ostküste so plötzlich und intensiv einsetzt, liegt aber vornehmlich auch daran, dass es in jenen Regionen früher kalt wird als bei uns. Die Bäume unterbinden dann schlagartig die Zufuhr des grünen Farbstoffes, des Chlorophylls. So bleiben die Rot- und Brauntöne übrig, die sonst vom Grün überdeckt werden. Der wichtigste Baum im Indian Summer ist der Zuckerahorn. Die Kälte unterbricht den Zuckerzyklus, wobei der danach einsetzende chemische Umwandlungsprozess das Laub erst so richtig zum Leuchten bringt. Aus Amerika stammt auch die originellste Sage um den Altweibersommer, die Rückschlüsse auf die Bezeichnung "Indian Summer" zulässt. Der Name Indian Summer geht nämlich auf die Zeit zurück, als die Weißen begannen, die Gebiete der Indianer zu erobern. Die an Zahl und Waffen unterlegenen Indianer wehrten sich bisweilen mit einer List. So unterstellte es ihnen der weiße Mann, dass sie ihre Geschenke in heuchlerischer Absicht oder mit listigen Hintergedanken übergaben. Sie standen ja schließlich mit dem Rücken zur Wand und versuchten, ihre Haut zu retten. Somit wäre der Indianer-Sommer als ein Heuchler zu betrachten, dem nicht zu trauen ist, ein "falscher" Sommer also, der uns zwar Echtheit vorgaukelt, der aber bald zu Ende sein wird und in Regen, Wind und Kälte umschlägt, in Nordamerika übrigens noch abrupter und nachhaltiger als hier bei uns. Es existiert aber noch eine zweite Deutung, vor allem für die rote Blattfärbung: Sie hat mit dem Sternenhimmel zu tun. Schuld gab man dem indianischen "Himmlischen Jäger", der den Großen Bären über den nächtlichen Himmel hetzte und auf ihn mit einem Bogen schoss. Aus der Pfeilwunde tropfte Blut, das die Herbstwälder Amerikas so markant rot färbte, dass in jedem Jahr nicht nur die Amerikaner selbst, sondern auch die Touristen sich jenes Naturschauspiel immer wieder anschauen. Luftdruck und Höhe Wahrscheinlich haben Sie schon mal eine Wanderung unternommen und dabei eine topographische Landkarte benutzt. Auf einer solchen Karte sind neben den üblichen Informationen zur Strecke auch Höhenlinien eingezeichnet. Jede dieser Linien stellt ein bestimmtes Höhenniveau dar. Von einer Linie zur nächsten wird immer derselbe Höhenunterschied angezeigt. So können sich diese Linien auch niemals berühren. Um einen wohlgeformten Berg herum verlaufen sie nahezu kreisförmig. Nehmen Sie einen Wanderweg senkrecht dazu, handelt es sich um den steilsten Anstieg, den es geben kann. Verläuft er schräg, ist er weniger steil, dafür aber länger. Benutzen Sie einen Weg, der parallel zu einer solchen Höhenlinie verläuft, bleiben Sie stets auf ein- und derselben Höhe. So können Sie Ihre Wanderstrecke bereits vor dem Aufbruch zur Tour genau danach untersuchen, wo es auf Ihrem Weg aufwärts oder abwärts geht und wie steil der Anstieg pro Wegstrecke jeweils ist. In der Wetterkunde gibt es ebenfalls solche topographischen Karten. Diese haben jedoch mit dem Luftdruck und seiner Höhenlage zu tun. Wie Sie bereits wissen, nimmt der Luftdruck mit der Höhe recht stark ab. So haben wir bereits in 5,5 km Höhe durchschnittlich nur noch die Hälfte des Luftdrucks hier am Boden. Sie kennen sicher auch den Begriff der Isobaren. Das sind die Linien gleichen Luftdrucks auf einer Bodenwetterkarte. Ihr Abstand voneinander gibt die Druckunterschiede über eine bestimmte Entfernung an. Am vergangenen Montag hatten wir den ersten Herbststurm dieses Jahres. Dieser war auf der Wetterkarte an einer besonders dichten Drängung der Isobaren im Bereich einer Kaltfront sichtbar. Es ging also über einen kurzen Raum steil mit dem Luftdruck nach unten. Daher der Sturm. Dabei weht der Wind etwa in Richtung dieser Isobaren. Eine solche Bodenwetterkarte ist jedoch keine topographische Darstellung. Für eine topographische Karte benötigt man ebenfalls Höhenlinien. Aber was sind das beim Luftdruck für Höhenlinien? Es sind die Höhenlinien einer bestimmten Druckfläche in unserer Atmosphäre. Sehr wichtig ist zum Beispiel die Druckfläche von 500 hPa. Dieses Druckniveau liegt etwa in 5 km Höhe. So kann man mit einem Radiosondenaufstieg eines Wetterballons messen, in welcher Höhe der Luftdruck 500 hPa beträgt. So erhält man zum Beispiel um ein Tief herum ziemlich kreisförmige Höhenlinien jenes Luftdruckniveaus. Die Messungen in der Höhe haben den Vorteil, dass dort die Winde wegen der fehlenden Bodenreibung parallel zu diesen Höhenlinien wehen. Dadurch wird eine Wetterlage für die Meteorologen durchsichtiger. Wir erhalten ebenfalls ein Bild von der Verteilung der Hoch-. und Tiefdruckgebiete und damit der Luftströmungen. Die Luft bewegt sich, wie gesagt, parallel zu diesen Linien und der Wind ist um so stärker, je dichter die Linien beieinander liegen. Die Regeln für die Luftbewegung um ein Hoch und ein Tief sind genau dieselben wie für die Isobaren in der Bodenwetterkarte. Linien, die Punkte gleicher Höhe miteinander verbinden, werden Isohypsen genannt. Und diese meteorologischen Isohypsen sind im Prinzip dasselbe wie die topografischen Höhenlinien auf einer Landkarte. Die Druckflächen von 500 hPa und 300 hPa sind besonders wichtig für die Arbeiten des Wetterdienstes. Da der Luftdruck von 500 hPa etwa die Hälfte des Luftdrucks an der Erdoberfläche ausmacht, stellt die 500 hPa Fläche das mittlere Niveau der Atmosphäre dar. Man hat dort ebenso viel Luft über sich wie unter sich. Karten für das 300 hPa- Niveau bei etwa 9000 Meter Höhe sind von großer Wichtigkeit für den Flugverkehr, da in dieser Höhe die Jetstreams (Strahlströme) wehen. Auf der Südhalbkugel rotieren Hoch- und Tiefdruckgebiete anders herum als auf der Nordhalbkugel Wir sind uns selten darüber bewusst, dass wir uns auf einer rotierenden Erdkugel befinden. Wir tun so, als seien wir in Ruhe. Ohne die Erddrehung sähe aber manches anders aus als wir es gewohnt sind. Mit Sicherheit gäbe es uns alle gar nicht. Nehmen wir nur einmal das Wetter und unser Klima als Beispiel. Ohne Erdrotation gäbe es keine Hoch- und Tiefdruckgebiete und somit auch nicht das uns bekannte und lebenswichtige Wetter und Klima auf der Erde. Wieso? Hintergrund dieses Phänomens ist die Corioliskraft oder "die ablenkende Kraft der Erdrotation". Richtig müsste man vom "Corioliseffekt" sprechen, denn es handelt sich um keine echte Kraft, sondern um eine Scheinkraft. Sie ist einfach ein Beobachtungseffekt, dem wir unterliegen, weil wir uns mit der Erde mitdrehen. Ein Gegenstand am Äquator dreht sich, von außen gesehen, mit einer Geschwindigkeit von 1667 Kilometern pro Stunde von West nach Ost. Je weiter man nach Norden kommt, umso langsamer rotieren die Punkte auf der Erdoberfläche. Eine Masse, die sich vom Äquator nach Norden bewegt, ist bestrebt, ihr höheres Drehmoment beizubehalten. Deshalb wird sie nach rechts abgelenkt, nach Osten. Umgekehrt: Eine Masse, die sich von Norden nach Süden auf den Äquator zu bewegt, "wehrt sich" gegen das zunehmende Rotationstempo und weicht nach Westen aus - also auch nach rechts in Strömungsrichtung. Tiefdruckgebiete zeichnen sich nun dadurch aus, dass Luftmassen in sie hinein strömen. Weil sie sich über Hunderte oder Tausende von Kilometern ausdehnen, wird für jene Luftmassen der Corioliseffekt spürbar. Sie erfahren auf der Nordhalbkugel eine Ablenkung nach rechts. Die Folge ist eine Rotation des gesamten Tiefdruckwirbels gegen den Uhrzeigersinn. Besonders gut kann man dies auf den Satellitenbildern von tropischen Wirbelstürmen sehen, die nichts weiter sind als extreme Tiefdruckgebiete. Aus einem Hochdruckgebiet strömt am Boden zum Ausgleich Luft nach außen, eine Folge der das Hoch umgebenden Tiefdruckgebiete. Auch diese Luft wird auf der Nordhalbkugel nach rechts ablenkt. Die Folge ist eine Drehung im Uhrzeigersinn. Auf der Südhalbkugel gelten natürlich die gleichen Gesetze, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, denn dort werden die Winde vom Corioliseffekt nach links abgelenkt. Dort drehen sich somit die Tiefdruckgebiete im Uhrzeigersinn und die Hochs dem entgegen. Wie gesagt: Da wir uns auf der Erde mitdrehen, scheint es nur so, dass unsere Winde durch die Erddrehung abgelenkt werden. Wenn wir der "Mann im Mond" wären, würden wir die Linien als Gerade sehen und genauso würden wir auch die Luft "sehen", wie sie geradewegs vom hohen zum tiefen Druck fließt. Deshalb ist die Corioliskraft eben nur eine Scheinkraft. Dieser Effekt wurde nach dem französischen Wissenschaftler Gaspard Coriolis benannt. Der Effekt macht sich bei allen frei beweglichen Objekten bemerkbar, somit auch bei Meeresströmungen, Flugzeugen und Raketen. Man hat sogar festgestellt, dass nordsüdlich verlaufende Eisenbahnschienen sich etwas eher abnutzen als westöstlich verlegte, eben wegen der ablenkenden Kraft nach rechts. Die Räder drücken bei einer Fahrt nach Norden etwas stärker gegen die Innenseite der rechten Schiene. Bei einer Fahrt nach Süden geschieht dies ebenso, nur ist dann die Innenseite der anderen Schiene davon betroffen. Der Corioliseffekt variiert mit der Geschwindigkeit des Objekts und mit der geographischen Breite. Er ist Null am Äquator und an den Polen am größten. Er ist jedoch so gering, dass wir im normalen Leben nichts von ihm bemerken, weil entweder die Geschwindigkeit zu gering ist oder aber die Strecke zu kurz. Somit ist der Corioliseffekt auch nicht daran schuld, ob sich in der Badewanne beim Abfließen der Wasserstrudel links oder rechts herum dreht. Wetterkapriolen und Klimaerwärmung Heftigste Regenfälle in Brasilien, Überflutungen von Riesenausmaßen in Queensland in Australien, Regen und Schneeschmelze bei uns und das Hochwasser, dies alles sind nur Einzelfälle im weltweiten Wettergeschehen. So haben die Australier unter ihrem Klimaphänomen "la Nina" zu leiden. Dies erhöht vor der australischen Ostküste die Wassertemperaturen, die ohnehin schon hoch sind. Deshalb verdunstet dort viel Wasser und es kommt entsprechend viel runter. Es handelt sich um eine Wetterkapriole, ohne dass sich eine bestimmte neue Ursache dafür erkennen lässt. Auch die massiven Niederschläge in Brasilien sind nicht die direkte Folge einer globalen Erwärmung. Die tropischen Ozeane haben sich erwärmt. So können enorme Wassermengen in relativ kurzer Zeit herunterkommen. Allerdings haben die Wetterextreme eine zunehmende Tendenz. Auch die Überschwemmungen in Pakistan muss man hinzurechnen. Der Indische Ozean ist ein bisschen wärmer geworden als im Normalfall. Starke Niederschläge können somit noch etwas stärker werden. Dies kann alles durchaus noch schlimmer werden, denn wir erleben ja jetzt erst den Anfang der globalen Erwärmung. Wir haben weltweit eine Erwärmung von 0,7 °C während des letzten Jahrhunderts zu verzeichnen. Wir wissen, dass jene Erwärmung auf jeden Fall weitergeht, zumal auch wegen der Trägheit des Klimageschehens. Selbst wenn wir jetzt die Erwärmung stoppen würden, es würde erst einmal noch schlimmer werden, bevor eine Stagnation eintritt. Nur über eine längere Zeit kann man dies rückgängig machen, zum Beispiel durch die drastische Verringerung des CO2. Aber das geht nicht kurzfristig. Jedoch im Prinzip haben wir es noch in der Hand, zumindest die schlimmsten Folgen zu vermeiden. So will man ja die Grenze einer weltweiten Erwärmung um 2 °C nicht überschreiten. Aber auch das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Wir müssen also in Zukunft mit weiter zunehmenden extremen Wettererscheinungen weltweit rechnen. Schon jetzt können sich die entwickelten reichen Länder besser dagegen schützen als die unterentwickelten armen. Das sieht man ja immer wieder ganz deutlich an den Folgen der Wetterkatastrophen. Die meisten Toten sind stets in den armen Ländern zu beklagen. Diese benötigen die Unterstützung - vor allem mit viel Geld - durch die reichen Länder. Dies wurde ja auch auf der letzten Klimakonferenz in Cancún mit Nachdruck angedacht. Hintergrundwissen zur aktuellen Winterdiskussion in Europa Die Nordatlantische Oszillation (NAO) Unser Klima über dem Nordatlantik und hier in Europa wird sehr stark durch die Nordatlantische Oszillation bestimmt. Es handelt sich dabei um eine interne Klimaschwankung, die schon seit vielen Jahrzehnten bekannt ist. Sie wurde bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts beschrieben. Es handelt sich dabei um eine "Luftdruckschaufel" zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch. Dadurch wird die Stärke der Westwinde in jener Region bestimmt. Ein einfach zu messender Index ist die Druckdifferenz zwischen Lissabon und Island. Ein hoher NAO- Index steht für ein anomal starkes Islandtief und ein anomal starkes Azorenhoch. Ein niedriger Index ist durch ein anomal schwaches Islandtief und ein anomal schwaches Azorenhoch charakterisiert. Seit 1860, dem Beginn der Luftdruckmessungen an beiden Stationen, kann man ausgeprägte Schwankungen im Abstand von durchschnittlich zehn Jahren feststellen. So wurden Anfang des 20. Jahrhunderts relativ hohe Werte gemessen, aber in den 60-er Jahren erreichte der Index ein Minimum und stieg dann wieder relativ stark an. Dieser Anstieg trug beträchtlich zur Erwärmung der Nordhemisphäre im Winter in den letzten Jahrzehnten, insbesondere über Eurasien, bei. Auch die milden Winter in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sind auf die anomale Stärke der NAO zurückzuführen. Bis heute weiß man jedoch nicht, ob diese Intensivierung auch durch menschliche Einflüsse teilweise bewirkt wird oder bewirkt worden ist. Jene Druckschwingungen waren in den vergangenen 30 Jahren sogar von Jahr zu Jahr recht variabel. Die Veränderungen der NAO haben natürlich Auswirkungen für das Klima über dem Nordatlantik und Europa. So werden vor allem die bodennahe Temperatur und der Niederschlag über Europa stark durch die NAO geprägt. Die Sturmhäufigkeit über dem Atlantik ist ebenfalls eng mit der NAO korreliert. Hohe Werte gehen üblicherweise mit milden Temperaturen, erhöhten Niederschlägen und mehr Stürmen über Deutschland einher. Unser diesjähriger lang anhaltender extremer Frühwinter in Deutschland und Europa hat seinen Ursprung in einem aktuell relativ niedrigen Wert der Nordatlantischen Oszillation. Man sollte dies bei allen Diskussionen über den globalen Klimawandel nicht vergessen. Der Mai Der Mai hat seinen Namen von der Erd- und Wachstumsgöttin Maria. Der zweite Namenspate ist der Göttervater Jupiter Maius, der Gebieter über Blitz, Donner, Regen und Sonnenschein. Obwohl die Sonne in diesem Monat das Festland schon auf sommerliche Temperaturen erwärmen kann, gibt es mit Sicherheit immer wieder recht kühle Tage, da sich das nördliche Meer noch nicht genügend aufgeheizt hat. Doch "Mai warm und trocken, lässt alles Wachstum stocken", heißt es. Und "Mai kühl und nass, füllt des Bauern Scheun und Fass." Der 25ste ist der Tag des Hl. Urban, Schutzpatron der Winzer und Weinberge. So werden dann in Weingegenden vielerorts Bittgänge abgehalten. Außerdem ist dieser Tag für die Wetterbestimmung der nächsten Tage bis Wochen wichtig: "Wie sich's an St. Urban verhält, so ist's noch 20 Tage bestellt." "St. Urbanus gibt der Kälte den Rest, wenn Servatius noch was übrig lässt". Am 25. und 26. Mai sind nämlich die sog. "kleinen Eisheiligen". Die bekannten Eisheiligen finden vom 11. bis 13. Mai statt (in Süddeutschland vom 12. - 14. Mai). Seit 1936 begehen wir in diesem Monat den "Vatertag". Dieser Tag hat vornehmlich für denjenigen, der zu tief ins Glas schaut, etwas von der ursprünglichen Erfahrung von "Himmelfahrt" verloren, wobei er am Folgetag sehr irdisch mit Katerstimmung auf dieser Welt sich wieder findet. In diesem Zusammenhang fällt mir ein Volksspruch ein, der in etwa dazu passt: "Es kommt kein gut Wetter, bevor Christus nicht die Beine von der Erde hat." Im Mai, im Marienmonat, werden überall Marienandachten gefeiert. Mit Maria wird Fruchtbarkeit und Wachstum verbunden. Der Mai gilt als Monat mit dem stärksten Wachstum in der Natur. Die Mauersegler kehren zurück und man kann wieder schwärmende Bienen beobachten. Die Libellen schlüpfen wieder, ein Geschlecht, das schon seit 250 Mio Jahren auf unserer Erde existiert. Und was ist mit den Maikäfern? Gibt es keine Maikäfer mehr? In früheren Zeiten traten diese in solchen Massen auf, dass sie bekämpft werden mussten. Sie fraßen innerhalb kürzester Zeit z.B. große Eichen kahl. Seit Mitte der 80er Jahre kommen sie heute auch wieder vermehrt vor, wobei man einen Jahresrhythmus von ca. 35 Jahren beobachtet hat. Dann gibt es sog. "Spitzenpopulationen". Die Entwicklungsdauer des wechselwarmen Maikäfers hängt von der Außentemperatur ab. Sie beträgt in warmen Regionen etwa 3 Jahre, in kälteren bis zu 5 Jahre. Der Käfer schwärmt nur 2 - 8 Tage von Mitte bis Ende Mai. Früher kannte man die sogenannten "gefürchteten Maikäferjahre", welches an der vierjährigen Entwicklungszeit der Maikäferlarve liegt. Wenn in diesem Jahr ein Maikäfer den Boden verlässt, frisst er Blätter und legt dann Eier ab. Daraus entwickelt sich die Larve, der Engerling, der zunächst einmal bis etwa Spätherbst Moder und Humus frisst, danach bis zum April nächsten Jahres im Boden ruht. Dann, im Mai bis Juni nächsten Jahres, frisst er Wurzeln und kann damit große Schäden anrichten. Dies macht er dann noch zwei Jahre lang so: ruhen und fressen. Im 3.- 4. Jahr erreicht er von Juli bis September sein Puppenstadium in etwa ein Meter Tiefe. Von Oktober bis Dezember schlüpft dann bereits der Käfer, bleibt aber noch im Boden, bis er im Mai durch wärmende Sonnenstrahlen geweckt wird und für kurze Zeit ausschwärmt. Sollten Sie in diesen Tagen irgendwo einen Maikäfer finden und in der Hand halten, dann werden Sie sich bewusst, welch lange Entwicklungszeit der Käfer hinter sich hat. Wenn er nicht gerade in Massen auftritt, schadet er der Natur wenig. Dann können wir ihn um so unbefangener bewundern. Kälterückfälle im Mai Aus wettermäßig aktuellem Anlass heute noch ein kleiner Nachschlag zum Thema der "Eisheiligen". Am vergangenen Sonntag bemerkte ich, dass jene Kälterückfälle im Mai nichts Ungewöhnliches darstellen und dass sie in früheren Zeiten fast in jedem Jahr nachgewiesen wurden. In unserer Zeit ist die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens auf etwa 60% herabgesunken. Wenn die Eisheiligen ausbleiben, beschwert sich natürlich niemand, und wenn sie dann so markant wie in diesem Monat auftreten - erst recht nach dem langen kalten Winter dieses Jahres - sind wir auf sie überhaupt nicht gut zu sprechen. Wir sind diese lang anhaltende kalte Witterung einfach leid, zumal diese überhaupt schwer einzuordnen ist in den Erwärmungstrend des angekündigten Klimawandels. Nun wird die Durchschnittstemperatur des Mai sogar um satte fünf Grad unterschritten. Droht vielleicht doch eher eine neue Eiszeit? Ich bleibe bei meinem Nein. Die Kälteperiode Mitte Mai bleibt ein typisches Wetterphänomen, das - wie gesagt - in früheren Jahrhunderten sogar regelmäßig stattfand. Heute bleiben jedoch derartige Kälterückfälle in zwei von fünf Jahren aus. Die Eisheiligen der hinter uns liegenden Woche sind markante Zeugnisse einer historischen, aber schon recht genauen Wetterbeobachtung: So enden die Eisheiligen in Norddeutschland am 13. Mai, im Süden unserer Republik aber erst am 14. oder 15. Mai. Der Grund: Die oftmals aus der Arktis stammende Luft braucht mindestens einen Tag, um von der Küste zu den Alpen zu gelangen. Zum Schluss möchte ich Ihnen heute jene Eisheiligen einmal etwas persönlicher vorstellen. Mamertus ( um 477 in Vienne, Gallien) war Bischof und wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Mamertus entstammte einer wohlhabenden gallorömischen Familie aus Lyon. Er wurde 461 Erzbischof von Vienne, wo er auch verstarb. Er führte die Bittprozession vor Himmelfahrt ein. Während seiner Amtszeit gebot er der Überlieferung nach durch Beten einer furchtbaren Feuersbrunst Einhalt, die die ganze Stadt zu zerstören drohte und soll auch andere Wunder und Heilungen bewirkt haben. In der Kunst wird er im Ornat eines Bischofs dargestellt, mit einem brennenden Licht zu Füßen des Kreuzes. Er ist der Patron der Hirten und der Feuerwehr und wird bei Dürre, Fieber und Brusterkrankungen angerufen. Sein Gedenktag ist der 11. Mai. In Deutschland (vor allem Norddeutschland) wird er zu den Eisheiligen gezählt. Pankratius, 12. Mai: Um das Jahr 303 kam der verwaiste Sohn eines reichen Römers mit seinem Onkel nach Rom und unterstützte der Legende nach mit seinem Erbe die verfolgten Christen. Der 14-jährige wurde erwischt, vor Kaiser Diokletian gebracht und öffentlich enthauptet. Der Heilige gilt als Schutzpatron der Kommunionkinder sowie gegen Krämpfe und Kopfschmerzen. Servatius, 13.Mai: Er war der erste Bischof von Tongern in den heutigen Niederlanden. Nach unterschiedlichen Legenden wurde er am 13. Mai 384 mit einem Holzschuh erschlagen. Sein Grab befindet sich in Maastricht an der Straße nach Köln. Er war im Übrigen noch entfernt verwandt mit Jesus. Marias Mutter Anna hatte nämlich eine Schwester namens Esmeria, deren Tochter Elisabeth die Mutter von Johannes dem Täufer war - somit die Großtante von Servatius. Bonifatius, 14. Mai: Es handelt sich nicht um den berühmten Heidenapostel der Deutschen, sondern um einen jungen Römer, der eigentlich gar kein Christ war. Er suchte in Tarsus (Türkei) nach den Reliquien christlicher Märtyrer. Unter dem Druck der Christenverfolgung bekehrte er sich und fiel ihr im Jahre 306 selbst zum Opfer. Sophie, 15. Mai: Sie gilt nur in Süddeutschland als Eisheilige. Man weiß nur wenig über sie. Auch sie soll während der Christenverfolgungen durch Kaiser Diokletian den Märtyrertod erlitten haben. Reliquien der Heiligen werden sowohl in Rom als auch im Elsass verehrt. Nach ihr ist das Sophienkraut benannt, auch als Besenranke bekannt. Bei den Datumsangaben der Eisheiligentage muss berücksichtigt werden, dass Papst Gregor XIII. den gregorianischen Kalender zwar schon 1582 einführte, dass er jedoch in den nichtkatholischen Gebieten Nord- und Mitteleuropas erst zwischen 1700 und 1752 flächendeckend auf die neue Zeitrechnung umgestellt wurde. Bei dieser Umstellung wurde z. B. in England der September 1752 um 11 Tage verkürzt (auf den 2. September folgte unmittelbar der 14.). Da die Eisheiligen, wie alle anderen Heiligen, im Kalender unverändert stehen geblieben sind, finden sie nach altem Kalender also eigentlich erst 11-12 Tage später statt, also vom 23. Mai bis 27. Mai. Diese Überlegung trifft natürlich nur zu, wenn die Regel vor Einführung der Kalenderreform aufgestellt wurde. Tatsächlich sind wetterstatistisch die Tage mit häufiger N/NO-Wetterlage, die Kaltluft bringt, vom 21. Mai bis 23. Mai, also 9 Tage später. Das lässt auf eine Entstehung der Wetterregel 2-3 Jahrhunderte vor der Kalenderreform schließen. Ganz zum Schluss noch ein paar Eisheiligen- Regeln: Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz. Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost. Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist. Servaz muss vorüber sein, will man vor Nachtfrost sicher sein. Pankrazi, Servazi und Bonifazi, sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie, die Kalte Sophie. Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Frühling gebracht, zerstören sie wieder. Pflanze nie vor der Kalten Sophie. Mamerz hat ein kaltes Herz. Die kalte Sophie macht alles hie. Sie bringt zum Schluss ganz gern noch einen Regenguss. Das war´s mal wieder. Schönen Sonntag und eine wärmere Woche! Vy 73 Klaus, DL5EJ Entwicklung des globalen Klimas Die Entwicklung des globalen Klimas hängt von weitaus mehr Faktoren ab als allgemein bekannt ist. Am vergangenen Sonntag wies ich darauf hin, dass seit Beginn der Industrialisierung die Menge von Gasen in unserer Atmosphäre, die den Treibhauseffekt verstärken, um 40% seit 1750 - und damit auch die globale mittlere Temperatur um 0,6 bis 1 Grad - unter Einwirkung des Menschen zugenommen hat. Auffallend ist, dass die 10 wärmsten Jahre des 20. Jahrhunderts aus seinen letzten 17 Jahren stammen (1998, 1997, 1995, 1990, 1991, 1994, 1983, 1988, 1987, 1996). Wir treiben also ein gewagtes Spiel mit dem globalen Klima, das wir mit Sicherheit nicht gewinnen werden, wenn wir so weitermachen. Das globale Klima hat sich aber immer schon durch "natürliche" Ursachen (ohne Eingriff des Menschen) mehr oder weniger stark verändert. So wissen wir z.B. inzwischen recht genau, wie sich das Klima in den letzten 1000 Jahren verhalten hat. Trotz leicht voneinander abweichender Ergebnisse der Klimaforscher stimmen ihre Aussagen in wesentlichen Punkten überein. Die Sonne, aber auch die Erde selbst, muss man nämlich mit globalen Temperaturschwankungen in Verbindung bringen. Sonne Die "Solarkonstante", also der Betrag der Sonnenenergie, die an der Obergrenze der Atmosphäre ankommt (1370 W / m²) schwankt um 3% wegen der unterschiedlichen Entfernung der Erde während ihres Umlaufs um die Sonne. Doch strahlt auch die Sonne bei weitem nicht so gleichmäßig, wie man noch bis ins 16. Jahrhundert hinein annahm. Denken wir an die "Sonnenflecken" und ihren ca. 11jährigen Zyklus, dem noch weitere Perioden überlagert sind und die zu extremen Fleckenmaxima und Fleckenminima führen können. So sind bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem Klima der letzten Jahrhunderte und der Anzahl der Sonnenflecken belegt. Die so genannte "Kleine Eiszeit" fand in einem Stadium der Sonne statt, als diese viele Jahrzehnte lang ohne Flecken war. Erde Ihre Bahn ist gleich mehreren Änderungen unterworfen. Die Bahn der Erde um die Sonne unterliegt einem Zyklus, bei dem diese zwischen einer Ellipse und (fast) einem Kreis schwankt. Dies vollzieht sich allerdings in dem großen Zeitraum von 100 000 Jahren. Je größer die Exzentrizität, umso größer ist der Unterschied der eintreffenden Sonnenstrahlung zwischen dem sonnenfernsten und sonnennächsten Punkt. Zurzeit ist die Exzentrizität gering. Der zweite Zyklus entsteht bei der Rotation der Erde um ihre Achse wie ein taumelnder Kreisel, "Präzession" genannt. Jene Periode dauert etwa 23 000 Jahre. In ca. 11 000 Jahren wird unsere Erde der Sonne wieder im Juli am nächsten sein, wenn auf der Nordhalbkugel Sommer ist. Dadurch werden die Gegensätze zwischen Sommer und Winter zunehmen, da die Nordhalbkugel die größeren Landmassen besitzt. (Zurzeit ist die Erde der Sonne im Januar am nächsten.) Der 3. Zyklus von ca. 41 000 Jahren wird durch die Änderung des Neigungswinkels der Erdachse gegenüber der Ekliptik, also der Erdbahn um die Sonne, hervorgerufen. Zurzeit beträgt jener Winkel 23,5°. Er schwankt zwischen 22° und 24,5°. Je kleiner der Winkel, umso geringer gestalten sich die jahreszeitlichen Schwankungen in mittleren und höheren Breiten. Was ich hier angeführt habe, ist die Grundannahme der "Melankovitch- Theorie". Milutin Melankovitch, ein serbischer Mathematiker, hat diese Theorie um 1930 entwickelt. Danach wird durch die geschilderten Änderungen des Laufes der Erde um die Sonne das globale Klima beeinflusst. Ablagerungen in den Ozeanen und Untersuchungen von Eisbohrkernen haben eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Eisausbreitung und der MelankovitchTheorie ergeben. Jedoch kann der Verlauf der verschiedenen Eiszeiten auf unserem Planeten damit nicht vollständig erklärt werden. Hierbei könnten z.B. auch gewaltige Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge ursächlich mitgewirkt haben. Welch dramatische Auswirkungen ein großer Vulkanausbruch auf das Wetter haben kann, zeigt das Jahr 1816, als in Teilen Nordamerikas und in Westeuropa der Sommer "ausfiel". Im Juni gab es Schneestürme, und Fröste traten noch im Juli und August auf. Ursache: Zwischen 1810 und 1815 stieg die Vulkanaktivität weltweit an und erreichte im April 1815 mit der Explosion des Vulkans "Tambora" im heutigen Indonesien ein Maximum. Aber Vorsicht! Ganz eindeutig ist der Zusammenhang zwischen dem Wetter von 1816 und der Eruption ein Jahr davor nicht, da es in jener Zeit kaum Wetteraufzeichnungen gab. Ziemlich sicher ist jedoch: Vulkangase können den Treibhauseffekt verstärken. Bedeutsamer ist aber wohl der Abkühlungseffekt durch die weltweite Trübung der höheren Atmosphärenschichten durch Vulkanrauch und Vulkanasche- Wolken. Soweit der heutige Funkwetterbericht von DL5EL, Klaus Hoffmann. Einen schönen Sonntag und eine gute Woche! Der Schmetterlings-Effekt Als wir über die fehlenden Kondensstreifen anlässlich des Flugverbots und die damit verbundenen Auswirkungen auf unser Wetter diskutierten, wies ich darauf hin, dass bereits eine kleine Änderung in der Ausgangslage der Wetterbedingungen, wie zum Beispiel die sich bisweilen zu Wolken auswachsenden Kondensstreifen von Flugzeugen, zu großräumigen Änderungen einer vorhergesagten Wetterlage führen können. Man kennt jenes Phänomen unter dem Begriff "Schmetterlingseffekt", der 1963 von dem Meteorologen Edward Lorenz geprägt wurde. Der stellte nämlich fest, dass in einer damals noch sehr einfachen Wettersimulation das Geschehen einen völlig anderen Verlauf nahm, wenn man die Ausgangsbedingungen auch nur ein winziges Bisschen veränderte. Um eine möglichst extrem kleine Veränderung im realen Wettergeschehen zu benennen, wählte er den Flügelschlag einer Möwe als Beispiel. Das war die Geburtsstunde der so genannten "Chaostheorie". Später bürgerte sich dann der Schmetterling als Vergleich ein, vielleicht auch deshalb, weil die mathematische Struktur, die dieses Chaos beschreibt, ein so genannter Attraktor, entfernt an einen Schmetterling erinnert. Inzwischen sind die Wettersimulationen erheblich komplexer, aber dass das Wetter ein chaotisches System ist, bestätigt sich immer wieder. In Simulationen und Prognosen gehen wir immer nur von einzelnen Daten an endlich vielen Punkten auf der Erde aus - und mit denen ist das Wetter nicht mehr als rund fünf Tage im Voraus zu bestimmen. Die kleinste Abweichung beim Ausgangszustand potenziert sich, je weiter man in die Zukunft rechnet, was eine große Auswirkung auf das Vorhersageergebnis hat. Die Vorgänge beim Wetter laufen bekanntlich nach physikalischen Gesetzen ab. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, Wetterentwicklungen vorherzusagen. Das Wetter unterliegt jedoch dem Gesetz der Strömungen. Turbulenzen darin werden zu einem Stück unberechenbarer Natur. Sie entwickeln sich wie gesagt "chaotisch". Somit sind bis heute Wetterprognosen über vier Tage hinaus noch immer relativ unsicher, da jede Ausgangswetterlage in ihrem Anfangszustand datenmäßig nicht genau genug bekannt ist, also angefüllt ist mit sog. "sensitiven Bereichen", in denen kleinste Veränderungen zu völlig anderen Endresultaten führen können. Und das Vertrackte bei Chaoseffekten ist, dass man für eine Verdopplung der Vorhersagezeit nicht die doppelte Anzahl von Vorhersagepunkten benötigt, sondern ein Vielfaches davon. Die chaotische Entwicklung bei Wetterphänomenen ist zwar bis heute unumstritten, doch auch die Turbulenz weist - soviel wurde inzwischen erkannt - Gesetzmäßigkeiten auf, die sie dem Chaos verdankt. In Experimenten hat sich gezeigt, dass die so unregelmäßig erscheinenden Wirbel einer turbulenten Strömung dennoch bestimmte Formen überraschend deutlich bevorzugen und dass man ihre Eigenschaften durch geeignete Mittelwerte kennzeichnen kann. Gerade die chaotischen Bahnen sind es, auf deren Mittelwerte Verlass ist. Es sind also immer die Anfangszustände, die den Verlauf einer chaotischen Entwicklung bestimmen, die - zum Glück - in ihrer weiteren Entwicklung dennoch zu recht verlässlichen Mittelwerten führen. Aber diese helfen bei einer Wetterprognose für mehrere Tage wenig. Hier will man ja wissen, wie sich das Wetter an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit entwickelt. Um dies genau vorher zu sagen, müsste man den Anfangszustand der Atmosphäre vor der Prognose so genau kennen, dass die weitere Entwicklung nach drei Tagen nicht mehr aus dem Ruder läuft. Denn der noch so kleinste nicht berücksichtigte Parameter im Anfangszustand kann eine Computervorhersage zu ganz anderen Ergebnissen führen. Man sollte den Schmetterlingseffekt allerdings nicht allzu wörtlich nehmen und eher als eine Metapher begreifen. Bei den Auswirkungen der Kondensstreifen, die bei den Anfangsparametern einer Wetterprognose wohl nicht berücksichtigt werden können, bin ich mir da nicht so sicher, weil diese mit Sicherheit größere wettermäßige Effektivität besitzen, wenn sie sich zu Wolkenformationen auswachsen. Jedoch könnte wohl kein Meteorologe eine Kausalkette angeben, wie sich dieser Effekt so vergrößert, dass er tatsächlich einen Sturm auslöst- noch dazu mehrere tausend Kilometer entfernt. So wird wohl jeder Kondensstreifen mehr vom Wetter beeinflusst als das Wetter von einem Kondensstreifen. Makelloser Stern Die Himmelsforscher stehen vor einem Rätsel: Schon seit Jahren bilden sich kaum noch Sonnenflecken. Ihr Verschwinden könnte sich auf unser Erdklima auswirken. Ein britischer Himmelsforscher hat bereits Ende des vorigen Jahrhunderts beim Studium alter astronomischer Aufzeichnungen entdeckt, dass zwischen den Jahren 1645 und 1715 (70 Jahre lang!) so gut wie gar keine Sonnenflecken beobachtet werden konnten. Genau zu jener Zeit herrschte in Europa die "kleine Eiszeit". Die Temperaturen rauschten in die Tiefe. Es gab viele strenge Winter und Missernten. Regelmäßig fror der Ärmelkanal zu. Schlittern wir heute erneut in ein solches Strahlungsminimum hinein? Würde das der anthropogenen globalen Erderwärmung entgegen wirken? Dämpft die Sonne - zumindest vorübergehend den Treibhauseffekt? Darüber sind sich die Forscher zurzeit nicht einig, einige vermuten sogar das Gegenteil. Nun eine kleine Rückblende: Man schrieb das Jahr 1611. Kopernikus´ Lehre von der Sonne als Mittelpunkt unseres Planetensystems kam einer Revolution gleich. Zwei "Sterne" leuchteten auf am Himmel der Wissenschaft auf: Galilei und Kepler. Galilei hatte von holländischen Linsenschleifern erfundene Fernrohre zur Verfügung. Alles, was er beobachtete, gab Kopernikus Recht. Die Sonne stand im Mittelpunkt. Aber es sollte noch viel schlimmer kommen. War nun die Erde ihrer zentralen Stellung beraubt, so war auch die Sonne - nun in den Mittelpunkt gerückt nicht ohne Makel. Man entdeckte die "Maculae solis", die Sonnenflecken. Galilei, katholisch, und Kepler, protestantisch, zogen im Widerstreit ihrer Beobachtungen manche Patres in ihren Bann, die, in zwei Lager aufgeteilt, nach Bestätigung oder Widerspruch der Beobachtungen suchten. Einer, der die Sonnenflecken als erster wahrnahm, und darüber mit Kepler einen Briefwechsel führte, war der ostfriesische Astronom und evangelische Priester Fabricius aus Osteel in Ostfriesland. Heute wissen wir im Vergleich zu damals natürlich mehr über die besagten Sonnenflecken. Uns interessiert in diesem Zusammenhang, ob sie unser Klima beeinflussen können. In den Großwetterlagen gibt es zwar keine 11-jährigen Schwankungen analog zum oft vorhandenen Sonnenfleckenzyklus, aber man hat doch beachtliche andere Zusammenhänge festgestellt, wie zum Beispiel ziemlich eindeutige Beziehungen der Flecken zum Herbstwetter. Wahrscheinlich hat die Strahlung der Sonne, die wir ja nicht nur auf den sichtbaren und langwelligen infraroten Bereich einschränken dürfen, sondern die den sog. "Sonnenwind" erzeugt, sowie eine Menge ultravioletter Strahlung, doch einen recht großen Einfluss auf Wetterereignisse und Klimaänderungen. Es hängt derzeit wohl viel für die weitere Entwicklung unseres Klimas davon ab, ob unsere Sonne noch für viele weitere Jahre ihre derzeitige stille Phase beibehält. Dann könnten die Sonnenflecken für mehrere Jahrzehnte verschwunden bleiben. Einige Forscher sagen das Gegenteil voraus: Die Flecken werden schon bald in großer Zahl zurückkommen. In diesem Fall würden sie die globale Erwärmung sogar noch zusätzlich anheizen. Eine ausführliche Abhandlung dieses doch recht interessanten astronomischen Themas können Sie im Heft 51, 2009, des SPIEGEL nachlesen. Stopp für unsere Hochgeschwindigkeitsgesellschaft Kein Jet mehr am Himmel! Keine Kondensstreifen Hat dies Auswirkungen auf unser Wetter? Ja, vor allem bei klarem Himmel. Die Kondensstreifen hindern als künstlich generierte Wolken tagsüber die Sonne daran, ihre volle Strahlungskraft zum Boden durchzusetzen. Bei klarem Himmel wird es somit etwas wärmer. In der klaren Nacht ist es umgekehrt: Die fehlenden Kondensstreifen sorgen dafür, dass der Erdboden seine Wärme ungehindert abstrahlen kann. Es wird somit nachts etwas kälter als bei vorhandenen Kondensstreifen. Bei der Diskussion um den vom Menschen mit verursachten Klimawandel kommt meines Erachtens der weltweit zunehmende Flugverkehr stets zu kurz. Ich will jetzt gar nicht auf die immensen Mengen von CO² in den Abgasen eingehen, die in wenigen Tagen durch die Jetstreams um den gesamten Globus verfrachtet werden. Bleiben wir bei den erwähnten Kondensstreifen. Diese können sich ausweiten und zu regelrechten Wolken werden und das Sonnenlicht abschwächen, denn Kondensstreifen sind ja im Prinzip Wolken. Sie gleichen in ihrer Struktur den Zirruswolken, die sich in Höhen zwischen 6 und 10 Kilometern bilden. Dort oben herrschen Temperaturen um minus 40 Grad, so dass der Wasserdampf in den Abgasen von Düsenflugzeugen unmittelbar zu Eiskristallen gefriert. Die dazu nötigen Kondensationskeime liefert der Jet in Gestalt von feinen Russpartikeln gleich mit. Dadurch wird ein Flugzeug für uns erst sichtbar, das sonst nur ein winziger Punkt am Himmel wäre. Normalerweise lösen sich Kondensstreifen schnell wieder auf - ihre Lebensdauer beträgt meist nicht mehr als ein paar Minuten. Wenn allerdings die Luft in dieser Höhe mit Feuchtigkeit schon fast gesättigt ist, bleiben die Kondensstreifen länger bestehen. Sie gehen in die Breite und sind als feine Schlieren am Himmel sichtbar. Langlebige Streifen sind also ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und damit in gewisser Weise auch ein Zeichen für eine bevorstehende Wetterverschlechterung. Die Wasserdampfmenge, die ein Flugzeug ausstößt, ist allerdings gering im Vergleich zu dem, was eine normale Wolke an Wasser enthält. Trotzdem können die Flugzeugabgase zur Wolkenbildung beitragen. Die Partikel, die aus dem Triebwerk strömen, können nämlich auch den schon vorhandenen Wasserdampf zum Kondensieren bringen. So kann aus einem schmalen Kondensstreifen eine regelrechte Wolke entstehen, die eine recht große Fläche überstreicht. Inzwischen ist längst nachgewiesen worden, dass es in den großen Flugkorridoren tatsächlich einen höheren Grad an Bewölkung gibt. Der Mensch verändert somit gebietsweise die Strahlungsbilanz der Sonne durch den Flugverkehr, was Auswirkungen auf Wettererscheinungen haben kann. Manchmal nimmt das Wettergeschehen nämlich einen ganz anderen Verlauf, wenn die Ausgangsbedingungen nur ein bisschen verändert werden. Wenn dies nach der "Chaostheorie" bereits durch den Flügelschlag einer Möwe oder sogar vielleicht bereits durch den eines Schmetterlings bewirkt werden kann, dann doch wohl erst recht durch einen sich zur Wolke auswachsenden Kondensstreifen. Astronomischer und meteorologischer Frühlingsbeginn sind nicht dasselbe Für die Meteorologen begann am 1. März bereits der Frühling. Das liegt daran, dass sich die Wetterkundler nicht nach den astronomischen Verhältnissen bei der Frühlingsbestimmung ausrichten, sondern nach wettermäßigen, vornehmlich wetter-statistischen Gesichtspunkten, und da sind Dezember, Januar und Februar eben die kältesten, also die Winter-Monate. Der astronomische Frühlingstermin liegt bekanntlich um den 21. März herum. In diesem Jahr war es der 20. März, also gestern um 18.32 Uhr. Die Sonne hat dann eine besondere Stellung am Himmel. Sie steht über dem Äquator genau senkrecht. Eine Folge davon ist die so genannte "Tag- und Nachgleiche". Tag und Nacht haben weltweit die gleiche Länge von je 12 Stunden. Würden wir das Sonnensystem von außen wie ein entfernter Beobachter betrachten, stellten wir fest, dass die Bahnen der Erde und der anderen Planeten, die um die Sonne laufen, vereinfacht gesagt, alle in einer Ebene liegen. Das Sonnensystem erschiene uns also wie eine Scheibe, auf der sich die Planetenbahnen als nahezu konzentrische Kreise abzeichnen. Die Rotationsachse unserer Erde bildet nun mit der Hauptebene dieser gedachten Scheibe einen Winkel von rund 66,5 Grad. Anders ausgedrückt: Die Ebene, die durch den Erdäquator bestimmt ist, bildet mit der Ebene, die durch die Erdbahn um die Sonne gebildet wird, der so genannten "Ekliptik", einen Winkel von 23,5 Grad. Dies wirkt sich für einen irdischen Beobachter so aus, dass die Sonne für ihn sechs Monate lang einen Bogen oberhalb der Äquatorebene - und sechs Monate lang einen gleichartigen Bogen unterhalb der Äquatorebene beschreibt. Zweimal im Jahr, im "Frühlingspunkt" und im "Herbstpunkt", schneidet die Sonne auf ihrer scheinbaren, das heißt von der Erde aus gesehenen Bahn, die Äquatorebene. Sie steht dann genau senkrecht über dem Äquator. Gestern überschritt sie um 18.32 Uhr den Frühlingspunkt. Das gleiche geschieht nochmals als "Herbstpunkt" am 23. September, nur wandert die Sonne dann anschließend südlich des Äquators weiter. Zurzeit aber bewegt sie sich immer weiter nordwärts, und wenn sie den Frühlingspunkt überwunden hat, strebt sie hin zum nördlichen Wendekreis, den sie am 21. Juno erreicht und über dem sie dann senkrecht steht. An diesem 21. Juni besitzt sie für alle Gebiete nördlich des Wendekreises die höchste Stellung am Himmel und der kalendarische Sommer beginnt. Das Wetter hält sich meist weder an den Frühlingstermin der Meteorologen am 1. März noch an den astronomischen Zeitpunkt um den 21. März. Das wissen wir alle längst aus Erfahrung. Nicht überall in Deutschland, vor allem in den Mittelgebirgen, ist nun der gesamte Schnee dieses Winters schon weggetaut. Alter Schnee hat jedoch eine dunklere Oberfläche, was die Reflexion der Sonnenstrahlung verringert und den Abschmelzprozess beschleunigt. Um diese Jahreszeit sind besonders die plötzlichen Warmlufteinbrüche gefürchtet, die eine starke Schneeschmelze und Hochwasser verursachen können. Aber auch ein warmer Regen auf Schnee kann Bäche und Flüsse über die Ufer treten lassen. Wenn Sie jetzt durch die Wälder spazieren, werden Sie feststellen, dass hier der Schnee viel länger liegen bleibt als auf Feldern oder Wiesen. Die Bäume schützen den Schnee nämlich vor Sonnenstrahlung, aber insbesondere vor dem Einfluss von Warmluft. Langsameres Schmelzen verringert somit die Hochwassergefahr. Im Kleinen sehen Sie das bei der Schneeschmelze im Vergleich zwischen Waldbächen und Bächen, die sich nur durch Wiesen und Felder schlängeln. Beim verzögerten Schmelzen kann mehr Wasser im Boden versickern und somit das Grundwasser anreichern. Auf Feldern, die im Herbst in groben Schollen gepflügt worden sind, können Sie verfolgen, wie sich dies auf die Grundwasserbildung auswirkt. Die groben Schollen ragen schon dunkel aus dem Schnee, während eine Wiese daneben noch eine geschlossene Schneedecke zeigt. Die Schollen wirken als kleine Wärmeinseln, welche die Sonnenstrahlen einfangen und als fühlbare Wärme an ihre Umgebung weitergeben. Sie können fast zuschauen, wie um sie herum der Schnee schwindet, das Schmelzwasser aber nicht abfließt, sondern vom Boden aufgesaugt wird. Auf der Wiese daneben wirkt der Schnee wie eine Isolierschicht und lässt lange Zeit das Wasser nicht in den Boden eindringen, bis ihn schließlich ein Warmlufteinbruch schlagartig wegtaut, so dass die Wiese voll Wasser steht oder ein Wiesenbach über seine Ufer tritt. Vor allem in den Städten bleiben manchmal dunkle bis schwarze Schneehaufen noch außergewöhnlich lange liegen. Es ist nämlich so, dass die dunkle Oberfläche der Schneereste zwar mehr Wärme absorbiert als weißer Schnee, dass aber auch umgekehrt eine solche dunkle Oberfläche in kühlen Tagen, vor allem bei windigem Wetter, mehr Wärme an die Umgebung abgibt als weißer Schnee. Dadurch entsteht Verdunstungskälte, welche dem Abtauen der schmutzigen Schneereste entgegen wirkt und diese somit konserviert. Die Natur benötigt für alle Vorgänge eben einen gewissen Zeitraum, der im Einzelfall auch einmal extrem lange andauern kann. Deshalb sollten wir uns in Geduld üben, auch wenn unser Verlangen nach Frühlingswetter in diesem Jahr nach dem langen Winter besonders intensiv empfunden wird. Schönen Sonntag und eine gute Woche! Meinen Funkwetterbericht finden Sie zum Nachlesen und Anhören auch auf meiner Homepage www.hoffydirect.de . Vy 73 Klaus, DL5EJ Die "gefühlte" Temperatur - "Wind-Chill- Effekt" In diesem Winter haben wir es recht oft immer wieder zu hören bekommen: Die "gefühlte" Temperatur läge recht häufig wesentlich unter den vorhergesagten exakten Temperaturwerten nach Anders Celsius. Sicher haben Sie schon einmal diese Beobachtung gemacht: Bei derselben Temperatur kommt es einem bei Wind kälter vor als ohne Luftströmung. Denselben Effekt spürt man auch beim Radeln, verursacht durch den Fahrtwind. Doch es ist in Wirklichkeit natürlich nicht kälter. Womit hängt die gefühlte Kälte denn zusammen? Klar ist, dass - bis auf ganz wenige Ausnahmen im Hochsommer - die Lufttemperatur immer geringer ist als unsere Körpertemperatur. Letztere liegt ja so um die 37°. Das heißt aber, dass unsere Hautoberfläche laufend Wärme an unsere Umgebung abgibt. Und das ist auch gut so, damit wir nicht an Überhitzung sterben. Je kälter die Luft aber ist, umso mehr Wärme wird der Haut entzogen. Man fängt dann unter Umständen an zu frieren, wenn man die Haut "offen- flächig" der Umgebung preisgibt, zum Beispiel, wenn man auch im Winter sein "Arschgeweih" der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Der Ratschlag aus früheren Zeiten, als die "digital natives" noch nicht herumliefen, lautete recht einfach: "Zieh dich warm an"! Und zwar überall am Körper, bis hin zur Baskenmütze. Und auch der seit Urzeiten bekannte Ausspruch: "Ob Frühling, Sommer, Herbst, ob Winter - ´ne lange Unterhose wärmt Schenkel und Hintern" lässt sich durchaus physikalisch korrekt im Bereich der Wärmelehre einordnen. Das Maß des Wärmeaustausches zwischen Körperoberfläche und Umgebungsluft ist aber stark vom Wind abhängig. Bei hohen Windgeschwindigkeiten ist der Wärmeverlust höher als bei schwacher Luftströmung und erst recht bei völliger Windstille. Somit lässt sich jener "Windchill" - Effekt einer "gefühlten" Temperatur erklären. Mit einem Thermometer kann man diesen Vorgang jedoch nicht nachweisen, da dieses ja gerade die jeweilige (nicht gefühlte) Temperatur der Umgebungsluft annehmen soll. Die Temperatur, die den Wind berücksichtigt, nennt man "Windchill - Temperatur". Diese lässt sich berechnen, wenn Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit bekannt sind. Dafür gibt es auch eine Näherungsformel, die natürlich nicht linear ist und auch nicht zwischen Mann und Frau unterscheidet, da Frauen ja bekanntlich häufiger frieren als Männer. Bei einer Windgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde zum Beispiel, also bei Windstärke 4, und einer Lufttemperatur von plus 5 Grad fühlt es sich für den DurchschnittsMenschen etwa an wie minus 5 Grad. Anders ausgedrückt: Der Wärmeverlust bei -5 Grad und Windstille wäre genau so groß wie bei plus 5 Grad und einem Wind von 25 km/h. Alle Leute, die in diesem Winter so oft bemerkten: "Et is ja eijentlich jar nit e so kalt, ever de verdammte Wind ", haben damit das Problem des Wärmetausches zwischen Hautoberfläche und Umgebungsluft völlig zutreffend angesprochen. Schönen Sonntag und eine gute Woche! Vy 73 Klaus, dl5ej Märzwinter Diese Bezeichnung ist sehr sinnvoll, denn es kommt alle Jahre vor, dass sich vor allem in der ersten Märzhälfte nochmals sehr kalte Luftmassen polaren Ursprungs bei uns durchsetzen und zu einer winterlichen Witterung führen. Aktuell hat uns ein kleines, aber wetterintensives Randtief von Freitagabend bis Samstagnachmittag überquert. Es brachte vor allem in der Westhälfte sowie in Süddeutschland Schneefälle, die auch im Flachland nochmals mehrere Zentimeter Schnee ergeben können. So fielen in Teilen Bochums z.B. bis zu 10 Zentimeter Schnee bis Samstagmorgen. Hier in Kempen fiel nichts. Dieser Schnee ist zumeist nass und taut aufgrund des doch zu dieser Jahreszeit schon relativ hohen Sonnenstandes tagsüber zumeist wieder weg. In den Mittelgebirgen sowie in den Alpen wird es aber richtig winterlich, denn die hinter dem Randtief einströmende Kaltluft konserviert den Schnee im Bergland und hier ist bei Dauerfrost die Sonne noch zu schwach, um durchgreifendes Tauwetter auszulösen. Somit wird es verständlich, dass wir in den kommenden Tagen es mit einer für die Jahreszeit wesentlich zu kalten Großwetterlage zu tun haben. Die erste Märzhälfte dürfte also aus Sicht des langjährigen Klimamittels (bezogen auf den Zeitraum von 1961 bis 1990) wesentlich zu kalt ausfallen, denn die kommenden Nächte können in weiten Landesteilen Deutschlands mäßigen Frost zwischen -5°C und -9°C bringen, über Schnee und in höheren Lagen wird es sogar zu strengem Frost von unter -10°C kommen. Frühlingswetter ist somit zunächst nicht drin. Der März hat wettermäßig so einige Kontraste zu bieten. Hier zum Schluss ein paar Beispiele. 2. März 1997: 22°C Stuttgart 21°C Mannheim, München 20°C Cottbus, Freiburg, Garmisch-Partenkirchen, Magdeburg Tiefstwerte am 4.März 2005 -19°C Itzehoe -18°C Bremen -17°C Emden Unabhängig davon gilt stets: "Der Märzwind mag blasen, wie er will. Ostern kommt stets noch vor Ende April". Treibhauseffekt, was ist das? Obwohl unsere Lufthülle nicht durch Glasscheiben isoliert ist, spricht man von einem Treibhauseffekt. Ist dieser Begriff nicht falsch gewählt? Wörtlich genommen schon, deshalb bedarf er einer Erläuterung, was damit eigentlich gemeint ist. Sie wissen, wer im Glashaus oder Wintergarten sitzt, muss nicht frieren, wenn die Sonne herein scheint. Vor allem im Winter merken wir das ganz deutlich. Was bewirken denn die Glasscheiben des Gewächshauses? Sie lassen den Anteil der kurzwelligen Sonnenstrahlung, der nicht reflektiert wird, nahezu unbeeinflusst passieren, strahlen jedoch die langwelligen Anteile überwiegend zurück, erwärmen damit den Boden und senden einen Teil der von ihm abgestrahlten Energie erneut wieder zur Erde zurück. Dadurch erhöht sich die Temperatur der Luft im Glashaus ganz beträchtlich. Jenen Effekt gibt es in unserer Atmosphäre auch bei den natürlich fehlenden Glasscheiben. Hier stehen dem Energiegewinn ebenfalls Verluste durch die Wärmeausstrahlung der Erde gegenüber. Wie jeder andere Himmelskörper strahlt die Erde selbst laufend Energie ab, sonst würde sich ihre Oberfläche in kurzer Zeit auf Gluttemperaturen erhitzen. Dieser Energieverlust ist mit durchschnittlich 8,2 kWh/m²d (Kilowattstunden pro m² und Tag) sogar mehr als doppelt so hoch wie der Gewinn. Eigentlich müsste die Erdoberfläche also immer kälter werden. Dass dies nicht so ist, verdanken wir Erdbewohner dem "Treibhauseffekt" der Atmosphäre. Die Lufthülle lässt die kurzwellige Einstrahlung fast ungehindert durch, aber nur einen sehr geringen Anteil der langwelligen Ausstrahlung direkt in den Weltraum entweichen. Der größte Teil wird von der Atmosphäre absorbiert, die sich durch die Energiezufuhr erwärmt und ihrerseits Wärme nach oben in den Weltraum und nach unten zur Erdoberfläche hin abstrahlt. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und andere Spuren- oder Treibhausgase. Die Erdoberfläche wird somit aus zwei Energiequellen versorgt: zum einen von der Sonne, zum anderen aus der Erdatmosphäre. So bleibt für die Energiebilanz noch ein stattlicher Gewinn übrig. In der Strahlungsbilanz der Erde spielt also der Energiegewinn durch die Gegenstrahlung der Lufthülle eine wichtige Rolle. Mit der Konzentration der so genannten Treibhausgase wächst jener Energiegewinn. Dies ist an einem außerirdischen Beispiel besonders deutlich zu erkennen: Am Boden der kohlendioxydreichen Atmosphäre des Planeten Venus herrscht eine Temperatur zwischen 450 und 700 Grad. Ihre Atmosphäre besteht allerdings zu 96% aus Kohlendioxyd. Auf unserer Erde hingegen sind es zurzeit nur 370 Millionstel Volumenanteile. Aber auch solch geringe Mengen erzeugen bereits einen "Treibhauseffekt". Was uns derzeit beunruhigt ist die Tatsache, dass der CO2- Gehalt unserer Atmosphäre von etwa 310 ppm im Jahre 1955 inzwischen auf über 370 ppm angestiegen ist. Daran könnten wir Menschen einen entscheidenden Anteil haben. Ob dies jedoch ein ausreichender Grund dafür ist, panisch zu reagieren und uns alle bange zu machen, dazu heute kein Kommentar. Auf meiner Wetter-Homepage können sie zu jenen Themen eine Menge lesen. Klicken Sie www.hoffydirect.de an. Von dort gelangen Sie zu allen meinen weiteren Seiten. Eine Schneeflocke ist eine Ansammlung von Schneekristallen. Liegt die Temperatur in der Nähe des Gefrierpunktes oder knapp darüber, werden die Schneeflocken nass. Sie kleben aneinander und können bis zu einem Durchmesser von 5 bis 7 cm anwachsen. Nur wenn die Temperatur ständig unter dem Gefrierpunkt bleibt, fallen einzelne Kristalle bis zur Erde. Liegt die Temperatur in der Wolke, in der sie entstehen, und in der Luft, durch die sie fallen, bei minus 2,7 Grad, sind die Kristalle im Allgemeinen flach und sechseckig. Zwischen -3 und -5 Grad werden sie nadelförmig und zwischen -5 und -7,7 Grad hohl und röhrenähnlich mit prismenförmigen Seitenflächen. Bei Temperaturen unter etwa -8 Grad können sie wie Säulen, Sechsecke oder Farne geformt sein. Praktisch alle Schneeflocken haben sechs Seiten. Diese Sechsersymmetrie ist ein wenig rätselhaft. Nach den Vermutungen mancher Wissenschaftler entsteht sie durch elektrische Ladungen in den Kristallen, andere meinen, sie sei eine grundlegende Eigenschaft der Wassermoleküle. Die Atome in einem H²O-Molekül sind nämlich angeordnet mit zwei kleinen Wasserstoffatomen an einem großen Sauerstoffatom wie die Ohren am Kopf von Micky-Maus. So könnte der Winkel, in dem die Wasserstoffatome vom Sauerstoff abstehen er beträgt etwa 120° - für die Sechsersymmetrie der Schneeflocken sorgen, in der sich sozusagen die Molekülstruktur des Wassers widerspiegelt. Dennoch gleicht sehr wahrscheinlich keine einzige Schneeflocke genau einer anderen. Etwa bei -4 Grad und bei Windstille lassen sich Schneeflocken zur Beobachtung am besten einfangen. Manchmal fallen die Kristalle einzeln, aber oft kleben sie in lockeren Klumpen zusammen, die bei der Landung zerfallen. Wenn man ein Stück dunkles Gewebe über Karton spannt und wartet, bis sich der Stoff an die Außentemperatur angepasst hat, bleiben meist die feinsten, empfindlichsten Kristalle so lange erhalten, dass man sie genau betrachten kann. Leichter und schwerer Schnee Wir haben es in diesem Winter besonders oft gehört: Manchmal lastet der Schnee schwer und nass auf den Ästen und lässt sie sogar abbrechen. Manche Flachdächer sind dann einsturgefährdet. Solange der Schnee nicht zu feucht ist, lassen sich daraus gut Schneemänner bauen. Manchmal türmt sich der Schnee aber auch locker auf einem Zaunpfahl. Dann besteht er aus großen, fein verästelten Flocken. Schnee ist also nicht gleich Schnee. Da gibt es einmal unverzweigte Nadeln und recht strukturlose Gebilde. Ein andermal besteht er aus unverzweigten kompakten Säulen, Knöpfen, Platten oder Eisprismen. Dann wieder aus sechsstrahligen Schneesternen oder aus Plättchen und bereiften Kugeln, als Griesel und Graupeln bekannt. Wenn runde weiße Häubchen auf Zweigen und Wipfeln sitzen oder sogar die Waben von Drahtzäunen mit feinen Kristallen geschmückt sind, so wirkt der Schnee ganz leicht und luftig. Ein kleiner Windhauch weht ihn dann auch sogleich wieder von unseren Antennendrähten und Antennenelementen. Ein solcher Schnee ist "trocken". Doch oft biegen sich die Zweige unter ihrer Schneelast, als ob sie sie kaum tragen könnten oder brechen sogar ab. Harte Schneelawinen rutschen von den Dächern und das Schneeräumen erfordert viel Kraft. Schneebälle lassen sich gut formen, aber sie sind schwer und eisig und somit als Wurfgeschosse gefährlich. Schnee kann somit verschiedene Gewichte haben. Um das Schneegewicht zu bestimmen, muss ein bestimmtes Volumen ausgestochen und geschmolzen werden. Die Schmelzwassermenge ergibt den Wassergehalt und das Gewicht des Schnees (1 ml Wasser wiegt 1 g). Eine bestimmte Menge Schnee lässt sich am einfachsten mit einer Konservendose ausstechen, auf dem Etikett ist nämlich ihr Inhalt (Volumen) aufgedruckt, z.B. 850 ml. Entfernen Sie mit dem Dosenöffner auch den unteren Deckel. Den Inhalt berechnen Sie nach der Formel: Volumen = r² mal Pi mal Höhe. Die präparierte Dose stechen Sie bis zur Oberkante in den Schnee, fahren mit einer Schaufel unter die untere Öffnung und schneiden die Schneesäule gerade ab. Liegt der Schnee nicht hoch genug, müssen Sie mehrfach ausstechen bis das Gefäß gefüllt ist. Den Schnee füllen Sie in einen Messbecher und lassen ihn im Zimmer schmelzen. Dann lesen Sie ab, wie viel ml (cm³) in dem Schneevolumen enthalten sind. Sind z.B. 90 ml Wasser im Messbecher, so ist das Wasservolumen durch das Dosenvolumen zu teilen, also 90: 850 = 0,106. Das bedeutet: In 1 ml Schnee stecken rund 0,1 ml Wasser. In Prozent sind das dann 10,6% Wassergehalt. Der Rest des Schneevolumens ist also Luft. So lässt sich leicht aus der Schneehöhe die Wassermenge ausrechnen, die beim Tauen entsteht, also wie schwer der Schnee bei der ermittelten Höhe ist. Wenn Schnee bei ruhigem, kaltem Wetter in großen Flocken fällt, bildet sich eine luftreiche, lockere Pulverschneedecke, die sich aber bald setzt und dichter, also wasserreicher wird. Ein kleinflockiger Schnee, von kräftigen Winden getrieben, setzt sich als dichtere Decke ab - der Wind bricht den Sternchen die Zacken ab, so dass sich die Flocken nicht verhaken. Vom Wind zusammen gewehter Schnee ist immer fester gepackt als frei gefallener. Sehr wasserhaltiger Schnee kann Schäden an Nadelbäumen verursachen, wenn er sich "klebrig" auf die Zweige legt. Schmilzt die Schneedecke an der Oberfläche und gefriert dann wieder, so "verharscht" der Schnee. Die Eisdecke kann dann dem Wild Verletzungen zufügen. Wenn sich eine dicke Schneedecke gebildet hat, so wird der untenliegende Schnee stärker zusammen gedrückt und sollte somit einen höheren Wassergehalt haben. Bei Gletschern wird älterer Schnee zu "Firn", der im Laufe der Zeit zu festem Eis gepresst wird. Den Langdrahtantennen und Antennenelementen der Funkamateure können die Schneeablagerungen kaum etwas anhaben. Aber auch hier ist die Gewichtsbelastung bei nassem Schnee natürlich am größten, reicht aber nicht zum Reißen oder Brechen. Anders sieht die Sache jedoch aus, wenn Eisregen oder unterkühlter Sprühregen um Drähte und Elemente eine Eisschicht anwachsen lässt. Dies kann zu sehr hohen Gewichtsbelastungen und zum Reißen der Drähte führen, manchmal auch zum Abbrechen von längeren freihängenden Antennenelementen. Aber das hat wie gesagt nichts mehr mit Schnee zu tun, sondern ist eine Sache von intensiver Reif- oder Eisbildung. Wegen der sich stark vergrößernden Zugspannungen an den Drähten knickten bisweilen sogar Hochspannungsmasten unter der Last ein. Nach der Wintersonnenwende am 22. Dezember werden die Nächte allmählich wieder kürzer und die Tage länger. Auf Grund der so genannten "Zeitgleichung" wird die Tageslänge bis gegen Ende Januar jedoch nur dadurch vergrößert, dass es abends immer länger hell bleibt, wohingegen die Sonnenaufgänge bis fast zum Ende dieses Monats Januar weiterhin fast konstant spät (so gegen 8.30 Uhr) erfolgen. Erst mit dem Beginn des Februars wird es dann auch spürbar morgens jeden Tag früher hell. Doch gerade in diesem von mir angesprochenen Zeitraum findet erst der Hochwinter statt. Das kommt auch in folgenden Bauernregeln zum Ausdruck: "Wenn der Tag beginnt zu langen, kommt der Winter erst gegangen." Oder: "Werden die Tage länger, wird der Winter strenger." Am 20. Januar heißt es: "An Fabian und Sebastian fängt der echte Winter an." Um diese Zeit hat sich in der Polarregion als Folge der Polarnacht die Luft so stark abgekühlt, dass bei Kaltluftvorstößen nach Mitteleuropa meist die niedrigsten Temperaturen des Winters auftreten. So heißt es in Bezug auf die Sonne, die auf Grund ihres tiefen Standes die Luft nur wenig erwärmen kann: "Januarsonne hat weder Kraft noch Wonne". Der Februar zeichnet sich zwar auch durch winterliches Wetter aus, doch ist er im Allgemeinen schon nicht mehr so kalt wie der Januar. So heißt es im Volksmund: "Der Februar sagt zum Januar, hätte ich die Gewalt wie du, erfröre das Kalb in der Kuh." Dies hat seinen Grund in der zunehmenden Tageslänge und Sonnenhöhe. Auch Warmlufteinbrüche mit Tauwetter sind im Februar häufiger zu erwarten als im Januar. So heißt es z.B. für den Valentinstag: "Am Tage von St. Valentin gehen Eis und Schnee dahin." Oder "am Matthiastag (24.2.) kein Fuchs über das Eis gehen mag." Der Spätwinter Mitte Februar ist oft mit einem kräftigen Hochdruckgebiet verbunden. Danach nimmt der Luftdruck bis Ende März deutlich ab. Die Kraft der Märzsonne erwärmt Luft und Erdboden so sehr, dass das winterliche Regime im Allgemeinen beendet ist. So heißt es für Kunigunde (3. März): "Kunigunde macht warm von unten". Oder für den Josefstag am 19.3. lautet ein Ausspruch: "Wenn´ s erst einmal Josefi ist, so endet auch der Winter gewiss." Natürlich muss man mit winterlichen "Nachwehen" und Nachtfrösten noch eine ganze Weile rechnen. In einigen Teilen Deutschlands gilt daher der Matthiastag (24.2.) als Datum für eine durchgreifende Umstellung des Wettercharakters: "Der Matthis bricht´ s Eis, findet er keins, dann macht er eins." Kalt trotz Klima-Erwärmung? Der extreme Wintereinbruch in Deutschland ist ein Einzelereignis Es bleibt dabei: Die Jahre von 2000 bis 2009 bilden das wärmste Jahrzehnt seit 130 Jahren Am 20. Dezember fiel massenhaft Schnee und legte den Flugverkehr lahm. Ein Hoch über Russland hatte zuvor eiskalte und trockene Kontinentalluft nach Europa getragen. Es kam zu Rekord-Tiefsttemperaturen. Am 20.12. brachte dann ein Tief milde und feuchte Luft von der Nordsee mit sich. Im Mischungsbereich jener Luftmassen kühlte sich die milde Luft stark ab und kondensierte aus - auf Grund der Kälte fiel statt Regen also Schnee. Beim Regen kann man die Mengen nicht so deutlich erkennen wie beim Schnee. Schnee führt somit stets zu dramatischeren Schlagzeilen, zumal er den Verkehr stärker behindert als eine entsprechende Regenmenge. Und jetzt zum Jahreswechsel 2009/10 hat sich eine neue Kälteperiode eingestellt. Mit Klimaänderung hat dies alles nichts zu tun. Jene Wettervorgänge sind Einzelereignisse und Momentaufnahmen. Man bezeichnet dies als aktuelles Wetter. Wetter ist übrigens immer nur aktuell! Hält sich dies über mehrere Tage oder sogar Wochen, spricht man von "Witterung". Wir erwarten somit aktuell in diesem Januar eine vorherrschend kalte Witterung. Und diese kann zur selben Zeit gar nicht so weit entfernt ganz anders sein. So herrschte in unseren frostigen Dezember-Tagen 2009 in Skandinavien eher ein mildes Winterwetter. Im Schnitt gleicht sich dies wieder aus. Klimaänderungen kann man nur global betrachten. Dazu benötigt man Weltwetter-Angaben von mindestens 30 Jahren. Klima ist statistisches Wetter. Es besteht nur aus statistischen Messwerten. Wenn ein Italiener bei 35 Grad sich in die kühlenden Fluten stürzt und zur selben Zeit im Winter auf der Südhalbkugel ein Obdachloser unter einer Brücke in Brasilien erfriert, so ist der Mittelwert beider Temperaturen durchaus erträglich (17 Grad). Damit könnte man leben! Kein schlechtes Klima! Aber wie gesagt, man braucht mindestens 30 Jahre für eine Statistik, die beginnt seriöser zu werden. Vergessen Sie also sehr schnell, unser derzeitiges Wetter in Deutschland mit einer Klimaerwärmung in Verbindung zu bringen! Die vergangenen kalten Tage und auch die Ente "Daisy" ändern nichts daran, dass die Durchschnittstemperaturen in Deutschland gestiegen sind. Das Mittel der Jahrestemperatur in Deutschland lag zwischen 1961 und 1990 bei 8,2 Grad. Seit 2000 stiegen die Durchschnittstemperaturen jedoch an und erreichten 2009 sogar 9,2 Grad. 2007 wurde sogar ein Rekordwert von 9,9 Grad ermittelt. Die Werte in den einzelnen Bundesländern fallen übrigens unterschiedlich aus. Die kalten Tage vor Weihnachten und auch die jetzigen im Januar sind somit Ausreißer. Der November war übrigens mit 7,3 Grad sogar um 3,3 Grad zu warm. Er gehört somit zu den drei wärmsten Novembermonaten in Deutschland seit 1881. Der gesamte Herbst 2009 war zu warm, hat jedoch den Rekord von 2006 nicht ganz erreicht (12 Grad gegenüber einem Mittel von 9,5 Grad). Es gibt eine sehr alte Bauernregel, die besagt, dass einem sehr milden November ein kalter Januar folgt, einem kalten November hingegen ein milder Januar. Eine weitere Bauernregel stellt fest, dass einem kalten Januar auch ein zu kalter Februar folgt. Aber das nur nebenbei. Man bedenke, dass jene Regeln in einer Zeit entstanden, als der Mensch beim Wetter noch nicht mitmischte. Es bleibt dabei: Wetter und Klima darf man nicht verwechseln. Klimawerte bestehen aus gemittelten Wetterdaten über mindestens 30 Jahre, am besten 100 Jahre - dann werden sie aussagekräftiger. Wenn sich Klimadaten verändern, kann man damit rechnen, dass sich ebenfalls die zu erwartenden Wetterereignisse ändern, die wie stets aus den uns bekannten Elementen bestehen wie Wind, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck usw. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, einzelne Wetterereignisse als relevant für oder gegen die derzeitige Klima- Diskussion anzuführen. Unser Verhalten sollte vielmehr geprägt sein von der Überzeugung, dass wir einfach noch zu wenig darüber wissen, inwieweit wir selbst mit unserer Treibgasemission zu einer globalen Erwärmung beitragen. Dies einfach dem Zufall zu überlassen und sozusagen nur mal auszuprobieren, was unsere Atmosphäre in den nächsten Jahrzehnten so macht, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist ethisch nicht vertretbar, mal ganz abgesehen von unserer Verpflichtung, den alten fossilen Energieträgern möglichst bald abzuschwören und dafür Alternativen zu entwickeln, die wir als Chance betrachten sollten, weltweit mit innovativen Techniken Arbeitsplätze zu sichern und neu zu schaffen. Klimaerwärmung als Chance, wie Sven Plöger es definierte. Klima hat sich immer wieder verändert. Das ist natürlich. Klima wird sich auch in Zukunft verändern, auch ohne unsere Einwirkung. Warmzeiten waren früher sogar Segenszeiten für die Menschheit. Dafür gibt es viele historische Belege. Dass wir inzwischen dabei sein könnten, das Klima (anthropogen) zu beeinflussen, führt zu einem Unsicherheitsfaktor im künftigen Wettergeschehen, der beunruhigend ist, erst recht im Hinblick auf die Lebensqualität unserer Nachkommen. Diese sollten niemals eine Klage gegen uns erheben können, wir hätten leichtfertig und egoistisch gehandelt. Wir hätten es doch besser wissen und dem entsprechend handeln müssen. Kopenhagen war leider bisher nur die Fortsetzung einer diesbezüglichen Änderung im Bewusstsein. Im Grunde haben wir uns in Kopenhagen, um das Klima zu retten, nur darauf geeinigt, das Klima zu retten. Mehr noch nicht. Daraus müssen bald rechtliche und allgemein verbindliche Taten hervorgehen. Zu spät? Sagen wir fünf nach zwölf. "El Nino" - "das Christkind" Es gibt eine katastrophale Witterung, die als "Christkind" bezeichnet wird (spanisch: "El Nino") Es handelt sich dabei um eine durchschnittlich alle fünf Jahre auftretende Witterung vor der Küste Perus. Katastrophal deshalb, weil sie in dieser Region ein Fisch- und Vogelstreben verursacht und somit den dort lebenden Menschen ihre Lebensgrundlage entzieht. Sie tritt so um die Weihnachtszeit auf, wenn auf der Südhalbkugel Sommer ist. Können Sie sich noch an ein paar Zeitungsartikel aus den 1980er Jahren erinnern? Damals wurde "El Nino" für unser Wetter hier in Europa entdeckt. Plötzlich wurde fast jedes Unwetter auf jenes Ereignis zurückgeführt. Trotz der damit verbundenen Aufregung und Faszination hatte die Wissenschaft damals sehr schnell herausgefunden, dass sich "El Nino" praktisch nicht auf das europäische Wetter auswirkt - wohl aber auf andere Regionen dieser Welt. Seinen Ursprung hat die Bezeichnung "das Christkind" in Peru. Alle etwa drei bis sieben Jahre beobachten die Fischer dort um die Weihnachtszeit herum das Verschwinden der für sie so wichtigen Fischschwärme. Dies wiederum lag daran, dass die Wassertemperaturen für einen Zeitraum von rund einem Jahr viel höher lagen, als das normalerweise der Fall ist. Teilweise kam es zu Anomalien von rund fünf Grad, wie es beim besonders starken Ereignis 1997/1998 der Fall war. Es ist der "Humboldtstrom" und mit ihm die Tatsache, dass die Südostpassate vor Südamerika das warme Oberflächenwasser nach Westen drücken, so dass kälteres und nährstoffreicheres Tiefenwasser nach oben quillt. Dies ist der Grund für die zahlreichen Fischschwärme in dieser Gegend. Lassen nun die Passatwinde nach, dann wird das warme Wasser nicht mehr von der Küste weggedrückt und es schwappt obendrein warmes Wasser aus dem westlichen Pazifik gegen die peruanische Küste. So gibt es dort kaum noch Fische, da das warme Wasser nährstoffarm ist. Das ozeanische Phänomen "El Nino" ist also mit den Passatwinden und damit mit den Vorgängen in der Atmosphäre verknüpft. Dabei spielt die so genannte "südliche Oszillation" in der Atmosphäre eine Rolle. Sie erinnern sich vielleicht noch an meinen Beitrag über das Azorenhoch und das Islandtief. Deren Stärke wird durch die "nordatlantische Oszillation" bestimmt, was einen ganz wichtigen Einfluss auf unser Wetter in Europa hat. Ich wiederhole: die "südliche Oszillation" wirkt sich auf die Passatwinde aus. Normalerweise herrscht über dem Ostpazifik im Bereich um Peru hoher Luftdruck und Wüstenklima, über Indonesien und den Philippinen hingegen tiefer Druck mit oft kräftigen Regengüssen. Und zwischen diesen Drucksystemen weht der Südostpassat, weil der Wind diese Luftdruckunterschiede auszugleichen trachtet. Steigt nun der Luftdruck über Indonesien, werden die Druckdifferenzen schwächer und somit auch der Südostpassat. Man kann hieran sehr gut erkennen, wie Ozean und Atmosphäre einen Prozess gemeinsam verstärken. Verschiedene Prozesse sorgen dafür, dass man in jenen betroffenen Regionen nicht von einem regelmäßigen Zyklus sprechen kann. Wann ein "El Nino" wieder auftritt, ist somit schwer vorherzusagen. Die Auslösung hängt meist mit Westwindperioden in den östlichen Philippinen zusammen. Das Ende des Phänomens wird durch eine einsetzende bessere Durchmischung der ozeanischen Deckschicht hervorgerufen. Dadurch sinken die Wasseroberflächentemperaturen, was zur Folge hat, dass die Luft weniger erwärmt wird und deshalb nicht mehr aufsteigt. Der Luftdruck über dem Ostpazifik steigt und die Südostpassate intensivieren sich wieder. Man kann den Prozess mit einer "Schaukel" vergleichen. Das Pendeln hin zur Warmwasseranomalie ist "El Nino". Die Kaltwasseranomalie heißt "La Nina". Das Jahr 2008 war beispielsweise ein "La Nina" - Jahr. Die verschiedenen Sphären unseres Klimasystems sind also bisweilen Schwingungen unterworfen. Damit haben regionale Bereiche unserer Atmosphäre eine Fähigkeit zur Fernwirkung. In "El Nino" - Jahren kommt es beispielsweise zu Dürren in Südostasien und Australien sowie zu verstärkten Niederschlägen an der südamerikanischen Westküste. Aber auch der indische Monsun wird beeinflusst, und selbst Teile der südlichen USA weisen Wetteranomalien auf. Europa ist - wie schon gesagt - mit diesen Ereignissen nahezu nicht verbunden. Mit Computermodellen ist man heute in der Lage, "El Nino" in Zeiträumen von bis zu einem Jahr vorherzusagen. Das kann man natürlich nicht nur mit den üblichen Wetterprognosen schaffen, sondern nur mit zusätzlichen Klimasimulationen. Im Hinblick auf die derzeitige Klimaerwärmung könnte es passieren, dass diese einen Klimazustand nach sich zieht, der einer Art permanenten "El Nino" entspricht. Ich hoffe, dass diese Nachricht auch in Kopenhagen (Hopenhagen !!) ankommt, denn die zusätzlichen Verlierer jener Klimaänderung zum Dauer- "El Nino" sind uns heute schon bekannt. Dezemberwetter Was hat uns der Dezember wettermäßig eigentlich alles so zu bieten? Smoglagen, Glatteis, Weihnachtstauwetter, Föhn, Halo- Erscheinungen und den berühmten "El Nino", das "Christkind". Natürlich gibt es auch Bauernregeln. Fangen wir gleich damit an: Wenn im Dezember noch kein Schnee fällt, ist dies für die Kornentwicklung nicht so gut, denn man sagt: " Dezember kalt mit Schnee, gibt Korn auf jeder Höh ". Früher wurden am 4. Dezember, also am letzten Freitag, Kirschzweige geschnitten. Diese sollten dann zu Weihnachten blühen. Es handelt sich um den Barbaratag, an dem man den ersten Frost erwartete. Über das Thema "Glatteis" habe ich mich bereits in einem meiner letzten Funkwetterberichte ausgelassen, also hier jetzt keine Wiederholung. Halo- Erscheinungen sind im Dezember relativ häufig. Wenn Sie bei Sonnenschein auf Schneekristalle schauen, sehen Sie oft farbige Reflexe in roten und blauen Farben. Solche Lichtbrechungen finden wir ja auch an Wassertröpfchen, die dann den Regenbogen erzeugen, über dessen Entstehung ich auch schon an dieser Stelle berichtet habe. Geht ein Lichtstrahl durch einen Eiskristall einer Wolke hindurch, so wird er gebrochen, also von seiner geraden Bahn abgelenkt. Solche Eiskristalle kommen oft in den dünnen hohen Wolken vor, den Zirrostrati. Sie können dann einen Ring mit blasser Farbentwicklung um die Sonne herum beobachten, den sog. Halo. Oft ist dieser ein Vorbote einer Wetterverschlechterung. Die Smog-Wetterlagen haben immer mit einem Hochdruckgebiet zu tun, welches den vertikalen Luftmassenaustausch unterbindet, so dass sich die Abgase in der bodennahen Luftschicht ansammeln können. Über das Weihnachtstauwetter habe ich in den vergangenen 31 Jahren wiederholt in diesem Monat Dezember berichtet. Ich will es in diesem Jahr nicht erneut tun. Ich nehme an, Sie wissen, was damit gemeint ist. Es ging dabei unter anderem stets um die Frage: Wie wahrscheinlich sind weiße Weihnachten bei uns in Deutschland, insbesondere hier am Niederrhein. Es bleibt bei etwa 10 % für weiße Weihnachten an Rhein und Ruhr. Über Föhnstürme in Bayern werden wir im November/Dezember recht häufig informiert. Sie treten auf, wenn feuchte Luftmassen über den Südkamm der Alpen nach Norden ziehen. Auf ihrer Luvseite bewirken sie große Niederschlagsmengen, auf der Leeseite hingegen trocknen sie aus und erwärmen sich und erzeugen im Alpenvorland einen aufgeheiterten Himmel mit relativ hohen Lufttemperaturen und geringer relativen Luftfeuchtigkeit in der bodennahen Luftschicht, bis zu 20°! Es gibt eine katastrophale Witterung, die als "Christkind" bezeichnet wird (spanisch: El Nino") Es handelt sich dabei um eine etwa alle 7 Jahre auftretende Witterung vor der Küste Perus. Katastrophal deshalb, weil sie in dieser Region ein Fisch- und Vogelstreben verursacht. Sie tritt so um die Weihnachtszeit auf, wenn auf der Südhalbkugel Sommer ist. Der Mistral Im letzten Beitrag berichtete ich über die drei weltweiten globalen Windsysteme, die das Klima auf der Erde mitbestimmen, den Passat, die Westwinddrift und die Polarwinde. Nun gibt es natürlich noch eine große Menge lokaler Windsysteme, die sich rund um unseren Globus verteilen. Einer der bekanntesten lokalen Winde in Europa ist der Mistral. Wenn kalte schwere Luft von Nordosten und Norden her gegen die Alpen strömt, wird sie sich einen Weg zwischen den Hindernissen suchen. Vor allem wenn ein Hoch über Nordfrankreich die kalte Luft daran hindert, die Berge zu überströmen und wenn gleichzeitig noch die Saugwirkung eines Tiefs im Raume Genua einsetzt, gibt es für die Luft nur den Weg durch das Rhonetal. Dabei wirken die französischen Alpen und das Zentralmassiv wie ein Trichter. Die Luft wird beschleunigt und bläst mit Sturmstärke durch das Tal. Der Mistral kann Orkanstärke und somit Windgeschwindigkeiten von über 120 km pro h erreichen. Auf der Autobahn von Lyon nach Marseille haben dann sowohl die PKW als auch Lastkraftwagen ihre Probleme. Manche wurden dabei schon von der Fahrbahn geweht. Der Mistral braust durch die Rhonemündung auf das Mittelmeer hinaus und hat als böiger Nordwind bis zu einer Entfernung von über 100 km von der Küste beim plötzlichen Einsetzen schon so manches Segelboot kentern lassen. Im Schweizer Mittelland gibt es einen ähnlichen Wind bei ähnlicher Wetterlage. Er kommt kalt und trocken aus Nordosten und weht bis in die Gegend um Genf und die französischen Voralpen. Er wird Bise genannt. Ein dem Mistral vergleichbarer Wind ist der so genannte Vardarwind. Er bläst in Mazedonien und Griechenland, wenn ein Hoch über Mitteleuropa liegt. Von Skopje kommend zwängt sich der Vardar durch ein enges Tal nach Südosten. Danach öffnet er sich weit zur Ägäis bei Thessaloniki. Die Windsysteme Davon gibt es drei große, die das Klima prägen, auf unserem Planeten. Zum einen wehen zwischen 30 Grad Breite und dem Äquator die so genannten Passate: Am Äquator erwärmte Luft steigt auf, fließt nach Norden oder Süden, kühlt sich dabei ab und strömt in Bodennähe zurück zum Äquator. Die Passate werden durch die Erdrotation, die sog. Corioliskraft, abgelenkt. Diese beschleunigt Bewegungen zu den Polen nach Osten und zum Äquator nach Westen. Daher wehen die Passate stets aus östlicher Richtung. In den mittleren Breiten hingegen herrschen Winde aus dem Westen vor, mit denen sich Tiefdruckgebiete nach Osten verlagern. Das dritte Luftdrucksystem befindet sich an den Polen. Von einem Hochdrucksystem über den Polkappen aus werden die abfließenden Luftmassen abgelenkt. Über diesen drei Systemen blasen in großer Höhe starke Westwinde (Jetstreams). Sie gleichen große horizontale Druckdifferenzen an der Grenze zwischen Warm- und Kaltluftmassen aus. Zu den weiteren wichtigen Klimafaktoren zählen wir die ozeanischen Strömungen sowie die Wolken und die Wärmestrahlung. Darüber vielleicht später einmal mehr. Spätherbst Wir befinden uns im Spätherbst, gekennzeichnet durch allgemeinen Laubfall, vor allem der Rosskastanie, und nun geht das Wintergetreide auf. Der Spätherbst beginnt Ende Oktober und erfasst normalerweise den gesamten November, reicht in günstigen Regionen bis Mitte Dezember. Erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts beschäftigten sich Naturwissenschaftler mit Klima und Wetter. Als erstes verbannten sie manche Bauernregel als unwissenschaftlichen Aberglauben. Doch trotz aller computergestützten Wettervorhersagen ist auch heute noch keine hundertprozentige Sicherheit zu erreichen. Wir stehen nun der Wetterwissenschaft gelassener gegenüber, so dass wir die alten Wettersprüche gern zur Kenntnis nehmen und mit der wissenschaftlichen Prognose vergleichen. Und solch ein Spruch lautet z.B. für den St. Martinstag: "Wenn um Martini Nebel sind, so wird der Winter meist gelind. Zieht die Spinne ins Gemach, kommt ihr gleich der Winter nach. Hecken die Hühner in den Ecken, kommt der Winter mit Frost und Schrecken". Die Sehnsucht nach Wärme und Sonne ist offensichtlich nicht nur eine Erfindung der Tourismus-Industrie. Schon seit Jahrhunderten freuen sich die Menschen über den "Altweibersommer" oder einen "goldenen Oktober". Doch mit dem November bricht unweigerlich die kalte Jahreszeit an. "Wenn der Winter vor Allerheiligen (1.11.) nicht kommt, kommt er nicht vor Martini (11.11.)" Neben "Altweibersommer" und "goldenem Oktober" hat eine weitere Schönwetter-Periode einen eigenen Namen erhalten: Im Zeitraum Anfang November können sich dann häufiger Hochdruckgebiete über Europa halten und für Sonnenschein sorgen. Dieser Zeitraum wird deshalb auch als "Nachsommer" bezeichnet. Davon gab es diesmal einige Tage. Aber auch bei solch schönem Wetter ist es mit Temperaturen unterhalb von 10 Grad auf jeden Fall kalt, da es in den meist klaren Nächten stark abkühlt. "Ist Martini (11.11.) klar mit Sonnenschein, bricht bald ein kalter Winter herein. - Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter hart." - Für diese Regel konnten die Meteorologen keine Bestätigung finden: Es lassen sich von der Wetterlage am 11. November keine Rückschlüsse auf den folgenden Winter ziehen, - bei dem Wetterdurcheinander auf Grund der Klimaerwärmung sowieso nicht mehr. "Wie der Tag zu Kathrein (25.11.), wird der nächste Februar bzw. Neujahr sein." Diese Bauernregel hält der wissenschaftlichen Betrachtung - zumindest teilweise - stand: Ist es um den 25.11. zu trocken, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit (über 80 Prozent!) auch der Februar zu trocken. Auch bei zuviel Feuchtigkeit um den 25.11. wird der Februar zu feucht. "Friert im November zeitig das Wasser, wird's im Januar umso nasser." - Auf den ersten Blick ein wirklich grotesker Zusammenhang, den die mittelalterlichen Wetter-Weisen da aufgestellt haben. Aber tatsächlich bestätigen die langjährigen Wetteraufzeichnungen diese Regel: Je häufiger es Anfang November friert, desto mehr Regentage gibt es im Januar. Wenn es also zurzeit noch kälter werden sollte, wäre dies auf keinen Fall ein Hinweis auf einen kalten Winter, eher im Gegenteil. Und das mit einer erstaunlichen Treffergenauigkeit von rund 80 Prozent! Aber was das Wetter tatsächlich in der kommenden Wochen uns anzubieten hat, haben Sie ja zu Beginn eben gehört. SCHAUER In den Wettermeldungen der vergangenen Woche kam recht häufig der Begriff "Schauer" vor. Es wurde vom "Aprilwetter" im November gesprochen. Drei Dinge sind für das Auftreten von Schauern notwendig: 1. eine instabile Luftschichtung, 2. ein Auslöser für Aufwärtsbewegungen der bodennahen Luftschicht und 3. ausreichende Luftfeuchtigkeit. Wenn ein Luftpaket vom Boden her aus eigenem Antrieb in beträchtliche Höhen weiter aufsteigt, bezeichnet man die vorhandene Luftschichtung als instabil oder "labil". Wir benötigen also eine nach oben gerichtete Luftströmung, die große, solide Kumuluswolken anwachsen lässt, und zwar bis weit über die Frostgrenze hinaus. Solche Wolken entstehen zum Beispiel mit einsetzender Thermik in der warmen Jahreszeit. Sobald die über den Boden strömende kühle Luft von der Sonne erwärmt wird, - das wissen besonders die Segelflieger setzt die Thermikentwicklung ein. Diese Wolken entstehen aber auch durch das Einfließen von Höhenkaltluft, also ohne nennenswerte Erwärmung von unten. Dabei kann es am Boden relativ kalt sein, wie zum Beispiel im Winter. Es kommt dann nur darauf an, dass es in der Höhe wesentlich kälter ist als unten. So kann es auch in der kalten Jahreszeit Schauer und Gewitter geben. Es kommt also nur auf die Temperaturdifferenz zwischen Boden- und Höhenluft an. Und diese kann auch im Winter recht hoch sein, wenn zum Beispiel frische Polarluft eindringt. Eine Quelle für Thermik ist z.B. ein örtlich begrenztes Gebiet, das wärmer als seine Umgebung ist. Überall dort, wo der Boden dunkel und relativ trocken ist und die Sonneneinstrahlung nicht bis in größere Tiefen eindringen kann, ist eine Thermikauslösung möglich, denn dort steigt die Temperatur gegenüber derjenigen der Umgebung. Bei der Entwicklung einer Schauerwolke ist es nun so, dass die Luft erst einmal trocken aufsteigt und sich dabei um ca. 1 Grad C je 100 m abkühlt. Wenn diese dann den Taupunkt erreicht hat, steigt sie mit Feuchte gesättigt - erst jetzt als Wolke erkennbar - weiter auf, kühlt sich jedoch, weil Kondensationswärme frei wird, nur noch um 0,65 Grad je 100 m ab. Sie wird also beim Aufsteigen dann nur langsamer kälter als vorher. Sie steigt so lange weiter auf, bis sie die gleiche Temperatur durch Abkühlung erreicht hat wie die Luft der Umgebung. Das kann z.B. im Bereich einer Inversion der Fall sein. Das Temperaturprofil der Umgebungsluft, das sich übrigens von Tag zu Tag, ja oft von Stunde zu Stunde ändert, entscheidet darüber, wie mächtig die Haufenwolke anwächst und ob daraus letztendlich Niederschlag fällt. Fehlen z.B. Inversionen, dann bleibt ein aufsteigendes Wolkenpaket recht lange wärmer als seine Umgebung und wird weiter immer größere Höhen erklimmen, recht oft Höhen von 6000 m bis hinauf zu ca. 10 000 m im Sommer! Aus einem derart großen Wolkenberg, der bis in große Höhen kalt ist - wie z.B. bei maritimer Polarluft werden sich Schauer entwickeln. Die polare Meeresluft besitzt nämlich genügend Feuchtigkeit, um die Kondensation beim Vorstoß der Luft in große Höhen voran zu treiben. Natürlich muss die Luft zum Ausgleich in der Umgebung einer solchen Schauerwolke absinken. Absinkende Luft bewirkt aber eine Inversion in der Höhe, denn beim Absinken erwärmt sich die Luft um ca. 1 Grad je 100 m, wird also - auf gleiche Höhe bezogen - wärmer als diejenige in der Wolke. Dabei verdunstet die Feuchtigkeit und der Himmel klart auf, so dass die Sonne kurzfristig durchkommt. Das ist der Grund für das so genannte "Aprilwetter", da im April derartige Wetterbedingungen sehr häufig auftreten. An jenen Inversionen hört ein neuer Aufstieg von Luft auf. Deshalb treten manchmal bei intensiver Schauertätigkeit auch kurzfristig wechselnde UKW-Bedingungen auf, eben wegen jener plötzlich sich bildenden engräumigen Absinkinversionen. Wenn die Wolken mächtig genug sind, um den Niederschlagsprozess in Gang zu setzen, fällt ein Regenschauer oder je nach Temperaturverhältnissen ein Graupelschauer. Falls nicht, entstehen nur Kumuli (Haufenwolken) ohne Regen. Das Thema der Regenschauer ist damit noch längst nicht erschöpft. Vielleicht bald einmal mehr dazu. Vielleicht im Schauermonat April. Verschiedene Nebel In dieser Jahreszeit tritt Nebel statistisch recht häufig auf. Doch Nebel ist noch längst nicht gleich Nebel. Allgemein für jede Form von Nebel gilt: Die Luft ist manchmal mit Feuchtigkeit übersättigt, so dass der Wasserdampf bei vertikaler Durchmischung durch leichten Wind darin spontan zu feinen Tröpfchen kondensiert. Die Wasserpartikel sind etwas kleiner als die beim feinsten Nieselregen und damit leicht genug, um in der Luft zu schweben. Jene Übersättigung feuchter Luft kann jedoch mehrere verschiedene Ursachen haben. Man unterscheidet etwa fünf verschiedene Nebelarten. Da gibt es zunächst den "Strahlungsnebel". Er entsteht dadurch, dass der Boden stark abkühlt, weil er seine Wärme ausstrahlt. Die aufliegenden Luftschichten geben nun ihre Wärme an den Boden ab und kühlen dabei bis zum Taupunkt ab. Jener Nebel entsteht nur bei sehr schwachem Wind bei klarem Himmel in der Nacht. Hauptentstehungszeiten sind Herbst und Frühjahr. Bei Windstille kommt es oft nur zu Tau-, bzw. Reifbildung. Darüber habe ich am vergangenen Sonntag ausführlicher berichtet. Als eine weitere Nebelart gilt der "Advektionsnebel". Er wird dadurch hervorgerufen, dass sich eine Luftmasse durch das Überstreichen eines kühlen Untergrundes stark abkühlt. Er tritt vor allem im Winter auf, wenn warme und feuchte Luft ihre Wärmeenergie durch Turbulenz und Strahlung auf den kälteren Boden überträgt. Dazu gehört aber auch der "Böschungsnebel", der häufig an Berghängen entsteht, wenn warme Luftströmungen der Geländeform folgen und schließlich eine Höhe erreichen, wo sie wegen kalter Oberflächen oder kalter Umgebungsluft kondensieren müssen. Dies geschieht z.B. in den Ebenen des Mittleren Westens der USA, wo feuchter Wind vom Golf von Mexiko am Fuß der Rocky Mountains aufsteigt, aber auch in den Küstengebieten, wo feuchte Meeresluft an Berghängen nach oben gedrückt wird. Eine weitere Art von Nebel ist der "Mischungsnebel". Feuchte, wärmere Luft strömt in kühle Luft hinein und mischt sich mit ihr. Jene Nebelart kann zu allen Jahreszeiten auftreten, vornehmlich in Küstennähe, wenn die Regentropfen einer Warmfront in eine kältere Luft hinein verdunsten. Ein weiteres Nebelphänomen ist der See- oder Flussnebel. Er bildet sich über Wasserflächen, die wärmer als die umgebende Luft sind. Die 5. Art von Nebel in dieser Reihe nennt man Hochnebel. Er bildet sich bei Inversionslagen und besitzt meist eine deutlich sichtbare Untergrenze. Jene liegt oft nur wenige 100 Meter über dem Erdboden. Strahlungs- und Hochnebel kommen bei uns am Niederrhein am häufigsten vor. In sehr kalter Luft kondensiert Wasserdampf oft direkt zu Eiskristallen, also zu Eisnebel. Wenn auch die Nebel von London und San Francisco eine gewisse Berühmtheit erlangt haben, so tritt Nebel doch an anderen Orten noch häufiger auf. Die nebligste Stelle der Erde ist wahrscheinlich Cape Race an der Südostecke Neufundlands. Dort ist der Blick auf den Atlantik an durchschnittlich 158 Tagen im Jahr verhüllt. Der Nebel hat viele Maler, Dichter und Komponisten zu künstlerischen Schaffensprozessen angeregt. So trägt z.B. der 2. Satz in Peter Tschaikowskys 1. Sinfonie den Titel "Land der Öde, Land des Nebels." Es lohnt, sich jene Tonmalerei einmal anzuhören. Sehr große Berühmtheit hat auch Hermann Hesses Gedicht "Im Nebel" erlangt: "Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder Busch und Stein, Kein Baum sieht den andern, Jeder ist allein. Voll Freunden war mir die Welt, Als noch mein Leben licht war; Nun, da der Nebel fällt, Ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, Der nicht das Dunkel kennt, Das unentrinnbar und leise Von allen ihn trennt. Seltsam, im Nebel zu wandern! Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den andern, Jeder ist allein." Tau und Reif Es ist allgemein bekannt, dass die Temperaturen in einer klaren Nacht oftmals recht stark absinken. Wie kommt das eigentlich? Nicht nur die Sonne, sondern jeder stoffliche Körper - also auch die Erde und die Luft sendet eine ausschließlich von seiner Temperatur abhängige Strahlung aus. Diese so genannte "Emission" ist umso stärker, je höher die Temperatur des Körpers ist. Dabei verschiebt sich mit zunehmender Strahlung das Spektrum weiter zu kürzeren, energiereicheren Wellenlängen. Nun ist es aber so, dass ein Körper nicht nur selbst Wärme ausstrahlt, sondern auch selbst in bestimmten Wellenlängenbereichen Wärme empfängt (absorbiert). So absorbieren die Erdoberfläche und die Luft am Tage einen Großteil der einfallenden kurzwelligen Sonnenstrahlung. Der Betrag ist meist größer als der, der durch die Ausstrahlung nachts wieder abgegeben wird. Nach Sonnenuntergang fällt der Anteil der Sonnenstrahlung natürlich weg. So kann sich die Erde mit der sie umgebenden Luft zunehmend abkühlen. Die Luft ist ja ein Gemisch verschiedener Gase. Der überwiegende Teil ist Stickstoff. In diesem Gemisch werden Strahlungen verschiedener Längenbereiche aufgenommen. Dazu gehören auch die bekannten Treibhausgase, also das Kohlendioxid, das Methan und der ebenfalls unsichtbare Wasserdampf. Diese Gase "verschlucken" die von der Erdoberfläche ausgesandten Wärmestrahlen (Infrarot) recht stark. Die Luft bleibt relativ warm, wenn ihr Wasserdampfanteil groß ist. Dann nämlich vermag sie die von der Erdoberfläche ausgestrahlte Wärmeenergie gut zu speichern. Wenn der Wasserdampf in Form von Wolken oder Nebel kondensiert, wenn sich also Wassertröpfchen bilden, wird die Wärmeausstrahlung noch viel stärker absorbiert als durch den gasförmigen, unsichtbaren Wasserdampf. Dann kühlt die Luft kaum aus. Bei aufklarendem Himmel werden die Temperaturen nur dann drastisch zurückgehen, wenn die Luft trocken und der Himmel klar sind. In diesem Fall kann nämlich der Erdboden seine Wärme ungehindert ausstrahlen. Dabei werden Erdboden und die darüber liegende Luft spürbar kälter. Es kann beim Erreichen des Taupunktes zu Nebelbildung, manchmal aber auch nur zu Tauoder Reifbildung kommen. In früheren Zeiten erinnerten sich Bauern, die morgens zu ihrer Scheune gingen, wahrscheinlich an ein altes Sprichwort: "Wenn der Tau liegt auf dem Gras, macht es heut kein Regen nass, sieht man aber trock´ne Wiesen, wird es vor dem Abend gießen." Fehlender oder vorhandener Tau ist zwar kein absolut sicheres Wetterzeichen, aber es spiegelt die Vorgänge in der Atmosphäre während der Nacht wider. Starker Tau bildet sich oft unter einem klaren Himmel, wenn der Verlust von Strahlungsenergie am Boden die Voraussetzungen für die Kondensation schafft. Bildet sich dagegen kein Tau, ist die Ursache oft eine Wolkendecke, die in der Nacht die Abkühlung des Bodens verhindert. Tau entsteht wie Nebel, wenn feuchte Luft mit einer kalten Oberfläche in Berührung kommt. Nachts kühlt sich die Erdoberfläche ab, so dass die warme, feuchte Luft, die in seine Nähe kommt, ebenfalls Wärme verliert. Da die kalte Luft nicht soviel Wasser aufnehmen kann wie die warme, nimmt ihre Sättigung mit Wasserdampf immer stärker zu, bis schließlich der sog. "Taupunkt" erreicht ist, an dem sie keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Wenn kein Wind für eine senkrechte Durchmischung der Kaltluft und der warmen, gesättigten Luft sorgt, erfolgt die Kondensation nicht in der Luft - was Nebel erzeugen würde - sondern auf allen kalten Oberflächen, welche die Luft berührt. Wenn also die Wassermoleküle einen Grashalm oder das kalte Blech eines Autos berühren, kondensieren sie dort. So entstehen, zusammen mit der Eigenfeuchtigkeit der Pflanze, die uns bekannten Tautropfen, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sprechen wir von Reif. Da Tau scheinbar aus der dünnen Luft entsteht und nur in kleinen Mengen vorkommt, hielt man ihn lange Zeit für eine Art himmlischen Nektar mit magischen oder verjüngenden Eigenschaften. Wenn man sich, vor allem im Mai, das Gesicht damit wusch, sollte das gut für den Teint sein. Als Getränk hielt man ihn ebenso gesund wie Lebertran, nur schmeckte er besser. Weiterhin - so habe ich in einem Sachbuch gefunden - soll sich der alte Kämpfer Oliver Cromwell ab und zu mit einem Schluck Morgentau gestärkt haben. Bei den Maifeiern im alten England wälzten sich angeblich junge Mädchen manchmal nackt im Morgentau, weil sie sich attraktiver machen wollten. Davon hört man nun schon lange nichts mehr. Vielleicht fühlten sich die Damen ja von der zunehmenden Anzahl der amtlichen Wetterfrösche gestört. Es gab einmal Zeiten ohne Telefon, Autos und Internet, wobei man im Zeitalter der Postkutschen oft wochenlang auf die Antwort eines Briefes warten musste. Auch fehlten amtliche Wetterprognosen. Heute können wir unsere modernen Wetterpropheten auf Hunderten von Seiten im Internet aufrufen, wohingegen man sich früher auf eigene Wetterbeobachtungen oder die Aussagen der Bauern beziehen musste, wenn es um die Vorhersage der künftigen Wetterentwicklung ging. So waren unsere Vorfahren auf jeden Fall bessere Wetterbeobachter als wir es heute sind und nicht bloße Wetter- Konsumenten, bzw. Wetterkunden. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass viele der mannigfaltigen Bauernregeln heute noch weitgehend stimmen. Beobachtete man zum Beispiel Frösche auf Stegen und Wegen, deutete dies auf baldigen Regen hin. Ihr Landgang war nämlich ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und bald einsetzenden Niederschlag. Das galt vor allem dann, wenn auch noch Spinnen zu dieser Zeit vermehrt ihre Netze bauten. Und wenn die Insekten Gewitter spürten, schwirrten sie dicht über den Wiesen, was zur Folge hatte, dass die Schwalben für alle sichtbar tief flogen. Auch die Pflanzen gaben deutliche Hinweise auf das zu erwartende Wetter. So deuteten nach unten geklappte Blätter des Sauerklees auf baldigen Regen. Ähnlich verhielten sich Tomaten-, Bohnen- und Gurkenblätter. Senkte der Mohn seine Köpfe, konnte man Sturm erwarten, wohingegen man bei weit geöffneten Anemonenblüten richtig schönes Wetter in Aussicht gestellt bekam. Auch der Regenbogen hat bis heute Botschaften zu bieten, die auf das Wetter der kommenden Stunden hindeuten. Vormittags bildet sich der Regenbogen im Westen. Weht dazu ein Westwind, ist mit Regen zu rechnen, denn hierzulande kommen die meisten Winde aus westlichen Richtungen. Ein Regenbogen am Nachmittag bringt jedoch meistens besseres Wetter. Zu dieser Zeit steht der Regenbogen im Osten. Die dort angesiedelten Wolken ziehen meist ab oder fallen in den Abendstunden auf Grund nachlassender Thermik in sich zusammen. Auch das Abendrot ist ein wichtiges Zeichen für meist gutes Wetter. Die Sonne geht ja im Westen unter und in unseren Breiten treiben die meisten Wolken von Westen heran. So ist ein blasses Abendrot meist ein Zeichen für schönes Wetter. Ein knallig roter Sonnenuntergang verheißt hingegen oftmals nichts Gutes. Denn dann ist die Luft sehr wasserhaltig. Regenwolken können sich leicht bilden. Bei einem feurigen Morgenrot sollte man auf jeden Fall den Schirm nicht vergessen. Denn von Westen her wird weiterhin sehr feuchte Luft erwartet. Die Wolken selbst geben natürlich jede Menge Hinweise auf das zu erwartende Wetter. Jene Beobachtung ist jedoch schon schwieriger und man benötigt eine Menge Erfahrung. Allgemein bekannt ist wohl, dass Schäfchenwolken - die mittelhohen Altokumulusbällchen meist gutes Wetter verheißen, wohingegen schmale Zirrusfetzen darauf hinweisen, dass es bald wettermäßig ungemütlich werden könnte. Aber auch in Zirren kann man sich - wie in Frauen - öfters mal irren. Wichtige Hinweise auf Schauer- und Regenbildung gibt die Tagesentwicklung der Haufenwolken, der Kumuli. Zu einer solchen Beurteilung benötigt man jedoch bereits eine detaillierte Kenntnis über Thermik, Inversion und Wolkenformen und deren Aussehen. Aber auch ein blauer Himmel hat so seine Wettergeheimnisse. Hier ist es die Intensität des Blau- Tons, die etwas über die Wetterlage aussagt. Ein leuchtendes Hellblau ist die beste Prognose für bleibend schönes Sommerwetter. Ein milchiges Graublau zeigt eine hohe Luftfeuchtigkeit an. So sind die Aussichten dann eher trüb: Regen zieht bald auf. Ein auffallend dunkles Blau bringt oftmals neuen Regen. Meist ist vorher eine Kaltfront durchgezogen und die Luft ist dahinter besonders trübungsarm. Die so genannte "postfrontale Subsidenz", also absinkende Luftmassen hinter der Frontlinie, sorgen für das tiefe Himmelsblau und eine manchmal bis zu einigen Stunden andauernde Regenpause. Es gibt natürlich noch viel mehr natürliche Hinweise auf das künftige Wetter, zum Beispiel sind auch Bäume und Winde bisweilen als Wetterpropheten zu verwenden. Sie können also auch heute noch eine ganze Menge über das Wetter und seine Entwicklung erfahren, auch ohne die Medien und das Internet zu bemühen, so wie Sie auch heute noch einen handgeschriebenen Brief zur Post bringen können anstatt schnell mal eine E-Mail zu tippen, oder einfach mal zu Fuß gehen, statt das Fahrrad oder den Wagen zu benutzen. Dann werden Sie wahrscheinlich auch wieder zu einem besseren Wetterbeobachter und haben erst recht etwas davon, wenn Sie bei totalem Stromausfall auf Ihr Barometer schauen. Die WetterMessinstrumente habe ich in diesem Zusammenhang ja noch gar nicht erwähnt. Und das müssen nicht unbedingt Kiefernzapfen sein. Schönen Sonntag und eine gute Woche! Vy 73 Klaus, DL5EJ Aufklaren Es ist allgemein bekannt, dass die Temperaturen in einer klaren Nacht oftmals recht stark absinken. Wie kommt das eigentlich? Nicht nur die Sonne, sondern jeder stoffliche Körper - also auch die Erde und die Luft sendet eine ausschließlich von seiner Temperatur abhängige Strahlung aus. Diese sogenannte "Emission" ist um so stärker, je höher die Temperatur des Körpers ist. Dabei verschiebt sich mit zunehmender Strahlung das Spektrum weiter zu kürzeren, energiereicheren Wellenlängen. Nun ist es aber so, dass ein Körper nicht nur selbst Wärme ausstrahlt, sondern auch selbst in bestimmten Wellenlängenbereichen Wärme empfängt (absorbiert). So absorbieren die Erdoberfläche und die Luft am Tage einen Großteil der einfallenden kurzwelligen Sonnenstrahlung. Der Betrag ist meist größer als der, der durch die Ausstrahlung nachts wieder abgegeben wird. Nach Sonnenuntergang fällt der Anteil der Sonnenstrahlung natürlich weg. So kann sich die Erde mit der sie umgebenden Luft zunehmend abkühlen. Die Luft ist ja ein Gemisch verschiedener Gase. Der überwiegende Teil ist Stickstoff. In diesem Gemisch werden Strahlungen verschiedener Längenbereiche aufgenommen. Dazu gehören auch die bekannten Treibhausgase, also das Kohlendioxid, das Methan und der ebenfalls unsichtbare Wasserdampf. Diese Gase "verschlucken" die von der Erdoberfläche ausgesandten Wärmestrahlen (Infrarot) recht stark. Die Luft bleibt relativ warm, wenn ihr Wasserdampfanteil groß ist. Dann nämlich vermag sie die von der Erdoberfläche ausgestrahlte Wärmeenergie gut zu speichern. Wenn der Wasserdampf in Form von Wolken oder Nebel kondensiert, wenn sich also Wassertröpfchen bilden, wird die Wärmeausstrahlung noch viel stärker absorbiert als durch den gasförmigen, unsichtbaren Wasserdampf. Dann kühlt die Luft kaum aus. Bei aufklarendem Himmel werden die Temperaturen nur dann drastisch zurück gehen, wenn die Luft trocken und der Himmel klar sind. In diesem Fall kann nämlich der Erdboden seine Wärme ungehindert ausstrahlen. Dabei werden Erdboden und die darüber liegende Luft spürbar kälter. Die größte uns auf dieser Erde bekannte nächtliche Abkühlung erfolgt in den Wüstengebieten mit ihren extrem trockenen Luftmassen unter äußerst klarem Himmel. In Deutschland treten die stärksten Nachtfröste meist bei winterlichen Hochdrucklagen auf, wenn aus Osteuropa trockene Kontinentalluft heran geführt wird. Besonders tief sinken die Temperaturen dann über Schneeflächen ab, da der Schnee als schlechter Wärmeleiter die Wärme des Erdbodens nicht durchlässt. Dadurch kann der Erdboden seine Wärme nicht abstrahlen, was zu besonders tiefen Temperaturen der Luft dicht über der Schneedecke führt. Die Grenztemperatur der weiteren Abkühlung wird jedoch durch den "Taupunkt" der Luft bestimmt. Das ist die Temperatur, bei welcher der Wasserdampf der Luft zur Sättigung kommt, so dass Nebel oder Raureif entsteht. Unter diesen Taupunkt kann sich die Luft kaum noch abkühlen, da bei der Kondensation des Wasserdampfes Wärme an die Luft abgegeben wird. Glätte In den Wetterberichten taucht der Begriff der "Glätte" nun wieder vermehrt auf. "Glätte" ist eine Sammelbezeichnung für meteorologische Erscheinungen, die durch Eisablagerungen am Erdbden oder an Gegenständen hervorgerufen werden. Hier muss man deutlich unterscheiden zwischen Eisglätte, Glatteis, Reifglätte und Schneeglätte. Eisglätte entsteht dadurch, dass auf dem Erdboden bereits vorhandenes Wasser gefriert. Das kann z.B. gefrorenes Schmelzwasser einer Schnee- oder Eisdecke sein. Sehr häufig stellt sich Eisglätte ein, wenn nach einem Kälteeinbruch mit Regen beim nächtlichen Aufklaren die Temperatur am Erdboden den Gefrierpunkt unterschreitet. Man spricht dann auch von "gefrierender Nässe". Glatteis wird durch gefrierenden Regen oder Sprühregen hervorgerufen. Reifglätte entsteht durch Bildung von Reif am Erdboden und Schneeglätte durch festgefahrenen oder festgetretenen Schnee. Vorsicht also, wenn es bei sinkenden Temperaturen und nassen Straßen aufklart! Dann besteht die Gefahr von Eisglätte. Vorsicht, wenn es bei Frosttemperaturen anstatt zu schneien, zu regnen beginnt. Dann kann es Glatteis geben. Vorsicht, wenn die Straßen mit einem weißen Hauch überzogen sind. Dann ist die Gefahr vorhanden, dass sich Reifglätte bildet. Zum Schluss ein Rätsel: Es hat die gesamte Nacht geregnet und es regnet auch am Tage bei sinkenden Temperaturen weiter. Am Nachmittag geht der Regen in Schnee über und es schneit nun bis in die späten Abendstunden. Um Mitternacht gibt es die ersten Wolkenlücken und später klart der Himmel ganz auf. Welchen Namen hat die Glätte, mit der Sie nun rechnen müssen? Kreuzen Sie richtig an: Glatteis, Eisglätte, Reifglätte, Schneeglätte. Jetstream Warum halten sich eigentlich manche Wetterlagen so lange und wie kommt es zur bekannten Erhaltungstendenz des Wetters? Daran sind die Wellen der westöstlichen Grundströmung der gemäßigten Breiten beteiligt, also die Höhenwinde. In den Subtropen reicht die warme, und somit dünnere Luft bis in Höhen von etwa 16 km, während im Subpolargebiet die gleiche Masse kalter, dichterer Luft sich nur bis in Höhen von 6 bis 10 km ausdehnt. Das hat entscheidenden Einfluß auf die globale Windzirkulation. In der Kaltluft nimmt nämlich der Druck mit der Höhe schneller ab als in der Warmluft. So entsteht in den Subtropen eine Art "Luftberg", von dem aus sich die Luft nach Norden in Bewegung setzt, ins "Lufttal" hinein. Die Luftmassen setzen sich also von den Subtropen aus nach Norden in Bewegung. Durch die Rotation der Erde wird jedoch aus dieser Bewegung bald ein Westwind, und zwar durch die ablenkende Kraft der Erddrehung, auch Corioliskraft genannt. Deshalb heißt der Bereich zwischen 30 und 60 Grad Breite auch die Westwindzone. Dies ist übrigens auch der Grund dafür, daß sich die Hochund Tiefdruckgebiete meist von Westen nähern und mit Vorzugsrichtung Ost weiterziehen. Jene Westwinddrift wird jedoch gestört durch Turbulenzen in der Atmosphäre, wodurch sich vor allem bei großen Windgeschwindigkeiten - horizontale Wellen ausbilden, die die Grundströmung des reinen Westwindes verändern. Solche Wellen können sehr langlebig und stationär sein. Und diese bestimmen die Großwetterlagen über den Kontinenten und Meeren. Auf der Höhenwetterkarte bemerken wir dann eine mäandrierende, mit ihrer Haupttendenz aber immer noch westöstlich verlaufende Hauptströmung. Im Bereiche dieser Wellen dehnt sich einerseits der Warmluftberg der Subtropen nach Norden hin aus, andererseits schneidet die kalte Polarluft nach Süden hin Täler in die Welle ein. Ein Wellental ist als Tiefdrucktrog bekannt, ein Wellenberg als Hochdruckkeil. So entsteht in unseren Breiten rund um den Globus ein sich ständig änderndes Band von nach Süden ausgreifenden Trögen und nach Norden gerichteten Keilen. Dort, wo die kalte Luft die warme verdrängt, steigt der Luftdruck am Boden. Umgekehrt sinkt der Luftdruck in jenen Gebieten, in denen die Kaltluft von Warmluft ersetzt wird. Die Höhenwinde innerhalb des mäandrierenden Bandes wehen recht stark und bilden oft regelrechte Windschläuche aus. Daher auch der Name Jetstream. Sie sind es nun, welche die Zugrichtung der Hoch-und Tiefdruckgebiete am Boden steuern. Bildet der Jetstream z.B. eine Welle von Island über die Nordsee hinweg, bis er über dem nördlichen Mittelmeer wieder nach Osten abbiegt, so liegen wir hier in Deutschland im Bereich eines Tiefdrucktroges, in dem maritime Polarluft nach Süden strömt. Mögen sich auch am Boden Hochkeile und Tiefausläufer abwechseln, an der Großwetterlage ändert sich im Wesentlichen nichts, solange der Jetstream seine Lage nicht ändert. Nehmen wir jetzt die Funkersprache zur Erläuterung zu Hilfe. Die Großwetterlage ändert sich nicht, wenn sich über uns eine "stehende Welle" ausbildet. Unser Wetter ist deshalb manchmal so hartnäckig, weil die wellende Höhenströmung konstant bleibt und uns ständig dieselbe "Schulter" zeigt. Das Wetter müßte dann mal "QSY" machen, also eine andere Welle anbieten. Verschiedene Nebel Die Luft ist manchmal mit Feuchtigkeit übersättigt, so dass der Wasserdampf darin spontan zu feinen Tröpfchen kondensiert. Die Wasserpartikel sind etwas kleiner als die beim feinsten Nieselregen und damit leicht genug, um in der Luft zu schweben. Die Übersättigung feuchter Luft kann jedoch verschiedene Ursachen haben. Man unterscheidet etwa fünf verschiedene Nebelarten. Da gibt es zunächst den "Strahlungsnebel". Er entsteht dadurch, dass der Boden stark abkühlt, weil er seine Wärme ausstrahlt. Die aufliegenden Luftschichten geben nun ihre Wärme an den Boden ab und kühlen dabei bis zum Taupunkt ab. Jener Nebel entsteht nur bei sehr schwachem Wind bei klarem Himmel in der Nacht. Hauptentstehungszeiten sind Herbst und Frühjahr. Als eine weitere Nebelart gilt der "Advektionsnebel". Er wird dadurch hervor gerufen, dass sich eine Luftmasse durch das Überstreichen eines kühlen Untergrundes stark abkühlt. Er tritt vor allem im Winter auf, wenn warme und feuchte Luft ihre Wärmeenergie durch Turbulenz und Strahlung auf den kälteren Boden überträgt. Dazu gehört aber auch der "Böschungsnebel", der häufig an Berghängen entsteht, wenn warme Luftströmungen der Geländeform folgen und schließlich eine Höhe erreichen, wo sie wegen kalter Oberflächen oder kalter Umgebungsluft kondensieren müssen. Dies geschieht z.B. in den Ebenen des Mittleren Westens der USA, wo feuchter Wind vom Golf von Mexiko am Fuß der Rocky Mountains aufsteigt, und in den Küstengebieten, wo feuchte Meeresluft an Berghängen nach oben gedrückt wird. Eine weitere Art von Nebel ist der "Mischungsnebel". Feuchte, wärmere Luft strömt in kühle Luft hinein und mischt sich mit ihr. Jene Nebelart kann zu allen Jahreszeiten auftreten, vornehmlich in Küstennähe, wenn die Regentropfen einer Warmfront in eine kältere Luft hinein verdunsten. Ein weiteres Nebelphänomen ist der See- oder Flussnebel. Er bildet sich über Wasserflächen, die wärmer als die umgebende Luft sind. Die 5. Art von Nebel in dieser Reihe nennt man Hochnebel. Er bildet sich bei Inversionslagen und besitzt meist eine deutlich sichtbare Untergrenze. Jene liegt oft nur wenige 100 Meter über dem Erdboden. Strahlungs- und Hochnebel kommen bei uns am Niederrhein am häufigsten vor. In sehr kalter Luft kondensiert Wasserdampf oft direkt zu Eiskristallen, also zu Eisnebel. Wenn auch die Nebel von London und San Francisco eine gewisse Berühmtheit erlangt haben, so tritt Nebel doch an anderen Orten noch häufiger auf. Die nebligste Stelle der Erde ist wahrscheinlich Cape Race an der Südostecke Neufundlands. Dort ist der Blick auf den Atlantik an durchschnittlich 158 Tagen im Jahr verhüllt. Der Nebel hat viele Maler, Dichter und Komponisten zu künstlerischen Schaffensprozessen angeregt. So trägt z.B. der 2. Satz in Peter Tschaikowskys 1. Sinfonie den Titel "Land der Öde, Land des Nebels." Es lohnt sich bestimmt, diese Tonmalerei einmal zu hören. Warum regnet es nicht aus jeder Wolke? Sie kennen das schon längst: Regenschwere Wolken bedecken den Himmel, aber es fällt kein Tropfen Wasser heraus. Wann regnet es eigentlich aus einer Wolke? Zunächst einmal müssen wir uns klar machen, dass der Wasserdampf unsichtbar ist. Die Wolke besteht somit nicht aus Wasserdampf, sondern aus Schwaden, einer Ansammlung von unzählbar vielen kleinen Wassertröpfchen. Nur das kann man sehen. Der Schwaden besteht also aus Wasser. Solange die kleinen Wassertröpfchen nicht wachsen, schweben sie nur in der Luft. Warum sollte es dann regnen? Ganz wichtig ist es zu wissen, dass warmer Schwaden viel mehr Wasser enthält als kalter Schwaden. Schwaden von 25 Grad zum Beispiel enthält etwa 23 Gramm Wasser je Kubikmeter, Schwaden von 5 Grad hingegen nur 7 Gramm. Das Geheimnis des Regnens besteht darin, Bedingungen zu schaffen, dass sich der warme Schwaden abkühlen kann. Dann muss das überschüssige Wasser raus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Sie kennen das Phänomen von wasser- triefenden Wänden, Spiegeln oder Fenstern, wenn sich warmer Schwaden an kalten Flächen niederschlägt, zum Beispiel beim Warmduschen. In der Atmosphäre gibt es solche Flächen natürlich nicht, dafür nehmen jedoch die Temperaturen mit zunehmender Höhe drastisch ab, bis zu einem Grad je 100 Meter. Eine Wolke muss mit ihrem warmen Schwaden also aufsteigen, damit Wasser herauskommt. Regen ist also Wasserüberschuss von warmem Schwaden, der in kältere Regionen aufsteigt. Solange Wolken nur horizontal dahindümpeln, passiert nichts und Sie haben Ihren Regenschirm umsonst mitgeschleppt. Goldener Oktober In jedem Jahr dürfen wir im Herbst zwei Schönwetterperioden von mindestens drei Tagen erwarten. Das sind einmal der Altweibersommer Ende September und dann der sog. Goldene Oktober zur Monatsmitte. Ansonsten gestaltet sich das Wetter statistisch wechselhaft, es wird allmählich kälter, es regnet recht oft und die Winde melden sich zurück. Jene Witterung über Deutschland ist wie ein Puzzleteil eingelagert in das globale Wettergeschehen auf der nördlichen Erdhalbkugel zwischen dem Polarmeer und den Subtropen. Infolge der abnehmenden Sonneneinstrahlung verschärfen sich die Temperaturgegensätze zwischen der Grenzzone des polaren Hochdruckgebietes und der wärmeren Luftmassen der gemäßigten Breiten. Im Bereich jener sog. Frontalzone strömen kalte polare Ostwinde und warme atlantische Westwinde gegeneinander und erzeugen Tiefdruckgebiete wie an einer Perlenschnur. Diese können uns recht nahe kommen, wenn sich in der Höhenströmung sog. Tröge ausbilden, die weit nach Süden ausgreifen. Die alternden tropischen Wirbelstürme aus den USA können das Wettergeschehen bei uns zusätzlich in dieser "negativen" Entwicklung beschleunigen, da sie mit ihrem Drehimpuls die zyklonale Grundstimmung (entgegen dem Uhrzeiger) über dem Atlantik unterstützen. Sie rennen so zu sagen "offene Türen" ein. Wie kommt es aber zu den erwähnten Schönwetterlagen? Das Azorenhoch hat meist noch im Herbst eine nach Norden ausgreifende Lage. In einer Zeit, in der die Temperaturgegensätze zwischen Land und Meer sich angleichen, schiebt es Ende September ziemlich regelmäßig einen Keil nach Mitteleuropa. Daraus entwickelt sich dann der "Altweibersommer". Ein zweiter Anlauf des Azorenhochs, jedoch meist schwächer als der erste, findet dann zur Oktobermitte statt. Wiederum schiebt sich ein Keil vom Atlantik nach Westeuropa vor. Trifft er dann auf ein Kontinentalhoch über Osteuropa, ist der "Goldene Oktober" perfekt, vorausgesetzt, dass sich die eben erwähnte Frontalzone an Aktivität zurückhält. Doch im Gegensatz zum Altweibersommer kann sich das Wetter in den Niederungen schon recht herbstlich gestalten. Nebellagen sind dort wesentlich häufiger anzutreffen als im Bergland. Dies ist die Zeit der Inversionen und der markanten UKW-Überreichweiten, eine Zeit, in der die Kontinente "ausatmen", da der Luftdruck über ihnen höher ist als über den Meeren. Jeder Mensch kann ja auch nur dann ausatmen, wenn die Luft in seinen Lungen mengenmäßig groß genug ist und die Atmungsmuskeln aktiv werden, damit der Überdruck nach außen gelangen kann. In diesem Zusammenhang ist der 14. Oktober ein Lostag. Es ist der Tag des heiligen Burkhard. Wenn an diesem Tag die Sonne scheint, sollen die Öchslegrade des Weines noch nachweislich ansteigen. So heißt es: "Gibt es zu St. Burkhard Sonnenschein, schüttet er Zucker in den Wein." Hoffen wir darauf, dass es so kommt, nicht nur im Sinne der Winzer! Wir alle sind mit gutem Wetter in der vergangenen Zeit recht verwöhnt worden. Doch Gott ließ die Sonne über Weinund Biertrinkern gleichermaßen scheinen. Dies ist natürlich in diesem Sinne kein Werturteil wie das etwa zwischen gut und böse. Die Verdunstungsrate Wir reden im Allgemeinen nur immer von ausbleibendem Regen oder von zu wenig oder zu viel Niederschlag. Es gibt jedoch einen Begriff, der bei unseren Überlegungen sehr vernachlässigt wird. Das ist die "Verdunstungsrate". In einem Sommerhalbjahr können z.B. von einer Grasoberfläche 250 bis 500 Liter Wasser je m² verdunsten, wenn es zwischendurch immer mal wieder genug geregnet hat. Die Höhe des Wasserentzuges durch Verdunstung hängt von der Lufttemperatur, von der Luftfeuchtigkeit, von der Sonnenscheindauer und in besonders großem Maße vom Wind ab. Natürlich spielt auch die Bodenbeschaffenheit eine wichtige Rolle dabei. Unwetterartige Regenfälle von 25 Liter pro m² und mehr in kurzer Zeit tragen hingegen höchstens fruchtbaren Boden ab und schädigen die Nutzpflanzen. Sie können den durch große Verdunstungsraten auftretenden Wassermangel keinesfalls ausgleichen. Es geht also mehr Wasser durch Verdunstung verloren als durch Niederschlag hinzukommt. Es gibt nur eine Möglichkeit, ein Niederschlagsdefizit in kürzerer Zeit wieder auszugleichen. Das ist ein lang anhaltender und somit ergiebiger "Landregen", so wie er sich an breiten Warmfronten einstellt. Dieser tritt aber gerade in den Sommermonaten einfach zu selten auf. Unsere derzeitige Wetterlage hat sich zwar etwas auf Unbeständigkeit umgestellt, aber die Regenmengen sind noch immer zu unterschiedlich verteilt, regional zu gering und treten zu sporadisch auf, als dass damit örtliche Trockenheitsprobleme gleich beseitigt werden könnten. Außerdem bleibt es noch immer relativ warm und windig dabei, so dass die Verdunstungsrate recht hoch ist. Mythos "Siebenschläfer" Sieben Jünglinge - frisch "gebackene" Christen - flüchteten vor ihren Verfolgern im Jahre 251 in eine Höhle bei Ephesos und schliefen dort ein. Dort erwachten sie erst wieder am 27. Juni 446. Was diese "sagenhafte" Erzählung über eine Christenverfolgung mit dem Wetter zwischen dem 27. Juni und dem 7. Juli (und auch noch mit der wochenlangen Witterung danach) zu tun hat, ist bis heute unklar. Es gibt zum Glück aber eine meteorologische Deutung für die Siebenschläferregel. Wir haben den "Aberglauben" also gar nicht (mehr) nötig. Jene Interpretation bezieht sich auf die sog. "Frontalzone". Was ist damit gemeint? In der um unseren Globus im Großen und Ganzen ununterbrochen wehenden Westwinddrift gibt es ein relativ schmales Band, in der warme Subtropikluft und kalte Polarluft ziemlich nahe aneinander stoßen. Im Bereich jener Zone - das ist die besagte mäandrierende "Frontalzone" - entstehen die nach Süden gerichteten Tiefdrucktröge und zum Ausgleich die nach Norden sich ausbeulenden Hochdruckkeile. Für unser Wetter in Mitteleuropa von großer Bedeutung sind das daraus resultierende Azorenhoch und als Gegenstück dazu das Islandtief. Zwischen diesen beiden Gebilden verläuft im Wesentlichen die Frontalzone, über welcher der sog. "Jetstream" weht, ein Starkwindband in der Höhe, welches die Zugbahn unserer Tiefund Hochdruckgebiete bestimmt. Äußerst wichtig für die Meteorologen ist es zu wissen, wie weit jene Frontalzone nach Süden reicht. Je südlicher sie anzutreffen ist, desto unbeständiger ist das Wetter, und je weiter sie im Norden liegt, umso länger halten Schönwetterperioden. Zurzeit liegt diese aktuell recht weit südlich, fast schon über uns - vom Atlantik aus Westen kommend - und biegt erst über Osteuropa nach Norden ab. Daher rührt das von manchen Zeitgenossen als abartig bezeichnete Sommerwetter der vergangenen Woche. Es ist nun so, dass die Lage der Frontalzone Ende Juni / Anfang Juli - und das ist ja die Zeit um den Siebenschläfertag - oftmals für eine längere Zeit ortsfest bleibt. Das kommt unter anderem daher, dass unsere Sonne nun ihren Höchststand am Wendekreis für etwa sieben Wochen unverändert beibehält. In den Jahren mit gutem Sommerwetter in Deutschland ist bei einer nördlicheren Lage der Frontalzone der Azorenhochkeil besonders stark ausgeprägt, so kräftig, dass daraus oftmals eine eigene Hochdruckzelle wird, die über Deutschland hinweg nach Osten wandert und sich mit dem osteuropäischen Kontinentalhoch verbindet. Immer dann können wir vorherrschend heiße und sonnige Sommer erleben. In den meisten Jahren wie auch gerade jetzt - liegt die Frontalzone aber zu weit südlich. Immer dann fällt es den atlantischen Tiefdruckgebieten besonders leicht, ihren Einfluss nach Süden hin bis zu den Alpen auszudehnen. Dann entsteht die uns allen bekannte sehr wechselhafte und kühle sommerliche Witterung, das "verflixte Sommerwetter", wie Professor Haber es einmal ausdrückte, das man manchmal als "europäischen Sommermonsun" bezeichnet, obwohl das so nicht stimmt, da sich Wasser- und Landtemperaturen um jene Zeit bei uns ziemlich angeglichen haben. Es gibt keinen Grund, uns über ein durchweg "normales" Sommerwetter zu beklagen, denn wir leben in Europa dort, wo lang anhaltende heiße und oftmals trockene Sommer einfach nicht an der Tagesordnung sind, wie z.B. im Raume der Subtropen. Die nach Norden gewanderte Subtropenzone beschert den Mittelmeerländern wie Spanien, Italien und Griechenland ihre meist sehr schönen Sommer. Wenn Sie also wirklich Sonnenferien haben wollen, dann kann ich Ihnen jetzt schon für das nächste Jahr Kreta, Rhodos, Sizilien, die Türkei oder Tunesien als recht zuverlässig empfehlen. Die beständige Hochdruckzone der Subtropen liegt nämlich dann mit einiger Sicherheit dort und eben nicht bei uns. Regionale Unwetter Es ist die Zeit von Mai bis Juli, in der Gewitter bei uns in Mitteleuropa am häufigsten auftreten. Die hoch reichenden Gewitterwolken, sog. "Cumulonimben", verdanken ihre Entstehung dem Aufsteigen von feuchter Warmluft bis in große Höhen. Dieser Vorgang ist unter dem Namen "Konvektion" bekannt. Diese Konvektion funktioniert natürlich im Sommer um die Zeit des Sonnenhöchststandes am besten. Dann brodelt die Luft oftmals wie die Suppe über einer heißen Herdplatte. Nun können jedoch Intensität und horizontale Ausdehnung von Gewittern recht unterschiedlich sein. Ein kleines Gewitter hat eine Ausdehnung von ca. 10 km mal 10 km, also 100 qkm. Das ist eine sog. "single cell", eine einzelne Zelle. Ein großes Gewitter, ein sog. "supercell storm", bringt es schon auf ca. 2500 qkm, also eine Fläche von 50 km mal 50 km. Die kleinen Gewitter haben etwa eine Lebensdauer von 1 Stunde. Sie toben sich nur örtlich aus, da in der Höhe wenig Wind ist, der sie weiter führt und dynamisiert. Anders ist das bei den großen Gewitterzellen. Sie sind sehr dynamisch und können sich lange halten, z.B. vom Nachmittag bis in die Nacht. Diese "supercell-storms" bilden sich oft "klumpenweise" in einem räumlich ziemlich eng begrenzten Gebiet, wobei sich im Umland obwohl der Wetterdienst auch für diese Region Gewitter vorhergesagt hat - überhaupt nichts tut (das ist oft glücklicherweise bei uns am Niederrhein der Fall, am Freitag war´s nicht so!). Die gewittrigen "Superzellen" - und das sind die Unwetterschwerpunkte ! - entstehen bevorzugt an der warmen Ostflanke von trichterförmigen Höhentrögen (Tief-Vorderseite), weil nämlich dort die Luft hoch reichend angehoben wird und weil der Wind mit zunehmender Höhe sehr schnell stärker wird. Er dreht zudem gleichzeitig von Südost über Süd auf Südwest. Jene starke Windscherung begünstigt dramatisch die Entstehung von schweren Gewitterwolken. Die Superzellen backen dann manchmal zu einem sog. "cloud cluster" zusammen. Der heißt in der Fachsprache "MCC" (Mesoskaligner konvektiver Wolkenkomplex). Davon kann es bisweilen gleich zwei oder drei geben. Einer davon hat eine durchschnittliche Größe von 300 km mal 300 km, also 90 000 qkm. So ein Gebilde bringt meistens Unwetter mit Platzregen, Hagelschlag und Sturm. Die Lebensdauer beträgt durchweg einen halben Tag. Welches Gebiet in Deutschland davon betroffen wird, hängt also von den erwähnten Faktoren ab. Einmal hat die Zugrichtung des Gewittertiefs großen Einfluss auf die Regionen, über denen die Unwetter niedergehen. Aber auch bevorzugte Entstehungsgebiete - das sind die Aufheizflächen am Boden - spielen eine Rolle, "Gewitterherde" genannt. Aufheizungszonen sind z.B. Hochflächen von Gebirgsmassiven oder Flussniederungen wie der Oberrheingraben oder die Kölner Bucht. Wenn also der Wetterbericht Unwetterwarnungen heraus gibt, dann nehmen Sie die Sache bitte ernst. Wenn es auch in Ihrem Gebiet wettermäßig friedlich ablaufen sollte, vielleicht nur mit ein paar Tropfen Regen, so kann es dennoch auf Grund der geschilderten Phänomene ein paar Kilometer weiter kräftig schütten, blitzen, hageln und stürmen. Für einen bestimmten Ort lassen sich jene Unwetter vorläufig weiterhin nicht voraussagen. Rückblick Frühling 2009 Nach kaltem März frühsommerlich Für die Meteorologen ging am 1. Juni der Frühling zu Ende. Den groben Witterungsverlauf geprägt haben in diesem Frühjahr ein nasskalter, teils spätwinterlicher März, dann der sehr rasche Übergang zu dem außergewöhnlich sonnigen und warmen April und schließlich ein wechselhafter Mai. Entsprechend kam es Anfang April zu einem markanten Wachstumsschub in der Natur, so wie man ihn in Mitteleuropa nur in einigen kontinental geprägten Jahren erlebt. Der April war außerdem im Nordosten Deutschlands sehr trocken, der Mai war dann besonders im Süden infolge zahlreicher Gewitterschauer nass. Der Frühling 2009 zeigte sich mit einer durchschnittlichen Temperatur von knapp 10 Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel um gut zwei Grad wärmer und gehörte damit zu den wärmsten Frühjahren seit dem Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. Diese bedeutungsvolle, positive Temperaturabweichung gegenüber dem Klimamittel lässt sich vor allem auf den ungewöhnlich warmen April zurückführen, der den so genannten "Aprilsommer" des Jahres 2007 teilweise sogar übertraf. Zu den kältesten Tagen zählte ausgerechnet der kalendarische Frühlingsanfang, als es überall Nachtfrost gab und die Temperatur in Oberstdorf im Allgäu sogar bis minus 14,1 Grad sank. Außer Nachtfrösten gab es im März überdurchschnittlich viele Tage mit Schneefall. So wurde es selbst bis in die Täler der Mittelgebirge teilweise weiß, während die Schneedecke auf der Zugspitze die stattliche "Fünf-Meter-Marke" übertraf. Die ersten Tropentage (also mindestens 30 Grad warm) gab es am 25. Mai. Die Niederschlagsverteilung fiel in diesem Frühjahr in Abhängigkeit von Zeit und geographischer Lage sehr unterschiedlich aus. Markant war die Trockenheit im Nordosten im April, als in den östlichen Bundesländern die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe ausgerufen wurde. Deutlich mehr geregnet hat es dann wieder im Mai, so dass die Trockenheit im Nordosten Deutschlands endete. Die Niederschlagsschwerpunkte lagen aber weitgehend im Süden. In der Westhälfte Deutschlands war dagegen zumeist der März der nasseste Frühlingsmonat. Davon bekamen wir an Rhein und Ruhr allerdings nur wenig ab. Das allgemeine Sonnenstundendefizit im März hat vor allem der sehr sonnige April kompensieren können. Besonders im Norden war auch der Mai sehr sonnig, so dass die Sonnenstundenanzahl an der Nordspitze Rügens sogar über 660 Stunden stieg. In den westlichen und südwestlichen Mittelgebirgen wurden meist etwas über 400 Sonnenstunden registriert, was dem Niveau der klimatologischen Durchschnittswerte entspricht. "Wetterfrösche" Da man mich bisweilen als "Wetterfrosch" des Distriktes bezeichnet, bietet sich die Frage an: Können Frösche wirklich das Wetter vorhersagen? Man sagt ja von Fröschen, die in einem Einmachglas mit Leiter gehalten werden, folgendes: Wenn die kräftig quaken, soll es Regen geben, und wenn sie die Leiter hochsteigen, wird das Wetter schön. Diese Geschichte hat allerhöchstens nur einen wahren Kern, was das Klettern des Frosches angeht. Laubfrösche, die im gewässernahen Gebüsch leben, finden bei feuchter Witterung genügend Nahrung am Boden. Wenn es trockener ist, krabbeln die Insekten höher auf die Blätter und Gräser hinauf, und auch der Frosch muss dann höher hinaus, um sich seine Nahrung zu sichern. Aber so ist das Klettern lediglich ein Zeichen dafür, wie das Wetter ist und nicht, wie es einmal wird. Für einen Frosch in einem Einmachglas ergibt dies wohl kaum einen Sinn. Wenn er die Leiter hinauf klettert, dann wahrscheinlich vor allem in der Hoffnung, seinem nicht artgerechten Gefängnis zu entkommen. Ich kenne keinen Wissenschaftler, der einen Zusammenhang zwischen Froschverhalten und der zukünftigen Wetterentwicklung festgestellt hat. Nicht nur die Abergläubischen unter Ihnen, sondern auch alle anderen dürfen mich aber weiterhin "Wetterfrosch" nennen. Dies ist nach über dreißig Jahren Funkwetterbericht inzwischen sowieso schon ein "Gewohnheitsrecht" geworden. Ich gehe mal davon aus, dass niemand von Ihnen vermutet, ich würde mit einem Lodenmantel bekleidet in einem großen Einmachglas neben einer Leiter mein Dasein fristen. Denn auch "die Würde" eines Wetterfroschs "ist unantastbar". Pfingstwetter - sehr beweglich Das hängt mit Ostern zusammen, denn Pfingsten ist stets sieben Wochen (50 Tage) später. Der Ostertermin wird vom Mond bestimmt. Ostern fällt stets auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, also dem Vollmond nach dem (von der Kirche festgesetzten) 21. März Null Uhr. Deshalb kann der Ostertermin zwischen dem 22. März und dem 24. April liegen. Somit kann Pfingsten in die Zeit zwischen dem 24. April und dem 12. Juni fallen. Der durchschnittliche Ostertermin ist der 9. April. Das entspräche dem durchschnittlichen Pfingsttermin, dem 28. Mai. Da Pfingsten somit in den Zeitraum zwischen dem 24. April und dem 12. Juni fallen kann, ist unschwer einzusehen, dass es zu Pfingsten kein typisches Wetter gibt, welches sich auffallend oft jährlich wiederholt. In jenen Zeitraum fallen nämlich die Eisheiligen vom 11. bis 13. Mai. Dafür verantwortlich sind die "Kandidaten" Mamertus, Pankratius und Servatius. Die "Eisheiligen" sind eine volkstümliche Bezeichnung für bestimmte Tage im Mai, in denen Kaltlufteinbrüche in manchen Gegenden Frostschäden verursachen, da sie mit einer frostempfindlichen Vegetationsperiode zusammenfallen. Sie entstehen bei Nordlagen, die im Mai ihre größte Häufigkeit haben und Polarluft nach Mitteleuropa führen. Bei klarem Himmel in den Nächten kommt es dann zu einer markanten Wärmeausstrahlung. Mitte Juni, somit dicht hinter dem Zeitraum für Pfingsten, tritt dann noch die so genannte "Schafskälte" auf. Hierbei handelt es sich um einen Kälteeinbruch von Nordwesten, der in den Gipfellagen der Mittelgebirge sogar zu einer dünnen Schneedecke führen kann. Jenes Ereignis ist natürlich für die gerade frisch geschorenen Schafe recht unangenehm. Sie fühlen sich dann wohl so ähnlich, als wenn wir in einem Kühlhaus unseren Pullover ausziehen müssten. Die erwähnten Kälterückfälle, mit denen wir bisweilen auch gerade zu Pfingsten in jedem Jahr rechnen müssen, haben ihre Ursache in Vorstößen kalter Meeresluft, die durch die bereits beträchtliche Erwärmung des Festlandes monsunartig "angesaugt" wird. Jene Wetterereignisse halten sich jedoch nicht streng an die erwähnten Lostage. Manchmal fallen sie sogar ganz aus oder treten nur in abgeschwächter Form auf. Nebenbei gesagt, die Eisheiligen beginnen in Süddeutschland einen Tag später als hier bei uns, da die kalte Luft bis dorthin einen Tag länger unterwegs ist. Sie beginnen somit erst am 12. Mai mit Pankratius. Dann folgt einen Tag später Servatius. Am 15. Mai gibt es dann noch die kalte Sophie. Das Wetter zu Pfingsten wird somit in jedem Jahr anders sein. Alles ist möglich, was Niederschläge, Wind und Temperaturen angeht. Das Wetter kann sich sommerlich, frühlingshaft, aber auch winterlich gebärden. Luftelektrizität bei schönem und schlechtem Wetter Gewitter gehörten immer schon zu den eindrucksvollsten Erscheinungen in unserer Atmosphäre. Benjamin Franklin wies 1752 elektrische Ladungen in den Gewitterwolken nach und im selben Jahr erkannte Lemonnier, dass auch in Schönwettergebieten ein elektrisches Feld in der Erdatmosphäre vorhanden ist. Zwischen der Erdoberfläche und den höheren Atmosphärenschichten bis zur Untergrenze des Ionosphäre (ca. 60 km Höhe) ist ein dauerndes elektrisches Feld vorhanden, dessen Feldlinien senkrecht zur Erdoberfläche stehen, während die Flächen gleicher Spannung (Potentialflächen) horizontal verlaufen. Der Spannungsunterschied je Höhenmeter, die sog. "Potentialdifferenz", nimmt mit der Höhe stark ab. Sie beträgt in Schönwettergebieten in Bodennähe im Durchschnitt 130 Volt/m, während sie in Schlechtwettergebieten (Gewitter) sehr groß werden kann, bis zu 450 000 Volt je Meter. Luft ist zwar ein guter Isolator. Mit empfindlichen Messinstrumenten kann jedoch nachgewiesen werden, dass zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche dauernd ein elektrischer Strom fließt. Dieser Strom wird durch leitfähige wandernde Luft-Ionen gebildet. Sie entstehen durch Herauslösung oder Anlagerung von Elektronen aus bzw. an elektrisch neutralen Atomen oder Molekülen. Diese Ionisierung wird von dem Erdboden aus durch radioaktive Strahlungen von Zerfallsprodukten des Radiums und Thoriums, von der Höhe aus durch die Höhenstrahlung hervorgerufen. Die Hochatmosphäre bildet den Pluspol und die Erdoberfläche den Minuspol bei dem ständig zu beobachtenden Stromfluss in unserer Lufthülle. Wenn auch die dabei auftretenden Stromstärken in Schönwetterzonen verschwindend gering sind, würde es in kurzer Zeit zu einem Ausgleich der zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre bestehenden Potentialdifferenzen kommen, wenn nicht in den Schlechtwettergebieten, insbesondere in den Gewittern, ein Strom in umgekehrter Richtung von der Erdoberfläche zur Atmosphäre fließen würde. Diesen Strom liefern die Blitze. Hierdurch wird das elektrische Feld der Erde dauernd aufrechterhalten. Schließlich schätzt man die Zahl der täglichen Gewitter auf unserer Erde auf ca. 44 000. Da die Erdoberfläche in den Schönwettergebieten negativ, in den Schlechtwettergebieten positiv geladen ist, erscheint sie als ganzes neutral. Wie kommt es nun, dass in den Schlechtwettergebieten, vor allem in Schauern und Gewittern, so große elektrische Entladungen auftreten? Es gibt zwar eine Reihe von Gewittertheorien, aber sie sind bis heute noch nicht befriedigend. Eine der bekanntesten ist die Simpsonsche Gewittertheorie. Sie hat die sog. "Wasserfallelektrizität" als Grundlage. Danach trennen sich elektrische Ladungen bei Wassertropfen, die unter der Einwirkung turbulenter Luftströmungen zerreißen. Da hierbei die positiven Ladungen in den größeren, nach unten fallenden und die negativen Ladungen in den kleineren, durch den aufsteigenden Luftstrom nach oben getragenen Tropfen verbleiben, würden sich im oberen Teil der Wolke negative und im unteren Teil positive Ladungen ansammeln können. Nach neueren Erkenntnissen entstehen bei dem Zusammentreffen von unterkühlten Wassertröpfchen mit Eiskristallen und bei der dabei eintretenden Vergraupelung starke elektrische Entladungen auf. Die Verteilungen der elektrischen Ladungen in einer Gewitterwolke sind inzwischen recht genau untersucht worden, wenn auch die Entstehung der Gewitterelektrizität noch immer nicht ausreichend erklärt werden kann. Danach sind negative Ladungen überwiegend im unteren Teil der Wolke bis zur Null-Grad-Grenze und positive Ladungen im oberen Teil der Wolke etwa oberhalb der -15° C - Isotherme konzentriert. Dazwischen ist die Wolke teils positiv, teils negativ geladen. Unterhalb der negativen Schicht an der Wolkenbasis ist meist ein eng begrenztes Gebiet positiver Ladungen an der Erdoberfläche vorhanden. Diesen gleichen die gefürchteten und für uns eigentlich wirklich gefährlichen Erdblitze aus, wenn der Blitz "einschlägt". In den Gewitterzonen gerät der normale luftelektrische Haushalt unserer Atmosphäre somit durcheinander. Die sich auf engstem Raume aufbauenden Gegensätze der Ladungen suchen einen Ausgleich, und dies geschieht nicht immer gleich durch die Blitze. Die Angelegenheit ist viel komplizierter. Während die Luftelektrizität bei schönem Wetter nur kleine Werte besitzt, gerät sie in den Schlechtwettergebieten, vor allem in den Gewittern selbst, haushaltsmäßig völlig durcheinander, wird somit "unnormal". Die sich dort auf engstem Raum aufbauenden Gegensätze der Ladungen suchen einen Ausgleich. Dies geschieht nicht, wie man meinen könnte, sogleich mit einer Blitzentladung, also mit einem "Kurzschluss". Nein, in der Nähe von Spitzen, die sich über das Gelände erheben (Kirchtürme, Mastspitzen, Blitzableiter usw.) werden die Potentialflächen des an sich schon starken elektrischen Feldes zusammen gedrängt, so dass die Luft-Ionen dort eine Beschleunigung erfahren und den sog. "Spitzenstrom" bilden. Diesen können Sie sogar in der Dunkelheit sehen in Form von sprühenden, bläulichen Büscheln oder Glimmentladungen, die man als "St. Elmsfeuer" bezeichnet. Die Blitze sind die imposantesten Ausgleichsformen elektrischer Ladungen. Wir unterscheiden zwischen den Wolkenblitzen und den Erdblitzen. Man spricht von Wolkenblitzen, wenn der Spannungsausgleich zwischen den verschiedenen Ladungszentren der Gewitterwolke erfolgt. Erdblitze entstehen, wenn der Spannungsausgleich zwischen den Ladungszentren der Wolke und der Erdoberfläche stattfindet. Das sind die für uns wirklich gefährlichen. Wenn Sie einen Blitz beobachten, so stellen Sie oftmals ein Flackern fest. Das kommt daher, dass der Blitz meist aus einer Aufeinanderfolge von mehreren Entladungen im gleichen Blitzkanal besteht. Der Blitzkanal bildet sich ruckartig von einem Ladungszentrum mit großen Feldstärken aus. Er wird in seiner Entstehung und in seinem Verlauf durch Ionisierungsprozesse der benachbarten Luft beeinflusst. Er hat einen Durchmesser von 10 - 50 cm. Er ist der Träger der "Vorentladung". Im Blitzkanal folgt nun die Hauptentladung, der weitere Entladungen folgen können - deshalb das Flackern. Dabei beträgt die Dauer einer einzelnen Entladung nur zwischen einer tausendstel und einer hundertstel Sekunde. Die Spannungsunterschiede können einige 100 Millionen Volt erreichen. Die Stromstärken bewegen sich zwischen 20 000 und 220 000 Ampere. Wegen der kurzen Dauer einer Blitzentladung ist die Energiebilanz dennoch verhältnismäßig gering. Blitze sind nicht gleich Blitze. Der "Linienblitz" ist wohl die am häufigsten beobachtete Form des Blitzes. Bei Flächenblitzen handelt es sich um flächenhafte, an vielen Tropfen und Kristallen gleichzeitig auftretende Büschelentladungen. Wenn Linienblitze durch Wolken verdeckt sind, werden durch ihren Widerschein oft Flächenblitze vorgetäuscht. Verhältnismäßig selten treten Kugelblitze auf, deren Natur bis heute noch ziemlich unbekannt ist. Sie bestehen aus leuchtenden Kugeln, welche sich relativ langsam fortbewegen und die seltsamsten Wege einschlagen können. Nach einer Lebensdauer von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten (!!) verschwinden sie entweder geräuschlos oder mit einem explosionsartigen Knall. Und was ist mit dem Donner? In der Blitzbahn wir die Luft äußerst stark erhitzt und explosionsartig auseinandergetrieben. Danach stürzt sie wieder in das entstandene Vakuum zurück. Hinzu kommt, dass bei dieser extremen Funkenentladung das in der Luft vorhandene Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet wird. Das so gebildete "Knallgas", wahrscheinlich in der Gesamtwirkung zu vernachlässigen, explodiert. Die Druckwellen dieser Erscheinungen sind als Donner bis zu einer Entfernung von 20 - 30 km hörbar. Über das "Donnergrollen" habe ich bisher selten eine plausible Erklärung gefunden. Es soll angeblich dadurch entstehen, dass die Schallwellen an Wolken, Bergwänden und an der Erdoberfläche reflektiert werden. Meiner Meinung nach hat das länger anhaltende Poltern des Donners (Donnergrollen) jedoch folgende Ursache: Der Schall breitet sich ja mit einer Geschwindigkeit von ca. 300 m pro Sekunde aus. Ein Wolkenblitz überstreicht - vom Beobachter aus gesehen - bisweilen einen Raum von mehreren Kilometern von ihm weg. Somit gelangen die Schallwellen, die der Blitz erzeugt, nacheinander aus unterschiedlichen Entfernungen zu ihm. Der Donner beginnt laut, das sind die Schallwellen aus dem Nahbereich. Der Donner wird leiser. Es gelangen die Schallwellen aus immer größer werdenden Entfernungen des Blitzkanals in das Ohr des Beobachters. Da die Blitze zudem oft weit verzweigt sind (Struktur eines Astes), ergeben sich die eigenartigsten Grollgeräusche des Donners. Sie alle aber haben ihre Ursachse vornehmlich in den Laufzeitunterschieden des Schalls in Bezug zum Beobachter. Vom "Wetterleuchten" spricht man, wenn wegen der großen Entfernung des Gewitters die Blitze oder deren Widerschein wohl zu sehen sind (nachts!!), der Donner aber nicht oder kaum hörbar ist. Blitze, wie Sie wissen, können erhebliche Schäden anrichten. Darüber habe ich in anderen Beiträgen berichtet, (www.darc.de/distrikte/l/html/wetter.htm) auch darüber, wie man sich bei einem Gewitter verhalten sollte. Ein Blitzableiter "zieht" im Übrigen den Blitz nicht an. Er sorgt nur dafür, dass im "Ernstfall" die Elektrizität zu Boden geleitet wird, ohne Schaden anzurichten. Er leitet zudem Überproportionalitäten im luftelektrischen Feld sicher zur Erde ab. Deswegen erden wir ja auch unsere Antennen. Grundsätzlich richtet ein Erdblitz, und um den handelt es sich ja jetzt nur, Schäden dadurch an, dass er auf seinem Weg in die Erde einen Widerstand vorfindet. Auch nur im kleinsten Widerstand (Ohmsches Gesetz) erzeugt der Blitz bei Stromstärken von vielen tausend Ampere ernorme Wärmemengen. Dies ist die Ursache dafür, dass durch Blitzschlag Höfe und Häuser abbrennen können. Es gibt die "kalten" und die "heißen" Blitzeinschläge. "Kalt" bedeutet soviel wie: Die Entladung war so kurz, dass deren Hitze nichts entflammen konnte. Die Entzündungstemperatur wurde nicht erreicht. Bei einem "heißen" Blitzeinschlag erfolgten mehrere Entladungen im gleichen Blitzkanal. Somit konnte die Entzündungstemperatur (von Dachlatten, Balken, Schaumstoff etc.) bisweilen sogar explosionsartig erreicht werden. An dieser Stelle möchte ich noch einer Auffassung widersprechen, die besagt, dass der Blitz stets in die höheren Objekte seiner Umgebung einschlägt. Radio Eriwan passt hier: "Im Prinzip ja!" Aber, die Blitzbahn, der sie vorbereitende Blitzkanal, orientiert sich zunächst einmal an der Leitfähigkeit der Luft, die sie (er) auf dem Weg zur Erde vorfindet. So kann es manchmal vorkommen, dass ein Blitz ungeahnte Wege nimmt und nicht in den Kirchturm, sondern in ein tiefer gelegenes Objekt in der Nähe einschlägt. Der Blitz bleibt somit unberechenbar! Und gerade davor haben wir Angst. Jedoch bleibt dies sicher: Ein richtig installierter Blitzableiter schützt das gewählte Objekt. Immer! Am besten: Erdwiderstand gleich Null! Aber das ist selten ganz zu verwirklichen. Vom "Aprilsommer" bis zur "Schafskälte" In etwa fünf Wochen erreicht die Sonne bereits ihre diesjährige höchste Stellung im Tagesbogen, besser bekannt als "kalendarischer Sommeranfang". Unser Muttergestirn steht dann senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Verbunden mit diesem Lauf am Himmel sind ständig weiterer Anstieg der Länge der Tageshelligkeit und damit Zunahme der Wärmeenergie, die wir als Strahlung von der Sonne erwarten können. Unsere Atmosphäre, vor allem das Wasser, besitzt bezüglich ihrer Erwärmung jedoch eine beachtliche Trägheit. So lagern zum Beispiel über dem Subpolargebiet noch immer relativ kühle Luftmassen, vornehmlich über dem kalten Ozean, während sich in den Subtropen die Luft schon beachtlich erwärmen konnte. Somit braucht man sich nicht zu wundern, dass bei so genannten "meridionalen Wetterlagen" in diesen Tagen noch Warmluftvorstöße mit Kälteeinbrüchen abwechseln. Auffallend war ja auch die markante Luftmassengrenze zwischen "kalt" und "warm" quer durch Deutschland in der vergangenen Woche. Konkret finden diese Wetterereignisse unter meteorologischen Begriffen wie "Aprilsommer" und "Eisheilige", bzw. "Schafskälte" ihre Bezeichnungen. Ebenso kommen jene Gesetzmäßigkeiten des Luftmassenaustausches im Mai und Juni in stark sich abwechselnden Wolkenarten zum Ausdruck. Bei Einbruch von Höhenkaltluft sind es die mächtigen Haufenwolken bis hin zum CB (Cumulonimbus), bei Warmluft- Advektion nehmen wir hingegen aufziehende Schichtbewölkung (Stratus) wahr. Eine weitere Bestätigung des derzeitigen Witterungscharakters kann man bei den Nachttemperaturen ausmachen, die zwischen äußerst milden Werten bis 15 Grad und Nachtfrösten hin- und herpendeln können. Erst gegen Ende Juni werden dann die eigentlichen meteorologischen Weichen für unser Sommerwetter gestellt. Die Tage um den Siebenschläfer lassen uns dann grob erahnen, wie unser Sommer werden wird. Wir wissen alle, dass unser mitteleuropäischer Sommer in den meisten Fällen "Monsuncharakter" aufweist, was bedeutet, dass er durchweg feucht und kühl ausfällt, wobei diesen Witterungscharakter meist nur wenige heiße und trockene Tage unterbrechen. So war es jedenfalls früher vor der Klimaänderung. Den Charakter des Sommers dieses Jahres jetzt schon vorherzusagen, traut sich niemand; er wäre ein Scharlatan. Erst nach dem Siebenschläfertag steigt das Eintreffen einer Prognose von 50 auf bis zu 70%. Aber selbst dann nimmt jeder seriöse Meteorologe seinen Mund noch nicht allzu voll, wenn er sich für eine mittel- bis längerfristige Vorhersage des Sommerwetters hinreißen lässt. Auch ich in meiner gewissen nichtamtlichen "Narrenfreiheit" neige eher nicht dazu, mich diesbezüglich aufs "Glatteis" führen zu lassen. Wetter, Witterung, Klima und Singularität Heute möchte ich einmal wichtige Begriffe aus der Wetterkunde erläutern, deren Bedeutungen meist nicht genau genug bekannt sind und die auch manchmal miteinander verwechselt werden. Jeder Wetterablauf besteht ja aus raum-zeitlichen Zusammenhängen. Hier sind es drei Begriffe, die man auseinander halten muss. Der bekannteste ist natürlich der Begriff "Wetter" selbst. Unter "Wetter" versteht man den physikalischen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Der zweite Begriff lautet "Witterung". "Witterung" beschreibt die Summe der Wettererscheinungen an einem Ort oder in einer Region über einen mehrtägigen Zeitraum. Im Unterschied dazu versteht man unter "Klima" den durchschnittlichen Zustand der Witterung an einem bestimmten Ort oder in einer Region über einen vieljährigen Zeitraum, meist 30 Jahre oder mehr. Soweit zu diesen drei wichtigen Grundbegriffen. Es gibt aber noch einen sehr wichtigen vierten, der schon öfters in meinen Berichten gefallen ist: "Singularität". Im Bereich der Westwinddrift, die ja in unserem mittel- und nordeuropäischen Raum den Wetterablauf in der überwiegenden Zeit des Jahres beherrscht, treten zu bestimmten Zeiten im Jahr sehr ähnliche Witterungen mit unterschiedlicher Häufigkeit auf. Solche häufig in bestimmten Wochen im Jahr wiederkehrenden Witterungsabschnitte bezeichnet man als Singularitäten. Jene sind nur statistisch zu begründen und liefern deshalb auch nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, können daher als Prognose für einen bestimmten Fall nicht heran gezogen werden. Es handelt sich um kalendergebundene Witterungen, die oft mit den sog. "Bauernregeln" in einen Topf geworfen werden. Ich will nun einmal eine Aufstellung dieser am häufigsten zitierten Singularitäten in Mitteleuropa vorstellen. In der ersten und zweiten Januarwoche treten häufig Stürme auf. Dabei ist es mild und regnerisch. Die 3. und 4. Januarwoche ist der sog. "Hochwinter" mit strenger Kälte. Hier werden häufig die tiefsten Temperaturen des Jahres gemessen. In der 2. Hälfte des Februars tritt oftmals der "Spätwinter" mit strenger Kälte auf. In der ersten Hälfte des März haben wir oft Kälterückfälle mit Schnee(Märzwinter). Weiterhin kennen Sie alle die Zeit der Eisheiligen vom 11. - 15. Mai, Kaltlufteinbrüche mit Spätfrösten. Anfang Juni haben wir dann die "Schafskälte", einen späten Kälterückfall mit Bodenfrösten. Sehr gut bekannt sind auch die "Hundstage", eine hochsommerliche Witterung vom 23. Juli bis 23. August. Erste Herbststürme treten häufig im letzten Septemberdrittel auf und der "Altweibersommer" verwöhnt uns recht regelmäßig in der Zeit zwischen Ende September und Anfang Oktober. Dann können wir ruhiges, zu Nebel neigendes Hochdruckwetter genießen, ähnlich wie im "Goldenen Oktober". Erste Kälteeinbrüche mit meist nur dünnen Schneedecken, den sog. "Frühwinter", erwarten wir dann Anfang bis etwa Mitte Dezember. Sehr regelmäßig (wer wüsste es nicht) kommt dann das "Weihnachtstauwetter" in der 3. bis 4. Dezemberwoche. Es handelt sich um eine milde Westwetterlage. Wer kennt nicht die schon fast sprichwörtliche "Neujahrskälte", einen Kälteeinbruch mit Schneedecke und z. T. strengem Frost um die Jahreswende? Das waren also die am häufigsten genannten Singularitäten in Mitteleuropa, also kalendergebundene Witterungen. Darauf beziehen sich natürlich manche bekannten Bauernregeln, aber man sollte sie dennoch nicht mit den Singularitäten in einen Topf werfen. Bauerregeln basieren auf der vormals recht exakten Wetterbeobachtungsgabe unserer Vorfahren, die den meisten von uns heute abgeht, da wir einfach zu vielen anderen Ablenkungsmanövern unterliegen. Singularitäten entstehen durch zu bestimmten Jahreszeiten recht regelmäßig mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederkehrende Luftdruckkonstellationen, wodurch bestimmte Wetterlagen zu mehr oder weniger kalendergebundenen Zeiten statistisch häufiger als eben nur zufällig auftreten. Im Zeichen des Klimawandels kann es künftig beträchtliche Abweichungen davon geben. "April, April" ! "Wohl hundertmal schlägt das Wetter um, das ist des Aprils Privilegium". Gegensätzliche Wetterlagen wechseln in bunter Folge ab, Launenhaftigkeit gibt der Witterung dieses Monats das Gepräge. Hochdrucklagen kommen im April am wenigsten vor. Quer durch Mitteleuropa bildet sich häufig eine von Norden nach Süden verlaufende Tiefdruckrinne, auf deren Ostseite Luft aus südlichen Breiten nordwärts strömt, während auf der kalten Westseite grönländische Polarluft zuweilen bis in den Mittelmeerraum vordringt. Der April hat auch, neben dem März, die häufigsten Tage mit Starkwindböen. Andererseits hat er manchmal den sog. "Aprilsommer" zu bieten. Das treibt die Entwicklung der Blüten stark voran und kann zu unangenehmen Folgen für die Obsternte führen, wenn danach ein Kälterückfall erfolgt. So nennt man den April nicht zu Unrecht den "Eulenspiegel" der Monate. Wer kennt es nicht aus der Erinnerung: das so genannte "Aprilwetter" mit einem Mix aus Sonnenschein, Temperatursprüngen, Gewitterschauern mit Starkregengüssen, Graupel und Schnee? Das Aprilwetter über Deutschland scheint sich im Zuge des Klimawandels bereits sichtlich zu verändern. Erinnern Sie sich noch? Vor zwei Jahren hatten wir trockene Wetterverhältnisse mit fast täglichem vollem Sonnenschein. Einmal wurden 30 Grad erreicht. Es was unser eigentlicher "Sommer" 2007. Rückblick April 2009 Mit Ausnahme des äußersten Westens und Südwestens war der Monat der wärmste April seit dem Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Die Durchschnittstemperatur reichte meist von etwa 11 Grad in Küstennähe bis 14 Grad in den Tälern des Binnenlandes. Damit ergaben sich markante positive Abweichungen zum Klimamittel, die verbreitet zwischen vier und fünf Grad lagen. Neben einigen Sommertagen traten jedoch vor allem zum Monatsanfang und um den 24. April auch kalte Nächte mit Bodenfrost auf. Abseits kalendarischer Einordnungen wurde das Kriterium für einen Sommertag, der über die Höchsttemperatur von mindestens 25,0 Grad definiert ist, vor allem an den Ostertagen, im nordostdeutschen Raum dann im letzten Monatsdrittel erfüllt. Anders als im vergleichbar warmen April 2007, als am Niederrhein 30,2 Grad erreicht wurden, gab es in diesem Monat keinen Tropentag mit mindestens 30,0 Grad. Am wärmsten wurde es am 15. April in Bendorf bei Koblenz mit 26,8 Grad, ehe am 27. April auch in der Hauptstadt ein Sommertag registriert wurde. Nach dem schneereichen Februar und dem nasskalten März kam der Frühling mit Macht und sorgte für einen explosionsartigen Wachstumsschub bei der Vegetation. Am sonnigsten verlief der Monat im Nordosten, wo die Sonne vielerorts 300 bis 340 Stunden lang schien und damit auch bei der Sonnenscheindauer Rekorde gebrochen wurden. Ansonsten waren zwischen Rhein, Weser und Werra meist 200 bis 240 Stunden Sonne zu verbuchen. Diese Werte lagen zwar deutlich unter denen von April 2007, aber zumeist 20 bis 50 Prozent über dem langjährigen Mittel. Dieser April ging nicht nur als sehr sonniger sondern insgesamt auch als trockener Frühlingsmonat in die Statistik ein. Am wenigsten geregnet hat es zwischen Elbe und Oder, wo dieser Monat beinahe ähnlich niederschlagsarm war wie der bislang trockenste April im Jahr 2007. Im nordostdeutschen Raum fielen meist nur 1 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter, das sind lediglich 5 bis 10 Prozent des langjährigen Mittels. Aber auch in der West- und Südhälfte konnten einige wenige Regentage das Niederschlagsdefizit vielerorts nicht mehr kompensieren. Erneut also ein April ohne Kälterückfälle so wie es früher die Regel war. In der Presse las ich recht dramatische Ausführungen zum Klimawandel in Deutschland. Darin wird NordrheinWestfalen als "Verlierer des Klimawandels" bezeichnet, vor allem das Ruhrgebiet. Einzelheiten dazu finden Sie zum Beispiel in der Rheinischen Post von Mittwoch, dem 29. April 2009, auf der Seite A3 "Land & Leute". Computermodelle Zum Thema "Klimaerwärmung", die zum Teil von uns Menschen mit verursacht wird, gibt es immer wieder kritische Thesen. Eine davon befasst sich zum Beispiel mit den Computermodellen. Diese besäßen keine oder nur eine unzureichende Aussagekraft. Dieses Argument lässt sich nicht leicht entkräften, denn die Rechenergebnisse vom Anfang dieses Jahrhunderts sind ja heute noch nicht überprüfbar. Die Kritiker führen an, dass die Klimaforschung mit unsicheren Ergebnissen Politik und Gesellschaft veranlasse, Kosten verursachende Maßnahmen durchzuführen, die ihre Ziele verfehlen würden, wenn sich die berechneten Klimamodelle als Fehlprognosen erwiesen. Betrachten wir die Sache aber einmal nüchtern: Natürlich spiegeln die Computermodelle die Zukunft nicht exakt wider, aber es handelt sich dabei auf keinen Fall um willkürlichen Unsinn ohne physikalische Grundlagen. Wir müssen lernen, mit derartigen Unsicherheiten umzugehen, denn jede Vorausschau und damit auch jede Strategie enthält gewisse Unwägbarkeiten. Das gilt ja auch zum Beispiel für die Prognose des Verlaufs der derzeitigen wirtschaftsbedingten Rezession. Die solide Forschung kann eigentlich nur so vorgehen, dass sie die Unsicherheiten so gering wie möglich hält. Das geschieht auch bei den aufgestellten Klimamodellen. Jene Klimamodellierung hat sich zum Beispiel bei der Rückrechnung (Klima- "Nachhersage") des Klimas recht gut bewährt. Daher gibt es eigentlich keinen Grund, die Modellergebnisse allesamt zu verwerfen. Bei den Interpretationen der Ergebnisse sollte man jedoch recht behutsam vorgehen. Ungenauigkeiten nehmen nämlich vor allem bei Rückschlüssen auf regionalere Prognosen zu. Wir können einfach die Modellergebnisse nicht ignorieren und abwarten, was dereinst nach vielen Jahren tatsächlich mit unserer Erde passiert. Das wäre sehr unvernünftig und auch ethisch nicht vertretbar. Außerdem sind die Klimamodellierungen durch immer größere und schnellere Computer mit höheren Rechenleistungen in den letzten Jahren besser geworden. Hinzu kommt, dass niemand mehr bezweifelt, dass wir das Wetter mit unseren Treibhausgasen beeinflussen. Die Messungen belegen dies, nicht etwa Computerprognosen. Klimaveränderungen finden zurzeit ja bereits statt. Es gibt noch einige andere kritische Thesen derjenigen Menschen, die unsere Klimaveränderung beschönigen wollen, zum Beispiel, dass eine wärmere Welt viele Vorteile bringen würde oder dass unsere Sonne alleiniger Verursacher der Klimaerwärmung ist. Man hört auch sehr oft, dass das Kohlendioxyd gar nicht so klimawirksam sein könne, da es anteilig in nur sehr geringen Mengen (etwa nur zu 0,038%) in unserer Atmosphäre vorkommt. Bei wissenschaftlicher Betrachtung sind jene Meinungen aber nicht stichhaltig. Ich weise in diesem Zusammenhang nur einmal darauf hin, dass unsere Atmosphäre zu 99 % aus den Gasen Stickstoff und Sauerstoff besteht, die nicht relevant für den Treibhauseffekt sind. Lediglich in dem verbleibenden 1 % können also solche Gase vorhanden sein, die den Treibhauseffekt bewirken. Den größten Anteil davon bildet der Wasserdampf, der in der Gesamterwärmung unserer Erde durch den Treibhauseffekt von 33 Grad über dem Normalwert von weltweit minus 18 Grad (Durchschnittwert der Erdtemperatur 15 Grad) allein für 21 Grad Temperaturerhöhung verantwortlich ist. Und auf den Wasserdampfgehalt unserer Erde hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss, da dieses Gas ständigen Energieumwandlungen unterliegt, also keine nachhaltigen Wirkungen bezüglich einer Klimaveränderung aufweist. Alle kritischen Thesen bedürfen somit einer ebenso kritischen wissenschaftlich begründeten Nachprüfung. Bei der großen Komplexität von Wetter und Klima können das nur studierte Fachwissenschaftler leisten. Und jene haben die schwere Aufgabe, ihre Ergebnisse dem Normalverbraucher verständlich zu machen. Dazu haben sie meist zu wenig Zeit und müssen ihre Stellungnahmen an Journalisten delegieren, die den Stoff dann meist so präsentieren, dass er überhaupt gelesen wird. So wird oft mit Schlagzeilen und emotionalisierenden Texten um die Leserschaft geworben. In jenem medialen Wettbewerb bleiben oftmals Einwände und auch unumstößliche Wahrheiten auf der Strecke. März 2009 Der vergangene März hat sich bei allen Menschen, die sich nach Frühling sehnen und die leicht frieren, vor allem also bei Frauen, wenig beliebt gemacht. Nur bei zeitweiligem Föhn am Alpenrand und in den Rheinebenen erreichte das Thermometer bisweilen gerade mal 15 Grad C. In den anderen Gebieten kam hauptsächlich der Fön zum Trocknen der nassen Haare vermehrt zum Einsatz. Besonders nass war es im ersten und letzten Monatsdrittel und der Schnee konnte in den Hochlagen im Gegensatz zur arbeitenden Bevölkerung jeden Morgen erneut liegen bleiben. Die küstennahen Gebiete bekamen den größten Anteil an Sonnenstunden mit. Dies passiert dort häufig im Frühjahr, allerdings bei recht tiefen Wassertemperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Insgesamt hielt sich der Lenzmond jedoch fast an das statistische Mittel von 4,9 Grad und schielte mit einem kleinen Defizit von 0,7 Grad in Richtung Ostermond, der versprach, es würde alles besser, was sich ja nun auch in der hinter uns liegenden Woche bewahrheitet hat. Kommen wir zum wärmsten Tag: Es war der 14. März mit 17,9 Grad in Nörvenich. Hingegen meldete Oberstdorf mit minus 14,1 Grad zu Beginn des kalendarischen Frühlings einen Minusrekord. Den meisten Regen des Monats bekamen die Nordseiten der Mittelgebirge mit. Einen Rekord mit 180 Eimern Wasser auf einen Quadratmeter lieferte das Erzgebirge am Fichtelberg. Das ist das Doppelte gegenüber dem Normalfall. Ansonsten lagen die Monatssummen meist zwischen 50 und 80 Millimeter, also Liter pro qm². Phasen der Abtrocknung stellten sich um die Monatsmitte ein. Der Schnee hielt sich hartnäckig in den Hochlagen. Aber auch in den Niederungen sorgte am 7. März das Tief "Berthold" für eine weiße Überraschung. Wie gesagt: Den meisten Sonnenschein gab es an der Nordseeküste. Dort waren es 100 Stunden gegenüber sonst 60 - 80. Ingesamt mussten wir landesweit auf 20 % des zu erwartenden direkten Sonnenlichtes verzichten. Wegen des wechselhaften Wetters hielten sich der Morgengesang der Vögel und der Vegetationsschub der Pflanzen zurück. So verschiebt sich die Blüte der Birke diesmal um bis zu zwei Wochen. Celsius & Co. Die Temperaturwerte geben wir im größten Teil der Welt in Grad Celsius an. Anders Celsius führte 1742 eine Temperaturskala ein, die zwei Fixpunkte besaß: den Siedepunkt des Wassers und den Schmelzpunkt des Eises. Dem Siedepunkt des Wassers gab er zunächst den Wert 0 Grad, dem Schmelzpunkt des Eises den Wert 100 Grad. ( ? ) Einfach so. Sie haben sich gerade nicht verhört. Es war nämlich Carl Linné, ein Mitarbeiter von Celsius und ein begeisterter Kopfständler, der jene Celsiusskala herumdrehte, so wie wir sie heute verwenden. Der Nullpunkt liegt bei der Temperatur des schmelzenden Eises und der Siedepunkt des Wassers bei 100 Grad. Wie Sie wissen beträgt der Fundamentalabstand zwischen den beiden Fixpunkten 100 gleiche Teile. Das sind die Celsiusgrade. Die Differenz zweier benachbarter Teilstriche entspricht genau einem Grad Celsius, egal wie groß Ihr Thermometer ist. Die negativen Celsiusgrade stellen eine Erweiterung dar auf unter dem Gefrierpunkt des Wassers liegende Werte. Danach liegt der absolute Nullpunkt auf der Celsius-Skala bei minus 273,15 Grad C. Für Temperaturdifferenzen gilt 1 Grad C = 1 Kelvin (Kelvin). Die Kelvin-Skala wurde von dem britischen Physiker William Lord Kelvin of Largs vorgeschlagen. Seine Überlegungen beruhten darauf, dass der absolute Nullpunkt dort liegen müsse, wo die mittlere Bewegungsenergie der Moleküle auf Null absinkt. Kelvins Temperatur-Skala beginnt also bei 0 Grad, dem absoluten Nullpunkt und wird als "absolute Temperaturskala" bezeichnet. Der Schmelzpunkt des Eises liegt demnach bei 273,15 Grad. Da können Sie mal sehen, wie "heiß" das Eis eigentlich noch ist. 1714 führte Fahrenheit aus Danzig eine Temperaturskala ein, die zwischen den Fixpunkten, dem Siedepunkt des Wassers bei 212 Grad Fahrenheit (F) und dem Schmelzpunkt des Eises bei 32 Grad F in 180 gleiche Teile unterteilt war. Die 180 hat mit der Kreiseinteilung zu tun. Eigentlich rechnet man hier mit 360 Graden, aber das war Fahrenheit dann doch zu viel. Das Kuriose: Der Nullpunkt der Fahrenheitskala entspricht der tiefsten, damals in Danzig, dem Geburtsort Fahrenheits, im Jahre 1709 gemessenen Temperatur von minus 17,78 Grad C, die später von Fahrenheit mit einer aus Wasser, Eis und Salmiak bestehenden Kältemischung nachgestellt wurde. Als einen weiteren Fixpunkt setzte Fahrenheit die Körpertemperatur des Menschen mit 100 Grad F (37,8° C) an. Einer Temperaturdifferenz von 1 Grad C entspricht eine Temperaturdifferenz von 9/5 Grad Fahrenheit. Die Fahrenheitskala wird heute nur noch in den USA und in Großbritannien verwendet, wo sonst? In England gebe ich auch heute noch meine Körpergröße als 7,08 Inches an, und niemand nimmt daran Anstoß. Es gibt zudem noch eine heute aus der Praxis so gut wie verschwundene Temperaturskala nach Reaumur. (Hat nichts mit Rheuma zu tun). Sie stammt aus dem Jahre 1730. Bei ihr beträgt der Abstand zwischen dem Siedepunkt des Wassers (80 Grad R) und dem Schmelzpunkt des Eises (0 Grad R) 80 gleiche Teile, Reaumur- Grade genannt. Einer Temperaturdifferenz von 1 Grad C entspricht eine Temperaturdifferenz von 4/5 Grad Reaumur. Man könnte dies heute als Seniorenthermometer einführen, da es etwas länger dauert, bis jeweils der nächste Temperaturstrich erreicht wird. Soweit diese Erläuterungen zu den verschiedenen Temperaturskalen. Zum Schluss noch eine sehr leicht zu merkende Umrechnungsmöglichkeit beider Temperaturskalen: Um Celsius in Fahrenheit umzurechnen, addiere man 40, multipliziere mit 1,8 und ziehe dann wieder 40 ab. Um Fahrenheit in Celsius umzurechnen, addiere man 40, dividiere durch 1,8 und ziehe dann wieder 40 ab. Diese sehr leicht zu merkende Umrechnung klappt deshalb, weil 40 Grad unter Null auf beiden Skalen die gleiche Temperatur bedeuten und ein Grad Celsius das 1,8fache eines Grades Fahrenheit beträgt. Probieren Sie´ s aus! Als Fahrenheit sein auf Null geeichtes Thermometer in Eiswasser steckte, stieg es gemäß seiner Einteilung auf 32 Grad. Auch die normale Körpertemperatur des Menschen besitzt auf der Fahrenheitskala einen gut zu merkenden Wert: 100 Grad Fahrenheit = 37,7 Grad Celsius. Wenn Sie also mal aussprechen sollten: "Das bringt mich auf 100", dann hätten Sie nach Fahrenheit eine völlig normale Körpertemperatur. Wie entsteht eigentlich eine Wettervorhersage? Die Grundlage der meteorologischen Arbeit bilden sämtliche verfügbaren Wetterdaten. Hierzu zählen die Daten des sehr dichten Wetterstationsnetzes, Radar- und Blitzinformationen sowie Satellitenaufnahmen. Sie beschreiben den Zustand unserer Atmosphäre wie Temperatur, Windgeschwindigkeit und Feuchtigkeit unterschiedlicher Luftschichten. Die Luftmasse selbst gehorcht den physikalischen Gesetzen der Thermo- und Strömungsdynamik. Damit ist es möglich, die Entwicklung des atmosphärischen Zustands mittels mathematischer Gleichungen zu beschreiben: Kennt man deren Lösung, so kennt man die bevorstehende Wetterentwicklung. Obwohl die strömungsbeschreibenden Gleichungen seit fast 200 Jahren bekannt sind, ist deren Lösung überaus komplex und aufwändig. Für eine mehrfach tägliche globale Vorhersage sind selbst die weltweit schnellsten Rechner viele Stunden beschäftigt. Meteomedia zum Beispiel hat Zugriff auf die Ergebnisse von mehr als zwölf numerischen Wettermodellen, unter anderem die des europäischen (ECMWF), des englischen (UKMO/UKNA/UKNX) des amerikanischen (GFS/ETA/NOGAPS) und des deutschen Wetterdienstes (DWD). Numerische Vorhersagemodelle stoßen aufgrund der Rechnerressourcen bei der Auflösung lokaler Wettererscheinungen aber schnell an ihre Grenzen. Mit Hilfe statistischer MOSVerfahren ist es möglich, beispielsweise die Temperatur in kleinen Muldenlagen, lokale Windsysteme, Niederschlagsereignisse durch Staulagen oder die Sonnenscheindauer in Hanglagen wesentlich präziser vorherzusagen. Meteomedia hat deshalb ein eigenes MOS- System entwickelt, das so genannte PunktVorhersagen erlaubt. Dazu wird der statistische Zusammenhang zwischen dem Output eines "grobmaschigen" Wettervorhersage-Modells und den Daten einer Wetterstation ermittelt. Dies ermöglicht präzise Vorhersagen für die Stationen, deren Beobachtungsdaten vorliegen. Diese Vorhersagen werden mehrmals täglich für ca. 14.000 Stationen weltweit berechnet. Damit ist Meteomedia in der Lage, für jeden Ort eine Vorhersage zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Modelle unterscheiden sich in ihrer Auflösung und in ihren Eigenschaften. Meteorologen werten die relevanten Modelle aus und lassen Ihre langjährige Erfahrung in die Interpretation der zu erwartenden Wetterentwicklung einfließen. Grundlagenforschung und produktorientierte Forschung sind wesentliche Bestandteile der täglichen Arbeit bei Meteomedia. Außerdem werden Produkte speziell nach individuellen Kundenbedürfnissen entwickelt. Im Meteomedia- Forschungsteam arbeiten Mathematiker, Physiker, Informatiker und natürlich Meteorologen. Unwetterwarnungen - Ein unverzichtbarer Service Schwere Stürme, heftige Gewitter und Überschwemmungen: Die wachsende Zahl extremer Wetterereignisse macht eine zuverlässige Früherkennung von Unwettern und rechtzeitige Veröffentlichung von Warnungen unverzichtbar. Unwetter verursachen enorme Schäden. Mit Hilfe rechtzeitiger Warnungen können sie verhindert oder zumindest verringert werden - und nicht zuletzt retten rechtzeitige Warnungen vor Unwettern sogar Menschenleben. Meteomedia hat auf die zunehmende Anzahl von Unwetterereignissen reagiert und betreibt eigene Unwetterzentralen in Deutschland und in der Schweiz. An 365 Tagen im Jahr beobachten die Unwetterexperten rund um die Uhr die (Un-)Wetterlage und warnen punktgenau vor Sturm/Orkan, Starkregen, Gewitter und Hagel, Glatteisregen und Starkschneefall. Moderne Unwetter-Früherkennung Wesentlicher Bestandteil des Unwetterwarnsystems ist das private Meteomedia- Messnetz, das allein in Deutschland und der Schweiz rund 700 Wetterstationen umfasst. In Kombination mit den weltweit führenden Wettermodellen und eigenen Prognoseverfahren bildet es eine einmalige Datengrundlage. Zusätzlich liefern hoch aufgelöste Radar-, Satelliten- und Blitzdaten einen detaillierten Überblick über die aktuelle (Un-)Wetterlage. Für kleinräumige Unwetter wie Gewitter wurde eine radarbasierte Spezialtechnologie entwickelt. Hinter den Warnungen stehen jedoch immer die Unwetterexperten persönlich. Effizientes Warnsystem Die Meteomedia- Unwetterzentralen warnen frühzeitig und präzise vor Sturm/Orkan, Starkregen, Gewitter und Hagel, Glatteisregen und Starkschneefall. Alle Warnungen werden für so genannte Naturräume ausgegeben - dies sind Räume gleicher (Un-)Wetterbedingungen. Die Veröffentlichung der Warnungen erfolgt bis zu 36 Stunden im Voraus. Ein optimal angepasstes, vierstufiges Warnkonzept informiert jeweils über die Art, die Stärke und den Verlauf der Unwetter. Durch das professionelle Warnsystem werden Betroffene individuell, frühzeitig und zuverlässig gewarnt. Quelle: Meteomedia Windrichtung und Schall Wenn eine Kirchenglocke mit Rückenwind läutet, wird ihr Schall manchmal kilometerweit getragen. Wie schafft es eigentlich eine Luftströmung, die sich mit wenigen Metern pro Sekunde bewegt, Schallwellen zu "tragen", deren Geschwindigkeit immerhin etwa 330 Meter pro Sekunde beträgt? Es kann ja wohl nicht daran liegen, dass sich der Schall ein kleines Bisschen schneller als sonst ausbreitet. Das Ganze hat etwas mit "Brechung" zu tun. Denn nicht nur Licht- und Funkwellen, sondern auch Schallwellen können gebrochen werden. Beim bekannten Echo werden sie sogar reflektiert. Normalerweise breitet sich der Schall von seiner Quelle geradlinig und kugelförmig aus. Bei Wind ändert sich aber genau das. Es liegt daran, dass die Windgeschwindigkeit in den unterschiedlichen Luftschichten nicht konstant ist. Meist nimmt sie von Boden aus nach oben hin zu. Das bedeutet, dass der Schall bei Rückenwind in der Höhe einen zusätzlichen Schub bekommt. Dadurch werden die Schallwellen gebrochen und ändern ihre Richtung - ähnlich wie Lichtstrahlen, die in ein anderes Medium mit höherer optischer Dichte eintreten. Der Rückenwind sorgt dafür, dass die Schallwellen in der Höhe, die den Zuhörer sonst nicht erreichen würden, zum Boden hin abgelenkt werden. Sie können auf diese Weise sogar Hindernisse wie Mauern oder Häuser überwinden. Die entfernte Glocke klingt sehr laut. Läutet die Glocke jedoch gegen den Wind, werden ihre Schallwellen vom Boden weg gebrochen und in Richtung Himmel geschickt. Der Schallpegel sinkt, es kann sogar ein Bereich entstehen, in dem gar nichts von dem Läuten zu hören ist, obwohl zwischen Kirchturm und dem Zuhörer kein Hindernis steht. In diesem Sinne "trägt" der Rückenwind den Schall tatsächlich. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass wir manchmal im Sommer den Donner eines weit entfernten Gewitters hören können, obwohl die Entfernung für jene Schallausbreitung viel zu weit ist. In diesem Fall gelangt der Schall ebenfalls durch Brechungen in der Luft aus der Höhe zu uns. Man hört dann jedoch nur ein dumpfes Grollen, da die hohen Frequenzanteile nicht so weit gelangen wie die tiefen. Diesen Effekt kennen Sie von der Stereoanlage Ihres Nachbarn. Hat diese die entsprechende Lautstärke, vernehmen sie durch die Wände vornehmlich nur noch die Bässe von Musik und Sprache. Dies alles dürfen wir nicht mit dem Doppler- Effekt verwechseln. Seine Auswirkungen beziehen sich auf Schallquellen, die sich relativ zu uns bewegen. Wir erinnern uns: Bewegt sich eine Schallquelle von uns weg, werden die Wellenlängen auseinander gezogen. Der Ton wird tiefer. Bewegt sich eine Schallquelle auf uns zu, werden ihre Wellen gestaucht, also kürzer. Der Ton erscheint höher. Schallwellen sind horizontale Dichteunterschiede im Medium Luft. Die Schallgeschwindigkeit wird durch die Luftdichte bestimmt. Schall breitet sich zum Beispiel in dem wesentlich dichteren Wasser viel schneller aus als in Luft. Besonders hoch ist die Schallgeschwindigkeit in Eisen. Wenn ein Indianer früher ein Ohr auf die Schienen legte, konnte er bereits viele Minuten vorher feststellen, ob sich ein Zug näherte. Ohne ein Medium der Übertragung gibt es keinen Schall. So ist es zum Beispiel auf unserem luftleeren Mond totenstill, auch wenn unmittelbar neben Ihnen jemand einen Schuss aus einem Gewehr abfeuert. Tiefdruckgebiete sind immer mit schlechtem Wetter verbunden? Stimmt das? Im Rahmen meiner Beiträge habe ich schon mehrmals erläutert, dass Hochdruckgebiete nicht immer schönes Wetter bedeuten. Vor allem im Winter können sich Inversionslagen mit Nebel und Sprühregen bilden. Bisweilen kommt auch ein unangenehm kalter Wind hinzu. Bescheren uns nun Tiefdruckgebiete stets schlechtes Wetter? Was bedeutet eigentlich "schlecht" in Verbindung mit Wetter? Der Regen, den man bei einer Radtour nicht gerade angenehm findet, gefällt vielleicht dem Bauern. Fragen wir also lieber: Bringen Tiefdruckgebiete immer Niederschläge mit sich? Erinnern wir uns einmal daran, wie das Wettergeschehen beim Durchzug eines Tiefs abläuft: Hohe Schleierwolken kündigen eine Warmfront an. Die nahende warme Luft gleitet zunächst in großer und sehr kalter Höhe großflächig auf die kältere, bereits vorhandene Luft auf, dabei kommt es zur Kondensation, wodurch jene Zirrus- Bewölkung aus Eiskristallen entsteht. Anschließend wachsen die Wolken immer mehr nach unten, werden also vertikal immer mächtiger und dichter, bis sich schließlich Nimbostratus- Bewölkung ausgebildet hat. Jene erzeugt den uns bekannten anhaltenden, gleichmäßigen "Landregen". Mit Durchgang der Warmfront hört der Regen dann auf und die Wolken beginnen aufzulockern. Es wird dann recht freundlich mit zeitweiligem Sonnenschein. Das Barometer ist bis zu diesem Zeitpunkt ständig weiter gefallen, verharrt aber nun eine Zeit lang auf dem zuletzt erreichten Wert. Der Wind hat auf Südwest gedreht. Bis zum Eintreffen der Kaltfront ist das Wetter durchaus schön. Dann aber schiebt sich die kalte Luft wie eine Nase in die warme Luft, es kommt zur Labilisierung und es bilden sich Schauer oder Gewitter. Das Wolkenbild hat sich total verändert: Die typische Wolkenform ist nun der Cumulonimbus mit dem "Gewitteramboss". Diese Wolken treten allerdings nicht großflächig, sondern eher punktuell auf. Der Wind frischt auf und dreht auf West bis Nordwest. In Gewitternähe gibt es starke Böen. Es wird kälter. Der Luftdruck, der direkt vor der Kaltfront noch etwas fiel, steigt nun plötzlich an. Auf dem Barographen sieht man dann deutlich die sog. "Gewitternase". Anschließend folgt das typische Rückseitenwetter. Schauer und sonnige Zwischenphasen wechseln in rascher Folge einander ab. Ist die Atmosphäre dann gut durchmischt, stabilisiert sich das Wetter. Es klart auf und die Sonne scheint dann oft für mehrere Stunden von einem tief blauen Himmel herab. Der Meteorologe spricht dann von einer sog. "postfrontalen Subsidenz", hervorgerufen durch absinkende Luftmassen hinter derKaltfront. Ein ideales Tief bringt also verschiedene Arten von Wetter mit sich. Meist beginnt es aber mit großflächigem ergiebigem Niederschlag, im Winter wie im Sommer. Dies gilt jedoch nur für unsere Breiten, in denen die Luft nicht zu heiß und zu trocken ist. Das Wetter bei Durchzug eines Tiefs kann aber durchaus im sog. Warmsektor, also zwischen Warm- und Kaltfront, einigen Stunde recht schön sein, aber auch, nachdem die Kaltfront durchgezogen ist, in der postfrontalen Subsidenz. Außerdem treffen die Schauer einer Kaltfront nicht jeden gleichermaßen, da es sich um mehr punktuelle Ereignisse sehr unterschiedlicher Intensität handelt. Dennoch lautet die Antwort auf unsere Anfangsfrage in der Gesamtbilanz eines Tiefs: Für Mitteleuropa stimmt es. Rückblick Februar 2009 Kaum Vorfrühling und viel Schnee Der Februar 2009 war im Durchschnitt etwas kälter als im langjährigen Klimamittel bezeugt. Im Vorjahr traten hingegen einmal Höchsttemperaturen von 20 Grad auf. Doch in diesem Jahr wurde die 10-Grad-Marke nur vereinzelt überschritten. Außerdem war der Monat vor allem im Osten und Süden Deutschlands sehr schneereich. In den höheren Lagen der Mittelgebirge wuchs die Schneedecke auf 1 bis 1,5 Meter an. Bei den Niederschlägen gab es kaum Abweichungen zum Klimamittel, die Sonne machte sich dagegen ziemlich rar. Im Süden und Osten des Landes war es generell kälter als im Klimamittel von 1961 bis 1990. Die größten Abweichungen mit 1 bis über 2,5 Grad gab es im äußersten Süden. Positive Abweichungen wurden in Norddeutschland vor allem in Nordseenähe registriert. Am kältesten war der 19. Februar mit minus 24,2 Grad in Oberstdorf. Nur leichte Frühlingsgefühle stellten sich bei 12 Grad plus am 10. Februar in Freiburg ein, bei Föhn am Alpenrand war es Anfang des Monats noch etwas milder. Zum Vergleich: Im Februar 2008 lagen die Temperaturspitzen bei 21 Grad! Die monatlichen Niederschlagsmengen bewegten sich meist zwischen 30 und 60 Liter pro Quadratmeter und damit im Mittel knapp über den langjährigen Werten. Bedeutend mehr Regen und vor allem Schnee fiel an den Nordrändern der Mittelgebirge und am Alpenrand. So wurden auf dem Fichtelberg im Erzgebirge über 150, auf der Zugspitze sogar über 250 Liter pro Quadratmeter gemessen. Dort wuchs die Schneedecke auf knapp 4 Meter an. Durch die starken Schneefälle erhöhte sich die Lawinengefahr in den Alpen. Im Vergleich zum sonnenscheinreichen Januar, wo Rekordwerte gemessen wurden, schien die Sonne im Februar recht selten. Mit rund 50 Stunden wurden etwa 30 Prozent weniger Sonnenstunden registriert als im Klimamittel. Teils nur die Hälfte des langjährigen Mittels gab es in Westdeutschland und im Norden. Die meisten Sonnenstunden konnte man im Süden Baden-Württembergs und in Bayern genießen. Was drückt eigentlich beim Luftdruck? Wir alle wissen, dass die Luft ein Gewicht hat, auch wenn wir sie nicht sehen können. Jenes Gewicht wird hauptsächlich durch Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle bestimmt. Jene Luftmoleküle sausen mit enormer Geschwindigkeit umher. Hier am Boden sind das etwa 1750 km/h. In jedem Kubikzentimeter sind rund 10 hoch 19 Luftmoleküle vorhanden, die mit jener hohen Geschwindigkeit herumrasen. Sie stoßen somit in dieser riesigen Zahl an jedes Hindernis. Und dieses Bombardement von Stößen erzeugt den Druck als Endergebnis. Dieser hängt von der Anzahl der Moleküle ab und von der Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen. Wenn wir Luft in einem festen Behälter erwärmen, steigt der Druck, weil die Moleküle schneller rasen. Kühlen wir die Luft ab, wird der Druck abnehmen. Wird bei gleicher Temperatur der Behälter verkleinert, steigt der Druck, da es nun mehr Moleküle pro Raumeinheit sind. Die Luft um uns herum haben wir der Schwerkraft zu verdanken. Sie zieht alle Dinge, auch die Gase, in Richtung Erdmittelpunkt. Warum werden nicht alle Luftmoleküle am Erdboden wie ein Teppich zusammengepresst? Das verhindert eben der Luftdruck. Die einzelnen Luftmoleküle sausen ja in alle Richtungen, erzeugen dabei den Druck, und dieser wirkt daher auch in alle Richtungen, also auch nach oben und zu den Seiten. Der Luftdruck gleicht damit die Schwerkraft aus. Allerdings hat die Schwerkraft doch noch eine besondere Auswirkung auf die Lufthülle unserer Erde: Hier am Erdboden werden die Luftmoleküle durch das Gewicht der anderen Moleküle darüber zusammengedrückt wie durch den Kolben einer Luftpumpe, und damit ist der Luftdruck über dem Erdboden am größten. In Meereshöhe beträgt der durchschnittliche Luftdruck 1013,25 hPa. Steigen wir auf einen Berg, lassen wir einen beachtlichen Teil der Luft unter uns, wodurch das Gewicht der Luft über uns vermindert wird, weshalb natürlich auch der Luftdruck sinkt. Das geht sogar ziemlich schnell. Auf dem Feldberg im Schwarzwald zum Beispiel, der 1500 Meter hoch ist, beträgt der Luftdruck nur noch rund 850 hPa, und auf der 3000 Meter hohen Zugspitze nur noch 700 hPa. Auf dem 4807 Meter hohen Montblanc wären es sogar nur noch 550 hPa, das heißt, wir hätten dort bereits fast die Hälfte der Luft unter uns gelassen. Damit wird klar, dass die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe nicht linear erfolgt. Die "Halbwertshöhe" des Luftdrucks am Boden liegt bereits bei 5,5 km. Dort beträgt der Luftdruck also nur noch 506,6 hPa, die Hälfte von 1013,25 hPa am Boden. In 11 km Höhe bleibt davon wieder nur die Hälfte übrig, also nur noch 253,3 hPa, etwa ein Viertel des Ausgangswertes am Boden. Vernachlässigt dabei habe ich die Lufttemperatur, die ja einen großen Einfluss auf die Luftdichte und somit den Luftdruck hat. Bereits in ungefähr 31 Kilometer Höhe hat der Luftdruck gegenüber dem am Boden um 99% abgenommen und in 50 Kilometer Höhe sind es 99,9%. Dort kann man bereits von weltraumähnlichen Bedingungen sprechen. Da sich der Luftdruck mit der Höhe streng mathematisch ändert, kann jeder Pilot mit Hilfe des Luftdrucks seine Höhe messen. Doch dies wäre ein Thema für ein neues Kapitel. Das soll´ s für heute gewesen sein. Sie hörten (oder lasen) den Funkwetterbericht von DL5EJ. Schönen Sonntag und eine gute Woche! Vy 73 Klaus Ein Regenbogen im Winter? Die Farben des Regenbogens entstehen, weil die unterschiedlichen Farben, aus denen das Sonnenlicht zusammengesetzt ist, an Wassertröpfchen unterschiedlich stark gebrochen werden - das rote Licht am wenigsten, das violette am stärksten. Der Bogen kommt zustande, wenn sich das Sonnenlicht in den Bogen zweimal bricht und zwischen den beiden Brechungen einmal gespiegelt wird - ein ziemlich kompliziertes optisches Phänomen, aber es ist immer so: Die Sonne steht im Rücken des Betrachters, und der Mittelpunkt des Bogens liegt exakt gegenüber auf der gedachten Himmelskugel, meist unter dem Horizont. Der Radius des Regenbogens beträgt immer 41 Grad. Wie viel von dem Bogen tatsächlich zu sehen ist, hängt vom Sonnenstand ab. Im Gebirge oder vom Flugzeug aus kann man manchmal einen vollständigen Regenbogenkreis sehen. Der Regenbogen hat also keine absolute Position am Himmel, sondern jeder Beobachter sieht seinen eigenen Bogen - und natürlich kann er nicht zu dem Ort laufen, wo der Bogen die Erde trifft. Bei sehr günstigen Bedingungen kann man manchmal zusätzlich zum Hauptregenbogen noch einen Nebenregenbogen sehen. Bei diesem wird das Licht im Inneren der Wassertröpfchen zweimal reflektiert, er liegt außerhalb des Hauptbogens und ist erheblich lichtschwächer. Außerdem ist bei ihm die Reihenfolge der Regenbogenfarben umgekehrt. Wir schließen also daraus: Der Durchmesser des Regenbogens ist immer gleich - wir sehen nur mal mehr oder weniger von ihm. Der Regenbogen hat immer einen Radius von 41 Grad um den so genannten Sonnengegenpunkt - den meist unter dem Horizont liegenden Punkt, welcher der Sonne exakt gegenüber liegt. Das bedeutet aber auch: Sobald die Sonne höher als 41 Grad über dem Horizont steht, können wir nicht einmal mehr ein kleines Stückchen vom Regenbogen sehen. In unseren Breiten steht aber im Sommer die Mittagssonne etwa 62 Grad über dem Horizont, und somit kann es keinen Regenbogen zur Mittagsstunde geben. Man sieht ihn dann nur am Vormittag und am Nachmittag. Im tiefsten Winter hingegen steigt die Sonne niemals höher als 16 Grad, und theoretisch ist ein Regenbogen den ganzen Tag über möglich. Allerdings gehört zu diesem Phänomen ja auch ein wolkenloser Himmel rund um die Sonne und ein kräftiger Regen in der gegenüberliegenden Himmelsrichtung - und diese Voraussetzungen sind in der kalten Jahreszeit sehr selten erfüllt. Dass es mittags keinen Regenbogen gibt, stimmt also nur für den Sommer. Zum Regenbogen gehört ein kräftiger Sonnenschein, und deshalb kann es ihn nachts nicht geben? Es gibt doch noch eine zweite Lichtquelle am Himmel: den Mond. Von diesem gelangt zwar 470 000mal weniger Licht zu uns als von der Sonne, aber das reicht durchaus, um einen Regenbogen zu erzeugen. Caspar David Friedrich hat einen solchen Regenbogen 1810 auf einem Gemälde verewigt. Weil der Mondregenbogen so lichtschwach ist, erscheint er unseren Augen meist nur als ein weißes Band am Himmel. Denn wir können bei schwachem Licht Farben kaum noch unterscheiden - denn auch für uns sind schließlich in der Nacht alle Katzen grau. In seiner vollen Pracht kann man den Mondregenbogen sehen, wenn man ihn mit einer langen Belichtungszeit fotografiert. Dann kann man feststellen: Er ist genauso groß wie der Sonnenregenbogen und er besteht aus denselben Farben. Nachts kann es also tatsächlich Regenbögen geben. Bauernregeln In meinen Funkwetterberichten habe ich schon häufig sog. "Bauernregeln" zitiert. Man kann durchaus sagen, dass diese Sprüche als Teil der Kulturgeschichte unseres Volkes bis auf den heutigen Tag von ihrer Faszination und Aktualität nichts eingebüßt haben. Jene Wetter- und Klimaregeln orientieren sich dabei an den vielfältigen Wetterzeichen wie Wind, Wolken und optischen Erscheinungen, die Vorboten einer bestimmten Wetterentwicklung sind. Mit solchen Regeln lässt sich in vielen Fällen eine recht gute Wetterabschätzung durchführen. Recht gute Wetterprognosen bis zu 6 Tagen mit einer Trefferquote von rund 75% leisten auch heute noch wie in früherer Zeit z.B. Schäfer und manche Landwirte. Das ausgezeichnete Wissen unserer Vorfahren über das Klima ihrer Heimat kommt in den kalendergebundenen Klimaregeln zum Ausdruck. Auch wenn sich das Wetter nicht an ein bestimmtes Kalenderdatum hält, so gibt es doch in den einzelnen Monaten ganz charakteristische Wettererscheinungen, sog. "Singularitäten", wie die "Schafskälte" oder den "Altweibersommer" und das "Weihnachtstauwetter". Ohne jede Möglichkeiten einer quantitativen Messung wurden diese anerkannt und in Form der Klimaregeln von Generation zu Generation weitergegeben. Den jeweiligen "Lostag" darf man jedoch dabei nicht zu eng sehen. Er hatte in erster Linie einen Merkcharakter. Abweichungen von mehreren Tagen liegen in der Natur der Sache, teilweise auch in der gregorianischen Kalenderreform von Papst Gregor XIII. im Jahre 1582, die alle Termine um ca. 12 Tage nach hinten verschoben hat. Was jene "Bauernregeln" z.B. für die kalte Jahreszeit bieten, möchte ich nun erläutern. "Geht Barbara (4. Dezember) im Grünen, kommt das Christkind im Schnee." "Ist es an Weihnachten kalt, ist kurz der Winter, das Frühjahr kommt bald." "Ist es auf Weihnachten gelind, sich noch viel Kälte einfindet." "Dezember veränderlich und lind, der ganze Winter wird ein Kind." Diese Bauernregeln besagen eigentlich nur: fällt der Dezember zu warm aus, so ist mit relativ großer Wahrscheinlichkeit (67%) auch ein zu warmes Frühjahr zu erwarten. Umgekehrt folgt zu etwa 60% ein zu kalter Frühling, wenn der Dezember zu kalt war. Ziemlich sicher sind folgende Klimaregeln: "Wenn der Tag beginnt zu langen, kommt der Winter erst gegangen." "Werden die Tage länger, wird der Winter strenger." "Januarsonne hat weder Kraft noch Wonne." Nach der Wintersonnenwende am 22. Dezember werden die Nächte wieder kürzer und die Tage länger, doch danach beginnt erst der Hochwinter mit seinen niedrigen Temperaturen. Was nicht jeder weiß: Unsere Sonne erreicht hier am Niederrhein am 8. Dezember ihren tiefsten Stand, also nicht erst am 22. Allerdings steht sie dann bis Ende Dezember weiterhin so tief, jedoch wird es bis zum 22. Dezember an jedem Morgen später hell. Dies ist ein Phänomen der sog. "Zeitgleichung", über die ich hier an dieser Stelle schon zweimal ausführlich berichtet habe. Aktuell für Mitte Februar habe ich abschließend folgende Bauernregel herausgesucht: "Wenn die Februarsonne den Dachs nicht weckt, schläft er im April noch fest". Zurzeit der aktuellen Finanzkrise denkt mancher sogleich wieder an das Börsengeschehen, wenn von "DAX", dem Deutschen Aktienindex, die Rede ist. Diese Bauernregel könnte diesmal sogar darauf übertragen werden: "Wenn die Februarsonne den DAX nicht weckt, schläft er bis April noch fest". (Es fragt sich nur: April welchen Jahres?) Nein, was hat dies für das Wetter zu bedeuten? Die Februarsonne weckt den Dachs wohl nur dann, wenn es gleichzeitig auch schon frühlingshaft mild wird. Ist das aber eher nicht der Fall, so wie in diesem kalten Februar 2009, dann bleiben die Temperaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im März und April noch so ungemütlich, dass die Dachse nur beschwerlich aus ihrem Winterschlaf aufwachen. In der Tat spricht vieles für ein eher kaltes Frühjahr 2009. Witterungsregeln deuten an, dass die Zahl der Frosttage im März und im April überdurchschnittlich hoch ist, wenn auch schon im Februar überdurchschnittlich viele Frosttage aufgetreten sind. Außerdem ist in den Monaten von Februar bis Mai die Häufigkeit von Nord- bis Ostströmungen am größten. Von Nord- und Ostsee kann aber in diesem Frühjahr nichts Warmes kommen, denn diese Meere weisen zurzeit Wassertemperaturen von wenigen Graden über dem Gefrierpunkt auf. Ein im Vergleich mit klimatologischen Mittelwerten zu kaltes Frühjahr 2009 - wenn es denn auch wirklich so eintreffen sollte - lässt lange noch nicht auf häufige Regen- oder Schneefälle schließen, im Gegenteil: Gerade die Monate von Februar bis Mai sind nämlich statistisch gesehen diejenigen mit den geringsten Niederschlägen im Jahr. Stellt sich in den Frühlingsmonaten oft Hochdruckwetter mit vielen Nachtfrösten ein, dann werden durch jene tiefen Werte die Monatsmitteltemperaturen nach unten gezogen, ähnlich wie auch in diesem Winter. Fazit: Sollte es ein kaltes Frühjahr geben, so war der Februar an allem schuld... Verläuft das Frühjahr 2009 aber trotzdem meist sonnig und warm, so freuen wir uns. Wenn es aber bis Juni doch zu kalt für 's Freibad bleibt, so sei keiner böse, denn: Der nächste Sommer kommt bestimmt! Wann auch immer. Seelische Ausgeglichenheit Ein beständiges Hochdruckwetter, gerade bei Kälte, beruhigt übrigens die Nerven und kann deshalb zu seelischer Ausgeglichenheit beitragen. Die meisten Menschen schlafen dann nachts erholsam und wachen morgens ausgeruht auf. Hohe Konzentrations- und Leistungsfähigkeit können die Folge sein. Wer tagsüber die Spätwintersonne nutzt und sich aktiv draußen bewegt, bringt den Kreislauf in Schwung und regt den Stoffwechsel an. An der Nordsee schwächen Südostwinde allerdings die Heilwirkung der dort vorherrschenden mineralstoffhaltigen Meeresluft ab. Dort lebt es sich im Sommer gesünder. Der Februar Der Februar war im altrömischen Kalender der letzte Monat des Jahres. Gegen Ende des Monats fanden Sühneopfer zur Reinigung statt. Er hatte zu Jahresschluss weniger Tage als die anderen und bekam in Schaltjahren noch einen Tag angehängt. So erklärt sich auch der Name "Hornung", der nichts mit Hirschgeweihen zu tun hat, sondern sich aus dem althochdeutschen Wort "hornunc", was so viel bedeutet wie "Bastard, Zu- kurz- Gekommener", entwickelte. So erklärt es sich, dass in manchen Bauernregeln ein zu schöner Februar als ein schlechtes Omen für die weitere Wetterentwicklung gesehen wird. Statistisch betrachtet, überwiegt noch bis zum 5. Februar die Zufuhr von milder Meeresluft. Es ist regnerisch und trübe, und wenn noch eine Schneedecke besteht, taut sie sicher weg. Erst in der Zeit vom 6. -12. und 19. - 24. Februar ist trockenes Frostwetter zu erwarten. Das fiele in diesem Jahr genau in die Karnevalstage. Immer wenn in strengen Wintern die milderen Zwischenabschnitte fehlten, traten in jenen Zeiten die tiefsten Jahrestemperaturen auf. Welche Wetterregeln und Lostage gibt es nun in diesem Monat? Wie Sie wissen, war am 2. Februar Maria Lichtmess. Die Sonne steht dann schon wieder eine ganze Stunde länger am Himmel als zu Weihnachten. Jedoch an diesem Tage wurde ihr Durchbrechen durch die Wolken nicht gewünscht, denn es hieß: "Wenn der Bär zu Lichtmess seinen Schatten sieht, kriecht er wieder für sechs Wochen ins Loch." Der vergangene Freitag, der 6. Februar, war eigentlich der Lostag für richtigen Schnee, denn es heißt: "Die heilige Dorothee bringt erst den meisten Schnee." Kälte wurde früher für den 14. Februar erwartet. Ein Spruch lautete: "An St. Valentein friert ´s Rad mitsamt der Mühle ein." Dieses Datum zeigt recht deutlich die Verschiebung der Lostage durch die Kalenderreform, denn der Valentinstag liegt heutzutage im langjährigen Mittel in der Mitte zwischen zwei Kältephasen. Dagegen stimmt die Bauernregel zum 24. Februar, dem heiligen Matthias, gut mit der häufigen Wetterabfolge überein: "Mattheis bricht ´s Eis." Zudem beginnt fünf Tage danach für die Meteorologen am 1. März der Frühling. Der Januar 2009 Der Januar 2009 war fast 2 Grad kälter als das langjährige Klimamittel des Monats. In der ersten Hälfte war es extrem kalt mit strengen Frösten von örtlich unter minus 20 Grad. Viele stehende und fließende Gewässer erstarrten zu Eis, die Schifffahrt kam teilweise zum Erliegen. Auch im Flachland lag längere Zeit Schnee. In der zweiten Monatshälfte wurde es milder, wobei zweistellige Plusgrade, wie man sie aus vergangenen Wintern kennt, meist ausblieben. Der Januar brachte ungewöhnlich viele Sonnenstunden und setzte die Serie trockener Monate fort. Die größten Temperaturabweichungen vom langjährigen Mittel traten in Hessen auf. Dort wurde das Klimamittel bis zu vier Grad unterschritten. Leicht positive Abweichungen gab es an den Küsten. Am kältesten war es am 6. Januar mit minus 27,7 Grad südlich von Dresden. An einigen Stationen wurden neue Negativ-Rekordwerte für den Januar aufgestellt. Am mildesten war es am 19. Januar mit plus 12,6 Grad in Freiburg. Einen ähnlichen kalten Januar gab es 2006 vor allem im Nordosten des Landes, landesweit dagegen zuletzt im Jahr 1997. Mit meist 20 bis 45 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geht der Januar 2009 als trockener Monat in die Statistik ein. Verbreitet wurden nur 50 Prozent des Klimamittels gemessen. Der regenreichste Tag war der 23. Januar. In Verbindung mit Sturmtief "Joris" fiel dort der Hauptteil der Gesamtmonatssumme. Sehr häufig schien die Sonne. Mit 80 bis teils über 100 Sonnenstunden wurden verbreitet die anderthalb bis zweifache Menge des Klimamittels erreicht. Die Ausnahme bildeten zum Beispiel die Bodenseeregion und die Nordseeküste, wo kaum Abweichungen zum langjährigen Mittel auftraten. Luftdruck und Barometer Im letzten Rundspruch am vergangenen Sonntag berichtete ich über den extrem tiefen Luftdruck, den wir am Freitag, dem 23. Januar 2009, über Deutschland zu verzeichnen hatten, den zweittiefsten seit dem Jahre 1901. Ich maß hier in Kempen 964,5 hPa. Deshalb heuteeinpaar Hintergrundinformationen zum Thema Luftdruck. Das Gerät zur Messung des Luftdrucks, das Barometer, wurde in den 30er und 40er Jahren des 17. Jahrhunderts erfunden. Die Tatsache, dass die Luft schwer ist und somit ein Gewicht besitzt, kannte man schon in der Antike. Allerdings wurde die Frage nach dem Luftdruck damals noch nicht gestellt. Aristoteles und andere Vertreter seiner Schule folgerten, dass in der Natur kein Vakuum existiere und dass die Natur geradezu eine "Furcht vor dem Vakuum" habe (horror vacui). Dabei hatte Demokrit schon vor Aristoteles die atomistische Ansicht vertreten, dass es nichts anderes als Atome oder leeren Raum gäbe. Die Auffassungen des Aristoteles wurden vom Christentum übernommen, da in ihnen kein Widerspruch zur Schöpfungsgeschichte der Bibel zu entdecken war. Die Frage nach dem Vakuum blieb bis ins 17. Jahrhundert hinein heikel, obwohl Versuche zum Vakuum durchgeführt wurden, bei der auch die Geistlichkeit anwesend war. All zu leicht konnte sich hinter der Bejahung des Vakuums "Ketzerei" verbergen. Bereits im 15. Jahrhundert hatte Kardinal Nicolaus von Cusa Versuche zur Gewichtsbestimmung der Luft vorgenommen. Seine positiven Resultate wurden jedoch angezweifelt. Man höre: Sogar Galilei war um 1615 noch der Meinung, Luft habe kein Gewicht, da sie keinen Druck ausübe. Später revidierte er seine Auffassung wieder. Das bekannte Quecksilberbarometer-Experiment wurde von Torricelli, der ein Schüler von Galilei war, Anfang des 17. Jahrhunderts vorgeschlagen. Man nannte es "das italienische Experiment". Die Kenntnis von diesem Versuch breitete sich rasch weiter, zunächst nach Frankreich. Bereits in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden das wetterabhängige Steigen und Fallen des Barometers beobachtet. Der erste Meteorologe, der die Beobachtungen von Luftdruckschwankungen und damit verknüpften Wetteränderungen erstaunlich klar und kritisch niederschrieb, war Ludwig Kämtz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bereits damals wies er in einem Text darauf hin, dass es gar nicht so einfach ist, die Regungen eines Barometers richtig zu interpretieren. Er schrieb: "Es wird als gewiss angenommen, dass es regnen werde, wenn der Luftdruck klein ist, dass hingegen schönes Wetter bei hohem Barometerstand stattfinden müsse. Geschieht das nicht, dann ergießen sich die Besitzer solcher Instrumente in ein Klagen über die Unrichtigkeit derselben. Besser wäre es, sie beklagten sich selber darüber, dass vorgefasste Meinungen bei ihnen zur fixen Idee geworden sind". Sehr modern, nicht wahr? Heute wissen wir ja längst, dass ein hoher Barometerstand nicht unbedingt schönes Wetter hervorrufen muss, vor allem nicht in der kalten Jahreszeit. Auch ein sehr tiefer Barometerstand bedeutet nicht uneingeschränkt "Regen" und "Sturm". Die Auswirkungen des Luftdrucks auf unser Wetter hängen nämlich noch von zwei anderen Gegebenheiten als von den reinen Messwerten ab: Einmal von der Jahreszeit und zum anderen von der Lage von Hoch oder Tief zum Standpunkt des Beobachters. Gerade im Winter ist ein Hochdruckgebiet recht oft mit schlechtem Wetter verbunden, wie Nebel, Kälte und Nieselregen. Andererseits gibt es oft in der warmen Jahreszeit Schönwetterereignisse bei tiefem Luftdruck, wie zum Beispiel im Warmsektor einer Zyklone (Tief). Auch in einem Sturm- oder Orkantief gibt es relativ ruhige Bereiche, wie zum Beispiel nahe am Zentrum oder in einem Streifen einer rückläufigen Kaltfront (Wellenstörung). Das eigentliche Sturmfeld befindet sich meist im Rückseitenbereich, bzw. im "Trog" des Tiefs. Es liegt also nicht an Ihrem Barometer, wenn es Ihre Erwartungen an das Wetter nicht erfüllt. Vergessen Sie die althergebrachten Beschriftungen "Sturm", "Viel Regen", "Regen-Wind", "Veränderlich", "Schönwetter", "Beständig" und "Sehr trocken". Wie sagte schon Ludwig Kämtz vor über 150 Jahren: Alles vorgefasste Meinungen, die bei vielen zur fixen Idee gewordensind. Wenn das Wettergeschehen so einfach wäre, bräuchten wir keine Meteorologen. Den extrem tiefen Luftdruck am 22. Januar 2009 konnte ich nur noch mit meinem Höhenmesser aus einem Jet feststellen: In 100 Fuß Höhe hier in Kempen am Niederrhein wurden mir 28,48 Inches HG in Meereshöhe angezeigt (964,5 hPa). Sowohl mein Quecksilber-Kontra- Barometer als auch mein Aneroid- Barometer waren nicht mehr ablesbar. Tauwetter in der Arktis In Sibirien benötigt man zum Graben eines Loches Sprengstoff, da der Boden in weiten Teilen des Landes die meiste Zeit des Jahres gefroren ist. Doch die Dauerfrostregionen, die dort weit über den Polarkreis nach Süden reichen, schmelzen. Der Klimawandel bedroht den "Kühlschrank" der Erde. Ein Viertel der globalen Festlandsoberfläche ist von Dauerfrost betroffen - seit vielen zehntausenden von Jahren. Aber in nur 75 Jahren wird diese Fläche um 25% geschrumpft sein mit dann vermutlich katastrophalen Folgen für Ökonomie und Ökologie. Deutsche Klimaforscher haben ziemlich Deutliches zur Zukunft gesagt: Es kann sein, dass das MeerEis der Nordpolregion im Sommer vollständig schmilzt. Die globale Temperatur könnte bis zum Ende dieses Jahrhunderts bis zu vier Grad ansteigen. Meist ist der Sommer in Sibirien kurz. Dann taut der Boden oberflächlich einige Dezimeter an, südlicher auch schon mal einen Meter tief. Darunter bleibt es eisig. Bis zu 1500 Meter tief kann der Dauerfrost reichen. Weder Erdwärme noch Sonnenstrahlen konnten das bisher ändern, wohl aber der Klimawandel. In den vergangenen 50 Jahren ist die Lufttemperatur dort bereits um drei Grad gestiegen. Das setzt die Natur unter Druck. Im angetauten Boden werden Mikroben aktiv. Sie zersetzen die wenigen Moose und Pflanzenreste der Tundra. Dabei entsteht Methan. Ein üblicher Vorgang, der überall passiert, wo es feucht ist, auch im Tümpel hierzulande. In der Tundra aber entsteht aufgrund der weltweiten Erwärmung viel mehr Methan als sonst, weil die Auftautiefe des Bodens größer wird. Einer schwedischen Studie zufolge entweicht in der sumpfigen Tundra Nordschwedens im Sommer bis zu 60% mehr Methan als noch vor 30 Jahren. Wenn man bedenkt, dass es sich beim Permafrost um riesige Regionen handelt, wird klar, dass die zusätzliche Methanproduktion den globalen Klimawandel unterstützt. Der Grund: Methan gilt als Treibhausgas Nr. 1. Es ist 23mal klimawirksamer als Kohlendioxid. Die bisherige Erwärmung führt also zu vermehrter Methanproduktion, was den Treibhauseffekt verstärkt. Falls es auf der Erde in den nächsten hundert Jahren noch ein paar Grade wärmer wird, bekommen wir Verhältnisse wie kurz nach der Eiszeit vor etwa 7000 Jahren. Da war der Dauerfrostboden schon einmal großflächig aufgetaut. Erste Probleme gibt es bereits heute. Weil der Boden im sibirischen Sommer immer tiefer auftaut, sind die riesigen Pipelines bedroht. Sie stehen, wie alle Bauten im Dauerfrostgebiet, auf Stelzen, die weit in die Erde gebohrt wurden. Taut es tiefer, wird der Baugrund instabil. Wenn das Dauer- Eis im Boden auftaut, gibt es in ebenen Gebieten mehrere zehn Meter tiefe Senken. Ganze Leitungen und Straßen brechen dann auf oder wellen sich. Das wäre eine neue, ganz andere Herausforderung für Gasprom als bislang durchgemacht. Dann würde Putin, falls noch immer an der Macht, um sich abzulenken, mal wieder "oben ohne" angeln gehen. Frau Merkel würde dies eher nicht in Betracht ziehen. Auch manche Trassen der berühmten Transsibirischen Eisenbahn sind bedroht. Erdöltrassen, wie die Trans- Alaska- Pipeline werden heute schon mit viel Energie künstlich nachgekühlt. Die Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasfelder würde noch schwieriger - und die Preise für die Produkte stiegen weiter. Die ökologischen Folgen sind bisher weniger sichtbar, jedoch werden sie dauerhafter sein. In den sich vermehrt bildenden Sümpfen würden keine Wälder mehr entstehen. Die waldreiche Taiga würde schwinden. Die hoch spezialisierte Pflanzen- und Tierwelt, angepasst an große Schwankungen von 60 - 80 Grad, würde den Klimawandel nicht schadlos überstehen. Damals vor 7000 Jahren starben ganze Tiergruppen aus. Zu diesem Thema gibt es ein Buch "Der Arktis- Klima- Report. Die Auswirkungen der Erwärmung". Convent Verlag, Hamburg 2005, 140 Seiten, 16,90 Euro. Chronik eines extremen Winters 1978/79 Der Winter 1978/79 begann mit einem Paukenschlag: Ende November war ein erster Wintereinbruch erfolgt und in den ersten Dezembertagen stellte sich trockenkaltes Winterwetter mit teils strengen Nachtfrösten ein. Als am 8. des Monats milde Atlantikluft auf die bodennahe Frostluft hinauf glitt, kam es in weiten Teilen Deutschlands zu teils extremem Glatteisregen. Beim ersten großen Wintergefecht setzte sich die milde Luft gegen die Kaltluft durch. Aber schon zur Monatsmitte wehte erneut Polarluft heran und brachte weiten Landesteilen reichlich Schnee. Der nächste Anlauf milderer Luft kam mit atlantischen Tiefausläufern pünktlich zu Weihnachten. Von Südwest nach Nordost wich der Winter zurück und anfängliche Schneefälle gingen bis in die Gipfellagen der Mittelgebirge in Regen über. Die aus dem Seegebiet um die Azoren stammende Luft brachte viel Regen, stürmischen Wind und Temperaturen bis über plus 10 Grad mit. In den Alpen setzte sich bis in Höhenlagen über 2000 Meter Tauwetter durch. Regen und Schneeschmelze ließen im Süden "zwischen den Jahren" zahlreiche Flüsse über die Ufer treten. Doch dann schlug der Winter machtvoll zurück: Die milde Atlantikluft hatte es gerade mal bis nach Dänemark und zur südlichen Ostsee geschafft, als die Frostluft auch schon wieder südwärts zu drängen begann. Weil sie jedoch zunächst kaum gegen den stürmischen Südwestwind anzukommen vermochte, wich sie nach Westen hin aus und schwoll dabei ihrerseits zu einem ausgewachsenen Sturm an. Dabei zwang sie den vom Atlantik kommenden Sturmtiefs immer südlichere Zugbahnen auf, so dass diese nunmehr genau über Deutschland nach Osten zogen. Gleichzeitig schob sich die schwere Kaltluft am Boden unter die leichtere, rund 20 Grad wärmere Atlantikluft und gewann so Stück für Stück auch südwärts an Raum. Drei Tage verlief das Gerangel zwischen den gleich starken Gegenspielern nahezu unentschieden, wobei die Gewalt des Schneesturms im Norden immer mehr zunahm. Aber erst hinter einem letzten Sturmtief, das am Silvestertag über die Mitte Deutschlands nach Osten zog, wurde der Weg nach Süden frei und die Eisluft konnte bis zum Neujahrstag ganz Mitteleuropa überfluten. Nach dem mit Nachttemperaturen teils unter minus 25 Grad zunächst extrem kalten Jahresbeginn beruhigte sich die wetterbestimmende Strömung allmählich und die Temperaturen normalisierten sich wieder. Doch Anfang Februar regenerierte sich das alte Strömungsmuster noch einmal. Wieder fegte vom Atlantik subtropische Warmluft heran und abermals hielt der nordosteuropäische blockierende Hoch dagegen. Der Höhepunkt dieses dritten großen Wintergefechts traf Norddeutschland am 13. Februar 1979 in Gestalt des zweiten verheerenden Schneesturms dieses denkwürdigen Winters. Erst danach löste sich das so beherrschende atmosphärische Strömungsmuster der scharfen Gegensätze über Europa endgültig auf, aber auch im anschließenden Frühjahr stellten sich auch aufgrund der im Norden Deutschlands noch lange liegenden Schneemassen immer wieder nasskalte Witterungsphasen ein. Noch bis zum Mai zeugten dort die letzten Schneereste von jenem so außergewöhnlichen, wiederholt arktisch geprägten Winterverlauf und erinnerten dort an den überstandenen norddeutschen Katastrophenwinter. Der "Schmetterlingseffekt" Im vergangenen Funkwetterbericht wies ich darauf hin, dass bereits eine kleine Änderung in der Ausgangslage der Wetterbedingungen, wie zum Beispiel die sich bisweilen zu Wolken auswachsenden Kondensstreifen von Flugzeugen, zu großräumigen Änderungen einer vorhergesagten Wetterlage führen können. Man kennt jenes Phänomen unter dem Begriff "Schmetterlingseffekt", der 1963 von dem Meteorologen Edward Lorenz geprägt wurde. Der stellte nämlich fest, dass in einer damals noch sehr einfachen Wettersimulation das Geschehen einen völlig anderen Verlauf nahm, wenn man die Ausgangsbedingungen auch nur ein winziges Bisschen veränderte. Um eine möglichst extrem kleine Veränderung im realen Wettergeschehen zu benennen, wählte er den Flügelschlag einer Möwe als Beispiel. Das war die Geburtsstunde der so genannten "Chaostheorie". Später bürgerte sich dann der Schmetterling als Vergleich ein, vielleicht auch deshalb, weil die mathematische Struktur, die das Chaos beschreibt, ein so genannter Attraktor, entfernt an einen Schmetterling erinnert. Inzwischen sind die Wettersimulationen erheblich komplexer, aber dass das Wetter ein chaotisches System ist, bestätigt sich immer wieder. In Simulationen und Prognosen gehen wir immer nur von einzelnen Daten an endlich vielen Punkten auf der Erde aus - und mit denen ist das Wetter nicht mehr als rund fünf Tage im Voraus zu bestimmen. Die kleinste Abweichung beim Ausgangszustand potenziert sich, je weiter man in die Zukunft rechnet, was eine große Auswirkung auf das Vorhersageergebnis hat. Die Vorgänge beim Wetter laufen bekanntlich nach physikalischen Gesetzen ab. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, Wetterentwicklungen vorherzusagen. Das Wetter unterliegt jedoch dem Gesetz der Strömungen. Turbulenzen darin werden zu einem Stück unberechenbarer Natur. Sie entwickeln sich wie gesagt "chaotisch". Somit sind bis heute Wetterprognosen über vier Tage hinaus noch immer relativ unsicher, da jede Ausgangswetterlage in ihrem Anfangszustand datenmäßig nicht genau genug bekannt ist, also angefüllt ist mit sog. "sensitiven Bereichen", in denen kleinste Veränderungen zu völlig anderen Endresultaten führen können. Und das Vertrackte bei Chaoseffekten ist, dass man für eine Verdopplung der Vorhersagezeit nicht die doppelte Anzahl von Vorhersagepunkten benötigt, sondern ein Vielfaches davon. Die chaotische Entwicklung bei Wetterphänomenen ist zwar bis heute unumstritten, doch auch die Turbulenz weist - soviel wurde inzwischen erkannt - Gesetzmäßigkeiten auf, die sie dem Chaos verdankt. In Experimenten hat sich gezeigt, dass die so unregelmäßig erscheinenden Wirbel einer turbulenten Strömung doch bestimmte Formen überraschend deutlich bevorzugen und dass man ihre Eigenschaften durch geeignete Mittelwerte kennzeichnen kann. Gerade die chaotischen Bahnen sind es, auf deren Mittelwerte Verlass ist. Es sind also immer die Anfangszustände, die den Verlauf einer chaotischen Entwicklung bestimmen, die - zum Glück - in ihrer weiteren Entwicklung dennoch zu recht verlässlichen Mittelwerten führen. Aber diese helfen bei einer Wetterprognose für mehrere Tage wenig. Hier will man ja wissen, wie sich das Wetter an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit entwickelt. Um dies genau vorher zu sagen, müsste man den Anfangszustand der Atmosphäre vor der Prognose so genau kennen, dass die weitere Entwicklung nach drei Tagen nicht mehr aus dem Ruder läuft. Denn der noch so kleinste nicht berücksichtigte Parameter im Anfangszustand kann eine Computervorhersage zu ganz anderen Ergebnissen führen. Man sollte den Schmetterlingseffekt allerdings nicht allzu wörtlich nehmen und eher als eine Metapher begreifen. Bei den Auswirkungen der Kondensstreifen, die bei den Anfangsparametern einer Wetterprognose wohl nicht berücksichtigt werden können, bin ich mir da nicht so sicher, weil diese mit Sicherheit größere wettermäßige Effektivität besitzen, wenn sie sich zu Wolkenformationen auswachsen. Jedoch könnte wohl kein Meteorologe eine Kausalkette angeben, wie sich dieser Effekt so vergrößert, dass er tatsächlich einen Sturm auslöst- noch dazu mehrere tausend Kilometer entfernt. So wird wohl jeder Kondensstreifen mehr vom Wetter beeinflusst als das Wetter von einem Kondensstreifen. Damit sind wir am Ende des heutigen Funkwetterberichtes. Nachlesen können Sie diesen Text wie stets auf meiner Homepage beim DARC. Schönen Sonntag und gute Woche! Kondensstreifen Bei der Diskussion um den vom Menschen mit verursachten Klimawandel kommt meines Erachtens der weltweit zunehmende Flugverkehr zu kurz. Ich will jetzt gar nicht auf die immensen Mengen von CO² in den Abgasen eingehen, die in wenigen Tagen durch die Jetstreams um den gesamten Globus verfrachtet werden können, sondern heute einmal fragen: Was ist eigentlich mit den Kondensstreifen von Flugzeugen? Diese können doch zu Wolken werden und das Sonnenlicht abschwächen, denn Kondensstreifen sind ja im Prinzip Wolken. Sie gleichen in ihrer Struktur den Cirruswolken, die sich in Höhen um zehn Kilometer bilden. Dort oben herrschen Temperaturen um minus 40 Grad, so dass der Wasserdampf in den Abgasen von Düsenflugzeugen unmittelbar zu Eiskristallen gefriert. Die dazu nötigen Kondensationskeime liefert der Jet in Gestalt von feinen Russpartikeln gleich mit. Dadurch wird ein Flugzeug für uns erst sichtbar, das sonst nur ein winziger Punkt am Himmel wäre. Normalerweise lösen sich Kondensstreifen schnell wieder auf - ihre Lebensdauer beträgt meist nicht mehr als ein paar Minuten. Wenn allerdings die Luft in dieser Höhe mit Feuchtigkeit schon fast gesättigt ist, bleiben die Kondensstreifen länger bestehen. Sie gehen in die Breite und sind als feine Schlieren am Himmel sichtbar. Langlebige Streifen sind also ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und damit in gewisser Weise auch ein Zeichen für eine bevorstehende Wetterverschlechterung. Die Wasserdampfmenge, die ein Flugzeug ausstößt, ist allerdings gering im Vergleich zu dem, was eine normale Wolke an Wasser enthält. Trotzdem können die Flugzeugabgase zur Wolkenbildung beitragen. Die Partikel, die aus dem Triebwerk strömen, können nämlich auch den schon vorhandenen Wasserdampf zum Kondensieren bringen. So kann aus einen schmalen Kondensstreifen eine regelrechte Wolke entstehen, die eine recht große Fläche überstreicht. Inzwischen ist längst nachgewiesen worden, dass es in den großen Flugkorridoren tatsächlich einen höheren Grad an Bewölkung gibt. Kondensstreifen können sich also tatsächlich zu Wolken auswachsen. Der Mensch verändert somit gebietsweise die Strahlungsbilanz der Sonne durch den Flugverkehr, was Auswirkungen auf Wettererscheinungen haben kann. Manchmal nimmt das Wettergeschehen nämlich einen ganz anderen Verlauf, wenn die Ausgangsbedingungen nur ein bisschen verändert werden. Wenn dies bereits durch den Flügelschlag einer Möwe oder sogar vielleicht bereits durch den eines Schmetterlings bewirkt werden kann, dann doch wohl erst recht durch einen sich zur Wolke auswachsenden Kondensstreifen. Sie merken, ich will auf die Chaostheorie beim Wetter hinaus. Das ist jedoch ein neues Thema. Mythos Kugelblitz Die Existenz des Kugelblitzes ist auch heute noch eine umstrittene Frage, denn es liegen nur wenige Berichte oder Bilder dieses Naturphänomens vor. Kugelblitze können angeblich durch Mauern und Ritzen dringen und sich langsam in Bodennähe bewegen. Es ist mittlerweile möglich, eine Art Kugelblitz künstlich zu erzeugen. Kugelblitze sind extrem seltene Erscheinungen, und die Augenzeugenberichte unterscheiden sich in manchen Einzelheiten. Viele der berichteten Eigenschaften von Kugelblitzen widersprechen einander. Eine mögliche Erklärung ist, dass mehrere verschiedene Phänomene als Kugelblitz bezeichnet werden. Kugelblitze treten sehr selten und zufällig im Zusammenhang mit Gewittern und atmosphärischen Entladungen überwiegend in Bodennähe auf. Sie wurden als schwebende, glühende Objekte beschrieben. Im Gegensatz zur kurzlebigen Lichtbogenbildung zwischen zwei Punkten eines gewöhnlichen Blitzes haben sie eine Lebensdauer von bis zu dreißig, typischerweise aber zwei bis acht Sekunden. Die Form kann kugelförmig, eiförmig oder stabähnlich sein, wobei die Erscheinung in keiner Dimension viel größer als in den anderen Formen ist. Die größte beobachtete Ausdehnung lag zwischen fünfzehn und vierzig Zentimetern. Die Blitze sind selbst leuchtend, meist orangefarben bis hellgelb und undurchsichtig. Manchmal versprühen sie Funken und sind von Geräuschen begleitet. Bisweilen wird die Erscheinung von einem bestimmten Objekt angezogen, manchmal bewegt sie sich eher zufällig oder bleibt sogar stehen. Nach mehreren Sekunden verschwindet die Erscheinung, zerstreut sich, wird von etwas absorbiert oder verabschiedet sich in seltenen Fällen in einer Explosion. Manchen Berichten zufolge können sie in Gebäude eindringen, scheinbar mühelos durch Mauern, Türen und Fenster dringen oder aber auch bei Berührung explodieren und Verletzungen verursachen. Manche Beschreibungen ähneln sehr stark denen von anderen Phänomenen wie zum Beispiel von UFO s. Entstehung und Aufbau des Phänomens "Kugelblitz" sind trotz erfolgreicher japanischer Experimente mit interferierenden Mikrowellen, die Plasma- Kugeln erzeugten, die Kugelblitzen in Größe und Erscheinungsbild ähnelten, nicht gänzlich geklärt. Experten verschiedener Fachrichtungen wie Meteorologen, Elektrotechniker, aber auch viele Laien sammeln deshalb seit langem alle Augenzeugenberichte, werten sie aus und versuchen auf dieser Grundlage, dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Besonders begehrt sind zufällig gelungene Fotos oder Filmaufnahmen. Dabei handelt es sich aber häufig um Fälschungen. Nikola Tesla berichtet in seinen Aufzeichnungen von der erfolgreichen Erzeugung von Kugelblitzen in seinem Labor. Spätere Versuche haben aber keine Anhaltspunkte finden können, ob diese Kugelblitze wirklich etwas mit dem beobachteten Naturphänomen zu tun haben oder ob es sich nur um eine andere Art eines elektrischen Phänomens handelt. Interferierende Mikrowellen in Plasmen Die populärste Hypothese ist, dass es sich um Plasmen handelt, die durch interferierende Mikrowellen gebildet werden. Zwei japanischen Wissenschaftlern gelang es 1991 erstmals, unter Laborbedingungen Kugelblitzen ähnelnde Gebilde aus Plasma reproduzierbar zu erzeugen, deren Eigenschaften dem von Augenzeugen berichteten Verhalten ähnelten. Dabei verwendeten sie ein Magnetron mit 2,45 GHz und 5 kW Dauerleistung. Die Lebensdauer der Kugelblitze betrug jedoch nur einige Millisekunden. Silizium-Wolken Eine andere, im Jahre 2000 von John Abrahamson und James Dinniss in Neuseeland vorgestellte Theorie postuliert, dass Kugelblitze keine elektrische Natur haben, jedoch durch Blitzeinschlag ins Erdreich entstehen. Dabei werde Siliziumdioxid (Sand, Kieselerde) in Silizium und Sauerstoff zerlegt. Während der Sauerstoff im Erdreich mit Kohlenstoff, also organischem Material, reagiere, trete das Silizium als Dampf oder Aerosol aus dem Blitzkanal aus und werde durch Luftsauerstoff langsam oxidiert, wodurch es leuchte. So diese Theorie. Die Siliziumpartikel-Wolke sei durch Selbstorganisation aufgrund ihrer Ladung in der Lage, eine kugelähnliche Form anzunehmen, und es sei daher auch möglich, dass sie sich nach Durchdringen einer kleinen Öffnung wieder zusammenfindet. Diese Hypothese wurde in Brasilien an der Universidade Federal de Pernambuco inzwischen nachgeprüft, indem Silizium- Wafer elektrisch verdampft und die Silizium-Luft-Mischung per Funkenentladung entzündet wurde. Farbe, Temperatur und Lebensdauer (8 Sekunden) der tischtennisballgroßen Siliziumdampfbälle entsprachen dabei den Zeugenaussagen, so weit diese bei einem seltenen Kurzzeitphänomen exakt sind. Stehende Wellen und Maser Eine wichtige Theorie wurde 1955 vom russischen Physiker Pjotr Kapiza aufgestellt. Er rechnete die Lebensdauer einer nuklearen Explosionswolke auf die von Kugelblitzen angenommenen Dimensionen herunter und erhielt für einen Feuerball von 10 cm Durchmesser eine Lebensdauer von weniger als 10 Millisekunden. Da Kugelblitze für mehrere Sekunden beobachtet werden, kam er zu dem Schluss, dass die Kugelblitze extern gespeist werden müssen und eine intern ablaufende Reaktion gleich welcher Art nicht für den Energiebedarf ausreicht. Daraufhin entwickelte er die Theorie, dass sich während eines Gewitters stehende elektromagnetische Wellen zwischen Himmel und Erde ausbilden und Kugelblitze an den Schwingungsbäuchen entstehen. Kapiza ging jedoch nicht auf die Problematik ein, dass es eine Reihe von Schwingungsbäuchen gibt und welche Bedingungen einen bestimmten Schwingungsbauch zum Kugelblitz werden lassen. Um einen Ort bevorzugter Energieabgabe zu bilden, muss das sich dort befindliche Gas im Vergleich zur Umgebungsluft zumindest schwach ionisiert (leitfähig) sein, und es ist unklar, wie sich eine solche Anfangsionisation ausbilden kann. Als theoretisches Beispiel sei eine heiße Luftblase genannt, denn die Ionisierung von Luft steigt mit der Temperatur an. Wenn eine solche Luftblase dadurch mehr Energie erhielte, führte das zu einem weiteren Anstieg der Temperatur und damit zu einem sich selbst aufschaukelnden Prozess. Peter Handel hat die Theorie mit dem Vorschlag eines atmosphärischen Masers, einer Art Verstärker von Mikrowellen, ausgebaut. Wenn das Volumen eines Masers groß genug ist (mehrere Kubikkilometer), könnten durch alleiniges Pumpen (was bei kleinen Masern normalerweise zur sofortigen Zerstreuung der Energie führt) genügend Moleküle in einen angeregten Zustand versetzt werden. Handel hat gezeigt, dass es Solitonlösungen innerhalb des Masers gibt, das heißt, eine stabile stehende Welle im nichtlinearen Medium, deren Energie vom Maser eine Zeitlang aufrechterhalten wird. Die Entstehung und die Bewegung der Kugelblitze sind damit an den Ort der Energieabgabe gebunden. Deshalb steigen sie im Gegensatz zum gewöhnlichen Plasma nicht auf und sind gegen Wind unempfindlich. Sofern Baustoffe von Gebäuden für Mikrowellen durchlässig sind, was zumeist der Fall ist, können Kugelblitze diese durchaus durchdringen. Die von den japanischen Wissenschaftlern Ohtsuki und Ofuruton durchgeführten Experimente konnten dies bestätigen. Die Plasma- Bälle hatten vergleichbare Dimensionen und Lebensdauer, sie konnten sich gegen Wind bewegen und eine 3 cm dicke Keramikplatte durchdringen. Wissenschaftler der gemeinsamen Arbeitsgruppe Plasmaphysik des Garchinger Max-PlanckInstituts für Plasmaphysik (IPP) und der Berliner Humboldt-Universität (HUB) haben 2006 kugelblitzähnliche Plasma- Wolken erzeugt. Die Physiker produzierten über einer Wasseroberfläche leuchtende Plasma- Bälle, die eine Lebensdauer von knapp einer halben Sekunde und Durchmesser von 10 cm bis 20 cm besitzen. Dabei ragen in ein mit Salzwasser gefülltes Becherglas zwei Elektroden, wobei eine Elektrode durch ein Tonröhrchen, das etwas aus der Wasseroberfläche herausschaut, vom umgebenden Wasser isoliert ist. Wird über eine Kondensatorbatterie von 0,5 mF eine Hochspannung von 5 kV angelegt, so fließt für 0,15 Sekunden ein bis zu 60 Ampere starker Strom durch das Wasser. Durch einen Überschlag vom Wasser aus gelangt der Strom in das Tonröhrchen, wobei das dort enthaltene Wasser verdampft. Nach dem Stromimpuls zeigt sich ein leuchtendes Plasmoid aus ionisierten Wassermolekülen. Elektromagnetischer Knoten Die Theorie von A. F. Ranada (Madrid) geht von einem topologischen Modell, einem so genannten elektromagnetischen Knoten aus. Ein elektromagnetischer Knoten ist definiert als Vakuum-Lösung der Maxwellschen Gleichungen mit der Eigenschaft, dass alle elektrischen und magnetischen Feldlinien geschlossen sind. Entsprechend dieser Theorie besteht das Volumen des Kugelblitzes nicht vollständig aus Plasma, sondern aus ineinander hängenden Plasma- Schläuchen, die sich gegenseitig magnetisch und hydrodynamisch stabilisieren und Eigenschaften von etwa 10 s Lebensdauer sowie eine Netto-Abstrahlung von etwa 100 W bei einer Gesamtenergie von etwa 20 kJ ohne externe Energiezufuhr zulassen, wie durch entsprechende elektrodynamische Modellrechnungen auf der Grundlage der Alfvén- und Maxwellschen Gleichungen gezeigt werden konnte. Dabei werde der Hauptteil der Energie nicht durch das Plasma der Blitzentladung, sondern in Form der magnetischen Feldenergie gespeichert, wobei magnetische Feldstärken von 0,5 T bis 2 T angenommen werden. Ich habe diese recht komplizierte Theorie, die ich selbst nicht richtig verstehe, nur mal angeführt, damit Sie sehen, wie stark das Phänomen des Kugelblitzes bis heute die Wissenschaft beschäftigt. Weitere Theorien Es gibt viele weitere Theorien: Hochstromentladungen, bei denen kleine (< 1 cm) hüpfende Feuerbälle entstehen, die Bildung anderer zündfähiger Gase oder Aerosole (so genannte diffusive Verbrennung), oder Zuhilfenahme esoterischer Energiequellen. Es gibt auch Forscher, die der Meinung sind, die beobachteten Kugelblitze seien nur eine optische Täuschung. Wird das Auge kurzzeitig stark geblendet, so sieht man noch einige Sekunden einen Lichteffekt. Bewegt man die Augen, kann der Eindruck entstehen, eine Lichtkugel fliege durch den Raum. Die Diskussion um die Kugelblitze ebbt wohl niemals ab und ist noch heute ebenso spannend und geheimnisvoll wie zu meiner Kindheit. Leider habe ich bislang eine derartige Erscheinung noch nie beobachten können. Dass es sich hierbei um eine Täuschung handeln könnte, glaube ich jedoch seit dem Tage nicht mehr, als mir eine Berufskollegin von ihrem Erlebnis mit einem Kugelblitz sehr detailliert, ergriffen und relativ glaubwürdig berichtete. Geht der Blitz eigentlich von unten nach oben? Die Physik der Blitze ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Es beginnt damit, dass in einer Gewitterwolke geladene Teilchen voneinander getrennt werden - die positiven wandern nach oben, die negativen sammeln sich im unteren Tei der Wolke an. So entsteht eine Spannung innerhalb der Wolke, zwischen einzelnen Wolken, aber auch zwischen Wolke und dem nicht geladenen Boden. Irgendwann wird die Spannung so groß, dass es zur Entladung kommt. Dabei entsteht zuerst ein so genannter Vorblitz, der sich von der Wolke auf einem Zickzackkurs einen Weg zum Boden sucht. Der schafft den Blitzkanal, in dem dann später die eigentliche Entladung stattfindet. Kommt die Spitze des Vorblitzes in die Nähe eines Baumes, einer Antenne oder eines Kirchturms, so wächst ihm von dort ein kleines Blitzchen entgegen. Sobald die beiden Äste sich getroffen haben, ist die Leitung zwischen Boden und Wolke geschlossen, und der eigentliche Blitz kann sich entladen - mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 000 Kilometern pro Sekunde, also immerhin einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Im Blitzkanal herrscht dabei eine Temperatur von 30000 Grad Celsius. Die erste Entladung pflanzt sich tatsächlich von unten nach oben fort. Die Ladungsträger fließen aber selbstverständlich immer vom negativen Pol zum positiven, also von der Wolkenunterseite zur Erde. Mit einem Hauptblitz ist es meistens nicht getan. Nach dem ersten Hauptblitz folgt ein kleinerer von oben nach unten und dann wieder ein großer von unten nach oben. Die mehrfachen Entladungen nehmen wir manchmal als Flackern wahr, das gesamte Spektakel dauert wenige Zehntelsekunden. Wenn man mit "Blitz" also die sichtbare Hauptentladung bezeichnet, dann geht der Blitz tatsächlich von unten nach oben. Schlägt der Blitz eigentlich nie zweimal in die gleiche Stelle ein? Dieser Satz ist genauso plausibel wie die Behauptung, es sei unmöglich, zweimal hintereinander eine Sechs zu würfeln. Man hat ein relativ seltenes Ereignis, und natürlich ist es noch seltener, dass dieses Ereignis gleich zweimal hintereinander auftritt. Es ist aber ein Fehlschluss zu glauben, dass nach dem Eintritt des ersten Ereignisses das zweite nun besonders unwahrscheinlich sei. So wie nach der ersten Sechs die zweite immer noch eine Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel hat, so ist ein Ort, in den gerade (oder in der letzten Woche) der Blitz eingeschlagen hat, nicht weniger gefährdet als vorher. Das wird besonders bei Orten deutlich, die besonders häufig vom Blitz getroffen werden, etwa das Empire State Building in New York. In dieses Hochhaus schlägt jedes Jahr etwa 25-mal der Blitz ein, was nicht zu besonderen Schäden führt wegen des guten Blitzableiters. Oft bekommt der Wolkenkratzer bei einem einzigen Gewitter gleich mehrere Blitzeinschläge mit. Auch für Menschen gilt der Satz natürlich nicht. Wer einmal von einem Blitz getroffen wurde und das überlebt hat, der ist in Zukunft nicht auf magische Weise sicher. Das Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet als Rekordhalter den Amerikaner Roy C. Sullivan, der insgesamt siebenmal vom Blitz getroffen wurde und alle diese Einschläge überlebte. Es handelt sich also hierbei um reinen Aberglauben. Dass der Blitz stets in den höchsten Punkt einschlägt, stimmt auch nicht absolut. Dass ein Blitz nicht immer den geradesten Weg nimmt, sieht man an seiner gezackten Form. Er schlägt nicht von oben geradewegs in den Boden ein, sondern zuckt in Teilentladungen erratisch hin und her. Das liegt daran, dass das elektrische Feld in der Luft nicht absolut gleichmäßig ist, sondern durchaus unterschiedlich dicht. Im Extremfall kann ein Blitz sogar eine große Strecke waagerecht überbrücken. Das mit dem höchsten Punkt stimmt durchaus, wenn man es nicht als absolute Regel nimmt. "Jeder hohe Gegenstand beeinflusst das normale luftelektrische Feld so, dass es über dem Gegenstand zu einer Drängung der parallel zur Erdoberfläche verlaufenden elektrischen Feldlinien kommt, wodurch der Blitz angezogen wird", schreibt der Meteorologe Horst Malberg. Das heißt: Die Einschlagwahrscheinlichkeit ist größer, und sie nimmt natürlich mit der Entfernung vom Objekt ab. Ein Kirchturm kann kein ganzes Dorf vor dem Blitzschlag schützen. Deshalb sollte man sich auf die Regel nicht verlassen, sondern bei Gewitter Schutz suchen. Trockene Gewitter In einem Gespräch vor ein paar Tagen behauptete jemand, dass "trockene Gewitter" viel gefährlicher seien als die normalen nassen. Gibt es bei uns überhaupt Gewitter, bei denen kein Niederschlag fällt? In unseren Breiten sind Gewitter durchweg mit Niederschlag verbunden. Allenfalls hört und sieht man einmal ein Gewitter am Horizont und bekommt seinen Niederschlag nicht mit, weil es vorbeizieht - aber am Ort des Gewitters selbst regnet oder hagelt es. Es gibt aber in heißeren Gegenden der Welt tatsächlich trockene Gewitter, etwa im Westen der USA. Wie kann das sein, denn schließlich sind doch für die Aufladung von Wolken elektrisch geladene Eispartikel nötig. Natürlich regnet es auch bei trockenen Gewittern, aber der Regen erreicht nicht den Boden. Die Luft unterhalb der Wolke ist so heiß und trocken, dass die Tropfen auf dem Weg nach unten verdunsten. Ein solches Phänomen nennen die Meteorologen "Virga". Man kann dies auch von weitem erkennen - man sieht dann unterhalb der Wolke die typischen Regenstreifen, aber diese hören dann mitten in der Luft auf. Gelegentlich geschieht dies auch mal in unseren Breiten vornehmlich an heißen Sommertagen. Gefährlich sind die trockenen Gewitter vor allem, weil sie Waldbrände auslösen können. Denn obwohl der Regen nicht den Boden erreicht, kann der Blitz natürlich in den Boden einschlagen. Wenn er dann etwa einen trockenen Baum in Brand setzt, ist kein Regen da, der das Feuer im Keim ersticken kann. Die böigen Winde, die mit dem Gewitter kommen, fachen das Feuer noch zusätzlich an. Trockene Gewitter können sogar aus lodernden Waldbränden entstehen. Das Feuer erzeugt dann die typischen heftigen Aufwinde, die viel Wasserdampf aus den verbrennenden Pflanzen enthalten. In der Höhe entstehen die Gewitterwolken, aber ihr Regen wird von den heißen Bodenschichten wieder in Wasserdampf verwandelt. Feuerwehrleute fürchten diese Gewitter, weil zum ersten die Blitze neue Brandherde zu erzeugen vermögen und zweitens die schnell drehenden Winde des Gewitters das Feuer in alle Richtungen treiben können. Im Auto sicher vor Blitzschlag? Immer wieder taucht auch die Frage auf, ob man im Auto wirklich vor Blitzschlag geschützt ist. Ein Auto ist, physikalisch betrachtet, ein Faraday - Käfig. Darunter versteht man eine geschlossene Metallstruktur mit nicht allzu großen Löchern. Wenn ein solcher Käfig von einer elektrischen Entladung getroffen wird, verteilt sich die Ladung nur über die Außenhülle und wird dann, meist zur Erde, abgeleitet. Das kann man zum Beispiel bei spektakulären Vorführungen im Deutschen Museum in München bestaunen, bei denen ein Mitarbeiter in einem solchen Käfig sitzt. Draußen sprühen die Funken, und er bleibt unverletzt. Im Inneren des Käfigs und auch in einem Auto ist die Feldstärke Null. An der Karosserie kann die enorme Hitze allerdings Spuren hinterlassen und auch elektrische Geräte können Schaden nehmen. Aber der Mensch ist sicher. Nun hat aber nicht jedes Auto eine vollständige Metallhülle. Heute werden immer mehr Kunststoffteile verbaut, etwa in Schiebedächern. Ein Cabriolet ist auch bei geschlossenem Verdeck nicht völlig sicher. Ob der Blitz dort wirklich abgeleitet wird, hängt von mehreren Faktoren ab - etwa davon, wie nass das Stoffdach ist oder ob es eine stützende Metallkonstruktion besitzt. Eine Cabriotour bei Gewitter ist somit auf jeden Fall riskant. Dass man bei Gewitter im Auto vor Blitzschlag geschützt ist, gilt daher nur für geschlossene Limousinen. Die Schafskälte traf pünktlich ein Zwischen dem 10. und 20. Juni tritt bis heute recht regelmäßig ein Wetterphänomen ein, das unter dem Namen "Schafskälte" bekannt ist. Traditionell wurden die Schafe in Mitteleuropa Mitte Juni geschoren. Wenn dann ein plötzlicher Kälteeinbruch, vielleicht sogar mit Nachtfrösten, kam, konnte das für die nackten und schutzlosen Tiere gefährlich werden daher der Name "Schafskälte". Im letzten Rundspruch am vergangenen Sonntag hatte ich jenes Ereignis für die Mitte der vergangenen Woche angekündigt uns es traf auch pünktlich ein. Die Schafskälte gehört zu den am besten dokumentierten "Singularitäten" - also Wetterlagen, die immer wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahresrhythmus auftreten. Tatsächlich stellt sich in jener Zeit Mitte Juni die Großwetterlage häufig um. Nach einem frühen Sommerauftakt Anfang Juni mit sonnigem Wetter bricht der Hochdruckeinfluss plötzlich zusammen und macht den Weg frei für atlantische Tiefdruckausläufer. Der Wind dreht von Süd- Südwest auf West bis Nordwest. So kann kältere Luft nach Mitteleuropa strömen und das Wetter wird wechselhafter. Die Tagestemperaturen können auf 10 Grad oder darunter absinken. Das ganze rührt zum Teil daher, dass sich zu Beginn des Sommers der Kontinent schneller aufheizt als das Meer. Wenn an Land die warme Luft aufsteigt, befindet sich oftmals über dem Atlantik ein kühles Hochdruckgebiet. So entsteht eine Tiefdruckrinne über dem Festland. Diese saugt dann die kalte Luft vom Atlantik an, so dass sie als "Rückseitenwetter" von Nordwesten her einbrechen kann. In der Mitte jener Tiefdruckrinne im Bereich der Luftmassengrenzen kommt es vorher oftmals zu Gewittern mit Unwetterpotenzial. Auch das haben wir in der letzten Zeit hier in Deutschland erlebt. An der Schafskälteregel ist also wirklich etwas dran. Können Frösche das Wetter vorhersagen? Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Da man mich bisweilen als Wetterfrosch des Distriktes bezeichnet, bietet sich die Frage an: Können Frösche wirklich das Wetter vorhersagen? Man sagt ja von Fröschen, die in einem Einmachglas mit Leiter gehalten werden, folgendes: Wenn die kräftig quaken, soll es Regen geben, und wenn sie die Leiter hochsteigen, wird das Wetter schön. Diese Geschichte hat allerhöchstens nur einen wahren Kern, was das Klettern des Frosches angeht. Laubfrösche, die im gewässernahen Gebüsch leben, finden bei feuchter Witterung genügend Nahrung am Boden. Wenn es trockener ist, krabbeln die Insekten höher auf die Blätter und Gräser hinauf, und auch der Frosch muss dann höher hinaus, um sich seine Nahrung zu sichern. Aber so ist das Klettern lediglich ein Zeichen dafür, wie das Wetter ist und nicht, wie es einmal wird. Für einen Frosch in einem Einmachglas ergibt dies wohl kaum einen Sinn. Wenn er die Leiter hinauf klettert, dann wahrscheinlich vor allem in der Hoffnung, seinem nicht artgerechten Gefängnis zu entkommen. Ich kenne keinen Wissenschaftler, der einen Zusammenhang zwischen Froschverhalten und der zukünftigen Wetterentwicklung festgestellt hat. Nicht nur die Abergläubischen unter ihnen, sondern auch alle anderen dürfen mich aber weiterhin Wetterfrosch nennen. Dies ist nach dreißig Jahren inzwischen sowieso schon ein Gewohnheitsrecht. Wie entsteht ein Regenbogen? Wer einen Regenbogen sehen will, braucht Sonne und Regen. Aber es geht auch bei gutem Wetter. Dann muss man den Regen selber machen. Man nehme: einen Schlauch und eine feine Düse. Wenn jetzt die Sonne genau im Rücken steht, dann sieht man ihn vor sich: den "künstlichen" Regenbogen. Der Vorteil bei einem künstlichen Regenbogen: Man kann versuchen, um ihn herum zu gehen. Dann sieht man: Der Regenbogen wandert mit dem Beobachter mit. So ist das natürlich auch beim Regenbogen unter den Wolken. Zum Regenbogen gehören die Farben. Ganz außen schimmert Rot. Dann geht es nach innen über Gelb, Grün, Blau zu Violett. Viele haben sich an der Erklärung versucht, aber erst Decartes und Newton fanden vor 300 Jahren die Lösung: Das weiße Sonnenlicht wird im Wassertropfen in seine verschiedenen Farben zerlegt. Rot außen und Violett innen. Der Regenbogen trägt seinen Namen zu Recht. Er ist tatsächlich ein Kreisbogen. Nur die Tropfen, von denen aus das Licht in einem bestimmten Winkel (42 Grad) auf die Augen des Betrachters trifft, bilden den Bogen, und deshalb wandert er auch mit dem Betrachter mit. Die verschiedenen Farben liegen haargenau nebeneinander, jede auf ihrem Kreisbogen. Wenn überall Regen ist (z.B. vom Flugzeug aus gesehen), dann wächst der Regenbogen zu einem Regenkreis. Von weitem betrachtet ist der Bogen genau genommen ein Kegel. In der Spitze liegt das Auge des Betrachters. Wer nicht darauf warten will, bis das Wetter seine Kapriolen schlägt und Regen und Sonne zugleich serviert, der kann es machen, wie zu Beginn beschrieben: sich seinen Regenbogen selber bauen. Jeder von uns hat, bedingt durch den Winkel zum Licht und zu den Wassertröpfchen, seinen ganz persönlichen Regenbogen. Wandert man zu der Stelle, wo der Regenbogen den Boden berührt, so bleibt der Bogen vor unseren Augen stehen, solange sich noch Tröpfchen in der Luft befinden, die von der Sonne beleuchtet werden. Dabei können die Tröpfchen 10 Meter oder 10 Kilometer von uns entfernt sein. Die Entfernung der Tröpfchen spielt überhaupt keine Rolle, es kommt nur auf ihren entsprechenden Winkel von 42 Grad an. Manipulierbares Wetter? Vor kurzem las ich die Meldung, dass man in Moskau anlässlich der großen Militärparade düstere Wolken in der Umgebung habe künstlich abregnen lassen, damit das Ereignis nicht durch "Segen" von oben beeinträchtigt würde. Seit Jahrtausenden träumen die Menschen davon, das Wetter beeinflussen zu können. So ließe sich nach einer langen Dürreperiode endlich Regen herbeiführen. Solche Versuche gibt es bis in die heutige Zeit. Die ersten Versuche, mit technischen Mitteln auf das Wetter einzuwirken, gab es in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Es handelt sich im Grunde dabei immer um das gleiche Prinzip: Man versucht, durch das Ausstreuen von Partikeln, an denen sich das Wasser niederschlägt, also durch so genannte "Kondensationskerne", entweder Wolken zu erzeugen oder bereits bestehende Wolken dazu zu bringen, ihre Wasserfracht als Regen abzuwerfen. Als Kondensationskeime benutzt man vor allem Silberjodid und Trockeneis (gefrorenes Kohlendioxid). China und Russland wenden jene Verfahren bis heute in größerem Maßstab an. So schießt man Raketen mit Silberjodid in Wolken, um sie über trockenen Regionen zum Abregnen zu bringen. Es gibt bereits Streit zwischen verschiedenen Regionen, die sich gegenseitig des "Regendiebstahls" beschuldigen. In Russland ist die Regenmacherei ein Überbleibsel aus der Zeit des Kommunismus. Noch immer werden vor den großen Paraden, die zu den Jahrestagen der Oktoberrevolution und des Sieges über die Nazis sowie zum 1. Mai stattfinden, die Wolken "behandelt". Tatsächlich finden die Paraden selten bei Regen statt. In des USA ist die Wettermacherei fast vollständig in privater Hand - Firmen bieten ihre Dienste an, etwa um Nebel in Flughafennähe zu beseitigen oder die Größe von Hagelkörnern in Gewitterwolken zu reduzieren. Das Problem bei all diesen Maßnahmen lautet: Ihre Wirksamkeit ist schwer zu beweisen. Wenn das gewünschte Ziel erreicht wird und eine Wolke abregnet - wer sagt dann, dass sie das nicht sowieso getan hätte. Denn natürliche Kondensationskeime sind stets in mehr oder weniger größerer Zahl in der Luft vorhanden, wie z.B. Ruß-, Staub- oder Salzteilchen. Wir verfügen nämlich bis heute nicht über langfristige Auswertungen der Versuche. So bleibt die Wettermacherei noch immer eine Glaubenssache. Es fehlen die Beweise. Neben jenen lokal eng begrenzten Versuchen des Menschen, das Wetter regional zu manipulieren, was keinerlei globale Auswirkungen hat oder hätte, stehen wir heute direkt vor einer weltweiten Klimabeeinflussung, wobei die Rolle des Menschen noch immer nicht klar ist. Nach dem letzten internationalen Klimabericht der UN von 2007 scheint sich die "Schuld" des Menschen am Klimawandel wieder ein Stückchen mehr zu erhärten. Jörg Kachelmann zum Beispiel gibt dem Menschen tatsächlich bereits die Schuld angesichts der folgenden Kernaussagen dieses Berichtes: Seit 20 000 Jahren hat es keinen so steilen Temperaturanstieg gegeben. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird es noch einmal um etwa drei Grad wärmer. Natürliche Schwankungen als Ursache für die Erwärmung sind praktisch auszuschließen. Mit Unsicherheiten behaftet sind noch immer Aussagen darüber, wie sich das Klima in den einzelnen Regionen der Erde entwickelt. Der nächste Winter kommt bestimmt.... Kalt ist aber nicht gleich kalt Ein kalter Winter bezieht seine Luftmassen natürlich aus polaren Regionen. Polare Luftmassen treten in drei unterschiedlich temperierten Varianten auf, und diese erwerben unterwegs - ob über Land oder Meer geführt - ihre kontinentalen oder maritimen Eigenschaften. Somit gibt es sechs verschiedene polare Luftmassen über Mitteleuropa. Auf der anderen Seite beteiligen sich ebenfalls sechs verschiedenartige subtropische Luftmassen am Wettergeschehen, insgesamt also 12 unterscheidbare Luftmassen in unseren Breiten. Bleiben wir heute bei den polaren Luftmassen. Am markantesten und am leichtesten zu erkennen ist die "nordsibirische Polarluft", die uns die strengste Kälte bringt. Sie entsteht in klaren Nächten und bei hohem Luftdruck über den weiten Flächen Sibiriens und überflutet in manchen Hochwintermonaten mit ihrem eisigen Atem ganz Mitteleuropa. Etwas weniger kalt ist die "russische Polarluft", die aus den Weiten Mittelrusslands stammt. Beide Luftmassen sind sehr trocken und trotz ihrer Kältegrade ganz gut zu ertragen, also auch in biologischer Hinsicht recht günstig. Die Wirkung des meist böigen Windes erhöht jedoch das Kälteempfinden des Menschen beträchtlich. Aus dem hohen Norden strömt sie sog. "arktische Polarluft" sehr kalt und feucht nach Mitteleuropa. Ihre Wetterwirksamkeit äußert sich in Niederschlägen, die oft schauerartig auftreten. Dazwischen ist diese Luftmasse sehr klar und beschert uns in den Winternächten den imposantesten Sternenhimmel. Die Alpen bilden jedoch für die aus Norden heranströmende arktische Polarluft ein meist unüberwindliches Hindernis. So gibt es in Südbayern kräftige Staubewölkung mit langanhaltenden Niederschlägen. Als nächstes wäre die "grönländische Polarluft" zu erwähnen, die von Nordwesten nach Mitteleuropa hineinströmt und die Eigenschaften der arktischen Polarluft in minder krasser Form aufweist. Sie tritt relativ häufig auf und spielt bei uns eine recht dominierende Rolle im Wettergeschehen. Die kalten Luftmassen aus dem Norden können beim Überqueren des Atlantiks oder des weiten russischen Kontinentes ihre ursprünglichen Eigenschaften weitgehend verlieren. Ehemals polare Luftmassen strömen dann z.B. von Westen her "erwärmt und feucht" heran, oder von Osten "erwärmt und trocken". Dabei ist der aus Südosten kommende Anteil der "rückkehrenden Polarluft" gering. Bedeutend für unser mitteleuropäisches Wetter ist jedoch der Anteil der aus dem Westen zu uns gelangenden "erwärmten Polarluft". Der hohe Feuchtigkeitsgehalt der erwärmten Polarluft verursacht die große Unbeständigkeit der mit ihrem Heranströmen verbundenen Wettervorgänge. Der Nordost-Atlantik, nördlich der Azoren, ist dann die Heimat der echten Meeresluft, deren Einfluss vor allem die Britischen Inseln unmittelbar und überwiegend unterliegen. Sie sehen also: Kaltluft ist nicht gleich Kaltluft. Neben der "arktischen Polarluft" gibt es auch noch die erwähnten anderen Arten, die ich zum Schluss noch einmal nenne: Die nordsibirische, die russische und die grönländische Polarluft, dann noch die rückkehrende und die erwärmte Polarluft. Die mitteleuropäische, also hausgemachte Festlandsluft, kann natürlich im Winter ebenfalls nur kalt sein. Sie ist meist trocken. Die Unterscheidungsmerkmale der angeführten kalten Luftmassen beziehen sich auf ihre Temperaturen, also ob sie extrem kalt, sehr kalt oder nur kalt sind, - und auf ihre Feuchtigkeit, ob sie eher trocken oder feucht sind. Für die subtropischen Luftmassen gibt es natürlich ebenso unterschiedliche Merkmale. Vielleicht darüber mal etwas im nächsten Sommer. Die "Kleine Eiszeit" Jeder recht lange und kalte Winter erinnert mich daran, dass erst vor 150 Jahren in Europa ein 500 Jahre währender Kälteeinbruch zu Ende ging, dem man als "Kleine Eiszeit" bezeichnet. Sie war die jüngste von drei relativ kalten Kälteeinbrüchen während der letzten zehntausend Jahre. Sie war eine Periode konstanter und manchmal bedeutender klimatischer Wechsel zwischen heißen Sommern und frostigen Wintern. Wie der Pazifik unterliegt auch der Atlantik eigenen Druckschwankungen. Wir kennen ja das große Druckgefälle zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch. Wenn dieses Gefälle groß ist, bringt es viel Regen, starke Weststürme und wärmere Temperaturen. Bei geringerem Druckgefälle kommen kalte Jahre. Man spricht hier von der "Nordatlantischen Oszillation", die unser Wetter großräumig beeinflussen kann. Die "Kleine Eiszeit" über vier Jahrhunderte hat gezeigt, wie langfristige Klimaschwankungen den Lauf der Geschichte sowohl allmählich als auch plötzlich zu ändern vermögen. Auf dem Höhepunkt der "Kleinen Eiszeit" zwischen 1550 und 1700 waren die mittleren Temperaturen 1,2 bis 1,4 Grad niedriger als die der mittelalterlichen Wärmeperiode. Was die "Kleine Eiszeit" ausgelöst hat, ist bis heute eine strittige Frage. Jene Kälteperiode ist jedoch gerade für das Verständnis des heutigen Klimawandels enorm wichtig, denn sie erstreckte sich zwischen sechs Jahrhunderten der jüngeren Geschichte, als die von Menschen verursachte globale Erwärmung noch keine Rolle spielte. Wahrscheinlich hatte auch eine Phase beachtlicher vulkanischer Ausbrüche der damaligen Zeit zusammen mit einer etwas schwächeren Sonneneinstrahlung einen Einfluss darauf. Es gibt Hinweise, dass sich die periodisch wiederkehrenden Veränderungen im Sonnenmagnetfeld auch direkt auf das irdische Klima auswirken könnten. Denn ist beispielsweise das Feld schwach, trägt unser Stern kaum Flecken, strahlt dann aber auch insgesamt etwas weniger hell. Die berühmteste dieser Perioden begann 1645 und endete zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Noch länger dauerte von 1420 bis 1530 das sog. "SpörerMinimum". Und zusammen korrelieren beide Perioden erstaunlich gut mit jener Ära, die Klimaforscher als die "Kleine Eiszeit" bezeichnen, weil es in Europa so kalt wurde, dass sogar die Lagune von Venedig im Winter regelmäßig zufror. Seit 1940 erweist sich das solare Magnetfeld dagegen wieder als ausgesprochen aktiv und beeinflusst nach neueren Erkenntnissen womöglich sogar die globale Klimaerwärmung. In den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts gab es lange Perioden strengen Winterwetters, unterbrochen von sehr trockenen, heißen Sommern und außergewöhnlich nassen Frühjahren und Herbsten. Um 1500 waren die europäischen Sommer um sieben Grad kälter als in der Mittelalterlichen Wärmeperiode. Die kalten Jahrhunderte endeten um 1850, auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution. Die Erde trat in eine neue wärmere Ära mit weniger extrem klimatischen Schwankungen ein, die offensichtlich ausschließlich von natürlichen Faktoren ausgelöst wurde. Die Erwärmung setzt sich bis heute fort, nur gelegentlich durch kühlere Episoden unterbrochen. Die drei strengen Winter von 1939 - 1942 schadeten Hitler in Frankreich und Russland. Zwischen 1940 und 1975 kühlte sich das Weltklima trotz steigender Kohlendioxidwerte ganz geringfügig ab, was sofort zur Diskussion über eine bevorstehende Eiszeit führte. Seit den siebziger Jahren setzte sich die Erwärmung wieder fort. Klimatologen berichteten, dass 1997 das wärmste Jahr des 20. Jahrhunderts gewesen war und von 1998 wohl noch übertroffen würde. Inzwischen sind diese Meldungen bereits überholt. Inwieweit diese Erwärmung auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe und andere menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist, ist immer noch Gegenstand einer kontroversen Diskussion. Vielleicht ist eine erneute kleine Eiszeit jetzt weniger wahrscheinlich, als es sie gewesen wäre, wenn die Nutzung fossiler Brennstoffe im 20. Jahrhundert nicht so dramatisch gestiegen wäre. Aber das heißt nicht, dass eine weitere "Kleine Eiszeit" unmöglich wäre. Die zahlreichen Märchen, in denen von Schnee, Eis und Kälte die Rede ist, sind entsprechend alt und in der damaligen "Kleinen Eiszeit" irgendwann entstanden und weitererzählt worden. Sie belegen wenig "Märchenhaftes", sondern bittere Realität, wenn man sich in Erinnerung ruft, welche Perioden steter Hungersnöte, Ernteausfälle und Entbehrungen mit der kalten Zeit verbunden waren. Es kam sogar soweit (nur ein Beispiel), dass schottische Hochlandbewohner ihr Brot aus Baumrinde herstellen mussten. Der Hunger verursachte zudem manche gesellschaftliche Verwerfungen und nicht zuletzt trugen die massiven Ernteausfälle auch zu den Unruhen bei, die zur Französischen Revolution führten. Die Kleine Eiszeit war die jüngste von drei relativ langen Kälteperioden während der letzten zehntausend Jahre. Die erste Dryaszeit, die den Ackerbau in Südostasien ausgelöst hat, war die strengste, denn sie brachte die Vergletscherung zurück nach Europa. Ein weiterer Kälteeinbruch um 6200 v. Chr. dauerte vier Jahrhunderte an und verursachte große Dürren. Die Kleine Eiszeit hatte einen größeren Einfluss auf die Geschichte als ihre beiden Vorgänger, denn sie ereignete sich nach Jahrhunderten von ungewöhnlich warmen Temperaturen. Man kann sie mit Recht die Mutter aller geschichtsverändernden Ereignisse nennen. Bauernregeln In meinen Funkwetterberichten habe ich schon häufig sog. "Bauernregeln" zitiert. Man kann durchaus sagen, dass diese Sprüche als Teil der Kulturgeschichte unseres Volkes bis auf den heutigen Tag von ihrer Faszination und Aktualität nichts eingebüßt haben. Jene Wetter- und Klimaregeln orientieren sich dabei an den vielfältigen Wetterzeichen wie Wind, Wolken und optischen Erscheinungen, die Vorboten einer bestimmten Wetterentwicklung sind. Mit solchen Regeln lässt sich in vielen Fällen eine recht gute Wetterabschätzung durchführen. Recht gute Wetterprognosen bis zu 6 Tagen mit einer Trefferquote von rund 75% leisten auch heute noch wie in früherer Zeit z.B. Schäfer und manche Landwirte. Das ausgezeichnete Wissen unserer Vorfahren über das Klima ihrer Heimat kommt in den kalendergebundenen Klimaregeln zum Ausdruck. Auch wenn sich das Wetter nicht an ein bestimmtes Kalenderdatum hält, so gibt es doch in den einzelnen Monaten ganz charakteristische Wettererscheinungen, sog. "Singularitäten", wie die "Schafskälte" oder den "Altweibersommer". Ohne jede Möglichkeiten einer quantitativen Messung wurden diese anerkannt und in Form der Klimaregeln von Generation zu Generation weiter gegeben. Den jeweiligen "Lostag" darf man dabei nicht zu eng sehen. Er hatte in erster Linie einen Merkcharakter. Abweichungen von mehreren Tagen liegen in der Natur der Sache, teilweise auch in der gregorianischen Kalenderreform, die alle Termine um ca. 12 Tage nach hinten verschoben hat. Was jene "Bauernregeln" z.B. für die kalte Jahreszeit bieten, möchte ich nun erläutern. "Geht Barbara (4. Dezember) im Grünen, kommt das Christkind im Schnee." "Ist es an Weihnachten kalt, ist kurz der Winter, das Frühjahr kommt bald." "Ist es auf Weihnachten gelind, sich noch viel Kälte einfindet." "Dezember veränderlich und lind, der ganze Winter wird ein Kind." Diese Bauernregeln besagen eigentlich nur: fällt der Dezember zu warm aus, so ist mit relativ großer Wahrscheinlichkeit (67%) auch ein zu warmes Frühjahr zu erwarten. Umgekehrt folgt zu etwa 60% ein zu kalter Frühling, wenn der Dezember zu kalt war. Ziemlich sicher sind Klimaregeln: "Wenn der Tag beginnt zu langen, kommt der Winter erst gegangen." "Werden die Tage länger, wird der Winter strenger." "Januarsonne hat weder Kraft noch Wonne." Nach der Wintersonnenwende am 22. Dezember werden die Nächte wieder kürzer und die Tage länger, doch danach beginnt erst der Hochwinter mit seinen niedrigen Temperaturen. Was nicht jeder weiß: Unsere Sonne erreicht hier am Niederrhein am 8. Dezember ihren tiefsten Stand, also nicht erst am 22. Allerdings steht sie dann bis Ende Dezember weiterhin so tief, jedoch wird es bis zum 22. Dezember an jedem Morgen etwas später hell. Der Tageswind Vielleicht haben Sie bei der derzeitig oftmals sehr ruhigen Hochdruckwetterlage schon einmal bemerkt, dass der Wind einen typischen Tagesgang hat. Wenn es nachts klar oder nur leicht bewölkt ist, kühlt sich der Erdboden mit der darüber liegenden Luftschicht stark ab. Da die Luft jedoch am Vortage bis in eine beträchtliche Höhe erwärmt wurde, bildet sich die bekannte Bodeninversion aus. Diese verstärkt sich in der Nacht und erreicht ihre größte Ausprägung etwa um die Morgendämmerung Die Inversion bewirkt die Ausbildung einer Sperrschicht für die darunter liegende Luft. So lässt der Wind unterhalb der Inversion nach, während er darüber zum Ausgleich zunimmt. Die Bildung der Inversion setzt bereits gegen Abend ein. So lässt der Wind schon zu jener Zeit nach und "schläft" nachts ganz ein. Auch am frühen Vormittag weht der Wind noch sehr schwach. Wenn jedoch die Sonne etwa 30° über dem Horizont steht, hat sie im Frühjahr - und erst recht im Sommer - genügend Energie, um die sog. "Thermik" in Gang zu setzen. Jene warmen Luftpakete steigen auf, werden anfangs noch durch die Inversion abgebremst, durchstoßen sie aber bald und lösen sich darüber auf. Ist die Luft feucht genug, erkennt man jene Thermik an einigen Kumuluswolken, die im Tagesverlauf meist anwachsen. Ist die Luft sehr trocken, besteht jene Thermik auch, wird "Blauthermik" genannt und ist somit unsichtbar. Nun kann der kräftigere Wind über der Inversion nach unten bis in Bodennähe vorstoßen. So wird der Wind am Vormittag bis zum frühen Nachmittag immer kräftiger und ist zunächst auch recht böig, wobei er seine Richtung oft wechselt. Einige Stunden nach dem Sonnenhöchststand ist der Wind an einem normalen Tag am stärksten. Kommt jedoch eine Absinkinversion mit ins Spiel, wird der vertikale Luftaustausch unterbunden und der Bodenwind bleibt auch am Nachmittag ruhig. Der Nachmittagswind wird allmählich zurückgehen, sobald die Inversionsbildung einsetzt. Das passiert etwa nach 17 Uhr. Dann lässt auch die Böigkeit des Windes rasch nach. Am Abend weht der Wind dann meist nur noch sanft und gleichmäßig. Er folgt nun auch recht "brav" den Konturen der Erdoberfläche, z.B. denen von Tälern und Hügeln. Vor allem als Radfahrer konnte man den Tageswind in der vergangenen Woche recht gut beobachten. Bis etwa 11 Uhr hatte der Radler keine Probleme mit dem Wind, doch ab Mittag musste er sich immer mehr auf böigen Gegenwind einstellen, dessen Richtung ziemlich variabel war. Zwischen 15 und 16 Uhr blies der Wind dann am stärksten. Am frühen Abend nahm er allmählich an Stärke ab, war jedoch als ständiger Begleiter beim Radfahren noch recht spürbar - recht gleichmäßig wehend. Kehrte man gegen 22 Uhr zurück, war es windstill. Ich konnte nur einige der vielen Variationsmöglichkeiten des Tageswindes erläutern, aber vielleicht haben sie doch zum grundsätzlichen Verständnis der Rhythmen des Windes bei ruhigem Hochdruckwetter beigetragen. Sturmtief und tropischer Sturm (Hurrikan, Taifun) Den Namen "Sturmtief" verdient erst eine Tiefdruckgebiet mit einem ausgeprägten Sturmfeld und sehr niedrigem, häufig 975 hPa unterschreitendem Luftdruck in seinem Kern. Das Sturmfeld ist der Bereich, in dem die Windgeschwindigkeiten 75 km/h überschreiten. Es liegt entsprechend der Wirbelstruktur des Tiefs ringförmig oder halbkreisförmig um eine windschwächere Kernzone und kann bei den Sturmtiefs unserer Breiten eine Ausdehnung von mehreren 100 km haben, wobei die höchsten Windgeschwindigkeiten im Bereich der Fronten und des nachfolgenden Troges vorkommen. Voraussetzung für die Entstehung eines Sturmtiefs ist das Vorhandensein unterschiedlich temperierter Luftmassen mit großen Temperaturunterschieden in der Vertikalen. Die Antriebsenergie erhält das Luftdruckgebilde durch eine feuchtlabile Schichtung seiner Luftmassen, also hauptsächlich durch die Wärmeenergie, die bei der Kondensation von Wasserdampf frei wird. Unter Sturm dürfen wir - streng genommen - nur einen Wind mit einer Geschwindigkeit zwischen 75 und 117 km/h bezeichnen. Das entspricht den Windstärken 9 bis 11. Weht es stärker, sprechen wir von Orkan. Es kommt häufig vor, dass sich die Zuggeschwindigkeit eines Sturm- oder Orkantiefs zu seiner Windgeschwindigkeit addiert. In jener Zone treten dann die höchsten Windstärken auf. Besonders zerstörerisch wirken sich bei einem Sturm oder Orkan die Böen aus, also die kurzzeitigen Schwankungen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung infolge der Luftturbulenz. Diese Sturm-, bzw. Orkanböen entstehen hauptsächlich zwischen einer vorrückenden Kaltfront und den nach oben ausweichenden wärmeren Luftmassen, oft in Verbindung mit Gewittern. Böigkeit des Windes kann aber auch durch Unebenheiten oder die ungleichmäßige Erwärmung der Erdoberfläche, durch die sog. Sonnenböigkeit, hervorgerufen werden und ist damit im allgemeinen über dem Land größer als über dem Meer und in den unteren Luftschichten größer als in den oberen. Sie ist in der Regel in Kaltluftmassen stärker ausgeprägt als in Warmluft. Parallel zu den Berichten über die Sturmtiefs unserer Breiten wird in den Medien immer wieder über die tropischen Wirbelstürme in der Nähe des Äquators berichtet. Diese haben ja ein weitaus größeres Ausmaß an Wetterwirksamkeit zu bieten, was Niederschlagsmengen und Windgeschwindigkeiten betrifft, verglichen mit unseren "normalen" Sturm-bzw. Orkantiefs in Nord- und Mitteleuropa. Die hauptsächlichen Entstehungszeiten für tropische Stürme sind Mitte August bis Mitte Oktober, weil dann die Wassertemperaturen in den Ursprungsgebieten ihre höchsten Werte erreichen. Mindestens 27° sind dazu nötig. Erst ab derart hohen Temperaturen kann sich die Luft über dem Wasserspiegel mit der nötigen Feuchtigkeit anreichern, die zur Abgabe einer entsprechend großen "Kondensationswärme" erforderlich ist. Ein tropischer Sturm hat ganz andere Entstehungsursachen als ein Sturmtief unserer Breiten. Er beginnt recht harmlos mit einigen Wolkenballen (cloud cluster), die langsam anwachsen. Sie dürfen sich allerdings nicht direkt am Äquator, aber auch nicht zu weit davon entfernt befinden. Sie müssen in einer Zone liegen, in der die ablenkende Kraft der Erdrotation (Corioliskraft) gerade noch ausreicht, um die erwähnten dicken Wolkenhaufen in eine langsam Drehung um ein Zentrum zu versetzen. Dabei wird vermehrt latente Wärme durch Kondensation frei und die feuchten "Wärmeblasen" wachsen sich allmählich zu einem tropischen Tief aus. Jene nennt man in der Karibik und Nordamerika "Hurrikans", im asiatischen Raum heißen sie "Taifune" und im Indischen Ozean sind es die "tropischen Zyklone". Im Unterschied zu unseren Tiefdruckgebieten der gemäßigten Breiten haben diese Zyklone keine Warm- und Kaltfronten und auch keine so große horizontale Ausdehnung. Unsere bekannten Tiefdruckgebiete entstehen ja an der sog. "Polarfront", wo kalte und warme Luftmassen an der "Frontalzone" sehr nahe beieinander liegen. Die Entstehungsursache der tropischen Stürme ist hingegen das Freiwerden von Kondensationswärme bei entsprechend hohen Wassertemperaturen. Solche Stürme können daher bei uns nicht entstehen. Ein Hurrikan oder Taifun verliert sehr schnell an Energie, wenn er aufs Land zieht oder in Meeresgebiete mit niedrigerer Wassertemperatur kommt. Dann versiegt die feuchtwarme Energiequelle von unten. Über Land - wegen der verstärkten Reibung an der rauen Bodenoberfläche - kann ein solcher Sturm anfänglich durch das Abbremsen der Luft am Boden ähnliche Eigenschaften wie ein normales Tief bekommen, da Luft vermehrt in Richtung Zentrum strömt, also ins Zentrum hinein geleitet wird, wie das auch in unseren Breiten der Fall ist. Aber dieser Effekt ist nicht sehr dynamisch und führt meist nur kurzfristig zu einer Verstärkung von Niederschlagsneigung. Tropische Stürme wandeln eigentlich "nur" diejenige Wärme, die durch Kondensation in den gewaltigen Wolkentürmen erzeugt wird, - angestoßen durch den Drehimpuls der ablenkenden Erdbe-schleunigung - in Bewegungsenergie um, beziehen ihre Energie also nicht wie normale Tiefdruckgebiete unserer Breiten aus horizontal unterschiedlichen Lufttemperaturen. Daher gibt es in ihrem Bereich, nochmals gesagt, keine Kalt- und Warmfronten. Ihren Drehimpuls können die tropischen Stürme jedoch oftmals auch nach Abschwächung noch so lange behalten, bis daraus die Entstehung eines "normalen" Tiefs begünstigt wird, das dann in der Westdrift z.B. nach Island und Skandinavien zieht. Das sind dann die sog. "Ex"Hurrikans aus Amerika, die als Tiefdruckgebiete unter ihrem alten Namen bei uns auf unseren Wetterkarten erscheinen. Ihr Einfluss auf unser Wetter in Mitteleuropa ist nicht zu unterschätzen. So können sie manchmal ganz schön "mitmischen", wie sich unser Herbst gestaltet. Sie können sogar den "Altweibersommer" einleiten, je nachdem, wo sie positioniert sind, denn zum Ausgleich muss ja irgendwo ein Hoch entstehen. Ja, man sieht daraus, für das Wettergeschehen ist unsere Erde relativ klein und begrenzt. So können sich "ferne" Ursachen noch ganz nah bei uns auswirken und die Gestaltung unseres Tages wettermäßig mitbestimmen. Jedoch werden wir hier bei uns mit Sicherheit niemals einen Hurrikan erleben. Tiefdruckgebiete mittlerer Breiten Zwischen 40° und 60° nördlicher Breite erstreckt sich die sog. "Westwindzone". Tiefdruckgebiete, die sich dort aufhalten und einen Durchmesser von 1000 km und mehr haben, transportieren kalte Luft südwärts und als Ausgleich dafür einige hundert bis einige tausend km weiter östlich, warme Luft nordwärts. Sie bewirken daher den Wärmeausgleich zwischen den kalten subpolaren und den warmen subtropischen Luftmassen. In den Zonen eines Tiefs entstehen die sogenannten "Fronten", das sind relativ schmale Wolken- und Niederschlagsbänder. Durch die Temperaturunterschiede an den Fronten wird die wärmere Luft in den meisten Fällen gehoben. Dabei kühlt sie sich ab und bildet Wolken und Niederschlag. Die trockenere Kaltluft sinkt meistens ab. Daher kommt es, dass das Wetter im kalten Bereich des Tiefs oftmals etwas freundlicher ist. Wenn die Kaltluft die Warmluft verdrängt, spricht man von einer "Kaltfront", im umgekehrten Fall von einer "Warmfront". Im Bereich der Fronten sind die Wettererscheinungen deshalb so markant, weil die Luftmassen dort "verwirbeln". Sie befinden sich in einer frontalen Übergangszone. Das verflixte Sommerwetter Leider können wir nicht rechtzeitig vorhersagen, was die Urlauber an den deutschen Küsten meist brennend interessiert: wie wird das Sommerwetter dort? Unser deutsches Sommerwetter ist und bleibt verflixt, nämlich unberechenbar und bisweilen ärgerlich. Woran liegt das eigentlich? Mit dem herannahenden Sommer bildet sich über dem riesigen asiatischen Festland, also auch in Osteuropa, ebenfalls wie über den Azoren eine recht verlässliche Hochdruckzone. Diese beiden, um mehrere tausend Kilometer getrennten, mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretenden Hochdruckgebiete des Frühsommers bilden nun eine jener Formen, welche die Umschaltung des Winterwetters auf das Sommerwetter kennzeichnen. Es hängt alles davon ab, ob diese beiden Hochdruckgebiete sich vielleicht zu einer Hochdruckbrücke vom mittleren Atlantik quer über Europa hinweg bis nach Russland verbinden. Die Entscheidung, ob sich eine solche Brücke mehr oder minder stark ausgeprägt bildet, fällt etwa gegen Monatswechsel von Juni zu Juli, also um den Siebenschläfer herum. Stellen Sie sich ein Hochdruckgebiet wie einen Berg und einen Hochdruckrücken wie ein langgestrecktes Gebirge in der Luft vor. Die Tiefdruckgebiete, die von Island und England her in Richtung Mitteleuropa unterwegs sind, müssen dabei wie Kugeln den Abhang eines solchen Rückens hinauf rollen. Wenn der Rücken hoch genug ist und die Wucht und Größe der Tiefdruckgebiete nicht ausreicht, können sie diesen Berg nicht durchbrechen und rollen wieder nach Nordwesten in Richtung Nordkap und Finnland zurück. In guten Sommern ist dieser Wall des Hochdruckrückens zwischen den Azoren und Westrussland so verlässlich und stark, dass im Juli und August die Tiefdruckgebiete vergeblich dagegen anrennen. Bei ständigem Hochdruckeinfluss mit Einstrahlung der hochstehenden Sonne haben wir Wochen lang große Hitze. Diese wird nur gelegentlich durch örtliche Gewitter unterbrochen und erreicht in den berühmten Hundstagen ihren Höhepunkt. In den meisten Sommern bildet sich dieser Hochdruckrücken aber nur zögernd. Wenn dann noch in schneller Folge kräftige Tiefdruckgebiete dagegen anrennen, wird er dauerhaft durchbrochen und kann sich von diesen Angriffen oft Wochen lang nicht erholen. Dann ziehen die Tiefausläufer in regelmäßiger Folge über Europa hinweg. Mit ihrer Linksdrehung wird Rückseitenkaltluft von der nördlichen Nordsee nach Süden verfrachtet. Wir haben dann unseren kühlen, regenreichen und sonnenarmen mitteleuropäischen Sommer. Niemand kann Ihnen also für das nächste Jahr den Rat geben, Ihren Urlaub an deutschen Küsten zu verbringen, da das Sommerwetter wohl gut ausfallen würde. Denn kein Meteorologe weiß heute schon, ob sich um den Siebenschläfertag herum diese für das Sommerwetter so kritische Hochdruckbrücke zwischen den Azoren und dem europäischen Russland aufbauen wird oder nicht. Wieso entsteht nun jene Hochdruckbrücke gerade zu dieser Zeit und nicht etwa auch im Winter? Dies hat mit dem Stand der Sonne zu tun, die zu unserem Sommerbeginn senkrecht über dem nördlichen Wendekreis steht. Der Gürtel der intensivsten Sonneneinstrahlung ist also dann vom Äquator aus 20 Grad nach Norden gewandert. Damit verschiebt sich auch die Tropenzone nach Norden. Die Subtropenzone tut das ebenfalls, wobei die Frontalzone der gemäßigten Breiten mit ihrem wechselhaften Wetter sich nach Norden verschiebt. Die nach Norden gewanderte Subtropenzone beschert den Mittelmeerländern wie Spanien, Italien und Griechenland ihre meist sehr schönen Sommer. Wenn Sie also wirklich Sonnenferien haben wollen, dann kann ich Ihnen jetzt schon für das nächste Jahr Kreta, Rhodos, Sizilien, die Türkei oder Tunesien als recht zuverlässig empfehlen. Die beständige Hochdruckzone der Subtropen liegt nämlich dann dort. Corioliskraft In meinen Beiträgen habe ich bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass unser Wetter - so wie wir es kennen - eine wesentliche Grundvoraussetzung hat. Dies ist die ablenkende Kraft der Erdrotation, die Corioliskraft. Wie entsteht sie eigentlich? Die Erde hat einen Durchmesser von etwa 12 000 km und einen Umfang von 40 000 km. Sie dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse, und zwar von West nach Ost. Das bedeutet am Äquator eine Geschwindigkeit von 40 000 km am Tag, also ca. 1 700 km pro Stunde. Je näher man zum Pol kommt, desto geringer wird der Erddurchmesser am Breitenkreis, dadurch wird auch der Erdumfang des jeweiligen Breitenkreises geringer, und die Geschwindigkeit, mit der sich die Erdoberfläche nach Osten bewegt, verringert sich ebenfalls, bis sie am Pol faktisch Null ist. Durch diese unterschiedliche Geschwindigkeit der Erdoberfläche wird jede Bewegung seitlich abgelenkt, und zwar auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links. Die Wirkung der unterschiedlichen Geschwindigkeit möchte ich an folgendem Beispiel verdeutlichen: Wird ein Gegenstand aus einem fahrenden Auto auf ein festes Ziel geworfen, fliegt er am Ziel vorbei. Der Gegenstand bewegt sich nämlich zusätzlich zu seiner Wurfgeschwindigkeit in Richtung Ziel auch mit der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges seitlich weg. Wirft man umgekehrt aus dem Stand einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto, so landet der Gegenstand hinter dem Fahrzeug, da sich das Fahrzeug während der Flugzeit des Gegenstandes weiterbewegt hat. Nach dem gleichen Prinzip wirkt sich die Corioliskraft auf Bewegungsvorgänge auf der Erde aus. Vom Weltraum aus erkennen wir unsere Erde als eine rotierende Kugel. Befindet sich der Nordpol oben, dann dreht sich die Erde nach rechts, also von West nach Ost. Würde jetzt ein Gegenstand am Äquator gestartet und zum Pol fliegen, dann bewegt er sich gleichzeitig mit der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde am Äquator, also 1700 km je Stunde nach Osten. Die Geschwindigkeit der Erdoberfläche wird jedoch wegen des abnehmenden Erdumfanges zum Pol hin immer geringer. Je weiter sich der am Äquator gestartete Gegenstand dem Pol nähert, desto mehr wird er der Erdoberfläche nach Osten voraus laufen. Das bedeutet auf der Nordhalbkugel eine Ablenkung nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links. Das gleiche gilt natürlich auch für ein sich bewegendes Luftpaket. Schickt man einen Gegenstand vom Pol zum Äquator, dann ist die Flugrichtung zum Äquator gerichtet ohne jede seitliche Ablenkung, denn am Pol ist die Geschwindigkeit der Erdoberfläche nach Osten kaum messbar. Je näher aber dieser Gegenstand zum Äquator kommt, desto größer wird der Erdumfang der Breitenkreise und damit die Geschwindigkeit der Erdoberfläche. Sie läuft immer schneller unter dem Gegenstand nach Osten weg und zwar umso schneller, je weiter sich der Gegenstand vom Pol nach Süden entfernt. Die Corioliskraft wirkt wegen der Kugelform der Erde je nach Entfernung vom Äquator unterschiedlich stark. Sie ist am Äquator am geringsten und am Pol am stärksten. Der Grund: Entfernt man sich ein Stück vom Äquator weg, dann ändert sich der Erdumfang und damit die Oberflächengeschwindigkeit der Erde nur wenig. Die Corioliskraft wirkt nur schwach. Das andere Extrem findet sich am Pol. Entfernt man sich die gleiche Strecke vom Pol, dann ist die Veränderung des Erdumfangs am größten, die Corioliskraft wirkt am stärksten. Zwischen diesen beiden Extremen gestalten sich die Übergänge gleitend. Ohne die ablenkende Kraft der Erdrotation, die Corioliskraft, gäbe es nicht die uns bekannten Hoch- und Tiefdruckgebiete, die unser Wetter entscheidend gestalten. Es gäbe auch nicht die dafür ursächliche mäandrierende Frontalzone mit ihren Strahlströmen, den Jetstreams. Ebenso nicht unser bekanntes planetarisches Windsystem mit den Passaten. Wahrscheinlich hätte sich das Leben auf unserer Erde erst gar nicht entwickeln können, wenn diese sich nicht wie ein Kreisel drehen würde. Hintergrundwissen zur Winterdiskussion in Europa Die Nordatlantische Oszillation (NAO) Unser Klima über dem Nordatlantik und hier in Europa wird sehr stark durch die Nordatlantische Oszillation bestimmt. Es handelt sich dabei um eine interne Klimaschwankung, die schon seit vielen Jahrzehnten bekannt ist. Sie wurde bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts beschrieben. Es handelt sich dabei um eine "Luftdruckschaufel" zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch. Dadurch wird die Stärke der Westwinde in jener Region bestimmt. Ein einfach zu messender Index ist die Druckdifferenz zwischen Lissabon und Island. Ein hoher NAO- Index steht für ein anomal starkes Islandtief und ein anomal starkes Azorenhoch. Ein niedriger Index ist durch ein anomal schwaches Islandtief und ein anomal schwaches Azorenhoch charakterisiert. Seit 1860, dem Beginn der Luftdruckmessungen an beiden Stationen, kann man ausgeprägte Schwankungen im Abstand von durchschnittlich zehn Jahren feststellen. So wurden Anfang des 20. Jahrhunderts relativ hohe Werte gemessen, aber in den 60-er Jahren erreichte der Index ein Minimum und stieg dann wieder relativ stark an. Dieser Anstieg trug beträchtlich zur Erwärmung der Nordhemisphäre im Winter in den letzten Jahrzehnten, insbesondere über Eurasien, bei. Auch die milden Winter in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sind auf die anomale Stärke der NAO zurückzuführen. Bis heute weiß man jedoch nicht, ob diese Intensivierung auch durch menschliche Einflüsse teilweise bewirkt wird oder bewirkt worden ist. Jene Druckschwingungen waren in den vergangenen 30 Jahren sogar von Jahr zu Jahr recht variabel. Die Veränderungen der NAO haben natürlich Auswirkungen für das Klima über dem Nordatlantik und Europa. So werden vor allem die bodennahe Temperatur und der Niederschlag über Europa stark durch die NAO geprägt. Die Sturmhäufigkeit über dem Atlantik ist ebenfalls eng mit der NAO korreliert. Hohe Werte gehen üblicherweise mit milden Temperaturen, erhöhten Niederschlägen und mehr Stürmen über Deutschland einher. Unser diesjähriger lang anhaltender extremer Frühwinter in Deutschland und Europa hat seinen Ursprung in einem aktuell relativ niedrigen Wert der Nordatlantischen Oszillation. Man sollte dies bei allen Diskussionen über den globalen Klimawandel nicht vergessen. Im Laufe dieser Woche stellte sich die europäische Großwetterlage um: In den vergangenen Wochen war die so genannte Nordatlantische Oszillation (NAO) negativ. Diese war also praktisch nicht vorhanden. Wetterbestimmend war die Konstellation Hoch Island/Skandinavien - Tief Azoren/Mittelmeer bei uns und mit nordöstlicher Strömung strömte immer wieder sehr kalte Polarluft nach Deutschland. Nun scheint sich wieder ein wintertypisches Strömungsmuster einzustellen. Atlantische Tiefausläufer griffen bereits ab Mittwochabend zunächst auf den äußersten Westen und Nordwesten unseres Landes über und erfassten zum Donnerstag von Westen her ganz Deutschland. Damit war eine deutliche Milderung verbunden. Das "Wunder von Cancún" Neue Chancen durch Kompromisse in letzter Sekunde Die Staaten der Welt haben gestern am Samstag ein schweres Trauma überwunden. Genau vor einem Jahr waren 120 Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen mit einem globalen Plan gegen die Erderwärmung gescheitert: Der Streit darüber, wer in den kommenden Jahrzehnten weniger Kohle, Öl und Erdgas verbrennt, wer seine Wälder besser schützt und wer seine Rinderherden verkleinert, endete im Crash der Klimaverhandlungen. Viele Beobachter folgerten, die Menschheit sei eben nicht fähig, kollektiv zusammenzuarbeiten. Sie erklärten den Multilateralismus, also das Zusammenwirken vieler Staaten, zum todkranken Patienten. Doch beim Endspurt des Klimagipfels von Cancún herrschte nun ein neuer und frischer Geist der Zusammenarbeit - ganz an-ders als damals in Kopenhagen. Der Multilateralismus ist aus dem Koma erwacht. Nachdem Ende Oktober schon der UnoNaturschutzgipfel mit einem Erfolg endete, ist es nun das zweite Lebenszei-chen. Offenbar saß das Trauma von Kopenhagen auch bei den neuen Großmächten China, Brasilien und Indien so tief, dass diese kein Interesse an einer neuen, destruktiven Machtdemonstration hatten. Die US-Regierung war nach den Enthüllungen durch Wikileaks bemüht, sich auf der Weltbühne nicht noch unbeliebter zu machen. Und auch die klassischen Entwicklungsländer setzten auf Kooperation statt auf Sabotage. Obwohl die UNO-Gipfel unter ihrem Gigantismus leiden, fanden die Unterhändler mit Ausnahme von Bolivien zur eigenen Überraschung einen gemeinsamen Kurs. Damit wird das Trauma von Kopenhagen wohl erfolgreich therapiert. Doch reicht das auch, um einen gefährlichen Klimawandel abzuwenden? Achim Steiner, der Chef des UnoUmweltprogramms Unep, hat in Cancún vorgerechnet, dass der Aus-stoß von Treibhausgasen sehr schnell seinen Höhepunkt erreichen und dann sinken muss, um den schlimmsten Risiken der Erderwärmung zu entgehen. Selbst wenn die Staaten die Reduktionen vornehmen, die sie nun bekräftigt haben, werden in den kommenden Jahren aber jährlich fünf bis zehn Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr zu viel in der Atmosphäre landen, warnte Steiner. Mehr also, als die Natur in Ozeanen, Böden und Pflanzen wieder aufnehmen kann. Das Gas bleibt in der Luft und speichert zusätzlich Sonnenenergie, die von der Erde abstrahlt. 2,5 bis 5 Grad Celsius Erderwärmung drohen. Eine Einigung in Cancún wurde eben auch möglich, weil weder für die USA noch für China noch irgendeinen anderen Staat konkret beziffert wurde, welche neuen CO2-Reduktionen bis wann verbindlich zu erbringen sind. Immerhin wurde das kol-lektive Ziel ausgelobt, dass die Industrieländer, die das Kyoto- Protokoll unterzeich-net haben, ihre Emissionen bis 2020 um 25 bis 40 Prozent reduzieren. Und auch die USA haben sich nun im Rahmen der Vereinten Nationen zu dem Ziel verpflichtet, die Erderwärmung unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu halten. Angesichts der existentiellen Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen, sind die konkreten Zusagen dafür aber noch viel zu unklar und unverbindlich - von ihrer Umsetzung ganz zu schweigen. Es bleibt eine schwierige, aber alternativlose Aufga-be, auf der nächsten Klimakonferenz im südafrikanischen Durban jenen Masterplan anzustreben, der damals in Kopenhagen gesucht wurde. Dieses Ziel aufzugeben, hieße zu riskieren, dass die Trendwende in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren nicht gelingt. Im Jahr 2014 werden die Wissenschaftler des Weltklimarats IPCC neu beziffern, wie stark die Emissionen sinken müssen, um die Erwärmung unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Spätestens dann wird sichtbar, auf was für einem gefährlichen Kurs die Menschheit auch nach Cancún ist. Ein zweiter Bereich, in dem es nennenswerte Fortschritte gab, ist die Geldfrage. Der Übergang von einer Infrastruktur, die verschwenderisch mit fossilen Brennstoffen umgeht, zu einer, die effizient von erneuerbaren Energien gespeist wird, kostet Geld. Bis 2012 sollen Entwicklungsländer insgesamt 30 Milliarden Dollar dafür bekom-men, ihre Wirtschaft mit modernen Technologien auszustatten - und so die Fehler des Westens nicht zu wiederholen. Bis 2020 sollen sogar 100 Milliarden Dollar jähr-lich mobilisiert werden. Das sind stolze Summen, bei denen sich mancher Amerikaner oder Europäer fragen wird, ob sie auch gerechtfertigt sind. Hier kommt auf die Regierungen des Westens eine große Aufgabe zu, ihren Bürgern zu erklären, dass Nicht-Handeln noch viel teu-rer käme - in Form steigender Ölpreise, humanitärer Probleme und wirtschaftlicher Schäden durch den Klimawandel. Erfreulich ist auch, dass der Cancún- Gipfel einen Rahmen geschaffen hat, wie Men-schen in waldreichen Gebieten dafür entlohnt werden, wenn sie den Naturreichtum erhalten statt ihn zu zerstören. "REDD" lautet das Uno-Kürzel für diese neue Form des Waldschutzes. Das Prinzip ist überzeugend: Wer die Waldzerstörung nachweis-bar gegenüber heute vermindert, bekommt für den erhaltenen Wald eine finanzielle Belohnung. Die Welt fängt damit endlich an, für ökologische Dienstleistungen zu bezahlen statt auf kostenlosen Raubbau zu setzen. Wäre nach Kopenhagen auch Cancún gescheitert, wären die internationalen Klima-schutzVerhandlungen womöglich wirklich am Ende gewesen. Die UNO und ihre Mitglieder haben diese letzte Chance zum Glück genutzt. Das ist aber kein Grund, sich nun beruhigt zurückzulehnen. Im Gegenteil geht jetzt vor allem jener "zweite Gipfel" los, von dem Unep Chef Achim Steiner in Cancún gesprochen hat - der per-manente Gipfel der Bürger, Firmen, Stadträte und Regierungen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Beschlüsse nicht nur umgesetzt, sondern am besten übertroffen werden. Von Cancún führt eine Spur in den Alltag jedes einzelnen. Die Menschen vor allem in den westlichen Ländern haben die Macht, weniger Auto und mehr mit öffentli-chen Verkehrsmitteln zu fahren, ihren Fleischkonsum zugunsten hochwertiger pflanzlicher Lebensmittel einzuschränken, in erneuerbare Energien zu investieren statt ihre Wohnungen mit fossilen Brennstoffen auf T-Shirt-Temperatur zu heizen. Zudem können sie Politiker dabei unterstützen, Steuergelder in Energieforschung statt in kurzfristigen Konsum zu investieren, in grüne Infrastruktur statt in weiteren Raubbau. So ließe sich demonstrieren, dass westlicher Wohlstand nicht heißen muss, den Pla-neten zugrunde zu richten. Neue, smartere Formen von Wohlstand sind möglich. Der globale Klimagipfel wird mit dem Happy- End in Cancún also erst beginnen. Der Uno-Klimaschutz war schon abgeschrieben, nun gibt es neue Chancen. Doch die Kompromisse von Cancún können nur ein Anfang sein. Es geht darum, den westlichen Lebensstil neu zu erfinden. Der Klimawandel Die populärsten Argumente der Skeptiker Das Klima hat sich schon immer geändert Stimmt, aber frühere Klimaänderungen beruhten auf natürlichen Ursachen, etwa Verschiebungen der Erdachse, und sie gingen viel langsamer vonstatten als heute. Den Temperaturanstieg der letzten Jahrzehnte können Wissenschaftler nur durch menschliche Einflüsse erklären: So führte etwa die massenhafte Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Freisetzung großer Mengen CO2, die in der Atmosphäre den natürlich Treibhauseffekt verstärken. Die Sonne ist schuld am Klimawandel Falsch. Zwar schlagen sich Veränderungen der Sonnenaktivität tatsächlich im Erdklima nieder. Nach Ansicht von Forschern ist aber nur ein Zehntel der heutigen Erderwärmung auf die Sonne zurückzuführen. Anderslautende Behauptungen halten einer Prüfung nicht Stand. Mindestens während der vergangenen 50 Jahre wurde dieser natürliche Faktor durch menschliche Einflüsse überlagert. Selbst eine Verdoppelung von CO2 in der Atmosphäre hätte nur eine Erwärmung um etwa ein Grad C zur Folge Eine geschickte Untertreibung. Die direkte Wirkung von zusätzlichem Kohlendioxid in der Atmosphäre ist zwar in der Tat begrenzt. Doch sein Anstieg löst zahlreiche indirekte Wirkungen, sog. "Feedbacks" aus. So steigt durch CO2 der Gehalt von Wasserdampf in der Atmosphäre, was starke, weitere Erwärmung bedeutet. Es wird auch mehr Wolken geben. Deren Wirkungen aufs Klima sind komplex. Wolken haben sowohl kühlende als auch wärmende Effekte, und Skeptiker betonen die Kühlwirkung. Doch die starken Klimaschwankungen der Erdgeschichte deuten darauf hin, dass die Feedback- Effekte insgesamt stark sind - und die Klimaskeptiker falsch liegen. Hohe CO2- Konzentrationen in der Atmosphäre traten früher nach einer Erwärmung auf. Kohlendioxid ist also Folge, nicht Ursache von Klimaerwärmung Dieses Argument beruht auf einer Vermischung urzeitlicher und moderner Phänomene. In Zyklen von Zehntausenden von Jahren erwärmte sich die Erde infolge orbitaler Veränderungen. Die so erwärmten Ozeane setzten mit einigen hundert Jahren Verzögerung große Mengen CO2 frei - was den Klimawandel dann weiter beschleunigte. Die gegenwärtige Situation ist grundlegend anders. Die zusätzlichen Treibhausgase in der Atmosphäre sind nachweislich vom Menschen verursacht und nicht Resultat einer vorherigen Erwärmung. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel Falsch. Natürlich gibt es auch beim Thema Erderwärmung Akademiker mit abweichenden Meinungen. Die Klimaskeptiker kommen meist nicht aus der Klimaforschung, sondern aus fachfremden Gebieten. Im Jahr 2009 ergab eine Umfrage der University of Illinois unter mehr als 3000 Geowissenschaftlern, dass rund 90 % von ihnen sicher sind, dass der Mensch das Klima aufheizt. Besonders groß war übrigens die Zustimmung unter Klimatologen. Bei Geologen aus der Erdölbranche betrugen sie nur 47 %. Allgemein gilt: Je informierter ein Forscher, desto besorgter ist er in der Regel über den Klimawandel. Seit 1998 erwärmt sich die Erde nicht mehr, der Klimawandel hat gestoppt Ein Trugschluss. Temperaturschwankungen zwischen einzelnen Jahren sind nur natürlich. Doch das Klima ist, salopp gesagt, der 30- jährige Durchschnitt des Wetters - und die Durchschnittswerte zeigen weiter nach oben. Das vergangene Jahrzehnt wirkt nur deshalb relativ kühl, weil 1998 das El- Nino - Phänomen die langfristige Erwärmung noch verstärkte und dies ein außergewöhnlich heißes Jahr war. Die folgenden fielen dahinter etwas zurück, aber insgesamt betrachtet war die vergangene Dekade erneut wärmer als das vorherige Jahrzehnt - und die war die wärmste jemals registrierte. Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass kalte Winter nicht im Widerspruch zum Klimawandel stehen. Forscher des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung haben erst vor kurzem gezeigt, wie die Erderwärmung in Europa kalte Winter zur Folge haben kann: In der östlichen Arktis schrumpft das Eis auf dem Meer. Dadurch aber werden regional die unteren Luftschichten wärmer. Das wiederum kann zu starken Störungen von Luftströmungen führen. Und diese Störungen können die Wahrscheinlichkeit des Auftretens extrem kalter Winter in Europa und Nordasien verdreifachen. Auch wenn wir zurzeit diesen kalten frühen Wintereinbruch haben, belegen die Daten, dass dieses Jahr 2010 aus globaler Sicht zu den drei wärmsten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1850 werden wird, vielleicht sogar das vorläufig heißeste Jahr. Dies hat die WMO (Welt - Meteorologieorganisation) gerade mitgeteilt. Computer- Wettermodelle (1) In den jüngsten drei Funkwetterberichten hatte ich über die verschiedenen Möglichkeiten der Wetterbeobachtung gesprochen, ohne die man zur Erstellung einer seriösen Wetterprognose nicht auskommt. Einmal ging es um die Wetterbeobachtungen unten am Erdboden in speziell dafür eingerichteten Wetterhütten, die ihre Messergebnisse heutzutage immer mehr automatisch weiterleiten, zum anderen um die Messungen von Wettergrößen im vertikalen Bereich, sowohl von unten nach oben wie von oben nach unten. Diese gewinnt man durch den Aufstieg von Wetterballonen sowie durch den Überblick der Wettersatelliten von oben. Zur Erstellung einer Wettervorhersage haben wir somit zur Verfügung: Satellitenbilder, Radarbilder, Wetterkarten mit aktuellen Messwerten am Boden, Wetterkarten mit aktuellen Messwerten aus der höheren Atmosphäre und Informationen über Blitzschläge in den Vorhersageregionen. Das wichtigste Hilfsmittel fehlt aber noch, das so genannte Computermodell. Dieses Modell ist ein mit physikalischen Gleichungen errechneter Entwurf, wie die Atmosphäre nach einer bestimmten Zeit aussehen müsste. Das Wetter gehorcht schließlich atmosphärischen Gesetzmäßigkeiten, wobei man entsprechende Formeln auf das gesamte Sammelsurium der gemessenen Wetterdaten anwenden kann und wobei jede Kenngröße Schritt für Schritt in die Zukunft hochgerechnet wird. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit auf der einen Seite, aber auch mit Fingerspitzengefühl und individuellem Geschmack werden pro Tag allein im ARDWetterstudio etwa zehn verschiedene Computermodelle errechnet. Doch bereits nach zwei Tagen kommt es oft zu ganz unterschiedlichen Lösungen. In solchen Fällen sprechen die Meteorologen dann von einer "unsicheren Wetterentwicklung". Die können sich aber auch für eine bestimmte Lösung entscheiden oder ein Mittel aus den unterschiedlichen Ergebnissen bilden. Wetterfrösche benötigen ein gewisses "Bauchgefühl", um die wahrscheinlichste Lösung bei den "weiteren Aussichten" zu finden. Warum aber sind die Computermodelle so unterschiedlich? Warum schmecken nicht alle Frikadellen gleich? Es liegt an der Rezeptur. So wie jeder Bulettenbrater sein eigenes Geheimnis hat - da ein Gewürz, dort etwas anderes Fleisch und am Schluss noch eine andere Grilltemperatur - gibt es auch Rezepturunterschiede bei den Computerwettermodellen. Zum Beispiel: Wann fange ich an zu rechnen nach den Wetterbeobachtungen? Sofort oder erst dann, wenn alle Nachzügler vom ohnehin kleinen Messnetz auf dem Meer da sind? Oder warte ich noch ab und korrigiere dafür offensichtliche Falschmeldungen von der Wetterfront? Wie groß ist die Maschenweite des Netzes, das ich über die Welt lege? Arbeite ich großmaschig und dafür schnell oder feinmaschig und langsamer? Wie kalkuliere ich eine schneebedeckte Landschaft ein? Wie die Wassertemperatur zum Beispiel der Nordsee? Jeder Wetterdienst hat für diese und andere Fragen eine eigene Antwort, und deswegen sind die Vorhersagen über 3 - 4 Tage hinaus oft so unterschiedlich. Soweit bis heute. Im nächsten Funkwetterbericht werde ich noch ausführen, warum die Computermodelle auch weiterhin nicht hundertprozentig sein werden, welche Chancen es aber dennoch gibt, diese zu verbessern und was man diesbezüglich bis heute schon erreicht und verbessert hat. Wetter- Computermodelle (2) Im Funkwetterbericht vor einer Woche sprach ich über das wichtigste Hilfsmittel zur Erstellung einer Wettervorhersage: das so genannte Wettercomputermodell. Ich erläuterte, warum diese Modelle bis heute noch immer so unterschiedlich ausfallen. Heute werde ich noch genauer ausführen, warum jene Modelle auch weiterhin nicht hundertprozentig sein werden, welche Chancen es aber dennoch gibt, diese zu verbessern und was man diesbezüglich bis heute schon erreicht und verbessert hat. Die ersten 24 Stunden differieren die Ergebnisse der Modelle nicht allzu stark. Für diesen Zeitraum benutzen die Meteorologen zudem ihre Fähigkeiten, das Wetter nach alten klassischen Methoden zu "machen": Sie sitzen vor der Wetterkarte mit aktuellen Meldungen, malen Isobaren und Fronten, die sie jede Stunde korrigieren. Es gibt noch zwei Dinge, warum die Computermodelle nicht hundertprozentig richtig sind. Zum einen ist das Wetterstationsnetz auf den Meeren nicht so dicht wie an Land, und jeder weiß, dass das Wetter ausgerechnet von dort am meisten kommt. Die Verhältnisse beim Atlantik sind zwar noch etwas besser als an der Pazifikküste von Nordamerika, wo das Wettergeschehen über drei Tage im Voraus bei West- Wetterlagen meist für eine Prognose unbrauchbar ist. Bei uns ist das erst nach 5 - 7 Tagen der Fall. Das zweite ist, dass sich die Atmosphärenphysik in ihrer ganzen Breite nicht in ein paar vereinfachende Formeln pressen lässt. Die Welt ist eben komplizierter und es kann auch dann noch zu Fehlern kommen, wenn die Ausgangslage sehr genau erfasst wurde. Die besten automatischen Prognosen und damit Hilfestellungen erzeugen Computermodelle in Zusammenhang mit den Beobachtungen einer Wetterstation. Dazu kombiniert man 5 Jahre Wetterkarte und 5 Jahre Beobachtungen einer Wetterstation und erhält eine Formel, welche Wetterlage bei jeder Station zu welchem Wetter führte. So ermittelt man die Eigenheiten eines Standortes viel besser als es das feinmaschigste Computermodell alleine könnte. Es handelt sich hierbei um ein statistisch verbessertes Modellverfahren, mit dem sich vor allem auch Unwetter künftig richtiger vorhersagen lassen. Dieses Modell hat sogar einen Namen bekommen: "Model Output Statistics". Hier ist ein Deutscher namens Klaus Knüpffer in der internationalen Forschung führend. Raten Sie mal, für welchen Betrieb dieser Forscher unter anderem auch arbeitet: für "Meteomedia" Jörg Kachelmann. Der Langfrist- Wetterbericht Kein Meteorologe wird weltweit von irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift gefragt, wie der Sommer oder der Winter wird. Das geschieht nur in Deutschland. Hier hat das meteorologische Institut der Freien Universität Berlin traurige Berühmtheit erlangt. Früher zu Recht gelobt wegen der praxisnahen Ausbildung seiner Studierenden, ist das Institut zu einer Verkaufsabteilung für seltsame Hoch -und Tiefnahmen und zum wissenschaftlichen Deckmäntelchen für Leute geworden, die mit Langfristvorhersagen experimentieren. Dass in diesem Bereich geforscht wird, ist gut, richtig und wichtig, aber es gilt das gleiche wie beim Biowetter: wir sind im Bereich der Monats- und Jahresvorhersagen am Anfang, nicht am Ende eines langen Weges. In der jüngsten Zeit hat der südkoreanische Wetterdienst mit guten Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht; alle Meteorologen verfolgen weltweit mit Spannung, wer zuerst eine brauchbare Formel entwickelt. Auf alle Fälle wird sie noch mindestens ein paar Jahrzehnte auf sich warten lassen, so dass man hoffen kann, dass eines Tages im Frühling die Journalistenfrage, wie der Sommer wird, nicht mehr kommt. Sie ist sinnlos, so wie jede Antwort unsinnig wäre. Nach 5 -7, als Trend 10 Tagen ist Ende der Fahnenstange. Wir erinnern uns: manche Wetterdienste haben Orkane wie "Lothar" oder "Anna" noch nicht einmal 12 Stunden vor Eintreffen korrekt vorhergesagt. Zusammenfassend können wir also sagen: wir müssen noch zig Jahre warten, bis wir zig Tage Wetter vorhersagen können. Vertikale Daten aus der Troposphäre Zusätzlich zu den Wetterstationen am Boden ist auch die Erforschung der Vertikalen in der Atmosphäre von großer Bedeutung. Seit Jahrzehnten sind dafür Radiosonden im Einsatz. Moderne Systeme, mit denen heute gearbeitet wird, sind technisch so weit entwickelt, dass nur das Füllen eines Ballons mit Wasserstoff, das Anhängen eines Fallschirms und der Start der Sonde Handarbeit bleiben. Seit der Nutzbarmachung des GPS -Systems ortet sich die Sonde selbst, was die aufwändige Ortung über Radar überflüssig gemacht hat. Der Ballon platzt erst in etwa 25-30 km Höhe, dringt also weit in die Stratosphäre vor. Radiosondierungen sind in der Meteorologie messtechnisch sehr spannend. Am Bildschirm folgt die unmittelbare Erfahrung, wie 30 km Atmosphäre über einem aussehen. Inzwischen gibt es auch andere Möglichkeiten, die Atmosphäre vertikal auszumessen, diese Instrumente heißen Radiometer und werten die Mikrowellenstrahlung in der Atmosphäre aus, die sich je nach Feuchtigkeit und Temperatur verändert Eine Kombination zwischen der Messung am Boden einerseits und dem Ziel, die gesamte Troposphäre, also die Wetterschicht in der Atmosphäre, andererseits zu vermessen, bietet das Radar. Hier geht es vor allem um die Erfassung des Niederschlags in der Atmosphäre (Radarstrahlen werden durch Regentropfen und Schneeflocken reflektiert), aber auch Windgeschwindigkeiten können durch besonders ausgerüstete Radarstationen ausgewertet werden. Das umgekehrte Prinzip, also nicht den Blick von unten nach oben, sondern von oben nach unten, verfolgt die Arbeit mit Wettersatelliten. Hier muss man die geostationären von den umlaufenden Satelliten unterscheiden. Um einen schönen Satellitenfilm jede halbe Stunde im Fernsehen zeigen zu können, muss der Satellit an derselben Stelle stehen. Das ist in 36.000 km Höhe der Fall, aber der Satellit ist dadurch ziemlich weit weg, um eine sehr gute Auflösung des Satellitenbildes hinzubekommen. Für Bilder mit hoher Auflösung sind deswegen die umlaufenden Satelliten zuständig - umlaufend deshalb, weil sie in ihrer Aufnahmehöhe von rund 700 km Höhe eben keine fixe Position über einem Punkt der Erde einnehmen, sondern einen Ort in unregelmäßigen Abständen und aus unregelmäßigen Richtungen mehrfach pro Tag überfliegen. Man sieht zwar jeden Fluss und jeden See, aber eben nicht jede halbe Stunde. Als zusätzliches Hilfsmittel für den meteorologischen Arbeitsplatz ist schließlich das BLIDSSystem zu erwähnen, dass ernst zu nehmende Blitzeinschläge registriert und uns hilft, die Intensität eines Gewitters unter dem Aspekt der Elektrizität zu bewerten. Wir resümieren: zur Erstellung einer Wettervorhersage hat der Meteorologe Satellitenbilder, Radarbilder, Wetterkarten mit aktuellen Messwerten am Boden, Wetterkarten mit aktuellen Messwerten aus der höheren Atmosphäre und Informationen über Blitzschläge in der Vorhersageregion. Ein äußerst wichtiges Hilfsmittel fehlt aber noch: das so genannte Computermodell. Darüber mehr in einem weiteren Beitrag. Wie eine moderne Wetterstation arbeitet Die Existenz von Wetterstationen ist die größte Gemeinsamkeit, die die Arbeit eines Meteorologen vor 50 Jahren und heute verbindet. Was sich in den Wetterstationen verändert hat, sind die Instrumente. Nur bei den immer seltener handbetriebenen Stationen, in denen ein Beobachter dreimal täglich die Treppe zu seiner Wetterhütte hoch steigt, den weißen Holzkasten mit den Lamellen nach innen und außen eröffnet und seine Quecksilberthermometer und das Haarhygrometer abliest, gibt es eine jahrzehntelange Kontinuität: an diesen Instrumenten wie auch am mechanischen Niederschlagsmesser hat sich nichts geändert: alles geht von Hand oder per Auge. Die aktuelle Temperatur wird abgelesen, die tiefste Temperatur am Minimum- Thermometer, die höchste Temperatur am MaximumThermometer, das genau so funktioniert wie ein Fieberthermometer - und alles auf 0,1° genau. Quecksilber - Thermometer wird es noch eine Weile geben, doch steht zu befürchten, dass eine Einnahmequelle für Trägerinnen blonder Haare versiegen könnte: seit jeher messen Hygrometer die Luftfeuchtigkeit über die Längenschwankungen entfetteter Haare. Wenn es feucht ist, werden Haare nämlich länger als in trockener Luft. Moderne Hygrometer arbeiten indessen kaum noch mit Haaren, sondern mit elektronischen Sensoren oder sogar mit so genannten Taupunktspiegeln, wenn es denn ganz genau sein soll. Um dieses Instrument zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme Luft. (Zum Thema "Taupunkt" habe ich hier an dieser Stelle bereits früher schon eine ganze Menge erklärt, und ich will dies hier heute nicht alles wiederholen). Nun zu unserem modernen Messgerät: in dem Moment, in dem der Taupunkt erreicht wird, bilden sich kleine Tröpfchen. Das nutzt das Instrument: ein kleiner Spiegel wird immer wieder in Messzyklen herunter gekühlt, bis sich auf ihm Tröpfchen bilden. Dadurch verändert sich die optische Charakteristik des Spiegels, welche die Elektronik registriert: das ist der Taupunkt. Und dann kann die relative Feuchtigkeit berechnet werden. Bei der Niederschlagsmessung ist die Automatisierung schon länger fortgeschritten. Die fernabfragbaren Geräte sind beheizt und mit einer Wippe ausgerüstet, die nach 0,1 mm Niederschlag ausgelenkt wird und einen Impuls erzeugt. Oder der Niederschlag wird direkt gewogen. Bei der Windmessung hat zum Glück für die Meteorologen eine Revolution stattgefunden, die sich weltweit noch gar nicht herumgesprochen hat: es gibt nun endlich einen Windmesser, der auch bei furchtbarsten windigsten Vereisungsbedingungen eisfrei bleibt - ein Stück deutscher Wertarbeit: die Firma Thies in Göttingen hat einen Ultraschall -Windmesser entwickelt, der ohne sich bewegende Teile mit Sicherheit eisfrei bleibt. Ultraschallwindmesser wurden zunächst in großen Höhen auf den Bergen bei eisigen Temperaturen eingesetzt, inzwischen aber auch in normalen Gegenden. Die Geräte zur Messung der Sonnenscheindauer haben sich inzwischen auch stark verändert. Früher bündelte eine Glaskugel die Sonnenstrahlen und brannte sie in eine Registrierpappe. Inzwischen lässt sich die Sonnenscheindauer auch elektronisch messen. Weil immer mehr Wetterstationen unbemannt sind, kommt dort sowieso nur die automatische Messung infrage. Bei anderen Messgrößen ist das menschliche Auge teilweise ersetzbar geworden, so bei der Sichtweite oder der Wolkenuntergrenze, aber Verluste an Informationen sind mit der Automatisierung immer verbunden. Die Schneehöhe kann zwar auch automatisch festgestellt werden, meistens wird dieses Instrument in automatische Stationen aber nicht eingebaut, so dass nur wenige Schneehöhen - Informationen in Deutschland, der Schweiz und Österreich vorliegen. Über die vertikalen Messungen in unserer Atmosphäre durch Wetterballone und Radiometer vielleicht demnächst einmal etwas hier im Funkwetterbericht. Libration des Mondes Täglich können wir beobachten, dass der Mond einen gewaltigen Einfluss auf unsere Erde hat: Ebbe und Flut. Wenn unser Erdtrabant derart an den Wassermassen zerren kann, dann wird er doch auch einen Einfluss auf das Wetter haben, oder? Elbe und Flut haben mit dem Wetter aber gar nichts zu tun. Luftdruckänderungen durch die Stellung des Mondes sind kaum messbar. Die relativ leichten Luftmassen werden durch den Mond viel weniger beeinflusst als die schweren Wassermassen. Alle Wetterregeln, die sich auf den Mond beziehen, lassen sich mit realen Wetterdaten nicht belegen. Man muss sich nur klar machen, dass ja auf der gesamten Erde Vollmond herrscht, wenn bei uns Vollmond ist. Ein weltweiter Wetterumschlag ist aber nicht zu beobachten. Das gleiche gilt für die anderen Mondphasen. Zum Thema "Mond" fällt mir gerade noch etwas sehr Interessantes ein. Sie alle kennen das berühmte "Mondgesicht". Wussten Sie schon, dass wir hier von der Erde aus diesem Gesicht einmal "unter das Kinn" und zum anderen Mal "über die Stirn" schauen können? Das kommt daher, dass die Mondbahn um 5° zur Erdbahnebene geneigt ist. Befindet sich der Mond nördlich der Erdbahnebene, so sehen wir ein wenig mehr von seiner Südkalotte, im anderen Fall zeigte er uns ein wenig mehr von seiner Nordkalotte. So sehen wir den Mond einmal gewissermaßen "unter das Kinn", das andere Mal "über die Stirn". Der Mond scheint zu "nicken" und Ja, Ja zu sagen. Darüber hinaus vermag der Mond aber auch noch den Kopf zu schütteln und gewissermaßen Nein, Nein zu sagen. Wieso? Warum kann man das Mondgesicht einmal über den Westrand und ein anderes Mal über den Ostrand hinaus sehen? Obwohl der Mond der Erde stets dieselbe Seite zukehrt (gebundene Rotation), kann man dennoch mehr als die Hälfte seiner Oberfläche von der Erde aus beobachten, etwa 59 %. Die Rotation des Mondes erfolgt gleichförmig, während sein Umlauf um die Erde gemäß dem zweiten Keplerchen Gesetz mit unterschiedlicher Geschwindigkeit erfolgt. In Erdnähe läuft der Mond somit schneller als in Erdferne. Deshalb sehen wir einmal ein wenig über den Westrand, einen halben Monat später über den Ostrand des Mondes hinaus. Der Mond scheint den Kopf zu schütteln und Nein, Nein zu sagen. Jene Schwankungen des Mondes in Breite und Länge werden als Libration bezeichnet. Die Libration des Mondes sorgt also dafür, dass unser Erdtrabant mit seinem Mondgesicht sowohl "nicken" als auch den "Kopf schütteln" kann. Das Barometer als Höhenmesser Am vergangenen Sonntag ging es zum Thema Luftdruck sehr theoretisch zu. Ich erläuterte Ihnen die Umrechnung von Millibar in Hektopascal. Zum Ausgleich geht es heute im Steilflug in die Praxis. Es geht um die im wahrsten Sinne überlebenswichtige Einschätzung der Flughöhe eines Piloten für seine Maschine. Jene vollzieht er nämlich mit Luftdruckangaben, die ihm ein hochempfindliches zum Höhenmesser umfunktioniertes Barometer liefert. Da der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, kann ein Aneroid - Barometer auch dazu verwendet werden, die Höhe über einem bestimmten Niveau zu bestimmen. Das ist aber gar nicht so einfach, da der Druck in kalter Luft schneller mit der Höhe abnimmt als in warmer Luft. Die kalte Luft ist nämlicher dichter und somit schwerer. Wenn der Pilot den Druck am Boden kennt und auch die Temperatur zwischen Boden und seinem Flugzeug, dann könnte er an seinem Barometer genau ablesen, in welcher Höhe er fliegt. Nun ist dies aber nie der Fall. Woher sollte der Pilot wissen, wie die Temperaturverhältnisse unterhalb seiner Flughöhe sind? Ein Flugzeug wird auf seiner Route somit nicht in einer konstanten Höhe fliegen können. Damit es aber bei dem dichten Luftverkehr nicht zu Kollisionen kommt, hat die internationale Luftfahrtorganisation ICAO eine künstliche Atmosphäre definiert, die so genannte Standard- Atmosphäre. Dabei wurde eine mittlere Temperaturabnahme mit der Höhe von 6,5 Grad pro 1000 Meter festgelegt, wobei die Temperatur am Boden 15° C beträgt und der Luftdruck 1013,2 hPa. Die Höhenmesser in allen Flugzeugen sind auf diese Standardatmosphäre geeicht. Den Flugzeugen wird nun von der Bodenkontrolle eine bestimmte Druckfläche, das so genannte flight level (FL) zugewiesen. Das entspricht in der Standardatmosphäre einer ganz bestimmten Höhe, die aber nicht mit der wirklichen Höhe übereinstimmen muss. In der Luftfahrt wird als Höhenmaß nicht Meter, sondern Fuß (ft) verwendet, wobei 1000 m gleich 3281 ft sind. Das flight level wird dabei in Hundert - Fuß - Stufen angegeben. FL 100 entspricht also eine Flughöhe von 10 000 ft oder etwa 3000 m. Der Druck in jener Fläche beträgt in diesem Fall 700 mb. Jene festgelegte Standardatmosphäre verhindert somit Flugzeugkollisionen, da sich alle Höhenmesser danach richten. Die Sache ist jedoch noch weitaus komplizierter. Während eines Fluges bewegt sich eine Maschine nicht nur in Luftschichten unterschiedlicher Temperatur, sondern auch stets zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Vor allem bei einem Flug von einem Hoch in ein Tief kann manches schief gehen, falls der Pilot nicht aufpasst. Bei abnehmendem Luftdruck zeigt der Höhenmesser nämlich bei konstanter Flughöhe einen Steigflug an. Die Höhenangaben auf dem Barometer stimmen nicht mehr. Wenn der Pilot seine Höhe beibehält, fliegt die Maschine in Wirklichkeit tiefer als es der Höhenmesser anzeigt. Würde sich der Pilot nun bei einer Landung im Nebel auf seinen Höhenmesser verlassen, würde seine Maschine bereits bei einer angezeigten Flughöhe von weit über Null Metern aufsetzen wollen. Dies entspräche wohl keiner gelungenen Landung, da sich die Maschine zu dieser Zeit noch im Landeanflug befinden würde. Fliegt ein Flugzeug von einem Tief in ein Hoch, ist es umgekehrt: Der Höhenmesser zeigt einen Sinkflug an, obwohl sich die Maschine auf konstanter Höhe bewegt. Der Pilot würde dann, geleitet vom Höhenmesser, bereits landen wollen, wenn die Maschine noch weit über Null Meter Höhe über dem Boden schwebt. Landen ohne Bodenkontakt wäre auch ein Problem. Wie kann man derartige "Missverständnisse" durch unterschiedliche Luftdruckverteilungen in Bodennähe verhindern? Ganz einfach: der Pilot lässt sich vor der Landung vom Tower den aktuellen Luftdruck durchgeben und korrigiert damit seinen Höhenmesser. Im Bereich des sog. "Transition Level, einer Übergangsfläche, muss der Pilot den Höhenmesser von 1013,2 hPa der Standardatmosphäre auf QNH umstellen, also auf den auf Meereshöhe reduzierten aktuellen Luftdruck auf der Piste des Landeflughafens. Diese Übergangsfläche (transition level) ist die tiefste noch oberhalb der Übergangsgröße gelegene Flugfläche. Sie ändert sich je nach dem Barometerstand. Auf dem Flughafen in Düsseldorf liegt diese je nach Barometerstand zwischen 60 und 70. Festzustellen ist also: Der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Deshalb lassen sich Barometer in Flugzeugen als Höhenmesser verwenden. Da der Luftdruck mit der Höhe jedoch nicht immer gleichmäßig abnimmt, sondern auch von Lufttemperatur und Wetterlage abhängig ist, hat man die so genannte Standardatmosphäre geschaffen und nach deren Berechnungen die Höhenmesser aller Flugzeuge geeicht. So können sich auf speziell eingerichteten Druckflächen, den Flight Levels, die Piloten mit ihren Maschinen sicher bewegen, ohne eine Kollision mit einer anderen Maschine befürchten zu müssen, denn alle Flugzeuge bewegen sich auf den ihnen vom Tower zugewiesenen Flugflächen der Standardhöhen, ohne dass sie ihre wahre Höhe überhaupt kennen müssten. Da ich keinen Pilotenschein besitze, spreche in hier in diesem Themenbereich nicht als Profi. Der eine oder andere von meinen Zuhörern oder Lesern wird vielleicht Flieger sein. Darunter gibt es viele Funkamateure. "Globalisierung" - für den Wind kein Thema Auch der kleinste Lokalwind auf unserer Erde ist eingebettet in das große globale Windsystem Nun ist er da, der Herbst, der uns kühle, teilweise auch nasse Tage bringt und der nun auch vermehrt den Wind im Gepäck hat. Jeder regionale oder sogar lokale Wind ist eingebettet in unser großes lokales Windsystem. Einen Überblick über die globalen Winde verschafft man sich am einfachsten, indem man vom Äquator ausgeht, wo die durch intensive Sonneneinstrahlung erwärmte Luft aufsteigt und sich zu den Polen hin bewegt. Bodenwinde, die von dem Unterdruck angesaugt werden, der durch die aufsteigende Luft entstanden ist, bewegen sich sowohl von Norden als auch von Süden in Richtung Äquator, werden aber durch die Kraft der Erddrehung nach Westen gelenkt, ein Phänomen, das als Corioliskraft bekannt ist. Diese so genannten Ostwinde (weil sie aus östlicher Richtung einströmen) sind die Passatwinde, die beständigsten und zuverlässigsten Brisen auf der ganzen Erde. Auch sie werden erwärmt, steigen nach oben und driften teilweise zu den Polen. All dies geschieht in der Troposphäre, der Heimat unseres Wetters, also bis in etwa 10 Kilometer Höhe. Ab etwa 30 Grad nördlicher und südlicher Breite - dort, wo die Subtropen enden, auf der Höhe von New Orleans und dem Nordrand Afrikas - beginnt die aufgestiegene Luft wieder zu sinken. Ein Teil dieser Luft wandert zum Äquator zurück und tritt wieder von vorne in den Kreislauf ein, ein anderer Teil bewegt sich in die mittleren Breiten. Dieser wird unterwegs durch die ablenkende Kraft der Erdrotation leicht im Uhrzeigersinn in die nördliche Halbkugel umgelenkt oder ebenso leicht gegen den Uhrzeigersinn in die südliche Halbkugel. Aus der Luft, die vom Äquator wegströmt, entwickeln sich die bodennahen Westwinde der mittleren Breiten. Treffen diese auf kühle Luft, die von den Polen zum Äquator strömt, vermischen sie sich mit ihr, wirbeln durcheinander und bilden jene durchziehenden Fronten, die das unbeständige Wetter der gemäßigten Zonen ausmachen. In der oberen Troposphäre erzeugen die aufeinander treffenden Luftmassen atmosphärische Wellen, die von Westen her um die Erdkugel strömen (Jetstreams). Um die Pole wehen leichtere, variablere Bodenwinde, die tendenziell von Osten kommen. (Damit will ich aber keineswegs behaupten, für die Polargebiete seien leichte Brisen typisch. Windströmungen in der Antarktis bewirken, dass Luftmassen an Berghängen abrupt abstürzen und dabei Spitzengeschwindigkeiten erreichen.) In den äußersten Regionen der Erde türmt sich kalte Luft auf und führt damit zur Entstehung starker Hochdruckzonen. Schließlich strömt diese kalte Luft von den Polen weg. Wenn sie den 60. Breitengrad erreicht (der Breitengrad, der durch die Südspitze von Alaska und Grönland verläuft), erwärmt sie sich etwas und steigt hoch, dabei schafft sie relativ stabile Tiefdrucksysteme. Gleichzeitig entsteht in den Rossbreiten (zu denen auch die trockenen Regionen im Südwesten Amerikas und des Mittleren Ostens zählen) ein Hochdruckgebiet, in dem kühle Luft über dem Festland nach unten sinkt. Die Hoch- und Tiefdruckgebiete - sowohl die stagnierenden Zellen als auch die durchziehenden Systeme, die uns abwechselnd sonnige und stürmische Perioden bescheren haben großen Einfluss auf die atmosphärische Zirkulation, denn sie wirken wie Gipfel und Täler. Luftpartikel, die den Weg des geringsten Widerstands suchen, gleiten um die Ränder der Hochdruckzonen und sinken in die wie Saugrohre wirkenden Tiefdruckzonen ab. Die Drucksysteme beeinflussen schließlich auch die Richtung des Windes: Auf der nördlichen Halbkugel wird die Luft um das Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn geleitet und in Tiefdruckrinnen gegen den Uhrzeigersinn. Auf der südlichen Halbkugel gilt genau das Gegenteil. Vor allem in den gemäßigten Zonen schlängelt sich die Luft von einem Drucksystem zum nächsten, bis sie wieder zum Äquator driftet, um das Spiel von neuem zu beginnen. Das ist nur eine vereinfachte Darstellung der Bodenwinde. Ihre genauen Bewegungsmuster hängen noch von einer ganzen Reihe anderer Faktoren ab, so z.B. von der Land- und Meerverteilung und von dem Verlauf der Jetstreams, der Strahlströme in der oberen Troposphäre. Aber es ist richtig: Auch unser Wind an Rhein und Ruhr ist natürlich in das erwähnte globale Windsystem eingebettet. Für die Luft sind Migration und Integration also kein Thema. Die Luftfeuchte Nichts ist bei Wetterbeschreibungen und Wetterprognosen wichtiger als die Angabe von Temperaturen. Deren Werte nehmen stets eine Favoritenstellung unter den meteorologischen Maßeinheiten ein. Zu Recht, denn sie haben schließlich den größten Einfluss auf das Wettergeschehen. Sie sind verantwortlich für Druckunterschiede und somit für unsere zahlreichen Windsysteme, die sich vertikal und horizontal täglich auf unserem Planeten ereignen. Über die Luftfeuchtigkeit, also den in der Luft ständig vorhandenen unsichtbaren Wasserdampf, hört man meist wenig. Zu Unrecht, denn dieser ist schließlich für unsere Niederschläge in fester oder flüssiger Form verantwortlich. Während wir Menschen Temperaturen gefühlsmäßig recht gut beurteilen können, haben wir kein direktes Sinnesorgan für die in der Luft vorhandene Feuchte. Erst wenn unser Körperschweiß bei Anstrengungen in höheren Temperaturen nicht mehr rechtzeitig verdunstet, die Abkühlung unserer Haut also problematisch wird, sprechen wir von Schwüle. Hinzu kommt, dass die Luftfeuchtigkeit nicht so einfach angegeben werden kann wie eine Temperatur. 20 Grad Celsius zum Beispiel ist für uns eine recht verständliche Angabe. Damit können wir erfahrungsgemäß etwas anfangen. Aber was bedeutet zum Beispiel 60 % Luftfeuchte? 60 % wovon? Was sind denn die 100 %? Warum nimmt man nicht eindeutigere Maße, etwa eine Skala von 1 bis 12 (wie bei den Windstärken)? 1 gleich rappeltrocken, 6 gleich normale Feuchte und 12 gleich superfeucht, feuchter geht´ s nicht mehr. Nun, das liegt daran, dass man Temperaturangaben und auch die Windstärken linear angeben kann. Die Luftfeuchtigkeit hingegen hängt sehr stark von der jeweiligen Temperatur ab, ist somit exponentiell. Die erwähnten 100 % Luftfeuchte sind je nach Temperatur sehr unterschiedlich. 100 % bei Null Grad bedeutet, dass nur etwa 5 Gramm Wasser in einem Kubikmeter Luft "hinein passen". Bei 20 Grad sind es aber bereits über dreimal so viel, ca. 17 Gramm, und bei 30 Grad sage und schreibe etwa 30 Gramm Wasser, also sechsmal soviel wie bei Null Grad. Jene temperaturabhängigen 100 % bezeichnet man als die jeweilige "Sättigungsfeuchte" bei einer bestimmten Temperatur. Die jeweilige Bezugstemperatur heißt auch "Taupunkt". Dieser Name ist gut gewählt, denn steigt die Feuchtigkeit über 100 %, wird der vormals unsichtbare Wasserdampf als Tau oder in Form von Wolkentröpfchen ausgeschieden. Eine sinnvolle Aussage über die Luftfeuchte kann man also nur machen, wenn man diese relativiert, und zwar auf die Sättigungsfeuchte bei einer bestimmten Temperatur. Wir sprechen ja bekanntlich von "relativer Luftfeuchtigkeit in Prozent". Nun, wie kommt die jeweilige Angabe in Prozent zustande? Nehmen wir als Beispiel eine Temperatur von 20 Grad. Wenn in der Luft dann je m³ 10 Gramm Wasserdampf enthalten sind, beträgt die relative Feuchte 59%. Klar, denn bei 20 Grad kann die Luft maximal nur ca. 17 Gramm Wasserdampf aufnehmen. Und 10 geteilt durch 17 sind ca. 59% (0,59). Es geht also stets um die Relation von absoluter Feuchte zur höchstmöglichen, der Sättigungsfeuchte. Haben Sie sich nicht schon einmal gefragt, warum es im Winter bei sehr kühlen Temperaturen keine extremen Regengüsse gibt wie sooft im Sommer? Die Luft kann einfach bei niedrigen Temperaturen nicht so viel Wasserdampf enthalten wie im Sommer. Somit kann sie auch nicht so viel davon in gleichen Zeitintervallen ausscheiden. Zum Ausgleich muss es dann länger regnen oder schneien. Die gleiche Menge Niederschlag kann im warmen Sommer bei einem einzigen kurzen Gewitterguss vom Himmel prasseln. Jeglicher Platzregen bleibt also weiterhin für die warme Jahreszeit reserviert. Messung der Luftfeuchte Am vergangenen Sonntag versuchte in den Begriff der "Luftfeuchtigkeit" zu erhellen. Dabei wurden die Bezeichnungen "relative Luftfeuchtigkeit", "Sättigungsfeuchte" und "Taupunkt" näher erläutert. Heute schließe ich die Frage an: Wir lässt sich die relative Luftfeuchtigkeit messen? Die Luftfeuchtigkeit kann man recht einfach mit Haarhygrometern bestimmen. Als Messelement dient ein Bündel staub - und fettfreier Haare, vorzugsweise Frauenhaare. Infolge der hygroskopischen Eigenschaften des Frauenhaares nimmt die Haarlänge zu, wenn die Luftfeuchte wächst. Bei der Feuchtigkeitsmessung muss die Sonnenstrahlung ebenso wie bei der Temperaturmessung vom Hygrometer ferngehalten und dieses gut belüftet werden. Besonders sichere Werte der Messung der relativen Luftfeuchtigkeit liefert das Psychrometer. Es besteht aus zwei Thermometern. Das sog. "trockene" Thermometer zeigt die aktuelle Lufttemperatur an. Das "feuchte" Thermometer ist von einem Wattebausch umhüllt, den der Beobachter vor der Messung mit Wasser anfeuchtet. Durch die Verdunstung des Wassers im Wattebausch wird dem Messkörper des feuchten Thermometers Wärme entzogen. Je tiefer die Temperatur am feuchten Thermometer unter dem zur gleichen Messzeit ermittelten Wert am trockenen Thermometer sinkt, je größer also die sog. "psychrometrische Differenz" ist, umso trockener ist die Luft, weil dann mehr Wasser verdunstet und dem feuchten Thermometer entsprechend mehr Wärme entzogen wird. Beide Thermometer werden durch einen künstlichen Luftstrom ventiliert, um den Messfehler möglichst gering zu halten. Mit diesen beiden abgelesenen Temperaturen lassen sich die relative Luftfeuchtigkeit und der Dampfdruck aus einer Psychrometertabelle oder entsprechenden Diagrammen ablesen. Der Temperaturunterschied zwischen trockenem und feuchtem Thermometer ist also ein Maß für die relative Luftfeuchte. Je kleiner die Differenz, desto feuchter ist die Luft. Die daraus zu ermittelnden Werte der relativen Feuchtigkeit, der Taupunkttemperatur und des Sättigungsdampfdrucks muss man aus diversen Tabellen der sog. "Psychrometertafel" ablesen. Für uns Normalverbraucher genügt jedoch ein einfaches Haarhygrometer. Man sollte es hin und wieder eichen. Das geht recht einfach: Man wickelt das Gerät in ein feuchtes Tuch und stellt den Zeiger nach etwa einer halben Stunde auf 95%. In den modernen Wetterstationen gibt es schon längst elektronische Messungen, die von einem Fühler per Funk zur Station im Innenraum übertragen werden. Nach meinen Erfahrungen sind diese oftmals ungenauer als die Werte von herkömmlichen Hygrometern. Vor allem in relativ feuchter Luft zeigen die modernen Geräte oft bis zu 10% zu wenig an Feuchtigkeit an. Himmelblau Welch ein tolles Wetter! Dieses fantastische Himmelsblau! Der blaue Himmel ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Sonnenschein und Atmosphäre. Ohne Atmosphäre hätten wir einen dunklen Taghimmel und könnten neben der Sonne auch die Sterne sehen. Die Astronauten, die unseren atmosphärelosen Mond betreten haben, konnten davon berichten. Die Sonnenstrahlen auf der Erde werden an den Molekülen der Luft und an den in der Lufthülle vorhandenen Staubpartikeln und Wassertröpfchen nach allen Richtungen hin gestreut. Und wie kommt es zum Farbton blau? Wenn unsere Augen von allen Farben des Spektrums getroffen werden, sehen wir ? (weiß). In der Atmosphäre werden an den Molekülen, Partikeln und Tropfen bevorzugt die kurzwelligen, blauen Strahlen zerstreut. Es ist somit der blaue Anteil des Sonnenlichts, der in der Atmosphäre auf diese Weise viel stärker zur Geltung kommt als das rote, gelbe oder grüne Licht. Auch für die wechselnde Kraft der Blautönung gibt es eine ebenso einfache Erklärung: die die Atmosphäre trübenden Elemente sind die Staubteilchen und die Wassertröpfchen. Je mehr sie in der Luft vorhanden sind, umso blasser wird das Blau. Der Himmel erscheint dann auch bei trockenem, schönem Wetter manchmal sogar mehr weiß und grau als blau. Umgekehrt verstärkt das Fehlen von Staubteilchen und Wassertropfen die Blaufärbung, was man besonders oft im Hochgebirge beobachten kann. Die "Schraubenzieher" - Regel Den Namen "Tiefdruckgebiet" (Tief) sowie den Ausdruck "Hochdruckgebiet" (Hoch) kennt jeder. Doch wie war das noch mal mit dem Unterschied der beiden? Die Luft weht links herum in das Zentrum eines Tiefdruckgebietes hinein. Nun muss sie schließlich irgendwo hin. In den Boden kann sie nicht, also bleibt nur der Ausweg in die Höhe. Oberhalb des Tiefs beginnt die Luft in etwa 6 km Höhe wieder auseinander zu fließen, um die bodennahe Konvergenz auszugleichen. Solange Konvergenz am Boden und Divergenz in der Höhe gleich sind, wird sich der Luftdruck am Boden nicht ändern. Durch das Aufsteigen der Luft bilden sich Wolken und bei entsprechender Stärke gibt es Niederschlag. Umgekehrt wird die bodennahe Divergenz in einem Hoch durch konvergente Strömung in der Höhe kompensiert. Beim Sinken der Luft erwärmt sich diese, Wolken lösen sich auf und deshalb herrscht im Bereich des Hochs meist sonniges Wetter. Im Winter gilt dies meist nicht wegen der Nebelbildung. Sie können sich den erwähnten Sachverhalt sehr leicht mit der "Schraubenzieher" - Regel merken. Wenn Sie eine Schraube eindrehen, dann drehen Sie den Schraubenzieher im Uhrzeigersinn rechts herum. Wenn Sie die Schraube herausziehen, drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn links herum. In einem Hoch sinkt die Luft im Uhrzeigersinn. Das Gewinde der Schraube bewegt sich rechts herum nach unten. In einem Tief steigt die Luft entgegen dem Uhrzeigersinn. Das Gewinde der "Schraube" bewegt sich nach oben. Mit Kenntnis dieser einfachen Regel können Sie die Strömungsverhältnisse in Hoch und Tief nie mehr vergessen. Natürliche Klimaänderungen Die Entwicklung des globalen Klimas hängt von weitaus mehr Faktoren ab als allgemein bekannt ist. Am vorletzten Sonntag wies ich darauf hin, dass seit Beginn der Industrialisierung die Menge von Gasen in unserer Atmosphäre, die den Treibhauseffekt verstärken, um 40% seit 1750 - und damit auch die globale mittlere Temperatur um 0,6 bis 1 Grad - unter Einwirkung des Menschen zugenommen hat. Auffallend ist, dass die 10 wärmsten Jahre des 20. Jahrhunderts aus seinen letzten 17 Jahren stammen (1998, 1997, 1995, 1990, 1991, 1994, 1983, 1988, 1987, 1996). Wir treiben also ein gewagtes Spiel mit dem globalen Klima, das wir mit Sicherheit nicht gewinnen werden, wenn wir so weitermachen. Das globale Klima hat sich aber immer schon durch "natürliche" Ursachen (ohne Eingriff des Menschen) mehr oder weniger stark verändert. So wissen wir z.B. inzwischen recht genau, wie sich das Klima in den letzten 1000 Jahren verhalten hat. Trotz leicht voneinander abweichender Ergebnisse der Klimaforscher stimmen ihre Aussagen in wesentlichen Punkten überein. Die Sonne, aber auch die Erde selbst, muss man nämlich mit globalen Temperaturschwankungen in Verbindung bringen. Sonne Die "Solarkonstante", also der Betrag der Sonnenenergie, die an der Obergrenze der Atmosphäre ankommt (1370 W / m²) schwankt um 3% wegen der unterschiedlichen Entfernung der Erde während ihres Umlaufs um die Sonne. Doch strahlt auch die Sonne bei weitem nicht so gleichmäßig, wie man noch bis ins 16. Jahrhundert hinein annahm. Denken wir an die "Sonnenflecken" und ihren ca. 11jährigen Zyklus, dem noch weitere Perioden überlagert sind und die zu extremen Fleckenmaxima und Fleckenminima führen können. So sind bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem Klima der letzten Jahrhunderte und der Anzahl der Sonnenflecken belegt. Die so genannte "Kleine Eiszeit" fand in einem Stadium der Sonne statt, als diese viele Jahrzehnte lang ohne Flecken war. Erde Ihre Bahn ist gleich mehreren Änderungen unterworfen. Die Bahn der Erde um die Sonne unterliegt einem Zyklus, bei dem diese zwischen einer Ellipse und (fast) einem Kreis schwankt. Dies vollzieht sich allerdings in dem großen Zeitraum von 100 000 Jahren. Je größer die Exzentrizität, umso größer ist der Unterschied der eintreffenden Sonnenstrahlung zwischen dem sonnenfernsten und sonnennächsten Punkt. Zurzeit ist die Exzentrizität gering. Der zweite Zyklus entsteht bei der Rotation der Erde um ihre Achse wie ein taumelnder Kreisel, "Präzession" genannt. Jene Periode dauert etwa 23 000 Jahre. In ca. 11 000 Jahren wird unsere Erde der Sonne wieder im Juli am nächsten sein, wenn auf der Nordhalbkugel Sommer ist. Dadurch werden die Gegensätze zwischen Sommer und Winter zunehmen, da die Nordhalbkugel die größeren Landmassen besitzt. (Zurzeit ist die Erde der Sonne im Januar am nächsten.) Der 3. Zyklus von ca. 41 000 Jahren wird durch die Änderung des Neigungswinkels der Erdachse gegenüber der Ekliptik, also der Erdbahn um die Sonne, hervorgerufen. Zurzeit beträgt jener Winkel 23,5°. Er schwankt zwischen 22° und 24,5°. Je kleiner der Winkel, umso geringer gestalten sich die jahreszeitlichen Schwankungen in mittleren und höheren Breiten. Was ich hier angeführt habe, ist die Grundannahme der "Melankovitch- Theorie". Milutin Melankovitch, ein serbischer Mathematiker, hat diese Theorie um 1930 entwickelt. Danach wird durch die geschilderten Änderungen des Laufes der Erde um die Sonne das globale Klima beeinflusst. Ablagerungen in den Ozeanen und Untersuchungen von Eisbohrkernen haben eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Eisausbreitung und der MelankovitchTheorie ergeben. Jedoch kann der Verlauf der verschiedenen Eiszeiten auf unserem Planeten damit nicht vollständig erklärt werden. Hierbei könnten z.B. auch gewaltige Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge ursächlich mitgewirkt haben. Welch dramatische Auswirkungen ein großer Vulkanausbruch auf das Wetter haben kann, zeigt das Jahr 1816, als in Teilen Nordamerikas und in Westeuropa der Sommer "ausfiel". Im Juni gab es Schneestürme, und Fröste traten noch im Juli und August auf. Ursache: Zwischen 1810 und 1815 stieg die Vulkanaktivität weltweit an und erreichte im April 1815 mit der Explosion des Vulkans "Tambora" im heutigen Indonesien ein Maximum. Aber Vorsicht! Ganz eindeutig ist der Zusammenhang zwischen dem Wetter von 1816 und der Eruption ein Jahr davor nicht, da es in jener Zeit kaum Wetteraufzeichnungen gab. Ziemlich sicher ist jedoch: Vulkangase können den Treibhauseffekt verstärken. Bedeutsamer ist aber wohl der Abkühlungseffekt durch die weltweite Trübung der höheren Atmosphärenschichten durch Vulkanrauch und Vulkanasche- Wolken. Kälterückfälle im Mai Aus wettermäßig aktuellem Anlass heute noch ein kleiner Nachschlag zu diesem Thema. Am vergangenen Sonntag bemerkte ich, dass jene Kälterückfälle im Mai nichts Ungewöhnliches darstellen und dass sie in früheren Zeiten fast in jedem Jahr nachgewiesen wurden. In unserer Zeit ist die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens auf etwa 60% herabgesunken. Wenn die Eisheiligen ausbleiben, beschwert sich natürlich niemand, und wenn sie dann so markant wie in diesem Monat auftreten - erst recht nach dem langen kalten Winter dieses Jahres - sind wir auf sie überhaupt nicht gut zu sprechen. Wir sind diese lang anhaltende kalte Witterung einfach leid, zumal diese überhaupt schwer einzuordnen ist in den Erwärmungstrend des angekündigten Klimawandels. Nun wird die Durchschnittstemperatur des Mai sogar um satte fünf Grad unterschritten. Droht vielleicht doch eher eine neue Eiszeit? Ich bleibe bei meinem Nein. Die Kälteperiode Mitte Mai bleibt ein typisches Wetterphänomen, das - wie gesagt - in früheren Jahrhunderten sogar regelmäßig stattfand. Heute bleiben jedoch derartige Kälterückfälle in zwei von fünf Jahren aus. Die Eisheiligen der hinter uns liegenden Woche sind markante Zeugnisse einer historischen, aber schon recht genauen Wetterbeobachtung: So enden die Eisheiligen in Norddeutschland am 13. Mai, im Süden unserer Republik aber erst am 14. oder 15. Mai. Der Grund: Die oftmals aus der Arktis stammende Luft braucht mindestens einen Tag, um von der Küste zu den Alpen zu gelangen. Zum Schluss möchte ich Ihnen heute jene Eisheiligen einmal etwas persönlicher vorstellen. Mamertus ( um 477 in Vienne, Gallien) war Bischof und wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Mamertus entstammte einer wohlhabenden gallorömischen Familie aus Lyon. Er wurde 461 Erzbischof von Vienne, wo er auch verstarb. Er führte die Bittprozession vor Himmelfahrt ein. Während seiner Amtszeit gebot er der Überlieferung nach durch Beten einer furchtbaren Feuersbrunst Einhalt, die die ganze Stadt zu zerstören drohte und soll auch andere Wunder und Heilungen bewirkt haben. In der Kunst wird er im Ornat eines Bischofs dargestellt, mit einem brennenden Licht zu Füßen des Kreuzes. Er ist der Patron der Hirten und der Feuerwehr und wird bei Dürre, Fieber und Brusterkrankungen angerufen. Sein Gedenktag ist der 11. Mai. In Deutschland (vor allem Norddeutschland) wird er zu den Eisheiligen gezählt. Pankratius, 12. Mai: Um das Jahr 303 kam der verwaiste Sohn eines reichen Römers mit seinem Onkel nach Rom und unterstützte der Legende nach mit seinem Erbe die verfolgten Christen. Der 14-jährige wurde erwischt, vor Kaiser Diokletian gebracht und öffentlich enthauptet. Der Heilige gilt als Schutzpatron der Kommunionkinder sowie gegen Krämpfe und Kopfschmerzen. Servatius, 13.Mai: Er war der erste Bischof von Tongern in den heutigen Niederlanden. Nach unterschiedlichen Legenden wurde er am 13. Mai 384 mit einem Holzschuh erschlagen. Sein Grab befindet sich in Maastricht an der Straße nach Köln. Er war im Übrigen noch entfernt verwandt mit Jesus. Marias Mutter Anna hatte nämlich eine Schwester namens Esmeria, deren Tochter Elisabeth die Mutter von Johannes dem Täufer war - somit die Großtante von Servatius. Bonifatius, 14. Mai: Es handelt sich nicht um den berühmten Heidenapostel der Deutschen, sondern um einen jungen Römer, der eigentlich gar kein Christ war. Er suchte in Tarsus (Türkei) nach den Reliquien christlicher Märtyrer. Unter dem Druck der Christenverfolgung bekehrte er sich und fiel ihr im Jahre 306 selbst zum Opfer. Sophie, 15. Mai: Sie gilt nur in Süddeutschland als Eisheilige. Man weiß nur wenig über sie. Auch sie soll während der Christenverfolgungen durch Kaiser Diokletian den Märtyrertod erlitten haben. Reliquien der Heiligen werden sowohl in Rom als auch im Elsass verehrt. Nach ihr ist das Sophienkraut benannt, auch als Besenrauke bekannt. Bei den Datumsangaben der Eisheiligentage muss berücksichtigt werden, dass Papst Gregor XIII. den gregorianischen Kalender zwar schon 1582 einführte, dass er jedoch in den nichtkatholischen Gebieten Nord- und Mitteleuropas erst zwischen 1700 und 1752 flächendeckend auf die neue Zeitrechnung umgestellt wurde. Bei dieser Umstellung wurde z. B. in England der September 1752 um 11 Tage verkürzt (auf den 2. September folgte unmittelbar der 14.). Da die Eisheiligen, wie alle anderen Heiligen, im Kalender unverändert stehen geblieben sind, finden sie nach altem Kalender also eigentlich erst 11-12 Tage später statt, also vom 23. Mai bis 27. Mai. Diese Überlegung trifft natürlich nur zu, wenn die Regel vor Einführung der Kalenderreform aufgestellt wurde. Tatsächlich sind wetterstatistisch die Tage mit häufiger N/NO-Wetterlage, die Kaltluft bringt, vom 21. Mai bis 23. Mai, also 9 Tage später. Das lässt auf eine Entstehung der Wetterregel 2-3 Jahrhunderte vor der Kalenderreform schließen. Ganz zum Schluss noch ein paar Eisheiligen- Regeln: Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz. Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost. Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist. Servaz muss vorüber sein, will man vor Nachtfrost sicher sein. Pankrazi, Servazi und Bonifazi, sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie, die Kalte Sophie. Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Frühling gebracht, zerstören sie wieder. Pflanze nie vor der Kalten Sophie. Mamerz hat ein kaltes Herz. Die kalte Sophie macht alles hie. Sie bringt zum Schluss ganz gern noch einen Regenguss. Klimaänderungen ? - Hitzesommer 2003 Seit Beginn der Industrialisierung in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist eine stetige Zunahme der "treibhauseffekt- relevanten Spurengase" zu beobachten. Allein die KohlendioxidKonzentration stieg von 2,8 Hundertstel Volumenprozent im Jahre 1750 auf 3,7 Hundertstel Volumenprozent heute und liegt damit 40% über dem damaligen Wert. Eine ähnliche Zunahme der Konzentration ist auch bei anderen Spurengasen zu verzeichnen. Es liegt also nahe, dass es auf der Erde wärmer werden muss. Tatsächlich konnte man nachweisen, dass etwa 0,6 bis 1 Grad der beobachteten Erderwärmung mit Sicherheit auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Damit bewegt uns die Frage sehr, wie es wohl mit den klimarelevanten Spurengasen künftig weitergehen wird. Da man diesbezüglich keine verlässlichen Prognosen erstellen kann, verwendet man verschiedene Denkmodelle, so genannte "Szenarien". Diese enthalten Annahmen über den zukünftigen sozioökonomischen Wandel. Dazu gehören die Entwicklung der Weltbevölkerung, ihr Lebensstandard und ihre Technologien und damit ihr Energiebedarf und insbesondere auch der Einsatz von alternativen Energien. Inzwischen hat sich der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) auf vier "Markerszenarien" geeinigt. Das zu ihnen gehörende Szenario A1B zum Beispiel beschreibt eine künftige Welt mit raschem Wirtschaftswachstum, einer Trendumkehr in der Weltbevölkerungszahl, schneller Einführung neuer und effizienter Technologien, einem Ausgleich regionaler Unterschiede in Lebensstandard und Einkommen und ausgeglichener Nutzung aller Energieträger. Ein solches Szenario kann man dann zur Steuerung eines Klimamodells benutzen und damit das Klima unter den Bedingungen des betreffenden Szenariums berechnen. Ein Klimamodell ist - sehr vereinfacht ausgedrückt - ein System von physikalischen, teilweise auch chemischen und biologischen Gleichungen, mit dessen Hilfe man die klimatischen Vorgänge an den Maschepunkten eines über die Erde gespannten imaginären Gitters berechnen kann. So kommt man zu Aussagen über die künftige Entwicklung von Temperaturen, Niederschlägen, Schneegrenzen, Gletschern und die Höhe des Meeresspiegels. Die Berechnungen deuten zum Beispiel auch darauf hin, dass künftig extreme Wettererscheinungen häufiger auftreten könnten. Zum Schluss möchte ich deshalb an ein solches Extremwetter hier in Deutschland und Europa erinnern, und zwar an den Hitzesommer 2003. Damals begann bereits der Frühsommer mit Wärmerekorden. So lag die Mitteltemperatur des Junis mit 19,1 Grad vier Grad über dem Normalwert. Es war der wärmste Juni seit dem Jahre 1901. Das heiße, sonnige und zu trockene Wetter setzte sich im Juli und August fort. Das Thermometer kletterte im Raume Nürnberg am 8. August auf 40 Grad C. Im Oberrheingebiet wurde 54 Tage mit über 30 Grad registriert und 84 Sommertage mit über 25 Grad. Die Niederschläge erreichten landesweit nur 30% der langjährigen Mittelwerte. Jene Hitzewelle 2003 wütete in fast ganz Europa, am extremsten in Südfrankreich. Frankreich hatte 14 000 Hitzeopfer zu beklagen. In Portugal wurden durch Brände 40% des Waldbestandes vernichtet. Die Donau führte so wenig Wasser, dass Schiffe zum Vorschein kamen, die im 2. Weltkrieg versenkt worden waren. Damals wurden uns weitere derartige Hitzesommer prophezeit, die jedoch bislang ausblieben. Vielleicht war diese extreme Witterung ja doch nur ein Einzelfall, ein sog. Ausreißer, also noch kein Hinweis auf eine bevorstehende Klimaänderung in Deutschland. Der Schmetterlings-Effekt Als wir über die fehlenden Kondensstreifen anlässlich des Flugverbots und die damit verbundenen Auswirkungen auf unser Wetter diskutierten, wies ich darauf hin, dass bereits eine kleine Änderung in der Ausgangslage der Wetterbedingungen, wie zum Beispiel die sich bisweilen zu Wolken auswachsenden Kondensstreifen von Flugzeugen, zu großräumigen Änderungen einer vorhergesagten Wetterlage führen können. Man kennt jenes Phänomen unter dem Begriff "Schmetterlingseffekt", der 1963 von dem Meteorologen Edward Lorenz geprägt wurde. Der stellte nämlich fest, dass in einer damals noch sehr einfachen Wettersimulation das Geschehen einen völlig anderen Verlauf nahm, wenn man die Ausgangsbedingungen auch nur ein winziges Bisschen veränderte. Um eine möglichst extrem kleine Veränderung im realen Wettergeschehen zu benennen, wählte er den Flügelschlag einer Möwe als Beispiel. Das war die Geburtsstunde der so genannten "Chaostheorie". Später bürgerte sich dann der Schmetterling als Vergleich ein, vielleicht auch deshalb, weil die mathematische Struktur, die dieses Chaos beschreibt, ein so genannter Attraktor, entfernt an einen Schmetterling erinnert. Inzwischen sind die Wettersimulationen erheblich komplexer, aber dass das Wetter ein chaotisches System ist, bestätigt sich immer wieder. In Simulationen und Prognosen gehen wir immer nur von einzelnen Daten an endlich vielen Punkten auf der Erde aus - und mit denen ist das Wetter nicht mehr als rund fünf Tage im Voraus zu bestimmen. Die kleinste Abweichung beim Ausgangszustand potenziert sich, je weiter man in die Zukunft rechnet, was eine große Auswirkung auf das Vorhersageergebnis hat. Die Vorgänge beim Wetter laufen bekanntlich nach physikalischen Gesetzen ab. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, Wetterentwicklungen vorherzusagen. Das Wetter unterliegt jedoch dem Gesetz der Strömungen. Turbulenzen darin werden zu einem Stück unberechenbarer Natur. Sie entwickeln sich wie gesagt "chaotisch". Somit sind bis heute Wetterprognosen über vier Tage hinaus noch immer relativ unsicher, da jede Ausgangswetterlage in ihrem Anfangszustand datenmäßig nicht genau genug bekannt ist, also angefüllt ist mit sog. "sensitiven Bereichen", in denen kleinste Veränderungen zu völlig anderen Endresultaten führen können. Und das Vertrackte bei Chaoseffekten ist, dass man für eine Verdopplung der Vorhersagezeit nicht die doppelte Anzahl von Vorhersagepunkten benötigt, sondern ein Vielfaches davon. Die chaotische Entwicklung bei Wetterphänomenen ist zwar bis heute unumstritten, doch auch die Turbulenz weist - soviel wurde inzwischen erkannt - Gesetzmäßigkeiten auf, die sie dem Chaos verdankt. In Experimenten hat sich gezeigt, dass die so unregelmäßig erscheinenden Wirbel einer turbulenten Strömung dennoch bestimmte Formen überraschend deutlich bevorzugen und dass man ihre Eigenschaften durch geeignete Mittelwerte kennzeichnen kann. Gerade die chaotischen Bahnen sind es, auf deren Mittelwerte Verlass ist. Es sind also immer die Anfangszustände, die den Verlauf einer chaotischen Entwicklung bestimmen, die - zum Glück - in ihrer weiteren Entwicklung dennoch zu recht verlässlichen Mittelwerten führen. Aber diese helfen bei einer Wetterprognose für mehrere Tage wenig. Hier will man ja wissen, wie sich das Wetter an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit entwickelt. Um dies genau vorher zu sagen, müsste man den Anfangszustand der Atmosphäre vor der Prognose so genau kennen, dass die weitere Entwicklung nach drei Tagen nicht mehr aus dem Ruder läuft. Denn der noch so kleinste nicht berücksichtigte Parameter im Anfangszustand kann eine Computervorhersage zu ganz anderen Ergebnissen führen. Man sollte den Schmetterlingseffekt allerdings nicht allzu wörtlich nehmen und eher als eine Metapher begreifen. Bei den Auswirkungen der Kondensstreifen, die bei den Anfangsparametern einer Wetterprognose wohl nicht berücksichtigt werden können, bin ich mir da nicht so sicher, weil diese mit Sicherheit größere wettermäßige Effektivität besitzen, wenn sie sich zu Wolkenformationen auswachsen. Jedoch könnte wohl kein Meteorologe eine Kausalkette angeben, wie sich dieser Effekt so vergrößert, dass er tatsächlich einen Sturm auslöst- noch dazu mehrere tausend Kilometer entfernt. So wird wohl jeder Kondensstreifen mehr vom Wetter beeinflusst als das Wetter von einem Kondensstreifen. Stopp für unsere Hochgeschwindigkeitsgesellschaft Kein Jet mehr am Himmel! Keine Kondensstreifen Hat dies Auswirkungen auf unser Wetter? Ja, vor allem bei klarem Himmel. Die Kondensstreifen hindern als künstlich generierte Wolken tagsüber die Sonne daran, ihre volle Strahlungskraft zum Boden durchzusetzen. Bei klarem Himmel wird es somit etwas wärmer. In der klaren Nacht ist es umgekehrt: Die fehlenden Kondensstreifen sorgen dafür, dass der Erdboden seine Wärme ungehindert abstrahlen kann. Es wird somit nachts etwas kälter als bei vorhandenen Kondensstreifen. Bei der Diskussion um den vom Menschen mit verursachten Klimawandel kommt meines Erachtens der weltweit zunehmende Flugverkehr stets zu kurz. Ich will jetzt gar nicht auf die immensen Mengen von CO² in den Abgasen eingehen, die in wenigen Tagen durch die Jetstreams um den gesamten Globus verfrachtet werden. Bleiben wir bei den erwähnten Kondensstreifen. Diese können sich ausweiten und zu regelrechten Wolken werden und das Sonnenlicht abschwächen, denn Kondensstreifen sind ja im Prinzip Wolken. Sie gleichen in ihrer Struktur den Zirruswolken, die sich in Höhen zwischen 6 und 10 Kilometern bilden. Dort oben herrschen Temperaturen um minus 40 Grad, so dass der Wasserdampf in den Abgasen von Düsenflugzeugen unmittelbar zu Eiskristallen gefriert. Die dazu nötigen Kondensationskeime liefert der Jet in Gestalt von feinen Russpartikeln gleich mit. Dadurch wird ein Flugzeug für uns erst sichtbar, das sonst nur ein winziger Punkt am Himmel wäre. Normalerweise lösen sich Kondensstreifen schnell wieder auf - ihre Lebensdauer beträgt meist nicht mehr als ein paar Minuten. Wenn allerdings die Luft in dieser Höhe mit Feuchtigkeit schon fast gesättigt ist, bleiben die Kondensstreifen länger bestehen. Sie gehen in die Breite und sind als feine Schlieren am Himmel sichtbar. Langlebige Streifen sind also ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und damit in gewisser Weise auch ein Zeichen für eine bevorstehende Wetterverschlechterung. Die Wasserdampfmenge, die ein Flugzeug ausstößt, ist allerdings gering im Vergleich zu dem, was eine normale Wolke an Wasser enthält. Trotzdem können die Flugzeugabgase zur Wolkenbildung beitragen. Die Partikel, die aus dem Triebwerk strömen, können nämlich auch den schon vorhandenen Wasserdampf zum Kondensieren bringen. So kann aus einem schmalen Kondensstreifen eine regelrechte Wolke entstehen, die eine recht große Fläche überstreicht. Inzwischen ist längst nachgewiesen worden, dass es in den großen Flugkorridoren tatsächlich einen höheren Grad an Bewölkung gibt. Der Mensch verändert somit gebietsweise die Strahlungsbilanz der Sonne durch den Flugverkehr, was Auswirkungen auf Wettererscheinungen haben kann. Manchmal nimmt das Wettergeschehen nämlich einen ganz anderen Verlauf, wenn die Ausgangsbedingungen nur ein bisschen verändert werden. Wenn dies nach der "Chaostheorie" bereits durch den Flügelschlag einer Möwe oder sogar vielleicht bereits durch den eines Schmetterlings bewirkt werden kann, dann doch wohl erst recht durch einen sich zur Wolke auswachsenden Kondensstreifen. Galileo - Thermometer Der Physiker Galileo Galilei (1564-1642) stellte fest, dass sich bei verschiedenen Temperaturen die Dichte von Flüssigkeiten verändert. Auf diesem Prinzip sind die ihm zu Ehren benannten Galileo-Thermometer aufgebaut. Das Thermometer besteht aus einem mit einer Flüssigkeit gefüllten Glaszylinder. In der Flüssigkeit schwimmen oder schweben mehrere kugelförmige Glaskörper. Die Flüssigkeit des Glaszylinders reagiert auf Änderungen der Temperatur mit Änderung der Dichte. Steigt die Temperatur, verringert sich die Dichte der Flüssigkeit. Somit nimmt der Auftrieb der Glaskörper ab. Schwebende Glaskörper sinken herab, schwimmende Glaskörper beginnen zu schweben. Ein Glaskörper schwebt, wenn sein Gewicht genau so groß ist wie das der durch ihn verdrängten Flüssigkeitsmenge. Die Gewichte der Glaskörper sind auf die temperaturabhängigen Dichteänderungen der Flüssigkeit so abgestimmt, dass jeweils die untere der oben schwimmenden Glaskugeln die aktuelle Temperatur anzeigt. Die Herstellung dieses Instrumentes ist äußerst aufwendig. Jede Glaskugel wird genau kalibriert. Die Gewichtsdifferenz von Kugel zu Kugel beträgt normalerweise etwa 1 bis 2 tausendstel Gramm. Für gewöhnlich befinden sich fünf bis zehn Glaskörper in Kugelform im Zylinder. Der Messbereich beträgt üblicherweise 18 °C bis 28 °C. Die Kugeln teilen den Messbereich entweder in Abstände von 1 °C oder 2 °C auf. Damit lassen sich Temperaturänderungen zwischen 0,5 und 1 Grad ablesen. Nochmals: Die Temperatur wird von jener Kugel abgelesen, die von der oben schwimmenden Gruppe die unterste ist. Wenn sich zum Beispiel drei Glaskörper, 28 ºC (obere Kugel), 26 ºC (mittlere) und 24 ºC (untere Kugel) oben befinden, ist es 24 ºC warm. Würde aber die Kugel mit z.B. 24 ºC zwischen der oberen und unteren Gruppe berührungslos schweben, wären es etwa 25 ºC. Würde die Kugel mit 26 ºC schweben, wären es etwa 27 ºC, usw. Die Temperaturangaben - so meine langjährige Erfahrungen mit einem XL* Galileo Thermometer - sind äußerst präzise und können sich mit jedem herkömmlichen Qualitäts- Thermometer messen. Es kann auch vorkommen, dass Kugeln sich untereinander verhängen und nicht aufsteigen oder (seltener) absteigen können. In diesem Fall muss das Thermometer nur etwas mit den Fingern angeklopft werden. Die Zusammensetzung der Flüssigkeit wird in der Regel nicht bekannt gegeben, besteht aber im Allgemeinen aus verschiedenen Ölen, also Kohlenwasserstoffen. Sie ist weder giftig noch aggressiv. Wenn ein solches Thermometer zerbricht, reinigen Sie sofort die betreffenden Stellen mit Wasser, da sonst Flecken zurück bleiben können. Falls die Flüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie diese einfach mit Wasser und Seife ab. Die Flüssigkeit innerhalb einer Glaskugel kann gefärbtes Wasser sein oder Alkohol enthalten. Das Thermometer ist natürlich leicht träge, weil die Flüssigkeitstemperatur nur langsam den Änderungen der Lufttemperatur folgt. Verschiedene Hersteller bieten diese Thermometer als Zimmerdekoration an. * Ein XL Galileo- Thermometer mit einer Länge von 65 cm besitzt 11 Glaskugeln für den Messbereich von 18 bis 28 Grad C. Damit lassen sich Temperaturänderungen von 0,5 Grad beobachten. Unser großer Luft- Ozean (1) Wetter ist das, was wir jeden Tag erleben. Klima ist die Summe aller Witterungsverläufe über eine bestimmte Zeitspanne, und zwar entweder für eine bestimmte Region oder für unseren Planeten als ganzes. Dies alles wird in unserer Erdatmosphäre hervorgerufen. DIE ATMOSPHÄRE UNTERGLIEDERT SICH in vier verschiedene Schichten. Jene unterscheiden sich durch ihre jeweilige Temperatur und die Richtung ihres Temperaturverlaufs. Der unterste Bereich der Atmosphäre heißt Troposphäre. Ihr Name bedeutet "Sphäre, in der umgewendet wird". Sie hat diesen Namen erhalten, weil die vertikale Durchmischung der Luft für sie charakteristisch ist. Die Troposphäre reicht durchschnittlich bis in 12 km über der Erdoberfläche. Sie enthält bereits 80 % aller atmosphärischen Gase. Dabei ist nur ihr unteres Drittel, das schon die Hälfte aller Gase in der Atmosphäre enthält, der Teil, den wir atmen können. Das Entscheidende an der Troposphäre ist, dass ihr Temperaturverlauf "auf dem Kopf steht": An der Erdoberfläche ist sie am wärmsten und nach oben kühlt sie sich um 6,5°C pro Kilometer Höhenunterschied ab. Man könnte ja erwarten, dass die Luft dort am wärmsten ist, wo sie der Sonne am nächsten kommt. Aber so ist es nun mal nicht, und gerade deswegen wird die gründliche Durchmischung der Troposphäre hervorgerufen. Schließlich steigt warme Luft nach oben. Die Troposphäre besitzt noch eine Besonderheit, deren sich viele Menschen gar nicht bewusst sind: Sie ist der einzige Bereich der Atmosphäre, dessen durch den Äquator getrennte nördliche und südliche Hälften sich kaum durchmischen. Die Bewohner der Südhalbkugel leiden somit unter weniger Luftverschmutzung als die Menschen auf der stärker bevölkerten Nordhalbkugel. Der Blick zum Horizont und zum Sternenhimmel ist auf der Südhalbkugel weniger eingeschränkt als in der nördlichen Hemisphäre. (!) Die Tropopause trennt die Troposphäre von der darüber liegenden Stratosphäre. Im Gegensatz zur Troposphäre wird die Stratosphäre mit zunehmender Höhe immer wärmer. Das liegt am Ozongehalt der oberen Stratosphäre. Ozon fängt die Energie des ultravioletten Lichtes ein und strahlt sie als Hitze wieder ab. Da sie nicht von aufsteigender warmer Luft durchmischt wird, ist die Stratosphäre deutlich geschichtet und starke Winde zirkulieren darin. Etwa 50 km über der Erdoberfläche folgt die Mesosphäre. Sie ist mit - 90° C der kälteste Bereich der Gesamtatmosphäre. Darüber schließt sich noch die letzte Schicht der Atmosphäre an, bestehend aus einem sehr dünnen Gas. Man nennt sie Thermosphäre. Dort können Temperaturen von 1000°C erreicht werden, aber weil die Gase so hauchfein verteilt sind, ist jene Temperatur nicht echt fühlbar. UNSER GROßER LUFTOZEAN setzt sich zu 78 % aus Stickstoff, zu 20,9 % aus Sauerstoff und zu 0,9 % aus Argon zusammen. Diese drei Gase machen über 99,95 % der Luft aus, die wir atmen. Hinzu kommt, dass diese Luft Wasserdampf aufnehmen kann. Aber diese Fähigkeit hängt von ihrer Temperatur ab. Je höher sie ist, desto mehr Wasserdampf kann darin enthalten sein. Im Durchschnitt besteht das, was wir bei 25 Grad einatmen, zu 3 % aus Wasserdampf. Dürfen wir nun das verbleibende Zwanzigstel von einem Prozent, das sich noch in den erwähnten Gasen der Atmosphäre befindet, vernachlässigen oder einfach unter den Tisch fallen lassen? Nehmen wir zum Beispiel das Ozon. Seine Moleküle setzen sich aus drei Sauerstoffatomen zusammen. Diese sind selbst im Rahmen dieser winzigen Minderheit von "Spurengasen" ziemlich selten. Ozon macht nur zehn von einer Million Molekülen aus, die in den Strömungen unseres Luftozeans umgewälzt werden. Jedoch ohne den Schutzeffekt jener zehn Moleküle pro Million würden wir bald erblinden, an Krebs sterben oder eine ganze Reihe anderer Probleme bekommen. Ebenso wichtig für unser Fortbestehen sind die Treibhausgase, von denen CO2 das häufigste ist. Weniger als vier von 10.000 Molekülen in unserer Atmosphäre sind davon vorhanden, doch spielt dieses Gas eine entscheidende Rolle dabei, uns vor dem Erfrieren zu schützen, und gerade weil es so rar ist, genauso vor einer Überhitzung zu bewahren. (623 Wörter) Unser großer Luft- Ozean (2) TREIBHAUSGASE haben eine große Macht über die Temperaturverhältnisse auf einem Planeten. Die Atmosphäre der Venus besteht zu 98 % aus CO2. Ihre Oberflächentemperatur beträgt ca. 470° C. Sollte Kohlendioxid einmal einen Anteil von nur 1 % in unserer Atmosphäre erreichen, würde die Oberflächentemperatur der Erde nahe an den Siedepunkt kommen. CO2 ist das häufigste der Spuren- oder Treibhausgase auf unserem Planeten. Es entsteht, wenn wir etwas verbrennen oder wenn etwas sich zersetzt. Seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat der Wissenschaftler Charles Keeling regelmäßig den Mount Mauna Loa auf Hawaii bestiegen, um dort möglichst ohne irgendeine Verfälschung die CO2- Konzentration in der Atmosphäre zu messen. Aus seinen Werten entwickelte er eine grafische Darstellung, die Keeling -Kurve. In ihr kann man entdecken, dass unser Planet "atmet". In jedem Frühling auf der Nordhalbkugel, wenn die sprießenden Pflanzen unserer Lufthülle CO2 entziehen, beginnt das große Einatmen unserer Erde. Die CO2 - Konzentration geht zurück. Wenn dann im Herbst die Zersetzung CO2 erzeugt, kommt es zum "Ausatmen", das die Luft wieder mit CO2 anreichert. KEELING ENTDECKTE aber noch etwas anderes: dass nach jedem Ausatmen ein bisschen mehr CO2 in der Erdatmosphäre war als bei dem davor. Jene kleinen Spitzen in der Keeling Kurve sind ein Hinweis darauf, dass der CO2 - Gehalt unserer Atmosphäre langsam, aber stetig und regelmäßig ansteigt. Wenn man den Verlauf der stetig ansteigenden Kurve in die Zukunft verlängert, könnten wir im 21. Jahrhundert eine Verdopplung des bisherigen CO2Gehalts erleben. Wir hätten dann einen Anstieg von drei Molekülen pro 10.000 Moleküle zu Beginn dieses Jahrhunderts auf sechs pro 10.000 Moleküle am Ende des Jahrhunderts. Darin steckt das Potenzial der Erwärmung unseres Planeten um drei Grad, evtl. auch noch darüber. Als den Wissenschaftlern erstmals klar wurde, dass der CO2- Gehalt der Atmosphäre etwas mit einer Klimabeeinflussung zu tun hat, entstand zunächst einmal eine große Verwirrung. (Zitat) "Sie wussten, dass CO2 nur Strahlung mit einer Wellenlänge von mehr als rund zwölf Mikrometern (ein menschliches Haar ist rund 70 Mikrometer dick) und dass schon eine kleine Menge des Gases sämtliche Strahlung in diesem Bereich einfängt. ( ) Darüber hinaus ist das Gas so selten, dass es unscheinbar schien, es könne das Klima eines ganzen Planeten ändern. VIELE WISSENSCHAFTLER MACHTEN SICH DAMALS NICHT KLAR, dass, bei sehr niedrigen Temperaturen - beispielsweise über den Polen und weit oben in der Atmosphäre -, mehr Energie jener Wellenlängen unterwegs ist, die CO2 am effizientesten absorbiert. Noch wichtiger war die Entdeckung, dass CO2 allein weniger für den Klimawandel verantwortlich ist, sondern als Auslöser für das potenteste Treibhausgas, Wasserdampf, dient. Und zwar, indem es die Atmosphäre nur ein wenig erwärmt, was es dieser aber ermöglicht, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen und zu speichern, die in der Folge die Atmosphäre weiter aufheizt. So kommt es zu einer positiven Rückkopplungsschleife, die die Temperatur unseres Planeten immer weiter in die Höhe schraubt. Wasserdampf ist zwar ein Treibhausgas, zugleich ist er aber auch, was den Klimawandel angeht, ein großes Rätsel, denn er bildet Wolken, und Wolken können sowohl Licht reflektieren als auch Wärme festhalten. Indem sie mehr Wärme einsammeln als sie Licht reflektieren, tendieren hohe, dünne Wolken dazu, den Planeten aufzuheizen, während tiefe, dicke Wolken das Gegenteil bewirken. Kein anderer einzelner Faktor birgt mehr Unsicherheiten, was Vorhersagen des künftigen Klimawandels angeht". ("Wir Wettermacher", Tim Flannery, S. 49/50). Zitat Ende DAS CO2 IN UNSERER ATMOSPHÄRE hat zwar noch einen verschwindend kleinen Anteil und seine Kapazität, Wärmeenergie zu binden, ist nur gering, aber es hält sich sehr lange dort oben. Rund 56 % von allem CO2, das Menschen durch Verbrennungsprozesse je freigesetzt haben, sind noch über uns vorhanden, und sie sind direkt wie indirekt - die Ursache für rund 80 % aller globalen Erwärmung. Ein uns stets bekannter Anteil von CO2 verbleibt somit sehr langfristig in unserer Atmosphäre. Wir kennen ihn und sind damit in der Lage, wenn auch mit gerundeten Werten, ein Kohlenstoff-Budget für die Menschheit zu berechnen. (647 Wörter) Unser großer Luft- Ozean (3) Die Temperaturen im Weltraum sind mit rund -270°C recht frisch. Unsere Sonne sorgt mit ihrer Strahlung als Energielieferant jedoch dafür, dass auf unserer Erde keine eisigen Weltraumtemperaturen herrschen. Sehr wichtig für unsere Lebensmöglichkeiten hier ist jedoch die Tatsache, dass ein Gleichgewicht von Ein- und Ausstrahlung herrscht, denn ansonsten würde unser Planet entweder immer heißer, bis er sich auflöst, oder immer kälter, bis er als ein riesiger Schneeball enden würde. WENN ES BEI UNS AN DER ERDOBERFLÄCHE ein reines Strahlungsgleichgewicht gäbe, dann lässt sich theoretisch errechnen, dass unsere Erde eine durchschnittliche Oberflächentemperatur von -18°C haben müsste. Das wäre für uns ein ziemlich lebensfeindlicher Umstand. Die durchschnittliche Erdoberflächentemperatur beträgt jedoch glücklicherweise +15°C und liegt damit 33 Grad über dem Wert des reinen Strahlungsgleichgewichts. Es sind genau diese 33 Grad, die man als den natürlichen Treibhauseffekt bezeichnet. Und dieser schafft erst die Voraussetzungen für Leben, wie wir es kennen. Über die dafür verantwortlichen Treibhausgase habe ich Ihnen bereits an dieser Stelle berichtet. Zu CO2 und Ozon kommen aber noch andere hinzu: Das wichtigste ist der Wasserdampf (damit hörte mein voriger Beitrag auf), dann noch das Lachgas oder DiStickstoffoxid (N2O), das Methan (CH4) und die ausschließlich von uns Menschen produzierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Sie alle haben die Eigenschaft, die eingehende kurzwellige Sonnenstrahlung relativ ungehindert passieren zu lassen, langwellige Strahlung, die von der Erde her kommt, jedoch zu absorbieren. Dabei erwärmen sie sich und senden ihrerseits wieder langwellige Wärmestrahlung aus. Auf diese Weise kommen die vorhin genannten 33 Grad zustande. Für 21 der 33 Grad ist allein der Wasserdampf verantwortlich, für 7 Grad das Kohlendioxyd und für die restlichen 5 Grad alle übrigen Gase. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass unsere Atmosphäre zu über 99 % aus Stickstoff und Sauerstoff besteht, bleibt für die restlichen Gase kein großer Anteil mehr übrig. Deshalb nennt man sie ja auch "Spurengase". Trotz ihrer geringen Konzentration besitzen aber gerade jene Gase im energetisch wichtigen Bereich des Spektrums eine große Emission und Absorption und sind deshalb für Temperaturänderungen sehr von Bedeutung. Sie sind es, welche den Wärmestau von 33 Grad auf unserer Erde bewirken. Man vergleicht ihn oft mit einem gläsernen Treibhaus, bei dem das Glas die kurzwellige Sonneneinstrahlung zwar durchlässt, die langwellige Wärmestrahlung aber zurückhält. Den Begriff "Treibhaus" sollte man jedoch nur als Metapher verwenden, denn unsere Lufthülle hat schließlich kein Glasdach und ein Lufttransport aus dem "Treibhaus" ist jederzeit möglich. DER MENSCH - und das nennt man den anthropogenen Treibhauseffekt - verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt vor allem durch das Freisetzen großer CO2 - Mengen. Den Beginn kann man etwa um 1800 zurzeit der Industriellen Revolution ansetzen. Dieses Kohlendioxid hält sich über Jahrzehnte in der Atmosphäre. So hat sich seine Konzentration von 0,028 % in der vorindustriellen Zeit auf 0,038 % heute erhöht. Die Ozeane haben glücklicherweise gut 30 % unseres Kohlendioxids aufgenommen und damit verhindert, dass die Konzentration in der Atmosphäre noch schneller steigt. Nachteil: Unsere Ozeane werden dadurch immer sauerer (Kohlensäure), was z.B. die Korallen schädigt. Die Vegetation nimmt ebenfalls eine Menge dieses Gases auf, denn die Pflanzen benötigen es zur Photosynthese, ohne die wir keinen Sauerstoff zum Atmen hätten. CO2 ist für das Leben auf der Erde also enorm wichtig. In den letzten 100 Jahren kann man einen deutlichen Temperaturanstieg auf der Erde feststellen. Er deckt sich übrigens gut mit einer Zunahme der Sonnenaktivität in jener Zeit. Zwischen 1940 und 1970 gingen die Temperaturen wieder etwas zurück, vornehmlich durch den vermehrten Aerosoleintrag (Staub oder Ruß) in unserer Atmosphäre. Danach stiegen die Temperaturen durch industrielle Maßnahmen der Luftreinigung wieder an. Eine neuerliche Änderung der Sonnenintensität konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, und so gilt der Mensch für die Änderungen des Klimas der letzten 30 Jahre als in erheblichem Maße (mit)verantwortlich. Die Wissenschaft geht inzwischen von einer Wahrscheinlichkeit von über 90 % aus und derzeitige Klimaprojektionen bestätigen den Fortgang dieser Entwicklung. Der Weg zum Klimaschutz Die Grenzen des Wachstums Im Jahre 1972 erschütterte der Bericht "Die Grenzen des Wachstums" (engl. Originaltitel: The Limits to Growth) die Welt. Dennis L. Meadows, Chef des "Club of Rome", verfasste dieses computersimulierte Drehbuch aufgrund von aktuellen Daten über den Zustand und die Zukunft der Welt. Bis heute sind von diesem Buch über 30 Millionen Exemplare in 30 Sprachen verkauft worden. 1973 wurde der "Club of Rome" dafür mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Seine Schlussfolgerung: Die Menschen fressen sich im direkten Wortsinn selbst auf. Zwar sind einige Vorhersagen Meadow´ inzwischen widerlegt, seine Forderung nach strikter Familienplanung vor allem in so genannten Dritte-Welt-Ländern sehr umstritten. Aber, so sagt der Wissenschaftler in einem Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" im November 2011: "Bei der Fördermenge von Erdöl ist der Wendepunkt seit 2006 erreicht... Es ist völlig undenkbar, dass Solar- und Windenergie das Öl ersetzen werden. Öl macht die große Mehrheit unseres Transportsystems aus. Bei der Nahrungsmittelproduktion pro Kopf ... ist der Höhepunkt in den 1990er Jahren überschritten ... Die Situation ist eher dramatischer geworden, wir wollen diesen schleichenden Prozess nur nicht wahrhaben". 2007 legte die von der UN eingesetzte Klimakommission (IPCC) ihren Klimabericht vor. Auch dem wurden massive Fehler nachgewiesen. Die Kernfrage bleibt: Ist das Klima von Menschenhand manipuliert oder befinden wir uns in einer natürlichen , erdgeschichtlichen Phase - sozusagen zwischen zwei Eiszeiten. Dass wir Menschen unsere Umwelt auf viele Art zerstören, Stichworte sind Vermüllung und Verseuchung der Meere, Abholzung von Regenwäldern, Ausbeutung von Rohstoffen etc., daran zweifelt niemand. Nach den Explosionen von Tschernobyl und Fukushima wurde die Energiedebatte weltweit immer dringlicher geführt. 2007 hat das Bundeskabinett die Reduktion von Treibhausgasen um 40% bis 2020 beschlossen. Nach dem politisch gewollten Ausstieg aus der Atomenergie wurde die Suche nach alternativer Energie vorrangig behandelt und mit staatlicher Subventionierung vorangetrieben (Erneuerbares Energiegesetz, EEG). Damit wurde die eigentlich sinnvolle Suche nach neuen Energieformen auch zu einem Spekulationsobjekt für Investoren. Jeder Steuerzahler finanziert die Förderung von Wind-, Solar-, Wasser-, Bio-Energie und anderen, unabhängig davon, wie aussichtsreich oder effektiv diese neuen Energien genutzt werden können. Im Bereich Solarenergie hat die Bundesregierung die Förderung bereits zurückgefahren. Quellenangabe: Ostfriesland Magazin 6/2012 - Seite 99 Hiobsbotschaften Die Überentwicklung Ich zitiere: "... Wie die Weltgesellschaft sich auf spektakuläre Weise selbst ans Ende ihrer Möglichkeiten bringt, können wir an der Klimakrise demonstrieren. Sie stellt ein besonderes (und besonders gravierendes) Krisenphänomen dar, das eng mit älteren wie dem Bevölkerungswachstum , der globalen Ernährungskrise, der Verschmutzung und Belastung der Umwelt und der Vergeudung von Ressourcen zusammenhängt. Die Klimakrise verstärkt diese Stressfaktoren und weist mit ihnen wiederum eine strukturelle Gemeinsamkeit auf, die man in einem Wort zusammenfassen kann: Überentwicklung. Die Kombination der einzelnen Krisen führt zu einer Metakrise, zur Infragestellung des komplexen Zusammenwirkens aller Teilsysteme und damit zur Gefahr eines Systemzusammenbruchs, der nur durch entschlossenes Gegensteuern abzuwenden ist. Das wird nicht erst seit der Finanzkrise vertagt, der Klimawandel hatte in der Wahrnehmung der Entscheidungseliten schon vorher keine 'systemische Relevanz'. Klimatische Veränderungen begleiten die gesamte Erdgeschichte, häufig in dramatischer Weise und mit katastrophalen Folgen. Klimastabilität gibt es ebenso wenig wie eine freundliche Natur. Und das Klima ist etwas anderes als das Wetter, dessen Launenhaftigkeit ein beliebtes Konversationsthema ist und manche, etwa nach einem (gefühlt) kühlen Sommer oder einem langen Winter, nicht an den langfristigen Wandel des Klimas glauben lässt. Wenn heute vom Klimawandel die Rede ist, meint man die Folgen der anthropogenen (vom Menschen gemachten) globalen Erwärmung und deren abrupten und ungewöhnlich steilen Anstieg seit den 1970er Jahren. Hauptursachen dafür sind die Verbrennung fossiler Rohstoffe, großflächige Entwaldungen und veränderte Nutzungen in der Landwirtschaft seit dem Beginn der Industrialisierung. Treibhauseffekt nennt man die Erwärmung der Oberflächentemperatur der Erde durch strahlungsaktive Gase. (...) Die Konzentration von Kohlendioxyd und Methan in der Atmosphäre liegt höher als jeder Wert in den vergangenen 650 000 Jahren. Die historische Erwärmung steht außer jedem Zweifel. Sie lässt sich am Anstieg der globalen mittleren Temperaturen der Bodenluft und Ozeane, am ausgedehnten Abschmelzen von Eis und Schnee und am Anstieg des mittleren globalen Meeresspiegels messen. Jahresdurchschnittstemperaturen werden seit 1850 aufgezeichnet; und es kann kaum Zufall sein, dass die elf der zwölf wärmsten Jahre seither in die Zeitspanne von 1995 bis 2007 fallen. (...) Hiobsbotschaften werden nie gerne entgegen genommen, und man hat die Erkenntnisse der Klimaforschung lange als Spekulation oder interessengeleitete Übertreibung, wenn nicht gar als grün- ökologisches Komplott abgetan. In der öffentlichen Diskussion wird meist übersehen, dass die Klimaforscher auf der Basis bereits gemessener Evidenz über Temperatur- und Meeresspiegelanstiege oder das Ausmaß des Gletscherschwundes argumentieren und ihre Messmethoden und die Datenbasis ständig erweitern und verfeinern. Modelle, Prognosen und Annahmen bilden die Grundlage für wissenschaftliche Erkenntnisse über und Warnungen vor den Folgen des weiteren Anstiegs der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere. Sie gibt es bereits seit gut 20 Jahren, und auch hier erhärtet sich die Evidenz mit zunehmender Präzision zu einem fast vollständigen Konsens in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und Politikberatung. Die regelmäßigen Sachstands- Berichte des UN- Weltklimarates (IPCC), die beides auf neuartige Weise kombinieren, haben dazu beigetragen, dass der anthropogene Klimawandel und seine Folgen die öffentliche Debatte erreicht haben, wenigstens zeitweise. (...) Die ungleiche Verteilung der Auswirkungen: Unterschiedliche Regionen, Länder und Bevölkerungsgruppen werden unterschiedlich schwer von Klimafolgen betroffen. Die ärmsten Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, sind häufig überdurchschnittlich stark betroffen und am wenigsten imstande, sich vor seinen Folgen zu schützen. (...) Insgesamt birgt die Ungleichverteilung der sozialen und ökonomischen Folgen der Klimaerwärmung gravierende Konfliktpotentiale in sich. ..." (Zitat Ende) Zitiert aus dem Buch: "Das Ende der Welt, wie wir sie kannten" von Claus Leggewie und Harald Welzer mit dem Untertitel: "Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie", Fischer Taschenbuch Verlag. Die Zitate stammen aus den Seiten 22 - 37. Ich empfehle Interessenten, dieses Buch zu lesen. Umweltgipfel in Rio +20 enttäuschend Erinnern Sie sich noch an Rio de Janeiro 1992? Die erste Konferenz dort galt als Wegbereiter des Umweltschutzes und war die Geburtsstunde der "Agenda 21". Ein ganzes Paket von Aktionen sollte die dringlichsten Probleme angehen und nicht weniger tun, "als die Welt auf die Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts vorzubereiten". 20 Jahre später treffen sich die Verantwortlichen für Umweltschutz wieder in Rio de Janeiro. Was hat sich in dieser Zeit wirklich verändert? Die Optimisten erzählen gerne ein paar Erfolgsgeschichten. So wurde das Ozonloch erfolgreich bekämpft und der Verbrauch der ozonschädlichen Substanzen ging seit 1992 um 93 % zurück. Es stieg die Zahl der Naturreservate und ein paar medienwirksame Tiere wie zum Beispiel seltene Tiger wurden vor dem Aussterben bewahrt. In vielen Großstädten hat sich zudem die Luftqualität verbessert, denn die am stärksten Schadstoffe emittierenden Regionen waren ja auch die am meisten geschädigten. Daraus ergaben sich schließlich lokale und regionale Motivationen, Emissionen zu reduzieren. Auch viele Flüsse sind sauberer geworden. Eine globale Trendwende ist hingegen nicht zu erkennen. So wurde die Produktion von Kunststoffen in den vergangenen 20 Jahren um 130% gesteigert. Davon wird etwa die Hälfe nicht wieder verwendet. Immer mehr Plastikmüll treibt sich in einigen Meeren je nach Strömungsverhältnissen massenweise herum. Die Nahrungsmittelproduktion wuchs um 45%, fast doppelt so stark wie die Weltbevölkerung, aber trotzdem hungern noch immer mehr als eine Milliarde Menschen. Zwei Entwicklungen sind aber besonders ernst zu nehmen: Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxyd ist seit 1992 fast kontinuierlich um insgesamt 36% gestiegen. Es sind vornehmlich die Schwellenländer, die 64% mehr Kohlendioxyd in die Atmosphäre entlassen, während die entwickelten Länder den Anstieg auf 8 % drosseln konnten. Das Kyoto Protokoll über eine rechtlich verbindliche Verringerung der Treibhausgase ist ausgelaufen, Nachfolgeverhandlungen sind nicht in Sicht. Auch verbesserte Technologien haben nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft klimafreundlicher wird. Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen werden weiterhin zerstört und führen Artensterben herbei. Nach dem Rheinischen Grundgesetz §1 brauchen wir uns nichts vorzumachen. "Et es wie et es". Und "Et kütt wie et kütt" (§ 2). Da macht der § 3 schon nachdenklicher: "Et hätt noch immer jot jejange". Wenn das man stimmt! Es liegt schon 40 Jahre zurück, dass mit einem der ersten Großrechner die Grenzen des Wachstums bewiesen wurden. Auf unserer begrenzten Erde ist kein grenzenloses Wachstum möglich. Irgendwann sind das Öl und andere wichtige Rohstoffe verbraucht. Böden sind ausgelaugt und die Meere leer gefischt. Luft und Wasser vergiftet. Die erwartete Katastrophe ist auf Grund technischer Fortschritte und neuer Rohstofffunde bislang noch nicht eingetreten. Jedoch wird der rheinische Optimismus auf mittlere Dauer mit Sicherheit nicht Recht behalten. Da ist es auch kein Trost mehr zu sagen: "Wat fott es es fott". (§ 4). Man muss schon sehr blind sein, wenn man im Angesicht der Probleme unserer Erde bei diesem Optimismus bleibt. Hinausgeschoben ist nicht aufgehoben. Es bleiben die Umweltgefährdungen und die düsteren Klimaprognosen. Die Grenzen des Wachstums sind uns näher gerückt. "Wat wellste maache?" (§ 7) Vor 20 Jahren gab es den Willen noch, etwas zu machen. 100 Regierungschefs mit Abordnungen aus über 170 Staaten in Rio. Damals wurde tatsächlich noch relativ viel erreicht. Klima- und Artenschutzabkommen beschlossen. Kommissionen wurden eingesetzt, die sich jedoch immer mehr als zahnlose Tiger entpuppten. Es fehlte ihnen der Biss. Der Schwung ist inzwischen ausgelaufen. Wie gut, dass jetzt 20 Jahre danach eine neue Mammutkonferenz am selben Ort stattfindet. (Rio plus 20). Sie ging am vergangenen Freitag zu Ende und dauerte nur lächerliche zwei Tage. Das Thema wiederum: Rettung der Erde und der Menschen darauf. Die Probleme sind dringender geworden. Aber US- Präsident Obama und Frau Merkel sind gar nicht erst dort hingefahren. Umweltminister Altmaier und Entwicklungsminister Niebel vertraten Deutschland. Von Rio plus 20 wurde allgemein nicht allzu viel erwartet. Auch die Umweltverbände haben längst zurückgesteckt. Sie befürchten, die Beschlüsse von heute würden niemandem mehr wehtun. Es gibt nur noch einen kleinsten gemeinsamen Nenner als deklarierte Lösung. Viele Forderungen und Ansätze sind weichgespült und man hört nur noch schöne Worte. Doch es gibt bekanntlich nichts Gutes, außer man tut es. Sind die Chancen nicht inzwischen vertan? Nun gibt es aber doch noch einen Artikel aus dem Rheinischen Grundgesetz, der auf unsere Situation passt (§ 5):"Et bliev nix wie et wor". Es wird sich in den nächsten Jahrzehnten viel ändern, zum Guten oder zum Schlechten. Es liegt in unserer Hand. Meine Beiträge zum Thema Klima Erdboden und Klimawandel Eis, Meer und Atmosphäre wirken zusammen und beeinflussen das Weltklima. Aber was passiert im Boden, wenn die Temperaturen steigen? Nimmt er weiterhin viel Kohlenstoff in seinen organischen Anteilen auf, oder setzt das Erdreich ihn verstärkt in Form von Treibhausgasen frei? Noch weiß die Wissenschaft wenig darüber. Viele Modellrechnungen, darunter auch solche, auf denen der Weltklimabericht aufbaut, lassen den Boden gleich ganz außen vor. Wahrscheinlich aber er ist seine Rolle im Klimaspiel tragender als gedacht. Milliarden Bakterien und andere Einzeller im Erdreich bestimmen, was geschieht. Sie verdauen abgestorbenes Grün und veratmen den Kohlenstoff daraus. Jedes Jahr strömen so geschätzte 60-80 Gigatonnen Kohlendioxid in die Luft, dazu noch Methan und Lachgas. In der Summe ist das mehr als zehnmal soviel wie die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Die weltweite Erwärmung heizt natürlich auch das Erdreich ordentlich ein. Die Bodenlebewesen könnten in kürzerer Zeit mehr Pflanzenmaterial abbauen und entsprechend mehr CO2 freisetzen. Dass es so kommt, ist aber nicht sicher. Prozesse im Boden laufen vergleichsweise engräumig ab. Im Ackerland passiert anderes als im angrenzenden Waldboden. An einem Ort regnet es viel, ein paar Kilometer weiter verdorrt das Gras. Gerade der Niederschlag ist viel schwieriger fass - und berechenbar als die Temperatur. Die Modelle, mit denen die Klimaforschung heute arbeitet, sind für all das viel zu großräumig angelegt. Derzeit erkunden Hamburger Wissenschaftler Moore und Permafrostböden Sibiriens. Sie gelten als mögliche tickende Zeitbomben für einen verschärften Klimawandel. In diesen Regionen hat der Boden jahrtausendelang als Senke gewirkt und Kohlenstoff aufgenommen. Die Moore speichern es, weil das Grundwasser dort sehr hoch steht: viel Wasser bedeutet wenig Sauerstoff, die Mikrolebewesen sind nur wenig aktiv. Beim Permafrost ist es die Kälte, die die Organismen und damit den Abbau von organischem Material bremst - und wiederum der hohe Wasserstand. Im Sommer taut der Boden etwa einen halben Meter tief auf. Das Schmelzwasser steht auf dem Eis darunter und hemmt das Bodenleben zusätzlich. Laut Berechnungen ist in den Mooren genug Kohlenstoff für umgerechnet etwa 550 Gigatonnen CO2 gebunden. Die Dauerfrostböden bergen gar 1700 Gigatonnen Kohlendioxid. Zum Vergleich: in der gesamten oberirdischen Pflanzendecke der Welt stecken "nur" 650 Gigatonnen CO2. Dauerfrostböden mit Temperaturen um den Gefrierpunkt könnten ab 2100 großräumig auftauen und die gespeicherten Treibhausgase in die Luft entlassen. Das betrifft etwa die Hälfte des heutigen Permafrost- Gebietes. Auch Torfböden setzen Klimagas frei: beim ständigen Auftauen und wieder Gefrieren des Bodens werden dessen oberste Schichten stofflich durchmischt. Dabei wird Lachgas freigesetzt, das sogar noch 300mal klimawirksamer ist als CO2. Die arktische Erwärmung kurbelt diesen Prozess noch weiter an, fanden letztes Jahr finnische und russische Forscher heraus. Ein gewaltiges Klimarisiko, glauben viele Fachleute. Wärmere Temperaturen bedeuten aber auch längere Wachstumsperioden. Die Pflanzendecke und der Moorgürtel könnten weiter Richtung Norden rücken, wo heute noch Permafrost ist. Das neue Grün verbraucht wiederum CO2. Somit kann es auch Gegeneffekte geben, welche die Ausgasung teilweise wieder aufheben. Vielleicht überwiegen sie sogar. Die Forschung müsste die Klimafolgen somit ganzheitlicher betrachten. Zunächst einmal müssen die Daten in die großen Modelle gefüttert und diese neu durchgerechnet werden. Erst dann lässt sich sagen, welche Bedeutung dem Boden wirklich für das Weltklima zukommt. Es bleibt also dabei: noch immer wissen wir über einen bevorstehenden Klimawandel viel zu wenig und sollten deshalb keine Horrorszenarien zeichnen. Den Erdboden unseres Planeten sollten wir ab sofort stärker als bisher in unsere Modellrechnungen zur Klimaentwicklung mit einbeziehen. Denn er besitzt ein Einwirkungspotenzial, das größer zu sein scheint als wir bisher erwartet haben. Erdklima konstant ? Obwohl vor Milliarden von Jahren die Sonne um 30 Prozent schwächer strahlte als heute, gab es schon damals ausgedehnte eisfreie Ozeane. Auch war die CO²Konzentration gleichmäßiger als bislang angenommen. Für die Entwicklung von Klimamodellen ist das eine wichtige Erkenntnis. Ein Rätsel der Klimageschichte ist gelöst. Nicht eine hohe Konzentration von Treibhausgasen, sondern größere Ozeane und fehlende Wolken ermöglichten schon vor über 2,5 Milliarden Jahren flüssiges Wasser auf der Erde - trotz einer deutlich geringeren Sonnenstrahlung als heute. Das haben dänische Geologen durch die Analyse von Gesteinsproben aus einem 3,8 Milliarden alten Felsen in Grönland herausgefunden. Zudem sei die CO²-Konzentration über Milliarden von Jahren konstanter gewesen als bisher angenommen - eine speziell für die Entwicklung von Klimamodellen wichtige Erkenntnis. (...) Seit die Sonne vor 4,5 Milliarden Jahren entstand, nimmt ihre Strahlungsleistung kontinuierlich zu. So war sie im Archaikum - also von 4 bis 2,5 Milliarden Jahren - etwa 30 Prozent schwächer als heute. Unter heutigen Bedingungen würde bei einer solchen Reduktion die Durchschnittstemperatur der Erde um etwa 23 Grad sinken und Wasser wäre nur noch als Eis vorhanden. Geologische Strukturen belegen aber, dass Wasser bereits in der frühen Erdgeschichte in flüssiger Form vorkam und das Klima relativ mild war - dieser Widerspruch wird auch das "Paradoxon der schwachen jungen Sonne" genannt. Ein Erklärungsansatz besagt, dass die Konzentration des Treibhausgases CO² vor vier Milliarden Jahren ein Vielfaches der heutigen betrug: Bis zu 30 Prozent der Erdatmosphäre sollen damals aus CO² bestanden haben. Dies kann nach Ansicht der Forscher um Rosing aber nicht stimmen, denn sie stießen in einem 3,8 Milliarden Jahre alten Felsen in Grönland auf zahlreiche Eisenoxide und Eisenkarbonate, so genannte Magnetite und Siderite. Diese Mineralien werden nur in einem bestimmten Bereich der CO²-Konzentration häufig gebildet, bei hohen Konzentrationen entstehen bevorzugt andere Mineralien. Die Proben verrieten, dass das Treibhausgas im Archaikum nur in etwa dreifach höherer Konzentration in der Atmosphäre vorkam als heute - zu wenig, um die schwache Sonnenstrahlung zu kompensieren. Mit Computermodellen testeten die Wissenschaftler darum, wie die Wolkenbedeckung und das Verhältnis der Landmassen zu den Ozeanen die Temperatur beeinflusst haben könnten. Ergebnis: Bei sehr geringer Bewölkung und kleineren Landmassen bleibt die Durchschnittstemperatur trotz niedriger Strahlung auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Vor allem tiefe Wolken schicken einen großen Teil der Sonnenstrahlung ins All zurück, wodurch weniger Energie auf der Erde ankommt. Eine ähnliche Wirkung haben die Kontinente, die im Vergleich zu den Ozeanen einen höheren Anteil der Strahlung reflektieren. Die Erkenntnisse seien auch für die Vorhersage des zukünftigen Klimas wichtig, betonen die Wissenschaflter. So müsste in Klimaberechnungen berücksichtigt werden, dass die CO²Konzentration über Jahrtausende konstanter gewesen sei als bisher angenommen. Genauigkeit der Werte Nach Ansicht der Forscher liegen die berechneten Werte ziemlich nahe an den tatsächlichen Werten im Archaikum: Es ist nämlich bekannt, dass die Ozeane in diesem Erdzeitalter eine größere Ausdehnung hatten als heute. Zugleich ist eine geringere Wolkenbedeckung für diese Zeit plausibel, denn die Wolken bilden sich nur, wenn Wasser an kleinen Partikeln - so genannten Kondensationskeimen - kondensieren kann. Diese entstehen größtenteils aus von Pflanzen und Algen ausgestoßenen Gasen. Solche Lebewesen waren im Archaikum jedoch noch nicht sehr verbreitet. Klimaänderungen ? - Hitzesommer 2003 Seit Beginn der Industrialisierung in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist eine stetige Zunahme der "treibhauseffekt- relevanten Spurengase" zu beobachten. Allein die KohlendioxidKonzentration stieg von 2,8 Hundertstel Volumenprozent im Jahre 1750 auf 3,7 Hundertstel Volumenprozent heute und liegt damit 40% über dem damaligen Wert. Eine ähnliche Zunahme der Konzentration ist auch bei anderen Spurengasen zu verzeichnen. Es liegt also nahe, dass es auf der Erde wärmer werden muss. Tatsächlich konnte man nachweisen, dass etwa 0,6 bis 1 Grad der beobachteten Erderwärmung mit Sicherheit auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Damit bewegt und die Frage sehr, wie es wohl mit den klimarelevanten Spurengasen künftig weitergehen wird. Da man diesbezüglich keine verlässlichen Prognosen erstellen kann, verwendet man verschiedene Denkmodelle, so genannte "Szenarien". Diese enthalten Annahmen über den zukünftigen sozioökonomischen Wandel. Dazu gehören die Entwicklung der Weltbevölkerung, ihr Lebensstandard und ihre Technologien und damit ihr Energiebedarf und insbesondere auch der Einsatz von alternativen Energien. Inzwischen hat sich der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) auf vier "Markerszenarien" geeinigt. Das zu ihnen gehörende Szenario A1B zum Beispiel beschreibt eine künftige Welt mit raschem Wirtschaftswachstum, einer Trendumkehr in der Weltbevölkerungszahl, schneller Einführung neuer und effizienter Technologien, einem Ausgleich regionaler Unterschiede in Lebensstandard und Einkommen und ausgeglichener Nutzung aller Energieträger. Ein solches Szenario kann man dann zur Steuerung eines Klimamodells benutzen und damit das Klima unter den Bedingungen des betreffenden Szenariums berechnen. Ein Klimamodell ist - sehr vereinfacht ausgedrückt - ein System von physikalischen, teilweise auch chemischen und biologischen Gleichungen, mit dessen Hilfe man die klimatischen Vorgänge an den Maschepunkten eines über die Erde gespannten imaginären Gitters berechnen kann. So kommt man zu Aussagen über die künftige Entwicklung von Temperaturen, Niederschlägen, Schneegrenzen, Gletschern und die Höhe des Meeresspiegels. Die Berechnungen deuten zum Beispiel auch darauf hin, dass künftig extreme Wettererscheinungen häufiger auftreten könnten. Zum Schluss möchte ich deshalb an ein solches Extremwetter hier in Deutschland und Europa erinnern, und zwar an den Hitzesommer 2003. Damals begann bereits der Frühsommer mit Wärmerekorden. So lag die Mitteltemperatur des Junis mit 19,1 Grad vier Grad über dem Normalwert. Es war der wärmste Juni seit dem Jahre 1901. Das heiße, sonnige und zu trockene Wetter setzte sich im Juli und August fort. Das Thermometer kletterte im Raume Nürnberg am 8. August auf 40 Grad C. Im Oberrheingebiet wurde 54 Tage mit über 30 Grad registriert und 84 Sommertage mit über 25 Grad. Die Niederschläge erreichten landesweit nur 30% der langjährigen Mittelwerte. Jene Hitzewelle 2003 wütete in fast ganz Europa, am extremsten in Südfrankreich. Frankreich hatte 14 000 Hitzeopfer zu beklagen. In Portugal wurden durch Brände 40% des Waldbestandes vernichtet. Die Donau führte so wenig Wasser, dass Schiffe zum Vorschein kamen, die im 2. Weltkrieg versenkt worden waren. Damals wurden uns weitere derartige Hitzesommer prophezeit, die jedoch bislang ausblieben. Vielleicht war diese extreme Witterung ja doch nur ein Einzelfall, ein sog. Ausreißer, also noch kein Hinweis auf eine bevorstehende Klimaänderung in Deutschland. Das Himalaya- Debakel Die Gletscher im Himalaya bedecken eine Fläche von 500 000 Quadratkilometern! In seinem 2007 veröffentlichten Bericht hatte der "Weltklima-Rat" unter Berufung auf die Umweltschutzorganisation WWF vorausgesagt, dass die Gletscher im Himalaya bis zum Jahr 2035 von 500 000 auf 100 000 Quadratkilometer zusammenschmelzen, sollte die Erderwärmung ihr Tempo beibehalten. Mehreren Klimaforschern, die zum Teil selbst an dem Report mitgearbeitet haben, erschienen diese Angaben angesichts der gewaltigen Eismassen schwer nachvollziehbar. Bei ihrer Spurensuche entdeckten sie, dass die Mengenangaben auf eine einzige Quelle zurückzuführen sind - nämlich auf ein Interview, das ein indischer Gletscherforscher 1999 einem populärwissenschaftlichen Magazin gegeben hatte. Brisant wurde diese Vorhersage aber erst durch den kurzen Zeitraum. Der Termin 2035 ist zu allem Überfluss ein Schreibfehler. Ein angesehener russischer Gletscherforscher hat vor 14 Jahren errechnet, dass bis 2350 die Eismassen im Himalaya auf ein Fünftel schrumpfen könnten. WWF International ist die Angelegenheit höchst peinlich. Die Umweltschützer bedauern, dass eine solch irrige Information geliefert wurde und für die entsprechende Konfusion gesorgt habe. Der Weltklima- Rat muss somit jetzt einräumen, dass seine Voraussage über bald abschmelzende Gletscher auf dem Dach der Welt fragwürdig ist. So fordern die Klimaschützer, wissenschaftliche Thesen strenger zu überprüfen, sonst könnte eventuell in einigen Jahren nach diesem "Himalaya - Debakel" ebenso ein Meeresspiegel- oder CO2 Debakel folgen. Für die Menschen am Ganges handelte es sich somit um eine unberechtigte Panikmache, als man ihnen prophezeite, ihr Fluss würde in regenarmen Zeiten bald nicht mehr genug Wasser liefern, um ihre Felder zu bewässern und ihnen damit ihre Lebensgrundlage entziehen. Nun muss man wissen, dass der Weltklima-Rat keine eigenen Forschungen anstellt, sondern die neuesten wissenschaftlichen, technischen und sozioökonomischen Erkenntnisse verarbeitet, die zum Verständnis des Klimawandels notwendig sind. Die Überprüfung der verwendeten Daten ist wesentlicher Bestandteil des IPCC- Prozesses. Dem "Intergovernmental Pannel on Climate Change", als dem "Zwischenstaatlichen Rat zum Klimawandel", gehören mehrere tausend Forscher von allen Kontinenten an. Der WeltklimaRat hingegen ist eine weltumspannende Arbeitsgemeinschaft von Wissenschaftlern, die 1989 von der UN- Umweltbehörde und der Weltorganisation der Meteorologen ins Leben gerufen worden ist. In ihrem ersten Report belegten die Experten 1990 die Dringlichkeit des Problems, was unter anderem ein Anstoß für den "Erd-Gipfel" von Rio 1992 und die folgenden internationalen Klimaschutzbemühungen war. Der IPCC- Report von 1995 lieferte die wissenschaftliche Fundierung für das Kyoto- Protokoll, in dem sich die meisten Industriestaaten zur Senkung ihrer Treibhausgasemissionen verpflichteten. Den bislang letzten Bericht veröffentlichte der Rat im Jahre 2007. Kurz vor dem Klimagipfel von Kopenhagen im Dezember vorigen Jahres legten 26 Forscher eine "Kopenhagen- Diagnose" vor, welche die Lücke bis zum nächsten Report füllen soll, der nicht vor 2013 zu erwarten ist. In diesem Diagnosepapier steht unter anderem, dass der Anstieg der Meeresspiegel deutlich stärker ausfallen dürfte als vom IPCC 2007 vorausgesagt. Warten wir ab. Hoffen wir auf ein "Meeresspiegel- Debakel" in einigen Jahren zum Wohle aller Menschen, die dicht über dem Meeresniveau leben! Zu viele Wissenschaftler verderben die Klimadebatte (2) Und das Geld spielt wie überall eine wichtige Rolle Im letzten Funkwetterbericht ging es um eine Panne, einen Fehler, vielleicht sogar um eine unverzeihliche Schlamperei des Weltklimarates, der behauptet hatte, dass die HimalayaGletscher bis zum Jahre 2035 infolge der Klimaerwärmung vollständig abschmelzen könnten. Es handelt sich hierbei um einen kapitalen Irrtum. Allein die Jahreszahl 2035 entpuppte sich als Zahlendreher und wurde von einem russischen Wissenschaftler vor über zehn Jahren mit 2 3 5 0 angegeben. Bis dahin, so dieser Wissenschaftler, könnten die Eismassen auf dem Himalaya bis zu einem Fünftel abgetaut sein. Der Chef des Weltklimarates geriet somit ins Zwielicht, denn sein Institut kassierte viel Geld für die zweifelhafte Behauptung vom Schmelzen der Himalaya- Gletscher. Von seinen Kritikern muss sich der Weltklimarat nun vorwerfen lassen, die These von der globalen Erderwärmung mit vermeintlich getricksten Beispielen öffentlichkeitswirksam zu untermauern. Viele Menschen glauben jetzt, wenn die "da oben" schon solch einen Fehler machen, wie verlässlich ist dann der Rest? Positiv zu bewerten ist, dass es nun eine Untersuchung geben wird oder jemand seinen Job verliert. Tatsache aber ist, dass die Glaubwürdigkeit des Weltklimarates und seiner Arbeit enorm beschädigt wurde. So müssen die Arbeitsprozesse nun grundsätzlich überprüft und Kontrollsysteme verschärft werden. Man muss bedenken, dass an den ersten Reporten des Weltklimarates nur sehr wenige ausgesuchte Wissenschaftler mitgearbeitet haben. Es gab noch eine überschaubare Menge von Datenmaterial. Im Laufe der Zeit hat sich die Zahl der beteiligten Forscher deutlich vergrößert und wir sehen uns einer Flut von Datenerhebungen gegenüber. Wir müssen sehr viel vorsichtiger werden als wir es bislang waren. Die ohnehin schon sehr angeheizte Debatte über den Klimawandel kann nicht sehr viele Fehler dieser Art vertragen. Viele Wissenschaftler wollen vielleicht etwas zu engagiert beweisen, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht ist, weil für die Welt so viel davon abhängt. Viele Forscher haben die Erfahrung gemacht, je drastischer sie sich äußern, desto stärker werden sie wahrgenommen. Das hebt das Ansehen und schlägt sich mitunter auch in der Aufstockung von Geldern nieder. So wurde zum Beispiel 2009 ein EU- Forschungsprojekt über Gletscher im Himalaya mit drei Millionen Euro dotiert, wodurch nicht nur Forscher in Indien, sondern auch hier im Westen profitierten. Bereits 2008 gewährte die New Yorker Carnegie Corporation dem indischen Forschungsinstitut eine halbe Million Dollar. Damit sollten die Folgen des angeblichen Gletscherschwundes für die indische Trinkwasserversorgung, für Energietechnik, Landwirtschaft und Industrie erforscht werden. Einer - wie sich nun gezeigt hat - sehr zweifelhaften Studie zufolge würden die meisten Gletscher in der Region innerhalb der nächsten Jahre als Folge der globalen Erwärmung verschwinden. Das Geld wurde über das isländische Institut "Global Center" vermittelt, das mit dem indischen Forschungsinstitut längst lukrativ zusammenarbeitet. Alle Klimaforscher sollten sich darauf zurückbesinnen, dass jede Hypothese nur so lange gültig ist, bis sie falsifiziert worden ist. Auch die Angabe der globalen Durchschnittstemperaturen und erst recht deren künftigen Vorhersagen sind nicht verlässlich genug, da die Modelle eben nicht perfekt sind. Sie sind zwar die besten, die wir zurzeit haben und können uns auf jeden Fall wichtige Hinweise geben. Aber es bleibt immer ein gewisses Maß an Unsicherheit. Klaus Hoffmann unter Verwendung von Artikeln aus der "Rheinischen Post" und dem "Kölner-Stadtanzeiger" . Kalt trotz Klimawandel Der extreme Winter in Deutschland ist ein Einzelereignis Es bleibt dabei: Die Jahre von 2000 bis 2009 bilden das wärmste Jahrzehnt seit 130 Jahren Am 20. Dezember fiel massenhaft Schnee und legte den Flugverkehr lahm. Ein Hoch über Russland hatte zuvor eiskalte und trockene Kontinentalluft nach Europa getragen. Es kam zu Rekord-Tiefsttemperaturen. Am 20.12. brachte dann ein Tief milde und feuchte Luft von der Nordsee mit sich. Im Mischungsbereich jener Luftmassen kühlte sich die milde Luft stark ab und kondensierte aus - auf Grund der Kälte fiel statt Regen also Schnee. Beim Regen kann man die Mengen nicht so deutlich erkennen wie beim Schnee. Schnee führt somit stets zu dramatischeren Schlagzeilen, zumal er den Verkehr stärker behindert als eine entsprechende Regenmenge. Und jetzt zum Jahreswechsel 2009/10 hat sich eine neue Kälteperiode eingestellt. Mit Klimaänderung hat dies alles nichts zu tun. Jene Wettervorgänge sind Einzelereignisse und Momentaufnahmen. Man bezeichnet dies als aktuelles Wetter. Wetter ist übrigens immer nur aktuell! Hält sich dies über mehrere Tage oder sogar Wochen, spricht man von "Witterung". Wir erwarten somit aktuell in diesem Januar eine vorherrschend kalte Witterung. Und diese kann zur selben Zeit gar nicht so weit entfernt ganz anders sein. So herrschte in unseren frostigen Dezember-Tagen 2009 in Skandinavien eher ein mildes Winterwetter. Im Schnitt gleicht sich dies wieder aus. Klimaänderungen kann man nur global betrachten. Dazu benötigt man Weltwetter-Angaben von mindestens 30 Jahren. Klima ist statistisches Wetter. Es besteht nur aus statistischen Messwerten. Wenn ein Italiener bei 35 Grad sich in die kühlenden Fluten stürzt und zur selben Zeit im Winter auf der Südhalbkugel ein Obdachloser unter einer Brücke in Brasilien erfriert, so ist der Mittelwert beider Temperaturen durchaus erträglich (17 Grad). Damit könnte man leben! Kein schlechtes Klima! Aber wie gesagt, man braucht mindestens 30 Jahre für eine Statistik, die beginnt seriöser zu werden. Vergessen Sie also sehr schnell, unser derzeitiges Wetter in Deutschland mit einer Klimaerwärmung in Verbindung zu bringen! Die vergangenen kalten Tage ändern nichts daran, dass die Durchschnittstemperaturen in Deutschland gestiegen sind. Das Mittel der Jahrestemperatur in Deutschland lag zwischen 1961 une 1990 bei 8,2 Grad. Seit 2000 stiegen die Durchschnittstemperaturen jedoch an und erreichen in diesem Jahr (2009) sogar 9,2 Grad. 2007 wurde sogar ein Rekordwert von 9,9 Grad ermittelt. Die Werte in den einzelnen Bundesländern fallen übrigens unterschiedlich aus. Die kalten Tage vor Weihnachten sind somit ein Ausreißer. Ebenso die jetzigen im Januar. Der November war übrigens mit 7,3 Grad sogar um 3,3 Grad zu warm. Er gehört somit zu den drei wärmsten Novembermonaten in Deutschland seit 1881. Der gesamte Herbst 2009 war zu warm, hat jedoch den Rekord von 2006 nicht ganz erreicht (12 Grad gegenüber einem Mittel von 9,5 Grad). Es gibt eine sehr alte Bauernregel, die besagt, dass einem sehr milden November ein kalter Januar folgt, einem kalten November hingegen ein milder Januar. Eine weitere Bauernregel stellt fest, dass einem kalten Januar auch ein zu kalter Februar folgt. Aber das nur nebenbei. Jene Regeln entstanden in einer Zeit, als der Mensch beim Wetter noch nicht mitmischte. Es bleibt dabei: Wetter und Klima darf man nicht verwechseln. Klimawerte bestehen aus gemittelten Wetterdaten über mindestens 30 Jahre, am besten 100 Jahre - dann werden sie aussagekräftiger. Wenn sich Klimadaten verändern, kann man damit rechnen, dass sich ebenfalls die zu erwartenden Wetterereignisse ändern, die wie stets aus den uns bekannten Elementen bestehen wie Wind, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck usw. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, einzelne Wetterereignisse als relevant für oder gegen die derzeitige Klimadikussion anzuführen. Unser Verhalten sollte vielmehr geprägt sein von der Überzeugung, dass wir einfach noch zu wenig darüber wissen, inwieweit wir selbst mit unserer Treibgasemission zu einer globalen Erwärmung beitragen. Dies einfach dem Zufall zu überlassen und sozusagen nur mal auszuprobieren, was unsere Atmosphäre in den nächsten Jahrzehnten so macht, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist ethisch nicht vertretbar, mal ganz abgesehen von unserer Verpflichtung, den alten fossilen Energieträgern möglichst bald abzuschwören und dafür Alternativen zu entwickeln, die wir als Chance betrachten sollten, weltweit mit innovativen Techniken Arbeitsplätze zu sichern und neu zu schaffen. Klimaerwärmung als Chance. Klima hat sich immer wieder verändert. Das ist natürlich. Klima wird sich auch in Zukunft verändern, auch ohne unsere Einwirkung. Warmzeiten waren früher sogar Segenszeiten für die Menschheit. Dafür gibt es viele historische Belege. Dass wir inzwischen dabei sein könnten, das Klima (anthropogen) zu beeinflussen, führt zu einem Unsicherheitsfaktor im künftigen Wettergeschehen, der beunruhigend ist, erst recht im Hinblick auf die Lebensqualität unserer Nachkommen. Diese sollten niemals eine Klage gegen uns erheben können, wir hätten leichtfertig und egoistisch gehandelt. Wir hätten es doch besser wissen und dem entsprechend handeln müssen. Kopenhagen war leider bisher nur die Fortsetzung einer diesbezüglichen Bewusstseinsänderung. Daraus müssen bald rechtliche und allgemein verbindliche Taten hervorgehen. Zu spät? Sagen wir fünf nach zwölf. DL5EJ, 23. Dezember 2009 Gebremster Anstieg Schmelzende Westantarktis erhöht Meeresspiegel weniger stark Von Volker Mrasek Glaziologie Unter den Eisschilden am Südpol gilt der der Westantarktis als anfällig für den Klimawandel. Bislang gingen die Forscher davon aus, dass eine abschmelzende Westantarktis den Meeresspiegel um fünf Meter ansteigen lassen würde. Tatsächlich, so schreiben Geophysiker jetzt in "Science", sind es nur gut 3,5 Meter. Dass der Meeresspiegel um rund fünf Meter steigt, wenn die Eishülle der West-Antarktis abschmilzt - diese Zahl stammt aus einem vielbeachteten Fachartikel. Doch der Aufsatz ist mittlerweile leicht angestaubt. Er stammt aus dem Jahr 1978. "Es wäre längst möglich gewesen, diese Angaben zu überprüfen. Denn die Datenlage hat sich immer weiter verbessert. Es kamen immer genauere Messungen zur Geometrie des Eispanzers und der Landoberfläche darunter hinzu." Jonathan Bamber hat das jetzt nachgeholt. Der Geophysiker und Eisexperte von der Universität Bristol in England wertete die neuesten Messdaten von Satelliten und Flugzeugen aus, gemeinsam mit Kollegen aus den Niederlanden. Die Forscher kommen zu dem Schluss: Wenn der west-antarktische Eisschild kollabiert, steigt der Meeresspiegel nicht um fünf Meter, sondern allenfalls um 3,30 Meter. Bamber: "Nach unseren Berechnungen sind größere Eis-Bereiche in der West-Antarktis stabil, als man bisher dachte. Es ist vorwiegend Eis in Regionen, in denen das darunterliegende Grundgestein über dem Meeresspiegel liegt. Es hat praktisch keinen Kontakt zum Ozean. Das gilt für das meiste Eis in der Ost-Antarktis - und auch für etwa ein Viertel des Eises im Westteil des Kontinentes." Die West-Antarktis ist ein Phänomen. Man muss sich ein Landgebiet vorstellen, das größtenteils unter dem Meeresspiegel liegt. Im Zentrum gibt es regelrechte Tiefsee-Täler. So kommt es, dass der mächtige west-antarktische Eispanzer nicht nur über 2.000 Meter hoch in den Himmel aufragt; er füllt auch die Landsenken unter der Wasseroberfläche aus, zum Teil bis in 2,5 Kilometer Tiefe. Das macht es so gefährlich für die West-Antarktis. Ein Ozean, der sich erwärmt, kann praktisch immer weiter landeinwärts vorstoßen und immer mehr Eis dazu bringen, sich vom Grundgestein zu lösen und abzuschmelzen. An diesem Modell rüttelt auch die neue Studie nicht. Doch ihr zufolge werden zwei große Eiskappen erhalten bleiben, denen eine Meereserwärmung nichts anhaben kann - die eine 600, die andere 200 Kilometer lang. Daher am Ende der geringere Meeresspiegelanstieg. Sind das endlich einmal gute Nachrichten aus dem Treibhaus Erde? Nicht unbedingt, findet Eric Ivins, Geophysiker vom California Institute of Technology in Pasadena: "Auch ein Meeresspiegelanstieg von drei Metern ist eine extrem schlechte Nachricht. Selbst ein halber Meter wäre schon verheerend für viele Küstenstädte. Wir können allerdings nicht vorhersagen, wie schnell oder wie langsam eine Eisschmelze in der West-Antarktis abliefe. Es wird darüber spekuliert, dass es mehrere hundert Jahre dauern würde. Es könnten sogar über 1000 sein. Das wäre die bessere Nachricht." Eine andere, nicht minder wichtige Frage: Wann kommt der Prozess in Gang? Könnte das sogar schon heute sein? Forscher wie Ivins und Bamber sehen aktuelle Entwicklungen in der West-Antarktis durchaus mit Sorge. Bamber: "Haben wir bereits Anzeichen für einen möglichen Kollaps des Eisschildes? Ich denke, die Antwort auf diese Frage lautet. Ja! In den letzten zehn Jahren gab es zum Teil dramatische Eisverluste im Amundsen-Meeressektor. Das ist eine Region, die auch in unseren Szenarien von einem Kollaps des Eispanzers als besonders kritisch hervortritt. Ich behaupte nicht, dass es definitiv schon so weit ist. Aber was ich sage, ist: Es gibt sehr ernstzunehmende Warnsignale." Daher auch der Appell der Forscher: Die Welt sollte das, was in der West-Antarktis geschieht, weiterhin genau im Auge behalten. Klima und Wetter In der gegenwärtigen Klimadiskussion bemerke ich oft, dass die Begriffe "Klima" und "Wetter" immer wieder durcheinander gebracht werden. Dazu möchte ich folgendes sagen: Das Klima setzt sich aus verschiedenen Wetterelementen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschlag, Sonnenscheindauer, Luftdruck, Schneehöhe, Strahlung und Verdunstung zusammen. Das ist der Punkt, wo Wetter und Klima oft unbemerkt vermengt werden. Fast alle diese Elemente können wir nämlich mit unseren Sinnesorganen fühlen. Aber was wir stets fühlen, das ist das Wetter, und nicht das Klima. Wetter ist nämlich definiert als der "aktuelle Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt". So war z. B. das heftige Gewitter hier in Kempen am Abend des Karsamstags ein markanter Wettervorgang, fast sogar ein Unwetter. Mit unserem Klima in Kempen hatte dies aber nichts zu tun, da solche Wetterereignisse in unserer Region sehr selten auftreten, also bloße "Ausreißer" darstellen. Das Wetter ist hochgradig variabel, denn genau das zeichnet unser Wetter aus. Mal ist es heiß, mal kalt, mal fällt Regen, mal herrscht ruhiges Hochdruckwetter mit Sonnenschein, dann kommt es wieder zu Gewittern oder zu Stürmen. Das gemittelte Wetter ist also kein Normwetter. So etwas gibt es nicht. "Beim Wetter ist die Abweichung von der Norm die Norm"! (Sven Plöger) Die Aufgabe des Begriffs Klima ist es nicht, ein Normwetter aufzustellen. Klima ist nur ein statistisches Konstrukt, das hilfreich und notwendig ist, da man sich schließlich nicht alle Wetterlagen über alle Ewigkeiten merken kann. Sven Plöger führt dazu in seinem neuen Buch (siehe "Wetterliteratur") folgendes an: "Die zwei folgenden Beispiele zeigen, was passiert, wenn man Wetter und dessen Mittelwert verwechselt. Lassen Sie uns zunächst die zeitliche Mittlung anhand eines Januarmonats betrachten: Der Januar hat an vielen Orten Deutschlands ein Temperaturmittel von 0 Grad. Jetzt stellen Sie sich einen speziellen Januar vor, der in der ersten Monatshälfte stets Temperatur von + 20° aufweist und in der zweiten Monatshälfte stets - 20°. Ein wettermäßig wohl unglaubliches Ereignis, von dem man noch jahrelang sprechen würde. Doch das Mittel ist exakt 0 Grad. Dieser verrückte Januar würde also zu einem "Normmonat. Eine groteske Aussage. Bei der räumlichen Mittelung passiert etwas Ähnliches. Wenn Sie hier in Deutschland nach der Qualität des Winters 2007/2008 fragen, würde wohl fast jeder sagen, der sei ja quasi ausgefallen, und würde möglicherweise auf den Klimawandel verweisen. Aber fragen Sie das Gleiche mal einen Chinesen. Nach der wochenlang währenden Schneekatastrophe im gleichen Winter 2007/2008 und nach vielen neuen Kälterekorden würde der Chinese Ihnen wohl eine dramatisch andere Antwort geben und wohlmöglich eine herannahende Eiszeit fürchten. Und so können sich die Wärme bei uns und die Kälte dort im Mittel genau ausgleichen. Doch Sie selbst können das räumliche Mittel des Wetters nicht fühlen, weil Sie ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können." Zudem fühlt jeder Mensch das Wetter anders. Der Landwirt hat z.B. eine andere Einstellung zum Regen als ein sich nach Wärme und Sonne sehnender Urlauber. Auch unser Erinnerungsvermögen an vergangene Wetterereignisse ist ein recht "gefärbter" Prozess. Die Hirnforschung macht manches erklärbar. Doch eine Abhandlung darüber würde an dieser Stelle zu weit führen. In unserem Alltag fällt uns die Trennung der Begriffe Wetter und Klima wirklich schwer, weil wir eben täglich das Wetter erleben. Klima ist also kein "Normalwetter", sondern eine Mittelung von Werten. In jener statistischen Mittelung kann es beim Wetter jede Menge Ausreißer geben. Diese können durchaus in einer Größenordnung von 80 - 90 % liegen. Aus den statistischen Mittelwerten darf man also nicht auf einen Erwartungswert des Wetters schließen. Daraus lässt sich folgern, dass die Variabilität des Wetters sehr groß ist. Der Begriff des Klimas kann also nicht dafür herangezogen werden, ein Normalwetter zu "erfinden". Der Klimaschutz erfordert somit ein nachhaltiges Handeln, und so muss man zunächst von solch wenig sinnvollen und gänzlich unphysikalischen Denkweisen wegkommen. Zum Erfolg kann nur führen, wenn man Wetter und Klima klar voneinander trennt. Der Wasserdampf als wichtigstes "Treibhausgas" Der Wasserdampf ist ein unsichtbares Gas, das unserer Lufthülle in wechselnden, von der Temperatur abhängigen Mengen beigemischt ist. Wasser kommt in den drei Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig auf unserem Planeten vor. Zwischen diesen Zuständen kommt es weltweit zu Energie-Übergängen. Wegen der großen Wärmekapazität des Wassers wird zunächst einmal recht viel Wärmeenergie benötigt, um die Wassertemperatur zu erhöhen. Das Festland hat dem gegenüber eine recht geringe Wärmekapazität. Daher rührt es, dass das maritime Klima im Sommer relativ kühl, im Winter relativ warm sich gestaltet. Beim Kontinentalklima ist es umgekehrt. Sollte sich unsere Lufthülle erwärmen, dauert es viele Jahre, bis sich die Wassertemperaturen der Ozeane durch Kontakt mit der Luft langsam aufheizen. Ein schnelleres Erwärmen des Wassers wird zudem durch die Meeresströmungen verhindert, die das Wasser ständig durchmischen. Die gemittelte Wassertiefe aller Ozeane beträgt nämlich dreitausend Meter. Damit lässt sich auch die Feststellung erklären, warum der CO2 - Anstieg erst viele Jahre nach einer Klimaerwärmung erfolgt. Das Wasser reagiert träge und gibt Kohlendioxyd infolge seiner Erwärmung erst bis zu 500 Jahre später an die Atmosphäre ab. Viel Sonnenenergie wird benötigt, um Wasser zu verdunsten. Die Verdunstung wird zudem bei höheren Temperaturen beschleunigt. Kondensiert jener Wasserdampf wieder in Form von Wolken und Niederschlag, wird jene latente Verdunstungsenergie wieder frei. Man nennt das Kondensationswärme. Hier zeigt sich sehr schön, dass Energie nicht "erneuerbar" ist, sondern nicht verloren geht, weil sie sich nur umwandelt. Der in der Klimadiskussion verwendete Begriff der "erneuerbaren Energien" ist also sachlich falsch. Beim Schmelzen von Eis wird Schmelzwärme frei. Versuchen Sie doch mal, einen Topf mit Wasser und Eiswürfeln auf dem Herd zu erhitzen. Sie können darunter heizen wie Sie wollen, die Temperatur des Wassers steigt erst dann über den Gefriepunkt an, wenn alle Eiswürfel geschmolzen sind. Sie mussten die gesamte Energie für das Abtauen des Eises verwenden. Umgekehrt wird dieselbe Wärmeenergie wieder frei, wenn Wasser zu Eis gefriert. Es ist immer wieder dasselbe: Energien erneuern sich nicht, sondern wandeln sich nur um. Doch gerade dieses "Nur" bestimmt gewaltig über das Klima unserer Erde. Die durch den Wasserdampf bewirkte Wärmeenergie- Verteilung auf unserer Erdkugel ist ein äußerst komplexes und im Einzelnen kaum durchschaubares System. Auch die Strahlungsbilanz der Erde, das Verhältnis von eingefangener und wieder abgegebener Wärmestrahlung, wird durch den Wasserdampf entscheidend beeinflusst. So reflektieren Wolken nicht nur einen beachtlichen Teil der Sonneneinstrahlung an ihrer Oberseite, sondern halten auch einen großen Teil der Wärmestrahlung des Erdbodens zurück, wodurch die bodennahen Lufttemperaturen zum Beispiel nachts nicht so weit zurückgehen wie bei einem wolkenlosen Himmel. Sehr komplex, dies alles. Wasserdampf ist somit unser wichtigstes Klimagas. Entwicklung des globalen Klimas Die Entwicklung des globalen Klimas hängt von weitaus mehr Faktoren ab als allgemein bekannt sein dürfte. Seit Beginn der Industrialisierung hat die Menge von Gasen in unserer Atmosphäre, die den Treibhauseffekt verstärken - und damit auch die globale mittlere Temperatur - zugenommen. Auffallend ist, dass die 10 wärmsten Jahre des 20. Jahrhunderts aus seinen letzten 17 Jahren stammen (1998, 1997, 1995, 1990, 1991, 1994, 1983, 1988, 1987, 1996). Wir treiben also ein gewagtes Spiel mit dem globalen Klima, das wir mit Sicherheit nicht gewinnen werden. Das globale Klima hat sich aber immer schon durch "natürliche" Ursachen mehr oder weniger stark verändert. So wissen wir z.B. inzwischen recht genau, wie sich das Klima in den letzten 1000 Jahren verhalten hat. Trotz leicht voneinander abweichender Ergebnisse der Klimaforscher stimmen ihre Aussagen in wesentlichen Punkten überein. Die Sonne, aber auch die Erde selbst, muss man mit globalen Temperaturänderungen in Verbindung bringen. Die Sonne Die "Solarkonstante", also der Betrag der Sonnenenergie, die an der Obergrenze der Atmosphäre ankommt (1370 W / m²) schwankt um 3% wegen der unterschiedlichen Entfernung der Erde während ihres Umlaufes um die Sonne. Doch strahlt auch die Sonne bei weitem nicht so gleichmäßig, wie man noch bis ins 16. Jahrhundert hinein annahm. Denken wir an die "Sonnenflecken" und ihren 11jährigen Zyklus, dem noch weitere Perioden überlagert sind und die zu extremen Fleckenmaxima und -minima führen können. So sind bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem Klima der letzten Jahrhunderte und der Anzahl der Sonnenflecken belegt. Die Erde Ihre Bahn ist mehreren Änderungen unterworfen. 1. Die Bahn der Erde um die Sonne unterliegt einem Zyklus, bei dem diese zwischen einer Ellipse und (fast) einem Kreis schwankt. Dies vollzieht sich allerdings in dem großen Zeitraum von 100 000 Jahren. Je größer die Exzentrizität, um so größer ist der Unterschied der eintreffenden Sonnenstrahlung zwischen dem sonnenfernsten und -nächsten Punkt. Zurzeit ist die Exzentrizität gering. 2. Der zweite Zyklus entsteht bei der Rotation der Erde um ihre Achse wie ein taumelnder Kreisel, "Präzession" genannt. Jene Periode dauert etwa 23 000 Jahre. In ca. 11 000 Jahren wird unsere Erde der Sonne wieder im Juli am nächsten sein, wenn auf der Nordhalbkugel Sommer ist. Dadurch werden die Gegensätze zwischen Sommer und Winter zunehmen, da die Nordhalbkugel die größeren Landmassen besitzt. (Zurzeit ist die Erde der Sonne im Januar am nächsten.) 3. Der 3. Zyklus von ca. 41 000 Jahren wird durch die Änderung des Neigungswinkels der Erdachse gegenüber der Ekliptik, also der Erdbahn um die Sonne, hervorgerufen. Zurzeit beträgt jener Winkel 23,5°. Er schwankt zwischen 22° und 24,5°. Je kleiner der Winkel, um so geringer gestalten sich die jahreszeitlichen Schwankungen in mittleren und höheren Breiten. Was ich hier angeführt habe, ist die Grundannahme der "Melankovitch-Theorie". Milutin Melankovitch, ein serbischer Mathematiker, hat diese Theorie um 1930 entwickelt. Danach wird durch die geschilderten Änderungen des Laufes der Erde um die Sonne das globale Klima beeinflusst. Ablagerungen in den Ozeanen und Untersuchungen von Eisbohrkernen haben eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Eisausbreitung und der MelankovitchTheorie ergeben. Jedoch kann der Verlauf der verschiedenen Eiszeiten auf unserem Planeten damit nicht vollständig erklärt werden. Hierbei könnten z.B. auch gewaltige Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge ursächlich mitgewirkt haben. Welch dramatische Auswirkungen ein großer Vulkanausbruch auf das Wetter haben kann, zeigt das Jahr 1816, als in Teilen Nordamerikas und in Westeuropa der Sommer ausfiel. Im Juni gab es Schneestürme und Fröste traten noch im Juli und August auf. Ursache: Zwischen 1810 und 1815 stieg die Vulkanaktivität weltweit an und erreichte im April 1815 mit der Explosion des Vulkans "Tambora" im heutigen Indonesien ein Maximum. Aber Vorsicht! Ganz eindeutig ist der Zusammenhang zwischen dem Wetter von 1816 und der Eruption ein Jahr davor nicht, da es in jener Zeit kaum Wetterbeobachtungen gab. Ziemlich sicher ist jedoch: Vulkangase können den Treibhauseffekt verstärken. Bedeutsamer ist aber wohl der Abkühlungseffekt durch die weltweite Trübung der höheren Atmosphärenschichten durch Vulkanrauch und Ascheteilchen. Ändert sich das Klima? Welche wichtigen Faktoren bestimmen eigentlich unser Klima? Da haben wir einmal das Wasser, die Wolken und die Wärmestrahlung. Weil Feuchtigkeit beim Verdunsten Wärmeenergie aufnimmt und als Wasserdampf an andere Orte transportiert, ist der Wasserkreislauf ein wichtiger Teil des Klimageschehens. Dazu gehören unter anderem die Wolken. Sie reflektieren einerseits Sonnenstrahlung ins All, geben andererseits auch Wärmestrahlung dorthin ab und können deshalb abkühlend auf das Klima wirken. Wolken bilden sich, wenn Wasser verdunstet, als Dampf in die Atmosphäre aufsteigt und in der höheren, kälteren Luft so weit abkühlt, dass die Feuchtigkeit zu Regentröpfchen kondensiert. Geht der Regen über einer Landfläche nieder, verdunstet ein Teil des Wassers wieder, ein Teil fließt an der Oberfläche über Bäche und Flüsse ins Meer zurück. Der Rest versickert und läuft unterirdisch als Grundwasser in Richtung Meer. Eine starke Bewölkung wiederum vermindert die Sonneneinstrahlung an Land oder auf dem Meer, so dass nur wenig Wasser verdunstet. Zum zweiten sind die Windsysteme für das Klima verantwortlich. Davon gibt es drei große, die das Klima prägen, auf unserem Planeten. Zum einen wehen zwischen 30 Grad Breite und dem Äquator die sogenannten Passate: Am Äquator erwärmte Luft steigt auf, fließt nach Norden oder Süden, kühlt sich dabei ab und strömt in Bodennähe zurück zum Äquator. Die Passate werden durch die Erdrotation, die sog. Corioliskraft, abgelenkt. Diese beschleunigt polwärtige Bewegungen nach Osten und äquatorwärtige nach Westen. Daher wehen die Passate stets aus östlicher Richtung. In den mittleren Breiten hingegen herrschen Winde aus dem Westen vor, mit denen sich Tiefdruckgebiete nach Osten verlagern. Das dritte Luftdrucksystem befindet sich an den Polen. Von einem Hochdrucksystem über den Polkappen aus werden die abfließenden Luftmassen abgelenkt. Über diesen drei Systemen blasen in großer Höhe starke Westwinde (Jetstreams). Sie gleichen große horizontale Druckdifferenzen an der Grenze zwischen Warm- und Kaltluftmassen aus. Zum dritten gibt es noch das globale Wärmetransportband der Ozeane. Weil Wasser sehr viel mehr Wärme speichern kann als Land oder Luft, haben die großen Meeresströmungen enormen Einfluss auf das Klima. Sie transportieren das in den Tropen aufgeheizte Oberflächenwasser in kältere Regionen und erwärmen diese. Dort aber sinkt das abgekühlte und durch Verdunstung salzhaltigere Wasser infolge seiner höheren Dichte in die Tiefe, zieht dabei weiteres Wasser hinter sich her und treibt so den weltweiten Wasserkreislauf wie eine Pumpe an. Als Tiefenstrom fließt es wieder zurück in wärmere Gegenden, um sich neu aufzuheizen. Die wichtigste warme Oberflächenströmung führt vom Pazifik durch den Indischen Ozean bis in den Atlantik. Von Mexiko geht sie in den Golfstrom über, transportiert ihre Wärmeenergie in breitem Strom an der Ostküste der USA vorbei bis nach Neufundland, teilt sich dann in zwei Ästen nach Nord- und Südosten und beschert Europa ein mildes Klima. Ohne diese "Warmwasserheizung" hätte Europa ein Klima, das dem von Kanada ähnelte, liegt doch zum Beispiel Deutschland in etwa auf der geografischen Breite der Großen Seen oder von SüdLabrador. In der Tiefe fließt dieses Wasser allmählich zurück und benötigt dazu etwa 1000 Jahre. Eine andere wichtige Meeresströmung ist der Humboldtstrom, dessen nährstoffreiches Wasser vor der Westküste Südamerikas aufsteigt. Alle drei bis sieben Jahre tritt dort das gefürchtete "El Nino" - Phänomen auf: Wärmeres Wasser verdrängt die Strömung, die Meeresfauna wandert ab, die Fischer fangen nichts mehr. Unser weltweites Klima ist also das Ergebnis eines komplexen Wechselspiels zwischen Sonne, Erdoberfläche und Atmosphäre. Das Klima war nicht immer so wie heute. Allein dreimal in den letzten 500 000 Jahren waren Teile Nord- und Mitteleuropas, Nordasiens und Nordamerikas für jeweils Zehntausende von Jahren kilometerdick von Eis bedeckt. Schon mehrmals in ihrer Geschichte ist die Erde für Millionen Jahre zum "Schneeball" geworden. Während dieser Mega-Eiszeiten herrschten wahrscheinlich Temperaturen von minus 50 Grad. Vor 750 Millionen Jahren geriet das Klima einmal völlig aus den Fugen. Unser Planet fror fast völlig ein. Dass er jemals danach wieder auftaute, verdanken wir großen Vulkanausbrüchen, die mit ihrem gigantischen Ausstoß von Treibhausgasen die Erde wieder so stark erwärmten, dass die Eismassen schmolzen. Ansonsten wäre die Erde ein "Schneeball" geblieben, da die Schneeflächen den größten Teil der Sonneneinstrahlung ins All reflektieren. Im letzten Rundspruch hatte ich die wichtigsten Klimafaktoren näher erläutert und festgestellt, dass das Klimasystem sehr komplexer Natur ist. Es setzt sich aus den Subsystemen Atmosphäre, Ozean, Biosphäre und Kryosphäre (Eis und Schnee) zusammen, die - angetrieben durch die Energie der Sonne - auf höchst komplexe Weise miteinander reagieren. Die Komponenten des Klimasystems variieren in typischer Weise auf unterschiedlichen Zeitskalen, die von Stunden (Wettererscheinungen) über Monate (Oberflächenströmungen der Ozeane) bis zu Jahrtausenden (Landeismassen) reichen, und reagieren in komplizierten Rückkopplungsprozessen miteinander. Der viel diskutierte vom Menschen verursachte (anthropogene) Treibhauseffekt ist lediglich eine Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes. Ohne die natürliche Treibhauswirkung der Atmosphäre würde die globale Mitteltemperatur der Erde gegenwärtig nicht bei +15 Grad C, sondern bei -18 Grad C liegen. Sie entsteht durch die atmosphärischen Spurengase Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid u.a., die wie eine Wärmefalle wirken. Die durchschnittliche globale Sonneneinstrahlung dringt zu einem großen Teil ungehindert bis zum Erdboden durch und erwärmt ihn. Die vom Erdboden emittierte Wärmestrahlung wird aber von den Treibhausgasen absorbiert und zurückgestrahlt, wodurch sich die Atmosphäre erwärmt. Der anthropogene Treibhauseffekt wird dadurch verursacht, dass der Mensch die Konzentration der natürlichen Treibhausgase erhöht bzw. neue Treibhausgase, wie z.B. FCKW, hinzugefügt hat. Die Temperaturkurve unseres Klimas geht in den letzten 50 - 60 Jahren steil nach oben. Das bestreitet niemand. Jedoch hatten wir das schon einmal vor über 2000 Jahren mit einem Höhepunkt um Christi Geburt. Danach sank die weltweite Temperatur wieder ab und blieb auf einem Minimum von ca. 14,8°C vom Ende des 5. Jahrhunderts bis etwa 1000 nach Christus konstant. Im 11. Jahrhundert gab es eine sprunghafte Erwärmung um über ein halbes Grad, die bis etwa 1200 andauerte und als "Europäische Warmzeit" benannt wird. In dieser Periode machten die Vikinger ihre Eroberungszüge und eroberten Grönland - damals eine grüne Insel. Zwischen 1200 und etwa 1350 fiel die weltweite Temperaturkurve wieder beachtlich ab. Vom 15. bis ins 17. Jahrhundert sank die Durchschnittstemperatur mit einigen Schwankungen und erreichte im 17. Jahrhundert sogar ein Minimum von etwas unter 14°C (zurzeit liegt sie bei ca. 15,75°C). Jene Jahrhunderte werden als "kleine Eiszeit" in Mitteleuropa bezeichnet. Manche Märchen, in denen von kalten Wintern die Rede ist, stammen noch aus jener Zeit, ebenso das Gemälde "Winterlandschaft" von Brueghel d.J.. Alle Temperaturwerte vor 1850 mussten mit Hilfe aufwändiger Eisbohrkernuntersuchungen rekonstruiert werden. Erst ab 1850 verfügen wir nämlich über wirklich gemessene Daten. In den letzten beiden Jahrhunderten kam es dann wieder zu einer erneuten Klimaerwärmung, vornehmlich ab etwa 1870. Mit Ausnahme der Jahre in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts stiegen die Temperaturwerte bis heute dramatisch weiter an. Ein Klimawandel ist also durchaus etwas Natürliches und lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das Wort "Klimaschutz" passt somit schlecht ins Vokabular der aktuellen Witterungsdebatte. Dem Menschen wird es nie gelingen, ein bestimmtes Klimageschehen konstant zu halten. Er wird sich ihm weiterhin anpassen müssen, doch leider gibt es heute für eine"Völkerwanderung" als Flucht vor Klimaänderungen keinen Raum mehr. Der Mensch sollte dennoch nicht eigenmächtig an der globalen Wettermaschine "herumfummeln". Denn durch den Einfluss des Menschen in unserer Zeit könnte eine globale Erwärmung noch nie da gewesene Ausmaße in relativ kurzer Zeit erreichen, wenn man die durch den Menschen verursachten Treibhausgase hinzu addiert. Nun noch zu den weltweiten Auswirkungen eines Anstiegs von "Treibhausgasen". Die Straßen, Pipelines und Industrieanlagen in Sibirien versinken immer mehr im Morast, weil der Permafrostboden taut. In der Stadt Jakutsk sind inzwischen bereits mehr als 300 Gebäude weggesackt. Forscher erwarten, dass der arktische Ozean bis spätestens 2100 im Sommer eisfrei sein wird. Die Inuit und viele arktische Tierarten, wie z.B. der Eisbär, verlieren ihre Heimat. Schon ein weiterer Anstieg der weltweiten Temperatur um nur 1 Grad C könnte zum Aussterben von 10 % aller Landtierarten führen. Mit dem Klimawandel wird die Luftströmung des Monsuns seine Stärke verändern und unzuverlässiger werden. Überflutungen, aber auch Dürren könnten die Folge sein. Im Südosten Australiens hat es den vergangenen Jahren noch nie so wenig geregnet wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Hälfte der Agrarflächen ist von Versteppung bedroht. Steigt die Temperatur weiter an, wird Landwirtschaft in den meisten Teilen Australiens unmöglich sein. Der warme Golfstrom ist für das Milde Klima in Mitteleuropa verantwortlich. Erste Hinweise zeigen, dass der Golfstrom sich abschwächt. Ob er abreißen wird, ist bislang ungewiss. Als Folge davon könnte sich Europa entgegen dem normalen Trend abkühlen. Durch die Klimaerwärmung droht das Amazonasgebiet auszutrocknen. Das Abholzen der Wälder beschleunigt den Prozess noch. Weniger Kahlschlag könnte den Klimawandel somit auf einfache Weise abbremsen. Sollten die Ozeane weiter versauern, könnten die Kalkschalen winziger Planktonorganismen sich auflösen. Dadurch würde die Fischerei weiter leiden, denn am oberen Ende der Nahrungskette stehen Fischarten wie Lachs, Kabeljau oder Thunfisch. Vor allem in den Entwicklungsländern leben die Verlierer des Klimawandels. Rund 8oo Millionen Menschen leiden derzeit an Mangel- oder Unterernährung. Ein Anstieg der globalen Temperatur um nur 1 Grad C könnte ihre Zahl auf 1,3 Milliarden anwachsen lassen. 250 000 Kindern pro Jahr könnte der Klimawandel das Leben kosten. Bei einem weltweiten Anstieg der Durchschnittstemperatur um 3 Grad C suchen alle zehn Jahre schwere Dürren Südeuropa heim. Bis zu 170 000 Millionen Menschen werden jährlich Opfer von Fluten und Überschwemmungen. Zwischen 150 - und 500 Millionen Menschen mehr als heute hungern. Die Ernten in den hohen Breiten hingegen sind ergiebiger den je zuvor. Ist jetzt der Mensch an einer Klimaveränderung schuld? Das Wetter ist ein reales Geschehen, es ist das, was wir erleiden oder erleben. Klima hingegen existiert nur auf dem Papier, nämlich als Mittelwert aller Wetterdaten, das selbst aber fast nie real ist. Das Wetter wechselt ständig, das ist seine Natur, und der Mensch hat gelernt, sich den Extremen anzupassen, von polarer Kälte bis zur Wüstenhitze. Warum also die gegenwärtige Panikmache? Die Grundlagen dafür sind äußerst zweifelhaft. Hier ein paar wissenschaftlich fundierte Beispiele: Die Temperaturen der Arktis haben sich völlig unabhängig vom CO2- Gehalt verhalten und lagen 1940 sogar über unserem heutigen Wert. In den letzten 10.000 Jahren verlief die Temperatur auch ohne Einfluss des Menschen keineswegs gleichförmig. Eine Betrachtung der im 20. Jahrhundert erfolgten Temperaturschwankungen verdeutlicht: Nach dem behaupteten CO2- Einfluss müsste die Temperatur von einem vormaligen Ruhestand ab 1947 kontinuierlich angestiegen sein - das Gegenteil zeichnet sich ab - die Temperatur sank bis in die 70er Jahre. Von einer neuen Eiszeit war damals die Rede. Klimaänderungen wie zurzeit hat es schon immer gegeben, und dies sogar in beträchtlich größerem Umfang. Sie stellen jedoch eine Naturerscheinung dar und verlaufen völlig unabhängig von jeder menschlichen Einwirkung. Was ist nun die Ursache der natürlichen Temperaturschwankungen? Trägt man zur Temperaturkurve gleichfalls die Aktivitätskurve der Sonne auf, so zeigt sich überraschend ein absolut gleichartiger Verlauf. Die Temperaturentwicklung unseres Klimas wird nicht von einem verschwindend kleinen CO2- Gehalt, sondern von der Sonne bestimmt. Zurzeit stellt man auch auf anderen Planeten unseres Sonnensystems eine Erwärmung fest. Interessant ist der Gedanke, dass Ursache und Wirkung verwechselt werden könnten. Wird das Klima kälter, vermindert sich der CO2- Gehalt der Atmosphäre durch vermehrte Aufnahme von Kohlendioxid in den Ozeanen. Unser derzeitiger Anstieg der CO2Konzentration könnte somit eine Folge der Erwärmung sein und nicht ihre Ursache. Erst steigt die klimatische Temperatur und erst dann der CO2- Gehalt, und das zudem im Abstand von einigen hundert Jahren. Die gewaltigen Wassermassen unserer Ozeane reagieren nämlich ziemlich träge. Sie brauchen etwa 100 Jahre, um sich den neuen Temperaturbedingungen anzupassen. Die CO2- Fluktuation hat also mit dem Treibhauseffekt absolut nichts zu tun. Es gab in der Erdvergangenheit Perioden mit drei- bis zehnmal soviel CO2 wie heute. Klimawandel haben sich ständig ereignet. Sie sind eine normale Erscheinung in der Natur. Es gab Zeiten, in denen es viel wärmer, aber auch viel kälter war als heute. Die jetzige Wärmephase geht auf etwa 200 Jahre zurück, bis zur damaligen "Kleinen Eiszeit", mit einem Temperaturminimum um etwa 1650, als man die Ostsee im Winter per Fuhrwerk überqueren konnte. Es ist nachgewiesen, dass in jener Zeit fast keine Sonnenflecken zu beobachten waren, was eine geringere Sonnenaktivität als üblich bezeugt. Davor gab es wiederum eine sehr warme Zeit, die "Mittelalterliche Warmzeit", mit höheren Temperaturen als heute mit einem Maximum um 1200. Damals besiedelten die Wikinger Grönland, "Grünes Land", das damals eisfrei gewesen ist, mit Ackerbau und Viehzucht. Eine weitere Warmzeit fiel in die Steinzeit mit erheblich höheren Temperaturen als heute. Die oft zu hörende Argumentation, wir hätten im Vergleich mit 1901 im Jahre 2006 den wärmsten Herbst sowie den wärmsten Winter, gefolgt vom wärmsten Frühling 2007 und so drei Jahreszeitrekorde gehabt, betrifft eine regionale Erscheinung und ist nicht repräsentativ für das Klima des gesamten Erdballs. Und selbst wenn es eine Erwärmung bedeuten würde, hätten wir keinen Einfluss hierauf. Wir müssen uns einfach wie schon in früheren Zeiten auf solche Veränderung entsprechend einstellen. Was verhindert eigentlich die Wärmeabstrahlung in den Weltraum? Die Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche wird nur durch eine wellenlängenabhängige Absorption klimawirksamer Spurengase gemindert. Das hat mit den Luftbewegungen in einem Treibhaus überhaupt nichts zu tun. Der Begriff "Treibhauseffekt" ist somit sachlich unrichtig. Die Absorptionslinien des CO2 liegen bei den Wellenlängen 2,8 µm (hier wird die Solarstrahlung absorbiert) sowie bei 4,5 µm und 14,5 µm. Nur bei diesen letzten beiden Wellenlängen wird die irdische Abstrahlung absorbiert, nur dort und nur zu etwa 65%. Da die terrestrische Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche jedoch nur die Bandbreite von etwa 3 bis über 40 µm umfasst, wird die Abstrahlung durch erhöhte CO2- Anteile, die sowieso nur 0,035 % der Atmosphäre ausmachen, kaum beeinflusst. Auch hier kann der Mensch nichts bewirken. Demnach unterliegen wir alle einer "CO2- Politkampagne". Die Annahme, der menschliche Beitrag wäre ausschlaggebend für eine dramatische Klimaänderung, entbehrt also nach diesen Argumenten jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Damit kein Missverständnis entsteht. Ich rede nicht gegen unsere weltweite Verpflichtung, Energien einzusparen und unsere Umwelt schonender zu behandeln als wir es zurzeit noch tun. Wir müssen auch neue umweltschonende Energien entwickeln, deren Erzeugung unsere Umwelt weniger belasten als die Herstellung von Energiesparlampen und Photozellen. Ich denke dabei z.B. an die Wasserstoff- Brennelemente und die Kernfusionsenergie. "Erneuerbare" Energien gibt es nämlich nicht. Nach dem Energiegesetz gehen Energien nicht verloren, sondern wandeln sich nur um und können somit auch nicht erneuert werden. Der Wind, der ein Windkraftwerk antreibt, kann nicht "erneuert" werden. Es kommt nur darauf an, dass er weht. Dies bewirkt die ständig zur Verfügung stehende Sonnenernegie. Die Sonne allein hält unsere "Wettermaschine" in Schwung. Würden wir aber jetzt unsere weltweite politisch geprägte CO2- Legende als Flop erklären, wäre dies gar nicht gut für unser in Gang gesetztes Energiebewusstsein. Wir hätten eine neue globale Krise und am Pranger stünden all unsere durch Fördergelder unterstützten Klimaforscher. Wollen wir das? Auch Irrtümer können bisweilen Gutes bewirken. Wir sollten jedoch nicht in Panik geraten! Alle Angstkampagnen sind schlechte Ratgeber. Das Klimasystem Das Klimasystem ist komplexer Natur. Es setzt sich aus den Subsystemen Atmosphäre, Ozean, Biosphäre und Kryosphäre (Eis und Schnee) zusammen, die - angetrieben durch die Energie der Sonne - auf höchst komplexe Weise miteinander reagieren. Die Komponenten des Klimasystems variieren in typischer Weise auf unterschiedlichen Zeitskalen, die von Stunden (Wettererscheinungen) über Monate (Oberflächenströmungen der Ozeane) bis zu Jahrtausenden (Land-Eismassen) reichen, und reagieren in komplizierten Rückkopplungsprozessen miteinander. Klimamodelle Die Grundlagenforschung untersucht die Variabilität des Klimas sowie das Zusammenspiel der Klimasubsysteme mittels numerischer Modelle. In einem Klimamodell werden physikalische Gleichungen gelöst, die die Bewegung eines Gases (Luft) oder einer Flüssigkeit (z.B. Wasser im Ozean) auf der rotierenden Erde beschreiben. Dieses Gleichungssystem kann nicht für jedes Luft- und Wasserteilchen an jedem Punkt des Globusses gelöst werden, vielmehr wird die Erde mit einem dreidimensionalen Gitternetz überzogen, an dessen Gitterpunkten die Berechnungen durchgeführt werden. Aufgabe der Klimaforschung ist es, zu untersuchen, wie sensibel das Klimasystem auf natürliche und menschliche Einflüsse reagiert und welche regionalen und globalen Klimaänderungen in Zukunft zu erwarten sind. Dabei erstrecken sich die Untersuchungen z.B. vom Studium des globalen Treibhauseffektes über regionale Schadstoffausbreitung sowie auf den Einfluss der Abholzung tropischer Regenwälder oder der Wälder im Mittelmeerraum. Diese räumliche Abstufung der Modelle wird heute durch eine hierarchische Kopplung der Simulationen genutzt und erlaubt damit detaillierte Klimastudien für jede Region der Erde. Treibhauseffekt Der viel diskutierte vom Menschen verursachte (anthropogene) Treibhauseffekt ist lediglich eine Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes. Ohne die natürliche Treibhauswirkung der Atmosphäre würde die globale Mitteltemperatur der Erde gegenwärtig nicht bei +15 Grad C, sondern bei -18 Grad C liegen. Sie entsteht durch die atmosphärischen Spurengase Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid u.a., die wie eine Wärmefalle wirken. Die durchschnittliche globale Sonneneinstrahlung von 342 W/qm dringt zu einem großen Teil ungehindert bis zum Erdboden durch und erwärmt ihn. Die vom Erdboden emittierte Wärmestrahlung wird aber von den Treibhausgasen absorbiert und zurückgestrahlt, wodurch sich die Atmosphäre erwärmt. Der anthropogenen Treibhauseffekt wird dadurch verursacht, dass der Mensch die Konzentration der natürlichen Treibhausgase erhöht bzw. neue Treibhausgase (FCKW) hinzufügt. Aktuelle Forschung: Abholzung der Wälder im Mittelmeerraum Ein Beispiel aktueller Forschung des Max-Planck-Instituts wird hier im Zusammenhang mit der Abholzung der Wälder im Mittelmeerraum gezeigt, um ein Verständnis für die Komplexität und Sensibilität des Klimasystems zu vermitteln. Die Regenwälder dieser Erde werden häufig als "grüne Lunge der Atmosphäre" bezeichnet und sind eine wesentliche Komponente des Klimasystems. Der Mensch greift durch Abholzung und Brandrodung massiv in diesen Bereich ein und setzt dabei Gigatonnen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) frei (1,6 Gt/J). Aber auch die Abholzung der Wälder im Mittelmeerraum beeinflusst unser Klima spürbar in regionaler Hinsicht. Abholzung im Mittelmeerraum wird seit mehr als 2000 Jahren betrieben. Das Ergebnis ist, dass zusätzlich zur Bodenerosion der regionale Wasserkreislauf durch die veränderte Bodenbeschaffenheit beeinflusst wird. Mit Hilfe eines Modells wurden die Auswirkungen auf das Klima untersucht. Dazu wurden 2 Modellrechnungen durchgeführt. Im ersten Experiment wurde radikal die gesamte Vegetation im Mittelmeerraum entfernt, das zweite Experiment arbeitet mit dem Bestand der Vegetation zu Zeiten der Römer vor 2000 Jahren. Das verwendete Modell rechnet mit klimatologischen Meeresoberflächentemperaturen (SST) der Jahre 1979-88. Beschrieben wird hier nur das Abholzungsszenario. Nach der radikalen Abholzung nimmt der Niederschlag im untersuchten Gebiet ab, da die Verdunstung durch die Pflanzen reduziert ist. Diese Abnahme der Verdunstung bedeutet, dass mehr Energie zur Erwärmung der Erdoberfläche vorhanden ist. Da gleichzeitig die Reflexion der Erdoberfläche steigt, wenn dunkler Wald durch kahlen Boden ersetzt wird, ist die solare Nettostrahlung am Boden trotzdem geringer. Der zweite Effekt übersteigt den ersten, so dass es zur Abnahme der Bodentemperatur kommt. In feuchten Gebieten wie dem Amazonasgebiet ist bei Abholzung die Abnahme der Verdunstung dominant. Die größte Abnahme von 0.8K der 2m-Temperatur durch die Abholzung wurde im Nahen Osten gefunden. Die kältere und trockenere Oberfläche unterdrückt die Konvektion, was sich ebenfalls in der Abnahme des Niederschlags äußert. Ein anderer Aspekt ist die leichte Verschiebung des Bodendruckfeldes nach Süden hin und ein geringerer horizontaler Druckgradient nach der Abholzung. Die Abnahme der Windgeschwindigkeit bei geringerem horizontalen Druckgradienten wird z.T. durch den geringeren Bodenwiderstand in der abgeholzten Region kompensiert. Daraus folgt eine Zunahme der Westströmung über dem Nordwesten des Mittelmeerraumes (Mistral) sowie des Nordwindes über dem Osten des Gebietes (Etesien) und eine Abnahme der Südwinde über der Iberischen Halbinsel und des Atlasgebirges. Streit um Klimawandel Die derzeitige Streitdiskussion um den Klimawandel wird in zwei unterschiedlichen Lagern ausgetragen. Da ist einmal die Gruppe um den Ozeanografen Mojib Lativ am Hamburger Max-Planck-Institut. Diese warnt vor einer menschengemachten Erwärmung der Erdatmosphäre und beruft sich in ihren Erkenntnissen auf Computermodelle, mit denen sie das Klima der Zukunft simuliert. Erfolge verzeichnete diese Gruppe z.B. mit der Vorhersage des regelmäßig wiederkehrenden Klimaphänomens "El Nino". Die andere Gruppe wird vertreten durch den Glaziologen (Gletscherforscher) Heinz Miller, stellv. Direktor des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Dieser Wissenschaftler befasst sich nicht mit Klima-Computermodellen, sondern erforscht die Geschichte des Klimas, vornehmlich durch Untersuchungen an Eisbohrkernen aus Grönland. Er konnte nachweisen, dass das Klima in der Vergangenheit stets recht starken Schwankungen unterworfen war - also auch ohne menschlichen Einfluss sich veränderte. Weil wir viel zu wenig über das Klima an sich wissen, bezweifelt Miller, dass die Vorhersagen der Klimamodelle wirklich zuverlässig sind - wie dies Latif immer wieder behauptet. Die Temperaturkurve unseres Klimas geht in den letzten 50 - 60 Jahren steil nach oben. Das bestreitet niemand. Jedoch hatten wir das schon einmal vor über 2000 Jahren mit einem Höhepunkt um Christi Geburt. Danach sank die weltweite Temperatur wieder ab und blieb auf einem Minimum von ca. 14,8°C vom Ende des 5. Jahrhunderts bis etwa 1000 nach Christus konstant. Im 11. Jahrhundert gab es eine sprunghafte Erwärmung um über ein halbes Grad, die bis etwa 1200 andauerte und als "Europäische Warmzeit" benannt wird. In dieser Periode machten die Vikinger ihre Eroberungszüge und eroberten Grönland - damals eine grüne Insel. Zwischen 1200 und etwa 1350 fiel die weltweite Temperaturkurve wieder beachtlich ab. Vom 15. bis ins 17. Jahrhundert sank die Durchschnittstemperatur mit einigen Schwankungen und erreichte im 17. Jahrhundert sogar ein Minimum von etwas unter 14°C (zurzeit liegt sie bei ca. 15,75°C). Jene Jahrhunderte werden als "kleine Eiszeit" in Mitteleuropa bezeichnet. Manche Märchen, in denen von kalten Wintern die Rede ist, stammen noch aus jener Zeit, ebenso das Gemälde "Winterlandschaft" von Brueghel d.J.. Alle Temperaturwerte vor 1850 mussten mit Hilfe aufwändiger Eisbohrkernuntersuchungen rekonstruiert werden. Erst ab 1850 verfügen wir nämlich über gemessene Daten. In den letzten beiden Jahrhunderten kam es dann wieder zu einer erneuten Klimaerwärmung, vornehmlich ab etwa 1870. Mit Ausnahme der Jahre in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts stiegen die Temperaturwerte bis heute dramatisch weiter an. Ein Klimawandel ist also durchaus etwas Natürliches und lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das Wort "Klimaschutz" passt somit schlecht ins Vokabular der aktuellen Witterungsdebatte. Dem Menschen wird es nie gelingen, ein bestimmtes Klimageschehen konstant zu halten. Er wird sich ihm weiterhin anpassen müssen, doch leider gibt es heute für eine "Völkerwanderung" als Flucht vor Klimaänderungen keinen Raum mehr. Der Mensch sollte dennoch nicht eigenmächtig "an der globalen Wettermaschine herumfummeln", wie Latif sich ausdrückte. Denn durch den Einfluss des Menschen in unserer Zeit könnte eine globale Erwärmung noch nie da gewesene Ausmaße erreichen, wenn man die durch den Menschen verursachten Treibhausgase hinzu addiert. Die Flutkatastrophen in Deutschland hatten mit dem Treibhauseffekt nichts zu tun. Sie waren einfach darauf zurück zu führen, dass die Tiefdruckgebiete in jenen Sommern eine Zugbahn ins Mittelmeer eingeschlagen hatten (Zugstraße Vb). Solche Wetterlagen hat es immer schon gegeben. Früher konnten derartige Regenmengen jedoch wesentlich besser verkraftet werden, als die Flüsse noch nicht so kanalisiert waren und als es noch große Auen gab, die das Wasser aufnahmen. Beispiel "Vater" Rhein: Vergleichen Sie einmal eine Rheinkarte vom Beginn des 19. Jahrhunderts mit einer von heute. Nach der Begradigung des Oberrheins zum Beispiel ab 1817 waren bereits gegen Ende desselben Jahrhunderts in einem Zeitraum von nur 50 - 60 Jahren die Auen weitgehend verschwunden. Damit gingen ca. 80% der Hochwasserrückhaltegebiete allein im Oberrheingraben verloren. Das Abholzen von Wäldern und das Versiegeln von Flächen im großräumigeren Wassereinzugsgebiet der Flüsse als Folge der Ansiedlung von Mensch und Industrie taten ihr Übriges dazu. Insofern muss man wohl Herrn Miller Recht geben: "Insofern ist die Überschwemmungskatastrophe natürlich doch Menschenwerk." Bezüglich der vom Menschen vielleicht doch inzwischen schon (mit) verursachten Klimaveränderung sollte man aber auch Herrn Latifs Worte nicht überhören: "Die Tests (Überprüfung der Klimamodelle) verliefen überwiegend positiv. Warum sollten unsere Modelle ausgerechnet für die nahe Zukunft ein völlig falsches Bild liefern?" Zum Schluss noch ein Aspekt, der jahrelang in der Klimadiskussion unerwähnt blieb und der eine zusätzliche Erklärung für eine Klimaerwärmung liefern könnte. Es handelt sich um die Schwankungen der Sonnenaktivität (Korpuskularstrahlung, "Sonnenwind"). Ein amerikanischer Wissenschaftler (dessen Name mir entfallen ist und der in der letzten aktuellen "Globus-Extra-Sendung" bei Ranga Yogeshwar im Westdeutschen Fernsehen zu Wort kam), legt schon seit einigen Jahren Forschungsergebnisse vor, wonach die Sonnenaktivität und die Aufheizung unserer Atmosphäre in direktem Zusammenhang stehen. Einfach gesagt: Je stärker der "Sonnenwind", desto weniger weltweite Wolkenentstehung und somit desto größer die Erwärmung. Die Temperaturkurven der Atmosphäre und die der Sonnenaktivität verlaufen demnach fast parallel zueinander. Haben wir vielleicht schon bald den eigentlichen Grund für die derzeitige Klimaerwärmung entdeckt, unsere Sonne selbst nämlich? Dazu passt auch die schon seit über 100 Jahren beobachtete Abschwächung unseres Erdmagnetfeldes, welches uns vor der Sonnen-Korpuskularstrahlung schützt und diese hauptsächlich in Richtung der magnetischen Erdpole ablenkt. Wetterbeeinflussungen Wird der Mensch das Wettergeschehen jemals maßgeblich beeinflussen können? Tut er es nicht schon heute z.B. durch die Anreicherung der Troposphäre mit Kohlendioxid, wodurch ja bekanntlich der "Treibhauseffekt" verstärkt wird. Auch mit der Erzeugung des Smog greift der Mensch zu seinem eigenen Nachteil in die Struktur der Luftmassen und damit in die Wettergestaltung ein. Das menschliche Erzeugnis in Form von Ruß und Schwaden giftiger Gase hat die Tendenz, Inversionen zu verstärken, wodurch die natürlichen Kräfte der Atmosphäre, sich selbst zu reinigen, gehindert werden. Wenn man diese Eingriffe des Menschen an der Gewalt der Naturkräfte misst, sind sie wohl als gering zu veranschlagen. Wir wissen aber auch, dass unser globales Klima bereits auf geringfügige Temperaturerhöhungen der Lufthülle sehr empfindlich reagieren kann. Ein Beleg dafür sind bekanntlich die Eiszeiten. Ein weiteres Beispiel: Durch manipulierte Viehzucht über weite Strecken werden fruchtbare Grasflächen abgeweidet und in Steppen verwandelt. Das geschieht nicht nur über wenige Quadratkilometer, sondern über riesige Strecken in ganzen Kontinenten, die dann durch Versandung und Versteppung die Strahlungseigenschaften des Erdbodens umgewandelt haben. Dadurch sind deutliche Verschlechterungen des Klimas eingetreten. Auch der Überanbau einer Nutzpflanze allein - wie etwa Weizen - laugt den Boden auf lange Sicht aus. Er versandet und es kann zu zerstörerischen Staubstürmen kommen. Kohlendioxid und Wasserdampf spielen im Wärmehaushalt unserer Atmosphäre und damit als Wetter- und Klimafaktoren eine sehr bedeutsame Rolle. Beide Gase sind nämlich für sichtbares Licht völlig durchlässig, so dass sie den Hauptteil der Sonnenstrahlung bis zum Erdboden hinunter durchlassen. Am Boden verwandelt sich die Energie der Sonnenstrahlung in Wärme, die dann als langwellige Wärmestrahlung ausgestrahlt wird. Dafür sind jedoch Kohlendioxid und Wasserdampf nun nicht mehr "durchsichtig". Sie sind in der Lage, diese Strahlen zurück zu halten und zur Erde zurück zu werfen. Umgekehrt ist es aber so, dass sie selbst im Wärmebereich besonders gut strahlen. An ihrer Obergrenze geben sie also Wärme an den Weltraum ab und kühlen sich dadurch selbst ab. Die Treibhausgase in der Luft wirken also sehr effektvoll mit, dass die unteren Schichten wärmer und die oberen Schichten der Atmosphäre kälter werden. Es ist erwiesen, dass die mittlere Temperatur an völlig verschiedenen Orten auf der Erde im Laufe der letzten Jahrzehnte ständig angestiegen ist. Es ist allgemein bekannt, dass auch die Gletscher in den vergangenen 70 Jahren ganz erheblich zusammen geschmolzen sind. Diese schleichende Klimaänderung - und es gibt inzwischen noch weitaus mehr Phänomene als Hinweis - ist vermutlich die Folge unseres eigenen Tuns. Aber zurück zu den mehr kleinräumigen Beeinflussungen des Wetters durch den Menschen. Mit Feuchtigkeit gesättigte und recht saubere Luftmassen sind bereit, sofort zu kondensieren, wenn ihnen Gelegenheit dazu gegeben wird. Bei bestimmten Wetterlagen bewirken das z.B. die Düsenflugzeuge, deutlich erkennbar an ihren Kondensationsstreifen. Der Strahl eines Düsentriebwerkes enthält zwar selbst viel Wasserdampf, aber die Verbrennungsprodukte bestehen zum Teil aus winzigen Rauchteilchen, die als sog. "Kondensationskerne" dienen. In völlig reiner Luft ohne Kristalle, Aerosole und Staubteilchen könnten sich gar keine Wolken bilden, auch wenn die Luft noch so feucht wäre. Der Kondensstreifen eines Jets kann sich bei bestimmten Wetterlagen bisweilen massiv verbreiten und zu einem ziemlich dichten Wolkenband auswachsen. Die Luft liefert dann nach dem Anstoß durch den Düsenstrahl weiteres Kondensationsmaterial nach. Stundenlang können solche künstlich erzeugten Wolken am Himmel verweilen und die Sonneneinstrahlung abschwächen. Die schon vor einigen Jahrzehnten geäußerte Befürchtung, dass wir bei immer weiter zunehmendem Luftverkehr bei einer Schönwetterlage keinen blauen Himmel mehr genießen könnten, weil die Abgase der Jets über uns eine milchige Wolkendecke erzeugen würden, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Dennoch haben wir einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Beeinflussung des Wetters durch den Menschen erhalten. Meine Frage zu Anfang, ob der Mensch jemals in der Lage sein wird, das Wetter maßgeblich zu beeinflussen, zielt eigentlich auf etwas anderes, und zwar darauf, ob der Mensch es vielleicht eines Tages schaffen könnte, nutzbringend für die Menschheit in Wetterprozesse einzugreifen oder gewollte Wettervorgänge einzuleiten. Dazu würde z.B. das künstliche Erzeugen von Regen, das sog. "Impfen" von Wolken mit Silberjodid gehören, von dem Trockengebiete der Erde profitieren würden. Denn ein recht großer Teil unserer Bewölkung zieht über den Himmel, ohne dass daraus ein Tropfen Regen fällt. Neben jener mehr regionalen Möglichkeit der Wetterbeeinflussung gibt es aber inzwischen auch neue Überlegungen, deren Verwirklichungen großräumigere Auswirkungen hätten. Freilich ist da alles noch Zukunftsmusik. Zunächst einmal zurück zum Thema der "Wolkenimpfung". Was hat es damit auf sich? Die Wasserdampfmoleküle brauchen für den Übergang von der gasförmigen in die flüssige oder feste Phase einen Anstoß in Form eines winzigen festen, in der Luft schwebenden Staubteilchens. Solche Teilchen sind in der natürlichen Atmosphäre fast immer ausreichend vorhanden in Gestalt von winzigen Staubteilchen und Salzkristallen. An diesen bleiben die Dampfmoleküle haften und so kann ein Tröpfchen oder ein Schneekristall entstehen und anschließend wachsen. Diese kleinen Teilchen nennt man "Kondensationskerne". Bei völlig reiner Luft in großen Höhen sind oft nicht genügend Kondensationskerne da, so dass die Luft gelegentlich mit Feuchtigkeit übersättigt ist. Der Dampf kann aber nicht ausfallen, da es an Kondensationskernen mangelt. Nach dem Krieg hat der Meteorologe Vincent Schäfer die Aufsehen erregende Entdeckung gemacht, dass fein pulverisiertes Trockeneis - in feuchter Luft ausgestreut - sehr schnell Milliarden von Schneeflocken erzeugt und den Kondensationsprozess beschleunigt. Später wurde entdeckt, dass die feinen Kristalle einer chemischen Verbindung von Jod und Silber - das Silberjodid (AgJ) - als Kondensationskerne noch günstigere Eigenschaften haben. Es hat sich gezeigt, dass fein verteilte Silberjodid-Kristalle die Kondensation so sehr begünstigen, dass man dadurch Wolken, die noch nicht regenbereit sind, veranlassen konnte, Regen zu erzeugen. Diese Fähigkeit des Silberjodids liegt darin, dass es in seiner Kristallstruktur einem Eiskristall ähnelt, so dass sich die Wassermoleküle recht gut an das Silberjodid anfügen und so einen Schneekristall schnell wachsen lassen. In vielen Teilen der Welt hat man Wolken mit Silberjodid geimpft, indem man es mit Flugzeugen ausstreute oder am Boden in den Auftrieb der Luft unter einer Wolke hinein schoss. Dieses Verfahren hat sich jedoch bis heute kaum durchgesetzt, wahrscheinlich wegen des zu geringen Wirkungsgrades und der nicht unerheblichen Kosten. Neben der zunehmenden Trockenheit in einigen Landstrichen der Erde könnte es als Hauptproblem in Zukunft die globale Erwärmung der Atmosphäre geben. Beide Dinge hängen wohl auch zusammen. Der Mensch könnte jenen Temperaturanstieg evtl. auch dadurch aufhalten oder rückgängig machen, dass er in die in 80 Kilometer Höhe anzutreffende atmosphärische Sperrschicht mittels Raketen fein verteilten Staub oder Wasserdampf absetzt. Das Material würde sich dann in fein verteilter Form in dieser Schicht von selbst ausbreiten, die Sonnenstrahlung teilweise absorbieren oder in den Weltraum zurück werfen. Da die Luftdichte dort oben sehr gering ist, kann man schon mit relativ wenig Material, d.h. einigen Tonnen, Flächen von vielen tausend Quadratkilometern überdecken. Die Natur hat in ihrer Geschichte solche "Experimente" immer wieder selbst angestellt, und zwar durch gewaltige Vulkanausbrüche. Wenn man z.B. an den Ausbruch des Vulkans Krakatau in der Sundastraße im Jahre 1883 denkt! Damals wurden fein verteilte Staubmassen durch den Explosionsdruck bis in jene 80 km - Schicht hinauf geschossen, wo sie noch Monate lang schwebten. Sie erzeugten in der ganzen Welt spektakuläre Sonnenuntergänge und haben sicher auch Wetter und Klima beeinflusst. Leider gibt es weltweit keine Wetteraufzeichnungen darüber. Die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung reicht aber nicht aus, um das Weltklima zu verändern. Der Mensch müsste es zudem fertig bringen, in den Haushalt der Kondensationswärme unserer Troposphäre einzudringen und diesen sinnvoll zu steuern. Vielleicht wird die Kontrolle des Wetters und des Klimas einmal eine nötige Herausforderung in unserer wissenschaftlichen Zukunft. Das globale Wetterproblem gehen wir ja heute schon seit vielen Jahren mit globalen Werkzeugen an, den Wettersatelliten. So kann mal wohl sicher sagen, dass eine sinnvolle Beeinflussung der Atmosphäre nur gelingen kann (wenn jemals überhaupt), wenn sie vom Weltall aus gesteuert und überwacht wird. Jene sehr vagen Visionen, dass der Mensch dies einmal schaffen könnte, entbinden uns natürlich in keiner Weise davon, gerade heute - aber auch künftig - mit unserer Lufthülle verantwortungsvoll und weitsichtig umzugehen, damit die Probleme nicht so rasch wachsen, dass wir sie wohl nie mehr in den Griff bekommen könnten, trotz aller künftig noch zu erwartenden wissenschaftlichen Fortschritte und technischen Innovationen. Troposphärische Überreichweiten im UKW-Bereich * Um die Entstehung von Überreichweiten verständlich machen zu können, werde ich zunächst die Aufteilung und Ausdehnung der dafür zuständigen Atmosphäre erläutern. In der Meteorologie wird die mehrere 100 km hoch reichende Lufthülle in verschiedene Schichten unterteilt. Diese werden durch entsprechende Flächen begrenzt, die man "Pausen" nennt. Bis zu einer Höhe von ca. 10 km über der Erdoberfläche nimmt die Lufttemperatur normalerweise recht konstant ab. Oberhalb von 10 km bleibt die Temperatur bis etwa 20 km trotz abnehmender Höhe gleich, und zwar bei ca. minus 55 Grad C. Jene Grenzfläche wird "Tropopause" genannt. Die Tropopause trennt die Atmosphäre in zwei Luftschichten mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften. Die unterhalb der Tropopause liegende Schicht, also die Troposphäre, ist die Zone der uns bekannten meteorologischen Erscheinungen. Dort tummeln sich die Kalt- und Warmfronten, dort entstehen Wolken, Niederschläge, Gewitter, Nebel usw. Die oberhalb der Tropopause liegende Schicht wird "Stratosphäre" genannt. Sie hat keinen Einfluss auf die sog. "Tropo-Überreichweiten". Von Tropo-Überreichweiten spricht man daher nur, weil sich dieses Phänomen in der Troposphäre entwickelt. Schon seit langem überholt ist die Auffassung, dass eine Funkverbindung auf VHF und UHF, ja selbst im SHF-Band nur in Sichtweite - also quasioptisch - zu Stande kommen könne. Erfahrungen belegen und Versuche haben bewiesen, dass Verbindungen auf 144 MHz wie auch auf 432 MHz recht oft über Distanzen von 1500 km und mehr zu Stande kommen können. Es müssen demnach Konstellationen entstehen, die solche Weitverbindungen ermöglichen. Inzwischen ist es übrigens klar erwiesen, dass Überreichweiten fast ausschließlich bei Hochdruckwetterlagen auftreten. Bei ausgesprochenen Schlechtwetterlagen können keine Weitverbindungen getätigt werden. Dies wird sicher jeder erfahrene UKW-Amateur bestätigen. Ausnahme: Regenscatter- Verbindungen im Gigahertz- Bereich. Es ist nötig, eine aktuelle Wettersituation analysieren zu können, damit Weitverbindungen nicht ausschließlich dem Zufall überlassen werden müssen. Dazu muss man nicht Meteorologe sein, denn es geht nur darum, die wesentlichsten Kriterien, die zu Überreichweiten führen können, zu erkennen. Längst ist es schon möglich geworden, sich aktuelle Wetterkarten aus dem Internet zu holen. Wir sind also gar nicht mehr auf das Fernsehen und die Zeitung angewiesen, deren Karten sowieso nicht ausreichend detailliert sind. Zur Beurteilung der UKW-Ausbreitung ist auch nicht die Wetterprognose von Bedeutung, sondern nur die momentane Wetterlage. Prognosen beziehen sich auf zu erwartende wetterbedingte UKW-Überreichweiten und sind äußerst schwierig. Es sind schwerpunktmäßig Inversionsvorhersagen (Boden- und Absinkinversionen). Man könnte nun annehmen, dass sich bei jedem Hochdruckgebiet auch Überreichweiten entwickeln müssten. Das ist jedoch nicht der Fall. So führen relativ kleine Hochdruckzellen selten zu ausgeprägten und stabilen Überreichweiten. Es sind vor allem weiträumige Hochdrucklagen, wie sie im Herbst und Winter entstehen, die für Weitverbindungen in Frage kommen. Was verändert sich eigentlich in der Troposphäre durch die Ausbildung einer Hochdruckzone, so dass manchmal Entfernungen von 1000 bis 2000 km überbrückt werden können, denn über eine solche Distanz entwickelt die Erdkrümmung schon beachtliche Dimensionen. Bei derart "guten Bedingungen" kann man davon ausgehen, dass sich die Funksignale der Krümmung der Erdoberfläche anpassen. Diese für Ultrakurzwellen "leitende" Schicht kann man sich als einen Schlauch vorstellen, der in einer bestimmten Höhe über der Erdoberfläche z.B. Süddeutschland mit Schottland verbindet. Im Englischen wird dieses Phänomen als "duct" bezeichnet, was frei übersetzt "Führung", "Schlauch", "Gang", "Röhre" ...heißt. Die für unsere Zwecke leitenden brauchbaren Schichten reichen von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von ca. 2000 m. Darüber liegende Duct-Bildungen haben kaum noch Bedeutung. Nun zur Frage zurück, was sich bei der Ausbildung einer Hochdruckzone in der Troposphäre verändert. Kurz gesagt: Es ist die Beziehung zwischen Temperaturverlauf und Höhe. Normalerweise nimmt die Lufttemperatur mit zunehmender Höhe ziemlich regelmäßig ab. Für unsere Betrachtungen ist eigentlich nur die Analyse des Temperaturverlaufs bis ca. 2000 m über Grund von Bedeutung. Die normale Temperaturabnahme bis in 2 km Höhe beträgt im Mittel etwa zwischen 0,6 und 0,8 Grad C pro 100 m, vom Erdboden aus gerechnet. Der Wert hängt stark von der Luftfeuchte ab, also davon, ob sich Wolken bilden. Wenn wir also über dem Erdboden dicht über dem Meeresniveau eine Temperatur von 20 Grad messen, dann beträgt die Temperatur in 2 km Höhe vielleicht nur noch 4 Grad C. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Temperaturverlauf jedoch genau umgekehrt, d.h. mit zunehmender Höhe nimmt auch die Temperatur zu. Man bezeichnet das als "Temperatur-Inversion", also Temperatur-Umkehr. Die Stärke einer Inversion stellt man an der Größe des Wertes Delta t zwischen der Bodentemperatur und derjenigen am "Temperaturknick" fest. "Temperaturknick" ist die Stelle, über der die Temperatur sprunghaft wieder abnimmt, wo die Bedingungen also wieder "normal" werden. Der Duct, also die "leitende" Schicht, bildet sich stets am Temperaturknick, d.h. an der Stelle, an der die Temperaturumkehr beginnt. Der daraus resultierende "Schlauch" kann sich manchmal über Entfernungen bis zu 2000 km erstrecken. Allerdings ist diese leitende Schicht selten homogen, weder in der Leitfähigkeit, noch in der Breite. Deshalb sind Weitverbindungen nicht von allzu langer Dauer und halten nur einige Stunden bis einige Tage an. Außerdem sind sie oft mit erheblichen Feldstärkeschwankungen behaftet. Die Dicke des Ducts in der Vertikalen ist über längere Strecken oft recht unterschiedlich. Sie kann zwischen 100 und 500 m variieren. Auch die Höhe der leitenden Schicht über Grund kann zwischen Meeresniveau und etwa 1000 m über NN liegen. Man kann kräftige Inversionen, wie sie z.B. im Herbst häufiger entstehen, optisch bisweilen sehr gut erkennen, und zwar, wenn man sich über der Inversionsschicht befindet. Von einem erhöhten Standort im Gebirge aus blickt man in einem solchen Fall auf ein "Nebelmeer", bei welchem die Nebelobergrenze sehr gradlinig und scharf unter dem Horizont liegt. Bei solchen Wetterlagen ist der Temperaturunterschied zwischen der Talsohle und der Nebelobergrenze oftmals recht markant. Überreichweiten stellen sich immer erst dann ein, wenn durch Überlagerung warmer Luft über kalter Luft eine Inversion, also eine Umkehr der Temperatur entsteht. Inversionen haben manchmal eine sehr markante Grenzschicht, in der sich die Temperatur im Dekameterbereich bisweilen um 10 - 20 Grad ändert. Damit werden auch die Dichtedifferenzen in jener Schicht so groß, dass die Möglichkeit der Spiegelung von elektromagnetischen Wellen hervor gerufen wird. Inversionen sind also stets an das Vorhandensein von unterer Kaltluft und darüber liegender Warmluft gebunden. Vor allem im Winterhalbjahr treten derartige Wetterlagen vermehrt auf, wobei sie oft in topographischen Mulden besonders ausgeprägt sind. Den Grund dafür bildet die mangelnde Sonneneinstrahlung im Winterhalbjahr. Die bodennahe Luftschicht kann sich dann im Kontakt mit dem Erdboden besonders stark abkühlen. Vor allem bei klarem Himmel kommt es zu großen Temperaturverlusten in Folge von Ausstrahlung. Hochdrucklagen sind deshalb besonders geeignet, um diese bodennahen Inversionen zu erzeugen. Nachteilig für Weitverbindungen ist es jedoch, dass solche Inversionen im allgemeinen nur 100 bis 300 m über Grund reichen. Interessanter werden die Inversionen erst, wenn sie im Höhenbereich von 800 bis 1000 m über Grund liegen. Das geschieht z.B., wenn sich trockene Kaltluft großflächig unter vorhandene wärmere, also weniger dichte Luft, schiebt und jene somit langsam anhebt. Im südwestlichen Randbereich eines Hochs über Skandinavien oder Osteuropa kann das im Winterhalbjahr öfter mal passieren. Es gibt aber noch eine andere, sehr günstige meteorologische Ausgangslage, die solche höher gelegenen Inversionen erzeugt. Immer dann, wenn im Randbereich eines Hochs noch kalte Luft am Boden liegt und aus Südwesten auf der Vorderseite eines Tiefs bereits wesentlich mildere Luft dagegen anströmt. Man spricht dann von einer sog. "Warmluftadvektion". Diese Lage findet sich häufig bei einem Hoch, das im Abbau begriffen ist. Eine Störung führt dann von Westen einen Schub Warmluft nach Norden gegen das zurück weichende Hoch. Dies geschieht bei uns in Deutschland z.B., wenn sich eine über Frankreich und den BeneluxLändern liegende Front an die Westflanke eines mitteleuropäischen Hochs drängt. Bei den Ausbreitungsbedingungen spielt jedoch auch die Höhe des Standortes in Bezug auf die Inversionsschicht eine Rolle. Ich sagte ja schon, dass weiträumige Temperaturumkehrschichten in verschiedenen Höhen über Grund entstehen, etwa zwischen 100 und 2500 m. Die Stärke der Inversion hängt von der Größe der Temperaturdifferenz ab. Je ausgeprägter der Temperaturknick, desto kräftiger die Inversion. Für eine für große Überreichweiten geeignete Inversion muss geltend gemacht werden, dass die "Duct"-Bildung nach oben und unten scharf begrenzt ist. Dann ist nämlich die "leitende" Schicht wie in einem Schlauch oder Hohlleiter gefangen. Doch es können bei solchen kräftigen Inversionen nur jene Stationen in den Genuss von Weitverbindungen kommen, die auf der Höhe der Inversion liegen. Die anderen Stationen, die standortmäßig nicht auf gleicher Höhe liegen wie die Inversionsschicht, sind hingegen stark benachteiligt, weil sie nicht in die leitende Schicht einstrahlen können. Vor allem in hügeligen und bergigen Gebieten ist dieser Effekt spürbar. So ist es schon beeindruckend, wenn beispielsweise Stationen auf dem Feldberg im Schwarzwald in 1400 m Höhe stundenlang mit englischen Stationen arbeiten konnten, wohingegen in die 60 km südöstlich davon gelegene Züricher Gegend in 900 m Höhe keine Verbindung zu Stande kam. Vertikalsonden fanden den Grund dafür heraus: Die Inversion hatte auch über Zürich und darüber hinaus bis an den Alpenrand durchgehend eine Höhe von 1300 m über NN. Es ist sicher schon wichtig, dass man solche Zusammenhänge versteht, um noch mehr Freude an UKW-DX-Verbindungen zu bekommen. Hinweise auf Überreichweiten kann man z.B. durch Informationen über die Großwetterlage erhalten, also durch Fernsehen, Tageszeitungen und meteorologische Anstalten, inzwischen auch kostenlos über das Internet. Manchmal lassen auch Störungen der Fernsehbilder und Rundfunkaussendungen vermuten, dass Überreichweiten im Spiel sind. Weiterhin bietet das Abhören von Bakensendern, die bei normalen Bedingungen nicht zu empfangen sind, eine Möglichkeit, Überreichweiten festzustellen. Natürlich sollte man auch den laufenden Funkverkehr beobachten und "abhorchen", um Informationen zu sammeln, die einen Hinweis auf gute Bedingungen liefern. Alle Erläuterungen gelten grundsätzlich für 144 MHz wie auch für das 70 cm- Band. Die Streckendämpfung nimmt allerdings mit der Höhe der Frequenz zu. Dennoch sind in Einzelfällen die Ausbreitungsbedingungen auf 432 MHz manchmal besser als auf 144 MHz. Bei vermuteten Überreichweiten empfiehlt es sich daher, beide Frequenzbereiche auf weit abgelegene Stationen abzusuchen. Die im UKW-Bereich betriebenen Baken können wertvolle Hinweise auf mögliche Überreichweiten liefern. Wenn auch die ERP-Leistungen jener Sender recht verschieden sind, so sind die weiter entfernten unter normalen Bedingungen nur schlecht oder gar nicht zu hören. Bei angehobenen Bedingungen oder vermuteten Überreichweiten kann das Abhorchen einer für eine bestimmte Richtung in Frage kommenden Bake nützliche Informationen liefern. Dabei ist die Auswertung von Baken im Nahfeld, d.h. in 100 - 200 km Entfernung, wenig sinnvoll, da sich stärkere Inversionen auf diese kurzen Distanzen kaum auswirken. Auch das Abhören von Baken, die zu hoch liegen, also auf ca. 3000 m, bringt nichts, da in diesen Höhen Inversionen selten auftreten und für Weitverbindungen kaum zu nutzen sind. Ich hatte erwähnt, dass UKW-Überreichweiten nur bei Hochdrucklagen entstehen können, weil sie die erforderliche Besonderheit der Luftschichtung hervor zu rufen im Stande sind, die wir "Inversion", also Temperaturumkehr nennen, ohne die eine Spiegelung der Funkwellen nicht möglich ist. Man kann sich ein Hochdruckgebiet wie einen "Luftberg" vorstellen, der einmal zu stärkeren, ein andermal zu schwächeren "Hängen" neigt. Die warme Luft im Hoch ist dünner als diejenige ihrer Umgebung und hat deshalb die Tendenz, in allen Höhenschichten aus dem Hoch heraus zu fließen. So kommt es dazu, dass manchmal das Absinken der Luft, bisweilen aber auch das Auseinanderfließen überwiegt. Die abfließende Luft strebt dabei dem tieferen Druck der Umgebung zu. Dem Hoch würde rasch die Luft ausgehen, wenn diese nicht durch aus großen Höhen abfließende Luft ständig ersetzt würde. Jene Abwärtsbewegung der Luft ist es, die zu einer Erwärmung und zu einer Verringerung der relativen Feuchte führt, und somit vielfach auch zu einer Auflösung von Wolken. Dadurch entsteht die sog. "Absinkinversion", die je nach Höhe zu bemerkenswerten Weitverbindungen führen kann. Wenn also das Hoch am Boden viel Luft abgibt und mit absinkender Luft aus der Höhe wieder aufgefüllt wird, können sich Inversionen zwischen 500 und 2000 m Höhe ausbilden. Bisweilen treten noch höher gelegene, meist schwächere Inversionen in 3 - 4 km Höhe auf, die für Weitverbindungen jedoch kaum Bedeutung haben. Die zweite Inversionsart ist die sog. "Bodeninversion" oder "Strahlungsinversion". Sie entsteht durch Energieabgabe der Erdoberfläche, meist in klaren Nächten. Die Luftschicht über dem Erdboden kühlt sich ab und bildet dann eine Temperatur-Umkehrschicht unter der darüber liegenden Luft aus. Die Höhe jener Inversion reicht auch in klaren Winternächten selten über 300 m Höhe hinaus. Jene Inversion hat wegen ihrer Bodennähe den Namen "Bodeninversion" erhalten. Sie tritt wesentlich häufiger als die Absinkinversion auf, führt aber nur zu geringeren Überreichweiten, selten zu Weitverbindungen, lässt jedoch die Feldstärken im Nahbereich bis ca. 200 km oft markant ansteigen, wodurch es oft zu Störungen im Relais-Funkverkehr kommt. Manchmal arbeiten Boden- und Absinkinversion zusammen. Dann wird es von oben wärmer, während die Temperatur von unten gleichzeitig abnimmt. Der Temperaturknick wird dadurch stärker oder es treten gleich zwei davon übereinander liegend - im Bereich zwischen 300 und ca. 600 m Höhe auf. In Tiefdruckgebieten können sich derartige Temperaturumkehrschichten nicht ausbilden, da sich aufsteigende Luftmassen abkühlen. Es wird also mit zunehmender Höhe kälter in unserer Troposphäre. Dennoch gibt es Fälle, wo die UKW-Bedingungen sich auch im Bereich eines Tiefs - wenn auch nur kurzfristig und meist sprunghaft- verbessern können. Dieses Phänomen wurde schon öfter im Bereich einer Kaltfront beobachtet. Die kalte Luft trifft meist zuerst in Bodennähe ein und hebt die wärmere Luft an, so dass sich im regional begrenzten Raum der Front kurzzeitige Überreichweiten ergeben können. Hinter der Kaltfront kann es zudem manchmal zu einem sprunghaften Luftdruckanstieg kommen, was ein Absinken von Luftmengen zur Folge hat, so wie es im Hochdruckgebiet im großen Stile geschieht. Außerdem ist die Luft hinter der Kaltfront meist sehr trübungsarm und daher besonders strahlungsdurchlässig. Eine vorübergehende Abnahme des Windes und Aufklarung nachts hinter der Front verstärken die Effekte. Sind die allgemeinen Ausbreitungsbedingungen in Tiefdruckgebieten gewöhnlich ziemlich normal, so sind jedoch die Funkverbindungen von Stationen auf gleichen Isobaren, also Linien des gleichen Luftdrucks, im Allgemeinen weitreichender als quer zu den Isobaren. Verständlich ist dies, wenn man bedenkt, dass die Luftschichtungen entlang der Isobaren meist einheitlicher sind als quer dazu. Es herrschen nämlich in nahezu gleichen Luftdruckbereichen um das Tief herum sich manchmal ähnelnde Windstärken, Temperaturverteilungen und Feuchteverhältnisse. Bisweilen gibt es im Bereich von Tiefdruckgebieten auch Luftturbulenzen im höheren Troposphärengebiet, starke vertikale Luftströmungen, Wirbel und Schlieren, im Flugverkehr als sog. "Luftlöcher" gefürchtet. Oft sind hochreichende Gewitter daran beteiligt. Aber auch die Nähe eines Jet-Streams kann über uns solche Verhältnisse herbeiführen. An den dadurch bisweilen entstehenden wabenartigen Luftpaketen können durch diffuse Reflexionen im UKW-Bereich ebenfalls Überreichweiten hervorgerufen werden. Bei hochreichenden Gewittern können zudem Wärme- und Feuchteumwälzungen zeitweise zu regional auftretenden Unregelmäßigkeiten in der UKWAusbreitung führen. Der Grund dafür: zellenartige Änderungen in der Luftdichte. Aber dennoch bleibt es dabei: Großräumige, längerfristige und markante Inversionslagen treten nur im Bereich von Hochdruckgebieten auf mit ihren warmen "Deckeln" auf kühlem Grund. Zum Schluss nenne ich zusammenfassend ein paar Wetterphänomene, die "überreichweitenverdächtig" sein könnten. Wetterbedingte UKW-Überreichweiten entstehen oft bei langsam abwandernden oder sich allmählich abbauenden Hochdruckgebieten, kurzfristig aber auch bei kleinen schnell vorbei ziehenden Zwischenhochs. Auch der Luftdruck selbst hat bisweilen Einfluss auf die UKW-Ausbreitung. Begünstigend wirken sich z.B. langsamer und stetiger Anstieg, aber auch Luftdruckkonstanz aus. Auch der sprunghafte Luftdruckanstieg hinter einer Kaltfront mit Niederschlag kann kurzzeitig zu guten Bedingungen führen. Zudem spielen die Windverhältnisse eine große Rolle. Hier sind es schwache Luftbewegung oder Windstille, die man als Voraussetzung einer verbesserten UKW-Ausbreitung anführen muss. Beobachtet hat man gute Verbindungsmöglichkeiten von Amateuren, die auf der gleichen Isobare ( gleiche Luftdrucklinie) über einer Höheninversion liegen. Überhaupt sind die UKW-Reichweiten etwa in Richtung der Isobaren im allgemeinen weitreichender als diejenigen, die quer zu den Isobaren verlaufen. Gewitterfronten bringen die Ausbreitungsbedingungen oft sehr durcheinander und führen manchmal zu sprunghaften Überreichweiten. Besteht in der Nacht die Tendenz zu Wolkenauflösung und nimmt dabei der Wind ab, kann mit einer Bodeninversion in den frühen Morgenstunden gerechnet werden. Fällt der Begriff "Warmluftadvektion", sollten Sie den Empfänger mal einschalten und die Ausbreitungsbedingungen überprüfen. Die "Hoch-Zeiten" der Tropo-Weitverbindungen sind die Jahreszeiten Herbst und Winter. Aber auch im Frühjahr und Sommer entstehen bisweilen Wetterlagen , die Weitverbindungen ermöglichen. DL5EJ OV Kempen DOK R05 im DARC * Dieser Text wurde auch im "Funkwetterbericht" der sonntäglichen "Rhein/Ruhrgebiet-News" in sechs Folgebeiträgen ausgestrahlt. Er erschien auch in "CQ-DL" 10 / 2000. Regenscatter Quelle: DL4IB und DL3NQ "Lokale unwetterartige Gewitter über Deutschland": so lautet manchmal die Wetterschlagzeile in Deutschland. Solche Wetterlagen mit Gewittern, Fronten und verschiedenen Formen von Niederschlägen haben bisweilen ganz erhebliche Auswirkungen auf den Funkverkehr im Gigahertz- Bereich. Regen- und Gewitterwolken reflektieren und streuen nämlich Mikrowellen-Frequenzen. Die Meteorologie nutzt die Reflektion an den Wolken, um Kurzzeitprognosen über Niederschläge (Regenradar) zu erstellen. Diese Streuungen lassen sich auch für Funkverbindungen vor allem im 3 cm- Band (10GHz) benutzen. Da auf den höheren Bändern der Antennengewinn recht groß wird, lassen sich mit ca. 1 Watt und einem 50 cm Spiegel durchaus Verbindungen über 300 km erreichen. Auf Grund der diffusen Streuung und anderer Effekte sind RegenscatterSignale stark verbrummt und zischen teilweise. Eiskerne reflektieren besonders stark, wenn sie so groß sind wie die halbe Wellenlänge der Funkfrequenz. D.h. bei 10 GHz sind das 1,5 cm große Eiskristalle und bei 5.7GHz (das sind freigegebene Amateurfunkfrequenzen) sind es 3 cm große Kristalle/Kerne. Man kann mit einer relativ kleinen Ausrüstung auf 10GHz (60cm Parabolspiegel) ein Gewitter in 400 km Entfernung noch "entdecken" über Reflexionen von Funkbaken. (ähnlich dem Wetterradar). Über die Änderung der Elevation (Höhenverstellung) kann man auch ein herannahendes Gewitter sehr gut verfolgen. 3 cm Wellen werden an dichten Regenwolken reflektiert. Auf diese Weise lassen sich mehrere hundert Kilometer überbrücken. Man beobachtet z.B. auf www.wetteronline.de das Regenradar, hält seinen Spiegel auf eine Regenfront im näheren Umfeld - und schon hört man viele OM in CW CQ rufen. Der Klang der Signale ist etwas gewöhnungsbedürftig, da sie sehr verbrummt klingen. Ähnlich wie bei Aurora. In einer ausgeprägten und voll ausgebildeten Gewitterwolke, einem Cumulonimbus, sind die Abläufe folgendermaßen (Ich beziehe mich auf das Originalskript von DL3NQ): "Der Gewitterturm eines Cumulonimbus besteht natürlich nicht nur aus einem, sondern aus einer Vielzahl von Auf- u. Abwind-Schloten, die auch 'Echozellen' genannt werden. Ihre einzelne Lebensdauer beträgt nur ca. 20 Minuten, es werden aber fortwährend neue gebildet (begleitet von heftigen, inneren elektrischen Entladungen). Die Gesamtlebensdauer eines Cumulonimbus kann - je nach Größe- zwischen 40 und 120 Minuten liegen. Besonders mächtige Exemplare können selbst die Tropopause bei max. 12.000 m erreichen und die Aufwinde der Schlote stoßen dann mit großer Energie in die stabile 'Stratosphäre' hinein. Die Turbulenz in diesen Türmen ist enorm, daher wird auch von den größten Verkehrsflugzeugen ein Durchfliegen gern vermieden". Als Ergebnis der ersten amateurfunkmäßigen Beobachtungen des 3 cm-Bandes kam man Anfang der 90iger Jahre zu dem Schluss: Das 3 cm-Band ist ein Schlechtwetter-Band! Auch die Erfahrungen der folgenden Jahre bestätigten das eindrucksvoll. Die 5 Knackpunkte des Regenscatter- Phänomens: 1. 2. 3. 4. 5. Wassertröpfchen streuen Mikrowellen. Ein turbulentes Kollektiv verformt ein diskretes Signal zu einer Rauschglocke. Die Relativbewegung von Scatter- Zonen hat Dopplerverschiebungen zur Folge. Der 'Streugrad' kleiner Wassertröpfchen wächst mit der 6. Potenz ihres Durchmessers In mächtigen Cumulonimben können Scatter- Zentren Höhen bis zu 10 km erreichen. Die Theorie besagt, dass Reflexion und Streuung von Energie im elektrischen Wellenfeld auftritt, wenn sich im 'durchstrahlten Medium' die Dielektrizitäts - Konstante auf kurze Entfernung ändert. Wassertröpfchen erfüllen diese Voraussetzungen recht gut, denn sie stellen dielektrische Kügelchen dar, deren Durchmesser kleiner als 1/20 Wellenlänge ist. Umfangreiche Forschungen nach dem 2. Weltkrieg haben ergeben, dass neben ihrer Dichte vor allem ihre Größe ausschlaggebend ist für das Rückstreumaß Wenn zum Beispiel 1000 Tröpfchen mit dem Radius 0,005 mm koagulieren und so ein neues Tröpfchen mit dem Radius 0,05 mm bilden, dann gibt es zwar 1000 kleine Reflektoren weniger, aber dafür einen neuen, der l.000 000 - fach stärker rückstreut! Würden das alle im Gebiet befindlichen Tröpfchen gleichzeitig tun, würde dessen 'Scatterleistung' also schlagartig um 30 dB zunehmen! So läuft das zwar nicht ab, aber es lässt sich leicht einsehen, warum man einen Landregen schwächer 'hört' als einen Regenschauer und wieso die Scatter- Echos von aktiven Quellwolken manchmal binnen 20 Minuten um mehrere Zehnerpotenzen ansteigen können. Es kondensiert nämlich die aufsteigende, feuchte- gesättigte Warmluft infolge der adiabatischen Abkühlung zu kleinsten Tröpfchen, die nach und nach wachsen, schließlich zu fallen beginnen, jedoch von dem stärker werdenden Sog erneut mit nach oben gerissen werden, immerfort mit anderen koagulieren und so weiter: Ein "Echoturm" bildet sich! Nähert sich der Durchmesser der Wassertröpfchen 0,5 mm, dann wird die 6. Potenz des Durchmessers immer schneller kleiner, so dass ab ca. 8 mm Durchmesser das Rückstreumaß nicht mehr weiter wächst. Radarbilder zeigen, dass sich die aktiven Scatterzentren etwa in der Mitte der jungen Schlote in einer Höhe von ca. 3500 m zuerst bilden, um dann schnell nach oben -aber auch nach unten- zu wachsen. Mächtige Schlote können bis zur Tropopause aufsteigen und sie sogar durchstoßen, wie schon erwähnt. Deren Höhe kann ab Juni 10 bis 12 km erreichen, ab Herbst dagegen bis auf 5 km absinken. Nach dem Überschreiten der weit tiefer liegenden Nullgradgrenze gehen die nach oben wirbelnden Tropfen zunächst in einen 'unterkühlten' Zustand über und gefrieren dann schließlich zu Eiskörnern. Werden sie aus dem Schlot herausgeschleudert, oder lassen die Auftriebskräfte nach, fallen sie zurück und schmelzen meistens, bevor sie den Erdboden erreichen. Geraten sie aber mehrfach in nachfolgende Schlote, in denen sie wieder nach oben gerissen werden und dabei weiter wachsen, dann droht Hagelschlag. Umgekehrt kann es in der Anfangsphase der Bildung von Wärmegewittern vorkommen, dass die angesaugte feuchte Warmluft zunehmend in trockenere übergeht und die fallenden Tröpfchen wieder verdunsten, ehe sie den Boden erreichen, d.h. es kommt nicht zum 'Abregnen', sondern die Quellwolke löst sich langsam wieder auf. Eis hat etwas andere Scatter- Eigenschaften als Wasser. Bis zu einer Größe von 10 mm verhalten sich Eiskugeln ähnlich wie Wassertropfen, allerdings mit etwa 10 dB schlechterer Rückstreuung. Das ändert sich, wenn sie weiter wachsen. Ab 20 mm sind sie so gut wie gleich große Wassertropfen, aber ab 50 mm Durchmesser scattern sie etwa 20mal stärker als jene - solange sie 'trocken' sind. Sobald sie aber angetaut sind, d.h. von einem Wasserfilm umgeben, verhalten sie sich auch wie Wassertropfen. Regen ohne den Umweg über Eis Der Vollständigkeit halber will ich nun aber auch noch erwähnen, dass Regen in selteneren Fällen auch ohne Eis entstehen kann. Denn auch Wolken, die relativ warm und an ihrer Oberfläche nicht kälter als -15 Grad sind, können Regen liefern. Dabei spielt der Zusammenstoß von Wolkentröpfchen die entscheidende Rolle. Damit die Anzahl jener Zusammenstöße mengenmäßig groß genug wird, müssen die Wolkentröpfchen zunächst einmal unterschiedlich groß sein, damit sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Wolke unterwegs sind. Beim Zusammenstoß können sich zwei Tröpfchen zu einem größeren Tropfen vereinigen. Wegen der Oberflächenspannung muss das aber nicht immer der Fall sein. Beim Fallen fängt ein größerer Tropfen auf der Vorderseite kleine Tröpfchen ein, während andere durch den Sog auf der Rückseite angezogen werden. Im Verhältnis zum Wachstum eines Eiskristalls erfolgt das Anwachsen eines Regentropfens allerdings sehr langsam. Deshalb muss er sich relativ lange in der Wolke aufhalten. Zum Beispiel fällt ein Wassertropfen von 0,2 mm bei ruhiger Luft in 12 Minuten durch eine 500 Meter dicke Wolke. Durch Aufwinde verringert sich die Fallgeschwindigkeit und der Wolkentropfen kann noch größer werden. Das ist zum Beispiel bei einem warmen Stratus der Fall, in dem durch solche Zusammenstöße Wolkentröpfchen so groß werden können, dass sie als Nieselregen bis zum Boden fallen können. Einen Sonderfall gibt es in den Tropen. Dort können selbst mächtige Quellwolken bis zur Obergrenze im positiven Temperaturbereich bleiben. Durch starke Aufwinde werden die Wolkentröpfchen dort so lange getragen, dass sie durch ihre Zusammenstöße zu recht großen Regentropfen anwachsen können. In unseren Breiten geschieht so etwas sehr selten. Thermodynamische Aspekte der UKW-Ausbreitung Adiabatische Vorgänge Die Entstehung der sogenannten "UKW-Bedingungen" hat im meteorologischen Bereich (Tropo) ihre Ursache in den Temperaturänderungen der Luft unter dem Einfluss ihrer Vertikalbewegungen (Thermodynamik). Wenn auch die im unteren Bereich der Troposphäre durch die Sonne zugeführten Wärmemengen zeit- und gebietsmäßig großen Schwankungen unterliegen, so sind der Temperaturabnahme der Luft in Abhängigkeit von der Höhe doch ziemlich enge Grenzen gesetzt. Die in jenen Grenzen auftretenden Unterschiede haben jedoch eine große Auswirkung auf das Wetter und damit auch auf die Ausbreitung der ultrakurzen Wellen. Im Durchschnitt beträgt die Temperaturabnahme mit zunehmender Höhe etwa 0,65°C je 100 Meter. Manchmal kann in der realen Troposphäre unter ganz besonderen Umständen ein Wert von 1°C kurzfristig überschritten werden. Eine Luftmenge, die angehoben wird, kommt in unserer Atmosphäre unter geringeren Druck und dehnt sich dabei aus. Für diese Ausdehnung wird Energie benötigt, die der Luft in Form von Wärme entzogen wird. Das Luftquantum kühlt sich also ab. Voraussetzung ist jedoch, dass Wärme von "außen" weder zu- noch abgeführt wird, das heißt, der Prozess muss "adiabatisch" verlaufen. Bei einem "adiabatischen" Vorgang wird der Luft nur ihre eigene "innere" Energie entnommen. Die adiabatische Temperaturänderung eines Luftteilchens bei seinem Aufsteigen beträgt 1°C pro 100 m in allen Höhenlagen. Umgekehrt wird absinkende Luft um den gleichen Betrag erwärmt. Die Luft gerät dann unter höheren Druck, sie wird also komprimiert, was ihrer inneren Energie zugute kommt. Sie erwärmt sich. Man bezeichnet jene eintretenden Temperaturänderungen von 1° je 100 m als "trockenadiabatisch". Die adiabatische Temperaturänderung von 1° je 100m bei Vertikalbewegungen gilt aber nur so lange, wie keine Kondensation stattfindet. Bei Kondensationserscheinungen wird nämlich Wärmeenergie abgegeben, die der Abkühlung von 1° je 100 m entgegen wirkt. Die Temperaturänderung erfolgt nun "feuchtadiabatisch". Die feuchtadiabatische Temperaturänderung ist geringer als die trockenadiabatische. Die trockenadiabatische Abkühlung wird also verringert, und zwar um so mehr, je größer die Wasserdampfmengen sind, die für die Kondensation zur Verfügung stehen. Die Menge des in der Luft vorhandenen Wasserdampfes hängt nun aber von der "Sättigungsfeuchte" ab - und diese wiederum von der Temperatur. Die Sättigungsfeuchte sinkt mit abnehmender Temperatur. Deshalb wird die feuchtadiabatische Temperaturänderung mit abnehmender Temperatur immer größer und nähert sich bei sehr tiefen Temperaturen sogar dem Wert von 1°C je 100 m. Außerdem hängt die Sättigungsfeuchte auch noch vom Luftdruck ab. Bei abnehmendem Luftdruck hat sie ebenfalls abnehmende Werte. Will man etwas über die Vertikalbewegungen eines Luftteilchens aussagen, muss man stets die trocken- und feuchtadiabatischen Temperaturänderungen beachten. Jene sind es nämlich, die das Verhalten eines Luftteilchens, eines Luftquantums und oft auch einer größeren Luftschicht bestimmen. Dabei ist eine "Inversion", die unsere UKW-Ausbreitung verbessert, nur ein "Sonderfall", sozusagen eine regionale "extreme", nicht "normale" Stabilität in unserer Lufthülle. Gleichgewichtszustände der Atmosphäre Weist unsere Troposphäre z.B. einen Zustand auf, bei dem der Temperaturgradient (regelmäßige Temperaturabnahme mit der Höhe) geringer als 1° je 100 m ist, so kommt ein Luftteichen, das sich entlang seiner Trockenadiabate aufwärts bewegt (also 1° Temperaturabnahme mit der Höhe) in seiner Umgebung immer kälter an als die Luft ist, die es umgibt. Es ist somit schwerer als seine Umgebung und muss deshalb wieder in seine Ausgangslage zurück sinken. Sein Zustand ist stabil, in unserem Falle "trockenstabil" in Bezug auf Vertikalbewegungen. Bei einem vertikalen Temperaturgradienten von über 1°C je 100 m würde jenes Luftteilchen wärmer als seine Umgebung bleiben und weiter aufsteigen. Es wäre "trockenlabil". Bei einem Temperaturgradienten von 1° C je 100 m hat das Teilchen immer dieselbe Temperatur wie seine Umgebung. Es treten keine Dichteunterschiede auf. Das Teilchen kann somit in jeder Höhe sich aufhalten. Sein Zustand ist "trockenindifferent". Alle drei Zustände haben auf die UKW-Ausbreitung keine nennenswerten Einflüsse. Betrachten wir nun die Vertikalbewegung feuchter Luft. Wir erinnern uns daran, dass die feuchtadiabatische Temperaturänderung wesentlich geringer ist (auf Grund der freiwerdenden Kondensationswärme). Ist der vertikale Temperaturgradient z.B. kleiner als 0,5° je 100 m, so kommt ein Luftpaket mit einer feuchtadiabatischen Temperaturänderung von 0,5° C je 100 m immer kälter an als die Umgebungstemperatur ist. Es sinkt also wieder ab. Sein Zustand ist "feuchtstabil". Ist der Temperaturgradient größer als 0,5°C/100 m kommt die Luft wärmer an als die Umgebung und kann weiter aufsteigen. Man nennt den Zustand deshalb "feuchtlabil". Beträgt der Temperaturgradient 0,5°/100 m, entspricht er also der Feuchtadiabate, so hat das Luftquantum immer die gleiche Temperatur wie seine Umgebung. Sein Zustand ist "feuchtindifferent". Auch diese Zustände haben keine besonderen Auswirkungen auf die UKW-Ausbreitung. Isothermie und Inversion Den Zustand, bei dem eine Luftschicht eine gleichbleibende Temperatur aufweist, nennt man "Isothermie". Er kann nach dem oben gesagten "trocken- oder feuchtindifferent" sein. Auf jeden Fall ist es ein sehr stabiler Zustand, der einen vertikalen Luftaustausch verhindert. Wenn es über dieser Schicht, deren Dicke ja zwangsläufig begrenzt ist, kälter wird, bleiben die UKW-Bedingungen "normal". Für die UKW-Ausbreitung bedeutsam wird erst ein Zustand, bei dem die Temperatur in der Luftschicht nach oben zunimmt ("Inversion"). Isothermie und vor allem Inversionen wirken noch stärker hemmend auf Vertikalbewegungen ein als es bei gewöhnlichen stabilen Zuständen der Fall ist. Inversionen können sich aus verschiedenen Ursachen ausbilden. In den bodennahen Luftschichten treten sie als sogenannte "Bodeninversionen" auf. In klaren Nächten kühlt sich der Boden infolge von Wärmeausstrahlung stark ab und somit auch die darüber liegende Luftschicht. Diese wird kälter als die darüber liegenden Luft, so dass die Temperatur vom Boden aus nach oben zunimmt. Die Ultrakurzwellen treten daher aus einem dichteren Medium in ein dünneres ein und werden vom Einfallslot weg in Richtung Erdoberfläche gebrochen. Es kommt zu Überreichweiten, deren Größe in erster Linie vom Temperaturunterschied im Bereich der Inversion abhängt, aber auch von der Höhe der Inversion, die meist nur wenige Dekameter aufweist. Für die UKW-Ausbreitung bedeutsamer sind jedoch Inversionen in der freien Atmosphäre. Diese haben hauptsächlich zwei Ursachen: 1. Wärmere Luft schiebt sich über wesentlich kältere ("Warmluftadvektion"). Man spricht in diesem Falle von "Aufgleitinversion". 2. "Absink- oder Schrumpfungsinversionen". Bei absinkenden Luftbewegungen, die ja stets trockenadiabatisch sind, also eine Temperaturerhöhung von 1° C/ 100 m bewirken, fließt die Luft bei erhöhtem Luftdruck am Boden auseinander, wobei oftmals der Fall eintritt, dass sich die Absinkbewegungen nicht bis zum Boden durchsetzen. So bleiben die Temperaturverhältnisse in der unteren Schicht gleich, während sich die darüber befindlichen Luftmassen trockenadiabatisch erwärmen. Nehmen wir einmal an, der vertikale Temperaturgradient betrüge 0,6°/ 100 m. Da sich die absinkende Luft jedoch trockenadiabatisch um 1°/ 100 m erwärmt, hat sie bald eine wesentlich höhere Temperatur als die in Nähe des Bodens lagernde Luft, so dass sich im Grenzbereich eine Absinkinversion ausbilden kann. Jene "Schrumpfungsinversion" (Schrumpfung deshalb, weil die Luft in größeren Höhen unter geringerem Druck stand und "gestreckter" war) liegt höher als eine Bodeninversion. Für verbesserte UKW-Bedingungen mit guten Überreichweiten hat sich eine Höhenlage der Absinkinversionen zwischen 500 und 2000 Metern erwiesen. Klaus Hoffmann, DL5EJ