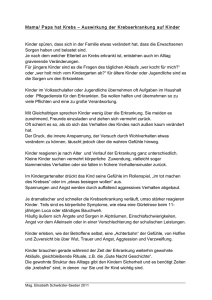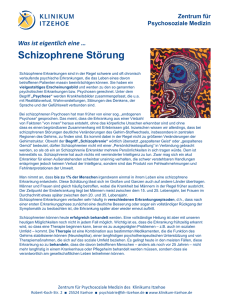und stigmafokussierte Angehörigenarbeit bei - Beck-Shop
Werbung

Therapeutische Praxis Emotions- und stigmafokussierte Angehörigenarbeit bei psychotischen Störungen Ein Behandlungsprogramm Bearbeitet von Roland Vauth, Nadine Bull, Gerda Schneider 1. Auflage 2009. Taschenbuch. 116 S. Paperback ISBN 978 3 8017 2235 7 Format (B x L): 21 x 29,7 cm Weitere Fachgebiete > Psychologie > Psychotherapie / Klinische Psychologie Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Kapitel 1 Die Störung: Merkmale und Verlauf schizophrener Erkrankungen Über schizophrene Erkrankung herrschen in der Allgemeinbevölkerung viele Vorurteile, die bereits in der langen Prodromalphase der Erkrankung von in der Regel drei bis fünf Jahren (vgl. Haefner, an der Heiden, Löffler, Maurer & Hamprecht, 1998) dazu führen, dass Betroffene und Angehörige zu spät professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Häufige Vorurteile sind, dass es sich um eine sehr seltene Erkrankung handelt, dass sie immer einhergeht mit einer Gefährlichkeit, die etwa dem Klischee des Dr. Jekyll und Mr. Hyde folgt („gespaltene Persönlichkeit“), und dass sie zu einer dauerhaften Lebensuntüchtigkeit führt. Epidemiologische Daten (vgl. zur Übersicht: Tandon, Keshavan & Nasrallah, 2008) über die Anzahl der Neuerkrankungen (Inzidenz) und den Verlauf der Erkrankung machen aber klar, dass die Krankheit durchaus nicht selten ist. Etwa 0.7 bis 1 % der Bevölkerung leidet daran (Saha, Chant, Welham & McGrath, 2005). In Deutschland sind demzufolge etwa 800.000, in der Schweiz annähernd 70.000 Menschen (Lebenszeitprävalenz) mindestens einmal in ihrem Leben von einer schizophrenen Episode betroffen. Dies entspricht etwa der Einwohnerzahl einer Stadt der Größe von Köln bzw. Winterthur und der Häufigkeit des Auftretens von Diabetes. Die Ein-Jahres-Neuerkrankungsraten liegen bei 8 bis 40 pro 100.000 Einwohner und Jahr, mit relativ ähnlichen Raten zwischen verschiedenen Kontinenten (Jablensky et al., 1992; McGrath et al., 2004; Saha et al., 2005). Dies bedeutet für Deutschland ca. 6.600 bis 32.000 und in der Schweiz zwischen 560 bis 2.800 Betroffene pro Jahr. Eine erhöhte Inzidenz ist assoziiert mit Urbanität (Amaddeo & Tansella, 2006; Kirkbride et al., 2006; Lewis, David, Andreasson & Allebeck, 1992; McGrath et al., 2004; Mortensen et al., 1999; Pedersen & Mortensen, 2001), Migration (Bhugra et al., 1997; Boydell et al., 2001; Cantor-Graae & Selten, 2005; Fearon et al., 2006), männlichem Geschlecht (Aleman, Kahn & Selten, 2003; Beauchamp & Gagnon, 2004; McGrath et al., 2004) und unterer sozialer Schicht (Saha et al., 2005). Die Hauptfragen der aktuellen Forschung sind Themen wie: • Welche spezifischen Kausalfaktoren, wie z. B. Stress, soziale Faktoren, Substanzabusus, ernährungs- und geburtsbezogene Faktoren oder Infektionen, erklären die Häufigkeitsunterschiede? • Sind Häufigkeitsunterschiede ein Epiphänomen der Veränderung diagnostischer Kategorien? • Welche genetischen oder Umweltfaktoren erklären die Unterschiede? Aktuell sind (Punktprävalenz) 2 bis 10 pro 1.000 Einwohner erkrankt (Saha et al., 2005). Der Symptombeginn liegt meist in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter (Baldwin et al., 2005; Jablensky et al., 1992), bei Männern früher (Angermeyer, Hofmann & Robra, 1982; Seeman, 1986). Hinsichtlich der Gefährlichkeit ist zu sagen, dass keine erhöhte Auftrittshäufigkeit für Gewalttaten besteht, außer in den akuten Phasen der Erkrankung und unter Einfluss von Alkohol. Der Verlauf ist zumeist durch Rückfälle und Funktionseinschränkungen gekennzeichnet (Bleuler, 1983; Ciompi, 1980; Harrison et al., 2001). Die Langzeitverläufe schizophrener Erkrankungen sind sehr unterschiedlich. So hat die International Study of Schizophrenia (SoS) der WHO (Moscarelli, 1994) über einen Zeitraum von 14 bis 25 Jahren in vierzehn Ländern (Harrison et al., 2001) zeigen können, dass 50 % der Patienten einen eher günstigen Verlauf aufweisen. Das heißt 50 % haben ein Rollenfunktionsniveau über einem Cut off-Wert des Global Assessment of Functioning (GAF) von 60 und einen Wert auf dem Disablement Assessment Schedule (DAS) der WHO von 0 bis 2, d. h. eine sehr gute bis annehmbare Rollenfunktionsfähigkeit bei keiner bis minimaler Symptomatologie. Ferner wurde in dieser Studie gezeigt, dass 16 % der Betroffenen, die im frühen Erkrankungsverlauf nur teilweise remittieren, auch nach Jahren noch einen günstigen Verlauf nehmen können. Eine Vollremission zeigen jedoch lediglich 15 bis 25 % der Betroffenen im Langzeitverlauf. Nur 20 % der Patienten haben eine singuläre psychotische Episode. Wenn man jedoch feinere Kriterien einer passageren Die Störung: Merkmale und Verlauf schizophrener Erkrankungen psychotischen Labilisierung heranzieht, haben bis zu 90 % der Betroffenen innerhalb des ersten Jahres nach einer Ersterkrankung einen „Minor Relapse“ (Combs et al., 2007). Unglücklicherweise kann man gegenwärtig Patienten, die lediglich einmal erkranken oder nur einen „Minor Relapse“ im Intervall aufweisen, nicht zuvor identifizieren. 80 % der Betroffenen haben mehr als eine psychotische Episode (Ohmori, Ito, Abekawa & Koyama, 1999; Robinson, Woerner & Alvir, 1999; Wiersma, Nienhuis, Slooff & Giel, 1998). Hinsichtlich der Lebensuntüchtigkeit muss man korrigierend feststellen, dass nur etwa 10 % aller an Schizophrenie Erkrankten es nicht schaffen, dauerhaft außerhalb von Kliniken leben zu können. Ein ungünstiger Langzeitverlauf ist häufiger bei Männern, bei frühem Krankheitsbeginn, einer längeren Dauer der unbehandelten Psychose, starker Negativsymptomatik sowie bei vermehrten kognitiven Funktionsstörungen (Green, 1996; Haefner & an der Heiden, 1999; Loebel et al., 1992). Aufgrund der hohen Inzidenz sind die volkswirtschaftlichen Kosten der Erkrankung enorm (Knapp, King, Pugner & Lapuerta, 2004; Moscarelli, 1994; Wiersma, Kluiter, Nienhuis, Ruphan & Giel, 1995). Dies liegt vor allem am frühen Erkrankungsausbruch, an der hohen Rezidiv- und Chronifizierungsneigung sowie an den hohen Kosten durch Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitations- und Frühberentungsmaßnahmen. So stellen schizophrene Erkrankungen eine der teuersten seelischen Störungen überhaupt dar (Falloon, Coverdale & Brooker, 1996; Kissling, 1991; Penn, Van der Does, Spaulding & Garbin, 1993). Einer der wohl wichtigsten Befunde der Forschungen der letzten fünf Jahre liegt in der Erkenntnis, dass Menschen mit schizophrenen Störungen häufig bereits fünf bis sieben Jahre vor der Ersthospitalisation zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und Rollenfunktionsstörungen entwickeln (Haefner et al., 1998). Die initialen Beschwerden im Frühverlauf der Erkrankung sind eher unspezifisch und werden vom Hausarzt, vom Schulpsychologen, von Lehrern, an psychologischen sowie studentischen- und Erziehungsberatungsstellen häufig als Adoleszenzkrise verkannt. Typische Faktoren für dieses Risikoprofil sind eine Tendenz zu sozialem Rückzug (soziale Anhedonie) sowie kognitive Funktionseinschränkungen im Bereich der Aufmerksamkeit, der verbalen Merkfähigkeit und des abstrahierenden 9 Denkens. Dies führt zu einer Leistungsbeeinträchtigung in der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie im Studium. Weiter ist ein Mangel an Antrieb und Initiative charakteristisch, der vom sozialen Umfeld oft als Bruch der Primärpersönlichkeit erlebt wird. Dies ist weder durch depressive Syndrome noch durch Drogenkonsum im Hintergrund alternativ erklärbar. Die Betroffenen selbst erleben häufig im Vorfeld der Ersterkrankung einen Verlust der Steuerbarkeit des eigenen Gedankengangs und in späteren Stadien dieser Vorläuferperiode (Klosterkotter, Hellmich, Steinmeyer & Schultze-Lutter, 2001) zeigen sich auch kleinere (meist nur stunden- oder tageweise auftretende) psychotische Episoden mit halluzinatorischer oder wahnhafter Symptomatik (sog. BLIPS = Brief Limited Psychotic Episodes). Ein frühes Erkennen und damit eine frühe optimale Behandlung tragen ganz wesentlich zu einer Verbesserung des gesamten Erkrankungsverlaufes bei. Es konnte gezeigt werden, dass die Dauer der unbehandelten Psychose (DUP) prognostisch wesentlich ist (Addington, Van Mastrigt, Hutchinson & Addington, 2003; Larsen et al., 2001; McGlashan, 1999). Die DUP ermöglicht verschiedene Voraussagen, u. a. wie schnell Patienten unter einer zielgerichteten Pharmakotherapie eine Symptomremission erreichen, wie vollständig diese Remission sein wird, wie ausgeprägt die Rollenfunktionsbehinderung im weiteren Verlauf der Erkrankung und sogar wie stark das Ansprechen auf psychosoziale Interventionen ausfallen wird. Entscheidend im Verlauf der Erkrankung sind die ersten drei bis fünf Jahre, da sich in diesem Zeitraum die Symptomatik und die Behinderungen am stärksten entwickeln und danach meist ein Plateau erreichen. Man spricht auch von der sogenannten „Critical Period“ (Birchwood & Spencer, 2001). In dieser kritischen Verlaufsphase versucht man durch eine frühe optimierte Behandlung ein möglichst hohes Funktionsniveau zu erhalten. Die diagnostischen Leitlinien nach ICD-10 für schizophrene Störungen sind im Kasten auf Seite 10 zusammengefasst. Das ICD-10 unterscheidet dabei diagnostische Symptome nach der Sicherheit mit der diese Auffälligkeiten mit dem Vorliegen einer schizophrenen Erkrankung verbunden sind (bei hoher Sicherheit ist nur ein Merkmal erforderlich, bei geringer Sicherheit zwei Merkmale). Die dia- 10 Kapitel 1 Diagnostische Leitlinien nach ICD-10 für Schizophrenie (F20.0-F20.3) Zeitkriterium: Während der meisten Zeit innerhalb eines Zeitraumes von mindestens einem Monat sollte eine psychotische Episode bestehen. Diese ist gekennzeichnet entweder durch Mindestens eines der folgenden Merkmale: a) Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, Gedankenentzug oder Gedankenausbreitung. b) Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, deutlich bezogen auf Körper- oder Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder Empfindungen; Wahnwahrnehmung. c) Kommentierende oder dialogische Stimmen, die über die Patienten reden oder andere Stimmen, die aus bestimmten Körperstellen kommen. d) Anhaltender, kulturell unangemessener, bizarrer Wahn, wie der, das Wetter kontrollieren zu können oder mit Außerirdischen in Verbindung zu stehen. ei der folgenden Merkmale: Oder mindestens zwei der folgenden Merkmale (Zusatzkriterien): a) Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität, täglich während mindestens eines Monats, begleitet von flüchtigen oder undeutlich ausgebildeten Wahngedanken ohne deutliche affektive Beteiligung oder begleitet von lang anhaltenden überwertigen Ideen. b) Neologismen, Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss, was zu Zerfahrenheit oder Danebenreden führt. c) Katatone Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien oder wächserne Biegsamkeit (Flexibilitas cerea), Negativismus, Mutismus und Stupor. d) „Negative“ Symptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate Affekte (es muss sichergestellt sein, dass diese Symptome nicht durch eine Depression oder eine neuroleptische Medikation verursacht werden). gnostische Terminologie wird im Folgenden nicht im Einzelnen ausgeführt, da es hier sehr gute Beschreibungen gibt (z. B. das AMDP-System, 2007). Mehr Wert wird hier auf häufige Fehlurteile in der diagnostischen Urteilsbildung gelegt. Insbesondere der Hausarzt oder der Kliniker in einer Rehabilitationsklinik oder in einer psychosomatischen Einrichtung, der in seiner professionellen Ausbildung keine oder wenig praktische Erfahrung im psychiatrischen Kernbereich gesammelt hat, wird die Negativsymptomatik oder kognitive Störungen nicht hinreichend als therapeutische Zielsymptomatik erkennen oder umgekehrt vorschnell aus wahnhafter oder halluzinatorischer Symptomatik auf das Vorliegen einer schizophrenen Störung schließen. Verkannt und damit unzureichend behandelt werden dabei v. a. depressive, bipolare und schizoaffektive Störungen. Im Folgenden sollen kurz wichtige differenzierende Merkmale nebeneinander gestellt werden. Bei wahnhaften Syndromen verweist beispielsweise eine Attribution des Verfolgtwerdens durch einen äußeren „Feind“ eher auf eine schizophrene Störung, eine Attribution auf „Verfolgung“ aufgrund eines vermeintlichen (moralischen) „Vergehens“ eher auf eine depressive Störung. Neben dem Thema Schuld und Versündigung ist Verarmung ein wichtiges Thema wahnhafter Depressionen. Während der Depressive sich selbst gewissermaßen als „Täter“ sieht, nimmt der schizophren Erkrankte sich selbst eher als „Opfer“ einer Verschwörung oder Intrige, die ihm nach Leib, Leben, Gesundheit oder anderem trachtet, wahr. Bei manischen Syndromen (Antriebssteigerung, Distanzlosigkeit, vermehrten Geldausgaben, reduziertem Schlaf bei erhaltener oder gar gesteigerter Tagesfrische und Leistungsfähigkeit) sind expansive Wahninhalte häufiger, bei denen der Betroffene sich als Auserwählter, im Rahmen einer menschheitsrettenden oder religiös inspirierten Mission fühlt. Ähnlich verhält es sich bei einer halluzinatorischer Symptomatik: Während der Depressive meist kritisierende, abwertende oder beschimpfende Stimmen hört, sind für Schizophrene (Alltagshandlungen) kommentierende, imperative („Tue dies“, „Lass das“) oder auch Die Störung: Merkmale und Verlauf schizophrener Erkrankungen dialogisierende Stimmen typisch, die sich beispielsweise über den Betroffenen unterhalten. Dazu werden formale Denkstörungen und die Negativsymptomatik (Antriebsmangel, kognitive Funktionsstörungen) bei schizophrenen Störungen oft unzureichend als wichtige, pathognomonische Krankheitszeichen (Erstrangsymptome) gesehen (Vauth, 2003). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Kliniker sich in der diagnostischen Urteilsbildung stärker von formalen 11 Denkstörungen, Ich-Störungen (Gedankenausbreitung, Gedankenentzug usw.), von der Anund Abwesenheit gleichzeitiger manischer oder depressiver Symptome, den Attributionen der wahnhaften Ängste (wie erklärt sich der Patient z. B., dass er verfolgt wird?) und den Stimmeninhalten (siehe oben) leiten lassen sollte. Dies ist wichtiger als die Frage, ob überhaupt eine halluzinatorische oder wahnhafte Symptomatik vorliegt. Kapitel 2 Die Rolle der Angehörigen im Krankheitsverlauf 2.1 Helfer – Opfer – Täter Der Angehörige ist in vielfältiger Hinsicht Helfer: 50 bis 90 % der schwer seelisch kranken Menschen leben unmittelbar nach der Akutbehandlung bei ihren Angehörigen (Lauber et al., 2003). Die Bedeutung der Unterstützung durch Angehörige ist vielfältig belegt. So ist regelmäßiger und positiver Kontakt zur Familie mit einem besseren sozialen Funktionieren (Brekke & Mathiesen, 1995) und Drogenabstinenz (Clark, 2001) verbunden. Angehörige haben auch eine prominente Rolle in der Unterstützung der Aufnahmebereitschaft für jedwede Form von pharmakologischer oder psychologischer Therapie für den Patienten (Vauth, Loschmann, Rusch & Corrigan, 2004). Darüber hinaus übernehmen Angehörige im Alltag natürlich vielfältige Stützfunktionen, z. B. im Bereich der Finanzen, der Entlastung im Alltag durch Übernahme von Aufgaben wie Haushaltsführung, Kindererziehung und Vernetzung mit dem sozialen Umfeld oder auch koordinierende Funktionen in der Behandlung (Wilms, Bull, Wittmund & Angermeyer, 2005). Die Rolle der Angehörigen als „Opfer“ schizophrener Erkrankungen ist erkennbar an den vielfältigen ungünstigen Gesundheitsfolgen (Hirst, 2005): So weisen Angehörige von Menschen mit schwerwiegenden seelischen Erkrankungen ein höheres Ausmaß an Stress auf, leiden häufiger an Depressionen, zeigen eine geringere Lebensqualität und eine schlechtere körperliche Gesundheit sowie ein geringeres Ausmaß an Zutrauen in die grundsätzliche Fähigkeit mit eigenen Schwierigkeiten und Problemen im Leben besser fertig zu werden (Selbstwirksamkeit). Das Gefühl subjektiver Belastetheit der Angehörigen („Burden“) nimmt in dem Maße deutlich zu, wie die Beziehung zum erkrankten Familienmitglied eine tief greifende Veränderung erfährt (Lauber et al., 2003). So verändern sich durch die Erkrankung Nähe und Distanz der Beteiligten. Das heißt, die Fähigkeit zur emotionalen Nähe und das wechselseitige Aufeinandereingehen in einer balancierten sozialen Beziehung können verloren gehen. Nun schon erwachsenen erkrankten Kindern begegnen die Eltern wieder stärker mit einer Haltung aus der Kindheit und Jugendzeit („Ich muss mich kümmern!“, „Ich bin für mein Kind verantwortlich“ usw.). Auch das Bild des erkrankten Angehörigen von sich selbst erfährt oft eine tief greifende Veränderung: Die eigene Persönlichkeit, Werte oder Ziele werden als verändert wahrgenommen bzw. bewertet, was vielfach mit den tatsächlich veränderten Rollen des Erkrankten nach Ausbruch bzw. im Verlauf der Erkrankung zusammenhängt (Rollenwechsel etwa von Vollzeitberufstätigkeit zum Invalidenstatus ohne Tagesstruktur). Die Belastung nimmt, mit unerwarteten finanziellen und moralischen Verantwortlichkeiten, in die sich die Angehörigen von außen gedrängt fühlen, zu (Schene, Tessler & Gamache, 1994). So erfahren Angehörige oft direkt oder indirekt, Schuldzuweisung aus dem sozialen Umfeld, indem sie für die Erkrankung als Ganzes oder bestimmte Symptome (wie ungepflegtes Äußeres, Scheitern auf dem beruflichen Weg usw.) verantwortlich gemacht werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den objektiven Belastungen, die sehr konkret und auch beobachtbar sind, wie etwa den Finanzen, und den subjektiven Belastungen der Angehörigen (Hoenig & Hamilton, 1966; Schulze & Rössler, 2005). Mit Letzteren sind die wahrgenommenen psychologischen Belastungen und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit gemeint. In Abbildung 1 sind belastende und entlastende Faktoren für das Angehörigensystem aufgeführt, die in der jüngeren Forschungsliteratur gefunden werden konnten (Bibou-Nakou, Dikaiou & Bairactaris, 1997; Birchwood & Cochrane, 1990; Carpentier, Lesage, Goulet, Lalonde & Renaud, 1992; Levene, Lancee & Seeman, 1996; MacInnes, 1998; Magliano et al., 1998; Provencher & Mueser, 1997; Raj, Kulhara & Avasthi, 1991; Scazufca & Kuipers, 1998; Smith, Birchwood, Cochrane & George, 1993; Solomon & Draine, 1995; Veltro, Magliano, Lobrace, Morosini & Maj, 1994; Winefield & Harvey, 1994). Schaut man sich die Ergebnisse an, so fallen einige dem Alltagsverstand scheinbar widersprechende Befunde auf. So könnte man etwa erwarten, dass mit zunehmender Die Rolle der Angehörigen im Krankheitsverlauf Kontaktfrequenz und Dauer Zufriedenheit mit Versorgungssystem und professioneller Unterstützung 13 Negativsymptomatik Rollenfunktionsfähigkeit Belastung Bewältigungsstrategien und Selbstwirksamkeit Dauer der Erkrankung Soziale Unterstützung = senkt Belastung = erhöht Belastung Abbildung 1: Was hat Einfluss auf die Belastung der Angehörigen? Dauer der Erkrankung und bei höherer Kontaktfrequenz und -dichte die Belastetheit der Angehörigen durch Habituation (Gewöhnung) abnimmt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ebenfalls erwartungsdiskrepant ist, dass nicht etwa die Positivsymptomatik (etwa Exazerbation von Stimmen oder wahnhafte Überzeugungen in der Akutphase) die Hauptbelastung für den Angehörigen ausmacht, sondern die Negativsymptomatik eine wesentlich stärkere Belastung für Angehörige darstellt. Auch ist das Funktionsniveau, auf dem das erkrankte Familienmitglied sich halten kann (Zutritt zu Rollen wie Partnerschaft, Arbeit, Freizeitinteressen) für die Belastung relevant. Ist die Funktionsfähigkeit gering, steigt die Belastung. Als schützend und damit für angehörigensystembezogene Interventionen bedeutend hat sich die Bereitstellung von sozialem Beistand, die Zufriedenheit mit dem Versorgungssystem und professioneller Unterstützung sowie die Verfügbarkeit von aktiven, problemzentrierten Bewältigungsstrategien und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung (allgemeines Zutrauen in die eigene Fähigkeit, mit schwierigen Situationen fertig zu werden) erwiesen. So konnten Gavois, Paulsson und Fridlund (2006) ermitteln, dass gerade in akuten Krisen die Präsenz von Therapeuten und deren aktives Zuhören bezüglich der Probleme im Alltag von den Angehörigen am meisten ge- schätzt wird, während in der Stabilisierungs- oder Recovery-Phase Ermutigungsprozesse („Empowering“) und praktische Hilfemöglichkeiten im Alltag (Kontrolle der Medikamentenabgabe, Organisation von Putzdienst usw.), die zur Verfügung gestellt werden, besonders positiv bewertet werden. Das Konzept vom Angehörigen als „Täter“ bezieht sich auf die Ergebnisse der so genannten „High Expressed Emotion“-Forschung (HEE) der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Die soeben dargestellte große Belastung der Angehörigen führt häufig zu ungünstigen Kommunikationsstilen wie Abwertung, negativer Kritik und selbstaufopfernd einmischendem Verhalten in die Belange des erkrankten Angehörigen. Verschiedene empirische Arbeiten zeigen, dass bei einer geringen Ausprägung dieser ungünstigen familiären Interaktionsund Beziehungsstile (im Falle einer Kontaktdichte von über 15 Stunden pro Woche) die Rückfallrate deutlich – zum Teil bis zur Hälfte – geringer ist, selbst bei medizierten Patienten (Glynn et al., 2007). Umgekehrt besteht bei einer emotional eher kalten und distanzierten, mangelhaft unterstützenden Haltung der Herkunftsfamilie gegenüber dem Erkrankten eine Erhöhung der Rückfallwahrschein- 14 Kapitel 2 Überlastung Angehöriger – kritische Kommentare – Feindseligkeit – Einmischen (Wieder-)Auftritt der Erkrankung Vermehrte familiäre Konflikte Stress Hilflosigkeit, Ärger, Angst Abbildung 2: Folgen der Belastung von Angehörigen (Levene et al., 1996; Scazufca & Kuipers, 1998) lichkeit (Levene, Lancee & Seeman, 1996; Scazufca & Kuipers, 1998, vgl. Abb. 2). In den HEE sieht man heute mehrheitlich ein Phänomen der Überlastung von Angehörigen. Dies kann partiell auch dadurch als belegt angesehen werden, dass Angehörige mit höheren HEE-Graden eher passive Bewältigungsmechanismen anstatt aktiver einsetzen und ein eher geringeres Maß an Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen. Die Folge von HEE sind vermehrte familiäre Konflikte, die ihrerseits wiederum mit Gefühlen von Hilflosigkeit, Ärger und Angstgefühlen beim erkrankten Angehörigen einhergehen. Dies wiederum führt dazu, dass vermehrt Stress vorhanden ist und damit die Auftrittswahrscheinlichkeit für eine erneute Krankheitsepisode steigt. Als Folge des erneuten Rückfalls oder eines drohenden Rückfalls kommt es zu einer weiteren Zunahme der Überlastung der Angehörigen im Sinne eines Circulus vitiosus. Die dargestellten Zusammenhänge sind besonders bedeutsam für Menschen mit einer ersten psychotischen Episode (vgl. Askey, Gamble & Gray, 2007). 60 bis 70 % der ersterkrankten Patienten leben im Haushalt von Angehörigen ers- ten Grades, was z. T. daran liegt, dass das Erstmanifestationsalter seinen epidemiologischen Gipfel zwischen dem 14. und 35. Lebensjahr hat und die „Entwicklungsaufgabe“ der „Ablösung vom Elternhaus“ (Havick-Hurst, 1953) noch nicht abgeschlossen ist. In dieser frühen Erkrankungsphase sind allerdings häufig der weitere Erkrankungsverlauf und die nosologische Einordnung (z. B. als schizophrene Störung versus schizoaffektive Störung versus bipolare Erkrankung) noch unklar. Die diagnostische Unklarheit geht daher auch mit einer relativ späten adäquaten psychopharmakologischen wie psychotherapeutischen Versorgung einher und führt so in der Folge zur Verschlechterung einer Reihe von Prognose- und Verlaufsaspekten. Die psychosoziale Adaptation (soziale und berufliche Integration) ist dadurch ungünstiger, es kommt zu langsameren und unvollständigeren Remissionen der Symptome, es besteht eine erhöhte Vulnerabilität für Rückfälle und ein erhöhtes Risiko für die Patienten, Depressionen und Ängste zu entwickeln. Zusätzlich kommt es krankheitsbedingt zu Störungen der sozialen und persönlichen Entwicklung des Erkrankten und einer fortschreitenden Entfremdung in den Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freunden.