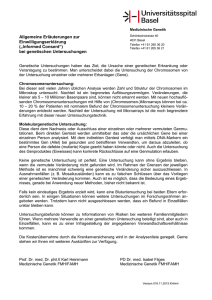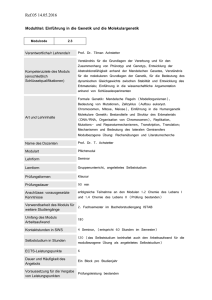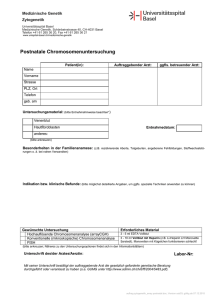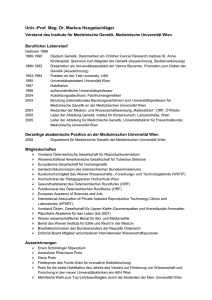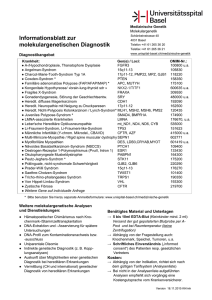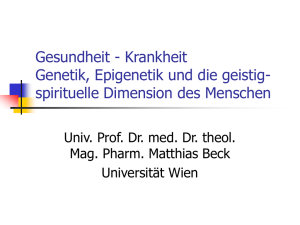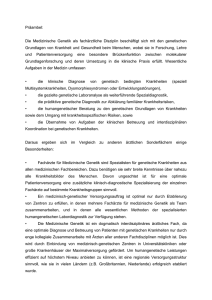13 Genetik 1 1
Werbung
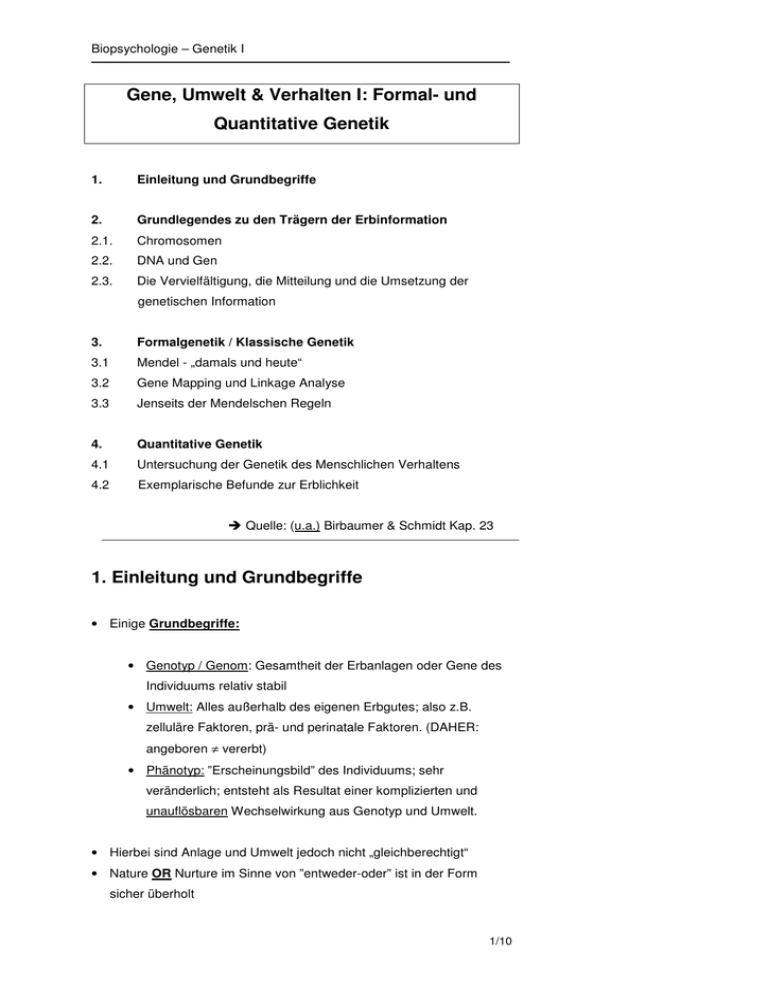
Biopsychologie – Genetik I
Gene, Umwelt & Verhalten I: Formal- und
Quantitative Genetik
1.
Einleitung und Grundbegriffe
2.
Grundlegendes zu den Trägern der Erbinformation
2.1.
Chromosomen
2.2.
DNA und Gen
2.3.
Die Vervielfältigung, die Mitteilung und die Umsetzung der
genetischen Information
3.
Formalgenetik / Klassische Genetik
3.1
Mendel - „damals und heute“
3.2
Gene Mapping und Linkage Analyse
3.3
Jenseits der Mendelschen Regeln
4.
Quantitative Genetik
4.1
Untersuchung der Genetik des Menschlichen Verhaltens
4.2
Exemplarische Befunde zur Erblichkeit
Quelle: (u.a.) Birbaumer & Schmidt Kap. 23
1. Einleitung und Grundbegriffe
• Einige Grundbegriffe:
• Genotyp / Genom: Gesamtheit der Erbanlagen oder Gene des
Individuums relativ stabil
• Umwelt: Alles außerhalb des eigenen Erbgutes; also z.B.
zelluläre Faktoren, prä- und perinatale Faktoren. (DAHER:
angeboren ≠ vererbt)
• Phänotyp: ”Erscheinungsbild” des Individuums; sehr
veränderlich; entsteht als Resultat einer komplizierten und
unauflösbaren Wechselwirkung aus Genotyp und Umwelt.
• Hierbei sind Anlage und Umwelt jedoch nicht „gleichberechtigt“
• Nature OR Nurture im Sinne von ”entweder-oder” ist in der Form
sicher überholt
1/10
Biopsychologie – Genetik I
2. Grundlegendes zu den Trägern der
Erbinformation
2.1. Chromosomen
• Gene (Definition siehe unten) befinden sich auf Chromosomen
(„gefärbter Körper“ im Zellkern aller Körperzellen. Sie haben dort
einen festen Platz (Genlocus).
Abb. B&S 23.6
• Menschen weiblichen Geschlechts haben 23 äußerlich verschiedene
Chromosomen, von denen jedes zweimal vorkommt (46
Chromosomen; diploider Chromosomensatz in jeder Körperzelle).
Eines dieser homologen Chromosomen stammt von mütterlicher,
eines von väterlicher Seite.
• Gene des gleichen Genlocus homologer Chromosomen heißen Allele
• Menschen männlichen Geschlechts:
Eines der Chromosomenpaare ist nicht gleich (XY); Frauen (XX).
Diese Geschlechtschromosomen (Gonosomen) bestimmen u.a. das
Geschlecht des Trägers.
Alle anderen Chromosomen heißen Autosomen
• Nur ein einfacher, haploider Chromosomensatz kommt in Keimzellen
(Gameten Ovum, Spermium) vor
2.2. DNA und Gen
• Chromosomen bestehen zum einen aus versch. Proteinen und zum
anderen aus einer sehr langen Sequenz von Desoxyribonukleinsäure
(DNS; oder englisch: DesoxyriboNucleinAcid)
Abb. B&S 23.4
• DNA besteht aus Zuckermolekülen (Desoxyribose), Phosphatgruppen
und stickstoffhaltigen Basen.
• DNA-Moleküle liegen in Doppelsträngen vor, die Basen jedes
Nukleotids sind über Wasserstoffbrücken nach einer festen Regel
miteinander verbunden
• Ferner ist die DNA verdrillt: Doppelhelix (pro Wendelgang 10
Basenpaare)
• Das Strukturmodell der DNA stammt von Watson und Crick (1953)
2/10
Biopsychologie – Genetik I
• Gene sind Abschnitte der DNA
• Definition ”Gen”:
”Ein Gen ist ein Abschnitt der DNA-Doppelhelix, der ein
spezifisches Polypeptid oder ein spezifisches RNAProdukt codiert”.
2.3.
Die Vervielfältigung, die Mitteilung und die
Umsetzung der genetischen Information
• Grundsätzlichen Funktionen, damit ”Vererbung” im allgemeinen Sinne
überhaupt möglich ist o
Speicherung der genetischen Information (siehe oben)
o
Existenz von Mechanismen zur Vervielfältigung und
Weitergabe der Information
o
von Zelle zu Zelle
semikonservative Replikation im Rahmen
der (Inter)mitose
o
zur nächsten Generation
Entstehung von Keimzellen (Ovum,
Spermium) durch Meiose
o
Existenz von Mechanismen zur Informationsumsetzung in ein
Genprodukt
Proteinsynthese mit Transkription und
Translation
3. Formalgenetik / Klassische Genetik
3.1 Mendel – „damals und heute“
• Im Folgenden: Gesetzmäßigkeiten der Weitergabe und phänotypische
Auswirkung der genetischen Information
• Geht auf Gregor Mendel (1822-1884) zurück
• Eine wesentliche Erkenntnis Mendels: Eine Eigenschaft (z.B.
Blütenfarbe) hängt von einem ”Faktor” ab, der mehr als einer Form
vorkommen kann. Jeder Faktor (also jedes Gen) kommt paarweise
vor, wobei ein Faktor des Paares von der Mutter und der andere vom
Vater stammt.
3/10
Biopsychologie – Genetik I
• Die verschiedenen Ausprägungsformen eines Gens werden als Allele
bezeichnet (s.o.). Die Allelie ist ein allgemeines Prinzip der
Vererbung.
• Ein Individuum ist hinsichtlich eines Genlocus homozygot, wenn die
Allele dieses Ortes gleich sind, und heterozygot, wenn die Allele
unterschiedlich sind.
• Mendel formulierte seine wichtigsten Beobachtungen in Form dreier
Regeln.
Abb. B&S 23.1 & Abb. Uniformitätsgesetz
{zur Einführung der 2. Mendelschen Regel }
• Morbus Huntington (”Veitstanz”)
• Patienten haben immer einen erkrankten Elternteil; ca. 50% der
Kinder eines Patienten bekommen auch M. Huntington
• Phenylketonurie:
• Wurde zunächst nicht als Erbkrankheit erkannt; ist ein Kind an
PKU erkrankt haben andere Kinder eine 25% Wahrscheinlichkeit,
auch wenn Eltern gesund sind. Weitere Beobachtung: Häufung
wenn Eltern „blutsverwandt“ sind
• Mendel erkannte: Diese „Faktoren“ (Allele) müssen sich bei der
Vermehrung irgendwie teilen
• einer der Faktoren kann über den anderen dominieren, so
dass im Phänotyp nur der eine sichtbar wird
• das rezessive Merkmal kann nur sichtbar werden, wenn es in
homozygoter Form auftritt
Abb. B&S 23.1 & Abb. Segregationsgesetz
• Huntington Autosomal-dominant; PKU Autosomal-rezessiv
• Bedingt Heterozygotie ein phänotypisches Bild, das zwischen den
Auswirkungen steht, die beide Allele in homozygotem Zustand
verursachen, so spricht man von intermediärem Verhalten dieser
Allele. Rote und weisse Blüten rosa Blüten
• Es werden im wesentlichen dominant-rezessive und intermediäre
Erbgänge unterschieden.
• Wird ein Merkmal durch nur ein Gen bestimmt, spricht man von
Monogenie. (z.B. AB0-Blutgruppensystem)
4/10
Biopsychologie – Genetik I
• Die meisten menschlichen Merkmale werden jedoch durch das
Zusammenwirken vieler Gene vererbt (Polygenie).
• Inzestuöse Verbindungen ca. 50% der Kinder aus Verbindungen
zwischen Vätern & Töchtern haben schwere genetische Abnormitäten
Mendels 3. Regel:
Abbildung B&S 23.3
• Mendels Glück: Auswahl der Merkmale
• Aus heutiger Sicht besonders interessant Die Ausnahmen
• Was Mendel nicht wusste: Gene sind auf Chromosomen in
organisierter Form lokalisiert.
• z.B. Gen für Huntington auf Chromosom 4; PKU-Gen auf Chromosom
12
• Mendels Regel wird verletzt, wenn Gene für zwei Merkmale auf einem
Chromosom sehr nahe beieinander liegen. Diese Gene werden
dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gemeinsam vererbt.
3.2
Gene Mapping und Linkage Analyse
•
Austausch von Chromosomenteilen während der Meiose Crossing Over Abrechen von Teilen von Chromosomen und
anwachsen an anderen
•
Je näher zwei Gene beieinander liegen, desto geringer die
Wahrscheinlichkeit, dass sie NICHT gemeinsam weitergegeben
werden
•
Über diesen linearen Zusammenhang kann die Position zweier
Gene zueinander berechnet werden Gen-Kartierung
•
Genauer: Die Anzahl der Rekombinationen pro 100 Keimzellen
wird als Distanzeinheit genutzt und als Zentimorgan bezeichnet
•
Begriff Linkage-Analyse Techniken, die sich Verletzung der
Unabhängigkeitsregel zu Nutze machen. Enormer
Wissenszuwachs mit Zunahme bekannter DNA-Marker (mehrere
1000)
dient zur Lokalisierung verhaltensrelevanter Gene
3.3
Jenseits der Mendelschen Regeln
•
Reihe von „Ereignissen“, die nicht zu den Mendelschen Regeln
passen.
•
Die meisten davon gehören thematisch in den Bereich der
Molekulargenetik (siehe Genetik 2))
5/10
Biopsychologie – Genetik I
Mutationen, Chromosomenveränderungen, Erweiterte
Tripletwiederholungen, Genom-Imprinting
•
Aber ein Nicht-Mendelsches Vererbungsmuster soll schon hier
vorgestellt werden •
Bspl: Farbenblindheit (Rot-Grün-Schwäche)
Abbildung 3.1 aus Plomin et al.
o
Bei Männern häufiger als bei Frauen
o
Farbenblinde Mutter & Gesunder Vater Alle Söhne
farbenblind
o
Fabenblinder Vater & Gesunde Mutter Meist gesunde
F1-Generation aber 50% Erkrankte F2-Söhne der F1Töchter Generationensprung
o
Ursache für Farbenblindheit rezessives Gen auf XChromosom
o
•
X-Chromosomal rezessiver Erbgang
Auch X-Chromosomal-rezessiv: Buterkrankheit (Störung der
Blutgerinnung)
4.
Quantitative Genetik
•
Die meisten Merkmale unter polygenem Einfluss
•
Komplexe Merkmale sind jedoch meist kontinuierlich verteilt
•
Anfang des 20. Jhdrts schöner Streit zwischen Mendelianern
und Biometrikern
•
Die Lösung findet sich in ...
Abbildung 3.9 aus Plomin et al.
•
Abbildung illustriert die Grundannahme der Quantitativen
Genetik:
o
Die Auswirkungen mehrerer Gene führen additiv zu
quantitativ verteilten Merkmalen (Bsple: Intelligenz,
Körpergröße, Schizophrenie etc.)
o
•
Jedes Allel hat additiv einen Effekt auf den Phänotyp
Durchschnittliche genetische Ähnlichkeit von Verwandten
Abbildung 3.10 aus Plomin et al.
6/10
Biopsychologie – Genetik I
•
Die Methoden der quantitativen Genetik erlauben die quantitative
Abschätzung des genetischen Anteils an der Varianz der
Ausprägung eines Merkmals in der Population.
•
Hierzu ist es nicht erforderlich, dass die verantwortlichen
Erbanlagen bekannt sind.
4.1
Untersuchung der Genetik des Menschlichen
Verhaltens
•
•
Die wichtigsten Methoden der quantitativen Genetik sind:
o
Familienstudien
o
Adoptionsstudien
o
Zwillingsstudien
o
[Kombinationsdesigns]
Gehen alle zurück auf Sir Francis Galton (1822-1911)
Familienstudien
•
Werden hier ausgelassen
Adoptionsdesigns
Abbildung 5.9 aus Plomin et al.
•
2 Vergleichsmöglichkeiten
o
1. Vergleich genetisch ähnlicher Personen ohne
gemeinsame Familienumwelt
o
2. Vergleich genetisch nicht überdurchschnittlich
ähnlicher Personen, welche aber die Familienumwelt
teilen
•
Vergleich von Eltern & Kindern bzw von Geschwistern
PROBLEME:
•
Selektive Platzierung:
•
Zeitpunkt der Trennung und pränatale gemeinsame Umwelt
•
Information über biologische Eltern
Abbildung 5.10 aus Plomin et al.
o
Exemplarischer Befund zu allg. kognitiven Fähigkeiten
7/10
Biopsychologie – Genetik I
Zwillingsdesigns
•
Meist Vergleich von monozygoten und dizygoten
(gleichgeschlechtlichen) Zwillingspaaren
•
Entstehung:
o
MZ Im frühen Embryonalstadium, bis spätestens zum
ca. 10. Tag trennen sich die Blastomere / Blastozyste /
Zweiblättrige Keimscheibe aus bisher unbekannten
Gründen in zwei omnipotente Organismen
o
DZ Seltene Befruchtung zweier Eizellen durch zwei
Spermien im selben Zyklus.
o
Zwillinge kommen bei etwas mehr als 1% der Geburten
vor, schätzungsweise jedoch bei ca. 20% aller Föten.
Etwa zu je einem Drittel MZ, gleichgeschlechtliche DZ
und gegengeschlechtliche DZ, wobei die Häufigkeit von
MZ sehr konstant ist, die DZ Häufigkeit allerdings von
verschiedenen Faktoren abhängt
Abbildung 11.2 aus Buselmaier et al.
•
Die Bestimmung der Zygotie:
o
polysymptomatischen Merkmalsvergleich
o
DNA-Fingerprinting Vergleich hochpolymorpher
Genabschnitte
•
Grundgedanke von Zwillingsstudien:
o
Sind sich monozygote Paare bezüglich des
interessierenden Merkmals ähnlicher als dizygote geht
man davon aus, dass dieses Merkmal genetischen
Einflüssen unterliegt..
•
Einige Probleme & Vorannahmen:
„Equal environment Hypothese“
o
Ist eine MZ-Ähnlichkeit evtl. durch ähnlichere
Umwelteinflüsse bedingt?
o
Hypothese wurde in vielen Studien untersucht und
generell kann man von ihrer Angemessenheit ausgehen.
Repräsentativität von Zwillingen?
o
z.B. Geburtszeitpunkt, Geburtsgewicht, verzögerte
Sprachentwicklung, Risiko für perinatale zerebrale
Schädigungen
o
ABER !!! : Dennoch sind Zwillinge bezüglich der
meisten Persönlichkeitsmerkmale und psychologisch
8/10
Biopsychologie – Genetik I
relevanten Störungen nicht signifikant unterschiedlich
von Nicht-Zwillingen
Kombinationsdesigns
•
Verschiedene Möglichkeiten der Kombination von
Forschungsstrategien werden eingesetzt.
o
Zwillingsstudien + normale Geschwister
o
Zwillingsdesign + Adoptionsdesign
Bekannteste: “Minnesota Study of Twins Reared
Apart“
Das Konzept der Erblichkeit
•
Gilt nicht nur für Zwillingsstudien
•
Der statistische Kennwert, der zur Schätzung der genetischen
Effektgröße herangezogen wird, ist die Erblichkeit (= Heritabilität =
Heritability)
Abbildung „Formeln“
Selektive Partnerwahl
•
Erhöht die genetische Varianz in einer Population
•
Erhöht die Korrelation zwischen Verwandten 1. Grades dies
führt zu einer h²-Überschätzung bei Familien- bzw.
Adoptionsstudien und einer h²-Unterschätzung in Zwillingsstudien.
•
Relativ gering bei Körpergröße, Gewicht und
Persönlichkeitsmerkmalen (Korrelationen zw. .10 und .25); größer
bei „g“ (.60) und Bildungsniveau (.60).
Dominanz und Epistase
•
Dominanz und Epistase sind nicht additive genetische Effekte;
Dominanz bezieht sich auf eine nicht additive Interaktion von
Allelen an einem Locus (recht häufig). Epistase: Allel-Interaktion
über verschiedene Loci hinweg.
Gen-Umwelt-Korrelation
Tab 14.3 aus Plomin et al.
9/10
Biopsychologie – Genetik I
Gen-Umwelt-Interaktion
•
Genetisch bedingte Empfindsamkeit bzw. Empfänglichkeit für
bestimmte Umwelteinflüsse. Bspl. PKU und Phenylalanin in
Nahrung; Stress-Sensitivität
•
Wie wird nun die Erblichkeit konkret geschätzt?
o
Moderne Zwillingsstudien mit ausreichend großer
Stichprobe werden mittels Anpassung von
Strukturgleichungsmodellen ausgewertet
o
Einfache (alte) Schätzformel, die in etwa zu ähnlichen
Ergebnissen kommt: ....
Abb. Erblichkeitsschätzung
Wichtige Hinweise zur Interpretation von
Erblichkeitsschätzungen:
o
Beziehen sich immer auf genetischen Beitrag zu
interindividuellen Unterschieden; NIE auf einzelne
Personen.
o
Erblichkeitsschätzungen sind auch bei großen
Stichprobenumfängen immer nur grobe Schätzungen;
o
Sie beziehen sich immer auf eine gegebene Population
zu einem gegebenen Zeitpunkt.
o
Erblichkeitsschätzungen sagen entsprechend auch
nichts darüber aus was „sein könnte“ und schon gar
nichts darüber, was sein sollte.
o
Erblichkeit ≠ Determiniertheit
4.2. Exemplarische Befunde zur Erblichkeit
•
Zusammenfassungen auf den Abbildungen:
Tab „Körpermaße“
Tab B&S 23.4
10/10