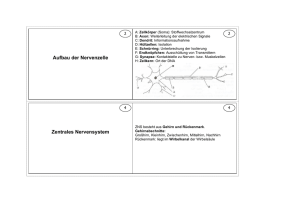Mikrobielle Genetik
Werbung

Mikrobielle Genetik
Johannes Woestemeyer
Mikrobielle Genetik
Table of Contents
Anknüpfung an Bekanntes und sonstige Trivialitäten....................................................................................1
Modellsysteme.........................................................................................................................................1
DNA als Träger der Erbinformationen − wieso?.....................................................................................2
DNA−Bausteine und wie sie zusammengehören.....................................................................................3
Die Struktur der DNA........................................................................................................................................6
Die Chargaff'schen Regeln......................................................................................................................6
Röntgenstrukturanalyse............................................................................................................................6
Modellbau................................................................................................................................................7
Formen der DNA: Was ist künstlich − was natürlich?............................................................................7
Gebogene DNA........................................................................................................................................9
i
Anknüpfung an Bekanntes und sonstige
Trivialitäten
Die Stunde, die wir brauchen, um einander zu verstehen.
Modellsysteme
Die Genetik dieses Jahrhunderts hat sich, soweit von Grundlagenforschung die Rede ist, zu einer
Wissenschaft von Modellorganismen entwickelt. Besonders häufig sind Arbeiten mit den folgenden
mikrobiellen Organismen:
Pilze: Saccharomyces cerevisiae als Hefe, Neurospora crassa und Aspergillus nidulans als Hyphenpilze
Bakterien: Escherichia coli für die gram−negativen und Bacillus subtilis für die gram−positiven.
Ein gutes Modell für entwicklungsgenetische Arbeiten an Pflanzen ist wegen der angenehm kleinen
Genomgröße, den fast mikrobiologischen Ausmaßen und der mit sechs Wochen erfreulich kurzen
Generationszeit der Kreuzblütler Arabidopsis thaliana. Ein exzellentes Modell für Säugetiere ist die Maus.
Mäuse sind klein, leicht und schnell vermehrbar und: Man kann zuverlässig transgene Mäuse herstellen. Sogar
die Konstruktion Locus−spezifischer Knock−out Mäuse ist möglich.
Wenn Sie den Modellgedanken fortführen, ergibt sich logisch stringent, daß Genetik im Ansatz eine
Organismus−unabhängige Wissenschaft ist. Es geht um grundlegende Fragen der Biologie wie identische
Duplikation von Elternorganismen zu Tochterorganismen, Rekombination von Merkmalen bei sexuellen
Vorgängen, Funktionsweise von Genen und Regulation der Genexpression, Steuerung von
Differenzierungsprogrammen. Das Problem steht im Mittelpunkt; der Organismus wird so gewählt, daß man
am besten zum Ziel kommt.
Die Gene von Escherichia coli und seiner Bakteriophagen sind heute die am besten verstandenen aller
Lebewesen. Aus diesem Modell heraus, das seit den 50er Jahren intensiv, nämlich molekularbiologisch
bearbeitet wird, hat sich dieser Zweig der Wissenschaft zu dem entwickelt, was er heute ist: zur Grundlage der
Biowissenschaften. Gleichgültig, ob Sie heute Systematik oder Physiologie betreiben, Sie kommen nicht am
molekularbiologischen und molekulargenetischen Denken vorbei, wenn Sie den Lebenserscheinungen
wirklich auf den Grund gehen wollen.
Escherichia coli steht unter den Prokaryonten am Anfang dieser Entwicklung. In vielen Fällen wird man
Erkenntnisse, die hier gewonnen wurden, auf andere Organismen übertragen können. Man spricht von dem
Modell Escherichia coli. Einer der frühen Genetiker hat die Formulierung geprägt: 'What's true for E. coli is
true for the elephant'. Betrachten Sie diese plakative Aussage als Plädoyer für den Wert von Modellen,
keinesfalls als Dogma. Selbstverständlich hat die Evolution auf den verschiedenen Organisationsstufen immer
wieder Neues hervorgebracht. Sie werden lernen, daß die Eukaryonten in mancher Hinsicht eigene Prinzipien
erfunden haben, die bei Bakterien nicht vorkommen. Auch die Archaea als dritte Domäne der lebendigen
Welt haben nochmals eigene genetische Besonderheiten erfunden. Dennoch sind die Grundprinzipien der
Vererbungsvorgänge und der Steuerung der Aktivität von Genen ziemlich ähnlich. Kein Wunder: Das was
heute lebt, ist mit hoher Sicherheit monophyletisch entstanden.
Mikroorganismen haben als Modellsysteme enorme Vorteile. Von einem eigentlichen Durchbruch in der
Genetik kann man eigentlich erst sprechen, seit mit Mikroorganismen, Bakterien, Bakteriophagen und Pilzen
gearbeitet wird. Ich will Ihnen ein Beispiel geben:
Der erste Organismus, in dem man mit Erfolg den Zusammenhang zwischen Genen − dem was sich vererbt −
und Enzymen − Genprodukten, die den Stoffwechsel der Zelle steuern − studiert hat, ist der Schimmelpilz
Anknüpfung an Bekanntes und sonstige Trivialitäten
1
Mikrobielle Genetik
Neurospora crassa, der rote Brotschimmel. Neurospora crassa wächst auf sehr einfachen, synthetischen
Medien mit Glucose als Kohlenstoff− und Ammonium als Stickstoffquelle. Der wesentliche experimentelle
Trick, um den Zusammenhang zwischen Genen und Enzymen zu beleuchten, bestand darin, Mutanten des
Pilzes herzustellen, die bestimmte Stoffwechselleistungen nicht mehr erbringen konnten. Mutationen kommen
ganz spontan in jedem Organismus in einer Vielzahl von Genen vor. Die Häufigkeit solcher Ereignisse ist
aber recht gering. Erheblich steigern läßt sich die Mutationsrate, wenn man die Zellen mit ultraviolettem Licht
bestrahlt. Unter den bestrahlten Pilzen konnten Derivate identifiziert werden, die zum Beispiel das Vitamin
Niacin nicht mehr produzieren konnten. Damit lag der Schluß nahe, daß in dieser Mutante ein Gen, das für die
Synthese des Niacins gebraucht wird, mutiert also zerstört wurde. Man nennt solche Mutanten
Stoffwechselmutanten, weil ein wesentliches, für den Stoffwechsel benötigtes Gen ausgefallen ist. Von
Neurospora crassa hat man sehr viele solcher Mutanten erzeugt. In vielen Fällen konnte man dann in
biochemischen Experimenten nachweisen, daß tatsächlich ein ganz bestimmtes Enzym in den Mutanten nicht
mehr in aktiver Form vorhanden war. Diese Experimente haben erstmals belegt, daß zu einem bestimmten
Gen, definiert durch eine Mutation, ein ganz bestimmtes Enzym gehört. Dieser Zusammenhang wurde dann
formuliert als die Ein−Gen−ein−Enzym Hypothese. Sie wissen vielleicht, daß Beadle, Tatum und Lederberg
für diese Arbeiten den Nobelpreis erhalten haben.
DNA als Träger der Erbinformationen − wieso?
DNA ist die Trägersubstanz der genetischen Information. Das klingt banal, trotzdem war es historisch gesehen
ein langer Weg bis zu dieser Erkenntnis. Wir wollen hier keine Geschichte der Genetik betreiben. Sie dürfen
aber ruhig wissen, daß man lange Zeit gedacht hat, eine chemisch so überaus einfache Substanz wie die
Desoxyribonukleinsäure, die insgesamt nur aus sechs sich immer wiederholenden chemischen Bausteinen
besteht (Phosphorsäure; der Zucker Desoxyribose; die vier Nucleobasen Adenin, Guanin, Cytososin,
Thymin), könne unmöglich die Baupläne für die gesamte Komplexität der Proteine, der Zelle und schließlich
des gesamten Organismus beinhalten. Man hat daher zunächst geglaubt, daß Proteine die Träger der
Erbinformation darstellen. Letztlich brauchte man konkrete experimentelle Belege dafür, daß allein die DNA
genetische, vererbbare Information enthält und überträgt. Den überzeugenden experimentellen Beweis
erbrachte Oswald Avery 1944 auf der Basis älterer Experimente von Frederick Griffith aus dem Jahre 1928.
Mit Griffith beginnt die Geschichte der chemischen Identität der Gene. Er machte Experimente mit
Streptococcus pneumoniae, den sogenannten Pneumococcen. Der Stamm, den er benutzte, war
außerordentlich virulent für Mäuse und rief dort zuverlässig Lungenentzündungen hervor. Für die
Pathogenität brauchen diese Bakterien eine extrazelluläre Schleimhülle aus Polysacchariden. Mit Hilfe dieser
Schleimkapsel entkommt das Bakterium den immunologischen Abwehrmechanismen seines Wirts; es wird
vom Immunsystem nicht erkannt. Diese Schleimhüllen kann man an Pneumococcen−Kolonien auf der
Petrischale sehr einfach erkennen, weil sie auch schon makroskopisch den Kolonien ein glattes, glänzendes
Aussehen verleihen. Genetiker nennen dieses Phänotyp 'smooth'. Griffith fand damals schon Mutanten, die
auf Petrischalen den S−Phänotyp verloren hatten. Diese Kolonien sehen verglichen mit dem Wildtyp rauh
('rough' oder R−Phänotyp) aus. Wir wissen heute, daß diese Bakterien die Fähigkeit zur Bildung der
Schleimhülle permanent verloren haben. Die Biosynthese der Pneumococcen−Schleimhülle ist aufgeklärt, die
beteiligten Enzyme kann man in vitro messen, so daß wir heute auch genau angeben können, welches der
Enzyme in Griffith's R−Mutanten defekt ist. R−Mutanten tragen einen Defekt im Gen für die
UDP−Glucose−Dehydrogenase. Das Enzym oxidiert aktivierte Glucose (durch Kopplung mit UDP) zur
Glucuronsäure. Somit kann der Schleim der Pneumococcen, der ein Copolymer aus alternierenden Glucose−
und Glucuronsäure−Resten darstellt, nicht mehr synthetisiert werden. Die Kolonien wirken folglich rauher.
Die R−Mutanten rufen keine Lungenentzündungen mehr hervor, da sie sich nicht mehr tarnen können und
somit der Immunantwort des Wirts zum Opfer fallen. Griffith machte nun ein geniales Experiment:
Er injizierte die nicht−pathogene R−Mutante zusammen mit Hitze−behandelten, also toten pathogenen
S−Zellen in Versuchsmäuse. Das Ergebnis waren tote Mäuse. Auf irgenseine, für Griffith damals
experimentell nicht faßbare Art und Weise waren harmlose R−Bakterien mit Hilfe irgendeiner Substanz aus
den toten S−Bakterien zu pathogenen Formen transformiert worden. Die Maus braucht man dazu eigentlich
DNA als Träger der Erbinformationen − wieso?
2
Mikrobielle Genetik
gar nicht. Es genügt, R−Zellen mit abgetöteten S−Zellen zu versetzen. Unter bestimmten
Wachstumsbedingungen bekommt man auch so zu einem kleinen Anteil S−Formen, die wieder eine
Schleimhülle bilden und die auch wieder pathogen sind. Soweit Griffith.
Avery ging einen Schritt weiter und nahm für diese Experimente nicht einfach Hitze−inaktivierte
S−Pneumococcen, sondern stellte Zellextrakte her, die er immer weiter aufreinigte. Alle Fraktionen:
Zellwand−Bestandteile, diverse Proteinfraktionen, Nukleinsäure−haltige Fraktionen, etc. wurden auf ihre
Fähigkeit untersucht, aus S−Formen R−Formen zu machen. Das Experiment gelang nur mit DNA−haltigen
Fraktionen. Weder Proteine noch RNA waren zur Transformation in der Lage. Nur Fraktionen, die DNA
enthielten und dann schließlich die chemisch reine DNA führten zum Erfolg und restaurierten permanent in
den Empfängerzellen den pathogenen S−Phänotyp.
Aus diesen genetischen Transformationsexperimenten folgt, daß die DNA der Träger der genetischen
Information ist, und zwar in beiden Funktionen, die wir angesprochen haben:
• als Träger der Vererbung: auch die Nachkommen transformierter Zellen behalten permanent den
S−Phänotyp
• als Grundlage der Steuerung des Stoffwechsels: die transformierten Zellen produzieren wieder intakte
Schleimhüllen.
Diese Griffith/Avery− Experimente sind auch aus heutiger Sicht erstaunlich modern. Wir würden sie im
Verwaltungs−Deutsch der Gentechniksicherheitsverordnung heute 'Gentechnik'−Experimente nennen. Sie
müssen sich vergegenwärtigen, daß zu dieser Zeit niemand etwas wirklich fundiertes, experimentell belegtes
über die Struktur der DNA wußte. Das einzige was man wußte war, daß DNA aus den sechs Komponenten
Phosphorsäure, dem Zucker Desoxyribose und den vier organischen Basen Adenin, Guanin, Thymin und
Cytosin besteht. Das wissen Sie auch, und noch etwas mehr, nämlich die Verknüpfung dieser Bausteine
miteinander. Sehen wir uns den Aufbau der DNA einfach nochmal an.
DNA−Bausteine und wie sie zusammengehören
Die Bausteine der Desoxyribonucleinsäure
DNA−Bausteine und wie sie zusammengehören
3
Mikrobielle Genetik
Wie die Bausteine zusammenpassen
Etwas Nomenklatur
DNA−Bausteine und wie sie zusammengehören
4
Mikrobielle Genetik
DNA−Bausteine und wie sie zusammengehören
5
Die Struktur der DNA
Die Chargaff'schen Regeln
Ein wirklich großer Fortschritt im Verständnis des Aufbaus der DNA wurde erzielt, als es möglich wurde, die
Basenzusammensetzung in der DNA vieler verschiedener Organismen quantitativ zu erfassen. Der mit diesen
bahnbrechenden Arbeiten der frühen 50er Jahre verknüpfte Name ist sicherlich Erwin Chargaff. Ohne seine
saubere quantitative Analytik der Basenzusammensetzung in sehr vielen verschiedenen DNAs ganz
unterschiedlicher organismischer Herkunft wäre die Strukturaufklärung der DNA nicht möglich gewesen.
Der prinzipielle Arbeitsablauf einer Basenanalyse sieht so aus:
• Zellaufschluß − Reinigung der DNA
• Totalhydrolyse der DNA in wasserfreier Ameisensäure unter Luftabschluß bei 150°C
• chromatographische Trennung der Basen (damals auf Papier, später Dünnschicht und HPLC)
• Elution der Basen
• photometrische Bestimmung der Basenmengen
Die Auswertung der quantitativen Daten ergab für alle DNAs, unabhängig von ihrer Herkunft die folgenden
Gesetzmäßigkeiten:
[A] = [T]
[G] = [C]
[Purine] = [Pyrimidine]
Diese strenge Gesetzmäßigkeit darf nicht drüber hinwegtäuschen, daß die Zusammensetzung der DNA bei
den verschiedenen Organismen recht verschieden sein kann. Zur Charakterisierung einer DNA ist es üblich,
den Gehalt an [G] + [C] Paaren in % anzugeben. Allein bei Bakterien variiert der GC−Gehalt zwischen 25%
und 75%. Alle Wirbeltiere − etwa Mensch, Lachs, Frosch, Maus und Huhn− sind beschränkt auf den engen
Bereich zwischen 40% und 44%. Die nahe Verwandtschaft aller Vertebraten spiegelt sich shon in einem
einfachen Parameter wie dem GC−Gehalt wieder. In der Tat kann man den GC.Gehalt auch in anderen
Gruppen von Lebewesen für systematische Zwecke heranziehen. Es kommt nicht vor, daß der GC−Gehalt
innerhalb einer Art stark variiert. Wenn doch, dann ist sicherlich bald eine Revision dieser Art fällig. Schon
anhand dieser sehr knappen Auswahl von Daten wird Ihnen klar, daß die Bakterien stammesgeschichtlich
keine homogene Gruppe bilden. In der Regel ist die Vermutung zulässig, daß Bakterien mit sehr ähnlichem
GC−Gehalt miteinander verwandt sind. In der Tabelle läßt sich das am Beispiel von Escherichia coli, Shigella
dysenteriae und Salmonella typhimurium verdeutlichen. Diese drei Gattungen, die alle zu den
Enterobakterien, also zu den Darm−bewohnenden Mikroorganismen von Säugetieren gehören, sind auch nach
allen anderen Kriterien nah miteinander verwandt. Diese Verwandtschaft wird besonders deutlich im Hinblick
auf den genetischen Austausch, in dem die drei genannten Gattungen miteinander stehen. Gene können mit
Hilfe parasexueller Mechanismen innerhalb dieser Bakteriengruppe zwischen den Arten übertragen werden.
Die sogenannte Artgrenze ist eine zweifelhafte, beinahe mehr ideologischen Hypothese. Auch bei den
sogenannten höheren Organismen sind Artgrenzen als Barrieren für den genetischen Austausch eher
verwischt. Natürlicher horizontaler Gentransfer weit über Artgrenzen hinweg stellt sich bei näherem
Hinsehen nicht als Ausnahme sondern eher als Regel dar.
Röntgenstrukturanalyse
Der zweite wichtige Durchbruch in Sachen DNA−Struktur kam aus der Physik, nämlich aus der
Röntgenstrukturanalyse. Das Prinzip ist einfach, die zugehörigen Rechnungen nicht:
Kurzwellige Röntgenstrahlen werden fokussiert und auf möglichst regelmäßige Kristalle, in unserem Fall auf
saubere, fibrilläre DNA geleitet. Die Wellenlänge der Röntgenstrahlen liegt etwa in der gleichen Größe wie
Die Struktur der DNA
6
Mikrobielle Genetik
die Durchmesser von Atomen. Damit kommt es dann zu Beugungserscheinungen, ganz analog zu der
Situation, die Sie in der Schule am Beispiel der Beugung der Wellen des sichtbaren Lichts am Gitter oder
Spalt kennengelernt haben. Das Ergebnis solcher Beugungsphänomene ist eine Ungleichverteilung der
Röntgenstrahlintensität jenseits des Kristalls. Diese Intensitätsunterschiede kann man sichtbar machen, indem
man einen normalen Röntgenfilm in die Apparatur einbringt, den man dann entwickelt und auswertet. Man
kann dann aus den Beugungsmustern mit ein paar Limitationen auf die Anordnung der Atome im bestrahlten
Kristall zurückrechenen und erhält somit recht konkrete Vorstellungen über den dreidimensionalen Aufbau
der untersuchten Substanz.
Aus der Anordnung und den Abständen der Beugungs− bzw. Interferenzflecken kann man die wichtigsten
räumlichen Parameter des DNA−Moleküls ableiten. Man erhält Aufschluß über den Durchmesser des
Moleküls und über seine Symmetrie−Eigenschaften. Aus diesen beiden experimentellen Voraussetzungen, der
chemischen Basenananalyse, die in die Chargaff'schen Regeln mündete und der Röntgenstrukturanalyse
stammt unser Bild von der DNA, das sich als Helix darstellt. Grundlegende räumliche Daten kann man aus
der Strukturanalyse ableiten, nicht unbedingt aber die genaue Anordnung der einzelnen Baugruppen
zueinander. Die DNA−Röntgendaten gehen experimentell zurück auf Rosalind Franklin, die den Triumph
ihrer wirklich genialen Arbeiten nie auskosten durfte, und die auch schon bald nach ihren bahnbrechenden
Experimenten noch als junge Frau starb.
Die ersten Röntgendaten wären durchaus auch mit einem Molekül aus drei umeinander gewundenen Strängen
kompatibel gewesen. Nach Verfeinerung der Röntgenanalyse bis zu Angstrom−genauen Koordinaten, heute
auch anschaulicher bestätigt durch hoch−auflösende elektronenmikroskopische Aufnahmen des
DNA−Moleküls, kennen wir heute den Aufbau der DNA sehr genau:
Das Rückgrat der Helix liegt außen und besteht aus zwei alternierend aus Desoxyribose und Phosphorsäure
aufgebauten Strängen. Im Innern, über das C1−Atom mit einem Ring−Stickstoff der Basen verknüpft, liegen
die Basen. Die Basen sind zwischen den beiden antiparallel verlaufenden Strängen durch schwache,
nicht−kovalente Wechselwirkungen, die Wasserstoffbrückenbindungen, miteinander verknüpft.
Modellbau
Die gedankliche Verbindung chemischer und physikalischer Daten zum Doppelhelix−Modell der DNA ist das
Verdienst von Francis Crick und James Watson, die für diese Arbeit aus den Jahren 1952/53 dann auch 1962
den Nobelpreis erhielten. Eine ganz wesentliche Rolle bei der Strukturaufklärung spielte der
Molekülmodellbau. Anfang der 50er Jahre wußte man bereits, welchen Abstand in den verschiedenen
Bindungstypen die Atome voneinander haben. Jeder Strukturvorschlag muß mit diesen Bindunglängen
kompatibel sein. Durch einfachen, aber maßstabsgerechten Modellbau kann dann oft eine Vielzahl von
Strukturen, die man erdacht hat, gleich wieder ausgeschlossen werden. Eventuell haben Sie solche
Molekülmodellbaukästen währen ihrer Chemieausbildung benutzt.
Formen der DNA: Was ist künstlich − was natürlich?
Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, daß für rund 25 Jahre nach der Vorstellung des
Watson/Crick'schen Doppelhelix−Modells die Struktur zwar sehr wahrscheinlich, aber letztendlich nicht
wirklich stringent bewiesen war. Die endgültigen experimentellen Beweise kamen erst so gegen 1980, zu
einem Zeitpunkt also, zu dem ohnehin niemand mehr an der DNA−Struktur zweifelte. Um diese Zeit konnte
man kurze DNA−Abschnitte mit definierter Basensequenz, sogenannte Oligonucleotide, synthetisch
herstellen. Mit komplementären also exakt basenpaarenden Oligonukleotiden konnte man schöne, ideale
Kristalle herstellen, die zu bisher unerreichten Auflösungen in der Röntgenstrukturanalyse führten. Damit
gelang der endgültige physikalische Beweis der doppelhelicalen DNA in der postulierten Form wie sie schon
lange in den Lehrbüchern stand. Die Auflösung war so groß, daß man sogar Abweichungen von der idealen
Doppelhelix zeigen konnte. Abhängig von der Art der Basenpaarung ist das Zucker/Phosphat−Rückgrat ein
klein wenig verzerrt, da die Form der möglichen Basenpaare nicht ganz exakt gleich ist.
Modellbau
7
Mikrobielle Genetik
DNA kann in mehr als einer Konformation kristallisieren. Der Blick auf die Beugungs− bzw.
Interferenzflecken der fünf verschiedenen, bekannten Konformationen (A, B, C, D, Z−DNA) lohnt.
In welcher Form die DNA jeweils im Experiment vorliegt, hängt stark von physikalischem Parametern ab,
z.B. vom Wassergehalt der Probe. Wichtiger für uns ist die Abhängigkeit der Konformation von der
Basenzusammensetzung. Molekülmodelle der fünf verschiedenen Konformationen zeigen die hohe
Symmetrie aller möglichen Konformationen, besonders schön beim Blick auf die DNA in Richtung der
Längsachse: Die Muster erinnern an dekorative Spitzendeckchen.
B−DNA
B−DNA, ist die Form der DNA, die in unseren Genomen mit großem Abstand die häufigste ist. Diese DNA
ist rechts−gewunden. Für eine Windung werden 9.8 Basenpaare gebraucht; das Molekül hat einen
Durchmesser von 3,4 A. Besonders in der Aufsicht wird deutlich, daß wir ein hochgradig geordnetes Molekül
vor uns haben. Nur aufgrund dieses hohen Ordnungsgrades kann es überhaupt zu den verhältnismäßig
einfachen, symmetrischen Röntgenbeugungsmustern kommen.
A−DNA
Im Normalfall liegt DNA in der B−Konformation vor. Bei starkem Wasserenzug geht DNA allerdings in die
A−Form über. Es ist nicht klar, ob es in der lebenden Zelle nennenswerte dauerhafte Bereiche der DNA in der
A−Form gibt. Als weitgehend sicher gilt aber, daß A− und B−Form dynamisch ineinander überführt werden
können. Die A−Form von Nukleinsäuren spielt aber eine Rolle bei Hybridmolekülen von DNA und RNA. Sie
wissen, daß die genetische Information für ihre Nutzung in der Zelle in RNA überschrieben wird.
Komplementär zu einem der DNA−Stränge wird eine RNA abgelesen, die durchaus zunächst noch über einen
gewissen Bereich mit der DNA über normale Watson/Crick−Basenpaarungen verbunden ist. Diese Hybride
liegen in etwa in der A−Konformation vor. Auch RNAs, sofern sie doppelsträngig vorliegen (intramolekulare
Rückfaltungen oder dsRNA in bestimmten Bakteriophagen) nehmen A−Konformation ein. Die B−Form ist
für RNAs auch gar nicht möglich, weil die zusätzliche Hydroxylgruppe an der Ribose im Vergleich zu
Desoxyribose die Ausbildung der B−Struktur verhindert.
C−DNA
Eine röntgenographisch andere Form der DNA erhält man, wenn man das Lithium−Salz der DNA bei sehr
geringen Wassergehalt herstellt. Es ist aber nicht klar, ob es so etwas auch in vivo, im lebenden Organismus
gibt.
D−DNA
Normale, durchschnittliche DNA nimmt keine D−Konformation an. Eine Ausnahme bilden solche Regionen,
in denen sich A und T−Paare ganz regelmäßig abwechseln. Eine zweite Ausnahme ist die DNA des
Bakteriophagen T2, die immer in der D−Konformation vorliegt. Der Grund dafür liegt in einer chemischen
Besonderheit dieser DNA. T2 enthält kein Cytosin sondern ein Derivat davon, das 5−Hydroxymethylcytosin.
Zusätzlich ist die Hydroxylgruppe auch noch mit Glucose veräthert.
Die Basenpaarungseigenschaften dieser sonderbaren Base sind die gleichen wie die von Cytosin. Der
dreidimensionale Aufbau des DNA−Moleküls sieht aber jetzt etwas anders aus. Das Ergebnis ist DNA in der
D−Konformation.
Z−DNA
Alle bisher besprochenen DNA−Konformationen haben dieselbe Drehrichtung: sie sind rechtsläufig. Man
kann aber prinzipiell auch sehr schöne Modelle bauen, in denen die DNA das Bild einer linksläufigen
Schraube bietet. Lange Zeit gab es intensive Auseinandersetzungen darüber, ob es solche linksläufige DNA
Modellbau
8
Mikrobielle Genetik
tatsächlich gibt. Es gibt sie tatsächlich. Wenn Sie Röntgenstrukturanalysen von Oligonukleotiden machen, die
aus einer alternierenden Kette von Purinen und Pyrimidinen bestehen, finden Sie eine eindeutig
linksgewundene Struktur, die aber ansonsten ganz normale Watson/Crick'sche Basenpaarungen aufweist
(Beispiel: poly(dG−dC)). Das Zucker/Phosphat−Skelett dieser DNA ist etwa zickzackförmig angeordnet;
daher der Name Z−DNA. Voraussetzung für die Z−Konformation ist eine hohe Ionenstärke; angegeben
werden 0,7M MgCl2 oder 2,5M NaCl. Bei niedrigeren Salzkonzentrationen weisen auch solche
DNA−Abschnitte eine relativ normale B−Konformation auf. Zumindest in vitro, unter artifiziellen
Bedingungen, gibt es also Z−DNA. Wie sieht es aber in vivo aus? Sicherlich gibt es in keinem Zellkern und in
der Nähe keines Genophors so hohe Salzkonzentrationen. Das schließt aber nicht aus, daß auch unter anderen
Bedingungen die Z−Konformation ausgebildet und aufrecht erhalten werden könnte. DNA−assoziierte
Proteine, aber auch andere Ionen in physiologischen Konzentrationen könnten leicht die Rolle von
Stabilisatoren übernehmen. Auch DNA−Modifikationen könnten dabei helfen, B−DNA in Z−DNA zu
überführen. In der Tat kann man die hohen Salzkonzentrationen durch kleinere Polykationen wie Spermin
oder Spermidin in vernünftigen, also millimolaren Konzentrationen ersetzen wie sie auch in der Zelle
vorkommen können. Auch die Methylierung von Cytosin zu 5−Methylcytosin fördert die Ausbildung von
Z−DNA. Cytosin−Methylierung ist überhaupt nichts seltenes. In vielen Bakterien sind etwa 1−3% aller
Cytosinreste methyliert. In manchen Eukaryonten, besonders in Pflanzen, kann der Methylierungsgrad bei
über 25% liegen. Man kann sich diese Funktion des Methylcytosins chemisch leicht plausibel machen: Die
Methylgruppe ragt in der B−Konformation in die major groove der DNA und verdrängt dort als hydrophobe
Gruppe zu einem gewissen Grad Wassermoleküle. Das Wasser spielt aber eine Rolle bei der Stabilisierung der
Doppelhelix; die Methylierung wirkt also etwas destabilisierend. Anders ist dies in der Z−Konformation. Hier
liegt dann die Methylgruppe ganz zwanglos an einer Stelle, an der die Abwesenheit von Wasser die Helix
besser stabilisiert. Besonders bei hohem Methylierungsgrad bietet also die Z−Konformation durchaus
thermodynamische Vorteile. Auf der Molekülbau−Seite stellt sich der Übergang von der B− in die
Z−Konformation nicht halb so dramatisch dar wie es den Anschein hat. Man kann beide Typen ineinander
überführen, ohne daß die Stränge getrennt also Wasserstoffbrücken dauerhaft gelöst werden müssen. Die B
nach Z−Transition könnte zwanglos über die DNA−Helix laufen. Thermodynamisch ist der Übergang auch
nicht sonderlich dramatisch. Abgesehen von der Aktivierungsenergie in Höhe von 21 kcal/Mol wird kaum
weitere Energiezufuhr gebraucht, zumal der Prozeß kooperativ verläuft. Kooperativ heißt: sobald sich eine
Z−DNA−Keimzelle gebildet hat, werden Konformationsänderungen in der Nachbarschaft induziert.
Wie sucht man nach Z−DNA in vivo? Man kann in Kaninchen Antikörper gegen synthetisch hergestellte
Z−DNA herstellen (gegen chemisch modifiziertes und somit stabilisiertes poly(dG−dC). Mit diesen
Antikörpern kann man dann in mikroskopischen Dünnschnitten von fixierten Zellkernen auf die Suche nach
natürlich vorkommender Z−DNA gehen (Fluoreszenz−Markierung). Mit dieser Technik kann man in den
polytänen Riesenchromosomen aus Speicheldrüsen von Drosphila melanogaster tatsächlich Z−DNA
nachweisen. Es gibt also Z−DNA. Hat sie aber auch eine biologische Funktion? Diese Frage läßt sich noch
nicht abschließend beantworten. Vieles ist gemessen und diskutiert worden. Abschließende Klarheit herrscht
noch nicht. Auf alle Fälle gibt es aber in allen in dieser Hinsicht studierten Organismen zwischen Bakterien,
Drosophila und Weizen Proteine, die spezifisch an Z−DNA binden.
Gebogene DNA
Die DNA ist in wässriger Lösung eine recht plastische Struktur, so daß das Molekül gebogen, verdreht und
auch gestreckt werden kann. Die Bindungswinkel des Zucker/Phosphat−Skeletts sind nicht ganz so starr wie
es den Anschein hat. Kleine Abweichungen sind möglich, so daß die erwähnten Abweichungen von der
idealen Doppelhelix problemlos möglich sind. Darüber hinaus gibt es aber auch gelegentlich richtige Knicks
in der DNA, die weit über die normale Plastizität hinausgehen. Diese 'Kinks' treten spezifisch an bestimmten,
definierten DNA−Sequenzen auf. Eine solche Sequenz ist CAAAAAT, besonders dann, wenn sie mehrfach,
am besten immer wieder im Abstand von 10 Nukleotiden auftritt (das ist eine Umdrehung der
DNA−Schraube). Gebogene DNA kann aber auch durch die Einwirkung DNA−bindender Proteine erreicht
werden. Sie können davon ausgehen, daß Stellen, die als Folge ihrer besonderen Nukleotidsequenz 'Kinks'
haben, etwas besonderes darstellen, sozusagen Markierungen oder Wegweiser auf der DNA, die von
Proteinen erkannt werden können.
Gebogene DNA
9
Mikrobielle Genetik
© by Johannes Wöstemeyer
Last modified: 10. April 2007 Sun May 8 16:53:50 2005
Gebogene DNA
(top)
10