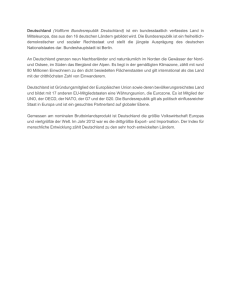Die ökonomische Dimension - Prof. Dr. Reinhard Rode
Werbung

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG PROFESSUR FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND DEUTSCHE AUßENPOLITIK Hallenser IB-Papier 3/2006 Reinhard Rode Europäisches oder atlantisches Deutschland: Die ökonomische Dimension Erscheint in: Thomas Jäger u. a. (Hg.), Deutsche Außenpolitik, VS Verlag, 2006. e-mail: [email protected] website: http://www.politik.uni-halle.de/rode 2 1 Traditionelle stabile transatlantische Beziehungen als Grundmuster deutscher Politik Die Nachkriegstradition deutscher Außenpolitik kannte stabile gute transatlantische Beziehungen als ein Grundmuster ihres Selbstverständnisses. Die Westbindung galt seit der Ära Adenauer als unangefochtene solide Säule der Außen- und Außenwirtschaftspolitik. Sie hatte also von vornherein eine politische und eine wirtschaftliche Logik. Nur Amerika konnte im Ost-West-Konflikt wirklich Schutz garantieren und amerikanische Rezepte galten als unverzichtbarer Baustein des deutschen Wirtschaftswunders. In der Spannung zwischen der europäischen und der atlantischen Orientierung lag kein wirklich tiefgehendes politisches und wirtschaftliches Konfliktpotential. „Atlantiker“ und „Gaullisten“ bildeten keine divergenten außenpolitischen Schulen. Sie vertraten keine Entweder-oder-Positionen, sondern setzten beim Sowohl-als-auch in der Tagespolitik die Akzente etwas mehr auf Washington oder Paris. Frankreich bot selbst für seine besten deutschen Freunde nie eine ernsthafte politische und schon gar keine wirtschaftliche Alternative zu den USA als Schutzmacht. Es gab für die Bundesrepublik nie eine französische Trumpfkarte. Frankreich konnte substantiell lediglich das deutsch-französische Tandem zur Führung im europäischen Integrationsprozess bieten. Auch wenn die europäische Perspektive betrachtet wird, bleibt die Logik der Untrennbarkeit evident. Ludwig Erhard hatte von Anfang an der handelspolitischen Beschränkung auf den Regionalismus eine Absage erteilt und auf die Notwendigkeit einer Weltmarktorientierung für ein Exportland wie Deutschland verwiesen.1 Damit war klar, dass Europa ohne Amerika für den deutschen Handelsstaat,2 um den jüngeren politikwissenschaftlichen Begriff zu verwenden, eine viel zu kleinräumige Perspektive böte. Das hieß aber auch, dass der wachsende europäische Regionalismus aus deutscher Sicht nicht im Gegensatz zu Amerika, sondern mit dem Akzent auf der Kooperation und dem Management wirtschaftlicher Konflikte bei unterschiedlichen Interessenlagen auszugestalten wäre. Damit war schon in der Frühphase des westdeutschen Staates ein atlantischer Kooperationsvorrang etabliert worden, der trotz aller Streitereien unter Freunden und Verbündeten bis zum Ende des Ost-WeltKonflikts vorhielt. An Disharmonien zwischen den Staatsspitzen und an Interessengegensätzen hat es im deutsch-amerikanischen Verhältnis dennoch nie gefehlt. Sie betrafen aber vor allem die Oberfläche, nicht die Substanz des Atlantizismus. Adenauer verstand sich mit Kennedy ebenso wenig wie Helmut Schmidt mit Jimmy Carter, Erhard wurde in der Frage der multilateralen Atomstreitmacht von Johnson düpiert und die Brandt’sche Ostpolitik wurde in Washington mit Misstrauen verfolgt. Bei der Vereinigung allerdings übernahmen die USA unter Bush senior schnell die Rolle des Förderers, während die westeuropäischen Partner noch auf Verzögerung setzten. Auch wenn im Ost-West-Konflikt immer Zweifel an der amerikanischen Allianztreue im hypothetischen Kriegsfall virulent waren, konnten allein die USA der glaubwürdige Garant westdeutscher Sicherheit sein. Diese Rolle des Sicherheitsexporteurs hatte ihren wirtschaftlichen Preis für die Bundesrepublik. Der Preis hieß Burden Sharing 1 Ludwig Erhard, Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt, Düsseldorf 1953, S. 9 f. Richard Rosecrance, Der neue Handelsstaat. Herausforderungen für Politik und Wirtschaft, Frankfurt am Main 1987 2 3 und mit dieser Lastenteilung3 war sowohl ein direkter materieller Beitrag zu den Stationierungskosten verbunden, als auch indirekte implizite Verknüpfungen außenwirtschaftlichen Wohlverhaltens. Frankreich leistete sich z. B. Ende der sechziger Jahre Attacken auf die schwächelnde amerikanische Währung und tauschte eifrig EuroDollars der französischen Notenbank gegen amerikanisches Währungsgold und unterminierte damit das Bretton-Woods-System. Paris arbeitete damit gegen die Währungshegemonie der USA. Die Deutsche Bundesbank hingegen hielt wohlüberlegt und politisch klug aus übergeordneten Sicherheitsinteressen wirtschaftlich still und stützte den US-Dollar. Beim Osthandel verhielt sich Westdeutschland jedoch mehrfach eigenständig interessengeleitet. Das Röhrenembargo der sechziger Jahre hatte ein westdeutsches Geschäftstrauma hinterlassen, bei dem sich Politik und Wirtschaft in Bonn hereingelegt gefühlt hatten. Beim Gas-Röhren-Geschäft in den achtziger Jahren leistete der westdeutsche Handelsstaat der Administration Reagan offenen Widerstand. Auch bei der Exportkontrolle durch das in Paris ansässige COCOM4 unterlief die deutsche Exportwirtschaft in Abstimmung mit der Politik immer wieder eine gar zu enge Handhabung und kurzfristig orientierte politische Instrumentierung, die die USA favorisierten. Auf dem Feld des Osthandels schuf sich die Bundesrepublik kleine Handlungsspielräume, die allerdings den Kern der Allianz und das dichte Muster transatlantischer Wirtschaftsverflechtung nicht wirklich untergruben. Diese politikfeldbezogene Verhaltensdifferenz erklärt sich schlicht und einfach aus der stark divergenten Machtposition der Bundesrepublik in den Sachbereichen Sicherheit und Wirtschaft. Der Wirtschaftsriese Bundesrepublik, der sich seit dem Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre sukzessive zum veritablen Partner der USA entwickelt hatte, befand sich in einer militärischen Zwergenrolle, weil die eigene Sicherheit nicht selbst garantiert werden konnte und eine hohe Abhängigkeit von den USA bestand. Auf dem Feld der Wirtschaft konnte Westdeutschland mit den USA auf gleicher Augenhöhe agieren, weil dieses Beziehungsmuster von relativ hoher Symmetrie gekennzeichnet war. 2 Zunehmende Europäisierung und Schwächung der deutschen Weltwirtschaftsmachtposition Die westdeutsche Republik war in den siebziger Jahren die dominante Ökonomie in Westeuropa und damit auch die Haupttriebkraft bei der europäischen Integration geworden. Die Logik der deutschen Europapolitik hatte sich geändert. Der friedensund stabilitätspolitische Akzent der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte war mit dem deutschen Interesse an regionaler Akzeptanz verknüpft gewesen. Dem folgte eine regionale kooperative Führungsphase im Tandem mit Frankreich. Die Bundesrepublik war dabei einerseits der Hauptnutznießer der Marktintegration, andererseits auch der 3 Elke Thiel, Dollar-Dominanz, Lastenteilung und amerikanische Truppenpräsenz in Europa: zur Frage kritischer Verknüpfungen währungs- und stationierungspolitischer Zielsetzungen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, Baden-Baden 1979 4 Das 1949 gegründete Coordinating Committee for Multilateral Export Control, COCOM wurde 1995 durch das Wassenaar-Abkommen ersetzt, bei dem auch die früheren Ostblockstaaten mitarbeiteten. 4 europäische Zahlmeister. Die deutsche Nettozahlerposition war eine feste Größe z. B. als Sponsor der kostenintensiven Süderweiterung. Die durch den Export reich gewordene Wirtschaftswunderrepublik konnte sich das auch leisten. Für die USA wurde sie damit auf diesem Feld zum europäischen Wirtschaftspartner Nummer 1 und zum Partner bei der Führung der Weltwirtschaft. Die Verflechtung in den Sektoren Handel, Investitionen und Währung belegt diese Rolle eindeutig. Damit wurde die Bundesrepublik ein stabiler Anker der Handelsliberalisierung im europäischen Integrationsgebilde, im globalen Handelsregime des GATT und in der Nachfolgeorganisation WTO. Das Liberalisierungsinteresse des westdeutschen Handelsstaats und zeitweiligen Exportweltmeisters wies im Grundsätzlichen eine breite Interessenübereinstimmung mit den USA auf. Bei den Überkreuzinvestitionen zwischen Deutschland und den USA traten in erster Linie Wirtschaftsunternehmen als Akteure auf, die für Wachstum sorgten und die Grundlage für die wirtschaftspolitische Partnerschaft schufen. Ein eigenständiger politischer Rahmen in Form eines Investitionsregimes kam dafür nicht zustande, dies war aber angesichts der florierenden Entwicklung auch nicht wirklich erforderlich. Auf dem Währungsfeld steuerten die amerikanische und die deutsche Notenbank in den achtziger Jahren praktisch das westliche Weltwährungssystem auf kooperative Weise. Hier war die Bundesrepublik in der Phase der Hochzeit der D-Mark neben den USA bis zur Europäisierung der Notenbank und der Einführung des Euro eine veritable Weltwährungsmacht.5 Schaubild 1 Der deutsche Warenexport nach Westeuropa, die USA, Japan, MOE und GUS 1980-2003 Mrd. Euro 375 350 EU15 325 USA 300 J 275 MOE+GUS 250 225 200 *EU und MOE+GUS vorläufige Werte 175 150 125 100 75 50 25 0 1980 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Quelle: Statistisches Bundesamt lfd.; eigene Grafik 5 David Marsh, Die Bundesbank. Geschäfte mit der Macht, München 1995 01 02 2003* 5 Die Vereinigung und die Europäisierung bewirkten hier prozessual eine Veränderung der Lage durch eine Intensivierung des Europaschwerpunkts der deutschen Außenwirtschaft. Wie Schaubild 1 aufzeigt, blieb der Europaschwerpunkt des deutschen Exports eine recht stabil wachsende Größe. Der Osthandelsanteil lag in den achtziger Jahren stets unter dem USA-Anteil. Erst nach 1989 übertraf der Ostexport den USAExport. Ein Großteil des Ostexports geht durch die Osterweiterung von der EU15 in die EU25 in die Europakurve ein. Im Zeitraum davor zwischen 1992 und 2002 hatte sich der Ostexport vervierfacht. Vor allem die drei Beitrittskandidaten Polen, Ungarn und Tschechien zeigten eine rasante Steigerung. Eine Relativierung des US-Markts für den deutschen Export könnte aus dieser Entwicklung herausgelesen werden. Allerdings blieb der US-Markt für den deutschen Export nach wie vor von großer Bedeutung. 2005 lagen die USA als zweitgrößter Absatzmarkt auf Rang 2 hinter Frankreich. Schaubild 2 Der deutsche Ostexport 1985-2004 Polen Mrd. € MOE+GUS Mrd. € 80 Ungarn Tschechien** 18 Russland*** MOE + GUS**** 15 60 12 40 9 6 20 3 0 0 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 *Ab 1990 gesamtdeutsche Daten. **Bis 1993 ehem. Tschechoslowakei. ***Bis 1993 ehem. Sowjetunion 02 03 04 04 vorläufige Daten Quelle: Statistisches Bundesamt lfd.; eigene Grafik Bei den deutschen Direktinvestitionen im Ausland liegt die EU25 als Anlage- wie als Herkunftsregion deutlich vor den USA (vgl. Schaubild 3). Parallel zum Handel konnten die mittelosteuropäischen Beitrittsländer auch als Anlageregion nach 1990 enorm zulegen, dennoch blieb die USA ein Schwerpunktland für die Anlagen deutscher Unternehmen. Auffällig war aber die Asymmetrisierung durch die geringeren amerikanischen Kapitalzuflüsse nach der Vereinigung. Deutschland und vor allem die neuen Bundesländer waren kein Magnet für amerikanische Direktinvestitionen. Neben wenigen Leuchttürmen wie Dow Chemical im mitteldeutschen Chemiedreieck und dem Engagement des Chipherstellers AMD in Dresden zeigte sich das amerikanische Kapital eher zurückhaltend beim Engagement im Standort Deutschland. Im nahen Mittelosteuropa der Beitrittsländer zur EU wurden die größeren Chancen gesehen. Im Währungssektor ging die deutsche Geldmacht in das europäischen Konzert des Euro und der Europäischen Zentralbank ein. Damit war das amerikanisch- 6 deutsche Währungsduopol in Form einer Quasi-G2 beim Dollarkursmanagement der zweiten Hälfte der achtziger Jahre nur noch Geschichte.6 Die deutsche Stimme im europäischen Konzert blieb zwar gewichtig, aber die bilaterale Führung war dahin und Deutschland für die USA auf diesem Feld kein direkter zentraler Ansprechpartner mehr. Das Opfer der DM auf dem Altar der europäischen Integration hatte somit zu einem unübersehbaren internationalen und vor allem auch transatlantischen Bedeutungsverlust Deutschlands geführt. Der Handelsstaat Deutschland hatte sich damit europäisch noch mehr eingereiht. Die Handelspolitik war schon lange europäisiert, jetzt traf dies auch auf die Währungs- und Geldpolitik zu. Weltmachtelemente der deutschen Position waren damit in Europa verschwunden. Wichtige Symbole wie die Ansiedlung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main und die Kreation nach dem unabhängigen Notenbankmodell der Bundesbank änderten daran wenig. Insofern war Deutschland damit ein weiteres Stück europäisch eingehegt worden und verlor für die USA an Eigengewicht. Die deutsche politische Führungsklasse sah und sieht darin mehrheitlich eine politische Tugend, die eine gewünschte Denationalisierung anzeigt. Schaubild 3 Deutsche Direktinvestitionen USA und EU25 1989-2004 Mrd. Euro 500 Deutsche DI in den USA 450 US-Amerikanische DI in Deutschland 400 Deutsche DI in der EU25 350 EU25 DI in Deutschland 300 250 200 150 100 50 0 1989 92 95 98 01 2004 Quelle: Deutsche Bundesbank, Zeitreihen lfd.; eigene Grafik Die Denationalisierung bestand in der Außenwirtschaftspolitik nach der Vereinigung vor allem in der deutschen Rolle im Prozess der Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union. Damit geriet Deutschland nicht in einen Gegensatz zu den USA, weil die USA traditionell die europäische Integration unterstützt haben. Das hieß freilich nicht, dass Handelsstreitigkeiten im Detail nicht mit harten politischen Bandagen ausgefochten wurden. Doch diese in Presseschlagzeilen hochstilisierten „Handelskriege“ waren tatsächlich politisch weitgehend verregelte transatlantische Verteilungskonflikte in einzelnen Sektoren, vor allem in der Landwirtschaft, bei denen die 6 Z. B. mit den Plaza- und Louvre-Abkommen von 1985 u. 1987. Beide Abkommen waren nur auf der Oberfläche multilateral, substantiell aber bi- bzw. trilateral mit Japan. 7 Regierungen unter starkem Druck von heimischen Schutzforderungen standen. Auffällig war, dass die deutsche Politik trotz der Vereinigungslast und dem höheren Schutzbedarf für die neuen Länder nur sehr wenig auf Protektion setzte. In der DohaRunde der WTO zeigte sich aber auch, dass die Zuständigkeit der EU und deren komplexes Entscheidungssystem die deutsche Handschrift in der Handelspolitik kaum mehr erkennen ließ. Der deutsche Politikanteil verschwand im Nebel kleiner ministerieller und verbandspolitischer Expertenkreise und oszillierte im europäischen Mehrebenensystem. So reisten z. B. deutsche Spitzenpolitiker und Verbandsvertreter im Dezember 2005 zur WTO-Ministerkonferenz nach Hongkong ohne Zugang zu den aktuellen Informationen des Verhandlungsverlaufs zu haben. Die Presse kolportierte das deutsche Auftreten folglich nicht grundlos spöttisch als „Klassenfahrt“.7 Noch viel mehr als der deutsche Handelsstaat mit seinem Sicherheitsmanko ist die EU immer noch in erster Linie eine Wirtschaftsunion, allerdings mit zunehmenden außen- und sicherheitspolitischen Ambitionen. Das letztere Profil ist aber immer noch recht schwach und vor allem von interner Fragmentierung geprägt. Zwar gilt das alte Diktum von Henry Kissinger nicht mehr, dass es keine Telefonnummer gibt, wenn er Europa anrufen möchte, weil die Kommission mittlerweile dafür einen Hohen Beauftragten, Javier Solana, hat. Doch Solana ist nur der Repräsentant des kleinsten gemeinsamen intergouvernementalen Nenners. Er muss immer noch an die führenden Mitgliedsstaaten durchstellen oder dort rückfragen. Selbst für den Fall einer Inkraftsetzung des Verfassungsvertrags gäbe es nur einen titularen europäischen Außenminister, der das Mehrebenensystem bereichert, aber die europäische Entscheidungs- und Handlungsschwäche kaum überwinden könnte. Auch die Europäisierung der Felder Handel und Währung hat dazu geführt, dass der deutsche Anteil an der europäischen Handels- und Währungspolitik immer schwieriger zu bestimmen und die Fragmentierung im operativen Tagesgeschäft zum vorherrschenden Muster geworden ist. Allgemein strategisch betrachtet war die deutsche Position in der Regel sehr deutlich. Die Währungsunion war zwar unpopulär, aber für die führende politische Klasse ein notwendiges und erwünschtes Ziel. Das historische Pathos Helmut Kohls in dieser Frage wurde nicht geteilt, das Ziel aber sehr wohl. Die These, dass Kohl sich die Zustimmung zum Euro vom französischen Präsidenten Mitterand als Quasi-Preis für die schnelle deutsche Einheit abhandeln ließ, ist immer wieder vorgebracht worden, wurde aber von Kohl und dem damaligen Außenminister Genscher bestritten. Die Vermutung eines solchen politischen Tauschgeschäfts ist nahe liegend, doch das Interesse an einer gemeinsamen Währung folgte ja durchaus der deutschen Handelslogik mit ihrem Europaschwerpunkt. Der Euro erklärt sich also durch den Wegfall von Transaktionskosten strukturell für Deutschland aus sich selbst heraus, auch wenn er die Weltgeltung der Deutschen Bundesbank beendete, die danach keinen interessanten Partner für die amerikanische Notenbank mehr darstellte. Das zweite große deutsche Ziel für Europa war die Osterweiterung als historische Tat und als Marktchance. Hier gingen eine historisch-politische Mission und das Handelsstaatsinteresse Hand in Hand und verstärkten sich im Sinne eines politischen Synergieeffekts. Der deutsche Osthandel konnte jetzt unter den Bedingungen der Systemübereinstimmung seine quasi-natürliche nachbarschaftliche Funktion einnehmen. Dafür war der Beitritt der mittelosteuropäischen Nachbarn zur EU ein logi7 Der Spiegel 51, 19.12.2005, S. 36; Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.12.2005, S. 2 8 scher Schritt. Dazu trat die politische Zielsetzung einer Einigung Europas mit seinen östlichen Teilen bis auf das qua Größe und Struktur unverdauliche Russland samt anderer GUS-Staaten, die für längere Zeit noch den Demokratie- und den Marktwirtschaftstest für die EU nicht bestehen würden. In der Osteuphorie der neunziger Jahre herrschte das rosarote Szenario eines Beitrittsidylls als historische Verpflichtung vor. Die deutsche Politik trat eifrig für die erste Runde der Neumitglieder ein und zog die skeptischen etablierten Subventionsempfänger im Süden, die um ihre Pfründe fürchteten, mit. Bei den Beitrittsverhandlungen wurden dann wie üblich mancherlei deutsche Finanzierungszusagen eingesetzt, um den Prozess zu beschleunigen. Die Standardkalkulation lautete, dass sich diese Investitionen mit dem boomenden Ostgeschäft bezahlt machen würden. Die deutsche Seite beförderte über ihren Beitrittskommissar Günter Verheugen (19992004)8 aktiv und mit großem Einsatz ihren schnellen Erweiterungskurs in der Kommission unter der Präsidentschaft des Italieners Romano Prodi. Mittlerweile sind auch die Folgekosten ins Berliner Lagebild eingegangen. Produktionsverlagerungen ins östliche Umfeld, zusätzliche Verzerrungen auf dem starren deutschen Arbeitsmarkt, die Anspruchshaltung der Neuen in Brüssel, Polen voran, und die zunehmende Fragmentierung der europäischen Entscheidungen haben die Begeisterung über weitere Mitglieder auf dem Balkan gedämpft. Auch für Bulgarien, Rumänien usw. wird zwar auf die Sogwirkung der EU und ihre Befriedungs- und Modernisierungseffekte vertraut. Die Gefahr der Überdehnung der EU bis hin zur Manövrierunfähigkeit ist aber ins politische Bewusstsein gerückt und für die nächste Etappe der Osterweiterung werden neben den Exportchancen auch die finanziellen und politischen Lasten für die deutsche Ökonomie als die Nummer 1 in Europa gesehen. Neben der europäischen spielt Deutschland auch auf der weltwirtschaftspolitischen Bühne immer noch eine tragende Rolle, vor allem in der G8 und in der OECD. Die OECD ist zwar die stärkste Ressourcenversammlung der Industriestaaten, sie wurde aber nicht zum Führungszentrum ausgebaut, sondern blieb Integrationsraum, Verhandlungsarena und Datensammelstelle mit Anregungscharakter.9 Die G7Staaten hingegen bildeten den Kern eines offenen Weltregierungsnetzwerks10 mit Deutschland 2006 immer noch in zentraler Position. Allerdings ist die tragende deutsche Rolle der Frühphase, als Helmut Schmidt 1975 ein Hauptinitiator gewesen war, mittlerweile einer wenig sichtbaren Nebenrolle gewichen. Auch darin drückt sich der Rückgang der weltwirtschaftlichen Position Deutschlands aus. Allerdings ist dafür auch der Strukturwandel von der alten G7 zur G8 mit Russland verantwortlich. Das stets lockere Gipfelregime wurde auf der Chefebene von den Staatschefs selbst durch den seit den Auftritten Ronald Reagans zunehmend übertriebenen Repräsentationsaufwand immer mehr ausgehöhlt. Dem Chefspektakel folgte dann das Anti-GipfelStraßenspektakel linksradikaler NGOs mit einem traurigen Höhepunkt 2001 in Genua. Der sachliche Gipfelbedarf wurde davon nicht tangiert, aber die polizeiliche Belastung für die Veranstaltungsorte als Anziehungspunkte für Krawalltourismus nahm enorm zu. 8 Seit November 2004 Kommissar für Industrie- und Unternehmenspolitik Reinhard Rode, Weltregieren durch internationale Wirtschaftsorganisationen, Münster 2002, S. 31 ff. 10 Ebd., S. 55 ff. 9 9 Die Aufnahme Russlands, die 1994 mit einer politischen G8 am zweiten Tagungstag begann und 1998 in die Vollmitgliedschaft der nunmehr G8 mündete, erwies sich ex post als voreilig. Dabei war die wirtschaftliche Führungslogik der Gipfel der politischen Integrationslogik Russlands untergeordnet worden. Das westliche Kalkül ging aber bis 2006 nicht auf, Russland blieb ein problematischer Mitspieler. Bei diesem voreiligen Fehlkalkül war die deutsche Seite mit Bundeskanzler Kohl führend beteiligt. Die Staatschefs mit ihrer symbolischen Politik und dem Hang zur Vermarktung von Bildern der personalen Führung der höchsten Ebene, z. B. durch die Männerfreundschaften zwischen Helmut Kohl und Boris Jelzin, später zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin, hatten in der Selbsteinschätzung und bei der politischen Reklame überzogen und die Gipfelmöglichkeiten grandios überschätzt. Der Erweiterungsbedarf ist angesichts aufstrebender Schwellenländer wie China und Brasilien als Kandidaten gegeben. Der Fall Russland hat aber das Qualitätsproblem dabei deutlich gemacht. Gefragt ist nicht politische Show, sondern reale Governancefähigkeiten auf der Grundlage von hinreichender Wirtschaftsleistung und gemeinsamen Wertorientierungen. Unterhalb der schwächelnden Chefebene haben sich seit 1982 Ministerforen entwickelt, um jenseits des Gipfelgetöses auch wieder reale Führungsleistungen zu generieren. Darunter ist die auf dem Gipfel in Köln 1999 geschaffene, für das Finanzsystem zuständige G2011 der Finanzminister unbestreitbar das wirkungsvollste Forum. Dieser Kreis der 20 dürfte mit Abstrichen bei einigen schwächeren und unzuverlässigen Teilnehmern die meisten Kandidaten für eine potentielle effiziente globale Governancestruktur enthalten. Deutschland wird wohl darin auf absehbare Zeit noch zum Führungskern zählen. Auf dem Ministerniveau waren die deutschen Vertreter auch stets eifrig als Teamplayer bei der Sache. Die G2-Phantasien mit den USA aus den achtziger Jahren, wenn sie denn je mehr als deutsches Wunschdenken und amerikanische Verlockungen enthielten, wirken allerdings aus der Sicht des Jahres 2006 kaum mehr verständlich. Global mutierte Deutschland langsam aber sicher zum relativen Absteiger. Transatlantisch herrschte auf diesen Feldern Grundkonsens mit Interessendifferenzen im Detail vor, keine Kontinentaldrift, wo die amerikanische Seite machtbewusst auf Mars und die Europäer ohnmächtig auf Venus setzten.12 Merkur bot beiden Seiten hinreichend langfristige Gemeinsamkeiten. 3 Deutschland als globaler Absteiger mit regionaler Überforderung Wie aufgezeigt, wurde aus der dominanten europäischen Ökonomie langsam der Problemfall Deutschland. Das zentrale Problem bestand im binnenwirtschaftlichen Substanzverlust durch die Starrheiten des rheinischen Modells der sozialen Marktwirtschaft deutscher Prägung mit ihrem hohen Niveau der Arbeitsmarktregulation 11 Mitgliedsländer waren Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Russland, Saudi Arabien, Südafrika, Südkorea, die Türkei, Großbritannien, die USA. Von den regionalen Akteuren war nur die EU vertreten. Hinzu kamen die Bretton-Woods-Zwillinge IWF und Weltbank. 12 Robert Kagan, Macht und Ohnmacht. Amerika und Europa in der neuen Weltordnung, Berlin 2003 10 und der sozialen Absicherung. Die einst gute Wettbewerbsfähigkeitsposition dieses Markt-Staat-Mischmodells gegenüber dem liberaleren angelsächsischen Konkurrenzmodell ging regional nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem Auftreten kostengünstigerer Wettbewerber in Mittelosteuropa und noch stärker weltweit im Zuge der jüngsten Globalisierungswelle verloren. Der zentrale Vorteil des deutschen Wohlfahrtsstaats, seine soziale Befriedungswirkung, die ein wichtiger Stabilitätsund Wachstumsfaktor gewesen ist, büßte im Zuge von Regionalisierungs- und Globalisierungsprozessen an Bedeutung ein. Der Wettbewerbsdruck von außen nahm erheblich zu. Gleichzeitig verlor die nationale Politik an Gestaltungsmacht. Mit dem Anstieg des europäischen Integrationsniveaus wurde eigenständige deutsche Standortpolitik auf den noch nicht vergemeinschafteten Feldern immer mehr zum Resthandlungsspielraum. Da Handels- und Währungspolitik denationalisiert waren, trat die Förderung der strukturellen Wettbewerbsfähigkeit als Optimierung von Staat, Markt und Gesellschaft in den Vordergrund. Die Debatte über die Leistungsfähigkeit und die Zukunftsperspektiven der deutschen Wirtschaft wurde zyklisch immer wieder im Hinblick auf zunehmende Globalisierungsprozesse geführt. Schwachpunkte des Industriestandorts Deutschland wurden bei den hohen Arbeitskosten, insbesondere den Lohnnebenkosten und der Unternehmensbesteuerung gesehen. Auch eine im Vergleich mit den USA und Japan geringere Technikakzeptanz, die sich z. B. in Widerständen gegen Bio- und Gentechniken ausdrückte, wurde moniert. Die Standortkritik aus der Wirtschaft war in der Rhetorik stark anti-interventionistisch und ging gewöhnlich nicht über das Credo der angebotsorientierten Vorstellungen hinaus. Das Weltspitzenniveau bei den Arbeitskosten, insbesondere bei den Lohnnebenkosten, wurde seit Mitte der neunziger Jahre zunehmend im politischen System als Problem begriffen. Deshalb suchten die deutschen Regierungen nach 1990 im Interesse der Beschäftigung die Nebenkosten zu senken. Sie verfingen sich damit aber immer wieder im Dickicht der etablierten wohlfahrtsstaatlichen Verteilungskoalitionen. Der deutsche Reformtanker erwies sich im Vergleich mit kleineren europäischen Ländern als nur schwer und langsam steuerbar. Gut gemeinte Versuche wie z. B. Hartz IV führten in noch mehr Bürokratismus und in die Kostenfalle. Arbeitsmarkt-, Steuer-, Renten- und Gesundheitssystemreformen kamen kaum voran oder brachten keine Durchbrüche. Der Diskurs um die Unternehmensbesteuerung z. B. entsprach dem undurchsichtigen deutschen Steuerrecht. Die Nominalbelastung war im internationalen Vergleich recht hoch. Die umfangreichen Abschreibungsmöglichkeiten relativieren aber dieses Bild der Hochbelastung. Globalisierungsgegner fürchteten um staatliche Verteilungsspielräume und erwarteten einen Steuerwettbewerb nach unten. In den neuen Ländern wurden unter erheblichem politischem Handlungsdruck zudem oft weltmarktfremde Distributionsideen favorisiert. Wohlstandsteilung im Inneren rangierte vor internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Auf Marktversagen wurde mit Politikversagen reagiert. Mezzogiornosymptome riefen linkspopulistische Verteilungskonzepte und ostalgische Identitätsdebatten hervor, die Modernisierungsverweigerung und Weltferne anzeigten. Immer deutlicher wurde ein Widerspruch zwischen der Herausforderung Ost in den neuen Ländern als nunmehr etablierte Dauersubvention und den Anforderungen der Globalisierungstrends. Der Weg vom erfolgreichen Handels- und Sozialstaat zum Wettbewerbsstaat erfordert gerade eine Rückführung der Staatsquote. Versuche, Ab- 11 striche am verkrusteten Sozialstaat mit seinen etablierten Verteilungskoalitionen zu implementieren, standen jedoch unter dem Generalverdacht einer neuen sozialen Kälte. Während in anderen westeuropäischen Ländern wie Großbritannien, Holland und Dänemark längst pragmatisch mit der Modernisierung der Sozialsysteme experimentiert wurde, fanden in Deutschland immer wieder ideologisch aufgeladene Diskurse statt, die den Mangel an politischer Innovationsphantasie bei den etablierten konservativen Verteilungskoalitionen anzeigten. Die Regierung in der Spätphase der Kanzlerschaft Kohls verweigerte sich den dringlichen Reformfragen weitgehend, weil der Chef sich lieber im Licht der großen historischen Erfolge der Vereinigung und der europäischen Integration sonnte. Kanzler Schröder hingegen suchte ein Modernisierprofil und wollte z. B. mehr als korporatistische Wiederauflagen präsentieren, seine eigene Partei aber verweigerte sich dem neuen Kurs immer mehr. Da das deutsche Problem in ziviler Fehlallokation und Starrheiten bestand, wurden die Unternehmensbesteuerung, das Rentensystem und die Zuwanderung von IT-Fachkräften immerhin angepackt. Die Agenda 2010 zielte durchaus auf die richtigen Punkte wie Steuerreform, Unternehmensentlastung, Bürokratieabbau, Stärkung der Investitionen und Arbeitsmarktreformen. Die Reformfortschritte blieben aber freilich im Vergleich mit den genannten kleineren europäischen Wohlfahrtsstaaten recht zaghaft. Die Große Koalition brachte in ihrem ersten Jahr auch keinen Aufbruch zustande, sondern offenbarte Züge der institutionalisierten Selbstblockade und fabrizierte eine Erhöhung der Staatsquote. Ein einschneidender nachhaltiger Subventionsabbau würde in der Tat an die Substanz der Deutschland AG mit ihrer hohen korporativen Verflechtung und ihrem mittlerweile unbezahlbaren Wohlfahrtsniveau gehen. Die Stärken in den traditionellen Sparten wie Chemie, Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Elektrotechnik erlauben durchaus auch Fortschritt bei neuen Schlüsseltechnologien. Der Faktor Wissen als Triebkraft für Wachstum und Strukturwandel befindet sich zwar nach wie vor auf einem hohen Stand. Die Qualität der deutschen Ausbildungssysteme verlor im internationalen Vergleich jedoch an Ansehen. Ein Qualitätsverlust trotz hohem Finanzaufwand zeigte typische Leistungsschwächen einer verwöhnten Gesellschaft. Auffällig war die veränderte Fremdeinschätzung. Während Deutschland zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung als neues dynamisches Kraftzentrum überschätzt wurde, was auch alte Ängste vor der deutschen Macht reaktivierte, überwogen seit Ende der neunziger Jahre skeptische Bewertungen. Die größte Ökonomie in Europa galt längst nicht mehr als europäische Modernisierungslokomotive. Sie erntete jetzt Häme mit der Metapher der „deutschen Krankheit“.13 Bei den internationalen Wettbewerbsratings schnitt Deutschland regelmäßig nur noch mäßig ab. Nach der Bewertung des Schweizer Institute for Management and Development (IMD) in Lausanne z. B. rangierte Deutschland zwischen 1999 und 2002 auf Rang 4. 2003 fiel es auf Rang 5 und 2004 auf Rang 7 zurück. Die USA hielten durchgängig Platz 1.14 Der Standort Deutschland war unübersehbar zum Problemfall geworden, das Modell Deutschland der siebziger Jahre längst Vergangenheit. 13 Hans-Werner Sinn, Der kranke Mann Europas. Diagnose und Therapie der deutschen Krankheit, in: Internationale Politik 59 (5), S. 25 14 IMD, World Competitiveness Yearbook 2004, Lausanne 2004, http://www02.imd.ch/wcc/online 12 Die globale Rolle im Konzert der Weltwirtschaftsmächte verfiel angesichts der Binnenschwäche bisher nicht dramatisch, mittelfristig steht hier freilich eine nachhaltige Schwächung zu erwarten. Deutschland agierte weiter zuverlässig kooperativ im Rahmen des westlich-liberalen Weltwirtschaftsregierungssystems mit seinen etablierten internationalen Institutionen IWF, Weltbank, WTO und OECD (Rode 2002).15 Allerdings ging Deutschland im multilateralen Konzert nur selten interessengeleitet aus der Deckung. Querelen wie z. B. bei der Besetzung des IWF-Chefpostens erstmals durch einen Deutschen gehörten zum üblichen Spiel der Einflusskonkurrenz. Von 2000 bis 2004 wurde Horst Köhler der erste deutsche Geschäftsführende Direktor (managing director) als Nachfolger des Franzosen Michel Camdessus (19872000). Der ursprüngliche Kandidat der Bundesregierung, der Staatssekretär im Finanzministerium, Caio Koch-Weser, war am amerikanischen Widerstand gescheitert. In der Doha-Runde der WTO z. B. fiel der amtierende Exportweltmeister Deutschland im Vergleich mit der letzten GATT-Runde, der Uruguay-Runde, politisch kaum mehr auf. Die Liberalisierungsinteressen des deutschen Handelsstaats wurden sehr still im Hintergrund verfochten, ohne dass ein nachhaltiges Engagement deutlich wurde. Das Schrumpfen des früheren deutschen Wirtschaftsriesen höhlte das außenwirtschaftspolitische Gewicht zunehmend aus, was nicht ohne Rückwirkung auf die Außenpolitik bleiben konnte. Ohne gedeckte Schecks mit großen Zahlen verlor die Scheckbuchdiplomatie an Kraft. Bei der rot-grünen Bundesregierung passten zudem die laute Menschrechtsrhetorik als Ausdruck überhöhter moralischer Ansprüche im Außenministerium und die Reisediplomatie von Kanzler Gerhard Schröder zur Exportförderung wie z. B. im Fall Chinas häufig nicht zusammen. Für den Export der Magnetschnellbahn Transrapid und den Bau der Strecke von Schanghai nach Hangzhou hatte Kanzler Schröder für den ersten Abschnitt einen deutschen Zuschuss von 100 Mio. Euro zugesagt. Die Kanzlerin Merkel versuchte dann im Mai 2006 bei ihrem Antrittsbesuch in Peking entsprechend hohe chinesische Forderungen für den Weiterbau aus guten Gründen zu vermeiden. Auch bei der Ostseepipeline zwischen Deutschland und Russland hatte Schröder interessengeleitet auf den Vorrang der deutschen Energieversorgung gesetzt. Die sukzessive Aufgabe außenwirtschaftlicher Souveränitäten zugunsten des europäischen Intergouvernementalismus war in der Phase der erfolgreichen deutschen Wirtschaftsmacht und bis zur noch überschaubaren EU15 klug gewesen, weil wirtschaftliche Stärke in der Regel aus sich heraus überzeugt und Einflussmöglichkeiten generiert, ohne dass diese ausdrücklich von den politischen Eliten betont und reklamiert werden müssten. Im Abstieg und in einer fragmentierten EU25 mit diffusen Verteilungskoalitionen und heftigen Haushaltsfeilschereien wurde ein neues aufgeklärtes Austarieren nationaler, regionaler und globaler Interessen und eine bessere Einbindung des rhetorischen Idealismus erforderlich. Mit dieser neuen Rollenbestimmung tat sich die deutsche politische Klasse überaus schwer. Sie liebäugelte allzu gern mit einer Weltmachtrolle des guten Deutschland und einer überhöht idealistischen Europarolle, zu der weder die Kraft noch die Vision ausreichten. Dabei fehlte auch die zielorientierte Koordination, nur allzu gern betrieben die verschiedenen Ressorts eifrig ihre eigene sektorale Europa- und Weltpolitik, was auf Widersprüche und Fragmentierungen sowie Irritationen bei den Partnern hinauslief. Beim unver15 Rode a.a.O. (Anm. 9). 13 meidlichen Feilschen in den europäischen politischen Verhandlungsarenen zeigte die deutsche Seite notorische Schwächen. In der wirtschaftlichen Schwächephase bedeutete dies einen Verlust an weicher Macht, der unweigerlich in den Einflussverlust mündet, was weder durch empathische noch durch Machtworte weggeredet werden kann. Die emsigen Auftritte der Kanzlerin Merkel als Vermittlerin in regionalen und internationalen Arenen wurden zwar gut vermarktet und bei den Partnern gern gesehen, besonders wenn diese nach alter Manier der Scheckbuchdiplomatie mit einer Kostenzusage untermauert wurden wie z. B. bei den EU-Budgetverhandlungen im Jahr 2005. Der geringere Einfluss war dennoch gegeben. Der Putz an der Erfolgsfassade des deutschen Handelstaats hat viele Risse bekommen. Der Weg in die zweite Reihe der Weltwirtschaftsmächte war vorgezeichnet und damit auch der Verlust an Gehör und Aufmerksamkeit in Washington. Deutschland blieb nach wie vor noch europäisch und atlantisch geprägt. Bei der politischen Gestaltung der transatlantischen Beziehungen wanderten jedoch immer mehr Kompetenzen und operatives Management von Berlin nach Brüssel ab. Die deutsche Spitzenbürokratie war stets fleißig beteiligt, fand sich aber zusehends öfter im Leerlauf von einflussarmen Routinen. Deutschland war damit bei den Wirtschaftsbeziehungen auf dem Weg zum zweitrangigen Atlantiker, dessen erlahmende Wirtschaftsmacht dazu führte, dass es auch im europäischen Konzert nur noch mühsam die erste Wirtschaftsgeige spielen konnte. Global befand sich Deutschland im Abstieg, regional war es überfordert und konnte seine frühere Lokomotivfunktion nicht mehr erfüllen. Die intergouvernementale Integration der EU15 und dann noch mehr der EU25 samt Aufwertungsprozessen der Funktionen der Kommission hatte den deutschen Einfluss in Europa und im atlantischen Raum geschwächt. Die Einflussgewinner waren vor allem die europäischen Kleinstaaten in der EU25.