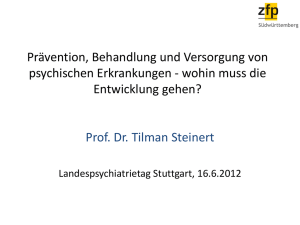Generika Cannabis & Schizophrenie Psychiatrie in
Werbung

Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – B 20695 F – Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle – Bajuwarenring 4 – D-82041 Deisenhofen – Oberhaching Wissenschaftliches Organ der pro mente austria, ÖAG, ÖGBE, ÖGKJP, ÖSG This journal is indexed in Current Contents / Science Citation Index / MEDLINE / Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Generika Cannabis & Schizophrenie Psychiatrie in Österreich Therapie der Alkoholabhängigkeit – Disulfiram – Neurokinin-1 Rezeptor Antagonist Suizidforschung – Abschiedsbriefe – Migranten Obsorge- & Besuchsrechtsverfahren Sterbehilfe ISSN 0948-6259 22/4 Band 22 Nummer 4 – 2008 Editorial Generika in der Psychiatrie – Verfügen sie über dieselbe therapeutische Äquivalenz wie das Original? S. Kasper, S. Lentner Übersicht Cannabis und Schizophrenie: Neue Erkenntnisse in einer alten Debatte W. Kawohl, W. Rössler Psychiatrische Versorgung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen – Ausblick U. Meise, J. Wancata, H. Hinterhuber Originalarbeit Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram J. Mutschler, A. Diehl, Ch. Vollmert, H. Herre, K. Mann, F. Kiefer Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen M. Heinrich, A. Berzlanovich, U. Willinger, B. Eisenwort Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der Immigrant­ Innen aus der Türkei T. A. Yilmaz, A. Riecher-Rössler Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren aus der Perspektive betroffener Eltern und Kinder S. Völkl-Kernstock, N. Bein, D. Gutschner, Ch. Klicpera, E. Ponocny-Seliger, M. H. Friedrich Kritisches Essay Gedanken zu den SterbehilfeBestrebungen in europäischen Ländern H. Hinterhuber, U. Meise Bericht Neue potentielle pharmakologische Behandlung bei Alkoholabhängigkeit im transnationalen Forschungsansatz entdeckt: Neurokinin-1 Rezeptor Antagonist als mögliche Therapie der Alkoholabhängigkeit? J. Mutschler, M. Grosshans, F. Kiefer Volume 22 Number 4 – 2008 221 223 230 243 252 261 268 277 283 Editorial Generics in Psychiatry – Do they have the same therapeutic equivalence as the original? S. Kasper, S. Lentner Review Cannabis and Schizophrenia: New findings in an old debate W. Kawohl, W. Rössler Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Mental health care in Austria: History – development – perspectives U. Meise, J. Wancata, H. Hinterhuber Original Recent results in relaps prevention of alcoholism with Disulfiram J. Mutschler, A. Diehl, Ch. Vollmert, H. Herre, K. Mann, F. Kiefer Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Measurement of cognitive constriction in suicide notes M. Heinrich, A. Berzlanovich, U. Willinger, B. Eisenwort Redaktion Suicide attempts among first and second generation immigrants T. A. Yilmaz, A. Riecher-Rössler Wissenschaftliches Organ On the work of Austrian authorised experts on procedures in custodial and visiting rights – a survey of current practice from the parents and children view S. Völkl-Kernstock, N. Bein, D. Gutschner, Ch. Klicpera, E. Ponocny-Seliger, M. H. Friedrich 4 08 Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Critical Essay Euthanasia and medically assisted suicide – attempts in European countries H. Hinterhuber, U. Meise Report A new pharmacological treatment option for alcohol dependence discovered in transnational study: Neurokinin-1 receptor antagonist as a possible therapy for alcoholism? J. Mutschler, M. Grosshans, F. Kiefer Dustri-Verlag Dr. Dustri-Verlag Dr. Karl Karl Feistle Feistle http://www.durstri.de http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 0948-6259 ISSN I Zeitungsgründer Franz Gerstenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Herausgeber Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck (geschäftsführend) Johannes Wancata, Wien Wissenschaftlicher Beirat Hans Förstl, München Andreas Heinz, Berlin Wulf Rössler, Zürich Christian Bancher, Horn Ernst Berger, Wien Karl Dantendorfer, Wien Max Friedrich, Wien Armand Hausmann, Innsbruck Hans Rittmannsberger, Linz Christian Simhandl, Neunkirchen Reinhold Schmidt, Graz Werner Schöny, Linz Erweiterter wissenschaftlicher Beirat Josef Aldenhoff, Kiel Michaela Amering, Wien Jules Angst, Zürich Wilfried Biebl, Innsbruck Peter Falkai, Göttingen Wolfgang Gaebel, Düsseldorf Verena Günther, Innsbruck Reinhard Haller, Frastanz Ulrich Hegerl, Leipzig Isabella Heuser, Berlin Florian Holsboer, München Christian Humpel, Innsbruck Kurt Jellinger, Wien Hans Peter Kapfhammer, Graz Siegfried Kasper, Wien Heinz Katschnig, Wien Ilse Kryspin-Exner, Wien Wolfgang Maier, Bonn Karl Mann, Mannheim Josef Marksteiner, Klagenfurt Hans-Jürgen Möller, München Heidi Möller, Kassel Franz Müller-Spahn, Basel Thomas Penzel, Berlin Walter Pieringer, Graz Anita Riecher-Rössler, Basel Peter Riederer, Würzburg Wolfgang Rutz, Uppsala Hans-Joachim Salize, Mannheim Alois Saria, Innsbruck Norman Sartorius, Genf Heinrich Sauer, Jena Gerhard Schüssler, Innsbruck Gernot Sonneck, Wien Marianne Springer-Kremser, Wien Thomas Stompe, Wien Gabriela Stoppe, Basel Hubert Sulzenbacher, Innsbruck Hans Georg Zapotoczky, Graz Redaktionsadresse Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-236 16, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected] Produktion in Lizenz durch VIP-Verlag Integrative Psychiatrie Innsbruck Anton-Rauch-Straße 8 c, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] www.vip-verlag.com – Tel. +43 (0) 664 / 38 19 488 Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Postfach 1351, © 2008 Jörg Feistle. D-82032 München-Deisenhofen, Verlag: Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle. Tel. +49 (0) 89 61 38 61-0, Telefax +49 (0) 89 6 13 54 12 ISSN 0948-6259 Email: [email protected] Regulary indexed in Current Contents/Science Citation Index/MEDLINE/Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht das Ver­lagsrecht für alle Sprachen und Länder einschließlich des Rechts der photomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfäl­ tigung an den Verlag über. benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen wird vom Verlag keine Gewähr übernommen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Die Neuro­ psychiatrie erscheint vierteljährlich. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß sol­che Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be­trachten wären und daher von jedermann Bezugspreis jährlich € 84,–. Preis des Einzelheftes € 23,– zusätzlich € 6,– Versandgebühr, inkl. Mehrwertsteuer. Einbanddecken sind lieferbar. Bezug durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis 4 Wochen vor Jahresende erfolgt. Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 III Hinweise für AutorInnen: Sämtliche Manuskripte unterliegen der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtung durch Schriftleitung und Reviewer. Allgemeines: Bitte die Texte unformatiert im Flattersatz (Ausnahme: Überschrift und Zwischenüberschriften, Hervorhebungen) und keine Trennungen verwenden! Manuskripte – verfasst im Word – sind am besten per Email an die Redaktion (Adresse ­siehe ­unten) zu übermitteln. Sie können auch elektronisch auf CD oder Diskette an die Redaktions­adresse ­gesandt werden. Die Zahl der Abbildungen und Tabellen sollte sich auf maximal 5 beschränken. Manuskriptgestaltung: • Länge der Arbeiten: - Übersichtsarbeiten: bis ca. 50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Originalarbeiten: bis ca. 35.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Kasuistiken, Berichte, Editorials: bis ca. 12.000 Zeichen inkl. Leerzeichen • Titelseite: (erste Manuskriptseite) - Titel der Arbeit: - Namen der Autoren (vollständiger Vorname vorangestellt) - Klinik(en) oder Institution(en), an denen die Autoren tätig sind - Anschrift des federführenden Autors (inkl. Email-Adresse) • Zusammenfassung: (zweite Manuskriptseite) - Sollte 15 Schreibmaschinenzeilen nicht übersteigen - Gliederung nach: Anliegen; Methode; Ergebnisse; Schlussfolgerungen; - Schlüsselwörter (mindestens 3) gesondert angeben • Titel und Abstract in englischer Sprache (3. Manuskriptseite) - Kann ausführlicher als die deutsche Zusammenfassung sein - Gliederung nach: Objective; Methods; Results; Conclusions - Keywords: (mindestens 3) gesondert angeben • Text: (ab 4. Manuskriptseite) Für wissenschaftliche Texte Gliederung wenn möglich in Einleitung, Material und Methode, Ergebnisse, Diskussion, evtl. Schlussfolgerungen, evtl. Danksagung, evtl. Interessenskonflikt • Literaturverzeichnis: (mit eigener Manuskriptseite beginnen) - Literaturangaben sollen auf etwas 20 grundlegende Werke und Übersichtsarbeiten beschränkt werden. Das Literaturverzeichnis soll nach Autoren alphabetisch geordnet werden und fortlaufend mit arabischen Zahlen, die in [eckige Klammern] gestellt sind, nummeriert sein. - Im Text die Verweiszahlen in [eckiger Klammer] an der entsprechenden Stelle einfügen. Beispiele: Arbeiten, die in Zeitschriften erschienen sind: [1] Rittmannsberger H., Sonnleitner W., Kölbl J., Schöny W.: Plan und Wirklichkeit in der ­psychiatrischen Versorgung. Ergebnisse der Linzer Wohnplatzerhebung. Neuropsychiatr 15, 5-9 (2001). (Abkürzung Neuropsychiatr) Bücher: [2] Hinterhuber H., Fleischhacker W.: Lehrbuch der Psychiatrie. Thieme, Stuttgart 1997. Beiträge in Büchern: [3] Albers M.: Kosten und Nutzen der tagesklinischen Behandlung. In: Eikelmann B., Reker T., Albers M.: Die psychiatrische Tagesklinik. Thieme, Stuttgart 1999. • Abbildungen und Tabellen: (jeweils auf eigener Manuskriptseite - Jede Abbildung und jede Tabelle sollte mit einer kurzen Legende versehen sein. - Verwendete Abkürzungen und Zeichen sollten erklärt werden. - Die Platzierung von Abbildungen und Tabellen sollte im Text durch eine Anmerkung markiert werden („etwa hier Abbildung 1 einfügen“). - Abbildungen und Grafiken sollten als separate Dateien gespeichert werden und nicht in den Text eingebunden werden! - Folgende Dateiformate können verwendet werden: Für Farb-/Graustufenabbildungen: .tiff, .jpg, (Auflösung: 300 dpi); für Grafiken/Strichabbildungen (Auflösung: 800 dpi) Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Ethische Aspekte: Vergewissern Sie sich bitte, dass bei allen Untersuchungen, in die Patienten involviert sind, die Grundsätze der zuständigen Ethikkommissionen oder der Deklarationen von Helsinki 1975 (1983) beachtet worden sind. Besteht ein Interessenskonflikt gemäß den Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors, muss dieser gesondert am Ende des Artikels ausgewiesen werden. Korrekturabzüge: Nach Anfertigung des Satzes erhält der verantwortliche Autor einen Fahnenabzug des Artikels elektronisch als pdf-Datei übermittelt. Die auf Druckfehler und sachliche Fehler durchgesehenen Korrekturfahnen sollten auf dem Postweg an die Verlagsadresse zurückgesandt werden. Manuskript-Einreichung: Redaktion: Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-236 68, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected] Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 IV Editorial Editorial Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 221–222 Generika in der Psychiatrie – Verfügen sie über dieselbe therapeutische Äquivalenz wie das Original? Siegfried Kasper1 und Susanne Lentner2 1 2 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien Anton-Proksch-Institut, Wien Generics in Psychiatry – Do they have the same therapeutic equivalence as the original? Ein Patient, in der Klinik auf Präparat A eingestellt, wird entlassen, und der niedergelassene Arzt entscheidet sich für Präparat B, der Apotheker dann für Präparat C und als der Patient das nächste Mal in die Apotheke kommt, erhält er Präparat D. Dies ist keine Fiktion, sondern heißt “Aut-Idem-Lösung”, d.h. es ist in dem Medikament jeweils der gleiche Wirkstoff vorhanden, jedoch werden unterschiedliche Präparate, einmal das Originalpräparat und dann verschiedene Generika eingesetzt, je nachdem, was gerade am billigsten verfügbar ist. Wie wir von den KollegInnen in Deutschland wissen, sind sie mit dieser Regelung gar nicht zufrieden. Offensichtlich wurden Wissenschaftler dazu nicht befragt, die z.B. den Unterschied zwischen Bioäquivalenz und therapeutischer Äquivalenz erklären hätten können. Die Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie (ÖGPB) wendet sich heuer erstmals in einem österreichweiten Konsensus-State© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 ment dem Thema „Generika und Originalpräparate in der Psychiatrie“ zu und versucht praktische Richtlinien zu erarbeiten. Originalpräparate werden im Rahmen von Zulassungsverfahren, heute meist weltweit sowohl in präklinischen als auch in klinischen Untersuchungen eingehend geprüft. Generika hingegen ahmen ein Originalpräparat nach und werden nach Ablauf des Patentschutzes desselben unter relativ einfachen Zulassungsbedingungen auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um eine „bezugnehmende Zulassung“. Die pharmazeutischchemische Qualität und die Pharmakokinetik werden im Rahmen einer Bioäquivalenz-Studie durchgeführt und sollen gemäß den Empfehlungen der European Medicine Evaluation Agency (EMEA) innerhalb eines Akzeptanzbereiches von 80 bis 125 % des Referenzpräparates liegen. Das Generikum muss den gleichen Wirkstoff, die gleiche Darreichungsform, den gleichen Applikationsweg, die gleiche Dosierung und die gleiche Indikation wie das Referenzarzneimittel aufweisen. Kritikpunkte in dem Konsensus-Statement weisen daraufhin, dass die Bioäquivalenzstudien nicht der klinischen Praxis entsprechen, da sie unter standardisierten Bedingungen stattfinden, bei gesunden Probanden zwischen 18 und 55 Jahren, meist im Single/Crossover-Design mit Einmal-Gabe. Weiterhin wird hervor- gehoben, dass die Untersuchungen somit nicht an Kranken durchgeführt werden, obwohl mehrfach belegt ist, dass die Physiologie bei Gesunden und Kranken unterschiedlich ist. Es wird daher für die Gruppe der Generika einschränkend festgehalten, dass die Untersuchungen lediglich bei ausgesuchten Gesunden durchgeführt werden, und sich die Untersuchungen auf Einzeldosen beschränken und zumeist kein Vergleich im Steady-State gemessen wird. Die Verwendung unterschiedlicher Zusatzstoffe stellt darüber hinaus noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor dar. Interessanterweise wird von den Zulassungsbehörden keine therapeutische Äquivalenz gefordert, worunter man eine gleiche Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit zweier Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff bei vergleichbaren PatientInnen bezeichnen würde. Die therapeutische Äquivalenz wird nur indirekt über die belegte Bioäquivalenz angegeben, wobei jedoch festgehalten sei, dass sich diese nur durch den direkten Vergleich therapeutischer Parameter in klinischen Prüfungen nachweisen lässt. Leider ist die Literatur zu wissenschaftlichen Vergleichsstudien von Originalpräparaten zu Generika bzw. von Generika untereinander in der Psychiatrie sehr dürftig und insgesamt von niedrigem Evidenzgrad. Kasper, Lentner Die wenigen verfügbaren Studien lassen jedoch erkennen, dass zum Teil deutliche Unterschiede bestehen. Vergleichbar ist die Datenlage in der Neurologie und KollegInnen, die z.B. PatientInnen mit einer epileptischen Erkrankung behandeln, gehen das Risiko einer Umstellung nicht ein, um nicht einen erneuten Anfall zu provozieren. Ist bei unseren psychiatrischen PatientInnen die Problemlage ganz anders? Ist nicht eine neue Phase einer Depression bzw. einer manischen Erkrankung oder einer schizophrenen Episode durchaus mit einem epileptischen Anfall zu vergleichen, oder wie die Datenlage darauf hinweist, sogar noch schlechter. Es ist bekannt, dass zunehmende Krankheitsphasen eine ungünstigere Therapierbarkeit, mannigfaltige Kosten im Gesundheitssystem und psychosoziale Schwierigkeiten für Betroffene wie auch für die Umgebung mit sich bringen. 222 Für die Praxis sollte daher ein unkontrollierter Wechsel von verschiedenen Substanzen ohne Kenntnis des Facharztes und ohne ärztliche Kontrolle möglichst vermieden werden, da psychiatrische und neurologische Erkrankungen zumeist chronisch verlaufen und Krankheitseinsicht und Compliance des Patienten einen wesentlichen Faktor für die Einhaltung eines speziellen Therapieplanes darstellen . Allein der Kostendruck sollte nicht zur Umstellung Anlass geben, da eine erneute Phase der Erkrankung neben dem individuellen Leid der PatientInnen auch für die Gesellschaft unvergleichlich teurer ist als der aktuelle Medikamententarif. Es sei festgehalten, dass bei Arzneimitteln mit einer geringen therapeutischen Breite, dazu gehören Psychopharmaka, und bei chronischen psychiatrischen Erkrankungen ein Medikamentenwechsel einer Neueinstellung gleich- zusetzen ist, der einer entsprechenden ärztlichen Betreuung bedarf und mit einem korrespondierenden Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Allein der Kostendruck sollte uns ÄrztInnen jedoch nicht veranlassen, bei den uns anvertrauten PatientInnen die oben genannten wissenschaftlichen Parameter außer Acht zu lassen. o. Univ. Prof. Dr. DDr.h.c. Siegfried Kasper Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Medizinische Universität Wien [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 223–229 Cannabis und Schizophrenie: Neue Erkenntnisse in einer alten Debatte Wolfram Kawohl1, 3 und Wulf Rössler2, 3 Forschungsgruppe Klinische und Experimentelle Psychopathologie Forschungsgruppe Public Mental Health 3 Klinik für Soziale Psychiatrie und Allgemeinpsychiatrie ZH West, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1 2 Schlüsselwörter: Cannabis – Kausalität –Psychose – Schizo­ phrenie –Tetrahydrocannabinol Keywords: cannabis – causality – psychosis – schizo­ phrenia – tetrahydrocannabinol Cannabis und Schizophrenie: Neue Erkenntnisse in einer alten Debatte Die Debatte, ob der Gebrauch von Cannabis mit einem höheren Risiko verbunden ist, an einer psychotischen Störung zu erkranken, wird seit den 1930er Jahren geführt. Zwei Fragen sind dabei von zentralem Interesse: Erstens, ob Cannabiskonsum ursäch­ lich für die Entwicklung psycho­ tischer Störungen ist und zweitens, wo­rin die entsprechende neurobio­ logische Verknüpfung besteht. Die vorliegende Arbeit liefert einen Über­blick über epidemiologische Unter­suchungen zum Zusammen­ hang zwischen Cannabiskonsum und Schizophrenie einerseits und ande­ rerseits über neurobiologische Studi­ en zur Wirkung von Cannabis im Ge­ hirn. In den letzten Jahrzehnten durch­ geführte Kohorten­studien und neuere Metaanalysen konnten den hypothe­ tisierten Zusammenhang erhärten. Das Risiko, psycho­tische Symptome © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 und auch eine Schizophrenie zu ent­ wickeln, wird demnach für junge Menschen durch Cannabiskonsum deutlich erhöht. Der Cannabiskon­ sum kann dabei als Teilursache an­ gesehen werden, es besteht eine Do­ sisabhängigkeit. Eine Information der breiten Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge ist angezeigt, um in Zeiten einer Lockerung des Umgangs mit Cannabis eine Zunahme der Inzi­ denz psychotischer Störungen durch Cannabiskonsum zu verhindern. Cannabis and Schizophrenia: New findings in an old debate The issue, whether the use of canna­ bis contains a higher risk to develop psychotic disorders, is disputed since the 1930s. Two questions are of cen­ tral concern: Firstly, if the use of can­ nabis is causal for the development of psychotic disorders, and secondly, what the neurobiological connection consists of. In this review we give an overview on epidemiological studies concerning the issue and on neuro­ biological studies on the effects of cannabis in the brain. On the basis of cohort studies that have been con­ ducted within the last decades and re­ cent meta-analyses the hypothesized connection between cannabis use und psychotic disorders can be corrobo­ rated. The risk to develop psychotic symptoms and also schizophrenic psychoses is thus explicitly elevated for young people who use cannabis. Cannabis use can be considered a component cause, a dose dependency exists. An information of the public concerning this matter is required in order to prevent a rising incidence of psychotic disorders in times of an increasing ease of handling of can­ nabis. Einleitung Cannabis sativa, der sogenannte Nutz­hanf, und insbesondere die an Cannabinoiden sehr reiche Unterart Cannabis indica (indischer Hanf), ist eine weitverbreitete Kulturpflanze, die seit Jahrtausenden als Rausch­ mittel genutzt wird [39]. Δ9-Tetrahy­ drocannabinol (Δ9-THC) konnte als hauptsächlicher psychoaktiver In­ haltsstoff der Cannabis sativa-Pflan­ ze identifiziert werden [31]. Δ9-THC ist ein Agonist am zentralen Canna­ binoidrezeptor (CB1). Die Zufuhr von Δ9-THC und auch von synthetischen Cannabinoiden kann bei gesunden Versuchspersonen psychotische Sym­ ptome hervorrufen [27]. Abgegrenzt von dieser Beobachtung ist die Frage von Bedeutung, ob durch die Anwen­ dung von Δ9-THC und gegebenen­ falls anderer Inhaltsstoffe der Cannabis sativa-Pflanze persistierende psy­ chotische Symptome im Sinne einer psychotischen Erkrankung unabhän­ gig von akuten Intoxikationseffekten auftreten können. Die Debatte, ob der Gebrauch von Cannabis ein höheres Kawohl, Rössler Risiko, an einer psychotischen Stö­ rung zu erkranken, bedingt, wird seit den 1930er Jahren geführt [37]. Mit der vor nunmehr 21 Jahren veröffent­ lichten Swedish conscripts-Studie [4] wurde die Diskussion intensiviert, da sich erstmals eine veröffentlichte Evidenz dafür ergab, dass Cannabis ein Risikofaktor für die Entwicklung von Schizophrenien darstellt. Seit­ her und insbesondere in den letzten Jahren ist diese Evidenz sowohl auf der Ebene einzelner longitudinaler Kohortenstudien als auch durch Meta­ analysen weiter untermauert worden. In einer epidemiologischen Studie konnte gezeigt werden, dass eine Zu­ nahme des Cannabis-Gebrauchs in den 1990er Jahren mit einer Zunahme der Inzidenz psychotischer Störungen im Kanton Zürich, insbesondere bei jungen Männern, im gleichen Zeit­ raum einher ging [1]. Der Forderung, vor dem Hintergrund der bisherigen Befunde vor Cannabiskonsum dezi­ diert zu warnen, war die Alternativin­ terpretation der sogenannten umge­ kehrten Kausalität (reverse causality) [21] entgegen gehalten worden: Der Nachweis eines statistischen Zusam­ menhangs zwischen Cannabiskonsum und Schizophrenie bedeutet demnach nicht, dass die Schizophrenie durch Cannabiskonsum verursacht wurde. Vielmehr besteht auch die Möglich­ keit, dass Patienten, die an prodroma­ len Symptomen einer Schizophrenie leidern, vermehrt Cannabis komsu­ mieren, um diese Symptome selbst zu behandeln (Selbstmedikationshy­ pothese) [19]. Studien zur akuten Wirkung von Can­ nabis sowie Tierversuchs- und Asso­ ziationsuntersuchungen liefern wei­ tere Beiträge zur Debatte. Wir möch­ ten mit dieser Arbeit einen Überblick über Studien liefern, die für die Fra­ gen von Bedeutung sind, ob der Ge­ brauch von Cannabis das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken, erhöht und wie der neurobiologische Zusammenhang beschaffen ist. 224 Zentrale Wirkmechanismen von Cannabinoden Cannabinoide greifen an den Canna­ bisrezeptoren CB1 und CB2 an. CB1 wird nur im Gehirn exprimiert [48], CB2 ausschliesslich peripher [34]. In autoradiographischen Studien und immunhistochemischen Mappingun­ tersuchungen konnte die Verteilung von CB1-Rezeptoren aus zellulärer Ebene im Gehirn der Ratte dargestellt werden: CB1-Rezeptoren sind dem­ nach hauptsächlich präsynaptisch an Axonen und Nervenendigungen vorhanden [14, 23]. Diese Verteilung deutet auf eine modulierende Funk­ tion der Cannabinoide bei der Neu­ rotransmitterfreisetzung hin, die in verschiedenen Studien mit tierischem und menschlichem Gewebe bestätigt werden konnte [26]. Es exis­tieren meh­ rere Tieversuchsstudien zu den Effek­ ten von Cannabis auf verschiedene Neurotransmittersysteme. Einflüsse auf die dopaminerge, GABAerge und glutamaterge Neurotransmission konn­ten nachgeweisen werden [8, 11, 17, 38, 40, 46, 54]. CB1-Rezeptoren kommen bei Tieren und beim Men­ schen mit hoher Dichte im cerebralen, insbesondere frontalen, Cortex, in den Basalganglien, im Hippocam­ pus, im anterioren Cingulum und im Kleinhirn vor [12, 23]. Cannabinoide erhöhen die Feuerrate dopaminerger Neurone und die synaptische Freiset­ zung von Dopamin im Striatum der Ratte [10]. Dieser Effekt könnte für eine psychoseinduzierende Wirkung zumindest mitverantwortlich sein, wobei diesbezüglich keine Unter­ suchungen am Menschen vorliegen [35]. Die Tatsache, dass in den Hirn­ stammkernen hingegen nur wenige CB1-Rezeptoren vorhanden sind, könnte für die geringe Toxizität der Cannabinoide bei Überdosierungen verantwortlich sein [26]. Synthe­ tischen und natürlichen Antagonisten am CB1-Rezeptor wie SR141716 (Ri­ monabant) und Cannabidiol (CBD) werden hingegen antipsychotische Eigenschaften zugeschrieben [42]. Akut- und Langzeitwirkung der Einnahme von Cannabinoden In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene experimentelle Stu­ dien zur akuten Wirkung von Can­ nabis durchgeführt. Nachdem an­ fangs noch pflanzliche Substanzen mit mehr oder weniger unklarer und variabler Zusammensetzung zur An­ wendung kamen [3], wurde durch die Einführung synthetischen Δ9-THCs eine genauere Bestimmung der do­ sisabhängingen Wirkungen ermögli­ cht: So konnte nachgewiesen werden, dass bei niedriger Dosis (120µg/kg Körpergewicht (KG) oral, 50µg/kg KG inhalativ) eine Verbesserung der Stimmung, eine empfundene Ver­ langsamung des Zeitablaufes sowie eine Verstärkung auditorischer und visueller Sinneseindrücke auftraten. Unter einer Dosis von 480µg/kg KG bei oraler Applikation bzw. 200µg/ kg KG bei inhalativer Applikation traten hingegen deutliche visuelle und auditorische Wahrnehmungsver­ änderungen, Depersonalisation und Derealisation sowie auditorische und visuelle Halluzinationen auf. Darüber hin­aus wurde eine Überempfindlich­ keit einiger Probanden beschrieben, die bereits bei den niedrigen Do­ sierungen schwere Symptome auf­ wiesen [25]. Die Gabe von Δ9-THC führt zu akuten, elektrophysiologisch nachweisbaren Veränderungen. Eine Reduktion der Amplitude des ereig­ niskorrelierten Potentials P300 konn­ te nachgewiesen werden [41]. Dieser Parameter gilt als Aufmerksamkeits­ mass, eine verminderte Aufmerk­ samkeit geht mit einer verminderten P300-Amplitude einher. Eine Ver­ minderung der Wirkung von Δ9-THC durch den synthetischen CB1-Anta­ gonisten SR 141716 lieferte schliess­ lich den ersten Nachweis beim Men­ schen, dass die psychomimetischen Effekte von Cannabis durch den CB1Rezeptor vermittelt werden [24]: 63 Männer, die an die Wirkung von Ma­ rijuana gewöhnt waren, erhielten ran­ domisiert verschiedene Dosierungen Cannabis und Schizophrenie: Neue Erkenntnisse in einer alten Debatte von SR 141716 oder alternativ ein Placebo. Zwei Stunden nach der Ap­ plikation rauchte jeder von ihnen eine Zigarette mit Δ9-THC oder alternativ eine Placebo-Zigarette. Die psycholo­ gischen und somatischen Effekte vor und nach Applikation der Substanzen wurden erfasst: SR141716 führte zu einer signifikanten dosisabhängigen Reduktion der Wirkungen von Δ9THC. Da die Konzentration von Δ9THC im venösen Blut nicht durch den Antagonisten beeinflusst wird, ist die Erklärung einer Rezeptorbesetzung durch SR141716 und der Verhinde­ rung einer Bindung von Δ9-THC an den CB1-Rezeptor plausibel. Aus der Zusammenschau der dies­ bezüglichen Veröffentlichungen schliesst Johns [28], dass Cannabis­ konsum bei psychisch Gesunden zu kurzzeitigen psychotischen Sym­ ptomen führen kann und dass bei an einer Schizophrenie erkrankten Pati­ enten Symptomverschlechterungen und Reexazerbationen auftreten. Die Frage, ob Cannabiskonsum einen Risikofaktor für die Entstehung von Schizophrenien darstellt, lässt sich allein durch die Beobachtung der akuten Wirkung von Cannabinoiden jedoch nicht beantworten. Langzeitwirkungen von Cannabis wurden in folgenden Tierversuchs­ studien untersucht: In einer austra­ lischen Arbeit wurde die wiederholte Applikation eines Cannabinoids bei Ratten unterschiedlicher Altersgrup­ pen (Neugeborene, Adoleszente und junge Erwachsene) beschrieben [36]. Es konnten anhaltende Defizite in der Objekterkennung sowie in der sozi­ alen Interaktion unabhängig vom Al­ ter der Tiere beobachtet werden. Die Effekte wurden 4 bis 6 Wochen ge­ messen nach der letzten Applikation gemessen, also nach einem Zeitraum, der nahezu der gesamten Jugendzeit einer Ratte entspricht. Eingeschränkte Objekterkennung und veränderte so­ ziale Interaktion sind jedoch keine psychotischen Symptome im engeren Sinne. Weitere Untersuchungen könnten daher von Nutzen sein. Eine andere Studie zeigte, dass chronische Behandlung mit Cannabinoiden bei Ratten in der Pubertät zu behavioralen und kognitiven Veränderungen führt, die bei erwachsenen Ratten nicht be­ obachtet werden konnten [44]. Kohortenstudien Aus der mit einer Kohorte schwe­ discher Rekruten durchgeführten „Study of Swedish conscripts“ ergab sich bereits vor mehr als 20 Jahren der Hinweis, dass Cannabiskonsum ein Risikofaktor für die Entwicklung ein­ er Schizophrenie sein kann [4]. Eine Kohorte von 45570 Schwe­dischen Rekruten wurde über 15 Jahre hinweg beobachtet. Für Probanden mit inten­ sivem Cannabiskonsum (mehr als fünfzigmal) ergab sich das gegenüber Personen ohne Cannabiskonsum sechsfach erhöhte Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken. Eine weitere Analyse der Daten aus der Schwedischen Rekrutenstudie über einen längeren Untersuchungszei­ traum von 27 Jahren hinweg ergab bei insgesamt 50087 untersuchten Personen eine Dosisabhängigkeit. Das Risiko nach Cannabisgebrauch eine Schizophrenie zu entwickeln, erhöhte sich vom 1.2-fachen bei ein­ maligen Konsum auf das 6.7-fache bei mehr als fünfzigmaligem Can­ nabiskonsum. Eine Untergruppe der untersuchten Kohorte wurde bez­ üglich des zeitlichen Verlaufs näher untersucht. Dabei zeigte sich, dass der Cannabiskonsum dem Auftreten psychotischer Symptome voranging. Die Autoren werten dies im Sinne einer kausalen Verknüpfung[52]. Seit der ersten Auswertung der Schwedischen Rekrutenstudie wur­ den aus sieben weiteren grossen Ko­ hortenstudien Erkenntnisse zum The­ ma veröffentlicht: Im Rahmen der ECA-Studie (Epidemiological Catch­ ment Area) aus den USA wurden die Beziehungen zwischen Alkohol- und Drogengebrauch und psychotischen Erfahrungen („psychotic experiences“) an 4994 Erwachsenen unter­ sucht. Es wurde festgestellt, dass für Personen, die Marijuana konsum­ 225 ieren, im Vergleich zu marijuana­ abstinenten Personen ein doppelt so hohes Risiko besteht, psychotische Symptome zu entwickeln [47]. In der niederländischen NEMESISStudie (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study), einer populationsbasierten Untersuchung mit einem Beobachtungszeitraum von drei Jahren, wurden 4045 Perso­ nen, die bei Beginn der Studie ohne psychotische Störung waren, und 59 Personen mit der Diagnose einer psychotischen Störung bei Studien­ beginn untersucht. Das Risiko zuvor psychosefreier Personen, an einer Psychose zu erkranken, wurde durch den Gebrauch von Cannabis erhöht. Das entsprechende Risiko betrug das 2.76-fache für solche Studienteilneh­ mer, die bereits bei Beginn der Unter­ suchung Cannabis konsumierten. Der Schweregrad psychotischer Symp­ tome in der NEMESIS Studie wurde ebenfalls durch Cannabiskonsum er­ höht (OR 24.17) [49]. In der EDSP-Studie (Early Develop­ mental Stages of Psychopathology) wurden 2437 deutsche Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren über vier Jahre hin­ weg untersucht. Es konnte eines Do­ sis-Wirkungs-Beziehung zwischen Cannabisgebrauch und psychotischer Symptomatik festgestellt werden. Cannabisgebrauch bei Studienbeginn erhöhte das Risiko um das 1,67fache, dass psychotische Symptome vier Jahre später auftraten. Bei denjenigen Studienteilnehmern, die bereits zu Beginn eine Prädisposition für eine Psychose aufwiesen zeigte sich ein deutlicherer Effekt des Cannabiskon­ sums. Die Prädispostion wurde mit Hilfe der Paranoia- und Psychotiz­ ismus-Subskalen in der Münchner Version des Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI)) untersucht und bei einem Ergebnis über der neunzigsten Perzentile als vorhanden angenommen. Umge­kehrt war die psychotische Prädisposi­ tion nicht signifikant prädiktiv für einen Cannabisgebrauch nach vier Jahren. Die Autoren kommen zu dem Kawohl, Rössler Schluss, dass Cannabisgebrauch das Risiko, psychotische Symptome zu entwickeln, moderat erhöht und dass bei Menschen mit psychotischer Prädisposition durch Cannabis­ konsum ein deutlich stärkeres Risiko, psychotische Symptome zu entwick­ eln, besteht [20]. In einem achtzehnmonatigen Fol­ low-up im Rahmen des National Psy­ chiatric Morbidity Surveys (NPMS) wurde in Grossbritannien eine repräsentative Stichprobe mit 8580 Personen zwischen 16 und 74 Jahren untersucht. Die Probanden wurden gebeten, eine Selbstauskunft über psychotische Symptome abzugeben. Probanden, bei denen eine Canna­ bisabhängigkeit festgestellt wurde, wiesen ein höheres Risiko auf, in der Folgeuntersuchung nach 18 Monaten psychotische Symptome zu entwick­ eln [50]. Über diese Studien hinaus liegen zwei Studien mit Geburtskohorten vor, die Dunedin- und die Christch­ urch-Studie (CHDS) aus Neuseeland. Im Rahmen der Dunedin-Studie wur­ den eine Geburtskohorte von 1037 Einwohner der Stadt Dunedin, die in den Jahren 1972 und 1973 geboren wurden, untersucht. Im Alter von elf Jahren wurde bei den Probanden die erste Untersuchung bzgl. psycho­ tischer Symptome durchgeführt, mit 15 und 18 Jahren wurden Informatio­ nen zum Drogenkonsum erhoben, im Alter von 26 Jahren wurde ein struk­ turiertes DSM-IV-Interview durchge­ führt. Die Studie zeichnet sich durch eine äusserst hohe Follow-up-Rate aus (96% im Alter von 26 Jahren) und ermöglichte, das Auftreten psycho­ tischer Symptome bereits im Kinde­ salter vor dem ersten Gebrauch von Cannabis zu beurteilen. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass auch ohne psychotische Symp­ tome vor dem Erstgebrauch von Can­ nabis die Wahrscheinlichkeit, bei Cannabisgebrauch an einer psycho­ tischen Störung zu erkranken, erhöht ist. Früher Gebrauch von Cannabis er­ wies sich diesbezüglich als besonders risikoreich: Teilnehmer, die bereits 226 mit 15 Jahren Cannabis konsum­ ierten, unterlagen mit 26 Jahren dem vierfachen Risiko im Vergleich zu Personen ohne Cannabiskonsum bzw. mit maximal zweimaligen Konsum überhaupt. Für andere Drogen waren diese Effekte nicht nachweisbar [5]. Die Christchurch-Studie ist als Langzeituntersuchung über 25 Jahre angelegt. Bei einer Gruppe von 1055 Personen einer unselektierten Ge­ burtskohorte von insgesamt 1265 Personen, die Mitte 1977 in der Neu­ seeländischen Stadt Christchurch geboren wurden, wurden im Alter von 18, 21 und 25 Jahren Daten über Cannabisgebrauch und psychotische Symptome erhoben. Die Rate psy­ chotischer Symptome war bei den Teilnehmern, die täglich Cannabis konsumieren, bis zum 1,8fachen er­ höht. Zur Klärung der kausalen Rich­ tung des Zusammenhangs zwischen Cannabisgebrauch und der Ausprä­ gung psychotischer Symptome wur­ den Strukturgleichungsmodelle zur Anwendung gebracht, mit deren Hilfe die Faktoren Cannabisgebrauch und Ausprägung psychotischer Symp­ tome sowie die zeitliche Änderung dieser Faktoren auf Zusammenhänge untersucht werden. Dabei ergab sich eine signifikante Beeinflussung der Symptomatik durch Cannabisge­ brauch, während umgekehrt kein Einfluss psychotischer Symptome auf den Cannabisgebrauch nachweis­ bar war [16]. In einer weiteren niederländischen Untersuchung wurden 1580 Kinder und Jugendliche über 14 Jahre hin insgesamt sechsmal untersucht. Die Auswahl der Kohorte erfolgte randomisiert und populationsbasi­ ert, die Teilnehmer waren bei Be­ gin zwischen vier und 16 Jahre alt. Gemessen wurden Cannabiskonsum und psychotische Symptome, wobei sich ein bidirektionaler Zusammen­ hang ergab: Die hier als „hazard ra­ tio“ angegebene Wahrscheinlichkeit für Cannabiskosumenten, psycho­ tische Symptome zu entwickeln, lag bei 2.81, umgekehrt betrug das Risiko eines Cannabiskonsum bei Menschen mit vorbestehenden psychotischen Symtomen 1.7 [15]. Genetische Assoziationsstudien In der Dunedin-Kohorte [9] konnte gezeigt werden, dass Träger des ValinAllels im Basenaustausch-Polymor­ phismus Val158Met des COMT-Gens im Vergleich zu heterozygoten oder Träger des Methionin-Allels einem zehnfach höheren Risiko unterliegen, bei Cannabisgebrauch an einer schiz­ ophreniformen Störung zu erkrank­ en. Dieser Zusammenhang bezieht sich auf einen Beginn des Cannabis­ gebrauchs vor dem 18. Lebensjahr. Das COMT-Gen codiert für das En­ zym Catechol-o-Methyltransferase (COMT). Das COMT-Enzym baut Catecholamine ab und ist involviert in die Inaktivierung synaptischen Do­ pamins [29]. In einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie konnte bestätigt werden, dass eine Assozia­ tion zwischen dem Val158Met-Poly­ morphismus und dem Einfluss von Δ9-THC auf vorbestehende psycho­ tische Symptome besteht [22]. Die höhere Aktivität des COMT-Enzyms bei Trägern der Val-Varianten dürfte zu einer verminderten frontalen und erhöhten mesolimbischen dopamin­ ergen Neurotransmission führen [32]. Letzteres ist mit einem erhöhten Ri­ siko verbunden, Wahn und Hallu­ zinationen zu entwickeln [2, 7]. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der beiden genannten Assoziationsstu­ dien konnte in einer weiteren Studie mit 838 Schizophreniepatienten kein Zusammenhang zwischen Cannabis­ gebrauch und dem Vorhandensein des Val-Allels nachgewiesen werden [53]. Cannabis und Schizophrenie: Neue Erkenntnisse in einer alten Debatte Metaanalysen Es existieren verschiedene Reviews, die jedoch wenig spezifisch der Frage nachgehen, ob das Risiko, an einer psychotischen Störung zu erkranken, durch den Gebrauch von Cannabis beeinflusst wird. Vielmehr wurde hier eher der Einfluss von Canna­ biskonsum auf psychosoziale Param­ eter näher untersucht [6, 13, 30, 45]. Das im vergangenen Jahr erschienene systematischen Review von Theresa Moore und Kollegen stellt insofern eine Ausnahme dar, als dass dort aus­ schliesslich Studien mit krankheits­ bezogenen Outcome-Parametern ein­ bezogen wurden [33]. In diese MetaAnalyse wurden 35 Kohortenstudien mit unterschiedlich langen Untersu­ chungszeiträumen eingeschlossen. Die Qualität der einzelnen Studien wurde unabhängig voneinander von zwei Wissenschaftlern bewertet, die Bewertungen wurden anschliessend abgeglichen; die Einflüsse konfundi­ erender Faktoren, von Intoxikationen und möglicher reverser Kausalität wurden bei der Beurteilung berück­ sichtigt. Aussschliesslich popula­ tionsbasierte Longitudinalstudien oder longitudinale Fall-Kontroll-Stu­ dien wurden in die Untersuchung ein­ geschlossen. Die zusammengefasste adjustierte OR beträgt 1.41, d.h., dass dass sich das Psychoserisiko bei Cannabiskonsumenten um circa 40% erhöht. Ausserdem gibt es einen ein­ deutigen Dosis-Risiko Zusammen­ hang. Die Autoren der Metaanalyse kommen zu dem Schluss, dass trotz des wahrscheinlich geringen indivi­ duellen Lebenszeitrisikos von un­ ter 3%, durch Cannabiskosum eine psychotische Störung zu entwickeln, eine substantielle Auswirkung von Cannabiskonsum auf die gesamte Bevölkerung zu erwarten sei, da die Substanz so weitverbreitet sei. Der Gebrauch von Cannabis erhöhe das Risiko, eine psychotische Störung zu entwickeln; es liege genug Evidenz vor, um eine entsprechende Warnung auszusprechen. In einer weiteren Metaanalyse sieben prospektiver Studien konnte eine OR von 2.1 ermittelt werden, auch hier wurde eine Kontrolle bzgl. konfun­ dierender Faktoren und reverser Kau­ salität durchgeführt [21]. Diskussion In der nicht emotionslos geführten Diskussion, ob Cannabisgebrauch die Entwicklung von psychotischen Störungen verursacht, nimmt die Ar­ beit von Theresa Moore eine heraus­ ragende Stellung ein: Aus der zusam­ menfassenden Untersuchung qualita­ tiv hochwertiger Kohortenanalysen lässt sich ableiten, dass das Risiko, eine Psychose zu entwickeln, für Menschen, die Cannabis konsumiert haben, um ca. 40% erhöht ist. Dosis­ abhängig erhöht sich dieses Risiko auf 50 bis 200% bei hochfrequentem Gebrauch. Die Arbeitsgruppe um Moore hat bei der Gewichtung der der Metaanalyse zugrundeliegenden Arbeiten die Wahrscheinlichkeit ein­ er reversen Kausalität berücksichtigt. Ebenfalls beachtet wurde die Dif­ ferenz zwischen rohen und adjusti­ erten ORs, also denjenigen aus den Originalstudien und denen, die be­ züglich der Wahrscheinlichkeit einer reversen Kausalität nach unten ange­ passt wurden. Insbesondere bei der Dunedin-Studie ist diese Differenz sehr gering, da die Kohorte bereits im Alter von elf Jahren bezüglich psychotischer Symptome beurteilt worden war. Durch die Berücksichtig­ tung dieser Zusammenhänge kommt den in der Mooreschen Metaanalyse errechneten prozentualen Risiken ein besonderes Gewicht zu. Die bei Auswertung der Daten aus der EDSP-Studie gemachte Beob­ achtung, dass eine Prädisposition für Psychosesymptome nicht prädik­ tiv für Cannabisgebrauch nach vier Jahren ist, spricht ebenfalls gegen den ausschliesslichen Zusammen­ hang einer Selbstmedikation [20], da sonst bei Personen mit dieser Prädis­ 227 position ein signifikant höherer Can­ nabisgebrauch zu erwarten wäre als ohne. Eine Selbstmedikation ist den­ noch nicht gänzlich auszuschliessen, die Gewichtung scheint aber eher in Richtung des Zusammenhangs von Cannabiskonsum hin zu Schizo­ phrenie verschoben, die in der Studie von Ferdinand et al. festgestellte Bi­ direktionalität beinhaltet ein höheres Risiko für Cannabiskonsumenten, psychotische Symptome zu entwick­ eln als umgekehrt. Auch in dieser Ar­ beit wird daher die Empfehlung aus­ gesprochen, präventive Massnahmen zum Schutz Heranwachsender vor Cannabiskonsum zu ergreifen. Beim ursächlichen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und En­ twicklung einer Schizophrenie ist anzunehmen, dass der Cannabiskon­ sum eine Teilursache darstellt: Im Kausalitätsmodell nach Rothmann werden drei verschiedene Formen der Ursachen unterschieden, nämlich die hinreichende (Krankheits-)Ur­ sache (sufficient cause), die notwen­ dige Ursache (neccesary cause) und die Teilursache (component cause) [43]. Die Teilursache ist dabei zwar Bestandteil einer hinreichenden Krankheitsursache, reicht allein aber nicht zur Entwicklung der Krankheit aus, sondern trägt nur dazu bei. Die Tatsache, dass Schizophrenien auch ohne den Einfluss eines Canna­ biskonsums auftreten, spricht gegen Cannabiskonsum als notwendige Ur­ sache (also als Ursache, ohne die die Krankheit nicht ausgebrochen wäre). Die umgekehrte Tatsache, dass nicht alle Cannabiskonsumenten eine Schizophrenie entwickeln, spricht wiederum gegen Cannabiskonsum als hinreichende Krankheitsursache. Während bzgl. der Frage, ob Can­ nabiskonsum einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Schizophrenie darstellt, eine bejahende Position an Gewicht gewinnt, herrscht weiter Unklarheit, welche Mechanismen dem zugrunde liegen. Allein du­ rch die Identifikation eines Risiko­ faktors ist der Mechanismus des gezeigten Zusammenhangs jedoch Kawohl, Rössler nicht ge­klärt. Die Aufklärung der pathophysiologischen Verknüpfung sollte ebenfalls weiter vorangetrieben werden [51]. Weitere Tierversuchss­ tudien sowie prospektive Untersu­ chungen beim Menschen und auch Assoziationsstudien können dabei zum Er­kenntnisgewinn beitragen, wobei auch hier je nach verwenderter Methodik heterogene Ergebnisse zu erwarten sind: Beispielsweise hatte in der Arbeit von Zammit und Kol­ legen [53] der aus anderen Assozia­ tionsstudien [9, 22] beschriebene Zusammenhang zwischen Cannabis­ gebrauch, Schizophrenie und COMTVarianten nicht bestätigt werden können. Die Autoren dieser Studie merken jedoch an, dass dies nicht gegen eine Gen-Umwelt-Interaktion spricht, wie sie in der Dunedin-Stud­ ie gezeigt werden konnte. Der Quer­ schnittscharakter der Untersuchung stelle ebenfalls eine Limitation dar, auch war die Herangehensweise un­ terschiedlich, da die Zammit-Studie als Fall-Kontroll-Studie konzipiert war und nicht eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe untersucht worden war. Insgesamt ist es jedoch unwahrscheinlich, dass es sich um eine Interaktion des Cannabiskonsum zum einem einzelnen Gen handelt [18]. Die bestehenden Hypothesen bzgl. neurodegenerativer Zusammen­ hänge [43], direktem Einfluss auf die dopaminerge Transmission (s.o.) und dopaminerger Sensibilisierung [20] bedürfen weiterer Untersuchung mit dem Ziel, sozusagen die einzel­ nen Puzzleteile zusammenzusetzen. Ungeachtet der nicht vollständig ge­ klärten und möglicherweise in abseh­ barer Zeit auch nicht völlig klärbaren pathophysiologischen Zusammen­ hänge sollte eine dezidierte Warnung ausgesprochen werden, um weiteren Schaden durch Cannabiskonsum ab­ zuwenden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf der epidemiologisch und tierexperimentell gezeigte beson­ dere Vulnerabilität Heranwachsender liegen. Zusammenfassend kann gesagt wer­ den, dass das Risiko, psychotische 228 Symptome und auch eine Schizo­ phrenie zu entwickeln, für junge Menschen durch Cannabiskonsum deutlich erhöht wird, dass der Canna­ biskonsum dabei als Teilursache an­ gesehen werden kann und dass eine Dosisabhängigkeit besteht. Eine In­ formation der breiten Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge ist an­ gezeigt, um in Zeiten einer Lockerung des Umgangs mit Cannabis eine Zu­ nahme der Inzidenz psychotischer Störungen durch Cannabiskonsum zu verhindern. Fachleute und nicht zuletzt der Gesetzgeber sollten sich dieser Verantwortung bewusst sein. Literatur [1] Ajdacic-Gross V., Lauber C., Warnke I., Haker H., Murray R.M., Rossler W.: Changing incidence of psychotic disor­ ders among the young in Zurich. Schizo­ phr Res 95, 9-18 (2007). [2] Akil M., Kolachana B.S., Rothmond D.A., Hyde T.M., Weinberger D.R., Kleinman J.E.: Catechol-O-methyltrans­ ferase geno­­type and dopamine regula­ tion in the human brain. J Neurosci 23, 2008-2013 (2003). [3] Ames F.R.: A clinical and metabolic study of acute intoxication with Cannabis sati­ va and its role in the model psychoses. J Mental Sci 104, 972-999 (1958). [4] Andreasson S., Allebeck P., Engstrom A., Rydberg U.: Cannabis and schizo­ phrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet 2, 1483-1486 (1987). [5] Arseneault L., Cannon M., Poulton R., Murray R., Caspi A., Moffitt T.E.: Can­ nabis use in adolescence and risk for adult psychosis: longitudinal prospec­ tive study. Bmj 325, 1212-1213. (2002). [6] Arseneault L., Cannon M., Witton J., Murray R.M.: Causal association be­ tween cannabis and psychosis: examina­ tion of the evidence. Br J Psychiatry 184, 110-117 (2004). [7] Bilder R.M., Volavka J., Lachman H.M., Grace A.A.: The catechol-O-methyl­ transferase polymorphism: relations to the tonic-phasic dopamine hypothesis and neuropsychiatric phenotypes. Neu­ ropsychopharmacology 29, 1943-1961 (2004). [8] Bortolato M., Aru G.N., Frau R., Orru M., Luckey G.C., Boi G., Gessa G.L.: The CB receptor agonist WIN 55,212-2 fails to elicit disruption of prepulse inhi­ bition of the startle in Sprague-Dawley rats. Psychopharmacology (Berl) 177, 264-271 (2005). [9] Caspi A., Moffitt T.E., Cannon M., McClay J., Murray R., Harrington H., Taylor A., Arseneault L., Williams B., Braithwaite A., Poulton R., Craig I.W.: Moderation of the effect of adolescentonset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X envi­ ronment interaction. Biol Psychiatry 57, 1117-1127 (2005). [10] Cheer J.F., Wassum K.M., Heien M.L., Phillips P.E., Wightman R.M.: Cannabi­ noids enhance subsecond dopamine re­ lease in the nucleus accumbens of awake rats. J Neurosci 24, 4393-4400 (2004). [11] Chen J., Marmur R., Pulles A., Paredes W., Gardner E.L.: Ventral tegmental microinjection of delta 9-tetrahydrocan­ nabinol enhances ventral tegmental so­ matodendritic dopamine levels but not forebrain dopamine levels: evidence for local neural action by marijuana's psy­ choactive ingredient. Brain Res 621, 6570 (1993). [12] Dean B., Sundram S., Bradbury R., Scarr E., Copolov D.: Studies on [3H]CP55940 binding in the human central nerv­ ous system: regional specific changes in density of cannabinoid-1 receptors asso­ ciated with schizophrenia and cannabis use. Neuroscience 103, 9-15 (2001). [13] Degenhardt L., Hall W., Lynskey M.: Exploring the association between can­ nabis use and depression. Addiction 98, 1493-1504 (2003). [14] Egertova M., Giang D.K., Cravatt B.F., Elphick M.R.: A new perspective on can­ nabinoid signalling: complementary lo­ calization of fatty acid amide hydrolase and the CB1 receptor in rat brain. Proc Biol Sci 265, 2081-2085 (1998). [15] Ferdinand R.F., Sondeijker F., van der Ende J., Selten J.P., Huizink A., Verhulst F.C.: Cannabis use predicts future psy­ chotic symptoms, and vice versa. Addic­ tion 100, 612-618 (2005). [16] Fergusson D.M., Horwood L.J., Ridder E.M.: Tests of causal linkages between cannabis use and psychotic symptoms. Addiction 100, 354-366 (2005). [17] Gorriti M.A., Rodriguez de Fonseca F., Navarro M., Palomo T.: Chronic (-)delta9-tetrahydrocannabinol treatment induces sensitization to the psychomo­ tor effects of amphetamine in rats. Eur J Pharmacol 365, 133-142 (1999). [18] Hall W., Degenhardt L.: Cannabis use and the risk of developing a psychotic disorder. World Psychiatry 7, 68-71 (2008). [19] Hambrecht M., Hafner H.: Substance abuse and the onset of schizophrenia. Biol Psychiatry 40, 1155-1163 (1996). [20] Henquet C., Krabbendam L., Spauwen J., Kaplan C., Lieb R., Wittchen H.U., van Os J.: Prospective cohort study of cannabis use, predisposition for psycho­ sis, and psychotic symptoms in young people. Bmj 330, 11 (2005). Cannabis und Schizophrenie: Neue Erkenntnisse in einer alten Debatte [21] Henquet C., Murray R., Linszen D., van Os J.: The environment and schizophre­ nia: the role of cannabis use. Schizophr Bull 31, 608-612 (2005). [22] Henquet C., Rosa A., Krabbendam L., Papiol S., Fananas L., Drukker M., Ramaekers J.G., van Os J.: An experi­ mental study of catechol-o-methyltrans­ ferase Val158Met moderation of delta-9tetrahydrocannabinol-induced effects on psychosis and cognition. Neuropsychop­ harmacology 31, 2748-2757 (2006). [23] Herkenham M., Lynn A.B., Little M.D., Johnson M.R., Melvin L.S., de Costa B.R., Rice K.C.: Cannabinoid receptor localization in brain. Proc Natl Acad Sci U S A 87, 1932-1936 (1990). [24] Huestis M.A., Gorelick D.A., Heishman S.J., Preston K.L., Nelson R.A., Moolchan E.T., Frank R.A.: Blockade of ef­ fects of smoked marijuana by the CB1selective cannabinoid receptor antago­ nist SR141716. Arch Gen Psychiatry 58, 322-328 (2001). [25] Isbell H., Gorodetzsky C.W., Jasinski D., Claussen U., von Spulak F., Korte F.: Ef­ fects of (--)delta-9-trans-tetrahydrocan­ nabinol in man. Psychopharmacologia 11, 184-188 (1967). [26] Iversen L.: How cannabis works in the brain. In: D. Castle and R. Murrays: Marijuana and Madness. Cambridge University Press, Cambridge 2004 [27] Johns A.: Psychiatric effects of cannabis. Br J Psychiatry 178, 116-122 (2001). [28] Johns A.: Psychiatric effects of cannabis. Br J Psychiatry 178, 116-122. (2001). [29] Juckel G., Kawohl W., Giegling I., Mavrogiorgou P., Winter C., Pogarell O., Mulert C., Hegerl U., Rujescu D.: Asso­ ciation of catechol-O-methyltransferase variants with loudness dependence of auditory evoked potentials. Hum Psy­ chopharmacol 23, 115-120 (2008). [30] Macleod J., Oakes R., Copello A., Crome I., Egger M., Hickman M., Oppenkowski T., Stokes-Lampard H., Davey Smith G.: Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people: a systematic review of longitudinal, general population studies. Lancet 363, 1579-1588 (2004). [31] Mechoulam R., Gaoni Y.: A Total Syn­ thesis of Dl-Delta-1-Tetrahydrocannabi­ nol, the Active Constituent of Hashish. J Am Chem Soc 87, 3273-3275 (1965). [32] Meyer-Lindenberg A., Kohn P.D., Kolachana B., Kippenhan S., McInerneyLeo A., Nussbaum R., Weinberger D.R., Berman K.F.: Midbrain dopamine and prefrontal function in humans: interac­ tion and modulation by COMT geno­ type. Nat Neurosci 8, 594-596 (2005). [33] Moore T.H., Zammit S., Lingford-Hughes A., Barnes T.R., Jones P.B., Burke M., Lewis G.: Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health out­ comes: a systematic review. Lancet 370, 319-328 (2007). [34] Munro S., Thomas K.L., Abu-Shaar M.: Molecular characterization of a periph­ eral receptor for cannabinoids. Nature 365, 61-65 (1993). [35] Murray R.M., Morrison P.D., Henquet C., Di Forti M.: Cannabis, the mind and society: the hash realities. Nat Rev Neu­ rosci 8, 885-895 (2007). [36] O'Shea M., McGregor I.S., Mallet P.E.: Repeated cannabinoid exposure during perinatal, adolescent or early adult ages produces similar longlasting deficits in object recognition and reduced social in­ teraction in rats. J Psychopharmacol 20, 611-621 (2006). [37] Parnefjord R.: Das Drogentaschenbuch. Thieme, Stuttgart, New York (2000) [38] Pistis M., Ferraro L., Pira L., Flore G., Tanganelli S., Gessa G.L., Devoto P.: Delta(9)-tetrahydrocannabinol decreases extracellular GABA and increases extra­ cellular glutamate and dopamine levels in the rat prefrontal cortex: an in vivo microdialysis study. Brain Res 948, 155158 (2002). [39] Rätsch C.: Enzyklopädie der psychoak­ tiven Pflanzen: Botanik, Ethnopharma­ kologie und Anwendungen. AT Verlag, Aarau 2004 [40] Rodriguez de Fonseca F., Del Arco I., Bermudez-Silva F.J., Bilbao A., Cippitelli A., Navarro M.: The endocannabi­ noid system: physiology and pharmaco­ logy. Alcohol Alcohol 40, 2-14 (2005). [41] Roser P., Juckel G., Rentzsch J., Nadulski T., Gallinat J., Stadelmann A.M.: Effects of acute oral Delta(9)-tetrahy­ drocannabinol and standardized canna­ bis extract on the auditory P300 eventrelated potential in healthy volunteers. Eur Neuropsychopharmacol 18, 569-577 (2008). [42] Roser P., Vollenweider F.X., Kawohl W.: Potential antipsychotic properties of central cannabinoid (CB1) receptor antagonists. World Journal of Biological Psychiatry epub ahead of print, 10.1080/ 15622970801908047 (2008). [43] Rothman K.J.: Interactions between causes. In: Modern Epidemiology. Lit­ tle, Brown and Co., Boston 1986 [44] Schneider M., Koch M.: Chronic puber­ tal, but not adult chronic cannabinoid treatment impairs sensorimotor gating, recognition memory, and the perform­ ance in a progressive ratio task in adult rats. Neuropsychopharmacology 28, 1760-1769 (2003). [45] Semple D.M., McIntosh A.M., Lawrie S.M.: Cannabis as a risk factor for psy­ chosis: systematic review. J Psychophar­ macol 19, 187-194 (2005). [46] Sundram S., Copolov D., Dean B.: Cloz­ apine decreases [3H] CP 55940 binding to the cannabinoid 1 receptor in the rat nucleus accumbens. Naunyn Schmiede­ bergs Arch Pharmacol 371, 428-433 (2005). 229 [47] Tien A.Y., Anthony J.C.: Epidemiologi­ cal analysis of alcohol and drug use as risk factors for psychotic experiences. J Nerv Ment Dis 178, 473-480 (1990). [48] Uslaner J.M., Norton C.S., Watson S.J., Akil H., Robinson T.E.: Amphetamineinduced c-fos mRNA expression in the caudate-putamen and subthalamic nucleus: interactions between dose, en­ vironment, and neuronal phenotype. J Neurochem 85, 105-114 (2003). [49] van Os J., Bak M., Hanssen M., Bijl R.V., de Graaf R., Verdoux H.: Cannabis use and psychosis: a longitudinal popula­ tion-based study. Am J Epidemiol 156, 319-327 (2002). [50] Wiles N.J., Zammit S., Bebbington P., Singleton N., Meltzer H., Lewis G.: Self-reported psychotic symptoms in the general population: results from the lon­ gitudinal study of the British National Psychiatric Morbidity Survey. Br J Psy­ chiatry 188, 519-526 (2006). [51] Witton J., Murray R.M.: [Reefer mad­ ness revisited: cannabis and psychosis]. Rev Bras Psiquiatr 26, 2-3 (2004). [52] Zammit S., Allebeck P., Andreasson S., Lundberg I., Lewis G.: Self reported cannabis use as a risk factor for schizo­ phrenia in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study. Bmj 325, 1199 (2002). [53] Zammit S., Spurlock G., Williams H., Norton N., Williams N., O'Donovan M.C., Owen M.J.: Genotype effects of CHRNA7, CNR1 and COMT in schizo­ phrenia: interactions with tobacco and cannabis use. Br J Psychiatry 191, 402407 (2007). [54] Zuardi A.W., Crippa J.A., Hallak J.E., Moreira F.A., Guimaraes F.S.: Can­ nabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug. Braz J Med Biol Res 39, 421-429 (2006). Dr. med. Wolfram Kawohl Klinik für Soziale Psychiatrie und Allgemein­ psychiatrie ZH West Psychiatrische Universitätsklinik Zürich [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 230–242 Psychiatrische Versorgung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen – Ausblick* Ullrich Meise1,2, Johannes Wancata3 und Hartmann Hinterhuber1,2 Universitätsklinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Department für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck 2 Gesellschaft für Psychische Gesundheit – pro mente Tirol, Innsbruck 3 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien 1 * Diese Arbeit erschien in einer gekürzten Fassung im „Österreichischen Schizophreniebericht“ der Österreichischen Schizophrenie Gesellschaft Schlüsselwörter: Psychiatrische Versorgung – Psychiatriereform – Psychiatriegeschichte – Österreich Keywords Psychiatric care – reform of psychiatry – history of psychiatry – Austria Psychiatrische Versorgung in Öster­ reich: Rückblick – Entwicklungen – Ausblick Die frühe Phase der Psychiatriereform, die in Österreich gegen Ende 1970 einsetzte, war von der Enthospitalisierung und den Prinzipien der Gemeindepsychiatrie geprägt. Im stationären Bereich konnten etwa 60% der Betten abgebaut werden; die 10 psychiatrischen Krankenhäuser wurden verkleinert; eines davon geschlossen und psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäu© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 sern eingerichtet. Die Anzahl der Aufnahmen ist dramatisch gestiegen und immer noch wird ein erheblicher Prozentsatz von Patienten mit psychiatrischer Haupt­diagnose an nichtpsychiatrischen Krankenhausabteilungen behan­delt. Im ambulanten Bereich verfügen etwa 20% der psychiatrischen Ordinationen über einen §2-Kassenvertrag. Psychotherapeuten stehen in größerem Umfang als Psychiater zur Verfügung. Zumeist durch NGO`s organisiert hat sich ein schwer überblickbares Netz von gemeindenahen sozialpsychiatrischen Einrichtungen und Diensten für die soziale und berufliche Rehabilitation psychisch Kranker mit komplexem Versorgungsbedarf entwickelt. Sie bieten Hilfen in den Bereichen „Psychosoziale Dienste“, „Wohnen“, „Tagesgestaltung“ und „ Arbeit“ an. Neben strukturellen Schwächen wie z. B. der auch durch zunehmende Spezialisierung geförderte Fragmentierung oder der Unterversorgung ländlicher Regionen, liegt für die Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung das größte Hindernis in der unzureichenden Koordination und Kooperation. Dies erschwert eine integrierte Versorgung, in der alle Komponenten des Systems zusammenwirken sollen. Dadurch wird die Umsetzung des personenbezogenen Behandlungsansatzes, bei dem es sich um einen weiteren Reformschritt handeln würde, erschwert. Das Fehlen österreichweit einheitlicher und verbindlicher Regelungen hatte eine Zersplitterung der Finanzierung und Zuständigkeit für das Versorgungssystem zur Folge. Damit eine integrierte Versorgung möglich wird, ist eine Koordination und Kooperation der Leistungsanbieter erforderlich. Dasselbe gilt jedoch auch für Kostenträger sowie für die politisch und administrativ Verantwortlichen. Mental health care in Austria: His­ tory – developments – perspectives The reform of psychiatric services in Austria started during the second half of the seventies of the 20th century. During the early phase the reform focussed on dehospitalization and principles of community psychiatry. About 60% of psychiatric hospital beds were closed and the size of psychiatric hospitals was reduced. One of the psychiatric hospitals was closed and psychiatric departments were opened as part of district general hospitals. During this time the number of psychiatric hospital admissions increased markedly and a large proportion of mentally ill are treated as inpatients in non-psychiatric wards. Only about a fifth of selfemployed psychiatrists working in their own office have a contract with Psychiatrische Versorung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen –Ausblick health insurances. In Austria, the number of psychotherapists is much higher than the number of psychiatrist. A variety of different types of community services provide social and vocational rehabilitation, focussing on consultation, housing, daily structure and employment. Psychiatric services are nowadays fragmented into a number of sub-disciplines such as psychosomatics or child and adolescent psychiatry. This fragmentation and the missing coordination of psychiatric services hamper the enhancements of psychiatric care. This complicates the development of integrated services, i.e. the structured and planned cooperation of the different types of services. Since there are no binding rules for the organisation and planning in entire Austria, financing and organisation of services is fragmented. For establishing an integrated health care, coordination and cooperation between providers, sponsors of health care as well as policy makers are essential. Die psychische Gesundheit wird, wie in der Lissabon-Strategie der EU aus dem Jahre 2000 ausgeführt, für das Wachstum, die Produktivität und den sozialen Zusammenhalt in Europa als wesentlich erachtet. Psychische Erkrankungen werden von der Politik zunehmend als ein schwerwiegendes Problem erkannt, welches nicht nur für das Gesundheits- sondern auch für das Sozial- und Justizsystem von Bedeutung ist und sich insgesamt auf die Volkswirtschaft auswirkt. So werden nach einer vorsichtigen Schätzung die durch psychische Erkrankungen verursachten Kosten mit jährlich 3 bis 4% des BIP angegeben, wobei die meisten Kosten, nämlich 65%, außerhalb des Gesundheitswesens, insbesonders durch Fehlzeiten am Arbeitsplatz, Arbeitsunfähigkeit und Invaliditätspensionierung entstehen [25,61,62,65]. 2005 wurde in der „Europäischen Ministeriellen WHO-Konferenz für Psychische Gesundheit“, die in Helsinki stattfand, detailliert die Notwendigkeit aufgezeigt, dass die psychische Gesundheitsversorgung in den EU-Mitgliedsstaaten verbessert werden müsste. Diese Konferenz stand unter dem griffigen Motto "Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen". Sie bot der WHO und der Europäischen Gemeinschaft die Gelegenheit, das aktuelle Wissen und die Erfahrungen im Bereich der psychischen Gesundheit darzustellen, indem sie die über die gesamte Europäische Region der WHO verstreuten Lernprozesse zusammenführte [70]. Anlässlich dieser Konferenz sollten: • psychische Störungen und die Konzepte zu ihrer Bewältigung in der EU einer Bestandsaufnahme unterzogen werden, • Hindernisse identifiziert werden, die der Gemeindenähe bei der Förderung von psychischer Gesundheit und der Prävention sowie Behandlung von psychischen Erkrankungen entgegenwirken, • auf Grundlage von Evidenz Lösungen vorgeschlagen werden, die in nachhaltige Konzepte umgesetzt werden können und • ein Aktionsplan mit Grundsatzempfehlungen für alle Mitgliedsstaaten der EU und der WHO erstellt werden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 231 Am Ende der Konferenz wurden die „Europäische Erklärung zur Psychischen Gesundheit“ und ein daran angeschlossener Aktionsplan, in dem 12 Prioritäten (Tabelle 1) formuliert wurden, verfasst. Dieser Erklärung hat sich auch Österreich angeschlossen. Seit Ende der 70ger Jahre des vergangen Jahrhunderts setzte auch in Österreich die Psychiatriereform ein. Der Begriff „Community Psychiatry“ wurde bereits in den angelsächsischen Ländern etwa 20 Jahre früher geprägt. Community Psychiatry wurde durch ihre Inhalte definiert und man verstand darunter: „Psychiatry focussing on detection, prevention, early treatment and rehabilitation of emotional and behavioural disorders as they develop in a community“. Die Definition von Gemeindepsychiatrie stellte in den deutschsprachigen Ländern hingegen weniger inhaltliche Visionen sondern vorzüglich strukturelle und organisatorische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt, wobei eine neue dezentrale Organisationsform der psychiatrischen und psychosozialen Behandlung in den Mittelpunkt gestellt wurde. In einem Gemeindeverbund sollten dabei stationäre, ambulante und komplementäre/rehabilitative Einrichtungen und psychisches Wohlbefinden fördern die zentrale Position der psychischen Gesundheit aufzeigen gegen Stigma und Diskriminierung vorgehen geeignete Angebote für vulnerable Lebensphasen fördern psychische Gesundheitsprobleme und Suizid verhüten eine gute Primärversorgung für psychische Gesundheitsprobleme sichern Menschen mit schweren psychischen Gesundheitsproblemen durch gemeindenahe Dienste wirksam versorgen Partnerschaften über Sektoren hinweg errichten ein ausreichendes und kompetentes Angebot an Fachkräften schaffen verlässliche Informationen über die psychische Gesundheit der Be­ völkerung sichern eine faire und angemessene Finanzierung bereitstellen Evaluierung und Forschung fördern Tabelle 1:Die 12 Prioritäten für die psychische Gesundheit: Ministerielle EU Konferenz, Helsinki 12.-15.1.05 Meise, Wancata, Hinterhuber Dienste organisatorisch zusammengefasst und koordiniert werden. Auch in Österreich wurden – angeregt durch die Entwicklungen in Italien [22] und durch die Deutsche Psychiatrieenquete von 1975 – als zentrale Forderung die Umsetzung von gesellschafts- und gesundheits­ politischen Zielen, wie die Gleich­ stellung psychisch mit körperlich Kranken, die Enthospitalisierung, die Gemeindenähe der Behandlung, den Abbau von Betten in den psychiatrischen Krankenhäusern, die Schaffung von komplemen­ tären und rehabilitativen Einrich­ tun­gen oder den Aufbau von psy­ chia­trischen Abteilungen an Allge­ meinkrankenhäusern etc. formuliert. Obwohl Österreich – wie auch 30% der Staaten der Europaregion der WHO – über keine nationale Politik für psychische Gesundheit verfügt, wurde bis heute die psychiatrische Gesundheitsversorgung erheblich verändert und verbessert. Auf Grund­ lage weitgehend ähnlicher versorgungspolitischer Leitlinien wurde in allen Bundesländern die so genannte kustodiale (auf das psychiatrische Krankenhaus zentrierte) Versorgung von der Entwicklung zur Gemeindepsychiatrie abgelöst [26]. Die frühe Reformphase galt in erster Linie den psychiatrischen Langzeitpatienten. Sie zielte auf deren Enthospitalisierung und gemeindenahen Versorgung ab; d.h., dass Betroffene die erforderlichen psychiatrischen Hilfen in Anspruch nehmen können, ohne dafür ihren gewohnten Lebenskontext verlassen zu müssen. In der Folge kam es zum Aufbau einer Vielzahl von Einrichtungen und Diensten zur ambulanten Behandlung und Rehabilitation aber auch um die Bedürfnisse chronisch Kranker nach Tagesstruktur-, Wohn- und Arbeitsbereichen abzudecken. Die Vorstellungen zur Versorgung orientierten sich an der so genannten „Versorgungskette“. Dabei handelte es sich um ein etwas mechanistisch anmutendes Konzept: Psy- 232 chisch Kranke sollten dabei durch die Nutzung eines abgestuften Systems von Einrichtungen – wie durch das Ersteigen einer Sprossenleiter – rehabilitiert werden. Dies führte in der Realität zu einer Fragmentierung des Systems, die von Unter-, Fehl- oder Überbetreuung gekennzeichnet war. In einem nächsten Reformschritt fand ein Umdenken statt, das von der einrichtungsbezogenen Planung abging und diese durch einen funktionalen Planungsansatz ersetzte. Dies führte weg vom institutionsorientierten Baukastendenken und stellte den personenorientierten Ansatz in den Mittelpunkt. Es sollte flexibel auf die individuellen Behandlungs- und Betreuungsbedürfnisse der Betroffenen eingegangen werden, wofür verschiedene Funktionsbereiche definiert wurden, die für eine umfassende Betreuung erforderlich sind. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass für das Entstehen einer psychischen Behinderung die Interaktion mit der Umwelt, also der Umfang und die Art der Ressourcen, die zur Verfügung stehen, berücksichtigt werden müssen, kam es zu einem dritten Reformschritt. Unter Begriffen wie „Empowerment“ oder „Recovery“ wurde ein Paradigmenwechsel angeregt, der nicht nur für die Psychiatrie Gültigkeit hat [60]. Sein Fokus richtet sich unter anderem auf die einer Person verfügbaren Ressourcen, die Förderung von Widerstandsfaktoren, auf die Mitbestimmung und Verantwortungsübernahme von PatientInnen, auf eine therapeutische Allianz oder auf Genesung und aktive Umgestaltung bei zu Behinderung führenden Erkrankungen. Grundlage für den vorliegenden Versuch einer Ist-Zustandsbeschreibung sind die Publikationen, die anlässlich der Tagungen „Die Versorgung psychisch Kranker in Österreich - Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven“ [34] sowie „Gemeindepsychiatrie in Österreich: eine gemeindenahe Versorgung braucht die Gemeinde, die sich sorgt“ [35] veröffentlicht wurden. Darüber hinaus wurden der „Wahrnehmungsbericht des österreichischen Rechnungshofes“ (19951996 [44], die vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebenen Psychiatrieberichte [26,28]sowie ausgewählte Publikationen zur Versorgungsforschung [41,42] herangezogen. Zuvor jedoch ein kurzer Blick auf die Geschichte der österreichischen Psychiatriereform. Die Psychiatriereform in Öster­reich – eine Chronologie 1971 wurde von der WHO im Rahmen einer Arbeitstagung zur psychiatrischen Versorgung die Einführung eines regionalisierten psychiatrischen Versorgungssystems empfohlen. 1973 veranstaltete die Österreichische Gesellschaft für Psychische Hygiene die Tagung „Psychiatrie in Österreich“ und setzte damit Impulse für eine Psychiatriereform in mehreren österreichischen Bundesländern. 1975 wurde von der Bundesministerin für Gesundheit Dr. Leodolter der Beirat für Psychische Hygiene einberufen. Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Hans Strotzka wurden wichtige Vorarbeiten zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung geleistet. !979 wurde der Zielplan für die psychiatrische und psychosoziale Versorgung von Wien publiziert [68]. 1986 setzte die Gesellschaft österreichischer Nervenärzte und Psychiater die Arbeitsgruppe Psychiatrische Versorgung ein, deren Stellungnahme 1986 - also vor mehr als 20 Jahren als „van Swieten Memorandum zur psychiatrischen Versorgung“ präsentiert wurde [13]. 1990 wurden anlässlich der Innsbru- Psychiatrische Versorung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen –Ausblick cker Tagung „Die Versorgung psychisch Kranker in Österreich - Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven“ [13] diese Richtlinien einem qualifizierten Gremium vorgestellt. Gleichzeitig wurde den politisch Verantwortlichen von den Teilnehmern und Referenten dieser Tagung eine Resolution zur Kenntnis gebracht [71]. In dieser wurden das Recht psychisch Kranker auf eine fachgerechte psychiatrische Behandlung, auf psychiatrisch und psychosoziale Rehabilitation sowie psychosoziale Betreuung, wie sie in den Richtlinien für die psychiatrische Versorgung formuliert wurden, gefordert und erneut angeregt, diese in einem Bundesgesetz zu verankern. Als Reaktion auf diese Resolution hat der damalige Bundesminister für Gesundheit Ing. Harald Ettel eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese begann unter der Leitung durch Prof. Gustav Hofmann ein ausdifferenziertes Konzept für „eine bedürfnisgerechte psychiatrische Versorgung“ zu erarbeiten. 1991 traten für die psychiatrische Versorgung wichtige Gesetze, wie das Unterbringungsgesetz (UbG) sowie das Psychotherapiegesetz in Kraft. 1992 wurde dann dieses aus fünf Teilen bestehende Konzept, das neben einer Funktionsbeschreibung der für die psychiatrisch/psychosoziale Versorgung erforderlichen Dienstleistungen auch rechtliche und Finanzierungsfragen sowie einen Entwurf einer Vereinbarung zur Sicherstellung einer bedürfnisgerechten psychiatrischen Versorgung beinhaltete, verabschiedet und publiziert. Es wurde als Durchführungsmöglichkeit der Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG aufgezeigt. Da gerade wegen der vielfältigen, in unterschiedlichen Materien geregelten, gesetzlichen Bestimmungen, der verschiedenartigen Kostenträger und der unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen bis dato eine österreichweite Umsetzung von fachlich begründeten Erkenntnissen nicht möglich war, erschien den Autoren, diese systemischen Anforderungen in einer Art.15a B-VG Vereinbarung festzuschreiben, ein gangbaren Weg zu sein. 1993 wurde für Tirol ein Reformplan für die psychiatrische Versorgung publiziert, der 1995 seitens der Tiroler Landesregierung zur Umsetzung empfohlen wurde.[36]. Ihm folgten, in Ermangelung einer nationalen Psychiatriepolitik, weitere Pläne für die meisten Bundesländer nach. 1994 forderten, nachdem eine inhaltliche Behandlung der 1992 veröffentlichten Empfehlungen verzögert wurde, die Angehörigenvereinigungen (HPE) und der Dachverband der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit, dass die Umsetzung dieser Empfehlungen beschleunigt würde. Bundesministerin Dr. Christa Krammer vertrat jedoch die Auffassung, dass es auf Grund der gegebenen Kompetenzsituation an den Ländern läge, die entsprechenden Initiativen zur Umsetzung der Empfehlungen zu setzen. 1994 wurde im Österreichischen Krankenanstaltenplan (ÖKAP), der vom Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheit (ÖBIG) erstellt wurde, ein Konzept zur allgemeinen stationären psychiatrischen Versorgung aufgenommen, das sich auf Sonderkrankenanstalten wie auch auf Fachabteilungen für Psychiatrie an Allgemeinkrankenhäusern bezog. Dazu wurde das gesamte Bundesgebiet in Versorgungsregionen eingeteilt und der Bedarf an akutpsychiatrischen Betten in jeder Region festgelegt. In diesem Plan waren allerdings jene Versorgungseinrichtungen, die außerhalb von Krankenanstalten liegen sowie stationäre Einrichtungen, die nicht der Akutversorgung zuzurechnen sind, wie Pflegeanstalten für chronisch Kranke und Betreuungseinrichtungen für psychisch kranke 233 Straftäter, nicht Gegenstand dieser Planung. 1995 bis 1996 wurde die psychiatrische Versorgung vom Österreichischen Rechnungshof überprüft [44]. Das Prüfungsergebnis wurde in Form eines „Wahrnehmungsberichtes“ publiziert. Obwohl die ambulante wie auch die komplementären Versorgungsebenen mit in die Überlegungen und Bewertungen einbezogen wurden, beschränkte sich diese Überprüfung jedoch vornehmlich auf den stationären Bereich. 1997 konnten anlässlich der Innsbrucker Tagung „Gemeindepsychiatrie in Österreich - eine gemeindenahe Ver­ sorgung braucht die Gemeinde, die sich sorgt“ wieder alle für die psychiatrische Versorgung relevanten Institutionen zu einem Erfahrungsaustausch und einer Darstellung sowie Beurteilung der bisherigen Entwicklungen zusammengeführt werden [35]. Im selben Jahr veröffentlichte das ÖBIG die Studie „Struktureller Bedarf in der psychiatrischen Versorgung“ [42]. Darin wurden erstmalig der außerstationäre gemeindenahe Versorgungsbereich sowie auch Aspek­te der Sonderversorgung von Abhängigkeitskranken und der Kinder und Jugendpsychiatrie berücksichtigt. Die Bundesländer einigten sich auf den Abschluss einer Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens sowie der Krankenanstaltenfinanzierung. Zwischen 1998 bis 2003 wurde der ÖKAP in Hinblick auf den „strukturellen Bedarf in der psychiatrischen Versorgung“ fortgeschrieben und was die psychiatrische Versorgung betrifft, lediglich die stationäre psychiatrische Behandlung in Krankenanstalten hinsichtlich der maximalen Bettenmessziffern, ihrer Standorte und der Tagesklinikplätze ausgeführt. 2005 fand in Linz veranstaltet von Meise, Wancata, Hinterhuber pro mente austria sowie der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Maria Rauch-Kallat die Enquete unter dem Motto „Die Zukunft der Österreichischen Psychiatrie“ statt [46,47]. Im gleichen Jahr konnte erneut ein Psychiatriebeirat ins Leben gerufen werden. 2006 wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit vom ÖBIG [41] der „Österreichische Strukturplan für Gesundheit (ÖSG)“ erstellt, der den ÖKAP ablösen soll. Der ÖSG versteht sich als Paradigmenwechsel in der Planung. Ziel dieser Weiterentwicklung in der Gesundheitsplanung ist ein systemischer und integrativer Ansatz, der alle Ebenen und Teilbereiche der Gesundheitsversorgung und die angrenzenden Bereiche erfassen soll. Entwicklungen Ziel der „Empfehlungen für die zukünftige psychiatrische Versorgung der Bevölkerung Österreichs“ [8] war es, Standards festzuschreiben und Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die österreichweit gültig sein sollten. Nachdem die von Psychiatrieexperten vehement geforderte Verabschiedung eines österreichweiten „Psychiatriegesetzes“ nicht zustande kam, begann jedes Bundesland einen eigenen Plan zu entwickeln. Auftraggeber waren die jeweiligen Landesregierungen; als Verfasser zeichneten zumeist die dort in der Psychiatrie Tätigen. Nur wenige dieser Pläne wurden in der Folge hinsichtlich ihrer Umsetzung evaluiert. Nach Katschnig [26] können die Psychiatriepläne der Länder in Abhängigkeit ihres zeitlichen Entstehungsdatums in drei Phasen eingeteilt werden: • die frühe Phase der Psychiatrie- 234 planung in den 70-er und 80-er Jahren wie der „Wiener Zielplan“ aus dem Jahr 1979 • die mittlere Phase der Psychiatrieplanung in den 90-er Jahren wie die Länderpläne von Tirol (1993), Salzburg (1994), Niederösterreich (1995) und der Steiermark (1995) sowie • die aktuelle Psychiatrieplanung, die seit 2000 erstellt wurde. sorgung sowie der komplementären Versorgung mit den Bereichen „Wohnen“, „Arbeit“, „Tagesstruktur und Freizeit“, vorgeschlagen. Diese Leitlinien und Planungsrichtwerte fanden auch Eingang in den „Wahrnehmungsbericht“ des Österreichischen Rechnungshofes und sie wurden von der ÖBIG - Studie „Struktureller Bedarf in der psychiatrischen Versorgung“ übernommen [42]. War die „frühe Phase“ vor allem von einer Wertediskussion und Kritik an der bestehenden Versorgung und Ansätzen zu strukturellen Überlegungen, wie Regionalisierung und Dezentralisierung charakterisiert, flossen in die mittlere Phase versorgungspolitische Leitlinien und Erfahrungen ein, die in den 70-er und 80-er Jahren in anderen Europäischen Ländern (vor allem in der Bundesrepublik Deutschland) mit der Psychiatriereform gemacht wurden. Einzelne Pläne wurden auf Grundlage von Daten, Ergebnissen aus der Epidemiologie, der Public Health Forschung sowie Raumplanung erstellt. Die versorgungspolitischen Leitlinien aller Pläne sind sehr ähnlich [53,54]. Gefordert wurden: Der Österreichische Rechnungshof [44] bezeichnete in seinem Wahr­ nehmungsbericht 1998 die Ziel­ vorgaben der Psychiatriepläne als weitgehend geeignet eine gemeindenahe und patientengerechte psychiatrische Versorgung zu schaffen sowie die im Zuge seiner Überprüfung festgestellten Defizite mittelfristig zu beseitigen. Seine Empfehlungen schließen sich den 1992 und den in Psychiatrieplänen aufgestellten Forderungen für den Aus- und Aufbau einer gemeindenahen Psychiatrie an. Die Querschnittsüberprüfung des Rechnungshofs ergab, dass die außerstationäre Versorgung psychisch Kranker noch erhebliche Lücken aufweist, weshalb eine bedürfnisgerechte Betreuung von PatientInnen vielfach nicht möglich ist. Gleichzeitig vertrat er die Auffassung, dass nur durch den Ausbau von ambu­lanten und komplementären Diensten die Größe des stationären Bereichs vermindert werden könnte. Zusätzlich sollte durch die Schaffung psy­ chiatrischer Abteilungen in Allge­ meinkrankenhäusern eine dezentrale Versorgungsstruktur aufgebaut werden. Was die Personalausstattung betrifft vertrat der Rechnungshof die Ansicht, dass psychotherapeutische und soziotherapeutische Maßnahmen in der Behandlung psychisch Kranker zunehmend an Bedeutung gewinnen. • die Gleichstellung von psychisch Kranken mit körperlich Kranken • die Bedarfsgerechtigkeit und Bedürfnisorientierung • die Personenorientierung • die Integration der psychiatrischen Versorgung in die medizinische und soziale Grundversorgung • die Gemeindenähe mit Regionalisierung der zumeist zentralisiert vorgehaltenen Versorgungsangebote sowie • der Aufbau von Koordinationsund Kooperationsstrukturen Auf der Grundlage von Planungsrichtwerten, die sich an den Empfehlungen der Deutschen Expertenkommission aus dem Jahr 1988 [7] orientierten, wurden die Bedarfszahlen für die Bereiche der (teil)-stationären Versorgung, der ambulanten Ver- Zur Abschätzung der Entwicklungen der psychischen Gesundheitsversorgung könnten die im „World Health Report 2001” [73] formulierten Schlüsselfragen herangezogen wer- Psychiatrische Versorung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen –Ausblick den: Fördert die Politik oder die Gesundheitsverwaltung ... • den Schutz der Menschenrechte psychisch Kranker? • die Entwicklung von Gemeindepsychiatrie? • die Partnerschaft zwischen Patienten, Familie und Behandler? • das Empowerment von PatientInnen und ihrer Familien? • die Kooperation zu anderen Teilen der Gesundheitsversorgung? • die Verantwortung für die Bedürfnisse bislang Unterversorgter? • ein kontinuierliches Monitoring und Evaluation der Dienste? Dieser Fragenkatalog unterstreicht, dass die psychische Gesundheitsversorgung heute mehr bedeutet, als die Behandlung oder Rehabilitation psychisch Kranker. Eine jüngst publizierte Studie [37, 38], in der sich unterschiedliche Interessensgruppen zur Umsetzung der im Aktionsplan der Ministeriellen WHO-Konferenz 2005 enthaltenen Forderungen äußerten, liefert grobe Hinweise auf den Zustand der psychischen Gesundheitsvorsorgung in Österreich. Im gesamten Bundesgebiet wurden Personen befragt, die sich aus vier Gruppen (Therapeuten, Vertreter der Gesundheitspolitik bzw. -verwaltung, PatientInnen und Angehörigen) rekrutierten. Die Befragung kam zum Ergebnis, dass die Umsetzung jener Empfehlungen, die sich auf die erforderlichen Ressourcen beziehen, durchwegs positiv beurteilt wurde. Auch die Fragen zur Verwirklichung zur Einbeziehung von PatientInnen und Angehörigen in Entscheidungsprozesse erhielten eine ausreichend positive Beurteilung. Jedoch wurden die Integration der psychiatrischen Versorgung in die medizinische Grundversorgung sowie die Umsetzung der gemeindepsychiatrischen Versorgung als unzureichend erachtet. Die psychiatrisch/psycho- 235 soziale Gesundheitsversorgung Für die Beurteilung der strukturellen und organisatorischen Entwicklungen liegen bis heute wichtige epidemiologische und versorgungsrelevante Daten, die sich auf ganz Österreich beziehen, noch nicht vor. Da eine integrierte Darstellungsmethodik der stationären und der außerstationären Leistungen auf Grundlage eines einheitlichen Dokumentationssystems fehlt, ist es daher – und das muss betont werden - nach wie vor kaum möglich, diesen Bereich der Gesundheitsversorgung in seiner Gesamtheit befriedigend darzustellen oder gar zu bewerten. Lediglich für den medizinisch-stationären Bereich liegen auf Grund der Dokumentation für die LKF (Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung) administrative Daten vor. Deren Aussagekraft ist jedoch eingeschränkt. So beziehen sie sich lediglich auf Behandlungsepisoden; die psychiatrischen Diagnosen werden vielfach nicht von psychiatrischen Fachleuten, sondern von Ärzten anderer Fachgebiete gestellt. Für die ambulante und vor allem für die komplementäre/rehabilitative Ver­ sorgungsebene stehen administrative Daten nur bruchstückhaft zur Verfügung. Wenige Informationen bestehen auch für Bereiche, wie Pflegeheime, in denen häufig chronisch psychisch Kranke betreut werden. Eine „Terra incognita“ ist z.B. der Wohnungslosenbereich, in dem, Berichten zufolge, zunehmend mehr chronisch psychisch Kranke betreut werden, die vom Behandlungs- und Hilfesystem nicht erreicht werden. In der Kurzinformation zum Österreichischen Psychiatriebericht 2004 [28] finden sich unter anderem folgende allgemeine Kernaussagen zu den Entwicklungen: • „Psychiatrieplanung: Bundesund Länderpläne vorbildlich“: Dazu wird jedoch einschrän­kend • • • • bemerkt, dass die Vergleich­ barkeit zwischen den LänderPlänen begrenzt und der Verbind­ lichkeitsgrad dieser Pläne unterschiedlich sei. So decken manche Pläne lediglich den Sozial­ hilfesektor ab; andere Pläne sind umfassender und betreffen sowohl den medizinischen wie auch den Sozialhilfebereich. „Dezentralisierung der stationären Versorgung schreitet voran: Psychiatrische Abteilungen am Allgemeinkrankenhaus sind auf den Vormarsch“: Konnten im Psychiatriebericht 2001 sechs kleine psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern genannt werden, waren 2004 dreizehn weitere in Planung, in Bau oder kurz vor der Eröffnung. „Drei Viertel aller stationären Behandlungsepisoden mit einer psychiatrischen Diagnose finden in nicht-psychiatrischenAbteilungen an Allgemeinkrankenhäusern statt“: Dieses Faktum, das in der Vergangenheit in den Planungen häufig nicht berücksichtigt wurde, wird nachstehend noch näher ausgeführt. „Finanzierungswirrwarr verhindert optimalen Einsatz der Ressourcen und patientengerechte Betreuung“: Die Betreuung psychisch Kranker leidet heute an der Zersplitterung von Finanzierung und Zuständigkeit für das Versorgungssystem. Diese ist nur für die stationären und ambulanten medizinisch-psychiatrischen Bereiche weitestgehend gleichartig geregelt. Dies trifft jedoch nicht für den komplementären Sektor zu, der in jedem Bundesland unterschiedlich gesetzlich geregelt oder finanziert wird. „Nicht-professionelle Hilfs­or­ga­ ni­sa­tionen oder Aktivitäten spielen eine große Rolle“: Die Be­ troffenenselbsthilfe,Angehö­rigen­ selbsthilfe und Laienhilfe sind mittlerweile für ein modernes Versorgungssystem unverzichtbar Meise, Wancata, Hinterhuber geworden. Der stationäre Versorgungsbereich Wurden 1974 in 10 psychiatrischen Krankenhäuser noch 11 763 Betten vorgehalten, waren im Jahre 2004 in 28 stationären Einrichtungen (incl. der Versorgung von Kinder und Jugendlichen oder PatientInnen mit Abhängigkeitserkrankungen) nur mehr ­ 4 716 Betten aufgestellt. Obwohl sich die Bettenzahl in den psychiatrischen Krankenhäusern durch Schließung oder durch Ausgliederung von Langzeitbereichen verringert hat, verbleibt in ihnen - trotz der Schaffung von psychiatrischen Abteilungen in Allgemeinkrankenhäuser - der Großteil der stationären Behandlungskapazität. Ein psychiatrisches Krankenhaus wurde geschlossen. Somit wurde das Ziel, die klinisch psychiatrische Behandlungskapazität möglichst umfassend in das Allgemeinkrankenhaus zu integrieren, bislang nur teilweise erreicht [26,49]. Parallel zum Bettenabbau ist die Anzahl der Aufnahmen von PatientInnen mit psychiatrischen Erkrankungen dramatisch gestiegen. Der Umstand, dass ein erheblicher Teil der stationär psychiatrisch Behandlungsbedürftigen an nicht-psychiatrischen Abteilungen Aufnahme findet, ist durch epidemiologische Untersuchungen gut belegt [64]. Dieses Faktum wurde hingegen in der Psychiatrie- bzw. der Bedarfsplanung nie berücksichtigt. Es gibt durch Daten untermauerte Hinweise, dass am Allgemeinkrankenhaus eingerichtete psychiatrische Abteilungen diese Fehlplatzierungen zwar verringern konnten, jedoch ihre Bettenkapazitäten zumeist zu gering bemessen wurden [33,39]. Eine positive Entwicklung ist der Aufbau von Plätzen zur tagesklinischen Behandlung und die Schaffung einer diesbezüglichen Abrechnungsmöglichkeit im LKF. Da ta- 236 gesklinisch Plätze als stationäre Behandlungsplätze gelten und nur durch Umwidmung von Betten geschaffen werden können, wird der Ausbau dieser wichtigen Behandlungsstruktur behindert. Der ambulante Versorgungsbereich Standen 1974 für die Behandlung psychisch Kranker im wesentlichen die Berufsgruppe der Nervenärzte - die gleichzeitig Neurologen und Psychiater waren - sowie das Krankenpflegepersonal zur Verfügung, hat sich das Bild heute sehr gewandelt. Wir finden heute zusätzlich Berufsgruppen wie Klinische- und GesundheitspsychologInnen, PsychotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen oder KunsttherapeutInnen, die im Bereich der psychiatrisch- psychosozialen Versorgung tätig sind. Zum ambulanten Bereich gehören Strukturen wie in eigener Praxis tätige PsychiaterInnen, ÄrztInnen mit PSY-Diplomen, PsychotherapeutInnen sowie Klinische- und GesundheitspsychologInnen. Auch die Ambulanzen von psychiatrischen Krankenanstalten und Abteilungen sowie die Psychosozialen Dienste übernehmen wichtige Funktionen. Bezogen auf das Jahr 2004 gab es in Österreich etwa 800 FachärztInnen für Psychiatrie bzw. für Psychiatrie und Neurologie. Von den 442 Ordinationen verfügten lediglich 93 (21%) über einen §2-Kassenvertrag. Österreichweit waren demnach für 100.000 EinwohnerInnen (EW) 1,1 FachärztInnen mit Kassenvertrag vorhanden. Die höchste Kassenpsychiaterdichte mit 2,9 wies Vorarlberg; die niedrigste Oberösterreich mit 0.4 für 100.000 EW auf. Gemessen an den Planungszahlen kann man davon ausgehen, dass heute lediglich etwa 25% der für die Basisversorgung erforderlichen niedergelassenen FachärztInnen mit §2-Kassenvertrag zur Verfügung stehen. Inzwischen stehen für die ambulante psychische Betreuung PsychotherapeutInnen (im Jahr 2004: 5788 PsychotherapeutInnen) in vielfach größerem Umfang als FachärztInnen zur Verfügung [26]. Etwa 40% der Klinischen und Gesundheitspsychologen sowie der Großteil der PsychiaterInnen führen die Zusatzbezeichnung PsychotherapeutIn. Das Angebot ist flächendeckend jedoch regional ungleich verteilt. Die höchste Dichte mit etwa 104 PsychotherapeutInnen für 100.000 EW weist Wien, die niedrigste mit 25 das Burgenland auf. Österreichweit stehen für 100.000 EW 71 PsychotherapeutInnen zur Verfügung. Grundsätzlich steht auch für diesen Bereich der Grossteil der Ressourcen in den urbanen Regionen zur Verfügung. Der extramurale bzw. komplementäre Versorgungsbereich Jene psychiatrischen Einrichtungen, die der Betreuung und Rehabilita­tion von schwer und chronisch psychisch Kranker dienen, die vor einigen Jahrzehnten überwiegend im Krankenhaus betreut wurden, werden heute üblicherweise als „extramurale“ oder „komplementäre“ Einrichtungen bezeichnet. Obwohl aufgrund der Umstrukturierung der psychiatrischen Versorgung heute in den psychiatrischen Krankenhäusern für diese psychisch Kranken keine Angebot mehr vorgehalten werden, verwenden wir in diesem Kontext den Begriff „komplementäre“ Einrichtungen. Diese Einrichtungen (z.B. zur Tagesstrukturierung, zur Kontaktstiftung oder zur Unterstützung beim Wohnen) werden häufig auch als „sozialpsychiatrische“ Einrichtungen bezeichnet. Sozialpsychiatrie ist aber nicht auf diese Einrichtungstypen beschränkt, sondern bezieht sich auf ­eine der drei wesentlichen Säulen der Psychiatrie Psychiatrische Versorung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen –Ausblick (neben biologischer und psychotherapeutischer Psychiatrie). Hans Strotzka (1973) definierte Sozialpsychiatrie als "[...] jene Wissenschaft, die sich systematisch mit der Bedeutung von sozialen, kulturellen sowie Umgebungsfaktoren in weitestem Sinn für seelische Gesundheit und Krankheit befasst." Aus heutiger Sicht befasst sich die Sozialpsychiatrie somit unter anderem mit den folgenden Bereichen: der psychiatrischen Rehabilitation, der Soziotherapie, der Arbeit mit Angehörigen sowie dem sozialen Umfeld und Netzwerk, der Beschäftigung mit sozialen Ursachen für das Auftreten und den Verlauf von psychischen Erkrankungen, der Beschäftigung mit den sozialen Folgen psychischer Erkrankungen (insbesondere jenen, die durch Stigma und Diskriminierung verursacht werden), der Versorgungsplanung und Versorgungsforschung, der Epidemiologie und der Prävention von psychischen Erkrankungen [21,29,55,66]. Komplementäre Einrichtungen und Dienste bieten ihre Leistungen Men­ schen mit chronisch psychischen Erkrankungen und psychischen Be­ einträchtigungen an, deren spezifi­ sche Bedürfnisse eine Rehabilitation notwendig machen und die durch andere ambulante oder stationäre Ein­richtungen nicht oder nicht aus­ reichend betreut werden können. Diese Hilfen sollen sich an den Bedürfnissen der Betroffenen orientieren, an de­ren Ressourcen ansetzen, bedarfsgerecht sein und sich an den Prinzipien der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und des ausreichenden Ausmaßes orien­tieren. Die dazu erforder­ lichen Hilfen betreffen die Bereiche "Wohnen", "Tagesgestaltung", "Ar­ beit" und "Kommunikation". We­sent­ liche Merkmale dieser Ein­richtungen sind Gemeindenähe und hohe Stand­ ortqualität wie leichte Erreich­barkeit und Einbettung in das unmittelbare gesellschaftliche Umfeld. Kleine, flexible und anpassungsfähige Rehabilitationsangebote fördern ei- nen vorurteilsfreien Zugang und gewährleisten Akzeptanz und Wirk­ samkeit. Psychiatrische Rehabilitation umfasst alle Maßnahmen, um "[...] einen seelisch behinderten Menschen über die Akutbehandlung hinaus durch umfassende Maßnahmen auf medizinischen, schulischen, beruflichen und sozialem Gebiet in die Lage zu versetzen, sich eine Lebensform und Lebensstellung, die ihm entspricht und seiner würdig ist, im Alltag, in der Gemeinschaft und im Beruf zu finden bzw. wieder zu erlangen" [6]. Nach der Definition der Vereinten Nationen (1994) bezieht sich der Begriff "Rehabilitation" sich auf einen Prozess, der darauf abzielt, dass Menschen mit Behinderungen ihr optimales physisches, sensorisches, intellektuelles, psychisches und/oder soziales Funktionsniveau erreichen und aufrecht erhalten, ihnen also Hilfestellungen zur Änderung ihres Lebens in Richtung eines höheren Niveaus der Unabhängigkeit zu geben [16,17,23,27,52]. Der prinzipielle Rechtsanspruch auf Rehabilitation ist in Österreich gesetzlich festgelegt. In den Psychiatrieberichten, dem ÖSG oder im Gesundheitsbericht 2006 wird dieses wichtige Versorgungssegment nur am Rande erwähnt und ausgeführt. Weiters wird im Gesundheitsbericht des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen [7] angemerkt, dass die Koordination von medizinischer und psychosozialer Versorgung wegen der Fragmentierung der Versorgungsbereiche und der damit unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen und Finanzierungsmodelle erschwert ist. Wie eine jüngst seitens der Bundesgesundheitsagentur in Auftrag gegebene Studie zur Erhebung und Beschreibung der außerstationären psychiatrischen Versorgung zeigt, ist die Darstellung dieses Versorgungssegmentes schwierig [43]. Es verfügen – so sie überhaupt vollständig vorhanden sind – die einzelnen Bun- 237 desländen über eine unterschiedliche Datenlage und -qualität der Dokumentations- und Berichtssysteme. Obwohl diese Studie erstmalig einen Überblick über die Versorgungssituation zu geben versucht, kann sie auf Grund methodischer Mängel derzeit noch keine Aussagen über die Bedarfsgerechtigkeit oder über zukünftige Entwicklungserfordernisse für den außerstationären rehabilitativen Bereich treffen. In diesem Zusammenhang bleibt häufig unberücksichtigt, dass zwar etwa 7.000 Betten ( das sind ca. 60% der Betten) in der Psychiatrie innerhalb der letzten drei Jahrzehnten - vor allem durch die Enthospitalisierung von LangzeitpatientInnen - abgebaut wurden, jedoch die so eingesparten Mittel nicht in den komplementären Bereich transferiert wurden. Vielmehr wurde dieser Bereich aus dem Gesundheits- in das Sozialressort ausgegliedert und belastete damit finanziell Länder und Gemeinden. Auch wird vielfach vergessen, dass die ÖBIG–Planwerte für die stationäre Versorgung unter der Prämisse angegeben wurden, dass zuvor die extramuralen, komplementären Dienste und Einrichtungen entsprechend ausgebaut werden. Dies ist aber nur selten - wenn überhaupt - eingetreten. Ausblick – Herausforderungen für die Zukunft Auch wenn die gemeindepsychiatrische Versorgung für viele Kranke Vorteile gebracht hat, stehen doch Probleme an, von denen wir im Folgenden einige herausgreifen. Es wird zunehmend erkannt, dass gemeindepsychiatrische Versorgungsziele nur mit Hilfe integrierter Versorgungsmodelle umgesetzt werden können [5,70,74]. Wurde vor den Psychiatriereformen psychisch Kranke überwiegend im psychiatrischen Krankenhaus behandelt, haben heute für die Behandlung und Rehabilitati- Meise, Wancata, Hinterhuber on eine strukturelle Differenzierung und ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Dies führte jedoch auch zu einer Fragmentierung der Versorgung. Durch Spezialisierung, unterschiedliche Leistungsanbieter (öffentliche, gemeinnützige, private), die Versorgungsebenen (stationär, ambulant, komplementär), sowie durch Unterschiede in Finanzierung und Zuständigkeiten haben sich Schnittstellen bzw. Bruchlinien im System entwickelt. Zusätzlich zur Grundversorgung finden wir heute Fachgebiete wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Psychiatrie für Suchterkrankungen, die Gerontopsychiatrie, die Psychosomatik oder die Forensische Psychiatrie. Es begannen sich dafür abgegrenzte Hilfesysteme mit jeweils eigenen stationären, ambulanten und rehabilitativen Strukturen zu entwickeln, die sich hinsichtlich Ausrichtung, Identität, Konzepten, Sichtweisen, Personal oder der Finanzierung unterscheiden. Auch kann es, wie sich an der Umsetzung der Psychosomatikversorgung zeigt, zu einer Zweigleisigkeit in der Versorgung kommen mit der Gefahr, dass sich dadurch eine „2-Klassen-Psychiatrie“ entwickelt. Die psychiatrische Grundversorgung bedarf einer integrierten Gemeindepsychiatrie. Durch einen kooperativen Verbund müssen sich Leistungserbringer und Kostenträger über die eigene Institutionsgrenzen vernetzen, eine funktionale - an den Bedürfnissen des einzelnen Patienten orientierte – Einheit bilden, die Leistungsangebote definieren und transparent gestalten. Dies trifft besonders auf Menschen mit Doppeldiagnosen, rezidivierenden oder chronischen Krankheitsverläufen, die einen komplexen Leistungsbedarf haben, zu. Eine Regionalisierung der Psychiatrie wird jedoch nur dann ermöglicht, wenn die Ungleichheiten in der Versorgungsdichte zwischen urbanen und ländlichen Gebieten ausgeglichen werden. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist 238 von einem bundesweit einheitlichen Versorgungsstandard noch weit entfernt [3,4,10,59,63]. Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Dezentralisierung psychiatrischer Angebote benötigt eine größere Zahl kompetenter MitarbeiterInnen als früher erforderlich waren. Bei den FachärztInnen für Psychiatrie ist in den letzten Jahren zunehmend ein Mangel zu beobachten. So können immer wieder vorhandene Stellen nicht ausreichend besetzt werden. Es wird nötig sein, nach Wegen zu suchen, um eine größere Zahl an FachärztInnen als bisher auszubilden. Die Psychiatrie muss sich vehementer als bisher gegen die nach wie vor bestehende Ausgrenzung und Abwertung psychisch Kranker stellen. Stigma und Diskriminierung sind noch so stark ausgeprägt, dass sie ein wesentliches Behandlungshindernis darstellen [14,45]. Ihre Folgen sind häufig eine „zweite Krankheit“, die von Resignation und Rückzug sowie einer Ghettoisierung der Betroffenen in einer gemeindepsychiatrischen Subkultur geprägt ist. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass unter den Wohnungslosen eine besonders hohe Prävalenz psychischer Erkrankungen zu finden ist. In der Stadt Mannheim litten beispielsweise 79% aller Obdachlosen unter irgendeiner psychischen Erkrankung [56]. Ähnliche Berichte liegen in Österreich vor, wobei eine erhebliche Zahl von Menschen mit Schizophrenie oder bipolaren Erkrankungen unter den Wohnungslosen zu finden sind. Zunehmend sind bereits Jugendliche von Wohnungslosigkeit betroffen. Sehr häufig sind diese psychisch Kranken ohne ausreichende psychiatrische, medizinische oder soziale Betreuung. Arbeitslosigkeit im Zusammentreffen mit einer schweren psychischen Krankheit dürfte einer der Hauptrisikofaktoren für Obdachlosigkeit sein. Spezielle nachgehende Angebote für psychisch kranke Ob- dachlose sind in Österreich noch eine Ausnahme, dürften aber eine zentrale Voraussetzung für deren Reintegration sein [30,48]. Viele psychisch Kranke finden in unserer Gesellschaft keine Arbeit und sind somit von der Teilhabe an zahlreichen gesellschaftlichen Möglichkeiten ausgeschlossen [12]. Im langjährigen Vergleich nahmen Pensionierungen aufgrund von Invalidität wegen psychischer Krankheiten stark zu; so sind sie von 1985 bis 1999 um das Zweieinhalbfache gestiegen, obwohl im gleichen Zeitraum die jährlichen Neuzugänge aller Berufsunfähigkeitspensionen abgenommen haben. Heute sind in Österreich psychische Krankheiten mit etwa 30% die häufigste Ursache für Pensionen aufgrund von Invalidität. Bei den 3039 jährigen männlichen Angestellten machen psychische Krankheiten sogar mehr als die Hälfte der Ursachen für eine Berufsunfähigkeitspension aus. Wichtige Fragen müssen geklärt werden, um psychisch Kranken besser bei einer beruflichen Reintegration helfen zu können [57]. In den letzten Jahren finden sich zunehmend Berichte, dass in Gefängnissen eine hohe Zahl psychisch Kranker zu finden ist [11,40]. So berichtete eine repräsentative britische Studie unter weiblichen Gefangenen, dass 14% unter schizophrenen oder affektiven Psychosen und mehr als ein Drittel unter Alkoholmissbrauch leidet. In Österreich berichteten Frühwald und MitarbeiterInnen von einer seit Jahren steigenden Zahl von Suiziden in Gefängnissen. Auch im sogenannten „Maßnahmenvollzug“ werden zunehmend mehr Menschen mit schizophrenen Psychosen gemäß § 21/1 StGB untergebracht, was auf ein Versagen der psychiatrischen Versorgung zurückgeführt wird. Die Ursachen für diese Zunahme verdienen eine genaue Untersuchung [18,19,58]. Noch immer bekommt ein beträcht- Psychiatrische Versorung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen –Ausblick licher Teil psychisch Kranker nicht die entsprechenden Behandlungen und Hilfsangebote. Eine groß angelegte Studie, die in mehreren EU-Ländern durchgeführt wurde, (ESEMeD European Study of Mental Disorders Projekt) berichtet, dass auch in reichen Staaten, wie Deutschland, Frankreich, Holland, Italien oder Spanien hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten psychischer Störungen große Lücken bestehen [2]. Allerdings zeigte sich in der ESEMeDStudie, dass auch eine Reihe jener Personen, die nicht psychisch krank waren, Psychopharmaka bekommen hatten bzw. in psychosozialer Betreuung gewesen waren. Die Gründe für diese vermutlich unnötigen Interventionen bei psychisch Gesunden und die Gründe für die mangelnde Behandlung psychisch Kranker konnten in der ESEMeD-Studie nicht geklärt werden. Es stellt sich die Frage, ob auch in Österreich ein erheblicher Teil aller psychiatrischen bzw. psychosozialen Interventionen von Personen ohne psychische Krankheit in Anspruch genommen wird. Dies würde eine enorme Fehlplatzierung von Mitteln bedeuten, die eigentlich psychisch Kranken zu Gute kommen sollten. Auch die Frage, wie es zu einer solchen Entwicklung kommen kann, scheint von enormer Bedeutung; werden Personen von ihren nichtpsychiatrischen Ärzten fälschlich als psychisch krank klassifiziert oder suchen Personen selbst psychiatrischpsychosoziale Hilfe, weil sie ihren körperlichen Zustand fälschlich als psychisch bedingt interpretieren? Die Ergebnisse dieser Studien sind jedoch, was die Prävalenz psychischer Störungen sowie die Behandlungsqualität betrifft, nicht auf Österreich übertragbar. Nur durch eine psychiatrisch-epidemiologische Untersuchung der österreichischen Bevölkerung könnten die entsprechenden Antworten gefunden werden. Im Zuge von Globalisierungsprozes- sen finden heute erhebliche und weitreichende Wanderungsbewegungen statt. Migration ist auf Grund der vielfältigen Belastungen ein Risikofaktor für den Erhalt von psychischer Gesundheit. Migranten finden in ihrem Gastland kaum Zugang zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung, da dort das für sie erforderliche transkulturelle psychiatrische Angebot zumeist fehlt [15,31]. Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das nationale Gesundheitssystem wäre auch ein Beitrag zu ihrer sozialen Partizipation. Die Erkenntnis, dass es erforderlich ist sich mit geschlechtsspezifischen Ansätzen für psychisch kranke Menschen auseinanderzusetzen, hat in den vergangenen Jahren zugenommen [67,69]. Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass die bisherigen Gender Mainstreaming-Projekte vorzüglich auf Frauen ausgerichtet sind. Wie etwa die Suizidstatistik aufzeigt, wird es als notwendig erachtet, sich auch mit männerspezifischen Aspekten zu beschäftigen [20]. Die Mitgliedsstaaten der Europaregion der der WHO haben sich in Helsinki darauf verständigt, der Zunahme von psychischen Störungen sowie ihren gesellschaftlichen Folgen entgegenzuwirken. Sie rückten damit psychische Erkrankungen aus dem Schatten des Tabus in den Brennpunkt einer gesundheitspolitischen Betrachtung und Diskussion: „Wir, die bei der Ministeriellen WHO-Konferenz von 12. bis 15. Jänner 2005 in Helsiniki versammelten Gesundheitsminister der Mitgliedstaaten der Europäischen Region [...], erklären, dass psychische Gesundheit und psychisches Wohlergehen grundlegend für die Lebensqualität des einzelnen Menschen sowie von Familien, Gemeinschaften und Nationen sind und es den Menschen ermöglichen, ihr Leben als sinnvoll zu erfahren und sich als kreative und aktive Bürger zu betätigen. [...]. Wir erkennen an, dass die Förderung der psychischen 239 Gesundheit und die Prävention sowie die Behandlung, Pflege und Rehabilitation bei psychischen Gesundheitsproblemen für die WHO und ihre Mitgliedstaaten, die Europäische Union (EU) und den Europarat ein vorrangiges Anliegen darstellen [...]. In diesen Resolutionen werden die Mitgliedsstaaten [...] eindringlich gebeten, Maßnahmen zu ergreifen, um die durch psychische Gesundheitsprobleme bewirkte Krankheitslast zu verringern und das psychische Wohlergehen zu steigern.“ Diese Äußerungen in der Präambel zur "Helsinki-Konferenz", die unter das Motto "Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen" gestellt wurde, setzen neue Maßstäbe. Ein „Aktionsplan“ sowie das „Grünbuch“ über Strategien, die die psychische Gesundheit der Menschen in der EU verbessern sollen, lassen hoffen, dass die Absichten, hier Verbesserungen herbeizuführen, ernsthaft gemeint sind [9]. Im Juni 2008 wurde von den GesundheitsministerInnen der „Europäische Pakt für psychische Gesundheit und Wohlergehen“ unterzeichnet, der die psychische Gesundheit in den Blickpunkt rückt. Dieser Pakt unterstreicht erneut den Vorschlag, Erkenntnisse aus der gesamten Europäischen Union zusammenzuführen, um gemeinsame Empfehlungen für Maßnahmen in den Bereichen Prävention von Suizid und Depression, psychische Gesundheit in den Bereichen Jugend und Bildung, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, psychische Gesundheit bei älteren Menschen und Bekämpfung von Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung zu formulieren. Innerhalb der nächsten 10 Jahre sollen in den EU-Mitgliedsstaaten die folgenden Prioritäten verfolgt werden: • das Bewusstsein von der Bedeutung des psychischen Wohlbefindens zu fördern, • Stigma, Diskriminierung und Ungleichbehandlung zu bekämpfen, Meise, Wancata, Hinterhuber • Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und ihre Angehörigen zu stärken und zu unterstützen und sie an diesem Prozess aktiv zu beteiligen, • umfassende, integrierte und effiziente psychiatrische und psychosoziale Versorgungssysteme zu entwerfen und jene zu implementieren, welche die Förderung, Prävention, Behandlung und Rehabilitation, Pflege und Genesung vorsehen, • dem Bedürfnis nach kompetenten und in allen diesen Bereichen leistungsfähigen Mitarbeitenden zu entsprechen sowie • die Erfahrungen und das Wissen der Betroffenen und der Betreuenden (damit sind auch die Angehörigen gemeint) als wichtige Grundlage für die Planung und Entwicklung von Diensten anzuerkennen. Die Tatsache, dass dieser Europäische Pakt keinerlei Verbindlichkeit, sondern nur Empfehlungscharakter hat, weist auf die Bedeutung nationaler Bemühungen hin. Um in Österreich weitere konkrete Verbesserungen für die Entwicklung der psychischen Gesundheitsversorgung zu erzielen, wäre es daher notwendig, die bereits vorhandenen Richtlinien in Form verbindlicher Standards mit den Bundesländern zu vereinbaren. Der Österreichische Strukturplan Ge­ sundheit 2005 [41,72,73], der von der isolierten Betrachtung der Kran­ kenhausversorgung abgeht, könn­te möglicherweise ein Vehikel sein, um auch für die Psychiatrie eine integrierte Versorgung zu etablieren. Damit betont er jenen Paradigmenwechsel in der Gesundheitsplanung, der für die Psychiatrie schon seit etwa 20 Jahren gefordert wird. Eine sich an der Einzelperson orientierte integrierte Behandlung – wie sie heute in der „Personenzentrierten Behandlung und Rehabilitation“ gefordert wird - ist angesichts der Fragmentierung der Kostenträger und 240 der Aufspaltung der Zuständigkeit, sowie der mancherorts unübersichtlichen Vielzahl von Einrichtungen und Diensten heute noch schwierig zu verwirklichen. Eine integrierte Versorgung kann jedoch nur mit Hilfe einer integrierten Finanzierung umgesetzt werden. Eine moderne psychiatrische Versorgung erfordert Kooperation und Koordination; nicht nur auf Seiten der Leistungsanbieter, sondern auch auf Seiten der Kostenträger und der politisch sowie administrativ Verantwortlichen. Die Realität ist heute noch, dass diese enorm zersplittert sind. Auch die Kosten- und die Entscheidungsträger müssten „personenzentriert“ zusammenarbeiten, wie dies mit Recht von den Leistungsanbietern gefordert wird [1,21,24,50,72]. Psychisch Kranke haben so wie körperlich Kranke ein Recht darauf, möglichst optimale Versorgungsstrukturen vorzufinden, die dazu beitragen ihr Leiden und die Belastungen der Angehörigen zu verringern, aber auch ermöglichen die individuell größtmögliche Autonomie, Partizipation und Lebensqualität zu erreichen. Vieles wurde in den letzten drei Jahrzehnten in Österreich erreicht, eine Reihe von wichtigen Fragen und Problemen steht aber noch an. Literatur [1] Aktionsgruppe Psychiatrie: Psychiatrie in Deutschland. Strukturen – Leistungen - Perspektiven: Gesundheitsministerkonferenz der Länder, Baden-Württemberg (2007) [2] Alonso J, et al: Sampling and Methods of the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project: Acta Psychiatr Scand Suppl 420,8-12 (2004). [3] Berger E., W. Aichhorn, M.H. Friedrich, S. Fiala-Preisberger, W. Leixnering, B. Mangold, G. Spiel, E. Tatzer, L. ThunHohenstein: Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorguing in Österreich. Neuropsychiatr 20, 86-90 (2006) [4] Berger E., Steinberger K., Huber N.: Jugendpsychiatrische Tagesklinik- Aufbau und Erfahrungen. Neuropsychiatr 20; 127-130 (2006) [5] Brieger P., H-J. Kirschbauer: Kann Planung und Steuerung der psychiatrischen Versorgung in Deutschland wissenschaftlich fundiert sein? Psychiat Prax 31, 383-386 (2004) [6] Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit: Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Bereich. Bonn (1988) [7] Bundesministerium für Gesundheit und Frauen: Gesundheitsbericht an den Nationalrat 2006 – Berichtszeitraum 20042005. Wien (2006) [8] Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz: Empfehlungen für die zukünftige psychiatrische Versorgung der Bevölkerung Österreichs. Mitteilungen der Österreichischen Sanitätsverwaltung. 93, 265289 (1992) [9] Europäische Kommission: Grünbuch. Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union, (2006) http://ec.europa. eu/health/ph_determinants/life_style/ mental/green_paper/mental_gp_de.pdf [10] Friedrich M.H.: Entwicklung der kinderund jugendpsychiatrischen Forensik in Österreich. Neuropsychiatr 20; 91-95 (2006) [11] Frühwald S, Frottier P, Benda N, Eher R, König F, Matschning T: Psychosoziale Charakteristika von Suizidopfern in Gefängnissen. Wiener Klinische Wochenschrift 114, 691-696(2002) [12] Frühwald S, Bühler B, Grasl R, Gebetsberger M, Matschnig T, Lönig F, Frottier P: (Irr-) Wege in die Arbeitswelt - Langzeitergebnisse arbeitsrehabilitativer Einrichtungen für psychisch Kranke der Caritas St. Pölten. Neuropsychiatr 20, 250-256 (2006) [13] Gesellschaft der Österreichischen Nervenärzte und Psychiater: Van Swieten – Memorandum zur psychiatrischen Versorgung. Öst Ärzteztg 23, 44-46 (1986) [14] Grausgruber A, Meise U, Katschnig H, Schöny W, Fleischhacker WW: Patterns of social distance towards people suffering from schizophrenia in Austria: a comparison between the general public, relatives and mental health staff. Acta Psychiatr Scand 115, 310-319 (2007) [15] Haasen C, Levit O, Gelbert A, Foroutan N, Norovjav A, Sinaa M, Demiralay C: Zusammenhang zwischen psychischer Befindlichkeit und Akkulturation bei Migranten. Psychiat Prax 2007; 34: 339342 [16] Haberfellner E.M., Schöny, Platz T., Psychiatrische Versorung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen –Ausblick Meise U.: Evaluationsergebnisse Medizinischer Rehabilitation für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen – ein neues Modell im komplexen psychiatrischen Leistungsangebot. Neuropsychiatr 20, 215-218 (2006) [17] Haberfellner E.M.,A. Grausgruber, R. Grausgruber-Berner, W. Schöny: Medizinische Rehabilitation für psychisch Erkrankte im „Sonnenpark“ in Bad Hall. Neuropsychiatrie 18,18-24 (2004) [18] Haller R., R. Prunnlechner-Neumann: Forensische Psychiatrie - Die Rolle des Faches zwischen Medizin, Justiz und Öffentlichkeit. Neuropsychiatr 20, 1-3 (2006) [19] Haller R.: Die Unterbringung psychisch abnormer Rechtsbrecher nach dem Strafrechtänderungsgesetz. Neuropsychiatr 20; 23-31 (2006) [20] Hausmann A., Rutz W., Meise U.: Frauen suchen Hilfe – Männer sterben. Ist die Depression wirklich weiblich? Neuropsychiatr 22; 43-48 (2008) [21] Hinterhuber H, Hinterhuber EM, Katschnig H, Meise U: Das Menschenbild in der Sozialpsychiatrie. In Hinterhuber H, Heuser MP, Meise U (Hrsg) Bilder des Menschen, 98-109, VIP-Verlag Innsbruck (2003) [22] Hinterhuber H, Liensberger D, Tasser A, Schwitzer J, Rizzuti E, Meise U: Stand und Entwicklung der psychiatrischen Versorgung in Italien. 22 Jahre nach Franco Basaglias Reformgesetz Nr.180. Nervenarzt 72, 501-510 (2001) [23] Hinterhuber H, Meise U.: Zum Stellenwert der medizinisch-psychiatrischen Rehabilitation. Neuropsychiatr 21, 1-4 (2007). [24] Hinterhuber H, Rutz W, Meise U: Psychische Gesundheit und Gesellschaft. „….Politik ist nichts anderes als Medicin im Großen.“ Neuropsychiatr 21,180186 (2007) [25] Günther OH, Friemel S, Bernert S, Matschinger H, Angermeyer MC, König HH: Die Krankheitslast von depressiven Erkrankungen in Deutschland. Psychiat Prax 2007; 34: 292-301 [26] Katschnig H, Denk P, Scherer M: Österreichischer Psychiatriebericht 2004. Analysen und Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung. Ludwig Boltzmann Institut für Sozialpsychiatrie, Universitätsklinik für Psychiatrie, Wien (2004) [27] Katschnig H, Donat H, Fleischhacker W, Meise U: 4x8 Empfehlungen zur Behandlung der Schizophrenie. edition pro mente, Linz (2002) [28] Katschnig H, Ladisner E, Scherer M, Sonneck G, Wancata J: Österreichischer Psychiatriebericht 2001: Teil 1, Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevöl- [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] kerung. Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, Wien (2001) Kleinmann A., Cohen A.: Psychiatry´s global challenge. En evolving crisis in the developing world signals the need for a better understanding of the links between culture and mental disoders. Scientific American, 74-77 (1997) Längle G, Egerter B, Petrasch M, Albrecht Dürr F: Versorgung obdachloser und wohnungsloser psychisch kranker Männer in der Kommune - eine kontrollierte Interventionsstudie. Psychiat Prax 2006; 33: 218-225 Machleidt W., Behrens K., Ziegenbein M., Calliess I.T: Integration von Migranten in die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in Deutschland. Psychiat Prax 2007; 34: 325-331 Meise U., Rössler W., Günther V., Hinterhuber H: Bürgernahe Psychiatrie: Leitlinien für die Reform der psychiatrischen Versorgung in Tirol; VIP-Verlag, Innsbruck (1993) Meise U., Forster H., Günther V., Kreuzer H.G., Stieg K., Wancata J., Hinterhuber H.: Stationäre psychiatrische Versorgung: Die Regionalisierung ist möglich! Neuropsychiatr 14, 55-70 (2000) Meise U, Hafner F, Hinterhuber H (Hrsg): Die Versorgung psychisch Kranker in Österreich. Eine Standortbestimmung. Springer-Verlag, Wien- New York (1991) Meise U, Hafner F, Hinterhuber H (Hrsg): Gemeindepsychiatrie in Österreich. Eine gemeindenahe Versorgung braucht die Gemeinde, die sich sorgt. VIP-Verlag, Innsbruck (1998) Meise U, Kemmler G, Kurz M, Rössler W: Die Standortqualität als Grundlage psychiatrischer Versorgungsplanung. Das Gesundheitswesen 58, 29-37 (1996) Meise U., Sulzenbacher H., Eder B., Klug G., Schöny W., Wancata J.: Psychische Gesundheitsversorgung in Österreich – Eine Beurteilung durch unterschiedliche Gruppen von Psychiatriebetroffenen auf Grundlage der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Neuropsychiatr 20, 174-185 (2006). Meise U., Wancata J.: „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“Die Europäische Ministerielle WHOKonferenz für Psychische Gesundheit; Helsinki 2005. Neuropsychiatr 19, 151154 (2006) Miller C., H. Rinner, J. Wancata, H. Sulzenbacher, U. Meise: Verändert die Regionalisierung der stationären psychiatrischen Behandlung die Inanspruchnahme? Neuropsychiatrie 18, 47- 54 (2004) O’Brien M, Mortimer L, Singleton N, Meltzer H: Psychiatric morbidity among 241 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [52] [53] [54] women prisoners in England and Wales. International Review of Psychiatry 15, 153-157(2003) ÖBIG: Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2005 (ÖSG). Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien (2006) ÖBIG: Struktureller Bedarf in der psychiatrischen Versorgung. ÖBIG, Wien (1997) ÖBIG: Planung Psychiatrie 2007. Dokumentation der außerstationären psychiatrischen Versorgung; Gesundheit Österreich GmbH, Wien (2007) Österreichischer Rechnungshof: Psychiatrie auf dem Prüfstand. Zusammenfassung des Berichtes des ÖR über die psychiatrische Versorgung in Österreich: In Meise U, Hafner F, Hinterhuber H (Hrsg) Gemeindepsychiatrie in Österreich, 55-83. VIP-Verlag, Innsbruck (1998) Pfeffer- Gerschel T., Wittmann M., Hegerl U.: Die „Europäische Alliance Against Depression (EAAD)“- Ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung depressiv erkrankter Menschen. Neuropsychiatr 21; 51-55 (2007) pro mente austria: EU einig für psychische Gesundheit. Zeitschrift des österreichischen Dachverbandes der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit; Heft 2 (2005) pro mente austria: Sozialpsychiatrie: Neue Ziele durch klare Orientierung. Zeitschrift des österreichischen Dachverbandes der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit; Heft 4 (2005) Quadflieg N, Fichter MM: Ist die Zuweisung dauerhaften Wohnraums an Obdachlose eine effektive Maßnahme? Eine prospektive Studie über drei Jahre zum Verlauf psychischer Beschwerden. Psychiat Prax 2007; 34: 276-282 Rittmannsberger H, Sartorius N, Brad M, et al: Changing aspects of psychiatric inpatient treatment. A census investigation in five European countries. Eur Psychiatry, 19, 483-488 (2004) Roick C., A. Deister, D.Zeichner, T. Birker, H. König, M. C. Angermeyer: Das Regionale Psychiatriebudget: Ein neuer Ansatz zur effizienten Verknüpfung stationärer und ambulanter Versorgungsleistungen. Psychiat Prax 32, 177-184 (2005) Rössler W (Hrsg): Psychiatrische Rehabilitation, Springer-Verlag Berlin- Heidelberg-New York(2004) Rössler W, Meise U: Neue Trends in der psychiatrischen Versorgung: Neuropsychiatr 7, 171-175 (1993) Rössler W, Salize HJ, Häfner H: Gemeindepsychiatrie- Grundlagen und Leitlinien: Planungsstudie Luxemburg. VIP-Verlag, Innsbruck (1993) Meise, Wancata, Hinterhuber [55] Rutz W: Social psychiatry and public mental health: present situation and future objectives. Time for rethinking and renaissance? Acta Psychiatr Scand 113( Suppl 429), 95-100 (2006) [56] Salize HJ, Horst A, Dillmann-Lange C, Killmann U, Stern G, Wolf I, Henn F, Rössler: W Needs for Mental Health Care in Single Homeless People. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 36, 207-216 (2001) [57] Salize HJ, Schuh C, Krause M, Reichenbacher M, Stamm K, Längle G und die Schizophrenie-Projektgruppe Arbeitsrehabilitation: Senken arbeitsrehabilitative Maßnahmen während stationärpsychiatrischer Behandlung langfristig die Versorgungskosten von Patienten mit Schizophrenie? Ergebnisse einer kontrollierten Multizenterstudie. Psychiat Prax 2007; 34: 246-248 [58] Schanda H., T. Stompe, G. OrtweinSwoboda: Psychisch Kranke zwischen Psychiatriereform und Justiz: Die Zukunft des österreichischen Maßnahmenvollzuges nach § 21/1 StGB. Neuropsychiatrie 20, 40-49 (2006) [59] Spiel G., Petscharnig J.: Rehabilitation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Beispiel der beruflichen Integration von Jugendlichen. Neuropsychiatr 20; 118126 (2006) [60] Schrank B., Amering M.: „Recovery“ in der Psychiatrie. Neuropsychiatr 21, 4550 (2007). [61] Schwappach D. L. B.: Die ökonomische Bedeutung psychischer Erkrankungen und ihrer Versorgung – ein blinder Fleck? Neuropsychiatr 21, 18-28 (2007). [62] Stamm K, Merkel S, Mann K, Salize HJ: Welche Kosten verursachen alkoholkranke Versicherte? Eine Analyse aus Sicht einer Betriebskrankenkasse. Psychiat Prax 2007; 34: 194-199 242 [63] Thun-Hohensein L., Kessler D., ArdeltGattinger E.: Die Häufigkeit von Essstörungen und Vorläufersymptomen in einer ländlichen Kohorte junger Adoleszenter. Neuropsychiatr 20; 197-204 (2006) [64] Wancata J, Benda N, Hajji M, Lesch OM, Müller C: Psychiatric disorders in gynaecological, surgical and medical departments of general hospitals in an urban and rural area of Austria. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 31, 220-226 (1996) [65] Wancata J., Sobocki P., Katschnig H.: Die Kosten von „Gehirnerkrankungen“ in Österreich im Jahr 2004. Wien Klin Wochenschr 119; 91-98 (2007) [66] Wancata J, Kapfhammer HP, Schüssler G, Fleischhacker WW: Sozialpsychiatrie: Essentieller Bestandteil der Psychiatrie. Psychiatrie & Psychotherapie. 3, 58-64 (2007) [67] Wancata J., Freidl M., Friedrich F., Matschnig T., Unger A., Kucera A., Gössler R., Alaxandrowicz R.: Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? Neuropsychiatr 22; 83-91 (2008) [68] Stadt Wien: Psychiatrische und psychosoziale Versorgung in Wien. Stadt Wien, MA 17 Anstaltenamt (1979) [69] Weiss E., Marksteiner J., Hinterhuber H., Nolan K.A.: Geschlechtsunterschiede bezüglich aggressivem und gewalttätigem Verhalten bei schizophrenen und schizoaffektiven Patienten. Neuropsychiatr 20; 186-191 (2006) [70] Weltgesundheitsorganisation Europaregion: Europäischer Aktionsplan für psychische Gesundheit. Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen. http://www,euro.who.int/dokument/ mnh/gdoc07.pdf [71] Wißgott L: Richtlinien für die psychiatrische Versorgung: Grundsätze einer bedürfnisgerechten psychiatrischen Betreuung der Bevölkerung. In: Meise U., Hafner F Hinterhuber H..: Die Versorgung psychisch Kranker in Österreich. Eine Standortbestimmung. SpringerVerlag, Wien (1991) [72] World Health Organization: Mental Health Policy and Service Guidance Package: Mental Health Policy, Plans and Programmes. WHO, Genf (2004) [73] World Health Organization: The World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope. WHO, Genf (2002) [74] Zechmeister I, Oesterle A: Informelle Betreuung psychisch erkrankter Menschen: Schafft das österreichische Pflegevorsorgesystem adäquate Vorraussetzungen? Neuropsychiatr 21, 29-36 (2007) Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Department für Psychiatrie und Psychotherapie; Medizinische Universität Innsbruck [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 243–251 Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram Jochen Mutschler, Alexander Diehl, Christian Vollmert, Hans Herre, Karl Mann und Falk Kiefer Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim Schlüsselwörter Disulfiram, Alkohol, Abhängigkeit, Craving, Pharmakotherapie Keywords Disulfiram, alcohol, addiction, craving, pharmacotherapy Interessenkonflikt Es besteht kein Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen. Die Präsentation des Themas ist unabhängig und die Darstellung der Inhalte produktneutral. Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram Disulfiram ist inzwischen über 50 Jahre für die Behandlung der chronischen Alkoholabhängigkeit zugelassen. Gegenwärtig ist ein Anstieg an Verschreibungen von Disulfiram in Deutschland zu beobachten. Die Wirksamkeit beruht auf einer psychologischen Abschreckung vor einer möglichen Disulfiram-Alkohol© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Reaktion. Die vorliegende Übersicht umfasst die aktuelle klinische Bedeutung und mögliche Perspektiven von Disulfiram. Aktuelle klinische Studien, die Disulfiram in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit einsetzten, und die Kombination von Disulfiram mit neueren Anti-Craving-Substanzen werden vorgestellt. Erfahrungen und Ergebnisse einer Querschnittserhebung aus dem Mannheimer Disulfiram-Programm werden vorgestellt. Konsens besteht inzwischen darin, dass Disulfiram nur als Teil eines weitergehenden Therapieprogramms sein kann, dass z.B. auch die supervidierte Einnahme umfasst. Aufgrund der aktuellen Datenlage und der steigenden Verordnung erscheint es sinnvoll, eine Neueinschätzung des Stellenwerts des Wirkstoffes Disulfiram innerhalb der gegenwärtigen suchtmedizinischen Behandlungsstrategien vorzunehmen. Recent results in relaps prevention of alcoholism with Disulfiram Objective: For more than 50 years, disulfiram has been approved for the treatment of chronic alcohol dependence. In the last years there has been observed an increase in the prescription of disulfiram in germany. It acts as a psychological deterrence of a possible disulfiram-alcohol reaction. This paper describes the current clinical impact and possible future of disulfiram. Methods: Clinical trials using disulfiram for the treatment of alcohol dependence were discussed. Furthermore, the options of combining disulfiram with novel anti-craving agents were considered. Moreover, experiences and results of a cross section of the Mannheimer Disulfiram program will be presented. Results and conclusions: Nowadays there exists consent in the matter that Disulfiram should only be adminsitered as part of a comprehensive therapy program, this means in the context of an intake under medical supervision. This paper is supposed to help estimate the value of disulfiram in recent addiction medicine. Einleitung Alkoholerkrankungen stellen in Deutschland ein außerordentliches soziales und volkswirtschaftliches Problem dar: So gelten hierzulande mindestens 1,6 Millionen Menschen als aktuell manifest alkoholabhängig, zusätzlich konsumieren aktuell 3,2 Millionen Menschen Alkohol in riskantem Ausmaße [1]. Etwa 40 000 Todesfälle pro Jahr sind deshalb in Deutschland in der Folge direkt oder indirekt auf Alkohol zurückzuführen. Die Lebensqualität von alkoholabhängigen Menschen liegt dabei deutlich niedriger als bei anders chronisch erkrankten Patienten [2]. Mutschler et al. Genetische Disposition, psychosoziale Einflüsse und Umweltbedingungen spielen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung dieser chronischen-rezidivierend verlaufenden Erkrankung eine Rolle. Verschiedenste adaptive Veränderungen von Neurotransmittersystemen gehen dabei mit der Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit einher [3]. Erst in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts führte das zunehmende Wissen um die neurobiologischen Aspekte der Alkoholabhängigkeit zu der Einführung sogenannter Anti-Craving Substanzen: Es konnte der Nachweis einer Wirksamkeit für den NMDARezeptormodulator Acamprosat und den µ-Opiatrezeptor-Antagonisten Naltrexon erbracht werden, so dass diese Substanzen für die Indikation der Alkohol-Rückfallprophylaxe in vielen Ländern eine Zulassung erhielten (Naltrexon in Deutschland nur als „off-label“ Gebrauch bei Alkoholabhängigkeit einsetzbar). Die Dritte und mit über 50 Jahren in Deutschland bereits am längsten eingestzte Substanz zur AlkoholRückfallprophylaxe ist der Acetaldehyd-Dehydrogenase-Inhibitor Disulfiram. Gegenwärtig ist ein Anstieg an Verordnungen von Disulfiram in Deutschland zu beobachten: Die Verordnungen zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherungen in der ambulanten Krankenversorgung haben sich zwischen 2001 und 2005 um 22% erhöht. Diese Verordnungen umfassten 2005 1,1 Mio. definierte Tagesdosen (DDD) (2001: 0,9 Mio. DDD) [4]. Inwiefern Disulfiram angesichts der vielversprechenden pharmakologi­ schen Neuentwicklungen eine Rolle in der modernen Suchtmedizin spielt, bzw. welchen Stellenwert Disulfiram einnimmt, soll in der folgenden Übersicht unter Berücksichtigung der Effektivität und Nebenwirkungen von Disulfiram nachgegangen werden. Dazu wurde Literatur bis 09/2007 in PUBMED unter den Schlüsselwörtern disulfiram, antabuse, alcohol dependence, addiction und pharmacotherapy 244 einbezogen. Es wurden klinische Studien berücksichtigt, welche Disufiram bei Alkoholabhängigkeit untersuchten. Weiterhin wurde anhand der vorhandenen Datenlage eine Bewertung von Implantaten und der Möglichkeit einer pharmakologischen Kombi­nationstherapie unternommen. zu einer Akkumulation von Diethyldithiocarbamat während der Behandlung kommen, welche zu einer Hemmung der Cytochrom P450 Enzyme führt, was wiederum die Bildung weiterer aktiver Metabolite und eine ADR verhindert. Pharmakologie von Disulfiram Disulfiram hemmt irreversibel die Aldehyd-Dehydrogenase, die für den Abbau von Acetaldehyd zu Acetat beim Alkoholabbau verantwortlich ist. Es werden noch weitere Enzyme durch Disulfiram gehemmt, z.B. die Dopamin-β-Hydroxylase und hepatische mikrosomale Enzyme [5]. Die Akkumulation von Acetaldehyd führt zu der sogenannten Disulfiram-Alkohol-Reaktion (ADR) mit folgendem, bereits rasch nach Alkoholkonsum auftretenden vegetativen Symptomkomplex bestehend aus: Übelkeit, Hautrötung (flush), Schwitzen, Kopfschmerz, Herzklopfen, Hypotonie bis hin zu lebensbedrohlichen Reaktionen wie Herzrhythmusstörungen, Synkopen, Herzinfarkt und cerebrale Krampfanfälle. Diese höchst unangenehmen Folgen sollen über ihre psychologisch aversive Wirkung zur Unterdrückung des Trinkverhaltens führen. Es existiert eine individuelle Dosisabhängigkeit für die Schwere der ADR. Einige Patienten entwickeln nach Einnahme von Disulfiram keine ADR. Dies liegt daran, dass nicht Disulfiram sondern sein aktiver Metabolit Diethyldithiocarbamat für die ADR verantwortlich ist, welcher von CYP2E1, CYP3A4 und CYP2A6 der Cytochrom P450 Enzymfamilie produziert wird. Eine Inaktivität dieser Enzyme mit in der Folge ausbleibender ADR kann genetische, organische (Lebererkrankungen) oder medikamentöse (Interaktionen mit z.B. Erythromycin) Ursachen haben. Letztlich kann es sogar durch die Behandlung mit Disulfiram selbst Abbildung 1: Wirkmechanismus von Disulfiram beim Abbau von Ethanol: Disulfiram hemmt die Aldehydde­hydrogenase und ver­hindert dadurch die Meta­ bolisierung von Ace­taldehyd zu Acetat. Abbk.: NAD: Nikotinamidadenindinukleotid, NADH: reduziertes NAD. Abbildung modifiziert nach R. M. Swift, 1999. Nach einer Eindosierungsphase von Disulfiram unter kontrollierter absoluter Alkoholabstinenz erfolgt die Fortführung mit einer Tagesdosis von 0,2-0,4 g. Auch eine Verabreichung von 1-2 g wöchentlich ist unter ärztlicher Kontrolle aufgrund der langen Halbwertszeit von Disulfiram möglich. Die Wirkung endet im Allgemeinen 1-4 Tage nach der letzen Einnahme, kann im Einzelfall aber noch bis zu 14 Tage anhalten. Von der Durchführung eines Probetrunks ist man aufgrund pragmatischer Erwägungen weitgehend abgekommen zugunsten einer sehr genauen Aufklärung des Patienten über die speziellen Risiken der Therapie; dieses Vorgehen ist aber nicht unumstritten, gefordert Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram werden hierzu Untersuchungen zur Notwendigkeit einer erlebten ADR als mögliche Voraussetzung einer erfolgreichen Therapie [6]. Nebenwirkungen von Disulfiram als Substanz selbst, die ohne Alkoholkonsum auftreten können, sind relativ mild und beinhalten: Müdigkeit, Kopfschmerzen, allergische Dermatitis, unangenehmer Körpergeruch und sexuelle Dysfunktionen. Durch Hemmung der Dopamin-β-Hydroxylase führt Disulfiram zu erhöhten cerebralen Dopaminspiegeln, was selten zu psychotischen Symptomen führen kann. Potentiell gefährlich sind die toxische Hepatitis (ca. 1 von 25 000 behandelten Patienten) und die Laktat-Azidose. Kontraindikationen ergeben sich für Patientinnen in der Schwangerschaft, akuten psychotischen Erkrankungen, Patienten mit kardiovaskulären, zerebrovaskulären Erkrankungen, Ösophagusvarizen und Hyperthyreose. Außerdem ist Disulfiram bei Patienten kontraindiziert, welche an einer dekompensierten Leberzirrhose erkrankt sind und bei unzureichendem Verständnis der ADR als Abschreckung, z.B. im Rahmen einer Intelligenzminderung oder cerebralen Erkrankung. Wechselwirkungen mit Disulfiram entstehen vorwiegend durch Beeinflussung der Pharmakokinetik, insbesondere bei einer gleichzeitigen Metabolisierung über das Cytochrom P450 System. Der Einfluss von Disulfiram auf das Cytochrom P 450 System tritt mit einer gewissen Latenz auf und ist Dosisabhängig. Substanzen die während einer Behandlung mit Disulfiram zu höheren Plasmaspiegeln bzw. einer längeren Halbwertszeit führen sind: Warfarin, Metronidazol, Phenytoin, Theophyllin, Amitriptylin und Benzodiazepine wie z.B. Diazepam und Chlordiazepoxid (nicht Oxazepam und Lorazepam). Disulfiram führt zu einer Demethylierung von Diazepam und von Chlordiazepoxid, was zu einem erhöhten Sedationsef- fekt der entsprechenden Pharmaka führen kann. Chlorpropamid und verschiedene Antibiotika wie Cefamandol, Cefotaxim und Metronidazol können ebenfalls ADR-ähnliche Reaktionen auslösen und im Rahmen einer Behandlung mit Disulfiram eine ADR verstärken. Durch eine Beeinflussung des zentralen MonoaminStoffwechsels kommt es gehäuft zu psychiatrischen Nebenwirkungen wenn Disulfiram mit Metronidazol, Isoniazid oder Amitriptylin kombi­ niert wird [7]. Klinischer Einsatz von Disulfiram Frühe Berichte beschrieben oft eine ausgezeichnete Wirksamkeit, dabei aber auch das Auftreten zahlreicher und schwerer Nebenwirkungen von Disulfiram [8]. Im Gegenzug hierzu wurden mehrfach kasuistisch Fälle berichtet, bei denen Patienten im Rahmen einer schwerer ADR verstarben, was zu einer entsprechenden Kontroverse bezüglich Disulfiram geführt hat. Bemerkenswert im Hinblick auf die berichteten häufig auftretenden Nebenwirkungen ist die vor einem halben Jahrhundert im Vergleich zu heute ausgesprochen hohe eingesetzte Tagesdosis von 1000 bis 3000 mg Disulfiram. Dennoch war Disulfiram in den 50er und 60er Jahren populär und wurde als „Heilmittel“ gegen den Alkoholismus gefeiert. Während in einigen Ländern wie z.B. England und Skandinavien Disulfiram in den letzten Jahrzehnten breitflächig eingesetzt wurde, gab es in Deutschland in den letzten Jahrzehnten keine nennenswerten Verordnungen mehr. Erst der Einsatz von Anti-Craving-Substanzen hat Disulfiram zur medikamentösen Alkohol-Rückfallprophylaxe in Deutschland wieder vermehrt in den Blickpunkt der Suchtmedizin gerückt. Der erste Wirkstoff in der pharmakologischen Therapie des Alkoholismus 245 wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts zufällig entdeckt: Zur Optimierung der industriellen Gummiherstellung wurde Tetraethylthiuram disulfiram, ein Thiuram Derivat, eingesetzt. Erstmalig erkannt E. Williams 1937 das Potential von Tetraethylthiuram disulfiram, nachdem Arbeiter, die dieser Substanz ausgesetzt waren, unangenehme Symptome nach dem Trinken von Alkohol entwickelten [9]. Wenige Jahre später stießen die Dänen Hald und Jacobsen erneut zufällig auf die Disulfiram-AlkoholReaktion bei ihren Forschungen zu Antihelminthika und begannen den Einsatz mit Martensen-Larsen erstmals klinisch zu erproben. Vorzugsweise ältere Studien mit Disulfiram sind aus methodologischen Gesichtspunkten oft als ungenügend zu bewerten, da meistens Kontrollgruppen oder eine Verblindung fehlen. Hughes und Cook haben in ihrer Übersichtsarbeit dargestellt, dass ausschließlich 62,5% von 24 Untersuchungen zu Disulfiram zwischen 1967-1995 als überwachte Medikamenten-Ausgabe erfolgten und lediglich 4 % methodisch als Doppelblind-Untersuchung durchgeführt wurden. Objektive Zielkriterien wurden in 83% angewendet, eine statistische Analyse kam gar nur bei 67% der Untersuchungen zum Einsatz [10]. Diese und weitere methodische Probleme der älteren Untersuchungen, wie z.B. fehlende Beachtung der Compliance, zu kurze Follow-up Periode, fehlende psychotherapeutische Begleitung und fehlende Randomisierung der Patienten, führten zu einer eher negativen Bewertung der Effektivität von Disulfiram in Deutschland. Erst 1986 publizierten Fuller und Mitarbeiter Ergebnisse einer groß angelegten, randomisierten, kontrollierten Multicenterstudie, bei der sie 605 amerikanische Veteranen mit bestehender Alkoholabhängigkeit über 1 Jahr untersuchten. Die Patienten wurden in drei Gruppen Mutschler et al. eingeteilt: (1) Tagesdosis von 250 mg versus (2) 1 mg Disulfiram und eine Kontrolle, welche (3) Placebo erhielt. Die Teilnehmer beider Disulfiram-Gruppen wussten, dass sie Disulfiram bekamen, jedoch nicht in welcher Dosierung. Es folgten 7 ambulante Nachuntersuchungen über 1 Jahr mit Befragungen der Patienten, sowie Blut- und Urin-Kontrollen auf Ethanol zu Überprüfung der Patientenangaben. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der Gruppen hinsichtlich der Gesamt-Abstinenz, der Zeit bis zum ersten Alkoholkonsum, einem bestehenden Arbeitsverhältnis, der Ergebnisse der Urin- und Blutuntersuchungen auf Ethanol und der sozialen Stabilität. Die Gruppe der abstinenten Patienten betrug 19% in der Disulfiram-Gruppe im Vergleich zu 16% in der Kontrollgruppe, ohne einen signifikanten Unterschied aufzuweisen. Allerdings kam es in der Verum-Gruppe (250 mg Disulfiram Tagesdosis) zu einer signifikanten Reduktion der Anzahl der Trinktage von 87 auf 49 im Vergleich zu der Placebogruppe. Es zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen durchgängiger Abstinenz während der Studiendauer und kontinuierlicher Studienteilnahme (Compliance) in allen drei Gruppen. Nur eine sehr kleine Anzahl Patienten der Verumgruppe (20% von 577 Patienten) verblieb allerdings bis zum Ende in der Studie. Die Autoren kamen letztlich zu dem Ergebnis, dass Disulfiram zwar helfen könnte, die Trinkfrequenz zu reduzieren, aber nicht zu einer dauerhafteren kontinuierlichen Aufrechterhaltung einer Abstinenz verhelfe [11]. Günstigere Ergebnisse wurden von Chick 1992 berichtet [12]: Eine überwachte, ambulante Gabe von Disulfiram wurde über sechs Monate im Rahmen einer randomisierten, partiell verblindeten Studie an 126 Patienten untersucht. Dabei erhielten die Patienten entweder 200 mg Disulfiram oder 100 mg Vitamin C. Die Einnahme der Medikation wurde unter 246 Aufsicht sichergestellt. Die Rate der Patienten, welche in der Studie bis zum Ende verblieben, war in beiden Gruppen gleich groß. Die DisulfiramGruppe zeigte im Vergleich zur Vitamin C-Gruppe eine signifikant höhere Anzahl an abstinenten Tagen (100 vs. 69) und eine geringere Anzahl von konsumierten alkoholischen Getränken (1448 vs. 2572) während der untersuchten 6 Monate. Trotz eines fehlenden Unterschiedes in Summe und Frequenz des Trinkens in den letzten 4 Wochen der Studie zeigt sich, dass Disulfiram unter Aufsicht ausgegeben eine effiziente Therapiemöglichkeit darstellen kann. In zwei kürzlich erschienen, offen und randomisierten Studien von De Sousa und De Sousa wurde die Effektivität von Acamprosat [13] und Naltrexon [14] direkt mit Disulfiram verglichen. Untersucht wurden dabei über einen Zeitraum von 8-12 Monaten jeweils 100 alkoholkranke, familiär gut eingebundene, für eine Therapie motivierte Männer. Zusätzlich zur Medikation wurde wöchentliche Gruppen-Psychotherapie angeboten. Sämtlichen Teilnehmern war das individuell eingesetzte Medikament bekannt. Regelmäßig wurden Craving, Alkoholkonsum und Nebenwirkungen erfasst. Am Ende der Studie waren noch 93% [13] bzw. 97% [14] der Patienten in Kontakt mit der Klinik. Ein Rückfall trat dabei hoch signifikant später in der Disulfiram-Gruppe, verglichen mit der Acamprosat-Gruppe auf (123 vs. 71 Tage) [13]. Auch mit Naltrexon verglichen traten Rückfälle bei Disulfiram behandelten Patienten signifikant später auf (nach 119 vs. 63 Tagen) [14]. 88% [13] bzw. 86% [14] der Patienten mit Disulfiram waren während der kompletten Studiendauer abstinent, bei Patienten mit Acamprosat waren dies nur 46% [13], bei Naltrexon 44% [14]. Das AlkoholCraving war hingegen bei Patienten mit Acamprosat und Naltrexon signifikant niedriger gegenüber Patienten, die mit Disulfiram behandelt wurden. Die Autoren folgern, dass Disulfiram sich bei Patienten mit guter familiärer Unterstützung eignet, um Rückfälle zu verhindern, aber weitere Studien notwendig sind, um diese Medikamente erfolgreich einsetzen zu können [13]. Für schwer alkoholkranke Patienten wurde 1993 in Göttingen von Ehrenreich und Mitarbeitern eine ambulante Langzeit-Intensivtherapie entwickelt (ALITA). Ein wesentlicher Aspekt in diesem Programm ist dabei neben regelmäßigen Kurzgesprächen, Therapeutenrotation, Förderung der sozialen Reintegration mit aggressiver Nachsorge, regelmäßigen Urinuntersuchungen auf Alkohol, die überwachte Gabe von Acetaldehyd-Dehydrogenase-Hemmstoffen. In einem Follow-up Zeitraum von 9 Jahre erbrachte diese Behandlung bei 180 Patienten eine kumulative Abstinenzwahrscheinlichkeit von > 50% [15]. 26% der Patienten konsumierten während des 9-jährigen Zeitraumes keinerlei Alkohol. Die genauere Analyse nach Abstinenzbruch (= lapses, d.h. jegliche Art von Alkoholkonsum, gefolgt von sofortiger Umkehr zur Abstinenz und Therapiefortführung) und „Rückfällen“ (= relapses, d.h. Aufnahme von Alkohol, gefolgt von fortgesetztem starken Trinken und Abbruch der Therapie) ergab, dass die tatsächliche Rückfallquote ein Jahr nach Therapieende 30% im Gegensatz zu 70% bei den Kontrollen betrug. Das sofortige Intervenieren nach einem Abstinenzbruch durch eine Krisenintervention hat bei 30% der Patienten die Entwicklung eines „Rückfalles“ verhindert. Im Rahmen der ambulanten Behandlung kam es neben einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenrate auch zu einem signifikanten Rückgang der komorbiden psychiatrischen Störungen insbesondere von Angststörungen und depressiven Syndromen. Eingesetzt wurden in dieser Untersuchung Disulfiram oder Calciumcarbimid als Aversiva in Verbindung mit einer überwachten Medikamentenausgabe durch einen Therapeuten [16]. Design Design BehandlungsBehandlungsBehandlungsbedingung bedingung (Medikation/Tag) (Medikation/Tag) (Medikation/Tag) Alkoholabhängigkeit Alkoholabhängigkeit (DSM-IV) Disulfiram 200 (DSM-IV) Disulfiram 200 mg mgmg = 126 N =N126 Alkoholabhängigkeit Alkoholabhängigkeit (DSM-IV) Disulfiram 250 (DSM-IV) Disulfiram 250 mg mgmg = 606 N =N606 Patienten Patienten Alkoholabhängigkeit Alkoholabhängigkeit (DSM-IV) Disulfiram 250 mg (DSM-IV) Disulfiram 250 mg mg N = 100 N = 100 Offen randomisiert De SousaOffen randomisiert wöchentl. De Sousa et al. wöchentl. Gruppentherapie et al.(2005) Gruppentherapie (2005) 1. Acamprosat 1. Acamprosat (1,332-1,998 g) (1,332-1,998 g) Randomisiert, multizen+ optional Disulfiram Randomisiert, multizen+ optional Disulfiram trisch, Placebo-kontrol(n= 44%)Disulfiram Alkoholabhängigkeit (n= 44%) Placebo-kontrolBesson ettrisch, liert. Disulfiram zusätz2. Acamprosat Alkoholabhängigkeit (DSM-IV) zusätz2. Acamprosat Besson et liert.lich Disulfiram al. (1998) freiwillig. Tägliche 3. Placebo + (DSM-IV) N = 118 Tägliche 3. Placebo + KlinikDisulfiram al. (1998) lich Ausgabe freiwillig.durch N = 118 Ausgabe durch KlinikDisulfiram Mitarbeiter. 4. Placebo Mitarbeiter. 4. Placebo Disulfiram Dosierung Disulfiram Dosierung nicht berichtet. Dosierung nicht berichtet. 3 Verum-Gruppen: Randomisiert, multizen1. Disulfiram 250 3 Verum-Gruppen: Verum-Gruppen: trisch Alkoholabhängigkeit Randomisiert, multizenRandomisiert, multizenmg/d (open-label) 1. 250 1. Disulfiram Disulfiram 250 Petrakis trisch partiell verblindet. + Achse 1 psychiatritrisch Alkoholabhängigkeit Alkoholabhängigkeit 2. Naltrexon 50 mg/d mg/d (open-label) mg/d (open-label) et al. CAVE: 87 % der Pat. hatsche Störung Petrakis + Achse 1 psychiatripartiell verblindet. Petrakis partiell verblindet. + Achse 1 psychiatri3. Disulfiram 250 2. Naltrexon 50 mg/d 2. Naltrexon 50 mg/d te zusätzlich (DSM-IV) et al. al.(2005) CAVE: sche Störung CAVE: 87 % Pat. hatet 87 % der derein Pat.weiteres hatsche Störung mg (open-label) + 3. Disulfiram 250 3. Disulfiram 250 Psychopharmakon! N = 254 (2005) te zusätzlich zusätzlich ein (DSM-IV) (2005) te ein weiteres weiteres (DSM-IV) 50 mg/d mg (open-label) ++ mgNaltrexon (open-label) Psychopharmakon! N = 254 Psychopharmakon! N = 254 (verblindet) Naltrexon 50 Naltrexon 50 mg/d mg/d (verblindet) (verblindet) Alkoholabhängigkeit Alkoholabhängigkeit (DSM-IV) Disulfiram 250 mg (DSM-IV) Disulfiram 250 mg mg N = 100 N = 100 Offen Randomisiert, De SousaOffen De Sousa Randomisiert, wöchentl. et et wöchentl. al. (2004) Gruppentherapie al. (2004) Gruppentherapie Kombination von Disulfiram mit Acamprosat und/oder Naltrexon Kombination von Disulfiram mit Acamprosat und/oder Naltrexon Randomisiert, kontrolkontrolRandomisiert, Chick partiell verblindet, verblindet, Chick et alet al liert,liert, partiell (1992) supervidierte supervidierte Ausgabe! Ausgabe! (1992) Randomisiert, multizenmultizenRandomisiert, Fuller trisch, partiell doppeldoppelFuller et al.et al. trisch, partiell (2003) blind, blind, keine Supervision! Supervision! (2003) keine Disulfiram als Monotherapie Disulfiram als Monotherapie Autoren Autoren der Studie der Studie Placebo Placebo Placebo Placebo Placebo Placebo und optional und optional und optional Disulfiram Disulfiram (n= 40%) Disulfiram (n= (n= 40%) 40%) Acamprosat 2 g Acamprosat Acamprosat 22 gg Naltrexon 50 mg Naltrexon Naltrexon 50 50 mg mg 100 mg VitaminC 100 mg Vitamin 100 mg Vitamin CC Placebo Placebo Placebo 1mg mg Disulfiram 11 mg Disulfiram Disulfiram KontrollKontrollKontrollbedingung bedingung bedingung (Medikation/Tag) (Medikation/Tag) (Medikation/Tag) Abstinenzraten: Abstinenzraten: Abstinenzraten: Disulfiram 88% Disulfiram Disulfiram88% 88% Acamprosat 46% Acamprosat Acamprosat46% 46% signifikant signifikant signifikant Zeit bis zum Rückfall: Zeit bis Rückfall: Zeit bis zum zum123 Rückfall: Disulfiram Tage Disulfiram 123 Disulfiram 123 Tage Acamprosat 71Tage Tage Acamprosat 71 Tage Acamprosat signifikant 71 Tage signifikant signifikant 12 Wochen 12 12 Wochen Wochen Kumulative Abstinenztage Placebo 73% Kumulative Abstinenztage Kumulative Abstinenztage Naltrexon 80% Placebo 73% Placebo 73% Disulfiram+ Naltrexon 80% Naltrexon 80% Placebo 84% Disulfiram+ Disulfiram+ Disulfiram+ Placebo Placebo 84% 84% Naltrexon 82% Disulfiram+ Disulfiram+ Naltrexon Naltrexon 82% 82% Abstinenzraten Placebo 66% Abstinenzraten Abstinenzraten Naltrexon 64% Placebo Placebo66% 66% Disulfiram+ Naltrexon Naltrexon64% 64% Placebo 77% Disulfiram+ Disulfiram+ Disulfiram+ Placebo Placebo77% 77% Naltrexon 71% Disulfiram+ Disulfiram+ Naltrexon Naltrexon71% 71% Kumulative Kumulative Kumulative Abstinenztage: Abstinenztage: Abstinenztage: Placebo 14% Placebo Placebo14% 14%31% Acamprosat Acamprosat 31% Acamprosat 31% Disulfiram 31% Disulfiram Acamprosat + Disulfiram31% 31% Acamprosat ++ Disulfiram 51% Acamprosat Disulfiram signifikant Disulfiram51% 51% signifikant signifikant Abstinenzraten: Abstinenzraten: Abstinenzraten: Disulfiram 86% Disulfiram 86% Disulfiram44% 86% Naltrexon Naltrexon 44% Naltrexon 44% signifikant signifikant signifikant Anzahl abstinente Anzahl Anzahlabstinente abstinente Tage: Tage: Tage: Disulfiram100 Disulfiram100 Disulfiram100 Placebo 69 Placebo Placebo69 69 signifikant signifikant signifikant Anzahlder derkonsumierten konsumierten Anzahl Anzahl der konsumierten Getränke Getränke Getränke Disulfiram1448 1448 Disulfiram Disulfiram 1448 Placebo2572 2572 Placebo Placebo 2572 signifikant signifikant signifikant Zeit bis zum Rückfall: Zeit bis Rückfall: Zeit bis zum zum119 Rückfall: Disulfiram Tage Disulfiram 119 Tage Disulfiram 119Tage Tage Naltrexon 63 Naltrexon 63 Tage Naltrexon signifikant63 Tage signifikant signifikant Trinktage: Trinktage: Disulfiram Disulfiram 49 Disulfiram49 49 Placebo 87 Placebo Placebo87 87 signifikant signifikant signifikant Abstinenzrate: Abstinenzrate: Abstinenzrate: Disulfiram1% 1% Disulfiram Disulfiram 1% Placebo16% 16% Placebo Placebo 16% nichtsignifikant signifikant nicht nicht signifikant Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Abstinenzraten nach 30 Abstinenzraten nach Abstinenzraten nach 30 30 Tagen Behandlung: Tagen Tagen Behandlung: 40 vonBehandlung: 55 (73%) Acam­ Behandlungsdauer 40 von Acam­ 40 von 55 55 (73%) (73%) Acam­ prosat beh. Patienten, Behandlungsdauer Behandlungsdauer 360 Tage, Follow prosat beh. Patienten, prosat beh. Patienten, verglichen mit 26 von 360 Follow 360upTage, Tage, Follow weitere 360 verglichen mit 26 von 55 (43%) Placebo beh. verglichen mit 26 von up Tage360 up weitere weitere 360 55 (43%) Patienten 55 (43%) Placebo Placebo beh. beh. Tage Tage Patienten signifikant Patienten signifikant (p = 0.019) signifikant (p (p == 0.019) 0.019) 8 Monate 88 Monate Monate 12 Monate 12 12 Monate Monate Monate 666Monate Monate 12Monate Monate 12 12 Monate Dauerder der Dauer Dauer der Behandlung Behandlung Behandlung Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram 247 Tabelle 1: Zusammenfassung von Studien zur Wirksamkeit von Disulfiram bei alkoholabhängigen Patienten Mutschler et al. Kombination von Disulfiram mit Acamprosat oder Naltrexon Eine gänzlich neue Gruppe von Psychopharmaka stellen die sogenannten „Anti-Craving“ Substanzen dar. Die Wirksamkeit der zugelassenen Einzelsubstanzen (Naltrexon, Acamprosat) sowie derer Kombination wurde in den letzten Jahren mehrfach in großen Studien und Metaanalysen dokumentiert [17, 18]. Dabei scheint die Kombination von Naltrexon und Acamprosat günstigere Behandlungsergebnisse zu erbringen als die Anwendung der Einzelsubstanzen [19]. Erstmals berichteten Landabaso und Mitarbeiter 1999 Ergebnisse einer Untersuchung, bei der sie Disulfiram mit Naltrexon kombinierten. Dabei wurden alkoholabhängige Patienten in 2 Gruppen über einen Zeitraum von 2 Jahren untersucht: (1) eine Gruppe erhielt 6 Monate lang 25 mg Naltrexon + Disulfiram gefolgt von 6 Monaten ausschließlich Disulfiram vs. (2) eine Gruppe, welche Disulfiram über 1 Jahr erhielt. Naltrexon wurde dabei mit 25 mg in der halben üblichen Dosierung eingesetzt. Nach einem Jahr waren 73% der Naltrexon + Disulfiram Gruppe abstinent im Vergleich zu 20% der Disulfiram Gruppe. Nach 2 Jahren waren noch 40% der Kombinationsgruppe abstinent, während dies bei der Disulfiram Gruppe bereits keiner mehr war [20]. Es existierte in der Untersuchung keine Gruppe, bei der ausschließlich Naltrexon eingesetzt worden war. Somit konnte ein additiver Effekt beider Substanzen nicht nachgewiesen werden. Petrakis und Mitarbeiter untersuchten kürzlich die Effektivität der Kombination von Naltrexon (50 mg/Tag) mit Disulfiram (250 mg/Tag) bei 254 Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit und einer weiteren bestehenden psychiatrischen Erkrankungen der „Achse 1“ nach DSM-IV. Es wurden dabei Patienten einbezogen mit 248 zusätzlich bestehender Depression, posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD), Schizophrenie, Bipolar Störung, schizoaffektiver Störung und Kokainabhängigkeit. Die häufigste psychiatrische Komorbidität war mit 70 % die Depression. Primäres Behandlungsziel war die Behandlung der Alkoholabhängigkeit. Untersucht wurden in dieser randomisierten Studie 4 Gruppen über 12 Wochen: (1) Disulfiram + Naltrexon vs. (2) Naltrexon vs. (3) Disulfiram + Placebo vs. (4) Placebo. Die Zuteilung zu den Gruppen erfolgte randomisiert, für Disulfiram offen und für Naltrexon doppel-blind. Insgesamt beendeten 65 % der Patienten die Behandlung regulär. Patienten, die mit einem Verum behandelt wurden, erreichten eine signifikant längere Abstinenzzeit und geringeres Craving im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dabei betrug die mittlere Dauer ohne Alkoholkonsum in der Kombinationsbehandlung Disulfiram/Naltrexon 69,2 Tage, bei Disulfiram/Placebo 70,5 Tage, bei Naltrexon 67,2 Tage und bei Placebo 61,0 Tage. Es zeigte sich ein signifikant günstigeres Behandlungsergebnis bei Patienten der Verum-Gruppe im Vergleich zu Placebo. Es fand sich aber kein Vorteil der Kombination von Naltrexon mit Disulfiram [21, 22]. Im Rahmen einer kontrollierten Multicenterstudie wurden von Besson und Mitarbeiter 118 Patienten mit Acamprosat vs. Placebo über einen Zeitraum von 360 Tagen behandelt [23]. Freiwillig konnte zusätzlich Disulfiram eingenommen werden. Primär sollte in dieser Untersuchung die Effektivität von Acamprosat untersucht werden. Hinsichtlich Rückfall-Rate und kumulativer Abstinenz war Acamprosat gegenüber Placebo signifikant überlegen, die zusätzliche Einnahme von Disulfiram verbesserte die Behandlungsergebnisse zusätzlich. Die kumulative Abstinenzdauer der Patienten ohne Medikation betrug 50 Tage, bei Acamprosat 100 Tage, bei Disulfiram 112 Tage und bei der Kombination beider Medikamente 185 Tage. Es traten keine Interaktionen zwischen Acamprosat und Disulfiram auf. Diese Ergebnisse lassen allerdings nur eine bedingte Beurteilung der Effekte zu einer kombinierten Therapie zu, da die zusätzliche Einnahme von Disulfiram in der Untersuchung einerseits optional war und die Disulfiram-Patientengruppe mehr Therapeutenkontakte hatte. Außerdem war die Abbruch-Rate in beiden Patienten Gruppen mit 65% hoch [23]. Das Mannheimer „Antabus-Programm“ In der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit wird Disulfiram inzwischen seit nahezu 10 Jahren bei alkoholabhängigen Patienten eingesetzt. Die Zahl der Disulfirambehandelten Patienten steigt dabei kontinuierlich. In Mannheim werden aktuell bis zu 50 alkoholabhängige, sowie ein kokainabhängiger Patienten im „Antabus-Programm“ behandelt. Nach Ausschluss von Kontraindikationen, ausführlicher Aufklärung und schriftlicher Zustimmung des Patienten erhalten die Patienten täglich Disulfiram unter Sicht im stationären Rahmen. Es folgt die ambulante Weiterbehandlung mit zunächst täglicher Vorstellung und Einnahme von Disulfiram unter ärztlicher Ausgabe. Nach einer Woche wird das Intervall der Vorstellungen und Medikamentenausgabe auf dreimal wöchentlich reduziert. Neben der Induktion einer Alkoholunverträglichkeit durch überwachte Ausgabe von Disulfiram kommen weitere therapeutische Elemente zum Tragen: Regelmäßige ärztliche Kurzgespräche, die bei Bedarf über ein kurzes Counseling hinausgehen, Ermutigung und Motivation zum Besuch von Selbsthilfegruppen, bei Bedarf Urin- und Laboruntersuchungen Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram sowie weitergehende psychiatrische Diagnostik und Therapie. Den Patienten wird empfohlen, zumindest 1 Jahr am Programm teilzunehmen, ggf. ist im Einzelfall eine längere Teilnahme sinnvoll und notwendig. Eine Querschnittserhebung zeigt, dass die Patienten bei Aufnahme in das Programm durchschnittlich 44 Jahre alt und 16 Jahre alkoholabhängig sind. Der zuletzt bestehende tägliche Alkohol-Konsum betrug durchschnittlich 378 Gramm reinen Alkohol und die Patienten hatten im Durchschnitt bereits zwölf stationäre Entgiftungen bzw. suchtspezifische Therapien absolviert. Die aktuell behandelten Patienten (35 Männer, 10 Frauen) werden durchschnittlich seit 16 Monaten im Antabus-Programm behandelt. 53% (n =24/45) der Patienten blieb in diesem Zeitraum komplett abstinent (kein relapse/lapse). Die maximale Abstinenzzeit vor dem Start der Behandlung mit Antabus betrug 4,5 Wochen (Median). Ein Drittel der Patienten (n = 15) berichtet über keinerlei Nebenwirkungen. Die am häufigsten berichtete Nebenwirkung (vorwiegend in der Einstellungsphase) bei knapp 50% der Patienten (n = 22/45) war Müdigkeit. Vereinzelt wurden Kopfschmerzen (n = 2), Juckreiz (n = 1), Durchfall (n = 1), sexuelle Dysfunktion (n = 2) und neurologische Nebenwirkungen (Polyneurophathie; n = 1) als Nebenwirkung berichtet. Potentiell gefährliche Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Zusammenfassung und Dis­kussion Alkohol-Aversiva erbrachten in aktuellen Meta-Analysen niedrige bis mittlere Effektstärken [24, 25]. Dies liegt neben fehlenden einheitlichen Variablen für Therapieerfolg und unterschiedlicher Studienpopulation u.a. an den bereits erwähnten methodologischen Schwierigkeiten, Un- tersuchungen mit Disulfiram durchzuführen. Aufbau und begleitendes Gesamttherapiekonzept der Studien zu Disulfiram erscheinen äußerst heterogen. Ein wesentlicher Aspekt, weshalb Disulfiram teils ungünstige Studienergebnisse mit schwacher Effektivität erbrachte, ist die Tatsache, dass die Compliance ausgesprochen gering war, wenn Disulfiram den Patienten zur freien Einnahme überlassen wurde [11]. Um dem Problem der mangelnden Compliance bei der oralen Disulfirameinnahme entgegenzuwirken, wurde bereits frühzeitig versucht, Disulfiram-Implantate einzusetzen [26, 27]. Wilson und Mitarbeiter setzten sich früh intensiv mit Disulfiram-Implantaten auseinander. Letztlich blieben aber ihre Ergebnisse wie die neuerer Untersuchungen uneindeutig [10, 27]. Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Nebenwirkungen von Disulfiram und der fehlenden ärztlichen und psychotherapeutischen Begleitung erscheinen Implantate mit Disulfiram nicht empfehlenswert. Mittlerweile mehren sich Hinweise dafür, dass Disulfiram im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzeptes unter therapeutischer Aufsicht ausgegeben das Rückfallrisiko eindrücklich senken kann [12, 15]. Angesichts der Tatsache, dass mittels anderer etablierter und evidenzbasierter Therapieverfahren (z.B. der kognitiven Verhaltenstherapie) Abstinenzraten von lediglich 25 – 30% nach einem Jahr gefunden werden [28, 29], können ambulante Langzeitverfahren mit Alkohol-Aversiva als hilfreich erachtet werden. Selbst über einen längeren Zeitraum verabreicht kann Disulfiram sicher und gut verträglich eingesetzt werden [15]. Am ehesten scheinen dabei besonders impulsive und Patienten mit guter Compliance von einer Disulfiramtherapie zu profitieren [11]. Disulfiram gilt bisher in Fach- und Patientenkreisen häufig als „Therapie der letzten Wahl“, ausschließlich für 249 Patienten mit einer schweren Alkoholerkrankung. Nach Expertenmeinung wird Disulfiram gegenwärtig nicht generell außerhalb spezifischer Behandlungsprogramme empfohlen (Leitlinien der Dt. Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie und der Dt. Ges. für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde). Die aktuelle Datenlage spricht allerdings dafür, dass Disulfiram neben Naltrexon und Acamprosat auch bei weniger schwer erkrankten Alkoholabhängigen in der Wirksamkeit überlegen sein könnte [13, 14, 30]. Unklar bleibt die Frage, ob eine Kombination von Disulfiram mit Anti-Craving Substanzen eine Wirksamkeitssteigerung erbringen könnte. Pharmakodynamisch unterscheiden sich Disulfiram, Acamprosat und Naltrexon voneinander, so dass eine Kombination der unterschiedlichen Wirkprinzipien (psychologische Abschreckung, Reduktion Relief- und Reward-Craving) einen zusätzlichen Effekt erwarten ließe. Erste Hinweise auf einen additiven Effekt durch Kombination von Disulfiram mit Acamprosat bei guter Verträglichkeit und fehlenden Medikamenteninteraktionen existieren [31]. Letztlich kann aus klinischer Sicht aktuell im Einzelfall eine zeitlich begrenzte Kombinationstherapie unter Abwägung der Nebenwirkungen gerechtfertigt und sinnvoll erscheinen. Auf die eingangs gestellte Frage zurückkommend, herrscht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass Disulfiram immer noch eine wichtige Rolle in der Suchtmedizin einnimmt [32, 33, 34]. Für chronisch schwer erkrankte Alkoholabhängige wurden vielversprechende multimodale ambulante Programme mit Disulfiram in Deutschland mit Erfolg entwickelt und etabliert. Die Indikation für Disulfiram könnte sich außerdem noch ausweiten: Neue ermutigende Untersuchungen legen neben der Rückfallprophylaxe von Alkohol auch eine unabhängige Wirksamkeit in der Mutschler et al. Rückfallprophylaxe bei Kokainabhängigkeit nahe [35]. Als pharmakologischer Wirkmechanismus wird hier die Hemmung der Dopamin-β-Hydroxylase mit konsekutiver Änderung des dopaminergen Systems diskutiert. Neben dem bislang wenig untersuchten „psychologischen Effekt“ von Disulfiram, welcher Aspekte wie Abschreckung, therapeutisches Ritual bei der Medikamentenausgabe, (Auto-)Suggestion, positive/negative Verstärkung und Entwicklungspotential von neuen Coping-Strategien während der Abstinenz umfasst [32], mehren sich die Hinweise auf eine mögliche zusätzliche neurobiologische Wirkung. Vergleiche mit anderen Klassen von Psychopharmaka (z.B. Neuroleptika, Antidepressiva) ergeben bei „Entwöhnungsmitteln“ angesichts ihrer Effektivität einen medizinisch unplausiblen niedrigen Einsatz [35]. Dabei gibt es keinerlei Evidenzen, dass eine medikamentöse Rückfallprophylaxe die Bereitschaft für eine Inanspruchnahme zusätzlicher psychosozialer Therapien verringert, im Gegenteil scheint eine Pharmakotherapie diese Bereitschaft durch eine erhöhe Abstinenzquote noch zu erhöhen [36]. Fazit für die Praxis Disulfiram wird aus unserer Sicht angesichts der hohen Prävalenz der Alkoholabhängigkeit und der vorgestellten Datenlage offenbar zu wenig eingesetzt. Der Einsatz von Disulfiram im Rahmen strukturierter, multimodaler ambulanter Therapieprogramme kann als sicher und wirksam bezeichnet werden. Wünschenswert ist daher eine weitere Ausweitung entsprechender Behandlungsangebote mit paralleler wissenschaftlicher Evaluation der Ergebnisse. 250 Literatur [1] Bühringer G, Bergmann E, Bloomfield K, Funk W, Junge B, Kraus L, MerfertDiete C, Rumpf HJ, Simon R, Töppich J, Augustin R (2000) Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen in Deutschland, Nomos, Baden Baden [2] Donovan D, Mattson ME, Cisler RA, Longabaugh R, Zweben A (2005) Quality of life as an outcome measure in alcoholism treatment research. J Stud Alcohol Suppl.:119-139 [3] Weiss F and Porrino LJ (2002) Behavioral neurobiology of alcohol addiction: recent advances and challenges. J Neurosci 22:3332-3337 [4] Datenlieferungen nach § 300 SGB V, Wissenschaftliches Institut der AOK WIdO (2007) [5] Johansson B (1992) A review of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of disulfiram and its metabolites. Acta Psychiatr Scand Suppl 369:15-26 [6] Poikolainen K (2004) The disulfiramethanol reaction (DER) experience. Addiction 99:26-28 [7] Poulsen H.E. Disulfiram therapy ­adverse drug reactions and interactions. Loft S, Andersen J.R., Ander­sen M., editors. Acta Psychiatr Scand 1992; 86: 59-66 [8] Guild J and Epstein NB (1951) Psychosis during the treatment of alcoholism with tetraethylthiuram disulfide. Q J Stud Alcohol 12:360-366 [9] Williams EE (1937) Effects of alcohol on workers with carbon disulfide. JAMA 109: 1472-1473 [10] Hughes JC and Cook CC (1997) The efficacy of disulfiram: a review of outcome studies. Addiction 92:381-395 [11] Fuller RK, Branchey L, Brightwell DR, Derman RM, Emrick CD, Iber FL, James KE, Lacoursiere RB, Lee KK, Lowenstam I, . (1986) Disulfiram treatment of alcoholism. A Veterans Administration cooperative study. JAMA 19;256:14491455 [12] Chick J, Gough K, Falkowski W, Kershaw P, Hore B, Mehta B, Ritson B, Ropner R, Torley D (1992) Disulfiram treatment of alcoholism. Br J Psychiatry 161:84-9.:84-89 [13] De Sousa A and De Sousa A (2005) An open randomized study comparing disulfiram and acamprosate in the treatment of alcohol dependence. Alcohol Alcohol 40:545-548 [14] De Sousa A and De Sousa A (2004) A one-year pragmatic trial of naltrexone vs disulfiram in the treatment of alcohol dependence. Alcohol Alcohol 39:528-531 [15] Krampe H, Stawicki S, Wagner T, Bartels C, Aust C, Ruther E, Poser W, Ehrenreich H (2006) Follow-up of 180 alcoholic patients for up to 7 years after outpatient treatment: impact of alcohol deterrents on outcome. Alcohol Clin Exp Res 30:86-95 [16] Wagner T, Krampe H, Stawicki S, Reinhold J, Jahn H, Mahlke K, Barth U, Sieg S, Maul O, Galwas C, Aust C, KronerHerwig B, Brunner E, Poser W, Henn F, Ruther E, Ehrenreich H (2004) Substantial decrease of psychiatric comorbidity in chronic alcoholics upon integrated outpatient treatment - results of a prospective study. J Psychiatr Res 38:619635 [17] Mann K (2004) Pharmacotherapy of alcohol dependence: a review of the clinical data. CNS Drugs 18:485-504 [18] Mann K, Lehert P, Morgan MY (2004) The efficacy of acamprosate in the maintenance of abstinence in alcohol-dependent individuals: results of a meta-analysis. Alcohol Clin Exp Res 28:51-63 [19] Kiefer F, Jahn H, Tarnaske T, Helwig H, Briken P, Holzbach R, Kampf P, Stracke R, Baehr M, Naber D, Wiedemann K (2003) Comparing and combining naltrexone and acamprosate in relapse prevention of alcoholism: a double-blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 60:92-99 [20] Landabaso MA, Iraurgi I, Sanz J, Calle R, Ruiz de Apodaka J, Jimenez-Lerma JM, Gutierrez-Fraile M (1999) Naltrexone in the treatment of alcoholism. Twoyear follow up results. Eur J Psychiatry 13:97-105 [21] Petrakis IL, Poling J, Levinson C, Nich C, Carroll K, Ralevski E, Rounsaville B (2006) Naltrexone and disulfiram in patients with alcohol dependence and comorbid post-traumatic stress disorder. Biol Psychiatry 60:777-783 [22] Petrakis IL, Poling J, Levinson C, Nich C, Carroll K, Rounsaville B (2005) Naltrexone and disulfiram in patients with alcohol dependence and comorbid psychiatric disorders. Biol Psychiatry 57:1128-1137 [23] Besson J, Aeby F, Kasas A, Lehert P, Potgieter A (1998) Combined efficacy of acamprosate and disulfiram in the treatment of alcoholism: a controlled study. Alcohol Clin Exp Res 22:573-579 [24] Finney JW and Monahan SC (1996) The cost-effectiveness of treatment for alcoholism: a second approximation. J Stud Alcohol 57:229-243 [25] Miller WR and Wilbourne PL (2002) Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction 97:265-277 [26] Kellam AM and Wesolkowski JM (1968) Disulfiram implantation for alcoholism. Lancet 1:925-926 [27] Wilson A, Davidson WJ, Blanchard R, White J (1978) Disulfiram implantation. A placebo-controlled trial with two-year follow-up. J Stud Alcohol 39:809-81 [28] Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogeneity: Project MATCH (1997) posttreatment drinking outcomes. J Stud Alcohol 58:7-29 [29] Moos RH, Finney JW, Ouimette PC, Suchinsky RT (1999) A comparative Aktueller Stand der pharmakotherapeutischen Rückfallprophylaxe mit Disulfiram evaluation of substance abuse treatment: I. Treatment orientation, amount of care, and 1-year outcomes. Alcohol Clin Exp Res 23:529-536 [30] Berglund M (2005) A better widget? Three lessons for improving addiction treatment from a meta-analytical study. Addiction 100:742-750 [31] Besson J, Aeby F, Kasas A, Lehert P, Potgieter A (1998) Combined efficacy of acamprosate and disulfiram in the treatment of alcoholism: a controlled study. Alcohol Clin Exp Res 22:573-579 [32] Ehrenreich H and Krampe H (2004) Does disulfiram have a role in alcoholism treatment today? Not to forget about disulfiram‘s psychological effects. Addiction 99:26-27 [33] Fuller RK and Gordis E (2004) Does disulfiram have a role in alcoholism treatment today? Addiction 99:21-24 [34] Suh JJ, Pettinati HM, Kampman KM, O‘Brien CP (2006) The status of disulfiram: a half of a century later. J Clin Psychopharmacol 26:290-302 [35] Carroll KM, Fenton LR, Ball SA, Nich C, Frankforter TL, Shi J, Rounsaville BJ (2004) Efficacy of disulfiram and cognitive behavior therapy in cocainedependent outpatients: a randomized placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 61:264-272 [36] Fritze J (2005) Psychopharmaka-Verordnungen: Ergebnisse und Kommentare zum Arzneiverordnungsreport 2004. Psycho­neuro 31:46-52 251 [37] Kiefer F, Jahn H, Holzbach R, Briken P, Stracke R, Wiedemann K (2003) Die NACALM-Studie: Wirksamkeit, Verträglichkeit, Outcome. Sucht 49:342-35 Dr. med. Jochen Mutschler Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 252–260 Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen1 Monika Heinrich1, Andrea Berzlanovich3, Ulrike Willinger2 und Brigitte Eisenwort1 Zentrum für Public Health, Institut für Medizinische Psychologie, Medizinische Universität Wien 2 Department für Gerichtliche Medizin, Medizinische Universität Wien und Medizinische Fakultät, Universität München, Institut für Rechtsmedizin 3 Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Medizinische Universität Wien 1 Schlüsselwörter: Suizid – Abschiedsbriefe – kognitive Einengung – Sprachparameter Keywords: suicide – suicide notes – cognitive constriction – parameters Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen Anliegen: Ziel dieser Studie war die Messung des Ausmaßes der kognitiven Einengung in deutschsprachigen Abschiedsbriefen durch erprobte quantitative psycholinguistische Textmaße. Dies sollte einen besseren Einblick in das präsuizidale Geschehen geben und Anregungen zu Verbesserungen in den Bereichen Suizidprävention und Krisenintervention mit sich bringen. Methode: Als Grundlage dienten Briefe des „Vienna Corpus of Suicide Notes“. Zur Hypothesenprüfung wurden neben deskriptiven Verfahren eine Faktorenanalyse, Regressionsanalysen 1 Unveröffentlichte Diplomarbeit, Humanmedizin N202, Medizinische Universität Wien (2006). © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 und das Allgemeine Lineare Modell verwendet. Ergebnisse: Die 16 Parameter konnten auf fünf Faktoren kognitiver Einengung, nämlich Sprachstil, Wortart, Dichotomie, Brieflänge und Einfachheit, reduziert werden. In Bezug auf den Sprachstil wurden bei Frauen (p=0.005), jüngeren Personen (p≤0.000), in kürzeren Briefen (p=0.027) und bei psychischen Problemen als Suizidmotiv (p=0.020) die höchsten Werte kognitiver Einengung gefunden. Auch der Fundort der Briefe (p=0.002) spielte eine Rolle. Schlussfolgerungen: Bei dem Konstrukt der kognitiven Einengung handelt es sich um ein mehrdimensionales komplexes Phänomen. Bei der Quantifizierung müssen daher auch personen- und textbezogene Variablen berücksichtigt werden. Measurement of cognitive constriction in suicide notes Objective: The target of this paper was to quantify the amount of cognitive constriction in German-language suicide notes by studying quantitative psycholinguistic parameters of texts. This should give a better understanding of presuicidal events and encourage improvement in the field of suicide prevention and crisis intervention. Methods: The study is based on letters of the “Vienna Corpus of Suicide Notes”. To prove various hypotheses a factor analysis, a number of regression analyses, and the General Linear Model were applied, apart from descriptive methods. Results: The 16 parameters could be reduced to five factors of cognitive constriction, such as the writing style, the usage of words, the dichotomy, the length and the grammatical correctness of the suicide notes. Regarding the writing style the highest values of cognitive constriction were found among women (p=0.005), young persons (p≤0.000), in short letters (p=0.027) and if psychological problems were the motive for suicide (p=0.020). The discovery site of the letters (p=0.002) was important as well. Conclusions: The construct of cognitive constriction is a multidimensional and complex phenomenon. Therefore the quantification must contain variables of the persons and the texts. Einleitung Abschiedsbriefe sind persönliche Dokumente, welche zumeist unmittelbar vor einem Suizid verfasst wurden und Nachrichten an Hinterbliebene, unbekannte Finder oder an die Allgemeinheit beinhalten. Nach Schätzungen von Salib et al. [19] verfassen etwa 4 bis 43% aller Suizidentinnen und Sui­ Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen zidenten solche Dokumente. Ebenso können Form und Brieflänge sehr unterschiedlich sein. Die Ergebnisse der Forschung an Abschiedsbriefen sind sehr aufschlussreich, dürfen aber nur nach kritischer Hinterfragung in die Erklärungsmodelle der allgemeinen Suizidologie eingegliedert werden. Bereits Gottschalk & Gleser [9] betonten die Wichtigkeit der Kombination zweier Analyseebenen: „…an ‚atomistic’ level, i.e. types of words used, and a ‚molecular’ level, i.e. types of themes and combinations of themes used“. Durch die Entwicklung von qualitativen und quantitativen psycholinguistischen Untersuchungsmethoden wurde und wird versucht, ganz spezifische Merkmale von Abschiedsbriefen zu identifizieren, welche diese von Dokumenten nicht suizidgefährdeter Personen unterscheiden. Solche Charakteristika könnten anschließend dazu verwendet werden, Skalen zur Suizidgefährdung zu präzisieren und genauere Suizidvorhersagen treffen zu können – sie wären somit wichtige Bausteine für die Verbesserung der Suizidprävention, im Besonderen der sekundären Prävention. Das Phänomen der kognitiven Einengung wurde – nicht nur als wichtiger Faktor beim Suizid – oft beschrieben und erforscht und ist Bestandteil vieler Suizidtheorien. Brakel [3] diskutiert in ihrer Abhandlung über „ego constriction“ den vielfältigen Gebrauch dieses Begriffes. Sie selbst unterschied „ego inhibition …an internalized conflict“, „ego restriction …psychological pain triggered from an area in the outside world“ und „ego constriction” als Überbegriff. Das Ausmaß der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen ist sowohl von soziodemografischen, als auch von briefbezogenen Variablen abhängig. Ho et al. [10] fanden, dass Abschiedsbriefe von jungen Personen signifikant länger und emotionsreicher sind. Manche Autorinnen und Autoren zählen zu den Merkmalen der Einengung unter anderem die dynamische Einengung, das heißt die Ein- engung der Gefühlswelt. Diesen Annahmen zufolge wäre ein Emotionsreichtum bei einer sehr ausgeprägten kognitiven Einengung eher unwahrscheinlich, wonach kürzere Briefe und solche von älteren Personen ein größeres Ausmaß an kognitiver Einengung aufweisen müssten. In nur 25% aller Suizidfälle sind Hinweise auf eine Planung zu finden [20]. Impulsive Suizidhandlungen sind sehr häufig mit höheren Aggressionen verbunden [20], was sich in früheren oder präsuizidalen autoaggressiveren Handlungen äußert. Ebenso haben Männer, die statistisch gesehen häufiger Suizid begehen, nach einem Selbstmordversuch höhere Aggressionswerte als Frauen [2]. Dadurch wird angenommen, dass Personen mit einem höheren Aggressionspotential eine geringere Hemmschwelle für suizidale Handlungen haben und somit auch präsuizidal ein geringeres Ausmaß an kognitiver Einengung aufweisen. Bei depressiven Personen werden ebenfalls impulsive Suizidhandlungen mit einer geringeren kognitiven Einengung diskutiert. Diese Annahme beruht auf einer Studie von Roberts et al. [18], wonach Depressionen sehr stark mit dem Vorhandensein von Suizidgedanken assoziiert sind. Dieser Faktor deutet auf eine längere Geschichte aufgestauter suizidaler Phantasien hin, welche durch die Grunderkrankung selbst nicht verdrängt oder verarbeitet werden können. Neben Adaptionsprozessen könnten diese geballten Emotionen nach Überschreitung eines gewissen Niveaus plötzlich und unkontrolliert freigesetzt zu einer sehr impulsiven Suizidhandlung führen. Versuche zur Messung der kognitiven Einengung oder ähnlicher psychologischer Konstrukte sind in mehreren, vor allem englischsprachigen Arbeiten zu finden (vgl. [1], [2], [5], [8], [9], [14]-[17]) und beinhalten beispielsweise folgende Parameter: Silbenanzahl pro Wort, Type-Token-Ratio, Nomen-Verb/Adjektive-Adverb Ratio, Allness-Terms und Desorganisation [16], Silbenwiederholung nach 253 Mittenecker, mittlere Wortlänge und mittlere Häufigkeitsklasse [17], VerbAdjektiv-Quotient, auch Action-Quotient genannt [1], personenbezogene Wörter der zweiten und dritten Person, Substantive und Funktionswörter [9], Wort- und Buchstabenanzahlen [10], und Wörter, die Gewissheit ausdrücken [8] (siehe Appendix). Im Rahmen der vorliegenden Studie sollten die oben genannten quantitativen psycholinguistischen Parameter kognitiver Einengung in deutschsprachigen Abschiedsbriefen von Wiener Suizidentinnen und Suizidenten anhand von gerichteten Hypothesen untersucht werden. Nach einer faktorenanalytischen Abklärung, ob die verschiedenen Sprachmaße tatsächlich alle eine gemeinsame Dimension, nämlich die kognitive Einengung, messen, sollten Zusammenhänge zu verschiedenen soziodemografischen und briefbezogenen Variablen untersucht werden. Zusätzlich waren erkundende Hypothesen geplant. Material und Methoden Für die vorliegende Arbeit wurden Daten und Briefe des „Vienna Corpus of Suicide Notes“ [6]+[7] herangezogen. Dieses beinhaltet insgesamt 53 Briefe, Nachrichten und Notizen von 30 Suizidentinnen und Suizidenten, bei denen eine schriftliche Zustimmung der Angehörigen oder der Adressaten zur Verwendung für Forschungszwecke existiert. Eine Bewilligung der Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien liegt ebenfalls vor. Personen, gesundheitsund suizidbezogene Daten wurden aus Polizeiakten, Obduktionsgutachten und anhand von Gesprächen mit Angehörigen, Empfängern der Abschiedsbriefe oder Bekannten ermittelt. Die Mehrheit der Suizidentinnen und Suizidenten verfasste einen Abschiedsbrief (n=22). Es gibt aber auch Personen, die zwei (n=4), drei (n=2) oder mehrere (n=2) Schriftstücke zurückließen. Die Länge der Heinrich, Berzlanovich, Willinger, Eisenwort n % Allgemeinheit 20 39.7 Familienangehörige 19 35.8 in der Wohnung 31 58.5 neben der Leiche 17 32.1 46 86.8 5 9.4 29 54.7 254 n % 11 20.8 3 5.7 5 9.4 1 1.9 SMS 1 1.9 nein 24 45.3 Briefempfänger Freund / Bekannter offizielle Stelle der wiederholten Kovarianz wurde eine Autoregression erster Ordnung gewählt, ein Modell, das auf korrelierten Messzeitpunkten basiert. Auffindungsort sonstige Form Handschrift Schreibmaschine, PC E-Mail Unterschrift ja Tabelle 1:briefbezogene Variablen Briefe reicht dabei von 2 bis 10.740 Wörter (p25=15, p50=36, p75=119). Weitere briefbezogene Daten sind Tabelle 1 zu entnehmen. Alle herangezogenen Datensätze stammen aus einer Gesamtstichprobe von insgesamt 454 ausführlich dokumentierten Suizidfällen, die sich im Zeitraum von Mai 2002 bis April 2005 in Wien ereignet haben und konsekutiv am Institut für Gerichtsmedizin gesammelt wurden. Eine detaillierte Stichprobenbeschreibung und die genaue Vorgangsweise bei der Ermittlung der einzelnen Sprachparameter sind bei Eisenwort et al. [6]+[7] und im Appendix zu finden. Für alle Berechnungen wurde das Statistikprogramm SPSS 11.5 für Windows verwendet. Zur Überprüfung der Haupthypothese wurden Interkorrelationen und eine Faktorenanalyse berechnet. Die Faktorenanalyse ist eine Hauptkomponentenanalyse mit einer Eigenwerteextraktion von Werten größer als Eins und einer orthogonalen Rotation nach der VarimaxMethode. Zum Vergleich der Ergebnisse wurden Berechnungen sowohl nach Personen als auch nach Briefen durchgeführt. Die Überprüfung aller anderen Hypothesen erfolgte mithilfe schrittweise multipler linearer Regressionsanalysen und des Allgemeinen Linearen Modells. Als Typ Ergebnisse Die 16 aus der Literatur entnommenen quantitativen psycholinguistischen Parameter konnten – sowohl bei der Auswertung nach Personen, als auch bei der Auswertung nach Briefen – auf insgesamt fünf Faktoren kognitiver Einengung reduziert werden (siehe Tabelle 2), die von den Autorinnen Sprachstil, Wortart, Di- nach Personen (n=30) nach Briefen (n=53) 80.47% 76.19% Faktor 1 Sprachstil 21.19% Sprachstil 17.68% Faktor 2 Wortart 19.52% Brieflänge 16.22% Faktor 3 Dichotomie 18.14% Wortart 15.50% Faktor 4 Brieflänge 13.26% Dichotomie 14.60% Faktor 5 Einfachheit 8.37% Einfachheit 12.20% nach Personen (n=30) nach Briefen (n=53) Silbenzahl pro Wort* mittlere Wortlänge* mittlere Häufigkeitsklasse* Verb-Adjektiv-Quotient mittlere Wortlänge* Silbenzahl pro Wort* Verb-Adjektiv-Quotient mittlere Häufigkeitsklasse* Nom-Vb-Pro/Adj-Adv Ratio Nom-Vb/Adj-Adv Ratio 2.+3. Person Substantive Funktionswörter* Nom-Vb-Pro/Adj-Adv Ratio Nom-Vb/Adj-Adv Ratio 2.+3. Person Dichotomie Silbenwiederholung Type-Token-Ratio* Gewissheit Allness-Terms Gewissheit Silbenwiederholung Type-Token-Ratio* Allness-Terms Brieflänge Wortanzahl* Buchstabenanzahl* Wortanzahl* Buchstabenanzahl* erklärte Varianz Sprachstil Wortart Einfachheit * Fehler Fehler Substantive Funktionswörter* Parameter wurden vor der Faktorenanalyse umkodiert, sodass niedrigere Werte jeweils für eine geringere kognitive Einengung stehen. Tabelle 2:Ergebnisse der Faktorenanalysen Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen chotomie, Brieflänge und Einfachheit genannt wurden. Briefe, die von einer Person verfasst wurden, unterscheiden sich in Bezug auf das Ausmaß der kognitiven Einengung nicht signifikant voneinander. Aufgrund dieser Ergebnisse hielten die Autorinnen eine weitere Unterscheidung der Auswertungen nach Personen und nach Briefen nicht mehr für notwendig. Alle weiteren Resultate sind daher nur noch nach Personen dargestellt. Im Rahmen der Haupthypothesen wurden vermutete alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede im Ausmaß der kognitiven Einengung anhand der oben genannten Faktoren überprüft. Zusätzlich wurden die Variablen Länge, Pulsaderschnitte, Suizidversuch und Depression berücksichtigt. Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt: Frauen weisen in ihren Abschiedsbriefen signifikant höhere Werte der kognitiven Einengung, gemessen durch die Faktoren Sprachstil (p=0.005) und Wortart (p=0.048), auf. Das Alter korreliert nicht signifikant positiv mit dem Ausmaß der kognitiven Einengung der Suizidentin oder des Suizidenten. Diese Aussage trifft vor allem für die Faktoren Wortart, Dichotomie, Brieflänge und Einfachheit zu. Beim Faktor Sprachstil (p≤0.000) zeigt sich ein signifikantes Ergebnis, das jedoch nicht der Richtung der vorgegebenen Hypothese entspricht (siehe Abbildung 1). Demnach verwenden jüngere Verfasser einfachere Sprachstrukturen und geläufigere Ausdrücke. Bei den Faktoren Sprachstil (p=0.027) und Brieflänge (p≤0.000) korreliert das Ausmaß der kognitiven Einengung signifikant negativ mit der Länge der Abschiedsbriefe. Dies bedeutet, dass in kürzeren Texten mehr psycholinguistische Merkmale kognitiver Einengung zu finden sind. Bei den Faktoren Wortart, Dichotomie und Einfachheit ist diese Signifikanz nicht zu beobachten. Ebenfalls keine 255 tiven Einengung auf. Im Ruhestand Befindliche zeigen eine geringere kognitive Einengung des Sprachstils als solche, die sich nicht im Ruhestand befinden (p=0.002) und Personen, die mehrere Abschiedsbriefe an verschiedenen Orten platziert hatten, zeigen das geringste Ausmaß der kognitiven Einengung gemessen am Faktor Brieflänge (p=0.002). Sie verfassten die längsten Briefe. Abbildung 1: Ausmaß der kognitiven Einengung gemessen am Parameter „Sprachstil“ in verschiedenen Altersgruppen (* Faktorwerte als z-Werte; niedrige Werte bedeuten geringere kognitive Einengung) Signifikanzen gibt es bei den Variablen Pulsaderschnitte, frühere Suizidversuche oder Depression. Personen, bei welchen vernarbte oder frische Pulsaderschnitte gefunden wurden oder die bereits mindestens einen Suizidversuch begangen haben, zeigen im Abschiedsbrief nicht wie vermutet signifikant geringere Werte kognitiver Einengung als die jeweils übrige Subgruppe. Auch Suizidentinnen oder Suizidenten, die bekannter Weise unter einer Depression litten, zeigen kein signifikant geringeres Ausmaß der kognitiven Einengung als Personen, die keine nachgewiesene Depression hatten. Erkundende Untersuchungen wurden zu den Faktoren Familienstand, Pension, Sterbemonat, Auffindungsort der Leiche, Suizidmethode, Suizidmotiv, Briefempfänger, Fundort des Abschiedsbriefes und Unterschrift im Abschiedsbrief durchgeführt. Dabei können folgende Tendenzen beobachtet werden: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der kognitiven Einengung des Sprachstils und dem Suizidmotiv (p=0.020). Personen, die sich wegen psychischer Probleme das Leben nahmen, weisen dabei – im Gegensatz zu Personen mit den Suizidmotiven Krankheit oder Verlusterlebnis – das höchste Ausmaß der kogni- Diskussion Die 16 aus der Literatur entnommenen quantitativen psycholinguistischen Parameter messen nicht eine gemeinsame Dimension, nämlich das Ausmaß der kognitiven Einengung. Es muss sich zumindest um Unterkategorien dieses psychologischen Konstrukts handeln, von denen die fünf Kategorien Sprachstil, Wortart, Dichotomie, Brieflänge und Einfachheit identifiziert werden konnten. Bereits Brakel [3] diskutierte den vielfältigen Gebrauch und unterschiedliche Kategorien des Begriffes, während Ertel [8], Gottschalk & Gleser [9], Osgood & Walker [16], Räder et al. [17] und Williams & Pollock [20] ganz spezifische Unterteilungen vornahmen. Dabei können folgende Parallelen zu der vorliegenden Arbeit gezogen werden: Mit ihren Parametern Silbenwiederholungen, Type-Token-Ratio, Allness-Terms und Gewissheitsausdrücke kann Dichotomie sehr gut mit Stereotypie nach Osgood & Walker [16] verglichen werden. Diese wird durch Wiederholungen, Type-Token-Ratio, Lückensätze und Allness-Terms, aber auch durch die Silbenanzahl pro Wort und die Nomen-Verb/AdjektivAdverb Ratio – Parameter, die in der vorliegenden Arbeit besser mit dem Sprachstil und der Wortart korrelieren – definiert. Stereotypie, gesehen als Überbegriff der Faktoren Sprachstil, Wortart und Dichotomie, entspricht den Ergebnissen dieser Arbeit. Der Faktor Einfachheit ähnelt Desorganisation nach Osgood & Walker [16], Heinrich, Berzlanovich, Willinger, Eisenwort die zusätzlich zu der Fehleranzahl ein Verhältnis zwischen Kern- und Teilsätzen berücksichtigten. Kognitive Redundanz schlägt sich nach Räder et al. [17] in vermehrten Wort- und Silbenwiederholungen nieder. Diese Aspekte spiegeln sich auch im Faktor Dichotomie wieder, der zusätzlich durch Allness-Terms und Gewissheitsausdrücke geprägt ist. Als Ausdruck des Begriffes des veränderten Wortgutes sahen Räder et al. [17] das Zurückgreifen auf geläufigere Formen und die Verwendung kürzerer Kodierungseinheiten. Diese Merkmale werden – gemeinsam mit dem Verb-Adjektiv-Quotienten – beim Sprachstil berücksichtigt. Gottschalk & Gleser [9] unterschieden im Rahmen der kognitiven Einengung in Schriftstücken grammatikalische und psychologische Aspekte. Als dritte Kategorie werteten sie Funktionswörter aus. Die Faktoren kognitiver Einengung der vorliegenden Arbeit enthalten hauptsächlich grammatikalische Parameter nach Gottschalk & Gleser [9], jedoch sind auch positive Korrelationen zu Funktionswörtern und psychologischen Aspekten (z.B. Allness-Terms) zu finden. Dogmatismus nach Ertel [8] umfasst AllnessTerms in Bezug auf Häufigkeiten, Mengen, Maße und Ausschließungen, Worte der Notwendigkeit, Gewissheitsausdrücke und Begriffe, die Entgegensetzungen aufzeigen. Dogmatismus [8] und kognitive Redundanz [17] würden somit gemeinsam den Faktor Dichotomie bilden. Williams & Pollock [20] definierten dichotomes Denken ganz unspezifisch als Schwarz-Weiß-Malerei. Alle vier Dichotomie-Parameter dieser Arbeit könnten logisch nachvollziehbar als Objektivierung dessen gesehen werden. In Abbildung 2 ist der Versuch einer hierarchischen Gliederung der Modelle verschiedener Autorinnen und Autoren zu sehen. Natürlich darf dieses Modell nicht als vollständig betrachtet werden, was unter anderem durch die beliebig gesetzten gestrichelten Organigrammfelder mit Fragezeichen betont werden sollte. 256 Abbildung 2: Versuch der Strukturierung verschiedener Modelle Bei der Durchsicht der faktorenanalytischen Aufteilung der einzelnen Parameter zu den entsprechenden Faktoren könnte sich die Leserin oder der Leser vielleicht fragen, weshalb der Verb-Adjektiv-Quotient besser mit dem Sprachstil korreliert, als mit der Wortart. Eine geringere kognitive Einengung würde dem Ergebnis nach einem eher elaborierten Sprachstil mit längeren und selteneren Wörtern und ausgeschmückten adjektivreichen Sätzen entsprechen, während präsuizidal ein restringierterer Stil zum Vorschein käme. Dies ist für die Autorinnen gut nachvollziehbar, kann aber die Zuordnung abseits der Wortart nicht erklären. Vielleicht sollte die Ursache dafür in der besonderen Gewichtung der (Pro-)Nomen bei vier der fünf Wortart-Parameter gesehen werden. Die faktorenanalytischen Gruppierungen der übrigen Parameter sind gut nachvollziehbar. Briefe, die von ein und derselben Person verfasst wurden, unterscheiden sich in Bezug auf das Ausmaß der kognitiven Einengung wie angenommen nicht signifikant voneinander. Es wird daher angenommen, dass die Briefe hintereinander und somit im gleichen kognitiven Zustand geschrieben worden sind. Die tendenzielle Heterogenität beim Sprachstil könnte darauf zurückzuführen sein, dass bei mehreren Abschiedsbriefen oft mehrere Empfänger mit entsprechend unterschiedlichen Brief- und Höflichkeitsformen, die sich im Sprachstil äußern, kontaktiert wurden. In Bezug auf das Geschlecht sind bei Frauen bei den Faktoren Sprachstil und Wortart wie erwartet höhere Werte der kognitiven Einengung zu finden. Ergebnisse von Reimer & Koch zeigen, dass Männer nach einem Suizidversuch höhere Aggressivitätswerte aufweisen als Frauen [2]. Weiters führten Williams & Pollock [20] eine Studie an, in welcher hohe Aggressionswerte mit impulsiven Suizidhandlungen, die sich auch in früheren oder präsuizidalen autoaggressiven Handlungen äußern, in Verbindung gebracht werden. Diese Resultate lassen die Autorinnen vermuten, dass impulsive Suizidhandlungen eher von Männern durchgeführt werden und weniger kognitive Einengung benötigen. Sehr interessant sind diese Ergebnisse aber dahingehend, dass sowohl Cohen & Fiedler [5] als auch Ho et al. [10] Abschiedsbriefe von weiblichen Suizidenten als signifikant emotionsreicher beschrieben. Die Autorinnen gehen daher davon aus, dass sich Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen diese Affekte nicht in den Faktoren Sprachstil und Wortart manifestieren, da sie einen Emotionsreichtum bei einer sehr ausgeprägten kognitiven Einengung für eher unwahrscheinlich halten. Möglicherweise zeigt sich die kognitive Einengung von Frauen eher grammatikalisch, während Männer psychologisch oder inhaltlich eingeengter sind. Dies könnte durch eine unterschiedliche Priorität der Aufteilung der präsuizidal generell verminderten kognitiven Ressourcen erklärt werden. Im Gegensatz hierzu konnten Leenaars [11] oder Canetto & Lester [4] keine geschlechtsspezifischen Unterschiede erkennen. Die Altershypothese beruhte auf oben genannter Studie nach Ho et al. [10], wonach Abschiedsbriefe von jüngeren Frauen signifikant länger und emotionsreicher sind. Während weder der geschlechts- noch der altersspezifische Längenunterschied mit dieser Arbeit bestätigt werden kann, zeigt sich zudem eine gegenläufige Korrelation zwischen dem Alter und dem Ausmaß der kognitiven Einengung bezogen auf den Sprachstil. Wahrscheinlich muss auch hier davon ausgegangen werden, dass sich Emotionsreichtum nicht in grammatikalischen Faktoren widerspiegelt, sondern eine eigenständige Dimension darstellt. Natürlich sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass hier chinesische und österreichische Abschiedsbriefe ohne Berücksichtigung anderer Faktoren verglichen werden und auch diese Tatsache alleine die vorhandenen Unterschiede erklären könnte. Doch auch Cohen & Fiedler [5] beschrieben signifikant mehr Ausdrücke der Liebe und somit vermehrt affektive Themen in Abschiedsbriefen von unter 50-Jährigen. Vielleicht könnte die geringere kognitive Einengung dadurch erklärt werden, dass nach Leenaars [11] ältere Personen klarer, bestimmter und entschlossener sind, die Tat tatsächlich auszuführen. Dadurch können sie ihre kognitiven Ressourcen alleine auf die Abschiednahme richten, während Jüngere durch unbewusste Gefühle, Zweifel, kritische Beziehungen und Auswegsuche [11] eingeschränkt sind. Die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen Suiziden älterer und jüngerer Personen sowie die unterschiedlichen altersabhängigen Korrelationen verschiedener Suizidmodelle betonten auch Lester [13] und Salib et al. [19], während letzterer jedoch keine inhaltlichen Differenzen zwischen den Briefen Älterer und Jüngerer aufzeigen konnte. Längere Briefe zeigen wie erwartet einen eher elaborierten Sprachstil, während kürzere Abschiedsbriefe restringierter, daher weniger ausgeschmückt, mit wenigen Adjektiven verziert und unter Verwendung kurzer und häufiger Wörter erstellt, wirken. Es erscheint nachvollziehbar, dass unter derartigen Bedingungen weniger Worte benötigt werden, um Ähnliches auszudrücken. Suizidmotiv und Sprachstil zeigen auch einen signifikanten Zusammenhang. Personen, die sich wegen psychischer Probleme oder aus unbekannten Gründen das Leben nehmen, weisen dabei das höchste Ausmaß der kognitiven Einengung auf. Der bestehende intrapsychische Konflikt ist dabei eine mögliche Erklärung für diese Ergebnisse und die damit verbundenen geringeren mentalen Kapazitäten. Die Autorinnen gehen davon aus, dass auch bei den unbekannten Suizidmotiven psychische oder psychiatrische Faktoren die größte Rolle spielen, da derartige Probleme am ehesten tabuisiert, verleugnet oder übersehen werden. Bereits O’Connor et al. [15] postulierten den Einfluss psychologischer Korrelate vor allem auf inhaltliche Aspekte von Abschiedsbriefen. Dabei zeigten sie unter anderem eine höhere kognitive Einengung und vermehrte Gedankenarmut in Abschiedsbriefen psychiatrischer Personen mit bekannter Depression. In der vorliegenden Arbeit wurde eine gegensätzliche Hypothese nach Roberts et al. [18] abgeleitet, während die Ergebnisse keine Signifikanzen in allen Faktoren der kognitiven Einengung aufweisen. Um hier 257 Fehlinterpretationen zu vermeiden und um eventuell doch bestehende Unterschiede nicht zu verschleiern, soll an dieser Stelle kurz auf Schwächen dieser Arbeit, insbesondere in Bezug auf psychiatrische Daten, eingegangen werden. Durch die österreichische Gesetzeslage, vor allem mit dem bestehenden Datenschutzgesetz, war es nicht möglich, objektive Daten aus diesen Bereichen zu erhalten. Gemeinsam mit einer fehlenden routinemäßigen psychologischen Autopsie und der geringen Bereitschaft der Kontaktierten zu einem Gespräch wäre es untragbar, bei manchen sensiblen Daten von einer hohen Validität auszugehen und die Ergebnisse kritiklos zu interpretieren. Auch die Stichprobengröße würde maximal dazu ausreichen, große Effektgrößen nachzuweisen. Viele Studien im Bereich der Abschiedsbriefforschung arbeiten mit vergleichbar kleinen Stichproben, während nur selten größer angelegte Studien beobachtet werden können. Unter ähnlichen Voraussetzungen müssen auch die Hypothesen zu vernarbten und frischen Pulsaderschnitten und zu früheren Suizidversuchen verworfen werden. Es kann somit nicht nachgewiesen werden, dass frühere oder präsuizidale autoaggressive Handlungen auf erhöhte Aggressionswerte hinweisen würden, was mit Impulsivität und folgend mit geringerer kognitiver Einengung vereinbar wäre. Aber auch O’Connor et al. [15] fanden keine signifikanten Differenzen im Ausmaß der kognitiven Einengung zwischen Personen mit einem früheren Suizidversuch und solchen ohne parasuizidaler Vergangenheit. Unterschiede sind in ihrer Arbeit nur hinsichtlich vermehrter aggressiver Botschaften und egozentrischer Sequenzen in Briefen von Personen mit durchlebtem Suizidversuch zu erkennen. Die Tatsache, dass Personen, die mehrere Abschiedsbriefe an verschiedenen Orten platzieren, auch längere Briefe hinterlassen, könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich diese Personen Heinrich, Berzlanovich, Willinger, Eisenwort generell mehr Gedanken um das Geschehen nach ihrem Tod machen. Sie überlegen regelrecht, wer wie und wo etwas erfahren soll. Ebenso, wie die einzelnen Ergebnisse auf den vorangegangenen Seiten genauer durchleuchtet und kritisch betrachtet wurden, dürfen an dieser Stelle ein paar Worte zur Repräsentativität der Stichprobe nicht fehlen. In einer Studie von Leenaars et al. [12] konnten beim Vergleich deutscher und amerikanischer Abschiedsbriefe nach dem multidimensionalen Modell nach Leenaars [11] trotz verschiedener Sprachen und Kulturen keine ausgeprägten Unterschiede festgestellt werden. In einer vergleichbaren Arbeit konnten O’Connor & Leenaars [14] auch bei Weitem mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen zwischen Briefen aus Nordirland und den USA finden. Trotz der nachgewiesenen Gemeinsamkeiten über Sprachen und Kulturen hinweg sollte bei dieser Arbeit nicht zuletzt deswegen von einer eingeschränkten Repräsentativität ausgegangen werden, da eine derartige Wiener Stichprobe mit deutschsprachigen Briefen österreichischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger noch nicht in vergleichbare Studien eingebunden wurde. Eine Studie zur konkreteren Abschätzung der Repräsentativität wäre sicherlich anzustreben. Neben der Repräsentativitätsfrage hinterlassen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auch noch einige weitere offene oder unklare Befunde, welche in zukünftigen Studien noch behandelt werden könnten. Sicherlich interessant wären Ergebnisse einer erweiterten Stichprobe, um geringere Differenzen zwischen Gruppen feststellen zu können. Ebenso wäre eine routinemäßige Einführung einer psychologischen Autopsie für eine bessere Validität sensibler Daten, kombiniert mit einem Betreuungsangebot für betroffene Angehörige unerlässlich. Weiters bedarf der Versuch einer hierarchischen Strukturierung verschiedener Aspekte noch genauerer Definitionen und Nachforschungen. Obwohl der Weg zu einem Messins- 258 trument zur Suizidgefährdung aufgrund der Abschiedsbriefforschung noch weit und die Erweiterung der Stichprobe dringend notwendig ist, sollte jedoch immer ein Ziel berücksichtigt und weiterverfolgt werden: Einen Einblick in das präsuizidale Geschehen zu geben, was zu Anregungen für Verbesserungen in den Bereichen Suizidprävention und Krisenintervention führen sollte. Appendix – Auswertungsbeispiel Sprachparameter kognitiver Einengung Die Auswertungen beziehen sich auf folgenden Beispieltext: „Habe niemanden mit denen ich in Kontakt treten kann. Und Krankheitsbedinkt. Würde gerne mit jeden darüber reden, aber jeder hat seine Gründe und weichen mir aus dem Weg.“ 1. Wortanzahl = W = 28 6. 7. 8. 2. Buchstabenanzahl = B = 138 Wort- und Buchstabenanzahl messen die Länge der Briefe und Darstellungen [10]. 3. Type-Token-Ratio = 28 – 4 24 W – WWH = = = 0.857 28 8 W 4. 5. Die Type-Token-Ratio ist ein weit gehend textlängenunabhängiges Redundanzmaß und entsteht aus dem Verhältnis der Anzahl verschiedener Worte zur Gesamtwortzahl eines Textes [16] + [17]. B W = 138 = 4.929 28 Die mittlere Wortlänge ist ebenfalls mit Textredundanz assoziiert. Zusätzlich ist sie ein Indikator der Wortgeläufigkeit, da häufig verwendete Wörter kürzer sind [17]. 7 V = = 7.000 1 A 9. Der Verb-Adjektiv-Quotient, auch Aktionsquotient genannt, ent­steht aus dem Verhältnis der Anzahl an Verben zu der Anzahl an Adjektiven und ist ein Maß für emotionale Stabilität [1]. 3+7 10 S+V = = = 2.500 1+3 4 A + AV Die Nomen-Verb/Adjektive-Ad­ verb Ratio beruht auf einer Mo­di­ fi­kation des Action-Quotienten und dient als Stereotypiemaß [16]. 3+7+6 16 S+V+P = = = 4.000 1+3 4 A + AV Bei der Durchsicht fiel auf, dass die Briefe subjektiv gesehen sehr viele Pronomen enthalten. Daher wurde die Nomen-Verb/ Adjektive-Adverb Ratio hier experimentell erweitert. 0+5 5 2P + 3P = = = 0.179 28 8 W Hier wird die Anzahl der personenbezogenen Wörter der zweiten und dritten Person durch die Gesamtzahl der Wörter dividiert [9]. Der Faktor zeigt die Einschränkung der rationalen Denkfähigkeit und lässt vermuten, dass die Verfasser in Gedanken vertieft bei all jenen Personen waren, die sie in ihre Hilflosigkeit getrieben hatten. 3 S = = 0.107 28 W Die Anzahl der Substantive wird in Relation zur Textlänge erhoben [9]. Ein hoher Wert lässt auf einen restringierten Sprachstil schließen. 10. AT = 3 = 0.107 28 W Unter dem Begriff Allness-Terms werden Wörter wie immer, nie, jeder, keiner, alles, nichts, etc. verstanden [8] + [16]. Sie sollen Hinweise für dichotome Denkweisen und geschlossene Überzeugungssysteme liefern. Zur Messung der kognitiven Einengung in Abschiedsbriefen 11. FW = 8 = 0.286 28 W Funktionswörter wie Artikel, Hil­fs­­verben, Präpositionen, Kon­junk­tionen oder Negationen quan­tifizieren die Ausschmückung eines Textes. Ein enger Tunnelblick erlaubt nur kurze Darstellungen ohne komplizierte Satzkonstruktionen [9]. 5 F = = 0.178 28 W 12. Desorganisation äußert sich in grammatikalischen und strukturellen Abweichungen, Rechtschreib-, Satzzeichen- oder Verlegenheitsfehlern. Der enorme Drang zum Suizid kann die höchste kognitive Funktion der Sprachverarbeitung beeinflussen [16]. 0 GA = 0 GA + GB 13. → 0.000 definiert Ertel [8] kreierte ein Maß zur Erfassung von dichotomen Denkweisen, indem er bestimmte Wörter, die Gewissheit ausdrücken (notwendig, wirklich, letztlich, keineswegs, natürlich, grundsätzlich, ohne weiteres, zweifellos und selbstverständlich) durch die Gesamtheit der Gewissheitsbegriffe (zusätzlich: meines Erachtens, mir scheint, offenbar, wohl, vielleicht, nicht selbstverständlich, sicherlich, gewiss und offensichtlich) dividierte. 14. ∑H = 163 = 5.821 28 W Eine Häufigkeitsklasse 5 beispielsweise bedeutet, dass das häufigste Wort der deutschen Sprache „der“ zirka 25-mal öfter vorkommt als der gesuchte Begriff und spiegelt somit die Wortgeläufigkeit wider [17]. 15. SWH = 9 = 0.191 47 SI Die Silbenwiederholung ist ein Maß für Redundanz innerhalb eines Textes und somit zur Messung kognitiver Einengung geeignet. Ursprünglich wurde innerhalb von 35 aufeinander folgenden Silben der prozentuelle Anteil sich wiederholender Silben ermittelt [17]. 16. SI = 47 = 1.679 28 W Die Silbenanzahl pro Wort entsteht, indem die Anzahl der Silben eines Abschiedsbriefes durch die Anzahl der Wörter dividiert wird und beschreibt Stereotypie im Rahmen der kognitiven Einengung [16]. 259 Legende: A = Adjektiv (inkl. attributive Possessiv­pro­nomen): seine AT = Allness-Term: niemanden, jeden, jeder AV = Adverb: darüber, gerne, krankheitsbedingt F = Fehler: 1 Beistrich fehlt, denen, krankheitsbedingt, jeden, weichen FW = Funktionswort: aber, aus, dem, in, mit, mit, und, und GA bzw. GB = Gewissheitsausdrücke A bzw. B H = Häufigkeitsklasse: aber 4, aus 3, darüber 7, dem 2, denen 6, gerne 8, Gründe 9, habe 4, hat 3, ich 4, in 1, jeden 8, jeder 7, kann 4, Kontakt 9, krankheitsbedingt 17, mir 6, 2x mit 2, niemanden 11, reden 8, seine 5, treten 9, 2x und 0, Weg 7, weichen 11, Würde 6 P = Pronomen (exkl. attributive Pronomen): niemanden, denen, ich, jeden, jeder, mir S = Substantiv: Kontakt, Gründe, Weg SI = Silbe SWH = Silbenwiederholung: be, de, de, V den, den, je, mit, ne, und = Verb: habe, treten, kann, würde, reden, hat, weichen WWH = Wortwiederholung: hat/habe, 2P bzw. 3P jeden/jeder, mit, und = 2. bzw. 3. Person: niemanden, denen, jeden, jeder, seine Heinrich, Berzlanovich, Willinger, Eisenwort Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Boder D.P.: The Adjective-Verb-Quotient: A Contribution to the Psychology of Language. Psychological Record 3, 310343 (1939). Botzki C.: Suizid und Autoaggression. Eine kontentanalytische Untersuchung der Tagebücher Kurt Tucholskys mit dem Gottschalk-Gleser Verfahren. Verlag für akademische Schriften, Frankfurt am Main 1993. Brakel L.A.W.: Ego Constriction. The American Journal of Psychoanalysis 64, 267-277 (2004). Canetto S.S., Lester D.: Motives for Suicide in Suicide Notes from Women and Men. Psychological Reports 85, 471-472 (1999). Cohen S.L., Fiedler J.E.: Content analysis of multiple messages in suicide Notes. Life Threatening-Behavior 4, 75-95 (1974). Eisenwort B., Berzlanovich A., Willinger U., Eisenwort G., Lindorfer S., Sonneck G.: Abschiedsbriefe und ihre Bedeutung innerhalb der Suizidologie: Zur Repräsentativität der Abschiedsbriefhinterlasser. Der Nervenarzt 77(11), 1355-1362 (2006). Eisenwort B., Berzlanovich A., Heinrich M., Schuster A., Chocholous P., Lindorfer S., Eisenwort G., Willinger U., Sonneck G.: Suizidologie: Abschiedsbriefe und ihre Themen. Der Nervenarzt 78 (6), 672-678 (2007). [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 260 Ertel S.: Erkenntnis und Dogmatismus. Psychologische Rundschau 23(4), 241269 (1972). Gottschalk L.A., Gleser G.C.: An Analysis of the Verbal Content of Suicide Notes. British Journal of Medical Psychology 33, 195-204 (1960). Ho T.P., Yip P.S., Chiu C.W., Halliday P.: Suicide notes: what do they tell us? Acta Psychiatrica Scandinavica 98(6), 467476 (1998). Leenaars A.A.: Suicide: A Multidimensional Malaise. Suicide and Life-Threatening Behavior 26(3), 221-236 (1996). Leenaars A.A., Lester D., Wenckstern S., Heim N.: Suizid-Abschiedsbriefe – Ein Vergleich deutscher und amerikanischer Abschiedsbriefe von Suizidenten (Übersetzung aus dem Englischen von Wolfersdorf M.). Suizidprophylaxe 3, 99101 (1994). Lester D.: A comparison of 15 theories of suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior 24(1), 80-88 (1994). O’Connor R.C., Leenaars A.A.: A Thematic Comparison of Suicide Notes Drawn from Northern Ireland and the Unites States. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social 22(4), 339-347 (2004). O’Connor R.C., Sheehy N.P., O’Connor D.B.: A thematic analysis of suicide notes. Crisis 20(3), 106-114 (1999). Osgood C.E., Walker E.G.: Motivation and Language Behavior: A Content Analysis of Suicide Notes. Journal of Abnormal and Social Psychology 59, 58-67 (1959). [17] Räder K.K., Adler L., Freisleder F.J.: Zur Differenzierung von Suizid und Parasuizid: Eine Untersuchung an Abschiedsbriefen suizidaler Patienten. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 142(5), 439-450 (1991). [18] Roberts R.E., Roberts C.R., Chen Y.R.: Suicidal thinking among adolescents with a history of attempted suicide. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 37(12), 12941300 (1998). [19] Salib E., Cawley S., Healy R.: The significance of suicide notes in the elderly. Aging and Mental Health 6(2), 186-190 (2002). [20] Williams J.M.G., Pollock L.R.: The Psychology of Suicidal Behaviour. In: Hawton K., van Heeringen K.: The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide. Wiley & Sons, New York 2000. Mag. Dr. Monika Heinrich Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien, Institut für Medizinische Psychologie, Wien [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 261–267 Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der ImmigrantInnen aus der Türkei Tarik A. Yilmaz1 und Anita Riecher-Rössler2 1 2 Psychiatrische Abteilung der Universität Bilim, Istanbul Psychiatrische Universitätspoliklinik, Basel Schlüsselwörter: Suzidversuch – Migration – Geschlecht – Gewalt fährdet. Gewalt scheint ein generationsübergreifendes Problem bei den suizidalen Immigrantinnen zu sein. Key words: Suicide attempt – migration – gender – violence Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der Immigrant­ Innnen aus der Türkei Das Ziel der Studie ist die Erfassung der soziodemografischen und migrationsspezifischen Besonderheiten von Migranten der 1. und 2. Generation mit Suizidversuchen. Alle Immigrant­ Innen aus der Türkei mit Wohnsitz Basel-Stadt, die nach einem Suizidversuch in die Notfallstation des Universitätsspital Basel eingewiesen wurden (n=70), wurden in einem Zeitraum von 7 Jahren systematisch erfasst. 35,7% der Suizidversucher gehörten der 1. und 64,3% der 2. Generation an. Der Quotient Frauen/ Männer war in der 1. Generation 1,3 und in der 2. Generation 3,1. 36.9% der Betroffenen waren im Alter von 15-19 Jahren eingereist. Von den weiblichen Immigrantinnen nannten 21,4% der 1. und 14,7% der 2. Generation Gewalt in der Partnerschaft oder Familie als Hauptproblem. Schlussfolgerungen: Immigrantinnen der 2. Generation sind bezüglich suizidalen Handlungen besonders ge© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Suicid attempts among first and se­ cond generation immigrants To examine the characteristics of suicide attempters among first and second generation immigrants from Turkey living in Basel-City, Switzerland. All immigrants living in Basel City and admitted to the University Hospital of Basel-City, Switzerland, after a suicide attempt, were consecutively examined during a 7-year period (n=70). 35,7% of the suicide attempters were first generation and 64,3% second generation immigrants. Among the first generation the sex ratio female to male was 1,3 and among second generation 3,1. 36,9% of those concerned were at immigration 15 to 19 years of age. 24,1 % of females from first generation and 14,7% of females from second generation mentioned violence in family and partnership as the main problem. Conclusions: Female migrants of 2. generation seem to be at risk with regard to suicidal behavior. Violence seems to be a significant problem in suicidal female immigrants of both generations. Einführung Die psychische Gesundheit der Immigranten und Immigrantinnen in West- und Mitteleuropa stellt eine Herausforderung dar. Eine der Hauptgruppen unter den Immigranten in West- und Mitteleuropa bilden die Auswanderer aus der Türkei. Autoaggressivität bzw. suizidale Handlungen stellen bezüglich der Prävention und der Behandlung eine gravierende Problematik dar. Grube [2] fand in der Akutpsychiatrie häufiger Suizidversuche bei Immigranten als bei Deutschen, v.a. bei Frauen und bei Personen im Alter von unter 45 Jahren. Die jugendlichen Immigranten werden häufiger wegen autoagressivem Verhalten hospitalisiert als die Einheimischen [7]. Storch und Poustka [8] stellten bei hospitalisierten Mädchen häufiger Suizidiversuche unter den Immigranten fest als bei deutschen Einheimischen. Unterschiede bestehen nicht nur zwischen den Immigranten und Einheimischen, sondern auch zwischen beiden Auswanderergenerationen. Hjern und Allebeck [9] haben gezeigt, dass in Schweden unter den Immigranten die zweite Generation eine höhere Sterberate an Suizid aufweist als die erste Auswanderergeneration. Die psychischen Belastungen in Zusammenhang mit der Migration sind für die erste und zweite Auswanderergeneration deutlich unterschiedlich, etwa bezüglich Trennungserfahrungen in der Kindheit, Problemen in der Schule, Spannungen in der Familie bis zur Zwangsheirat [3-6]. Die Besonderheiten der Suizidversuche im Hinblick auf die erste und zweite Generation wurden allerdings bisher nicht genügend untersucht. Yilmaz, Riecher-Rössler Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Erfassung der soziodemografischen und migrationsspezifischen Besonderheiten der Suizidversuche in der ersten und zweiten Auswanderergeneration aus der Türkei. Material und Methode Alle Immigranten aus der Türkei, die in Basel-Stadt wohnhaft sind und vom 1.1.1991 bis 31.12.1997 (n=70) nach einem Suizidversuch in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel (ehemaliges Kantonsspital) eingewiesen wurden, wurden in die Studie aufgenommen. Das Universitätsspital Basel ist für die Versorgung von Notfällen des ganzen Kantons Basel-Stadt zuständig. D.h. in die Studie wurden alle Suizidversucher eingeschlossen, die für eine medizinische Untersuchung bzw. Behandlung ins Spital gebracht worden sind. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um ernsthafte Suizidversuche handelte. Daten bezüglich der Suizidversuche wurden systematisch auf der Basis von medizinischen Akten anhand eines Evaluationsbogens erfasst, der für die Studie vorbereitet wurde. Die medizinischen Akten bestehen aus den Unterlagen der Notfallstation, dem Aufnahmebogen des Sanitäters der Notfallstation sowie den Krankenakten der Psychiatrischen Universitätspoliklinik inklusive standardisiertem Bogen, der vom zuständigen Arzt von der Psychiatrischen Universitätspoliklinik in der Regel innerhalb von 72 Stunden nach dem Suizidversuch ausgefüllt wurde. Die wenigen fehlenden Daten wurden anhand von allen erreichbaren früheren Akten der Notfallstation, der psychiatrischen Universitätspoliklinik, Notizen und Zuweisungen von Internisten und Hausärzten sowie anderen professionellen Helfern ergänzt. Der Evaluationsbogen bestand aus folgenden Items: Adresse, Geschlecht, Alter, Anzahl der Suizidversuche, Alter bei 262 Migration, Alter beim ersten Suizidversuch, Zivilstand, Wohnsituation, Arbeitssituation, Suizidversuchsmethode, Hauptprobleme die zum Suizidversuch führten, Alkoholabhängigkeit, Abhängigkeit von illegalen Drogen (gemäss ICD-10) und Nachbehandlung. In unserer Studie wurden, wie in einer anderen ähnlichen Studie von Hjern und Allebeck [9], die ImmigrantInnen mit Migrationsalter (Einreisealter) von 19 Jahren und jünger als zweite Generation definiert und diejenigen mit Einreisealter über 19 Jahre als erste Generation. In der Studie wurde folgende Definition des Suizidversuches [10] verwendet: „Es ist eine Handlung mit nicht tödlichem Ausgang, bei der ein Individuum ein nicht habituelles Verhalten beginnt, das ohne Intervention von dritter Seite eine Selbstschädigung bewirken würde, oder bei der es absichtlich eine Substanz in einer Dosis einnimmt, die über die verschriebene oder im allgemeinen als therapeutisch angesehene Dosis hinausgeht und die zum Ziel hat, durch die aktuellen oder erwarteten Folgen Veränderungen zu bewirken“. Langandauernde Selbstschädigungen wie z.B. anorektische Verhaltensweisen, Drogenabusus, usw. werden damit ausgeschlossen. Suizidversucher, denen die Bedeutung ihrer Handlungen nicht bewusst ist (wie mentale Retardierung), wurden ebenfalls aus der Studie ausgeschlossen. Wenn ein Immigrant im Untersuchungszeitraum mehrfach nach einem Suizidversuch eingewiesen wurde, wurden nur die Angaben der ersten Aufnahme berücksichtigt. Bezüglich der Methode des Suizidversuchs wurden alle wesentlichen Mittel berücksichtigt. Die gewonnenen Daten wurden einer Frequenzanalyse unterzogen und Vergleiche mit Chi-Quadrat-Tests, Fisher’s Exact Test und Student tTest durchgeführt. Ergebnisse 25 Suizidversucher (35,7%) gehörten der ersten und 45 Suizidversucher (64,3%) der zweiten Auswanderergeneration an. Geschlechtsverteilung 14 Suizidversucher (56,0%) der ersten Auswanderergeneration waren Frauen und 11 (44,0%) Männer. Der Anteil der Frauen unter der zweiten Generation betrug 75,6% (34 von 45 Suizidversuchern). Dieser Unterschied bezüglich der Geschlechtsverteilung ist statistisch nicht signifikant (χ2= 2,85, df=1, p=0,09). Der Quotient Frauen zu Männer war in der ersten Generation 1,3 und in der zweiten Generation 3,1. Alter bei aktuellen Suizidversuch Das Durchschnittsalter der Erstgenerationsmigranten war beim aktuellen Suizidversuch 36,5 (SD±7,4), bei den Frauen 37,9 (SD±8,4) und bei den Männern 34,7 (SD±5,6) und das der Zweitgenerationsmigranten 22,6 (SD±5,8) bei den Frauen 22,1 (SD±5,8) und bei den Männern 24,0 (SD±5,9). Dieser Unterschied war erwartungsgemäss statistisch signifikant (t=8,74, df=68, p<0,001). Einreisealter Das durchschnittliche Einreisealter war in der ersten Generation 28,2 (SD±6,3) (bei den Frauen 28,3 (SD±6,3) und bei den Männern 28,0 (SD±6,5)) und in der zweiten Generation 14,0 (SD±4,5) [bei den Frauen 13,4 (SD±4,6) und unter den Männern 15,8 (SD±3,7)]. Die Immigrantinnen, die in der Schweiz geboren sind (n=5), wurden aus der Berechnung ausgeschlossen, da es sich hier nicht um die Einreise, sondern um die Geburt geht. Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der ImmigrantInnen aus der Türkei Der Anteil von Migranten mit einem Einreisealter von 15 bis 19 Jahren war 36.9% (24 von 65). Somit waren sie gegenüber den anderen Altersgruppen deutlich überrepräsentiert. Ihr Anteil betrug bei den Frauen 34,1% (15 von 44) und bei den Männern 38,1% (9 von 21) (Abb.1). 1) Suizidversuche vor der Einreise Nur einer der 70 Suizidversucher hatte einen Suizidversuch vor der Immigration unternommen, und zwar ein männlicher Migrant der ersten Generation. Abbildung 1: Häufigkeit der Suizidversuche nach dem Einreisealter. Das Durchschnittsalter beim ersten Suizidversuch war bei den Erstgenerationsmigranten 35,3 (SD±7,7), bei den Frauen 36,4 (SD±8,3) und bei den Männern 33,8 (SD±6,8) und bei den Zweitgenerationsmigranten 22,4 (SD±5,6), bei den Frauen 21,9 (SD±5,5) und bei den Männern 24.0 (SD±5,9). Dieser Unterschied war signifikant (t=8,079 df=68 p<0,001). Mehrfache Suizidversuche Mehrfache Suizidversuche kamen in der ersten Generation bei 5 von 14 (35,7%) Frauen und 2 von 11 (18,2%) Männern, also insgesamt bei 7 von 25 (28.0%) Immigranten vor. In der zweiten Generation wurden Mehrfachsuizidversuche bei 6 von 34 (17,6%) Frauen und bei 2 von 11 (18,2%) Männern, also insgesamt bei 8 von 45 (17, 8%) Immigranten festgestellt. ten Generation bei den Frauen 8,1 (SD±4,7) und bei den Männern 7,3 (SD±3,8) Jahre. In der zweiten Generation betrug der Abstand unter den Frauen 8,3 (SD±4,9) Jahre und unter den Männern 8,5 (SD±5,4) Jahre. Zivilstand Die in der Schweiz geborenen Suizidversucher (n=5) wurden ausgeschlossen. Alter beim ersten Suizidversuch 263 Zeitlicher Abstand zwischen der Migration und dem ersten Suizidversuch Der Abstand von der Migration bis zum ersten Suizidversuch war bei den älteren Migranten der ersten Generation 7,5 (SD±4,5) Jahre und bei den jüngeren der zweiten Generation 8,4 (SD±5,0) Jahre. Ausgenommen aus diesen Berechnungen waren ebenfalls die in der Schweiz geborenen fünf Suizidversucher sowie der eine Patient, der den ersten Suizidversuch schon vor der Migration unternommen hatte. Trotz des signifikanten Unterschieds des Einreisealters zwischen beiden Generationen, wurde also kein signifikanter Unterschied bezüglich des zeitlichen Abstandes zwischen der Migration und dem ersten Suizidversuch gefunden (t=0,70 df=62 p=0,48). Dies trifft auch zu, wenn man die Geschlechter getrennt betrachtet. Der Abstand von der Migration bis zum ersten Suizidversuch war in der ers- 17 (68,0%) ImmigrantInnen aus der ersten und 23 (51,1%) aus der zweiten Generation waren verheiratet. 7 (28,0%) Suizidversucher aus der ersten Generation waren geschieden oder verwitwet, während ein Immigrant (2,2%) aus der zweiten Generation geschieden war. 1 Suizidversucher (4,0%) aus der ersten Generation war ledig, 21 (46,7%) Suizidversucher aus der zweiten Generation waren ledig. Dieser Unterschied ist sicherlich z.T. durch das höhere Lebensalter der Migranten der Erstgeneration bedingt und erwartungsgemäss signifikant (χ2= 19,45, df=2, p<0,001). Wohnsituation Auch die Wohnsituation der Erst- und Zweitgenerationsmigranten ist unterschiedlich. 20 (80%) der Suizidversucher aus der ersten Generation und 24 (53,3%) aus der zweiten Generation lebten mit ihrem Partner und/oder mit ihren Kindern zusammen. Keine Suizidversucher aus der ersten Generation lebten mit ihren Eltern zusammen, während 14 (31,1%) Immigranten der zweiten Generation mit ihren Eltern –mit oder ohne Partner – lebten. 5 (20%) Suizidversucher der ersten Generation und 6 (13,3%) derjenigen aus der zweiten Generation lebten alleine. 1 (2,2%) Immigrant aus der zweiten Generation lebte in einer Institution (χ2= 10,60, df=3, p=0,025). Letzte absolvierte Schule 4 (16,0%) Immigranten aus der ersten Generation, aber keiner der zweiten Generation hatten keine Schulen be- Yilmaz, Riecher-Rössler 264 sucht. 8 (17,8%) aus der ersten Generation und 18 (40,0%) aus der zweiten Generation hatten unterschiedlich lange die Primarschule besucht. Mittelschule oder Gymnasium haben 10 (22,2%) der ersten Generation, 27 (60,0%) der zweiten Generation besucht. Einen Hochschulabschluss hatten 3 (12,0%) der ersten Generation. Dieser Unterschied bezüglich der letzten absolvierten Schule ist nicht signifikant (χ2= 14,09, df=3, p=0,99). bezog eine Invalidenrente. 9 (20%) der Suizidversucher aus der zweiten Generation waren in Ausbildung. Arbeitsituation Beide Generationen wiesen keinen signifikanten Unterschied in bezug auf die Arbeitssituation auf (χ2= 8,2, df=4, p=0,10). 14 (65%) der Immigranten der ersten Generation und 25 (55,6%) der zweiten Generation standen im Berufsleben. 7 Frauen (28%) aus der ersten Generation und 7 Frauen (15,6%) aus der zweiten Generation waren Hausfrauen. 3 (12%) Immigranten aus der ersten Generation und 4 (8,9%) aus der zweiten Generation waren arbeitslos. Ein (4%) Suizidversucher der ersten Generation Suchtmittelabhängigkeit In beiden Generationen wurde keine Abhängigkeit von illegalen Drogen festgestellt. Alkoholabhängigkeit wurde bei 3 (12%) der Suizidversucher aus der ersten und einem (2,2%) der zweiten Generation festgestellt. Dieser Unterschied ist nicht signifikant ( χ2= 2,85, df=1, p=0,09). 1. Generation 2. Generation Gesamt n (%) n (%) n (%) Benzodiazepine 5 (20,0) 7 (15,6) 12 (17,4) Analgetika 4 (16,0) 13 (28,9) 17 (24,3) Antidepressiva 6 (24,0) 5 (11,1) 11 (15,7) Neuroleptika 3 (12,0) 4 (8,9) 7 (10,0) Alkohol 1 (4,0) 1 (2,2) 2 (2,9) Andere Intoxikation 7 (28,0) 11 (24,4) 18 (25,7) Schnittverletzungen 2 (8,0) 4 (8,9) 6 (8,6) Andere Selbstschädigende Handlungen 1 (4,0) 3 (6,7) 4 (5,7) Tabelle 1: Suizidversuchsmethoden bei Erst- und Zweitgenerationsmigranten 1. Generation 2. Generation Gesamt Hauptproblembereiche n (%) n (%) n (%) Beziehunsprobleme mit Partner 15 (60,0) 29 (64,4) 44 (62,9) Probleme mit Eltern 0 (0,0) 9 (20,0) 9 (12,9) Drohende Ausweisung 4 (16,0) 2 (4,4) 6 (8,6) Andere 6 (24,0) 5 (11,1) 9 (12,9) Tabelle 2: Hauptprobleme nach Generationen Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der ImmigrantInnen aus der Türkei Suizidversuchsmethode Tabelle 1 zeigt die Suizidversuchsmethoden der beiden Gruppen. Da pro Patient z.T. mehrere Methoden angewandt wurden, ist die Summe über 100% (Tab. 1). Mit Abstand die häufigste Methode ist bei beiden Generationen die Intoxikation mit Medikamenten, insbesondere Psychopharmaka, aber auch Analgetika. In der ersten Generation wurden am häufigsten Antidepressiva und in der zweiten Generation am häufigsten Schmerzmittel eingenommen. Hauptprobleme Als häufigste den Suizidversuchen zugrunde liegende Problematik wurden bei beiden Generationen Beziehungsprobleme angegeben (Tab. 2), wobei ganz im Vordergrund Partnerschaftsprobleme stehen. 20% der Zweitgenerationsmigranten geben aber auch Probleme mit den Eltern als Auslöser an. Auch eine drohende Ausweisung führte nicht selten zu einem Suizidversuch. Gewalterfahrung in der Beziehung Ob Gewalt in der Beziehung angewendet wurde, wurde als eine Untergruppe von Beziehungsproblemen erfasst. Alle Gewaltopfer waren Frauen. In der ersten Generation war der Anteil der Frauen 21,4% (3 von 14) und in der zweiten Generation 14,7% (5 von 34). In Bezug auf Gewalt als Hauptproblem bezüglich des Suizidversuches konnte zwischen beiden Generationen kein signifikanter Unterschied festgestellt werden (χ2= 0,32, df=1, p=0,42). Nachbehandlung In Anschluss an die Behandlung in der Notfallstation wurden 12 (48,0%) Suizidversucher der ersten Generation und 14 (31,1%) der zweiten Generation auf die psychiatrische Kriseninterventionsstation des Universitätsspitals eingewiesen, das eine maximal 4-tägige Hospitalisation auf einer offenen Station anbietet. 6 (24,0%) Suizidversucher der ersten Generation und 11 (24,4%) Suizidversucher der zweiten Generation wurden in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Aus der ersten Generation wurden 7 (28,0%) Immigranten in eine ambulante Behandlung entlassen, während 20 (44,4%) Immigranten der zweiten Generation direkt entlassen wurden. Damit war kein signifikanter Unterschied bezüglich der Nachbehandlung festzustellen (χ2= 2,36, df=2, p=0,69). Diskussion Die Notfallstation des Universitätsspitals Basel hat die Hauptversorgungsfunktion im Kanton Basel-Stadt für Notfälle, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die in die Studie aufgenommenen Immigranten als repräsentativ für alle in Basel-Stadt wohnhaften Migranten mit ernsthaften Suizidversuchen gelten können. Dennoch sollen die Daten mit Vorsicht interpretiert werden. Aufgrund der Stigmatisierung werden nicht alle Suizidversucher nach dem Suizidversuch einer medizinischen Behandlung zugeführt [11]. Zudem geben nicht alle ImmigrantInnen offen Auskunft über die in der Studie untersuchten Fragen. So wird etwa Gewalterfahrung in der Familie oder Partnerschaft sicher nicht immer angegeben. Trotzdem lassen die Daten einige wichtige Rückschlüsse zu. So waren die in der Adoleszenz immigrierten Suizidversucher (Einreisealter 15 bis 19 Jahre) mit mehr als einem Drittel (36,9%) aller Betroffenen deutlich überrepräsentiert. Dieser Befund deutet darauf hin, dass unter den Immigranten ein Einreisealter von 15 bis 19 Jahren in Bezug auf suizidale Handlungen einen Risikofaktor darstellt. Gestützt auf die Literatur 265 [3,4,6,12,13] gehen wir davon aus, dass während der Adoleszenz die psychosozialen Belastungen, Trennungserfahrungen und die mit der Migration verbundenen Identitätskrisen intensiver erlebt werden, als bei Jüngeren oder Älteren. Der Quotient Frauen zu Männern betrug in der ersten Generation 1,3 und in der zweiten Generation 3,1. Bei der Interpretation dieser Befunde muss das jüngere Alter der Zweitgenerationsmigranten berücksichtigt werden. Schmidtke et al. [14] fanden in einer Untersuchung von Suizidversuchern in den Jahren 1989 und 1997 in Bern den Frauen/Männer Quotienten in der Altersgruppe von 30 bis 44 Jahren 1,3 und in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren 1,8. Das Suizidrisiko scheint also bei jüngeren Frauen besonders hoch und zwar – wie unsere Daten zeigen, v.a. bei jüngeren Frauen der zweiten Migrantengeneration. Die Tatsache, dass Frauen sehr viel häufiger Suizidversuche verüben ist ein aus zahlreichen Studien auch bei Nicht-Migranten bekanntes Phänomen [15]. Die Immigranten aus der zweiten Generation weisen aber einen wesentlich höheren Frauenanteil auch im Vergleich zu den Suizidversuchern aus der Schweiz auf, während in der ersten Generation kein signifikanter Unterschied zu den Schweizern in Bezug auf das Geschlechtsverhältnis [10] besteht. Es gibt einige Erklärungsmodelle für den hohen Anteil insbesondere junger Frauen der zweiten Generation. Die traditionell hierarchische Struktur in der türkischen Familie definiert die Rolle junger Frauen ziemlich streng. Während des Migrations- bzw. Integrationsprozesses kommen Konflikte in der Familie und Partnerschaft häufiger vor, da die neue westliche Rolle im Aufnahmeland mehr Autonomie und Selbstbestimmung erfordert, welche durch den Mann bzw. Vater als Bedrohung für die traditionelle Lebensweise empfunden wird und häufig zu eskalierenden Zwangsmassnahmen führt [15,16]. Arcel et al. [17] haben gezeigt, dass suizidale Yilmaz, Riecher-Rössler Frauen von ihren Partnern häufiger dominiert werden und in ihrer Mobilität stark begrenzt werden. Simons und Murphy [18] fanden bei Frauen mit suizidalen Handlungen in der Adoleszenz häufig eine Entfremdung gegenüber den Bezugspersonen. Die Zwangsheirat kann eine weitere Ursache suizidaler Handlungen bei jungen Frauen sein [19,20]. Auffallend ist, dass vor der Migration keine Suizidversuche vorkommen, ausser bei einem Mann aus der ersten Generation. Dieser Befund scheint ein Hinweis dafür zu sein, dass die Migration bzw. psychosoziale Folgen der Migration das Suizidversuchsrisiko erhöhen. Beide Auswanderergenerationen wie­ sen keine signifikant unterschiedlichen zeitlichen Abstände zwischen der Migration und dem ersten Suizidversuch auf, obwohl sie ein signifikant unterschiedliches durchschnittliches Einreisealter hatten. Gemäss diesen Befunden entsteht der Eindruck, dass unabhängig vom Einreisealter nach einem ähnlichen Intervall die psychosozialen Belastungen der Migration zu Suizidversuchen beitragen können. Man könnte argumentieren, dass nach einer bestimmten Zeit bei beiden Generationen die Bewältigungsstrategien soweit überfordert sind, dass ein Suizid noch die einzig mögliche Lösung scheint. Obwohl die zweite Generation eine bessere Schulbildung aufwies, wurde kein signifikanter Unterschied in Bezug auf die letzte absolvierte Schule zwischen den beiden Generationen gefunden. Die hohe Anzahl von Nur-Hausfrauen sowohl in der ersten Generation (28%) also auch in der zweiten Generation (15,6%) kann als eine kulturelle Besonderheit der traditionellen Lebensweise interpretiert werden. Die traditionelle Lebensweise ist anscheinend unter den Suizidversuchern auch in der zweiten Generation häufig. Eine Mehrzahl der Suizidversucher der ersten wie auch der zweiten Generation war verheiratet und lebte mit Partnern , Kindern oder – bei den 266 jüngeren – Eltern. Obwohl soziale Isolation in westlichen Ländern als ein Risikofaktor für Suizidversuche betrachtet wird [21-23], scheint dies in unserer Studienpopulation kaum der Fall zu sein, da die Gruppe eine ziemlich gute Integration in die Familie aufweist. Ebenfalls im Gegensatz zu den westlichen Ländern, wo Alkohol- und Opiatabhängigkeit zu den Risikofaktoren für suizidale Handlungen zählen [26-30], haben wir nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Generation eine geringe Anzahl von Suchtmittelabhängigkeit festgestellt. Akvardar et al. [24] haben gezeigt, dass Opiatabhängigkeit in der Türkei relativ selten ist. Bei Immigranten scheint Opiatabhängigkeit fast ausschliesslich in der zweiten Generation vorzukommen [25]. Bezüglich der Suizidversuchsmethode waren keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Generationen, weder bei den Intoxikationen, noch bei den selbstschädigenden Handlungen, festzustellen. In beiden Gruppen war Analgetika-Einnahme häufig. Wir nehmen an, dass die Erreichbarkeit der Schmerzmittel dabei eine Rolle spielt, da Schmerzstörungen bei den Immigranten aus der Türkei häufig vorkommen [31]. In beiden Generationen waren Beziehungsprobleme die häufigsten Probleme, die als Anlass des Suizidversuch angegeben wurden. Dies ist nicht spezifisch für die Immigranten, da ähnliche Häufigkeiten bei den Suizidversuchern in europäischen Studien gezeigt werden konnten [32]. Der hohe Anteil von Frauen mit Gewalterfahrung fiel in beiden Generationen auf. Yilmaz und Battegay [33] haben bei Immigrantinnen aus der Türkei mit Anpassungsstörung gezeigt, dass bei Gewaltopfern häufiger Suizidversuche vorkommen als bei denen, die keine Gewalterfahrung hatten. Diese Befunde zeigen, dass die Gewalt bei weiblichen Migranten beider Generationen ein wichtiger Risikofaktor für Suizid ist. Unsere Befunde deuten ferner darauf hin, dass eine Ausweisung für Migranten eine existentielle Bedrohung darstellen kann und als einer der wesentlichen Anlässe für suizidale Handlungen insbesondere bei der ersten Generation berücksichtigt werden sollte. Bezüglich der Nachbehandlung nach dem Suizidversuch gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen der ersten und zweiten Generation. Die niedrige Frequenz von Einweisungen in eine psychiatrische Klinik (24,0% bzw. 24,1%) kann einerseits mit der zur Verfügung stehenden Kriseninterventionsstation (eine offene Abteilung im Allgemeinspital), andererseits auch mit der kultursensitiven Krisenintervention eines türkischsprachigen Psychiaters (Erstautor) während der Zeit der Studie erklärt werden. Schlussfolgerungen Unsere Befunde deuten darauf hin, dass türkische Migranten in der Schweiz insbesondere dann in Bezug auf suizidale Handlungen gefährdet sind, wenn sie als Jugendliche eingereist sind und wenn sie weiblichen Geschlechts sind. Weiterführende Studien sind in dieser Population erforderlich und Präventionsstrategien sollen auf diese Gruppe gerichtet werden. Unabhängig vom Einreisealter ist das zeitliche Intervall von der Migration bis zum ersten Suizidversuch in beiden Generationen etwa ähnlich. Das würde bedeuten, dass die Suizidversucher nach der Einreise einen ähnlich andauernden Prozess bis zur suizidalen Handlung durchmachen. Typische westliche Risikofaktoren für suizidale Handlungen wie soziale Isolation oder Alkohol- und Opiatabhängigkeit scheinen weder in der ersten noch in der zweiten Generation bei den Immigranten aus der Türkei zu gelten. Gewalterfahrung in der Familie und Partnerschaft scheint bei den Frauen häufig vorzukommen und Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der ImmigrantInnen aus der Türkei ein generationsübergreifendes Problem zu sein. Wichtig scheint, dass es bei den Betroffenen vor der Migration praktisch keine Suizidversuche gab. Es ist also davon auszugehen, dass die Migration selbst ein wesentlicher Risikofaktor für suizidale Handlungen darstellt. [12] [13] [14] Literatur [1] Devrimci-Ozguven H, Sayil I. Suicide Attempts in Turkey: Results of the WHO-EURO Multi-centre Study on Suicidal Behavior. Can J Psychiatry 48: 324-329 (2003). [2] Grube M. Suizidversuche von Migranten in der Akutpsychiatrie. Nervenarzt 75: 681-687 (2004). [3] Erdheim M. Das Eigene und das Femde. Psyche 8: 730-744 (1992). [4] Parin P. The Mark of Oppression – Juden und Homosexuelle als Fremde. In: Paul Parin & Goldy Parin-Matthéy (Eds.), Das Subjekt im Widerspruch. Aufsätze 1978-1985, Frankfurt a.M.: Syndikat (1986). [5] Yılmaz A. T., Battegay R.: Transkulturelle und migrationsspezifische Aspekte der Krisenintervention bei Immigranten aus der Türkei. In: Koch E., Özek M., Pfeiffer W., Shepker R.: Chancen und Risiken von Migration. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau (1998). [6] Weiss R. Macht Migration krank? Zürich: Seismo (2003). [7] Van Moffaert M, Vereecken A. Somatization of psychiatric illness in Mediterranean migrants in Belgium. Cult Med Psychiatry Sep;13(3): 297-313 (1992). [8] Storch G, Poustka F. Psychische Störungen bei stationär behandelten Kindern mediterraner Migrantenfamilien. Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr 49: 199-208 (2000). [9] Hjern A, Allebeck P. Suicide in first- and second generation immigrants in Sweden. A comparative study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 37: 423-439 (2002). [10] Michel K, Knecht CH, Kohler I, Sturzenegger M. Suizidversuche in der Agglomeration Bern. Schweizerische Medizinische Wochenschrift 121: 1133-1139 (1991). [11] Raguram R, Weiss MG, Channabasavan- [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] na SM et al. Depression and somatizitation in South India. American Journal of Psychiatry 153/8; 844-851 (1996). Michaut PA, Narring F. The health of immigrant teenagers living in Switzerland (Mandated by the Swiss Federal Office for Public Health, Bern), Lausanne (1996). Von Klitzing K. Risiken und Formen psychischer Störungen bei ausländischen Arbeiterkindern, Dissertation, Beltz, Weinheim und Basel (1983). Schmidtke A. et al. Sociodemographic characteristics of suicide attempters in Europe – combined results Suicidal behaviour in Europe: Results from WHO/ EURO Multicenter Study on Suicidal behaviour. Eds. Schmidtke A., A., Bille-Brahe U., De Leo D., & Kerkhof A. Hogrefe & Huber: Göttingen (2004). Riecher-Rössler A. Epidemiologie psychischer Störungen bei Frauen. In: Anita Riecher-Rössler & Johannes Bitzer (Hrsg.), Frauengesundheit – Ein Leitfaden für die ärztliche und psychotherapeutische Praxis. Elsevier Urban & Fischer, München, Jena (2005). Güc F. Ein familientherapeutisches Konzept in der Arbeit mit den Emigran­ tenfamilien. Familiendynamik 1:3-23 (1991). Koch E, Pfeiffer W. Migration und transkulturelle Psychiatrie. Curare 23:133139 (2000). Arcel LT, Mantonakis J, Petersson B, Demos J, Kaliteraki E. Suicide attempts among Greek and Danish women and the quality of their relationship with their husbands or boyfriends. Acta Psychiatr Scand 85: 189-195 (1992). Simons R, Murphy P. Sex differences in the causes of adolescent suicide ideation. Journal of Youth and Adolescence 14: 423-433 (1985). Cosar B, Kocal N, Arikan Z, Isik E. Suicide Attempts among Turkish Psychiatric Patients. Can J Psychiatry 42: 10721075 (1997). Khan MM, Islam S, Kundi AK. Para suicide in Pakistan: experience at a university hospital. Acta Psychiatr Scand 93: 264-267 (1996). Magne-Ingvar U, Öjehagen A, Träskman-Bendz L. The social network of people who attempt suicide. Acta Psychiatr Scand 86: 153-158 (1992) Pirkis JE, Burgess PM, Meadows GN, Dunt DR. Suicidal ideation and suicide attempts as predictors of mental health service use. Med J Aust 175(10): 542-5 (2001). 267 [24] Ostamo A, Lonnqvist J. Excess mortality of suicide attempters. Soc. Psychiatry Psychiatr Epidemiol 36(1): 29-35 (2001). [25] Akvardar Y, Demiral Y, Ergor G, Ergor A, Bilici M, Akil O. Substance use in a sample of Turkish medical students. Drug Alcohol Depend 72(2): 117-21 (2003). [26] Yilmaz A T, Stohler R, Battegay R. Opiatabhaengigkeit bei Immigranten aus der Türkei. Rundschau für Medizin (Praxis) 85, 31/32, 930-934 (1996). [27] Wacker HR, Yilmaz T, Schaub N. Abklärung und Behandlung suizidaler Patienten im Akutspital. Notfall- und Kriseninterventionsstation. Der informierte Arzt - Gazette Médicale 15: 443-446 (1994). [28] Roy A. Relation of family history of suicide attempts in alcoholics. Am J Psychiatry 157(12):2050-1 (2000). [29] Hufford MR. Alcohol and suicidal behaviour. Clin Psychol Rev 21(5):797-811 (2001). [30] Preuss UW, Schuckit MA, Smith TL, et al. Predictors and correlates of suicide attempts over 5 years in 1237 alcohol-dependent men and women. Am J Psychiatry 160:56-63 (2003). [31] Roy A. Characteristics of drug addicts who attempt suicide. Psychiatry Res 1;121(1):99-103 (2003). [32] Yilmaz AT. Immigranten aus der Türkei in einer ambulant-psychiatrischen Behandlung. Schweizerische Rundschau für Medizin (Praxis) 86:895-898 (1997). [33] Grootenhuis M, Hawton K, Van Rooijen L, Fagg J. Attempted Suicide at Oxford and Utrecht. Br J Psychiatr 165:73-78 (1994). [34] Yilmaz AT, Battegay R. Gewalt in der Partnerschaft bei Immigrantinnen aus der Türkei. Nervenarzt 68:884-887 (1997). Prof. Dr. Tarik Yilmaz Psychiatrische Abteilung, Universität Bilim, Istanbul [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 268–276 Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren aus der Perspektive betroffener Eltern und Kinder Sabine Völkl-Kernstock1, Nicolas Bein2, Daniel Gutschner3,Christian Klicpera2, Elisabeth Ponocny-Seliger4 und Max H. Friedrich1 Univ.-Klinik für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Medizinische Universität Wien 2 Institut für Klinische, Biologische und Differentielle Psychologie, Fakultät für Psychologie, Universität Wien 3 Institut für forensische Kinder- und Jugendpsychologie, -psychiatrie und -beratung, Bern, Schweiz 4 Empirische Sozialforschung, statistisches Consulting & statistische Auswertungen 1 Schlüsselwörter: Scheidung – Obsorge – Familiengericht – psychologischer Sachverständiger Keywords: divorce – family court – expert psychological evaluator Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren aus der Perspektive betroffener Eltern und Kinder Anliegen: Der kinderpsychologische/ kinderpsychiatrische Sachverständige (SV) begutachtet bei strittigen Obsorge- und Besuchsregelungen die Familie und erkennt das Leid der betroffenen Kinder, kann aber nicht im Sinne einer Behandlung intervenieren, da er ausschließlich einen Begutachtungsauftrag erhalten hat. Inwieweit bereits das SV-Gutachten eine Möglichkeit bietet, bei den Eltern mehr Einsicht und Verstehen in das kindliche Verhalten zu erlangen, © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 ist Ziel vorliegender Arbeit, ebenso wie die Erfassung der Einstellung betroffener Kinder gegenüber der SV-Begutach­tung. Methode: 1200 Elternteile, die in ein Familienrechts­ verfahren als Parteien involvierten sind, wurden postalisch kontaktiert. Ebenso wurden 27 Kinder, im Alter von 6 bis 14 Jahren, als Probanden rekrutiert, die aufgrund der hochstrittigen Trennung der Kindeseltern an einer kinderpsychiatrischen Forensikambulanz vorstellig wurden. Sowohl den Eltern als auch den Kindern wurde ein Fragebogen zur Beurteilung der Sachverständigentätigkeit vorgegeben, welche unabhängig vor der Befragung und durch nicht an der Forensikambulanz der Wiener Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie tätige Sachverständige stattfand. Ergebnisse: Die Eltern zeigen insgesamt eine hohe Unzufriedenheit mit dem SV-Vorgehen. Mehr als ein Drittel der Befragten lässt ein Informationsbedürfnis in Bezug auf den entsprechenden Umgang mit dem Kind im Rahmen der Obsorge- und Besuchsrechtsregelung erkennen. Eine zu kurze Gesprächszeit mit dem SV erweist sich als ein wesentlicher Kritikpunkt. Die Kinder bewerten die Untersuchungssituation sowie den SV positiver. Sie sehen sich selbst für den Ausgang des Gerichtsverfahrens verantwortlich und sind hinsichtlich ihrer Angaben zu Vater und Mutter verunsichert. Schlussfolgerungen: Zur Entlastung der betroffenen Kinder und aufgrund der evaluierbaren Unzufriedenheit der Eltern im Begutachtungsprozess ist eine Modifizierung der bisherigen Begutachtungsform, im Sinne eines lösungsorientierten Vorgehens in Österreich anzudenken. On the work of Austrian authorised experts on procedures in custodial and visiting rights – a survey of current practice from the parents and children view Objective: Children who are involved in their parents’ contentious separations, and about whom custody or visiting rights have become a matter of legal dispute, often demonstrate changes in behaviour, sometimes to the extent that these changes develop into noticeable psychological problems. Where custody and visiting rights are in dispute the expert child psychological/psychiatric evaluator appraises the family and recognises the suffering of the children involved, but is unable to intervene to treat the Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren ... child for they have only been authorised to provide an appraisal. The goal of this study is to determine the extent to which an expert’s evaluation provides the opportunity to intervene with the child’s parents, and to what extent it offers a greater insight and understanding of the child’s behaviour. The study also aims to record the children’s own attitude to the expert evaluation. Methods: With the support of each Austrian district court, 1200 parents involved in custodial proceedings were contacted by post. Likewise, 27 children aged between 6 and 14 years old who were referred to a forensic psychology outpatient’s clinic as a result of their parent’s highly contentious separations, were recruited as test persons. Parents as well as children were asked to complete an especially designed questionnaire in order to assess the work of the expert evaluator; this took place before the study began and was conducted by an expert who didn`t work at the forensic outpatient clinic of the department of child and adolescent psychiatry. Results: Overall, the parents displayed a high level of dissatisfaction with the expert evaluation procedure. More than a third of those questioned highlighted the lack of information about the psychological and educational contents of the appraisal, and about the way the child is treated in terms of the provisions for custody and visiting rights. A key point of criticism turned out to be the brevity of the discussion with the expert evaluator, whilst the opportunity to hold a sympathetic and understanding discussion with the expert evaluator was commonly regarded as desirable. The children evaluate the appraisal experience and the evaluator more positively, but they believe themselves to be responsible for the outcome of the court decision and feel insecure about the statements they make regarding their father and mother. Conclusions: In order to provide greater relief for the affected children, and because of the demonstrable and overwhelming pa- rental dissatisfaction with the evaluation process, a modification of the current form of evaluation to create a solution-oriented process approach should be considered in Austria. The feasibility of this proposal, and its adherence to methodological-theoretical and normative framework conditions, should be discussed amongst expert evaluators. This requires relevant legal input to ensure that a modified form of the expert evaluator’s work is implemented in a manner which is legally compliant. 1. Einleitung Kinder, die eine konfliktbehaftete, oftmals mit psychischer und physischer Gewalt verbundene Trennung deren Eltern miterleben und in diese involviert sind, können als Opfer eines familiären Prozesses erachtet werde, obwohl sie im forensisch – strafrechtlichen Sinn nicht als solche gesehen werden. Wie in der Literatur mehrfach beschrieben, können Rosenkrieg-Szenarien der Eltern krankheitswertige psychische Störungen deren Kinder bedingen [2, 4, 6, 9, 11, 18], wenngleich diese nicht immer im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Konfliktgeschehen der Eltern auftreten, sondern oftmals eine Latenzzeit bis zu mehreren Jahren haben können. Die Komplexität von Familien mit Trennung bzw. Scheidung sowie der Einfluss von externen Faktoren und internen Charakter- und Persönlichkeitsvariablen der betroffenen Kinder bedingt die Schwierigkeit einer von Störvariablen befreiten Datenerfassung. Hetherington & Kelly [12] konnten in ihrer Langzeitstudie aufzeigen, dass 20% der Kinder aus geschiedenen Familien eine krankheitswertige emotionale Störung aufweisen, wobei vor allem ein hohes Maß an Anpassungsstörungen diagnostiziert wurde. Erste Ergebnisse einer Studie der Forensikambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien, 269 zur Erfassung von kognitiven und psychopathologischen Auffälligkeiten, die in einem Zusammenhang mit der vorangegangenen hochstrittigen Trennung der Eltern stehen, weisen darauf hin, dass innerhalb dieser klinisch vorstelligen Stichprobe 98% der Kinder krankheitswertige Belastungen in Form von Affektiven Störungen, Neurotischen-, Belastungsund somatoformen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, klassifiziert nach ICD-10, aufweisen [23]. Diese Studiendaten stehen teilweise im Einklang mit Untersuchungsergebnissen von Huurre et al. [13], deren Angaben zufolge insbesondere junge erwachsene Frauen, deren Eltern sich in der Kindheit geschieden haben, mehr psychische Probleme aufweisen, als Frauen, die nicht aus einer Scheidungsfamilie stammen. Weiters konnten Huurre et al. [13] retrospektiv aufzeigen, dass sowohl bei jungen Frauen als auch bei jungen Männern, bei Vorliegen einer Scheidung der Eltern häufiger geringere Schulbildung, Arbeitslosigkeit, negative Life-events und ein höheres Krankheitsrisiko vorhanden waren. Dabei gaben die befragten Erwachsenen im Rückblick persönlicher Erfahrungen übereinstimmend an, dass eine besondere Wichtigkeit darin gegeben ist, die speziellen Bedürfnisse von Kindern in Scheidungsprozessen zu erkennen, um negative Konsequenzen und Kettenreaktionen zu verhindern oder zu minimieren [13]. Der Akt der Scheidung an sich ist dabei jedoch nicht das ausschlaggebend belastende und verantwortliche für die Entwicklung einer etwaigen Psychopathologie des Kindes, sondern viel mehr der Umgang mit Konflikten und die Streit(un)kultur der Eltern bereits vor der eigentlichen Trennung [5, 10]. Kinder in Ehen mit oftmaligen und intensiven Konflikten haben signifikant häufiger Anpassungsprobleme bereits vor der Scheidung der Eltern und weisen zudem signifikant häufiger eine beeinträchtigte ElternKind Beziehung auf [14]. Bei vorhandener physischer und psychischer Völkl-Kernstock et al. Gewalt zwischen den Eltern konnten Yates et. al. [25] aufzeigen, dass Buben signifikant vermehrt mit externalisierenden Symptomen reagieren und Mädchen signifikant vermehrt internalisierende Verhaltensweisen zeigen. Wie aus diesen Ergebnissen ersichtlich, sind insbesondere Kinder aus hochstrittigen Paar- und Elternbeziehungen, denen eine einvernehmliche Trennung und Lösung von erziehungsrelevanten Fragen nicht gelingt, gefährdet für die Entwicklung krankheitswertiger psychischer Symptome. Nach Schätzung österreichischer Familienrichter sind 10-20% der Scheidungsverfahren als strittig zu erachten, wobei im Rahmen von Pflegschaftsverfahren zumeist um die Obsorge und/ oder den Besuchskontakt mit dem Kind Uneinigkeit zwischen den Eltern besteht. In hochstrittigen Fällen basiert die richterliche Entscheidungsfindung auf einer Sachverständigenexpertise. Eine Befragung österreichischer Familienrichter ergab, dass in 21% der Obsorgeverfahren und in 14% der Besuchsrechtsverfahren die Notwendigkeit zur Hinzuziehung eines kinderpsychologischen bzw. kinderpsychiatrischen Sachverständigen (SV) besteht [22]. Mittels dieser SV-Begutachtung wird eine, die allgemeine Lebenssituation des betroffenen Kindes und dessen Familie gedeihliche und den bislang vorhandenen Konflikt befriedende sowie vor allem unter dem Zeit­ aspekt beständige Lösung angestrebt. Die Erwartungen an das SV-Gutachten scheinen jedoch im Rahmen der Beantwortung der richterlichen Fragestellung bei sachverständiger Darstellung der jeweiligen familiären IST-Situation, verbunden mit einem Ausblick auf zukünftige Geschehnisse, seitens der betroffenen Eltern überhöht zu sein, zumal sich durch diese Form der Status-Begutachtung Konflikte nicht primär lösen und kontroverse Einstellungen der Kindeseltern nicht ändern lassen. In wieweit bereits der Kinderpsychologe/ Kinderpsychiater als SV in 270 einem Familienrechtsstreit deeskalierend wirkt bzw. in welcher Weise die Belastungsreduktion bereits in der Begutachtungssituation möglich ist, beschäftigt SV hinsichtlich der Überprüfung der Effektivität ihrer Arbeit. Rexilius [20] formulierte in kritischer Sicht, dass trotz der Rückgriffe auf psychologische Theorien und Modelle man sich im Bereich der Sorgerechtsbegutachtungen meistens eines allgemeinen entwicklungsund persönlichkeitspsychologischen Standardwissens bedient und die Besonderheit des Trennungsgeschehens und seiner Folgen dabei stark vernachlässigt erscheinen. Dies mag daran liegen, dass „ein theoretisches Konzept, das geeignet wäre, die seelischen und sozialen Vorgänge bei Trennung und Scheidung, ihre Widersprüche und Folgen sowie deren produktiven Potentiale zu erfassen und handlungsleitend zu entfalten, bislang nicht entwickelt wurde“ (S.23). Darüber hinaus ist zu folgern, dass die im Rahmen der SV-Begutachtung angewendeten Untersuchungsmethoden und Testbatterien der besonderen Dynamik und Struktur von Trennung und Scheidung nicht gerecht werden, und lediglich der Versuch stattfindet, eine hoch belastete Situation festzuschreiben bzw. kindliche Beziehungen, Gefühle und Bindungen zu quantifizieren. Um verbesserte bzw. neue Wege in der SV-Arbeit sowie in der Kooperation zwischen Familienrichter – SV- und involvierten Parteien zu beschreiten, ist zuvor die nähere Betrachtung der derzeitige Begutachtungssituation in Österreich notwendig. Vorliegende Untersuchung ist ein Teil eines aus drei Befragungssäulen bestehenden Projektes, bei dem erstmals in Österreich eine Befragung der Familienrichter, SV sowie der betroffenen Eltern hinsichtlich deren Bewertung der österreichischen SVPraxis im Bereich der Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren durchgeführt und auch die Sicht betroffener Kinder erfasst wurde. In vorliegendem Untersuchungsabschnitt steht die Wahr- nehmung und Bewertung der betroffenen Eltern und Kinder hinsichtlich der SV-Tätigkeit im Mittelpunkt. Die Haupthypothese besagt, dass die SV-Begutachtung das elterliche Verständnis für das Kind und seine Erlebnisreaktionen bei und nach Trennung der Eltern beeinflusst. Zusätzlich soll überprüft werden, inwieweit betroffene Kinder an die Untersuchung durch den SV hohe Erwar­tungen hinsichtlich einer Kon­ flikt­lösung aufweisen. 2. Methode und Material Um eine Repräsentativität der Studienergebnisse für Österreich zu erzielen, wurden insgesamt 1200 Fragebögen an 60, per statistischen Zufalls­prinzip ausgewählte Bezirksgerichte der neun Bundesländer zur weiteren Verteilung an die entsprechenden Parteien in einem Familienrechtsverfahren, übermittelt. Die einzelnen Parteien wurden schriftlich ersucht, den anonymisierten Fragebogen an die Projektleitung mit beigelegtem Antwortkuvert zu retournieren. Da im Rahmen der postalischen Daten­erhebung die Befragung der Kinder nicht möglich war, wurden 27 Kinder, die im Rahmen der kinderpsychia­trischen Forensikambulanz wegen psychischer Belastungen infolge hochstrittiger Trennungen der Kindeseltern vorstellig wurden und bei denen vorangehend durch nicht an der Klinik tätige SV eine gerichtlich in Auftrag gegebene SV-Begutachtung stattgefunden hatte, als Probanden rekrutiert. Eingeschlossen in die Befragung wurden Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Grund für diese Altersbegrenzung ist einerseits die Bezugnahme auf die entwicklungsmäßig kognitiv vorhandene Möglichkeit des Reflektierens über bisherige Geschehnisse, welche mit Beginn des Schulalters zumeist vorhanden ist [19]. Andererseits sind Kinder ab dem 14. Lebensjahr in Österreich nur mehr in Ausnahme- Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren ... fällen vom SV zu begutachten, zumal sie bereits selbst aussagen können, bei welchem Elternteil sie nach der Trennung leben möchten. 2.1 Untersuchungsinstrument Der Fragebogen zur Beurteilung der SV-Tätigkeit durch die Eltern umfasst neben persönlichen Daten der Eltern, Angaben über Verlauf und Ausgang des Familienrechtsverfahrens sowie über die Person und Arbeitsweise des SV und über die Folgen des Verfahrens bzw. der derzeitigen familären Situation. Der Fragebogen unterteilt sich in vier, mittels Faktorenanalyse berechneten Faktoren (1. „Bewertung der Kompetenz des SV“, 2. „Elemente lösungsorientierter Begutachtung und Beratung“,, 3. „Elterliches Verhalten nach der SV-Begutachtung“, 4. „Zeitaufwand für die Begutachtung“) und besteht aus insgesamt 50 Items, die auf einer fünf-kategoriellen Likertskala einzustufen sind. Dieses psychometrische Verfahren weist insgesamt eine Reliabilität von α = 0,96 auf. Auch beinhaltet dieses statistisch überprüfte Datenerhebungs­ instrument abschließend zwei offen gestellte Fragen, für die eine qualitative Auswertung erfolgte. Den rekrutierten Kindern wurden zur Beurteilung ihrer Sicht der SV-Arbeit zwei, aus insgesamt 17 Fragen bestehende Skalen (1. „Zufriedenheit mit der Person und der Arbeit des Sachverständigen“, 2. „Eigene Empfindungen“) vorgegeben. Die einzelnen Items werden auf einer fünfkate­goriellen Likertskala eingestuft. Skala 1 weist dabei eine Reliabilität von α = 0,81 und Skala 2 ein α = 0,74 auf. 2.2 Statistische Analyse Die statistische Auswertung der quantitativ erhobenen Daten erfolgte mittles SPSS, Version 15 (Statistical Package for the Social Sciences Softwareprogramm, Rel. 15). Neben einer überwiegend deskriptiven Auswertung mittels Häufigkeiten, Mittel- werten und Standardabweichungen erfolgte die Überprüfung von Mittelwertsunterschieden über t-Tests für unabhängige Stichproben (bei gegebener Varianzhomogenität) oder Mann-Withney U-Test (bei fehlender Varianzhomogenität). Bei allen Tests wurde ein Signifikanzniveau von 5% zugrunde gelegt. Eine unterschiedliche Stichprobenzahl resultiert aus fehlenden Werten oder unterschiedlichen Größen von Teilstichproben. Die qualitativen Daten, resultierend aus einer offenen Fragestellung, wurden gemäß den Regeln der induktiven qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [17] ausgewertet. Induktive Kategorien wurden nur dann in die Auswertung aufgenommen, wenn die Inter-Rater-Reliabilität zweier unabhängiger Rater κ ≥0,7 betrug. 3. Ergebnisse 3.1 Darstellung der Elternstichprobe Von den insgesamt 1200 angeschriebenen Elternteilen in Gesamtösterreich, die sich in einem Familienrechtsverfahren als Parteien gegenüberstanden, wurde der Fragebogen von 206 Personen ausgefüllt retourniert. Damit konnten die Daten von 106 Müttern und 100 Vätern, unter Einbeziehung von Personen aus allen neun österreichischen Bundesländern zur Auswertung herangezogen werden und dies entspricht einer Rücklaufquote von 17,2%. Der Altersdurchschnitt der Probanden lag bei 38 Jahren, mit einer Streubreite des Alters von 19 bis 61 Jahren. Der Stichprobe gehören 49,5% allein-obsorgeberechtigte und 34,9% besuchsberechtigte Elternteile an. 4,9% der Befragten haben eine gemeinsame Obsorge, 6,8% sind weder obsorge- noch besuchsberechtigt. 2,9% der Befragten üben aufgrund einer Geschwistertrennung sowohl die Obsorge als auch ein Besuchsrecht für das andere Kind aus. 271 3.2 Das Verfahren In 25,7% der Fälle galt es gerichtlich die Obsorge über das Kind zu klären und in 39,8% stand die Besuchsrechtsfrage im Mittelpunkt der Entscheidung. In 33% der Fälle galt es einen Beschluss zu beiden Fragestellungen zu erreichen. Die restlichen 1,5% betrafen das so genannte Informations- und Äußerungsrecht des nicht obsorgeberechtigten Elternteiles. Die Pflegschaftsverfahren betrafen zu 64,4% ein Kind, zu 26,9% zwei Kinder und zu 8,7% 3 Kinder. In den Einkindfamilien handelte es sich in 57,8% der Fälle um eine Tochter und in 42,2% um einen Sohn. Das Alter der betroffenen Kinder lag zwischen einem und fünfzehn Jahren und das jüngste Kind bzw. das Einzelkind einer Familie, war im Durchschnitt zum Untersuchungszeitpunkt 6,4 Jahre alt. Der Zeitraum für ein Pflegschaftsverfahren betrug sich nach Angaben der Eltern im Durchschnitt 22 Monate. In 74,6% der vorliegenden Fälle endete das Verfahren mit einem vom Richter gefassten Beschluss, in 13,2% mit einem von den Kindeseltern getroffenen Vergleich. 1,6% der Fragebögen wurden zu einem Zeitpunkt ausgefüllt, als das Verfahrensende noch ausstand. In 0,6% der Fälle fehlte eine entsprechende Angabe. 3.3 Zur Modalität der Sachverständigenbegutachtung aus Sicht der Eltern Die Bestellung des SV-Gutachtens ging in 73,7% der Verfahren vom zuständigen Familienrichter aus. In 17,3% der Fälle war dies auch der Wunsch des Kindesvaters und in 9% jener der Kindesmutter. Die Begutachtung durch einen SV wurde im Durchschnitt sechs Monate nach Beginn des Verfahrens in Auftrag gegeben und nach durchschnittlich vier bis sechs Monaten in Folge beendet. Der bestellte SV war entsprechend den Angaben der Eltern in 53,6% der Begutachtungen weiblich und in 46,4% ein Mann. In 72,8% war der SV von Völkl-Kernstock et al. seiner Profession Psychologe. 13,1% der Begutachtungen wurden von Kinder- und Jugendpsychiatern durchgeführt. Allerdings gaben 14,1% der Befragten Unkenntnis über die genaue berufliche Ausbildung des SV an. Ergänzend ist anzumerken, dass 21,5% der SV-Begutachtungen im Jahr 2005 erfolgten, 42,5% betreffen das Jahr 2004, 19,5% das Jahr. 2003. 8,5% der Begutachtungen fanden im Jahr 2002 statt. 3.4 Beurteilungen der Sachverständigenarbeit durch die Eltern Die Berechnung eines Gesamtscores (Summe aller 50 Items) bescheinigt den SV mit einem Mittelwert von 1,78 und einer Standardabweichung von 0,86 einen unter dem Skalenmittelwert liegenden Wert. Dies ist in Hinblick auf die Kodierung der Skala als eine deutlich vorhandene Unzufriedenheit seitens der befragten Eltern zu sehen. Selbst jene Personen, bei denen der Beschluss des Gerichts gemäß ihrem Antrag ausfiel, bewerteten die SV-Arbeit im Mittel mit 2,44 (SD = 0,67), was nur einem durchschnittlichen Wert entspricht. Diese Bewertung ihrer allgemeinen Zufriedenheit ist jedoch als hoch signifikant besser (t164=12,10, p<,001***) als die jener Elternteile zu erachten, bei denen der Ausgang des Verfahrens konträr zu deren Vorstellungen verlief (MW = 1,20, SD = 0,65). Die Ergebnisse innerhalb der vier berechneten Faktoren weisen im Bereich der „Bewertung und Kompetenz Faktor 272 des SV“ ein noch im Durchschnitt liegendes Resultat (MW = 2,20, SD = 1,10) auf. Innerhalb der drei weiteren Faktoren, welche sind „Elemente lösungsorientierter Begutachtung“, „Elterliches Verhalten nach der SVBegutachtung „ und „Zeitaufwand für die SV-Begutachtung“ ergeben sich sehr niedrige Faktorenmittelwerte, die auf eine hohen Unzufriedenheit der Eltern und auf eine nicht positive Einflussnahme der SV-Begutachtung auf das weitere Elternverhalten hindeuten. (Tab. 1). 3.5 SV-Empfehlungen und Wunsch der Eltern nach Beratung 59% der befragten Eltern gaben an, dass der SV neben der Beantwortung der richterlichen Fragestellung mindestens eine weiterführende Maßnahme im Gutachten schriftlich empfohlen hat. Bei Möglichkeit von Mehrfachnennungen wurden am häufigsten (39%) eine professionell unterstützte Besuchsbegleitung und eine Mediation (36,4%) seitens des SV angeraten. In 28% der Fälle war die Psychotherapie für einen Elternteil und in 22% jene für das Kind als zu empfehlende Maßnahme im SVGutachten genannt worden. Die Umsetzung empfohlener Maßnahmen erfolgte in 47%. Bei Detailbetrachtung wurden die Besuchsbegleitung in 63% aller Empfehlungen, die Psychotherapie für das Kind in 57,7% sowie die Psychotherapie für einen Elternteil in 45% als weiterführende Interventionen angenommen. Im Rahmen der Frage nach einem verpflichtenden Beratungstermin für alle Beteiligten, d.h. für Eltern und Kinder, im Anschluss an den gerichtlichen Beschluss/ Vergleich, der nach der SV-Begutachtung folgt, durch einen ausgebildeten Psychologen bzw. Pädagogen, bei dem u.a. Hilfestellungen für den richtigen Umgang mit dem Kind nach der ehelichen Trennung besprochen werden, befürworten dies 40,7% der Befragten „sehr“. 8,3% „ein wenig“, 34,9% nicht und 16,1% zeigten sich diesbezüglich neutral. 3.6 Positiva und Negativa der SVBegutachtung aus der Perspektive betroffener Eltern Die offene Fragestellung hinsichtlich Positiva und Negativa der SV-Begutachtung wurde mittels induktiver qualitativer Inhaltsanalyse nach ­Mayring [17] ausgewertet Insgesamt wurden 106 positive und 236 negative Kommentare abgegeben, die sich den nachfolgenden inhaltsanalytischen Kategorien zuordnen ließen. Positiv erlebt wurden (Rangfolge nach Häufigkeit der Nennungen): 1. Die Sachlichkeit und Neutralität des SV. 2. Das entgegengebrachte Verständnis des SV sowie die Möglichkeit sich aussprechen zu können. 3. Der Umgang des SV mit dem Kind. 4. Die Professionalität und Erfahrung des SV. N Mittelwert Standardabweichung 1. Bewertung des SV 166 2,20 1,10 2. Elemente lösungsorientierter Arbeit 181 1,44 1,03 3. Folgen der Begutachtung 178 1,01 0,77 4. Zeitaufwand 185 1,94 1,39 Tabelle 1: FB zur Beurteilung der SV-Tätigkeit durch die Eltern -Faktorenmittelwerte Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren ... 5. Die Betrachtung des Kindes als Hauptperson und das Erkennen des Kindeswillens. 6. Ratschläge seitens des SV. 7. Durchgeführte psychometrische Verfahren sowie deren Resultate. Negativ erlebt wurden (Rangfolge nach Häufigkeit der Nennungen): 1. Der Sachverhalt wurde durch den SV falsch oder zumindest zu oberflächlich eingeschätzt. 2. Die Gespräche mit dem SV waren zu kurz. 3. Ein Mangel an wissenschaftlicher Objektivität und Neutralität wurde empfunden. 4. Keine Hilfestellungen und Lösungsvorschläge wurden angeboten sowie keine Schlichtungsversuche unternommen. 5. Der Zeitaufwand bzw. die Wartezeiten während der Begutachtung waren zu lange. 6. Die Bedürfnisse der Kinder fanden zu wenig Berücksichtigung. 7. Für das Kind wurde der Druck und die Belastung durch die Begutach­ tungs­situation als zu groß empfunden. 8. Aussagen der Betroffenen wurden vom SV missinterpretiert. Aus den abschließenden Kommentaren wurde ersichtlich, dass bei 15% der Stichprobe keine Akzeptanz des SV-Gutachtens vorliegt. 3.7 Einfluss der SV-Begutachtung auf das elterliche Verständnis für das Kind und seine Erlebnisreaktionen infolge der Trennung seiner Eltern Im Rahmen des Faktors 2, „Elemente lösungsorientierter Vorgehensweise“ ergibt sich auf Itemebene, dass 65% der Befragten angeben, keine Informationen über Verhaltensweisen und so genannte natürliche Erlebnisreaktionen von Kindern nach Trennung ihrer Eltern vom SV erhalten zu haben. Weiters geben 67% der befragten Eltern an, keine Empfehlungen für den Umgang mit dem Kind nach der Trennung vom SV erhalten zu haben. Aufgrund der nicht erfolgten bzw. nicht wahrgenommenen Information der Kindeseltern durch den SV hinsichtlich etwaiger Erlebnisreaktionen des Kindes u.a. ist zu folgern, dass durch das Einschreiten des SV ein Einfluss auf das elterliche Verständnis für das Kind und seine Erlebnisreaktionen infolge der Trennung seiner Eltern nicht zu verzeichnen ist. 3.8 Die Sicht der Kinder Die 27 rekrutierten und in die Untersuchung eingeschlossenen Kinder weisen bei Skala 1 einen Faktorenmittelwert von 2,96 (SD = 0,89) und somit ein überdurchschnittliches Maß an Zufriedenheit bezüglich der „Person und Arbeit“ des SV auf. Hinsichtlich der Begutachtung selbst ist bei Skala 2 anhand eines Faktorenmittelwertes von 3,23 (SD = 0,44 ) erkennbar, dass die Kinder einerseits eine hohe Erwartung an eine elterliche Konfliktbefriedigung aufweisen und 273 andererseits sich für den Ausgang des Gerichtsverfahrens verantwortlich fühlen und Angst haben, „etwas Falsches“ hinsichtlich der eigenen Eltern dem SV gesagt zu haben (Tabelle 2). 4. Diskussion Wie die Befragung österreichischer Familienrichter ergab, wird das Vorgehen der Sachverständigen (SV) in Form der Erhebung des Ist-Zustandes mit Ausblick auf zukünftige Entwicklungen des Kindes und der Eltern, als positiv erachtet. Die Arbeit der SV wird von den Familienrichtern in den statistisch abgesicherten Fragebogendimensionen „organisatorische Rahmenbedingungen und Nachvollziehbarkeit der Gutachten“, „Zufriedenheit mit der Person und Kompetenz der Sachverständigen“ sowie „Verwertbarkeit der Gutachten“ als sehr zufriedenstellend bewertet [22]. Im Gegensatz dazu steht die kritische Sicht der betroffenen Eltern, deren Erwartungen im Zusammenhang mit der SV-Begutachtung scheinbar nicht erfüllt wurden. Die bisher, auch aus juridischer Sicht etablierte und bewährte Form der Begutachtung soll dennoch nicht generell in Frage gestellt werden, sondern für bestimmte, hochstrittige Fälle in der Familiengerichtsbarkeit modifizierbar werden. Die Erhebung der Ist-Situation durch den SV ist als prinzipiell notwendig zu erachten, wie auch von Balloff [3] und Figdor [8] angeführt, um als SV eine entsprechende Sicht der gegenwärtigen familiären Situation Faktor N Mittelwert Standardabweichung 1. Zufrieden mit Person u. Arbeit des SV 27 2,96 0,89 2. Eigene Empfindungen 27 3,23 0,74 Tabelle 2: FB zur Beurteilung der SV-Tätigkeit durch die Kinder -Faktorenmittelwerte Völkl-Kernstock et al. zu erhalten und weitere Handlungsmöglichkeiten daraus abzuleiten. Die Frage ist jedoch, ob die SV-Tätigkeit bei der Interpretation der Ergebnisse dieser Begutachtung endet, wie dies derzeit im Rahmen des gerichtlichen Auftrages an den SV der Fall ist, oder ob ein fortgesetztes Handeln möglich sein soll, um Lösungen mit den Eltern gemeinsam zu erarbeiten, die dem betroffenen Kind eine stabile Lebenssituation in der sich veränderten Familie ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Frage der Obsorge oder die des Besuchsrechtes im Mittelpunkt steht. Vorliegende Studie ergab, dass die Eltern die derzeit mögliche Form der Begutachtung als zu wenig ihre spezielle Situation erfassend erachten und daher als nicht entsprechend effizient erleben. Sie führen mehrheitlich an, dass sie sich neben einer ausreichend längeren Gesprächsmöglichkeit mit dem SV, Informationen von diesem erhoffen und sehen ihr Kind durch die Begutachtung des SV stark belastet. Unter Heranziehung der formulierten Haupthypothese, die einen Einfluss der SV-Begutachtung auf die elterliche Sichtweise der Bedürfnisse ihres Kindes in der Trennungssituation annimmt, ist zu folgern, dass diese Hypothese vollinhaltlich nicht bestätigt werden konnte. Zwar beschreibt ein Teil der Eltern den Erhalt von trennungsspezifischen Informationen, diese können jedoch scheinbar nicht entsprechend umgesetzt werden. Demgegenüber ist es als interessantes Ergebnis zu erachten, dass mehrheitlich die Eltern ein Informationsangebot nach Beschluss- bzw. Vergleichsfassung durch das Gericht, nachfolgend dem SV-Gutachten, als wünschenswertes Angebot erachten. Neben der Informationsgewinnung wird dabei der Wunsch nach Kontakt- und Verstehensvermittlung gegenüber dem anderen Elternteil, zur Etablierung nachhaltiger Lösungen geäußert. Bereits mehrmals wurde in Österreich die Frage nach der Verpflichtung der Eltern zu diesbezüglichen Informationsgesprächen im 274 Rahmen der Kinder- und Jugendanwaltschaft thematisiert. Die Freiwilligkeit, Veränderungen anzudenken und auszuprobieren ist dabei wichtig für das Gelingen etwaiger Maßnahmen und wird immer wieder als kritisches und berechtigtes Argument angeführt. Dennoch ist der Gedanke zu verfolgen, dass Eltern, die bei der Lösung eigener Konflikte versagen und einen Richter als Autorität benötigen, zu solchen Informationsmaßnahmen verbindlich angeleitet werden sollen. Wie bereits in der Literatur mehrfach publiziert, können Eltern, die sich in einem konfliktbehafteten Trennungsgeschehen befinden, die Bedürfnisse ihres Kindes nicht umfassend und deutlich wahrnehmen und vermengen diese mit ihren persönlichen Ansichten und Empfindungen [7, 9, 12]. Demnach sollte eine Modifizierung der Begutachtungsmodalität diesen Aspekt inkludieren und neben der ausschließlichen Rechtsprechung bei Gericht ebenso die Schulung der Verantwortung gegenüber dem betroffenen Kind und einer damit verbundenen Verdeutlichung der kindlichen Bedürfnisse beinhalten. Dabei kann es nicht um die Aufarbeitung der elterlichen Konflikte gehen und auch nicht um das Verstehen der Handlungsweisen des ehemaligen Partners. Im Mittelpunkt dieser Intervention stehen das Akzeptieren der Zuneigung des Kindes zu beiden Elternteilen und die damit verbundene unterschiedliche Ausdrucksweise dieser Zuneigung. Auch die Bewusstmachung psychischer Prozesse beim Kind und die notwendige Unterstützung beider Eltern, sich als Elternteile gegenseitig für das Kind zu erhalten, ist dabei ein wichtiger Vermittlungsbereich. Dieses Wissen ist Fachleuten bekannt und wird in der Literatur [vgl. 1, 9, 15, 16], aber auch in einzelnen SV-Gutachten oftmals zitiert. Der Transfer dieses Wissens zu Eltern, die sich in einem strittigen Obsorgeund Besuchsrechtsverfahren befinden, scheint im Rahmen der derzeit möglichen Begutachtungsform nicht entsprechend zu gelingen und das Wohl des Kindes wird oftmals mit den eigenen Bedürfnissen der Eltern vermischt. Wie sich anhand der Befragung begutachteter Kinder zeigte, nehmen diese die Begutachtung an sich als nicht so belas­tend wahr, wie ihnen von Eltern attes­tiert, sondern empfinden sich für die Eltern, deren Trennung und den rechtsanhängigen Konflikt verantwortlich, den es ihnen nicht zu lösen gelingt. Diese empfundene Hilflosigkeit und das Unwissen darüber, was zu sagen oder zu tun ist beim SV um eine Konfliktlösung herzuleiten, scheinen die vorhandene Belastung der Kinder zu begünstigen und zu verstärken. Aufgrund eines zu massiven Konfliktgeschehens sind einlenkende Maßnahmen durch außenstehende Personen erforderlich, da ansonsten die psychische Gesundheit des Kindes auf lange Sicht gefährdet ist. Wie Langzeitstudien zeigen [12, 24] werden diese Einwirkungen des elterlichen Konfliktgeschehens auf die Psyche und die allgemeine Entwicklung des Kindes oftmals erst in deren jungen Erwachsenenalter deutlich sichtbar. Neben so genannten Erlebnisreaktionen, die unmittelbar mit der Trennung und dem Konfliktgeschehen der Eltern im Zusammenhang stehen, sehen Hetherington & Kelly [12] aufgrund der Daten ihrer Langzeitstudie eine Gefährdung junger Erwachsener, die aus hochstrittigen, geschiedenen Ehen stammen, zur Entwicklung dissozialer, depressiver und psychosomatischer Störungen. Ahrons [1] sowie Lehmkuhl & Lehmkuhl [16] beschreiben einen anhaltenden Langzeiteffekt bei der Verschlechterung innerfamiliären Beziehungen infolge eines nicht vorhandenen Einvernehmens über das Kind seitens der geschiedenen Eltern. Ein Begutachtungsmodell mit zwei SV, die neben der Erfassung der gegenständlichen Situation in Co-Tätigkeit die Gespräche mit den Eltern und gegebenenfalls dem Kind führen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten reflektieren, und in anschaulicher Form mit den Elternteilen bearbeiten, Die Arbeit österreichischer Sachverständiger in Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren ... ist als verändertes und auf Lösung fokussiertes SV-Vorgehen anzudenken. Das Kind, abhängig von seinem Lebensalter, soll in diesem Entscheidungsprozess der Eltern weitgehend entlastet werden, da es gerade bei Kindern unter dem 14. Lebensjahr, die in Österreich bis dahin als unmündige Minderjährige gelten, vornehmlich die Aufgabe der Eltern ist, in ihrer Verantwortung Vereinbarungen miteinander zum Wohl des gemeinsamen Kindes zu treffen. Für den Fall des Scheiterns einer gemeinsamen Lösung der Eltern kann subsidiär auf die erhobenen Daten im Rahmen der ersten Gespräche zurückgegriffen und ein schriftliches SV-Gutachten im herkömmlichen Sinn erstellt werden [vgl. 8, 21]. Dieses kurz skizzierte Vorgehen zweier SV ist nicht als eine Mediation anzusehen, wenngleich Techniken der Bewusstmachung von Konflikten, Einstellungen und Sichtweisen ähnlich sein können. Diese Co-SV-Tätigkeit ist ganz klar von Psychotherapie, Coaching oder Mediation abzugrenzen und dient weder zur Heilung eines Leidenszustandes noch zur Erzielung einer Einigung von letztlich zwei erwachsenen Gewinnern in einem Gerichtsverfahren. Vielmehr beruht der Fokus auf der Stärkung der elterlichen Verantwortung und Kompetenz mit teilweise direktiven Interventionen, damit diese Eltern wieder aus elterlicher Perspektive, im Gegensatz zur Wahrnehmung ihrer Einzelinteressen, die Bedürfnisse ihres Kindes aufnehmen können. Dieser erste Denkansatz eines lösungsorientierten SV-Vorgehens wäre in weiterer Folge auf inhaltlicher, sowohl psychologischer als auch juristischer, sowie finanzieller Ebene noch genauer auszuarbeiten. Die Modifizierung der rein entscheidungsorientierten SV-Begutachtung hin zu einer möglichen lösungsorientierten SVTätigkeit würde somit den Ansichten der Familienrichter und Sachverständigen [22] sowie jenen der betroffenen Eltern entsprechen. Auch scheint mit dieser Begutachtungs- und Interventionsform der Forderung der Eltern nach einer zeitlich ausgedehnten Möglichkeit zur Darlegung ihrer Positionen und Sichtweisen entsprochen 275 und dem Vorwurf der zu kurzen SV Eltern - Gespräche entgegen getreten zu werden. Diese Modifizierung der SV-Arbeit würde bei entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen eine inhaltliche und zeitlich intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den SVen ermöglichen, zumal Einstellungsänderungen und das Einnehmen anderer Sichtweisen neben der Erlangung einer Vertrauensbeziehung zum SV auch entsprechend Zeit zur Umsetzung benötigen. Danksagung Diese Studie wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung des österreichischen Bundesministeriums für Justiz (Projektnummer: 00118) Völkl-Kernstock et al. Literatur [1] Ahrons C.R.: Family ties after divorce: long-term implications for children. Fam Process 46 (1), 53-65 (2007). [2] Andritzky W.: Child psychiatric dokumentation in child visitation and custody disputes – results of a survey. Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr. 52 (10), 794-811 (2003). [3] Balloff R.: Zum aktuellen Stand der Begutachtung in Familiengerichtsverfahren - Einschätzung und Perspektiven. Praxis der Rechtspsychologie Heft 1, 99-113 (2004). [4] Canetti L., Bachar E., Bonne O., Agid B., Lerer A., Kaplan De-Nour A., Shalev a.Y.: The impact of parental death versus separation from parents on the mental health of Israeli adolescents. Compr. Psychiatry 41, 360-368 (2000). [5] Cohen A.J., Adler N., Kaplan S.J., Pelcovitz D., Mandel F.S.: Interactional effects of marital status and physical abuse on adolescent psychopathology. Child Abuse & Neglect 26(3), 277-88 (2002). [6] D`Onofrio B.M., Turkheimer E., Emery R.E., Maes H.H., Silberg J., Eaves L.J.: A Children of Twins Study of parental divorce and offspring psychopathology. J Child Psychol Psychiatry 48(7), 667675 (2007). [7] Figdor H.: Scheidungskinder – Wege der Hilfe. Psychosozial-Verlag, Gießen 1998. [8] Figdor H.: Lässt sich das Kindeswohl quantifizieren? Über die Rolle von Sachverständigen bei Trennung und Scheidung. Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht 6, 246-257 (2006). [9] Friedrich, M.H.: Die Opfer der Rosenkriege. Kinder und die Trennung ihrer Eltern. Ueberreuter, Wien 2004.. 276 [10] Gould M.S., Shaffer D., Fisher P., Garfinkel R.: Separation/divorce and child and adolescent completed suicide. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 37(2), 155-162 (1998). [11] Hetherington E.M.: Divorce and the Adjustment of Children. Pediatrics in Review 26, 163-169 (2005). [12] Hetherington E.M., Kelly J.: Scheidung – Die Perspektiven der Kinder. Beltz, Weinheim 2003. [13] Huurre T., Junkkari H., Aro H.: LongTerm psychosocial effects of parental divorce: a follow-up study from adolescence to adulthood. European archives of psychiatry and clinical neuroscience 256(4), 256-263 (2006). [14] Kelly J.B.: Marital conflict, divorce and children’s adjustment. Child and adolescent psychiatric clinics of North America 7(2), 259-271 (1998). [15] Kelly J.B.: Children’s living arrangements following separation and divorce: insights from empirical and clinical research. Fam Process 46(1), 35-52 (2007). [16] Lehmkuhl G., Lehmkuhl, O.: Scheidung Trennung - Kindeswohl. Diagnostische, therapeutische und juristische Aspekte. Beltz, Weinheim 1997. [17] Mayring, P.: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz, Weinheim 2003. [18] O`Connor T.G., Hetherington E.M., Reiss D.: Familiy systems and adolescent development: shared and nonshared risk and protective factors in nondivorced and remarried families. Dev Psychopathol. 10(2), 353-375 (1998). [19] Piaget J.P:. Meine Theorie der geistigen Entwicklung. Beltz, Weinheim 2003. [20] Rexilius G.: Einige theoretische und methodische Grundagen für zeitgemäße interdisziplinäre Arbeit im Familienrecht. [21] [22] [23] [24] [25] In: Bergmann E., Jopt U., Rexilius G.: Lösungsorientierte Arbeit im Familienrecht. Bundesanzeiger, Köln 2002a. Rexilius, G.: Beispiel für eine Psychologische Stellungnahme bei misslungener sachverständiger Arbeit. In: Bergmann E., Jopt U., Rexilius, G.: Lösungsorientierte Arbeit im Familienrecht. Bundesanzeiger, Köln 2002b. Völkl-Kernstock S., Bein N., Klicpera Ch., Friedrich M.H.: Evaluierung kinderpsychologischer und kinderpsychiatrischer Sachverständigengutachten aus Sicht österreichischer Familienrichter. Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht 6, 241-245 (2006). Völkl-Kernstock, S., Fennesz, P., Friedrich, M.H.: Psychische Auffälligkeiten und Familienmuster bei Kindern aus Trennungs- und Gewaltfamilien. In preperation. Wallerstein J., Blakeslee S.: Gewinner und Verlierer. Frauen, Männer und Kinder nach der Scheidung – eine Langzeitstudie. Knaur, München 1997. Yates T.M., Dodds M.F., Sroufe L.A., Egeland B.: Exposure to partner violence and child behavior problems: a prospective study controlling for child physical abuse and neglect, child cognitive ability, socioeconomic status, and life stress. Dev Psychopathol. 15, 199-218 (2003). Dr. Sabine Völkl-Kernstock Medizinische Universität Wien Universitätsklinik für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Medizinische Universität Wien [email protected] Kritisches Essay Critical Essay Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 277–282 Gedanken zu den Sterbehilfe-Bestrebungen in europäischen Ländern* Hartmann Hinterhuber und Ullrich Meise Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Innsbruck, Department für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck „Helfen sie mir zu meinem Tod, ich will nicht den Tod der Ärzte haben.“ R.M. Rilke Euthanasia and medically assisted suicide – attempts in European countries Jeder Mensch hofft auf ein menschenwürdiges Sterben. Häufig werden Patientenverfügungen, die Möglichkeit des assistierten Suizides und der Tod auf Verlangen als Fortschritt auf den Weg zu einem guten Sterben bezeichnet. In den Diskussionen um ein menschenwürdiges Sterben wird oft vergessen, dass „Sterben“ wesentlich vielschichtiger ist, als dies die Logik der autonomen Kontrolle nahe zu legen vermeint. (G. Maio) Ulla Berkéwicz beklagt, dass von einem Sterbenden noch immer bis in den Tod hinein verlangt werde, sich zu verhalten, als ginge es ums Überleben, weil Alter, Krankheit, Sterben als „ekelhaft und schamlos“ gelten, dass der Tod einen Sinn in den westli∗ Die vorliegenden Überlegungen fußen auf dem überarbeiteten Manuskript des gleich lautenden Vortrages, der im Rahmen des Sektionssymposium V "Vom Recht auf den eigenen Tod" anlässlich der 8. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychiatrie in Gmunden am 23.04.2008 gehalten wurde. © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 chen Kulturen verloren habe und nur mehr als ein Fehlschlag gelte, dass unsere Todesangst so groß sei, dass wir den Tod nur noch ignorieren und missachten. Sehr häufig wird das Angewiesensein eines Menschen auf Hilfe mit wertlosem Leben gleichgesetzt. Das Leben verliere seinen Sinn, wenn Hilfe und Unterstützung notwendig werden. Giovanni Maio, Professor für Bioethik an der Albert-LudwigsUniversität in Freiburg i. Br. weist darauf hin, dass oft von Autonomie gesprochen wird, wo lediglich Selbständigkeit in den Lebensvollzügen gemeint ist. Das Leben ist in dieser Ideologie nur so lange ein gutes Leben, wie es unabhängig von anderen geführt werden kann; ab dem Moment des Angewiesenseins auf andere wird dieses Leben zum Unleben erklärt. Mit einer solchen Ich-bezogenen Unabhängigkeitsideologie ist nicht nur die verschleierte Verachtung schwerkranken und behinderten Lebens verbunden, sondern auch eine ausgesprochene Egozentrik. Es wird hierbei aus den Augen verloren, dass die menschliche Existenz sich vor allem durch die Beziehung zum anderen konstituiert. Die Diskussion um Patientenverfügungen, Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen resultieren aus einer Denkströmung, das gesamte Schicksal abzustreifen und nichts mehr als schicksalhaft zu akzeptieren. Häufig sind Gespräche aber gerade dieser Themen mit einer Mahnung verbunden, man könne heutzutage nicht einfach so sterben, ohne vorher festgelegt zu haben, wie, wann und wo unter welchen Umständen dies erfolgen solle. Der Zuwachs an Einflussmöglichkeit ist mit einer Überforderung verbunden, häufig auch mit einem Verlust an Lebenskunst, an Gelassenheit und Zuversicht. Gelassenheit und Zuversicht sind alte Tugenden, ohne die kein Mensch gut leben kann. Die schleichende Verzweiflung vieler Menschen treibt sie in die Illusion einer alles umfassenden Kontrollierbarkeit: Die Patientenverfügung gilt dann als Voraussetzung für ein gutes Sterben, der assistierte Suizid wird – wie die Tötung auf Verlangen – als Menschenrecht erachtet. Diese Forderungen resultieren nicht zuletzt aus Defiziten der modernen Medizin, die den Patienten selten hilft, sich in ein Verhältnis zu seiner Krankheit zu bringen, deren Ärzte kaum noch in der Lage sind, eine verstehende Beziehung zu dem Patienten aufzubauen, deren Krankenhäuser eine grundsätzlich positive Einstellung zum Sterben nicht mehr vermitteln können. In diesem Sinne fordert Giovanni Maio als dringlichste gesellschaftliche Aufgabe eine Kultur des Sterbens zu erlernen, die nicht mit Verfügungen, Rechten und Gesetzen übersät ist, sondern in die Mitmenschen eingebunden sind, die Trost und Zuversicht spenden können, die ein Sterben in Beziehungen ermöglichen und damit die beste Grundlage für ein Sterben in Würde bilden. Hinterhuber, Meise Sterbehilfe in der Schweiz Das Thema der Sterbehilfe wird in der Schweiz seit langem vehement diskutiert. Dignitas-Gründer und -Geschäftsfüh­ rer Ludwig A. Minelli erklärte im Feber 2008 vor dem Zürcher Verwaltungsgericht das Prozedere seiner Sterbehilfe-Organisation: Zuerst studiere ein 77-jähriger, mit eingeschränktem Jus Praktikandi ausgestatteter Arzt die Krankengeschichte des Sterbewilligen, dann informiert dieser Dignitas, dass er bereit sei, dem Betreffenden Natrium-Pentobarbital zu verschreiben. Als nächstes klärt der Arzt in einem einmaligen persönlichen Gespräch mit dem Sterbewilligen ab, ob dieser an seinem Sterbewunsch festhalte und ob er urteilsfähig und in der Lage sei, das tödliche Mittel selbst einzunehmen. Das Verfahren gegen den Arzt wurde von einer ehemaligen Dignitas-Mitarbeiterin ausgelöst, die der Zürcher Gesundheitsdirektion mitteilte, der Arzt würde „Express-Rezepte“ ausstellen und nur ein einziges Gespräch mit dem Sterbewilligen führen. Dem Dignitas-Arzt wurde daraufhin die ärztliche Tätigkeit untersagt. Kurze Zeit später beschäftigt Dignitas neuerlich die Medien: Im März 2008 berichtete Ludwig A. Minelli nach einer Reportage des Regionaljournals von Radio DRS, dass seine Organisation in letzter Zeit Sterbewillige durch die Abgabe von Helium in den Tod begleite. Konkret heißt das, wie die NZZ vom 19.3.2008 schreibt: „Eine Mitarbeiterin von Dignitas setzt einer sterbewilligen Person in den Räumen der Organisation in Schwärzenbach eine Maske auf die Stirn.“ Sie erklärt dem Dignitas-Kunden dann „dass dieser, wenn er wirklich sterben wolle, sich die Maske über Nase, Mund und Kinn ziehen und danach weiteratmen solle.“ Der Vorgang wird gefilmt: Nach dem Oberstaatsanwalt Dr. Andreas Brunner seien die Filmaufnahmen nie- 278 mandem zumutbar und belasteten die Justizbeamten sehr. Ludwig A. Minelli begründete den Einsatz von Helium durch die Tatsache, dass es „in dringenden Fällen, wenn stark pflegebedürftige Menschen in die Schweiz kämen, es sehr schnell gehen müsse“. Helium würde nicht deshalb angewandt, um die Ausstellung eines Rezeptes zu umgehen, nachdem der Organisation der Arzt abhanden gekommen sei. Der von Dignitas angewandte Tod durch Ersticken löste in der Schweiz große Diskussionen aus, die Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe wurden neuerlich laut. Der Bundesrat bezeichnete aber bisher ein entsprechendes Gesetz als unnötig. Wie die Neue Zürcher Zeitung bereits am 04.12.2007 meldete, bekämpft Dignitas die Bemühung der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, Standesregel festzuschreiben, dass vor einer Suizidbegleitung mehrmalige persönliche Gespräche geführt werden müssen. Die Begründung: Die Freitodbegleitung von Ausländern würde dadurch erheblich erschwert. Darauf habe sich Dignitas aber spezialisiert! Dignitas sieht die Freitodbegleitung als eine „Dienstleistung“. Dienstleistungen folgen den Marktgesetzen. Wesentlich ist, dass eine Nachfrage besteht. Es widerspricht dem Dienstleistungsdenken und den Marktgesetzen, alles Notwendige zu unternehmen, um den Nachfrager von seiner Nachfrage abzubringen: im Konkreten – bei Sterbewilligen in mehreren Gesprächen ihre Motivation zu ergründen und gegebenenfalls Alternativen anzubieten. Es ist somit nur folgerichtig, dass „Dignitas“ seine „Dienstleistungen“ künftig nicht mehr auf Parkplätzen in Zürich sondern in einem Gewerbegebiet erbringen wird. „Dignitas“ hat kürzlich angekündigt, dass über eine Freitodbegleitung in Deutschland der assistierte Suizid als „Menschenrecht“ anerkannt werden soll. Würden sich deutsche Gerichte dem verschließen, ist gedacht, in Strassburg darum zu kämpfen. Exkurs: Gibt es ein Menschenrecht auf assistierten Suizid? Es ist Aufgabe der Staaten, innerhalb ihrer Grenzen die Gewährleistung der Menschenrechte zu garantieren. Juristen unterscheiden diesbezüglich zwischen einem Anspruchsrecht und einem Abwehrrecht. Wird der assistierte Suizid als Anspruchsrecht definiert, wäre es verpflichtende Aufgabe des Staates, auf seinem Territorium die Möglichkeit der Suizidbeihilfe sicherzustellen, damit jeder, der dies wolle, sie auch in Anspruch nehmen könne. Die Aufgaben, die heute beispielsweise in der Schweiz private Suizidhilfeorganisationen beanspruchen, würden somit bei Anwendung des Anspruchsrechtes zu einer staatlichen Aufgabe. Wird das eingeforderte Menschenrecht auf assistierten Suizid als Abwehrrecht interpretiert, dann engt sich die Aufgabe des Staates darauf ein, sicherzustellen, dass niemand gehindert wird, Suizidbeihilfe entweder zu leisten oder in Anspruch zu nehmen. Dieser Problematik widmete sich besonders Johannes Fischer, Professor für Ethik an der Universität Zürich. Er argumentiert 2007 folgendermaßen: Es gibt ein Menschenrecht auf Bildung. Doch gibt es auch ein Menschenrecht die eigene Bildung zu vernachlässigen? Es gibt ein Menschenrecht auf ausreichende Ernährung. Doch gibt es auch ein Menschenrecht zu verhungern? Vielfach wird in diesem Zusammenhang argumentiert, dass es ein Menschenrecht gibt, selbst zu bestimmen, wie man leben und sterben möchte. Das Recht auf Selbstbestimmung ist in der Tat zu respektieren. Dem gegenüber stellt Johannes Fischer die Frage, ob wir es nicht als eine moralische Pflicht erachten, den Hungertod eines Menschen nach Möglichkeit Gedanken zu den Sterbehilfe-Bestrebungen in europäischen Ländern zu verhindern oder Bildungsangebote mit Nachdruck zu vertreten? Gelingt es nicht, den Entschlossenen umzustimmen, haben wir – betroffen und traurig – seine Selbstbestimmung zu respektieren. Johannes Fischer setzt fort: "Es gibt kein Menschenrecht auf assistierten Suizid, nicht einmal als Abwehrrecht. Ein solches Recht würde bedeuten, dass wir die Entscheidung eines (auch an einer schweren - aber gut therapierbaren Depression leidenden) Menschen zum Suizid als solche zu respektieren hätten und nichts unternehmen dürften, um seine Selbsttötung zu verhindern: Denn dies käme einem Eingriff in seine Rechte gleich. Dagegen steht ein breiter gesellschaftlicher Grundkonsens." Gerade wir Psychiater und Psychotherapeuten und alle im Dienste der psychisch Kranken stehenden Berufsvertreter sehen es als unsere ureigenste Aufgabe und als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, depressiven Menschen und allen, die am Leben verzweifeln, wieder Hoffnung und Zukunftsperspektiven zu vermitteln und sie von ihren suizidalen Einengungen weg zu einer Akzeptanz des Daseins zu begleiten. In allen europäischen Ländern werden gerade von Psychiatern und Psychotherapeuten erfolgreiche Bemühungen und Anstrengungen zur Suizidprävention unternommen. Darüberhinaus muss anerkannt werden, dass sich die Medizin zunehmend um Palliativmaßnahmen bemüht. Die Palliativbetreuung ist in der Medizin bereits weitgehend etabliert. Die Suizidforschung lehrt uns, dass viele Suizidversuche auch in schweren Krisensituationen und bei malignen Erkrankungen einmalige Ereignisse im Leben der Betroffenen sind. Nach psychiatrisch-psychotherapeutischer Hilfe führen sie wieder ein Leben, das sie selbst als wertvoll erachten. Sterbehilfe in den Niederlanden Ein im April 2001 in den Niederlanden verabschiedetes Gesetz klammert die Tötung von kranken Menschen auf Verlangen aus Strafrecht und Strafverfolgung aus, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: - Der Patient muss unheilbar krank sein, - unerträglich leiden und - den Todeswunsch freiwillig, deutlich und wiederholt angemeldet haben. Der Arzt ist aufgefordert, "sorgfältig zu handeln, einen Kollegen zu Rate ziehen und nach der Tat den Tod dem Leichenbeschauer der jeweiligen Stadt oder Gemeinde melden." Was "unerträgliches Leiden" ist, bestimmt der Arzt. Nach diesem Gesetz entscheidet nicht mehr der Staatsanwalt, ob Mediziner oder Psychiater gesetzeskonform gehandelt haben, und somit straffrei bleiben, sondern eine Kommission aus Juristen, Medizinern und Ethikern. Ungefähr 3 % der Holländer wählten pro Jahr diesen Weg, darunter sehr viele alte und höchstaltrige, denen "Hoffnungslosigkeit" attestiert wird. Genaue Zahlen liegen seit 2005 nicht mehr vor. Aber bereits von Beginn an beschränkte sich die Erlaubnis zu töten nicht auf Menschen, die ihr Einverständnis zur Euthanasie geben: Die letzte verfügbare Statistik dokumentiert 900 Fälle von "Lebensbeendigung ohne ausdrücklichen Wunsch". Bei knapp 0,8 % aller Todesfälle wird somit die Tötung entgegen den geltenden Vorschriften sogar ohne ausdrückliche oder mutmaßliche Zustimmung vorgenommen. Von niederländischen Ärzten wird "Tötung ohne Verlangen" nicht nur an Kranken vollzogen, die zu Willensäußerungen nicht mehr fähig waren, sondern auch an Entscheidungsfähigen, die gar nicht mehr befragt wurden. Als ausschlaggebendes Motiv für die unverlangte "Sterbehilfe" gaben Ärzte keineswegs nur "unerträgliches Leiden" an, das sie ja hätten behandeln kön- 279 nen, sondern begründeten ihr Tun mit Angaben wie: "Angehörige wurden nicht damit fertig" oder "Die Lebensqualität des Patienten ist zu niedrig". Statistisch wird nicht mehr erfasst, ob Krebs- oder Aids-Patienten und behinderte Neugeborene oder demente Menschen mittels "Euthanasie" oder an der Grundkrankheit sterben. Die Bestimmungen des "Protokolls von Groningen" regeln das Vorgeben bei Patienten mit ernsthafter Demenz. Bei diesem Protokoll handelt es sich um eine Übereinkunft zwischen Ärzten und den Gerichten, in der festgeschrieben steht, wann aktive Sterbehilfe angewandt werden darf, ohne dass es anschließend zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt. Zu bedenken ist ferner, dass nur 40 % der Tötungen überhaupt gemeldet werden. Folgende Paradoxie scheint bisher unbemerkt geblieben zu sein: In der Erläuterung zum Gesetz wird nicht nur die "Barmherzigkeit" als "das zentrale Element der ethischen Legitimation des Arztes bei der Euthanasie" genannt, sondern auch die Selbstbestimmung der Patienten gepriesen: gleichzeitig werden aber Menschen getötet, die nicht in der Lage sind, ihre Einwilligung zu geben, oder die gar nicht mehr gefragt werden! Sterbehilfe in Belgien Das Abgeordnetenhaus in Belgien hat am 16. Mai 2002 ein „Gesetz zur Sterbehilfe“ erlassen. Nach diesem Gesetz ist nicht nur eine „infolge eines Unfalls oder einer unheilbaren Krankheit ausweglose Situation“ Bedingung der Zulassung der aktiven „Sterbehilfe“, diese ist auch ganz allgemein im Falle eines „dauernden und unerträglichen physischen oder psychischen Leidens, das nicht in absehbarer Zeit zum Tode führen wird“ erlaubt. Auch zu diesem Gesetzestext scheint eine klare Stellungnahme notwendig. Da physisches Leiden lange vor dem natürlichen Verlöschen des Lebens „unerträglich“ sein kann, Hinterhuber, Meise wäre es in diesen Fällen ehrlicher und korrekter nicht von „Sterbehilfe“, son­ dern von „Tötung auf Verlangen“ zu sprechen. Die zweite Zielrichtung, die das Gesetz für eine „aktive Sterbehilfe“ vorsieht, ist gerade für den Psychiater erschreckend und zutiefst unzumutbar: Erstmals wird in der modernen Rechtsgeschichte die subjektive Lebensablehnung und die Todessehnsucht zum objektiven Rechtsanspruch auf staatlich sanktionierte Lebensverkürzung. Viele Menschen erleben in einer schweren depressiven Episode, nach einer traumatisierenden Situation oder im Rahmen einer schizophrenen Psychose ihr Leben als unerträglich: Die Einleitung einer aktiven Therapie und entsprechende Unterstützungsmaßnahmen sind in diesen Fällen vordringliches Gebot. Ein zweites Argument kommt dazu: „Dauerhaftes und unerträgliches psy­ chisches Leiden“ kann Entscheidungs­ prozesse beeinträchtigen, die Urteilsfähigkeit herabsetzen sowie die Dispositions- und Diskretionsfähigkeit eines Menschen beeinflussen. Erschreckend ist somit einerseits die Tatsache, dass die Tötung eines Menschen anstelle einer zielgerichteten Therapie tritt, andererseits die rechtlichen Voraussetzungen auch bei jenen psychisch Kranken gegeben scheinen, die nach unserem Rechtsverständnis in der Urteilsfähigkeit so eingeschränkt sind, dass sie keine verantwortbaren Entscheidungen zu treffen in der Lage sind. Nicht nur die Tatbestände, die einen Anspruch auf aktive Sterbehilfe rechtfertigen sollen, sind zweifelhaft, auch das Verfahren ist sehr mangelhaft. Der Patient muss eine mündliche oder schriftliche Willenserklärung abgegeben haben. Ist diese nicht älter als fünf Jahre, wird die Tötung auch vollzogen, wenn der Patient – beispielsweise nach einem Unfall – nicht bei Bewusstsein ist und sich in einem aussichtslosen Zustand befindet. Die Möglichkeit, dass sich in der Zwischenzeit die Einstellung 280 gewandelt haben könnte, wird nicht berücksichtigt. Bei akuten Fällen muss sich der Arzt überzeugen, dass der Sterbewillige zum Zeitpunkt des Ersuchens volljährig, handlungsfähig und bei Bewusstsein war. Ist ein Sterbewilliger wohl krank, aber nicht in der Nähe des Todes, muss er seinen Wunsch schriftlich niederlegen und datieren. Der erste kontaktierte Arzt muss einen zweiten heranziehen, der entweder Facharzt für die jeweilige Erkrankung oder aber Psychiater ist. Zwischen dem Ersuchen und dem zum Tode führenden ärztlichen Eingriff müssen vier Wochen liegen. Die Fristensetzung mutet makaber an, genauso wie die Tatsache, dass der mit der „aktiven Sterbehilfe“ beauftragte Arzt die Tötung auch einem Helfer übergeben kann. Der Gesetzestext betont, dass der An­ trag auf Tötung nicht einem „äuße­ ren Druck“ folgen darf. Subtilen Druck ausüben kann aber einerseits das persönliche, familiäre Umfeld des Antragsstellers, besonders leicht durchführbar und zugleich besonders schwer nachweisbar bei alten oder psychisch kranken Menschen. Andererseits zermürbt viele auch das immer wieder wiederholte Argument der finanziellen Belastung durch hohe Betreuungskosten bei langem Siechtum. Diese Gefahrenmomente scheinen auch die Initiatoren des Gesetzes bemerkt zu haben und suchten diese durch ein Gesetz über die Ausweitung der Palliativmedizin etwas zu entkräften. Die belgischen Gesetzgeber verabsäumten auch, die aktive Sterbehilfe bzw. die Tötung auf Verlangen als rechtlich eigenständige Todesart zu definieren und diese somit in der Sterbestatistik des Landes auszuweisen. Die so getöteten Menschen werden als „natürliche Todesfälle“ ausgewiesen. Ein weiterer Widerspruch besteht zwischen dieser Bestimmung und den gesetzlich vorgeschriebenen Procedere nach erfolgter Tötung. Der Arzt muss vier Tage nach dem Tod des Menschen alle Schritte dokumentiert haben und diese einer aus Ärzten, Juristen und anderen Fachleuten bestehenden Kontrollkommission vorlegen. Bestehen Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Tötung, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der Kommissionsmitglieder, um die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Eine gegen das Gesetz, also widerrechtlich durchgeführte, staatlich aber grundsätzlich genehmigte Tötung kann damit jedoch nicht mehr ungeschehen gemacht werden! Der Präsident der Deutschen Bundesärztekammer Hoppe fand klare Worte zum belgischen Euthanasiegesetz: „Ohne entschiedenen Widerstand werde es wohl eines Tages dazu kommen, dass schwerkranke Menschen eine Genehmigung einholen müssen, um weiterleben zu können.“ Derzeit (April 2008) fordern die flämischen Liberalen im Parlament in Brüssel eine Erweiterung des bestehenden Sterbehilfegesetzes und verlangen die Zulassung der Sterbehilfe auch bei schwerstkranken Neugeborenen und dementen Erwachsenen. Dabei wird immer wieder auf das niederländische „Protokoll von Groningen“ verwiesen. Im Jahr 2007 wurden in Belgien insgesamt 495 Euthanasiefälle registriert, 4 Fünftel im Teilstaat Flandern. Sterbehilfe in Luxemburg Am 21.2.2008 wurde in der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg der Gesetzesentwurf verabschiedet, der Tötung auf Verlangen und assistierten Suizid legalisiert. Voraussetzung für die Gewährung der aktiven Sterbehilfe ist unheilbare Krankheit und Urteils- und Geschäftsfähigkeit des Patienten. Auch Jugendliche ab 16 Jahren können beim Vorliegen einer unheilbaren Erkrankung mit der Einwilligung ihrer Eltern ihrem Leben mit ärztlicher Hilfe ein Ende setzen. Gedanken zu den Sterbehilfe-Bestrebungen in europäischen Ländern Das Gesetz schreibt vor, dass Ärzte mehrere persönliche Gespräche mit den Betroffenen führen und einen zweiten Mediziner zur Beratung heranziehen müssen. Gleichzeitig mit dem Sterbehilfe-Gesetz beschloss die Abgeordnetenkammer auch ein Gesetzesprojekt zur Palliativmedizin. Als einer der ersten reagierte Eugen Brysch, der geschäftsführende Vorstand der Deutschen Hospizstiftung auf das Sterbehilfegesetz des Großherzogtums: „Es ist fatal, dass man in Luxemburg beide Gesetze gleichzeitig gemacht hat, eines zum Töten und eines zum Begleiten“. Darüber hinaus konfrontierte er Luxemburg mit folgenden Fragen: „Wie will der Staat für die Qualität der Suizidbegleitung sorgen? Wie werden die Ärzte trainiert?“ Juridische Überlegungen Deutschland in Der 66. Deutsche Juristentag hat in seinen Sitzungen vom 19. bis 22. Sep­ tember 2006 in Stuttgart zu folgenden Themen Stellung bezogen: Tötung auf Verlangen Eine auch nur partielle Legalisierung der Tötung auf Verlangen - etwa nach niederländischem Vorbild - ist abzulehnen. (angenommen 96:11:8) Ärztlich assistierter Suizid Die ausnahmslose standesrechtliche Missbilligung des ärztlich assistierten Suizids sollte einer differenzierten Beurteilung weichen, welche die Mitwirkung des Arztes an dem Suizid eines Patienten mit unerträglichem, unheilbarem und mit palliativmedizinischen Mitteln nicht ausreichend zu linderndem Leiden als eine nicht nur strafrechtlich zulässige, sondern auch ethisch vertretbare Form der Sterbebegleitung toleriert. (angenommen 72:27:12) Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung Die Voraussetzungen für die Straflosigkeit einer nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft erfolgenden Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung sollten gesetzlich geregelt werden. (angenommen 102:7:8) Sie ist zulässig a) nicht nur bei Sterbenden, sondern auch bei tödlich Kranken. (angenommen 112:4:6) b) auch dann, wenn die Lebensverkürzung zwar nicht beabsichtigt, aber als sichere Folge vorhergesehen wird. (angenommen 102:8:8) Hinderungs- und Rettungspflicht bei freiverantwortlichem Suizid Wer in Kenntnis der Freiverantwortlichkeit einer Selbsttötung a) diese nicht verhindert (angenommen 101:10:6) b) eine nachträgliche Rettung unterlässt (angenommen 97:14:8) ist nicht strafbar. Juridische Überlegungen in Frankreich Der Tod von Chantal Sébires motivierte im April 2008 die Staatssekretärin für Familie der französischen Republik, anzuregen, eine ranghohe Kommission zu schaffen, die in besonderen Einzelfällen Sterbehilfe zulassen sollte. Premierminister François Fillon ordnete eine Prüfung des Sterbehilfe-Verbotes an. Abschließende Gedanken Die in den Benelux-Staaten und der Schweiz geltenden Kriterien sind unscharf und beliebig auslegbar. Ein Arzt, der auch in bester Absicht und auf ausdrücklichen Wunsch eines Patienten die Rolle des Todbringers übernimmt, verkennt die Tatsache, dass oft das verzweifelte Todesverlangen die chiffrierte 281 Bitte nach individueller Zuwendung, nach Linderung von unerträglichen Schmerzen und Leidenszuständen oder nach ärztlicher Lebens- und Sterbebegleitung bedeuten. Im Kinsauer Manifest von 1991 warnen die Verfasser (prominente Mediziner, Juristen, Philosophen, Künstler, Politiker und andere) vor der „Tötung auf Verlangen“ und bezeichnen diese als „Einstiegsdroge“ in die Euthanasiegesellschaft. Bereits im August 1941 sagte Bischof Graf Clemens August von Galen in seiner berühmt gewordenen Predigt wider die Krankenmorde des NS-Regimes: „…. wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben „unproduktive“ Mitmenschen zu töten….. dann ist der Mord an uns allen, wenn wir altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben“ Was sich aber nach außen hin als frei gewählte Entscheidung darstellt, kann – nach H. Lauter – „auch aus dem starken Erwartungsdruck einer Leistungsgesellschaft resultieren, die den alten, gebrechlichen und unproduktiven Menschen durch Rollenentzug, unterlassene Hilfeleistung, Ausrangieren, Ghettobildung oder Altenexport und andere Formen schleichender Euthanasie aus der gemeinsamen Lebenswelt ausschließt und ein soziales Todesurteil über ihn verhängt“. Viele behinderte und betagte Menschen wünschen ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen und lehnen infolgedessen eine langdauernde Pflege ab. Solche Wünsche sind aber gesellschaftlich manipulierbar und können leicht zur Aufforderung umgemünzt werden, sich beim Auftreten einer chronischer Behinderung zu suizidieren. Das unterstellte eigene Verlangen entlarvt sich somit allzu häufig als das Verlangen Dritter. Nach der „Deklaration von Madrid“ (1996) des Weltverbandes für Psychiatrie (WPA) ist „die erste und wichtigste Pflicht des Arztes Hinterhuber, Meise die Förderung der Gesundheit, Linderung des Leidens und der Schutz des Lebens“. Bezüglich der „Euthanasie“ stellt die Deklaration fest: „Der Psychiater sollte sich dessen bewusst sein, dass die Ansichten eines Patienten durch eine psychische Erkrankung, wie beispielsweise eine Depression, verzerrt sein können. In solchen Situationen ist es die Aufgabe des Psychiaters, die Krankheit zu behandeln“ und nicht zu töten. „... Ist es purer Zufall, wenn die öffent­liche Forderung nach moralischer Enttabuisierung und gesetzlicher Regelung der Euthanasie in einem Augenblick erhoben wird, wo die anormale Altersstruktur unserer Gesellschaft, die Entwicklung der Medizin, der Pflegenotstand und die wachsenden Pflegekosten einen Problemdruck erzeugen, für den sich hier eine verführerisch einfache Lösung abzeichnet?“, schrieb der Philosoph Robert Spaemann in der Wochenschrift „Die Zeit“ vom Juni 1992. Zum assistierten Suizid und zur Tötung auf Verlangen äußerte sich der Moralphilosoph Hans Jonas: „Eine auf Mitleid alleine gegründete Ethik ist etwas sehr Fragwürdiges. Was sich da auftut für eine Gewöhnung an die Praxis des Tötens ist unabsehbar.“ Wenn das Recht dem Arzt das Töten zuerkennt, bedeutet dies nicht nur den Bruch eines grundlegenden Tabus, sondern gefährdet auch seine Rolle in der Gesellschaft. „Ein Patient darf niemals argwöhnen, dass der Arzt sein Henker sein könnte.“, meint der zuvor zitierte Philosoph. Der ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger lehnt nach einer jüngst publizierten Aussage jeden Versuch das niederländische oder das belgische Modell auf Österreich zu übertragen ab. Dies sei „eine Bankrotterklärung, weil dort depressive und nicht eiwilligungsfähige Patienten der Euthanasie anheimfallen“. Auch füe Caritas–Präsident Franz Küberl muss es „ eine strikte Grenze 282 geben, sonst öffnen wir eine Büchse der Bandora“. [8] Wie ein Blick zurück zeigt, beschäftigen sich Ärzte schon lange mit diesem Problem. Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), der bekannte Persönlichkeiten wie Goethe und Schiller zu seinen Patienten zählte, sagte: „Wenn ein Kranker von unheilbaren Übeln gepeinigt wird, wenn er sich selbst den Tod wünscht...wie leicht kann da...der Gedanke aufsteigen: Sollte es nicht erlaubt, ja sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien? Der Arzt soll und darf nichts anderes thun, als Leben erhalten,...... Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht mit in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird zu gefährlichsten Mensch im Staate; denn ist einmal die Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Nothwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur stufenweise Progressionen um den Unwerth und folglich die Unnöthigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden.“ [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Berkéwicz U.: Überlebnis. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008 Beschlüsse des 66. Deutschen Juristentages, Stuttgart 19.-22.9.2006 Cording C.: Leserbrief zu dem Artikel von R. Herzinger „Der belgische Tod. Aktive Sterbehilfe ist kein Angriff gegen das Recht auf Leben“ Die Zeit Nr. 22 (23.05.02) "Dignitas-Arzt stellte ohne Bewilligung Rezepte für Sterbewillige aus." NZZ 37, 15.2.2008, 40 Dinkermann J.: Königreich Belgien erlässt Lizenz zum Töten. Neue Solidarität 22 (2002) Fischer J.: Kein Menschenrecht auf assistierten Suizid. NZZ Nr. 282, 4.12.2007, 35 Gabriel E.: Die Bedeutung der NS-Euthanasie in der Gegenwart der österreichischen Psychiatrie. Neuropsychiatr 15, 3/4: 92-97 (2001) Helmchen H., A. Okasha: From the Hawaii Declaration to the Declaration of Madrid. Acta Psychiatr Scand Suppl 399, 20-3 (2000) Hinterhuber H., U. Meise: Die Verführbarkeit der Wissenschaften und die Gefährdung der Menschenrechte – gestern und heute. Neuropsychiatr 15, 3/4: 98102 (2001) Hinterhuber H., Meise U.: Wi(e)der das Schweigen: Gedanken zu den Euthanasiegesetzen in Belgien und den Niederlanden. Nervenarzt 76: 1286-1291 (2005) Jonas H.: Technik, Medizin und Ethik. Insel, Frankfurt a.M. 1985 Lauter H.: Ethische und juristische Probleme der Demenz. In: H. Hinterhuber (Hrsg.) Psychiatrie im Aufbruch. VIPVerlag Integrative Psychiatrie Innsbruck-Wien 1993 Maio G.: Für eine andere Kultur des Sterbens. NZZ Nr. 86, 14.4.2008, 17. "Mit Luftballon-Gas in den Tod" NZZ Nr. 66, 19.3.2008, 37 Spaemann R: „Die Zeit“, Hamburg Juni 1992 Spaemann R., Fuchs T.: Töten oder sterben lassen? Worum es in der Euthanasiedebatte geht. Freiburg - Basel - Wien: Herder V. 1997 „Tod auf Rezept“ profil 25,79-86,16. Juni 2008 Weltverband für Psychiatrie: Deklaration von Madrid. Neuropsychiatrie 12: 77-79 (1998) World Psychiatric Association: Madrid Declaration on ethical standards for psychiatric practice: http//www.wpanet. org/generlainfo/ethic1.htm Zypries B.: Patientenautonomie am Lebensende. 64. Aachener Hospizgespräch, Bundesministerium der Justiz 3.11.2007 o.Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Department für Psychiatrie und Psychotherapie; Medizinische Universität Innsbruck [email protected] Bericht Report Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 4/2008, S. 283–285 Neue potentielle pharmakologische Behandlung bei Alkoholabhängigkeit im transnationalen Forschungsansatz entdeckt: Neurokinin-1 Rezeptor Antagonist als mögliche Therapie der Alkoholabhängigkeit? Jochen Mutschler, Martin Grosshans und Falk Kiefer Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim Schlüsselwörter Alkoholabhängigkeit – Stress – Neurokinin-1 –Substanz P – Rückfallprävention Keywords alcohol dependence – stress – Neurokinin-1 – Substance P, relapse prevention Neue potentielle pharmakologi­ sche Behandlung bei Alkohol­ abhängigkeit im transnationalen Forschungs­ansatz entdeckt: Neu­ rokinin-1 Rezeptor Antagonist als mögliche Therapie der Alkoholab­ hängigkeit? Es gibt heute klare Evidenzen dafür, dass eine pharmakologische Rückfallprophylaxe das klinische Outcome bei der Alkoholabhängigkeit verbessert. In einer präklinischen und klinisch-experimentellen Studie untersuchten George und Kollegen erstmals den Einfluss von Substanz P bzw. dessen Rezeptor (NK1R) auf die Bedeutung bei Alkoholismus. Es zeigte sich, dass eine Blockade bzw. Fehlen des NK1R zu weniger Alkoholkonsum, schlechterer Alkoholverträglichkeit und geringerem Craving bei gleichzeitig besserem Allgemeinbefinden führt. © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 A new pharmacological treatment option for alcohol dependence dis­ covered in transnational study: Neurokinin-1 receptor antagonist as a possible therapy for alcohol­ ism? Today solid evidence is available that pharmacological treatments can prevent relapse and improve clinically relevant outcomes in alcoholism. In a preclinical and experimental-clinical study George and colleagues first investigated the role of Substance P and its receptor (NK1R) in the context of alcoholism. They could demonstrate that either the blockade of the receptor, or the lack of the receptors leds to a decreased alcohol intake as well as reduced alcohol tolerance and craving concomitantly accompanied by improved general well-beeing. Fragestellung Rolle des Neurokinin-1 Rezeptors (NK1R) bei Alkoholismus? Vorgestellte Arbeit George DT, Gilman J, Hersh J, Thorsell A, Herion D, Geyer C, Peng X, Kielbasa W, Rawlings R, Brandt JE, Gehlert DR, Tauscher JT, Hunt SP, Hommer D, Heilig M. Neurokinin 1 receptor antagonism as a pos- sible therapy for alcoholism. Science. 2008 Mar 14;319(5869):1536-9. Epub 2008 Feb 14 Hintergrund Die Alkoholabhängigkeit ist eine chronisch-rezidivierend verlaufende Erkrankung mit weitreichenden sozialen und ökonomischen Folgen für die Betroffenen. Psychosozialer Stress und Alkohol-assoziierte Reize (Cues) stellen die Hauptgründe für Rückfälle bei alkoholabhängigen Patienten nach einer Suchtbehandlung dar. Aus präklinischen und klinischen Studien ist bekannt, dass biologische Veränderungen im Bereich der StressAchse mit der Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit einhergehen: Neben vielen anderen ist Substanz P einer der Neurotransmitter, die durch Stress erhöht werden. Der Hauptrezeptor für Substanz P ist der Neurokinin 1 Rezeptor (NKR1R), der v.a. im Belohnungssystem und Gehirnregionen, die für die Stress-Antwort verantwortlich sind, exprimiert wird (z.B. Hypothalamus, Amygdala und N. accumbens). Vorbekannt war, dass der NK1R Antagonist GR205171 Symptome der sozialen Angst und die Stress-Antwort beim Trierer Sozialen Stress Test beim Menschen reduziert. George und Kollegen untersuchten in der vorgestellten translationalen Studie erstmalig die Hypothese, ob Mutschler, Grosshans, Kiefer die Blockade der NK1-Rezeptoren einen Einfluss auf Belohnungseffekte durch Alkohol bzw. Craving im Tiermodell und bei Patienten hat. Methodik Zunächst wurden tierexperiementell NK1R knocked-out Mäuse (-/-), mit heterozygoten (+/-) und Wildtyp Geschwistern (+/+) auf ihr freiwilliges Alkoholtrinkverhalten, AlkoholSensitivität und Alkohol-Metabolismus untersucht. Freiwilliges Alkohol-Trinkverhalten wurde in einem klassischen 2-Flaschen Experiment (Wasser/Alkohol) mit ansteigenden Alkoholkonzentrationen (3-15 % über 60 Tage) untersucht. Die Alkohol-Sensitivität wurde durch die Zeit erfasst, die Tiere benötigen, um nach einer hohen Alkoholdosis (3,5 g/kg i.p.) den Umkehrreflex (righting reflex) wiederzuerlangen. In den human-experimentellen Teil der Studie, welcher sich insgesamt über 4 Wochen erstreckte, wurden 50 stationäre Patienten eingeschlossen. Wesentliche Einschlusskriterien waren: Alter zwischen 21-65 Jahre, Diagnose der Alkoholabhängigkeit nach SKID, die Patienten durften in den letzten 4 Wochen keine psychotropen Medikamente (ausgenommen der Entzugsmedikation) eingenommen haben und Patienten durften nicht an medizinischen und psychiatrischen Komplikationen leiden. Im Rahmen einer Baseline Cue-Reactivity Messung musste ein bestimmtes Maß an Craving durch einen Alkoholreiz auslösbar sein. Ein weiteres wichtiges Einschlusskriterium war, dass Patienten mittels dem psychometrischen Testverfahrens State-TraitAngst-Inventar (STAI) einen Wert > 39 aufweisen sollten – d.h. es wurden Patienten mit einer relativ hohen „Grund-Ängstlichkeit“ eingeschlossen. Für die erfolgreiche Teilnahme an der Studie erhielt jeder Patient $600. Diese 50 stationären alkoholabhängigen Patienten wurden randomisi- 284 ert und erhielten zwischen Woche 2-4 doppelblind den hochselektiven NK1R Antagonist LY686017 oder Placebo. Regelmäßig wurde während des gesamten Untersuchungszeitraumes mittels standardisierter Erhebungsverfahren Craving (AUQ), Depressivität, Ängstlichkeit (CPRSSA) und globaler klinischer Eindruck (CGI) erhoben. Nach einer zweiwöchigen Behandlungsphase mit dem NK1R-Antagonisten wurden alle Patienten mittels einem standardisierten Stresstest, dem Trierer Stress Test (TSST), Stress ausgesetzt. Gleichzeitig wurde den Patienten in dieser Stresssituation erneut Alkoholreize dargeboten und das darauf folgende Ausmaß des Cravings erfasst. Im Rahmen des TSST wurde zusätzlich das Stresshormon Cortisol bestimmt. Bis zu 48 Stunden nach dem TSST wurde noch bei allen Patienten die BOLD-Response mittels fMRI auf negative und positive emotionale Stimuli (aus dem International Affective Picture System) und alkoholassozierte Reize gemessen. Als Hauptoutcome-Variable wurde spontanes und (Stress-) Reizinduziertes Craving der Patienten definiert. Ergebnisse In den tierexperimentellen Untersuchungen zeigte sich, dass Tiere mit einem fehlenden NK1R (-/-) im Vergleich zu heterozygoten (+/-) und Wildtypen (+/+) hochsignifikant weniger Alkohol tranken. Passend hierzu war die Sensitivität für die sedativen Effekte von Alkohol nach intraperitonealer Injektion bei -/- Tieren deutlich höher, was sich in einer verlängerten Zeit wiederspiegelte, bis sich die Tiere erholten und den Umkehrreflex (LORR) wiedererlangten. Bei NK1R knocked-out Tieren kann das Neuropeptid Substanz P keine Wirkung mehr entfalten. In den humanexperimentellen Experimenten ergab sich, dass Patienten, die mit dem NK1R-Antagonisten behandelt wurden, während der gesamten Behandlungsphase hochsignifikant weniger spontanes Alkohol-Craving angaben, vergleichen mit der Placebogruppe. Dies spiegelte sich auch im objektiv erhobenen klinischen Gesamteindruck wider (CGI-Skala), hier ging es den Verum behandelten Patienten während des Behandlungszeitraumes insgesamt klinisch signifikant besser. Im Rahmen der Stress-Testung mit dem TSST erlebten die Verum behandelten Patienten signifikant weniger Craving, nachdem ihnen ein Alkohol-Cue präsentiert wurde, als die Patienten mit Placebo. Serum Cortisolspiegel, welche im Rahmen des TSST erhoben wurden, waren durchgängig niedriger in der Verumgruppe. In den fMRI Messungen zeigte sich, dass die Placebo-Patienten wie erwartet eine höhere Aktivierung auf negative Stimuli im Bereich der Insel, dem mittleren temporalen Gyrus und des inferioren frontalen Gyrus zeigen. Dieses Aktivitätsmuster findet sich üblicherweise bei alkoholabhängigen Patienten. Bei den Patienten, die mittels Verum behandelt wurden, waren die Aktivierungen in diesen Gehirnbereichen signifikant reduziert. Ein gegensätzliches Bild zeigte sich bei den positive Stimuli: Die mit LY686017 behandelte Gruppe zeigte eine höhere Bold-Response im Thalamus, Caudatum und verschiedenen temporalen Regionen im Vergleich zur Placebogruppe. Eine von Heinz und Kollegen kürzlich publizierte Arbeit konnte zeigen, dass eine höhere Aktivierung auf positive emotionale Bilder im Bereich des Striatum und Thalamus bei Alkoholikern einen verminderten Alkoholkonsum innerhalb den nächsten 6 Monaten prädiziert. [2] Somit führte die Behandlung mit dem NK1R-Antagonisten zu einer „Normalisierung“ der Gehirnaktivierung auf negative und positive Stimuli. Neue potientielle pharmakologische Behandlung bei Alkoholabhängigkeit ... Schlussfolgerungen Pärklinisch und klinisch-experimentell wurde in der Studie von George und Mitarbeiter die Bedeutung von Substanz P bzw. dessen Rezeptor (NK1R) erstmalig im Hinblick auf Alkoholismus untersucht. Es zeigte sich, dass eine Blockade bzw. Fehlen des NK1R zu weniger Alkoholkonsum, schlechterer Alkoholverträglichkeit und geringerem Craving bei gleichzeitig besserem Allgemeinbefinden führt. Kommentar Die vorliegende Studie zeigt einen neuen innovativen Behandlungsansatz in der pharmakologischen Therapie Alkoholabhängiger. Sehr schön konnte demonstriert werden, wie mit einem translationalen Forschungsansatz hypothesengeleitet ein vielversprechendes Ergebnis erreicht wurde. Als einzige Einschränkung bleiben die kleine Fallzahl und die Beschränkung der medikamentösen Intervention auf den Zeitraum der stationären Behandlung zu erwähnen. Weiterhin bleibt unklar, ob die Reduktion von Craving durch die Behandlung auch zu einer verminderten Rückfallrate nach einer Entzugsbehandlung führt. Weitere klinische Studien sind allerdings bereits in Planung. Generell bleibt zu sagen: Vergleiche mit anderen Klassen von Psychopharmaka (z. B. Neuroleptika, Antidepressiva) ergeben bei den bereits zugelassenen „Entwöhnungsmitteln“ (Acamprosat, Naltrexon und Disulfiram) angesichts ihrer Effektivität einen medizinisch unplausiblen niedrigen Einsatz. Dabei gibt es keinerlei Evidenzen, dass eine medikamentöse Rückfallprophylaxe die Bereitschaft für eine Inanspruchnahme zusätzlicher psychosozialer Therapien verringert, im Gegenteil scheint eine Pharmakotherapie diese Bereitschaft durch eine erhöhte Abstinenzquote noch weiter zu erhöhen. So sagt Mark Willenbring vom amerikanischen National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism dem Feld der Entwöhnungsmittel bereits sein „Prozac Moment“ in den nächsten 5-10 Jahren voraus. 285 Literatur [1] George DT, Gilman J, Hersh J, Thorsell A, Herion D, Geyer C, Peng X, Kielbasa W, Rawlings R, Brandt JE, Gehlert DR, Tauscher JT, Hunt SP, Hommer D, Heilig M. Neurokinin 1 receptor antagonism as a possible therapy for alcoholism. Science. 2008 Mar 14;319(5869):15369. Epub 2008 Feb 14 [2] Heinz A, Wrase J, Kahnt T, Beck A, Bromand Z, Grüsser SM, Kienast T, Smolka MN, Flor H, Mann K. Brain activation elicited by affectively positive stimuli is associated with a lower risk of relapse in detoxified alcoholic subjects. Alcohol Clin Exp Res. 2007 Jul;31(7):1138-47. Epub 2007 May 4 Dr. med. Jochen Mutschler Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim [email protected]