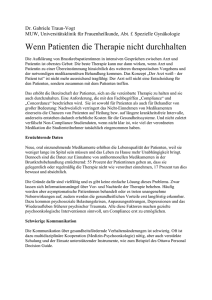Freie Universität Berlin
Werbung

Freie Universität Berlin Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie Studiengang Psychologie Diplomarbeit Konzeption eines Online-Informationssystems für Sarkom-Patientinnen und interessierte medizinische Laien vorgelegt von: Jens Lückert Erstgutachter: Herr Professor Doktor M. Zaumseil Zweitgutachter: Herr Professor Doktor L. Issing Berlin, den 06. Juni 2001 0. Eidesstattliche Erklärung Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre an Eides Statt, dass ich die beiliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Ich bin mit der Einsichtnahme in der Bibliothek und auszugsweiser Kopie einverstanden. Alle übrigen Rechte behalte ich mir vor. Zitate sind nur mit vollständigen bibliographischen Angaben und dem Vermerk „unveröffentlichtes Manuskript einer Diplomarbeit“ zulässig. Berlin, den 06. Juni 2001 ...................................................................................... Jens Lückert -2- 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis Eidesstattliche Erklärung..............................................................................................................2 1. Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................3 1.1. Danke ..................................................................................................................................7 1.2. Vorwort ...............................................................................................................................7 2. Aufbau der Diplomarbeit........................................................................................................9 3. Sarkome..................................................................................................................................11 3.1. Definition - was sind Sarkome? ........................................................................................11 Weichgewebssarkome.......................................................................................................................... 12 Knochensarkome ................................................................................................................................. 12 3.2. Epidemiologie – wie häufig sind Sarkome und wer bekommt sie? ..................................12 3.3. Diagnose – wie werden Sarkome festgestellt?..................................................................13 Diagnostische Verfahren ..................................................................................................................... 13 Staging – Bestimmung des Erkrankungsstadiums ............................................................................... 14 3.4. Therapie – wie werden Sarkome behandelt? ....................................................................16 Operation - chirurgische Therapie...................................................................................................... 16 Bestrahlung - Radiotherapie ............................................................................................................... 17 Chemotherapie – systemische Therapie .............................................................................................. 17 3.5. Prognose – wie sind die Heilungschancen? ......................................................................18 4. Patientinnen-Information .....................................................................................................20 4.1. Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung ......................................................................20 Patientinnenrecht auf sorgfältige Information (Aufklärung)............................................................... 22 Patientinnenrechte in der Behandlung ................................................................................................ 24 Recht auf selbstbestimmtes Sterben..................................................................................................... 24 Rechte im Schadensfall........................................................................................................................ 24 4.2. Patientenrechte – gesundheitspolitische Aspekte der Aufklärung ....................................25 Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin – Bestimmung oder Neubestimmung? ........................ 25 4.3. Wirtschaftliche Aspekte der Patientinnenaufklärung........................................................27 4.4. Medizinethische Probleme bei der Patientinnenaufklärung..............................................29 Die fehlende Möglichkeit der Selbstbestimmung................................................................................. 29 Der fehlende Wille zur Selbstbestimmung ........................................................................................... 30 5. Mediendidaktische Produktion ............................................................................................32 5.1. Analyse des Bildungsproblems und der Vorgaben ...........................................................32 -3- 1. Inhaltsverzeichnis 5.2. Klärung der Funktion der didaktischen Medien................................................................32 Wissensrepräsentation......................................................................................................................... 33 Steuerung und Regelung von Lernprozessen ....................................................................................... 33 Werkzeug zur Unterstützung der Wissenskonstruktion........................................................................ 33 Werkzeug zur Unterstützung interpersoneller Kommunikation........................................................... 34 Motivation zum Lernen........................................................................................................................ 34 5.3. Zielgruppenanalyse ...........................................................................................................34 Soziodemographische Merkmale......................................................................................................... 34 Vorwissen ............................................................................................................................................ 35 Lernmotivation .................................................................................................................................... 35 Lerngewohnheit und Lerndauer .......................................................................................................... 36 Lernorte und Medienzugang................................................................................................................ 36 5.4. Bestimmung der Lehrziele ................................................................................................36 Gegenstandsbereiche von Lehrzielen .................................................................................................. 36 Leistungsniveaus nach Merrill ............................................................................................................ 37 5.5. Bestimmung der Lehrinhalte.............................................................................................38 Tätigkeitsanalyse ................................................................................................................................. 38 Aufgabenanalyse ................................................................................................................................. 38 Sammlung und Gliederung von relevantem Lehrstoff ......................................................................... 38 5.6. Bestimmung der Form des Lernangebotes........................................................................38 Sequentiell orientierte Lernangebote .................................................................................................. 38 Logisch strukturierte Angebote ........................................................................................................... 39 Werkzeuge zur Wissenskonstruktion.................................................................................................... 40 Benutzerinnenführung ......................................................................................................................... 40 5.7. Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an Auftraggeberin und Zielgruppe..................................................................................................................................42 Medienwahl ......................................................................................................................................... 42 Anbindung ........................................................................................................................................... 43 5.8. Umsetzung und Kontrolle der Konzeption .......................................................................44 6. Forschungsinteresse, Zielsetzung und Fragestellung .........................................................46 6.1. Forschungsinteresse ..........................................................................................................46 6.2. Zielsetzung der Untersuchung ..........................................................................................47 6.3. Fragestellung der Untersuchung .......................................................................................47 Spezielle Fragestellung in Bezug auf die inhaltlichen Anforderungen................................................ 47 Spezielle Fragestellung in Bezug auf die gestalterischen Anforderungen........................................... 48 Spezielle Fragestellung in Bezug auf die Anbindung .......................................................................... 48 -4- 1. Inhaltsverzeichnis 7. Planung und Durchführung der Untersuchung..................................................................49 7.1. Darlegung der Ausgangssituation und der eigenen Vorannahmen ...................................49 Auftrag................................................................................................................................................. 49 Auftraggeber........................................................................................................................................ 51 Auftragnehmer und seine Positionierung zum Auftrag........................................................................ 51 7.2. Planung der Untersuchung ................................................................................................52 Reformulierung des Forschungsauftrages........................................................................................... 53 Abschließende Formulierung des Forschungsauftrages ..................................................................... 56 Die Forschungsstrategie: Aktionsforschung ....................................................................................... 56 Das problemzentrierte Interview als Methode der Aktionsforschung ................................................. 59 Sampling: Die Auswahl der Interviewpartnerinnen ............................................................................ 64 Der Interview-Leitfaden ...................................................................................................................... 67 Die Auswertung der problemzentrierten Interviews............................................................................ 69 Evaluation des Online-Konzepts ......................................................................................................... 70 7.3. Durchführung der Untersuchung.......................................................................................71 Die Kontaktaufnahme.......................................................................................................................... 71 Gespräche mit Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches ......................................................... 72 Die Auswertung ................................................................................................................................... 72 Gespräche mit den Patienten............................................................................................................... 74 Gespräche mit den Ärzten ................................................................................................................... 74 Die Evaluation..................................................................................................................................... 75 8. Die Ergebnisse der Untersuchung........................................................................................76 8.1. Das Konzept......................................................................................................................76 Gestaltung des Internet-Konzeptes...................................................................................................... 76 Anbindung der Internet-Seiten ............................................................................................................ 79 8.2. Die Evaluation...................................................................................................................80 Änderungswünsche.............................................................................................................................. 80 Anbindung des Online-Konzeptes........................................................................................................ 82 8.3. Wichtige Produktions-Faktoren des Online-Informationssystems ...................................84 Analyse des Bildungsproblems und der Vorgaben .............................................................................. 85 Klärung der Funktion der didaktischen Medien.................................................................................. 85 Zielgruppenanalyse ............................................................................................................................. 85 Bestimmung der Lehrziele ................................................................................................................... 85 Bestimmung der Lehrinhalte ............................................................................................................... 85 Bestimmung der Form des Lernangebotes .......................................................................................... 86 Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an die Auftraggeberin und die Zielgruppe86 Umsetzung und Kontrolle der Konzeption........................................................................................... 86 9. Diskussion und Ausblick .......................................................................................................87 -5- 1. Inhaltsverzeichnis 9.1. Aufklärung über die Krankheit: Ja! - Aufklärung über die Aufklärung: Nein?................87 Methodische Überlegungen zum Problem........................................................................................... 88 Aussichten............................................................................................................................................ 88 9.2. Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin: zwei Interessengruppen – ein Team? .....89 Methodische Überlegungen zum Problem........................................................................................... 91 Aussichten............................................................................................................................................ 92 9.3. Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? ............................................92 Methodische Überlegungen................................................................................................................. 95 Aussichten............................................................................................................................................ 95 10. Zusammenfassung .................................................................................................................97 11. Literatur .................................................................................................................................99 A. Anhang: Die Interviews – Leitfäden und Zitierweise.......................................................103 Leitfaden für das Gespräch mit den Patientinnen (und Angehörigen) .............................................. 103 Leitfaden für das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich.................. 103 Leitfaden für das Gespräch mit den Ärzten ....................................................................................... 104 Zitierweise der Interviews ................................................................................................................. 105 B. Anhang: Theoretisch hergeleitete Kategorien ..................................................................106 Inhalt ................................................................................................................................................. 106 Gestaltung ......................................................................................................................................... 106 Anbindung ......................................................................................................................................... 107 C. Anhang: Kategorien – Gestaltung und Anbindung..........................................................108 Gestaltung ......................................................................................................................................... 108 Anbindung ......................................................................................................................................... 108 D. Anhang: Konzept des Online-Informationssystems (Kategorien – Inhalt)....................109 E. Anhang: Kategorien – Evaluation......................................................................................141 Inhalt & Gestaltung........................................................................................................................... 141 Anbindung ......................................................................................................................................... 141 -6- 1.1. Inhaltsverzeichnis - Danke 1.1. Danke Zuerst einmal möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich auf vielfältige Weise unterstützt und damit diese Diplomarbeit erst möglich gemacht haben: Meinen Forschungspartnerinnen – den Patientinnen, ihren Angehörigen, den Ärzten und den Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich der Klinik – danke ich für die Offenheit und das Vertrauen, das sie mir in den Gesprächen entgegengebracht und die das Forschungsvorhaben mit Leben gefüllt haben. Ein weiteres „Dankeschön“ geht an Anja Hermann, die bei den Unwägbarkeiten des Forschungsprozesses immer ein offenes Ohr für mich hatte und mir mit Rat, Erfahrung und Kontakten beiseite gestanden hat. Und schließlich sind da noch all die helfenden Hände, Köpfe und Herzen meiner Freundinnen und meiner Eltern, die mich bei der Alltagsorganisation unterstützt, mir beim Verstehen geholfen und die mich bei Stress und Sorgen getragen haben. 1.2. Vorwort Das Schreiben einer Diplomarbeit bedeutet meines Erachtens nicht nur Wiedergeben fachlicher Inhalte sondern auch – wie jeder Sprachgebrauch - gesellschaftlicher Spielregeln und Mechanismen. Zwei dieser Mechanismen, die ich als Ausschlussmechanismen benennen möchte, liegen mir als Ärgernis besonders am Herzen: Zum einen der untergründige Ausschluss von Frauen durch deren Nicht-Nennung1, bzw. durch die ausschließliche Nennung von Männern (günstigstenfalls unter dem Zusatz, Frauen seien mitgemeint). Zum anderen die Bildung von (fachlichen) Eliten durch eine Begriffswahl, die Anderen den Zugang zum Dargestellten erschwert oder unmöglich macht. Diesen beiden Mechanismen möchte ich sprachliche Aufmerksamkeit widmen. Aus diesem Grund bin ich bemüht, mich einer klaren und allgemein verständlichen (Alltags-)Sprache zu bedienen und Fachausdrücke und Fremdworte zu vermeiden, soweit es mir möglich ist, bzw. zu erklären, soweit deren Gebrauch mir wichtig erscheint. Ziel meiner Vermeidung von Fremdworten ist es, allen Interessierten das Wissen dieser Diplomarbeit zugänglich zu machen unabhängig davon, ob sie Laien sind oder welchem Fachgebiet sie sich zurechnen. 1 Pusch (1984) zeichnet in ihrem Vortrag am Beispiel von Orwells Roman „1984“ nach, wie die Nichtnennung („Vaporisation“) von Frauen mit der Löschung ihrer Existenz aus dem Bewußtsein einhergeht: sowohl aus dem Bewusstsein von Redenden, als auch aus dem der Zuhörenden – aus dem Bewusstsein von Männern und aus dem Bewusstsein der Frauen selbst. So wird die Wahrnehmung von Frauen als handelnde Wesen verschleiert, erschwert, bisweilen unmöglich gemacht. Ihre Leistungen und ihr Vermögen werden ignoriert oder ihrem (männlichen) Umfeld zugeschrieben. -7- 1.2. Inhaltsverzeichnis - Vorwort Dem Ausschluss von Frauen (aus der Sprache) möchte ich mit dem von Pusch (1990) geforderten Gebrauch des umfassenden Femininums entgegentreten, das heißt dass ich bei Verallgemeinerungen die weibliche Form wähle: So werde ich zum Beispiel von Patientinnen schreiben, wenn ich Patienten und Patientinnen meine. Männer sind bei der weiblichen Form mitgemeint. Wieso wähle ich keine Doppelnennung sondern kehre die unterdrückenden Verhältnisse um? Zum einen wird oft bei der Begründung der einfachen Nennung die bessere Lesbarkeit ins Feld geführt – die Konsequenz ist jedoch nur allzu oft das Beibehalten (und damit weitere Festschreiben) der alten Form. Der Kommentar, Frauen seien mitgemeint, erleichtert meines Erachtens das Gewissen, ändert jedoch nichts am sprachlichen Sachverhalt und in der Gedankenwelt der Leserinnen. Zum Anderen pflichte ich Pusch (1990, S. 99f) bei, die ausführt, dass nicht eine Gleichbehandlung sondern eine gezielte Bevorzugung und Förderung von Frauen ein effektives Mittel zur Herstellung sprachlicher Gerechtigkeit ist. Eine Gleichbehandlung in Form von Doppelnennungen ist meines Erachtens erst dann die sinnvollere Wahl, wenn eine sprachliche Gerechtigkeit hergestellt ist. Auf diese Weise schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe: Ich bediene mich einerseits einer Sprache, die angenehm lesbar sein soll und die andererseits einen Beitrag leisten soll, sprachliche Gerechtigkeit effektiv herzustellen. -8- 2. Aufbau der Diplomarbeit 2. Aufbau der Diplomarbeit Im Rahmen dieser Diplomarbeit habe ich in Zusammenarbeit mit Patientinnen, Angehörigen, Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches und Ärztinnen der Robert-Rössle-Klinik ein Konzept für ein Online-Informationssystem für Sarkompatientinnen und deren Angehörige entwickelt. Dieses Vorhaben schließt an ein Kooperationsprojekt2 zwischen der Freien Universität Berlin (Prof. Zaumseil) und der Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. Hohenberger) an, das die Kommunikation zwischen Ärztinnen und medizinischen Laien untersucht hat. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine „Informationskluft“ zwischen diesen beiden Gruppen festgestellt: Medizinische Laien (Patientinnen und Angehörige) haben ein anderes Bild von ihrer Erkrankung und der Prognose als ihre behandelnden Ärztinnen. Das wurde unter anderem darauf zurückgeführt, dass bei den Patientinnen und Angehörigen bestimmte Informationen fehlten. Eine Möglichkeit, die – neben anderen – zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Ärztinnen und medizinischen Laien angedacht wurde, war das Erstellen von Internetseiten, die die entsprechenden Informationen für die Laien bereithalten, bzw. die es ihnen ermöglichen, die für sie relevanten3 Informationen einzuholen. Bevor ich die eigentliche Konzeption der Internetseiten in den Kapiteln 6 (Forschungsinteresse, Zielsetzung und Fragestellung) und 7 (Planung und Durchführung der Untersuchung), sowie die Ergebnisse der Untersuchung in Kapitel 8 vorstelle, möchte ich die theoretischen Grundlagen der Arbeit darstellen. Wenn ein Online-Informationssystem für Sarkom-Patientinnen und deren Angehörige erstellt werden soll, so liegt die Darstellung von drei Themenbereichen nahe: 1. 2. 3. Darstellung der Erkrankung: Sarkome Darstellung der Notwendigkeit von Information: Aufklärung Darstellung der Produktion von Internetseiten (Online-Medien): Mediendidaktische Produktion Eine Einführung in das Thema Sarkome werde ich im 3. Kapitel geben. Diese Einführung dient nur einem groben Überblick über die Einteilung der Sarkome, möglicher Untersuchung, Bewertung und Behandlung sowie Prognose-Einschätzungen, sie kann und soll nicht als Grundlage für eine Einschätzung oder Beurteilung der eigenen Erkrankung der Leserin oder der Erkrankung von Bekannten dienen4. 2 Als wissenschaftliche Mitarbeiterin betreute Anja Hermann das Projekt „Brücken zwischen Vorstellungen von Laien und von Fachpersonal über den Umgang mit chronisch rezidivierenden Krebserkrankungen am Beispiel von Knochen- und Weichgewebssarkomen. Entwicklung von Interventionsansätzen zur Verbesserung der Kommunikation als Grundlage zur Beteiligung der Betroffenen an der Behandlung“ 3 relevant, lat.-frz. von Belang, erheblich, wichtig. (vgl. Hermann, 1992, S. 363) 4 Interessierte Laien wenden sich zu diesem Zweck bitte an ihre behandelnde Ärztin und bitten sie um entsprechende Fachliteratur. Die in dieser Diplomarbeit verwendete Literatur finden sie im Kapitel 11. -9- 2. Aufbau der Diplomarbeit Im Kapitel 4 wird mich das Wertesystem beschäftigen, in dem das zu konzipierende Informationssystem verortet werden kann: Wieso sollen den Patientinnen Informationen gegeben werden? Welche Informationen sollen den Patientinnen gegeben werden? Die Auswahl der Informationen ist nicht nur durch den Bedarf der Patientinnen gesteuert, sondern auch durch die Auswahl der Ärztinnen, die von ihnen unter anderem aufgrund gesundheitspolitischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und ethischer Überlegungen getroffen wird. Das 5. Kapitel dient zur Darstellung der „technischen“ Seite der Diplomarbeit: Da die in dieser Diplomarbeit erarbeitete Konzeption umgesetzt werden soll, müssen schon in der Konzeption die zur Umsetzung wichtigen Daten erfasst und „eingeplant“ werden. Welche Daten und Vorüberlegungen dies sind, soll in diesem Kapitel behandelt werden. Die Kapitel 6 bis 8 dienen der Darstellung meiner Untersuchung. In Kapitel 6 stelle ich das Forschungsinteresse und die Fragestellungen dar. In welcher Situation und unter welchen Bedingungen die Untersuchung stattfindet und welches methodische Vorgehen dieser Forschungssituation angemessen ist, erarbeite ich in Kapitel 7. Hier stelle ich auch den Verlauf der Untersuchung dar und die Änderungen, die gegenüber der Planung notwendig wurden. Das 8. Kapitel dient der Darstellung meiner Forschungsergebnisse. Hier werde ich gestalterische und anbindungsorientierte Bestandteile des Internet-Konzeptes, sowie ihre Verbesserungsmöglichkeiten vorstellen. Die Inhaltliche Konzeption und den Aufbau der Seiten sind im Anhang zu finden. Des weiteren werde ich noch einmal die zur Umsetzung des Konzeptes notwendigen Daten stichwortartig zusammenfassen. Eine Diskussion meiner Untersuchung und ihrer Ergebnisse schließt im 9. Kapitel an. - 10 - 3.1. Sarkome - Definition - was sind Sarkome? 3. Sarkome Im Folgenden möchte ich einen kurzen Überblick über die verschiedenen Sarkomarten geben, darüber, wo sie vorkommen, wie häufig sie sind, bei welchem Personenkreis sie gehäuft auftreten, wie man sie feststellt und behandelt und wie die Heilungschancen sind, um einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Informationen über die Krankheit auf den Seiten vermittelt werden sollen. Neben dem Eindruck, von den Informationen, die – nicht zuletzt aus meiner Untersuchung heraus – als wichtig erachtet werden, soll dieses Kapitel auch einen Eindruck davon vermitteln, auf welche Art und Weise diese Informationen vermittelt werden sollen. Ebenso, wie sich das Produkt dieser Diplomarbeit (die Internetseiten) nicht (nur) an die Fachöffentlichkeit richten, sondern in erster Linie an interessierte Laien, verfolge ich auch in dieser Arbeit selbst die Absicht die Inhalte allgemeinverständlich wiederzugeben. Insofern kann dieses Kapitel auch als eine inhaltliche Vorarbeit zu den medizinischen Inhalten des Informationssystems angesehen werden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die hier dargestellten Inhalte weder als Grundlage für eine Einschätzung oder Beurteilung der eigenen Erkrankung der Leserin noch einer Einschätzung oder Beurteilung der Erkrankung von Bekannten dienen kann und soll – sie hat lediglich einen Übersichscharakter und beschreibt die Krankheit(en) statistisch im Hinblick auf die untersuchten Patientinnengruppen. Im jeweiligen Einzelfall können Faktoren zum Tragen kommen, die eine Veränderung gegenüber den statistischen Werten bewirken, zum Beispiel eine Verbesserung oder Verschlechterung der Prognose, ein höheres oder niedrigeres Ersterkrankungsalter und so fort5. 3.1. Definition - was sind Sarkome? Sarkome sind seltene Krebserkrankungen, die sehr grob in 1. 2. Weichgewebssarkome und Knochensarkome unterteilt werden können. Eine genauere Einteilung der Sarkome erfolgt anhand des Gewebes, in dem sie entstehen (NCI, 2001b), bzw. der Beschaffenheit des Gewebes, aus dem sie bestehen. Zum einen können Gewebezellen entarten und Tumoren ausbilden, so dass eine „Verwandtschaft“ zwischen Tumorgewebe und dem Gewebe besteht, in dem der Tumor wächst. Zum anderen können Tumorzellen so weit entarten, dass diese „Verwandtschaft“ in Laboruntersuchungen nicht mehr nachvollzogen werden kann (Wie zum Beispiel bei dem Synovialsarkom oder dem alveolaren Weichgewebssarkom). Die (gewebsbezogene) Herkunft dieser Tumoren wird als un- 5 Interessierte Laien, die personen- oder krankheitsfallbezogene Informationen bekommen möchten, wenden sich zu diesem Zweck bitte an (ihre behandelnden) Ärztinnen. Selbstverständlich können sie auch dort nach entsprechender Fachliteratur fragen. - 11 - 3.2. Sarkome - Epidemiologie – wie häufig sind Sarkome und wer bekommt sie? klar angesehen6 Zum Dritten kann jedoch das Tumorgewebe eine andere „fremde“ Struktur haben. Dies ist der Fall, wenn Tumore metastasieren, das heißt Tumorzellen in ein anderes Gewebe gelangen, sich dort „einnisten“ und dort weiterwachsen. Diese Tumore werden als Metastasen bezeichnet. Treten sie zum Beispiel in der Lunge auf, so spricht man nicht von einer neuen Erkrankung (Lungenkrebs), sondern von einer bestehenden Krebserkrankung, die Metastasen gebildet hat7. Weichgewebssarkome Als Weichgewebssarkome8 werden bösartige Tumore bezeichnet, die im Bindegewebe, in der Muskulatur und/oder im Fettgewebe entstehen. 40% der Weichgewebssarkome befallen die Beine und Füße, 15% die Arme und Hände, 15% den Kopf- und Nackenbereich und ca. 30% den Rumpf. Zu den häufigeren Weichgewebssarkomen gehören 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Synovialsarkome Sie treten in der Regel als harte Schwellungen auf und entstehen im Gelenkbereich: in Sehnen, Schleimbeuteln, Gelenkzwischenräumen, etc. Meist treten Synovialsarkome an Armen und Beinen (Ellenbogen- oder Kniegelenk) auf, seltener in Kopf, Hals oder Rumpf. Rhabdomyosarkome Sie treten bei Kindern in den Muskeln des Bewegungsapparates, des Kopf-, Hals- oder Beckenbereichs auf (embryonal), bei Erwachsenen meist in der Zahnhöhle (alveolar). Leiomyosarkome Sie treten im Muskelgewebe des Bauches, Magen- und Darmtraktes und in Blutgefäßen auf. maligne fibröse Histiozytome (MFH) Sie treten im Bindegewebe - meist in Armen und Beinen – auf, das das Weichgewebe mit den Knochen verbindet. Fibrosarkome Sie treten wie auch MFH im Bindegewebe auf, meist in Armen und Beinen. Liposarkome Sie treten im Fettgewebe meist nahe der Haut auf. Neurofibrosarkome Sie treten in dem Gewebe auf, das die Nerven umgibt. Kaposi-Sarkome Sie treten zumeist im Bereich der Haut und des darunter liegenden Bindegewebes auf. Knochensarkome Zu den wichtigstem Knochensarkomen9 gehören 1. 2. Ewingsarkome Sie treten im Knochen auf, meist in Armen und Beinen. Osteosarkom / maligne fibröse Histiozytome (MFH) Sie treten am Übergang vom Knochen zum Weichgewebe auf. 3.2. Epidemiologie – wie häufig sind Sarkome und wer bekommt sie? Genaue Zahlen für Neuerkrankungen sind nicht bekannt, da es keine einheitliche Registrierung der Erkrankungsfälle gibt. Bei Weichgewebssarkomen sprechen Katenkamp & Kosmehl (1995) für die USA von etwa 6000 Neuerkrankungen pro Jahr, das entspricht 1% der bösartigen Krebs- 6 vgl. NCI (2001b) und Eggermont (2001) vgl. Eggermont (2001) 8 vgl. Eggermont (2001) 9 vgl. NCI (2001c, 2001d) 7 - 12 - 3.3. Sarkome - Diagnose – wie werden Sarkome festgestellt? erkrankungen. Eggermont (2001) bestätigt diese Zahlen und erwähnt zusätzlich bei Kindern 1300 Neuerkrankungen pro Jahr. Weiterhin beschreibt er (ebd.) das Vorkommen einiger Weichteilsarkome10: Synovialsarkome treten häufiger bei Männern als bei Frauen und meist im Alter von 20-30 Jahren auf, zum Teil auch später. Rhabdomyosarkome werden unterschieden in embryonale Rhabdomyosarkome, die meist bei Kindern und jungen Erwachsenen vorkommen und alveolaren Rhabdomyosarkomen, die bei Erwachsenen auftreten und dort die Zahnhöhlen befallen. Leiomyosarkome sind in allen Altersstufen gleich häufig vertreten, Liposarkome befallen meist ältere Männer oder Männer mittleren Alters. Kaposi-Sarkome treten meist als Folge einer Immunschwäche (z. B. HIV/AIDS) auf, Neurofibrosarkome stehen meist im Zusammenhang mit der genetisch bedingten Recklinghausen-Erkrankung. Das National Cancer Institute beschreibt für Ewing-Sarkome (NCI, 2001c) ein Ersterkrankungsalter von 10 bis 20 Jahren (Jungen erkranken häufiger als Mädchen) bei Osteosarkomen (NCI, 2001d) liegt die Ersterkrankung meist im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter. 3.3. Diagnose – wie werden Sarkome festgestellt? Sarkome treten zuerst meist als schmerzlose Schwellungen auf, die mit verschiedenen diagnostischen Verfahren untersucht werden. Ziel der Untersuchungen ist es, die genaue Lage und Beschaffenheit des Geschwürs herauszufinden, zu entscheiden, ob es sich um eine bösartige oder gutartige Geschwulst handelt und – wenn es sich um eine Krebserkrankung handelt – das Stadium der Erkrankung zu bestimmen. Die Einteilung in verschiedene Krankheitsstadien wird Staging genannt. Diagnostische Verfahren Ein erster Eindruck von der Größe der Geschwüre, die diese Schwellungen hervorrufen, kann im Bauchraum oder bei oberflächennahen Geschwüren11 durch eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) gewonnen werden (Issels, 1999). In der Folge können verschiedene andere bildgebende Verfahren angewandt werden: Einen ersten Überblick kann sich die Ärztin mit einer Röntgenaufnahme verschaffen. Dabei wird der geschwollene Bereich in zwei Ebenen (aus zwei Perspektiven) geröntgt. Ein genaueres Bild von festen Strukturen (Knochen) kann aufgrund einer Computertomographie (CT) gewonnen werden, Weichgewebe und die Ausdehnung von Geschwüren im Gewebe hingegen kann mit einer Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht werden (Helmberger et al., 10 vgl. auch NCI (2001a) für Weichteilsarkome im Erwachsenenalter und NCI (2001b) für Weichteilsarkome im Kindesalter. - 13 - 3.3. Sarkome - Diagnose – wie werden Sarkome festgestellt? 1999). Während die Computertomographie auf Röntgentechnik beruht und wie auch das Röntgen die Dichte von festem Material untersucht, reagieren bei der Magnetresonanztomographie die die unterschiedlichen Gewebe, also die nicht festen Bestandteile des Körpers, auf die Veränderung elektromagnetischer Felder. So wird mit der CT die Struktur eines Tumors deutlich, mit der MRT die Ausdehnung und Abgrenzung des Tumors zu anderem Gewebe. „Zur Beurteilung einer Fernmetastasierung ist die Röntgenuntersuchung des Thorax in zwei Ebenen sowie eine CTUntersuchung des Thorax12 (8 mm Schichten; ggf. Spiral-CT) obligat, ferner die Ultraschall- und/oder CTUntersuchungen des Abdomens13 sowie die Skelettszintigraphie14.“(Helmberger et al., 1999, Abschnitt 2, Hervorhebung, J. L.) „Die Positron-Emission-Tomographie (PET) eröffnet die Möglichkeit, Stoffwechselaktivitäten des Tumorgewebes zu erfassen.“(ebd., Abschnitt 4, Hervorhebung, J. L.) Nach der bildgebenden Diagnostik wird eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen, um zu bestimmen, ob der Tumor gut- oder bösartig ist und um welchen Tumor es sich handelt (welchem Gewebe/Zellmaterial er entspringt) (Rechl, Graf, Issels, 1999). Staging – Bestimmung des Erkrankungsstadiums Die Erkrankungsstadien werden nach der sogenannten TNM-Klassifikation eingeteilt. Man unterscheidet vier Stadien, die jeweils noch einmal zweigeteilt sind. Einen Überblick gibt folgende Tabelle15: Stadium Histopathologisches Grading Primärtumor Regionale Lymphknoten Fernmetastasen Prognose in % IA G1 T1 N0 M0 100 IB G1 T2 N0 M0 88 IIA G2 T1 N0 M0 83 IIB G2 T2 N0 M0 52 IIIA G3, G4 T1 N0 M0 87 IIIB G3, G4 T2 N0 M0 39 IVA Jedes G Jedes T N1 M0 10 IVB Jedes G Jedes T Jedes N M1 - 11 d. h. Geschwüren, die relativ nah an der Körperoberfläche liegen Thorax, lat. Brustkorb (Pschyrembel, 1993, S. 1529) 13 Abdomen, lat. Bauch, Unterleib (Pschyrembel, 1993, S. 1) 14 Die Szintigraphie ist ein auf Röntgentechnik basierendes Verfahren, bei dem Kontrastmittel verabreicht werden. (Vgl. Pschyrembel, 1993, S. 1508) 15 Klassifikationen. TNM: Klinische Klassifikation. Der Onkologe, 1995 (1), S. 85. Vgl. auch NCI (2001a) 12 - 14 - 3.3. Sarkome - Diagnose – wie werden Sarkome festgestellt? Tumore des Stadiums I werden als Low-Grade-Tumore bezeichnet, die Stadien II und III bezeichnen High-Grade-Tumore Stadium IV kennzeichnet das metastasierende Krankheitsstadium (NCI, 2001a). Histopathologisches Grading Das histopathologische Grading beschreibt den Differenzierungsgrad des Tumorgewebes. Unter Differenzierungsgrad versteht man die Ähnlichkeit des Tumorgewebes mit dem Gewebe, in dem der Tumor wächst. Gut differenziertes Tumorgewebe bezeichnet dabei Tumorgewebe, das dem Ursprungsgewebe sehr ähnlich ist, undifferenziertes Zellmaterial hingegen ist so entartet, dass das Tumorgewebe dem Gewebe, in dem der Tumor wächst, nicht mehr ähnelt. Das histopathologische Grading wird unterteilt in G1: Gut differenziert G2: Mäßig differenziert G3: Schlecht differenziert G4: Undifferenziert GX: Differenzierungsgrad kann nicht bestimmt werden. Primärtumor Die „T-Einstufung“ beschreibt die Größe (Ausdehnung) des Tumors: T0: Kein Anhalt für Primärtumor T1: Tumor 5cm oder kleiner in größter Ausdehnung T2: Tumor mehr als 5cm in größter Ausdehnung TX: Primärtumor kann nicht beurteilt werden Regionäre Lymphknoten Der „N-Wert“ macht Angaben über das Vorhandensein von Metastasen am nächsten Lymphknoten: N0: Keine regionären Lymphknotenmetastasen N1: Regionäre Lymphknotenmetastasen NX: Regionäre Lymphknotenmetastasen können nicht beurteilt werden Fernmetastasen In der M-Kategorie werden die Fernmetastasen beschrieben: M0: Keine Fernmetastasen M1: Fernmetastasen MX: Das Vorliegen von Metastasen kann nicht beurteilt werden Darüber hinaus können noch Angaben darüber gemacht werden, wo die Metastasen auftreten: Lunge (PUL), Knochen (OSS), Leber (HEP), Hirn (BRA), Lymphknoten (LYM), Knochenmark (MAR), Pleura16 (PLE), Peritoneum17 (PER), Nebennieren (ADR), Haut (SKI) oder andere Organe (OTH). 16 17 Pleura, lat. Brustfell (Pschyrembel, 1993, S.1208) Peritoneum, lat. Bauchfell (Pschyrembel, 1993, S.1172) - 15 - 3.4. Sarkome - Therapie – wie werden Sarkome behandelt? Prognose Der Prognose-Wert wird als „rezidivfreie 5-Jahres-Überlebensrate in Prozent“ bezeichnet. Er macht eine Angabe darüber, wie groß der Anteil der Patientinnen ist, die nach einer Behandlung fünf Jahre überleben, ohne einen neuen Tumor zu bekommen. 3.4. Therapie – wie werden Sarkome behandelt? Je nach Art des Sarkoms und Schwere der Erkrankung (siehe Staging) wird zur Behandlung auf eine Operation (chirurgische Therapie), Bestrahlung (Radiotherapie), Chemotherapie (systemische Therapie) oder verschiedene Kombinationen dieser Behandlungsmethoden zurückgegriffen (Eggermont, 2001). Handelt es sich beispielsweise um einen einzelnen kleinen Tumor (Stadium IA), so ist in der Regel eine operative Entfernung des Tumors (Resektion) angezeigt. Ist der Tumor zu groß, an ungünstiger Lage oder scheidet eine operative Entfernung aus anderen Gründen aus, so kann ein einzelner Tumor auch bestrahlt werden. Haben sich Metastasen ausgebildet und hat sich der Krebs so bereits im Körper verteilt oder befindet sich der Tumor an einer für Operation und Bestrahlung ungünstigen Stelle, so wird die Chemotherapie eingesetzt18. Ein weiterer Aspekt, der bei der Entscheidung des Therapieverfahrens hinzugezogen wird, ist das Ansprechen der bestimmten Sarkomart auf die Therapie: Einen Tumor, der auf Chemotherapie schlecht anspricht, systemisch zu behandeln, ist zu überdenken. Hier wird in der Regel eine Güterabwägung stattfinden: Ist es günstiger, die Nebenwirkungen einer Bestrahlung oder Operation in Kauf zu nehmen oder will man auf eine kurative19 Behandlung verzichten und gegebenenfalls nur den Krankheitsprozess verlangsamen? Operation - chirurgische Therapie Hohenberger (1995) beschreibt, dass für Weichteilsarkome das „Ziel des operativen Eingriffs [...] die Tumorresektion im Gesunden [ist. ...]. Eine weite Exzision strebt an, den Tumor mit einem Sicherheitsabstand von etwa 2 cm zur Tiefe und von ca. 5 cm nach longitudinal und zur Seite zu exzidieren“ (S. 101f) Ein solch weiträumiges „Herausschneiden“ des ganzen Tumors zuzüglich des oben genannten „Sicherheitsbereiches“ wird R0-Resektion genannt. Sie ist nur in wenigen Geweben überhaupt möglich – bei Tumoren nahe am Hand- oder Kniegelenk oder in tieferen Muskelschichten gar nicht. In solchen Fällen sind die Resektionsränder (der „Sicherheitsabstand“ zum Tumor) nur 18 vgl. Behandlungsschema (Algorithmus) für Weichteilsarkome, wie es im Onkologen, 1995 (1), S. 84 dargestellt ist. 19 kurativ, lat. heilend (Pschyrembel, 1993, S. 834) – kurative Behandlung: eine Behandlung, die auf Heilung abzielt. - 16 - 3.4. Sarkome - Therapie – wie werden Sarkome behandelt? wenige Millimeter breit oder es sollten – soweit möglich – die benachbarten Gewebe und Knochenteile mit entfernt werden. Diese Form der Behandlung setzt eine genaue Kenntnis der Lage und der Umgebung des Tumors voraus. Die Überlegung, ob ein Tumor operiert (chirurgisch therapiert) werden kann, bezieht jedoch nicht nur die Lage und Umgebung mit ein, sondern auch die Frage, ob durch die Operation ein Funktionsverlust auftritt, der vertreten werden kann (Hohenberger, 1995). Wird zum Beispiel ein Tumor am Handgelenk entfernt, so ist unter anderem zu überlegen, ob bei der Operation Nervenbahnen durchtrennt werden und somit nach der Operation der Tastsinn der Hand beeinträchtigt ist. Bestrahlung - Radiotherapie Bei der Bestrahlung (Radiotherapie, Strahlentherapie) werden die Tumorzellen mit energiereichen Strahlen behandelt. Ziel ist es, den Tumor abzutöten oder zu verkleinern. Dabei werden zwei Formen der Strahlentherapie unterschieden: Die Bestrahlung von außen (z. B. mit Röntgenstrahlen) und das Einbringen von strahlendem Material in den Tumorbereich. (KID, 1997). Voraussetzung für die Bestrahlung ist die Kenntnis darüber, wo sich der Tumor befindet und wie groß er ist20, da nur dieses Gebiet bestrahlt wird. Die Wirkung der Strahlen beruht darauf, dass sie das Erbgut der Krebszellen schädigen, um so einen Zelltod herbeizuführen. (Busch et al., 1999). Die Bestrahlung kann sowohl vor einer Operation angewandt werden, um einen Tumor zu verkleinern und damit eine Operation, die an der Tumorgröße gescheitert ist, möglich zu machen, sie kann jedoch auch nach der Operation stattfinden, um die Neubildung eines Tumors im Operationsgebiet oder die Ausbildung von Metastasen zu verhindern. Als Nebenwirkungen beschreibt Forbriger (2000b) „Kopfschmerzen, Müdigkeit auf Grund eines sich verschlechternden Blutbildes, Übelkeit bis hin zum permanenten Erbrechen, Schleimhautentzündungen, Hautverbrennungen- und -rötungen, Durchfall und Geschmacksveränderungen und zeitweiser Geschmacksverlust. [...] Ein häufiges Problem bei Bestrahlungen im Mundbereich ist die sogenannte Mundtrockenheit, d.h. die Speichelzellen produzieren wenig oder keinen Schleim. Dies führt [...] zu erheblichen Komplikationen. [... beim] Schlucken und Sprechen. [...] Später kann es zu Hautverfärbungen und Verhärtungen des Unterhautfettgewebes kommen. [...] Die Gefahr besteht, eine Strahlenpneumitis (Lungenentzündung) zu bekommen. Auch Rezidive sind möglich, aber selten. Bei Bestrahlungen im Kopfbereich kann [im bestrahlten Bereich] das Haar ausfallen (Kopf- und Barthaare)“ Chemotherapie – systemische Therapie Bei der Chemotherapie werden den Patientinnen Medikamente verabreicht. Diese Medikamente können als Tabletten verabreicht oder per Infusion21 in die Blutbahn eingebracht werden. Auf 20 vgl. Eggermont (2001) 21 „Einfließenlassen von Flüssigkeiten in den Körper, meist in eine Vene [Blutgefäße mit zum Herzen hinführender Strömungsrichtung] (intravenöse I.), selten in eine Arterie [Schlagadern, Blutgefäße mit vom Herzen wegführender Strömungsrichtung], in das Unterhautgewebe ([…]subkutane [… I.]) oder in den Darm.“ (Pschyrembel, 1993, S. 113, 720 und 1622) - 17 - 3.5. Sarkome - Prognose – wie sind die Heilungschancen? diesem Wege werden die Medikamente (Zytostatika) im ganzen Körper verteilt und können dort die Krebszellen abtöten. Eine Chemotherapie mit mehr als einem Medikament wird Kombinationschemotherapie genannt. Eine Chemotherapie, die nach der operativen Entfernung von Tumoren eingesetzt wird – beispielsweise um das Risiko der Streuung von Tumoren oder einer Neubildung von Tumoren vorzubeugen – bezeichnet man als adjuvante22 Chemotherapie. Eine neoadjuvante Chemotherapie wird zur Verkleinerung eines Tumors eingesetzt, um eine spätere operative Entfernung zu ermöglichen. (KID, 2000) Eine Sonderform der Chemotherapie stellt die Extremitätenperfusion dar: Hier wird der vom Tumor befallene Körperteil (Arm oder Bein) vom Kreislauf „abgekoppelt“ und mit hoch dosierten Medikamenten „durchspült“. Sind nach der Behandlung die Medikamente wieder aus dem Körperteil „herausgespült“, wird es wieder an den Körper „angekoppelt“. Die Extremitätenperfusion erlaubt eine noch höhere Dosierung der Medikamente als eine hoch dosierte Chemotherapie. (Eggermont, 2001) Neben den gewünschten Wirkungen auf die Krebszellen, können sich jedoch auch unerwünschte Nebenwirkungen zeigen, die die Patientinnen belasten: Haarausfall, Übelkeit, Verlust des Geschmacksvermögens, Appetitlosigkeit, Schwächung des Immunsystems, Lichtempfindlichkeit, Schmerzen, Juckreiz der Haut. (Forbriger, 2000a). Nebenwirkungen können die Nieren betreffen (Nierenversagen), die Herzmuskulatur (Herzinfarktrisiko), die Nerven, die Lungen, den Magenund Darmbereich und den Fortpflanzungsbereich (Schädigung der Frucht im Mutterleib, Schädigung von Ei- und Samenzellen, Schädigung der Keimzellen, die Ei- und Samenzellen bilden Unfruchtbarkeit) (Schlimok, 1997). 3.5. Prognose – wie sind die Heilungschancen? Die Heilungschancen werden – wie im Kapitel 3.3 bereits eingeführt – in rezidivfreien 5-JahresÜberlebensraten statistisch erfasst. Das heißt jedoch nicht, dass die Krebserkrankung dann endgültig als geheilt angesehen werden kann, wenn eine Patientin fünf Jahre ohne Neuauftreten eines Tumors überlebt hat. Krebs muss als chronische Krankheit angesehen werden, bei der auch nach vielen Jahren Tumore erneut auftreten können, jedoch sinkt die Wahrscheinlichkeit des Neuauftretens von Tumoren mit der Zeit. Bei der Abschätzung der Prognose spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle, unter anderem die Krebsart, der Differenzierungsgrad, wie schnell der Tumor wächst (Größe) und sich verbreitet (Metastasierung) und wie gut er auf die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten anspricht. Auch das Alter, der Allgemeinzustand der Patientin haben einen Einfluss auf die Behandlung und 22 adjuvant, lat. unterstützend - 18 - 3.5. Sarkome - Prognose – wie sind die Heilungschancen? damit auch auf die Heilungschancen – in dem Maße, wie sich diese Faktoren ändern, ändert sich auch die Prognose für die jeweilige Patientin (NCI, 2000)23. Allgemein lässt sich sagen, je differenzierter und kleiner ein Tumor ist und je weniger die angrenzenden Lymphknoten und andere Organe durch Metastasen befallen sind, desto besser ist die Prognose. 23 “A cancer patient's prognosis can be affected by many factors, particularly the type of cancer, the stage of the disease, and its grade (how closely the cancer resembles normal tissue and how fast the cancer is likely to grow and spread). Other factors that may also affect the prognosis include the patient's age, general health, and response to treatment. As these factors change over time, a patient's prognosis is also likely to change”.( NCI, 2000, Abschnitt “Handling the Diagnosis“, 2) - 19 - 4.1. Patientinnen-Information - Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung 4. Patientinnen-Information Der Gedanke, Internetseiten anzubieten, kann nicht nur dem Hintergrund der Verbesserung der Kommunikation zwischen Ärztinnen und medizinischen Laien gesehen werden, sondern auch vor dem Hintergrund der (Patientinnen-) Aufklärung – das heißt insbesondere vor einem 1. 2. 3. 4. medizinrechtlichen, gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen und medizinethischen Hintergrund. Anders formuliert: Die Kommunikation als verbesserungswürdig zu beschreiben und das Ziel der Verbesserung in einem weitestgehend gleichen Wissens- und Informationsstand zu sehen, setzt ein Wertesystem voraus, das besagt, dass ein gleicher Informationsstand als „gut“ bezeichnet werden kann, ein ungleicher Informationsstand von der behandelnden Ärztin und ihrer Patientin hingegen als weniger gut, als verbesserungswürdig. Es wäre – um ein Beispiel für eine andere Position zu nennen – denkbar, den Standpunkt zu vertreten, dass das Informieren von Patientinnen so lange unnötig ist, wie die Behandlung dem – wie auch immer beschriebenen – Wohl der Patientinnen dient und die Patientinnen nicht mit ihr unzufrieden sind und keinen Wunsch nach Erklärung oder Information zur Behandlung und der damit verbundenen Themen haben. Die Beschreibung dieses Wertesystems kann Aufschluss darüber geben, welchem Zweck die Informationen und die verbesserte Kommunikation dienen soll und wie die „Güte“ von Informationen und Kommunikation „gemessen“ wird: Es ist die Frage, ob der Informationsanspruch, den dieses Wertesystem vertritt, ein „totaler Informationsanspruch“ ist (Patientinnen sollen alles wissen – vielleicht sogar mehr als ihre Ärztin) oder ob es sich um einen Anspruch an gleiche Information bei Patientin und behandelnder Ärztin handelt. Das Informieren der Patientinnen – und somit auch ein Online-Informationssystem für Patientinnen – wird nur als gut eingeschätzt, wie es eben diesem Wertesystem entspricht und seinen Forderungen nachkommt. 4.1. Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung Schlund (2001) führt die ärztliche Aufklärungsverpflichtung auf eine Entscheidung des Reichsgerichts vom 31.5.1894 zurück, das noch heute herrschende Rechtsprechung ist. Diese Entscheidung24 besagt, dass ein ärztlicher Eingriff – auch wenn er der Genesung dient, nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt und erfolgreich abgelaufen ist – unabhängig davon wie krank eine Patientin ist, den Tatbestand einer Körperverletzung darstellt und somit rechtswidrig ist. Diese Rechtswidrigkeit kann nur durch eine wirksame Einverständniserklärung der Patientin aufgehoben werden; eine wirksame Einverständniserklärung setzt jedoch eine richtige – das heißt 24 RGSt 25, 355ff (nach Schlund, 2001) - 20 - 4.1. Patientinnen-Information - Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung eine den Grundsätzen ärztlicher Aufklärungsverpflichtung entsprechende – Aufklärung, sprich Information der Patientin, voraus. Neben der Aufklärung, dem Recht auf sorgfältige Information, sind in der bundesdeutschen Rechtsprechung noch weitere Patientinnenrechte verankert: Rechte in der Behandlung, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und Rechte im Schadensfall. Diese Patientinnenrechte wurden vom Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen (1999) in dem Dokument „Patientenrechte in Deutschland heute“ zusammengetragen und von der 72. Gesundheitsministerinnenkonferenz am 9./10. Juni 1999 in Trier verabschiedet25. Dabei wird betont, dass es in Deutschland eine gute Absicherung der Patientinnenrechte gebe. Diese Patientinnenrechte „sind jedoch nicht in einem Gesetz oder in anderer Form festgeschrieben, sondern beruhen zu mehr als 90 % auf Richterrecht, also auf Urteilen verschiedener Gerichte zu spezifischen Einzelfällen.“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 5) Während die Entscheidung des Reichsgerichts den geschichtlichen Hintergrund für die Patientinnenrechte darstellt, bildet in der Bundesrepublik Deutschland die Verfassung26 ihre rechtliche Grundlage. Schneider (2000) führt das Recht auf Selbstbestimmung, also das Recht, selbst zu bestimmen, ob ein ärztlicher Eingriff in den eigenen Körper vorgenommen wird, auf das Grundrecht auf Menschenwürde27, das allgemeine Persönlichkeitsrecht28 und das Recht auf körperliche Unversehrtheit29 zurück: „Das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), das in Art. 2 Abs. 1 GG begründete allgemeine Persönlichkeitsrecht und nicht zuletzt das in Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG verbürgte Grundrecht auf Menschenwürde geben dem Willen des Individuums Vorrang. Sie verbieten, den Menschen zum Objekt staatlicher Gewalt werden zu lassen und die Interessen des Einzelnen mit denen des Gemeinwohls als deckungsgleich zu erachten oder durch diese zu ersetzen.“ (Schneider, 2000, S. 497) Auch die 72. Gesundheitsministerinnenkonferenz greift diese verfassungsrechtlichen Grundlagen auf, indem sie in der Präambel verabschiedet, dass „Behandlung und Pflege [...] die Würde und Integrität des Patienten zu achten [haben], sein Selbstbestimmungsrecht und sein Recht auf Privatheit zu respektieren und das Gebot der Humanität zu beachten.“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 7) 25 Rechtsverbindlich ist also nicht das Dokument selbst, sondern die ihm zugrundeliegenden Urteile und Gesetze. 26 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 27 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (1, 1 GG) 28 „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ (2, 1 GG) 29 „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ (2, 2, Satz 1 GG) - 21 - 4.1. Patientinnen-Information - Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung Des weiteren wird auch das grundrechtlich garantierte gleiche Recht ohne Ansehen der Person30 noch einmal ausdrücklich in die Präambel aufgenommen: „Niemand darf bei der medizinischen Versorgung wegen Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen, politischen und sonstigen Anschauungen, seines Alters, seiner Lebensumstände oder seiner Behinderung diskriminiert werden.“ (ebd.) Die von der 72. Gesundheitsministerinnenkonferenz verabschiedeten Patientinnenrechte sind dabei als „Patientinnenschutzrechte“ (Schneider, 2000) anzusehen, die der Ärztin der Patientin gegenüber eine besondere Sorgfaltspflicht auferlegen. Sie richten sich also beispielsweise in Fragen der Haftung eher an die Behandelnden als an die Behandelten. Zwar ist das Einwilligen in die Behandlung die Aufgabe der Patientinnen (und damit auch die Entscheidung über die Behandlung), jedoch liegt die Verantwortung dafür, ob die Patientin diese Entscheidung treffen kann, bei der Ärztin. Eine Fehlentscheidung aufgrund fehlender Information wird also im Zweifelsfalle nicht der Patientin zur Last gelegt, die versäumt hat, die Information einzuholen, sondern der Ärztin, die ihrer Aufklärungspflicht nicht nachgekommen ist. Im folgenden möchte ich die vier schon benannten Arten des Patientinnenrechts noch genauer beschreiben. Dabei handelt es sich um 1. 2. 3. 4. Das Patientinnenrecht auf sorgfältige Information, Patientinnenrechte in der Behandlung, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und Rechte im Schadensfall. Patientinnenrecht auf sorgfältige Information (Aufklärung) Der Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen (1999) legt den Schwerpunkt auf die Entscheidungsfreiheit der Patientin und darauf, eine Grundlage für diese Entscheidungsfreiheit zu schaffen. Der Gegenstand der Aufklärung wird hier genauer benannt: Aufklärung bezieht sich auf „- die geeignete Vorbeugung, die Diagnose, Nutzen und Risiken diagnostischer Maßnahmen, Nutzen und Risiken der Behandlung sowie der zur Anwendung kommenden Arzneimittel und Medizinprodukte Chancen der Behandlung im Vergleich zum Krankheitsverlauf ohne Behandlung, die Behandlung der Erkrankung und ihre Alternativen, soweit sie mitunterschiedlichen Risiken verbunden sind, Nutzen und Risiken der Behandlung sowie eine eventuell erforderliche Nachbehandlung.“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 8) „[Weiterhin haben Patientinnen] über die allgemeine Informationspflicht des Arztes hinaus das Recht zu fragen. Der Arzt ist verpflichtet, auf diese Fragen wahrheitsgemäß, vollständig und verständlich zu antworten.“ (ebd., S. 10) 30 „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (3, 3, GG) - 22 - 4.1. Patientinnen-Information - Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung Vom Durchsetzen dieses Informationsrechts, das den Patientinnen die Möglichkeit gibt, alle für sie wichtigen Informationen einzuholen – unabhängig davon, ob die behandelnde Ärztin diese Information auch für wichtig hält – erhofft sich die Gesundheitsministerinnenkonferenz, die Patientinnen zur eigenen Entscheidung zu befähigen31. Die Entscheidungsbefugnis der Patientin umfasst dabei zum einen die Behandlung und deren Abbruch, zum anderen die Weitergabe von Informationen (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 9ff). Das heißt zum einen, dass ohne die Einwilligung der Patientin keine medizinische Maßnahme durchgeführt werden darf und dass sie jederzeit die Möglichkeit hat, die Einwilligung zu entziehen und die Behandlung abzubrechen. Diese Entscheidungsfreiheit gilt zum Beispiel auch für die Teilnahme an Studien: Auch hier hat die Patientin jederzeit das Recht, nicht nur die Teilnahme zu verweigern, sondern auch – wenn sie sich für eine Teilnahme entschieden hat – die Teilnahme abzubrechen (unabhängig davon, ob die Studie beendet ist oder nicht). Zum anderen bestimmt die Patientin, wer außer oder anstatt ihr informiert werden soll, das heißt sie allein bestimmt an welche Ärztin, Psychotherapeutin, Angehörige, etc. welche Information weitergegeben werden soll. Ist die Patientin nicht mehr in der Lage, diese Entscheidungen zu treffen, so muss der mutmaßliche Wille der Patientin ermittelt oder ein gesetzlicher Vertreter bestimmt werden. Um den Patientinnen eine eigene Entscheidung überhaupt zu ermöglichen muss die Aufklärung bestimmten Anforderungen genügen, die Schlund (2001, S. 122) als 22 Grundsätze ärztlicher Aufklärungspflicht benennt. Ich fasse diese Grundsätze zu acht Punkten zusammen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Die Aufklärung einer Patientin soll durch die Ärztin erfolgen, die die Behandlung vornimmt. Diese Ärztin kann mit der Aufklärung auch eine Kollegin beauftragen. Mit dieser Aufklärung über die Behandlung dürfen jedoch nur Ärztinnen betraut werden, keine anderen Berufsgruppen. Die Aufklärung muss – um wirksam zu sein – vom Patienten verstanden und nachvollzogen worden sein. Das heißt, sie muss den sprachlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten der Patientin angepasst werden. So ist zum Beispiel sicherzustellen, dass Patientinnen, die kein Deutsch sprechen, das Aufklärungsgespräch in eine Sprache übersetzt wird, der sie mächtig sind, dass die Wortwahl den Patientinnen angepasst ist (keine unverständlichen Fachworte) und dass die Patientinnen nicht zu aufgeregt oder verwirrt sind, um dem Aufklärungsgespräch zu folgen. Es müssen die Behandlungs- und Diagnosealternativen aufgezeigt werden, damit die Patientin sich für eine von ihnen entscheiden kann. Die Aufklärung muss rechtzeitig erfolgen. Eine Aufklärung kurz vor einem Eingriff, wenn die Patientinnen ggf. zu aufgeregt sind oder schon unter Medikamenteneinfluss stehen, ist ebenso unzulässig, wie eine Aufklärung nach dem Eingriff. Die Aufklärung muss auf die individuelle Behandlungssituation abgestimmt sein. Eine generelle Aufklärung reicht nicht aus: Die Fähigkeiten der behandelnden Ärztin, die Möglichkeiten des Krankenhauses und die Verfassung der Patientin müssen in das Aufklärungsgespräch mit einfließen. Aufklärung muss nicht doppelt vorgenommen werden. Falls ein Eingriff bereits vorgenommen wurde und die Kenntnis der Patientin vorausgesetzt werden kann, muss sie nicht erneut aufgeklärt werden. Patientinnen haben das Recht, ganz oder teilweise auf die Aufklärung zu verzichten. 31 „Dieses Dokument soll zur Stärkung der Position des Patienten im Gesundheitswesen beitragen. Es will das ArztPatienten-Gespräch anregen und durch Informationen die Entscheidung des Patienten erleichtern.“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 7) - 23 - 4.1. Patientinnen-Information - Medizinrechtliche Aspekte der Aufklärung 8. Die Beweislast für eine ordnungsgemäße Aufklärung liegt bei der behandelnden Ärztin. Sie ist selbst dann zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie eine Kollegin mit der Aufklärung betraut hat. Patientinnenrechte in der Behandlung Die Patientin hat ein Recht auf eine „sichere, sorgfältige und qualifizierte Behandlung“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 12ff). Ist eine solche Behandlung nicht zu gewährleisten, ist die Patientin über Nutzen und Risiken aufzuklären. Bevor die Patientin Leistungen in Anspruch nimmt, deren Kostenübernahme durch die Gesetzlichen Krankenversicherungen nicht gesichert sind, muss sie auch darüber informiert werden. Zu dieser sicheren, sorgfältigen und qualifizierten Behandlung gehört auch, die Patientin darüber aufzuklären, wer ihre Ansprechpartnerinnen sind, das heißt, wer für die Pflege und Behandlung zuständig ist. Die Patientin hat die Möglichkeit, diese Personen abzulehnen oder weitere Personen zum Einholen einer weiteren Meinung hinzuzuziehen32. Die Behandlung der Patientin muss dokumentiert werden; die Patientin hat das Recht, diese Dokumentation einzusehen, ohne dass ein besonderes Interesse erklärt werden muss. Mit der Einsicht in die Dokumentation kann die Patientin auch eine Vertrauensperson beauftragen. Recht auf selbstbestimmtes Sterben „Jeder Patient, der entscheidungsfähig und über seine Situation aufgeklärt ist, hat das Recht, den Abbruch oder das Unterlassen weiterer lebensverlängernder Maßnahmen zu verlangen, unabhängig davon, ob der Sterbeprozess bereits eingesetzt hat.“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 17) Ist die Patientin nicht mehr in der Lage die Entscheidungen selbst zu treffen, muss ihr mutmaßlicher Wille ermittelt werden. Über den mutmaßlichen Willen kann eine von der Patientin vorab verfasste Patientinnenverfügung Auskunft geben. Rechte im Schadensfall Im Schadensfall wird geraten, das Gespräch mit der Behandlerin zu suchen und Einsicht in die Behandlungsdokumentation zu nehmen. Sollte dies zu keinem Ergebnis führen, stehen der Patientin verschiedene Einrichtungen zur Verfügung, an die sie sich wenden kann: - - Landesärzte- bzw. Zahnärztekammern, • Gutachterkommissionen • Schlichtungsstellen Patientenberatungs- und -beschwerdestellen in unterschiedlichen Institutionen, z.B. in • Krankenhäusern, 32 Das Recht, eine weitere fachliche Meinung einzuholen, darf nur in begründeten Fällen verweigert werden. In diesem Fall müssen sich Ärztin und Patientin um eine Einigung bemühen. - 24 - 4.2. Patientinnen-Information - Patientenrechte – gesundheitspolitische Aspekte der Aufklärung • bei öffentlichen Trägern, • privaten Initiativen oder Verbraucherzentralen Rechtsanwälte (spezialisierte Anwälte, sind zu erfragen bei den Anwaltskammern oder -vereinen) Krankenkassen - Die Inanspruchnahme von Beratungen dieser Einrichtungen ist in der Regel kostenlos33. Die Krankenkasse der Patientin kann auch mit Auskünften aus Akten und mit Daten die Durchsetzung von Ansprüchen unterstützen. Ein Rechtsbeistand – der für Gerichtsverfahren empfohlen wird – wird jedoch nicht von der Krankenkasse finanziert. 4.2. Patientenrechte – gesundheitspolitische Aspekte der Aufklärung Das von der 72. Gesundheitsministerinnenkonferenz verabschiedete Dokument „Patientenrechte in Deutschland heute“ stellt jedoch nicht nur eine medizinrechtliche Veröffentlichung dar, sondern auch eine gesundheitspolitische: Es handelt sich nicht nur um eine Zusammenschau der derzeitigen Rechtsprechung, sondern auch um eine (Neu-) Bestimmung des Verhältnisses zwischen Ärztin und Patientin sowie die Anweisung, wie das Miteinander der beiden auszugestalten ist: „Das vorliegende Dokument informiert Patienten und Versicherte über ihre wichtigsten Rechte und Pflichten. Es soll gleichzeitig Ärzten, Zahnärzten, Pflegekräften und Psychotherapeuten sowie Mitarbeitern aus Gesundheitsfachberufen bei der täglichen Arbeit als Orientierungshilfe dienen. Wenn Arzt und Patient ausreichend informiert sind, kann eine vertrauensvolle Beziehung entstehen. Patienten und Ärzte haben das übereinstimmende Ziel, Gesundheit zu erhalten, Krankheiten vorzubeugen, zu erkennen, zu lindern und zu heilen. Dieses Ziel erfordert eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten im Gesundheitssystem, auch der Krankenversicherung und Gesundheitsverwaltungen.(Hervorhebung, J. L.) Nur wer seine Rechte und Pflichten kennt, kann diese Aufgabe bewusst und erfolgreich wahrnehmen. Wer als Patient über seine Rechte informiert ist, kann sich aktiv am Behandlungsprozess beteiligen. Wer als Arzt, Krankenhaus oder Versicherer seine Pflichten kennt, kann Patienten besser unterstützen.“ (Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen, 1999, S. 7) Die 72. Gesundheitsministerinnenkonferenz fordert durch die Verabschiedung der Patientinnenrechte eine Stärkung der Position von Patientinnen im Gesundheitswesen, einen Ausbau ihrer Beteiligung im Gesundheitswesen, ihre aktive Teilnahme am Behandlungsprozess und eine einverständige Zusammenarbeit von Ärztinnen, Pflegepersonal und Patientinnen (ebd.). Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin – Bestimmung oder Neubestimmung? Wie bereits erwähnt, besteht das Patientinnenrecht in Deutschland größtenteils aus Richterinnenrecht. Das bedeutet, dass im Falle eines Rechtsstreites von bundesdeutschen Gerichten im Sinne des dargestellten Rechts entschieden wird und somit auch im Sinne der von der 72. Gesundheitsministerinnenkonferenz geforderten Zusammenarbeit von Ärztin und Patientin. So gesehen ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Ärztin und Patientin bereits „Rechtswirklichkeit“: Sie kann von den Patientinnen per Gesetz eingefordert werden. Zwei Fragen stellen sich also angesichts dieser Feststellung: 33 Bei zahnärztlichen Stellen und Rechtsanwälten können Kosten entstehen. - 25 - 4.2. Patientinnen-Information - Patientenrechte – gesundheitspolitische Aspekte der Aufklärung 1. 2. Wieso also eine gesundheitspolitische Neubestimmung, wenn dieses Verhältnis schon gängige Rechtspraxis ist? Was ist das Gesundheitspolitische34 an dieser Neubestimmung? Neubestimmung Es handelt sich aus zwei Blickrichtungen um eine Neubestimmung: Zum einen wird das angesprochene Partnerinnenschaftsmodell zwar in der Rechtspraxis durchgesetzt, dies gilt jedoch nur für die Fälle, die vor Gericht verhandelt werden. Über die ärztliche Praxis ist dabei nichts ausgesagt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Patientinnen nach oder während ihrer Behandlung keinen Rechtsstreit mit ihrer behandelnden Ärztin führen. Wie sich ihr Verhältnis gestaltet, kann also nicht aus der Rechtslage abgeleitet werden. Die Präambel der Patientinnenrechte dehnt jedoch den Rechtsraum auf die nicht verhandelten Fälle aus und schafft gewissermaßen eine Ausführungsbestimmung. Eine Neuerung liegt also darin, dass aus der unausgesprochenen Rechtspraxis eine ausgesprochene Handlungsanweisung für Ärztinnen und Patientinnen wird. Zum anderen besteht eine Neuerung in dem Partnerschaftsbegriff, das heißt, dass nicht die Partnerschaft zwischen Ärztin und Patientin an sich als neu zu betrachten ist, sondern die Ausgestaltung der Partnerschaft: Es geht nicht mehr „nur“ um einverständige Zusammenarbeit, sondern um eine aktive Beteiligung der Patientin am Behandlungsprozess. Die Neuerung liegt also in der Unterscheidung, dass nicht mehr nur die Entscheidung der Ärztin aus Einsicht der Patientin in die Notwendigkeit der Behandlung „abgenickt“ werden soll („informed consent“35), sondern dass die Patientin sich mit ihren eigenen Vorstellungen in den Behandlungsprozess einbringt und die Behandlung mitgestaltet („shared decision making“36). Der politische Aspekt der Neubestimmung Während die Politik in anderen Bereichen die Anpassung des Rechtes an veränderte gesellschaftliche Gegebenheiten vorantreibt – als Beispiel sei die „eingetragene Partnerschaft“ genannt, die einer geänderten Einstellung gegenüber homosexueller Partnerschaften Rechung trägt – vollzieht 34 in Abgrenzung zu dem medizinrechtlichen Aspekt Mit dem Begriff „informed consent“ (engl. informiertes Einverständnis) wird in der Literatur eine Form der Zusammenarbeit bezeichnet, in der die Patientin mit dem Ziel informiert wird, eine Einsicht in die Notwendigkeit der Behandlung zu entwickeln und die Behandlung aus Eigeninitiative mitzutragen und zu unterstützen. Diese Form der Zusammenarbeit soll zu einem möglichst guten und nachhaltigen Behandlungserfolg führen. Die eigentliche Behandlungsentscheidung wird in diesem Arbeitsbündnis von der Ärztin getroffen, die Zusammenarbeit beschränkt sich auf die Durchführung der Behandlung. (Vgl. Ingham, 2000) 36 „shared decision making“ (engl. geteiltes Entscheiden, im Sinne eines gemeinsamen Entscheidens) beschreibt eine Form der Zusammenarbeit, die die Ärztin und die Patientin als gleichberechtigte Partnerinnen sieht, die gemeinsam die Behandlungsentscheidungen treffen, bis hin zu Konzepten, die die Ärztin als eine Dienstleisterin sehen, die die Patientin mit Informationen versorgt, so dass die Patientin selbst die Behandlungsentscheidung kompetent treffen kann. In einem so beschriebenen Arbeitsbündnis wird die eigentliche 35 - 26 - 4.3. Patientinnen-Information - Wirtschaftliche Aspekte der Patientinnenaufklärung sich die Anpassungsleistung im Falle des Patientinnenrechts andersherum: Hier werden gesellschaftliche Strukturen dem bereits ausgeübten Recht angepasst. Diese politische Arbeit vollzieht sich zum einen in der Veröffentlichung der Patientinnenrechte37, zum anderen in der Schaffung und Förderung von Institutionen, die Patientinnen gezielt bei der Wahrnehmung ihrer (nunmehr bekannten) Rechte unterstützen. 4.3. Wirtschaftliche Aspekte der Patientinnenaufklärung Neben anderen möglichen Aspekten, die ärztliches Entscheiden beeinflussen können (wie zum Beispiel Forschungsinteressen), scheinen mir wirtschaftliche Interessen ein nicht unerheblicher Aspekt ärztlicher Entscheidungsfindung zu sein sein. Daher werde ich das Zusammenspiel von ökonomischen Interessen, medizinischer Entscheidungsfindung und politischen Vorgaben an dieser Stelle exemplarisch darstellen. Kuhlmann (1999) führt den gesundheitspolitischen Wandel vom „informed consent“ zum „shared decision making“ weniger auf eine Rückbesinnung auf das Grundgesetz zurück als vielmehr auf die veränderte wirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik. Knappere finanzielle Mittel hatten auch im Gesundheitssystem Umstrukturierungen zur Folge: Das Gesundheitssystem wurde an betriebswirtschaftlichen Zielen ausgerichtet, so dass Wettbewerb- und Marktorientierung in das Gesundheitswesen Einzug erhielten. Vimar beschreibt diesen Wandel wie folgt: „Nicht mehr der medizinische Versorgungsbedarf der Kranken soll das Leistungsgeschehen bestimmen, dies soll sich vielmehr nach den ökonomischen Interessen gesunder Beitragszahler richten. Vorstellungen, durch Wettbewerb Preissenkungen bewirken zu können, wandeln notwendigerweise die soziale Krankenversicherung zu gewinnorientierten Kassenunternehmen [...].“(Vimar, 1999, S. 225) Diese Umstrukturierung bleibt jedoch für das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin nicht ohne Folge: „Die primär an betriebswirtschaftlichen Zielen ausgerichteten gesundheitspolitischen Vorgaben durchdringen die ärztliche Entscheidungsfindung im klinischen Alltag und überschatten das Arzt-Patient-Verhältnis. Die Folge dieser ökonomischen Vereinseitigung, die ‚Verbetrieblichung der medizinischen Arbeit’ sind mittlerweile kaum noch ernsthaft in Abrede gestellte Rationierungseffekte und vielschichtige Praktiken der Patientenselektion.“ (Kuhlmann, 1999, S. 147) So beschreibt Kuhlmann, wie das Verhältnis Ärztin-Patientin in ein Verhältnis DienstleisterinKundin umgewandelt wurde, in dem die medizinische Versorgung das Produkt darstellt, das von der Dienstleisterin (Ärztin) angeboten und der Kundin (Patientin) nachgefragt wird. Die Umstrukturierung der Gesundheitsversorgung hat also drei „Angriffspunkte“, an denen die Veränderung zum Tragen kommt: Entscheidung von Ärztin und Patientin entweder zusammen getroffen oder gemeinsam vorbereitet und von der Patientin getroffen. (Vgl. Ingham, 2000) 37 Während ich die Durchsetzung der Rechte im medizinrechtlichen Bereich verorte, fällt ihre Veröffentlichung meines Erachtens in den politischen Bereich. - 27 - 4.3. Patientinnen-Information - Wirtschaftliche Aspekte der Patientinnenaufklärung 1. 2. 3. die Medizinische Versorgung (Produkt), die Ärztin (Anbieterin) und die Patientin (Kundin) Auf der Ebene des Produkts ist das von der Bundesregierung angestrebte Ziel, die medizinische Versorgung zu verbessern und ihre Kosten zu senken. Jedoch besteht nicht nur das Interesse, den Preis für die Gesundheitsversorgung zu senken, sondern auf Seiten der Anbieterinnen auch das Interesse, möglichst profitabel zu arbeiten. Für die Ärztinnen bedeutet das, möglichst viele Patientinnen möglichst günstig zu behandeln. Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es auch einer geeigneten Verkaufsstrategie, die den Kundinnen das eigene – möglichst günstige – Produkt nahe bringt. Ein dritter Aspekt dieser Marktsituation bezieht sich auf die Kundin, die sich auf dem Markt orientieren und die Wahl zwischen den verschiedenen angebotenen Produkten treffen muss. Hat sie ein Interesse an einem qualitativ hochwertigen Produkt, so muss sie in der Lage sein, ein Urteil über die Qualität des Produktes zu treffen. Auf die Patientin bezogen heißt das, dass sie in der Lage sein muss, die Qualität und Angemessenheit der angebotenen medizinischen Versorgung zu beurteilen. Das setzt jedoch bei den Patientinnen medizinische Kenntnisse voraus: „Das dem Gütermarkt entlehnte Kundenparadigma setzt stillschweigend voraus, dass Patientinnen und Patienten so hinreichend über ihre Möglichkeiten informiert sind, dass sie tatsächlich selbstbestimmt Entscheidungen treffen und ein Gleichgewicht zwischen Anbietern und Nachfragern herstellen können. Es basiert zudem auf der Vorstellung ähnlicher Ausgangsbedingungen, d.h. gleicher Chancen auf Gesundheit und gleichem Zugang zur Gesundheitsversorgung . Die informierte Entscheidungsfindung und Zustimmung von Patienten wird somit zum Dreh- und Angelpunkt der Legitimation ökonomischer Modelle.“ (Kuhlmann, 1999, S. 147) Folgt man Kuhlmann, so kann die gesundheitspolitische Forderung nach Stärkung der Patientinnen-Position und die Förderung der aktiven Teilnahme von Patientinnen am Behandlungsprozess, wie ich sie im Kapitel 4.2 beschrieben habe, als Folge der marktorientierten Umstrukturierung des Gesundheitswesens betrachtet werden. Bevor ich im Kapitel 4.4 auf die medizinethischen Probleme der Kundinnen-Rolle für Patientinnen eingehe, möchte ich noch kurz den Umgang der Ärztinnen mit dieser Marktsituation darstellen, den Kuhlmann (1999) untersucht hat. In ihrer Untersuchung zeigt sie auf, wie die wirtschaftlichen Interessen der Ärztinnen durch medizinische Argumentationen verschleiert werden. Wirtschaftliche Interessen, die einen Einfluss auf die medizinische Versorgung der Patientinnen haben, werden von den Ärztinnen lediglich genannt, „wenn es sich nicht um endgültige Verweigerungen [von kostenintensiveren Behandlungen] handelt, sondern eine Lösung in Aussicht steht [... oder] wenn die Verweigerung in der Verantwortung einer anderen Instanz, wie z. B. dem Hausarzt oder der Krankenkasse, liegt.“( Kuhlmann, 1999, S. 154) - 28 - 4.4. Patientinnen-Information - Medizinethische Probleme bei der Patientinnenaufklärung Ansonsten nutzen Ärztinnen, so Kuhlmann, ihr medizinisches Wissensmonopol38 um wirtschaftliche Interessen zu verschleiern und gezielt Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Patientinnen zu nehmen. Dieses Verhalten verdeutlicht sie mit einem Zitat aus ihrer Untersuchung: „Ich versuche zumindest, es noch zu kaschieren. Wenn die Leute sagen, sie hätten gern irgendwelche Vitamine, dann zu sagen: ,Vitamine helfen wohl eher doch nicht. Essen Sie lieber Obst, lassen Sie sich was mitbringen. Das ist viel gesünder‘. So in der Art. Und nicht zu sagen: ,Vitamine geben wir nicht, weil wir die Kosten zusammenhalten müssen‘. (...) Das Problem ist: Was soll man dem Patienten sagen? Soll man jetzt sagen: ,Sie sind zu alt, Sie kriegen keine Reha mehr?‘ Am wenigsten tut man das in der Situation.“ ( Kuhlmann, 1999, S. 154) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter anderem wirtschaftliche Interessen die medizinische Versorgung beeinflussen, dass Patientinnen jedoch nur wenig Möglichkeiten haben, dies in ihrer eigenen Behandlung wahrzunehmen. Neben den als Beispiel dargestellten wirtschaftlichen Interessen, sind noch weitere Interessengebiete denkbar, die mit Behandlungsentscheidungen der Ärztinnen verbunden sein könnten und die einen – für die Patientinnen nicht oder nur schwer durchschaubaren – Einfluss auf Behandlungsentscheidungen und –verlauf haben: Forschungsinteresse, Interesse an der Ausbildung von medizinischem Personal, etc. 4.4. Medizinethische Probleme bei der Patientinnenaufklärung Die Medizinethischen Probleme liegen auf der Hand: Einerseits sollen Ärztinnen und Patientinnen Partnerinnen sein, die gemeinsam das Unternehmen „Genesung“ oder „Behandlung“ betreiben, andererseits stehen die Erwartungen der Patientinnen in Bezug auf bestmögliche Behandlung den wirtschaftlichen Interessen der Ärztinnen zum Teil gegenüber. Ärztinnen befinden sich also in einem Dilemma: Einerseits soll ein zur Behandlung notwendiges Vertrauensverhältnis hergestellt werden, andererseits besteht eine Mittelknappheit, die dazu führt, weniger Patientinnen optimal versorgen zu können oder bei der Versorgung Abstriche zu machen. Aus dem anderen Blickwinkel, der Patientinnen-Perspektive, formuliert, sind die Patientinnen auf Informationen von Ärztinnen angewiesen, die ihrerseits ein Interesse daran haben, diese Informationen zu verschleiern. Die fehlende Möglichkeit der Selbstbestimmung Die Patientinnenrechte, die nach Schneider (2000) als Schutzrechte gedacht sind, bekommen im Hinblick auf die zum Teil unterschiedlichen Interessen innerhalb dieser Partnerschaft eine neue Bedeutung: Zwar gebieten sie den Ärztinnen in der Rechtstheorie eine Sorgfalts- und Aufklä- 38 Kuhlmann legt in ihrer Untersuchung dar, dass „die wenigsten Patienten [...] ärztliche Informationen tatsächlich bewerten oder überprüfen [können]: ‚Sie können einem Laien alles erzählen, fast immer’. [...] Zudem wird die ärztliche Informationspolitik in den meisten Fällen durch einen erheblichen Vertrauensvorschuss der Patienten gestützt.“ (1999, S. 155) - 29 - 4.4. Patientinnen-Information - Medizinethische Probleme bei der Patientinnenaufklärung rungspflicht, die die Interessen der jeweiligen Patientin vertreten soll, in der Rechtspraxis bekommt dieses Recht jedoch nur, wer sich – im Sinne eines Anspruchsrechts – darauf beruft. Ein marktwirtschaftlich orientiertes Gesundheitswesen, das Patientinnen zu Kundinnen werden lässt, verlangt von den Patientinnen nicht nur eigene Interessen zu vertreten und dementsprechend eigene Entscheidungen zu treffen, sondern auch die Verantwortung für deren Richtigkeit zu übernehmen: Die Patientin muss als Kundin sozusagen die „Richtigkeit“ der Ware überprüfen und ist dafür zuständig, ihr Recht auf Nachbesserung geltend zu machen, sollte die Ware nicht der vereinbarten Vorstellung entsprechen. Wenn jedoch schon die Entscheidungsgrundlage – die ärztliche Information – nicht notwendigerweise im Interesse der einzelnen Patientin gegeben ist, wird auch eine selbstbestimmte Entscheidung im eigenen Interesse verunmöglicht. Anders formuliert hieße das, dass die Patientin gegebenenfalls gar keine Entscheidung für eine bessere Behandlung treffen kann, da sie diese Information nicht oder nur verzerrt bekommt. Hat sie diese Information bekommen und sich für die Behandlung entschieden, wird sie dennoch nicht notwendigerweise entscheiden können, ob die Behandlung optimal verlaufen ist. Der fehlende Wille zur Selbstbestimmung Eibach & Schaefer (2001) wählen einen anderen Zugang zum ethischen Problem der Selbstbestimmung von Patientinnen. Sie begründen ihre ethischen Bedenken nicht mit der ärztlicher Verschleierungstaktik, die den Patientinnen die Selbstbestimmung erschwert, sondern damit, dass die Begriffe „Selbstbestimmung“ und „freier Wille“ nicht die Wirklichkeit von Patientinnen treffen. Die Fähigkeit, den eigenen Willen und Patientinnenrechte geltend zu machen schwindet umso mehr, je niedriger der soziale Status, je niedriger der Bildungsgrad, je höher das Alter und/oder je schwerer die Erkrankung der Patientin ist. Die Aufklärung von Patientinnen wird von Eibach & Schaefer zwar auch als wesentliche, aber nicht als hinreichende Bedingung dafür angesehen, dass Patientinnen ihr Recht geltend machen können: „Information allein befähigt in Fällen von ernsthaften oder auch existenzerschütternden Lebenskrisen in der Regel nicht zur ‚autonomen’ Entscheidung“ (Eibach & Schaefer , 2001, S. 24) Sie führen aus, dass für die Patientinnen in Krisen- und Grenzsituationen auch nicht die eigenständige Entscheidung im Vordergrund steht, sondern ihr Wohlbefinden, für das sie die Ärztinnen als Expertinnen ansehen. Die Entscheidungen werden von den Patientinnen nicht „autonom“ getroffen, sondern auf die Ärztinnen übertragen: „Die Befragungen zeigen, dass das Vertrauen der Patienten in die Ärzte, sowohl ihre medizinischen Fähigkeiten wie auch ihre für die Patienten richtigen ethischen Entscheidungen, groß ist. Indem sie zum weitaus größten Teil auf eine eigenständige Entscheidung über ihre Behandlung in Krisen- und Grenzsituationen des Lebens verzichten, diese den Ärzten und Angehörigen überlassen möchten, verstehen sie unter richtigen bzw. guten Entscheidungen für sie Entscheidungen, die ihrem Wohlergehen dienen, und nicht in erster Linie Entscheidungen, die ihren Willen respektieren. Die Ermittlung und Beachtung ihres Wohlergehens ist ihnen wichtiger als die Respektierung ihres Willens, über den sie - 30 - 4.4. Patientinnen-Information - Medizinethische Probleme bei der Patientinnenaufklärung sich nicht klar sind oder den sie nicht geltend machen wollen. Anders ausgedrückt: Ihr Wohlergehen ist ihnen in der Krankheit wichtiger als ihre Autonomie.“ (Eibach & Schaefer, 2001, S.25f) Soll also eine Behandlung im Sinne der Patientin vonstatten gehen, so muss sie sich nach Auffassung von Eibach & Schaefer nicht in erster Linie an einem autonomen Willen und der Selbstbestimmung der Patientin orientieren, sondern am Wohlergehen der Patientin. In diesem Sinn plädieren sie für eine „sprechende Medizin“, in der die Ärztin eine Haltung anteilnehmender Fürsorge einnimmt, um gemeinsam mit der Patientin ihren Willen herauszufinden. Bei ihnen liegt der Schwerpunkt nicht darauf, die Patientin als eigenständig entscheidende Person, sondern in ihrer Abhängigkeit von den Ärztinnen zu sehen. Sie fordern eine „Ethik der Fürsorge [..., die] den Menschen nicht primär als ein autonomes und rational entscheidendes Individuum [betrachtet]. Sie [die Ethik der Fürsorge, J. L.] gründet in Beziehungen des Lebens, in denen der Andere – trotz der Gleichrangigkeit in seiner unverlierbaren Würde – in seinen empirischen Lebensgegebenheiten doch als Anderer wahrgenommen wird, und zwar zunächst in seiner Bedürftigkeit, seinem Angewiesensein auf Andere, in denen er zugleich als Subjekt und Partner geachtet wird, in denen sich der Helfende auch durch das Geschick des Kranken betreffen lässt und mit ihm gemeinsam nach dem sucht, was für ihn das Gute ist, ohne ihn zu einer ihn gegebenenfalls überfordernden Entscheidung zu drängen.“ (Eibach & Schaefer, 2001, S.27) Während Kuhlmann (1999) zu bedenken gibt, dass die Patientinnen aufgrund von Fehl- und Falschinformationen ihr Selbstbestimmungsrecht nicht wahrnehmen können, betonen Eibach & Schaefer (2001), dass die Patientinnen in Krisen- und Grenzsituationen aus krankheitsbedingter Überforderung nicht in der Lage sind, ihr Selbstbestimmungsrecht wahrzunehmen. Sie stellen die Abhängigkeit der Patientinnen von den Ärztinnen dar, die die Patientinnen in dieser Situation stützen sollten. Bei beiden Aspekten dieser ethischen Diskussion wird die Schutzbedürftigkeit der Patientinnen deutlich. Einen möglichen Lösungsweg sehen Eibach & Schaefer (2001) unter anderem in Patientinnenanwaltschaften, das heißt in (gesunden) Personen39, die die Patientinnen dabei unterstützen, ihren berechtigten Willen geltend zu machen. 39 z. B. Angehörige, Pflegekräfte, Seelsorger - 31 - 5.1. Mediendidaktische Produktion - Analyse des Bildungsproblems und der Vorgaben 5. Mediendidaktische Produktion In diesem Kapitel geht es darum, wie ein mediales Angebot erstellt wird, was dabei zu beachten ist und welche Reihenfolge als günstig erscheint. Kerres (1998, S. 380ff) stellt einen Leitfaden für die Mediendidaktische Konzeption vor, den ich im folgenden erläutern werde und der in leicht abgewandelter Form das Gerüst dieses Kapitels bereitstellen wird: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Analyse des Bildungsproblems und der Vorgaben Klärung der Funktion der didaktischen Medien Zielgruppenanalyse Bestimmung der Lehrziele Bestimmung der Lehrinhalte Bestimmung der Form des Lernangebotes Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an Auftraggeberin und Zielgruppe Da die Konzeption in meiner Diplomarbeit auf eine spätere Umsetzung hin ausgelegt sein soll, werde ich diesen Leitfaden durch einen weiteren Punkt ergänzen: 8. Umsetzung und Kontrolle der Konzeption. 5.1. Analyse des Bildungsproblems und der Vorgaben Als erster Arbeitsschritt wird von Kerres vorgeschlagen, einen Arbeitstitel zu finden und das Anliegen zu formulieren, das den Einsatz des Mediensystems anregt. Diesen Arbeitsschritt beschreibt Issing (1995, S. 203) als Definition von Lernzielen und bemerkt, dass diese von den Auftraggeberinnen häufig nur global und unpräzise vorgegeben würden, so dass es Aufgabe des Lernsoftware-Entwicklers sei, „zu fragen: ‚Was soll sich bei den Adressaten durch die Lernphase in ihrem Denken, Wissen, Verhalten, in ihren Fertigkeiten oder Einstellungen gegenüber vorher verändern?'“ Neben den Zielvorstellungen müssen auch die Startvoraussetzungen der Produktion beachtet werden: So ist nach Kerres zu klären, wer am Projekt beteiligt ist und welche Ressourcen zur Verfügung stehen. 5.2. Klärung der Funktion der didaktischen Medien In einem zweiten Arbeitsschritt gilt es zu formulieren, welcher Nutzen vom Einsatz der Medien erhofft wird und einzuschätzen, ob der erwartete Nutzen den (finanziellen) Aufwand rechtfertigt. Kerres unterscheidet zwischen Text-, Audio-, Einzelbild- und Bewegtbildmedien, deren Produktionskosten in der Reihenfolge der Nennung steigen (die Produktion von Textmedien ist die günstigste, die Herstellung von Bewegtbildmedien – Videos und Filme – ist vergleichsweise teuer40) und die folgende Funktionen wahrnehmen können: 40 Eine nähere Beschreibung der Produktionskostenschätzung würde den Rahmen der Diplomarbeit sprengen und wird daher nicht vorgenommen. - 32 - 5.2. Mediendidaktische Produktion - Klärung der Funktion der didaktischen Medien 1. Wissensrepräsentation a. Darstellung b. Organisation 2. Steuerung und Regelung von Lernprozessen 3. 4. 5. Werkzeug zur Unterstützung der Wissenskonstruktion Werkzeug zur Unterstützung interpersoneller Kommunikation Motivation zum Lernen Wissensrepräsentation Medien können nicht nur genutzt werden, um Sachverhalte abzubilden (darstellende Funktion), sondern auch um sie in andere Sachgebiete und in schon bestehendes Wissen einzugliedern (organisierende Funktion). So kann zum Beispiel nicht nur gezeigt werden, was ein Auto ist (eine metallene Konstruktion) und was es macht (es fährt, es hupt, es riecht), sondern auch in welchem Kontext es steht (es gehört zu den Verkehrsmitteln, kann Statussymbol sein). Es können also nicht nur Details dargestellt, sondern auch übergeordnete Prinzipien hervorgehoben werden. Steuerung und Regelung von Lernprozessen Medien können nicht nur Sachverhalte darstellen und organisieren, sondern auch steuern, wie die Aneignung des Sachverhaltes geschieht. Während auf einem Photo beispielsweise nur ein Auto dargestellt werden kann und in einem Schaubild Bezüge zu anderen Verkehrsmitteln hergestellt werden können, ist es in einem Film oder Text möglich, zu steuern, wann einer Betrachterin eine Darstellung oder ein Zusammenhang aufgezeigt wird (vgl. Kerres). So ist es möglich Wissen Stück für Stück aufzubauen (sequentieller Lernprozess). Werkzeug zur Unterstützung der Wissenskonstruktion Lernen kann jedoch nicht nur als passiver Vorgang betrachtet werden, in dem den Lernenden Sachverhalte vermittelt werden, sondern auch als aktiver Prozess, in dem sie sich die Sachverhalte aneignen. Verweise auf einer Internetseite geben nicht nur einen Weg vor, der beschritten werden soll, sondern bieten den Nutzerinnen die Möglichkeit, zwischen mehreren Wegen auszuwählen und selbst zu entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten und was sie (zuerst) lernen möchten. Ein anderes denkbares Beispiel ist ein Computerprogramm, das die Lernenden vor die Aufgabe stellt, ein Auto zu bauen und Handlungsschritte anbietet, die beim Bau von Autos anfallen. Es könnte seinen Nutzerinnen bei der Wahl der richtigen Schritte zur Seite stehen, Tipps geben und rückmelden, inwiefern die Wahl eines Handlungsschrittes zu einem bestimmten Zeitpunkt (nicht) sinnvoll ist. Auf diese Weise hätte die Benutzerin dieses Computerprogramms die Möglichkeit, den Autobau realitätsnah zu erlernen und zu erfahren. Von diesem Ansatz (situiertes Lernen) verspricht man sich eine größere Übertragbarkeit und Anwendbarkeit des Gelernten (als zum Beispiel vom Auswendiglernen einer Bauanleitung), da das Gelernte nicht nur theoretisches Wissen ist, sondern bereits (wenn auch nur medial vermittelt) ausprobiert und angewandt wurde (vgl. Mandl, Gruber & Renkel, 1995). - 33 - 5.3. Mediendidaktische Produktion - Zielgruppenanalyse Werkzeug zur Unterstützung interpersoneller Kommunikation Es kann auch kooperatives Lernen gewünscht sein, das sich dadurch auszeichnet, dass „die Mitglieder einer Gruppe gemeinsam und in wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. [...] Kooperatives Lernen umfasst eine Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten. Die Gruppenmitglieder spezifizieren Ziele, planen Prozeduren, generieren und wählen Alternativen aus, testen Hypothesen, bewerten und modifizieren Pläne und Annahmen. Die Wissenskonstruktion kann durch fokussierte Diskussions- und Interaktionsprozesse unterstützt werden.“ (Hesse, Garsoffky & Hron, 1995) Beispiele für eine mediale Gestaltung und Unterstützung von Kommunikation sind sowohl eine Videokonferenz als auch das gemeinsame Erarbeiten von Sachverhalten an einer Wandtafel oder in Internet-Foren. Motivation zum Lernen Ein letzter Aspekt, den Kerres zur Funktion von Medien nennt, ist die Lernmotivation: Das Arbeiten mit neuen Medien stelle aufgrund des Neuigkeitseffekts Aufmerksamkeit und Interesse sicher - wobei der Autor auch das schnelle Abklingen des Neuigkeitseffektes anmerkt. Weiterhin wird auch durch Anwendungsbezogenheit und Realitätsnähe des Lernangebotes eine größere Motivation erwartet (vgl. Mandl, Gruber & Renkel, 1995) 5.3. Zielgruppenanalyse Da sich das Medium nicht von selbst an die Lernenden anpasst, „bleibt die Notwendigkeit bestehen, dass sich das didaktische Design auch bei der Planung interaktiver Medien an wesentlichen Variablen der Zielgruppe, wie sie in der Lehr- und Lernforschung diskutiert werden, auszurichten hat.“ (Kerres, 1998, S. 141) Eigenschaften der Zielgruppe, die bei der Planung eines Lernangebotes berücksichtigt werden sollten (ebd., S. 144ff), werde ich im Folgenden vorstellen. Dazu gehören: 1. 2. 3. 4. 5. Soziodemographische Merkmale Vorwissen Lernmotivation Lerngewohnheit und Lerndauer Lernorte und Medienzugang Soziodemographische Merkmale Soziodemographische Merkmale beinhalten die Größe der Zielgruppe, deren Aufenthaltsorte, Alter, Schulabschluss und Gruppenzugehörigkeit (betriebliche Nutzerin, Heimanwenderin). Diese Daten sind vor allem wichtig um zu planen, wie das Lehrangebot vertrieben und gestaltet werden soll. So geht es beispielsweise darum, ob es sich um ein Produkt für kaufkräftige Heimanwenderinnen handelt oder ob die Herstellung kostengünstig geplant werden soll, um es beispielsweise in sozial schwächeren Regionen oder jungen Kundinnen mit geringen finanziellen Möglichkeiten anzubieten. - 34 - 5.3. Mediendidaktische Produktion - Zielgruppenanalyse Vorwissen Kerres nennt drei Bereiche, aus denen Nutzerinnen eines Lernangebotes Kenntnisse mitbringen können. Neben dem Lerngebiet selbst, auf dem schon ein Vorwissen bestehen kann, ist auch technisches Vorwissen und Vorwissen in Bezug auf Lerntechniken zu beachten. Beim technischen Vorwissen geht es in erster Linie um die Frage, ob die Nutzerinnen die technischen Voraussetzungen41 im Umgang mit dem Medium selbst beherrschen, z. B. Installation eines Programms auf dem Computer. Vorwissen in Bezug auf Lerntechniken42 ist wichtig für die Ausarbeitung der Benutzerinnenführung: Bevorzugen die Anwenderinnen einen selbständigen und entdeckenden Wissenserwerb (exploratives Lernen) und sind sie in der Informationsbeschaffung geübt oder brauchen sie eine stärkere Strukturierung des Lernangebotes und eine genauere Anweisung (expositorisches Lernen)? Das fachliche Vorwissen der Nutzerinnen ist entscheidend für die Frage, an welcher Stelle in den Lernstoff eingestiegen werden kann. Lernmotivation Kerres unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Lernmotivation: Während sich die intrinsische Lernmotivation durch Interesse am Lerngegenstand selbst und/oder Spaß an der Beschäftigung mit dem Lerngegenstand auszeichnet, ist bei extrinsischer Lernmotivation die Beschäftigung mit dem Lerngegenstand nur Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Während sich eine Technik-Begeisterte vielleicht aus Interesse an elektromechanischen Zusammenhängen mit der Funktionsweise eines Scheibenwischer-Relais beschäftigt (intrinsische Motivation), wird die auszubildende Kfz-Mechanikerin dies vielleicht nur im Hinblick auf das gute Bestehen ihrer Abschlussprüfung tun (extrinsische Motivation). Das Medium sollte, um auf die Lernenden abgestimmt zu sein, bei intrinsischer Motivation: extrinsischer Motivation: - ein Eintauchen in eine Lernwelt mit möglichst umfang- - - 41 reichen Informationen ermöglichen, keine vorgegebenen Einteilungen in „Lerneinheiten“ vornehmen, der Lernerin eine weitgehende Kontrolle über Lernwege überlassen, der Lernerin Möglichkeiten zur Beeinflussung der Darstellung geben, Tests und Rückmeldung nur auf Anforderung durchführen und durch Abwechslung in der Präsentation Neugier aufrecht erhalten(ebd., S. 146). - beim Einstieg motivieren, die Aufmerksamkeit auf die Ziele des Lernens lenken, den Lehrstoff in definierte, überschaubare Einheiten einteilen, die Konsistenz der Präsentation rigide aufrecht erhalten, Tests ankündigen und nach Präsentation durchführen, Lernfortschritt rückmelden und Pausen berücksichtigen (ebd., S. 147). Näheres zum Thema Anbindung - Technische Voraussetzungen folgt in Kapitel 5.7. - 35 - 5.4. Mediendidaktische Produktion - Bestimmung der Lehrziele Lerngewohnheit und Lerndauer Neben den oben bereits genannten bevorzugten Lerntechniken (exploratives / expositorisches Lernen) ist für die Gestaltung des Lernangebotes auch von Interesse, wie viel Zeit die Nutzerinnen für das Lernen aufbringen können, wie lange sie sich auf das Lernen konzentrieren können und wie intensiv gelernt wird: „Werden textliche Darstellungen intensiv bearbeitet oder wird schnell weiter geblättert? Ist der Lerner bereit/interessiert Testfragen zu beantworten?“ (ebd., S. 148) Lernorte und Medienzugang Ein letzter Aspekt, dem Beachtung geschenkt werden muss, ist die Frage, ob die Nutzerinnen überhaupt die Möglichkeit haben, das Medium zu nutzen, beziehungsweise, welche Medien genutzt werden können. So ist die Produktion eines Lehrfilmes nur dann sinnvoll, wenn die Nutzerinnen über Fernseh- und ggf. Videogerät verfügen oder zumindest Zugang dazu haben. Auch der Mangel an Räumlichkeiten für erforderliche technische Geräte kann den Zugang zum Bildungsangebot behindern. 5.4. Bestimmung der Lehrziele Die Bestimmung der Lehrziele und der zugrundeliegenden Lehr-Lern-Theorien, die Kerres (1998, S. 157ff) zusammenfassend beschreibt, werde ich an dieser Stelle nur in Stichworten wiedergeben, da sie sonst den Rahmen dieses Kapitels sprengen würden. Kerres zitiert zum einen Gegenstandsbereiche von Lehrzielen, zum anderen verschiedene Leistungsniveaus der Lehrziele: 1. 2. Gegenstandsbereiche von Lehrzielen, a. Kognitive Lehrziele, b. Affektive Lehrziele, c. Psychomotorische Lehrziele Leistungsniveaus nach Merrill, a. Fakten, b. Konzepte, c. Prozeduren, d. Prinzipien. Gegenstandsbereiche von Lehrzielen Die Lehrziele teilt Kerres nach Bloom et al. in kognitive, affektive und psychomotorische Lehrziele. Kognitive Lehrziele Zu den kognitiven Lehrzielen gehört - 42 das Erinnern von Informationen (Kenntnisse), das Einordnen neuer Informationen in vorhandenes Wissen (Verstehen), der Einsatz von Regeln und Prinzipien in bestimmten Situationen (Anwenden), Näheres hierzu folgt in Kap. 5.6 Bestimmung der Form des Lernangebotes - 36 - 5.4. Mediendidaktische Produktion - Bestimmung der Lehrziele - das Gliedern von Sachverhalten in ihre Bestandteile (Analyse), das Zusammenfügen von Einzelteilen zu einem Ganzen (Synthese) und das Fällen von Urteilen, ob bestimmte Kriterien erfüllt sind (Bewerten) Affektive Lehrziele Unter affektive Lehrziele fasst er nach Metfessel, Michael & Kirsner - Passives Wahrnehmen und die Bereitschaft zur aktiven Informationsaufnahme (Aufmerksamkeit) Dulden von Reaktionen anderer, Bereitschaft zu eigener aktiver Reaktion und das Erleben von emotionaler Betroffenheit (Reagieren) Verstehen von Werten, Entwickeln eigener Vorlieben in Bezug auf diese Werte und das Eingehen persönlicher Verpflichtungen für diesen Wert (Werte bilden) Eigenständiges Formulieren und Beschreiben eines Wertes, Einordnen von Werten in ein Wertesystem und Vergleich von Wertesystemen (Werte einordnen) Umsetzen von Werten im Handeln, Bestehen von Werten und Handeln in Konfliktsituationen (Internalisierung von Werten) Psychomotorische Lehrziele Psychomotorische Lehrziele werden als das Beherrschen von Bewegungsabläufen und komplexen Verhaltensweisen beschrieben. Je besser diese Bewegungsabläufe und Verhaltensweisen beherrscht werden, desto weniger Aufmerksamkeit muss ihnen geschenkt werden. (Automatisierung) Leistungsniveaus nach Merrill Merrill gliedert die Lehrziele in Fakten, Konzepte, Prozeduren und Prinzipien, bei denen jeweils anzugeben ist, wie genau das Wissen erworben werden soll: Es kann erinnert werden, es kann darüber hinaus angewendet werden oder durch Anwenden vorhandenen, erinnerten Wissens entdeckt werden. Besteht das Lehrziel zum Beispiel darin, zu wissen, wie ein Vogelhaus gebaut wird, so ist die Stufe „Erinnern“ gegeben, wenn eine Schülerin ihrer Mutter beim Bau eines Vogelhauses zugeschaut hätte und dies nacherzählen könnte (konkretes Beispiel erinnern) oder eine Bauanleitung für Vogelhäuser verfasste (Verallgemeinerung). Die Stufe „Anwenden“ ist erreicht, wenn sie das Vogelhaus mit ihrer Mutter zusammen gebaut hätte und es nun nachbauen könnte. Hätte ihre Mutter ihr hingegen nur den Umgang mit dem Werkzeug gezeigt, wie sie sägt, bohrt, leimt und so weiter und die Schülerin hätte daraufhin selbst ein Vogelhaus gebaut, so wäre die Stufe „Entdecken“ erreicht. Die Lehrziele selbst werden beschrieben als „- Fakten: beliebig gegliederte Informationsbestandteile (aktuell: entfällt) - Konzepte: Gruppen von Objekten, Ereignissen, Symbolen, die eine gemeinsame Eigenschaft oder Bezeichnung tragen (aktuell: „Entitäten“, die sich auf einen Gegenstand, Person etc. beziehen) - Prozeduren: geordnete Sequenz [Abfolge, J. L.] von Schritten, die zur Erreichung eines Ziels benötigt werden, - Prinzipien: Aussagen über kausale43 oder korrelative44 Zusammenhänge von Ereignissen oder Bedingungen (aktuell: ‚Prozesse’, die sich ‚extern’ vom Lerner [außerhalb von der Lernerin, d. Verf.] abspielen“ (Kerres 1998, S. 164) 43 Ein kausaler Zusammenhang besteht, wenn ein Ereignis der Grund für ein anderes Ereignis ist. Ein korrelativer Zusammenhang besteht, wenn zwei Ereignisse mit einer bestimmten Häufigkeit gemeinsam auftreten. 44 - 37 - 5.5. Mediendidaktische Produktion - Bestimmung der Lehrinhalte 5.5. Bestimmung der Lehrinhalte Kerres (1998, S. 153ff) beschreibt drei Methoden um Lehrinhalte zu bestimmen: 1. 2. 3. die Tätigkeitsanalyse, die Aufgabenanalyse sowie die Sammlung und Gliederung von relevantem Lehrstoff. Diese Methoden dienen dazu, herauszufinden, was genau an Lehrstoff vermittelt werden soll und wie er gegliedert sein soll. Tätigkeitsanalyse Sollen Tätigkeiten vermittelt werden, so ist die Tätigkeitsanalyse die Methode der Wahl: die Tätigkeiten werden in einzelne Handlungsschritte aufgeteilt und diese werden dann auf Fähigkeiten und Kenntnisse hin analysiert, die zu ihrer Ausführung benötigt werden. Diese Fähigkeiten und Kenntnisse sowie deren Ablauf stellen die Lehrinhalte dar, die vermittelt und eingeübt werden können. Aufgabenanalyse Sollen abstraktere Vorgänge und Fähigkeiten vermittelt werden, so besteht die Möglichkeit, die Aufgabe zu formulieren und entweder einen idealen Lösungsweg anzunehmen (beispielsweise von einer Expertin vorgegeben), der ähnlich wie bei der Tätigkeitsanalyse in Handlungsschritte aufgeteilt wird oder typische Anwenderinnen beim Lösen der Aufgabe zu beobachten, und deren Lösungswege zu analysieren. Sammlung und Gliederung von relevantem Lehrstoff Bei dieser Methode der Lehrinhaltsbestimmung formulieren Sachexperten „alle relevanten Themen, Aspekte, Probleme, Anwendungsfälle, Fertigkeiten relativ unstrukturiert [...]. Die Beschaffung und eigene Sichtung relevanter Literatur ist eine weitere Informationsquelle [...]. Die Sammlung sollte so angelegt sein, dass sie kein Raster und keine theoretisch Begrifflichkeit vorgibt, an das sich Experten halten müssen, sondern sollte eher als Brainstorming angelegt sein. Neben der Sammlung gilt es, eine Gliederung der Lehrinhalte anzufertigen die immer wieder erweitert und umstrukturiert werden wird, die Inhalte jedoch wesentlich besser handhaben lässt. Hierbei wird man sich ebenso auf Experten und Literatur verlassen müssen.“ (ebd., S. 154f) 5.6. Bestimmung der Form des Lernangebotes Die Form des Lehrangebotes ist zwischen sequentiell orientierten Lernangeboten einerseits und logisch strukturierten Angeboten andererseits zu verorten. Dabei können Werkzeuge zur Wissenskonstruktion angeboten und sollte die Benutzerinnenführung überdacht werden. Sequentiell orientierte Lernangebote Sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten nur auf den Stufen „Erinnern“ und „Anwenden“ vermittelt werden, so wird eher eine darstellende (expositorische) Lehrform gewählt. Die Fähigkeiten und - 38 - 5.6. Mediendidaktische Produktion - Bestimmung der Form des Lernangebotes Fertigkeiten, die beispielsweise mit einer Tätigkeits- oder Aufgabenanalyse in ihre einzelnen Handlungsschritte gegliedert wurden, können nun Schritt für Schritt, also in einer zeitlichen Abfolge (Sequenz) gezeigt und vermittelt werden: Sei es, dass die Lernenden die einzelnen Handlungsschritte gezeigt bekommen und „trocken“ lernen oder dass sie diese Schritte einüben. Dieses Einüben kann sowohl real geschehen, beispielsweise durch eigene Experimente im ChemieUnterricht (Mischen von Chemikalien), bei denen die Lehrerin die Schülerinnen anweist, was sie tun sollen, als auch symbolisch mit einer Computersimulation45, in der die Schülerinnen jeden Handlungsschritt gesagt bekommen. Diese sequentiell orientierten Lernangebote orientieren sich also am zeitlichen Ablauf dessen, was gelernt werden soll. Logisch strukturierte Angebote Um auch das Entdecken von Wissen zu fördern, ist es sinnvoll eher die logischen Zusammenhänge von Einzelschritten zu zeigen als den zeitlichen Ablauf der gesamten Aufgabe. Den zeitlichen Ablauf sollen die Schülerinnen dann selbst erarbeiten. Angenommen das Lernziel wäre es, Waffeln backen zu können, so würden in einem logisch strukturierten Angebot die Schülerinnen nicht angewiesen, bestimmte Mengen von Mehl, Butter und Milch zu mischen, das Waffeleisen zu erhitzen, einzufetten, den Teig hineinzugeben und die fertige Waffel nach einer bestimmten Zeit zu entnehmen, sondern sie würden ausprobieren können, wie sich der Teig verändert, wenn sich die Mischungsverhältnisse ändern (er wäre eher fest oder flüssig, eher fettig/geschmeidig oder bröselig). Sie würden lernen, dass mit dem Teig nichts passiert, wenn er in ein kaltes Waffeleisen gegeben wird, zum Backen also ein erhitztes Waffeleisen notwendig ist, und dass der Teig am Waffeleisen klebt, wenn es zuvor nicht eingefettet wurde, dass er sich bei einem eingefetteten Waffeleisen gut löst und dass das Fett, wenn das Waffeleisen zu sehr eingefettet wurde, aus dem Waffeleisen herausläuft. Sie würden lernen, dass der Teig noch nicht gar ist, wenn er zu kurz im Waffeleisen war und verbrannt, wenn zu viel Zeit gegeben wurde und schließlich, wie sich verschiedene Teige (trocken, flüssig, geschmeidig, bröselig) im Waffeleisen verhalten: Sie kleben mehr oder weniger, werden hart und trocken oder erst gar nicht fest. All dies könnte zum einen in einer (Lehr-)Küche oder auch computersimuliert ausprobiert werden. Das Wissen, wie eine Waffel am besten gebacken wird, was in welchem Verhältnis und in welcher Reihenfolge geschehen sollte, müssen sich die Schülerinnen selbst erarbeiten. Logisch strukturierte Lernangebote zeichnen sich gegenüber sequentiell orientierten Lernangeboten dadurch aus, dass das Wissen nicht linear, das heißt entlang eines Ablaufplanes 45 Eine Computersimulation ist ein Computer-Programm, in dem die Wirklichkeit nachgestellt ist. Auf dem Bildschirm wäre im genannten Beispiel dann ein Chemie-Labor zu sehen mit verschiedenen Chemikalien, die die Lernenden per Mausklick oder Tastatureingaben auswählen und mischen könnten. Das Programm würde dann die Reaktion zeigen, die beim Mischen dieser Chemikalien auftritt. - 39 - 5.6. Mediendidaktische Produktion - Bestimmung der Form des Lernangebotes „von einer Thematik, bzw. Schwierigkeitsstufe zur nächsten, [erworben wird,] sondern eher spiralförmig: Die Person tastet sich in verschiedene Richtungen weiter, sie kann sich in Sackgassen begeben, bevor sie an eine frühere Stelle zurückkehrt“.(Kerres, 1997, S. 229) Auf das Waffel-Beispiel bezogen heißt das, dass eine Schülerin sich für einen zu festen, bröseligen Teig entschieden haben kann, ihn nicht gut im Waffeleisen verteilt bekommt, daraufhin zurückkehrt zum Anrühren des Teiges, sich für einen zu flüssigen Teig entscheidet, beim Backen bemerkt, dass sich das als ungünstig erweist, wieder zurückkehrt zum Anrühren des Teiges, und so fort bis sie einen geeigneten Weg gefunden hat. Werkzeuge zur Wissenskonstruktion Neben der Darstellung der Lerneinheiten selbst können Medien auch Hilfestellung bei der Bewältigung des Lernstoffes bieten: Sie können das Hervorheben relevanten Lernstoffes ermöglichen (Markieren von Textstellen in einem Buch), das Sammeln und Gliedern von Wissen erlauben (Notiz-Zettel, Wandtafel), den Austausch von Informationen und gemeinsames Lernen unterstützen (Telefon, Video-Konferenz, Email). Kontrolle über den Lernweg Bei der Lernwegkontrolle wird unterschieden zwischen der Lernerinnen- und der Systemkontrolle. Während bei der Systemkontrolle der Lernweg durch das Medium vorgegeben wird – beispielsweise in einem sequentiell orientierten Lernangebot, wo die Lernerin von einem Schritt zum nächsten geführt wird – ist es bei der Lernerinnenkontrolle möglich, den Lernstoff entlang eigener Vorlieben und Interessen zu bearbeiten. Dies trifft eher auf logisch strukturierte Angebote zu, bei denen bei einzelnen Lerninhalten auf mehrere weitere verwiesen wird. Es ist denkbar, dass beide Arten der Lernkontrolle in demselben Lernmedium angeboten werden: So kann zum Beispiel eine „starre“ Systemkontrolle dadurch aufgeweicht werden, dass neben dem Hauptlernweg noch weitere Verweise (ggf. als nebensächlich gekennzeichnet) angeboten werden, bzw. trotz Lernerkontrolle Tipps gegeben werden, welcher Lernschritt zum Erreichen eines bestimmten Zieles als nächster günstig wäre. Eine andere Art der Mischung besteht darin, in einem sequentiell orientierten Angebot eine explorative Sequenz einzubauen, bzw. in einem logisch strukturierten Angebot eine Lerneinheit auch sequentiell orientiert zu gestalten. Benutzerinnenführung Die Frage nach der Benutzerinnenführung stellt sich bei logisch strukturierten Angeboten mehr als bei sequentiell orientierten. Während bei sequentiell orientierten Lernangeboten die Lernwegkontrolle vom medialen System übernommen wird (die einzelnen Lernschritte sind vorgegeben), kann bei einem logisch strukturierten Angebot auch die Kontrolle über den Lernweg den Lernenden überlassen werden, während sich die Logik bei darstellenden Angeboten auf ein „Ich muss - 40 - 5.6. Mediendidaktische Produktion - Bestimmung der Form des Lernangebotes dieses tun, damit ich jenes tun kann“ beschränken kann, müssen bei explorativen Lehrangeboten die logischen Zusammenhänge in allen Einzelstrukturen herausgearbeitet werden. Bei Kerres sind die Unterkapitel „Sachlogische Strukturierung“ und „Lerner- vs. Systemkontrolle bei Lernwegen“ in das Kapitel „Logisch strukturierte Lernangebote“ eingegliedert. Ich werde deren Inhalte kurz als eigenes Unterkapitel neben dem sequentiellen und dem logisch strukturierten Angebot darstellen, da ich der Auffassung bin, dass diese Inhalte für beide Lehrangebotsformen von Interesse sein können: Zum einen sind diese Lehrangebotsformen in der Praxis meines Erachtens nicht immer so klar zu trennen, so dass in einem prinzipiell sequentiellen Angebot einzelne Sequenzen auch in explorativer Form angeboten werden (können) und umgekehrt, ohne das Konzept insgesamt in Frage zu stellen. Zum anderen bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, eine sachlogische Struktur aufzuzeigen, auch wenn das Lehrangebot sequentiell orientiert ist und die Lernenden keine Kontrolle über den Lernweg haben. Wird nur die aus aufgaben- und tätigkeitsanalytischer Sicht gegebene Struktur angeboten und nicht erklärt, wieso dieser Aufbau auch inhaltlich Sinn macht, besteht die Gefahr, dass der Sinn nicht gesehen wird und daher Motivationsverlust droht. Orientierung in der Lernumgebung Als eine Voraussetzung für den Lernerfolg wird bei Kerres die Orientierung in der Lernumgebung genannt: die Lernenden sollten „möglichst schnell [...] die prinzipielle Struktur der Anwendung [... durchschauen]. Dies geschieht am ehesten, wenn sich der Aufbau zunächst an der Struktur eines Hierarchiebaumes mit bestimmten Eigenschaften orientiert.“ (Kerres, 1998, S. 244) Dabei erwähnt er, dass auf jeden Fall vermieden werden sollte, „eine wilde Vernetzung der Informationselemente zuzulassen“, da dies bei den Benutzerinnen zu Verwirrung führen könne und eine Orientierung in der Lernumgebung erschwere. Daneben gibt er weitere Anregungen, welche Fehler vermieden werden sollten: 1. 2. 3. zu tiefe/flache Auslegung der Hierarchie Während eine zu tiefe Hierarchie von den Benutzerinnen als lineares Angebot erlebt werden kann (was in einer explorativen Lernumgebung nicht gewünscht ist), wird eine zu flache Hierarchie, in der zu viele Elemente nebeneinander stehen als zu unübersichtlich und unüberschaubar erlebt. unausgewogene Äste des Hierarchiebaumes Je unausgewogener die Äste eines Hierarchiebaumes sind, desto schwerer fällt es den Benutzerinnen, sich die Struktur des Lernstoffes vorzustellen. Sackgassen, die nicht angemessen zu anderen Ästen zurückführen. zu niedrige/hohe Vernetzung des Interaktionsraumes Verschiedene Hilfsmittel erleichtern den Benutzerinnen die Orientierung: Inhaltliche Orientierungselemente, wie eine Gliederung, die dem Lernangebot vorangestellt wird, Auszüge oder Zusammenfassungen aus den Lerneinheiten sowie wichtige Begriffe, die zur Hinführung auf das Kapitel vorab vorgestellt werden. - 41 - 5.7. Mediendidaktische Produktion - Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an Auftraggeberin und Zielgruppe Indizes, das heißt eine Schlagwortliste, die auf bestimmte, wichtige Stellen im Lehrmaterial verweist, so dass die Benutzerinnen immer wieder zu bestimmten wichtigen Stellen der Lernumgebung zurückfinden können. Graphische Landkarten sind Schaubilder, die die Beziehungen wichtiger Lerninhalte zueinander verdeutlichen, wobei die Lerneinheit, die zur Zeit bearbeitet wird graphisch hervorgehoben wird, um den momentanen Standpunkt zu verdeutlichen. Orientierungspunkte bieten eine weitere Orientierungshilfe. Als Orientierungspunkte werden sowohl inhaltlich wichtige als auch Lerninhalte mit hoher Verknüpfungsdichte genommen, das heißt Lerninhalte, die mit vielen anderen Lerninhalten in Verbindung stehen. Diese Orientierungspunkte werden in den oben genannten graphischen Landkarten eingesetzt und erleichtern nicht nur, den eigenen Standpunkt innerhalb des Informationsangebotes zu finden, sondern auch die Planung des weiteren Lernweges: Welche Punkte muss ich passieren wenn ich zu einem bestimmten anderen Punkt gelangen will? Filter stellen eine Übersicht über das Lerngebiet unter bestimmten Gesichtspunkten dar. Während ein Lernprogramm „Internationale Küche“ sein Gebiet beispielsweise in Vor-, Haupt- und Nachspeisen einerseits und in verschiedene Länder andererseits gliedern würde, könnte ein Filter in diesem Programm dazu eingesetzt werden, alle Gerichte herauszufinden, die zu bestimmten Getränken passen oder bestimmte Zutaten (nicht) enthalten. Um den Lernenden die Möglichkeit zu geben, Informationen wiederzufinden, die sie selbst für wichtig halten, sollten sie die Stellen mit Lesezeichen markieren können und den Lernweg, den sie zurückgelegt haben, aufzeichnen können (Pfadverfolgung/History). Zuletzt besteht auch die Möglichkeit, Pfadvorgaben zum Erreichen eines bestimmten Zieles zu machen. 5.7. Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an Auftraggeberin und Zielgruppe Medienwahl Zur Klärung, welches Medium genutzt werden soll, ist zu fragen, welche Effekte durch den Medieneinsatz erreicht werden sollen, welche Kosten die Produktion verursachen darf und wie effektiv das Medium eingesetzt werden kann. In Bezug auf den Lerneffekt zitiert Kerres (1998, S. 275f) Clark, der der Auffassung ist, dass ein didaktischer Vorteil von keinem Medium geboten würde und „dass im Prinzip mit jedem Mediensystem jeder Inhalt vermittelt werden kann.“ Kerres gibt jedoch auch die technische Seite des Mediums zu bedenken. Das heißt, dass für Benutzerinnen, die den Umgang mit dem Medium nicht gewohnt sind, bzw. die keinen Zugang dazu finden, der Einsatz dieses Mediums ineffektiv wäre. Folglich sollte ein Medium gewählt werden, das für die Benutzerinnen handhabbar ist. - 42 - 5.7. Mediendidaktische Produktion - Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an Auftraggeberin und Zielgruppe Ein weiterer Aspekt der Medienwahl liegt in der Funktion und im Einsatz des Mediums: Soll das Medium Lehrpersonal ersetzen, soll es den Unterricht ergänzen (beispielsweise als Hilfe zur Nachbereitung des im Unterricht Gelernten) oder soll es als Werkzeug des Lehrpersonals eingesetzt werden? Hier müssen Medien gewählt werden, die die gewünschte Funktion unterstützen. Ein Bild oder ein Videofilm zum Beispiel wird nicht alle Fragen der Lernenden beantworten, dies wird nicht reichen, um das Lehrpersonal zu ersetzen, es hilft lediglich, Gesagtes zu wiederholen oder zu veranschaulichen. Anbindung Soll ein Lehrangebot die Lernenden erreichen, so ist es wichtig, dass sowohl die technischen als auch die personellen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Technische Voraussetzungen Auf der Seite der technischen Voraussetzungen bedeutet dies, dass die Lernenden entweder in der Lage sein sollten, das Medium zu handhaben, oder dass sie vorab mit dem Medium vertraut gemacht und im Umgang mit ihm geschult werden sollten. Außerdem muss die Verfügbarkeit der Technik, die genutzt werden soll, sichergestellt sein: Für eine CD-ROM mit einem Lernprogramm wird beispielsweise zum einen ein Computer und ggf. weiteres technisches Gerät gebraucht, zum anderen aber auch (!) der Platz, das technische Gerät aufzubauen. Personelle Voraussetzungen Die personellen Voraussetzungen beziehen sich auf Menschen, die den Einsatz des medialen Angebotes vermitteln sollen: Kerres (1998, S. 277) nennt beispielsweise Widerstände bei Lehrkräften, die den Erfolg eines Lehrangebotes gefährden könnten, wenn dieses Angebot die Funktion hat, die Lehrkräfte zu ersetzen. Mit anderen Worten: Wenn das Angebot sich gegen Personen richtet, die es vermitteln oder einführen sollen, kommt es unter Umständen nicht oder nur schwer zum Einsatz. Außerdem wird möglicherweise Personal für die Pflege des Angebotes (Aktualisierungen) sowie zur Betreuung der Nutzerinnen gebraucht: So können bei einem Computerprogramm trotz ausführlicher Anleitung bei Nutzerinnen noch spezielle Fragen offen sein, für die Ansprechpartnerinnen bereit stehen sollten (Telefon-Hotline). Ein anderes Beispiel ist Fernunterricht über das Internet: Sollen hier Diskussionen über Videokonferenzen geführt werden, so muss jemand die Koordination der Videokonferenzen übernehmen – angefangen von der Bereitstellung der Technik über die Einladung und Information der Teilnehmerinnen, gegebenenfalls bis hin zur Moderation und Nachbereitung der Diskussion. - 43 - 5.8. Mediendidaktische Produktion - Umsetzung und Kontrolle der Konzeption 5.8. Umsetzung und Kontrolle der Konzeption Piller (2000) stellt fest, dass es zwei Marktstrategien gibt, mit denen sich Unternehmen am Markt behaupten: Während die eine Strategie auf die Gewinnung von Neukundinnen setzt, setzt die andere auf Kundinnenorientierung und Pflege der Bestandskundschaft. Mit anderen Worten geht es darum, nicht in erster Linie ein fertiges Produkt möglichst vielen Kundinnen anzubieten, sondern darum, Kundinnen dauerhaft an das Unternehmen zu binden und die Produktpalette gezielt auf diese Kundschaft auszurichten, beziehungsweise die Bedürfnisse der Kundinnen schnell, einfach und kostengünstig zu befriedigen. Piller formuliert fünf Basisregeln für ein erfolgreiches CRM46-Konzept, die die Zielrichtung der Strategie zusammenfassen: 1. Im Mittelpunkt von CRM steht die Kundenbeziehung. Diese ist Ergebnis einer Folge von gemeinsamen Interaktionen zwischen Anbieter und Nachfrager. 2. Ihre Kunden sind nicht an einer Beziehung mit den Anbietern interessiert, sondern an einer Unterstützung bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Bedürfnisse. 3. Die Interaktionen müssen mit der Zeit eine lernende Beziehung (Learning Relationship) zwischen Anbieter und Kunde aufbauen, mit dem Ziel, dessen Bedürfnisse schneller, einfacher und kostengünstiger zu erstellen. 4. Je bequemer, leistungsstärker und besser für den Kunden die Abwicklung von Geschäften mit dem Unternehmen wird, desto größer wird seine Loyalität. 5. Während der klassische Anbieter versucht, immer mehr Kunden für seine Produkte zu gewinnen, bedeutet CRM, mehr Produkte und Leistungen für seine Kunden zu finden (Piller, 2000, S. 6) Den Ablauf der am CMR ausgerichteten Produktion, der meines Erachtens auch auf eine kundinnenorientierte Multimedia-Produktion übertragbar ist, stellt er als einen spiralförmigen Prozess dar: Die Schritte Kundenwünsche „Unternehmen und –bedürfnisse“ „Speicherung der Kundendaten“ vergleichbar mit den Konzeptionsschritten. erhebt und sind vorgenannten Die „Auf- tragsausführung“ besteht in der Umsetzung der Kundenwünsche. Nach der Ausführung wird die Reaktion der Kunden erhoben, um in einem nächsten Arbeitsschritt die Leistung (das Produkt) noch einmal entsprechend der zu verbessern. Schließlich wird wieder bei den Bedürfnissen Reaktion der angesetzt Kundinnen und das zu Produkt überarbeiten von neuund em überarbeitet. 46 CRM: Customer Relationship Management – „ganzheitliche Bearbeitung der Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden“ (Piller, 2000, S. 5) - 44 - 5.8. Mediendidaktische Produktion - Umsetzung und Kontrolle der Konzeption In diesem Modell sind meiner Meinung nach zwei Sachverhalte sehr gut veranschaulicht: Zum einen wird deutlich, dass es kein optimales Produkt geben kann, dass der Produktionsprozess – wenn er sich an den (sich wandelnden) Bedürfnissen der Kundinnen orientiert - nie wirklich abgeschlossen ist. Es muss immer wieder bei den Kundinnenbedürfnissen angesetzt werden („Wiederholungsauftrag“) um das Produkt zu optimieren. Zum anderen wird aus dem Schaubild aber auch die stetige Annäherung an ein optimales Produkt deutlich – die Überarbeitung wird in der Regel immer „feiner“. Auf die Multimedia-Produktion übertragen bedeutet das, dass auch hier ein spiralförmiger Planungs- und Umsetzungsprozess angestrebt werden sollte, um das Produkt möglichst optimal auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen abzustimmen. - 45 - 6.1. Forschungsinteresse, Zielsetzung und Fragestellung - Forschungsinteresse 6. Forschungsinteresse, Zielsetzung und Fragestellung Um das Forschungsinteresse meiner Untersuchung zu beschreiben, ist meines Erachtens eine kurze Schilderung der Ausgangssituation sinnvoll. Im Gegensatz zu einer freien Themenwahl, die auf der Grundlage der Interessen der Diplomandin getroffen und als Forschungs-Angebot an betreuende Professorinnen herangetragen wird, wurde das Thema dieser Diplomarbeit vom betreuenden Professor als Forschungs-Auftrag an mich (den Diplomanden) herangetragen und kann daher als Auftragsarbeit angesehen werden. Während eigene Interessen bei einem frei gewählten Thema die Themenwahl, die Fragestellung und die Zielsetzung lenken und das Forschungsvorhaben dann in Zusammenarbeit mit der Betreuerin modifiziert wird, sind bei einer Auftragsarbeit die Zielsetzung und das Thema durch den Auftrag bereits direkt vorgegeben. Die Fragestellung ist insofern indirekt vorgegeben, als sie der Zielsetzung dienen soll. Sie ist also zielgerichtet oder um im marktwirtschaftlichen Bild von der Auftraggeberin zu bleiben, die einer Auftragnehmerin einen Auftrag zur Herstellung eines Produktes erteilt: Die Fragestellung soll produktorientiert sein. Eigene (Forschungs-) Interessen haben in Bezug auf die Fragestellung und die Untersuchung einen modifizierenden Charakter. 6.1. Forschungsinteresse Anlass zu der Überlegung, Internetseiten für Sarkom-Patientinnen zu entwickeln, bietet das Projekt „Kommunikation und Interaktion während der stationären chirurgischen Behandlung von Patienten mit Knochen- und Weichgewebssarkomen“ von Zaumseil und Hohenberger, das weitestgehend unter der Betreuung von Anja Hermann durchgeführt wurde (Hermann, Zaumseil & Hohenberger, 2001). Untersucht wurde in diesem Projekt die Kommunikation zwischen medizinischem Fachpersonal, Sarkom-Patientinnen und deren Angehörigen in Bezug sowohl auf die Krankheit selbst als auch auf die Behandlung und die Zukunftsperspektive der an Sarkomen Erkrankten. Ziel dieses Projektes war die Entwicklung von Interventionsansätzen, „die die Interaktionspartner bei der Verbesserung der Kommunikation unterstützen“. Ein in diesem Projekt benanntes Problem besteht in den unterschiedlichen Krankheitsvorstellungen der Medizinerinnen und Laien. Das heißt, es existieren bei Medizinerinnen und Patientinnen unterschiedliche Vorstellungen über den Krankheitsverlauf, Therapiemöglichkeiten und Prognosen, was die Kommunikation zwischen ihnen oft erschwert. Eine Möglichkeit unter mehreren, diese „Informationskluft“ zu überbrücken und die Krankheitsvorstellungen der beiden Gruppen anzugleichen, wird in der Installation eines OnlineInformationssystems gesehen. Die Hoffnungen werden darauf gesetzt, dass es die Kommunikation zwischen den Medizinerinnen und den Patientinnen stützen und effektiver gestalten könnte. - 46 - 6.2. Forschungsinteresse, Zielsetzung und Fragestellung - Zielsetzung der Untersuchung 6.2. Zielsetzung der Untersuchung Ziel meiner Untersuchung ist die Konzeption eines solchen Online-Informationssystems. Es sollen also Internetseiten für Sarkom-Patientinnen entwickelt werden, die einen Beitrag dazu leisten können, den Informationsstand der medizinischen Laien zu verbessern und die Kommunikation zwischen ihnen und dem medizinischen Fachpersonal effektiver zu gestalten. 6.3. Fragestellung der Untersuchung Wie ein solches Online-Informationssystem gestaltet sein sollte, um eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den Patientinnen und dem medizinischen Fachpersonal zu unterstützen, ist die Fragestellung, die mich in meiner Untersuchung leitet. Im Kapitel 5, Mediendidaktische Produktion, habe ich bereits ein Konzept vorgestellt, wie ein multimediales Angebot erstellt wird. An diesem Leitfaden soll sich auch meine genauere Fragestellung orientieren. Wenn Internetseiten für Patientinnen und deren Angehörige erstellt werden sollen, die Zielgruppen und das Medium also grob gegeben sind, so bleiben neben deren genaueren Analyse noch die inhaltlichen und gestalterischen Anforderungen an diese Seiten sowie die Anforderungen an die Anbindung zu klären. Im wesentlichen stellen sich für die Erstellung dieses Onlinekonzeptes also drei Fragen, die mein Forschungsinteresse abbilden und die als zu untersuchende Fragestellung noch weiter auszuarbeiten sind: 1. 2. 3. Welche Informationen sollen auf den Internetseiten zu finden sein? (Inhaltliche Anforderungen) Wie sollen sie dargeboten werden? (Gestalterische Anforderungen) Wie kann gewährleistet werden, dass das Informationsangebot die Zielgruppe erreicht? (Anforderungen an die Anbindung des Angebotes) Spezielle Fragestellung in Bezug auf die inhaltlichen Anforderungen Da die Seiten für Patientinnen und deren Angehörige erstellt werden sollen, soll sich die inhaltliche Gestaltung nach deren Informationsbedarf richten. Bei der Bestimmung dieses Informationsbedarfes kann nun aus zwei Perspektiven vorgegangen werden: Zum einen aus dem Blickwinkel des Fachpersonals, das aus der Kenntnis medizinischer sowie struktureller Anforderungen heraus entscheidet, welche Informationen für Patientinnen von Interesse sind, zum anderen aus dem Blickwinkel der Patientinnen und Angehörigen selbst, bei denen sich die Interessen im Verlauf der Erkrankung und deren Behandlung herausbilden und verfeinern. Diese beiden Perspektiven können übereinstimmen, denkbar ist jedoch auch, dass sie sich in einigen Punkten voneinander unterscheiden: So ist zum Beispiel von Interesse, ob Patientinnen mit einigen Informationen überfordert sind, die Ihnen vom Fachpersonal gegeben werden oder ob an anderer Stelle Unsicherheiten auftreten, weil relevante Informationen fehlen. Aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich folgende Fragestellungen: 1. 2. Welche Informationen sollen auf jeden Fall, nicht oder nur unter bestimmten Umständen gegeben werden? a. aus der Perspektive der Zielgruppen selbst b. aus der Perspektive des Fachpersonals c. Wie verhalten sich diese Perspektiven zueinander? Benötigen die verschiedenen Zielgruppen unterschiedliche Informationen? - 47 - 6.3. Forschungsinteresse, Zielsetzung und Fragestellung - Fragestellung der Untersuchung Spezielle Fragestellung in Bezug auf die gestalterischen Anforderungen Neben den inhaltlichen Anforderungen ist zu klären, wie die Inhalte aufbereitet sein sollen, um von Nutzerinnen als hilfreich, verständlich und attraktiv erfahren zu werden. Dies umfasst zum einen die Frage nach der Gestaltung des Mediums selbst (Bild-, Ton-, Textmaterial), zum anderen nach der Gestaltung des Vermittlungsprozesses (Reihenfolge und Anordnung der Informationen). Die Fragestellung, die diesbezüglich zu verfolgen sein wird, ist: 1. 2. 3. Welche Informationsmedien werden warum genutzt? a. Was wird als hilfreich empfunden? b. Welche Schwierigkeiten treten auf? Wie sieht optimale Aufklärungsarbeit im Krankenhaus aus? a. Welche Hilfsmittel werden genutzt? b. Wie werden sie genutzt? Welche Informationen werden wann abgefragt? Spezielle Fragestellung in Bezug auf die Anbindung Damit inhaltliche und gestalterische Aspekte überhaupt zum Tragen kommen können, ist es wichtig, dass das Informationsangebot seine Zielgruppe auch erreicht. Wie dies sicherzustellen ist, bzw. welche Schwierigkeiten es dabei geben könnte, stellt den dritten Schwerpunkt meiner Fragestellung dar. Auch hier wird die Fragestellung zwei Perspektiven beinhalten. Da das Informationsmedium vorab bereits festgelegt wurde, ist nicht nur die Frage von Interesse, welche Medien genutzt werden, sondern auch die Frage ob und wie das Internet als Informationsmedium genutzt wird. Die grundlegenden Fragen lauten also: 1. Woher bekommen die Zielgruppen ihre Information? a. Wie kann das Informationsangebot dort angebunden werden? 2. Besteht Zugang zum Internet? a. b. - 48 - Wie wird es genutzt? Von wem wird es genutzt? 7.1. Planung und Durchführung der Untersuchung - Darlegung der Ausgangssituation und der eigenen Vorannahmen 7. Planung und Durchführung der Untersuchung Da kein Forschungsprozess im „luftleeren Raum“ stattfindet, sondern immer an die Forscherin, ihre Forschungssituation, ihre Methodik, den Gegenstand der Forschung und die Bezüge des Forschungsgegenstandes zu seiner Umwelt gebunden ist, ist es sinnvoll all diese Sachverhalte (soweit dies möglich und für die Forscherin nachvollziehbar ist) zu Anfang einer Untersuchung offen zu legen. Erst diese Offenlegung und damit auch die Nennung der Voraussetzungen der Forschung lassen eine spätere Einschätzung und Verwertung der Ergebnisse zu (vgl. Flick, 1995, 270f). Diese Offenlegung der Ausgangssituation bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit der Einschätzung der Ergebnisse. Ihre Analyse ist auch die Voraussetzung dafür, eine Forschungsmethode zu finden (vgl. Diekmann, 1995, 174ff), die dem Forschungsziel angemessen ist (zur Gegenstandsangemessenheit siehe auch Flick, 1995, 13f). So ist es zwar – um ein Sprichwort zu bemühen – im Hinblick auf eine effektive Vertreibung von Spatzen durchaus angebracht, sie mit Kanonen zu beschießen, im Hinblick auf die finanziellen Mittel der Schützin, ihres Wohnumfeldes und ihrer nachbarschaftlichen Beziehungen jedoch, könnte sich diese Methode als letztendlich ungünstig erweisen. 7.1. Darlegung der Ausgangssituation und der eigenen Vorannahmen Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargestellt, verstehe ich mein Forschungsvorhaben als Auftragsarbeit. Eine Analyse dieser Situation ist demnach die Analyse einer Auftragssituation, die sich auszeichnet durch: 1. 2. 3. Auftrag, Auftraggeber und Auftragnehmer und seine Positionierung zum Auftrag Auftrag Der Auftrag besteht, wie im Kapitel 6.2 (Zielsetzung der Untersuchung) beschrieben, in der Konzeption eines Online-Informationssystems für Sarkompatientinnen, das einen Beitrag dazu leisten soll, den Informationsstand der medizinischen Laien zu verbessern und die Kommunikation zwischen ihnen und dem medizinischen Fachpersonal effektiver zu gestalten. Konzeption, Online-Informationssystems und Sarkompatientinnen Während die ersten drei Bestandteile klar abzugrenzen sind – in den Kapiteln 5.1 bis 5.7 wurde dargestellt, was unter Konzeption zu verstehen ist, Online-Informationssystem lässt sich vereinfacht mit Internet-Seiten übersetzen und Sarkompatientinnen lassen sich medizinisch klar bestimmen – sind die letzten beiden Bestandteile des Auftrages (Beitrag zur Verbesserung des Informationsstandes und Beitrag zur Effektivierung der Kommunikation) unklar gefasst. - 49 - 7.1. Planung und Durchführung der Untersuchung - Darlegung der Ausgangssituation und der eigenen Vorannahmen Verbesserung des Informationsstandes Selbst wenn der Begriff des Informationsstandes auf den Bereich der Sarkom-Erkrankungen bezogen wird, bleibt der Gegenstand unklar und der Auftrag ungenau formuliert, da nicht abgegrenzt ist, was zum Bereich der Sarkom-Erkrankung gehört und was nicht. Während beispielsweise eine Medizinerin sich auf die Erkrankung im medizinisch-therapeutischen Sinne berufen würde, würde eine Psychotherapeutin vermutlich psychische Folge-Erscheinungen dazuzählen, eine Sozialarbeiterin spezifische Versorgungsleistungen, die Patientin Veränderungen im Beziehungsgeflecht zu Freundinnen und Angehörigen. Effektive Gestaltung der Kommunikation Ebenso ist noch der Begriff der effektiven Kommunikation genauer zu bestimmen, das heißt, klar zu fassen, was zum einen unter Kommunikation verstanden wird und zum anderen, wann sie als effektiv bezeichnet werden kann. Ist eine effektive Kommunikation ein Gespräch, das zur Folge hat, dass die Patientin sich vertrauensvoll in die Hände ihrer Ärztin gibt oder sollen beide Therapiemaßnahmen und medizinische Feinheiten diskutieren, bis alle Fragen bis ins Detail geklärt sind? Umfasst der Begriff der Kommunikation formale Aspekte wie zum Beispiel Verhaltensweisen, die gegenseitige Achtung und Wertschätzung zeigen (Patientinnen mit Namen ansprechen und sie auf dem Gang wiedererkennen) oder ist der Kommunikationsbegriff nur inhaltlich gefasst, wird damit also nur das Fachgespräch zwischen Ärztin und Patientin in Bezug auf die Erkrankung gemeint? Ein Beitrag zu ... Zuletzt ist auch der Begriff des Beitrages zu klären: Soll ein bestimmter Beitrag geleistet werden oder ist der Begriff des Beitrages nur Ausdruck dessen, dass ein Informationssystem alleine nicht die umfassende Verbesserung des Informationsstandes und die letztendliche Effektivierung der Kommunikation bewirken kann? Wenn kein spezifischer Beitrag vorab als Erwartung formuliert werden kann, so bleibt jedoch noch die Frage, ob im nachhinein genauer bestimmt werden soll, welchen Beitrag die Internetseiten in Bezug auf den Informationsstand und die Kommunikation leisten (können). Reformulierung des Auftrages Ein nächster Arbeitsschritt wird sein, den Auftrag noch einmal klarer zu fassen (Diekmann, 1995, 163f), bevor die Untersuchung, die auf diesen Auftrag hin ausgerichtet sein soll, geplant werden kann. Hier ergibt sich ein Problem, auf das ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer eingehen werde: Ein Teil der Auftraggeber ist Bestandteil des Untersuchungsfeldes. - 50 - 7.1. Planung und Durchführung der Untersuchung - Darlegung der Ausgangssituation und der eigenen Vorannahmen Eine Klärung der offenen Fragen und somit nähere Bestimmung des Auftrages würde bereits einen Eingriff in das Untersuchungsfeld darstellen, hätte also schon ein Stück Untersuchung vor die Planung gesetzt. Ich wäre damit in einen zirkulären Prozess (Untersuchung–Planung– Untersuchung) eingetreten, der eine klare Trennung der komplexen Zusammenhängen in unterscheidbare Einheiten und ihrer Wirkungen erschweren oder unmöglich machen würde. Die Planung der Untersuchung auf der Grundlage eines unklar formulierten Auftrages würde jedoch bedeuten, das Forschungsinteresse nicht klar bestimmen zu können und somit auch das Forschungsdesign, die Methoden und gegebenenfalls den zu untersuchenden Gegenstand nicht klar zu benennen. Einen wissenschaftlichen Zugang zum Forschungsgebiet würde das unmöglich machen. Bortz legt in einem solchen Fall laut Flick (1995, 13) nahe, ein anderes Forschungsthema zu wählen. Auftraggeber Wie ich im Kapitel 6 einleitend geschrieben habe, wurde das Thema der Diplomarbeit vom betreuenden Professor an mich herangetragen. Er leitet auch das Projekt „Brücken zwischen Vorstellungen von Laien und von Fachpersonal über den Umgang mit chronisch rezidivierenden Krebserkrankungen am Beispiel von Knochen- und Weichgewebssarkomen“ und steht diesbezüglich mit dem Oberarzt der Klinik, der an dem Informationssystem interessiert ist, in einem wissenschaftlichen Kooperationsverhältnis, da dieser der zweite Projektleiter des genannten Projekts ist. Das Lehrangebot und die institutionelle Verankerung von Prof. Manfred Zaumseil lassen eine Patientinnenorientierung vermuten. Diese Patientinnenorientierung zu beachten, liegt nahe, wenn ich ihn als Auftraggeber ansehe. Die Anbindung der Informationsseiten ist an eine Klinik geplant und steht dort unter der Regie des leitenden Oberarztes, der Interesse an einem solchen Projekt geäußert hat. Der Speicherplatz für ein solches Sarkom-Informationssystem ist auf seinen Namen konnektiert, das heißt, es gibt bereits eine Internetadresse, für die dieses Informationssystem erstellt werden soll. Die Weisungsberechtigung, welche Inhalte unter dieser Internetadresse abgelegt werden, liegt bei dem Oberarzt. Seine Position im Auftragsgefüge ist unklar: 1. 2. 3. Ist er der eigentliche Auftraggeber und Professor Zaumseil tritt als Vermittler in Erscheinung? Gibt es aufgrund des eingangs erwähnten wissenschaftlichen Kooperationsverhältnisses zwei Auftraggeber (ggf. mit verschiedenen Schwerpunkten)? Oder ist der Oberarzt der zu untersuchenden Zielgruppe zuzurechnen, da der Auftrag u. a. „Verbesserung der Kommunikation zwischen Patientinnen und medizinischem Fachpersonal“ lautet? Auftragnehmer und seine Positionierung zum Auftrag Die Wahl, im Arbeitsbereich Gemeindepsychologie nach Betreuung einer Diplomarbeit zu suchen, ist eine bewusste Entscheidung für klientinnenbezogenes Arbeiten. Ich empfinde die Sicht- - 51 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung weise der Gemeindepsychologie, die psychosoziale Probleme nicht als Störung der Person, sondern als „individuelle Lösungsversuche im Spannungsfeld subjektiver Bedürfnisse und gesellschaftlicher Widersprüche und Belastungen der alltäglichen Lebenswelt“ (Keupp, 1994) betrachtet, als eine Chance, nachhaltig mit Klientinnen an der Verbesserung ihrer Situation zu arbeiten: Ich bin nicht gezwungen „in der Person“ zu arbeiten oder an ihren (als unangenehm empfundenen) Störungen, sondern kann mit ihr nach ihren Möglichkeiten und Ressourcen suchen und (im Idealfall als angenehm empfundene) Perspektiven erschließen. Ich entscheide mich für den Auftrag und die Diplomarbeit unter folgenden Bedingungen: 1. 2. 3. Als (weisungsberechtigter) Auftraggeber tritt allein Prof. Zaumseil auf. Ich möchte klientinnenzentriert arbeiten: Die Wünsche der Klientinnen in Bezug auf die Internetseiten haben Auftragscharakter. Die Wünsche des medizinischen Fachpersonals haben beratenden Charakter. Von dieser Positionierung erhoffe ich mir, den Auftrag klarer fassen zu können: Der Forschungsauftrag kann so mit Prof. Zaumseil ausgehandelt werden, der diese Aufgabe an Anja Hermann delegiert. Da Anja Hermann und Prof. Zaumseil nicht zum Untersuchungsfeld gehören, kann der Auftrag mit ihnen zusammen reformuliert werden, ohne in das Untersuchungsfeld einzugreifen. Von der klientinnenzentrierten Arbeit erhoffe ich mir, dass die Internetseiten später auch von den Patientinnen in ihrer spezifischen Lebenssituation genutzt werden können. Ich gehe davon aus, dass die Nutzbarkeit eines Hilfsangebotes für Patientinnen davon abhängt, wie das Angebot (in diesem Fall die Internetseiten) auf die von ihnen erfahrene Lebenssituation angepasst ist. Um die Möglichkeit zu haben, die Internetseiten auf ihre Bedürfnisse hin zu planen, ist es von Vorteil, ihre Wünsche und Bedürfnisse als Auftrag anzusehen. Durch die Positionierung des medizinischen Fachpersonals als Beraterinnen hoffe ich einerseits, die Patientinnenzentrierung aufrecht erhalten zu können, zum anderen hoffe ich jedoch auch einen breiteren Blick auf mögliche Perspektiven, Möglichkeiten und Ressourcen zu bekommen. Besonders im Hinblick auf die Verbesserung der Kommunikation zwischen medizinischem Fachpersonal und medizinischen Laien – wenn also Patientinnen und Ärztinnen Zielgruppe des Hilfsangebotes sind, also die Lebens- und Arbeitsumstände beider Gruppen Berücksichtigung finden müssen – ist es sinnvoll, auch die Ärztinnen „ins Boot zu holen“. Diese Gratwanderung zwischen Patientinnenorientierung und Einflussnahme durch das medizinische Fachpersonal hoffe ich durch deren Positionierung als Beraterinnen leisten zu können. 7.2. Planung der Untersuchung Die oben genannte Positionierung bietet nun die Grundlage, das weitere Vorgehen zu planen. Dazu ist es notwendig, den Forschungsauftrag neu zu formulieren. - 52 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Reformulierung des Forschungsauftrages Auf der Grundlage des bisher Dargestellten, lässt sich der Forschungsauftrag wie folgt formulieren: 1. Es sollen Internetseiten für Sarkompatientinnen geplant werden. 2. Diese Planung wird aus der Perspektive der Patientinnen erfolgen. 3. Diese Perspektive wird durch die Perspektive des medizinischen Fachpersonals kontrastiert. Die Funktion der Seiten ist zu reformulieren. Sie lautet bisher: 1. Beitrag zur Verbesserung des Informationsstandes der medizinischen Laien. 2. Beitrag, die Kommunikation zwischen medizinischen Laien und medizinischem Fachpersonal effektiver zu gestalten. Die Reformulierung der Funktion erfolgt, indem Zaumseil und Hermann als formale Auftraggeberinnen47 zu Rate gezogen werden. Der Forschungsauftrag zu dieser Diplomarbeit beruht, wie eingangs erwähnt (s. Kapitel 6.1, Forschungsinteresse), auf den Ergebnissen des Projektes „Brücken zwischen Vorstellungen von Laien und von Fachpersonal über den Umgang mit chronisch rezidivierenden Krebserkrankungen am Beispiel von Knochen- und Weichgewebssarkomen“. Somit ist auch die Funktion, die das Informationssystem, das in Auftrag gegeben wird, vor dem Hintergrund der Projekt-Ergebnisse zu sehen und zu deuten. In Bezug auf Informationen stellt Hermann das Ergebnis dieses Projektes wie folgt dar: „Das Krankheitsverständnis, das Patienten mit Hilfe der ärztlichen Informationen, im Vergleich mit Mitpatienten, aus den Medien und im privaten Umfeld entwickeln, stimmte in unseren Fallanalysen in wesentlichen Punkten nicht mit dem der behandelnden Ärzte überein. weshalb wir von einer Informationskluft sprechen“ (Hermann, 2000, S. 12) Diese Informationskluft – also die Unterschiede im Krankheitsverständnis – führt sie auf eine unterschiedliche Haltung von Patientinnen und Ärztinnen in Bezug auf die Erkrankung zurück. Die Patientinnen Ziel der Patientinnen ist es, gesund zu werden, bzw. so lange wie möglich mit so wenig Einschränkungen wie möglich zu leben. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Patientinnen „Orientierungsarbeit in vielerlei Hinsicht [...] leisten: zunächst örtlich – in einer fremden Institution mit eigenen Regeln, sozial – mit vielen verschiedenen Kommunikations- und Interaktionspartnern, kognitiv – in Bezug auf eine ihnen (teilweise) unverständliche medizinische Fachsprache und Behandlungslogik, emotional: hinsichtlich der erfassten Konsequenzen der Erkrankung und deren Behandlung für die eigene Person. Unsicherheit und Angst begleiten die Orientierungsarbeit der Patienten.“ (Hermann, 2000, S. 7) Diese Darstellung veranschaulicht die Vielschichtigkeit der Situation, in der sich die Patientinnen befinden und die Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt sind. Ein wesentliches Interesse besteht darin, Informationen zu bekommen, die ihnen zu einer Orientierung verhelfen. Dieser Orientie47 Unter „formale Auftraggeberinnen“ verstehe ich die Personen, von denen ich den Auftrag zur Forschung entgegengenommen habe und die die Rahmenbedingungen der Forschung (mit-) bestimmen. Im Gegensatz dazu verstehe ich die Patientinnen als „inhaltliche Auftraggeberinnen“, die die Inhalte des Forschungspro- - 53 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung rungswunsch beschränkt sich dabei nicht nur auf den Weg, sondern auch auf das Ziel: Gesund zu werden ist den Patientinnen keinesfalls sicher – Hermann (ebd.) beschreibt als erste Frage der Patientinnen: „Inwieweit kann ich mit Hilfe der stationären Behandlung wieder gesunden [...]?“ Die Ärztinnen Die Ärztinnen haben laut Hermann das Ziel, fachspezifisch mögliche Behandlungen zu bestimmen48 und zu entscheiden, welche dieser Behandlungen nach dem derzeitigen Wissensstand die beste ist. Bei der Bestimmung dieser bestmöglichen Behandlung orientieren sich die Ärztinnen vorwiegend an rein medizinischen Entscheidungsrichtlinien49. Das Zusammenspiel (Interaktion) von Ärztinnen und Patientinnen Im Gegensatz zu den Patientinnen, deren vorrangiger Wunsch es ist, gesund zu werden und die die Behandlung als den Weg dahin ansehen, besteht für die Ärztinnen das Ziel in der Auswahl des bestmöglichen Weges. Bildlich gesprochen haben die Patientinnen das Ziel vor Augen, nur wissen sie den Weg nicht – die Ärztinnen haben dagegen eine Vorstellung vom Weg (sie haben eine Landkarte) – wohin es letzten Endes geht, ist jedoch vorab nicht absehbar (das hängt zum Beispiel von Verkehrsmitteln sowie den Straßen- und Wetterverhältnissen ab). Die Hoffnung der Patientinnen, eine Fachfrau könne eine klare Zielvorgabe geben („Sie werden wieder gesund“ oder „Diesen oder jenen Status können/werden wir erreichen“) widerspricht also dem Denken, Handeln und letzten Endes auch den Möglichkeiten der Ärztinnen – diese Hoffnung wird jedoch von den Ärztinnen nicht eindeutig zurückgewiesen, sie bleibt vielmehr als berechtigt im Raum stehen. Was für das Gesundwerden im Großen geschieht, geschieht für die Behandlungsschritte im Kleinen: Von den Ärztinnen als erreichbar angegebene Behandlungsziele werden von den Patientinnen so lange als angestrebte und tatsächlich erreichbare Ziele angesehen, bis die Ärztinnen diese Sicht berichtigen. Solch eine Korrektur in einem Auswertungsgespräch nach der Behandlung konnte Hermann hingegen nicht beobachten. Sie formuliert das so: „Als erreichbar angekündigte Behandlungserfolge stellen für den Patienten solange das Ziel und die Handlungsmotivation dar, bis in einem folgenden Gespräch explizit darauf hingewiesen wird, inwieweit vor dem Hintergrund neuer Informationen der angekündigte Behandlungserfolg relativiert wird.“ (Hermann, 2000, S. 10) duktes bestimmen. Während ich von Zaumseil und Hermann einen Forschungsauftrag entgegennehme, nehme ich von den Patientinnen einen Produktionsauftrag entgegen. 48 das heißt, zu entscheiden, welche von den Behandlungsformen, die ihr jeweiliges Fachgebiet nahe legt, im speziellen Fall der Patientin anwendbar sind. 49 Diese Entscheidungsrichtlinien (z. B. Stagings, Studienprotokolle, Entscheidungsbäume) können als „Fahrplan“ verstanden werden, der in Abhängigkeit von Ergebnissen vorgeschlagener Untersuchungen (z. B. Röntgen- oder Ultraschallbilder, Laborbefunde, usw.) nächste Behandlungsschritte vorschlägt. - 54 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung „Es fand kein Auswertungsgespräch statt, in dem eine [...] Einordnung des Operationsergebnisses in die dem Patienten im Aufnahmegespräch angegebenen Prozentangaben erfolgte. Für den Patienten hatten die Angaben des Aufklärungsgespräches ohne eine Abgleichung in einem postoperativen Gespräch die Bedeutung einer guten Prognose50 [...].“ (ebd.) Hermann zeigt hier ein Missverständnis auf, das sie auf das Fehlen medizinischer Informationen zurückführt: das Fehlen eines Auswertungsgespräches. In der weiteren Analyse dieser Situation51 arbeitet sie heraus, dass ein solches Gespräch und damit die medizinische Information nur eingeschränkt von den Ärztinnen angeboten wird und von zwei Sachverhalten abhängt: zum einen von der Person der Ärztin, „Es liegt in der Hand des Arztes, seiner Erfahrung und Zeit, ob und wann der Patient etwas über Therapie und Prognose erfährt.“ (Hermann, 2000, S. 11) zum anderen von der Fähigkeit der Patientin die Informationen abzurufen. „Das heißt der Patient muss speziell fragen, also präzise, kurz und knapp Fragen formulieren. Diese Art zu fragen setzt viel voraus: emotionale Distanz und ein medizinisches Grundverständnis, das eigenständige Schlussfolgerungen in Bezug auf Risiken und Folgen der Behandlung zulässt und so überhaupt erst Fragen zur Therapie aufwirft. (ebd.) Die Deutung des Auftrages vor dem Hintergrund der Interaktion Was bedeutet das vorher Beschriebene für die Formulierung des Auftrages? Wie ist es vor diesem Hintergrund nun zu verstehen, wenn es heißt, die Internetseiten sollen einen Beitrag leisten, 1. 2. den Informationsstand der medizinischen Laien zu verbessern und die Kommunikation zwischen medizinischen Laien und medizinischem Fachpersonal effektiver zu gestalten? Die Beschreibung der Projektergebnisse macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um zwei getrennte Aufträge handeln kann: Es soll nicht einerseits der Informationsstand verbessert und andererseits die Kommunikation effektiver gestaltet werden, sondern die Verbesserung des Informationsstandes soll der effektiveren Gestaltung der Kommunikation dienen. Es geht also um einen Auftrag, nämlich darum, einen Beitrag zur effektiveren Gestaltung der Kommunikation zwischen medizinischen Laien und medizinischem Fachpersonal durch die Verbesserung des Informationsstandes der medizinischen Laien zu leisten. In Bezug auf den Informationsstand bedeutet das, dass die Patientinnen alle Informationen bekommen sollen, die sie in der Kommunikation mit den Ärztinnen brauchen, um diese (für sich) effektiv zu gestalten. Welche Hermann sieht, wenn Patientinnen sich mit Ärztinnen effektiv auseinandersetzen wollen, möchte ich nun noch einmal wiederholen: 50 Im Textzusammenhang wird bei Hermann deutlich, dass die gute Prognose nicht gegeben war. Da Hermann diese Fallbeschreibung exemplarisch in ihrem Ergebnisbericht behandelt, gehe ich davon aus, dass diese Situation in einem gewissen Rahmen verallgemeinert werden kann und zur Erklärung des Begriffes „Informationskluft zwischen Patientinnen und Ärztinnen“ genügt. „In einem gewissen Rahmen“ meint dabei eine nennenswerte Häufigkeit dieser und ähnlicher Situationen. 51 - 55 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung 1. 2. Sie müssen emotionale Distanz aufbringen und ein medizinisches Grundverständnis bekommen, das eigenständige Schlussfolgerungen in Bezug auf Risiken und Folgen der Behandlung zulässt und so überhaupt erst Fragen zur Therapie aufwirft. Andersherum formuliert bedeutet dies, dass in dem Moment ein Beitrag zur effektiveren Gestaltung der Kommunikation zwischen medizinischen Laien und medizinischem Fachpersonal geleistet wird, in dem Patientinnen darüber informiert werden (Verbesserung des Informationsstandes), 1. 2. wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können, so dass eine fachliche Auseinandersetzung mit Medizinerinnen über ihre Erkrankung möglich wird (emotionale Distanz) und wie Medizinerinnen arbeiten, das heißt, wie sie die Krankheit sehen und in welchen Begriffen sie darüber sprechen, wie sie Handeln und auf welcher Grundlage sie ihre Entscheidungen treffen (medizinisches Grundverständnis). Abschließende Formulierung des Forschungsauftrages So kann der Auftrag verstanden werden als ein Auftrag zur Konzeption eines OnlineInformationssystems für Sarkom-Patientinnen, das einerseits ein medizinisches Grundverständnis vermittelt (in Bezug auf ärztliches/medizinisches Denken über ihre Krankheit, sowie ärztliches/medizinisches Handeln und Entscheiden, sowie deren Grundlage) und andererseits Möglichkeiten aufzeigt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen (um ein medizinisches Gespräch emotional distanziert führen zu können). Die Forschungsstrategie: Aktionsforschung Anforderung an die Forschungsstrategie: Beteiligung der Beforschten Hermann (2000, S. 6) führt die Perspektive ihres Projektes aus und beschreibt „dass (sie) weder das Anliegen verfolge, Arbeit in der Klinik zu kontrollieren oder zu bewerten, noch unangemessene Interventionsprogramme zu entwickeln und (den Mitarbeiterinnen der Klinik) vorzusetzen. [...] Veränderungen in Angriff zu nehmen macht [...] nur Sinn, wenn sie im untersuchten Feld selbst als notwendig erachtet und gemeinsam entwickelt werden“. Den Begriff der Veränderung nehme ich auch für die Konzeption der Internetseiten in Anspruch, da es nicht um eine Konzeption zum Selbstzweck geht, sondern darum, Patientinnen Handlungsalternativen aufzuzeigen und zu ermöglichen. Insofern sind die Patientinnen hier als die an den Veränderungen Beteiligten zu sehen. Ihre Interessen – das was sie als notwendig erachten – bei der Entwicklung der Internetseiten nur zu berücksichtigen, kann meiner Meinung nach vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll sein, wenn es um tatsächliche Veränderung gehen soll: Um eine nachhaltige Veränderung zu ermöglichen, sollten die Patientinnen an der Entwicklung und Umsetzung der Internetseiten direkt beteiligt sein. Die Einstellung, dass es nur Sinn macht, Veränderungen in Angriff zu nehmen, wenn sie gemeinsam entwickelt und von den Beteiligten selbst als notwendig erachtet werden, deckt sich mit den - 56 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Erfahrungen der Entwicklungszusammenarbeit52. Im Jahresbericht 1995 der GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) heißt es: „Dabei erhält eine möglichst frühe und konsequente Beteiligung der betroffenen Menschen ein noch größeres Gewicht. Denn nur durch ‚public participation’ – von Selbsthilfegruppen und sie unterstützenden Nichtregierungsorganisationen – kann gewährleistet werden, dass die Hilfe zur Selbsthilfe wirklich dauerhafte Erfolge zeitigt.“ (GTZ, 1996, S. 21) Minkner-Bünjer formuliert aufgrund von praktischen Erfahrungen der Entwicklungszusammenarbeit folgenden Grundsatz: „Je partizipativer die Planung ist, desto leichter läuft der Prozess der Kompetenzsteigerung durch Erfahrungs- und Kenntniszuwachs ab. Partizipative Planung schult die Zielgruppe in der Identifizierung und Analyse ihrer Probleme, im Erkennen von Zusammenhängen, in der Einordnung der Probleme sowie in der Formulierung der Nachfrage zu deren Lösung. Sie ist unentbehrlich bei armutsorientierten Projekten.“ (Minkner-Bünjer, 2000, S. 53) Diese Erfahrung möchte ich auch für die Planung der Internetseiten nutzen. Wenn ich sie auf meine Forschungssituation anwende, so kann ich davon ausgehen, dass die Internet-Seiten von Sarkom-Patientinnen umso nutzbringender eingesetzt werden können, je intensiver sie an der Planung der Seiten beteiligt waren. Ihre Beteiligung an der Planung soll dazu führen, dass ein späterer Kenntniszuwachs für Sarkom-Patientinnen leichter möglich ist. Da Informationen aus rein medizinisch-fachlicher Perspektive unter Umständen nicht alle Patientinneninteressen abdecken, wird ein Informationsangebot besser an die Bedürfnisse von Patientinnen angepasst sein, wenn ihre Interessen bereits in der Planung mit einfließen konnten. Ein Informationsangebot, das wiederum besser an die Patientinneninteressen angepasst ist, wird ihnen mehr Kenntniszuwachs ermöglichen. Um der Forderung nachzukommen, dass die Forschungsmethode dem Forschungsgegenstand angemessen sein53 soll, ist aufgrund der oben dargestellten Argumentation eine Methode, bzw. Forschungsstrategie54 zu wählen, die die Zusammenarbeit der Forscherin mit den Beforschten fördert. Anders formuliert: Es ist eine Methode zu wählen, die die Patientinnen nicht in die Rolle von „passiven Beforschten“ drängt, sondern eine Methode, die es ermöglicht, dass Patientinnen aktiv ihre Bedürfnisse (im Dialog mit dem Forscher) entwickeln und sie in den (Forschungs-) Prozess einbringen. Die Wahl der Forschungsstrategie Eine solche Forschungsstrategie ist die Aktionsforschung, die in der Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt wird. Laut Schneider-Barthold et al. (1994) ist die Aktionsforschung nicht als ei- 52 Entwicklungszusammenarbeit kann als eine Form der Entwicklungshilfe angesehen werden. Vgl. Flick (1995, 13f) und Schmidt-Sichermann (1995, Abs. 3): "Die Methoden müssen ihrem Forschungsgegenstand angemessen sein." 54 Die Begriffe Forschungsstrategie, Forschungskonzept und Forschungsdesign verwende ich synonym (in gleicher Bedeutung) für einen geplanten Einsatz wissenschaftlicher Forschungsmethoden, wobei die Planung die Art und den Ablauf des Methodeneinsatzes bestimmt. 53 - 57 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung gene Methode zu sehen, sondern sie bedient sich der Methoden der qualitativen und quantitativen Sozialforschung. Sie stellt vielmehr eine Strategie dar, die die Auswahl der methodischen Instrumente bestimmt. Dabei „zielt sie auf ein ganzheitliches Verständnis von Situationen ab und interessiert sich daher für die Ursachen, Zusammenhänge und Kontexte von sozialen Tatbeständen, die Erfahrungen, die von der untersuchten Gruppe bereits bei der Änderung von Handlungsweisen gemacht wurden, die subjektive Sichtweise und die Werte der Gruppe die Einordnung der Tatbestände in deren Lebenswelt und ihre Deutung aus dem Alltagswissen der Gruppe.“ (Schneider-Barthold et al., 1994, S. 7) Zentral bei diesem Forschungskonzept ist der Prozesscharakter der Forschung. Im Gegensatz zu quantitativer Sozialforschung, die eher statische Fragestellungen verfolgt, gehen Hermann und Schürmann davon aus, „dass sich bei Anwendung von Methoden der qualitativen Sozialforschung das Forschungsdesign stets verändert und differenziert, das heißt Methoden im Forschungsverlauf weiterentwickelt werden.“ (Hermann & Schürmann, 2000, S. 30) Bei dieser Sicht auf qualitative Sozialforschung steht eine dynamische Fragestellung im Vordergrund: Es wird nicht nur der Zustand vor oder während der Forschungsperiode untersucht, sondern auch die Veränderung, die im und durch den Forschungsprozess ausgelöst wird. Qualitative Sozialforschung geht also über das bloße Beschreiben und Deuten von Veränderungen hinaus: Sie lässt die Veränderungen in die weitere Datenerhebung und -auswertung des Forschungsprozesses mit einfließen. Dies gilt auch für die Aktionsforschung, die sich der Methoden der qualitativen Sozialforschung bedient. Während jedoch das Verändern des Forschungsdesigns bei qualitativer Sozialforschung oftmals allein auf der Grundlage der Erkenntnisse der Forscherin geschieht, ist die Veränderung des Forschungsdesigns in der Aktionsforschung ein interaktiver Prozess, der auf den Erkenntnissen der Forscherin und der Beforschten beruht und die Beforschten somit zu Forschungspartnerinnen werden lässt. Bildlich gesprochen gewährt die Forscherin ihren Forschungspartnerinnen Einsicht in ihre Erkenntnisse und den Erkenntnisprozess und gibt ihnen die Möglichkeit auch den weiteren Forschungsprozess aktiv mitzugestalten. Gagel beschreibt diesen Prozess zwischen Forscherin und Forschungspartnerin wie folgt: „Während des gemeinsamen Forschungsprozesses werden auf beiden Seiten Erkenntnisse gewonnen und Einsichten ausgelöst, die zu Konsequenzen führen. Den verschiedenen Interessen entsprechend, zieht der Forscher Konsequenzen eher bei der Dokumentation, Aufbereitung und Darstellung der gewonnenen Information sowie hinsichtlich der Fortführung des eingeleiteten Forschungsprozesses (Hervorhebungen, J. L.)“ (Gagel, 2000, S. 2) Wesentliches Merkmal der Aktionsforschung ist damit, dass sie durch Rückkopplungsschleifen gekennzeichnet ist: Sie begnügt sich nicht damit, Fragen zu stellen, im Untersuchungsfeld nach Antworten zu suchen und diese als Forschungsergebnis wiederzugeben (linearer Forschungsprozess), sondern trägt ihre Forschungsergebnisse zurück ins Untersuchungsfeld, um sie mit den - 58 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Forschungspartnerinnen zu überprüfen, die Forschungsfragen neu zu formulieren, wiederum nach Antworten zu suchen und so fort (zyklischer / rekursiver Forschungsprozess). Diese (zyklische) Prozessorientierung wird von der gtz als wichtiger Erfolgsfaktor in ihrer Projektarbeit angesehen: „GTZ-interne und externe Untersuchungen haben gezeigt, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Projektarbeit deren Prozessorientierung ist. Dementsprechend wurde das Projektmanagement der GTZ auf der Grundlage der ‚Zielorientierten Projektplanung’ (ZOPP) zu einem flexiblen ‚Project Cycle Management’ (PCM) weiterentwickelt. ZOPP, seit vielen Jahren ein Markenzeichen der GTZ, versteht Planung als Klärungs- und Verständigungsprozess zwischen den Menschen, die gemeinsam etwas ändern wollen. Dabei werden die wesentlichen Elemente eines TZ-Projekts von allen beteiligten Akteuren schrittweise entwickelt und dem Projektablauf und der Situation im Partnerland angepasst. Nach PCM verlaufen Prozesse nicht linear, sondern in vielen Rückkoppelungsschleifen, sodass Fragen der Analyse und Konzeption, der Aufgaben und Zuständigkeiten im Projektablauf immer wieder aufgenommen und neu geklärt werden müssen.“ (GTZ, 2000, S. 8) Das problemzentrierte Interview als Methode der Aktionsforschung Wie bereits beschrieben, bedient sich die Aktionsforschung der Methoden qualitativer Sozialforschung: Ich entscheide mich dafür, problemzentrierte Interviews nach Witzel (2000) zu führen. Gemeinsamkeiten55 des problemzentrierten Interviews und der Aktionsforschung Den wesentlichen Vorteil des problemzentrierten Interviews sehe ich in seiner (methodischen) Offenheit. Da eine flexible Anpassung an die Forschungssituation bereits in seinen „Grundpositionen“ verankert ist, teilt es mit der Aktionsforschung die Blickrichtung auf das Forschungsvorhaben und kann so in ihrem Rahmen gut eingesetzt werden. Diese Grundpositionen formuliert Witzel in Bezug auf 1. 2. 3. Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung. Unter Problemzentrierung versteht Witzel „die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung und [...] die Organisation des Erkenntnis- oder Lernprozesses (Vorinterpretation): Der Interviewer nutzt die vorgängige Kenntnisnahme von objektiven Rahmenbedingungen der untersuchten Orientierungen und Handlungen, um die Explikationen der Interviewten verstehend nachzuvollziehen und am Problem orientierte Fragen bzw. Nachfragen zu stellen(Hervorhebungen, J. L.)“. Parallel zur Produktion von breitem und differenziertem Datenmaterial arbeitet der Interviewer schon an der Interpretation der subjektiven Sichtweise der befragten Individuen und spitzt die Kommunikation immer präziser auf das Forschungsproblem zu. (Witzel, 2000, Abs. 4) Sowohl die Orientierung an der gesellschaftlich relevanten Fragestellung als auch das Nachfragen (Nachvollziehen der Forschungspartnerinnen), das einen ersten Analyse- und Auswertungsschritt schon in der Datenerhebung verankert und damit die Datenerhebung beeinflusst, ist bei der Aktionsforschung gefordert. 55 Da die Aktionsforschung ein Forschungskonzept ist, das Problemzentrierte Interview hingegen eine Methode, die in einem Konzept angewendet wird, sind die Begriffe „Gemeinsamkeiten“ und „Unterschiede“ problematisch: Sie legen einen Vergleich zweier Begriffe nahe, die sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen - 59 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Klüver & Krüger (zitiert bei Schneider-Barthold et al., 1994, S. 5f) stellen diesbezüglich für die Aktionsforschung folgende Prinzipien auf: „Die Problemauswahl und -definition geschieht nicht vorrangig aus dem Kontext wissenschaftlicher Erkenntnisziele, sondern entsprechend konkreten gesellschaftlichen Bedürfnissen.“ und „Die praktischen und theoretischen Ansprüche des action research verlangen vom Forscher eine zumindest vorübergehende Aufgabe der grundsätzlichen Distanz zum Forschungsobjekt zugunsten einer bewusst einflussnehmenden Haltung, die von teilnehmender Beobachtung bis zur aktiven Interaktion mit den Beteiligten reicht.“ Die Gegenstandsorientierung beschreibt die Offenheit des methodischen Vorgehens. Sie soll es ermöglichen, die Methode den unterschiedlichen Anforderungen des Forschungsgegenstandes anzupassen. Je nach Forschungsvorhaben können die problemzentrierten Interviews beispielsweise als Gruppendiskussion geführt werden, als biographische Interviews, als Interviews mit standardisiertem Fragebogen oder als Kombination verschiedener Interviewformen. Genauso, wie die Interviews insgesamt an die Forschungssituation angepasst werden sollen, soll auch jedes einzelne Interview an die Interviewsituation angepasst werden: „Den Erfordernissen des Aufbaus einer befragtenzentrierten Kommunikationssituation folgend kann der Interviewer je nach der unterschiedlich ausgeprägten Reflexivität und Eloquenz der Befragten stärker auf Narrationen oder unterstützend auf Nachfragen im Dialogverfahren setzen.“ (Witzel, 2000, Abs. 5) Sowohl diese methodische Offenheit wird in der Aktionsforschung durch „Verzicht auf ein vorgefertigtes Projektprogramm [... und ...] Verzicht auf standardisierte Interviews durch professionelle Interviewer“( von Schneider-Barthold et al., 1994, S. 12) gefordert, als auch die damit verbundene Anpassung an den Forschungsgegenstand: "Die Methoden müssen ihrem Forschungsgegenstand angemessen sein."(Huschke-Rhein, zitiert nach SchmidtSichermann, W., 1995, Abs. 3) Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass die in der Aktionsforschung ausgeübte Zusammenarbeit von Forscherinnen und Forschungspartnerinnen schon von sich aus methodische Offenheit und eine Anpassung der Methodik an die jeweilige Situation erfordert: Gagel (2000, S. 7) beschreibt den Forschungsprozess als Verhandlung zwischen beiden Parteien, bei der keine von beiden sich der anderen unterwerfen soll. In dem Maße, wie beide jedoch als beteiligt gelten können, kann der Forschungsprozess als ihnen angepasst gelten. Gerade die Prozessorientierung macht die Aktionsforschung aus. Was für die Aktionsforschung als wesentliche Grundlage angesehen wird, formuliert Witzel für das problemzentrierte Interview wie folgt: bewegen. Es geht mich jedoch nicht um einen direkten Vergleich von Aktionsforschung und Problemzentriertem Interview, sondern um den Vergleich der dahinterstehenden Forschungshaltung. - 60 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung „Die Prozessorientierung bezieht sich auf den gesamten Forschungsablauf und insbesondere auf die Vorinterpretation. Wenn der Kommunikationsprozess sensibel und akzeptierend auf die Rekonstruktion von Orientierungen und Handlungen zentriert wird, [...] entwickeln [die Forschungspartnerinnen in Zusammenarbeit mit der Forscherin, J. L.] im Laufe des Gesprächs immer wieder neue Aspekte zum gleichen Thema, Korrekturen an vorangegangenen Aussagen, Redundanzen, und Widersprüchlichkeiten. Redundanzen sind insofern erwünscht, als sie oft interpretationserleichternde Neuformulierungen enthalten. Widersprüchlichkeiten drücken individuelle Ambivalenzen und Unentschiedenheiten aus, die thematisiert werden sollten. Ihnen liegen möglicherweise Missverständnisse des Interviewers oder Fehler und Lücken in der Erinnerung der Interviewten zugrunde, die durch Nachfragen aufgeklärt werden können. Sie können aber auch Ausdruck von Orientierungsproblemen, Interessenswidersprüchen und Entscheidungsdilemmata angesichts widersprüchlicher Handlungsanforderungen sein“ (Witzel, 2000, Abs. 6) Gerade in der Aktionsforschung sucht – bildlich formuliert – nicht die Forscherin alleine nach den Daten, sondern sie sucht gemeinsam mit den Forschungspartnerinnen: Einerseits kann sie ihnen die gefundenen Daten zeigen (die Forschungspartnerinnen können daraufhin eine Einschätzung des Stellenwertes vornehmen), andererseits können die Forschungspartnerinnen der Forscherin Daten zeigen, die sie alleine übersehen hätte. „So ziehen normalerweise beide Seiten Nutzen aus der Aktionsforschung. Die Gruppe der Nutzer56 gewinnt unter Anleitung eines externen Facilitators57 Erkenntnisse und Einsichten, die zu Änderungen von Handlungsweisen führen, und der Berater58 erhält dadurch Zugang zu Informationen, die auf andere Weise nicht zu gewinnen sind“ (Gagel, 2000, S. 2) Der Unterschied59 zwischen Aktionsforschung und problemzentriertem Interview Der Unterschied in den Ansätzen von Aktionsforschung und problemzentrierten Interviews liegt auf den Gebieten der „Deutungshoheit“ und der „Entscheidungsgewalt“ oder - salopp formuliert in der Frage, wer die erste Geige spielt. Gagel beantwortet diese Frage für die Aktionsforschung ganz eindeutig: „Die Nutzer der Zusammenarbeit spielen die erste Geige. Sie sind die Akteure. Sie analysieren ihre Lage, suchen Auswege, konzipieren und realisieren Maßnahmen (Hervorhebung, J. L.). Der Berater schafft zunächst lediglich die Voraussetzungen für diese Aktivitäten. Sobald diese in Gang gekommen sind, tauchen Fragen auf; je nachdem, welchen Problemkomplex die Nutzer zuerst angehen, sind es organisatorische, steuer-, boden- oder verwaltungsrechtliche, technische, medizinische, pädagogische etc. Fragen.“ (Gagel, 2000, S. 2f). Er formuliert deutlich, wer die „Deutungshoheit“ in der Zusammenarbeit hat: Die Forschungspartnerinnen analysieren ihre Lage selbst. Und auch die „Entscheidungsgewalt über den Fortgang 56 gemeint sind die Forschungspartnerinnen – diejenigen, die das Hilfsangebot der Entwicklungszusammenarbeit nutzen. 57 gemeint sind die Forscherin – Facilitator ist abgeleitet von engl. faciliation: erleichtern. „Projektmitarbeiter wirken also als Facilitators. Sie bieten den Nutzern oder deren Vertretern eine - wie auch immer geartete - Möglichkeit, ihre drängendsten Probleme zu nennen, Lösungsansätze zu suchen, Aktionspläne auszuarbeiten und Tätigkeiten festzulegen, und sie ermutigen sie, entsprechend den Plänen und Absichten zu handeln.“ (Gagel, 2000, S. 3) 58 gemeint ist die Forscherin Da die Aktionsforschung ein Forschungskonzept ist, das Problemzentrierte Interview hingegen eine Methode, die in einem Konzept angewendet wird, sind die Begriffe „Gemeinsamkeiten“ und „Unterschiede“ problematisch: Sie legen einen Vergleich zweier Begriffe nahe, die sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen bewegen. Es geht mich jedoch nicht um einen direkten Vergleich von Aktionsforschung und Problemzentriertem Interview, sondern um den Vergleich der dahinterstehenden Forschungshaltung. 59 - 61 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung des Forschungsvorhabens, liegt - in erster Linie60 - bei ihnen. Gerade in Bezug auf die Gesprächsführung, die bei dem problemzentrierten Interview Schwierigkeiten aufwirft, bezieht er klar Stellung: „Um den Missbrauch des Gesprächsleitfadens als Fragebogen zu vermeiden, wurde den Animatoren empfohlen, den Leitfaden in den Betrieben nicht abzulesen sondern das Wesentliche an ihm in der Diskussion untereinander vorher zu diskutieren und zu memorieren. Wir legten Wert auf die Entwicklung von Diskussionen und weniger auf die systematische Erfragung von Daten. Von den Handwerkern aufgeworfene Probleme waren vorrangig zu behandeln, auch wenn sie nach Meinung der Animatoren nicht wesentlich waren.(Hervorhebung, J. L.)“ (Gagel, 1994, S. 39) Witzel (2000) legt die Entscheidung über die Gesprächsführung in die Hände der Forscherin: Sie entscheidet, worüber gesprochen wird, lenkt das Gespräch auf (für sie) relevante Themen, wobei sich die Relevanz der Themen aus dem „induktiv-deduktiven Wechselspiel“ – dem Wechselspiel aus dem Erfragen von Informationen und deren Erschließen aufgrund der Zusammenarbeit von Forscherin und Forschungspartnerinnen – ergibt. Sie ergibt sich jedoch in erster Linie für die Forscherin61. Der Interview-Leitfaden und sein Stellenwert für die Gesprächsführung Nach dem Leitsatz „Wissenschaft ohne Praxis bleibt leicht leere Theorie, Praxis ohne Wissenschaft droht bei kurzsichtiger Praxis stehen zu bleiben“62 entscheide ich mich für ein problemorientiertes Leitfaden-Interview, wobei der Interviewleitfaden - orientiert an der Theorie zur Medienproduktion, die ich im Kapitel 5 dargestellt habe - folgende drei Bereiche abdecken soll: 1. 2. 3. Anbindung der Internetseiten, Gestaltung der Internetseiten und Inhalte der Internetseiten Das Thema Anbindung soll dabei klären, wie ein Kontakt zwischen den Patientinnen und dem Online-Informationsangebot hergestellt werden kann. Es ist abzuklären, woher Informationen für die Patientinnen kommen (soll), ob das Internet genutzt wird und wie die Nutzung des Internets sichergestellt/gefördert werden kann. Die Fragen zur Gestaltung sollen das „wie“ der Informationsweitergabe klären: Wie sollen Informationen aufbereitet sein und zu welchem Zeitpunkt sollen sie gegeben werden? 60 vgl. Gagel, 2000, S. 7 : „Auch wenn es richtig ist daran festzuhalten, dass der Nutzer in seinem Bereich tatsächlich in vielen Angelegenheiten seinen Bedarf am ehesten zu erkennen in der Lage ist, beruht der Umkehrschluss, der Berater wäre nun seiner eigenständigen Rolle beraubt, auf einem Missverständnis. Aktionsforschung ist nicht die alleinige und autonome Aktion einer Gruppe, sondern Aktionsforschung als Partizipation bedeutet, dass sich zumindest zwei Seiten einer ständigen Verhandlungssituation stellen müssen. Von Seiten der Projektmitarbeiter sollten [...] Kriterien [...] eingebracht werden, die den Nutzern nicht immer gegenwärtig sind, oder die diese nicht immer bereit sind, von vornherein zu akzeptieren [...]. Diese Verhandlungssituation ist aufgrund eventuell unterschiedlicher Wertesysteme der Beteiligten nicht unproblematisch und konfliktfrei, ist aber unumgehbar, will sich eine Seite nicht bedingungslos der anderen unterordnen.“ 61 vgl. weiter oben, Abschnitt Prozessorientierung (Witzel, 2000, Abs. 6) - 62 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Der dritte Themenbereich soll sich mit den Inhalten, also den Informationen selbst, beschäftigen, welche Auswahl an Informationen den Interviewpartnerinnen helfen kann, ihre Krankheit und ihren Alltag besser zu bewältigen. Was sind die Informationen, die sie – um auf den Forschungsauftrag zurückzukommen - im Umgang mit der Krankheit im Allgemeinen und der (medizinischen) Krankheitsbehandlung im Speziellen benötigen? Der Einsatz des Interview-Leitfadens (siehe Anhang) wird im Sinne der Aktionsforschung gestaltet, das heißt die Interviewpartnerinnen bekommen ihn – wenn möglich – vor dem Interview ausgehändigt. Zudem wird auf dem Leitfaden das Forschungsvorhaben kurz vorgestellt, damit die Forschungspartnerinnen ein Bild davon bekommen, in welchem Kontext die Fragen stehen. Durch diese Offenlegung der Situation haben sie die Möglichkeit, die Gesprächssituation in ihrem Sinn zu gestalten. Das Interview selbst findet als gleichberechtigtes Gespräch statt – der Leitfaden dient bestenfalls als Gedächtnisstütze und Hilfe für den Gesprächseinstieg, der vor jedem Interview mit jeder Forschungspartnerin ausgehandelt wird: Die über das Forschungsvorhaben informierten Gesprächspartnerinnen werden gefragt, ob sie frei erzählen möchten oder ob ich Fragen stellen soll. Der Fortgang des Gespräches wird möglichst frei gestaltet: der Leitfaden kommt nur dann zum Einsatz, wenn die Gesprächspartnerinnen ihre Ausführungen beendet haben und auch von meiner Seite her keine weiteren Fragen zum Ausgeführten bestehen. Ich betrachte die Interviewpartnerinnen als Expertinnen ihrer Situation, das heißt, dass ich die Entscheidung, was zum Thema gehört und was nicht, ihnen überlasse und – von Verständnisfragen abgesehen – bemüht bin, wenig strukturierend in den Gesprächsverlauf einzugreifen. Dabei halte ich mich auch strikt an die bei Gagel für sein Projekt formulierte Anweisung „Von den Handwerkern aufgeworfene Probleme waren vorrangig zu behandeln, auch wenn sie nach Meinung der Animatoren nicht wesentlich waren.“ (Gagel, 1994, S. 39). Das bedeutet, dass alles, was geäußert wird, im Kontext der Information von SarkomPatientinnen gesehen wird. Wenn zum Beispiel eine Patientin äußern sollte, dass sie nun donnerstags nicht mehr zum Schwimmen gehen könne, gehört dies für mich ebenso zum Thema „Informationen für Sarkompatientinnen“ wie die Frage nach den Therapiemöglichkeiten des Leiomyosarkoms. Der thematische Bezug wird, wenn er mir nicht eingängig scheint, in Zusammenarbeit mit den Interviewpartnerinnen herausgearbeitet. So könnte zum Beispiel hinter der Äußerung, donnerstags nicht mehr schwimmen gehen zu können, der Wunsch stehen, vorab darüber informiert zu werden, wie sich der Alltag für Patientinnen verändern kann und welche Alternativen zu gewohnten Handlungen und in der Freizeitgestaltung bestehen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten 62 unbekannte Verfasserin, letzter Abruf am 16.04.2001, abrufbar über: http://www.schulnetz.ch/unterrichten/fachbereiche/medienseminar/einfger.htm - 63 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung neue Hobbies vorzubereiten (Anschaffung von Farben, Pinsel, Leinwand, Staffelei und Raumbeleuchtung lässt sich gegebenenfalls vor der Behandlung leichter bewerkstelligen als währenddessen – vielleicht scheitern Hobbies nicht weil ihre Ausführung so schwierig ist, sondern weil die Voraussetzung nicht geschaffen werden kann). Ich gehe also davon aus, dass das Informationsbedürfnis von Patientinnen nicht immer so klar formuliert werden kann, dass es in vollem Umfang mit einem Fragebogen abgefragt werden kann, sondern bediene mich des Leitfadens als Anstoß gemeinsam mit den Interviewpartnerinnen das Informationsbedürfnis zu erforschen und nach Möglichkeiten zu suchen, es zu befriedigen. Tonträgeraufzeichnungen Die Interviews werden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend vorschriftlicht. Die Auswertung der Interviews erfolgt dann anhand des Textmaterials. Kurzfragebogen und Postskripte Im Anschluss an das Gespräch werden noch Alter, Beruf und Familienstand erfragt und Besonderheiten der Interviewsituation vermerkt, um den Gesprächskontext gegebenenfalls in die Auswertung mit einfließen lassen zu können. Sampling: Die Auswahl der Interviewpartnerinnen Neben der Frage wie das Interview geführt werden soll, ist zu planen mit wem die Gespräche stattfinden sollen. Die Reformulierung des Auftrages sowie die gewählte Forschungsstrategie legen problemzentrierte Interviews mit Sarkom-Patientinnen nahe. Patientinnen Da eine repräsentative Stichprobe nach quantitativer Forschungslogik den Rahmen dieser (qualitativen) Diplomarbeit sprengen würde, entscheide ich mich für eine Auswahl der Forschungspartnerinnen mit Fallkontrastierung, das heißt, ich suche möglichst unterschiedliche Forschungspartnerinnen, um eine große Bandbreite an Informationen zu gewinnen und somit auch möglichst unterschiedliche und viele Informationswünsche und Aspekte des Informationsbedarfes erarbeiten zu können. Eine möglichst große Unterschiedlichkeit erreiche ich meines Erachtens mittelbar über das Alter der Patientinnen. So dürften die Anforderungen an Informationen sich bei 1. 2. 3. jungen Patientinnen, Patientinnen mittleren Alters und älteren Patientinnen aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebenssituation weitgehend unterscheiden. Unter jungen Patientinnen verstehe ich Schülerinnen oder Patientinnen, die noch zu Hause bei den Eltern wohnen und wo Eltern noch mindestens einen Teil der Verantwortung tragen. - 64 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Zu den Patientinnen mittleren Alters zähle ich Patientinnen, die „auf eigenen Beinen stehen“. Sie stehen im Berufsleben, bzw. in einer Berufskarriere, wohnen nicht mehr zu Hause und planen ihren weiteren Lebensweg alleine oder mit der „eigenen“ Familie, sprich mit Ehefrauen und ggf. Kindern und Freundinnen. Ihre Eltern sollten gegebenenfalls unterstützend von ihnen zu Rate gezogen werden, nicht aber direkt in einer entscheidenden Rolle stehen oder gesehen werden. Die älteren Patientinnen sollten Rentnerinnen sein oder kurz vor der Berentung stehen. Die Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen sehe ich in den Entscheidungsanforderungen: Bei jungen Patientinnen vermute ich, dass die Verantwortung leichter an Eltern abgegeben wird, Entscheidungen weniger selbst oder alleine getroffen werden und daher ein anderes Informationsbedürfnis besteht als bei Patientinnen, die ihr Leben selbst „in die Hand nehmen“ müssen. Der Unterschied zwischen Patientinnen mittleren Alters und älteren Patientinnen liegt für mich in der Perspektive: Bei Patientinnen, die das Arbeitsleben noch vor sich haben, vermute ich einen anderen Umgang mit der Krankheit und andere Behandlungsziele als bei Patientinnen, die nicht mehr im gesellschaftlichen Produktionsprozess stehen und – mindestens aus dieser Perspektive – einen geringeren Druck haben sollten, hinterher so zu „funktionieren“ wie vor der Diagnose. Auch die altersbedingt begrenztere Lebenserwartung könnte unter Umständen Auswirkungen auf Behandlungsentscheidungen und damit auf den Informationsbedarf haben. Eine zweite Ebene, die ich nicht vernachlässigen möchte, ist die Ebene des Geschlechts. Aufgrund unterschiedlicher sozialer Rollen von Frauen und Männern kann ebenfalls ein unterschiedlicher Informationsbedarf bestehen: So stehen vielleicht für einen Familienvater mittleren Alters, der einen größeren Teil des Familieneinkommens erwirtschaftet, andere Fragen im Vordergrund als für die Ehefrau, die zumeist unabhängig von ihrem Beitrag zum Familieneinkommen, den Grossteil der Familien- und Hausarbeit erledigt63. So ist beispielsweise denkbar, dass Männer sich eher um die finanzielle Absicherung der Familie sorgen, Frauen darum, wie die Familie „zu Hause ohne sie klarkommt“. Ein anderer Unterschied besteht in den sozialen Bezügen von Frauen und Männern: Für Männer gestaltet sich nach Hollstein (1999) das Ansprechen von Krankheit und Schwäche sozialisationsbedingt oft schwierig: Es passt nicht zur männlichen Geschlechtsrolle und wird als unmännlich erlebt. Während Frauen in ihren sozialen Beziehungen eher Krankheiten begegnen können als 63 Vgl. Sieverding, 1999, S. 31ff - 65 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Männer64, stellt für Männer oft die Familie, insbesondere die Ehefrau, die einzige Beziehung dar, in der Schwäche thematisiert werden kann65 . Die Diagnose „Krebs“ kann somit für einen Mann und sein Umfeld andere Folgen haben als für eine Frau, die für diese emotionale Belastung mehr Hilfsangebote in Anspruch nehmen kann. Kupfer, Felder & Brähler (1999) beschreiben, dass Jungen und Mädchen geschlechtsspezifisch unterschiedlich wahrgenommen werden und ihre Bezugspersonen unterschiedlich auf ihre Krankheit reagieren. Demzufolge müssen sie ihre Krankheit unterschiedlich verarbeiten. Auch hier liegt ein unterschiedlicher Informationsbedarf nahe. Diese Überlegungen zum Sampling legen es nahe, zumindest sechs Interviews zu führen: je eine Frau und einen Mann in jeder Altersgruppe. Der Kontakt zu den Patientinnen soll über die Ärzte hergestellt werden, die den Patientinnen den Interviewleitfaden (beispielsweise bei der Visite) mindestens einen Tag vor dem Interview hereinreichen, sie über den Kontext der Untersuchung66 informieren und für deren Gesprächsbereitschaft werben. Ist eine Patientin zu einem Gespräch bereit, wird der Kontakt zu mir hergestellt und ein Termin zu einem Interview vereinbart. Ärztinnen Darüber hinaus ist es sinnvoll Interviews mit Ärztinnen zu führen, um abzuklären, wie die Seiten an die Klinik angebunden werden können. Bei diesen Gesprächen soll es weniger um den Informationsbedarf aus der Sicht von Patientinnen gehen, sondern darum, welche Informationen Patientinnen haben sollten, um den Arbeitsalltag der Ärztinnen zu erleichtern. Wie sollten die Seiten gestaltet sein, damit sie auch für die Ärztinnen der Klinik nutzbringend eingesetzt werden können? Welchen Einsatz können sich die Ärztinnen in der Klinik vorstellen? Wie ist das umzusetzen? Wie sollten die Seiten dazu gestaltet sein? Was sollte auf den Seiten diesbezüglich inhaltlich zu finden sein? Da der Oberarzt, der ursprüngliche den Auftrag zur Planung von Informationsseiten für SarkomPatientinnen zusammen mit Prof. Zaumseil gegeben hat, in der Klinik Mitglied einer Arbeitsgruppe von drei Ärzten ist, die selber an der Planung von Sarkom-Seiten arbeitet, liegt es nah, mit diesen Ärzten - wie oben beschrieben - problemzentrierte Interviews nach Witzel (2000) zu führen. 64 Vgl. Schepank, 1999, S. 168 Vgl. Wieck, 1993, S. 231ff 66 Zusammenhang in dem die Untersuchung stattfindet: Die Klinik plant Internetseiten für Sarkompatientinnen; an dieser Planung sollen Patientinnen beteiligt werden; es wird um Mithilfe gebeten. 65 - 66 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Angehörige Zusätzliche separate Gespräche67 mit Angehörigen würden den Rahmen der Diplomarbeit sprengen: Auch hier wäre eine Fallkontrastierung angezeigt, da eine repräsentative Auswahl im Rahmen der Diplomarbeit noch weniger zu leisten wäre als bei den Patientinnen. Allein die Fallkontrastierung würde – selbst bei Vernachlässigung des Geschlechts – mindestens noch vier weitere Interviews erfordern: Eltern von (minderjährigen) Sarkompatientinnen, Lebensgefährtinnen, (minderjährige) Kinder von Sarkompatientinnen und Freundinnen/Bekannte. Ein weiterer Grund, mich gegen Angehörigen-Gespräche zu entscheiden liegt darin, dass der Auftrag in erster Linie auf Patientinnen abzielt und die zu planenden Internetseiten in erster Linie den Patientinnen eine Hilfe sein sollen, den Umgang mit ihrer Krankheit und der Behandlung zu erleichtern. Um andererseits die Perspektive von Angehörigen jedoch nicht ganz außer Acht zu lassen, sondern sie wenigstens ansatzweise mit einzubeziehen, sind Angehörige eingeladen, an den Patientinnen-Gesprächen als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen teilzunehmen. Der Interview-Leitfaden Wie bereits erwähnt, soll der Leitfaden nicht als Fragebogen eingesetzt werden, sondern als Gedächtnisstütze und Einstiegshilfe in das Gespräch: Der Einstieg in das Gespräch ist bei allen Interviews gleich, der weitere Gesprächsverlauf orientiert sich am Gesprächswunsch der Patientinnen. Die Fragen müssen weder insgesamt „abgearbeitet“, noch der Reihenfolge nach „abgehakt“ werden. Es sollen mit dem Leitfaden die drei Bereiche Anbindung, Gestaltung und Inhalt abgedeckt werden. Die Umsetzung des Gesprächseinstieges und der drei Themen in Fragen für die jeweiligen Interviewpartnerinnen verdeutlicht die folgende Übersicht: 67 gemeint sind Gespräche alleine mit Angehörigen ohne Patientinnen. - 67 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Patientinnen und Ärzte Angehörige Einstieg Anbindung Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu einem Gespräch bereit sind. Wie Sie (sicher) wissen, geht es darum, dass die Robert-Rössle-Klinik in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin ein Informationsangebot für Sarkompatientinnen und – Patienten und deren Angehörige erstellen möchte. Dazu ist es wichtig, von Ihnen zu erfahren, was für Informationen Sie sich als Patient/in oder Angehörige/r wünschen. Unser Gespräch würde ich gerne mitschneiden, damit ich mir keine Notizen machen muss und mich ganz auf unser Gespräch konzentrieren kann. Ich habe auch eine Einverständniserklärung vorbereitet, die ich Sie bitten möchte jetzt zu lesen. Dann können wir im Anschluss offene Fragen besprechen oder nach ihrer schriftlichen Einverständniserklärung per Unterschrift mit dem Gespräch beginnen. Sie haben meine Fragen ja bereits vorab bekommen. Insgesamt wird es um folgende Komplexe gehen: Wichtige Informationen für Patientinnen, Patienten und Angehörige; Informationsquellen; Zeitpunkt der Information; Möchten Sie zunächst einmal erzählen, was Sie sich in der Zwischenzeit für Gedanken zum Thema Informationsangebote für Patienten gemacht haben oder ist es Ihnen lieber, dass ich die Fragen nacheinander stelle? - - Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für ein Gespräch Zeit genommen haben. Wir haben uns ja schon einmal getroffen und über das Vorhaben unterhalten, ein Informationssystem für Sarkom-Patientinnen und –Patienten zu erstellen. Ich möchte Ihnen nun noch einmal die Kernfragen stellen, die mich bezüglich der Konzeption des Informationssystems beschäftigen. Es ist mir wichtig, zu betonen, dass es mir bei der Frage nach ihrer Informationspraxis nicht darum geht, Sie zu bewerten. Ich gehe davon aus, dass Sie soweit möglich ihrer Arbeitssituation angemessen und im Sinne der Patientinnen reagieren. Vielmehr geht es mir darum, zu erfahren, welche Informationspraxis sie für ideal halten, um ggf. nach Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen des Informationssystems suchen zu können. Woher haben Sie Ihre Informationen bekommen? Nutzen Sie die Möglichkeit, Informationen aus dem Internet zu beziehen? Über eigenen Zugang, Angehörige, Freunde, Freundinnen, Ärztinnen, Bibliotheken, die Krankenkasse? Hätten Sie Interesse, das Internet (ggf. nach einer Einführung oder zusammen mit anderen) als Informationsquelle zu nutzen? Was könnte Ihnen da helfen? - - Gestaltung - - 68 Welche Informationsquellen haben Sie genutzt? Welche Informationsquellen68 haben Ihnen am meisten geholfen? Was haben Sie daran geschätzt? Was verstehen Sie bei der Betrachtung von z.B. Röntgenbildern oder der Darstellung einer statistischen Erhebung? Wollen Sie mehr verstehen? Was sie für Hilfen bräuchten Sie? Gab es Informationen, die Sie gerne früher oder später bekommen hätten, als es in Ihrer Behandlung der Fall war? Was erhoffen Sie sich von einem Informationssystem für Sarkom-Patientinnen? Welchen Nutzen soll es für Sie und Ihre Arbeit an der Robert-Rössle-Klinik bringen? Würden Sie das Informationssystem in Ihre Arbeit einbeziehen wollen? Wie? Sehen Sie darüber hinaus Einsatzmöglichkeiten für das Informationssystem im Arbeitsalltag der Robert-Rössle-Klinik? Haben Sie Kontakt zu Ärztinnen anderer Kliniken, die bereits mit einem PatientinnenInformationssystem arbeiten? Von welchen Erfolgen und Schwierigkeiten ist Ihnen berichtet worden? Welche Schwierigkeiten könnten sich Ihrer Meinung nach hier in der Robert-RössleKlinik ergeben? Gibt es Patienten-Informationssysteme, die Sie gut finden? Was schätzen Sie an diesen Seiten? Was mögen Sie ggf. nicht? Wie sieht die derzeitige Praxis aus? Wie informieren Sie Patientinnen und Angehörige? Was würden Sie verändern, wenn Sie optimale Bedingungen (z. B. genügend Zeit, Material, umfassendes Interesse d. Pat. oder Angehörigen) vorfänden? Broschüren, Fachartikel, Videos, Radiosendungen, Gespräche mit Patientinnen, Angehörigen, Ärzten - 68 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Patientinnen und Ärzte Angehörige Inhalt - - - Wenn Sie als Patient/in mit vielen Behandlungser- fahrungen Informationen für Sarkom-Patientinnen zusammenstellen sollten, welche Informationen wären das? Was sollten Menschen (unbedingt) wissen, die mit der Diagnose Sarkom zum ersten Mal konfrontiert werden? Welche Informationen brauchen Angehörige Ihrer Meinung nach? Brauchen Patientinnen andere Informationen als Angehörige? (nur falls noch nicht in der vorhergehenden Frage bereits behandelt: Welche Informationen haben Sie sich selbst (ggf. mit Schwierigkeiten) beschafft? Prognose / bad news kommen: Grenzen, Bedenken gegenüber Alles-wissen-wollen? Welche Informationen sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall gegeben werden? Welche Informationen nicht oder nur unter bestimmten Umständen? Haben Patientinnen und Angehörige nach Ihren Erfahrungen einen unterschiedlichen Informationsbedarf? Wo liegen die Unterschiede? Die Auswertung der problemzentrierten Interviews Die auf Tonband aufgezeichneten Gespräche werden verschriftlicht und anschließend wird das Textmaterial ausgewertet. Witzel (2000) fordert – ebenso wie für das problemzentrierte Interview selbst – auch für seine Auswertung Gegenstandsorientierung ein: „Dem Prinzip der Gegenstandsorientierung entsprechend gibt es für unterschiedliche Erkenntnisinteressen und thematischen Bezüge verschiedene Auswertungsmethoden“ (Abs. 19) Globalauswertung Ich entscheide mich für eine Globalauswertung des Textmaterials nach Böhm, wie sie bei Flick (1995, 215ff) beschrieben ist und deren Ziel es ist, „eine Übersicht über das thematische Spektrum des zu interpretierenden Textes zu gewinnen“ (Flick, 1995, 215). Einerseits geht es in der Untersuchung um das Herausfinden von Fakten bezüglich des Informationsbedarfs – welche Wünsche haben Patientinnen an Gestaltung und Inhalt von Informationen und welchen Zugang haben sie zu Informationsquellen – und weniger um interpretationsbedürftige soziale Zusammenhänge. Andererseits wird Deutungsarbeit – wo sie erforderlich wird, um den Bezug des Erzählten zum Informationsbedarf herzustellen – gemeinsam im Gespräch geleistet. Daher kann auf eine interpretierende Auswertungsmethode meines Erachtens verzichtet werden. Vielmehr geht es darum, die genannten „Fakten“ zu sammeln und zu gliedern. Zum Sammeln ist die Globalauswertung die geeignete Methode, zum Gliedern der verschiedenen Anforderungen an die Internetseiten bedarf es einer weiteren Methode. - 69 - 7.2. Planung und Durchführung der Untersuchung - Planung der Untersuchung Qualitative Inhaltsanalyse In Bezug auf die Gliederung der Anforderungen orientiere ich mich an den strukturierenden Elementen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1990, S. 55ff), insbesondere der 1. 2. Zusammenfassung und der Strukturierung. Zur Zusammenfassung der mit der Globalauswertung gesammelten Anforderungen der einzelnen Interviews an das Online-Informationssystem bezüglich Anbindung, Gestaltung und Inhalt werden gleiche Anforderungen unter einer Überschrift (Paraphrasierung) gesammelt, so dass Doppelungen der Anforderungen entfallen. Wird zum Beispiel in einem Interview erzählt, die Informationen sollen kurz und prägnant formuliert sein, in einem anderen Interview wird beispielsweise gefordert, es solle nicht so viel „Drumherum“ geschrieben werden, so würden beide Forderungen zu „Wunsch nach kurzen, prägnanten Informationen“ zusammengefasst. Bezüglich der Strukturierung beschränke ich mich auf eine thematische Strukturierung der Zusammenfassung, da - wie bereits erwähnt - keine Interpretation der Interviews vorgenommen werden soll. Hier werden zuerst einmal die Anforderungen nach den drei Anforderungsbereichen Anbindung, Gestaltung und Inhalt gesammelt. Innerhalb dieser Anforderungsbereiche werden die Anforderungen weiter strukturiert: thematisch Ähnliches wird mit einer Überschrift versehen (Paraphrasierung), so dass man Kategorien erhält. Diese Kategorien werden dann weiter strukturiert, man erhält Unterkategorien und so fort. Die Kategorien und Unterkategorien des Anforderungsbereiches „Inhalt“ sollen schließlich das Gerüst des Online-Informationssystems darstellen, die einzelnen Anforderungen, die in diesen Kategorien gesammelt sind, stellen somit die thematischen Anforderungen an die einzelnen Seiten des Informationssystems dar. Die Anforderungen im Bereich „Gestaltung“ sind als Anweisungen zur gestalterischen Umsetzung zu verstehen, der Bereich „Anbindung“ soll Möglichkeiten aufzeigen, wie das OnlineInformationsangebot den Patientinnen nachhaltig zur Verfügung gestellt werden kann. Evaluation des Online-Konzepts Dieses Gerüst wird dann wieder ins Untersuchungsfeld zurückgetragen und dort mit den Forschungspartnerinnen besprochen. Hier wird untersucht, inwiefern, das Gerüst den Anforderungen den medizinischen Laien, sowie den Medizinerinnen genügt. Auch dieses Gespräch wird als problemzentriertes Interview geführt, wobei das Gerüst der Internetseiten den Leitfaden des Gespräches darstellt. Die Forschungspartnerinnen werden gebeten, ihre Meinung zu der Struktur und den zu entwickelnden Inhalten zu sagen, Inhalte zu benennen, die sie vermissen oder Inhalte, die sie gerne anders dargestellt sähen. - 70 - 7.3. Planung und Durchführung der Untersuchung - Durchführung der Untersuchung Diese Änderungs- und Vervollständigungswünsche werden – ebenso wie die Gespräche mit den Forschungspartnerinnen zuvor – wieder mit einer Globalauswertung erfasst, zusammengefasst und strukturiert. Die so erhaltenen Daten dienen der späteren Überarbeitung (Optimierung) des Online-Konzeptes. 7.3. Durchführung der Untersuchung Da die Aktionsforschung ein spiralförmig verlaufender Forschungsprozess ist, können Ergebnisse und Durchführung nur schwer getrennt voneinander dargestellt werden, vielmehr gilt es, den Forschungsprozess darzustellen, seine Entwicklung und die verschiedenen Zwischenergebnisse, die er hervorbringt. Ein anderes Problem in der Darstellung der Ergebnisse dieses Prozesses ist, dass es in der Regel kein „natürliches“ Endergebnis gibt, sondern das Ende des Prozesses willkürlich gesetzt ist. Um den Rahmen der Diplomarbeit nicht zu sprengen, beschränke ich mich hier darauf, den Prozess der Durchführung darzustellen und Zwischenergebnisse und Erkenntnisse nur dort einzubringen, wo sie für den weiteren Verlauf des Forschungsprozesses von Interesse sind. Während bei einem linearen Forschungsprozess die Untersuchungsdurchführung entlang der Planung vorgestellt wird und am Ende eine Präsentation der Ergebnisse steht, möchte ich mich bei der Vorstellung der Durchführung an den Abweichungen von der Planung orientieren. Die Kontaktaufnahme Die erste Abweichung von der Planung bestand in der Kontaktaufnahme. Während in der Planung der Untersuchung eine „Überweisung“ interessierter Patientinnen zum Interview durch die an der Arbeitsgruppe beteiligten Ärzte vorgesehen war, stellte sich in der Praxis heraus, dass sich eine Kontaktanbahnung durch mich „auf eigene Faust“ für die angestrebte partnerschaftliche Gesprächsatmosphäre als günstiger erwies. Die Erfahrung der ersten Interviews zeigte, dass die Patientinnen recht kurzfristig über das Forschungsvorhaben informiert worden sind. Beispiel: In einem Fall wurde der Gesprächsleitfaden eine Viertelstunde vor dem (mit dem Arzt abgesprochenen) Interviewtermin auf das Bett des abwesenden Patienten gelegt. Meine Annahme, der Patient habe sich zu einem Gespräch bereit erklärt und der Termin sei mit ihm abgesprochen gewesen, stellte sich als falsch heraus. Nachdem ich dieses Missverständnis mit dem Patienten klären konnte, ihm das Forschungsvorhaben erklärt habe, entschied er sich gegen ein Interview. Um sicherzustellen, dass die Patientinnen einerseits freiwillig am Gespräch teilnehmen und andererseits auf das Gespräch vorbereitet sind, habe ich mich ab dem dritten Interview auf zwei Stationen nach Patientinnen erkundigt, ihnen das Anliegen der Untersuchung erläutert, meine Fragen vorgestellt (ihnen versichert, dass es auch nur um diese Themen gehen wird) und einen Termin – zumeist für den nächsten Tag – mit ihnen abgesprochen. - 71 - 7.3. Planung und Durchführung der Untersuchung - Durchführung der Untersuchung Gespräche mit Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches Eine weitere Abweichung stellt die Einbeziehung des nichtmedizinischen Personals dar. Eine Mitarbeiterin der Klinik, die im Patientinnenzimmer anwesend war, als ich meine erste Interviewpartnerin zum Gespräch abholen wollte, hat den Kontakt zu mir aufgenommen: Zum einen war sie interessiert an der Untersuchung, zum anderen wollte sie eine Rückmeldung zu der Kontaktanbahnung zum ersten Interview geben, die sie als unglücklich empfand. In einem ersten Gespräch wurde deutlich, dass Interviews mit den Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich eine zusätzliche interessante Informationsquelle darstellen, da die Patientinnen mit vielen Sorgen und Nöten Hilfe bei ihnen suchen. Auch von anderen Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich wurde dem Anliegen, Internetseiten für Patientinnen zu gestalten, großes Interesse entgegengebracht, so dass ich mich entschied, auch Interviews mit Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches zu führen. Diese Interviews werden zusammen mit den Patientinnen- und Angehörigengesprächen ausgewertet, da sie alle die Position der medizinischen Laien vertreten. Darüber hinaus bereichern die Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich diese Perspektive um die Kenntnisse der Klinik-Strukturen. Die Auswertung Transkription Die ursprünglich zugesicherte Transkription (Verschriftlichung) aller Gespräche konnte aus finanziellen Gründen nicht eingehalten werden. Da es den zeitlichen Rahmen der Diplomarbeit gesprengt hätte, die Interviews selber zu verschriftlichen, entschied ich mich für eine Globalauswertung der Tonaufzeichnungen selbst, anstatt eine Auswertung der verschriftlichten Interviews vorzunehmen. Globalauswertung In dieser Globalauswertung bin ich jedes Interview daraufhin durchgegangen, was den Interviewpartnerinnen in Bezug auf Anbindung, Gestaltung und Inhalt von Informationsseiten für SarkomPatientinnen wichtig ist. Diese Anforderungen an Sarkom-Seiten habe ich chronologisch, das heißt, wie sie im Verlauf des Interviews vorkamen, aufgeschrieben und so für jedes Interview eine Übersicht erstellt. Fragen und Wünsche der Interviewpartnerinnen habe ich meist wörtlich übernommen, Situationsschilderungen sind sinngemäß wiedergegeben. Die so erstellte Anforderungsübersicht war die Grundlage für die weitere qualitative Inhaltsanalyse. Die Inhaltsanalyse wurde nach Abschluss der Patientinneninterviews durchgeführt, die Globalauswertung hingegen wurde direkt nach dem Interview durchgeführt, um Fragen die sich im Nachhinein noch aus dem Gespräch ergaben, in ein anderes Patientinnengespräch einfließen zu lassen. - 72 - 7.3. Planung und Durchführung der Untersuchung - Durchführung der Untersuchung Ein zusätzlicher Auswertungsschritt: Bilden theoretisch hergeleiteter Kategorien Gleich nach Globalauswertung und Zusammenfassung mit der thematischen Strukturierung zu beginnen, erwies sich aufgrund der unterschiedlichen Struktur der Gespräche als nicht praktikabel: Implizit69 bin ich davon ausgegangen, dass die Anforderungen an die Internetseiten in den Gesprächen offen liegen und nur gesammelt und strukturiert werden müssen, dabei habe ich jedoch vernachlässigt, dass diese Anforderungen in einem durch die Patientinnen strukturierten Gespräch in sehr unterschiedlicher Form präsentiert werden. Ich entschied mich dafür, einen Auswertungsschritt vor die Bildung inhaltlicher Kategorien und somit vor die inhaltliche Auswertung zu setzen und zuerst Kategorien zu bilden, die sich einerseits aus meinen Vorüberlegungen zum Leitfaden ergaben, das heißt, die drei Bereiche Inhalt, Gestaltung und Anbindung erfassen und andererseits innerhalb der Bereiche die Form der Äußerung beachteten und die Äußerungen somit vergleichbarer und leichter handhabbar machten. Im Bereich Inhalt konnte ich vier Formen der Äußerung ausmachen: Es wurden 1. 2. 3. 4. 5. Wünsche geäußert Fragen gestellt, Situationen geschildert und Tipps und Lösungsvorschläge für problematische Situationen gegeben Einschätzung, ob Patientinnen und Angehörige dieselbe Information benötigen In Bezug auf Gestaltung wurden zum einen direkt Gestaltungswünsche geäußert, zum anderen wurde von mehr oder weniger hilfreichen Informationsquellen berichtet, die auf positive oder negative Eigenschaften von Informationsquellen verweisen und somit auch Anregungen zur Gestaltung der Seiten geben: 6. 7. Vorlieben bezüglich der Informationsgestaltung Informationsquellen Die Angaben zu Informationsquellen können auch in Bezug auf die Anbindung gelesen werden: Sie geben Hinweise auf die Informationsgewohnheiten von Patientinnen und Angehörigen. Wer wurde angesprochen? Welches Medium wurde genutzt? Welche Internetseiten wurden besucht? Soweit möglich, sollte hier bei der Umsetzung der Internet-Seiten eine Verbindung hergestellt werden: Information von Ärzten, Werbung in Zeitschriften, Links auf anderen Internetseiten. Darüber hinaus wurden zwei weitere Aspekte der Anbindung erfasst: 8. 9. Probleme beim Zugang zu Informationen oder Informationsquellen Erfahrung mit den Auswirkungen von Informationen - 73 - 7.3. Planung und Durchführung der Untersuchung - Durchführung der Untersuchung Die letztgenannte Kategorie entstand aufgrund eines Arztgespräches: Hier bestanden Vorbehalte gegenüber zu vielen Informationen. Diese Kategorie soll Rückschlüsse darauf geben, inwiefern die Information von Patientinnen und Angehörigen den Interessen von Ärzten widersprechen kann und somit eine Umsetzung eines Informationsbedarfes zu Problemen bei der Anbindung an den institutionellen Rahmen der Klinik (zu den Auftraggebern der Seiten gehört auch ein leitender Oberarzt) führen kann. Diese neun Kategorien wurden dann einer thematischen Strukturierung unterzogen. Innerhalb jeder dieser theoretisch hergeleiteten Kategorien wurden thematische Kategorien herausgearbeitet, die die Anforderungen an ein Online-Informationssystem gliedern. Im Anschluss an diese thematische Auswertung wurden alle thematischen Kategorien in eine Struktur gebracht, gewissermaßen wurden neun Folien mit ihren thematischen Kategorien übereinander gelegt und zusammen-gelesen. Diese Struktur stellt dann die Anforderungen an Inhalt, Gestaltung und Anbindung dar und bildet das Gerüst der zu erstellenden Internet-Seiten. Gespräche mit den Patienten Da zum einen die Auswertung, die ich schon parallel zu den Gesprächen angefangen hatte, zeitaufwändiger wurde als geplant, zum anderen Gespräche mit den Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich dazugekommen waren und es zum dritten schwierig war, einen letzten Patienten zu finden, der dem Sampling entsprach70, entschied ich mich zugunsten der Einhaltung meiner Zeitplanung gegen ein weiteres Patientengespräch. Gespräche mit den Ärzten Ich hatte mich während der Planung der Untersuchung entschieden, die Gespräche mit den Ärztinnen nach den Patientinnen-Interviews zu führen, um möglichst wenig medizinisches Wissen und Denken in die Patientinnen-Interviews mitzubringen und unbefangener sein zu können. Nach der Auswertung der Patientinnen-Gespräche teilte mir der leitende Oberarzt der Klinik mit, dass nun auch von ärztlicher Seite ein Internet-Konzept für die Sarkom-Seiten stünde. Ich gehe davon aus, dass dieses Konzept den Vorstellungen der Ärzte in Bezug auf Inhalt und Gestaltung entspricht, so dass sich ein Gespräch über diese Vorstellungen erübrigt. Diese neue Situation bot die Möglichkeit, die Ärztinnen noch einmal anders zu positionieren: Während meine Untersuchungsplanung vorsah, die Interessen der Ärzte zu thematisieren und sie in die Planung der Seiten mit einzubinden, entschied ich mich nun, den Ärzten das die Struktur der von den Patientinnen gewünschten Seiten zu zeigen und zu klären, wie die Patientinnen69 Eine implizite Annahme ist eine Annahme, die nicht ausgesprochen und formuliert wurde, sondern stillschweigend vorausgesetzt – eine explizite Annahme wurde überlegt und offengelegt. - 74 - 7.3. Planung und Durchführung der Untersuchung - Durchführung der Untersuchung Interessen umzusetzen sind. Dabei galt es, das Verhältnis der beiden Internet-Konzepte zueinander zu klären. Dieses Vorgehen bot den zusätzlichen Vorteil, dass nicht ich gegebenenfalls die Integration zweier unterschiedlicher Interessen (Ärztinnen – Patientinnen) leisten musste, sondern diese Auseinandersetzung auch ganz im Sinne der Aktionsforschung bei den Forschungspartnerinnen verblieb – hier indem sich die Medizinern selbst mit den Anforderungen der medizinischen Laien auseinandersetzen sollten. Das Gespräch mit den Ärzten bekam also einen Evaluations-Charakter. Um auch erneut auf den zeitlichen Rahmen der Diplomarbeit Rücksicht zu nehmen, entschied ich mich ein Arztinterview fallen zu lassen und führte nur zwei Gespräche: Ein Gespräch mit dem leitenden Oberarzt, der letzten Endes entscheidet, was im Internet veröffentlicht wird und ein weiteres Gespräch mit dem Assistenzarzt, der die Umsetzung des Ärzte-Konzeptes vorgenommen hatte. Die Evaluation Auch die Evaluation, so wie ich sie geplant hatte, stellte sich leider als nicht praktikabel heraus: Ein Gespräch mit den an der Planung beteiligten Patientinnen scheiterte daran, dass sie großteils nicht aus Berlin kamen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Rhythmen in der Klinik waren. Aus diesem Grund wurde nur mit einer Patientin ein Evaluationsgespräch geführt. Um jedoch die Perspektive von weiteren medizinischen Laien zu einer Evaluation zu nutzen, entschied ich mich, die Seiten im Diplomanden-Colloquium meinen Kommilitoninnen vorzustellen und sie um eine Stellungnahme zu bitten. Des weiteren wurden ein Evaluationsgespräch mit den Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches geführt und die beiden Gespräche mit den Ärzten. Das Patientinnengespräch wurde auf Wunsch der Patientin nicht auf Tonband aufgezeichnet, für das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen stand aufgrund der spontanen Planung kein Tonband zur Verfügung. In beiden Fällen verlasse ich mich auf meine Feldnotizen. Die anderen Evaluationsgespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet und wie geplant ausgewertet. 70 Es wäre noch ein Gespräch mit einem minderjährigen Patienten vorgesehen gewesen. - 75 - 8.1. Die Ergebnisse der Untersuchung - Das Konzept 8. Die Ergebnisse der Untersuchung Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt, werden in einem zirkulären Forschungsprozess eine Reihe von Ergebnissen entwickelt und – wie im Kapitel zur mediendidaktischen Konzeption beschrieben – kann auch kein fertiges Ergebnis erwartet werden, da es sich um einen fortschreitenden Optimierungsprozess handelt. Die Darstellung von Ergebnissen ist in diesem Fall also immer mit Willkür verbunden. Zwei Ergebnisse, die gewissermaßen eine Zusammenfassung des Forschungsvorhabens darstellen, möchte ich vorstellen: Zum einen das Konzept, das aufgrund der Interviews mit den Patientinnen, Angehörigen und dem Fachpersonal aus dem psychosozialen Bereich erstellt wurde, zum anderen die Vorschläge zur Optimierung der Internet-Seiten, die aus den Evaluationsgesprächen stammen. 8.1. Das Konzept An dieser Stelle möchte ich besonders die Gedanken zu den Möglichkeiten der Umsetzung (Anbindung) und Gedanken zur Gestaltung wiedergeben, soweit sie nicht aus der Papierversion des Online-Konzeptes ersichtlich sind. Dieses Konzept befindet sich im Anhang D (S. 109) der Diplomarbeit. Auf die Darstellung der Inhalte und der Benutzerinnenführung verzichte ich an dieser Stelle, da auch sie im Anhang der Diplomarbeit anzusehen sind. Gestaltung des Internet-Konzeptes Drei Aspekte der Gestaltung möchte ich ansprechen: 1. 2. 3. die Informationsmenge, die Zielgruppe und die mediale Gestaltung Informationsmenge Bezüglich der Informationsmenge zeichnet sich ein uneinheitliches Bild ab: Zum einen wird eine kurze knappe Information gewünscht, die auf weitergehende Informationen verweist (Portal) (03p-6f), zum anderen wird geäußert, alles finden zu wollen, was mit der Krankheit zu tun hat (02p-5) – zu wenig Information könne es nicht geben (03p-9) und die Patientinnen sollen selbst die Auswahl vornehmen (07n-4). Im Hinblick auf die Informationsauswahl zeichnet sich ab, dass Patientinnen und Angehörige in Bezug auf die Krankheit dieselben Informationen fordern71 (01pa-4, 02p-10, 03p-5, 05pa-1272, 71 „Gleiche Informationen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es abgelehnt wird, Patientinnen und Angehörige mit unterschiedlichen Informationen (innerhalb eines Themas) zu versorgen, zum Beispiel mit einer „entschärften“ Version einer Krankheitsbeschreibung für eine der beiden Gruppen. Über eventuelle Unterschiede im Informationsbedarf bezüglich der Themen oder Schwerpunkte (beispielsweise ein unterschiedlicher Bedarf von Eltern und erkrankten Kindern) kann hier keine Aussage getroffen werden. 72 Informationen zurückbehalten zu haben, wird als Fehler erlebt: Am besten man weiß alles vorher und direkt und nichts wird zurückbehalten. ‚Schonen’ ist nur Aufschub des Schocks. Derjenige, der etwas zurückbehält, ist damit - 76 - 8.1. Die Ergebnisse der Untersuchung - Das Konzept 06p-9f: in abgeschwächter Form – Freundinnen und Familienangehörige sollen alles wissen73, die Information wird jedoch zum Teil auf die Gesprächspartnerinnen abgestimmt formuliert). Darüber hinaus wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Angehörige zusätzlicher Stützung und Angebote bedürfen (02p-3f, 04n-4, 07n-6). Den Zwiespalt, ob Patientinnen auch über schlechte Prognosen informiert werden sollten oder nicht, teilen die Patientinnen selber nicht, vielmehr fordern sie diese Information (02p-10f, 03p-5, 05pa-12, 06p-1) – je früher desto besser (02p-5f, 05pa-12). Eine Patientin nennt einen Grund: So kann sie sich darauf – auch auf Unangenehmes - einstellen (01pa-8). Lediglich Fehlinformationen werden von einer Patientin ausdrücklich abgelehnt (06p-5). Weniger die Befürchtung, zu viele Informationen zu bekommen, wird genannt als vielmehr die Angst, dass Informationen „verschwiegen“ oder „zurückbehalten“ werden, insbesondere im Zusammenhang mit ärztlichen Netzwerken, bei denen die Gefahr bestehe, Informationen seien nicht mehr unabhängig, sondern durch ärztliche/institutionelle Interessen beeinflusst (03p-4, 05pa-2). Zielgruppe In Bezug auf die Zielgruppe, wurde das Verhältnis Informationen von Angehörigen/medizinischen Laien – Informationen für Patientinnen bereits kurz angerissen. Genauere Anforderungen an Informationen für verschiedene Gruppen für Angehörige kann diese Untersuchung jedoch nicht bieten. Als soziale Bezugspersonen, die Unterstützung brauchen, wurden Eltern, Lebensgefährtinnen, Kinder, weitere Verwandte, Bekannte und Freundinnen genannt. Ihren Bedarf unabhängig von den Patientinnen zu untersuchen wäre die Aufgabe einer weiteren Unersuchung. Ein weiterer unterschiedlicher Bedarf für Patientinnen verschiedener Altersgruppen wurde von einer Mitarbeiterin aus dem psychosozialen Bereich formuliert (04n-7ff): „Um die 40“ beschäftige die Patientinnen, wie es mit der Arbeit weitergehe, Rahmenbedingungen spielten eine größere Rolle, Lebensveränderungen würden angestrebt. Ältere Patientinnen fielen nach der Behandlung eher in ein Loch, sie hätten oft keine Perspektive ("Jetzt ist das wohl das Ende"). Um einen unterschiedlichen Bedarf verschiedener Altersgruppen anhand dieser Untersuchung herauszuarbeiten, hätte es mehr Gespräche mit Patientinnen verschiedener Altersgruppen bedurft. Vermutlich hätte eine größere Stichprobe auch größere Unterschiede zwischen den Patientinnengruppen zu Tage gefördert. In diesem Stadium der Untersuchung Schlussfolgerungen anzustellen, halte ich für verfrüht. Die Unterschiede, die ich für die Gruppen benennen würde, könnten ebenso gut auf andere Variablen zurückzuführen sein: Anwesenheit von Angehörigen während des Interviews, unterschiedliche Lebenssituationen innerhalb der Gruppen (alleinerziehende Mutter aus Ostbelastet. Wenn der Andere das dann durch Zufall erfährt, ist das auch wieder nicht richtig - also man sollte keine Information zurückbehalten: Offenheit und Ehrlichkeit.“(05a-12, Transkript für die Globalauswertung) - 77 - 8.1. Die Ergebnisse der Untersuchung - Das Konzept deutschland – Familie mit erkranktem Vater und erkrankter Tochter aus Westdeutschland; erwerbstätiger Familienvater von zwei Kindern – ledige Frau in der Ausbildung; Schülerin – alleine in ihrer Altersgruppe). Die Ermittlung eines spezifischen Informationsbedarfs von verschiedenen Patientinnengruppen (Patientinnen verschiedenen Alters, verschiedenen Geschlechts, verschiedenen Bildungsgrades, verschiedener Herkunft, verschiedener Sarkom-Erkrankungen, verschiedener Krankheitsstadien, etc.) wäre eine Aufgabe einer neuen, größer angelegten Untersuchung. Mit dieser Untersuchung wurde das wesentliche, gemeinsame Informationsbedürfnis möglichst verschiedener Personen erfasst. Mediale Gestaltung Die mediale Gestaltung scheint mit der Wahl einer Kombination aus Broschüre und Internetangebot gut getroffen. Patientinnen äußern vermehrt Interesse an schriftlichem Material, das so aufbereitet ist, dass es stückchenweise gelesen werden kann, je nachdem wie die Informationen aufgenommen und verarbeitet werden können (01pa-10, 02p-5, 03p-6, 06p-14). Großer Wert wird auch auf Schilderungen von anderen Patientinnen gelegt (01pa-10, 02p-12, 03p-9, 04n-2, 06p-14): Wie haben sie das gemacht? Erfahrungsberichte und Kontaktmöglichkeiten sind ausdrücklich gewünscht. Bildmaterial wird weniger erwähnt, zum Teil für das Internet wegen längerer Ladezeiten vom Heimcomputer aus skeptisch gesehen (03p-6). Hier sollte auf jeden Fall beachtet werden, dass die Patientinnen gegebenenfalls keine modernen Rechner und keine schnelle Internetverbindung (ISDN, DSL, etc.) haben, sondern eventuell eine Analogleitung und ein Modem mit geringer Übertragungsleistung nutzen. Wichtig erscheint mir, hier darauf hinzuweisen, dass ein Internet-Angebot alleine wenig Sinn zu machen scheint - alle Patientinnen sahen diesbezüglich Probleme: Die Internetnutzerinnen sahen Probleme bei langen Online-Zeiten (03p-7) und Schwierigkeiten alle Informationen an einem Stück aufzunehmen (s.o.) und zu durchsurfen sowie Probleme, die Informationen wiederzufinden (03p-7). Die Patientinnen ohne direkten Internetzugang kritisierten, dass sie diese Informationen nur schwer bekämen (s.o.). Da aber alle Patientinnen unter anderem mit Informationen aus dem Internet versorgt wurden, sind Broschüren, die aus dem Internet heruntergeladen und gegebenenfalls an geeigneten Orten ausgelegt werden, eine gute Möglichkeit, die Patientinnen trotz der Anbindungsprobleme zu erreichen. 73 „Das haben wir uns immer geschworen - egal was ist, wir werden uns alles sagen“ (06p-10) - 78 - 8.1. Die Ergebnisse der Untersuchung - Das Konzept Anbindung der Internet-Seiten Die Anbindung der Seiten lässt sich auf drei Ebenen beschreiben: 1. 2. 3. Personelle/institutionelle Ebene, örtliche Ebene und technische Ebene Personelle/institutionelle Ebene Eine institutionelle und personelle Anbindung hat zwei Aspekte: Einerseits ist zu beachten, wer die Internet-Seiten pflegt, andererseits ist zu beachten, wer sie „an die Frau bringt“, also den Kontakt zu den Patientinnen und Angehörigen herstellt. Bezüglich der Pflege der Seite wird wenig gesagt. Soweit es sich um Kontakte zu Patientinnen der Klinik geht, sehen sich die Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich für das Beantworten von Nachfragen zuständig. Einem erhöhten Aufwand, der aus vielen weiteren Anfragen resultieren könnte, sehen sie sich nicht gewachsen. In solchen Fällen sollte über eine weitere Stelle nachgedacht werden (07n-9) 74. Der Kontakt zu den Patientinnen scheint hingegen gut abgesichert: die Mitarbeiterinnen sowie die Ärzte, die dies in den Evaluationsgesprächen äußerten, können sich vorstellen, die InternetSeiten aktiv in ihre Arbeit einzubinden (Nutzung zur eigenen Informationssuche (07n-9), Weiterempfehlen an Patientinnen (08a-2, 07n-9) , Nutzung als Merkblatt für Patientinnen (07n-8, 08m2)). Diese Einbindung wird auch von einem Patienten gewünscht: Er möchte von seiner Ärztin die Information bekommen, wo er etwas nachlesen kann (03p-1). Eine weitere Anbindung sollte über andere Organisationen und ihr Internetangebot stattfinden, die auf die Sarkom-Seiten verweisen könnten (03p-2), eine Anbindung an das PIA-Projekt75 wäre denkbar (Internet-Kurse für Patientinnen (02p-5, 07n-8)). Örtliche Anbindung Eine örtliche Anbindung könnte über den Computer in der Patientinnen-Bibliothek der Klinik realisiert werden(07n-8). Technische Anbindung Die technischen Aspekte der Anbindung werfen Probleme auf: Zum einen müssen die Patientinnen Zugang zu einem Computer mit Internetzugang haben und zum anderen müssen sie in der Lage sein, dieses Angebot auch wahrzunehmen. In den Gesprächen mit Patientinnen berichtet lediglich ein Patient von guten Erfahrungen mit der Informationssuche im Internet: Er hat selbst intensiv im Internet nach Informationen gesucht und 74 zur Zitierweise der Gespräche siehe Anhang A, Zitierweise der Interviews. PIA steht für „Patienten informiert und aktiv“ – im Rahmen dieses Projektes werden unter anderem Informationsveranstaltungen für Patientinnen angeboten oder ein Internetcafé. 75 - 79 - 8.2. Die Ergebnisse der Untersuchung - Die Evaluation ist fündig geworden (03p-2). Zwar beziehen auch andere Patientinnen Informationen aus dem Internet, jedoch gestaltet sich der Zugang zu den Informationen hier in zweierlei Hinsicht schwierig: Zum einen wird das Internet als unbefriedigend erlebt, weil die gewünschten Informationen nicht gefunden wurden (01pa-2), zum anderen wird berichtet, dass ein Internetzugang nur über Angehörige, bzw. Bekannte gegeben ist und dort auch nicht selbst genutzt wird: Patientinnen bekommen Informationen (05pa-6, 02p-11) oder bitten Andere zu suchen (01pa-2) und fühlen sich zum Teil zu schwach, selbst zu suchen (02p-4, 05pa-9). Es ist folglich sinnvoll, verstärkt Angehörige und Freundinnen im Online-Angebot anzusprechen, zumal erwähnt wird, dass dies auch oft ein guter Zugang zu den Patientinnen sei, da Zettel, die an Pinnwänden hängen oder vom Klinik-Personal hereingereicht werden, oft nicht wahrgenommen werden (04n-5). 8.2. Die Evaluation Die Ergebnisse der Evaluation brachten zum einen Änderungswünsche hervor, zum anderen bestimmten sie die Möglichkeiten und Probleme der Anbindung des Online-Konzeptes sowie seinen Rahmen genauer. Änderungswünsche Die Änderungswünsche lassen sich grob in drei Kategorien teilen: 1. 2. 3. Änderungswürdiges Fehlendes Unerwünschtes Unklarheit bestand in Bezug auf die Informationsfülle: Die Frage, ob generell zu viel Informationen gegeben werden (09s-1f) oder ob die Informationsmenge angebracht ist (ebd.), kann nicht beantwortet werden – sowohl beide Meinungen als auch die Auffassung dies nicht entscheiden zu können (09s-4), wurde geäußert. Ich halte es für sinnvoll, mich diesbezüglich an die Meinung eines Patienten zu halten, dass es „in diesem Bereich kein Überangebot an Informationen geben“ (03p-9) kann und hoffe, dass die oft geäußerte Übersichtlichkeit des Informationssystems (09s2ff) den Nutzerinnen die Möglichkeit gibt, Informationen gezielt auszuwählen und die Informationsmenge so zu bewältigen. Um dies zu unterstützen, halte ich den Vorschlag, den eigentlichen Inhalten Zusammenfassungen voranzustellen für sinnvoll (09s-2). Änderungswürdiges Als änderungswürdig wurde zum einen die Darstellung des Themas Tod und Sterben diskutiert. Hier verwirrte zum einen das mehrmalige Auftauchen des Themas an verschiedenen Stellen (09s5, 09s-7) zum anderen erschreckte die Härte des Themas, die auch Angst erzeugen kann, anstatt Angst zu nehmen (09s-2). Hier wurde von ärztlicher Seite vorgeschlagen, das Leben in den Vordergrund zu rücken und eine Perspektive zu wählen, die deutlich macht, dass Leben in jeder Le- 80 - 8.2. Die Ergebnisse der Untersuchung - Die Evaluation bensphase lebenswert ist (10m-4). Auf die Behandlung bezogen bedeutet dies, dass es Phasen der Behandlung gibt, in denen die Symptomkontrolle im Vordergrund steht. In diesem Rahmen wäre auch eine Nennung von Palliativstationen76 und Hospizen und Patientenverfügung möglich. Aufzuzeigen, woran Patientinnen sterben und woher die Schmerzen kommen, wurde abgelehnt (ebd.). Dieser Position stand eine andere gegenüber, die auch die Möglichkeit vertrat, Patientinnen genau darüber zu informieren, wenn es von Patientinnenseite gewünscht wird. Hierzu gäbe es auch entsprechendes Bildmaterial (08m-7). Auch von Seiten des Personals aus dem psychosozialen Bereich gab es hierzu unterschiedliche Positionen: Während Einigkeit darüber bestand, eine Perspektive zu wählen, die die Angst nimmt und Möglichkeiten aufzeigt (Palliativmedizin, Hospize, Patientenverfügung) (07n-8), bestand Uneinigkeit bei der Frage, ob Statistiken, die unter Umständen eine schlechte Überlebenschance aufzeigen, in den Internetseiten veröffentlicht werden sollten (04n-2, 07n-4). Einerseits wurde die Position vertreten, Patientinnen sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Lebenserwartung besser einzuschätzen, um auch weitere Lebens- und Behandlungsziele besser planen zu können (07n-4), andererseits wurde Skepsis gegenüber den Statistiken geäußert (ebd., 04n-2): Sie seien zu allgemein, Patientinnen würden sie nicht richtig einschätzen können, so dass sie für Patientinnen wertlos wäre. Informationen über eine Überlebensdauer sollten nur individuell gegeben werden, wenn der Tod bevorstehe und noch letzte Dinge geregelt werden sollen (07n-4). Auch das Internet wurde als „totes Medium“ angezweifelt, um Sterben und Tod zu thematisieren: Die Patientinnen säßen alleine vor dem Computer, ihre Reaktion könne nicht abgefangen werden (10m-4). Die geäußerten Bedenken gegenüber Statistiken gelten generell – auch für Statistiken bezüglich Erfolgserwartungen von Behandlungen. Weiterhin wurden die Begriffe „Erfahrungen“ und „Behandlungsteam“ als änderungswürdig empfunden, da sie die folgenden Inhalte nicht treffend abbilden (09s-5, 09s-8). Der Begriff „Behandlungsteam“ und die Darstellung von Ärztinnen als Dienstleisterinnen, von denen Informationen bezogen werden können, wurden darüber hinaus abgelehnt, da sie Patientinnen auf eine aktive Rolle verpflichten, die sie eventuell nicht einnehmen wollen oder können (09s-1, 09s-8). Es ist eine Perspektive vorzuziehen, die ihnen die Wahl lässt, ob und wie sie die Behandlung mitgestalten (09s-6). Fehlendes Als fehlend wurden Erfahrungen von Angehörigen benannt (09s-2), fehlende Begriffe sind „gutartig“, „bösartig“, „Tumor“, „Krebs“ und „Metastasen“ (09s-3), Themen die noch zu behandeln wären, sind „Wie verändert die Erkrankung die Schullaufbahn und die Ausbildung?“ (09s-6), 76 Palliativmedizin widmet sich der Kontrolle von Symptomen, wie z. B. Schmerzen, Übelkeit, etc. - 81 - 8.2. Die Ergebnisse der Untersuchung - Die Evaluation „Sarkome bei Kindern und Jugendlichen“ (08m-11), „Wo werden welche Behandlungen angeboten?“ (09s-7) und „Wie werden welche Leistungen abgerechnet?“ (09s-5). Bei den Erfahrungen wurden klarere Handlungsanweisungen einerseits vermisst (09s-5), andererseits wurde erwähnt, dass es beispielsweise zum Umgang mit der Angst keine Patentrezepte geben könne (ebd.). Auch bei den unter „Erfahrungen“ beschriebenen Gefühlen wurden Ergänzungen vorgeschlagen: Selbstmitleid und Selbstvorwürfe (09s-7), Ängste vor der Behandlung, vor der Operation und vor Schmerzen sowie Überforderung durch Mitpatientinnen (09s-6). Technische Ergänzungen sind - die Volltextsuche77(09s-7), Hinweise, wie Patientinnen Beiträge schreiben können, die auf den Seiten erscheinen (ebd.), das Erstellen einer Druckversion der einzelnen Abschnitte (09s-5) und ein Hinweis, wann Patientinnen-Anfragen beantwortet werden (09s-1). Unerwünschtes Unerwünscht war bei den Ärzten generell die Darstellung spezieller OP-Techniken bis ins Detail (08m-3, 10m-3). Die Einstellung zu Statistiken war – wie bereits erwähnt – gespalten. Ebenso wie die Einstellung zu Fachzeitschriften, bei denen angenommen wird, Patientinnen würden sie nicht verstehen (08m-3, 10m-1). Auch zur Darstellung von Erfahrungsberichten gibt es zwei verschiedene Positionen: Zum einen wird vertreten, dass sie nicht auf die Seite selbst gehören, sondern auf Patientinnen-Homepages (08m-14). Zum anderen werden Erfahrungsberichte jedoch als unverzichtbar und als für die Patientinnen interessant angesehen (09s-2, 10m-5). Aus dieser Perspektive werden auch die fehlenden Erfahrungsberichte von Angehörigen bemängelt (09s-2). Auch der Gedanke des Leitfadens (siehe Anhang D, S. 109) stößt auf unterschiedliches Echo – zum einen wird er als zu profan empfunden (08m-14f), besonders, wenn es um Checklisten geht, die aufzeigen, was Patientinnen mit ins Krankenhaus nehmen sollen, zum anderen wird er als anspruchsvolle Aufgabe gesehen, die erfordert, die Vielschichtigkeit der Situation von Patientinnen abzudecken, wobei es als positiv bewertet wird, wenn diese Aufgabe gelingt (10m-2). Anbindung des Online-Konzeptes Die Ärzte wollen mit den Internet-Seiten zum einen eine medizinische Fachöffentlichkeit und zum anderen medizinische Laien ansprechen (08m-1f). Ihr Ziel besteht darin, sich in der Außendarstellung als Kompetenzzentrum zu präsentieren und die Zielgruppen mit medizinischen FachInformationen zu versorgen(ebd.). Dazu schwebt ihnen ein Internetkonzept vor, das in drei Bereiche geteilt ist (08m-3, 08m-6, 10m-1): einen Ärztinnen-Bereich (hier wird ein Passwortschutz angedacht), einen Patientinnen-Bereich (frei zugänglich) und einen gemeinsamen Bereich (frei - 82 - 8.2. Die Ergebnisse der Untersuchung - Die Evaluation zugänglich). Während der Ärztinnenbereich und der gemeinsame Bereich von einem Arzt als eher „theoretische Bereiche“ angesehen werden, stellt für ihn der Patientinnenbereich einen „praktischen Bereich“ dar78. Das in dieser Arbeit entwickelte Online-Informationssystem wurde von den Ärzten im Evaluationsgespräch in ein solches Gesamtkonzept eingegliedert. Dabei wurden die Bereiche Untersuchung, Sarkome, Behandlung, Vorbeugung, Anlaufstellen, Fachbegriffe, Downloads, Kontakte und Links dem gemeinsamen Bereich des Gesamtkonzeptes zugeordnet. Dieser Bereich wird durch die Seiten, die die Ärzte konzipiert und im Internet veröffentlicht haben, als abgedeckt angesehen (10m-1). 77 Ein Internet-Formular dass es ermöglicht innerhalb bestimmter Internet-Seiten nach einem Wort oder einer Wortkombination zu suchen. 78 Diese Konstruktion von „theoretisch“ und „praktisch“ interpretiere ich als im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Informationen für Patientinnen zu verstehen. Während die Patientinnenseiten so gesehen unter der Überschrift „Das können sie machen“ oder „So können/sollen sie sich verhalten“ stehen, steht der gemeinsame Bereich (und der Ärztinnenbereich) unter der Überschrift „Zu ihrer Information“ oder „Was sie wissen sollten“. Diese gedankliche Konstruktion erinnert an die Aufklärungspraxis, die als „informed consent“ bezeichnet wird: Der Patientin werden (ausgewählte) Informationen (Passwortschutz) gegeben, die ihre Einsicht in die Behandlung und die Bereitschaft die Behandlung mit zu tragen fördern (s. Kapitel 4, Patientinnen-Information). - 83 - 8.3. Die Ergebnisse der Untersuchung - Wichtige Produktions-Faktoren des Online-Informationssystems Unterschiedliche Ansprüche79 von Medizinerinnen und medizinischen Laien an die Inhalte und eine unterschiedliche Wortwahl von Medizinerinnen und medizinischen Laien, die zwei gesonderte Versionen der Inhalte erforderlich machen könnten, werden in den Evaluationsgesprächen nicht angesprochen. Die Bereiche Leitfaden, Erfahrungen und Behandlungsteam werden dem Patientinnenbereich zugeordnet, sie sind im Internet-Konzept der Ärzte nicht vertreten und können von ihnen nach Einschätzung eines Arztes auch nicht geleistet werden (10m-8). Die Rubrik Informationen wird von den Ärzten je nach Wissenschaftlichkeit der Inhalte auf den Ärztinnen- und den Patientinnen-Bereich verteilt80. Die Umsetzung und langfristige personelle Betreuung des Internet-Auftrittes gestaltet sich schwierig: Es mangelt an „Manpower“. Ärztinnen haben keine Kapazitäten für die Pflege der Seiten (08m-8, 10m-7, 07n-9). Auf lange Sicht sollte die Pflege der Seiten nach der Meinung eines Arztes Bestandteil einer ärztlichen Stellenausschreibung werden. Weiterhin wurde zum einen ein interdisziplinäres Team, das aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und einer Patientinnenvertreterin81 besteht, für die Pflege des gesamten Internetauftrittes angedacht (10m9), zum anderen wurde überlegt, die Betreuung der „Patienten-Ecke“ durch Patientinnen selbst organisieren zu lassen (08m-14). 8.3. Wichtige Produktions-Faktoren des Online-Informationssystems Im Folgenden werde ich noch einmal die Ergebnisse der Untersuchung, so wie sie für die Konzeption und Umsetzung des Online-Informationssystems von Bedeutung sind, stichwortartig zusammentragen. Diese Aufstellung hat zwei Funktionen: Zum einen dient sie als „Checkliste“, anhand der die Internetseiten überprüft werden können, ob sie den Ansprüchen, die geäußert wurden genügen. Zum anderen bietet sie die Anknüpfungspunkte einer weiteren Optimierung: Entspricht diese „Checkliste“ noch den Gegebenheiten oder hat sich die Situation geändert, für die die Seiten entwickelt wurden? Denkbar sind Änderungen der Ziele, Erweiterung der Zielgrupp, die angesprochen werden soll, Änderung in den Bedürfnissen der Zielgruppe, Wünsche nach dem Einsatz neuer oder neu entwickelter Medien. 79 beispielsweise an die Genauigkeit der Information oder an eine fachgerechte Beschreibung Fachliteratur soll im Ärztinnenbereich zu finden sein (08m-5f), Selbsthilfe-Literatur im Patientinnenbereich (10m-2). 81 Aus welchem Fachbereich sie stammen könnte blieb unklar – Physiotherapeutin, Sozialarbeiterin oder Psychologin. 80 - 84 - 8.3. Die Ergebnisse der Untersuchung - Wichtige Produktions-Faktoren des Online-Informationssystems Analyse des Bildungsproblems und der Vorgaben - Auftrag: Erstellung eines Online-Informationssystems für Sarkom-Patientinnen und deren Angehörige mögliche einzubeziehende Projektteilnehmerinnen: Patientinnen, ihre Verwandten und Bekannte, Ärztinnen, Pflegepersonal, Mitarbeiterinnen aus der psychosozialen Versorgung, Mitarbeiterinnen aus dem seelsorgerischen Bereich. Klärung der Funktion der didaktischen Medien - Vermittlung von Wissen „rund um“ die Sarkom-Erkrankung und –Behandlung im weitesten Sinne (Untersuchung, Erkrankung, Behandlung, Rückfallvorbeugung, deren Folgen und der Umgang damit) Hilfestellung zur weiteren individualisierten82 Informationsbeschaffung (Checklisten, Hinweise, Anlaufstellen) Hilfestellung für persönliche Gespräche (Foren als Kontaktmöglichkeiten, Vermittlung von Email-Adressen, Anschriften, Telephonnummern, IRC83, Newsgroups84) Eigeninteresse an Informationen und Kontakt kann bei der Zielgruppe vorausgesetzt werden, so dass sie dahingehend nicht motiviert werden müssen, die Gestaltung sollte jedoch Schwellenängste abbauen und den Zielgruppen so ermöglichen ihrem Kontaktbedürfnis nachzukommen (Wunsch nach Nutzerinnenbeteiligung deutlich äußern). Zielgruppenanalyse - - Nutzerinnen sind in allen Bildungs- und sozialen Schichten, Altersstufen zu finden, sie sind beiderlei Geschlechts. Das Vorwissen, Lerngewohnheiten und Lerndauer sind aufgrund der breit angelegten Zielgruppe(n) sehr unterschiedlich – als Minimalvoraussetzungen sollten gelten: spezielles Vorwissen kann nicht vorausgesetzt werden, Unterstützung bei der Verarbeitung der Informationen sollte gegeben werden, eine Einteilung in möglichst kleine Informationseinheiten sollte angestrebt werden (herabgesetzte Konzentration bei den Patientinnen herabgesetzte Lerndauer) eine Intrinsische Motivation kann aufgrund eigener Betroffenheit (entweder direkt als Patientin oder indirekt aufgrund von Patientinnenkontakt) angenommen werden. als Lernort und Medienzugang sollte der eigene Heimcomputer angesehen werden (oder der von Verwandten und Bekannten), daher ist auf möglichst geringe Online-Kosten zu achten (schneller Seitenaufbau, Downloadmöglichkeiten, Druckmöglichkeiten) Bestimmung der Lehrziele - - Das Informationssystem soll die Nutzerinnen informieren und so gestaltet sein, dass diese Informationen von den Nutzerinnen nachvollzogen und erinnert werden können (Grundverständnis der eigenen Krankheit und ihrer Behandlungsmöglichkeiten im weitesten Sinne), es soll ihnen ermöglichen, weiteres – speziell für ihre Situation wichtiges – Wissen zu sammeln und aufzubauen (Ärztinnen gezielt nach für sie wichtigen Informationen fragen) sowie Informationen, die die Nutzerinnen von anderen beziehen in ihr vorhandenes Wissen einzugliedern (Mitteilungen von Ärztinnen einordnen) Eigenverantwortliche Lebens- und Behandlungsentscheidungen der Patientinnen sollen durch das Informationssystem unterstützt werden – die Entscheidungsfreiheit der Patientinnen beinhaltet jedoch auch die Entscheidung, Verantwortung abzugeben (Behandlungsentscheidungen können auch weiterhin auf die Ärztin übertragen werden). Bestimmung der Lehrinhalte - - Die Bestimmung der Lehrinhalte enthält Komponenten der Tätigkeits- und Aufgabenanalyse sowie der Sammlung relevanter Informationen: In Gesprächen mit Patientinnen und Angehörigen wurden Handlungen erörtert (Tätigkeitsanalyse) Probleme sowie deren Bewältigung besprochen (Aufgabenanalyse) die entsprechenden Informationen, die dazu benötigt wurden gesammelt und gegliedert (Sammlung und Gliederung) Weitere Informationen stammen aus den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich sowie mit den Ärzten (Sammlung und Gliederung) eine genaue Beschreibung der Lehrinhalte ist im Anhang der Diplomarbeit zu finden (Konzept der InternetSeiten). 82 das heißt, auf die jeweilige Situation der Nutzerin abgestimmt Internet Relay Chat, „Internetkonferenz“; Möglichkeit, mit verschiedenen Nutzerinnen zeitgleich über das Internet Gespräche zu führen 84 ähnlich wie IRC, Gespräche finden jedoch nicht zeitgleich statt, sondern zeitversetzt per Email. 83 - 85 - 8.3. Die Ergebnisse der Untersuchung - Wichtige Produktions-Faktoren des Online-Informationssystems Bestimmung der Form des Lernangebotes - - - Aufgrund der sehr unterschiedlichen Anforderungen durch die Nutzerinnen bietet sich ein logisch strukturiertes Angebot an, das es den Nutzerinnen ermöglicht, für sie interessante Informationen gezielt zu suchen. (Ein sequentieller Wissensaufbau scheint aufgrund verschiedener Stadien, verschiedener Erkrankungen, verschiedener Behandlungen trotz gleicher Erkrankungen nur schwer umsetzbar. Die Leistung, Informationen auf die jeweilige Krankheitsgeschichte „zuzuschneiden“ sollte von der Patientin selbst geleistet werden.) Neben einer klaren und übersichtlichen thematischen Gliederung sind Hilfestellungen zu geben, die der Nutzerin das Zurechtfinden in den Internet-Seiten erleichtern (Hervorhebung der Bereiche und Überschriften, unter denen die jeweils abgerufenen Information zu finden ist, Verweise auf „benachbarte“ Themen. Zusammenfassungen zu Beginn von Informationseinheiten, sowie deren grafische Darstellung Klärung des Mediums und der Anbindung des Angebotes an die Auftraggeberin und die Zielgruppe - - - Hauptmedium ist das Internet, Schwerpunkt sollte auf Textmaterial liegen, bei Ton- und Bildmaterial sollte auf niedrige Ladezeiten geachtet werden. Darüber hinaus sollten die Internetseiten auch in Form einer oder mehrerer Broschüren einerseits zum herunterladen aus dem Internet, andererseits zur Auslage an verschiedenen Orten in der Klinik (Auf Station, in der Ambulanz, in Sprech- und Wartezimmern, usw.) und andernorts (z. B. Beratungsstellen) zur Verfügung stehen Anbindung sollte über das Umfeld der Patientinnen erfolgen: Verwandte und Bekannte, Ärztinnen, Pflegepersonal, Mitarbeiterinnen aus der psychosozialen Versorgung, Mitarbeiterinnen aus dem seelsorgerischen Bereich. Zur Betreuung der Seiten ist die Einrichtung einer Stelle anzudenken, bzw. die Pflege der Internetseiten sollte Teil einer Stellenbeschreibung werden. Denkbar ist auch eine Anbindung an eine noch zu gründende interdisziplinäre Arbeitsgruppe Umsetzung und Kontrolle der Konzeption - Umsetzung und Evaluation sollten – wie auch die Konzeption – in einem Aktionsforschungsprojekt geschehen. - 86 - 9.1. Diskussion und Ausblick - Aufklärung über die Krankheit: Ja! - Aufklärung über die Aufklärung: Nein? 9. Diskussion und Ausblick Da der theoretische Rahmen dieser Diplomarbeit recht weit gesteckt ist, möchte ich mich mit der Diskussion der Ergebnisse innerhalb dieses Rahmens auf einige ausgewählte Aspekte beschränken, die auch bei der Durchführung der Untersuchung und der Konzeption der Internetseiten Fragen aufgeworfen haben. 1. 2. 3. Aufklärung über die Krankheit: Ja! - Aufklärung über die Aufklärung: Nein? Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin: zwei Interessengruppen – ein Team? Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? Da eine kritische Auseinandersetzung mit der Untersuchung schon in der Methodik dieser Diplomarbeit verankert ist, werde ich auf eine gesonderte Betrachtung weitgehend verzichten und die kritischen Anmerkungen zu der Untersuchung – soweit sie im Methodenteil der Diplomarbeit unberücksichtigt sind – in die Diskussion der oben genannten Fragen einbinden. Auch den Ausblick den ich als meine Antwort auf die Frage, was noch zu tun bleibt, verstehe, werde ich am Ende der jeweiligen methodischen Diskussion einbringen. 9.1. Aufklärung über die Krankheit: Ja! - Aufklärung über die Aufklärung: Nein? Im Kapitel 4 bin ich zum einen auf die Rechte der Patientinnen eingegangen, zum anderen auf die gesundheitspolitischen Bestrebungen, den Patientinnen ihre Rechte nahe zu bringen. Interessant finde ich, dass das Konzept des Informationssystems inhaltlich schwerpunktmäßig dem Recht der Patientinnen auf umfassende Information nachzukommen versucht – die Rechte in der Behandlung, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, die Rechte im Schadensfall sowie die politische Dimension, diese Rechte zu benennen und den Patientinnen nahe zu bringen, wurden inhaltlich weit weniger deutlich. Während Informationen zur Erkrankung, Untersuchung, Behandlung, Nachsorge und psychosozialen Betreuung geplant sind, sowie ein Angebot von Anlaufstellen, wo solche Informationen abgerufen werden können, kommt in dem Informationskonzept weder eine Rubrik „Patientinnenrechte“ vor, noch ist unter den Anlaufstellen die Nennung von Rechtsbeiständen, ärztliche Schlichtungsstellen, Gutachterkommissionen etc. geplant. Die Verwirklichung des politischen Anspruches wird eher formal umgesetzt: Es wird zwar nicht auf die gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Information hingewiesen, es werden jedoch vielfältige Anregungen zur Informationssuche gegeben (einschließlich einer geplanten Checkliste für das Gespräch mit Ärztinnen). Es wird zwar nicht auf ein gesetzlich verankertes Recht auf selbstbestimmtes Sterben hingewiesen, es sollen jedoch Patientinnenverfügung und Patientinnenanwaltschaft benannt werden. Die Rechte in der Behandlung sowie im Schadensfall werden inhaltlich und formal wenig bis gar nicht betrachtet. - 87 - 9.1. Diskussion und Ausblick - Aufklärung über die Krankheit: Ja! - Aufklärung über die Aufklärung: Nein? Methodische Überlegungen zum Problem Was auf den ersten Blick als unvollständiges Ergebnis erscheint und verwundert, wird bei einem Blick auf den Forschungsauftrag klar und verständlich: „So kann der Auftrag verstanden werden als ein Auftrag zur Konzeption eines Online-Informationssystems für SarkomPatientinnen, das einerseits ein medizinisches Grundverständnis vermittelt (in Bezug auf ärztliches/medizinisches Denken über ihre Krankheit, sowie ärztliches/medizinisches Handeln und Entscheiden, sowie deren Grundlage) und andererseits Möglichkeiten aufzeigt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen (um ein medizinisches Gespräch emotional distanziert führen zu können).“ (S. 56) Im Zentrum dieses Auftrages stehen das medizinische Grundverständnis, das vermittelt werden soll, sowie Strategien des Umganges mit der medizinisch konzipierten Behandlungssituation85. Angesichts dieses Auftrages ist es also weniger verwunderlich, dass Aspekte jenseits rein medizinischer und psychosozialer Krankheitsinformation fehlen, und dass gesundheitspolitische Aspekte nicht inhaltlich benannt aber dennoch im Konzept formal umgesetzt vorkommen. Das Vorkommen dieser formalen „gesundheitspolitischen Zusätze“ führe ich auf die offene Methodik zurück, die den Gesprächspartnerinnen erlaubt, eigene Themen und Vorstellungen einzubringen. Dass diese Themen nicht inhaltlich auftauchen sondern nur formal, ist auf die Auswertung zurückzuführen: Richtlinie für die Auswertung war, dass alles, was die Gesprächspartnerinnen sagen, zum Thema gehört, das Thema jedoch war durch den Auftrag festgelegt. In der Auswertung musste nun also die Leistung vollbracht werden, die von den Gesprächspartnerinnen eingeführten Themen so zu übersetzen, dass sie vom Forschungsauftrag gedeckt sind. So wird beispielsweise der Inhalt „Sie haben ein Recht darauf, umfassend über ihre Erkrankung informiert zu werden“ (rechtliche Formulierung) übersetzt in „Checkliste für das Gespräch mit der Ärztin: Welche Therapie wird vorgeschlagen? Welche Erfolgsaussichten bestehen?“ (Medizinische Formulierung) Aussichten In einem größeren Aktionsforschungsprozess sollte dieses Resümee eine Erweiterung des Forschungsauftrages zur Folge haben, da an dieser Stelle offensichtlich wird, dass ein rein medizinisch-psychosozialer Forschungsauftrag zu kurz greift. Bei weiteren Gesprächen sollten gesundheitspolitische, ethische und juristische Aspekte thematisiert werden. Inwiefern ökonomische und wissenschaftliche Interessen angesprochen werden können und ob sich dies für die Weiterentwicklung des Online-Systems als sinnvoll und fruchtbar erweist, wäre eine weitere interessante Fragestellung. 85 Mit medizinisch konzipierter Behandlungssituation meine ich, dass in der Vorstellung (dem Konzept) der Behandlungssituation bereits gesundheitspolitische, ethische und rechtliche Aspekte ausgeklammert sind und die Situation als eine rein medizinische gesehen wird: Ärztinnen behandeln Patientinnen (nur) aufgrund medizinischer Überlegungen, die die Patientinnen gegebenenfalls nicht verstehen. - 88 - 9.2. Diskussion und Ausblick - Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin: zwei Interessengruppen – ein Team? Denkbar ist zum einen auch eine erneute Auswertung der Gespräche auf der Grundlage einer erweiterten Fragestellung sowie zum anderen das Einbeziehen von Seelsorgerinnen oder Juristinnen in die Weiterentwicklung des Online-Konzeptes, um zum Beispiel ethische und juristische Aspekte zu integrieren. 9.2. Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin: zwei Interessengruppen – ein Team? Ein Problem, das ich in der Theorie bereits dargelegt habe, tritt auch in der Untersuchung deutlich zu Tage: Einerseits – so die ökonomisch-gesundheitspolitische Forderung – ist die aktive Beteiligung der Patientin an der Behandlung gewünscht, andererseits – so die ethische Mahnung – soll die Patientin nicht überfordert werden. Einerseits wird auf den Internetseiten ein breit gefächertes Informations- und Hilfsangebot geplant und durch die Darstellung von Ärztinnen als Dienstleisterinnen der neue Geist des Gesundheitswesens verkündet. Andererseits ist die Frage berechtigt, ob ein solches Angebot nicht auch nahe legt, dass sich informieren muss, wer sich informieren kann und dass verantwortlicher Auftraggeber ist, wer eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Vor diesem Hintergrund ist die in der Untersuchung von Studentinnen der Evaluationsgruppe geäußerte Ablehnung der Begriffe „Arzt als Dienstleister“ und „Behandlungsteam“ als die Patientinnen gegebenenfalls überfordernde Begriffe nur zu verständlich (09s-1, 09s-6). Die ethische Forderung nach Patientinnenschutz findet jedoch meines Erachtens auch keine Berücksichtigung, wenn die abgelehnten Begrifflichkeiten vermieden und durch Begriffe ersetzt werden, die den Patientinnen die Wahl lassen, ob sie aktiv an Behandlungsentscheidungen teilnehmen wollen oder nicht. Die Umgestaltung des Gesundheitswesens im Sinne der Marktwirtschaft ist – wie ich in Kapitel 4.3 dargestellt habe – bereits gesellschaftliche Realität und mit ihr das marktwirtschaftliche Denken, das Behandlungsentscheidungen beeinflusst – eine begriffliche Verschiebung würde meines Erachtens eine Verschleierung bedeuten und den Patientinnen die Möglichkeit nehmen, sich zu diesen gesellschaftlichen Gegebenheiten zu verhalten. Bei einer kritischen Betrachtung des Online-Konzeptes ist meines Erachtens diesbezüglich anzumerken, dass dieser gesellschaftspolitische Wandel nicht deutlich ausformuliert, sondern nur formal umgesetzt und über wenige Begrifflichkeiten angedeutet ist und so im Prinzip den Wandel nicht wirklich offen legt. Für mich stellt sich weniger die Frage, ob die Patientinnen überfordert werden, wenn sie die Verantwortung für Behandlungsentscheidungen bekommen, als vielmehr die Frage, welche Hilfen den Patientinnen an die Hand gegeben werden können, um die Verantwortung, die sie de facto haben, auch tragen zu können. Während die Diskussion um die aktive Teilhabe am Behandlungsprozess einen strukturellen Aspekt der Beziehung zwischen Ärztin und Patientin darstellt, möchte ich noch einen emotionalen Aspekt ansprechen, der in den Interviews deutlich zu Tage trat: Vertrauen. In den PatientinnenGesprächen wurde auch das Thema „Vertrauen“ angesprochen, wobei Vertrauen eine unter- - 89 - 9.2. Diskussion und Ausblick - Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin: zwei Interessengruppen – ein Team? schiedliche Rolle spielt. Da eine genaue und wissenschaftlich fundierte Beschreibung der Rolle des Vertrauens eine inhaltliche Analyse der Patientinnengespräche voraussetzt, die ich nicht geleistet habe, handelt es sich bei der folgenden Darstellung um eine subjektive Einschätzung. Auch wenn diese Einschätzung mit Vorsicht betrachtet werden sollte, möchte ich sie in die Diskussion einbringen, da sie ein – für mein Befinden wesentliches – Problem deutlich werden lässt: Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Patientinnen bereits bei der gesundheitspolitischen Reform angekommen sind. In einem Fall hat eine Auseinandersetzung mit medizinischen Studien stattgefunden (03p-2f) und die Ärztinnen wurden anhand des medizinischen Wissens überprüft86. Je öfter die gleichen Informationen auftraten, desto vertrauenswürdiger schienen die Informationen (03p-6) – Ärztinnen, die diese vertrauenswürdigen Informationen weitergaben, wurden als kompetent und vertrauenswürdig empfunden. Dieses Verhalten entspräche dem Behandlungs-Modell der „aktiven Patientin“, die nach Informationen sucht, Behandlung und Ärztin einschätzt und sich selbstverantwortlich um die optimale Behandlung bemüht. Das Vertrauen erscheint mir hier als erarbeitet. Die anderen Patientinnen suchen bei den behandelnden Ärztinnen selbst nach Informationen und wollen über das Vorgehen in unterschiedlichem Maß informiert werden. Zusätzliche Informationsquellen werden hinzugezogen. Bestimmend für die Behandlung bleibt jedoch weitestgehend die behandelnde Ärztin: Sie ist Spezialistin und zum Teil letzte Hoffnung. Hier werden die Ärztinnen an ihren eigenen Aussagen und Darstellungen gemessen. Vertrauen wird hier in die Behandlung mitgebracht und im Verlauf der Behandlung gefestigt87. Verlaufen Behandlungen anders als aufgrund des Gespräches angenommen, wird das Vertrauen erschüttert. Mit unterschiedlichen Techniken wird dann (neues) Vertrauen aufgebracht: Unter anderem wird die Schuld bei sich selbst gesucht (man weiß zu wenig, man hat nicht nachgefragt) 88 oder in der unberechenbaren Krankheit89, so dass die Ärztin vertrauenswürdig bleibt. 86 „Aber manchmal will ich auch die bad news haben ... na klar ... um mich da auch irgendwo in diesem Diagramm einordnen zu können: Erzählen mir die Ärzte nun Blödsinn, wenn sie mir erzählen: ‚Sie haben gute Chancen und mit sehr gutem Allgemeinzustand ...’ [unverständlich]... Da kommen natürlich auch Zweifel auf und da will ich das [was die Ärztinnen sagen, J. L.] auch irgendwo mal in so ... so eingeordnet ... zuerst eingeordnet wissen.“ (03p-10) 87 „Ich hab ähh ... also ich persönlich hab ähh ... eigentlich gar nicht über ... über irgendwelche Hilfen oder Informationen nachgedacht ... ähh da war immer nur die Angst, dass ... dass sie sterben könnte ... und [Patient stimmt zu: „mhm“] alle anderen Sachen, wie zum Beispiel Schmerztherapien oder was dann halt kommen würde oder ... das ähh ... hätte ich dann eigentlich den Ärzten überlassen, weil man davon ja doch keine Ahnung hat ... da muss man ... muss man sich halt wieder auf die [Ärzte] verlassen, denk ich mal.[...] ...wie will man ... als Laie, was will man denn da machen?“(05a-9f) „In erster Linie muss man mal Vertrauen zu den Ärzten haben, das ... das sind schließlich ja die Spezialisten, unsereiner ist ja Laie ... das ... ist schon mal ähh ... sehr wichtig ... nee, man muss sich den Ärzten anvertrauen, es ... es bleibt einem hier denn keine ... ähh ... keine andere Wahl ...[Angehörige: „ja und Mitarbeiten“] ... und Mitarbeiten vor allen Dingen.“ (05p-10) 88 „ ... und wir haben das aber so verstanden ... also einmal auf den Stuhl drauf, da vier Stunden angeschlossen ja und ... das reicht dann ... so ungefähr, ne? ... und derweil haben wir das ein bisschen falsch verstanden ... ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Arzt es uns jetzt da nicht richtig erklärt hat ... und dass dann ... das sind dann mitunter so Missverständnisse, die dann entstehen können im Gespräch, weil man eben auch zu wenig davon weiß.“ (01a-3) 89 „Man kann nicht helfen. Aber den Ärzten geht’s genauso, die tun alles in der Welt um zu helfen und dann sieht man doch, dass man an ein Ende angekommen ist, dass man nicht helfen kann. Das ist ja eben dieser böse Krebs.“(02p-6) - 90 - 9.2. Diskussion und Ausblick - Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin: zwei Interessengruppen – ein Team? Vertrauen stellt die Grundlage dar, auf der die Behandlung durchgeführt wird. Eine Zustimmung zu den Behandlungsentscheidungen der Ärztin und damit auch das Mittragen der Behandlung (Compliance) hängen davon ab, ob der behandelnden Ärztin Vertrauen entgegengebracht werden kann. Hier steht die Information nicht im Dienst der eigenen unabhängigen (autonomen) Behandlungsentscheidung der Patientinnen, sondern dient – wie bei dem Konzept des „informed consent“ – dazu, der Behandlungsentscheidung von Fachleuten (mittelbar über das Aufbringen von Vertrauen) folgen zu können. In einem Evaluationsgespräch wurde angemerkt, dass es wichtig sei, das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin zu stützen, die Ärztin als Dienstleisterin darzustellen, würde beide nicht zusammenführen, sondern sie auseinanderbringen. Hier stellt sich für mich die Frage, ob Ärztin und Patientin auseinandergebracht werden, wenn die Ärztin und die Behandlung hinterfragbar gemacht werden. Wird nur Misstrauen und Unsicherheit angelegt oder kann eine Grundlage für Vertrauen geschaffen werden, da die Beziehungsgrundlage klargestellt wird? Methodische Überlegungen zum Problem Der Auftrag, der meiner Untersuchung zu Grunde liegt, steht bereits in der Logik der aktiven Beteiligung der Patientinnen an der Behandlungsentscheidung: Es wird nicht danach gefragt, ob eine Patientin ein angemessenes Bild von ihrer Erkrankung haben muss oder warum sie ein angemessenes Bild von ihrer Erkrankung haben soll oder will – diese Notwendigkeit wird als Möglichkeit vorausgesetzt – es wird nur danach gefragt, wie die Patientin ein angemessenes Bild von ihrer Erkrankung bekommt, das heißt, welche Informationen sie zu ihrer Erkrankung im weitesten Sinne benötigt und wie sie mit der Krankheit im weitesten Sinne umgehen kann. Diese Fragestellung verstellt den Blick auf die ethische Problematik der Überforderung von Patientinnen durch Informationen und erschwert damit auch die Suche nach möglichen Lösungsansätzen. Zwar konnten ethische Bedenken sowohl in den Planungs- als auch in den Evaluationsgesprächen von den Gesprächspartnerinnen angesprochen und in das Blickfeld gerückt werden, eine Bearbeitung dieses Problems wurde jedoch nicht vorgenommen. Auch die Beziehung zwischen Patientin und Ärztin ist aus dem Blickfeld geraten: Eine Untersuchung, die sich der Perspektive des „shared decision making“ verschrieben hat, und die aktive Patientin voraussetzt, verliert aus dem Blick, wie eine aktive Rolle von den Patientinnen ausgestaltet werden kann und welchen Aktivitätsgrad sich die Patientinnen selbst wünschen. Das in dieser Untersuchung entwickelte Online-System geht von der Möglichkeit aus, Patientinnen zu eigenen (autonomen) Entscheidungen und zur Mitgestaltung ihrer Behandlung zu befähigen (theoretischer Rahmen des Konzepts). Es wurde untersucht, welche Informationen dazu notwendig sind. Welche Informationen die Patientinnen letzten Endes in Anspruch nehmen (wollen) und - 91 - 9.3. Diskussion und Ausblick - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? wozu sie sie tatsächlich verwenden (möchten) (praktischer Rahmen des Konzepts), bleibt weitgehend unbeachtet. Aussichten Einen Weg zu finden, der aus dem Dilemma zwischen dem ethischen Anspruch auf Schutz und dem gesundheitspolitischem Ziel der Selbstbestimmung führt, wäre Aufgabe einer neuen Untersuchung, wobei in dieser Untersuchung zuerst einmal das oben angesprochene „Ob“ und das „Warum“ geklärt werden sollte. Die Voraussetzung dafür, tragfähige Hilfs-Angebote für eine aktive Patientinnen-Rolle zu schaffen, ist eine Analyse der verschiedenen Interessen an dieser aktiven Rolle. Auch die Frage, ob eine Eigenverantwortung von Patientinnen, die das Hinterfragen von Ärztinnen einschließt, die therapeutische Beziehung belastet oder ob diese Form der Auseinandersetzung der therapeutischen Beziehung dienlich sein kann, wäre interessant. Bei einer Untersuchung dieser Beziehung wäre auch das Bild der „aktiven Rolle der Patientin“ auszuarbeiten: Was ist das wesentliche Merkmal dieser Patientinnen-Rolle? Wie stellen sich Patientinnen diese aktive Rolle vor? Wie wird sie von Ärztinnen und anderen Berufsgruppen gesehen? 9.3. Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? Ein drittes Problem das ich noch ansprechen möchte, ist das Thema „Sterben und Tod“ – das eng verknüpft ist mit der Frage „Wie viel sollen die Patientinnen wissen?“. Krebs ist eine chronische Krankheit, die unter Umständen zum Tode führt, aber: Soll das in einem Informationssystem angesprochen werden? Und wenn ja, wie soll es angesprochen werden? Vor der Untersuchung hatte ich Bedenken, die zum Teil in der Evaluation geteilt werden (s. Kapitel 8.2, Änderungswürdiges, S. 80f): Die Patientinnen sitzen gegebenenfalls alleine vor dem Computer und werden nicht aufgefangen. Sie werden bei der Verarbeitung schlechter Nachrichten nicht unterstützt und das Medium („totes Medium“) nimmt keine Rücksicht darauf, wie viel die Nutzerin vertragen kann. Besteht die Möglichkeit, die Nutzerinnen mit schlechten Botschaften zu überfordern? Gibt es eine Grenze des Zumutbaren? Wo wird diese Grenze gezogen? Angenommen, ich entscheide mich dafür, das Thema „Sterben und Tod“ nicht auszugrenzen, sondern nehme es – gewissermaßen als Bestandteil der Krankheit – mit herein in die darzustellenden Bereiche: Wie sollen das Sterben und Tod dann dargestellt werden? Wird vom Leben gesprochen, das in jeder Phase lebenswert ist und – wenn eine Heilung nicht mehr im Vordergrund der Behandlung steht – möglichst symptomfrei gestaltet werden kann? Wird über Patientinnenanwaltschaft und Patientinnenverfügung gesprochen, die eine Möglichkeit darstellen, das eigene Sterben – im Sinne des Rechtes auf selbstbestimmtes Sterben – zu regeln? Wird also über - 92 - 9.3. Diskussion und Ausblick - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? das Leben und über das Fortführen von Leben gesprochen oder über Sterben und die Endlichkeit des Lebens? Angenommen ich bin konsequent, ich nehme das Sterben nicht nur in den zu besprechenden Themenkreis auf, sondern ich spreche es auch aus: Wie kann ich das Sterben aus- und ansprechen – einerseits ohne es zu verschleiern, andererseits ohne die Patientinnen zu überfordern oder zu ängstigen. Soll das Thema Sterben hinter einem Verweis90 auf einer Seite zu finden sein – gewissermaßen als „Alles, was sie über das Sterben wissen sollten ...“ – oder sollte das Thema Sterben in die gesamten Seiten „eingewoben“ werden: Bei den Sarkomen als mehr oder minder schlechte Prognose, bei den Untersuchungen als Metastasen oder Rezidive, die die Prognose verschlechtern, bei der Behandlung, die auf Heilung, aber auch auf Linderung von Symptomen abzielen kann, bei den Gefühlen als Angst vor dem Sterben und Trauer um Verstorbene, bei Bewältigungsstrategien als Antwort auf die Frage „Wie gehe ich damit um, wenn meine Mitpatientin stirbt?“ Meine Ratlosigkeit ist geblieben. Die Entscheidung ist willkürlich – wenn überhaupt etwas entschieden ist. Dass dies eigentlich nicht der Fall ist, zeigt auch die Verwirrung, die in der Evaluation darüber aufgetreten ist, dass das Sterben an verschiedenen Orten mit verschiedenen Schwerpunkten angesprochen wird und Inhalte der Seite „Sterben und Tod“ mit anderen Schwerpunkten wiederholt werden (s. Kapitel 8.2, Änderungswürdiges, S. 80). Ganz im Sinne des Aktionsforschungsprozesses habe ich versucht, das Thema Sterben und seine Darstellung in die Gespräche einzubringen und es gemeinsam mit meinen Forschungspartnerinnen zu entwickeln. Bei den Patientinnen war die Grenze schnell gesetzt: Von ihnen und von mir. Wenn ich die Antworten auf meine Frage, ob Sterben und Tod behandelt werden soll, zusammenfasse, dann komme ich zu einem klaren Ergebnis: Ja. Die Patientinnen möchten alles wissen, was ihre Krankheit betrifft, auch die schlechten Nachrichten, die man früher oder später sowieso bekommt (Siehe Kapitel 8.1, Informationsmenge, S. 76). Diese Antwort deckt sich auch mit der Literatur: Spir et al. (2000) erwähnen, dass 92% der Patientinnen schlechte Nachrichten bekommen möchten – 78% möchten sie auf eine freundliche, einfühlsame Art mit Rücksicht auf ihre emotionale Reaktion bekommen, 14% ohne Rücksicht auf ihre emotionale Reaktion. Das „Aber“ lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Sterben und Tod werden als „nicht greifbar“ erlebt, betreffen die Patientinnen nicht, werden verdrängt. Ängste werden ausgesprochen, die bei der Konfrontation mit dem Tod der Bettnachbarin auftreten, der Wunsch, darauf vorbereitet zu 90 Der Vorteil läge darin, dass die Patientinnen sich entscheiden könnten, ob sie dem Verweis folgen und die Informationen abrufen wollen. - 93 - 9.3. Diskussion und Ausblick - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? sein, auch der Wunsch, sich damit auseinander zu setzen, das Wissen darum, dass eine andere Patientin sich intensiv damit auseinandergesetzt hat (alleine!) und immer wieder die Abwehr der Patientinnen, dass das Thema gerade nicht aktuell sei, dass es darum ginge gesund zu werden, dass man „es schaffen“ will91. Ich selber war immer wieder unsicher, hatte Angst, weiter nachzufragen und zu aufdringlich zu werden, wenn ich noch einmal nachhakte bei dem Thema, das nicht aktuell, weit weg, nicht greifbar ist – oder ich hakte nach, wie das denn war mit der Tochter und mit der Angst und was die Patientin selbst gedacht hat und hatte ein schlechtes Gewissen – das Gespräch wurde schwer und intim und ich war froh, wenn es sich auch wieder in eine andere Richtung entwickelte oder wenn das Gespräch gestört wurde und ich ein neues Thema anschneiden konnte. „D’ailleurs c’est toujours les autres, qui meurent“92 (Pierre Granoux), hatte ich auf einem Schild am Eingang einer Ausstellung93 gelesen – dies beschreibt auch die Gesprächssituation mit den Patientinnen. Viel leichter fiel mir das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches und den Ärzten – das war gewissermaßen ein Reden über den Tod, ohne dass er (als Möglichkeit, die meine Gesprächspartnerin oder mich betrifft) mit am Tisch sitzt. Es war ein Reden über das „Andere“, das – gleichsam aus dem Gespräch ausgeschlossen – kommunizierbar wird, besprochen werden kann. In diesen Gesprächen wurden die Möglichkeiten der Darstellung erörtert. Es entwickelte sich eine Diskussion, in der Notwendigkeiten, Wünsche und Ängste deutlich wurden: 91 „Man kann das [den Tod] nicht verdrängen, das ist das Leben. ... Das ist das Leben ... und man kann das nicht verdrängen, und man sollte natürlich darüber sprechen, bloß ich verdränge das immer, wie ich jetzt sage: ‚also, das kann doch nicht alles gewesen sein!’ ... Ich habe mein Leben lang gearbeitet ... und jetzt mit einem Mal diese schreckliche Krankheit ... und ... ich möchte ... noch nicht von dieser Welt gehen und ich möchte ... auch noch was von meinem Leben haben und ähh ... und ich möchte noch nicht sterben und darum tue ich eigentlich alles dafür:... ich kämpfe, was ich als sehr wichtig empfinde, dass man sich nicht aufgibt ... und wenn’s noch so schlimm ist also man darf sich nicht aufgeben. ... Glaube versetzt Berge und das Kämpfen ... ich nehme an, ... wenn man ... das hilft auch den Ärzten, wenn man mitkämpft und sich nicht aufgibt ... die Stärke hat. ... Ich habe natürlich auch in diesem langen Hier sein Momente gehabt, zum Beispiel letzte Woche mal, ne? ... da hab’ ich denn gedacht ... da war ich auch ... fix und fertig als ich darüber nachdachte: ;Du hast hier den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter erlebt.’ ... Aber ich weiß, dass es den nächsten Sommer geben wird, ... wieder einen Herbst und wieder einen Winter, wo ich denke, dass ich denn die Krankheit überwunden habe. Was heißt überwunden habe? ... Das wichtigste ist ja dass keine Metastasen ...“ (03p6) 92 „Es sind immer die Anderen, die sterben.“ – dieses Zitat, genauer „die Anderen“, hat mich immer wieder beschäftigt: Wer war wie der/die Andere und was macht das? Für die Patientinnen schienen es andere Patientinnen zu sein, für mich war es meine Gesprächspartnerin (die an einer zum Teil tödlichen verlaufenden Krankheit litt und deren Auseinandersetzung mit dem Thema mich interessierte). Wurde sie nun – in dem Maße, in dem ich den Tod ansprach – zur Anderen? Wird hier das Gespräch aufgrund von Ab- und Ausgrenzung schwer? 93 Kunstausstellung M°A°I°S, 21. April – 12. Mai 2001 in Berlin, Bunker unter dem Blochplatz zum Thema „Der Tod“. - 94 - 9.3. Diskussion und Ausblick - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? Patientinnen sollen die Möglichkeit bekommen, „letzte Dinge zu regeln“ und ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben wahrzunehmen, dazu muss die Endlichkeit des Lebens auch deutlich ausgesprochen werden. Eine Verschleierung nimmt den Patientinnen Zeit. Den Patientinnen soll die Angst vor einem qualvollen Tod genommen werden. Sie sollen die Hoffnung nicht verlieren, solange noch ein Funke Hoffnung besteht. Diese (hoffnungsvolle) Zeit soll den Patientinnen gegeben werden, so eine andere Position. Meines Erachtens führt gerade das Thema Sterben wieder zurück zu dem theoretischen Rahmen der Untersuchung und all seinen Widersprüchlichkeiten. Zu der Frage, wie Patientinnen ihre Rechte wahrnehmen können, welchen Schutz und welche Fürsorge sie brauchen. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass sich das Gesundheitswesen im Umbruch befindet: Alter und neuer Zeitgeist stehen nebeneinander. Dies soll sich auch in dem Online-Konzept zeigen, das einerseits Patientenverfügung und Patientinnenanwaltschaft erwähnt, andererseits ängstigenden Vorstellungen über Zukunft und Sterben entgegentritt und zum dritten Hoffnung vermitteln soll und die Perspektive, was alles machbar ist. Methodische Überlegungen Methodische Überlegungen sind im vorangegangen Abschnitt schon angeklungen: In Bezug auf das Thema Sterben sind die Patientinnen-Gespräche mit den medizinisch-psychosozialen Interviews nicht vergleichbar und die Frage „Wie viel Informationen wollen die Patientinnen wirklich?“ kann meines Erachtens nicht befriedigend beantwortet werden, und auch eine klare Handlungsanweisung für die Konzeption kann den Gesprächen und ihrer Auswertung nicht entnommen werden. Die Lösung, möglichst viele Informationen anzubieten und den Nutzerinnen des Online-Systems die Auswahl zu überlassen, ist zwar durch die Patientinnen-Gespräche gedeckt, eine letztendliche Gestaltung der Informationen beruht jedoch eher auf Anregungen von den Ärzten, psychosozialen Mitarbeiterinnen und der studentischen Evaluationsgruppe. Von den Patientinnen gab es diesbezüglich keine Rückmeldung. Aussichten Als ein wesentliches Vorhaben erscheint mir, die Vorstellungen der Patientinnen bezüglich der Grenzen der Information und der Darstellung „schwieriger Informationen“ genauer herauszufinden. Dazu wäre jedoch ein Projekt anzuraten, das einen längeren Kontakt mit den Patientinnen ermöglicht, so dass eine Beziehung entstehen kann, die das Thematisieren von Tabu-Themen ermöglicht. Mit Gesprächen, wie ich sie geführt habe, ist dies meines Erachtens nicht zu leisten. Zum anderen sollte untersucht werden, wie die Internetseiten gestaltet werden können, so dass die Patientinnen den Informationsfluss selbst regulieren können. Wie können – insbesondere bei - 95 - 9.3. Diskussion und Ausblick - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? „problematischen“ Themen – die Informationen strukturiert werden, um den Patientinnen eine Entscheidung zu ermöglichen, ob sie die folgende Information bekommen möchten oder lieber nicht. Dazu sollte ihnen jedoch auch die Entscheidungsgrundlage bereitgestellt werden: die Information, wozu die folgende Information dienen kann (und wozu nicht). Das heißt, es wäre ein Konzept auszuarbeiten das auch Metainformationen (Informationen über die Informationen) enthält. Darüber hinaus sollte untersucht werden, welche Möglichkeiten bestehen, die Patientinnen bei schwierigen Themen (interaktiv) zu begleiten, sie nicht alleine zu lassen. Stellen Chatrooms, Newsgroups und Foren eine angemessene Möglichkeit der Begleitung dar? Worauf kann noch zurückgegriffen werden, um den Patientinnen in Krisensituationen Halt zu geben (Krisentelephon)? - 96 - 9.3. Zusammenfassung - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? 10. Zusammenfassung In der vorliegenden Diplomarbeit wurde ein Online-Informationssystem für Sarkom-Patientinnen entwickelt. Dieses Informationssystem soll den Patientinnen ermöglichen, ein medizinisches Grundverständnis aufzubauen und Strategien zu entwickeln mit ihrer Krankheit umzugehen. Das bedeutet zum einen, dass medizinische Informationen bereitgestellt werden sollen, die 1. 2. 3. 4. die Untersuchungsmethoden (Diagnostik), die Erkrankung (Diagnose), die Behandlungsmethoden (Therapie) und die Vorbeugung (Prävention), bzw. Nachsorge betreffen, zum anderen sollen Informationen gegeben werden, die 1. 2. die psychischen Folgen der Erkrankung und Möglichkeiten des Umgangs mit a. den medizinischen Informationen und b. den psychischen Belastungen beschreiben. Zur Konzeption der Internetseiten habe ich mich für eine nutzerinnenorientierte Perspektive entschieden und zum einen Patientinnen nach ihren Informationsbedürfnissen befragt, zum anderen medizinisches und psychosoziales Fachpersonal daraufhin angesprochen, welchen Informationsbedarf sie bei Patientinnen sehen. Die oben genannten Themenbereiche dienten bei den Gesprächen zwar als Orientierung, schlossen eigene Themen der Gesprächspartnerinnen jedoch nicht aus, vielmehr war das Einbringen eigener Interessen erwünscht. Die Untersuchung ist als Aktionsforschungsprozess angelegt, der es ermöglicht, die Gesprächspartnerinnen zu Forschungspartnerinnen werden zu lassen und das Setting der Untersuchung den jeweiligen Bedürfnissen und Anregungen der Gesprächspartnerinnen anzupassen. Ergebnis dieses Aktionsforschungsprozesses war zum einen die Ausweitung des Informationsangebotes über die oben beschriebenen Themen hinaus und zum anderen eine Anpassung der Informationen an die Patientinnen. Die Ausweitung des Informationsangebotes wird in zusätzlichen Kategorien deutlich: Diese zusätzlichen Angebote sind: 1. 2. 3. 4. 5. Der „Leitfaden“, der den Patientinnen je nach Stand in ihrer „Behandlungskarriere“ Hilfestellungen geben will (zum Beispiel einen Leitfaden für das Gespräch mit der behandelnden Ärztin), die „Anlaufstellen“, die den Patientinnen aufzeigen sollen, an wen sie sich bei der Suche nach Hilfe oder einer zweiten Meinung wenden können, den „Informationen“, die weiterführende (Fach-) Informationen anbieten soll, die „Fachbegriffe“, die den Patientinnen erklärt werden sollen und die „Downloads“, die dem Wunsch der Patientinnen nach Broschüren, bzw. einer Papierversion der Informationen Rechnung trägt. - 97 - 9.3. Zusammenfassung - Sterben und Tod – wie viel sollen die Patientinnen wissen? Die Anpassung an die Patientinnen wird in der Perspektive der Informationen deutlich. Es sollen einerseits wichtige medizinische Informationen gegeben werden, andererseits soll dies so geschehen, wie die Patientinnen sie abfragen. Am Beispiel der Strahlentherapie kann verdeutlicht werden, um welche Aspekte die medizinische Perspektive erweitert werden soll: Die Frage „Was passiert da?“ Kann auf zwei Ebenen beantwortet werden: auf einer medizinischen und einer Erfahrungsebene. Eine medizinische Antwort ist: „Energiereiche Strahlen treffen aus verschiedenen Richtungen auf die Krebszellen, um sie zu zerstören. Dabei wird auch gesundes Gewebe angegriffen, das sich jedoch wieder davon erholt.“ Eine Antwort auf der Erfahrungsebene ist: „Nachdem ich einige Zeit im Wartezimmer verbracht habe, lege ich mich in den Bestrahlungsraum, die Strahlenassistentin stellt das Bestrahlungsgerät ein, das dann bei der Bestrahlung, die nur wenige Minuten dauert, um mich herumfährt. Unter Umständen bekomme ich Kopfschmerzen oder die Haut ...“. Ein patientinnenorientiertes Online-Konzept sollte bestrebt sein, beiden Perspektiven gerecht zu werden und weitere Perspektiven, die den Patientinnen dienlich sein können, einzubeziehen. Um dies zu gewährleisten wurde die Untersuchung, die die Grundlage für das Informationssystem bildet, interdisziplinär angelegt und durchgeführt. An der Konzeption der Internetseiten waren zum einen Patientinnen, Angehörige und weitere medizinische Laien als Expertinnen des Umganges mit der Erkrankung beteiligt, zum anderen eine Kunsttherapeutin, Sozialarbeiterinnen, Ärzte und Psychologinnen als Vertreterinnen verschiedener Fachperspektiven. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit scheint zum einen eine gute Basis für die weitere Optimierung und Pflege des Internetangebotes zu sein und andererseits eine nachhaltige Anbindung des Informationssystems an die Klinik sicherzustellen, so dass die Verfügbarkeit und die Verbreitung der Informationen auch auf längere Sicht möglich ist. - 98 - 11. Literatur 11. Literatur Busch, Feldmann, Kretzler, Rohloff & Wilkowski (1999). Strahlentherapie. In R. Issels. Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Knochentumoren, Weichteilsarkome. Abrufbar über: http://www.krebsinfo.de/ki/empfehlung/knochen/4-2-stra.html [Letzter Abruf: 07.02.2001] Der Senat für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz der Freien Hansestadt Bremen (1999) (Hrsg.). Patientenrechte in Deutschland heute. Beschluss der 72. Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren in Trier. Bremen. Diekmann, A. (1995). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag. Eggermont, A. M. M. (2001). What is sarcoma cancer? Abrufbar über http://www.stsp.org/sarcomas.html [letzter Zugriff: 24.05.2001] Eibach, U. & Schaefer, K. (2001). Patientenautonomie und Patientenwünsche. Ergebnisse und ethische Reflexion von Patientenbefragungen zur selbstbestimmten Behandlung in Krisensituationen. Medizinrecht, 19 (1), S. 21-28 Flick, U. (1995). Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag. Forbriger, A. (2000a). Krebstherapie. Hochdosis-Chemotherapie – Nebenwirkungen. Abrufbar über: http:// www.inkanet.de/info/krebstherapie/hoch_neben.htm [Letzter Abruf: 25.05.2001] Forbriger, A. (2000b). Krebstherapie. Strahlentherapie – Nebenwirkungen. Abrufbar über: http://www.inkanet.de/info/krebstherapie/neben.htm [Letzter Abruf: 25.05.2001] Gagel, D. (1994). Durchführung einer sechsmonatigen Aktionsforschung im Handwerk des Niger. In D. Gagel (Hrsg.), Aktionsforschung und Kleingewerbeförderung. Methoden partizipativer Projektplanung und -durchführung in der Entwicklungszusammenarbeit. München: WeltforumVerlag, S. 35-44. Gagel, D. (2000). Grundlagen der Aktionsforschung in der Entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Heidelberg. Abrufbar über http://www.aktionsforschung.de/dokumente/AF-grundlagen%208- 2000.doc [letzter Abruf 16.04.2001] GTZ. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (1996). Jahresbericht 1995. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH GTZ. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (2000). Jahresbericht 1999. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH Hermann, A. & Schürmann, I. (2000). Ein Werkstattbericht zu Methodenfragen. In A. Hermann; I. Schürmann & M. Zaumseil (Hrsg.), Chronische Krankheit als Aufgabe. Betroffene Angehörige und Behandler zwischen Resignation und Aufbruch. Tübingen: dgvt-Verlag, S. 21-46. Hermann, A. (2000). Kommunikation und Interaktion während der stationären chirurgischen - 99 - 11. Literatur Behandlung von Patienten mit Knochen- und Weichgewebssarkomen. Erste Ergebnisse. Unveröffentlichtes Manuskript eines Vortrages. Hermann, A.; Zaumseil, M. Hohenberger, P. (2001). Der kommunikative Umgang mit dem Thema „Zukunft“ bei Krebspatienten. Der Onkologe, 7 (2), S. 167-177. Hermann, U. (1992). Knaurs Fremdwörterlexikon. München: Knaur. Hesse, F. W.; Garsoffky, B. & Hron, A. (1995). Interface-Design für computergestütztes kooperatives Lernen. In: L. J. Issing, P. Klimsa, (Hrsg.), Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 253-267. Hohenberger, P. (1995). Chirurgische Therapie von Weichgewebssarkomen. Der Onkologe, 1 (1), S. 101-109. Hollstein, W. (1999). Männlichkeit und Gesundheit. In D. Brähler & H. Felder (Hrsg.), Weiblichkeit, Männlichkeit und Gesundheit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 72-81. Ingham, C. (2000). My journey from Informed Consent to Mutual Inquiry and Collaborative decision making between client and therapist. Abrufbar über: http://www.cchs.usyd.edu.au/arow/reader/ingham.htm [Letzter Abruf: 04.04.2001] Issels (1999). Sicherung der Diagnose. Erstvorstellung. In R. Issels. Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Knochentumoren, Weichteilsarkome. Abrufbar über: http://www.krebsinfo.de/ki/empfehlung/knochen/2-SICHER.html [Letzter Abruf: 07.02.2001] Helmberger, Reiser, Bautz, Lukas, Flierdt, Baur (1999)Bildgebende Verfahren in der Diagnostik von Knochen- und Weichteiltumoren. In R. Issels. Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Knochentumoren, Weichteilsarkome. Abrufbar über: http://www.krebsinfo.de/ki/empfehlung/knochen/2-SICHER.html [Letzter Abruf: 07.02.2001] Issing, L. J. (1995). Instruktionsdesign für Multimedia. In: L. J. Issing, P. Klimsa, (Hrsg.), Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 195-220. Katenkamp D. & Kosmehl, H. (1995). Epidemiologie, Ätiologie und Pathologie der Weichgewebssarkome. Der Onkologe 1 (1), S. 86-92 Kerres, M. (1996). Varianten computergestützten Instruktionsdesigns: Autorensysteme, Lehrprogrammgeneratoren, Ratgeber- und Konsultationssysteme. Unterrichtswissenschaft, 24 (1), S. 68-92. Kerres, M. (1998). Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München: Oldenbourg. Keupp, H. (1994). Gemeindepsychologie. In R. Asanger & G. Wenninger (Hrsg.), Handwörterbuch Psychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 219-226. KID. Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (1997). Weichteilsarkome bei Erwachsenen. Abrufbar über: http://www.dkfz-heidelberg.de7Patienteninfo/pdq-text/soft-a.htm [Letzter Abruf: 24.05.2001] KID. Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (2000). Osteosarkom. Abrufbar über: - 100 - 11. Literatur http://www.dkfz-heidelberg.de7Patienteninfo/pdq-text/osteo.htm [Letzter Abruf: 24.05.2001] Kuhlmann, E. (1999). Im Spannungsfeld zwischen Informed Consent und konfliktvermeidender Fehlinformation: Patientenaufklärung unter ökonomischen Zwängen ; Ergebnisse einer empirischen Studie. Ethik in der Medizin (11), S. 146-161. Kupfer, J.; Felder, H. & Brähler, E. (1999). Zur Genese geschlechtsspezifischer Somatisierung. In D. Brähler & H. Felder (Hrsg.), Weiblichkeit, Männlichkeit und Gesundheit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 139-158. Mandl, H.; Gruber, H. & Renkl, A. (1995). Situiertes Lernen in multimedialen Lernumgebungen. In: L. J. Issing, P. Klimsa, (Hrsg.), Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 167-178. Mayring, P. (1990). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Deutscher Studien Verlag. Minkner-Bünjer, M. (2000). Armutsminderung durch Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung am Beispiel der Klein(st)en und Mittleren Unternehmen (KKMU). Grundlagen, Zusammenhänge und Fallbeispiele. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). NCI. National Cancer Institute (2000). Cancer. Abrufbar über http://cancernet.nci.nih.gov/wyntk_pubs/cancer.htm [letzter Abruf: 24.05.2001] NCI. National Cancer Institute (2001a). Adult Soft Tissue Sarcoma (PDQ®). Treatment - Health Professionals. Abrufbar über: http://cancernet.nci.nih.gov/cgibin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&SFMT=pdq_statement/1/0/0&Z208=208_00921 H [letzter Abruf: 24.05.2001] NCI. National Cancer Institute (2001b). Childhood Soft Tissue Sarcoma (PDQ®). Treatment - Health Professionals. Abrufbar über http://cancernet.nci.nih.gov/cgibin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&SFMT=pdq_statement/1/0/0&Z208=208_03085 H [letzter Abruf: 24.05.2001] NCI. National Cancer Institute (2001c). Ewing's Family of Tumors Including Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET) (PDQ®). Treatment - Health Professionals. Abrufbar über http://cancernet.nci.nih.gov/cgibin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&SFMT=pdq_statement/1/0/0&Z208=208_07968 H [letzter Abruf: 24.05.2001] NCI. National Cancer Institute (2001d). Osteosarcoma/Malignant Fibrous Histiocytoma of Bone (PDQ®). Treatment - Health Professionals. Abrufbar über http://cancernet.nci.nih.gov/cgibin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&SFMT=pdq_statement/1/0/0&Z208=208_07864 H [letzter Abruf: 24.05.2001] Piller, F. (2000). Aufbau dauerhafter Kundenbindungen mit Customer Relationship Management (CRM). http://www.aib.ws.tum.de/piller/download/crm2000.pdf (letzter Abruf: 15.04.2001) Pschyrembel, W. (1993). Medizinisches Wörterbuch. Berlin: de Guyter. - 101 - 11. Literatur Pusch, L. F. (1984). Männersprache – Sprache des Großen Bruders? In L. F. Pusch (1990), Alle Menschen werden Schwestern. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 18-34. Pusch, L. F. (1990). Alle Menschen werden Schwestern: Überlegungen zum umfassenden Femininum. In L. F. Pusch, Alle Menschen werden Schwestern. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 85-103. Rechl, Graf, Issels (1999). Probeexzision von Knochen- und Weichteiltumoren. Biopsieverfahren. In R. Issels. Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Knochentumoren, Weichteilsarkome. Abrufbar über: http://www.krebsinfo.de/ki/empfehlung/knochen/2-SICHER.html [Letzter Abruf: 07.02.2001] Schepank, H. (1999). Geschlechtsunerschiede in Manifestation und Verlauf psychogener Erkrankungen. In D. Brähler & H. Felder (Hrsg.), Weiblichkeit, Männlichkeit und Gesundheit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 159-170. Schlimok, G. (1997). Komplikationen der Chemotherapie. Der Onkologe, 3 (7) [Suppl. 1], S. 16-19. Schlund, G. H. (2001). Anforderungen an die Patientenaufklärung am Beispiel der Strahlentherapie. Strahlentherapie und Onkologie, 177 (3), S. 121-124. Schmidt-Sichermann, W. (1995). Action-Research - zehn Grundsätze. Abrufbar über http://wwwfim.fh-reutlingen.de/archiv/action_research3.html [letzter Zugriff: 16.04.2001] Schneider, G. (2000). Patientenrechte. Medizinrecht, 18 (11), S. 497-504. Schneider-Barthold, W.; Gagel, D.; Hillen, P & Mund, H. (1994). Aktionsforschung: Partizipative und prozessorientierte Methoden in der Entwicklungszusammenarbeit. In D. Gagel (Hrsg.), Aktionsforschung und Kleingewerbeförderung. München: Weltforum Verlag. Sieverding, M. (1999). Weiblichkeit – Männlichkeit und psychische Gesundheit. In D. Brähler & H. Felder (Hrsg.), Weiblichkeit, Männlichkeit und Gesundheit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 31-57. Spir, R.; Catane, R.; Kaufman, B.; Isacson, R.; Segal, A.; Wein, S. & Cherny, N. I. (2000). Cancer patient expectations of and communication with oncologists and oncology nurses: the experience of an integrated oncology and palliative care service. Support Cancer Care, 8, S. 458-463. Vimar, K. (1999). Kurswechsel in der Gesundheitspolitik. Vom mündigen Bürger zum entmündigten Patienten? Der Internist (8), S. 225-232. Wieck, W. (1993). Wenn Männer lieben lernen. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag. Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview [26 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(1). Abrufbar über: http://qualitativeresearch.net/fqs [letzter Zugriff: 25.04.2001]. - 102 - A. Anhang: Die Interviews – Leitfäden und Zitierweise A. Anhang: Die Interviews – Leitfäden und Zitierweise Leitfaden für das Gespräch mit den Patientinnen (und Angehörigen) Sehr geehrte Damen und Herren, die Robert-Rössle-Klinik plant in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin ein Informationsangebot für Sarkom-Patientinnen und -Patienten zu erstellen. In erster Linie ist dabei an ein Internet-Angebot und an eine Broschüre gedacht. Um diese Information optimal in ihrem Interesse zu gestalten, suchen wir die Zusammenarbeit mit Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen. Wir hoffen, dass unser Anliegen auf Ihr Interesse stößt und sie zu einem Gespräch über Ihre Wünsche in bezug auf ein Informationsangebot bereit sind. Folgende Fragen sollen in dem Gespräch angesprochen werden: - - Wenn Sie als Patient mit vielen Behandlungserfahrungen Informationen für Sarkom-Patient/inn/en zusammenstellen sollten, welche Informationen wären das? Was sollten Menschen (unbedingt) wissen, die mit der Diagnose Sarkom zum ersten Mal konfrontiert werden? Welche Informationen brauchen Angehörige Ihrer Meinung nach? Brauchen Patient/inn/en andere Informationen als Angehörige? Woher haben Sie Ihre Informationen bekommen? Welche Informationsquellen haben Sie genutzt? Gab es Informationen, die Sie gerne früher oder später bekommen hätten, als es in Ihrer Behandlung der Fall war? Welche Informationsquellen haben Ihnen am meisten geholfen? Was haben Sie daran geschätzt? Nutzen Sie die Möglichkeit, Informationen aus dem Internet zu beziehen? Hätten Sie Interesse, das Internet (ggf. nach einer Einführung oder zusammen mit anderen) als Informationsquelle zu nutzen? Was könnte Ihnen da helfen? Leitfaden für das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen aus dem psychosozialen Bereich Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für ein Gespräch Zeit genommen haben. Wir haben uns ja schon einmal getroffen und über das Vorhaben unterhalten, ein Informationssystem für Sarkom-Patientinnen und –Patienten zu erstellen. Ich möchte Ihnen nun noch einmal die Kernfragen stellen, die mich bezüglich der Konzeption des Informationssystems für Patienten beschäftigen. Es ist mir wichtig, zu betonen, dass es mir bei der Frage nach ihrer Informationspraxis nicht darum geht, Sie zu kontrollieren oder zu bewerten. Ich gehe davon aus, dass Sie soweit Ihnen das in ihrer zeitlich sehr angespannten Arbeitssituation möglich ist, im Sinne der Patient/inn/en (re)agieren. Vielmehr geht es mir in unserem Gespräch darum, zu erfahren, welche Informationspraxis sie für ideal halten, um ggf. nach Umsetzungsmöglichkeiten zwischen Ärzten, Sozialarbeiterinnen und Patienten im Rahmen des Informationssystems suchen zu können. - 103 - A. Anhang: Die Interviews – Leitfäden und Zitierweise Fragen-Katalog - Welche Informationen sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall gegeben werden? Welche Informationen nicht oder nur unter bestimmten Umständen? Wie sieht die derzeitige Praxis aus? Wie werden derzeit die Informations- bzw. Aufklärungsgespräche mit Patient/inn/en und Angehörigen in der Rössle Klinik gestaltet? Was würden Sie verändern, wenn Sie optimale Bedingungen (z. B. genügend Zeit, Material, umfassendes Interesse d. Pat. oder Angehörigen) vorfänden? Haben Patient/inn/en und Angehörige nach Ihren Erfahrungen einen unterschiedlichen Informationsbedarf? Wo liegen die Unterschiede? Was für Materialien konkret würden Sie als Anschauungsmaterial ins Netz stellen? Werden Grenzen, Bedenken gegenüber offener Information und Aufklärung gesehen? Was erhoffen Sie sich von einem Informationssystem für Sarkom-Patient/inn/en? Welchen Nutzen soll es Ihnen und Ihrer Arbeit an der Klinik bringen? Würden Sie das Informationssystem in Ihre Arbeit einbeziehen wollen? Wie? Sehen Sie darüber hinaus Einsatzmöglichkeiten des Informationssystems im Arbeitsalltag der Klinik? Welche Schwierigkeiten assoziieren sie mit dem Einsatz eines Patient/inn/en-Informationssystems in der Klinik? Leitfaden für das Gespräch mit den Ärzten Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für ein Gespräch Zeit genommen haben. Wir haben uns ja schon einmal getroffen und über das Vorhaben unterhalten, ein Informationssystem für Sarkom-Patientinnen und –Patienten zu erstellen. Ich möchte Ihnen nun noch einmal die Kernfragen stellen, die mich bezüglich der Konzeption des Informationssystems beschäftigen. Es ist mir wichtig, zu betonen, dass es mir bei der Frage nach ihrer Informationspraxis nicht darum geht, Sie zu bewerten. Ich gehe davon aus, dass Sie soweit möglich ihrer Arbeitssituation angemessen und im Sinne der Patient/inn/en reagieren. Vielmehr geht es mir darum, zu erfahren, welche Informationspraxis sie für ideal halten, um ggf. nach Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen des Informationssystems suchen zu können. Fragen-Katalog - - Was erhoffen Sie sich von einem Informationssystem für Sarkom-Patient/inn/en? Welchen Nutzen soll es für Sie und Ihre Arbeit an der Klinik bringen? Würden Sie das Informationssystem in Ihre Arbeit einbeziehen wollen? Wie? Sehen Sie darüber hinaus Einsatzmöglichkeiten für das Informationssystem im Arbeitsalltag der Klinik? Haben Sie Kontakt zu Ärzt/inn/en anderer Kliniken, die bereits mit einem Patient/inn/enInformationssystem arbeiten? Von welchen Erfolgen und Schwierigkeiten ist Ihnen berichtet worden? Welche Schwierigkeiten könnten sich Ihrer Meinung nach hier in der Klinik ergeben? Gibt es Patienten-Informationssysteme, die Sie gut finden? Was schätzen Sie an diesen Seiten? Was mögen Sie ggf. nicht? Welche Informationen sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall gegeben werden? Welche Informationen nicht oder nur unter bestimmten Umständen? Wie sieht die derzeitige Praxis aus? Wie informieren Sie Patient/inn/en und Angehörige? Was würden Sie verändern, wenn Sie optimale Bedingungen (z. B. genügend Zeit, Material, umfassendes Interesse d. Pat. oder Angehörigen) vorfänden? Haben Patient/inn/en und Angehörige nach Ihren Erfahrungen einen unterschiedlichen Informationsbedarf? Wo liegen die Unterschiede? - 104 - A. Anhang: Die Interviews – Leitfäden und Zitierweise Zitierweise der Interviews Ich zitiere die Interviews mit einer Nummern-Buchstabenkombination. Beispiel: 01pa-10 Die zweistellige Nummer zu Beginn ist die Nummer des Interviews: Beispiel: Hier handelt es sich um das erste Interview, das ich geführt habe. Die Buchstaben geben Auskunft über die Gruppenzugehörigkeit meiner Gesprächspartnerin: a – Angehörige m – Mediziner (Ärzte) n – Nicht-Medizinerinnen (Mitarbeiterinnen des psychosozialen Bereiches) p – Patientin s – Studierende (Forschungscolloquiums-Teilnehmerinnen als Evaluationsgruppe) Das erste und fünfte Interview wurde jeweils mit einer Patientin und ihrer Angehörigen geführt. Da die Gesprächsinhalte von beiden Interviewpartnerinnen getragen wurden (Zustimmung), macht es bei inhaltlichen Zitaten keinen Sinn, zu unterscheiden, wer etwas gesagt hat und wer genau welcher Meinung war. Eventuelle Meinungsverschiedenheiten sind nicht zu Tage getreten und wurden nicht herausgearbeitet. Die Wortführung wird durch eine Unterstreichung kenntlich gemacht. Bei wörtlichen Zitaten wird nur die Sprecherin durch das Buchstabenkürzel kenntlich gemacht. Beispiel für ein inhaltliches Zitat: Es besteht der Wunsch nach schriftlicher Information, um die Information auch wiederholt abrufen zu können (01pa-10). Beispiel für ein wörtliches Zitat: „[Ich wünsche mir ein] Buch, wo man nachlesen kann. eine Seite zweidreimal lesen, wenn man sie beim ersten mal nicht erfasst oder erfassen will.“(01a-10) Die letzte(n) Ziffer(n) geben den Interview-Abschnitt an: Die Gespräche wurden in fünfminütige Abschnitte unterteilt. Diese Sequenzen wurden durchnummeriert. Beispiel: Das Zitat befindet sich im zehnten Interviewabschnitt, das heißt zwischen 45. und 49. Gesprächsminute. - 105 - B. Anhang: Theoretisch hergeleitete Kategorien B. Anhang: Theoretisch hergeleitete Kategorien Struktur der vorab theoretisch entwickelten Kategorien mit Kodierbeispielen Inhalt Wünsche werden als Äußerungen verstanden, die besagen, welche Inhalte vertreten sein sollen „Man sollte mit den Patienten besonders das Seelische besprechen, was sie erwarten könnte.“ (02P-6) Fragen werden als Aufforderung verstanden, sie im Informationssystem zu beantworten. „Was bedeutet das eigentlich, ein Ewing-Sarkom?“ (01a-1) Situationen werden als Aufforderung verstanden, über die besondere Situation von Patientinnen zu berichten und nach Informationsbedarf und Lösungsansätzen für Probleme zu suchen. „Ich hatte sehr viele Aufgaben und auf einmal sollte ich das alles ablegen. das geht nicht.“ (06p-7) Tipps und Lösungsvorschläge werden als Ratschläge verstanden, die im Informationssystem veröffentlicht werden sollen. „Man darf niemals aufgeben, immer weitersuchen und versuchen irgendetwas zu finden: Es gibt irgendwo Ärzte, die helfen wollen und können.“ (05a- 2) Einschätzung, ob Patientinnen und Angehörige unterschiedliche Informationen benötigen werden als Anweisungen zur Informationsauswahl gelesen und als Hinweis auf besondere Informationsbedürfnisse verschiedener Personengruppen Eine Angehörige berichtet: „Ältere Patienten [...] was die so erzählen, das gibt mir nicht so viel ... weil ich mir immer sage, das betrifft dich ja nicht, das ist ja was ganz anderes, wie sie [die Patientin] ... das ganze ... wie geht’s mit der Schule weiter? ...“ (01a-4) Gestaltung Vorlieben werden als Anweisungen zur Medienwahl und Mediengestaltung gelesen. „... also dass man eigentlich in Kurzfassung – man muss ja da keine Romane schreiben – aber dass die Patienten, der ja eigentlich nicht aus der Medizin kommt, der sich vorher damit nicht befasst hat, dass der einen kleinen Einblick dadurch in die Medizin bekommt.“ (02p-8) Informationsquellen werden als Hinweise verstanden, wie Informationen gestaltet werden sollen, welche Form der Darstellung Patientinnen schätzen. „Ein Buch, wo man nachlesen kann. Eine Seite zwei-, dreimal lesen, wenn man sie beim ersten Mal nicht erfasst oder erfassen will“ (01a-9) - 106 - B. Anhang: Theoretisch hergeleitete Kategorien Anbindung Informationsquellen werden als Hinweise verstanden, woher Informationen bezogen werden, an welche Stellen sie angebunden werden sollen. „Wir haben ja hier das Pik-Angebot in der Klinik und da wird ja auch einiges gemacht und da ist an einem Tag, am Donnerstag, kann man da auch ins Internet rein.“ (02p-5) Probleme beim Zugang zu Informationen oder Informationsquellen Werden als Schwierigkeiten verstanden, die bei der Konzeption des Online-Systems beachtet und bei der Umsetzung gelöst werden sollten. „... aber ich hatte ... bisher war ich immer nicht in der Lage, dass ich da hätte hingehen können. Entweder habe ich gelegen, ich bin ja jetzt in der letzten Zeit sehr oft operiert worden ...“ (02p-5) Erfahrung mit den Auswirkungen von Informationen geben Hinweise auf Schwierigkeiten und positive Effekte von Informationen. „Ich glaube, die [Studie] hat die Entscheidung nicht so sehr beeinflusst ... die hat sie vielleicht indirekt beeinflusst, weil ich von der Studie wusste, dass das da eine Behandlungsmöglichkeit gibt, dann kam ich hier her, dann hat der Dr. X mir davon erzählt – auch in der Abfolge – und dann hat mir das die Sicherheit gegeben. Also die erste so ... Sicherheit, was ist Sicherheit? ... aber ein ruhigeres Gefühl.“ (03p-5f) - 107 - C. Anhang: Kategorien – Gestaltung und Anbindung C. Anhang: Kategorien – Gestaltung und Anbindung Struktur der aus den Gesprächen entwickelten Kategorien Gestaltung Info-Auswahl Benutzerinnenführung (schnell und gezielt zu ausgewählten Infos) Vollständigkeit für Personengruppen Angehörige weiteres soziales Umfeld Auswirkungen von Informationen Präsentation Anschauungsmaterial Interaktivität Download/Service Portal Links Probleme Struktur Alter Kinder jüngere Patienten um die Vierzig ältere Patientinnen Personengruppe Angehörige Patientinnen Reihenfolge anfangs bei Diagnose im Krankenhaus nach dem Krankenhaus Perspektiven zuletzt Anbindung örtlich personell/institutionell technisch/Vermarktung Probleme - 108 - D. Anhang: Konzept des Online-Informationssystems (Kategorien – Inhalt) D. Anhang: Konzept des Online-Informationssystems (Kategorien – Inhalt) Die Struktur der aus den Gesprächen entwickelten inhaltlichen Kategorien stellt das Gerüst des Online-Informationssystems dar. - 109 - - 110 - Hier sollte ein kurzer Willkommenstext stehen, Urheberschaft (Zusammenarbeit von Patientinnen, Angehörigen, Ärzten, Sozialarbeiterinnen, einer Therapeutin, einer Psychologin, ...), Sinn und Zweck der Seiten. Einladung zur Mitarbeit: Verbesserungsvorschläge/Wünsche an Webmaster, Beteiligung an Foren (alle dürfen/sollen fragen und antworten!). Letzte Aktualisierungen --> Link zu einer Seite, die alle Aktualisierungen aufführt (letzte zuoberst). Generell sollte auf den Seiten soweit möglich auf Fachbegriffe verzichtet werden (Behandlung statt Therapie, Vorbeugung statt Prävention, etc.). Bemerkung für dieses Papierkonzept: Sowohl die Navigationsleiste links als auch das www.sarkome.de und die Unterüberschrift (Patientinnenfrage) sind immer sichtbar, auch wenn sie ggf. auf späteren Seiten wegen der „Registertechnik“ der Papierversion entfallen mußte. Jeweils die erste Seite eines Unterkapitels zeigt diesen Aufbau. In diesem Konzept werden Anforderungen an Internetseiten für Sarkom-Patientinnen und Patienten vorgestellt – weibliche Substantive meinen männliche Personen mit. Es wird vorgestellt welche Themen wie behadelt werden sollen. Kursivdruck stellt dabei (stichwortartig) mögliche Beispiele für die Umsetzung der Inhalte dar. Aus Gründen der Platzersparnis sind Seiten, die im Internet getrennt sind im Papierkonzept auf einem Blatt wiedergegeben – getrennte Internetseiten werden im Papierkonzept durch eine Rahmung kenntlich gemacht. Willkommen Navigation Hier sollte ein kurzer Willkommenstext stehen, Eine kurze Erklärung, was unter den Links in den Urheberschaft (Zusammenarbeit von Patientinnen, Navigationsleisten zu verstehen ist: Angehörigen, Ärzten, Sozialarbeiterinnen, einer Therapeutin, einer Psychologin, ...), Sinn und Zweck der Seiten. Unter ... finden Sie ... . Einladung zur Mitarbeit: Verbesserungsvorschläge/Wünsche Unter "?!" gelangen Sie zu einem Forum, wo Sie Fragen an Webmaster, Beteiligung an Foren (alle dürfen/sollen stellen können und wo Ärzte und Patienten Ihnen fragen und antworten!). weiterhelfen können. Letzte Aktualisierungen --> Link zu einer Seite, die alle Wenn Sie auf das Disketten-Symbol klicken, können Sie die Aktualisierungen aufführt (letzte zuoberst). Inhalte dieser Rubrik herunterladen. Generell sollte auf den Seiten soweit möglich auf Fachbegriffe verzichtet werden (Behandlung statt Therapie, Vorbeugung statt Prävention). Übersicht Ihre Fragen Hier sollte eine Übersicht (Sitemap) zu finden sein, die die Hier sollte eine Aufstellung der Fragen zu finden sein, die Struktur der Seiten verdeutlicht und von der aus ein Patienten immer wieder stellen und die Antworten dazu. Direktzugriff auf die Unterseiten besteht. - 111 - - 112 - Dieser Abschnitt soll als Orientierungshilfe dienen, da die Patientinnen und Angehörigen besonders am Anfang mit der Diagnose überfordert sind. Es geht darum, sie in ihrer Situation abzuholen und ihnen eine Struktur anzubieten, die sie in ihrer Behandlungsplanung und bei den jeweils anstehenden Situationen unterstützt, ihnen Basisinformationen für anstehende Entscheidungen liefert, bzw. Hilfen an die Hand gibt, diese Informationen zu beschaffen sowie verschiedene Perspektiven für die jeweilige Situation aufzeigt und ggf. diskutiert. - Perspektiven Anfangs - Diagnose ggf. plötzlich und schnell - Berg ist zu bewältigen - Existenzängste kommen auf - Fassungslosigkeit und Fragen: Wo kommt das her? Habe ich was falsch gemacht? Wo soll ich hin? Wer kann mir helfen? Muß ich nun Sterben? Werde ich viel Leiden müssen? Wie reagieren die Anderen? Bei all diesen Fragen wollen wir hier eine Orientierungshilfe bieten. Verweise [Links] zu den entsprechenden Stellen. - 113 - Nachsorge Wiedereinstieg in den Alltag: Beruf: Hilfen zur Herrichtung des Arbeitsplatzes, Teilzeit. Nachsorgeuntersuchungen und die Angst - Schule. Rente. dort hinzugehen. Wie das zukünftige Leben gestalten? (auf Klinik angewiesen? Was kann ich zu meiner Genesung sozialesEngagement? etc) beitragen? Ernährung, Lebensumstellung, Prävention. Behindertenausweis. Was, wenn Rezidive auftreten? Psychosoziale Hilfen Was kann man tun, wenn man nichts mehr tun kann? Palliativmedizin - nicht qualvoll sterben. Testament, Hospiz, Hinterbliebene absichern. - - 114 - Vorbereitung Krankenhaus Jeweils Verweise [Links] zu den entsprechenden Stellen der Homepage: Checklisten/Fragebögen für das Krankenhaus: Wer sind meine Ansprechpartnerinnen im KH? Sprechzeiten, Zimmer, Telephon, Email. Welche Therapie wird vorgeschlagen? Welche Erfolgsaussichten bestehen? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Was kann dagegen getan werden? Wodurch wird der Erfolg der Therapie angezeigt? Unter welchen Umständen wird sie abgebrochen? Welche Möglichkeit habe ich, wenn die Therapie nicht den gewünschten Erfolg birngt? Gibt es andere Therapiemöglichkeiten? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wo werden sie durchgeführt? Was muß dort vorbereitet werden? (Mistelth. sollte vor KH begonnen werden) - Krankentransport - Perücke - Vorbereitung auf Therapien Welche Kliniken gibt es und was wird dort gemacht? Ansprechpartnerinnen für die Krankenhauswahl / Spezialistinnen Verweise [Links] zu den entsprechenden Stellen. Checklisten: - Was muß Zuhause abgeschlossen werden? - Wer kümmert sich um ... (Kinder, Zeitung, Post, Blumen, Haustiere). Zusammenstellung eines Behandlungsteams: Wer kann Ihnen wo helfen? Wie komme ich raus und wieder rein in den Alltag? (Umgang mit und Beteiligung von Familie, Freunden und Bekanten). Wie stelle ich mir meine Behandlung und ggf. den Abbruch der Behandlung vor? Patientenverfügung. Tipps für Verhalten im Krankenhaus: im Umgang mit dem Arzt (Arzt als Dienstleister --> Behandlungsteam). Gegenseitigen Unterstützung von Patientinnen: Gedächtnisstütze (bei Visite an Fragen erinnern), Behandlung durchsprechen. Fragen für die Visite aufschreiben und gemeinsam mit dem Arzt durchgehen oder nach einem gesonderten Termin fragen. Welche Möglichkeiten haben Patientinnen an der Behandlung aktiv teilzunehmen? Was können Sie selbst für eine (schnelle) Genesung tun? Entspannungs- und Hilfsmöglichkeiten im KH nutzen (psychosoziales Angebot). Sozialarbeiterinnen aufsuchen, um die Situation nach der Klinik abzusichern: Kur, Rente, Hilfen, ambulante Pflege. Ggf. Perspektiven für die Zeit nach der Klinik überlegen (Depression, wenn alles vorbei ist). Hier sollen Informationen zu verschiedenen Untersuchungsmethoden stehen, wozu sie dienen, wie sie durchgeführt werden, welche Ergebnisse, Werte, Bilder sie produzieren und was sie aussagen. Biopsie, Schnellschnitt, Feingewebeprobe, MRT, CT, Ultraschall, Röntgen Verlauf? Kontrastmittel? - 115 - - 116 - [Methode 2, etc. ist ebenso aufgebaut] Wozu? Wozu dient die Untersuchung? Was soll abgeklärt werden? Ablauf Was passiert bei der Untersuchung? Was wird gemacht? Wie oft muß die Untersuchung wiederholt werden, bzw. wovon hängt die Zahl der Wiederholungen ab? Wie lange dauert die Untersuchung, bzw. wovon hängt die Dauer ab? Ergebnisse Welche Ergebnisse bringt die Untersuchung? (Werte, Bilder) Wie liest man sie? (Beispiele, z. B. Animation einer Verlaufsuntersuchung) Grenzwerte? Was besagen sie bei Unter-/Überschreitung? Welche Konsequenz hat das? Was sollte daraufhin geschehen? Hier sollte ein einleitender Text zu Sarkomen zu finden sein Einteilung in -Weichgewebs- und - Knochensarkome Informationen zu den einzelnen Sarkomen sollten dann über die Navigation oben abgerufen werden können - 117 - - 118 - [Sarkom 2, etc. ist ebenso aufgebaut] Beschreibung Was ist das? Wo ist das? Wieviele Arten gibt es? Welche? Verbreitung Wie häufig kommt das vor? Wer bekommt es? (Wer nicht?) Ursachen Woher kommt es? Ernährungs- oder Verhaltensbedingt? Verlauf & Prognose Wie sind die Heilungschancen? Wovon hängen sie ab? Was kann man machen? Welche Therapieformen sind angezeigt? Wie sind die Erfolgsaussichten der Therapien? Statistiken, was sie besagen und wie man sie liest. Welche Patienten schaffen es? Welche nicht? Einleitender Text zu den Therapien. Aufgrund des großen Interesses an alternativen Ansätzen sollte eine Stellungnahme zu dem Verhältnis Schul- und Komplementärmedizin erfolgen. Eine Darstellung sowohl schulmedizinischer wie auch komplementärmedizinischer Konzepte erscheint als sinnvoll, um umfassende Therapiemöglichkeiten darzustellen. Können die Therapien ergänzend genutzt werden und wenn ja, wie? Desweiteren sollte deutlich gemacht werden, inwiefern Sarkom-PatientInnen einer besoderen Behandlung bedürfen. Können "generelle Krebs-Informationen" übernommen werden? Welche Informationen, die an Krebs-Patientinnen zur Verfügung stehen, gelten auch für Sarkom-Patientinnen? Welche nicht? Literaturverweise an den entsprechenden Stellen sind wünschenswert (Literatur sollte dann unter Fachliteratur aufgeführt sein) - 119 - - 120 - [Therapie 2, etc. ist ebenso aufgebaut] Welchem Ziel dient die Therapie? Was kann erreicht werden? Was nicht? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Voraussetzungen Welche Voraussetzungen gibt es für die Therapien? Unter welchen Umständen kann diese Therapiemethode angewandt werden? Verlauf & Prognose Was geschieht mit einem? Was wird gemacht? Wie oft muß die Behandlung wiederholt werden? Chemotherapie: Wieviele Zyklen, wieviele Anwendungen pro Zyklus? Wie lange dauert dieBehandlung, bzw. wovon hängt die Dauer ab? Welche Erfolge wurden mit dieser Therapie erzielt? Statistiken, wie liest man sie? Wie wird der Erfolg der Behandlung überprüft? Wie wird das Behandlungsergebnis eingeschätzt? Wann gilt ein Behandlungsversuch als gescheitert? Welche Konsequenz hat das? Was sollte daraufhin geschehen? Nebenwirkungen Mit welchen Nebenwirkungen kann gerechnet werden? (Schwäche, Übelkeit, Haarausfall, Unfruchtbarkeit, wunder Hals, ...) Was kann man dagegen tun? Welche (mittelbaren und unmittelbaren) psychischen Folgen hat die Behandlung? (Depression, ...) Wie mit der Angst umgehen, falls was wiederkommt? Empfehlung, wie man leben sollte. Stellenwert von Ernährung, keimfreie Kost, Haushaltshygiene, Autogenes Trainig, Entspannungsmöglichkeiten. Wie können Rezidive (aber auch Infekte z. B. zwischen Therapiezyklen) vermieden / hinausgeschoben werden? Was ist nötig? Was ist möglich? Was kann man gar nicht beeinflussen? Wie kann psychischen Folgeerscheinungen vorgebeugt werden? (nicht depressiv werden? Angst?) - 121 - - 122 - In dieser Rubrik geht es darum, aufzuzeigen, wo welche Hilfe bezogen werden kann: welche Krankenhäuser welche Behandlungsschwerpunkte und -erfolge haben, welche Spezialisten zu welchen Themen nach einer zweiten, unabhängigen Meinung gefragt werden können, welche Organisationen welche Hilfen bereit halten und wo psychosoziale Unterstützung gewährt werden kann. - - Kliniken Spezialisierte Ärztinnen Wo wird einem am besten geholfen? Welche Spezialkliniken gibt es? (Deutschland/Ausland) Ärzteliste aus dem Focus: Wen kann man um Rat fragen? Welche weiteren Kliniken gibt es und welche Schwerpunkte Zweite (unabhängige) Meinung einholen. haben sie? Was wird in den Kliniken angeboten? Wieviele Sarkompatienten wurden dort behandelt? Erfolgsquote? Kontaktadressen der jeweiligen Klinik, Ansprechpartnerinnen, Email. Kliniken vorsortiert: Spezialkliniken in Deutschland, dann Ausland, dann andere Kliniken. Hospize, Palliativversorgung. Organisationen Welche Verbände / Organisationen gibt es? Was ist ihre Aufgabe? Wo helfen sie weiter? Kontaktmöglichkeiten. Selbsthilfe Was können die Patienten und Angehörigen selbst für sich tun. (siehe Prävention). Auflistung von Selbsthilfegruppen und Vereinen, die Selbsthilfegruppen anbieten: Angebote für Patienten, Speziell Angebote für Angehörige, Selbsthilfe im Internet: Foren, Newsgroups, Mailinglists, IRC-Channel. - - 123 - - 124 - Patienten, die an diesen Seiten mitgearbeitet haben, haben immer wieder berichtet, wie wichtig das gemeinsame Bewältigen der Krankheit für sie war und ist ("wir machen das alles zusammen", "Krebs kann man nicht alleine bewältigen") und daß Schwierigkeiten und Anstrengungen entstehen, wenn nicht zusammengearbeitet wird oder werden kann. Die Behandlung kann als ein gemeinsames Projekt verstanden werden, in dem die verschiedenen Personen unterschiedliche Kompetenzen beisteuern und sowohl für sich, als auch für die anderen nutzbar machen. In dieser Rubrik soll aufgezeigt werden, welche Ressourcen die an der Behandlung beteiligten Personen für wen möglicherweise zur Verfügung stellen können. Grundgedanke ist die gegenseitige Entlastung durch Kooperation. Ärztinnen Psychosoziale Mitarbeiterinnen für Patienten und Angehörige Informationen zur Krankheit, Untersuchungen, Behandlungsmöglichkeiten,Heilungschancen,Vorbeugung von Rezidiven oder Krankheiten, medizinische Nachsorge medizinische Fachliteratur, Broschüren. Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Therapeutinnen für Patienten undAngeörige Bei alleinerziehenden Müttern/Vätern: Wer kümmert sich während des Krankenhausaufenthalts um die Kinder? Hilfen für den Wiedereinstieg in den Alltag (Herrichtung des Arbeitsplatzes, finanzielle Unterstützung). Vorschläge zur Behandlungsplanung: Welche Behandlung scheint warum sinnvoll? Alternativen zur bisherigen Behandlung. Ambulante Pflege. Entlastungsmöglichkeiten für die Angehörigen, Sie können die Visite zur Klärung Ihrer Fragen nutzen oder um psychologische Betreuung für Patienten und Angehörige: Umgang mit Ängsten, Leben mit der veränderten einen gesonderten Gesprächstermin bitten. Situation/dem veränderten Körper (sowohl mit sich als auch in einer Beziehung). Welche Hilfen bekommt man von welchen Behörden? Behindertenausweis. Information bezüglich gesetzlicher Bestimmungen. Vermittlung von Hospizen, Sterbebegleitung. - 125 - - 126 - Patientinnen Familie und Freundinnen für Patientinnen Erfahrungsaustausch, Tips, Unterstützung bei der Behandlungsplanung, Aufklärung: Wo findet man was im Krankenhaus, gegenseitiges Erinnern, welche Fragen noch zu klären sind (Visite). für Patienten Informationsbeschaffung durch das soziale Umfeld für Angehörige Unsicherheiten der Angehörigen abfangen (Befindlichkeiten mitteilen), emotionale Unterstützung bei der Bewältigung der Situation. Angehörigen mitteilen ob, wo und wie sie helfen können Gefühl der Hilflosigkeit abfangen: Sie können vielleicht nicht heilen, aber helfen. Angehörige in ihrer Alltagsplanung unterstützen. Überforderung der Angehörigen, die plötzlich mit dem "alten" Alltag und der Krankheit des Patienten nun zum Teil alleine fertig werden müssen/wollen, um den Patienten nicht zu belasten. für Ärzte Befindlichkeiten mitteilen, damit die Therapie darauf abgestimmt werden kann. Unterstützung bei der Behandlungsplanung (oft haben Verwandte und Freunde, die nicht so in den Krankenhausalltag eingebunden sind, einen klareren Kopf), Begleitung bei Gesprächen mit Ärzten oder psychosozialen Mitarbeiterinnen. Patienten nicht aus dem "alten" Alltag ausschließen ("Schonen") und ihn auf die Krankheit reduzieren. Emotionale Unterstützung bei der Bewältigung der Krankheit Literaturliste: Artikel und Aufsätze zu den in den verschiedenen Rubriken genannten Themen (dort sollte jeweils mit einem Link auf diese Artikel verwiesen werden) Fachzeitschriften, Fachbücher, etc. - 127 - - 128 - Literaturliste: Artikel und Aufsätze zu den in den verschiedenen Rubriken genannten Themen (dort sollte jeweils mit einem Link auf diese Artikel verwiesen werden). Bücher Weitere Bücher, die für Sarkompatienten und deren Angehörige von Interesse sein könnten: Erfahrungsberichte, Belletristik, etc. Fachzeitschriften, Fachbücher, etc. Filme (Video-) Filme: Informationsfilme der Krebshilfe Spielfilme Reportagen Titel und Bezugsquellen. Veranstaltungen / Termine Vorträge (Fach-) Tagungen Hinweis auf Filme im Fernsehprogramm (Reportagen, Spielfilme, etc.) Immer wieder wurde die Fragen gestellt: "Wie haben die Anderen das geschafft?", und: „Wie sind die damit umgegangen?" Unter dieser Rubrik sollen wichtige Punkte des Erfahrungsbereiches von Sarkompatienten vorgestellt werden. Fallbeispiele zu den Punkten sind wünschenswert, in denen Patienten/Angehörige beschreiben, wie sie die Situation gemeistert haben. - 129 - - 136 - Lebensveränderung Inwiefern geht das Leben weiter wie vorher? Was hat sich im Leben der Patienten verändert und wie haben sie das gemeistert? - - Psychische Veränderung? Körperliche Veränderung? Beziehungen? (Attraktivität, Haarausfall, Narben, Amputation) Schule/Arbeit - wie war dort der Wiedereinstieg? Behandlungsentscheidungen Die Frage, wo einem am besten geholfen werden kann und von wem, wohin man sich wendet und welche Behandlung die richtige ist, stellt Patienten vor schwierige Fragen und nicht zuletzt vor schwere Entscheidungen. Hinzu kommt, daß das Gebiet auf dem die Entscheidungen zu treffen sind, die Medizin, den Patienten meist fremd ist.Vieles ist verwirrend und überfordert. Hier sollte ein Angebot zu finden sein, das Patienten in dieser Situation unterstützt, Hilfen, wie Entscheidungen getroffen werden können. (mehrere Meinungen einholen, Vertrauensperson mit einbeziehen, ...) Beispiele von Patienten, die sich für/gegen Behandlungen entschieden haben und warum. Sterben & Tod Ein Thema, das alle Patienten und Angehörigen in den Interviews beschäftigte, ist das Thema „Sterben und Tod“. Zum Teil wird die Angst genannt, dass Rezidive auftreten könnten und dass die Krankheit am Ende doch nicht heilbar sein könnte. Es scheint an dieser Stelle sinnvoll, aufzuzeigen, was machbar ist, "wenn man nichts mehr machen kann", wenn die Grenzen therapeutischer Machbarkeit erreicht scheinen: Palliativmedizin (kein qualvoller Tod), Wo möchten Patienten sterben und was kann dort für sie getan werden (Hospiz, eigene Wohnung, ...)? Sterbebegleitung (nicht alleine gelassen werden), Patientenverfügung (wie möchte ich sterben), Patientenanwaltschaft (wer soll für mich entscheiden, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin?) In dieser Rubrik sollte ein Wörterbuch angeboten werden, das medizinische Fachbegriffe erläutert, die Sarkompatientinnen begegnen können. Die Fachbegriffe, die auf den Seiten zu finden sind, sollten jedoch erklärt werden, ohne daß zum Wörterbuch gewechselt werden muss (kleines Fenster mit Erklärung geht auf, sobald die Maus sich über dem Fachbegriff befindet und wird geschlossen, sobald die Maus den Begriff verläßt). - 137 - - 138 - Hier sollte diese Seite komplett als PDF-File zum Download angeboten werden, sowie die Rubriken im Einzelnen. Foren-Auflistung und Verweise zu den Foren dieser Seite stehen Kontaktemails der med., psychol., soz., therap. Redaktion u. Webmaster Aufruf zur Mitgestaltung der Seiten: Was fehlt? Was sollte anders sein? Bitte um Feedback (Formular?) Verweis auf Anlaufstellen. - 139 - - 140 - Linksammlung (angelehnt an die Struktur der Seiten) E. Anhang: Kategorien – Evaluation E. Anhang: Kategorien – Evaluation Struktur der Evaluations-Kategorien Inhalt & Gestaltung Änderungswürdiges – was ist falsch? wird als Anweisung verstanden, Inhalte auf den Seiten zu ändern. „Was mir überhaupt nicht so richtig gefallen hat auf einer Seite war, dass der Arzt als Dienstleister da steht ... also ... das ähh ... kommt dann so ins Kaufmännische rein und wenn ich Betroffener oder Angehöriger bin, ... ähm also ... kaufmännisch ... ähm ... impliziert für mich, ich hab die Freiheit, was zu kaufen und zu geben und so weiter, aber ... ähm ... wenn ich an Krebs erkrankt bin, hab ich ... ist für mich meine Freiheit eingeschränkt und also ... ich ... nicht ... ob jetzt der Begriff so auftauchen wird in ... auf den Seiten, aber inhaltlich vielleicht schon ... das würde mir nicht gefallen.“ (09s-1) Fehlendes – was fehlt? wird als Anweisung verstanden, den Seiten Inhalte hinzuzufügen. „Dann find ich immer ziemlich wichtig ... bei allen Webseiten ... dieses Suche-Ding. Also mich stört es immer sehr, wenn’s das nicht gibt.“ (09s-7) Unerwünschtes – was ist zu viel? wird als Anweisung verstanden, Inhalte auf den Seiten zu streichen. „Palliativmedizin ist natürlich einganz heikles Thema, also wo ... ähm ... wo es auch schwierig ist herangeführt zu werden ... weißt du, da letztendlich, wenn ein Patient wirklich in die Situation kommt, denn ... ja? [spricht leiser] ... denn stellt er häufig die Frage ... [steht auf, schließt die Tür des Arztzimmers zur Station hin] ... stellt er die Frage meinetwegen: ‚Ach, ich habe jetzt Lungenmetastasen, woran sterbe ich denn dann?’ und dann muss man ihm erklären, dass er erstickt ... [...]Also ich glaube, das zu konkret zu machen ist eine ganz schwierige Situation. Es sei denn, die Patienten wünschen das wirklich, aber das kann ich mir ganz schwer vorstellen.“ (10m-3) Anbindung Verhältnis Ärzte-Internetkonzept – Online-Informationssystem wird als Hinweis verstanden, wie die Ärzte sich die Umsetzung von Internetseiten für Patientinnen vorstellen und wie diese Seiten an/in ihr Konzept an- oder eingebunden werden soll. „Also ich hatte so’n bisschen gedacht, dass das eigentlich so sein soll dass in diese Seite [gemeint sind die von den Ärzten konzipierten Seiten] so’ne Seite noch integriert werden soll, wo dann noch was reinkommt, wie jetzt, was ... was die Sache noch aus Patientensicht darstellt oder wo vielleicht zum Beispiel auch eine ... ähm ... eine Selbsthilfegruppe sich einrichten kann.“ (10m-1) Ziele werden als Erwartungen der Ärzte verstanden, die ein Internet-Konzept erfüllen soll. „Erstens habe ich das Anliegen für Patienten Informationen bereitzustellen...“ (08m-1) Nachhaltigkeit der Umsetzung wird als Hinweis verstanden, wie eine dauerhafte Umsetzung des Konzeptes gewährleistet werden kann. „Wir sind für die Patienten hier im Haus da und ähm ... das würde ... also ich, ich glaube, das würde auch nicht ... also ich glaube, man müsste denn irgendwie eine andere Stelle schaffen hier, die sich darum kümmert.“ (07n-9) - 141 -