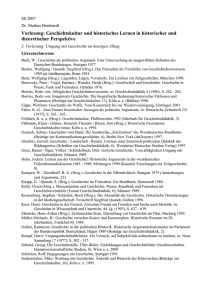schichtskultur in der Geschichtsdidaktik 2.1 Geschichtsbewusstsein
Werbung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Impressum: Copyright © 2017 Studylab Ein Imprint der GRIN Verlag, Open Publishing GmbH Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany Coverbild: GRIN | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz Steffen Brumme Historisierung von Geschichtskultur und Einsatzmöglichkeiten im Geschichtsunterricht Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................... 5 2 Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur und historische Geschichtskultur in der Geschichtsdidaktik ........................................................................................................ 7 2.1 Geschichtsbewusstsein .................................................................................................... 7 2.2 Geschichtskultur ............................................................................................................ 10 2.3 Historische Geschichtskultur als Unterrichtsgegenstand? Der Disput zwischen Schönemann und Pandel ............................................................................................ 18 3 Historisierung von Geschichtskultur ............................................................................... 24 3.1 Überblick über den Forschungsstand ............................................................................ 24 3.2 Synthese gelungener Konzepte zur Historisierung von Erinnerungskulturen ............... 27 3.3 Entwicklungsmodell der Erinnerungskulturen .............................................................. 34 4 Potentiale historischer Erinnerungs- und Geschichtskultur für den Geschichtsunterricht ........................................................................................................ 43 4.1 Die gegenwärtige Geschichtskultur verstehen............................................................... 43 4.2 Gegenwärtige geschichtskulturelle Objektivationen verstehen ..................................... 45 4.3 Eine Vergangenheit anhand ihrer Erinnerungskultur erschließen.................................. 49 4.4 Integration in das Kompetenz-Strukturmodell historischen Denkens ........................... 51 5 Zusammenfassung ............................................................................................................... 54 6 Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 57 7 Anhänge ................................................................................................................................... 68 1 Einleitung Geschichtskultur ist seit vielen Jahren das bestimmende Thema der Geschichtsdidaktik. Eine schier unüberschaubare Masse an Dissertationen, Zeitschriftenartikeln und Sammelbänden mit geschichtskulturellen Themen überfluten den geschichtsdidaktischen Markt, Konferenz an Konferenz diskutiert über die Auswirkungen dieser inzwischen nicht mehr allzu neuen Zentralkategorie für die Disziplin und den Geschichtsunterricht. Augenfällig sind in diesem Zusammenhang zwei Dinge: Ein konsensorientierter Debattenstil hat die Freude an der kontroversen Zuspitzung abgelöst, die die (zumindest westdeutsche) Geschichtsdidaktik über Jahrzehnte prägte. Im Vordergrund stehen nicht mehr die großen gesellschaftspolitischen Kämpfe. Vielmehr diskutiert die Geschichtsdidaktik heute nuanciert über Kompetenzen, Unterrichtsmethoden etc. Darüber hinaus überrascht die Tatsache, dass innerhalb der geschichtsdidaktischen Forschung zur Geschichtskultur die Historizität eben dieser kaum eine Rolle spielt. Für eine geschichtswissenschaftliche Disziplin ist das Ausblenden der Geschichtlichkeit einer zentralen Untersuchungskategorie atypisch. Diese Arbeit setzt an diese beiden Beobachtungen an. Einerseits wird die prominent ausgetragene Kontroverse rund um das Thema Geschichtskultur aufgegriffen, anderseits die Historizität von Geschichtskultur genauer in den Blick genommen. Die von Bernd Schönemann und Hans-Jürgen Pandel geführte Debatte um die Historisierungsfähigkeit von Geschichtskultur und die darin vorgebrachten Argumente werden ausführlich in Kapitel 2.3. dargestellt und diskutiert. Durch die Auseinandersetzung mit den Positionen der beiden renommierten Vertretern der Geschichtsdidaktik wurden die zwei erkenntnisleitenden Fragestellungen dieser Arbeit abgeleitet: Wie kann Geschichtskultur konzeptionell historisiert werden und welche Potentiale besitzt vergangene Geschichtskultur für den Geschichtsunterricht? Im Laufe dieser Arbeit werden diese Fragen umformuliert zu: Wie können Erinnerungs- und Geschichtskulturen konzeptionell historisiert werden und welche Potentiale besitzen diese für den Geschichtsunterricht? Um verständlich zu machen, warum diese Fragen für die Geschichtsdidaktik und den Geschichtsunterricht relevant sind, bedarf es einer ausführlichen Hinführung. Kapitel 2.1. und 2.2. geben daher einen Überblick über die Forschung zu den beiden Zentralkategorien der Disziplin: Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur. Ein Abriss der Definitionen, des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontextes ihrer Durchsetzung sowie ihrer wechselseitigen Bedingtheit soll die Bedeutung der Forschungsfragen für die Geschichtsdidaktik und den Geschichtsunterricht zeigen. Die zentralen Kapitel 3 und 5 4 dienen der Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragestellungen. Die Historisierung von Geschichtskultur wird in Kapitel 3.1. durch einen kursorischen Überblick über die geschichts- und kulturwissenschaftliche Forschungsliteratur in diesem Themenfeld eingeleitet. In Kapitel 3.2. wird mittels einer Synthese vorhandener Ansätze zur Historisierung des gesellschaftlichen Umgangs mit der Vergangenheit ein eigenes Modell entwickelt. Im Rahmen einer Masterarbeit kann allerdings lediglich ein vorläufiges Modell konzipiert werden. Dieses soll der fachwissenschaftlichen und geschichtsdidaktischen Forschung als Orientierung dienen, um theoretische und empirische Untersuchungen durchführen zu können. Im Laufe dieser Arbeit kam ich zu der Einsicht, dass die bis Kategorie Geschichtskultur unter die übergeordnete Kategorie der Erinnerungskulturen subsumiert werden muss. Kapitel 3.3. erklärt daher ausführlich, warum Geschichtskultur als spezifische Erinnerungskultur der Moderne verstanden werden kann. Zusätzlich diskutiere ich in diesem Kapitel die Fragen, ob die Synthese von zukünftigen Forschungsergebnissen zu einem Entwicklungsmodell der Erinnerungskulturen sinnvoll wäre und ob die Geschichtskultur der Moderne in der jüngsten Vergangenheit durch eine neue Erinnerungskultur der Postmoderne abgelöst wurde. In diesem Zusammenhang ergab sich ein Grundproblem dieser Arbeit, das nur ansatzweise von mir gelöst werden kann. Im Kontext der Themen Geschichtsund Erinnerungskultur bestehen innerhalb der Geschichtswissenschaft eine Vielzahl von sich ergänzenden, überlagernden und widersprechenden Definitionen, Kategorien, Begriffen und Konzepten. Die vorliegende Arbeit versucht, Klarheit in die Pluralität dieses Forschungsfeld zu bringen. Eine abschließende Klärung dieser Problematik muss allerdings der weiteren Forschungsdiskussion überlassen werden. Die drei Unterkapitel des letzten Abschnittes erarbeiten jeweils ein Potential der Thematisierung von historischer Erinnerungs- und Geschichtskultur für den Geschichtsunterricht. Die theoretisch gewonnenen Potentiale sollen jeweils kurz an Beispielen verdeutlicht werden, ohne dass eine tatsächliche didaktische Umsetzung angestrebt werden konnte. Auch für diese Überlegungen gilt, dass sie einen vorläufigen Versuch darstellen. Erst eine zukünftige Erforschung von historischen Erinnerungs- und Geschichtskulturen wird die unterrichtspragmatische Nutzung der Potentiale in ausreichendem Maße gewährleisten. 6 2 Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur und historische Geschichtskultur in der Geschichtsdidaktik 2.1 Geschichtsbewusstsein Die Frage, warum sich Geschichtskultur zur zweiten zentralen Kategorie der Geschichtsdidaktik entwickelte, ist nicht zu beantworten, ohne das deutlich veränderte theoretische Selbstverständnis der Geschichtsdidaktik seit den späten 1970er Jahren zu betrachten.1 Insbesondere durch die Arbeiten von Karl-Ernst Jeismann transformierte sich die Geschichtsdidaktik von einer Didaktik des Geschichtsunterrichts zu einer umfassenden Didaktik der Geschichte. Voraussetzung für diese Neuorientierung und Erweiterung war die Einführung des Begriffes Geschichtsbewusstsein, welcher relativ schnell zu der Zentralkategorie der Geschichtsdidaktik aufstieg. Anfangs definierte Jeismann Geschichtsbewusstsein relativ unspezifisch in „einem sehr allgemeinen Sinne als das Instrument der unterschiedlichsten Vorstellungen von und Einstellungen zur Vergangenheit“2. Er formulierte damals Grundannahmen, die für die heutige Geschichtsdidaktik noch immer maßgeblich sind. Erstens erweiterte er den Gegenstandsbereich der Geschichtsdidaktik um das „Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft“, „sowohl in seiner Zuständlichkeit, den vorhandenen Inhalten und Denkfiguren, wie in seinem Wandel, dem ständigen Um- und Aufbau historischer Vorstellungen, der stets sich erneuernden und verändernden Rekonstruktion des Wissens von der Vergangenheit“3. Zweitens traf er fundamentale Entscheidungen für die weitere Entwicklung der Geschichtsdidaktik. Geschichte konnte im Kontext von Geschichtsbewusstsein nicht mehr als Gesamtheit von „richtigem“ Wissen über die Vergangenheit verstanden werden, sondern als ein retrospektives Konstrukt: 'Geschichte' tritt uns entgegen als ein auf Überreste und Tradition gestützter Vorstellungskomplex von Vergangenheit, der durch das gegenwärtige Selbstverständnis und durch Zukunftserwartungen strukturiert und gedeutet wird. Nur in dieser Form haben wir Ges- 1 Vgl.: Schönemann, Bernd: Geschichtskultur als Forschungskonzept der Geschichtsdidaktik, in: ZfG 1/2002, S.78. 2 Jeismann, Karl-Ernst: Didaktik der Geschichte. Die Wissenschaft vom Zustand, Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellungen im Selbstverständnis der Gegenwart, in: Erich Kosthorst (Hrsg.): Geschichtswissenschaft. Didaktik - Forschung - Theorie, Göttingen 1977, S.12f. 3 Ebd., S.12. 7