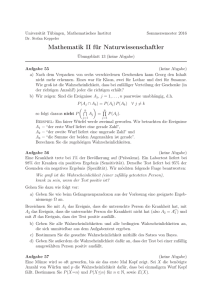Punkt (XY)
Werbung

6
Inhalt
2
Teil I: Theoretische Grundlagen
Inhalt
3
Inhalt
Teil I: Theoretische Grundlagen............................................................................ 2
Inhalt........................................................................................................................ 3
2
Vorbemerkungen......................................................................................... 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge ......................................... 9
Statistik als Entscheidungshilfe .................................................................... 9
Statistische Einheiten.................................................................................... 9
Merkmale, Merkmalsausprägungen und ihre Skalierung ........................... 10
Empirische Verteilungen............................................................................. 13
Häufigkeiten ............................................................................................... 14
Statistische Analysemethoden..................................................................... 17
4
Beschreibung und Analyse von Daten..................................................... 19
4.1
Mittelwerte: Wohin tendiert eine Verteilung? ............................................. 20
4.2
Streuungsmaße: Wie variabel ist eine Verteilung?...................................... 25
4.3
Konzentrationsmaße: Auf wieviele Merkmalsträger konzentriert sich eine
Verteilung?.............................................................................................................. 32
4.4
Korrelationsmaße: Wie gleichgerichtet sind zwei verschiedene
Verteilungen? .......................................................................................................... 38
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie.......................................... 43
Ereignisse und ihre Verknüpfungen ............................................................ 43
Zufallsexperimente, Ergebnis- und Ereignisräume..................................... 45
Die verschiedenen Wahrscheinlichkeitskonzeptionen ................................ 48
Bedingte Wahrscheinlichkeiten................................................................... 56
Regeln für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten .................................... 60
Wichtige Spezialfälle: Unabhängigkeit und Disjunktheit von Ereignissen 63
Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit .............................................. 64
Der Satz von Bayes..................................................................................... 65
4
5.9
Inhalt
Kombinatorik.............................................................................................. 68
TEIL II: Statistikanwendungenmit Excel........................................................... 79
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Grundlagen von Excel .............................................................................. 81
Einführung .................................................................................................. 81
Grundelemente............................................................................................ 82
Eingabe und Bearbeitung von Daten .......................................................... 83
Aufbereitung von Daten.............................................................................. 88
Integrierte Funktionen................................................................................. 89
Online-Hilfesysteme ................................................................................... 91
Aufgaben zu Kapitel 1 ................................................................................ 95
Lösungsvorschläge zu Kapitel 1.7 .............................................................. 96
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Beschreibung und Analyse von Daten..................................................... 99
Einführung .................................................................................................. 99
Häufigkeiten ............................................................................................. 101
Mittelwerte................................................................................................ 107
Streuungsmaße.......................................................................................... 110
Konzentrationsmaße ................................................................................. 114
Korrelationsmaße...................................................................................... 117
Aufgaben zu Kapitel 2 .............................................................................. 119
Lösungsvorschläge zu Kapitel 2.7 ............................................................ 123
Wahrscheinlichkeitsrechnung............................................................................ 129
3.1
Einführung ................................................................................................ 129
3.2
Zufallsexperimente ................................................................................... 129
3.3
Kombinatorik............................................................................................ 130
3.4
Aufgaben zu Kapitel 3 .............................................................................. 132
3.5
Lösungsvorschläge zu Kapitel 3.4 ............................................................ 133
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Grafische Präsentation von Daten......................................................... 135
Einführung ................................................................................................ 135
Diagrammerstellung ................................................................................. 138
Statistische Anwendungen ........................................................................ 140
Aufgaben zu Kapitel 4 .............................................................................. 154
Lösungsvorschläge zu Kapitel 4.4 ............................................................ 155
5
Literatur .................................................................................................. 161
1
Vorbemerkungen
Der vorliegende erste Band der insgesamt zweibändigen „anwendungsorientierten
Statistik mit Excel“ wendet sich vor allem an Studierende der Hochschulen mit
Statistik im Haupt- oder Nebenfach. Aufgrund seiner stark inhaltlichen Ausrichtung
ist es darüberhinaus aber auch für einen Leserkreis geeignet, der sich – sei es aus
beruflicher Notwendigkeit, sei es „nur“ um sich weiterzubilden – die grundlegenden statistischen Konzepte im Selbststudium erarbeiten möchte.
Leser, welche sich einen weitgehend formalen Stoff aneignen wollen (oder müssen), benötigen in der Regel eine Hilfestellung, um sich die Inhalte erarbeiten zu
können. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Werk so zu gestalten,
daß die Arbeit mit ihm zugleich eine sinnvolle Übung am Tabellenkalkulationsprogramm MS-Excel sein kann. Die statistischen Funktionen dieses Programmes sind
mittlerweile so ausgefeilt, daß auch anspruchsvolle Analysen möglich sind. Spezielle Statistikprogramme, die noch vor ein paar Jahren unverzichtbar waren, erübrigen sich daher weitgehend. Die Excel-Anwendungen sind jeweils in einem separaten Teil II zusammengefaßt. Auf diese Weise bleibt der Charakter von Teil I als
eine überschaubare Darstellung der wichtigsten statistischen Grundlagen erhalten.
Teil I gliedert sich in insgesamt drei Abschnitte. Im ersten werden grundlegende
statistische Begriffe vorgestellt, wogegen im zweiten Abschnitt die wichtigsten
Bestandteile dessen behandelt werden, was man üblicherweise als deskriptive Statistik bezeichnet. Spätestens in diesem Abschnitt wird der Leser ein entscheidendes
Charakteristikum unseres Buches bemerken, nämlich die konsequente Konzentration auf grundlegende statistische Konzeptionen und ihre ausführliche Darstellung.
Nach unserer Erfahrung ist es gerade für das inhaltliche Verständnis von großer
Bedeutung, die Grundlagenkonzepte – auch wenn sie dem Kenner trivial erscheinen mögen – in aller Ausführlichkeit und vor allem anhand einer Vielzahl von Beispielen zu erläutern.
Abschnitt 3, welcher den theoretischen Teil abschließt, befaßt sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Auch hier war es unser Ziel, das Buch so zu gestalten, daß
vor allem das Verständnis für die manchmal auch gegen die Intuition gehenden
wahrscheinlichkeitstheoretischen Konzepte gefördert wird.
Die konsequente Ausrichtung eines Buches an der Vermittlung von inhaltlichem
Verständnis führt nur dann zum Ziel, wenn es lesbar geschrieben ist. Dies wieder-
6
6
1 Vorbemerkungen
um erfordert es, den statistischen Formalismus möglichst gering zu halten. Wenngleich wir alles andere als Gegner formaler Darstellungen sind, haben wir uns bei
der Verfassung des vorliegenden Werkes doch sehr zurückgehalten. Wann immer
wir uns zwischen formal-exakter Darstellung und besserer Lesbarkeit entscheiden
mußten, haben wir letzterem den Vorrang gegeben.
Leser, welche vorliegendes Werk mit anderen Statistik-Lehrbüchern vergleichen,
werden bemerken, daß unser Buch mit sehr viel Mut zur Lücke verfaßt wurde. Wir
sind der Überzeugung, daß es im Rahmen eines einführenden Lehrbuches nicht
erforderlich ist, sämtliche Aspekte der an den Hochschulen gelehrten Statistik darzustellen. Wichtiger als ein inhaltlich umfassender Statistik-Wälzer erschien uns
eine Darstellung, die nicht zu viele Inhalte transportiert, diese dafür aber ausführlich. Um das Buch nicht zu umfangreich werden zu lassen, mußten wir daher
zwangsläufig den bereits erwähnten sprichwörtlichen Mut zur Lücke unter Beweis
stellen.
Anschließend erscheint uns ein Wort zur „Formeldichte“ in unserem Lehrbuch
angebracht. Obgleich es durchaus möglich ist, auch ein Statistikbuch völlig ohne
Formeln zu schreiben, halten wir dies nicht für sinnvoll. So schwer nachvollziehbar
dies gerade für den Anfänger sein mag: Formeln sind keine Schikane, sondern sie
erleichtern das Verständnis eines statistischen Zusammenhanges! Dies allerdings
nur, wenn man sich ihnen wie folgt nähert:
• Zunächst muß sichergestellt werden, daß über die Bedeutung jedes einzelnen
Symboles einer Formel vollständige Klarheit herrscht.
• Erst wenn dies geleistet ist, kann man sich an die eigentliche Aussage der Formel heranwagen. Machen Sie sich hierbei klar, was die Formel inhaltlich bedeutet. Entscheidend ist: Sie müssen in der Lage sein, ein eigenes Beispiel zu konstruieren, das den durch die Formel beschriebenen Zusammenhang illustriert.
Nur wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie davon ausgehen,
einen formalen Ausdruck wirklich verstanden zu haben. Strenggenommen dürften
Sie erst dann weiterlesen. Wenn statistische Formeln in der beschriebenen Weise
gehandhabt werden, liefern sie eine wertvolle Möglichkeit der Verständniskontrolle, die ein rein verbaler Text nicht ohne weiteres gewährleistet.
Abschließend eine letzte Bemerkung zu Excel: Die Funktionalität dieses Tabellenkalkulationsprogrammes erlaubt es, Berechungen und grafische Darstellungen statistischer Probleme vergleichsweise einfach und – auch bei großen Datenmengen –
schnell erstellen zu können. Der Leser sei jedoch davor gewarnt, die Ergebnisse
kritiklos zu akzeptieren, denn eine fehlerhafte Eingabe oder die Auswahl einer
unzutreffenden Funktion kann sehr leicht zu fehlerhaften und unsinnigen Resultaten führen. Grundsätzlich sollte jedes Ergebnis daraufhin überprüft werden, ob es
logisch überhaupt möglich und vor allem, ob es sinnvoll ist. Dies setzt natürlich
über die rein rechentechnischen Fertigkeiten hinaus ein inhaltliches Verständnis der
1 Vorbemerkungen
7
verwendeten statistischen Konzepte voraus. Dieses Verständnis zu vermitteln, ist
das Hauptanliegen des vorliegenden Werkes.
2
Grundlegende Begriffe und
Zusammenhänge
2.1
Statistik als Entscheidungshilfe
Der Hauptzweck statistischer Arbeit besteht in der Entscheidungsunterstützung in
einem durch Unsicherheit geprägten Umfeld. Die Unsicherheit wird durch die Statistik nicht aus der Welt geschafft, zumindest jedoch in einem begrenzten Umfang
kalkulierbar gemacht.
Es gibt zwei Arten von Unsicherheiten, welche mittels statistischer Methoden bewältigt werden können, die Datenunsicherheit und die Entscheidungsunsicherheit. Erstere wird durch den schönen Satz deutlich, wonach das Meer der Daten
stumm sei. Eine Aufgabe der Statistik besteht demnach darin, in einem Wust von
unstrukturierten und verwirrenden Daten Ordnung zu schaffen und Strukturen
sichtbar werden zu lassen. Dies geschieht im Rahmen der deskriptiven Statistik.
Bei der Bewältigung der zweiten Art von Unsicherheit, der Entscheidungsunsicherheit, geht es darum, mittels statistischer Verfahren die wahrscheinlichen Konsequenzen alternativer Entscheidungen herauszuarbeiten und zu quantifizieren. Auf
diese Weise erhält man eine rationale und nachvollziehbare Grundlage für die zu
treffende Entscheidung. Dies geschieht im Rahmen der induktiven Statistik.
2.2
Statistische Einheiten
Der Gegenstand einer statistischen Erhebung ist niemals ein einzelnes Objekt, sondern immer eine Menge von Objekten, die sogenannte Grundgesamtheit (statistische Masse, statistische Gesamtheiten, im Englischen auch häufig: „universe“ und
„population“). Aus welchen statistischen Elementen eine bestimmte Grundgesamtheit letztlich besteht, kann nicht allgemeingültig angegeben werden, sondern
wird immer durch das vorliegende Entscheidungsproblem festgelegt.
6
2 Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge
10
Beispiel 1.1
Der Manager eines deutschen Aktienfonds hat die Aufgabe, seinen Fond zu „bereinigen“,
d.h. er hat sämtliche Aktien, die in den letzten zwei Jahren die Renditeerwartungen nicht
erfüllt haben, zu verkaufen. Die Grundgesamtheit besteht hier aus allen Aktien, die sich zu
einem bestimmten Stichtag (z.B. dem 31.12 1996) in seinem Fond befinden.
Beispiel 1.2
Der Marketing-Chef eines Versicherungsunternehmens will wissen, ob die von Ihm initiierte Direct-Mailing-Aktion, durch die der Verkauf der speziellen Kapitallebensversicherung
„Rendite-Pro“ angeregt werden sollte, erfolgreich war. Die Grundgesamtheit besteht hier
aus allen Verträgen von „Rendite-Pro“, welche im Zeitraum der Mailing-Aktion abgeschlossen wurden.
Statistische Elemente können Bestandsgrößen (Zeitpunkt- bzw. Stichtagsbezogen), oder aber Stromgrößen (Zeitraum-bezogen) sein. Zwischen beiden Arten
von statistischen Elementen besteht folgende Beziehung:
Anfangsbestand+ Zugänge
(Bestandsgröße)
– Abgänge
=
(Stromgrößen)
Endbestand
(Bestandsgröße)
Beispiel 1.3
Anfangsbestand:
Anzahl der in der BRD ansässigen Unternehmen am 31.12.1995
(Bestandsgröße)
Zugänge:
Anzahl der Unternehmensneugründungen im Jahr 1996
(Stromgröße)
Abgänge:
Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im Jahr 1996
(Stromgröße)
Endbestand:
Anzahl der in der BRD ansässigen Unternehmen am
31.12.1996 (Bestandsgröße)
Läßt man die Abwanderung von Unternehmen ins Ausland unberücksichtigt, so gilt der
obenstehende Zusammenhang.
2.3
Merkmale, Merkmalsausprägungen und ihre
Skalierung
Das Interesse einer statistischen Erhebung ist letztlich nicht auf die Grundgesamtheit als solche gerichtet, sondern auf bestimmte Merkmale bzw. Merkmalsausprägungen ihrer Elemente.
Beispiel 1.4
Grundgesamtheit: Alle erwerbstätigen Personen in der BRD am 31.12.1995
Mögliche Merkmale, die für bestimmte Fragestellungen von Interesse sein könnten, sind:
Jahreseinkommen, Familienstand, Geschlecht, Alter, Intelligenzquotient usw. Entsprechen-
2.3 Merkmale, Merkmalsausprägungen und ihre Skalierung
11
de Merkmalsausprägungen sind beispielsweise 100 TDM, ledig, weiblich, 35 Jahre und
IQ=100.
Werden die Ausprägungen bestimmter Merkmale nicht durch Zahlen, sondern
durch verbale Angaben beschrieben, so spricht man von qualitativen Merkmalen.
Erfolgt die Messung dagegen durch Zahlen, so handelt es sich um quantitative
Merkmale.
Beispiel 1.5
Die in Beispiel (4) genannten Merkmale „Jahreseinkommen“ , „Alter“ und „IQ“ sind quantitativ, wogegen die Merkmale „Familienstand“ und „Geschlecht“ qualitativen Charakter
haben.
Abhängig davon, um welches Merkmal es sich im einzelnen handelt, werden
Merkmalsausprägungen anhand unterschiedlicher Skalierungen gemessen. Man
unterscheidet:
Nominalskalierung
Unterschiedliche Ausprägungen eines bestimmten Merkmals stehen gleichberechtigt nebeneinander.
Beispiel 1.6
Die Ausprägungen des Merkmals „Familienstand“ werden wie folgt verschlüsselt: ledig=1,
verheiratet=2, verwitwet=3 geschieden=4. Obgleich dann in der weiteren statistischen Analyse mit der Merkmalsausprägungsmenge {1; 2; 3; 4} gearbeitet wird, dürfen mit diesen
Zahlen keinerlei Berechnungen durchgeführt werden. Sie dienen ausschließlich der Identifikation einzelner Gruppen, z.B. der Gruppe aller Ledigen, mit einem Jahreseinkommen
über 100 TDM.
Ordinalskalierung
Zwischen unterschiedlichen Ausprägungen eines bestimmten Merkmals besteht
eine natürliche Rangordnung, so daß sich zwischen Ihnen eine „größer alsBeziehung“ herstellen läßt. Aber: Die Abstände (Differenzen) zwischen den einzelnen Merkmalsausprägungen dürfen nicht interpretiert werden.
Beispiel 1.7
Gemäß einer Rahmenprüfungsordnung für Hochschulen in Bayern (RAPO) werden unterschiedliche Prüfungsleistungen wie folgt verschlüsselt:
1=hervorragende Leistung.
2=Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt.
3=Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genügt.
4=Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt.
5=Leístung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht genügt.
Zwar besteht beispielsweise zwischen den Merkmalsausprägungen „2“ und „4“ eine „4
größer als 2“-Beziehung derart, daß die 4 auf eine schlechtere Prüfungsleistung hinweist als
die 2. Aber: Keinesfalls dürfen Differenzen oder gar Quotienten gebildet werden und aus
12
2 Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge
ihnen beispielsweise der Schluß gezogen werden: „Eine mit 2 bewertete Leistung ist doppelt so gut wie eine mit 4 bewertete“.
Intervallskalierung
Wie bei der Ordinalskalierung besteht auch auf Intervallskalen zwischen unterschiedlichen Ausprägungen eines bestimmten Merkmals eine natürliche Rangordnung, so daß sich auch hier eine „größer als“-Beziehung herstellen läßt. Darüberhinaus lassen sich auch die Differenzen zwischen den einzelnen Ausprägungen interpretieren. Aber: Eine Quotientenbildung sowie daraus abgeleitete Schlüsse sind
unzulässig.
Beispiel 1.8
Die Differenzen zwischen unterschiedlichen Ausprägungen des Merkmals „Temperatur“
können sinnvoll interpretiert werden. So ist beispielsweise die Aussage zulässig, in einer
bestimmten Fabrikhalle mit einer Temperatur von 30 °C, sei es um 15 °C heißer als in einer
anderen Halle, in der die Temperatur lediglich 15 °C beträgt. Unzulässig ist allerdings die
Aussage, in der ersten Halle sei es doppelt so heiß wie in der zweiten.
Beispiel 1.9
Das Merkmal Intelligenz wird üblicherweise (und nicht unumstritten!) durch den sogenannten Intelligenzquotienten gemessen. Über zwei Personen, A und B, von denen der A einen
IQ von 140 aufweist, während B nur 70 erreicht, können zulässigerweise folgende beiden
Aussagen gemacht werden:
A ist intelligenter als B (ordinale Interpretation)
A hat einen um 70 höheren Intelligenzquotienten als B (Differenzinterpretation)
Nicht zulässig ist jedoch die aus einer Quotientenbildung resultierende Aussage „A ist
doppelt so intelligent wie B“.
Verhältnisskalierung (metrische Skalierung)
Die Verhältnisskalierung kann behandelt werden wie die Intervallskalierung, zusätzlich ist es jedoch auch möglich, Quotienten zu bilden und sinnvoll zu interpretieren.
Beispiel 1.10
Die Ausprägungen der Merkmale „Jahreseinkommen“ und „Alter“ werden metrisch skaliert
und interpretiert; insbesondere ist die Quotientenbildung zulässig. So ist beispielsweise die
Aussage: „Person A ist nur halb so alt wie Person B, verdient aber das dreifache“ durchaus
sinnvoll.
An obenstehenden Beispielen sollte deutlich geworden sein, daß der Abfolge von
Nominal-, Ordinal-, Intervall- und metrischer Skalierung eine zunehmende Informationsdichte entspricht: Hinter metrisch skalierten Merkmalsausprägungen stecken mehr Informationen, als hinter Intervall-skalierten. Diese beinhalten mehr
Informationen als ordinal-skalierte, welche wiederum die Nominalskalierung an
2.4 Empirische Verteilungen
13
Informationsgehalt übertrifft. Man spricht daher in diesem Zusammenhang auch
von einem ansteigenden Skalierungsniveau.
Stetige versus diskrete Merkmalsausprägungen
Liegt ein bestimmtes Merkmal vor, so kann es sich um ein diskretes oder ein stetiges Merkmal handeln. Diskret ist es dann, wenn ihm innerhalb eines bestimmten
Bereiches aus den reellen Zahlen nur ganz bestimmte Werte entsprechen, stetig
dagegen, wenn es grundsätzlich jeden beliebigen Wert innerhalb dieses Bereichs
annehmen kann.
Beispiel 1.11
Betrachten wir den einmaligen Wurf zweier Würfel und interpretieren die geworfene Augensumme als Merkmal des Ereignisses „einmaliger Wurf zweier Würfel“. Die Ausprägungen diese Merkmals können nur ganz bestimmte Werte des Intervalls [2;12] reeller Zahlen
annehmen, nämlich die natürlichen Zahlen (2; 3; 4; ...;12). Gemäß unserer Definition handelt es sich somit um ein Merkmal mit diskreten Ausprägungen.
Beispiel 1.12
diskrete Merkmale:
Ø Anzahl der in einem Haushalt zur Verfügung stehenden Wohnräume
Ø Beschäftigte eines Betriebs
Ø Jahreseinkommen in DM
Stetige Merkmale:
Ø Zeitdauer für einen bestimmten Arbeitsgang
Ø Länge eines Werkstücks
Aufgrund der Grenzen der Meßgenauigkeit lassen sich auch stetige Merkmale in
der Praxis nur diskret erfassen. Andererseits werden aus rechentechnischen Gründen auch viele offensichtlich diskrete Merkmale mittels stetiger Verteilungsfunktionen analysiert. Davon jedoch später mehr.
2.4
Empirische Verteilungen
Man betrachte die folgenden Prüfungsergebnisse einer Gruppe von 15 Studenten in
den beiden Fächern „Statistik“ und „BWL“:
Student
Statistiknote
BWL-Note
A
3
3
B
4
5
C
5
5
D
1
3
E
3
4
F
4
1
G
3
5
H
5
1
I
4
3
J
2
4
K
5
2
L
5
2
M
5
1
N
4
4
O
5
2
Diese sogenannte Urliste ist eine völlig unsystematische und unstrukturierte Ansammlung von Daten, der nur sehr schwer sinnvolle Informationen zu entnehmen
2 Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge
14
sind. Trotzdem aber – und dies ist entscheidend – sind in dieser Urliste sämtliche
relevanten Informationen über die Grundgesamtheit (den fünfzehn Studenten) enthalten. Um gezielt Informationen entnehmen zu können, müssen die Daten „nur“
noch aufbereitet und strukturiert werden.
Eine sinnvolle Struktur wird beispielsweise hergestellt, wenn man die Daten wie
folgt anordnet:
Benotung
Anzahl der Statistikarbeiten
Anzahl der BWL-Arbeiten
1
1
3
2
1
3
3
3
3
4
4
3
5
6
3
Man beachte, daß mit obenstehender Strukturierung der Daten zugleich eine Datenverdichtung einhergeht, in dem Sinne, daß bestimmte Informationen verlorengehen, die in der Urliste noch enthalten sind. So ist beispielsweise der zweiten Tabelle nicht mehr zu entnehmen, welcher der Studenten eine bestimmte Benotung
erreicht hat. Dafür sieht man nun sehr deutlich, daß die Anzahl der unterschiedlichen Merkmalsausprägungen in beiden Fächern dieselbe ist, nämlich die Noten 15. Zudem sind die Prüfungsergebnisse von Fach zu Fach sehr unterschiedlich auf
die diversen Noten verteilt. So ist die Anzahl der BWL-Arbeiten auf die verschiedenen Noten gleichverteilt, wogegen es in Statistik eher eine Konzentration auf die
schlechteren Noten gibt. Statistik- und BWL-Noten sind somit unterschiedlich
verteilt. In diesem Sinne wird im Rahmen der Statistik von empirischen Verteilungen gesprochen.
Ist die empirische Verteilung einer Reihe von Merkmalsausprägungen bekannt, so
ist man damit im Besitz sämtlicher relevanter Informationen, die in dieser Reihe
enthalten sind. Die empirische Verteilung liefert somit eine vollständige Beschreibung der Merkmalsausprägungen einer Grundgesamtheit.
Neben den empirischen gibt es auch eine Reihe von theoretischen Verteilungen,
von denen wir in Abschnitt 4 die wichtigsten kennenlernen werden.
2.5
Häufigkeiten
Gegeben seien insgesamt N Merkmalsausprägungen x1; ...; xN, wovon K=N unterschiedlich sind. Die Merkmalsausprägungen seien zudem der Größe nach geordnet,
d.h. x1≤ x2≤ x3≤ ..... ≤xN. Dann gelten folgende Definitionen:
2.5 Häufigkeiten
15
Absolute Häufigkeit
Die absolute Häufigkeit hi einer Merkmalsausprägung xi (i=1;...:N) ist die Anzahl
der Elemente in der Grundgesamtheit mit genau dieser Merkmalsausprägung.
Relative Häufigkeit
Die relative Häufigkeit fi einer Merkmalsausprägung xi (i=1;...;N) entspricht der
absoluten Häufigkeit hi, dividiert durch die Gesamtzahl N aller Elemente der
Grundgesamtheit. Sie mißt den prozentualen Anteil der Elemente mit der Merkmalsausprägung xi an der Gesamtzahl aller Elemente.
fi =
hi
N
Für absolute bzw. relative Häufigkeiten gilt:
(i)
0 ≤ hi ≤ N
(ii)
0 ≤ fi ≤ 1
K
(iii)
∑ fi = 1
i =1
Beispiel 1.13
In einem Hörsaal befinden sich insgesamt 120 Studenten. Die Hälfte davon ist 19 Jahre alt,
dreißig Studenten sind 20 Jahre, zehn 18 Jahre, zwölf 22 Jahre und acht Studenten schließlich sind 25 Jahre alt. Die Anzahl aller Ausprägungen des Merkmals „Lebensalter“ beträgt
120 (N=120), die Anzahl unterschiedlicher Ausprägungen dagegen nur 5 (K=5). Die absoluten und relativen Häufigkeiten der verschiedenen Merkmalsausprägungen sind in folgender Tabelle zusammengefaßt:
x1=18
h1=10
f1=1/12
x2=19
h2=60
f2=1/2
x3=20
h3=30
f3=1/4
x4=22
h4=12
f4==1/10
x5=25
h5=8
f5=1/15
Liegt eine bestimmte Merkmalsausprägung xi vor, so geben die absolute bzw. die
relative Häufigkeit die Anzahl bzw. den Anteil der Elemente in der Grundgesamtheit an, die genau die Merkmalsausprägung xi aufweisen.
Für eine Reihe von Fragestellungen ist es jedoch interessant zu wissen, wieviel
Merkmalsträger bzw. welcher Anteil höchstens eine bestimmte Merkmalsausprägung xi aufweisen. Fragen dieser Art werden mit Hilfe der absoluten und relativen
Summenhäufigkeit beantwortet.
2 Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge
16
Absolute Summenhäufigkeit
Die absolute Summenhäufigkeit Hi einer (vorgegebenen) Merkmalsausprägung xi
gibt die Anzahl der Elemente an, die höchstens diese Merkmalsausprägung aufweisen:
i
Hi
=
∑ hj
j =1
Relative Summenhäufigkeit
Die relative Summenhäufigkeit Fi einer (vorgegebenen) Merkmalsausprägung xi
gibt den prozentualen Anteil der Elemente an allen Merkmalsträgern an, die höchstens diese Merkmalsausprägung aufweisen:
i
Fi
=
∑ fj
j =1
=
Hi
N
Für das Verständnis obenstehener Formeln ist es entscheidend, sich daran zu erinnern, daß die Merkmalsausprägungen x1;...;xN und damit auch die entsprechenden
absoluten und relativen Häufigkeiten der Größe nach geordnet sind und daß der
Index j nur über die unterschiedlichen absoluten und relativen Häufigkeiten summiert.
Beispiel 1.14
Die Tabelle aus Beispiel (13) läßt sich noch um die Information der absoluten und relativen
Summenhäufigkeiten erweitern:
x1=18
h1=10
f1=1/12
H1=10
F1=1/12
x2=19
h2=60
f2=1/2
H2=70
F2=7/12
x3=20
h3=30
f3=1/4
H3=100
F3=10/12
x4=22
h4=12
f4=1/10
H4=112
F4=112/120
x5=25
h5=8
f5=1/15
H5=120
F5=120/120
H4=112 bedeutet beispielsweise, daß von insgesamt 120 Studenten (Merkmalsträgern) 112
höchstens 22 Jahre alt sind (die Merkmalsausprägung 22 aufweisen). F2=7/12 dagegen
bedeutet, daß ein Anteil von 7/12 aller Studenten höchstens 19 Jahre alt ist.
Einen Überblick über die relativen Summenhäufigkeiten aller Merkmalsausprägungen liefert die Summenhäufigkeitsfunktion F(x). Sie gibt für jede (denkbare)
Merkmalsausprägung x den Anteil der Merkmaslsträger an, die höchstens die Ausprägung x aufweisen.
2.6 Statistische Analysemethoden
17
Summenhäufigkeitsfunktion
Gegeben seien die unterschiedlichen Merkmalsausprägungen xj (j=1.....K) sowie
die entsprechenden relativen Summenhäufigkeiten Fj (j=1.....K). Die Summenhäufigkeitsfunktion F(x) ist dann definiert als:
R
0 für: x ≤ ( ≠ ) x
|
F ( x) = S
F für: x ≤ x ≤ ( ≠) x
|T1 für: x ≥ x
1
j
j
j +1
( j = 1;.....;( K − 1)
K
Die auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrende Konstruktion der Summenhäufigkeitsfunktion wird klarer, wenn man sich folgende Zusammenhänge vor Augen hält: Da F(x) eine Funktion im mathematischen Sinne ist, muß sie jedem Wert
x genau einen Funktionwert F(x) zuordnen. Wenn durch F(x) also jeder Wert von x
abgedeckt sein muß, sind folgende Fälle zu betrachten:
(a) x< x1, d.h. der Wert, dem ein Funktionswert zugeordnet werden muß, ist kleiner
als die geringste Merkmalsausprägung der Grundgesamtheit. Dies bedeutet aber,
daß F(x), d.h. der Grundgesamtheitsanteil der höchstens diesen Wert x aufweist,
Null sein muß. Darum gilt für diesen Fall: F(x) = 0.
(b) xj≤ x< xj+1, d.h. der Wert, dem ein Funktionswert zugeordnet werden muß, liegt
zwischen der konkreten (aber beliebigen) Merkmalsausprägung xj und der nächstgrößeren Ausprägung xj+1, wobei in diesem Intervall xj noch enthalten ist, nicht
aber xj+1. Allen Werten von x, die in dieses Intervall fallen, wird von der Summenhäufigkeitsfunktion die relative Summenhäufigkeit Fj zugeordnet, d.h. F(x) = Fj.
(c) x≥ xK, , d.h. der Wert, dem ein Funktionswert zugeordnet werden muß, liegt
über der größten Merkmalsausprägung xK. Dies bedeutet aber, daß F(x), d.h. der
Grundgesamtheitsanteil der höchstens diesen Wert x aufweist, Eins sein muß. Darum gilt für diesen Fall: F(x) = 1.
Die Summenhäufigkeitsfunktion beinhaltet alle Informationen darüber, wie die
Gesamtzahl der Merkmalsausprägungen auf die unterschiedlichen Ausprägungen
verteilt sind. Sie wird daher auch als empirische Verteilungsfunktion bezeichnet.
2.6
Statistische Analysemethoden
Häufig ist es prinzipiell oder aus Kostengründen nicht möglich, von sämtlichen
Elementen einer interessierenden Grundgesamtheit die jeweiligen Merkmalsausprägungen zu analysieren. In diesen Fällen behilft man sich mit sogenannten Stichprobenerhebungen: Aus der Grundgesamtheit wird unter Beachtung ganz bestimmter Prinzipien eine Teilgesamtheit (Stichprobe) entnommen. Unter bestimmten Voraussetzungen (und mit Einschränkungen) kann dann von den Charakteristika der Teilgesamtheit auf die entsprechenden Charakteristika der Grundgesamtheit
18
2 Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge
geschlossen werden. Die Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, die hierbei gelten,
sind Gegenstand der schließenden bzw. induktiven Statistik.
Demgegenüber beschäftigt man sich im Rahmen der deskriptiven (beschreibenden) Statistik ausschließlich mit der Beschreibung und Darstellung von Grundgesamtheiten, wobei die Merkmalsausprägungen für sämtliche Elemente der Grundgesamtheit vorliegen müssen (Totalerhebung). Wichtig ist jedoch, daß eine Aussage darüber, ob eine bestimmte Menge von Merkmalsträgern eine Grundgesamtheit
oder aber eine Stichprobe darstellt, nicht absolut, sondern nur relativ zum Problem
getroffen werden kann. So können die Einwohner einer Großstadt durchaus als
Grundgesamtheit angesehen werden – nämlich dann, wenn man beispielsweise am
Wahlverhalten in genau dieser Stadt interessiert ist. Liegt aber eine andere Fragestellung vor – z.B. das zu erwartende Wahlverhalten in der Bundesrepublik – so
kann dieselbe Großstadt als eine (wahrscheinlich unzulängliche) Stichprobe aufgefaßt werden.
3
Beschreibung und Analyse von
Daten
„Das Meer der Daten ist stumm.“ Dieser schöne Satz verweist auf ein Problem,
dem man sich gegenübersieht, wenn aus einer Fülle von Informationen und Daten
Schlußfolgerungen gezogen werden müssen. Um zu verdeutlichen, wie weitreichend diese Problematik ist, stelle sich der Leser folgende Situation vor: Sie stehen
einer Gruppe von 500 Personen gegenüber und wollen wissen, wie es um das Jahreseinkommen in dieser Gruppe bestellt ist. Zu diesem Zweck erhalten Sie eine
Liste, auf der ohne jede Systematik das Jahreseinkommen jeder einzelnen der 500
Personen vermerkt ist. Obgleich diese Liste sämtliche relevanten Informationen
beinhaltet, hat sie zunächst fast keine Aussagekraft. Würde man Ihnen beispielsweise die Frage stellen, ob wohlhabende Gruppenmitgleider überwiegen, wüßten
Sie darauf vermutlich keine Antwort. Auch die Frage nach dem Unterschied zwischen dem reichsten und dem ärmsten Gruppenmitglied könnten Sie vermutlich
nicht ohne weiteres beantworten.
Um auf Fragen der genannten Art eine Antwort geben zu können, müssen vorliegende Daten zunächst unter dem Blickwinkel der Fragestellung strukturiert und
analysiert werden. Erst im Anschluß daran können die interessierenden Informationen geliefert werden. Dies geschieht in erster Linie mit Hilfe spezifischer Kennziffern.
Für ein korrektes Verständnis dieser Kennziffern ist es entscheidend, sich klarzumachen, daß sie vor allem dazu dienen, eine in der Regel unüberschaubare oder
sogar unbekannte Grundgesamtheit mittels einer einzigen oder einiger weniger
Kennziffern zu beschreiben. Dies bedeutet im Extremfall den Versuch, eine gesamte Datenflut mit nur einer einzigen Zahl zu charakterisieren. Vor diesem Hintergrund wird es nachvollziehbar, daß im Rahmen einer solchen Datenverdichtung
nicht alle Facetten der Grundgesamtheit berücksichtigt werden können. Oder anders ausgedrückt, letztlich muß man sich entscheiden, welcher Aspekt der Grundgesamtheit durch die entsprechende Kennziffer herausgearbeitet werden soll.
Handlungsleitend ist hierbei sinnvollerweise die konkrete Fragestellung, mit welcher der Statistiker an die Grundgesamtheit herangeht.
6
3 Beschreibung und Analyse von Daten
20
Entsprechend der Vielfalt möglicher Fragestellungen gibt es zur Beschreibung einer Grundgesamtheit eine umfangreiche Anzahl von Kennziffern. Im wesentlichen
versuchen sie jedoch alle, vier unterschiedliche Arten von Fragen zu beantworten,
für die im folgenden ein jeweils typisches Beispiel genannt wird:
• Wie hoch ist das mittlere Jahreseinkommen innerhalb einer bestimmten Gruppe
von Personen?
• Wie groß ist der Einkommensunterschied zwischen dem ärmsten und dem
reichsten Gruppenmitglied?
• Auf wieviel Prozent der Gruppenmitglieder entfallen 50 % des gesamten Einkommens der Gruppe?
• Inwieweit gibt es innerhalb der Gruppe eine Zusammenhang zwischen dem
Merkmal „Jahreseinkommen“ und dem anderen Merkmal „Alter“?
Fragen dieser Art werden im Rahmen der deskriptiven Statistik mit den speziellen
Kennziffern Mittelwerte, Streuungsmaße, Konzentrationsmaße und Korrelationsmaße beantwortet.
3.1
Mittelwerte: Wohin tendiert eine Verteilung?
Angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher Merkmalsausprägungen ist eine der
ersten Fragen die nach der „mittleren“ Merkmalsausprägung. Wie wir im folgenden
noch sehen werden, kann man diese Frage durchaus unterschiedlich beantworten.
Arithmetisches Mittel
Der wohl bekannteste Mittelwert ist das sogenannte arithmetische Mittel. Dies ist
die Kennzahl, welche auch der Laie vor Augen hat, wenn von „dem“ Mittelwert
oder vom Durchschnitt die Rede ist.
Arithmetisches Mittel
Gegeben seien insgesamt N Merkmalsausprägungen x1;...;xN , wovon K≤N unterschiedlich sind. Weiter seien mit fj (j=1;...;K) die relativen Häufigkeiten der verschiedenen Merkmalsausprägungen xj (j=1;...;K) bezeichnet. Das arithmetische
Mittel x der Merkmalsausprägungen x1;...;xN läßt sich dann auf zwei Arten berechnen:
(a)
x=
1
N
N
∑ xi
i =1
K
(b)
x =∑ f jxj
j =1
In Formel (a) wird mit dem Laufindex i über alle Merkmalsausprägungen summiert, wogegen in (b) mit dem Laufindex j nur die unterschiedlichen Merkmalsausprägungen addiert werden, vorher allerdings noch multipliziert („gewich-
3.1 Mittelwerte: Wohin tendiert eine Verteilung?
21
tet“) mit ihrer relativen Häufigkeit. Den Ausdruck (b) bezeichnet man daher auch
als gewichtetes arithmetisches Mittel.
Beispiel 2.1
Stellen wir uns in Anlehnung an Beispiel (13) vor, daß von insgesamt zehn Studenten vier
18 Jahre, drei 19 Jahre und zwei 20 Jahre alt sind. Einer schließlich sei 21 Jahre alt. Während die Anzahl aller Ausprägungen des Merkmals „Lebensalter“ zehn beträgt (N=10), gibt
es lediglich vier unterschiedliche Ausprägungen (K=4). Es ergeben sich daher folgende
absolute und relative Häufigkeiten:
x1=18
h1=4
f1=2/5
x2=19
h2=3
f2=3/10
x3=20
h3=2
f3=1/5
x4=21
h4=1
f4=1/10
Gemäß obenstehender Definition läßt sich das arithmetische Mittel der unterschiedlichen
Lebensalter wie folgt alternativ berechnen:
1 10
18 + 18 + 18 + 18 + 19 + 19 + 19 + 20 + 20 + 21 190
x = ∑ xi =
=
= 19
(a)
10 i =1
10
10
4
(b)
x = ∑ f jxj =
j =1
4
3
2
1
18 + 19 + 20 + 21 = 19
10
10
10
10
Beispiel 2.2
Ein LKW fährt die Autobahnstrecke von Frankfurt nach Würzburg mit der konstanten Geschwindigkeit von 120 km/h. Den Rückweg von Würzburg nach Frankfurt dagegen legt er
auf der Landstraße mit einer konstanten Geschwindigkeit von 60 km/h zurück. Wie groß ist
die durchschnittliche Geschwindigkeit des LKW auf der gesamten Tour? Spontan werden
hier vermutlich die meisten Leser das arithmetische Mittel wie folgt berechnen:
120km / h + 60km / h 180km / h
=
= 90 km/h. Obgleich dieser Wert durchaus plausibel
2
2
erscheint, ist er trotzdem falsch. Die richtige Lösung ergibt sich als gewichtetes arithmetisches Mittel:
1h * 120km / h + 2h * 60km / h 240km
=
= 80km / h
3h
3h
Diesem Ergebnis liegt die folgende, einfache Überlegung zugrunde: Die Entfernung zwischen Frankfurt und Würzburg beträgt 120 km. Daher dauert die Fahrt nach Würzburg bei
einer Geschwindigkeit von 120 km/h genau eine Stunde. Für die Rückfahrt dagegen benötigt der LKW die doppelte Zeit, also zwei Stunden. Um die gesamte Strecke von 240 km
zurückzulegen braucht der LKW somit drei Stunden. Dies ergibt eine durchschnittliche
Geschwindigkeit von 240 km/3h=240/3 km/h = 80 km/h.
3 Beschreibung und Analyse von Daten
22
Geometrisches Mittel
Das arithmetische Mittel ist trotz seines großen Bekanntheitsgrades eine ungeeignete Kennziffer, wenn es sich bei den Größen, aus denen der Durchschnitt gebildet
werden soll, um prozentuale Veränderungsraten handelt. Beispiele hierfür sind die
Inflation (als Veränderung des Preisniveaus in % pro Zeiteinheit, meistens ein Jahr)
oder die Ausbreitungsrate einer Infektionskrankheit (als Zunahme der Zahl der
Infizierten in % pro Zeiteinheit).
Grundsätzlich gilt: Immer wenn ein Merkmal Auskunft darüber gibt, wie stark sich
eine bestimmte Größe innerhalb eines Zeitraumes prozentual verändert, darf aus
den verschiedenen Merkmalsausprägungen nicht das arithmetische Mittel gebildet
werden, sondern man muß auf das geometrische Mittel zurückgreifen.
Geometrisches Mittel
Gegeben seien insgesamt N in Prozent gemessenen Veränderungsraten x1;...;xN ,
wovon K≤N unterschiedlich sind. Weiter seien mit hj (j=1;...;K) die absoluten Häufigkeiten der unterschiedlichen Veränderungsraten xj (j=1;...;K) bezeichnet. Seien
yi:=1+xi (i=1;...;N) die entsprechenden Wachstumsfaktoren. Das geometrische Mittel GM(y) der Wachstumsfaktoren y1;...;yN läßt sich dann auf zwei Arten berechnen:
(a)
GM(y) = N y1 * y2 *.....* y N
(b)
GM(y)= N y h 1 * y h 2 *.....* y h K
Das geometrische Mittel GM(x) der Merkmalsausprägungen x1;...;xN ergibt sich
durch GM(x)= GM(y)-1.
1
2
K
Beträgt eine Wachstumsrate beispielsweise 3% und eine andere -2% („negatives
Wachstum“), so ergeben sich die entsprechenden Wachstumsfaktoren als 1+3% =
1+
3
2
= 1+0,03 = 1,03 und 1+ (-2%) = 1+() =1-0,02 = 0,98.
100
100
Beispiel 2.3
Dem Vermögensverwalter einer Großbank werden von einem Kunden DM 100.000,- mit
dem Auftrag anvertraut, dieses Geld innerhalb von zwei Jahren möglichst zu vermehren. Im
ersten Jahr erwirtschaftet der Verwalter einen Vermögenszuwachs um 50 % auf DM
150.000,-, im zweiten Jahr dagegen einen Verlust um 50 %, d.h. das Vermögen halbiert
sich im zweiten Jahr von DM 150.000,- auf DM 75.000,-. Würde der Vermögensverwalter
die durchschnittliche Wertentwicklung des ihm anvertrauten Vermögens mit Hilfe des
arithmetischen Mittels berechnen, so ergäbe sich für die beiden Jahre ein Wert von
0,5 + ( −0,5)
= 0 %. Der Kunde würde es jedoch vermutlich nicht akzeptieren, wenn ange2
sichts eines absoluten Verlustes von DM 25.000,- nach zwei Jahren von einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 0 % die Rede wäre. Offensichtlich ist das arithmetische Mittel
im vorliegenden Fall ungeeignet. Dem Sachverhalt gerecht wird man dagegen mit dem
3.1 Mittelwerte: Wohin tendiert eine Verteilung?
23
geometrischen Mittel. Hierzu transferieren wir die prozentualen Veränderungen zunächst in
die entsprechenden Wachstumsfaktoren:
Jahr
1
2
Veränderungsrate x
+ 50 % = 0,5
- 50 % = – 0,5
Wachstumsfaktor y
1+0,5 = 1,5
1+(-0,5) = 0,5
Das geometrische Mittel der Wachstumsfaktoren errechnet sich dann als:
GM(y) = 1,5 * 0,5 = 0,75 = 0,866025.... . Das geometrische Mittel der Veränderungsrate
dagegen beträgt: GM(x) = 0,866025 – 1 = – 0,133975 = – 13,3975 %. Dieser Wert stimmt
mit dem tatsächlichen Sachverhalt überein: Wenn ein Anfangsvermögen von DM 100.000,über zwei Jahre hinweg jedes Jahr um 13,4 % an Wert verliert, so beträgt es nach zwei
Jahren nur noch DM 75.000,-.
Spötter behaupten, der Durchschnittswert sei der Wert, welcher tatsächlich noch
niemals beobachtet worden sei. Damit ist gemeint, daß sich bei der Berechnung
von Mittelwerten häufig Werte ergeben, die als konkrete Merkmalsausprägungen in
gewisser Weise unsinnig sind. So beträgt beispielsweise die durchschnittliche Anzahl von Kindern in deutschen Familien, die mindestens ein Kind haben, 1,64 Kinder. Berücksichtigt man auch Familien ohne Kinder, so ergibt sich eine durchschnittliche Kinderzahl pro Familie von 0,99 Kindern. Es wird sich aber nur sehr
schwer eine Familie finden lassen, die tatsächlich 1,64 bzw. 0,99 Kinder hat.
M.a.W., die durchschnittliche Anzahl von Kindern entspricht einem Wert, der als
tatsächliche Ausprägung des Merkmals „Kinderanzahl“ gar nicht „zulässig“ ist.
Nicht zuletzt aus diesem Grund weicht man häufig auf die alternativen Mittelwerte
Modus und Median aus.
Modus
Modus
Der Modus einer Reihe von Merkmalsausprägungen ist der Wert, der in dieser Reihe am häufigsten vorkommt.
Beachte, daß es in einer Reihe von Merkmalsausprägungen mehrere Modi geben
kann.
Beispiel 2.4
Der Gast eines Spiel-Casinos glaubt durch sorgfältige Beobachtung der rollenden Kugeln
Gesetzmäßigkeiten im Spielverlauf entdecken zu können, um auf diese Weise gegen die
Bank zu gewinnen. Hierzu notiert er das Ergebnis von insgesamt 1.000.000 Drehungen der
Roulette-Scheibe und stellt fest, daß die Kugel sowohl bei der Zahl „16“ als auch bei der
„5“ am häufigsten zum Stillstand kommt. Hieraus zieht er den Schluß, daß er mit der „16“
und der „5“ höhere Gewinnchancen als mit den anderen Zahlen hat. (Wie wir in Abschnitt
3 sehen werden, macht unser Spieler hierbei einen Denkfehler!)
3 Beschreibung und Analyse von Daten
24
Median
Häufig ist es sehr hilfreich, für eine Reihe von Merkmalsausprägungen als zusätzliche Information den Wert zu kennen, der „im Zentrum“ dieser Datenmenge liegt.
Diese Information wird durch den sogenannten Median oder auch Zentralwert
geliefert. Als Median wird daher der Wert gewählt, der in einer Reihe von der Größe nach geordneten Merkmalsausprägungen genau in der Mitte liegt. Alternativ
formuliert: „Links“ und „rechts“ vom Median liegen jeweils 50 % der kleinsten
und 50 % der größten Merkmalsausprägungen.
Median
Gegeben seien insgesamt N Merkmalsausprägungen x1;...;xN. Diese seien der Größe nach geordnet, d.h. x1≤ x2≤ x3≤ ..... ≤xN. Der Median -Me(x)- errechnet sich
dann wie folgt:
(a)
N ist eine ungerade Zahl
(b)
N ist eine gerade Zahl
Me(x) =
Me(x) = x N +1
2
L
M
M
N
1
xN + xN
+1
2 2
2
O
P
P
Q
Bei einer ungeraden Anzahl von Ausprägungen entspricht der Median einer
konkreten Merkmalsausprägung. Ist die Anzahl der Ausprägungen dagegen gerade,
so wird er als das einfache arithmetische Mittel aus den beiden in der Mitte
liegenden Merkmalsausprägungen gebildet.
Was den Median als Mittelwertkennziffer u.a. interessant macht, ist die Eigenschaft, daß er – im Gegensatz beispielsweise zum arithmetischen oder geometrischen Mittel – von sogenannten „Ausreißern“, d.h. von ungewöhnlich großen (oder
kleinen) Merkmalsausprägungen nicht beeinflußt wird.
Beispiel 2.15
Eine neu gegründete Privatuniversität wirbt damit, daß ihre mittlerweile 15 Absolventen
mit einem durchschnittlichen Anfangsgehalt von DM 75.333,- ins Berufsleben starten. Je
nachdem, wie dieser Durchschnitt berechnet wird, kann diese Information die tatsächlichen
Verhältnisse widerspiegeln, sie kann aber auch einen falschen Tatbestand suggerieren.
Nehmen wir an, die Anfangsgehälter der fünfzehn Absolventen sind wie folgt verteilt:
xj
hj
fj
DM 60.000,3
3/15
DM 70.000,4
4/15
DM 80.000,4
4/15
DM 85.000,2
2/15
DM 90.000,2
2/15
In diesem Fall werden die tatsächlichen Gehälter mehr oder weniger gut durch das arithmetische Mittel von DM 75.333,- repräsentiert; die Universitätswerbung spiegelt die tatsächlichen Verhältnisse wider. Etwas anders liegt der Sachverhalt bei folgender Verteilung der
Anfangsgehälter:
3.2 Streuungsmaße: Wie variabel ist eine Verteilung?
xj
hj
fj
DM 30.000,3
3/15
DM 35.000,4
4/15
DM 40.000,4
4/15
DM 42.500,3
3/15
25
DM 612.495,1
1/15
Nun verdienen von den insgesamt 15 Absolventen immerhin 14 einen Betrag zwischen DM
30.000,- und DM 42.500,- und lediglich einer hat ein exorbitant hohes Einkommen. Dieses
wiederum ist sicherlich nicht auf den Abschluß an der Privatuniversität zurückzuführen,
sondern kann vermutlich aufgrund anderer Besonderheiten erzielt werden. Trotzdem ergibt
sich – wie man leicht nachprüfen kann – als arithmetisches Mittel auch hier ein Durchschnittsgehalt von DM 75.333,-. Offensichtlich spiegelt das arithmetische Mittel nicht den
tatsächlichen Sachverhalt wider. Anders verhält es sich mit dem Median: Er beträgt für die
erste Tabelle DM 80.000,-, für die zweite dagegen DM 40.000,-. Der Median ( und übrigens auch der Modus) berücksichtigt somit die sich verändernden Konstellationen beim
Übergang von der ersten zur zweiten Tabelle.
Sowohl arithmetisches und geometrisches Mittel als auch Modus und Median sind
Kennziffern, welche die Frage beantworten, wo „die Mitte“ einer bestimmten Verteilung von Merkmalsausprägungen liegt bzw. wohin sie tendiert. Wie wir gesehen
haben, wird diese Frage von den bisher vorgestellten Kennziffern – die man auch
als Lageparameter bezeichnet – auf durchaus unterschiedliche Art und Weise beantwortet. Jede hat sowohl Vor- als auch Nachteile: Vorteile, weil sie ganz bestimmte Aspekte der Verteilung gezielt in den Vordergrund rückt; Nachteile, weil
andere Aspekte dadurch unterdrückt werden müssen. Für einen sinnvollen Einsatz
ist die genaue Kenntnis dieser Zusammenhänge entscheidend; nur so können Lageparameter problemadäquat angewendet werden.
Selbst der reflektierteste Umgang kann allerdings nicht verhindern, daß mit einem
Lageparameter – welchem auch immer – ein wichtiger Aspekt ausgeklammert
bleibt, nämlich die Frage, wie variabel, bzw. wie breit gestreut eine bestimmte Verteilung ist.
3.2
Streuungsmaße: Wie variabel ist eine Verteilung?
Nachdem die Frage geklärt ist, wohin eine bestimmte Verteilung tendiert, rückt
eine weitere Frage in den Vordergrund: Wie divers ist die Verteilung, d.h. wie breit
sind die Merkmalsausprägungen um das – wie auch immer errechnete – „Zentrum“
der Verteilung gestreut? Man spricht hier auch von der Variabilität einer Verteilung.
Wie schon bei den Mittelwerten gibt es auch bei den Streuungsmaßen auf diese
Frage unterschiedliche Antworten.
26
3 Beschreibung und Analyse von Daten
Spannweite
Die einfachste Antwort auf die Frage nach der Streuungsbreite einer Verteilung
liefert die Spannweite. Sie entspricht der Differenz aus der größten und kleinsten
Merkmalsausprägung.
Spannweite
Gegeben seien insgesamt N Merkmalsausprägungen x1;...;xN. Diese seien der Größe nach geordnet, d.h. es gilt x1≤ x2≤ x3≤ ..... ≤xN. Die Spannweite -SW(x)- errechnet sich dann als:
SW(x) = xN – x1
Interquartilsspanne
Häufig tritt bei der Analyse von Verteilungen das Problem auf, daß es – aus unterschiedlichen Gründen, meistens ist die Ursache aber ein Datenfehler – mehr oder
weniger große „Ausreißer“, d.h. aus dem üblichen Rahmen fallende Merkmalsausprägungen gibt. In solchen Fällen bietet sich die Interquartilsspanne als Streuungsmaß an, denn mit ihrer Hilfe wird zwar ebenfalls eine Art Spannweite bestimmt, allerdings erst nachdem die 25 % geringsten und die 25 % größten Merkmalsausprägungen ausgeschlossen wurden. Bei der konkreten Berechnung geht
man daher wie folgt vor:
(a) Zunächst werden sämtliche Merkmalsausprägungen in eine der Größe nach
geordnete Reihenfolge gebracht.
(b) Anschließend werden die Ausprägungen in zwei Gruppen eingeteilt – eine
Gruppe der geringen und eine Gruppe der großen Ausprägungen. Zwischen diesen
beiden Gruppen liegt der Median, bzw. wenn der Median selbst eine Merkmalsausprägung ist, wird er jeder Gruppe zugerechnet.
(c) Nun wird von beiden Gruppen der Median gebildet. Den Median der ersten
Gruppe nennt man erstes Quartil Q1, den der zweiten Gruppe drittes Quartil Q3.
Das zweite Quartil Q2 entspricht hierbei dem Median aller Merkmalsausprägungen: Q2 = Me(x)
(d) Die Interquartilsspanne ist nun nichts anderes als die Differenz aus dem dritten
und ersten Quartil: IQS(x) = Q3-Q1
Die exakte Definition der Interquartilsspanne lautet:
Interquartilsspanne
Gegeben seien die der Größe nach geordneten Merkmalsausprägungen x1;...;xN,
sowie deren Median Me(x). Weiter liege vor das erste Quartil Q1 sowie das dritte
Quartil Q3. Dann gilt für die Interquartilsspanne IQS(x):
IQS(x) = Q3 – Q1
3.2 Streuungsmaße: Wie variabel ist eine Verteilung?
27
Die Interquartilsspanne ist somit nichts anderes als die Spannweit der „in der Mitte“ liegenden Merkmalsausprägungen.
Varianz und Standardabweichung
Das bei weitem bekannteste und in den verschiedensten Anwendungen bedeutsamste Streungsmaß ist die Varianz, bzw. die daraus abgeleitete Standardabweichung.
Die Grundidee der Varianz ist es, eine Art durchschnittlicher Abweichung vom
Mittelwert zu bestimmen. Es ist daher naheliegend hierfür den folgenden Ausdruck
zu berechnen:
1
N
N
∑ ( xi − x )
i =1
Der Ausdruck in der Klammer gibt die Abweichung der Merkmalsausprägung xi
vom Mittelwert (d.h. vom arithmetischen Mittel) an. Der Rest der Formel macht
nicht anderes, als den Durchschnitt (wieder im Sinne des arithmetischen Mittels)
all dieser Abweichungen zu bestimmen. Mit obenstehender Formel hätte man somit
eine durchaus akzeptables Streuungsmaß, wenn damit nicht ein kleines Problem
verbunden wäre: Um welche Merkmalsausprägungen immer es sich handeln mag,
und wie auch immer diese verteilt sind: Die durchschnittliche Abweichung vom
Mittelwert gemäß der obenstenstehenden Formel ist definitiongemäß immer Null!
Der Grund für dieses unerfreuliche Ergebnis liegt in der Konstruktion des Mittelwertes. Ein Mittelwert ist ja nichts anderes als die durchschnitttliche Merkmalsausprägung aller Merkmalsausprägungen. Vor diesem Hintergrund sollte es eigentlich
nicht überraschen, wenn sich positive und negative Abweichungen im Durchschnitt
aufheben, so daß die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnitt wiederum
Null ergibt. Dieser Zusammenhang läßt sich auch mathematisch „beweisen“, was
im folgenden Beispiel geschieht. Der Leser ist aufgefordert, dieses Beispiel nachzurechnen, insbesondere um eine größere Vertrautheit mit dem Durchschnittsbegriff zu erlangen.
Beispiel 2.6
Sei (x1;...;xN ) eine beliebige Reihe von Merkmalsausprägungen und sei x das arithmeti1 N
sche Mittel daraus, d.h. x = ∑ xi . Dann gilt:
N i =1
1 N
1 N
1 N
(
x
−
x
)
=
x
−
∑ i
∑ i N ∑x
N i =1
N i =1
i =1
=
1
N
N
1
∑ xi − N N * x
i =1
= x – x = 0.
3 Beschreibung und Analyse von Daten
28
Da die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert somit als Streuungsmaß aus
„technischen“ Gründen ausscheidet, geht es nun darum, ein Streuungsmaß zu finden, das zum einen keine technischen Probleme bereitet, zum anderen aber die
Grundidee einer Art „mittleren“ Abweichung vom Mittelwert weiter beinhaltet.
Eine Möglichkeit besteht darin, hierfür das arithmetische Mittel der betragsmäßigen Abweichungen vom Mittelwert zu verwenden, d.h., folgenden Ausdruck zu
bilden:
1
N
N
∑ xi − x
i =1
Der offensichtliche Vorteil liegt darin, daß durch die Betragsbildung vermieden
wird, daß sich negative und positive Abweichungen aufheben. In der Tat ist dieses
Maß der sogenannten mittleren absoluten Abweichung durchaus geläufig. Letztlich durchgesetzt hat es sich jedoch aus einer Reihe von Gründen nicht.
Stattdessen wird dem Problem, daß sich negative und positive Abweichung gegenseitig aufheben, üblicherweise durch Quadrierung ausgewichen. Konkret geschieht
dies durch die Verwendung der empirischen Varianz als Streuungsmaß. Diese ist
daher als arithmetisches Mittel der Abweichungsquadrate konstruiert.
Empirische Varianz
Gegeben seien die Ausprägungen x1;...;xN eines beliebigen Merkmals sowie der
entsprechende Mittelwert x . Die empirische Varianz VAR(x) ergibt sich dann als:
1
N
VAR(x) =
N
∑ ( xi − x ) 2
i =1
Wie wir noch sehen werden, ist es aus einer Reihe von Gründen sinnvoll, zwischen
einer empirischen und einer „theoretischen“ Varianz zu unterscheiden. Erstere dient
ausschließlich der Beschreibung eines vorliegenden („empirischen“) Datenmaterials, wogegen letztere v.a. im Rahmen der induktiven Statistik eingesetzt wird, womit wir uns noch ausführlich beschäftigen werden.
Der durch obenstehende Definition gelieferte Ausdruck für die Varianz läßt sich in
folgender Weise umformen:
N
1
N
∑ ( xi − x ) 2
=
1
N
∑ (x
=
1
N
L
∑x
M
N
VAR(x) =
i =1
2
i
N
i =1
2
i
− 2 xi x + x 2 )
N
N
i =1
i =1
− 2 x ∑ xi + ∑ x
O
P
Q
3.2 Streuungsmaße: Wie variabel ist eine Verteilung?
=
=
=
N
1
N
∑ xi 2 − 2 * x * x + N N * x 2
1
N
∑ xi 2 − 2 * x 2 + x 2
1
N
29
1
i =1
N
i =1
N
∑ xi 2 − x 2 .
i =1
Die obenstehende Umformung hat vor allem praktische Konsequenzen. Denn damit ist gezeigt, daß die Varianz in zwei Varianten ausgedrückt werden kann.
1. Variante:
2. Variante:
VAR(x)=
VAR(x) =
N
1
N
∑ ( xi − x ) 2
1
N
∑ xi 2 − x 2
i =1
N
i =1
Variante 1 entspricht unserer Definition der Varianz. Dies ist die Form, in der sie
inhaltlich sinnvoll interpretiert werden kann. Demnach ist sie das arithmetische
Mittel der quadrierten Abweichungen.
Variante 2 hat sich durch eine Reihe von relativ simplen mathematischen Umformungen ergeben. Die Bedeutung von Variante 2 liegt vor allem in der Anwendung:
Wie man bereits an der Formel erkennen kann, ist die Berechnung einer konkreten
Varianz einfacher, wenn man Variante 2 zugrundelegt. Variante 2 dient daher ausschließlich der Vereinfachung von konkreten Berechnungen. Im Zeitalter der EDV
wird dieser Vorteil jedoch immer unbedeutender.
Beispiel 2.7
Folgende Tabelle enthält die Bevölkerungsanzahl aller Länder der Europäischen Gemeinschaft.
3 Beschreibung und Analyse von Daten
30
Land
Deutschland
Belgien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien u. Nordirland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal
Schweden
Spanien
Bevölkerungsanzahl in Millionen
81,54
10,13
5,22
5,10
57,22
10,28
57,90
3,53
57,14
0,41
15,42
8,04
9,89
8,82
39,06
Dies ergibt eine europäische Geamtbevölkerung von 369,70 Mio Personen und einen
Durchschnitt pro Land von 369,70 Mio /15 = 24,65 Mio Personen. Der Leser ist aufgefordert, zur Übung die Varianz der Bevölkerungsanzahl mit beiden Formeln zu ermitteln. Als
Ergebnis sollte er den Wert von 647, 09 Mio (Personen)2 errechnen.
Durch die Quadrierung der Mittelwertabweichungen ergibt sich der unangenehme
Nebeneffekt, daß die Dimension der Varianz, d.h. die Einheit, in der sie gemessen
wird, nicht mehr der Dimension des Mittelwertes entspricht. Dies wird auch anhand obenstehenden Beispiels deutlich, in dem der Mittelwert in der Einheit „Personenanzahl“ gemessen wird, die Varianz dagegen in der Einheit „Personenanzahl
zum Quadrat“.
Um diese unschöne Eigenheit der Varianz als Streuungsmaß zu beheben und um
damit zugleich eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Mittelwert herzustellen, bildet man aus der Varianz durch einfaches Radizieren („Wurzelziehen“) die Standardabweichung.
Standardabweichung
Gegeben seien die Ausprägungen x1;...;xN eines beliebigen Merkmals, der entsprechende Mittelwert x sowie die Varianz VAR(x). Dann ergibt sich die
Standardabweichung SAW(x) als:
SAW(x)
= VAR ( x )
=
1
N
N
∑ (x
i =1
i
− x)2
3.2 Streuungsmaße: Wie variabel ist eine Verteilung?
31
Der entscheidende Vorteil der Standardabweichung liegt darin, daß sie in exakt
derselben Einheit gemessen wird wie die entsprechenden Lageparameter. Dies
erleichtert insbesondere die Interpretation von konkreten Auswertungen, in denen
diese Kennziffer angewendet wird. In diesem Zusammenhang ist es von besonderer
Bedeutung, sich über eine spezielle Interpretation der Standardabweichung klarzuwerden, die zwar formal gesehen nicht ganz korrekt ist, trotzdem aber sehr hilfreich sein kann. Es geht hierbei um folgendes: Die Quadrierung der Abweichungen
im Rahmen der Varianzberechnung geschieht ja im wesentlichen deshalb, um das
Problem zu umgehen, daß sich die (unquadrierten) Abweichungen im Durchschnitt
zu Null addieren. Zugleich handelt man sich durch den Quadrierungsprozeß den
Nachteil ein, daß nun „die Dimension nicht mehr stimmt“. Dies wird nun durch die
Verwendung der Standardabweichung als Streuungsmaß rückgängig gemacht, da
diese ja die Quadratwurzel aus der Varianz darstellt. Diese Radizierung wird jedoch
auf die gesamte Summe der quadrierten Abweichungen angewendet und nicht auf
jeden einzelnen Summanden. Da aber im allgemeinen der Zusammenhang
a1 + a2 +...+an <
2
2
2
a1 + a2 +...+ a n
2
2
2
gilt (und nicht die Gleichheit!), ist es
formal auch nicht korrekt, zu behaupten, daß die Standardabweichung einer Merkmalsausprägung der durchschnittlichen Abweichung von ihrem Mittelwert entspricht. In gewisser Weise – nämlich von der Konstruktion und der inneren Logik
der Standardabweichung her – gilt dieser Zusammenhang inhaltlich aber doch –
wenn auch nur in „nichtsauberer“ Weise. Für eine etwas laxe Umschreibung der
inhaltlichen Aussage einer Standardabweichungskennziffer ist diese Formulierung
daher sinnvoll. In der Tat hat sie sich auch und gerade in stark praxisorientierten
Erklärungen weitgehend durchgesetzt.
Beispiel 2.8
In Beispiel 2.7 ergab sich für die Anzahl der innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
lebenden Personen eine Gesamtzahl 369,70 Mio Personen, ein Durchschnitt pro Land von
24,65 Mio Personen sowie eine empirische Varianz von 647,09 Mio (Personen)2. Der Bezug dieser (quadrierten) Zahl zu den Bevölkerungszahlen der einzelnen Ländern (den
Merkmalsausprägungen) sowie zum arithmetischen Mittel wird erst deutlich, wenn wir
daraus die Quadratwurzel, d.h. die Standardabweichung bilden:
SAW(x)= 647,09 Mio( Personen) 2 = 24,65 Mio Personen
Die (nicht ganz saubere) Interpretation dieser Zahl lautet: Die durchschnittliche Abweichung der Bevölkerungszahl innerhalb der Europäischen Gemeinschaft vom Mittelwert
beträgt 24,65 Mio Personen.
Variationskoeffizient
Varianz und Standardabweichung sind sogenannte absolute Streuungsmaße. Dies
bedeutet, daß konkrete Werte dieser Kennziffern von der Größenordnung abhängig
sind, in der sich die entsprechenden Merkmalsausprägungen selbst bewegen. So ist
beispielsweise die Standardabweichung der Umsätze eines Milliardenkonzerns
3 Beschreibung und Analyse von Daten
32
sicherlich höher als die Standardabweichung der Umsätze eines kleinen Familienunternehmens. Dies hat nun die unangenehme Konsequenz, daß ein Standardabweichungsvergleich zwischen diesen beiden Unternehmen wenig aussagekräftig
ist. Um in solchen und ähnlich gelagerten Fällen Vergleichbarkeit herzustellen,
wird ein relatives Streuungsmaß, nämlich der Variationskoeffizient, verwendet.
Variationskoeffizient
Gegeben seien die Ausprägungen x1;...;xN eines beliebigen Merkmals, das entsprechende arithmetischeMittel x sowie die Standardabweichung SAW(x). Der Variationskoeffizient – VK(x) – ergibt sich als Quotient aus Standardabweichung und
arithmetischem Mittel:
VK(x) =
=
SAW ( x )
x
1
N
N
∑ ( xi − x ) 2
i =1
1
N
N
∑ xi
i =1
Durch die Quotientenbildung bei der Berechnung des Variationkoeffizienten kürzt
sich die Einheit, in der sowohl SAW(x) als auch AM(x) gemessen wird, einfach
weg; der Variantionskoeffizient wird dadurch zu einer dimensionslosen Zahl (zu
einem „Koeffizienten“).
3.3
Konzentrationsmaße: Auf wieviele
Merkmalsträger konzentriert sich eine Verteilung?
Neben den Fragen, wo der Mittelwert einer Verteilung liegt und wie stark diese
Verteilung um den Mittelwert „streut“, steht in vielen Auswertungen von Daten
eine andere Frage im Vordergrund: Man ist an einer Kennzahl interessiert, die Auskunft darüber gibt, ob die Merkmalsausprägungen auf einige (wenige) Merkmalsträger konzentriert sind, oder ob sie sich relativ gleichmäßig auf alle Merkmalsträger verteilen. In diesem Zusammenhang haben sich die folgenden Konzentrationsmaße bewährt.
Konzentrationsrate
Mit Hilfe der Konzentrationsrate wird die Frage beantwortet, wieviel Prozent der
gesamten Merkmalsausprägungssumme auf eine bestimmte vorgegebene Anzahl
von Merkmalsträgern entfällt. So läßt sich z.B. fragen, wieviel Prozent des insgesamt in der Industrie erzielten Gesamtumsatzes von den fünf größten Unternehmen
3.3 Konzentrationsmaße: Auf wieviele Merkmalsträger konzentriert sich
eine Verteilung?
33
erwirtschaftet wurde. Fragen dieser Art werden mit der Konzentrationsrate beantwortet.
Konzentrationsrate
Gegeben seien insgesamt N Merkmalsausprägungen x1;...;xN. Diese seien der Größe nach geordnet, d.h. x1≤ x2≤ x3≤ ..... ≤xN. Gegeben seien weiter die Anteile der
einzelnen Merkmalsausprägungen ander Summe aller Merkmalsausprägungen, d.h.
q1;q2;.....;qN mit qi =
xi
∀ i sowie eine beliebige vorgegebene Anzahl z von
N
∑x
i =1
i
Merkmalsträgern. Die Konzentrationsrate KR(x;z) gibt an, wieviel Prozent der
gesamten Merkmalssumme auf die z „größten“ Merkmalsträger entfallen:
N
KR(x;z) =
∑x
i
i = N − z +1
N
∑x
i =1
N
=
∑ qi
i = N − z +1
i
Der Anteil qi darf nicht mit der relativen Häufigkeit fi verwechselt werden. Während die relative Häufigkeit fi für eine vorgegebene Merkmalsausprägung xi angibt,
wie hoch der Anteil der Merkmalsträger mit genau dieser Ausprägung ist, wird mit
qi eine andere Frage beantwortet: Nun ist der Merkmalsträger vorgegeben und qi
gibt an, wieviel Prozent der gesamten Ausprägungssumme auf diesen Merkmalsträger entfällt.
Herfindahl-Index
Die Konzentrationsrate ist aufgrund ihrer Einfachheit und leichten Interpretierbarkeit eine sehr häufig verwendete Kennzahl. Ein Nachteil dieser Kennziffer ist, daß
sie nicht sämtliche Informationen verwertet, die in einer vorliegenden Verteilung
enthalten sind. So ist beispielsweise ein konkreter Wert der Konzentrationsrate
davon abhängig, welche Vorgabe man bezüglich der Anzahl der größten Unternehmen macht, d.h., welches z gewählt wird. Hier liegt ein gewisser Spielraum für
Willkür und Datenmanipulation, denn es werden nicht sämtliche, sondern nur Teile
der verfügbaren Informationen ausgewertet.
Dieses Manko wird durch den sogenannten Herfindahl-Index behoben, einer
Kennzahl der Konzentration, die sich zudem durch besondere Übersichtlichkeit
und leichte Berechenbarkeit auszeichnet.
3 Beschreibung und Analyse von Daten
34
Herfindahl-Index
Gegeben seien insgesamt N Merkmalsausprägungen x1;...;xN sowie die entsprechenden Anteile q1;...;qN mit
qi =
xi
N
∑ xi
(i=1;...;N). Der Herfindahl-Index HI(x) berechnet sich dann als:
i =1
N
∑ qi 2
HI(x) =
i =1
Bei völliger Gleichverteilung der Merkmalsausprägungen auf die N verschiedenen
Merkmalsträger gilt: q1=q2=.....=qN. Dies bedeutet insbesondere, daß es nur ein
Merkmalsausprägungsniveau gibt (K=1), d.h. es gilt auch x1=x2=.....=xN. Für diesen Fall läßt sich ein beliebiges qi ausdrücken als:
xi
qi =
=
N
∑x
i =1
xi
1
=
Nxi
N
(i=1;...;N)
i
Damit gilt aber für den Herfindahl-Index in einem Zustand ohne jede Konzentration der folgende Zusammenhang:
N
N
i =1
i =1
HI ( x ) = ∑ qi 2 = ∑
1I
F
F1 IJ = 1
G
HN JK= N G
HN K N
2
2
Herrscht dagegen die größtmögliche Konzentration, so bedeutet dies, daß sich die
gesamte Ausprägungssumme auf nur einen Merkmalsträger konzentriert. Ohne
hierbei die Allgemeinheit der folgenden Aussagen einzuschränken, unterstellen wir
der Übersichtlichkeit halber, daß dies der „letzte“ Merkmalsträger N ist. Dann gilt:
q1=0; q2=0;....; qN-1=0; qN=1. Der Herfindahl-Index nimmt dann folgenden Wert an:
N
HI ( x ) = ∑ qi = q N = 12 = 1
2
2
i =1
Im Falle maximaler Konzentration beträgt der Herfindahl-Index somit Eins. Wir
können somit zusammenfassen: Bei minimaler Konzentration gilt HI(x)=1/N, bei
maximaler Konzentration gilt HI(x)=1. Wie groß auch immer und wie verteilt auch
immer die Grundgesamtheit sein mag, der Herfindahl-Index bewegt sich im Intervall: 1/N≤HI(x)≤1.
Der Nachteil des Herfindahl-Indexes liegt darin, daß die jeweils kleinste Ausprägung des Indexes, d.h. 1/N von der Anzahl der Merkmalsträger N abhängig ist. So
ist der geringstmögliche Wert (d.h. der Wert bei absoluter Gleichverteilung) des
Herfindahl-Indexes bei nur zwei Merkmalsträgern ½, wogegen sich bei 100 Merkmalsträgern ein minimaler Wert von 1/100 ergibt. Diese Abhängigkeit vom Umfang der vorliegenden Grundgesamtheit schränkt die Anwendungsmöglichkeiten
3.3 Konzentrationsmaße: Auf wieviele Merkmalsträger konzentriert sich
eine Verteilung?
35
des Herfindahl-Indexes stark ein, da Konzentrationsvergleiche zwischen Grundgesamtheiten unterschiedlichen Umfanges fast nicht möglich sind. In diesem Sinne
ist auch der Herfindahl-Index – neben der Konzentrationsrate – ein absolutes Konzentrationsmaß.
Lorenz-Kurve
Die Lorenz-Kurve bietet eine besonders anschauliche Möglichkeit, die in einer
Verteilung liegende Konzentration graphisch zu verdeutlichen. Sie ist definiert als
die Funktion, welche jedem kumulierten Anteil an Merkmalsträgern den entsprechenden kumulierten Anteil an der Gesamtsumme der Merkmalsausprägungen
zuordnet.
Lorenz-Kurve
Gegeben seien die der Größe nach geordneten Merkmalsausprägungen x1;...;xN, die
entsprechenden Merkmalsausprägungsanteile q1;...;qN mit
qi =
xi
(i=1;...;N) sowie die Merkmalsträgeranteile w1;...;wN mit
N
∑ xi
i =1
wi = i/N (i=1;...;N). Die Lorenzkurve
L:{wi:i=1;...;N}→[0;1] derart daß gilt:
ist
dann
eine
Funktion
i
L( wi ) = ∑ q ν
(i=1.....N)
ν =1
Um sich Konstruktion und inhaltliche Bedeutung der Lorenz-Kurve klarzumachen,
betrachten wir noch einmal Beispiel 2.5 aus Abschnitt 2.1 In diesem Beispiel hatten
wir die beiden folgenden (fiktiven) Verteilungen der Startgehälter von Hochschulabsolventen in TDM (Tausend DM) gegeben:
Hochschule I: Anfangsgehälter der ersten 15 Absolventen in TDM
xj
hj
fj
60
3
3/15
70
4
4/15
80
4
4/15
85
2
2/15
90
2
2/15
Hochschule II: Anfangsgehälter der ersten 15 Absolventen in TDM
xj
hj
fj
30
3
3/15
35
4
4/15
40
4
4/15
42
3
3/15
612,495
1
1/15
Zur Ermittlung der Lorenzkurve benötigen wir die Merkmalsträgeranteile wi
(i=1;.....;N) sowie die Merkmalsausprägungsanteile qi (i=1;.....;N) für sämtliche
3 Beschreibung und Analyse von Daten
36
Merkmalsausprägungen (d.h. nicht nur der verschiedenen!), um mit diesen Anteilen
die Funktionswerte L(wi) der Lorenzkurve ermitteln zu können. Es ergeben sich
daher folgende Tabellen:
Hochschule I:
xi
qi
wi
L(wi)
x1-3=60
q1-3=0,053
w3=0,20
L(w3)=0,159
x4-7=70
q4-7=0,062
w7=0,467
L(w7)=0,407
x8-11=80
q8-11=0,071
w11=0,733
L(w11)=0,690
x12-13=85
q12-13=0,075
w13=0,867
L(W13)=0,841
x14-15=90
q14-15=0,08
w15=1
L(W15)=1
Hochschule II:
xi
qi
wi
L(wi)
x1-3=30
q1-3=0,027
w3=0,20
L(w3)=0,08
x4-7=35
q4-7=0,031
w7=0,467
L(w7)=0,204
x8-11=40
q8-11=0,035
w11=0,733
L(w11)=0,345
x12-14=42
q12-14=0,037
w14=0,933
L(w14)=0,458
x15=612,495
q15=0,542
w15=1
L(W15)=1
Um den Graph der Lorenzkurve zu erhalten, müssen lediglich die diversen Werte
der wi gegen die entsprechenden Werte der L(wi) abgetragen werden.
Wie man anhand der Definition der Lorenzkurve feststellen kann und wie auch an
obenstehenden Beispielen deutlich wird, äußert sich eine starke Ungleichverteilung
in einer extrem nach unten gewölbten Lorenzkurve, wogegen sie sich bei zunehmender Gleichverteilung immer mehr einer Diagonalen annähert. Eine bauchige
Gestalt der Lorenzkurve ist somit ein Indikator für eine mehr oder weniger starke
Ungleichverteilung.
Damit sind wir aber mit der Lorenzkurve im Vergleich zu den anderen Kennzahlen
etwas ins Hintertreffen geraten: Bisher war es möglich, den uns interessierenden
Sachverhalt (z.B. die Streuung einer Verteilung) durch eine einzige Zahl (z.B.
durch die Standardabweichung) auszudrücken. Dies scheint im Falle der Konzentration nun nicht mehr in befriedigender Weise zu gelingen, da das verwendete
Konzentrationsmaß entweder Unzulänglichkeiten aufweist (Konzentrationsrate,
Herfindahl-Index) oder aber, wie im Falle der Lorenzkurve, kein einzelner Wert,
sondern ein ganzer Kurvenzug ist. Aus diesem Dilemma verhilft uns der sogenannte Gini-Koeffizient.
3.3 Konzentrationsmaße: Auf wieviele Merkmalsträger konzentriert sich
eine Verteilung?
37
Gini-Koeffizient
L(wi)
1
50%
B
10%
50 %
1
wi
Betrachten wir obenstehende fiktive Lorenzkurve und stellen uns vor, daß mit ihr
gemessen wird, welches Ausmaß an Konzentration der „Wohlstand der Nationen“
aufweist. Der Argumentwert wi = 50 % bezeichnet den Anteil von 50 % der ärmsten Länder an der Gesamtzahl aller Länder und der Funktionswert L(wi) = 10 %
bedeutet, daß diese 50 % ärmsten Länder nur 10 % des Gesamtwohlstands auf sich
vereinen. Im Falle völliger Gleichverteilung müßte dieser Wohlstandsanteil dem
Anteil der Merkmalsträger entsprechen, d.h. er müßte ebenfalls 50 % betragen.
Hieraus wird deutlich, daß die Lorenzkurve im Falle völliger Gleichverteilung der
Diagonalen entspricht, wogegen sie sich mit zunehmender Konzentration immer
mehr dem Verlauf des Koordinatenkreuzes annähert. Dies wiederum bedeutet, daß
die Fläche B zwischen der Diagonalen und der Lorenzkurve umso größer wird, je
stärker die Konzentration ist, d.h. je stärker die Ausprägungen auf einige (wenige)
Merkmalsträger konzentriert sind. Aufgrund dieses Zusammenhanges bietet es sich
an, die Fläche B zwischen Diagonallinie und Lorenzkurve als Basis eines formalen
Konzentrationsmaßes zu verwenden. Genau diese Überlegung liegt dem GiniKoeffizienten zugrunde: Der Gini-Koeffizient entspricht dem Quotienten aus der
Fläche zwischen Diagonaler und Lorenzkurve und der gesamten Dreiecksfläche.
38
3 Beschreibung und Analyse von Daten
Gini-Koeffizient
Gegeben sei eine Lorenz-Kurve. Die Fläche zwischen der Diagonalen und der Lorenzkurve sei mit B bezeichnet. Dann ergibt sich der Gini-Koeffizient – GK –
durch:
B
GK =
Dreiecksgesamtfläche
Der Gini-Koeffizient ist bewußt in einer Weise konstruiert, die an der bereits erwähnten Eigenschaft der Lorenz-Kurve anknüpft: Ist das Ausmaß der Konzentration extrem gering, so entspricht die Lorenzkurve nahezu der Diagonalen; die Fläche
zwischen Lorenz-Kurve und Diagonalen ist fast Null; der Gini Koeffizient strebt
ebenfalls gegen Null. Ist das Ausmaß der Konzentration dagegen extrem hoch, so
verläuft die Lorenzkurve fast entlang dem Koordinatenkreuz; die Fläche zwischen
Lorenz-Kurve und Diagonalen entspricht fast der Gesamtfläche des Dreiecks; der
Gini-Koeffizient strebt gegen Eins. Der Gini-Koeffizient bewegt sich somit im
(rechtsoffenen) Intervall zwischen Null und Eins, wobei hohe Werte ein hohes und
niedrige Werte ein geringes Ausmaß an Konzentration anzeigen: GK∈[0; 1)
3.4
Korrelationsmaße: Wie gleichgerichtet sind zwei
verschiedene Verteilungen?
Im Rahmen statistischer Auswertungen spielt manchmal das Verhalten zweier
Merkmalsausprägungen relativ zueinander eine überragende Rolle. So gibt es Ausprägungspaare, die sich mehr oder weniger gleichlaufend verhalten: wenn sich eine
Ausprägung erhöht, steigt die andere ebenfalls und umgekehrt. Andererseits gibt es
jedoch auch Paare, die sich gegenlaufend verhalten: nimmt eine Ausprägung zu,
fällt die andere und umgekehrt.
Kovarianz
Die Kovarianz quantifiziert das Ausmaß des "Gleichlaufens" zweier Merkmale. Sie
ist definiert als das arithmetische Mittel des Produktes der Abweichungen beider
Merkmale von ihrem jeweiligen (arithmetischen) Mittelwert:
3.4 Korrelationsmaße: Wie gleichgerichtet sind zwei verschiedene
Verteilungen?
39
Kovarianz
Gegeben seien die Ausprägungen (x1;.....;xN) der Merkmals X sowie die Ausprägungen ( y1;.....;yN) des Merkmals Y. Gegeben seien weiter die arithmetischen Mittel x und y . Die Kovarianz
– KOV(x;y) – der beiden Merkmale X und Y errechnet sich dann als:
KOV(x;y) =
1
N
N
∑ [ xi − x ][ yi − y ]
i =1
Ähnlich der Varianz ist auch die Kovarianz eine unter Beteiligung aller Merkmalsausprägungen gebildete Summe. Allerdings ist jeder einzelne Summand das
Produkt der beiden Faktoren [xi- x ] und [yi- y ]. Der erste Faktor ist die Abweichung der Merkmalsausprägung xi vom Mittelwert x und der zweite Faktor ist die
Abweichung der Merkmalsausprägung yi vom Mittelwert y . Für jeden einzelnen
dieser Summanden sind folgende drei Fälle denkbar:
• [xi- x ][yi- y ] < 0; einer positiven oder negativen Abweichung der Merkmalsausprägung xi entspricht eine entgegengesetzte Abweichung der Ausprägung yi.
• [xi- x ][yi- y ] = 0; mindestens eine der beiden Merkmalsausprägungen weist
keine Abweichung von ihrem Mittelwert auf.
• [xi- x ][yi- y ] > 0; einer positiven oder negativen Abweichung xi entspricht eine
gleichgerichtete Abweichung yi.
Die Summation all dieser Abweichungsprodukte bewirkt nun, daß die Kovarianz
selbst drei Arten von Ausprägungen haben kann:
• Sie ist negativ, wenn die negativen, d.h. entgegengesetzt verlaufenden Abweichungsprodukte überwiegen.
• Sie ist Null, wenn sich entgegengesetzte und gleichgerichtete Abweichungen die
Waage halten.
• Sie ist positiv, wenn die positiven, d.h. gleichgerichtet verlaufenden Abweichungsprodukte überwiegen.
Korrelationskoeffizient
Die Spanne der Werte, welche Kovarianzen annehmen können, ist im Prinzip unbegrenzt. Es ist jedoch völlig ausreichend, das Ausmaß der Gleichläufigkeit zweier
Merkmale durch die Zahlen des realwertigen Intervalls [-1;+1] auszudrücken. Eine
solche Normierung wird erreicht, wenn man die Kovarianz zweier Merkmale
durch das Produkt ihrer jeweiligen Standardabweichungen teilt. Das Ergebnis ist
der sogenannte Korrelationskoeffizient
3 Beschreibung und Analyse von Daten
40
Korrelationskoeffizient
Gegeben seien die Ausprägungen (x1;.....;xN) des Merkmals X und die Ausprägungen ( y1;.....;yN) des Merkmals Y. Gegeben seien weiter die entsprechenden arithmetischen Mittel x und y sowie die Standardabweichungen SAW(X) und
SAW(Y). Der Korrelationskoeffizient δ(x;y) der beiden Merkmale X und Y errechnet sich dann als:
δ(x;y) =
KOV ( x; y )
SAW ( x ) * SAW ( y )
Ein Korrelationskoeffizient von +1 drückt eine perfekte Gleichläufigkeit, ein Wert
von -1 dagegen eine perfekte Gegenläufigkeit zweier Merkmale aus.
Zum Abschluß wollen wir uns noch einmal vor Augen führen, bei welchem Skalierungsniveau (vgl. Abschnitt 1.3) die verschiedenen Kennziffern, die wir bisher
erarbeitet haben, sinnvoll angewendet werden können. Folgende Tabelle gibt daher
für alle vier Skalierungsniveaus an, ob die Verwendung der jeweiligen Kennziffer
zu interpretierbaren Ergebnissen führt („Ja“) oder besser unterbleiben sollte
(„Nein“).
Nominal-
Ordinal-
Intervall-
Verhältnis-
skalierung
skalierung
skalierung
skalierung
Modus
Ja
Ja
Ja
Ja
Median
Nein
Ja
Ja
Ja
arithmetisches
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Spannweite
Nein
Nein
Ja
Ja
Interquartils-
Nein
Nein
Ja
Ja
Varianz
Nein
Nein
Ja
Ja
Standardab-
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Mittel
geometrisches
Mittel
spanne
weichung
Variationskoeffizient
3.4 Korrelationsmaße: Wie gleichgerichtet sind zwei verschiedene
Verteilungen?
41
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Lorenzkurve
Nein
Nein
Nein
Ja
GiniKoeffizient
Nein
Nein
Nein
Ja
Kovarianz
Nein
Nein
Ja
Ja
Korrelations-
Nein
Nein
Nein
Ja
Konzentrationsgrad
HerfindahlIndex
koeffizient
4
Grundlagen der
Wahrscheinlichkeitstheorie
Vor allem aus zwei Gründen ist es notwendig und sinnvoll, sich im Rahmen statistischer Grundlagen mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Fragen zu befassen. Zum
einen ist die Wahrscheinlichkeitstheorie ein eigenständiges Teilgebiet der Statistik
mit einer Fülle von Anwendungsmöglichkeiten. Zum anderen aber – und dies ist
der vielleicht wichtigere Grund – bildet die Wahrscheinlichkeitstheorie die Basis
der induktiven Statistik: Die Gesetzmäßigkeiten, welche den Prozeß des Schließens
von einer Stichprobe auf die unbekannte Grundgesamtheit beherrschen, sind die
Gesetze der Wahrscheinlichkeitstheorie. So kann man beispielsweise aus einer
vorliegenden Stichprobe die empirische Varianz ermitteln und die Frage stellen, ob
die (unbekannte) Varianz der Grundgesamtheit einen Wert hat, der „in der Nähe“
der empirischen Varianz liegt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit hierfür ist. Fragen dieser und ähnlicher Art, wie sie für die induktive Statistik charakteristisch
sind, sind wahrscheinlichkeitstheoretischer Natur. Der gesamte Prozeß des induktiven statistischen Schließens beruht auf den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie.
4.1
Ereignisse und ihre Verknüpfungen
Die Basis wahrscheinlichkeitstheoretischer Analyse ist der Begriff des zufälligen
Ereignisses. Unter einem Ereignis kann grundsätzlich jeder interessierende Sachverhalt oder Vorgang u.ä. verstanden werden. Aus Gründen besserer Übersichtlichkeit werden Ereignisse mit Hilfe von Symbolen beschrieben; sie werden formalisiert.
Wenn wir Ereignisse formalisieren (d.h. statt durch Worte mit Hilfe von Symbolen
beschreiben), bietet sich hierfür die allgemeinste mathematische Einheit an, nämlich die Menge. Ist im folgenden daher von einem beliebigen Ereignis X (oder auch
6
44
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
von den Ereignissen A, B, C, usw.) die Rede, so kann damit im Grunde jedes beliebige Geschehen oder jede beliebige Ausage bezeichnet sein.1
Sind Ereignisse als Mengen formalisiert, so lassen sich durch mengentheoretische
Verknüpfungen neue Ereignisse bilden. Damit ist ein fundamentales Prinzip angesprochen: Ereignisse sind darstellbar als logische Verknüpfung von zwei oder mehreren anderen Ereignissen. Einer logischen Verknüpfung entspricht hierbei eine
ganz bestimmte mengentheoretische Operation. Folgende Verknüpfungsarten stehen zur Verfügung:
zwei Ereignisse werden mit „und“ verknüpft; die entspre• Konjunktion:
chende mengentheoretische Operation ist die Durchschnittsbildung, die symbolisch als „ ∩ “ dargestellt wird.
• Disjunktion:
zwei Ereignisse werden mit „oder“ verknüpft; die entsprechende mengentheoretische Operation ist die Vereinigung, die symbolisch als
„ ∪ “ dargestellt wird.
• Negation:
ein Ereignis wird durch den Zusatz „nicht“ in sein Gegenteil verkehrt; die entsprechende mengentheoretische Operation ist die Komplementbildung, die symbolisch als „ ¬ “ dargestellt wird.
Konjunktion
Werden zwei Ereignisse mit „und“ verknüpft, so entsteht ein neues Ereignis, das
genau dann eintritt, wenn jedes der beiden Ereignisse, aus denen es zusammengesetzt ist, eintritt.
Beispiel 3.1
Gegeben seien folgende Ereignisse:
A:
Bei einmaligem Würfeln ergibt sich die Zahl 4
B:
Bei einmaligem Würfeln ergibt sich eine Zahl, die größer als 3 ist.
C:
Bei einmaligem Würfeln ergibt sich eine Zahl, die kleiner als 5 ist.
Offensichtlich gilt A=B ∩ C, da sich „die Zahl 4“ (Ereignis A) dann und nur dann ergibt,
wenn „eine Zahl größer 3“ (Ereignis B) und „eine Zahl kleiner 5“ (Ereignis C) gewürfelt
wird.
_________________
1
) Die einzige Beschränkung, der wir hierbei unterworfen sind, ist, daß die entsprechenden Mengen
bzw. Aussagen widerspruchsfrei konstruiert sein müssen. Ein Beispiel für eine nicht widerspruchsfrei konstruierte Menge ist „die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element
enthalten“. Grund: Für eine so definierte Menge – nennen wir sie A – kann letztlich nicht entschieden werden, ob sie sich selbst als Element enthält (ob sie zu A gehört) oder nicht. Ein Beispiel für eine nicht widerspruchsfreie Aussage ist: „Der Professor behauptet, daß alle Professoren
(immer) lügen.“ Grund: Es kann nicht zweifelsfrei entschieden werden, ob diese Aussage falsch
oder richtig ist. Für eine anschauliche Darstellung dieser und ähnlicher Probleme vgl. Hofstädter
(1985).
4.2 Zufallsexperimente, Ergebnis- und Ereignisräume
45
Disjunktion
Werden zwei Ereignisse mit „oder“ verknüpft, so entsteht ein neues Ereignis, das
genau dann eintritt, wenn mindestens eines der beiden Ereignisse, aus denen es
zusammengesetzt ist, eintritt.
Beispiel 3.2
Gegeben seien folgende Ereignisse:
A:
Bei einmaligem Würfeln ergibt sich die Zahl 6.
B:
Bei einmaligem Würfeln ergibt sich die Zahl 5.
C:
Bei einmaligem Würfeln ergibt eine Zahl, die größer als 4 ist.
Offensichtlich gilt C=A ∪ B, da sich „eine Zahl größer 4“ (Ereignis C) dann und nur dann
ergibt, wenn „die Zahl 6“ (Ereignis A) oder “die Zahl 5“ (Ereignis B) gewürfelt wird.
Negation
Wird ein Ereignis A mit dem Wörtchen „nicht“ versehen, so entsteht ein neues
Ereignis, das genau dann eintritt, wenn das Ereignis A nicht eintritt.
Beispiel 3.3
Gegeben sei folgendes Ereignis:
A:
Bei einmaligem Würfeln ergibt sich eine Zahl, die mindestens so groß ist
wie die 4.
Der Negation von A entspricht das Ereignis:
¬ A: Bei einmaligem Würfeln ergibt sich eine Zahl die kleiner als 4 ist.
Eine
alternative Formulierung für ¬ A lautet:
¬ A: Bei einmaligem Würfeln ergibt sich die Zahl 1 oder die Zahl 2 oder die
Zahl 3.
4.2
Zufallsexperimente, Ergebnis- und Ereignisräume
Häufig ist es nötig, begrifflich zwischen einem Ereignis und einem Ergebnis zu
unterscheiden. Hierbei ist „Ereignis“ der allgemeinere Begriff, d.h. jedes Ergebnis
ist zugleich auch eine Ereignis, wogegen ein Ereignis nicht notwendigerweise auch
ein Ergebnis sein muß.
Diese Zusammenhänge sind von so großer Bedeutung, daß es sinnvoll ist, die entsprechenden Begriffe und Hintergründe systematisch sauber und exakt einzuführen. Hierzu sind folgende Definitionen erforderlich:
Zufallsexperiment
Unter einem Zufallsexperiment versteht man die Beobachtung und Dokumentation
des Ausgangs eines beliebigen zufälligen Vorganges oder Geschehens.
46
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
Klassische Beispiele für Zufallsexperimente sind Glücksspiele. So ist der Wurf
eines Würfels eindeutig ein zufallsbehafteter Vorgang. Ein mögliches Zufallsexperiment besteht beispielsweise in der Beobachtung des Ausganges eines fünfmaligen
Wurfes.
Ereignis
Ein Ereignis ist ein konkreter Ausgang eines Zufallsexperiments.
Beispiel 3.4
Betrachten wir den einmaligen Wurf eines Würfels. Mit diesem Wurf zusammenhängende
mögliche Ereignisse sind beispielsweise:
A:
Es ergibt sich eine Zahl, die größer als 4 ist.
Ei:
Es ergibt sich die Zahl i (i=1,2,3,4,5,6)
Beachte, daß sich das Ereignis A als „oder-Verknüpfung“ der Ereignisse E5 und E6 darstellen läßt: A=E5 ∪ E6.
Ergebnis
Ein Ergebnis ist ein konkreter Ausgang eines Zufallsexperiments, der nicht als
„oder-Verknüpfung“ anderer Ereignisse dargestellt werden kann.
Beispiel 3.5
Mögliche Ereignisse aus dem einmaligen Wurf zweier Münzen sind:
A:
Mit mindestens einer der beiden Münzen Wurf eines „Kopfes“
B:
Mit zweiter Münze Wurf einer „Zahl“
C:
Mit erster Münze Wurf eines „Kopfes“
D:
Mit zweiter Münze Wurf eines „Kopfes“
Offensichtlich ist keines der Ereignisse zugleich auch ein Ergebnis, da sich jedes einzelne
als „oder“ Verknüpfung anderer Ereignisse darstellen läßt. So gilt beispielsweise für das
Ereignis A: A=C ∪ D. Die Ergebnisse dieses Zufallsexperiments sind:
E1:
Mit beiden Münzen Wurf eines „Kopfes“.
E2:
Mit erster Münze Wurf einer „Zahl“ und mit zweiter Münze Wurf eines
„Kopfes“.
E3:
Mit erster Münze Wurf eines „Kopfes“ und mit zweiter Münze Wurf einer
„Zahl“.
E4:
Mit beiden Münzen Wurf einer „Zahl“.
Nun wird auch deutlich, durch welche „oder“-Verknüpfungen sich die Ereignisse B, C, und
D darstellen lassen: B=E3 ∪ E4; C=E1 ∪ E3; D=E1 ∪ E2.
Ergebnisraum
Ein Ergebnisraum – häufig mit dem Symbol Ω bezeichnet – ist die Menge von
Ergebnissen eines Zufallsexperiments, von denen genau eines eintreten muß und
die sich als Ausgang eines Zufallsexperiments gegenseitig ausschließen.
4.2 Zufallsexperimente, Ergebnis- und Ereignisräume
47
Beispiel 3.6
Beim einmaligen Wurf einer Münze muß offensichtlich entweder Kopf (K) oder Zahl (Z)
geworfen werden. Damit erfüllt die Menge mit den Elementen Z und K die Bedingung des
Ergebnisraumes Ω , d.h. es gilt: Ω = {Z, K}.
Beispiel 3.7
Für den Ergebnisraum des einmaligen Wurfes von zwei Münzen (alternativ: zweimaliger
Wurf einer Münze) gilt: Ω = {(Z, Z); (K, Z); (Z, K); (K, K)}.
Beispiel 3.8
Gegeben seien die folgenden Ereignisse, die aus dem einmaligen Wurf eines Würfels resultieren können:
A:
Es ergibt sich eine Zahl, die größer als 4 ist.
B:
Es ergibt sich eine ungerade Zahl
C:
Es ergibt sich eine Zahl, die größer 2, aber kleiner 5 ist.
D:
Es ergibt sich eine Zahl zwischen 1 und 6
Ei:
Es ergibt sich die Zahl i (i=1, 2,3,4,5,6)
Diese Liste möglicher Ereignisse könnte noch um einiges verlängert werden, ein wichtiger
Zusammenhang läßt sich jedoch bereits der Liste A bis Ei (i=1,2,3,4,5,6) entnehmen: Obgleich es sich bei A bis Ei (i=1,2,3,4,5,6) um Ereignisse handelt, sind nur die sechs Ereignisse Ei (i=1,2,3,4,5,6) zugleich auch Ergebnisse und bilden gemeinsam den Ergebnisraum:
Ω = {E1, E2, E3,E4, E5, E6}. Grund: Genau ein Ei muß eintreten und keines der Ei läßt sich
als „oder-Verknüpfung“ anderer Ereignisse darstellen. Die Ereignisse A-D dagegen können
durch „oder-Verknüpfungen“ der Ergebnisse Ei (i=1,2,3,4,5,6) ausgedrückt werden:
A=E5 ∪ E6; B=E1 ∪ E3 ∪ E5; C= E3 ∪ E4; D= E2 ∪ E3 ∪ E4 ∪ E5. Ereignisse A bis D sind
daher keine Ergebnisse.
Ereignisraum
Ein Ereignisraum ist die Menge aller Ereignisse, die mit einem Zufallsexperiment
in Zusammenhang gebracht werden können. Mengentheoretisch ist der Ereignisraum die Potenzmenge P(Ω) des Ergebnisraumes:
Beispiel 3.9
Betrachten wir wieder die möglichen Resultate des einmaligen Wurfes einer Münze. Für
den Ergebnisraum Ω gilt: Ω={Z, K}. Die Potenzmenge von Ω ergibt sich nach den Regeln
der Mengenlehre als: P(Ω)={∅; {Z}; {K}; {Z, K}}. Die einzelnen Elemente der Potenzmenge sind wie folgt zu interpretieren:
∅
Weder Zahl noch Kopf wird geworfen (die alternative
Formulierung lautet „Kopf und Zahl wird geworfen“, woraus ersichtlich wird daß es sich
um ein unmögliches Ereignis handelt).
{Z}
Zahl wird geworfen.
{K}
Kopf wird geworfen.
{Z, K} Kopf oder Zahl wird geworfen.
Unter diesen Ereignissen repräsentiert die leere Menge ∅ das unmögliche und die Menge
{Z, K} das sichere Ereignis.
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
48
Beispiel 3.10
Gegeben seien die möglichen Ergebnisse eines Fußballspieles Ω={EA, EB, EU} mit der
inhaltlichen Bedeutung:
EA:
Mannschaft A gewinnt.
EB:
Mannschaft B gewinnt.
E U:
Unentschieden.
Die Potenzmenge von Ω ergibt sich nach den Regeln der Mengenlehre als:
P(Ω)={∅; {EA}; {EB}; {EU}; {EA, EB}; {EA, EU}; {EB, EU}; {EA, EB, EU}}. Die einzelnen
Elemente der Potenzmenge sind wie folgt zu interpretieren:
∅
Das Spiel hat kein Ergebnis (alternativ: Das Spiel gewinnt
Mannschaft A und Mannschaft B und endet unentschieden).
{EA}
Mannschaft A gewinnt.
{EB}
Mannschaft B gewinnt.
{EU}
Unentschieden.
{EA, EB}
Das Spiel endet nicht unentschieden (alternativ: Mannschaft A oder
Mannschaft B gewinnt).
{EA, EU}:
Mannschaft B gewinnt nicht (alternativ: Mannschaft A gewinnt oder das
Spiel endet unentschieden).
{EB, EU}:
Mannschaft A gewinnt nicht (alternativ: Mannschaft B gewinnt oder das
Spiel endet unentschieden).
{EA, EB, EU}:
Das Spiel wird von Mannschaft A oder von Mannschaft B gewonnen oder
es endet unentschieden.
Wie man sich leicht überzeugen kann, ist durch den Ereignisraum [der Potenzmenge P(Ω) des Ergebnisraumes Ω ] tatsächlich jedes Ereignis erfaßt, das mit einem
Zufallsexperiment, dessen Ergebnisraum Ω ist, in Zusammenhang gebracht werden
kann.
Um den Leser mit den grundlegenden Begriffen vertraut zu machen, wurden bisher
die Beispiele so gewählt, daß der jeweils adäquate Ergebnisraum ohne Probleme
ersichtlich war. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall: Im Zentrum vieler statistischer Anwendungen stehen Ereignisse, denen nicht unmittelbar entnommen werden kann, aus welchen Ergebnissen sie im einzelnen zusammengesetzt sind. Wie
wir im nächsten Abschnitt sehen werden, ist jedoch vor allem zur Ermittlung korrekter Wahrscheinlichkeiten eine klare Vorstellung hinsichtlich des (zugrundeliegenden) Ergebnisraumes erforderlich.
4.3
Die verschiedenen
Wahrscheinlichkeitskonzeptionen
Was bedeutet es eigentlich, wenn von „Wahrscheinlichkeit“ die Rede ist? So häufig
dieser Begriff – auch umgangssprachlich – gebraucht wird, wenn man etwas tiefer
bohrt, so wird man feststellen, daß er alles andere als „wohldefiniert“ ist. Aller-
4.3 Die verschiedenen Wahrscheinlichkeitskonzeptionen
49
dings kann man festhalten: Der Begriff wird immer im Zusammenhang mit der
„Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmtes Ereignis eintritt“ verwendet. Es geht also
offensichtlich darum, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, ob etwas Bestimmtes geschieht oder nicht geschieht. Die Vielfalt dessen, was damit in der Anwendung gemeint sein kann, wird üblicherweise in das unscheinbare Wort „Ereignis“ gepreßt. Dies werden wir – wie bereits im letzten Abschnitt – auch weiterhin
so handhaben. Wie bisher werden wir ein Ereignis, von dessen Wahrscheinlichkeit
die Rede sein soll, mit einem beliebigen Symbol – beispielsweise mit A, B, C oder
auch X – belegen. Die Notation W(X) (in Worten: „W von X“) bezeichnet dann
„die Wahrscheinlichkeit, daß genau das Ereignis X eintritt“.
Obgleich wir im vorliegenden Abschnitt die einzelnen konkreten Bedeutungen der
behandelten Ereignisse bewußt ausklammern werden, heißt dies nicht, daß diese
inhaltlichen Belegungen keine Rolle spielen. Ganz im Gegenteil: Gerade bei der
Anwendung und Interpretation von wahrscheinlichkeitstheoretischen Aussagen
kommt es entscheidend auf die konkreten Inhalte an. Nur: Das Thema dieses Abschnittes – der Wahrscheinlichkeitsbegriff sowie die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten – sind davon unabhängig.
Man unterscheidet insgesamt vier verschiedene Wahrscheinlichkeitsbegriffe:
• klassische Wahrscheinlichkeit
• statistische Wahrscheinlichkeit
• subjektive Wahrscheinlichkeit
• axiomatische Wahrscheinlichkeit
Jeder dieser vier Begriffe repräsentiert eine ganz bestimmte Vorstellung dessen,
was man unter Wahrscheinlichkeit verstehen kann; jeder repräsentiert somit eine
besondere Wahrscheinlichkeitskonzeption. Diese stehen jedoch nicht isoliert nebeneinander, sondern es bestehen Gemeinsamkeiten und gewisse Zusammenhänge.
Allerdings beleuchten sie jeweils ganz spezielle Bereiche der umfassenden Bedeutung des Begriffes „Wahrscheinlichkeit“.
Die klassische Wahrscheinlichkeit
Die Essenz der klassischen, auf Pierre Simon Laplace (1774) zurückgehende, Vorstellung über das Wesen der Wahrscheinlichkeit ist relativ simpel: Zwei Ereignisse
haben dann als gleichwahrscheinlich zu gelten, wenn es keinen vernünftigen Grund
dafür gibt, etwas anderes anzunehmen. Dies bedeutet nicht, daß vor dem Hintergrund des klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriffes alle Ereignisse als gleichwahrscheinlich anzusehen sind. Selbstverständlich gibt es eine Vielfalt von vernünftigen
Gründen, die es angezeigt erscheinen lassen, vom Prinzip der Gleichwahrscheinlichkeit abzuweichen. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn ein bestimmtes Ereignis aus mehreren anderen „elementaren“ Ereignissen zusammengesetzt ist.
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
50
Damit können wir an die im letzten Abschnitt eingeführte Unterscheidung in „Ergebnis“ und „Ereignis“ anknüpfen: Der klassische Wahrscheinlichkeitsbegriff setzt
voraus, daß alle Ergebnisse eines Zufallsexperiments gleichwahrscheinlich sind.
Voraussetzungen des klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriffes
Gegeben sei der Ereignisraum P(Ω) eines Zufallsexperiment sowie der zugehörige
Ergebnisraum Ω. Klassische (Laplace’sche) Wahrscheinlichkeiten lassen sich ermitteln, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
(a) Die Anzahl der Elemente des Ergebnisraumes Ω ist endlich.
(b) Die Ergebnisse sind gleichwahrscheinlich.
Unter diesen Voraussetzungen reduziert sich die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit
eines beliebigen Ereignisses auf ein reines Abzählproblem, wie anhand folgender
Defintion deutlich wird:
Klassische Wahrscheinlichkeit (Laplace-Wahrscheinlichkeit)
Gegeben sei der Ereignisraum P(Ω) eines Zufallsexperiment sowie der zugehörige
Ergebnisraum Ω. Gegeben sei weiter ein beliebiges Ereignis A des Zufallsexperiment. [Erinnerung: Dieses Ereignis ist eine Teilmenge des Ergebnisraumes Ω und
zugleich ein Element des Ereignisraumes P(Ω), d.h. es gilt A⊆Ω und A∈P(Ω)]. Die
(klassische) Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A ergibt sich dann durch:
Anzahl der Elemente der Menge A
W(A) =
Anzahl der Elemente der Menge W
Anzahl der für A günstigen Ergebnisse
=
Anzahl aller Ergebnisse
=
A
Ω
Beispiel 3.11
Gegeben sei der Ergebnisraum Ω={1;2;3;4;5;6} des einmaligen Wurfes eines Würfels und
das Ereignis A mit der inhaltlichen Bedeutung „Wurf einer geraden Zahl“. Offensichtlich
gilt A= {2;4;6}. W(A) errechnet sich durch
A 3 1
W(A)=
= = .
Ω 6 2
Beispiel 3.12
Betrachten wir den Ergebnisraum des zweimaligen Wurfes eines Würfels
Ω={(1,1);...;(1,6);(2,1);..;(2,6);(3,1);...;(3,6);(4,1);...;(4,6);(5,1);...;(5,6);(6,1);...;(6,6)} und
die Ereignise A bzw. B mit den inhaltlichen Belegungen A = „Wurf der 1 im ersten und im
zweiten Wurf“ und B = „Wurf der 1 im ersten oder im zweiten Wurf“. Offensichtlich gilt A
= {(1,1)}. W(A) ergibt sich daher durch:
4.3 Die verschiedenen Wahrscheinlichkeitskonzeptionen
W(A)=
A
Ω
=
51
1
.
36
Etwas komplizierter ist das Ereignis B zu formalisieren, denn es gilt:
B = {(1,1);(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(1,6);(2,1);(3,1);(4,1);(5,1);(6,1)}. W(B) ergibt sich durch:
W ( B) 11
W(B)=
.
=
Ω
36
Die statistische Wahrscheinlichkeit
Die Konzeption der sogenannten statistischen Wahrscheinlichkeit, die erstmals
von Richard von Mises (1936) in die Diskussion gebracht wurde, rückt den uns
bereits bekannten Begriff der relativen Häufigkeit eines Ereignisses ins Blickfeld.
Grundlegende Idee hierbei – und zugleich eine gewisse Abgrenzung zum klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriff – ist die Überlegung, daß viele Zufallsexperiment
wiederholbar sind und sich auf diese Weise die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte
Ereignisse ermitteln lassen sollten. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist im
Rahmen der statistischen Wahrscheinlichkeitskonzeption definiert als der Grenzwert der relativen Häufigkeit des Ereignisses, für den Fall, daß die Anzahl der
Wiederholungen des Zufallsexperiments gegen Unendlich geht.
Statistische Wahrscheinlichkeit (von Mises-Wahrscheinlichkeit)
Gegeben sei das Ereignis A eines beliebigen wiederholbaren Zufallsexperiments
und hn(A) bzw. fn(A) seien die absoluten bzw. relativen Häufigkeiten des Auftretens von A bei n Wiederholungen des Zufallsexperiments. Die statistische Wahrscheinlichkeit von A ist definiert als:
W(A) = lim n→∞ f n ( A)
= lim n →∞
hn ( A)
n
Um diese Definition zu vedeutlichen, überlegen wir uns für das Zufallsexperiment
eines zweimaligen Münzwurfes, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, daß
dabei „mindestens einmal Kopf“ geworfen wird. Da die Ergebnismenge dieses
Zufallsexperiments der Menge Ω = {(Z, Z); (K, Z); (Z, K); (K, K)} entspricht und
drei von insgesamt vier Ergebnissen unserer Ereignis begünstigen, gibt uns die
klassische Wahrscheinlichkeit die Antwort: W(„mindestens einmal Kopf“) = 3/4.
Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, daß jedes Ergebnis des Zufallsexperiments gleichwahrscheinlich ist. Nehmen wir einmal an, daß wir aus irgendwelchen
Gründen nicht mehr auf diese „Gleichwahrscheinlichkeitshypothese“ vertrauen
können, z.B. weil wir den begründeten Verdacht hegen, daß die Münze irgendwie
verbogen und damit nicht “perfekt“ ist. Können wir trotzdem etwas über die uns
interessierende Wahrscheinlichkeit aussagen? Die Konzeption der statistischen
52
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
Wahrscheinlichkeit gibt hierauf die Antwort, daß die gesuchte Wahrscheinlichkeit
als Grenzwert der entsprechenden relativen Häufigkeit verstanden werden muß.
Die statistische Wahrscheinlichkeit ist eine zunächst sehr überzeugende Konstruktion. Vor allem weil man die Grenzwerte meistens im Sinne der klassischen Wahrscheinlichkeit interpretiert. So wird gerne unterstellt, daß beispielsweise beim Würfeln die relative Häufigkeit einer „Sechs“ mit zunehmender Zahl der Versuche tatsächlich gegen 1/6 konvergiert – was ja der klassischen Wahrscheinlichkeit entspricht. Man sollte jedoch nie vergessen, daß dies letztlich lediglich eine Vermutung ist. Es besteht weder die Möglichkeit, zu beweisen, daß dieser vermutete
Grenzwert tatsächlich existiert, noch daß er der klassischen Wahrscheinlichkeit
entspricht. Wie gesagt, dies kann man nur vermuten. Allerdings gibt es hierfür starke Argumente. Das überzeugendste hierbei ist der sogenannte Stabilisierungseffekt
relativer Häufigkeiten, der sich durch folgende Grafik veranschaulichen läßt:
fn(A)
1
3/4
Anzahl der Doppelwürfe (n)
Hierbei sei mit A wieder das Ereignis bezeichnet, daß bei einem zweimaligen
Münzwurf mindestens einmal Kopf geworfen wird. Die Glieder der Folge [f1(A);
f2(A); f3(A);f4(A);.....] bezeichnen für konkrete Versuche jeweils die relativen Häufigkeiten, daß dabei tatsachlich mindestens einmal Kopf geworfen wurde und zwar
bei einem Doppelwurf, bei zwei Doppelwürfen, bei drei Doppelwürfen, bei vier
Doppelwürfen usw. Ein mögliche konkrete Folge besteht in [f1(A)=1; f2(A)=0,5;
f3(A)=1;f4(A)=0;.....], wobei f1(A)=1 besagt, daß bei einmaligen Doppelwurf mindestens einmal Kopf geworfen wurde, f2(A)=0,5 dagegen, daß in einem der beiden
Doppelwürfe zweimal Zahl geworfen wurde, f3(A)=1 wiederum zeigt an, daß in
jedem von drei Doppelwürfen (mindestens) einmal Kopf vorlag, wogegen f4(A)=0
bedeutet, daß in keinem von vier Doppelwürfen „Kopf“ das Ergebnis war. Man
4.3 Die verschiedenen Wahrscheinlichkeitskonzeptionen
53
beachte, daß selbstverständlich auch andere Folgen als die beschriebene resultieren
können. Entscheidend ist jedoch folgendes: Während die relativen Häufigkeiten bei
nur wenigen Wiederholungen des Zufallsexperiments sehr breit streuen können,
scheinen sie sich mit zunehmender Anzahl um einen bestimmten Wert zu stabilisieren. Um diesen Sachverhalt zu illustrieren, betrachten wir noch einmal die oben als
Beispiel angeführte Folge, bei der für n=4 gilt f4(A)=0. Dies ist ein durchaus plausibles Resultat, denn es besagt lediglich, daß bei vier Doppelwürfen nicht ein einziges Mal „Kopf“ gewürfelt wurde. Betrachten wir dasselbe Resultat bei einer
Wiederholungszahl von n=500, d.h es gelte f500(A)=0. Die würde bedeuten, daß bei
fünfhundert Doppelwürfen, also bei insgesamt eintausend Münzwürfen, nicht ein
einziges Mal „Kopf“ erscheint. Vermutlich glauben die meisten Leser, daß dies
unmöglich ist. Hier müssen wir jedoch relativieren: Unmöglich ist ein solches Ereignis nicht, es ist nur extrem unwahrscheinlich. Unmöglich ist auch nicht der Fall
f500.000(A)=0. Allerdings ist er in einem so hohen Maße unwahrscheinlich, daß wir
ihn für alle praktischen Zwecke ausschließen können.
Halten wir also fest: Im Rahmen der Konzeption statistischer Wahrscheinlichkeiten
ist der Begriff Wahrscheinlichkeit als Grenzwert relativer Häufigkeiten definiert.
Hierbei ergeben sich zwei Probleme: Zunächst kann die Existenz eines solchen
Grenzwertes niemals bewiesen, sondern nur vermutet bzw. postuliert werden. Genau dies geschieht im Rahmen des statistischen Wahrscheinlichkeitskonzeptes.
Darüberhinaus kann ebenfalls nicht bewiesen werden, daß dieser Grenzwert –
wenn er denn existiert – der klassischen Wahrscheinlichkeit entspricht. Auch dies
kann nur vermutet werden. Allerdings liegt für beide Vermutungen eine überzeugende empirische Evidenz vor.
Die subjektive Wahrscheinlichkeit
Die von Savage (1954) vorgestellte subjektive Wahrscheinlichkeitskonzeption
macht auf einen Schwachpunkt der bisher behandelten Wahrscheinlichkeiten aufmerksam: Sowohl die klassische als auch die statistische Wahrscheinlichkeit suggerieren durch ihre formal exakten Definitionen eine Präzision, die, vor allem was
ihre konkrete Anwendbarkeit anbelangt, Erwartungen weckt, die sich nicht einlösen lassen. Dies gilt für viele Bereiche. Man denke beispielsweise nur an das gesamte Gebiet der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Obgleich wir es in diesen
Disziplinen mit Phänomenen zu tun haben, die vom Zufall (mit)bestimmt werden,
ist es uns nicht möglich, für die interessierenden Ereignisse objektive Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Dies macht es sehr schwer, bei bestimmten Vorgängen die
zufälligen Einflüsse quantitativ abzuschätzen und von systematischen Einflußfaktoren – hinter denen sich Gesetzmäßigkeiten verbergen könnten – abzugrenzen.
M.a.W., es ist fast unmöglich zu entscheiden, ob sie rein zufällig ausgelöst wurden,
oder ob sie Ausdruck eines systematischen Zusammenhanges sind.
54
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
Trotz dieser Schwierigkeiten ist es gelungen, im Rahmen dieser Disziplinen eine
Vielzahl allgemeiner Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Dies wurde möglich durch den
Kunstgriff der subjektiven Wahrscheinlichkeit: In Ermangelung objektiver Wahrscheinlichkeiten unterstellt man in diesen Disziplinen häufig, daß die handelnden
Subjekte ihre Entscheidungen auf der Basis individueller, rein subjektiver Wahrscheinlichkeiten treffen.
Der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff stellt daher eine bewußte Abgrenzung
zum objektivierenden Charakter der klassischen und der statistischen Wahrscheinlichkeit dar.
Die axiomatische Wahrscheinlichkeit
Es ist müßig darüber zu spekulieren, welcher der bisher vorgestellten Wahrscheinlichkeitsbegriffe der „richtige“ ist. Keine der Konzeptionen hat „die Wahrheit“ für
sich alleine gepachtet, sondern jede weist Vor- und Nachteile auf. So ist es sicherlich sinnvoll, bei allen Fragestellungen und Zusammenhängen, in denen der reine
Zufall dominiert, die klassische Wahrscheinlichkeit zu unterstellen. Liegen dagegen
Probleme vor, bei denen sich kontrollierte Wiederholungen der Zufallsexperimente
durchführen lassen, so bietet sich die Verwendung statistischer Wahrscheinlichkeiten an. Das weite Feld der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften schließlich, das
durchweg von nicht wiederholbaren Vorgängen und Begebenheiten geprägt ist,
kann als das gewissermaßen natürliche Anwendungsgebiet des subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffes betrachtet werden. So werden beispielsweise in soziologischen, psychologischen aber auch wirtschaftswissenschaftlichen Entscheidungsmodellen unter Unsicherheit durchgängig subjektive Wahrscheinlichkeiten vorausgesetzt.
Unabhängig davon,welcher konkrete Wahrscheinlichkeitsbegriff einer konkreten
Fragestellung zugrundeliegt, gibt es bestimmte Bedingungen, die jede Wahrscheinlichkeit – wie auch immer sie begründet wird – erfüllen muß, wenn mit ihr vernünftig und widerspruchsfrei gearbeitet werden soll. Diese sogenannten Konsistenzanforderungen stehen im Zentrum des von Kolmogoroff (1933) begründeten
axiomatischen Wahrscheinlichkeitsbegriffes. Im Gegensatz zu den drei bisher
behandelten Wahrscheinlichkeiten liefert die axiomatische Wahrscheinlichkeit daher keine neue Interpretation des Phänomens, sondern sie repräsentiert lediglich
bestimmte Grundanforderungen, die im folgenden dargestellt werden sollen:
4.3 Die verschiedenen Wahrscheinlichkeitskonzeptionen
55
Kolmogoroff-Axiome 2 der Wahrscheinlichkeitstheorie
Gegeben sei ein beliebiges Zufallsexperiments sowie der zugehörige Ergebnisraum
Ω. Gegeben seien weiter beliebige Ereignisse A und B des Zufallsexperiments.
Eine Funktion W(A), d.h. eine Vorschrift, die jedem Ereignis genau eine reelle Zahl
zuordnet, ist eine Wahrscheinlichkeit, wenn sie folgenden Axiomen genügt:
(A1) W(Ω)=1
(A2) 0 ≤ W(A) ≤ 1
(A3) W(A∪B) = W(A)+W(B) wenn gilt: A∩B=∅
Axiom 1 – die sogenannte Normierung – besagt, daß dem absolut sicheren Ereignis (und nur diesem!) die Wahrscheinlichkeit Eins zugeordnet wird. Eine Konsequenz dieses Axioms (plus der beiden anderen) ist, daß dem unmöglichen Ereignis
die Wahrscheinlichkeit Null zugeordnet werden muß, d.h. W(∅)=0. Dies wiederum
bedeutet, daß jedem Ereignis, das nicht dem absolut unmöglichen Ereignis entspricht, eine Wahrscheinlichkeit größer als Null zukommt. Auch extrem unwahrscheinliche Vorgänge haben somit gemäß den Kolmogoroff-Axiomen eine positive
Wahrscheinlichkeit.
Axiom 2 – die Voraussetzung der Nichtnegativität – fordert, daß die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Ereignisses, wie auch immer sie zustandekommt oder
eingeschätzt wird, niemals negativ, aber auch niemals größer als 1 sein kann. Diese
Bedingung braucht nicht weiter thematisiert zu werden, denn es ist klar, daß negative Wahrscheinlichkeiten grober Unfug sind und daß kein Ereignis eine höhere
Eintrittswahrscheinlichkeit haben kann als das absolut sichere Ereignis.
Axiom 3 – die Additivität – schließlich verlangt, daß die Wahrscheinlichkeit eines
Ereignisses, das sich durch eine „oder-Verknüpfung“ zweier anderer sich gegenseitig ausschließender Ereignisse ergibt, der Summe der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten entspricht.
Trotz der obenstehenden Einteilung in vier unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsbegriffe, ist es sehr hilfreich, sich vor Augen zu halten, daß es sich hierbei nicht um
Konzeptionen handelt, die sich widersprechen. Jeder einzelne dieser Wahrscheinlichkeitsbegriffe beleuchtet ganz bestimmte Facetten der Gesamtheit dessen, was
wir „Wahrscheinlichkeit“ nennen. So steht beim klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriff die Idee im Vordergrund, daß vermutlich alle Ereignisse auf einer sehr elementaren Ebene gleichwahrscheinlich sind, wogegen der statistische Wahrscheinlichkeitsbegriff an die Bedeutung der relativen Häufigkeit erinnert. Beiden Wahrscheinlichkeitsbegriffen – sowohl dem klassischen als auch dem statistischen –
haftet in gewisser Weise noch ihre Herkunft an, nämlich das Casino des 18. Jahrhunderts. Hier markiert der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff einen vollständigen Bruch: Nun stehen Ereignisse im Vordergrund, deren Wahrscheinlichkeiten
_________________
2
Unter einem Axiom versteht man eine nicht beweisbare Voraussetzung.
56
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
weder durch die Gleichverteilungsannahme der klassischen noch durch die Konvergenzvermutung der statistischen Wahrscheinlichkeit bestimmt werden können:
Entscheidend ist ausschließlich die subjektive Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse. Der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff schließlich lenkt die Aufmerksamkeit auf minimale Konsistenzanforderungen,
die (bei aller Subjektivität) erfüllt sein müssen, wenn mit einer wie auch immer
begründeten Wahrscheinlichkeit theoretisch und praktisch gearbeitet werden soll.
In diesem Zusammenhang ist eine alte, von Frank Knight (1921) in die Diskussion
gebrachte Differenzierung von besonderem Interesse: Es geht um den Unterschied
zwischen Risiko und Unsicherheit in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
Gemäß der – mittlerweile überholten – Klassifizierung Knight’s ist eine Situation
risikobehaftet, wenn den involvierten Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet
werden können, die mehr oder weniger „objektiver“ Natur sind. Die Situation ist
dagegen von Unsicherheit geprägt, wenn eine solche Wahrscheinlichkeitszuordnung nicht oder nur sehr vage möglich ist.Vor dem Hintergrund obenstehender
Ausführungen zu den diversen Wahrscheinlichkeitsbegriffen sollte deutlich geworden sein, daß eine begriffliche Abgrenzung zwischen Risiko und Unsicherheit
durch die Einführung subjektiver Wahrscheinlichkeiten vor allem in den Sozialund Wirtschaftswissenschaften überflüssig geworden ist. In der Tat werden die
Begriffe Risiko und Unsicherheit im modernen Fachjargon dieser Disziplinen immer mehr zu Synonymen. Es wird immer klarer, daß letztlich jede Wahrscheinlichkeitszuordnung, die sich nicht aus exakten naturwissenschaftlichen Gesetzen ableiten läßt, subjektiver Natur sein muß. Unterschiede bestehen lediglich im Präzisionsgrad der Einschätzung. So beträchtlich diese im einzelnen auch sein mögen,
begründen sie doch keinen qualitativen Unterschied, der es rechtfertigen würde,
begrifflich zwischen „Risiko“ und „Unsicherheit“ im Sinne Knight’s (1921) zu
unterscheiden. Beispielsweise beinhaltet die Sterbetafel einer Lebensversicherung
erheblich präzisere Angaben zur Wahrscheinlichkeit des „Schadensfalles“ als die
Risikokalkulationen des Betreibers eines Atomkraftwerkes – den Anspruch auf
Objektivität ihrer Wahrscheinlichkeitskalkulation jedoch können beide nicht erheben.
4.4
Bedingte Wahrscheinlichkeiten
Zu einer Vielzahl von Fragestellungen liegen Informationen vor, die Wahrscheinlichkeitszuordnungen nur in einer indirekten Form erlauben. So ist von medizinischen Tests in der Regel bekannt, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, daß
eine bestimmte Krankheit diagnostiziert wird, unter der Voraussetzung, daß der
Proband die Krankheit auch tatsächlich hat. Darüber hinaus liegt meistens auch die
Wahrscheinlichkeit vor, daß die Krankheit diagnostiziert wird, unter der Vorausset-
4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten
57
zung, daß der Proband die entsprechende Krankheit nicht hat. Unbekannt ist jedoch
zunächst die Wahrscheinlichkeit, ob der konkrete Proband die Krankheit nun tatsächlich hat oder nicht. Sie muß indirekt erschlossen werden.
Ein anderes erfreulicheres Beispiel sind Schwangerschaftstests: Die Qualität der
Tests ist bekannt, d.h. man weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, daß der Test
positiv ausfällt, wenn die Frau tatsächlich schwanger ist. Man kennt auch die
Wahrscheinlichkeit eines positiven Test, wenn tatsächlich keine Schwangerschaft
vorliegt. Was zunächst noch unbekannt ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Schwangerschaft. Diese und andere können aber durch die Konstruktion
sogenannter bedingter Wahrscheinlichkeiten erschlossen werden.
Bedingte Wahrscheinlichkeit
Als bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A bezeichnet man die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Voraussetzung, daß ein anderes Ereignis
(z.B. B) bereits eingetreten ist. Das Symbol hierfür lautet: W(AB). Formal ergibt
sich die bedingte Wahrscheinlichkeit durch:
W(AB)=
W ( A ∩ B)
W ( B)
Beispiel 3.13
Betrachten wir folgende mit einer potentiellen Schwangerschaft verbundenen Ereignisse:
A:
Probandin ist schwanger
¬ A:
Probandin ist nicht schwanger
B:
Schwangerschaftstest zeigt bei der Probandin eine Schwangerschaft an
¬B:
Schwangerschaftstest zeigt bei der Probandin keine Schwangerschaft an
Folgende bedingte Wahrscheinlichkeiten können sinnvollerweise gebildet werden:
(a) W(BA)
Wahrscheinlichkeit, daß der Test eine Schwangerschaft
anzeigt, unter der Voraussetzung, daß die Probandin
tatsächlich schwanger ist.
(b) W(¬BA) Wahrscheinlichkeit, daß der Test keine Schwangerschaft
anzeigt, unter der Voraussetzung, daß die Probandin schwanger ist.
(c) W(B¬A ) Wahrscheinlichkeit, daß der Test eine Schwangerschaft
anzeigt, unter der Voraussetzung, daß die Probandin
tatsächlich nicht schwanger ist.
(d) W(¬B¬A ) Wahrscheinlichkeit, daß der Test keine Schwanger schaft
anzeigt, unter der Voraussetzung, daß die Probandin nicht
schwanger ist.
Offensichtlich sind (a) und (d) die Wahrscheinlichkeiten der korrekten Ergebnisse des
Schwangerschaftstests, wogegen (b) und (c) die Wahrscheinlichkeiten zweier möglicher
Testfehler angeben. Die Qualität eines Tests ist daher umso höher, je geringer die Fehler (b)
und (c), d.h. die bedingten Wahrscheinlichkeiten W(¬BA) und W(B¬A) sind. Die Er-
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
58
eignisse (¬BA) bzw. (B¬A) werden darum häufig auch Alpha-Fehler bzw. Beta-Fehler
genannt.
Beispiel 3.14
Gegeben sei das Zufallsxexperiment des zweimaligen Wurfes eines Würfels sowie die
Ereignisse:
A
„Augensumme aus beiden Würfen ist 3“
B
„der erste Wurf ist eine 1“
A∩B „Augensumme ist 3 und im ersten Wurf ergibt sich 1“
(Alternativformulierung: „im ersten Wurf ergibt sich 1 und im zweiten Wurf 2“)
A, B und A∩B lassen sich als Mengen wie folgt darstellen:
A = {(1,2); (2,1)}; B = {(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6)}; A∩B = {(1,2)}
Da das Zufallsexperiment insgesamt 36 Ergebnisse („Elementarereignisse“) hat, ergeben
sich folgende Wahrscheinlichkeiten: W(A) = 2/36, W(B) = 6/36 und W(A∩B)=1/36. Nun
stellen wir uns vor, daß das Ereignis B bereits eingetreten ist und überlegen uns, wie groß
die Wahrscheinlichkeit W(AB) ist. Anhand obenstehender Regel zur Berechnung beding1
W ( A ∩ B)
36
ter Wahrscheinlichkeiten gilt: W(AB)=
=
= 1/6. Dieser Regel liegen fol6
W ( B)
36
gende Zusammenhänge zugrunde: Durch die Realisierung des Ereignisses B „schrumpft“
die Menge aller verbleibenden Möglichkeiten, d.h. die Ergebnismenge Ω nimmt ab. Konkret: Vor Realisierung von B läßt sich die Ergebnismenge durch folgende Matrix darstellen:
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
Die Ergebnisse, welche das Ereignis A („Augensumme ist 3“) begünstigen, wurden hervorgehoben. Wenn nun das Ereignis B eintritt, d.h. wenn sich im ersten Wurf eine 1 ergibt,
„degeneriert“ die verbleibende Ergebnismatrix zu:
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
Wieder wurde das nun noch mögliche Ergebnis, welches A begünstigt, hervorgehoben. Es
verbleibt von insgesamt 6 Ergebnissen nur noch eines, welches das Ereignis A begünstigt;
die errechnete Wahrscheinlichkeit von 1/6 somit wird auch durch die klassische Wahrscheinlichkeitsermittlung des Abzählens gestützt.
4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten
59
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß mit der fortschreitenden Realisierung
von Ereignissen einerseits zwar die Anzahl der Möglichkeiten abnimmt, die ein
bestimmtes, uns interessierendes Ereignis begünstigen, daß andererseits aber
zugleich die gesamte Ergebnismenge noch deutlicher schrumpft: Die Anzahl insgesamt möglicher Ergebnisse nimmt stärker ab als die Anzahl der begünstigenden
Ergebnisse. Daraus ergibt sich eine bemerkenswerte Schlußfolgerung: Solange ein
bestimmtes Ereignis prinzipiell noch eintreten kann, nimmt seine Wahrscheinlichkeit mit fortschreitender Evolution (was ja nichts anderes bedeutet, als die laufende
Realisierung von bis dato nur potentiellen Möglichkeiten!) permanent zu. Diese
Wahrscheinlichkeitszunahme dauert an, bis das Ereignis sich entweder tatsächlich
realisiert (d.h. die Wahrscheinlichkeit „springt“ auf 1) oder sein Eintreten endgültgig ausgeschlossen wird (d.h. die Wahrscheinlichkeit „springt“ auf 0).
Um sich dieses Prinzip vor Augen zu führen, stellen Sie sich vor, Sie hätten an
einem Lottospiel („6 aus 49“) teilgenommen und hierbei die Zahlen (1,2,3,4,5,6)
getippt. Nun sitzen Sie vor Ihrem Fersehgerät und verfolgen die Ziehung der Lottozahlen. Als geübter Wahrscheinlichkeitstheoretiker wissen Sie, daß die Chance
auf sechs Richtige verschwindend gering ist. Entsprechend uninteressiert verfolgen
Sie den Verlauf der Ziehung. Als nun als erste Zahl die 6 gezogen wird, bleiben Sie
ganz ruhig, da Ihnen bewußt ist, daß Ihre Chance auf den Hauptgewinn nun zwar
zugenommen hat, aber immer noch verschwindend gering ist. Als jedoch als zweite
Zahl die 5 erscheint, spitzen Sie die Ohren. Nachdem als dritte Zahl eine 4 gezogen
wird, sitzen Sie kerzengerade in Ihrem Sessel, bei der vierten Zahl 3 sind Sie nicht
mehr zu halten und als dann als fünfte Zahl auch noch die 2 gezogen wird, bricht
Ihnen der Schweiß aus. Immerhin stehen Sie nun kurz vor sechs Richtigen. Die
Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn hat sich mit jeder Ziehung erhöht und
beträgt nun 1/44, da sich noch 44 Kugeln in der Trommel befinden. Wird als sechste Zahl die 1 gezogen, sind Sie der große Gewinner (d.h. die Wahrscheinlichkeit
des Hauptgewinns springt auf 1), ist eine andere Zahl das Ergebnis, gehen Sie leer
aus (die Wahrscheinlichkeit springt auf Null).3 Entscheidend ist, daß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „sechs Richtige“ auf jeder Stufe des Spiels auf Null
springen kann. Geschieht dies nicht, steigt Sie notwendigerweise an. Angenommen, es wäre nach der ersten Zahl „6“ als zweite Zahl zwar die „5“, aber als dritte
die „27“ gezogen worden. Die Wahrscheinlichkeit des Hauptgewinns wäre nach
der ersten und zweiten Ziehung angestiegen, nach der dritten aber auf Null zurückgefallen.
Vor dem Hintergrund der soeben skizzierten Zusammenhänge sollte nachvollziehbar sein, warum Wahrscheinlichkeiten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber auch in den Naturwissenschaften nicht als statische, sondern als sich dy_________________
3
Aus Vereinfachungsgründen werden die beim Lotto ja zusätzlich gegebenen Gewinnchancen bei
fünf, vier und drei Richtigen vernachlässigt.
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
60
namisch entwickelnde Größen betrachtet werden: Allein die Evolution bedingt, daß
sie sich permanent verändern.
4.5
Regeln für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten
Nachdem nun die wichtigsten wahrscheinlichkeitstheoretischen Konzepte vorgestellt wurden, kann das Ganze zu einigen sinnvollen Rechenregeln zusammengefaßt werden: Additionssatz, Multiplikationssatz und Negationssatz
Additionssatz
Der Additionssatz bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit einer oder-Verknüpfung
zweier Ereignisse und damit auf die Vereinigungsmenge, die aus den beiden entsprechenden Mengen gebildet werden kann.
Additionssatz
Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung zweier Ereignisse entspricht der Wahrscheinlichkeit des ersten Ereignisses, plus der Wahrscheinlichkeit des zweiten Ereignisses, abzüglich der Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts beider Ereignisse.
Symbolisch: W(A∪B) = W(A) + W(B) – W(A∩B)
Beispiel 3.15
Betrachten wir das Zufallsexperiment eines einmaligen Wurfes zweier Münzen und überlegen uns, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, hierbei mindestens einmal „Kopf“ zu werfen.
Nach den Regeln der klassischen Wahrscheinlichkeit ist die Lösung einfach: Offensichtlich
gilt für die Ergebnismenge: Ω = {(K,K); (Z,K); (K,Z); (Z,Z)}, wobei (K,K) bedeutet, daß
im ersten und im zweiten Wurf „Kopf“ das Ergebnis war; (Z,K), daß im ersten Wurf „Zahl“
und im zweiten „Kopf“ geworfen wurde, usw. Unser Ereignis – nennen wir es C -, mindestens einmal „Kopf“ zu werfen, wird daher durch die ersten drei Elemente von Ω begünstigt.
Somit gilt: C = {(K,K); (Z,K); (K,Z)} und die Wahrscheinlichkeit W(C) errechnet sich
durch:
C
{( K , K );( Z , K );( K , Z )}
W(C) =
=3/4. Um nun den Zusammenhang mit dem
=
Ω
{( K , K );( Z , K ); ( K , Z ); ( Z , Z )}
Additionssatz zu verdeutlichen, betrachten wir die Ereignisse A und B sowie (A ∩ B), die
wie folgt definiert sind: A = „Kopf im ersten Wurf“; B = „ Kopf im zweiten Wurf“; (A ∩
B) = „Kopf im ersten und im zweiten Wurf“. Die entsprechenden klassischen Wahrscheinlichkeiten ergeben sich durch:
A
{( K , K );( K , Z )}
W(A) =
=1/2
=
Ω
{( K , K );( Z , K ); ( K , Z ); ( Z , Z )}
W(B) =
B
Ω
=
{( K , K );( Z , K )}
{( K , K );( Z , K ); ( K , Z ); ( Z , Z )}
=1/2
4.5 Regeln für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten
W(A ∩ B) =
A∩ B
Ω
=
{( K , K )}
{( K , K );( Z , K );( K , Z );( Z , Z )}
61
= 1/4
Nun überlegen wir uns, ob sich das Ereignis C („mindestens einmal Kopf“) durch eine
Verknüpfung der Ereignisse A („im ersten Wurf Kopf“) und B („im zweiten Wurf Kopf“)
„erzeugen“ läßt. Offensichtlich tritt C ein, wenn A oder B eintritt. Somit gilt C=A ∪ B,
sowie W(C) = W(A ∪ B). Nach dem Additionssatz ergibt dies: W(A ∪ B) = W(A) + W(B)
– W(A ∩ B) =1/2+1/2-1/4=3/4, was auch dem Ergebnis der klassischen Wahrscheinlichkeit
entspricht.
An diesem Beispiel läßt sich sehr schön erkennen, warum gemäß dem Additionssatz von der Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeit des
Durchschnitts abgezogen werden muß: Das Ereignis {(KK)} [das dem Durchschnitt aus A und B entspricht: A∩B={(KK)}] ist sowohl im Ereignis A als auch im
Ereignis B enthalten. Bei einer einfachen Addition der Wahrscheinlichkeiten von A
und B würde die Wahrscheinlichkeit von (A ∩ B) doppelt gezählt. Daher muß sie
einmal abgezogen werden, um ein korrektes Ergebnis zu erhalten.
Multiplikationssatz
Der Multiplikationssatz bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit einer undVerknüpfung zweier Ereignisse und damit auf die Durchschnittsmenge, die aus
den beiden entsprechenden Mengen gebildet werden kann.
Multiplikationssatz
Die Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts zweier Ereignisse A und B entspricht der
Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A, multipliziert mit der (durch den Eintritt von
A) bedingten Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B.
Symbolisch: W(A∩B) = W(A)*W(BA)
Selbstverständlich gilt auch: W(A∩B) = W(B)*W(AB)
Beispiel 3.16
Betrachten wir noch einmal unser Beispiel (3.14). Dort hatten wir folgende Ereignisse definiert:
A
„Probandin ist schwanger“
B
„Schwangerschaftstest zeigt bei der Probandin eine Schwangerschaft an“
BA
„Der Test zeigt eine Schwangerschaft an, unter der Voraussetzung, daß
die
Probandin schwanger ist“
Wir unterstellen die folgenden fiktiven Werte für die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten:
W(A) = 60 %; W(B) = 70 %; W(BA) = 98 %.
Zusätzlich definieren wir das Ereignis:
C
„Der Test zeigt eine Schwangerschaft an und die Probandin ist
schwanger“.
Offensichtlich gilt C = A∩B, so daß sich die Wahrscheinlichkeit von C nach dem Multiplikationssatz wie folgt errechnet:
62
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
W(C) = W(A∩B) = W(A)*W(BA) = 0,6*0,98 = 0,588 = 58,8 %.
Obgleich sie verbal sehr ähnlich klingen, besteht zwischen den Ereignissen C und BA ein
fundamentaler Unterschied, der häufig übersehen wird: Während C das Ereignis beschreibt,
daß zwei ungewisse Ereignisse („Schwangerschaft“ und „positiver Test“) zugleich eintreten, beschreibt BA das Eintreten eines positiven Tests unter der Voraussetzung, daß tatsächlich eine Schwangerschaft vorliegt. Entsprechend unterschiedlich sind die korrespondierenden Wahrscheinlichkeiten: W(C) = 58,89 % und W(BA) = 98 %.
Man beachte, daß die beiden Ereignisse A und B in obigem Beispiel in ausgeprägter Weise voneinander abhängig sind. Unabhängigkeit [W(B) = W(BA)] würde
inhaltlich bedeuten, daß beispielsweise die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses
eines Schwangerschaftstests unbeeinflußt davon ist, ob die Getestete nun tatsächlich schwanger ist oder nicht – was dem Sinn jeden Tests zuwiderläuft und in diesem Fall einen offensichtlichen Unsinn darstellt.
Negationssatz
Der Negationssatz bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit der Negation eines Ereignisses („Gegenereignis“) und damit auf die Komplementärmenge, die aus der
entsprechenden Menge gebildet werden kann.
Negationssatz
Die Wahrscheinlichkeit des zum Ereignis A komplementären Ereignisses ¬A erhält
man, indem man vom Wert 1 die Wahrscheinlichkeit von A abzieht. Symbolisch:
W(¬A) = 1-W(A).
Man beachte, daß der Negationssatz auch auf die Komplementärmengen bedingter
Ereignisse angewendet werden kann: Das zu (AB) gehörige Gegenereignis ist
(¬AB). Es gilt daher: W(¬AB) = 1 – W(AB).
Beispiel 3.17
Betrachten wir wieder unser Schwangerschaftstestbeispiel mit den Ereignissen und Wahrscheinlichkeiten:
A
„Probandin ist schwanger“
B
„Schwangerschaftstest zeigt bei der Probandin eine Schwangerschaft an“
(BA) „Test zeigt eine Schwangerschaft an, unter der Voraussetzung, daß die Probandin
schwanger ist“
W(A) = 60 %; W(B) = 70 %; W(BA) = 98 %.
Die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Komplementärereignisse sind:
W(¬A) = 1- W(A) = 1- 0,6 = 0,4 = 40 %
W(¬B) = 1- W(B) = 1- 0,7= 0,3 = 30 %
W( ¬BA) = 1 – W(BA) = 1 – 0,98 = 0,02 = 2 %
Offensichtlich ist die Menge (¬BA), welche das Ereignis beschreibt, daß der Schwangerschaftstest negativ ausfällt, obwohl die Probandin schwanger ist, eine echte Negation der
Menge (BA).
4.6 Wichtige Spezialfälle: Unabhängigkeit und Disjunktheit von
Ereignissen
4.6
63
Wichtige Spezialfälle: Unabhängigkeit und
Disjunktheit von Ereignissen
Disjunktheit zweier Ereignisse
Zwei Ereignisse A und B heißen disjunkt („punktfremd“), wenn das Eintreten des
einen Ereignisses, das Eintreten des anderen Ereignisses ausschließt. Symbolisch:
A und B sind disjunkt, wenn gilt: A ∩ B = ∅.
Beispiel 3.18
Betrachten wir die beiden folgenden Ereignisse:
A
„im Zeitpunkt t erfolgt eine exakte Messung der Geschwindigkeit des Objektes X“
B
„im Zeitpunkt t erfolgt eine exakte Messung der Position des Objektes X“
Handelt es sich bei unserem „Objekt X“ um ein Objekt, das nur durch die Regeln der Quantenmechanik beschreibbar ist (wie z.B. ein Elektron), dann gilt die sogenannte Heisenberg`sche Unschärferelation. Diese besagt – grob gesprochen -, daß eine exakte Messung
der Geschwindigkeit eines Objektes, die gleichzeitige exakte Messung seiner Position prinzipiell ausschließt und umgekehrt. Das gleichzeitige Eintreten von A und B ist daher nicht
möglich, A und B sind disjunkt. Anders verhält es sich, wenn unser Objekt X mit den Regeln der klassischen Physik beschrieben werden kann (wie z.B. eine Billardkugel). In diesem Falle sind A und B nicht disjunkt, denn einer gleichzeitigen Messung von Position und
Geschwindigkeit des Objektes X steht nichts im Wege.
Die Disjunktheit wird häufig verwechselt mit der sogenannten Unabhängigkeit.
Diese ist jedoch ein anderes Konzept, wenngleich es durchaus gewisse Zusamenhänge gibt.
Unabhängigkeit zweier Ereignisse
Zwei Ereignisse heißen unabhängig, wenn der Eintritt (oder Nichteintritt) des einen
Ereignisses keinen Einfluß auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des anderen Ereignisses hat, d.h., wenn gilt:
W(AB) = W(A).
Im Falle der Unabhängigkeit gilt selbstverständlich auch W(BA) = W(B).
Beispiel 3.19
Betrachten wir die beiden Ereignisse:
A:
Student „Lustig“ kann während einer Statistikklausur von der Studentin
„Flott“, welche excellente Statistikkenntnisse hat, abschreiben.
B:
Student “Lustig “ besteht die Statistikprüfung
Offensichtlich ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B abhängig davon, ob Ereignis A
eintritt. Kurz: B ist von A abhängig.
An diesem Beispiel wird deutlich, daß die Frage, ob zwei Ereignisse voneinander
abhängig sind, inhaltlich entschieden werden muß. So ist es entscheidend, ob es
dem „Lustig“ ermöglicht wird, während der Klausur von der „Flott“ abzuschreiben.
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
64
Ist dies der Fall, so liegt Abhängigkeit vor, ist dies nicht der Fall, so sind A und B
unabhängig. Wenn Abschreiben möglich ist, dann gilt W(BA)>W(B), was inhaltlich einfach besagt, daß die Chance, des „Lustig“, durch die Prüfung zu kommen,
steigt, wenn er neben der „Flott“ sitzt. Ist dagegen Abschreiben nicht möglich, so
gilt W(BA) = W(B), was inhaltlich besagt, daß die Wahrscheinlichkeit des Bestehens nur von den Fähigkeiten des „Lustig“ abhängt und nicht davon beeinflußt
wird, ob er nun neben der „Flott“ zum Sitzen kommt oder nicht.
Zwischen der Disjunktheit von Ereignissen und dem Additionssatz sowie zwischen
der Unabhängigkeit und dem Multiplikationssatz bestehen enge Zusammenhänge.
Stellen wir uns zunächst zwei disjunkte Ereignisse A und B vor. Da sie disjunkt
sind, gilt definitionsgemäß: A∩B=∅. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses,
das der leeren Menge entspricht ist Null. Daher vereinfacht sich der Additonssatz
bei Disjunktheit der entsprechenden Ereignisse wie folgt:
W(A∪B)
= W(A)+W(B)-W(A∩B)
= W(A) + W(B) – W(∅)
= W(A) + W(B) – 0
= W(A) + W(B).
Ähnliches gilt bei Unabhängigkeit. Sind A und B unabhängig, gilt definitionsgemäß: W(BA) = W(B). Daher vereinfacht sich der Multiplikationssatz bei Unabhängigkeit der entsprechenden Ereignisse wie folgt:
W(A∩B)
= W(A)*W(BA)
= W(A)*W(B)
4.7
Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit
Die vor allem für die Kalkulation konkreter Probleme relevanten Wahrscheinlichkeitsregeln lassen sich zum sogenannten Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit
zusammenfassen.
Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit
Gegeben sei ein beliebiges Ereignis A aus dem Ergebnisraum Ω sowie die Ereignisse B1;.....; Bn mit den Eigenschaften:
(a)
B1∪B2∪B3∪.....∪Bn = Ω
(b)
Bi∩Bj = ∅ ∀i,j
Dann gilt:
W(A) = W(AB1)*W(B1)+W(AB2)*W(B2)+ .....+W(ABn)*W(Bn)
4.8 Der Satz von Bayes
65
Der Beweis des Satzes ist relativ einfach: Die Ereignisse B1;.....; Bn haben die Eigenschaft, daß sie gemeinsam den gesamten Ergebnisraum Ω umfassen, sie „spannen“ ihn auf [Eigenschaft (a)]. Gleichzeitig sind sie paarweise disjunkt, d.h. sie
schließen sich gegenseitig aus [Eigenschaft (b)]. Eine Menge von Ereignissen aus
Ω mit diesen beiden Eigenschaften nennt man eine Zerlegung von Ω. Da die Ereignisse B1;.....; Bn den gesamten Eregbnisraum aufspannen bzw. umfassen, kann A
wie folgt als Vereinigung dargestellt werden: A = (A∩B1) ∪ (A∩B2) ∪ (A∩B3) ∪
..... ∪ (A∩Bn). Aufgrund der Disjunktheit der Ereignisse B1;.....; Bn gilt für die
Wahrscheinlichkeit von A: W(A) = W(A∩B1) + W(A∩B2) + W(A∩B3) + .....+
W(A∩Bn). Nach dem Multiplikationssatz läßt sich dies auch schreiben als: W(A) =
W(AB1)*W(B1) + W(AB2)*W(B2) + W(AB3)*W(B3) + ..... +
W(ABn)*W(Bn), womit der Satz bewiesen wäre.
Beispiel 3.20
Student „Lustig“ geht sehr lückenhaft vorbereitet in das Statistik-Examen. Die Wahrscheinlichkeit, daß er die Prüfung ohne fremde Hilfe besteht, beträgt daher lediglich 10 %. Seine
große und einzige Hoffnung ist die Studentin „Flott“, denn diese hat ihm schon manchen
nützlichen Tip gegeben. Der „Lustig“ ist sich daher bewußt: Wenn er während der Prüfung
neben der „Flott“ zum Sitzen kommt, läßt sie ihn abschreiben und er besteht die Prüfung
mit 80 %-iger Wahrscheinlichkeit. Da die Sitzverteilung rein zufällig erfolgt, beträgt die
Wahrscheinlichkeit, daß er neben der „Flott“ zum Sitzen kommt (d.h. abschreiben kann!),
lediglich 5 %. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß der „Lustig“ die Prüfung besteht?
Um diese Frage zu beantworten, definieren wir folgende Ereignisse:
A:
Student „Lustig“ kann während der Prüfung von der „Flott“ abschreiben
B:
Student „Lustig“ besteht die Prüfung
Die vorliegenden Informationen liefern uns folgende Wahrscheinlichkeiten: W(A)=0,05:
W(BA)=0,8; W(B¬A)=0,1. Wir wissen aber auch: W(¬A)=1-W(A)=0,95;
W(¬BA)=1-W(BA)=0,2; W(¬B¬A)=1-W(B¬A)=1- 0,1=0,9. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit W(B). Da die Ereignisse A und ¬A eine Zerlegung des relevanten Ergebnisraumes darstellen, sind die Voraussetzungen des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit
gegeben. Daher gilt: W(B)=W(BA)*W(A)+W(B¬A)*W(¬A). Diese Wahrscheinlichkeiten liegen uns aber vor: W(B) = 0,8*0,05+0,1*0,95 = 0,04+0,095=0,135. Fazit: Allein
durch die kleine Chance, neben der „Flott“ zum Sitzen zu kommen, steigen die Aussichten
des „Lustig“, die Prüfung zu bestehen, von zunächst 10 % auf 13,5 %.
4.8
Der Satz von Bayes
Wie im letzten Beispiel deutlich wurde, kann mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit die (unbedingte) Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisse ermittelt werden, wenn Informationen über die bedingten Wahrscheinlichkeiten dieses
Ereignisses vorliegen. In vielen Anwendungen ist man jedoch darüber hinaus noch
daran interessiert, zu erfahren, wie groß die Wahrscheinlichkeit des bedingenden
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
66
Ereignisses ist, unter der Voraussetzung, daß das Ereignis, an dem man ursprünglich interessiert war, tatsächlich eingetreten ist. Anhand der Problematik aus Beispiel (3.20) kann sehr schön illustriert werden, was damit gemeint ist: Dort hatten
wir eine a priori Wahrscheinlichkeit, daß der „Lustig“ von der „Flott“ abschreibt,
von 5 % gegeben. Wissen wir nun zusätzlich, daß der Student die Prüfung tatsächlich bestanden hat, so besteht verständlicherweise der Verdacht, daß er von der
„Flott“ abgeschrieben hat. Sicher ist dies jedoch nicht. Wir können hierfür lediglich
eine Wahrscheinlichkeit angeben. M.a.W: Wir sind an der Wahrscheinlichkeit interessiert, mit welcher der „Lustig“ von der „Flott“ abgeschrieben hat, unter der Voraussetzung einer bestandenen Prüfung. Diese und ähnlich strukturierte Fragen können mit Wahrscheinlichkeitskalkulationen beantwortet werden, die im 18. Jahrhundert von Thomas Bayes zu einem berühmten Satz zusammengefaßt wurden – dem
Satz von Bayes.
Satz von Bayes
Gegeben sei wieder ein beliebiges Ereignis A aus dem Ergebnisraum Ω sowie die
Ereignisse B1;.....; Bn mit den den Eigenschaften:
(a)
B1∪B2∪B3∪.....∪Bn = Ω
(b)
Bi∩Bj = ∅ ∀i, j
Dann gilt:
W(BiA) =
W ( A Bi ) * W ( Bi )
n
∑ W ( A B )W ( B )
i
i =1
i
Auch dieser Satz läßt sich relativ problemlos nachvollziehen: Die Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten besagt:
W(BiA) =
W ( Bi ∩ A)
.
W ( A)
Aufgrund des Multiplikationssatzes und des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit können Zähler und Nenner des Bruches auf der rechten Seite der Gleichung wie folgt umgeschrieben werden:
W(BiA) =
W ( A Bi ) *W ( Bi )
n
∑ W ( A B )W ( B )
i =1
i
.
i
Damit ist der Satz von Bayes bewiesen.
Ein wichtiger Spezialfall des Satzes ergibt sich, wenn die relevante Zerlegung des
Ergebnisraumes nur aus den Ereignissen B und ¬B besteht. Dann gilt:
4.8 Der Satz von Bayes
W(BA) =
67
W ( A B) *W ( B )
W ( A B)W ( B ) * + * W ( A ¬B)W ( ¬B )
.
Beispiel 3.21
Gegeben sei unser Beispiel 3.20 mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Dort waren
wir an der (unbedingten) Wahrscheinlichkeit interessiert, mit der der Student „Lustig“ die
Prüfung besteht, eingedenk der Möglichkeit, daß er von der „Flott“ abschreiben kann. Nun
gehen wir davon aus, der „Lustig“ hat die Prüfung bestanden und wir wollen vor dem Hintergrund dieser zusätzlichen Information wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß
er tatsächlich von der „Flott“ abgeschrieben hat. Folgende Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten liegen der Fragestellung zugrunde:
A:
Student „Lustig“ kann von der „Flott“ abschreiben;
B:
Student „Lustig“ besteht die Prüfung
W(A)=0,05, W(BA)=0,8, W(B¬A)=0,1, W(¬A)=1-W(A)=0,95, W(¬BA)=1W(BA)=0,2, W(¬B¬A)=1-W(B¬A)=1- 0,1=0,9.
Gesucht ist nun die die Wahrscheinlichkeit W(AB). Bei der Berechnung hilft uns die
spezielle Variante des Satzes von Bayes weiter:
W ( B A) * W ( A)
W ( B A) * W ( A)
W(AB) =
=
. Die zur Berechnung
W ( B A) * W ( A) + W ( B ¬A) * W ( ¬A)
W ( B)
von W(AB) erforderlichen Wahrscheinlichkeiten haben wir gegeben: W(B/A) = 0,8,
W(A) = 0,05 und W(B) = 0,135 (vgl. Bsp. 3.20). Somit gilt:
0,8 * 0,05
= 0,2963 = 29,63 %
W(A/B) =
0,135
Wir können also festhalten: Wenn der „Lustig“ die Prüfung tatsächlich besteht, hat er mit
rund 30%-iger Wahrscheinlichkeit von der „Flott“ abgeschrieben.
Beispiel3.22
Ein Unternehmen verwendet die Methode des sogenannten Assessment-Centers (AC), um
aus der Flut von Bewerbungen die richtige Kandidatin bzw. den richtigen Kandidaten auszuwählen. Von dieser Methode ist bekannt, daß ein geeigneter Kandidat von einem AC mit
85%-iger Wahrscheinlichkeit als solcher erkannt wird. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein ungeeigneter Bewerber von einem AC ebenfalls als geeignet eingestuft wird,
mit 20% relativ hoch. Man kann davon ausgehen, daß von allen Bewerbern lediglich 30 %
für die ausgeschriebene Position geeignet sind. Eine sicherlich interessante Frage besteht
nun darin, wie hoch Wahrscheinlichkeit ist, daß sich ein vom AC als geeignet beurteilter
Kandidat letztlich als ungeeignet erweist. Folgende Variablendefinition ist sinnvoll:
A:
Bewerber ist ungeeignet
B:
Bewerber besteht Assessment-Center
Der Problemstellung können folgende Wahrscheinlichkeiten entnommen werden:
W(B/A)=0,2, W(B¬A)=0,85, W(A)=0,7, W(¬A)=0,3. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit
W(A/B). Diese ergibt sich nach dem Satz von Bayes durch:
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
68
W(AB) =
W ( B A) * W ( A)
W ( B A) * W ( A) + W ( B ¬A) * W ( ¬A)
=
0,2 * 0,7
0,14
=
=
0,2 * 0,7 + 0,85 * 0,3
0,14 + 0,255
0,14
= 0,3544 = 35,44 %. Fazit: Gegeben die Testqualität des AC, erweist sich ein als
0,395
geeignet eingestufter Bewerber mit rund 35%-iger Wahrscheinlichkeit letztlich als ungeeignet.
4.9
Kombinatorik
Die Kombinatorik stellt ein bedeutendes und aufgrund der vielfältigen Anwendungsbereiche eigenständiges Teilgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie dar. Vor
Erläuterung der Grundkonzepte, ist es aber nötig, einige Begriffe einzuführen:
Fakultät
Die Fakultät einer positiven ganzen Zahl n (sprich: „n Fakultät“) entspricht dem
Produkt, das aus den zwischen 1 und n gelegenen ganzen Zahlen gebildet werden
kann, wobei 1 und n bei der Produktbildung mit einbezogen werden. Symbolisch:
n! := 1*2*3*......*n.
Die Fakultät von 0 ist definitorisch gleich 1.
Symbolisch: 0!:=1
Beispiele 3.23
1! = 1
2! = 1*2 = 2
3! = 1* 2* 3 = 6
4! = 1* 2*3*4 = 24
5 ! = 1*2*3*4*5 = 120
n! = 1*2*3*4*.....*(n-2)*(n-1)*n
Allgemeiner Binomialkoeffizient
Sei α eine beliebige reelle Zahl und k eine beliebige natürliche Zahl. Der wie folgt
αI
F
G
Hk JK(sprich: „α über k“) heißt Binomialkoeffizient:
αI α * (α − 1) * (α − 2) * (α − 3)*.....*[α − ( k − 1)]
F
G
1 * 2 * 3 * 4*.....*k
Hk JK: =
definierte Ausdruck
Beispiel 3.24
(a)
−2I −2 * ( −2 − 1) * ( −2 − 2) −24
F
=
= −4
G
1* 2 * 3
6
H3 JK=
4.9 Kombinatorik
69
10
F1 / 3I 1 / 3 *(1 / 3 − 1) *(1 / 3 − 2) = 1 / 3 *(−2 / 3) *(−5 / 3) = 27 = 5
(b) G J=
1* 2 * 3
1* 2 * 3
6
81
H3 K
Spezieller Binomialkoeffizient
Der Binomialkoeffizient
αI
F
G
Hk JKläßt sich für den Fall, daß neben k auch α eine natür-
liche Zahl ist (d.h. wenn gilt α:=n∈Ν) darstellen als
αI F
nI
F
n!
G
Hk JK: = G
Hk JK= (n − k )! k !
Der spezielle Binomialkoeffizient kann sehr schön illustriert werden. Der Wert von
18I
F
G
J errechnet sich gemäß der Definition des allgemeinen Binomialkoeffizienten
12K
H
als:
18I 18 *17 *16*.....*7
F
.
G
J=
12K 1 * 2 * 3 * 4*.....*12
H
Multiplikation beider Seiten mit
6!
verändert nicht den Wert der Gleichung, macht
6!
aber deutlich, daß gilt:
18I 18 *17 * 16*.....*7 1 * 2 * 3*.....*6
F
.
*
G
J=
12K 1 * 2 * 3 * 4*.....*12 1 * 2 * 3*.....*6
H
Offensichtlich entspricht der Zähler auf der rechten Seite dem Wert 18! und der
Nenner dem Wert (18-6)!6!. Somit gilt:
ne Zusammenhang
18I
F
18!
=
. Damit ist der allgemeiG
J
12K (18 − 6)! 6!
H
nI
F
n!
=
G
J
Hk K (n − k )! k ! beispielhaft illustriert.
Beispiel 3.25
49I
F
49!
1 * 2 * 3*.....*43 44 * 45*.....*49
44 * 45*.....*49
.
G
H6 JK= (49 − 6)!6! = 1* 2 * 3*.....*43 * 1* 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 1* 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 13.983816
Wie wir noch sehen werden, entspricht diese Zahl der Anzahl der insgesamt vorhandenen
Möglichkeiten, aus 49 Elementen genau eine Sechser-Kombination zu ziehen – eine Situation wie sie z.B. beim Lotto gegeben ist.
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
70
Halten wir also fest: Der zunächst für reelle α´s definierte allgemeine Binomialkoeffizient kann für denFall, daß beide Zahlen α und k natürlich sind, in die Form
nI
F
n!
=
G
J
Hk K (n − k )! k ! gebracht werden. Diese Variante des Binomialkoeffizienten spielt
in der Anwendung der Kombinatorik eine sehr große Rolle. Doch nun weiter mit
unserer Einführung grundlegender Begriffe:
Permutation
Gegeben sei eine beliebige Menge mit n Elementen Α={a1;.....an}. Jede einzelne
Anordnung all dieser Elemente heißt Permutation der Menge Α.
Eine Permutation der Menge {a; b; c} besteht im Tupel (abc), eine andere im Tupel
(cba), wieder eine andere in (acb) usw. Insgesamt gibt es zur Menge {a; b; c} die
folgende Menge an Permutationen: {(abc), (bac), (cab); (cba), (acb), (bca)}.
Beispiel 3.26
Die Städte Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Köln und Frankfurt müssen von einem
Vertreter im Rahmen einer Präsentationsreise besucht werden. Eine Tour durch Deutschland (die diese Städte beinhaltet!) kann als eine Permutation der Menge {Berlin; München;
Düsseldorf; Hamburg; Köln; Frankfurt} aufgefaßt werden. Beispielsweise bietet sich – von
Nord-Ost kommend – die Tour (Berlin,Hamburg,Düsseldorf,Köln,Frankfurt,München)
an.
Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, wieviel Permutationen es zu
einer bestimmten vorliegenden Menge insgesamt gibt. Die Antwort hierauf läßt
sich durch einige einfache Überlegungen finden: Etwas präziser formuliert, lautet
die Frage, wieviel Permutationen es zur Menge {a1; a2; .....; an} gibt. Dies entspricht der Anzahl von Möglichkeiten die einzelnen „Stellen“ einer gewissermaßen
„virtuellen“ Permutation (?1; ?2; .....; ?n) zu belegen. Zunächst ist klar, daß die erste
Stelle, für die noch alle Elemente zur Verfügung stehen, mit n Elementen belegt
werden kann. Wenn nun die erste Stelle (wie auch immer!) belegt ist, stehen für die
zweite nur noch (n-1) Möglichkeiten zur Verfügung, für die dritte (n-2) für die
vierte (n-3), usw., bis hin zur letzten, der n-ten Stelle, für die nur noch n-n+1 = 1
Möglichkeit zur Verfügung steht. Zusammenfassend ergibt sich daher folgendes
Bild:
1. Stelle
⇒
n Möglichkeiten
2. Stelle
⇒
(n-1) Möglichkeiten
3. Stelle
⇒
(n-2) Möglichkeiten
4. Stelle
⇒
(n-3)Möglichkeiten
............
........
4.9 Kombinatorik
71
............
........
k-te Stelle
⇒
............
............
........
........
n-te Stelle
⇒
[n-(k-1)] Möglichkeiten
[n-(n-1)] = 1 Möglichkeit
Insgesamt gibt es also [n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*.....*1] = n! Möglichkeiten, die verschiedenen Stellen einer „virtuellen“ Permutation zu belegen. Dieses wichtige Ergebnis halten wir fest:
Anzahl möglicher Permutationen
Zur Menge Α={a1;.....an} gibt es insgesamt n! Möglichkeiten, sämtliche Elemente
dieser Menge anzuordnen, d.h. es gibt zur Menge Α insgesamt n! Permutationen.
Der Vertreter des Beispiels (3.26), der die Städte Berlin, München, Düsseldorf,
Hamburg, Köln und Frankfurt besuchen muß, hat 6!=720 Möglichkeiten, seine
Deutschlandtour zu legen. Ein berühmtes Problem aus der betriebswirtschaftlichen
Entscheidungslehre besteht darin, bei gegebenen Entfernungen zwischen den einzelnen Städten, die Tour herauszufinden, welche die Gesamtstrecke der Rundreise
minimiert, unter der Voraussetzung, daß alle Städte besucht werden müssen. Interessanterweise wurde für dieses sogenannte „traveling-salesman-problem“ (TSP)
erst in jüngster Vergangenheit ein exakter allgemeiner Lösungsalgorithmus gefunden.
Bei Permutationen geht es darum, für eine gegebene Menge von Elementen zu
bestimmen, wieviele Möglichkeiten es gibt, alle Elemente dieser Menge anzuordnen. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Viele Problemstellungen haben jedoch darüberhinausgehend eine etwas allgemeinere Struktur.
Häufig ist es nötig, zu wissen, wieviele Möglichkeiten es gibt, aus einer gegebenen
Anzahl von Elementen Untergruppen einer vorgegebenen Größe zu bilden. Hier
wird der Begriff der sogenannten Kombination relevant.
Kombination
Gegeben sei die n elementige Menge Α={a1;.....an} sowie eine beliebige natürliche
Zahl k≤n. Jede einzelne, k-stellige Anordnung von einem bis k Elementen aus der
Menge Α heißt Kombination der Ordnung k (sprich: „k-Kombination“) aus der
Menge Α.
Im Gegensatz zu Permutationen werden bei k-Kombinationen nicht alle Elemente
der zugrundeliegenden Menge angordnet, sondern es werden Anordnungen mit
dem Umfang k gebildet, d.h. der Umfang einer einzelen Anordnung kann kleiner
sein als die Anzahl der Elemente („Mächtigkeit“) der zugrundeliegenden Menge.
Zudem dürfen einzelne Elemente grundsätzlich mehr als einmal vorkommen, ja im
72
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
Extremfall kann eine Kombination nur aus einem Element bestehen, das k-mal
„wiederholt“ wird. So können aus der Menge {a; b; c} die folgenden Kombinationen zweiter Ordnung gebildet werden: {(aa); (bb); (cc); (ab); (ba); (ac); (ca); (bc);
(cb)}.
Beispiel 3.27
Ein Lottotip, z.B. die Zahlen (2,8,1,3,5,6) stellt eine Kombination der Ordnung 6 aus der
Menge der Zahlen {1; 2; 3; .....; 49} dar.
Wie bei Permutationen ist es auch hier wieder von Interesse zu wissen, wieviele
mögliche Kombinationen es zu einer bestimmten Menge gibt. Diese Frage muß
jedoch präzisiert werden, bevor sie allgemein beantwortet werden kann. Zunächst
ist festzulegen, welcher Ordnung die Kombination sein soll, deren mögliche Anzahl man sucht. Die Frage könnte also lauten: „Wieviele Kombinationen der Ordnung k gibt es zu einer n-elementigen Menge?“ Doch selbst diese konkretisierte
Frage kann noch nicht beantwortet werden. Weiter muß man festlegen, ob innerhalb der Kombinationen Wiederholungen erlaubt sein sollen, d.h. ob Kombinationen der Form (a,a,....,a) zulässig sind, und ob die Anordnung der Elemente in einer
Kombiantion eine Rolle spielt, d.h. ob z.B. die Anordnungen (ab) und (ba) zwei
verschiedene Kombinationen darstellen, oder nur eine einzige repräsentieren.
Insgesamt ergeben sich also vier verschiedene Möglichkeiten aus einer nelementigen Menge Kombinationen der Ordnung k zu bilden:
• die Elemente der Menge dürfen sich in der Kombination nicht wiederholen und
die Anordnung der Elemente ist relevant. („Keine Wiederholung – Anordnung
relevant“)
• die Elemente der Menge dürfen sich in der Kombination nicht wiederholen und
die Anordnung der Elemente ist irrelevant. („Keine Wiederholung – Anordnung
irrelevant“)
• die Elemente der Menge dürfen sich wiederholen und die Anordnung der Elemente ist relevant. („Mit Wiederholung – Anordnung relevant“)
• die Elemente der Menge dürfen sich wiederholen und die Anordnung der Elemente ist irrelevant. („Mit Wiederholung – Anordnung irrelevant“)
Alle kombinatorischen Probleme lassen sich einer dieser vier Möglichkeiten zuordnen. Welcher Fall auf ein konkret vorliegendes Problem anzuwenden ist, muß
von der Sache, d.h. vom Problem her entschieden werden. Dies wird deutlich,
wenn wir die Problematik des Beispiels (3.27) aufgreifen. Dort hatten wir festgestellt, daß ein einzelner Lottotip eine Kombination der Ordnung 6 aus der 49elementigen Menge {1; 2; .....; 49} darstellt. Welcher unserer vier Fälle hier zutrifft, wird ausschließlich von den Lottoregeln bestimmt: Da eine Zahl nicht zweimal gezogen werden kann, sind Kombinationen ohne Wiederholung der Elemente
angesprochen. Da es im Falle eines Gewinns vom Reglement her keinen Unter-
4.9 Kombinatorik
73
schied macht, in welcher Reihenfolge die 6 Zahlen getippt wurden, sind Kombinationen angesprochen, bei denen die Anordnung der Elemente irrelevant ist . Beim
Lottospiel liegt also die spezielle Variante „keine Wiederholung – Anordnung irrelevant“ vor.
Da die Antwort auf die Frage, wieviele Kombinationen der Ordnung k es zu einer
bestimmten Menge gibt, unterschiedlich ausfällt, je nachdem welche der vier möglichen Varianten zur Anwendung konmt, müssen wir jeden Fall einzeln betrachten.
Variante I: Keine Wiederholung – Anordnung relevant
Auf Basis dieser konkreten Spezifizierung können wir nun die Frage beantworten,
wieviele k-Kombinationen aus n Elementen gebildet werden können. Wieder hilft
uns die Überlegung weiter, wieviele Möglichkeiten es gibt, die verschiedenen Stellen der „virtuellen“ k-Kombination (?1,?2,.....,?k) zu belegen. Wir erhalten:
1. Stelle
⇒
n Möglichkeiten
2. Stelle
⇒
(n-1) Möglichkeiten
3. Stelle
⇒
(n-2) Möglichkeiten
4. Stelle
⇒
(n-3)Möglichkeiten
............
........
............
........
k-te Stelle
⇒
[n-(k-1)] Möglichkeiten
Wir haben also insgesamt n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*.....*[n-(k-1)] Möglichkeiten, die
verschiedenen Stellen einer k-Kombination zu belegen, d.h es gibt n*(n-1)*(n2)*(n-3)*.....*[n-(k-1)] Kombinationen der Ordnung k. Dieser Ausdruck kann jedoch vereinfacht werden: Multiplikation mit
(n − k )!
verändert zwar nicht den
(n − k )!
Wert, ergibt aber:
n * (n − 1) * (n − 2)*.....*[ n − ( k − 1)]
(n − k )!
(n − k )!
=
n * (n − 1) * (n − 2)*.....*[n − ( k − 1)]* (n − k )!
(n − k )!
=
n * (n − 1) * (n − 2)*.....*[n − ( k − 1)]* (n − k ) *[n − ( k + 1)]*[n − ( k + 2)]*.....*1
(n − k )!
=
n!
(n − k )!
Wir erhalten also folgendes Ergebnis:
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
74
Anzahl Kombinationen: Variante I
Wenn Wiederholungen ausgeschlossen sind und die Anordnung der Elemente von
Bedeutung ist, dann gibt es zur n-elementigen Menge Α={a1;.....an} insgesamt
n!
Kombinationen der Ordnung k.
(n − k )!
k!
und die Erinnerung an die Definitik!
n
n!
erkennen wir, daß dies
on des speziellen Binomialkoeffizienten als
=
k
(n − k )! k !
Durch Multiplikation dieses Ausdrucks mit
F
IJ
G
HK
auch alternativ ausgedrückt werden kann:
F
IJ
G
HK
n
n!
=
k!
k
(n − k )!
Beispiel 3.28
Aus 70 Kandidaten soll ein Studentensprecher sowie dessen Stellvertreter gewählt werden.
Es stellt sich die Frage, wieviele Wahlausgänge grundsätzlich möglich sind. Offensichtlich
sind die Voraussetzungen von Variante I erfüllt: Wiederholung der Elemente ist ausgeschlossen, weil ein Studentenvertreter sinnvollerweise nicht sein eigener Stellvertreter sein
kann; Anordnung der Elemente ist von Bedeutung, da es für den Wahlausgang einen Unterschied macht, ob ein bestimmter Student auf den ersten oder den zweiten Platz gewählt
70!
70!
wird. Daher haben wir
=
=69*70 = 4.830 mögliche Ergebnisse der Wahl.
(70 − 2)! 68!
Variante II: Keine Wiederholung – Anordnung irrelevant
Bei der Frage nach der Anzahl möglicher Kombinationen in Variante II, ist es zunächst sehr hilfreich, sich klarzumachen, daß bei Irrelevanz der Anordnung die
Anzahl geringer sein muß als bei Relevanz. Um wieviel geringer, das wollen wir
uns am Beispiel der Menge {a; b; c; d} klarmachen: Haben unterschiedliche Anordnungen eine Bedeutung (Variante I), so gibt es zur Menge {a; b; c; d}
4I
F
G
H3J
K3! =
24 Kombinationen der Ordnung 3. Diese lassen sich durch folgende Matrix darstellen:
4I
F
G
J
3
H
644447K
44448
Fabc
G
acb
G
bac
G
G
bca
G
cab
G
G
Hcba
abd
adb
bad
bda
dab
dba
acd
adc
cad
cda
dac
dca
bcd
bdc
cbd
cdb
dbc
dcb
I
JJU
JJ||V3!
JJ||
JKW
4.9 Kombinatorik
75
Die Spaltenzahl dieser Matrix entspricht der Anzahl der 3-er Kombinationen bei
Nichtberücksichtigung der Anordnung; sie entspricht daher genau der Fragestellung von Variante II. Die Zeilenanzahl 3! dagegen entspricht der Anzahl möglicher
Permutationen zu einer dreielementigen Menge. Da die Gesamtzahl aller Kombinationen, d.h. die Anzahl der Elemente der Matrix
4I
F
G
H3J
K3! beträgt, erhalten wir unser
gesuchtes Ergebnis, wenn wir diese Gesamtzahl durch die Anzahl der Zeilen divi-
4I
F
G
J3! 4I
3K F
H
dieren:
=G
3!
H3JK. Dieser Wert entspricht dem bereits bekannten Binomialkoeffi-
zienten. Wir können daher festhalten:
Anzahl Kombinationen: Variante II
Wenn Wiederholungen ausgeschlossen sind und die Anordnung der Elemente nicht
von Bedeutung ist, dann gibt es zur n-elementigen Menge Α={a1;.....an} insgesamt
nI
F
G
Hk JKKombinationen der Ordnung k.
Die wohl beste Illustration dieser Variante liefert das Lottospiel „6 aus 49“. Wie
bereits erwähnt, kann beim Lotto keine Zahl mehrfach gezogen werden („Keine
Wiederholung“) und die Reihenfolge, in der ein Tip abgegeben wird, hat auf die
Gewinnchancen keinen Einfluß („Anordnung irrelevant“ ). Damit liegen die Voraussetzungen der Variante II vor und es gibt insgesamt
49I
F
49!
=
G
J
H6 K (49 − 6)!6! =
13.983.816 Möglichkeiten sechs Richtige zu tippen. Unterstellt man beispielsweise
– was ja durchaus üblich ist -, daß von einem Spieler insgesamt sechs Tips abgegeben werden und daß jeder mögliche Tip gleichwahrscheinlich ist, dann entspricht
die Wahrscheinlichkeit eines Hauptgewinns („sechs Richtige“) der mikroskopisch
kleinen Zahl von
6
= 0,00000042907.
13.983.816
Beispiel 3.29
Der Student „Lustig“ hofft, daß er während einer für ihn sehr wichtigen Prüfung neben der
großzügigen und intelligenten Studentin „Flott“ zum Sitzen kommt, denn diese hat ihm
signalisiert, daß sie einem kleinen Unterschleif nicht ablehnend gegenübersteht. Als nun der
Tag der Prüfung anbricht, stehen für insgesamt 20 Prüflinge (unter ihnen die „Flott“ und
der „Lustig“) genau zehn Zweisitzbänke zur Verfügung, so daß in jedem Fall zehn Sitzpaare gebildet werden müssen. Angesichts dieser günstigen Konstellation ist der „Lustig“ verständlicherweise an der Wahrscheinlichkeit interessiert, daß ihnen beiden tatsächlich dieselbe Bank zugewiesen wird, wobei berücksichtigt werden muß, daß die Sitzverteilung rein
zufällig erfolgt. Bei diesem Problem geht es offensichtlich darum, aus insgesamt 20 Stu-
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
76
denten zehn Paare, d.h. Kombinationen zweiter Ordnung zu bilden. Da es beim Abschreiben unerheblich ist, ob jemand links oder rechts in der Bank sitzt, sind Kombinationen
angesprochen, deren Anordnung irrelevant ist. Da ein Student nicht neben sich selbst sitzen
kann, sind Wiederholungen ausgeschlossen. Wir haben also unsere Variante II vorliegen.
20
Dementsprechend gibt es
= 190 Kombinationen, d.h. 190 Möglichkeiten, aus 20 Stu2
denten Zweiergruppen zu bilden. Da jedoch nur zehn Bänke zur Verfügung stehen, muß
diese Zahl um den Faktor 10 reduziert werden. Dadurch erhalten wir 190/10 = 19 Möglichkeiten. Die Chance des „Lustig“, während der Prüfung neben der neben der „Flott“ zu sitzen, beträgt daher 1/19 ≈ 0,05263 ≈ 5,26 %. Diese Wahrscheinlichkeit kann auch durch
eine einfachere, alternative Überlegung abgeleitet werden: Man stelle sich vor, der „Lustig“
betritt den Prüfungsraum und setzt sich in eine beliebige Bank. Nun sind noch 19 Plätze frei
und 19 Personen ohne Platz, von denen sich jede mit gleicher Wahrscheinlichkeit neben
den Lustig setzen kann. Da eine der Personen die „Flott“ ist, beträgt die Chance, daß sie
neben den „Lustig“ zum Sitzen kommt 1/19.
F
I
G
HJK
Variante III: Mit Wiederholung – Anordnung relevant
Die Anzahl möglicher Kombinationen der Ordnung k ergibt sich für diese Variante
aus ähnlichen Überlegungen wie in Variante I. Zunächst überlegen wir uns wieder,
wieviele Möglichkeiten es gibt, die verschiedenen Stellen der „virtuellen“ kKombination (?1,?2,.....,?k) zu belegen. Da nun Wiederholungen erlaubt sind, kann
jede Stelle mit allen n Elementen belegt werden. Wir erhalten:
1. Stelle
⇒
n Möglichkeiten
2. Stelle
⇒
n Möglichkeiten
3. Stelle
⇒
n Möglichkeiten
4. Stelle
⇒
nMöglichkeiten
............
........
............
........
k-te Stelle
⇒
n Möglichkeiten
k − mal
644744
8
Wir haben also insgesamt n * n * n*.....*n = nk Möglichkeiten, die verschiedenen
Stellen einer k-Kombination zu belegen. Somit gilt:
Anzahl Kombinationen: Variante III
Wenn Wiederholungen erlaubt sind und die Anordnung der Elemente von Bedeutung ist, dann gibt es zur n-elementigen Menge Α={a1;.....an} insgesamt nk Kombinationen der Ordnung k.
4.9 Kombinatorik
77
Beispiel 3.30
Ein Würfel wird dreimal hintereinander geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, im
ersten Wurf die „1“, im zweiten die „2“ und im dritten Wurf die „3“ zu erhalten? Da Wiederholungen möglich sind sowie die Reihenfolge dere Wurfergebnisse und damit die Anordnung der 3-er Kombinationen relevant ist, liegt Variante III vor und es ergeben sich 63
=216 verschiedene Kombinationen. Eine davon ist die gefragte Wurffolge (1,2,3). Die
Wahrscheinlichkeit, als Resultat von drei Würfen genau diese Folge zu erhalten beträgt
daher 1/216 ≈ 0,0046296 ≈ 0,46 %.
Variante IV: Mit Wiederholung – Anordnung irrelevant
Um die Anzahl möglicher Kombinationen für den Fall abzuleiten, daß Wiederholungen erlaubt sind und die Anordnung irrelevant ist, sind formale Kenntnisse erforderlich, die in diesem einführenden Lehrbuch nicht theamtisiert werden müssen.
Wir begnügen uns daher einfach mit dem Ergebnis:
Anzahl Kombinationen: Variante IV
Wenn Wiederholungen erlaubt sind und die Anordnung der Elemente nicht von
Bedeutung ist, dann gibt es zur n-elementigen Menge Α={a1;.....an} insgesamt
n + k − 1I
F
G
H k JKKombinationen der Ordnung k.
Beispiel 3.31
Die Zeitschrift „High Fidelity & Lebensart“ will aus insgesamt 25 verschiedenen Lautsprecherboxen die drei besten herausfinden, um sie ihren Lesern zu empfehlen. Hierzu arrangiert der Verlag mit einer Gruppe ausgewählter Experten einen möglichst objektiven Hörtest. Der Testcrew werden jeweils zwei Lautsprecher vorgespielt, von denen sie sich für den
besseren entscheiden soll. Um zugleich auch Objektivität und Qualität der Tester zu testen,
werden ihnen auch Paare identischer Lautsprecher vorgesetzt. Aus Zeitgründen will man
nun wissen, wieviele Hörtest bei einem solchen Testdesign durchzuführen sind. Um diese
Frage zu beantworten, muß die Anzahl der Kombinationen zweiter Ordnung ermittelt werden, wobei Wiederholungen erlaubt sind und die Anordnung der Elemente irrelevant ist. Es
25 + 2 − 1
26
26!
25 * 26
sind somit gemäß Variante IV
=
=
=
= 325 verschiedene
2
2
24! 2 !
2
Hörtests durchzuführen.
F
G
H
IJ F
I
KG
HJ
K
Die bisher abgeleiteten Ergebnisse sind aus Gründen größerer Übersichtlichkeit
noch einmal in folgender Tabelle zusammengefaßt:
Tabelle: Anzahl möglicher Kombinationen der Ordnung k zu einer n-elementigen Menge bei unterschiedlichen Kombinationstypen
Anordnung wichtig
Anordnung unwichtig
4 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
78
F
I
G
HJ
K
Wiederholung ausgeschlossen
n
n!
=
k!
k
(n − k )!
Wiederholung zugelassen
nk
nI
F
G
Hk J
K
n + k − 1I
F
G
Hk J
K
TEIL II: Statistikanwendungenmit Excel
6
1
Grundlagen von Excel
1.1
Einführung
In diesem Kapitel werden in kompakter Form die wesentlichen Eigenschaften und
Funktionen des Tabellenkalkulationsprogramms Excel dargelegt, die für die Bearbeitung der weiteren Abschnitt benötigt werden. Dem erfahrenen Excel-Benutzer
wird so ein Überblick über die erforderlichen Vorkenntnisse gegeben.
Für eine weitergehende Beschäftigung mit Excel sei auf die Spezialliteratur (siehe
Abschnitt 5) verwiesen. Neben der klassischen, buchgestützten Stofferarbeitung
bietet sich für die Aneignung der nötigen Excel-Kenntnisse auch die Verwendung
von interaktiven Selbstlernprogrammen an. Mit diesen Lernprogrammen kann sich
der Benutzer selbständig am Personal Computer Kenntnisse über Excel verschaffen. Dabei werden die Funktionen – z.T. unter Verwendung von multimedialen
Komponenten – schrittweise erklärt, simuliert und der Benutzer wird zu Aktionen
in der simulierten Excel-Umgebung aufgefordert. Zum Thema Office 97 und damit
zu Excel 97 ist in Deutschland nach Kenntnis der Autoren die LernprogrammReihe TutorWIN der Firma Prokoda GmbH, Köln, am weitesten verbreitet.
Neben geringen Excel-Vorkenntnissen werden für die Erarbeitung des folgenden
Stoffes grundlegende Kenntnisse im Umgang mit einem Personal Computer sowie
dem verwendeten Betriebssystem1 in der Form, wie sie heute üblicherweise im
Grundstudium wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge an Hochschulen vermittelt werden, vorausgesetzt.
Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf Excel 97 – installiert unter Windows
95 – , wobei im Regelfall auch frühere Excel-Versionen die beschriebene Funktionalität aufweisen.
_________________
1
6
Excel 97 ist unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98 und Windows NT ab Version
4.0 lauffähig.
1 Grundlagen von Excel
82
1.2
Grundelemente
Der standardmäßige Dokument- bzw. Dateityp in Excel ist die Arbeitsmappe. In
einer Arbeitsmappe befinden sich sog. Arbeitsblätter, beispielsweise für die Darstellung von Tabellen und Diagrammen.
Jedes Arbeitsblatt stellt eine gitternetzartige Anordnung von Zeilen und Spalten
dar. Eine Zelle ist der Schnittpunkt einer Zeile und einer Spalte. Jede Zelle besitzt
eine eindeutige Adresse, den sog. Bezug. Beispielsweise bildet der Schnittpunkt
von Spalte C und Zeile 5 die Zelle C5 (siehe Abbildung 1.2.1). Zellenbezüge werden u.a. beim Einsatz von Formeln verwendet (siehe Abschnitt 1.3). In den verschiedenen Zellen können Zahlen, Texte, arithmetische und logische Ausdrücke mit
oder ohne Bezugnahme auf andere Zellen eingetragen werden. Damit ist es dem
Benutzer möglich, auf sehr flexible Art und Weise individuelle Rechenschemata zu
erstellen.
Zur Erhöhung der Lesbarkeit und Aussagekraft von Formeln können Zellen und
Zellbereiche – anstelle der Zellbezüge – auch mit einem Namen (max. 255 Zeichen
lang) versehen werden, der – nach Doppelklick auf das Namenfeld (siehe Abbildung 1.2.1) – dort einzugeben ist.
Der Name eines jeden Arbeitsblattes erscheint auf einem Register am unteren Rand
der Arbeitsmappe. Die Blätter führen zunächst die Namen Tabelle1, Tabelle2 usw.
Nach Doppelklick auf das Registerfeld kann man das jeweilige Blatt umbenennen
(siehe Abbildung 1.2.1).
Die einzelnen Arbeitsblätter lassen sich zwischen verschiedenen Arbeitsmappen
verschieben oder kopieren und auch innerhalb einer Arbeitsmappe neu anordnen.
Dem Zugriff auf die von Excel zur Verfügung gestellten Befehle dient die Menüleiste. Sie ist variabel, d.h., abhängig von der jeweiligen Arbeitssituation (z.B. Bearbeitung einer Tabelle oder eines Diagramms) weist sie unterschiedliche Befehle
auf.
Um die Verwendung häufig vorkommender Grundoperationen zu vereinfachen und
zu beschleunigen, bietet Excel über 200 eingebaute Symbol-Schaltflächen an, die
in vorgegebenen Symbolleisten zusammengestellt sind.
Im folgenden werden hauptsächlich die Standard- und die Format-Symbolleiste
angesprochen, die über das Menü Ansicht und den Menüpunkt Symbolleisten einund abschaltbar sind.
1.3 Eingabe und Bearbeitung von Daten
83
Namenfeld
Zelle C5
Blattregister
Abbildung 1.2.1: Excel-Arbeitsmappe
1.3
Eingabe und Bearbeitung von Daten
Zellen, in die Daten eingegeben bzw. deren Inhalte verändert werden sollen, müssen markiert werden. Markierte Zellen werden hervorgehoben (siehe Abbildung
1.3.1). Die Zelle, in der die eingegebenen Daten plaziert werden, heißt aktive Zelle.
Es ist immer nur eine Zelle aktiv. Adresse und Inhalt der aktiven Zelle werden auch
in der sog. Bearbeitungsleiste, die sich unterhalb der Symbolleisten befindet (siehe
Abbildung 1.3.1), angezeigt.
1 Grundlagen von Excel
84
Bearbeitungsleiste
aktive Zelle
Abbildung 1.3.1: Excel-Arbeitsblatt
Für die Weiterverarbeitung von Daten im Rahmen von Berechnungen werden in
Excel Formeln verwendet. Formeln sind Rechenvorschriften, die Excel veranlassen, in der Zelle, in der die Formel eingegeben wird, das Ergebnis auszugeben.
Eine Formel beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen. Die Formel selbst sieht
man in der Zelle nur bei erstmaligem Bearbeiten dieser Zelle sowie später bei
Doppelklick auf diese Zelle. Ansonsten führt die Zelle nur den Wert, den die Formel erzeugt. Die Formel ist immer in der Bearbeitungsleiste zu sehen.
Bestandteile von Formeln können sein:
Ø Konstanten (Zahlen)
Ø Mathematische Operatoren
Ø Integrierte Funktionen (siehe Abschnitt 1.5)
Ø Zellbezüge
Ø Zell- oder Zellbereichsnamen
Das Bearbeiten größerer Tabellen mit gleichen Rechenoperationen wird durch die
Funktionalität Autoausfüllen wesentlich erleichtert.
Durch Ziehen des sogenannten Ausfüllkästchens – einem kleinen schwarzen Kästchen in der rechten unteren Ecke des markierten Zellbereichs (siehe Abbildung
1.3.2 (a)) – wird der Inhalt der markierten Zelle(n) auf andere Zellen derselben
Zeile oder Spalte übertragen. Ist dieser Inhalt in einer Reihe fortführbar, wie beispielsweise bei Datums- oder Zahlenangaben, so werden diese Werte erweitert,
andernfalls kopiert.
1.3 Eingabe und Bearbeitung von Daten
85
Abbildung 1.3.2 veranschaulicht die Funktionsweise von Autoausfüllen anhand
von Monatsangaben. Zunächst wird in Zelle A1 "Januar" eingegeben (siehe Abbildung 1.3.2 (a)). Bewegt man nun den Mauszeiger in die Nähe der Zelle A1, so
verwandelt er sich in ein "+" (siehe Abbildung 1.3.2 (a)). Durch Ziehen der Maus
in Pfeilrichtung nach unten2, werden automatisch die Zellen A2:A12 mit den entsprechenden Monaten ausgefüllt (siehe Abbildung 1.3.2 (b)).
Ausfüllkästchen
Mauszeiger
(a)
(b)
Abbildung 1.3.2: Funktionsweise von Autoausfüllen
Die Registerkarte Autoausfüllen, die über den Befehl Optionen aus dem Menü
Extras aufgerufen wird (siehe Abbildung 1.3.3), zeigt die verfügbaren Datenreihen
an (in Abbildung 1.3.3 ist die in Abbildung 1.3.2 verwendete Datenreihe für Monate ausgewählt) und erlaubt die Definition neuer Datenreihen.
Neben den Datenreihen können mit der Autoausfüllen-Funktion auch Formeln
automatisch fortgeführt werden (siehe Beispiel 1.1).
Will man Daten, die Bestandteile von Datenreihen sind, lediglich kopieren, so muß
man neben dem für das Autoausfüllen erforderlichen Markieren und Ziehen gleichzeitig die Strg-Taste drücken!
_________________
2
Die linke Maustaste bleibt gedrückt.
86
1 Grundlagen von Excel
Abbildung 1.3.3: Verfügbare Datenreihen in Excel
Ein weiteres wichtiges Konzept von Tabellenkalkulationsprogrammen stellen die
bereits in Abschnitt 1.2 angesprochenen Zellbezüge dar.
Mit einem Zellbezug wird eine Zelle oder eine Gruppe von Zellen genau bestimmt.
Verwendet man Zellbezüge in einer Formel, so ist der Formelwert von den Werten
der Zelle abhängig, auf die Bezug genommen wird. Ändert man diese, so ändert
sich der Formelwert automatisch.
Man unterscheidet zwei Arten von Zellbezügen:
Ø Relativer Zellbezug
Kopiert man durch Verwendung der Autoausfüllen-Funktion eine Zelle mit einem relativen Zellbezug, so bezieht sich die Formel im Einfügebereich nicht
auf dieselben Zellen wie im Kopierbereich.
Ø Absoluter Zellbezug
Es gibt Anwendungen, bei denen der Zellbezug unverändert bleiben muß. In
diesem Fall fügt man ein $ vor die beiden Bestandteile des Zellbezugs. Beim
Kopieren bleibt so der Bezug auf die gleiche Zelle erhalten.
1.3 Eingabe und Bearbeitung von Daten
87
Dieser Unterschied soll an kleinen Beispielen verdeutlicht werden.
Beispiel 1.1
Abbildung 1.3.4: Beispiel für relative Zellbezüge
Abbildung 1.3.4 zeigt die monatlichen Umsätze (in TDM) einer Gaststätte mit verschiedenen Biersorten. Der Gesamtumsatz für den Monat Januar ergibt sich durch Addition der
relativen Bezüge B2:B4. Diese Vorgehensweise weist den Vorteil auf, daß sich bei Verwendung der Autoausfüllen-Funktion die in B6 eingegebene Formel auch auf andere Zellen, im Beispiel die Zelle C6, ausdehnen läßt. Dort wird dann automatisch die Summe der
Zellen C2:C4 eingetragen. Diese Vorgehensweise läßt sich auf weitere Zellen ausdehnen.
Will man diese automatische Übertragung von Formelbestandteilen auf angrenzende Zellen nicht, muß man mit absoluten Zellbezügen arbeiten.
Beispiel 1.2
Im Beispiel der Abbildung 1.3.5, bei dem die monatliche Zinslast für eine Schuld von
100.000 DM bei einem Zinssatz von 8,5 % zu ermitteln ist, wird beispielsweise der permanente Bezug auf die Zelle B1 erforderlich. Die Formel der Zelle C5 für die Zinslast im
Monat Januar muß demzufolge lauten:
= B5*$B$1*1/12
Abbildung 1.3.5: Beispiel für absolute Zellbezüge
Nach Eingabe der entsprechenden Formeln für die Zellen D5, E5 und B6 lassen sich durch
Anwenden der Autoausfüllen-Funktion die monatlichen Zinsbelastungen ebenso bestimmen
wie der Monat, in dem letztmalig Zahlungen zu leisten sind.
1 Grundlagen von Excel
88
Die bisherigen Formeloperationen liefern jeweils nur für eine Zelle ein Ergebnis.
Sie werden verschiedentlich auch als Einzelwertformeln bezeichnet. Demgegenüber kann eine Matrixformel mehrere Ergebnisse für einen markierten Bereich
"gleichzeitig" liefern. Beispiel 1.3 soll die Vorgehensweise bei der Anwendung von
Matrixformeln veranschaulichen.
Beispiel 1.3
Gegeben sei die Aufstellung der Abbildung 1.3.6 über den Süßwaren- Umsatz eines Tages
an einem Kiosk.
Abbildung 1.3.6: Tabelle für Beispiel 1.3
Die mit den verschiedenen Süßwaren erzielten Umsätze können nun mit Hilfe der Matrixformeln wie folgt ermittelt werden:
Ø Zunächst ist der Ergebnisbereich, in unserem Fall D2:D6, zu markieren.
Ø Die Formel für den gesamten Ergebnisbereich ist in die Bearbeitungsleiste einzugeben.
Ø Der Cursor ist in der Bearbeitungsleiste hinter die Formel zu setzen.
Ø Mit Auslösen der Tastenkombination STRG+ñ+Return (gleichzeitiges Drücken) werden alle Ergebnisse in die Zellen D2:D6 ausgegeben.
Die Funktionalität von Matrixformeln erleichtert – wie im angeführten Beispiel –
nicht nur Kalkulationen, sondern ist bei manchen Anwendungen (siehe Abschnitt
2.2) unabdingbar.
1.4
Aufbereitung von Daten
Neben der reinen Kalkulation ist eine übersichtliche Aufbereitung von Tabellen
und/oder deren grafische Darstellung in der Praxis ganz besonders wichtig.
Zur Erhöhung von Lesbarkeit und Übersichtlichkeit einer tabellarischen Darstellung von Daten verfügt Excel über eine Vielzahl von Formatierungswerkzeugen,
die über die Format-Symbolleiste bzw. den Befehl Format in der Menüleiste aktivierbar sind.
1.5 Integrierte Funktionen
89
Hierzu zählen insbesondere unterschiedliche Zahlenformate, Schriftarten und grade, Funktionen für Numerierungen und Aufzählungen, Auswahlmöglichkeiten
für Ausrichtung und Farbdarstellung von Zell-inhalten, Rahmen, Schattierungen
und Muster für Zellen usw.
Vor allem bei großen Datenmengen ist die grafische Darstellung von Daten aussagekräftiger als die tabellarische Aufbereitung. Die in Excel eingebundene Funktionalität ermöglicht es dem Anwender, aus einer Tabelle in wenigen Arbeitsschritten einfach und bequem ein Diagramm zu erstellen. Dabei bietet Excel eine Reihe
von Diagrammtypen, aus denen sich der Benutzer den für seine Problemstellung
geeigneten Typ auswählen kann. Die Vorgehensweise zur Diagrammerstellung und
Auswahlkriterien für die angebotenen Diagrammtypen werden in Abschnitt 4 behandelt.
1.5
Integrierte Funktionen
Excel verfügt über eine Vielzahl integrierter Tabellenfunktionen und läßt sich zusätzlich durch sog. Add-Ins um weitere Funktionen3 erweitern. Damit kann man auf
über 400 Tabellenfunktionen zugreifen, die von einfachen mathematischen Funktionen, wie Summenbildung, bis zu komplexen Analysefunktionen, wie z.B. Fourieranalyse oder zweifaktorielle Varianzanalyse, reichen. Die Funktionen lassen sich
in folgende Kategorien einteilen:
Ø Datenbank- und Listenverwaltungsfunktionen
Ø Datums- und Zeitfunktionen
Ø Finanzmathematische Funktionen
Ø Informationsfunktionen
Ø Logische Funktionen
Ø Mathematische und trigonometrische Funktionen
Ø Statistische Funktionen
Ø Such- und Referenzfunktionen
Ø Technische Funktionen
Ø Textfunktionen
Grundsätzlich stellt eine Funktion eine Rechenvorschrift dar, die bestimmt, welche
Operationen mit einem oder mehreren Werten, den Funktionsargumenten, ausge_________________
3
Die Add-In-Funktionen sind nach der Installation von Excel bei Bedarf zu aktivieren und danach
von den anderen integrierten Funktionen nicht mehr zu unterscheiden..
1 Grundlagen von Excel
90
führt werden. Das Ergebnis der Operation heißt Funktionswert. Argumente einer
Funktion werden immer in Klammern an Excel übergeben.
So addiert man beispielsweise die Zahlen 1,2,3,4 mit der Funktion SUMME wie
folgt:
=SUMME(1;2;3;4)
Als Funktionsargumente sind anstelle der Zahlen auch Zellbezüge und andere
Funktionen denkbar. So werden in nachfolgender Funktion die Inhalte der Zellen
A1 und A2, das Produkt der Zellen B1 und B2 und die Zahl 111 addiert:
=SUMME (A1;A2;Produkt(B1;B2);111)
Auf diese Weise lassen sich auf Basis des verfügbaren Funktionsvorrates beliebig
komplexe Funktionen darstellen und berechnen.
Die verfügbaren Funktionen lassen sich über den Funktions-Assistenten aktivieren,
ihre Verwendung wird durch das Beispiel 1.4 veranschaulicht.
Beispiel 1.4
Ausgangspunkt ist der in Abbildung 1.5.1 dargestellte monatliche Umsatz eines Getränkefachhändlers an Erfrischungsgetränken. Zur Jahresmitte ist der Gesamtumsatz sowie der
durchschnittliche monatliche Umsatz zu ermitteln.
Für den Gesamtumsatz der einzelnen Getränkesorten wird die Funktion SUMME für die
erste Getränkesorte verwendet (siehe Abbildung 1.5.1).
Für diese Funktion existiert in der Standard-Symbolleiste eine eigene Schaltfläche, ansonsten ist sie auch über den Funktionsassistenten aufrufbar. Mit Hilfe der AutoausfüllenFunktion erhält man unmittelbar die in Abbildung 1.5.2 dargestellten Ergebnisse.
Abbildung 1.5.1: Ausgangstabelle für Beispiel 1.4
Für die Ermittlung der monatlichen Durchschnittsumsätze ist zunächst der Durchschnittswert für ISO-Drinks zu bestimmen, indem im Funktionsassistenten die Funktion MIT-
1.6 Online-Hilfesysteme
91
TELWERT ausgewählt wird, anschließend ist der Bereich der Argumente, hier wiederum
B4:B9, festzulegen. Der sich ergebende Wert für die ISO-Drinks ist durch die Autoausfüllen-Funktion auf die anderen Getränkearten auszuweiten. Das Ergebnis zeigt die Abbildung
1.5.2.
Abbildung 1.5.2:Ergebnistabelle für Beispiel 1.4
1.6
Online-Hilfesysteme
Ein umfangreiches System von Online-Hilfen unterstützt den Anwender dabei, den
großen Funktionsumfang von Excel effizient für seine konkrete Aufgabenstellung
einsetzen zu können. Zu unterscheiden sind dabei die folgenden Hilfesysteme (siehe Abbildung 1.6.1), die grundsätzlich nach Aufruf des Fragezeichens in der Menüleiste (siehe beispielsweise Abbildung 1.2.1) aktiviert werden können:
Ø Microsoft-Hilfe
Ø Index und Inhalt
Ø Direkthilfe
1 Grundlagen von Excel
92
Ø Microsoft im Web
Abbildung 1.6.1: Überblick über Excel-Hilfefunktionen
4
Die Microsoft-Hilfe – auch als Office-Assistent bezeichnet und immer mit dem
in Abbildung 1.6.1 dargestellten Symbol visualisiert – kann auch direkt über die
Schaltfläche in der Standard-Symbolleiste bzw. mit der Funktionstaste F1 aktiviert
werden. Sie gibt in Form der Tips Ratschläge zum effektiveren Umgang mit Excel.
Diese Tips können nach Auswahl der Microsoft-Hilfe aufgerufen werden (siehe
Abbildung 1.6.2 (a)) bzw. sind stets dann aktivierbar, wenn eine Glühlampe in der
Schaltfläche des Office-Assistenten ( ) bzw. im Office-Assistenten selbst (siehe
Abbildung 1.6.2 (b)) eingeblendet ist. In diesen Fällen schlägt Excel eine Anzahl
von zum momentanen Bearbeitungsstand passenden Hilfethemen vor, im Beispiel
der Abbildung 1.6.2 (b) handelt es sich aufgrund der unmittelbar vorhergehenden
Erstellung von Diagrammen um Themen in diesem Umfeld. Sollten die angebotenen Hilfestellungen nicht zutreffen, kann über die Suchmaske gezielt weitere Unterstützung abgefragt werden.
_________________
4
Die Abbildung ist direkt der Excel-Hilfe entnommen.
1.6 Online-Hilfesysteme
93
(a)
(b)
Abbildung 1.6.2: Microsoft-Hilfe
Neben dieser passiven Hilfestellung gibt der Office Assistent auch aktive Unterstützung. Dabei "beobachtet" Excel den Benutzer bei seiner Arbeit und bietet eigenständig und unaufgefordert Hilfe an, wenn es den Eindruck gewinnt, daß dieser
Probleme bei der Bedienung oder Benutzung des Programms hat.
Inhalt und Index ermöglichen unterschiedlichen Zugang zu den Hilfethemen.
Im Registerfeld Inhalt sind die verfügbaren Hauptthemen alphabetisch gelistet. Bei
Doppelklick auf ein Hauptthema erscheinen die dazu gehörigen Themen, die ggf.
in weitere Unterthemen unterteilt sind. Abbildung 1.6.3 veranschaulicht dies anhand des Hauptthemas "Bearbeiten von Themen in einem Tabellenblatt". Nach
Selektion dieses Themas werden dazu passende Themen angezeigt, die bei Darstellung eines Buchsymbols, wie z.B. bei "Suchen oder Ersetzen von Dateien", weitere
Unterthemen beinhalten. Die mit Fragezeichen versehenen Formulare stellen jeweils die unterste Hierarchieebene dar.
Abbildung 1.6.3: Excel-Hilfethemen
Das Registerfeld Index erlaubt die alphabetische Suche nach den im Index enthaltenen Begriffen, deren Erläuterung mit Mausklick abgerufen werden kann. Abbildung 1.6.4 zeigt einen Auszug aus diesem Index sowie die in einem eigenen Fenster dargestellte Erläuterung des selektierten Themas.
94
1 Grundlagen von Excel
Abbildung 1.6.4: Auszug aus dem Index der Excel-Hilfe
Im Registerfeld Suchen ist es möglich, in den Hilfethemen eine Volltextsuche mit
mehreren Suchbegriffen durchzuführen.
Die Direkthilfe bietet bei der Arbeit mit Dialog- und Registerfeldern Unterstützung. Nach Klicken auf die in den meisten dieser Felder vorkommenden Schaltfläche ? nimmt der Mauszeiger die Form eines Fragezeichens an. Klickt man nun mit
diesem Mauszeiger auf eine Option oder ein Dialogfeld, so erhält man in einem
Überlagerungs-Textfeld die erforderlichen Erläuterungen. (siehe Abbildung 1.6.5).
Abbildung 1.6.5: Direkthilfe
Mit Microsoft im Web erhält man über das Internet den direkten Zugriff auf die
Microsoft-Website und damit auf aktuelle Informationen u.a. zu den jeweiligen
Softwarepaketen. Über die verfügbaren Informationsinhalte gibt Abbildung 1.6.1
einen Überblick.
1.7 Aufgaben zu Kapitel 1
1.7
95
Aufgaben zu Kapitel 1
Aufgabe 1.1
Das Unternehmen „Skandal & Co.“, dessen Geschäftsführer Sie sind, benötigt zur Renovierung des firmeneigenen Swimmingpools ein Darlehen in Höhe von 60.000 DM. Die Hausbank bietet einen Zinssatz von 8% bei einer monatlichen Zahlung von 2.800 DM an. Die
Rückzahlung des Darlehens soll am 1.6.1998 beginnen.
a) Erstellen Sie einen Tilgungsplan mit folgendem Aufbau:
Tilgungsplan
Termin
Schuld am An- Zinszah- Zahlung pro
Schuld am
fang des Monats lung [DM] Monat [DM] Ende des Mo[DM]
nats [DM]
1.6.1998
60.000,00 ...
...
...
1.7.1998 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
b) Ermitteln Sie mit Hilfe der Excel-Funktionalität „Autoausfüllen“, wann Ihre Firma die
letze volle Zahlung in Höhe von 2.800 DM leisten muß?
c) Wie hoch ist der im letzten Monat zu zahlende Betrag?
1 Grundlagen von Excel
96
Aufgabe 1.2
Eine andere Bank, die mit Ihrer Firma ins Geschäft kommen möchte, unterbreitet Ihnen für
das in Aufgabe 1.1 dargestellte Vorhaben folgendes Angebot:
Zinssatz:
6,5 %
monatl. Zahlung:
2.500 DM
a) Stellen Sie den folgenden Tilgungsplan auf:
Tilgungsplan
Zinssatz:
Termin
monatliche
Zahlung:
Schuld am Anfang Zinszahlung Schuld am Ende des
des Monats [DM]
Monats [DM]
[DM]
1.6.1998
60.000,00
1.7.1998
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
b) Ermitteln Sie durch Verwendung absoluter Bezüge, wann Ihre Firma die letze volle
Zahlung in Höhe von 2.500 DM leisten muß?
c) Wie hoch ist der im letzten Monat zu zahlende Betrag?
1.8
Lösungsvorschläge zu Kapitel 1.7
Aufgabe 1.1
a) Die nachstehende Excel-Tabelle beinhaltet den geforderten Aufbau.
b) Am 1.4.2000 ist die letzte volle Zahlung zu leisten.
c) Der am 1.5.2000 zu zahlende Restbetrag beträgt 556,63 DM.
1.8 Lösungsvorschläge zu Kapitel 1.7
97
98
1 Grundlagen von Excel
Aufgabe 1.2
a) Die nachstehende Excel-Tabelle beinhaltet den geforderten Aufbau.
b) Am 1.6.2000 ist die letzte volle Zahlung zu leisten.
c) Der am 1.7.2000 zu zahlende Restbetrag beträgt 1.939,38 DM.
2
Beschreibung und Analyse von
Daten
2.1
Einführung
Üblicherweise liegen die zu untersuchenden Daten in unstrukturierter und unsystematischer Form als Datenurmaterial vor. Dies führt nicht nur zu einer gewissen
Unübersichtlichkeit, sondern verhindert auch den optimalen Einsatz von Excel für
solche statistischen Berechnungen, für die ein Aufbereiten und Strukturieren der
zur Verfügung stehenden Daten unabdingbar ist.
Am einfachsten strukturiert man eine Datenmenge durch Sortieren der Werte. Hierfür stellt Excel den Befehl Sortieren des Menüs Daten zur Verfügung, wobei das
markierte Datenmaterial der Größe nach in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge – bis zu dreistufig nach verschiedenen Merkmalen – angeordnet werden
kann.
Beispiel 2.1
Abbildung 2.1.1 zeigt die Einsatz- und Torübersicht eines Fußball-Bundesligavereins, wobei jeweils in Spalte A die Rückennummer des Spielers, in Spalte B die Anzahl seiner
Pflichtspiel-Einsätze in der Bundesliga und in Spalte C die insgesamt erzielten Tore stehen.
(a) gibt das ursprüngliche Datenmaterial – geordnet nach der Rückennummer des Spielers –
wider, das unter (b) nach der Anzahl der Pflichtspiel-Einsätze in absteigender Reihenfolge
(Spalte B) und unter (c) zusätzlich noch nach den erzielten Toren in absteigender Reihenfolge (Spalten B und C) sortiert ist.
Die Eingaben in das zugehörige Dialogfenster des Befehls Sortieren, die für den direkten
Übergang von (a) nach (c) erforderlich sind, zeigt Abbildung 2.1.2.
6
2 Beschreibung und Analyse von Daten
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A B C
A B C
A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
6
13
9
14
3
4
7
11
5
8
10
1
12
13
6
2
9
14
3
7
11
4
8
5
10
1
12
17 1
34 3
30 4
28 3
27 4
34 4
28 6
27 5
33 11
25 6
28 4
17 0
34 5
33 3
(a)
Abbildung 2.1.1: Zweistufiges Sortieren
34 3
34 4
34 5
33 11
33 3
30 4
28 3
28 6
28 4
27 4
27 5
25 6
17 1
17 0
(b)
34 5
34 4
34 3
33 11
33 3
30 4
28 6
28 4
28 3
27 5
27 4
25 6
17 1
17 0
(c)
2.2 Häufigkeiten
101
Abbildung 2.1.2: Sortier-Dialogfeld
2.2
Häufigkeiten
Eine Möglichkeit zur Beschreibung von Datenmaterial ist die Bestimmung der
Häufigkeit der Merkmalsausprägungen (siehe Teil I, Abschnitt 1.5). Dabei erfordern diskrete und stetige Merkmale eine unterschiedliche Vorgehensweise.
Aus der Eigenschaft diskreter Merkmale, innerhalb eines bestimmten Bereiches nur
ganz bestimmte Werte annehmen zu können (siehe Teil I, Abschnitt 1.3) läßt sich
ableiten, wie oft eine Merkmalsausprägung auftritt. Dies wird als Gruppieren bezeichnet.
Gruppieren bedeutet also, diskrete Merkmale mit der gleichen Merkmalsausprägung zusammenzufassen und so die absolute Häufigkeit einer jeden Merkmalsausprägung festzustellen. Excel bietet hierzu die Funktion HÄUFIGKEIT an.
Beispiel 2.2
Die Tabelle der Abbildung 2.2.1 beinhaltet ausschnittsweise die Ergebnisse einer Prüfung.
Es soll ermittelt werden, wie oft eine Note vergeben wurde.
Student
A
Note
2,3
Student
I
Note
4,0
2 Beschreibung und Analyse von Daten
102
B
C
D
E
F
G
H
3,3
3,7
1,0
2,0
3,0
3,0
5,0
J
K
L
M
N
O
P
2,3
2,0
5,0
4,0
1,0
1,7
2,3
Abbildung 2.2.1: Datenurmaterial von Beispiel 2.2
Zur Vorbereitung der Gruppierung ist in Excel eine Tabelle gemäß Abbildung 2.2.2 zu
erstellen.
Abbildung 2.2.2: Ausgangstabelle für Beispiel 2.2
Die Berechnung geschieht nun mit Hilfe der Funktion HÄUFIGKEIT, wobei folgendes zu
beachten ist:
Da man gleichzeitig verschiedene Ergebnisse erzielen will, in unserem Fall die Häufigkeiten für die 12 Notenstufen, muß der entsprechende Platz für die Ergebnisse durch vorheriges Markieren freigehalten werden; in Abbildung 2.2.2 sind das die Zellen D2 bis D13.
Gleichzeitig muß die Operation mit der Tastenkombination STRG+ñ+Return (gleichzeitiges Drücken) abgeschlossen werden, um Excel diese Matrixformel (siehe Abschnitt 1.3)
mitzuteilen.
Die Häufigkeiten werden nun wie folgt ermittelt:
Ø Markieren des Ergebnisbereiches D2:D13.
Ø Aufruf der Funktion HÄUFIGKEIT.
2.2 Häufigkeiten
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
103
Nach Klicken von „Weiter“ sind im nächsten Dialogfeld folgende Informationen einzugeben:
bei DATEN:
B2:B17
bei KLASSEN:
C2:C13
Schließen des Dialogfensters durch „Ende“.
In der ersten Zelle des Ergebnisbereiches (D2) steht nun die Häufigkeit für die erste
Merkmalsausprägung. Durch Mausklick hinter die letzte Position der Bearbeitungsleiste und anschließendes Auslösen der Tastenkombination STRG+ñ+Return erhält man
alle gewünschten Häufigkeiten (siehe Spalte D in Abbildung 2.2.3 (a)).
Aus den so errechneten absoluten Häufigkeiten lassen sich die relativen Häufigkeiten mit Hilfe der Formel
fi = hi /N1
direkt aus den absoluten Häufigkeiten gewinnen. Der Wert N für die Anzahl der
Merkmalsausprägungen kann mit Hilfe der Funktionen ANZAHL bzw. ANZAHL2 sofort aus der Spalte (Spalte B in Abbildung 2.2.3) mit den Merkmalsausprägungen oder durch Addition der absoluten Häufigkeiten (Spalte D in Abbildung
2.2.3) mit Hilfe der Summenfunktion bestimmt werden.
Dabei berechnet die Funktion ANZAHL, wie viele Zahlen eine Liste von Argumenten enthält, ANZAHL2, wie viele Einträge eine Liste von Argumenten enthält.
In unserem Beispiel führt die Verwendung beider Funktionen zum Ergebnis „16“.
_________________
1
mit fi = relative Häufigkeit, hi = absolute Häufigkeit und N = Gesamtzahl aller
Elemente
(a)
(b)
Abbildung 2.2.3: Ergebnistabellen für Beispiel 2.2
Abbildung 2.2.3 (b) beinhaltet die auf die eben beschriebene Weise ermittelten relativen
Häufigkeiten von Beispiel 2.2.
Es wird für derartige Fragestellungen grundsätzlich die Verwendung dieser Funktionen oder der Summenfunktion anstelle der manuellen Ermittlung empfohlen, da
sich so bei einer Erweiterung oder Reduzierung des Datenurmaterials der jeweilige
Wert automatisch anpaßt.
Während sich das Gruppieren auf diskrete Verteilungen bezieht, werden bei stetigen Merkmalen sog. Häufigkeitsklassen gebildet. Will man beispielsweise in einem
großen Unternehmen die monatlichen Gehälter der Mitarbeiter aussagekräftig darstellen, teilt man diese in Klassen ein, z.B. 3.500 – 3.999 DM, 4.000 – 4.499 DM
etc. Für die Wahl der Klassengrenzen gibt es keine Regelungen, sie hängen naturgemäß vom jeweiligen Datenmaterial ab. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein,
unterschiedliche Klassengrößen zu verwenden.
Die Funktion HÄUFIGKEIT ist bei stetigen Merkmalen analog zum Einsatz bei
diskreten Merkmalen anzuwenden, wobei die jeweilige obere Klassengrenze als
Klassenmerkmal einzugeben ist.
Beispiel 2.3
Abbildung 2.2.4 zeigt die in einer Umfrage bei Absolventen einer Hochschule ermittelten
Anfangsgehälter (per annum).
6
2.2 Häufigkeiten
Nr.
Anfangsgehalt
1001
84.500
1002
52.400
1003
76.340
1004
61.000
1005
43.000
1006
65.987
1007
55.670
1008
72.000
1009
64.567
1010
56.987
105
Nr.
Anfangsgehalt
Nr.
Anfangsgehalt
1011
57.939
1021
82.000
1012
56.993
1022
74.000
1013
76.930
1023
65.450
1014
52.959
1024
57.660
1015
54.955
1025
64.700
1016
67.450
1026
87.500
1017
75.000
1027
91.400
1018
102.000
1028
59.700
1019
50.450
1029
72.550
1020
61.000
1030
51.000
Abbildung 2.2.4: Datenmaterial von Beispiel 2.3
Im ersten Schritt sind diese Daten in ein Excel-Arbeitsblatt einzugeben und in aufsteigender
Reihenfolge zu sortieren (siehe Spalten A und B in Abbildung 2.2.5). Anschließend sind
sinnvolle Klassengrenzen festzulegen (siehe Spalte C in Abbildung 2.2.5) und die absoluten
und relativen Häufigkeiten dieser Klassen zu ermitteln (siehe Spalten D und E in Abbildung
2.2.5)
2 Beschreibung und Analyse von Daten
106
Abbildung 2.2.5: Ergebnistabelle von Beispiel 2.3
1
Für eine Reihe von Fragestellungen interessieren auch die Summenhäufigkeiten
(vgl. Teil I, Abschnitt 1.5). So kann man für das Beispiel 2.3 zu Aussagen wie „40
% verdienen bis zu 60.000 DM oder 19 Absolventen verdienen bis zu 70.000 DM
pro Jahr“ gelangen. Die Summenhäufigkeiten erhält man aus den absoluten bzw.
relativen Häufigkeiten durch Aufsummieren der einzelnen Werte.
Beispiel 2.4
Aus den relativen und absoluten Häufigkeiten des Beispiels 2.3 (siehe Abbildung 2.2.5)
sind die Summenhäufigkeiten zu ermitteln. Die einzelnen Werte der Summenhäufigkeiten
werden durch Addition der einzelnen Häufigkeiten gewonnen. So erhält man beispielsweise
die absolute Summenhäufigkeit für Einkommen bis zu 55.000 DM (Zelle F3 in Abbildung
2.2.6) durch die Formel = F2+D3. Die weiteren Werte der absoluten Summenhäufigkeiten
werden mit Hilfe der Autoausfüllen-Funktion berechnet (siehe Abbildung 2.2.6).
_________________
1
Spalten A und B sind nur teilweise dargestellt.
2.3 Mittelwerte
107
Abbildung 2.2.6: Ergebnistabelle des Beispiels 2.4
2.3
2
Mittelwerte
Excel verfügt über integrierte Funktionen (siehe Abschnitt 1.5) für die Bestimmung
der in Teil I, Abschnitt 2.1 behandelten Kenngrößen. Abbildung 2.3.1 zeigt diese
Funktionen.
Statistische Kenngröße
Zugehörige Excel-Funktion (Argumente)
Arithmetischer Mittelwert
MITTELWERT (Zahl1;Zahl2;...)
Modus
MODALWERT (Zahl1;Zahl2;...)
Median
MEDIAN (Zahl1;Zahl2;...)
Geometrischer Mittelwert
GEOMITTEL (Zahl1;Zahl2;...)
Abbildung 2.3.1: Mittelwerte
_________________
2
Spalten A und B sind nur teilweise dargestellt.
2 Beschreibung und Analyse von Daten
108
Der Funktionsassistent gibt dabei die jeweiligen Eingabeerfordernisse an, wobei
für alle Funktionen gilt:
Ø Zahl 1;Zahl2 ... sind 1 bis 30 Argumente.
Ø Als Argumente dürfen nur Zahlen bzw. Namen, Matrizen oder Bezüge angegeben werden, die Zahlen enthalten.
Ø Enthält ein als Matrix oder Bezug angegebenes Argument Text, Wahrheitswerte
oder leere Zellen, werden diese Werte ignoriert. Zellen, die den Wert 0 enthalten, werden dagegen berücksichtigt.
Darüber hinaus sind folgende Besonderheiten zu beachten:
Ø MEDIAN
Besteht eine Zahlenreihe aus einer geraden Anzahl von Zahlen, berechnet
MEDIAN den Mittelwert der beiden mittleren Zahlen.
Beispiel: Der Median aus den Zahlen 1,2,3,4,5 beträgt 3, der Median aus den
Zahlen 1,2,3,4,5,6 wird als 3,5 berechnet.
Ø MODALWERT
♦ Enthält die jeweilige Datenmenge keine mehrfach vorkommenden Werte, so
liefert MODALWERT den Fehlerwert #NV3.
♦ Enthält die jeweilige Datenmenge mehrere gleich oft vorkommenden Werte,
so wählt Excel daraus den Wert, der in der Datenliste als erster erscheint.
Beispiel: Der Modalwert der Datenreihe 3,2,1,3,2,1 wird von Excel als 3, der
Modalwert der Datenreihe 2,3,1,1,3,2 als 2 bestimmt.
Beispiel 2.5
Ausgangspunkt sind die in Abbildung 2.2.1 dargestellten Klausurergebnisse. Für die Bestimmung des arithmetischen Mittelwertes erscheint nach Selektion der Funktion MITTELWERT das in Abbildung 2.3.2 dargestellte Dialogfenster. Nach Eingabe der Bezüge
enthält man unmittelbar das Ergebnis, das zunächst im Dialogfenster angezeigt wird (siehe
Abbildung 2.3.2), nach Betätigen der Endetaste in der vorher aktivierten Zelle (in Abbildung 2.3.2 ist das die Zelle E13) ausgegeben wird.
In analoger Weise werden Median und Modus über die zugehörigen Excel-Funktionen
MEDIAN und MODALWERT ermittelt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.3.2 in den
Zellen E14 und E15 dargestellt.
_________________
3
NV = No Value. #NV besagt, daß "kein Wert verfügbar" ist.
2.3 Mittelwerte
109
Abbildung 2.3.2: Dialogfenster für Berechnung des arithm. Mittels
Beispiel 2.6
Die Abbildung 2.3.3 zeigt für die Jahre 1993-1997 das jeweilige Bruttosozialprodukt der
Bundesrepublik Deutschland und die jährlichen Zuwachsraten an. Für die Ermittlung der
durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate ist nicht auf das arithmetische Mittel, sondern
auf das geometrische Mittel zurückzugreifen (siehe Teil I, Abschnitt 2.1).
Die Anwendung der Funktion GEOMITTEL mit den jährlichen Zuwachsraten als Argumenten führt zu einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 3,18 %.
2 Beschreibung und Analyse von Daten
110
Jahr
1993
1994
1995
1996
1997
BSP (Mrd. DM)
3.168,8
3320,2
3442,7
3515,3
3612,2
Jährlicher Zuwachs in %
4,78
3,69
2,11
2,76
4
Abbildung 2.3.3: Ausgangsdaten für Beispiel 2.6
2.4
Streuungsmaße
Für die in Teil I, Abschnitt 2.2, erläuterten Kenngrößen für die Variabilität einer
Verteilung liefert Excel nur in einigen Fällen eine vollständige und sofort anwendbare Funktion, die meisten Streumaße müssen durch Verknüpfung mehrerer Funktionen abgeleitet werden.
Die Abbildung 2.4.1 gibt einen Überblick darüber, wie die einzelnen Kenngrößen
bestimmt werden.
Statistische
Kenngröße
Berechnung in Excel
Spannweite
Interquartilsspanne
Varianz
Standardabweichung
Variationskoeffizient
MAX (Zahl1;Zahl2; ...) – MIN (Zahl1;Zahl2;...)
QUARTILE (Matrix;3) – QUARTILE (Matrix;1)
VARIANZEN (Zahl1;Zahl2;...)
STABWN (Zahl1; Zahl2;...)
STABWN (Zahl1; Zahl2;...) / MITTELWERT (Zahl1; Zahl2;...)
Abbildung 2.4.1: Streuungsmaße
Die Spannweite, die der Differenz aus der größten und kleinsten Merkmalsausprägung einer Verteilung entspricht, läßt sich mit Excel durch Differenzbildung der
Funktionen MAX und MIN einfach bestimmen.
Beispiel 2.7
Die in Abbildung 2.4.2 dargestellte Tabelle enthält das Ergebnis der Gewichtsmessung von
zwölf Studierenden einer Hochschule.
_________________
4
Quelle: Statistisches Bundesamt, Internet-Abfrage der Dokumentenadresse http://www.statistikbund.de/indicators/d/vg4w.htm vom 1.3.1998.
2.4 Streuungsmaße
111
Abbildung 2.4.2: Ausgangs- und Ergebnisdaten von Beispiel (2.7)
Wendet man die Funktionen MAX und MIN auf den Zellenbereich B3:B14 an, so erhält
man die in den Zellen E2 und E3 dargestellten Werte. Die Differenz dieser beiden Werte
ergibt dann unmittelbar die in Zelle E4 ausgewiesene Spannbreite.
Die Interquartilsspanne läßt sich als Differenz aus erstem und drittem Quartil
bestimmen. Für die Berechnung der Quartile bietet Excel eine Funktion an, deren
Syntax wie folgt lautet:
QUARTILE (Matrix; Quartil)
Matrix ist hierbei eine Matrix oder ein Zellbereich numerischer Werte, deren Quartil bestimmt werden soll.
Quartil gibt an, welcher Wert ausgegeben werden soll (siehe Abbildung 2.4.3).
Ist Quartil gleich
0
1
2
3
4
liefert QUARTILE
Den kleinsten Wert
Das erste Quartil Q1
Den Median (0,5-Quantil)
Das dritte Quartil Q3
Den größten Wert
Abbildung 2.4.3: Werte der Funktion QUARTIL
112
2 Beschreibung und Analyse von Daten
Beispiel 2.8
Die Interquartilsspanne für die in Abbildung 2.4.2 dargestellten Datenwerte wird wie folgt
bestimmt:
Ø Bestimmung des ersten Quartils:
QUARTILE (B3:B14; 1)
Ø Bestimmung des dritten Quartils:
QUARTILE (B3:B14; 3)
Ø Bildung der Differenz aus drittem und erstem Quartil
Die sich jeweils ergebenden Werte sind aus Abbildung 2.4.2 zu entnehmen.
Sortiert man die Datenwerte in aufsteigender Reihenfolge (siehe Abbildung 2.4.4),
so überrascht das Ergebnis im ersten Moment. Bei Betrachtung der Datenwerte
hätte man für das erste Quartil das Ergebnis 68 als Mittelwert zwischen dem dritten
und dem vierten Datenwert und für das dritte Quartil das Ergebnis 88 als Mittelwert zwischen dem neunten und zehnten Datenwert erwartet. Excel berücksichtigt
allerdings, daß der unterhalb des ersten bzw. oberhalb des dritten Quartils liegende
Wert, in unserem Beispiel der dritte bzw. zehnte Wert, nur 25%, der oberhalb des
ersten und unterhalb des dritten Quartils liegende Wert, in unserem Beispiel der
vierte bzw. neunte Wert jeweils 75% zur Spannweite der 50% „in der Mitte liegenden“ Merkmalsausprägungen beiträgt.
Während die Quartile jeweils die 25%-Schwellwerte liefern, läßt sich mit Quantilen für jeden beliebigen Prozentsatz der dazugehörige Schwellwert bilden, wobei
die Werte 25% und 75% zu den Quartilen führen. Für die Bestimmung der Quantile
bietet Excel die Funktion QUANTIL, deren Syntax der Excel-Hilfefunktion bzw.
bei Aufruf der Funktion dem Dialogfenster entnommen werden kann.
Abbildung 2.4.4: Sortierung der Datenwerte von Beispiel 2.7
2.4 Streuungsmaße
113
Für die Bestimmung der Varianz bietet Excel die Funktion VARIANZEN5, für die
Berechnung der Standardabweichung die Funktion STABWN6.
Für die Bestimmung des Variationskoeffizienten gibt es in Excel keine gesonderte
Funktion, er ist aber leicht als Quotient aus Standardabweichung und arithmetischem Mittel zu bestimmen.
Beispiel 2.9
Bei Anwendung der Funktionen VARIANZEN und STABWN bzw. bei Berechnung des
Variationskoeffizienten über die o.a. Formel erhält man unmittelbar die in Abbildung 2.4.2
dargestellten Ergebnisse.
_________________
5
Achtung: Nicht verwechseln mit der EXCEL-Funktion VARIANZ, welche die Varianz einer
Grundgesamtheit ausgehend von einer Stichprobe schätzt.
6
Achtung: Nicht verwechseln mit der EXCEL-Funktion STABW, welche die Standardabweichung
einer Grundgesamtheit ausgehend von einer Stichprobe schätzt.
2 Beschreibung und Analyse von Daten
114
2.5
Konzentrationsmaße
Die in Teil I, Abschnitt 2.3 behandelten Konzentrationsmaße
Ø Konzentrationsrate
Ø Herfindahl-Index
Ø Lorenzkurve
sind in Excel nicht als „fertige“ Funktionen integriert, sondern müssen durch Berechnung mit Hilfe der jeweiligen Formeln bestimmt werden.
Für die Konzentrationsrate und den Herfindahl-Index ist diese Bestimmung sehr
einfach, wie anhand des Beispiels 2.10 deutlich wird.
Beispiel 2.10
Gegeben sind die in Abbildung 2.5.1 dargestellten Anfangsgehälter von HochschulAbsolventen, für welche die Konzentrationsraten und der Herfindahl-Index herzuleiten
sind.
Absolvent-Nr.
1
2
3
4
Anfangsgehalt in
DM p.a.
52.500
51.000
67.000
59.000
Absolvent-Nr.
5
6
7
8
Anfangsgehalt in
DM p.a.
45.000
81.000
72.000
66.000
Abbildung 2.5.1: Ausgangsdaten für Beispiel 2.10
Diese Daten sind gemäß den Ausführungen von Abschnitt 2.3 in Teil I zunächst bezüglich
der Anfangsgehälter in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren und aufzuaddieren. Dieses
Ergebnis zeigen die Spalten A und B in Abbildung 2.5.2. Für die Bestimmung der Konzentrationsraten sind die Zellen B3:B10 jeweils durch die in Zelle B12 dargestellte Summe zu
dividieren. Die Ergebnisse sind in den Zellen C3:C10 abzulesen.
Für die Bestimmung vom Herfindahl-Index sind die Quadrate der Konzentrationsraten
aufzuaddieren. Hierzu werden die Quadrate durch Anwendung der Funktion QUADRATSUMME gebildet (siehe Zellen D3:D10). Die Zelle D12 zeigt den ermittelten HerfindahlIndex als Summe der quadrierten Konzentrationsraten.
2.5 Konzentrationsmaße
115
Abbildung 2.5.2: Ergebnisse für Beispiel (2.10)
Die Lorenzkurve ist gemäß den Ausführungen in Teil I, Abschnitt 2.3, eine Funktion, die jedem kumulierten Anteil an Merkmalsträgern den entsprechenden Anteil
an der Gesamtsumme der Merkmalsausprägungen zuordnet.
Die Vorgehensweise zu ihrer Ermittlung soll ebenfalls an einem Beispiel
veranschaulicht werden.
Beispiel 2.11
Ausgangspunkt sind wiederum die in Abbildung 2.5.1 dargestellten Anfangsgehälter von
Hochschulabsolventen. Die Konzentrationsraten qi wurden bereits in Beispiel 2.10 bestimmt (siehe Abbildung 2.5.2).
Die Merkmalsträgeranteile wi sind mit der Formel
wi = i/N (i = 1;...;N)
beispielsweise durch Einfügen einer Spalte mit laufenden Nummern (Spalte A in Abbildung 2.5.3) und Division der jeweiligen Nummer durch die Anzahl der gesamten Merkmalsträger leicht zu bestimmen. Die Ergebnisse der Division zeigt Spalte E in Abbildung
2.5.3.
116
2 Beschreibung und Analyse von Daten
Abbildung 2.5.3: Ergebnisse für Beispiel 2.11
Durch Kumulieren der qi erhält man die Werte für L(wi), die in Spalte F der Abbildung
2.5.3 dargestellt sind. Für die Ermittlung der Lorenzkurve werden nun noch die Nullwerte
für wi und L(wi) eingetragen.
Nach Markieren der Spalten E und F in Abbildung 2.5.3 und Aktivieren des DiagrammAssistenten von Excel (siehe Abschnitt 4.2) wird aus dem Standard-Diagrammtyp "Punkt
(X,Y)" der Untertyp "Punkte mit Linien ohne Datenpunkte" ausgewählt.
Die sich daraus ergebende Lorenzkurve zeigt die Abbildung 2.5.4, wobei vorher noch die
beiden Achsen auf den Maximalwert 1,0 einzustellen sind.
2.6 Korrelationsmaße
117
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Abbildung 2.5.4: Lorenzkurve für Beispiel 2.11
2.6
Korrelationsmaße
Für die in Teil I, Abschnitt 2.4, dargestellten Korrelationsmaße bietet Excel die in
Abbildung 2.6.1 dargestellten Funktionen, wobei Matrix1 und Matrix2 die jeweiligen Zellbereiche der beiden Merkmalsauspägungen aufnehmen.
Statistische Kenngröße
Berechnung in Excel
Kovarianz
Korrelationskoeffizient
KOVAR (Matrix1;Matrix2)
KORREL (Matrix1;Matrix2)
Abbildung 2.6.1: Korrelationsmaße
Beispiel 2.12
Abbildung 2.6.2 zeigt eine Wertetabelle, die für die zwölf Studierenden von Beispiel 2.7
zusätzlich auch deren Körpergröße beinhaltet.
Bei Anwendung der in Abbildung 2.6.1 dargestellten Funktionen gelangt man unmittelbar
zu den in Abbildung 2.6.2 dargestellten Ergebnissen, wobei nach Funktionsaufruf der Zellbereich B3:B14 in Matrix1 und der Zellbereich C3:C14 in Matrix2 des jeweiligen Dialogfensters einzugeben ist.
118
2 Beschreibung und Analyse von Daten
Abbildung 2.6.2: Ausgangs- und Ergebnisdaten von Beispiel 2.12
2.7 Aufgaben zu Kapitel 2
2.7
119
Aufgaben zu Kapitel 2
Aufgabe 2.1
In einer Klausur sind folgende Ergebnisse erzielt worden:
Matr.-Nr.
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
a)
b)
c)
d)
Note
1,3
5,0
3,3
2,0
4,0
3,0
1,7
2,0
1,3
3,7
2,7
2,0
4,0
Matr.-Nr.
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
Note
2,7
5,0
3,3
2,7
1,7
1,3
4,0
5,0
5,0
5,0
2,7
3,3
2,3
Matr.-Nr.
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
Note
2,3
1,0
5,0
1,7
2,3
2,7
3,0
3,7
3,3
1,0
1,3
5,0
4,0
Geben Sie die Noten in eine Spalte eines Excel-Tabellenblattes ein
Sortieren Sie die Noten in aufsteigender Reihenfolge, d.h. ab 1,0.
Berechnen Sie die absoluten und relativen Häufigkeiten der vergebenen Notenstufen!
Ermitteln Sie die Durchschnittsnote!
2 Beschreibung und Analyse von Daten
120
Aufgabe 2.2
Die beiden folgenden Tabellen geben die Verteilungen der Anfangseinkommen von 15
Absolventen zweier verschiedener Hochschulen an!
60.000 DM
80.000 DM
60.000 DM
85.000 DM
70.000 DM
90.000 DM
80.000 DM
85.000 DM
70.000 DM
80.000 DM
70.000 DM
60.000 DM
80.000 DM
70.000 DM
90.000 DM
Hochschule 1
a)
30.000 DM
35.000 DM
40.000 DM
30.000 DM
40.000 DM
612.500 DM
42.500 DM
35.000 DM
40.000 DM
30.000 DM
35.000 DM
40.000 DM
42.500 DM
35.000 DM
42.500 DM
Hochschule 2
Ermitteln Sie die durchschnittlichen Anfangseinkommen der Absolventen beider
Hochschulen!
b) Ermitteln Sie die Spannbreiten der Anfangseinkommen der Absolventen beider
Hochschulen!
c) Berechnen Sie die Interquartilsspannen der beiden Verteilungen!
2.7 Aufgaben zu Kapitel 2
121
Aufgabe 2.3
Die folgenden Tabellen enthalten die Bevölkerungsanzahlen von allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie von deren Hauptstädten !
Land
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal
Schweden
Spanien
Bevölkerungszahl des
Landes
10,12
5,22
81,54
5,10
57,22
10,28
57,90
3,53
57,14
0,41
15,42
8,04
9,89
8,82
39,06
Hauptstadt des
jeweil. Landes
Brüssel
Koppenhagen
Berlin
Helsinki
Paris
Athen
London
Dublin
Rom
Luxemburg
Amsterdam
Wien
Lissabon
Stockholm
Madrid
Bevölkerungszahl der
Hauptstadt
951.000
1,34 Mio.
3,46 Mio.
502.000
9,1 Mio.
3,1 Mio.
6,8 Mio.
1,1 Mio.
2,79 Mio.
75.713
1,0 Mio.
1,8 Mio.
2,3 Mio.
692.954
2,9 Mio.
a)
Berechnen Sie die Gesamtbevölkerung der Europäischen Gemeinschaft sowie die
durchschnittliche Bevölkerungszahl pro Land und pro Hauptstadt!
b) Bestimmen Sie die Varianz und die Standardabweichung der Bevölkerungszahlen der
Länder und der Hauptstädte!
c) Bestimmen Sie die Variationskoeffizienten der Länder und der Hauptstädte!
Aufgabe 2.4
Für diese Aufgabe sind die bereits in Aufgabe 2.2 angegebenen Anfangseinkommen der
Absolventen der Hochschulen1 und 2 zu verwenden!
2 Beschreibung und Analyse von Daten
122
60.000 DM
80.000 DM
60.000 DM
85.000 DM
70.000 DM
90.000 DM
80.000 DM
85.000 DM
70.000 DM
80.000 DM
70.000 DM
60.000 DM
80.000 DM
70.000 DM
90.000 DM
Hochschule 1
a)
30.000 DM
35.000 DM
40.000 DM
30.000 DM
40.000 DM
612.500 DM
42.500 DM
35.000 DM
40.000 DM
30.000 DM
35.000 DM
40.000 DM
42.500 DM
35.000 DM
42.500 DM
Hochschule 2
Sortieren Sie zunächst die Einkommen beider Hochschulen in aufsteigender Reihenfolge!
b) Bestimmen Sie aus den Konzentrationsraten beider Einkommensverteilungen die Herfindahl-Indices der beiden Verteilungen!
c) Bestimmen Sie die Werte der Lorenz-Kurve für beide Verteilungen und stellen Sie
diese anschließend grafisch dar!
2.8
Lösungsvorschläge zu Kapitel 2.7
Aufgabe 2.1
a) Siehe Spalten A und B der nachstehenden Tabelle.
1
b) Siehe Spalten C und D der nachstehenden Tabelle, die sich durch Kopieren der Spalten A und B und Anwenden der Sortierfunktion auf Spalte D ergaben. Dabei ist zu beachten, daß Spalte C ebenfalls umsortiert werden muß, um den Bezug zwischen Prüfungsteilnehmer und Note beizubehalten.
c) Siehe Spalten F und G der nachstehenden Tabelle. Die Berechnung erfolgt gemäß der
in Abschnitt 2.2 (Beispiel 2.2) geschilderten Verfahren mit der Funktion Häufigkeit
und unter Verwendung von Matrixformeln (siehe Abschnitt 1.3). Die Summen für die
absolute und relativen Häufigkeiten sind in den Zellen F14 und G14 ermittelt worden.
Eine gute Kontrolle für die richtige Vorgehensweise stellt die Summe der relativen
Häufigkeit dar, die grundsätzlich den Wert 1,0 annehmen muß.
d) Für die Ermittlung der Durchschnittsnote wird in Spalte H zunächst das Produkt aus
Notenstufe (Spalte E) und Anzahl der vorkommenden Noten (Spalte F) gebildet werden. Die daraus resultierende Summe (H 14) wird mit der Anzahl der Prüfungsteilnehmer (F14) dividiert. Die Durchschnittsnote von 2,98 zeigt die Zelle G16.
_________________
1
6
Das Kopieren der Spalten A und B wurde nur für diesen Lösungsvorschlag vorgenommen, ansonsten wendet man die Sortierfunktion direkt auf das eingegebene Zahlenmaterial an.
124
2 Beschreibung und Analyse von Daten
2.8 Lösungsvorschläge zu Kapitel 2.7
125
Aufgabe 2.2
a)
Die durchschnittlichen Anfangseinkommen der Absolventen ergeben sich durch Anwendung des arithmetischen Mittelwertes. Die Ergebnisse zeigen die Zellen A17 und
B17.
b) Die Spannbreiten als Differenz der Maxima- und Minima-Funktionen der jeweiligen
Datenreihen führen die Zellen A20 und B20.
c) Die Interquartilsspanne wird entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 2.4 bestimmt und ist in den Zelle A23 und B23 dargestellt.
126
2 Beschreibung und Analyse von Daten
Aufgabe 2.3
a)
Die Gesamtbevölkerung wird mit der Funktion Summe, die durchschnittliche Bevölkerungszahl mit der Funktion Mittelwert bestimmt. Die Ergebnisse sind in den Zeilen 18
und 20 dargestellt.
b) Die Varianzen werden mit der Funktion Varianzen, die Stabdardabweichung mit Hilfe
der Funktion STABWN ermittelt. Die Ergebnisse führen die Zeilen 22 und 24.
c) Durch Bildung der Quotienten aus Standardabweichung und Mittelwert erhält man die
Variationskoeffizienten (siehe Zeile26).
2.8 Lösungsvorschläge zu Kapitel 2.7
127
Aufgabe 2.4
a)
Die in aufsteigender Reihenfolge sortierten Einkommen der beiden Hochschulen sind
den Spalten B und G der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Lorenzkurven für Aufgabe 2.4
1,0000
0,8000
0,6000
Hochschule A
0,4000
Hochschule B
0,2000
0,0000
0,0000
0,5000
1,0000
b) Die Konzentrationsraten werden jeweils durch Division der Höhe der einzelnen Einkommen durch die Gesamtsumme der Einkommen berechnet (siehe Spalte C für Hochschule A und Spalte H für Hochschule B). Durch Quadrieren der Konzentrationsraten
und Aufsummieren erhält man die Herfindahl-Indices (siehe D20 für Hochschule A
und I20 für Hochschule B).
c) Die für die Bestimmung der Lorenzkurve erforderlichen wi ergeben sich nach Abschnitt 2.5 aus der Division der laufenden Nummer durch die Anzahl der gesamten
2 Beschreibung und Analyse von Daten
128
Merkmalsträger. Die für beiden Hochschulen identischen wi sind in den Spalten E und
2
J dargestellt . Das Kumulieren der qi liefert die L(wi ) (siehe Spalten F und K). Die
Verwendung der Diagrammtyps Punkt (XY)-Diagramm führt zum nachstehend abgebildeten Diagramm, welches die Lorenzkurven beider Hochschulen zeigt.
_________________
2
Die doppelte Darstellung der Spalten für die wi dient hier nur der Übersichtlichkeit, ist an sich aber
nicht erforderlich.
3
Wahrscheinlichkeitsrechnung
3.1
Einführung
Für das Verständnis der in Teil I, Abschnitt 3 behandelten Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie läßt sich Excel nur sehr beschränkt einsetzen. Der Grund
liegt darin, daß bei den dort vorkommenden Fragestellungen in erster Linie der
zutreffende Ansatz zu bestimmen ist sowie die wahrscheinlichkeitstheoretischen
Sätze angewendet werden müssen. Die Berechnungen selbst sind meist trivial,
Kalkulationen mit großen Datenmengen kommen fast nicht vor.
Excel-Funktionen werden im folgenden für Zufallsexperimente und für Aufgabenstellungen im Bereich der Kombinatorik angewendet.
3.2
Zufallsexperimente
Zufallsexperimente lassen sich in Excel mit Hilfe der Funktion ZUFALLSZAHL
simulieren, wobei Excel hierbei eine Zahl zwischen 0 und 1 liefert. Dabei gilt es zu
beachten:
1. Die erzeugte Zufallszahl ändert sich bei jeder neuen Berechnung in der aktuellen Arbeitsmappe. Um mit einer festen Zufallszahl arbeiten zu können, muß
nach Eingabe der Funktion die Funktionstaste F9 ausgelöst werden, um die
Formel in eine Zufallszahl zu verändern.
2. Um eine reelle Zufallszahl, die zwischen a und b liegt, zu erzeugen, ist folgende Formel zu verwenden:
= ZUFALLSZAHL()*(b-a) + a
Beispiel 3.1
Abbildung 3.2.1 zeigt die Ergebnisse von sechsmaligem Würfeln, wobei die Formel
= ZUFALLSZAHL () * (6-1) +1
verwendet wurde.
6
3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
130
Abbildung 3.2.1: Ergebnisse sechsmaligen Würfelns
Die Ganzzahligkeit wird durch die entsprechende Festlegung des Zellenformats – in unserem Fall als Zahl ohne Dezimalstellen – oder durch Verwendung der Funktion RUNDEN
erreicht.
3.3
Kombinatorik
Die wesentliche Berechnungskomponente bei kombinatorischen Fragestellungen
stellt die Fakultät dar, die in Excel durch die gleichnamige Funktion repräsentiert
wird.
Die Funktion FAKULTÄT bestimmt für ganze positive Zahlen die Fakultät, bei
Dezimalzahlen werden die Nachkommastellen abgeschnitten und für "0" wird definitionsgemäß der Wert 1 ausgegeben.
Beispiel 3.2
Um die Wahrscheinlichkeit, beim Lotto einen Sechser zu haben, errechnen zu können, ist
zunächst die Anzahl der möglichen Sechserkombinationen gemäß Teil I, Abschnitt 3.9, zu
ermitteln:
Abbildung 3.3.1 zeigt das Ergebnis dieser Berechnung mit Hilfe der Excel-Funktion FA-
49!
(49 − 6)! 6!
KULTÄT, wobei die Bearbeitungszeile die Berechnungsformel führt.
3.3 Kombinatorik
131
Die Wahrscheinlichkeit, daß nun genau die getippte Sechserkombination gezogen wird,
beträgt 1:13.983.816 oder, in % ausgedrückt, 0,0000072 %.
Abbildung 3.3.1: Lösung für Beispiel 3.2
3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
132
3.4
Aufgaben zu Kapitel 3
Aufgabe 3.1
Die Kugel kann beim Roulette-Spiel auf eine von insgesamt 37 Zahlen (Zahlen 0 bis 36)
fallen.
a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Kugel bei der ersten Runde auf die "0"
rollt!
b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Kugel in der zweiten Runde auf die "0"
rollt.
c) Simulieren Sie 15 Runden des Roulette-Spieles!
Aufgabe 3.2
In Bayern ist Schafkopfen das am weitesten verbreitete Kartenspiel. Bei der üblichen Spielart erhält jeder der vier Spieler aus insgesamt 32 genau acht Karten. Das beste Blatt, "Sie"
genannt, besteht aus den vier Ober und den vier Unter. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, als Spieler einen Sie zu bekommen?
3.5 Lösungsvorschläge zu Kapitel 3.4
3.5
133
Lösungsvorschläge zu Kapitel 3.4
Aufgabe 3.1
a)
Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1:37, oder in % ausgedrückt, 2,7 %.
b) Natürlich beträgt auch hier die Wahrscheinlichkeit 2,7 %.
c) Die nachstehende Tabelle erhält ein mögliches, mit der Funktion Zufallszahl ermitteltes Ergebnis. Als Funktionsargument ist lediglich die Zahl 36 einzugeben.
Aufgabe 3.2
Analog zum Vorgehen in Abschnitt 3.3 ist zunächst die Anzahl der Möglichkeiten, genau
eine Achterkombination ausgeteilt zu bekommen, zu berechnen (Formel: siehe Bearbeitungsleiste).
Das in Zelle A1 dargestellte Ergebnis zeigt, daß es insgesamt 10.518.300 verschiedene
Achterkombinationen gibt. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sie zu erhalten, beträgt demnach
1:10.518.300 oder, in % ausgedrückt, 0,0000095 %.
4
Grafische Präsentation von
Daten
4.1
Einführung
Für die grafische Präsentation von Daten bietet Excel eine Reihe von Diagrammtypen, die jeweils in mehreren, unterschiedlichen Varianten verfügbar sind.
Excel unterscheidet dabei zwischen Standard-Diagrammtypen und benutzerdefinierten Diagrammtypen. Jeder benutzerdefinierte Diagrammtyp basiert auf einem
Standard-Diagrammtyp und enthält zusätzliche Formatierungen und Optionen.
Man kann auf die bereits in Excel integrierten benutzerdefinierten Diagrammtypen
zugreifen oder eigene benutzerdefinierte Diagrammtypen erstellen. Im Rahmen der
folgenden Ausführungen werden ausschließlich Standard-Diagrammtypen verwendet.
Die Daten werden im einfachsten Fall durch Datenpunkte repräsentiert, an deren
Stelle – je nach Diagrammtyp – Säulen, Balken, Kreise usw. treten können. Da
diese auch nur jeweils einen Wert darstellen, werden sie in Excel ebenfalls als Datenpunkte bezeichnet.
Zusammengehörige Daten bilden eine Datenreihe. Die Datenpunkte einer Datenreihe sind in der zugrundeliegenden Tabelle zeilen- oder spaltenförmig angeordnet.
Den Bezugsrahmen, in dem die Daten einer Tabelle grafisch dargestellt werden,
liefert ein Koordinatensystem. Am häufigsten sind Diagramme anzutreffen, die
auf dem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem basieren. Als weitere
Koordinatensysteme finden sich noch Kreis-/Ringdiagramme und Netzdiagramme.
Kartesisches Koordinatensystem
Dieses Koordinatensystem wird durch Achsen bestimmt, wobei in Excel die Achse
der unabhängigen Variablen Rubrikenachse, die der abhängigen Variablen Größenachse heißt. Mit Ausnahme der Balkendiagramme stimmt die Rubrikenachse
mit der Abszisse, die Größenachse mit der Ordinate überein. Bei dreidimensionalen
Darstellungen kommt eine dritte Achse – Reihenachse genannt – hinzu.
6
4 Grafische Präsentation von Daten
136
Die Einteilung der Achsen, Skalierung genannt, nimmt der Diagramm-Assistent
(siehe Abschnitt 4.2) aufgrund des vorliegenden Datenmaterials automatisch vor.
Dabei verfügt Excel bei den meisten Diagrammtypen nur über eine numerische
Achse, die Größenachse. Auf diesen Umstand ist bei der Auswahl der Diagrammtypen zu achten.
Neben den Achsen mit entsprechenden Skalierungen weist ein Diagramm normalerweise noch folgende Elemente auf:
Ø Achsenbeschriftungen
Ø Gitternetzlinien
Ø Legenden
Ø Titel
Ø Kopf- und Fußzeilen
Abbildung 4.1.1 zeigt für die in Beispiel 1.4 vorliegenden Umsatzerlöse für Erfrischungsgetränke ein Säulendiagramm mit den eben angeführten Elementen. Die
Datenpunkte sind dabei die einzelnen Umsatzwerte, die Umsatz-Datenpunkte jeweils einer Getränkesorte bilden die Datenreihen.
Kopfzeile
Titel
Gitternetzlinien
Größenachse
Achsenskalierungen
Achsenbeschriftungen
Legende
Rubrikenachse
Fußzeile
Abbildung 4.1.1: Beispiel für ein „kartesisches Koordinatensystem“1
Kreis- und Ringdiagramme
_________________
1
Nicht exakt aus mathematischer Sicht, da bei einem kartesischen Koordinatensystem beide Achsen
kardinak skaliert sind.
4.1 Einführung
137
Bei diesen Koordinatensystemen wird anstelle der Rubrikenachse ein Kreis verwendet, der – im Gegensatz zu einer Achse – keinen Anfangspunkt hat. An Stelle
der Größenachse tritt dann der Winkel im Kreis, so daß den verschiedenen Datengrößen verschiedene Winkelgrößen entsprechen. Abbildung 4.1.2 stellt die Umsatzwerte von Beispiel 1.4 für den Monat Januar in einem Kreisdiagramm dar, in
dem zur leichteren Lesbarkeit die Datenbeschriftungen und die jeweiligen Prozentsätze bei den Kreissegmenten angegeben sind.
Umsatzerlöse Erfrischungsgetränke Januar 1998
Apfel17%
saft
Min.wasser
28%
Iso16%
Drinks
Limon21%
aden
Cola
18%
Abbildung 4.1.2: Beispiel für ein Kreisdiagramm
Netzdiagramme
Bei diesem Koordinatensystem werden die Rubriken kreisförmig angeordnet. Für
jede Rubrik wird eine eigene Größenachse erstellt, auf der die jeweiligen Datenpunkte markiert werden. Abbildung 4.1.3 veranschaulicht diese Darstellung vereinfacht ebenfalls anhand der Umsatzerlöse der Erfrischungsgetränke im Januar (siehe
Beispiel 1.4).
4 Grafische Präsentation von Daten
138
Umsatzerlöse Erfrischungsgetränke Januar 1998
ISO-Drinks
6000
4000
Apfelsaft
2000
Limonaden
0
Min.-wasser
Januar
Cola
Abbildung 4.1.3: Beispiel für ein Netzdiagramm
4.2
Diagrammerstellung
Die Erstellung von Diagrammen läuft mit Hilfe des Diagramm-Assistenten in
folgenden Dialogschritten ab:
1. Wahl des Diagrammtyps
Im ersten Schritt kann zwischen Standard-Diagrammtypen und benutzerdefinierten Diagrammtypen ausgewählt werden. Bei der Bestimmung eines Standard-Diagrammtyps ist dessen Eignung für das vorliegende Datenmaterial zu
beachten.
2. Zuordnung der Diagramm-Quelldaten
Zunächst muß im Registerfeld Datenbereich der Bereich festgelegt werden,
der die grafisch darzustellenden Daten enthält. Sind diese bereits vor dem Start
des Diagramm-Assistenten markiert, so werden sie im Feld Datenbereich angezeigt, ansonsten sind sie im Tabellenblatt zu markieren.
Weiterhin ist festzulegen, ob die Datenreihen zeilen- oder spaltenweise angeordnet sind.
Im Registerfeld Reihe können u.a. folgende Festlegungen getroffen werden:
Ø Hinzufügen oder Entfernen von markierten Datenreihen
Ø Modifizieren von Namen für Datenreihen
4.2 Diagrammerstellung
139
Ø Ändern des von Excel standardmäßig ausgewählten Zellbereichs für die
Rubrikenbeschriftung
3. Festlegung von Diagrammoptionen
Hier werden eine Reihe optionaler Eigenschaften für eine aussagekräftige Aufbereitung der Grafiken in Form von Registern angeboten, wobei die Optionen
nur bei Eignung für den jeweils ausgewählten Diagrammtyp verfügbar sind.
Die Tabelle der Abbildung 4.2.1 gibt einen Überblick über die insgesamt verfügbaren Optionen.
Option
Titel
Achsen
Gitternetzlinien
Legende
Datenbeschriftungen
Datentabelle
Auswirkung bei Auswahl
Titel für das Diagramm und die Achsen
Ein- und Ausblenden der Rubriken-, Größen- und Reihenachse; Festlegung der Rubrikenachse als Zeit- oder Standardachse
Festlegung von Haupt- und/oder Hilfsgitternetzlinien
Festlegung der Anzeige und Anordnung einer Legende
Beschriftung der dargestellten Daten mit ihren Datenwerten oder mit
der Beschriftung der zugehörigen Rubrikenachse
Anzeige der Werte für die einzelnen Datenreihen in einem Gitternetz
unter dem Diagramm
Abbildung 4.2.1: Überblick über Diagrammoptionen
4. Diagrammplazierung
Hier wird festgelegt, ob das Diagramm in eine der vorhandenen Tabellenblätter
eingefügt oder ob ein neues Arbeitsblatt erzeugt werden soll.
Nach dem Ausführen dieser Dialogschritte wird automatisch ein Diagramm erstellt.
Verschiedene Befehle des Menüpunkts Diagramm, der nach Markieren des Diagramms verfügbar wird, gestatten dem Benutzer, die getroffenen Festlegungen
hinsichtlich des Diagrammtyps, des zugrundeliegenden Datenbereichs, der Diagrammoptionen (siehe Abbildung 4.2.1) sowie der Plazierung in das vorhandene
oder ein eigenes Tabellebblatt nachträglich abzuändern. Des weiteren gibt es Befehle für das Hinzufügen neuer Datenpunkte oder einer Trendlinie.
Bei der Erstellung des Diagramms bestimmt Excel eine Reihe von Eigenschaften,
die ggf. noch den Anforderungen des Benutzers anzupassen sind. Durch Doppelklick im Diagramm auf die einzelnen Achsen, den Diagrammtitel, die Legende, die
Zeichnungsfläche, die Gitternetzlinien oder die Datenpunkte öffnen sich die zugehörigen Dialogfenster, die eine bedarfsgerechte Formatierung des selektierten Elements ermöglichen. Abbildung 4.2.2 zeigt beispielhaft das Dialogfenster für die
Formatierung einer Achse.
4 Grafische Präsentation von Daten
140
Abbildung 4.2.2: Dialogfenster für Achsenformatierung
4.3
Statistische Anwendungen
Für die im Rahmen dieses Buches behandelten statistischen Fragestellungen kommen für die grafische Präsentation vor allem folgende Diagramme in Betracht:
Ø Säulendiagramme
Ø Balkendiagramme
Ø Stabdiagramme
Ø Liniendiagramme
Ø Kreisdiagramme
Ø Streudiagramme
Ø Lorenzkurve
Diese Diagramme lassen sich direkt aus Standard-Diagrammtypen von Excel ableiten. Die Charakteristika der erforderlichen Standard-Diagrammtypen werden in
4.3 Statistische Anwendungen
141
diesem Abschnitt in tabellarischer Form dargestellt, die Vorgehensweise und zu
beachtende Besonderheiten im wesentlichen anhand von Beispielen aufgezeigt.
Für die grafische Darstellung von Häufigkeiten finden Säulen-, Balken- und
Stabdiagramme Anwendung.
Einen Überblick über Säulendiagramme gibt Abbildung 4.3.1.
Säulendiagramm
Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten:
1.
Anzeige von Datenänderungen innerhalb eines Zeitabschnitts
2.
Darstellung von Vergleichen zwischen Elementen
Anwendungsgebiete in der Statistik:
Darstellung der Häufigkeit bei stetigen Merkmalen (Histogramm)
Achsenzuordnung für statistische Anwendungen:
Rubrikenachse: Klassen der Merkmalswerte
Größenachse: Häufigkeit der Merkmalswerte
Alternative Formate (Auswahl):
Gestapelte Säulendiagramme
3D-Säulendiagramme
Abbildung 4.3.1: Überblick über Säulendiagramme
Beispiel 4.1
Ausgangspunkt sind die in Beispiel 2.4 ermittelten Häufigkeiten für verschiedene Einkommensklassen (siehe Abbildung 2.2.6). Mit Hilfe des Diagramm-Assistenten erhält man bei
Auswahl des Diagrammtyps Säule die in Abbildung 4.3.2 dargestellte Grafik, wobei folgende Besonderheiten zu beachten sind:
Ø Als Datenbereich wird D2:D13 ausgewählt.
Ø Für die Beschriftung der Rubrikenachse wird der Bereich C2:C13 bestimmt.
4 Grafische Präsentation von Daten
142
Ø
Ø
Für die Rubrikenachse wird die Ausrichtung des Textes auf 90o eingestellt.
Nach Doppelklick auf einen Datenpunkt, d.h. auf eine Säule, öffnet sich das Dialogfenster "Datenreihen formatieren (siehe Abbildung 4.3.3). Im Registerfeld Optionen
ist der Abstand auf 0 einzustellen, andernfalls werden die Säulen nicht unmittelbar nebeneinander angeordnet.
Einkommensgrenzen
Abbildung 4.3.2: Säulendiagramm für Beispiel 4.1
105000
100000
95000
90000
85000
80000
75000
70000
65000
60000
55000
6
5
4
3
2
1
0
50000
Häufigkeit
Einkommensverteilung
4.3 Statistische Anwendungen
143
Abbildung 4.3.3: Formatieren der Datenreihe
Mit Balkendiagrammen (siehe Abbildung 4.3.4) kann man ebenso wie mit Säulendiagrammen Vergleiche zwischen einzelnen Elementen darstellen, allerdings
bieten Balkendiagramme aufgrund der horizontalen Darstellung eine bessere Vergleichsmöglichkeit zwischen den Werten.
Balkendiagramm
Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten:
1. Anzeige einzelner Zahlen zu einem bestimmten Zeitpunkt
2. Darstellung von Vergleichen zwischen Elementen
Anwendungsgebiete in der Statistik:
Darstellung der Häufigkeit bei stetigen Merkmalen
Achsenzuordnung für statistische Anwendungen:
Rubrikenachse: Klassen der Merkmalswerte
Größenachse: Häufigkeit der Merkmalswerte
4 Grafische Präsentation von Daten
144
Alternative Formate (Auswahl):
Gestapelte Balkendiagramme
3D-Balken, gestapelt
Abbildung 4.3.4: Überblick über Balkendiagramme
Beispiel 4.2
Abbildung 4.2.5 zeigt die in Beispiel 4.1 ermittelten Häufigkeitswerte in Form eines Balkendiagrammes, wobei die für Beispiel 4.1 geltenden Besonderheiten auch hier zutreffen.
E in k o m m e n s v e r t e ilu n g
105000
100000
Einkomme n s k l a s s e n
95000
90000
85000
80000
75000
70000
65000
60000
55000
50000
0
2
4
6
H ä u fig k e it
Abbildung 4.3.5: Balkendiagramm
Mit Säulen- und Balkendiagramme werden Häufigkeiten klassifizierter stetiger und
diskreter Merkmale grafisch dargestellt. Vorzugsweise geschieht dies in solchen
Fällen, in denen mehrere Datenreihen, d.h. mehrere Merkmale, in einem Diagramm
abgebildet werden. Der wesentliche Grund liegt in der einfachen unterschiedlichen
Darstellbarkeit (z.B. durch verschiedene Muster und Schraffuren) der einzelnen
Datenreihen.
4.3 Statistische Anwendungen
145
Zur Abbildung der Häufigkeit von in einer Datenreihe vorliegenden diskreten
Merkmalen werden manchmal auch Stabdiagramme eingesetzt. Diesen – als Säulendiagramm mit der Breite null interpretierbaren – Diagrammtyp bietet Excel
explizit nicht an. Die Ableitung aus Säulen- bzw. Balkendiagrammen ist ebenfalls
nicht möglich, da die Breite der Säulen bzw. Balken nicht auf Null reduziert werden kann.
Mit einem kleinen Trick lassen sich die Stabdiagramme mit dem Diagrammtyp
Kurs erstellen, der üblicherweise zur Darstellung von Aktienkursen herangezogen
wird. Beispiel 4.3 veranschaulicht die erforderliche Vorgehensweise.
Beispiel 4.3
Ausgangspunkt ist die in Abbildung 2.2.6 dargestellte Ergebnistabelle für Beispiel 2.2. Die
Anwendung des Diagrammtyps Kurs setzt drei verschiedene Datenreihen voraus, für Aktienkurse sind dies die Hoch-, Tief- und Schlußwerte. Im vorliegenden Fall stellen die Häufigkeiten der Abbildung 2.2.6 die Hochwerte dar, als Tief- und Schlußwerte sind zwei Datenreihen zu ergänzen, die ausschließlich die Werte null enthalten (siehe Spalten E und F in
Abbildung 4.3.6).
Abbildung 4.3.6: Ergänzte Ausgangsdaten von Beispiel 4.3
Markiert man nun den Bereich D2:F13 und weist diesem den Diagrammtyp Kurs zu, so
erhält man nach Festlegung der Rubrikenachse auf C2:C13 und Eingabe der Titel unmittelbar das in Abbildung 4.3.7 dargestellte Stabdiagramm.
4 Grafische Präsentation von Daten
146
N o t e n v e r t e ilu n g
Häufigkeit
4
3
2
1
N o ten
Abbildung 4.3.7: Stabdiagramm für Beispiel 4.3
5,0
4,7
4,0
3,7
3,3
3,0
2,7
2,3
2,0
1,7
1,3
1,0
0
4.3 Statistische Anwendungen
147
Liniendiagramme (siehe Abbildung 4.3.8) dienen in erster Linie der Darstellung
zeitlicher Entwicklungen einer Datenreihe.
1
Liniendiagramm
Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten:
Anzeige von Datentrends über einen bestimmten Zeitraum
in regelmäßigen Intervallen
Anwendungsgebiete in der Statistik:
Siehe allgemeine Anwendungsmöglichkeiten
Achsenzuordnung für statistische Anwendungen:
Rubrikenachse: Zeitintervalle
Größenachse: Merkmalswerte
Alternative Formate (Auswahl):
Gestapelte Liniendiagramme
3D-Liniendiagramme
Abbildung 4.3.8: Überblick über Liniendiagramme
Beispiel 4.4
Die Tabelle der Abbildung 4.3.9 enthält das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik für die
2
Jahre 1993 – 1997 . Der Diagramm-Assistent liefert bei Auswahl des Diagrammtyps Linie
das in Abbildung 4.3.10 dargestellte Diagramm.
_________________
2
Quelle: Statistisches Bundesamt, Internet-Abfrage der Dokumentenadresse
http://www.statistik-bund.de/indicators/d/vg4w.htm vom 1.3.1998.
148
Abbildung 4.3..9: Ausgangsdaten für Beispiel 4.4
4 Grafische Präsentation von Daten
4.3 Statistische Anwendungen
149
Bruttosozialprodukt BRD 1993 - 1997
1.000,00
900,00
800,00
700,00
I
1993
III
I
1994
III
I
1995
III
I
1996
III
I
1997
III
Abbildung 4.3.10: Liniendiagramme für Beispiel 4.4
Kreisdiagramme – häufig auch als Tortendiagramme bezeichnet – zeigen das proportionale Verhältnis der einzelnen Werte einer Datenreihe zum Gesamtwert der
Datenreihe (siehe Abbildung 4.3.11).
Kreisdiagramm
Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten:
Anzeige der proportionalen Größe von Elementen einer
Datenreihe im Verhältnis zur Gesmatzahl der Elemente.
Anwendungsgebiete in der Statistik:
Siehe allgemeine Anwendungsmöglichkeiten
Alternative Formate (Auswahl):
Explodierendes Kreisdiagramme
Abbildung 4.3.11: Überblick über Kreisdiagrammme
3D-Kreisdiagramme
4 Grafische Präsentation von Daten
150
Beispiel 4.5
Abbildung 4.3.12 zeigt das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen im Jahr 1998, Abbildung 4.3.13 das dazugehörige Kreisdiagramm.
Partei
SPD
CDU
Grüne
FDP
Sonstige
Anteil
47,9 %
35,9 %
7,0 %
4,9 %
4,3 %
Abbildung 4.3.12: Ausgangsdaten für Beispiel 4.5
Landtagswahl Niedersachsen 1998
SPD
CDU
Grüne
FDP
Sonstige
Abbildung 4.3.13: Kreisdiagramm für Beispiel 4.6
Punktdiagramme (siehe Abbildung 4.3.14) stellen das Verhältnis von zwei Datenreihen als xy-Koordinaten dar und werden im Rahmen statistischer Anwendungen
für die Erstellung von Streudiagrammen und für die Darstellung der Lorenzkurve
verwendet.
Punkt (XY)-Diagramm
Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten:
1. Anzeige des Verhältnisses zwischen numerischen Werten in
Mehreren Datenreihen
4.3 Statistische Anwendungen
151
2. Aufzeichnung von zwei Zahlengruppen als eine Reihe von xy-Koordinaten
Anwendungsgebiete in der Statistik:
1. Streudiagramme
2. Lorenzkurve
Alternative Formate (Auswahl):
Punkte mit interpolierten Linien
Punkte
mit
Datenpunkte
Linien
ohne
Abbildung 4.3.14: Überblick über Punktdiagramme
Beispiel 4.7
Abbildung 4.3.15 zeigt in einer vergleichenden Gegenüberstellung die entscheidenden
Kriterien für die Teilnahme der EU-Staaten an der gemeinsamen Währung Euro.
Bei Auswahl des Punktdiagramms auf das zugrundeliegende Zahlenmaterial erhält man das
– in der Statistik als Streudiagramm bezeichnete – Diagramm der Abbildung 4.3.11, welches Aufschluß über den statistischen Zusammenhang von Haushalts-Defizit bzw. Überschuß und Schuldenstand der einzelnen EU-Staaten gibt.
4 Grafische Präsentation von Daten
152
EU-Staat
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Haushaltsdefizit (-) bzw. -überschuß (+)
in Prozent des Bruttoinlandsprodukt
-2,1
+1,3
-2,7
-0,9
-3,0
-4,2
-2,0
-0,4
-2,7
+1,72
-2,2
Österreich
Portugal
Schweden
Spanien
-2,5
-2,45
-1,9
-2,6
Schuldenstand in Prozent des Bruttoinlandsprodukt
122,0
67,0 (EU-Schätzung)
61,3
55,8
58,0
109,3 (EU-Schätzung)
52,9 (EU-Schätzung)
67,0 (erwartet)
121,6
6,7
3
65 (erwartet)
66,1
61,99
77,4 (EU-Schätzung)
68,3
Abbildung 4.3.15: Euro-Kriterien im Vergleich4
150,0
100,0
50,0
0,0
-5
-3
-1
Schuldenstand
Eurokriterien im Vergleich
1
Haushalts-Defizit bzw. -Überschuß
Abbildung 4.3.16: Streudiagramm für Vergleich der Euro-Kriterien
_________________
3
Aus den angegebenen Grenzen "60 – 70%" wurde vereinfacht der Mittelwert angenommen.
4
Entnommen aus: Nürnberger Zeitung vom 28.2.1998, S. 3.
4.3 Statistische Anwendungen
153
Grundsätzlich lassen sich mit derartigen Streudiagrammen Aussagen über Art,
Richtung und Stärke eines statistischen Zusammenhanges von zwei Variablen treffen, d.h., es kann festgestellt werden, ob ein Zusammenhang vorliegt, ob er sich
gleichgerichtet oder gegenläufig verhält und wie groß der Zusammenhang ist.
Das zweite Anwendungsgebiet von Punktdiagrammen stellt die Lorenzkurve dar.
Die Vorgehensweise der Erstellung ist bereits in Abschnitt 2.5, insbesondere in
Beispiel 2.11, erläutert worden, so daß an dieser Stelle auf eine Behandlung verzichtet wird.
4 Grafische Präsentation von Daten
154
4.4
Aufgaben zu Kapitel 4
Aufgabe 4.1
Eine Befragung unter 1866 wahlberechtigten Personen ergab folgende nach Geschlecht
differenzierte Anhängerschaft der im Bundestag vertretenen Parteien:
männlich
weiblich
Summe
CDU/CSU
388
416
804
SPD
345
322
667
Grüne
101
112
213
FDP
55
65
120
Sonstige
38
24
62
Gesamt
927
939
1866
a)
Ermitteln Sie für jede Partei den Anteil ihrer Wähler an der Gesamtzahl der Wähler
und stellen Sie Ihr Ergebnis in einer geeigneten Grafik dar!
b) Ermitteln Sie für jede Partei den Anteil weiblicher Wähler an der Gesamtzahl der
weiblichen Wähler. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den
in a) ermittelten Anteilen in einer geeigneten Grafik dar!
Aufgabe 4.2
Die nachstehende Abbildung zeigt die Tabellensituation zweier Fußballvereine im Verlauf
der Vorrunde einer Bundesligaaison.
Stellen Sie in einem geeigneten Diagramm diesen Verlauf da, wobei insbesondere die Entwicklung der Tabellenplazierungen beider Vereine verdeutlicht werden soll.
Spieltag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Plazierung
Verein 1
2
4
3
3
7
5
7
7
7
9
9
12
12
14
14
15
16
Plazierung
Verein 2
16
11
12
12
13
11
15
15
17
17
16
16
18
16
15
14
15
4.5 Lösungsvorschläge zu Kapitel 4.4
155
Aufgabe 4.3
a)
Stellen Sie die in der folgenden Tabelle dargestellten Daten in einem Diagramm dar,
das den Zusammenhang zwischen den beiden Datenreihen wiedergibt!
b) Welchen zwischen den beiden Datenreihen bestehenden Zusammenhang können Sie
dem Diagramm entnehmen?
4.5
Lösungsvorschläge zu Kapitel 4.4
Aufgabe 4.1
a)
Nach Ermittlung der jeweiligen Anteile durch Division der für die einzelnen Parteien
ermittelten Summen durch die Gesamtzahl der Befragungsteilnehmer wird für die Anzeige der in Zeile 5 ermittelten Anteile im Diagramm-Assistenten der Diagrammtyp
Kreis ausgewählt. Das Ergebnis zeigt die nachstehende Abbildung.
156
4 Grafische Präsentation von Daten
b) Nach Ermittlung des Anteils der weiblichen Wähler kann aus den Datenreihen der
Zeilen 5 und 6 die folgende Abbildung hergeleitet werden. Zur besseren Unterscheidung der beiden Datenreihen werden hier – obwohl es sich um diskrete Merkmale handelt – Säulendiagramme ausgewählt (siehe hierzu auch Abschnitt 4.3).
4.5 Lösungsvorschläge zu Kapitel 4.4
157
4 Grafische Präsentation von Daten
158
Aufgabe 4.2
Die Abbildung zeigt den Verlauf der Plazierungen der beiden Bundesligavereine in einem
Liniendiagramm an, wobei zur Verdeutlichung der Untertyp Linien mit Datenpunkten
ausgewählt wird.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
V e r e in 1
S p ie lta g
17
15
13
11
9
7
5
3
V e r e in 2
1
Plazierung
A n a ly s e V o r r u n d e n v e r la u f
4.5 Lösungsvorschläge zu Kapitel 4.4
159
Aufgabe 4.3
a)
Das nachstehend abgebildete Streudiagramm wird aus einem Punktdiagramm hergeleitet.
b) Es besteht ein relativ starker, gleichläufiger Zusammenhang zwischen Bruttosozialpro-
Bruttoe inkomme n
Zusammenhang zw ischen Bruttosozialprodukt und
B ruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen
240
220
200
180
160
140
120
100
700
750
800
850
900
Bruttosozialprodukt
dukt und Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen.
950
1.000
5
Literatur
Bleymüller, J., Gehlert, G., Gülicher, H., 1996, Statistik für
schaftler, Vahlen Verlag.
Wirtschaftswissen-
Bourier, G., 1996, Beschreibende Statistik, Gabler Verlag.
Bosch, K., 1993, Statistik-Taschenbuch, Oldenbourg Verlag.
Fischer Weltalmanach, 1996, Fischer Taschenbuch Verlag.
Freedman, D., Pisani, R., Purves, R., Adhikari, A., 1991, Statistics, Norton &
Company.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.), 1995, Zahlen zur wirtschaftlichen
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Deutscher Instituts-Verlag
Köln.
Gonick, L., Smith, W., 1993, The Cartoon Guide to Statistics, HarperCollins.
Hofstädter, D., 1985, Gödel, Escher, Bach - ein endloses geflochtenes Band,
Klett-Cotta.
Jarai, H., 1997, Excel 97, München.
Kamenz, A., Vonhoegen, H., 1997, Excel 97, Düsseldorf.
Knight, F. H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit, New York.
Königs, G., 1997. Excel 97, Kaarst.
Kolmgoroff, A. N., 1933, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
Berlin.
Laplace, P. S., 1774, Mémoire sur la probabilité des causes les par les
mens. Übersetzung in: Stigler (1986).
évène-
Mises, R.v., 1936, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Wien.
Monka, M., Voss, W., 1996, Statistik am PC - Lösungen mit Excel, MünchenWien.
Oberhofer, W., 1984, Wahrscheinlichkeitstheorie, Oldenbourg Verlag.
Ortlepp, M., Osenberg, R., 1997, Das Excel 97 Buch, Düsseldorf.
Penrose, R., The Emperor’s New Mind - Concerning Computers, Minds, and the
Laws of Physics, Penguin Books.
6
162
Literatur
Pfuff, F., 1979, Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 1+2, Vieweg
Verlag, Braunschweig.
Rao, C. R., 1995, Was ist Zufall? Statistik und Wahrheit, Prentice Hall.
Savage, L. J., 1954, The Foundations of Statistics, New York.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 1996, Statistisches Jahrbuch für das Ausland,
Metzler Poeschel.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 1996, Statistisches Jahrbuch für die
publik Deutschland, Metzler Poeschel.
Bundesre-
Stigler, S. M., 1986, Laplace’s 1774 memoir on inverse probability, Statistical
Science, 1.