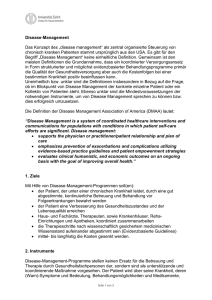Disease Management in Deutschland
Werbung

Disease Management in Deutschland - Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Faktoren zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation Gutachten im Auftrag des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK) und des Arbeiter-Ersatzkassen-Verbandes e.V. (AEV) Prof. Dr. Dr. Karl W. Lauterbach, Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität zu Köln. Gleueler Str. 176-178/III 50935 Köln Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Autoren Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität zu Köln. Gleueler Str. 176-178/III 50935 Köln Telefon: +49 - 221 - 4679 - 0 Telefax: +49 - 221 - 430 230 4 Leitung: Prof. Dr. Dr. Karl W. Lauterbach Mitarbeit: Dr. med. Stephanie Stock, Gesundheitsökonom (ebs) Marcus Redaèlli, Arzt Matthias Kühn, Arzt und Wirtschaftswissenschaftler Dr. rer. pol. Markus Lüngen Seite 2 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 3 Inhaltsverzeichnis 1 Definition und Zielsetzung von Disease Management 17 1.1 Einführung 17 1.2 Definition 17 1.3 Zielsetzung von Disease Management in der GKV 24 1.4 Beispiele im internationalen Bereich 25 1.5 Status Quo, gesetzliche Rahmenbedin-gungen in Deutschland 33 1.5.1 Gesetzliche Krankenversicherung 34 1.5.2 Private Krankenversicherung 45 1.5.3 Kommerzielle Gesundheitsdienstleister: 49 2 Disease Management Komponenten bei ausgewählten Erkran kungen im internationalen Bereich 51 2.1 Bsp. 1: Leitlinienimplementierung / Organisationsmanagement 52 2.2 Bsp.2: Organisationsentwicklung, Einsatz von Informations technologie 2.3 Bsp. 3: Evaluationsstrategien: Entwicklung von Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität 2.4 60 67 Bsp 4: Patientenschulung, individuelle Therapieleitlinien und Patienten-Selbstmanagementtechniken 71 2.5 Bsp 5: Organisationsmanagement 75 2.6 Bsp 6: Reminder und Feedback für Ärzte und Patienten 83 2.7 Bsp 7: Installation eines Elektronischen Monitoring-Systems und Gruppensprechstunden für Diabetiker 87 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens 2.8 2.9 Seite 4 Bsp. 8: Schulung und Unterstützung des Krankheitsselbstmanagements 89 Bsp. 9: Organisationsmanagement 91 2.10 Bsp. 10: Leitlinieneinsatz, Feedback, Ärztefortbildung 96 3 Evidenzbasierte Leitlinien 98 3.1 Einleitung 98 3.2 Definition 99 3.3 Qualitätsmerkmale von Leitlinien 100 3.4 Methodik, Dissemination, Implementierung und Evaluierung von Leitlinien 102 3.4.1 Methodik 103 3.4.2 Dissemination 105 3.4.3 Implementierung 106 3.4.4 Evaluation 106 4 Patientenschulung 109 4.1 Formen der Wissensvermittlung 110 4.2 Strukturierte Behandlungs- und Schulungsprogramme 112 4.3 Materialien der Wissensvermittlung 112 4.4 Empfohlenes Gesamtkonzept für die Patientenschulung im Disease Management 113 4.4.1 Anforderungen an schulende Institutionen 113 4.4.2 Anforderungen an die Schulungsleiter 114 4.4.3 Anforderungen an das Schulungsprogramm 115 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 5 5 Erinnerungssysteme im Disease Management 5.1 Bedeutung und Funktion von Erinnerungssystemen im Disease Management 120 121 5.1.1 Funktion von Remindern für den Arzt 121 5.1.2 Funktion von Remindern für den Patienten 123 5.2 Der Einsatz von Erinnerungssystemen im Disease Management Programm 130 5.2.1 Wann sollen Reminder eingesetzt werden? 130 5.2.2 Welche Arten von Reminder können verwendet werden? 132 5.2.3 Wer soll den Remindereinsatz steuern? 134 6 Arzt- und Patienteninformationssysteme im Disease Manage ment 137 6.1 Patienteninformationssysteme 141 6.2 Arztinformationssysteme 148 6.3 Internet und Disease Management 150 7 Datenmanagement, Dokumentation und Datenbanken im Disease Management 154 7.1 Funktion und Stellenwert von Daten im Disease Management 154 7.2 Dokumentation im Disease Management: der Benchmarkingdatensatz 155 7.3 Datenbanken der am Disease Management Beteiligten 160 7.4 Datenfluss im Disease Management Programm 162 7.5 Datenschutz im Disease Management 163 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens 8 Seite 6 Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung 166 8.1 Qualitätsstufen von Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung 8.2 167 Interventionen zum Organisationsmanagement und zur Entscheidungsunterstützung 169 9 Ärztliche Fortbildung im Disease Management 174 9.1 Entwicklungstendenzen in der ärztlichen Fortbildung 174 9.1.1 Internationale Entwicklungen 175 9.1.2 Anforderungen an einen systematischen Fortbildungsansatz im Disease Management 9.2 Ärztliche Fortbildung im Disease Management: Systematische Weiterentwicklung der ärztlichen Kompetenz 10 178 183 Vorschlag zum Aufbau eines Disease Management in Deutsch land 187 10.1 Aufbau und Ablauf eines Disease Management Programms 187 10.1.1 Disease Management Module 188 10.1.2 Einschreibemodul 190 10.1.3 Disease Management Gruppen 191 10.1.4 Basismodul 192 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens 11 Seite 7 Disease Management bei ausgewählten Erkrankungen (Diabetes Mellitus) 196 11.1 Einleitung 196 11.2 Über-, Unter- und Fehlversorgung bei Diabetikern 200 11.3 Einschreibungsmodul: 204 11.4 Basismodul 212 11.5 Ergänzungsmodule 249 11.6 Ergänzungsmodul - Komplikationstherapie 260 12 Kosten- Effektivität als Voraussetzung für den Einsatz von Di sease Management Programmen 12.1 Einführung 279 279 12.2 Aspekte der Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen 281 12.3 Evidenz für Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen 12.3.1 Mehrkosten von Krankheiten 282 283 12.3.2 Beispiele für Evaluationen von Disease Management Programen 285 12.3.3Vergleich mit betrieblichen Gesundheitsprogrammen 288 12.4 Zusammenfassung und Diskussion 290 13 294 Qualitätssicherung 13.1 Anforderungen an die Qualitätsicherung von Disease Management Programmen im Risikostrukturausgleich 295 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 8 13.1.1 Wahl der Erkrankungen und Leitlinien, Definition von Versorgungszielen und Einschreibungskriterien durch die Spitzenverbände 295 13.1.2 Definition der Module und Komponenten für Disease Management Programme sowie der Anforderungen an die Module und Komponenten 13.1.3 Definition von Kriterien zur Evaluation der Programme 297 298 13.1.4.Programmentwicklung durch geeignete Institutionen, wie z.B. Krankenkassen, auf dem Boden der gesetzlichen Vorgaben 298 13.1.5 Monitoring durch eine unabhängige Institution 299 13.2 301 Akkreditierung von Disease Management Programmen 13.2.1 Kriterien der Akkreditierung 303 13.3 Reakkreditierung von Disease Managment Programmen 309 14. Literatur 313 Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 9 Fazit des Gutachtens: Im Gutachten „Disease Management in Deutschland – Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Faktoren zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation“ werden Rahmenbedingungen und Faktoren zur Implementierung von Disease Management in Deutschland untersucht. Disease Management ist ein systematischer Behandlungsansatz, der für chronisch Kranke eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung nach dem neuesten Standard der Wissenschaft organisiert. Während in der Routineversorgung auch in Deutschland weniger als die Hälfte der chronisch Kranken nach diesem Standard versorgt werden, können durch Disease Management Programme Werte von mehr als 80 % evidenzbasiert versorgter Patienten erreicht werden. Dies ist möglich, indem eingeschriebene Patienten, die Krankenkasse und die behandelnden Ärzte einen Vertrag schließen, der vorsieht, dass der wissenschaftlich gesicherte Standard das Ziel der Versorgung ist. Dieser Standard wird Ärzten und Patienten in geeigneter Form vorgelegt, z.B. durch Leitlinien und leicht verständliches und didaktisch hochwertiges Informationsmaterial. Der wissenschaftlich gesicherte Standard ist Gegenstand der Fortbildungen der teilnehmenden Ärzte und spezieller Schulungen der Patienten. Die Krankenkassen helfen aktiv bei der Verbesserung der Mitarbeit des Patienten, indem sie z.B. den Patienten an wichtige Untersuchungen oder Eigenaktivitäten erinnern, Raucherentwöhnungsprogramme anbieten oder weitergehende unabhängige Informationen zu seiner Krankheit anbieten. Durch die Einschreibung der Patienten in Disease Management Programme wird ermöglicht, dass die Versorgung chronisch Kranker sich stärker auf die Ärzte und Einrichtungen konzentriert, die über ausreichendes Erfahrungswissen verfügen und die bereit sind, sich einer solchen Behandlungsphilosophie anzuschließen. Disease Management ist ein ideales Instrument, Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Versorgung chronisch Kranker in Deutschland abzubauen. Dies führt im medizinischen Bereich zu verbesserten Outcomes und im ökonomischen Bereich zur Kostenstabilisierung, da: Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens • Seite 10 Die Einführung von Disease Management bereits kurzfristig durch den gleichzeitigen und gleichmäßigen Abbau der Über-, Unter- und Fehlversorgung zu Kosteneinsparungen führen kann. • Die Verknüpfung der Programme mit dem Risikostrukturausgleich (RSA) bereits kurzfristig eine wirtschaftliche Entlastung derjenigen Krankenkassen mit sich bringt, die einen hohen Anteil an chronisch Kranken in ihrem Patientengut aufweisen. • Die Einführung einer evidenzbasierten Therapie zur Vermeidung bzw. Verringerung von Komplikationen und Komorbiditäten führt. Dadurch werden die Krankenkassen langfristig wirtschaftlich entlastet, da die Krankenhausaufenthalte in der Summe und Länge verkürzt werden. Zusätzlich werden diejenigen Krankenkassen, die viele Diabetiker einschreiben, durch den Risikostrukturausgleich entlastet, da ihr von Krankenkassen mit überwiegend gesunden Versicherten Gelder zufließen. Gäbe es durch den Risikostrukturausgleich keinen Ausgleich zwischen Kassen mit vielen und wenigen chronisch Kranken in ihrer Versichertenstruktur, könnten die Krankenkassen die sinnvolle und ökonomisch attraktive Initiative Disease Management nicht ergreifen, weil sie neue Diabetiker durch das Programm anziehen würde. Ohne Risikostrukturausgleich hat sich Disease Management daher im wesentlichen nur in den USA weit verbreitet, weil dort kein solidarisches Wettbewerbssystem besteht, und die Krankenkassen neue Diabetiker einfach ablehnen können. Gut eingeführt, unterstützt das Disease Management die Bemühungen um eine rationale und kosteneffektive Arzneimitteltherapie und ist eine ideale Ergänzung laufender Gesetzgebungsverfahren in diesem Bereich. Durch die vermehrte Datentransparenz sowie Angeboten an Fortbildungen und Entscheidungsunterstützung an den Arzt können im Disease Management nicht wirksame Arzneimittel, teure Me-Too Präparate oder Pseudoinnovationen in ihrer Verordnungshäufigkeit zurückgedrängt werden. Für die Entwicklung der Arzneimittelkosten ist Disease Management von großer Bedeutung, da 80 % der Kosten auf nur 20 % der Versicherten zurückgehen, von denen die meisten chronisch krank sind. Um eine optimale Qualitätsverbesserung ohne Kostensteigerungen zu erreichen, sollten bei der geplanten Einführung von Disease Management Programmen im Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 11 Rahmen des Risikostrukturausgleichs die folgenden drei Punkte besonders berücksichtigt werden: 1. Disease Management stabilisiert die Kosten, wenn durch qualitätsgesicherte Programme gleichzeitig Über-, Unter- und Fehlversorgung abgebaut wird Im Gesetzesentwurf zur Reform des Risikostrukturausgleichs ist geplant, die Leistungsausgaben von Versicherten, die in Disease Management Programme eingeschrieben sind, im Risikostrukturausgleich besonders zu berücksichtigen. Daher besteht für die Krankenkassen ein starker Anreiz, die größtmögliche Anzahl von Versicherten in Disease Management Programme einzuschreiben. Eine weitgehend unkontrollierte Einschreibung in nicht qualitätsgesicherte Disease Management Programme kann jedoch u.a. zu folgenden Problemen führen: • Defizite in der Regelversorgung werden durch die Durchführung zusätzlicher Leistungen in Randbereichen kompensiert. Ein solches Vorgehen würde den Anforderungen an Disease Management nicht gerecht und folglich nicht zu den erwarteten Ergebnissen bezüglich der Verbesserung der Versorgungsqualität und Stabilisierung der Kosten in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) führen. Vielmehr würde ein Kostenschub in der Versorgung ausgelöst werden. • Durch eine Ausdehnung von Zusatz- und Service– Leistungen in Randbereichen würde einer Intensivierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung Vorschub geleistet. Zur Vermeidung dieser Problematik werden folgende Maßnahmen der Qualitätssicherung vorgeschlagen: • Alle Programme, die im Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden, sollten gleichzeitig Über-, Unter- und Fehlversorgung abbauen. Die Beschränkung eines Programms auf den selektiven Abbau von Unterversorgung sollte zum Ausschluss aus der Förderung durch den Risikostrukturausgleich führen (keine Akkreditierung). Dies ist auch ethisch gut begründbar, da Probleme der Über- und Fehlversorgung genauso gravierend sind, wie Probleme der Unterversorgung. • Die wichtigsten Versorgungsziele zum Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung sollten von den Spitzenverbänden einheitlich und gemeinsam in § 137f SGB.V definiert werden. Dabei sollten die im Gutachten des Sachverständigen- Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 12 rats für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen identifizierten Bereiche von Über-, Unter- und Fehlversorgung berücksichtigt werden. Zum späteren Zeitpunkt können auch die Beschlüsse des Koordinierungsausschusses nach § 137e zugrunde gelegt werden. Sind die wichtigsten Ziele von Über-, Unter und Fehlversorgung definiert, so hat auch das Bundesversicherungsamt (BVA) eine gute Grundlage für die Akkreditierung der Programme. Für das Gesetzliche Krankenversicherungs - System sollten einheitliche Versorgungsziele festgelegt werden. So kann verhindert werden, dass Programme zum einen eine Vielzahl an Versorgungszielen festlegen können und diese nur sehr oberflächlich angehen (z.B. Schein-Disease Management in allen Bereichen durch ein Call Center). Zum anderen soll so verhindert werden, dass Programme, die lediglich ein Ziel zum Abbau von Unter- oder Fehlversorgung in einem bestimmten Bereich definieren, aber dieses sehr intensiv verfolgen, akkreditiert werden können (beispielsweise ein Diabetes Disease Management Programm, das sich ausschließlich auf die Versorgungsverbesserung einer einzigen Begleiterkrankung wie der Polyneuropathie konzentriert). Somit soll ein Wettbewerbsvorteil von Kassen verhindert werden, die sich lediglich auf den Abbau von Unterversorgung konzentrieren oder die ein sehr weites Spektrum von Gesundheitszielen pro Krankheit sehr wenig intensiv verbessern bzw. sich auf einen sehr kleinen Ausschnitt der Verbesserung der Versorgung konzentrieren. 2. Um viele widersprüchliche Standards zu vermeiden, müssen wissenschaftliche Leitlinien ausgewählt werden Zur Verbesserung der Versorgungsqualität und der Sicherung der Kosteneffektivität ist die Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie in die Regelversorgung von größter Bedeutung. Denn hohe Folgekosten in der Versorgung chronisch Kranker werden häufig durch Leistungen verursacht, deren Wirksamkeit nicht gesichert ist. Die Versorgungsziele sollten sich dazu an deutschen oder internationalen evidenzbasierten Leitlinien orientieren. Um die Ablösung einer Situation ohne Standards durch die Schaffung multipler Standards zu vermeiden, wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens • Seite 13 Die wichtigsten, auf dem Boden von Über-, Unter- und Fehlversorgung definierten Versorgungsziele sowie die Standards zur Erreichung dieser Ziele sollten einheitlich und gemeinsam von den Spitzenverbänden festgelegt werden. Dazu können pro Krankheit drei bis vier evidenzbasierte Leitlinien durch die Spitzenverbände definiert werden, auf deren Boden die Standards festgelegt werden. Die Vorgabe von nur einer ausgewählten Leitlinie würde den Charakter einer Richtlinie tragen und dem Vorwurf der „Kochbuchmedizin“ Vorschub leisten. Würden keine Leitlinien in § 137f SGB V vorgeschlagen, würde die Gefahr bestehen, dass es zu einer Vielzahl unübersehbarer und widersprüchlicher Standards kommt. Damit könnte keine Verbesserung in der Versorgungsqualität und keine Kostenstabilisierung erreicht werden. • Um die Einschreibung ungeeigneter Patienten und damit die medikamentöse Überdosierung von Versicherten zu vermeiden, sollten von den Spitzenverbänden einheitlich und gemeinsam Einschreibekriterien für die Disease Management Programme definiert werden. Die Kriterien können deutschen bzw. internationalen evidenzbasierten Leitlinien entnommen werden. • Alle Programme, die im Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden, sollten vom Bundesversicherungsanstalt bezüglich der Einhaltung dieser Kriterien überprüft werden. 3. Die Qualitätssicherung der Programme sollte durch einen minimalen Benchmarkingdatensatz optimiert werden Ein etwa eine Seite umfassender Benchmarkingdatensatz fragt evidenzbasierte Parameter der Prozess- und Ergebnisqualität sowie Zielwerte für jeden Patienten ab, die zur Erfüllung der definierten Versorgungsziele beitragen. So wird nach der Verbesserung einiger weniger, besonders wichtiger Laborwerte gefragt, nach der Durchführung von Untersuchungen, die häufig unterlassen werden, nach Arzneimitteln, die für den eingeschriebenen Patienten besonders wichtig oder besonders problematisch sein könnten, und ob dem Patienten für ihn geeignete, qualitativ hochwertige Schulungen angeboten wurden. Der Datensatz erfüllt dabei mehrere Anforderungen gleichzeitig: Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens • Seite 14 Er wird vierteljährlich von den Krankenkassen erhoben und einmal jährlich dem Bundesversicherungssamt (BVA) mitgeteilt. • Er liefert die Daten, die es der Krankenkasse erlauben, aktiv am Disease Management teilzunehmen und Arzt und Patient mit spezifischen Angeboten (Schulungen, patientenindividuelle Therapieempfehlungen, Reminder, etc) zu unterstützen. • Da die Daten vom Arzt mitgeteilt werden, der das Formular unterschrieben hat, kann die Krankenkasse sich auf die Richtigkeit der Daten in der Regel verlassen. Daten vom Patienten selbst oder auf der Grundlage von Auswertungen elektronischer Datensätze wären zur Zeit noch nicht ausreichend zuverlässig. • Da auch der Patient die Daten unterschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit der Mitteilung „zu guter“ Werte reduziert. Der Patient trägt zum Monitoring der Daten bei. Durch die quartalsweise Erhebung des Benchmarkingdatensatzes stehen Arzt, Patient und Kasse die Daten zeitnah zur Verfügung. Damit ist ein rasches Eingreifen und die frühzeitige Korrektur von Abweichungen möglich. • Die Bögen stellen eine ausgezeichnete Grundlage zum Benchmarking der Programme dar. Durch diese Daten kann ermittelt werden, welchen Programmen es gelingt, die wichtigsten Laborwerte, Untersuchungen und Behandlungen als Parameter der Prozessqualität günstig zu beeinflussen. In den Vereinigten Staaten hat die Dokumentation eines solchen minimalen Benchmarkingdatensatzes in der Qualitätssicherung (HEDIS Programm der Managed Care Organisationen) wesentlich zur Verbesserung der Qualität der Versorgung beigetragen. • Die Bögen sind ebenfalls eine gute Grundlage für die Prüfung der Programme zum Zwecke der Akkreditierung und Reakkreditierung durch das BVA (s.u.). Auf der Grundlage der Bögen kann das BVA erkennen, ob die Patienten an dem Disease Management überhaupt teilgenommen haben und ob die wichtigsten zum Disease Management gehörenden Leistungen erbracht wurden. Dazu gehören z.B. die vereinbarten Schulungen und die vereinbarten Laboruntersuchungen und Behandlungen. Versicherte, für die keine Bögen vorliegen, sollten nach Ablauf einer definierten Frist keine Berücksichtigung im RSA-Ausgleichsverfahren finden. Nur so kann das Mitführen von „Karteileichen“ zur Abrechnungsmanipulation im RSA verhindert werden. Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens • Seite 15 Durch den Datensatz wird vermieden, dass sich das Disease Management wie oben beschrieben auf nicht evidenzbasierten Randbereiche konzentriert und zu einer Intensivierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung führt. • Auch eine effizientere Arzneimitteltherapie kann über den Benchmarkingdatensatz erreicht werden, indem beispielsweise die Therapie mit sogenannten Reservetherapeutika abgefragt und begründet werden muss. Medikamente, die nicht kosteneffektiv sind, bzw. deren Wirksamkeit nicht gesichert ist, wie z.B. Pseudoinnovationen oder Me-too Präparate könnten so in der Verordnungshäufigkeit zurückgedrängt werden und der kostenstabilisierende Effekt des Disease Management verstärkt werden. Die Richtigkeit der gemachten Angaben können die Krankenkassen in ihren Arzneimitteldaten untersuchen, die sie auf der Grundlage der Einwilligung der Patienten unter Berücksichtigung des Datenschutzes auswerten dürfen. • Der Benchmarkingdatensatz darf Kassen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch schwachen Versicherten bzw. mit einem hohen Anteil an eingeschriebenen Versicherten mit schlechten Ausgangswerten nicht benachteiligen. Daher sollte nicht der absolut erreichte Wert eines Indikators als Vergleichsbasis herangezogen werden, sondern die erreichte Verbesserung. Ist die Verbesserung das wichtigste Kriterium im Benchmarking, so besteht für Kassen mit schlechter Ausgangslage ein größeres Potenzial an erreichbaren Verbesserungen als für Kassen mit einer besseren Ausgangslage, auch wenn diese aufgrund der Versichertenstruktur schwieriger zu erreichen sein können. Mit der Einführung eines qualitätsgesicherten Disease Management in der GKV kann ein Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung bei gleichzeitiger Kostenstabilisierung geleistet werden. Wichtige Voraussetzungen für das Gelingen der Einführung sind: • Der gleichzeitige Abbau von Über- und Fehlversorgung an Stelle der alleinigen Konzentration auf den Abbau von Unterversorgung. • Die einheitliche und gemeinsame Definition von evidenzbasierten Versorgungszielen und Standards durch die Spitzenverbände. • Die Festlegung möglichst manipulationssicherer Einschreibekriterien. Disease Management in Deutschland – Fazit des Gutachtens Seite 16 Eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität der Programme kann durch ein öffentliches Benchmarking erreicht werden, das sich an den einheitlich definierten Versorgungszielen und Standards orientiert. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 17 1 Definition und Zielsetzung von Disease Management 1.1 Einführung Durch die sich verändernde demographische Entwicklung ist in Deutschland wie in anderen Industrienationen mit einer Zunahme chronischer Erkrankungen zu rechnen. Die Schätzungen zur steigenden Prävalenz des Diabetes Mellitus in Europa/ Deutschland beispielsweise liegen bei ca. 7-8% in der Erwachsenenbevölkerung [Alberti et al., 1998; Palitzsch et al., 1999; European Diabetes Policy Group, 1999]. Eigenen Erhebungen zufolge leiden in Deutschland ca. 25% aller GKV-Versicherten an einer oder mehreren der folgenden Erkrankungen: Asthma, Herzinsuffizienz, Hypertonie, Koronare Herzerkrankung, Brustkrebs sowie Z.n. Apoplex [Lauterbach et al., 2001]. Die Versorgung dieser chronisch kranken Patienten erfolgt in einem Gesundheitssystem, das durch eine sektorale Gliederung und durch die überwiegende Ausrichtung seiner Organisationsstrukturen auf die Therapie akuter Krankheitsbilder gekennzeichnet ist. Ein großer Teil der Regelversorgung chronisch Kranker wird daher von niedergelassenen (Haus-) Ärzten durchgeführt [Wagner et al., 1996], die aufgrund von Zeitdruck und Arbeitsbelastung kaum in der Lage sind, sich mit den jeweils neuesten Informationen zur Therapie der verschiedenen Erkrankungen auseinander zusetzen. Nur ein kleiner Teil der Patienten ist zusätzlich an Schwerpunktpraxen und Spezialambulanzen angebunden, obwohl Studien zufolge Spezialisten eher auf dem aktuellen Stand des Wissens sind und neue Verfahren auch rascher in die Regelversorgung umsetzen [McCulloch et al., 1998]. Werden Diabetiker von Diabetologen im Rahmen von systematischen Programmen betreut, so weisen die Patienten in der Regel bessere Ergebnisse bezüglich ihrer Diabetestherapie auf als Patienten der Regelversorgung beim Hausarzt. Unklar ist allerdings, ob die erreichten Ergebnisse der Versorgungsverbesserung nicht eher auf den systematischen Ansatz der Versorgung als auf die Betreuung durch einen Spezialisten zurückzuführen sind. So zeigten sich beispielsweise in der Betreuung von Diabetikern und Hypertonikern durch Allgemeinärzte, internistisch tätige Hausärzte und spezialisierte Internisten nur wenige Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 18 signifikante Unterschiede [Greenfield et al., 1995]. Vielmehr scheint die symptomorientierte, unsystematische Versorgung von chronisch Kranken in allen Settings mit mehr oder weniger großen Defiziten behaftet zu sein. So erhielten beispielsweise Patienten, die in der Diabetesambulanz einer großen Klinik betreut wurden eine bessere Therapie bezüglich ihres Diabetes (Augenhintergrunduntersuchung, Fußinspektion, Messung von HbA1c etc.). Bei anderen Aspekten der Versorgung, wie beispielsweise der Prävention oder Therapie einer koronaren Herzerkrankung wiesen 75% der Patienten der Spezialambulanz jedoch Defizite auf [Ho et al., 1997]. Bedingt durch die sektorale Trennung im System sowie den unsystematischen Versorgungsansatz kann Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Betreuung chronisch Kranker in Deutschland nebeneinander beobachtet werden. Eine Qualitätsverbesserung in der Versorgung von chronisch kranken Patienten mit allen Aspekten der (Sekundär)- Prävention, Therapie und Weiterbetreuung hat einen systematischen, organisierten und evidenzbasierten Ansatz in der Patientenversorgung als Voraussetzung [McCulloch et al., 1998]. Insbesondere der gleichzeitige Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung sollte dabei berücksichtigt werden, um eine Verbesserung der Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Kostenstabilisierung zu erreichen. Zusätzlich haben die steigenden Anforderungen an das Gesundheitssystem in weiten Teilen der Bevölkerung zu einer kritischeren Bewertung von Qualität, Leistung, Kosten und Transparenz des Gesundheitsversorgungsprozesses geführt. In die Diskussion geraten ist die steigende Prävalenz der chronischen Erkrankungen durch Versorgungsmängel sowie die steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Entsprechend versuchten Lösungsansätze der vergangenen Jahre in erster Linie eine wirksame Kostenkontrolle durch isolierte Ansätze zur Kostensenkung durch ausgewählte Maßnahmen in einzelnen Sektoren (Komponentenmanagement) zu erreichen [Lonsert, 1995]. Die finanziellen Erfolge des Komponentenmanagements einzelner Bereiche des sektoralen Gesundheitsversorgungsprozesses wurden jedoch durch Kostenverschiebung in andere Bereiche häufig kompensiert [Lonsert, 1995]. Die Versorgungsqualität konnte durch das Komponentenmanagement nicht positiv beeinflusst werden. Vielmehr muss immer noch davon ausgegangen werden, dass ein großer Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 19 Teil der Verfahren, die in den Gesetzlichen Krankenkassen zur Anwendung kommen, weder evidenzbasiert sind noch eine positive Kosten- Nutzen- Relation aufweisen. Durch isolierte Einzelmaßnahmen wie z.B. durch die Entwicklung von Leitlinien oder durch sektoral getrennte Budgets konnte keine wirksame Kostenstabilisierung im Gesundheitswesen erreicht werden. Vielmehr wurde eine Kostenverschiebung in andere Sektoren ausgelöst. Vor diesem Hintergrund wurde in den USA das Konzept des Disease Management als integrierter und sektorenübergreifender Ansatz entwickelt. Dazu wurden bewährte Konzepte der Gesundheitsversorgung in einen systematischen Ansatz zur Verbesserung der Versorgungsqualität mit dem Ziel der Kostensenkung oder zumindest der Kostenneutralität integriert. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen von Programmen, die durch ihre Evidenzbasierung und durch ihre Populationsbezogenheit charakterisiert sind. Solchen Programmen liegt eine Standardisierung der Behandlungsprozesse zugrunde. Ziel ist es, eine evidenzbasierte Regelversorgung zu etablieren. Dabei kommen folgende Prinzipien zur Anwendung: • Identifizierung von Bereichen mit Über-, Unter- und Fehlversorgung zum gleichzeitigen Abbau dieser Versorgungsdefizite • Definition einer angemessenen Gesundheitsversorgung (Versorgungsziele) auf dem Boden der evidenzbasierten Medizin • Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie in die Regelversorgung • Beurteilung aller Interventionen aufgrund ihres medizinischen und ökonomischen Nutzens • Abschätzung der Ressourcen auf einer populationsbezogenen Ebene • Optimierung von Versorgung und Versorgungsqualität mit den gegebenen Ressourcen • Strukturierung eines sektorenübergreifenden Behandlungsprozesses • Förderung eines patientenzentrierten Ansatzes mit regelmäßiger Evaluation der Patientenzufriedenheit Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 20 Die Standardisierung des Behandlungsprozesses soll dabei nicht zu einer standardisierten Behandlung des individuellen Patienten führen, sondern den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen die evidenzbasierten Empfehlungen an die Situation des einzelnen angepasst werden. Die Entscheidungen des Arztes sollen nicht vorweggenommen werden, sondern die Strukturierung der Information soll die Berücksichtigung aller Informationen in dem Entscheidungsfindungsprozess des Arztes auf dem Boden von evidenzbasierter Medizin, klinischer Expertise und klinischer Erfahrung fördern. Obwohl Disease Management Programme letztlich die Bündelung bewährter Konzepte darstellen, führen sie zu einem Paradigmenwechsel in mehreren Bereichen des Gesundheitsversorgungsprozesses. (1) Im Bereich der Leistungserbringer: • kommt es an Stelle der sektoralen Trennung zu einer kontinuierlichen Versorgungskette mit aufeinander abgestimmten Interventionen • werden individuelle Einzelentscheidungen eines Arztes abgelöst durch gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient bzw. von mehreren Ärzten und dem Patienten • entstehen neue Anforderungen an die Informationstechnologie, die Dokumentation und die Qualitätssicherung • kommt es zu einer Reorganisation der Versorgung chronisch Kranker und zu einer Konzentration auf eine evidenzbasierte Regelversorgung (2) Im Bereich der Leistungsinanspruchnahme: • kommt es zu mehr Transparenz, Einbindung und Verantwortung des Patienten (3) Im Bereich der Leistungsträger: • kommt es zu einem größeren Informationsbedarf und Informationsangebot • entstehen durch Datentransparenz neue Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten Solche Steuerungs- und Kontrollaufgaben im Disease Management beziehen sich im Sinne eines strategischen Prozesses immer auf die Abgleichung von Ist- und SollZustand unter Berücksichtigung des Feedbacks der Leistungserbringer aller Ebenen. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 21 1.2 Definition Im Disease Management hat die Evidenzbasierung der Instrumente eine große Bedeutung. Das heißt, dass für jedes eingesetzte Instrument nachgewiesen sein sollte, inwieweit die Erbringung der Leistung zu einer signifikanten Verbesserung in der Ergebnis- bzw. in der Prozessqualität der Gesundheitsversorgung führt. Dabei wird eine Gesamtsichtweise des Patienten und seiner Erkrankung zugrunde gelegt. Angestrebt wird nicht die Therapie unterschiedlicher Episoden einer Erkrankung, sondern die Versorgungsverbesserung einer Patientenpopulation mit einer definierten Erkrankung. Der Patient wird mit seiner Erkrankung und dem Erkrankungsverlauf als medizinische, organisatorische und ökonomische Einheit betrachtet. Im wesentlichen werden für die Koordination dieser sektoren- und krankheitsübergreifenden Betrachtung folgende Komponenten eingesetzt: (1) Eine Datenbasis zur Quantifizierung der Kostenstruktur, der Erkrankung und der Therapieoptionen [Hunter et al., 1997] (2) Evidenzbasierte Leitlinien, die innerhalb von Empfehlungskorridoren die zu erbringenden Leistungen spezifizieren. Dazu gehören die Art des Leistungserbringers (Hausarzt, Spezialist), das Umfeld (stationär, ambulant) sowie die Beschreibung des Prozesses (first- line drug, second- line drug, etc.) (3) Die Aufhebung der traditionellen Sektorengrenzen des Gesundheitsversorgungsprozesses (4) Ein Qualitätsverbesserungskonzept, das einen Prozess der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung unterstützt [Hunter et al., 1997]. Dazu gehört die Pflege der Datenbasis, der Leitlinien und die Überprüfung der Versorgungsinstitutionen und –prozesse (5) Die systematische Evaluation des Zusammenhangs zwischen Therapieoptionen und Patientenergebnissen (6) Die systematische Beeinflussung von Arzt- und Patientenverhalten) (7) Neustrukturierung von Praxisabläufen und Organisationskonzepten In der Literatur existiert keine eindeutige Definition von Disease Management. Es zeichnet sich allerdings eine Entwicklung des Begriffs ab. Sie geht von bestehenden Rahmenbedingungen aus, innerhalb derer Instrumente wie Best Practice, Leitlinien Case Management sowie die Beeinflussung der Patientencompliance und des ärztli- Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 22 chen Verschreibungsverhaltens implementiert und evaluiert werden. In weiter gefassten Definitionen werden unter dem Begriff Disease Management Programme zur Therapie definierter Erkrankungen zusammengefasst, denen in der Regel eine sektorenübergreifende Betrachtung zugrunde liegt. Disease Management wird zunehmend als ein systematischer, sektorenübergreifender Ansatz zur Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie in die Regelversorgung gesehen. Zu vermeiden ist dabei insbesondere eine Kompensation von Defiziten in der Regelversorgung durch eine Ausweitung von (nicht- evidenzbasierten) Leistungen in Randbereichen der Versorgung. Dieses Vorgehen würde den Anforderungen an Disease Management nicht gerecht und nicht zu den erwarteten Ergebnissen bezüglich der Verbesserung der Versorgungsqualität und Kosteneffektivität führen. Vielmehr würde es durch eine Ausdehnung von Zusatz und Service- Leistungen in Randbereichen bzw. bei einem selektiven Abbau von Unterversorgung zu einer gleichzeitigen Intensivierung von Über-, und Fehlversorgung kommen. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 23 Tabelle 1: Definitionen des Disease Managements Quelle Definition Neuffer 1996 Disease Management ist ein systematischer Ansatz mit dem Ziel, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und gleichzeitig qualitativ hochwertigere Ergebnisse in der Versorgung zu erzielen. Deuser 1999 Disease Management ist das populationsbezogene, prozessorientierte und sektorenübergreifende Management von Krankheitsbildern und Krankheitsverläufen. Die Ergebnisse werden mittels Outcomes Research gemessen. Hunter 1997 Disease Management ist ein strukturierter Ansatz, der den Patienten mit seiner Erkrankung und seinem Krankheitsverlauf als therapeutische Einheit betrachtet. Die drei Säulen des Disease Management sind eine Datenbasis (Krankheitskostenstruktur, Leitlinien), ein sektorenübergreifendes Gesundheitsversorgungssystem und ein kontinuierlicher Qualitätsverbesserungsprozess. Disease Management Association of America Disease Management ist ein multidisziplinärer, kontinuierlicher Ansatz in der Gesundheitsversorgung für Populationen mit definierten Erkrankungen oder mit einem Risiko bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Disease Management unterstützt die Verbesserung des Arzt/Patienten-Verhältnisses, verhindert durch Prävention die Exazerbation und die Entwicklung von Komplikationen durch evidenzbasierte, kosteneffektive Therapiestrategien und umfasst einen kontinuierlichen Evaluationsprozess medizinischer, ökonomischer und patientenzentrierter Outcomes. Luginbill, Eli Lilly, USA 1995 Disease Management ist das Maß der Ausprägung zu der Patienten, Leistungserbringer und andere Mitglieder des professionellen Systems einer rationalen Therapiestrategie folgen. [Quelle: Eigene Darstellung] Werden die genannten Definitionen und Prämissen für den Disease Management Prozess zugrunde gelegt, so lässt sich folgende Arbeitsdefinition für Disease Management in Deutschland formulieren: Disease Management ist ein systematischer, sektorenübergreifender und populationsbezogener Ansatz zur Förderung einer kontinuierlichen, evidenzbasierten Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen über alle Krankheitsstadien und Aspekte der Versorgung hinweg. Der Prozess schließt die kontinuierliche Evaluation medizinischer, ökonomischer und psychosozialer Parameter sowie eine darauf beruhende kontinuierliche Verbesserung des Versorgungsprozesses auf allen Ebenen ein. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 24 1.3 Zielsetzung von Disease Management in der GKV Die Einführung von Disease Management in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) soll der Implementierung einer systematischen, sektorenübergreifenden und evidenzbasierten Regelversorgung zur Sicherung von Versorgungsqualität und Kosteneffektivität dienen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten insbesondere die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: • Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung: Dabei sollte im Rahmen der Einführung von Disease Management in der GKV zunächst die im Gutachten des Sachverständigenrats beschriebenen Bereiche von Über-, Unter- und Fehlversorgung Berücksichtigung finden. Zu einem späteren Zeitpunkt können auch die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses nach § 137e zugrunde gelegt werden • Flächendeckende Verbesserung der Versorgungsqualität chronisch Kranker durch die Umsetzung evidenzbasierter Therapiestandards in die Regelversorgung: Dabei sollte insbesondere die Kompensation von Defiziten in der Regelversorgung durch Leistungsausweitung in Randbereichen vermieden werden. Nur durch die Umsetzung einer evidenzbasierten Regelversorgung kann eine Kostenstabilisierung erwartet werden. Kommt es statt dessen zu Leistungskonzentration in Randbereichen, so ist mit einem Kostenschub zu rechnen • Kostenstabilisierung der Versorgung: Um dies zu gewährleisten sollten alle im Risikostrukturausgleich berücksichtigten Programme gleichzeitig Über-, Unterund Fehlversorgung abbauen. Die wichtigsten Versorgungsziele zum Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung sollten dazu von den Spitzenverbänden einheitlich festgelegt werden. Programme, die sich auf einen selektiven Abbau von Unterversorgung konzentrieren, sollten durch den Risikostrukturausgleich nicht gefördert werden Zum Erreichen dieser Ziele werden folgende Maßnahmen bei der Einführung von Disease Management Programmen in der GKV vorgeschlagen: • Auswahl von Erkrankungen zur Implementierung von Disease Management und Identifizierung von krankheitsspezifischen Bereichen mit Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie Definition von einheitlichen, evidenzbasierten und kassenüber- Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 25 greifenden Versorgungszielen zum Abbau der Über-, Unter- und Fehlversorgung. Zur Identifizierung von qualitätskritischen Bereichen und bei der Festlegung von Versorgungszielen sollten die Empfehlungen des Gutachtens des Sachverständigenrats [Gutachten 2001 Band III] berücksichtigt werden. Weiterhin können die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses nach § 137e herangezogen werden • Definition einheitlicher Versorgungsziele und Standards für die ausgewählten Erkrankungen durch die Spitzenverbände: Die Versorgungsziele und Standards können auf dem Boden von drei bis vier evidenzbasierten Leitlinien pro Erkrankung von den Spitzenverbänden einheitlich und gemeinsam definiert werden • Definition von einheitlichen und gemeinsamen Einschreibekriterien durch die Spitzenverbände: Sie sollen den größtmöglichen Schutz vor Manipulation gewährleisten und gleichzeitig mit geringstmöglichen Aufwand durch den einschreibenden Arzt zu erheben sein. Die Kriterien können deutschen und internationalen evidenzbasierten Leitlinien entnommen werden • Erhebung, Weiterleitung und Auswertung der Daten im Rahmen datenschutzrechtlicher Möglichkeiten • Implementierung eines Qualitätssicherungsverfahrens mit Akkreditierung und Reakkreditierung durch ein öffentliches Benchmarkingverfahren • Definition der Benchmarkingkriterien unter Berücksichtigung der zu erreichenden Versorgungsziele. Die Benchmarkingkriterien werden im sog. Benchmarkingdatensatz zusammengefasst (Kapitel 12) • Kontrolle der Erfüllung der Einschreibekriterien und der Versorgungsziele durch das Benchmarkingverfahren. • Kontinuierliche Evaluation durch die Programmanbieter selbst (siehe Gutachten Teil II) 1.4 Beispiele im internationalen Bereich Ursprünglich wurde Disease Management in den USA entwickelt. Heute findet es u.a. in Australien, Neuseeland und Europa Anwendung. In Australien, Neuseeland und Europa sind allerdings häufig Disease Management Programme implementiert, die nicht der umfassenden Definition entsprechen, die diesem Gutachten zugrunde gelegt wird. Im europäischen Raum sind entsprechende Programme vorwiegend in Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 26 den skandinavischen Ländern entwickelt und implementiert worden. Einen Überblick über Diabetes Programme sowie ausgewählte Programme anderer Erkrankungen, die Komponenten von Disease Management anwenden, geben Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 (zur ausführlichen Beschreibung einzelner Programme siehe Kapitel Disease Management bei ausgewählten Programmen). Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 27 Tabelle 2: Beispiele für Diabetes-Programme Autor (Jahr) Programmbeschreibung (Populationsgröße, Intervention, Umfeld) Teilnehmeranzahl Dauer der Intervention Gemessene Ergebnisse Adams, Cook (1994) Häusliche Pflegedienste mit und ohne Diabetesschulung des Personals im Vergleich 45 nicht festgelegt Wissen über Diabetes und Pflegestandard des geschulten Personals war signifikant höher Baker et al. (1993) Protokollierung der Prävention und Behandlung von DiabetesFolgeerkrankungen sowie Schulungsprogramme 4300 5 Jahre Vorbeugeuntersuchungen von zahlreichen Folgeerkrankungen haben sich als kosten effektiv erwiesen Barth et al. (1990) Behandlungs- und Schulungsprogramm: Konventionelle und intensive 62 Betreuung im Vergleich 6 Monate Patienten im Intensivprogramm haben ein deutlich höheres Wissen zum diabetischen Fußsyndrom. Eine Verminderung der zu behandelnden Fälle wird beobachtet. Carlson et al. (1991) Fortlaufende medizinische Schulungskurse in Gesundheitszentren zur 806 Organisation 18 Wochen Verbesserung der Behandlungsqualität und des Self-Monitoring von Diabetes-Patienten DCCT (1993) Intensive Insulintherapie mit drei oder mehr Injektionen pro Tag (konventionell ein oder zwei pro Tag) 1441 6,5 Jahre Verminderung von Komplikationen der Retinopathie, Neuropathie und Nephropathie Glasgow et al. (1996) Computer gestützter, interaktiver Kontakt zu Diabetespatienten zum Selbstmanagement, Diätzielen und Problemlösungsstrategien; anschließend telefonischer Kontakt 206 nicht festgelegt Größere Erfolge bei der Umsetzung von Diätplänen, Senkung des Cholesterinspiegels, größere Patientenzufriedenheit Habert et al. (1999) Mailing – Reminder - System zu Vorsorgeuntersuchungen sowie Versendung von Schulungsmaterial an Patienten; Information zum Gesundheitszustand (Retinopathie) an den Patienten sowie dessen behandelnden Arzt 19523 nicht festgelegt Untersuchungsrate nach zweitem Kontakt war höher als bei einmaligem Kontakt McCabe et al. (1998) Diabetisches Fußscreening– Programm 2001 2 Jahre Vermeidung von Amputationen Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 28 Friedman et al. (1998) Lovelace: „Episodes of Care“, Diabetes Disease Management Programm, Leitlinien-basiert Bisher 5 Jahre, Programm dauert an Verbesserung medizinischer Ergebnisse, wie bessere HbA1c-Werte, erhöhte Raten an Fußinspektion und Überweisungen zum Augenarzt und Screening auf Microalbunimurie Piette et al. (2001) Telefonische Diabetiker-Betreung 272 1 Jahr Förderung des Blutzucker Selbstkontrolle, höhere Fußinspektionsraten, häufigere Kontakte zu Diabetesspezialkliniken McCulloch et al. (1998) Diabetes Disease Management Programm 15000 Programm dauert an Verbesserung medizinischer Ergebnisse wie Anzahl der zum Augenarzt überwiesenen Diabetiker, duchgeführte Fußinspektionen, Screening auf Microalbuminurie, Kontrolle des HbA1c .Kosteneinsparungen [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 29 Tabelle 3: Beispiele für Behandlungsprogramme bei Patienten mit Herzinsuffizienz Autor (Jahr) Patientenanzahl Studienstichprobe (Ort) mittleres Alter Beschreibung der Intervention Dauer der Intervention Rich (1993) 98 Patienten >70 Jahre mit Herzinsuffizienz, klinische Anzeichen deuten auf mittleres und hohes Risiko der Wiedereinweisung hin (USA) 79 Pflegepersonal- geleitete Patientenschulung, Ernährungsund Sozialberatung, ausführliche Medikamentenanamnese, intensive Nachbetreuung nach Entlassung 3 Monate Rich (1995) 282 Patienten >70 Jahre mit Herzinsuffizienz, klinische Anzeichen deuten auf hohes Risiko der Wiedereinweisung hin (USA) 79 Pflegepersonal- geleitete Patientenschulung, Ernährungsund Sozialberatung, ausführliche Medikamentenanamnese, intensive Nachbetreuung nach Entlassung 3 Monate Cline (1998) 190 Patienten 65-84 Jahre, Krankenhauseinweisung aufgrund Herzinsuffizienz (Schweden) 76 Pflegepersonal- geleitete Schulung, Patientenselbstmanagement-Leitlinien, häusliche Pflegebetreuung (falls notwendig) nach Entlassung 12 Monate Stewart (1998) 97 Patienten mit Herzinsuffizenz nach stationärer Entlassung (Australien) 75 Pflegepersonal- geleitete Schulung, Hausbesuch durch Pflege und Pharmazeut zur optimalen Medikamenteneinstellung und zur Früherkennung von Rückfällen, Compliance-Förderung bei „Risiko“patienten 1 Termin Ekman (1998) 158 Patienten mit mittelschwerer Herzinsuffizienz nach stationärer Entlassung (Schweden) 80 Pflegepersonal- geleitete Schulung, SelbstmanagementLeitlinien für Patienten, mobile Pflegeversorgung falls benötigt, häufige Telefonkontakte 6 Monate Serxner (1999) 109 Patienten nach stationärer Entlassung mit diagnostizierter Herzinsuffizienz (USA) 71 Versendung von Material zur Förderung des Patientenselbst-management, ggf. Hausbesuche 3 Monate Jaarsma (1999) 179 Patienten >50 Jahre, stationäre Aufnahme aufgrund von Herzinsuffizienz (Niederlande) 73 Pflegepersonal- geleitete Schulung, Hausbesuche nach Entlassung, telefonischer Kontakt eine Woche nach Entlassung 1 Woche Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Stewart (1999) 200 Patienten >55 Jahre, stationäre Aufnahme aufgrund von Herzinsuffizienz (Australien) Naylor (1999) 363 Patienten >65 Jahre mit entweder koronarer (davon Herzerkrankung oder Herzinsuffizienz (USA) 108 mit Herzinsuf fizienz) [Quelle: Mc Allister et al., 2001] Seite 30 76 Pflegepersonal-geleitete Schulung, Kur-Beratung, Hausbesuch 7-14 Tage nach Entlassung und Beurteilung zu einer evtl. neuen Medikamenteneinstellung laut Verordnung, telefonischer Kontakt nach 3 und 6 Monaten 6 Monate 75 Pflegepersonal- geleitete Schulung, Koordination der häuslichen Versorgung, mindestens 2 Hausbesuche, Verwendung eines standardisierten Protokolls zur Optimierung der Medikation, wöchentlicher telefonischer Kontakt für 1 Monat 1 Monat Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 31 Tabelle 4: Multidisziplinäres Management der Herzinsuffizienz - Beispielprogramme Ergebnisse Patientenalter 61% weniger Einweisungen, 85% weniger KrankenhausAufenthaltstage, Kostensenkung: $8000/pt/jr1 mittleres Alter: 65 62% weniger Einweisungen, 72% weniger Einweisungen mit kardiologischen Ursachen, verbesserte Leistungsfähigkeit in der Bewältigung alltäglicher Aufgaben mittleres Alter: 78 6 Monate 14% weniger Einweisungen, 22% kürzere stationäre Aufenthaltsdauer, geringere Krankenhauskosten: $ 500/pt mittleres Alter: 65 im Mittel 138 Tage 74% weniger Einweisungen, 87% weniger Einweisungen aufgrund von Herzinsuffizienz, Verbesserung der Lebensqualität, der körperlichen Fitness, der Compliance mittleres Alter: 66 Umfassende Versorgung durch spezielles Herzinsuffizienz/ Transplantationsteam 6 Monate 44% weniger Einweisungen, verbesserte Einteilung nach NYHAKlassifizierung2, verbesserte körperliche Fitness, geringere Kosteneinsparungen: $ 9800/pt mittleres Alter: 52 134 Umfassende Versorgung durch spezielles Herzinsuffizienz/ Transplantationsteam 30 Tage bis zu 1 Jahr 53% weniger Einweisungen mit kardiologischen Ursachen, 69% weniger Einweisungen mit Ursache Herzinsuffizienz mittleres Alter: 52 Jahre Smith (1998) 21 Spezialambulanz/ -sprechstunde mit Fachpflegepersonal und Kardiologen 6 Monate 87% weniger Einweisungen mit Herzinsuffizienz als Ursache, Verbesserung der NYHA-Klasse, der Lebensqualität, der körperlichen Fitness mittleres Alter: 61 Shah (1998) 27 Brieflicher Kontakt und Fernüberwachung durch Pflegepersonal nach ärztlicher Absprache im Mittel 8,5 Monate 50% weniger Einweisungen, 67% weniger Einweisungen mit Herzinsuffizienz als Ursache, 92% weniger Krankenhausaufenthaltstage mittleres Alter: 62 Autor (Jahr) PatientenIntervention anzahl Cintron (1983) 15 Kornowski (1995) 42 Lasater (1996) 80 West (1997) 51 Fonarow (1997) 214 Hanumanthu (1997) Dauer Ambulante Betreuung durch 24 Monate Krankeitskoordinator mit möglicher ärztlicher Konsultation Häusliche Betreuung durch Internisten 12 Monate und medizinisches Assistenzpersonal Ambulante Betreuung durch Krankheitskoordinator mit ärztlicher Unterstützung Häusliche Pflege unter ärztlicher Aufsicht Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 32 Dennis (1996) 24 Häusliche Betreuung 12 Monate Häufigkeit und Intensität der Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen ist rückläufig keine Altersangaben Martens (1997) 924 Häusliche Betreuung 90 Tage 36% weniger Inanspruchnahme von häuslichen Pflegedienstleistungen mittleres Alter: 71 [Quelle: Rich, 1999] 1 2 pt = Patient; jr = Jahr NYHA – Klassifizierung = Einteilung der klinischen Symptomatik einer Herzinsuffizienz Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 33 1.5 Status Quo und gesetzliche Rahmenbedingungen in Deutschland Sogenannte klassische Disease Management Programme im Sinne der im Gutachten verwendeten Definition finden sich in Deutschland zur Zeit noch nicht. Die Anbieter implementieren bisher meistens nur ausgewählte Teile eines Disease Management. Informationen zu bereits existierenden Disease Management Programmen weisen in Deutschland derzeit noch eine geringe Transparenz auf, das Datenaufkommen sowie das Datenmanagement in den Projekten ist im Regelfall gering. Eine kontinuierliche Evaluation wird nur selten durchgeführt und wissenschaftliche Ergebnisse über bereits verwirklichte Projekte liegen nur vereinzelt vor. Die künftige Entwicklung des Disease Managements wird unter anderem von den Entscheidungen des Gesetzgebers zur Qualitätssicherung und Auswahl der Erkrankungen sowie zu den Vorgaben der Ausgestaltung der Programme innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung geprägt werden (siehe Kapitel Qualitätssicherung). Insbesondere wird dadurch festgelegt werden, ob es durch das Disease Management zu einer Intensivierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung durch Leistungsausweitung in Randbereichen kommt, oder ob es gelingt, durch die Konzentration auf eine evidenzbasierte Regelversorgung Qualität und Kosten- Effektivität der Versorgung zu erreichen und langfristig zu gewährleisten. Der Wettbewerb unter den Kassen wird auch außerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Dies bestätigen auch Entwicklungen in den USA. Dort etablieren sich Disease Management Programme weitgehend ohne regulatorische Eingriffe des Gesetzgebers oder anderer Institutionen in einem zunehmenden Markt des Gesundheitswesens. Allerdings kann dort von den Versicherern bis zu einem gewissen Ausmaß Risikoselektion betrieben werden. Bisher sind in Deutschland nur ausgewählte Teile von Disease Management im Rahmen von Strukturverträgen und Modellprojekten implementiert worden. „Klassische“ Disease Management Programme im Sinne der Definition des Gutachtens finden sich in Deutschland bisher noch nicht. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Status Quo von Disease Management Ansätzen in Deutschland gegeben. Diskutiert werden die gesetzlichen und so- Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 34 zialpolitischen Rahmenbedingungen sowie bereits bestehende Programme, deren Erfahrungen bei der Einführung von Disease Management in Deutschland berücksichtigt werden können. 1.5.1 Gesetzliche Krankenversicherung In der Gesetzlichen Krankenversicherung ist die Einführung von Disease Management Programmen im Zusammenhang mit einer Reform des Risikostrukturausgleichs vom Gesetzgeber vorgesehen. Ordnungspolitisch sollen die zukünftigen Disease Management Programme mit dem Risikostrukturausgleich verknüpft werden, indem die durchschnittlichen Kosten der in Disease Management Programme eingeschriebenen chronisch Kranken im Rahmen des Risikostrukturausgleichs gesondert berücksichtig werden. Daher sollten durch den Gesetzgeber hohe Anforderungen bezüglich Qualitätssicherung, Kosten- Effektivität und Akkreditierung an die Programme gestellt werden. Der Wettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung soll sich auf die Implementierung von Disease Management Programmen mit hohen, gesetzlich vorgegebenen Standards konzentrieren und die Versorgungsqualität chronisch Kranker so verbessert werden. Gleichzeitig soll durch die Erstattung der durchschnittlichen Kosten für chronisch Kranke, die in Disease Management Programme eingeschrieben sind, die Risikoselektion junger und gesunder Versicherte an Attraktivität verlieren. Die gesetzlichen Krankenkassen befinden sich somit in einer Phase der strategischen (Neu-) Positionierung im Gesundheitswesen. Mit dem 1. und 2. GKV–NOG (Neuordnungsgesetz) hat der Gesetzgeber sukzessive den Gestaltungsspielraum für neue Versorgungsmodelle erweitert (Tabelle 5) und bereits wichtige vertragliche Voraussetzungen für Disease Management in Deutschland geschaffen. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 35 Tabelle 5: Neue Versorgungsmodelle Entwicklung der gesetzlichen Basis Modellvorhaben §§ 63 – 65 SGB V Strukturverträge §73a SGB V Vor 1997 Beschränkt auf definierte Maßnahmen (Erprobung neuer Verfahren, Kostenerstattung, Beitragsrückzahlung u.a.) 1. und 2. NOG ab Juli 1997 Neue Modelle in den Bereichen Finanzierung, Organisation und Vergütung möglich (u.a.) Evaluationspflicht Abweichung von SGB V und KHG in bestimmten Teilbereichen möglich Einsparungen können direkt an die Versicherten weitergegeben werden Gesundheitsreformgesetz 2000 Keine Änderung Direktverträge mit Vertragsärzten möglich Einfluss der KV auf Benehmensregelung reduziert Integrierte Versorgung §§140a – h SGB V Im Rahmen eines Sektorenübergreifende Versorgungsmodelle Gesamtvertrags mit der sind in der Regelversorgung möglich KV (Strukturvertrag) sind andere Versorgungs- und Vergütungsstrukturen möglich §§ 137 f-g SGB V, u.a. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 36 Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der Gesetzlichen Krankenversicherung [Quelle: Modifiziert nach Einführung eines Disease Management Modells am Beispiel Diabetes AOK-BV] Definition von für Disease Management geeigneten Erkankungen, Beschreibung der Anforderungen an die Programme, Verpflichtung zur Qualitätssicherung und Evaluation Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 37 Die bis 1997 bestehende Regelung für Modellvorhaben erlaubte nur klar definierte und abgegrenzte Maßnahmen der Umsetzung. Für die Leistungserbringer bestand im Rahmen des alten § 63 SGB V die Möglichkeit der Erprobung neuer Leistungen, Maßnahmen und Verfahren. Für die Kostenträger beschränkten sich die Möglichkeiten auf Kostenerstattung und Beitragsrückzahlung. Erst mit dem 2. Neuordnungsgesetz (NOG) ab Juli 1997 wurden die Voraussetzungen für neue Modelle in den Bereichen Organisation, Finanzierung und Vergütung geschaffen. Damit wurde den Kassen zum ersten Mal die Möglichkeit eingeräumt, mit unterschiedlichen Gruppen von Leistungserbringern direkte Verträge abzuschließen. Im Bereich der niedergelassenen Ärzte musste weiterhin die Kassenärztliche Vereinigung mit einbezogen werden. Mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 (GRG 2000) ist die Möglichkeit der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entfallen, Modellvorhaben an ihrem Veto scheitern zu lassen. Es ist für die Kassen jetzt möglich, Modellvorhaben (mit dem Benehmen der Kassenärztlichen Vereinigung) direkt mit den Vertragsärzten abzuschließen. Zusätzlich wurden vom Gesetzgeber durch die Strukturverträge weitere Möglichkeiten zur Ausgestaltung neuer Versorgungsformen geschaffen. Im Rahmen der Strukturverträge nach § 73a SGB V können im Einvernehmen zwischen Kasse und Kassenärztlicher Vereinigung für Arztgruppen neue Versorgungs- und Vergütungsstrukturen sowie die Übernahme von Budgetverantwortung vereinbart werden. Sie beschränken sich allerdings auf den vertragsärztlichen Bereich. Eine sektorenübergreifende Regelung ist nicht vorgesehen. Sektorenübergreifende Verträge zwischen Leistungserbringern unterschiedlicher Sektoren werden durch § 140a–h SGB V möglich. Sie können aber auch als Grundlage für weitergehende Regelungen wie die Übernahme von Budgetverantwortung durch die Leistungserbringer herangezogen werden. Damit ist es durch die Regelungen zur Integrierten Versorgung möglich, dass Leistungserbringer eine Steuerungsund Integrationsfunktion in sektorenübergreifenden Versorgungskonzepten übernehmen. In der Folge kommt es zu einer teilweisen Übernahme des Morbiditätsrisikos durch die Leistungserbringer. In Tabelle 6 sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für neue Versorgungsmodelle gegenübergestellt. Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 38 Tabelle 6: Sozialpolitische Rahmenbedingungen für neue Versorgungsmodelle in der Gesetzlichen Krankenversicherung Modellvorhaben §§ 63 - 65 SGB V Strukturverträge § 73a SGB V Integrierte Versorgung § 140a - h SGB V Vertragspartner der Krankenkasse bzw. Spitzenverbandes Direkter Vertragsabschluss mit einzelnen Leistungserbringern oder mit Gruppen von Leistungserbringern möglich KVen KVen, Gemeinschaften von Vertragsärzten/ Zahnärzten, sonstige Leistungserbringer oder Gemeinschaften dieser Leistungserbringer, Träger zugelasssener Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehaeinrichtungen Rolle der KV Kann als Vertragspartner einbezogen werden Muss Vertragspartner sein Kann als Vertragspartner und/ oder Berater einbezogen werden Sektoren Alle Hausarzt oder Netze von Hausärzten und Spezialisten Alle Evaluation Pflicht Nein Kann erfolgen (Dokumentation ist aber Pflicht) Rahmenvereinbarungen Können vereinbart werden Können vereinbart werden Müssen mit KBV vereinbart werden; können mit DKG und anderen Spitzenorganisationen vereinbart werden Budgetbereinigung Außerhalb der Gesamtvergütung: Bereinigung entsprechend der Zahl und Risikostruktur der am Modell teilnehmenden Versicherten Budgetvereinbarung möglich, Bereinigung nicht geregelt Regelungen zur Vergütung und Bereinigung in Rahmenvereinbarungen festzulegen. Dabei sind Zahl und Risikostruktur der teilnehmenden Versicherten sowie ergänzende Morbiditätskriterien zu berücksichtigen Bonus Ist möglich in Höhe der erzielten Einsparungen Ist nicht ausgeschlossen Ist möglich, wenn Versicherte die Teilnahmebedingungen mindestens ein Jahr eingehalten haben und die Versorgungsform Einsparungen erbracht hat [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 39 Mit dem geplanten Gesetz zur Änderung des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung ist die gezielte Förderung von Disease Management Programmen sowie die Berücksichtigung erhöhter standardisierter Leistungsausgaben im Risikostrukturausgleich für Versicherte in akkreditierten Programmen gesetzlich verankert worden. Damit hat der Gesetzgeber einen starken Anreiz zur Ausschöpfung der erweiterten Rahmenbedingungen zur Etablierung einer sektorenübergreifenden, evidenzbasierten Versorgung gesetzt. Momentan werden auf Basis der derzeitigen Gesetzgebung verschiedene Modellprojekte (§ 63 ff SBG V) und Strukturverträge (§ 73a SGB V) insbesondere für die Erkrankung Diabetes verwirklicht. Eine Auswahl von Projekten und Modellversuchen auf Grundlage der derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind in Tabelle 7–9 zusammengestellt. Tabelle 7: Modellvorhaben innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung (Stand: Juli 2001) Projektbezeichnung Rechtsgrundlage Vereinbarung zur Steigerung der § 63 SGB V (alt) Leistungsfähigkeit der hausärztlichen Versorgung (Hausarzt- Modell) Medizinische § 73a SGB V (alt) Qualitätsgemeinschaft Ried Praxisnetz Berliner Ärzte und § 63 SGB V (neu) Betriebskrankenkassen/ Techniker Krankenkasse Modell Qualität und Humanität § 63 SGB V (alt) Medizinische Qualitätsgemeinschaft Modell Herdecke Modellvorhaben über die Weiterentwicklung der Verfahrens-, Organisations-, Finanzierungs- und Vergütungsformen stationsersetzender ambulanter Operationen Modellvorhaben zur Akupunktur § 63 SGB V [Quelle: Eigene Darstellung] Vertragspartner Laufzeit AOK Hessen, KV Hessen 01.01.97 30.06.98 VdAK / AEV, KV Hessen BKK LV OST, TK, KV Berlin AOK Baden – Württemberg, KV Südbaden VdAK-LV, KV Westfalen Lippe § 63 SGB V IKK-LV Nord, KV MV § 63 SGB V AOK MV, KV MV 01.01.97 31.03.99 01.01.96 31.12.05, Änderung vom 31.10.97 Bis 31.12.97, verlängert bis 31.12.98 Seit 02.02.00 01.01.01 31.12.03 Disease Management in Deutschland – Definition und Zielsetzung Seite 40 Tabelle 8: Strukturverträge innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung (Stand: Juli 2001) Projektbezeichnung Rechtsgrundlage Vertragspartner Laufzeit Medizinische Qualitätsgemeinschaft Dresden Nord § 73a SGB V VdAK, KV Sachsen 01.07.98 01.07.01 Strukturvertrag zur Verbesserung § 73 a SGB V der medizinischen Versorgung der Versicherten der AOK Rheinland und zur Förderung der Struktur der ambulanten ärztlichen Versorgung Rahmenvertrag zum Aufbau § 73 a SGB V vernetzter Praxisstrukturen AOK Rheinland, KV Nordrhein Seit 01.07.98, unbefristet mit Kündigungsmöglichkeit ab 31.12.1999 § 73 a SGB V BKK LV Hessen (BKK Seit 01.10.98, Opel in Rüsselsheim), KV unbefristet mit Hessen Kündigungsmöglichkeit ab 31.12.1999 BKK LV Bayern, KV Seit 24.11.98, Bayern unbefristet mit Kündigungs-möglichkeit ab 31.12.01 AOK Schleswig-Holstein, KV Schleswig-Holstein BKK LV Bayern, KV 01.10.99, Bayern ursprünglich für 8 Jahre festgelegt, TK, BEK, KV Bayern gescheitert und aufgelöst am 30.06.01 BKK-LV Bayern, AOK 15.10.97, seit Bayern, KV Bayern 03/99 Vertrag mit BKK VdAK/AEV, KV Nordrhein § 73 a SGB V BKK-LV Ost, KV Berlin 01.07.98 31.12.98 VdAK, KV Berlin 01.01.98 30.06.98 Rahmenvereinbarung zum Aufbau vernetzter Praxisstrukturen § 73 a SGB V Praxisnetze Schleswig Holstein § 73 a SGB V Medizinisches Qualitätsnetz München (MQM) § 73 a SGB V nach: § 63 SGB V Praxisnetz Nürnberg Nord (PNN) § 73 a SGB V Förderung ambulanter Operationen in der vertragsärztlichen Versorgung Strukturvertrag zur Förderung ausgewählter Krankenhausersetzender ambulanter Operationen mit Protokollnotizen [Quelle: Eigene Darstellung] Seite 41 Tabelle 9: Indikationsspezifische Modellversuche innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung (Stand: Juli 2001) Projektbezeichnung Rechtsgrundlage Vertragspartner Förderung der Kooperation zwischen diabetologischen Schwerpunktpraxen § 63 ff SGB BE, KV Westfalen Lippe Focus Diabeticus Intensivierung der interdisziplinären Kooperation von Vertragsärzten in der ambulanten Versorgung von Diabetikern Vereinbarung über eine abgestufte, flächendeckende ambulante Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus Vereinbarung über eine strukturierte und qualitätsgesicherte ambulante Versorgung von Patienten mit Diabetes Mellitus "Oldenburger Herzpass" Diabetes Gesundheitsmanagement im Rahmen eines Modellvorhabens Modellvorhaben für eine abgestufte, flächendeckende Versorgung mit Kataraktoperationen [Quelle: eigene Darstellung] seit 01.10.2000: § 73 a SGB V §§ 63.1, 64.1 SGB V § 73 a SGB V Laufzeit 01.07.98 31.12.99, Verlängerung bis 2006 möglich BKK Bayer, KV Nordrhein 01.01.98 31.12.99 BKK LV NW, KV 01.01.98, Nordrhein unbefristet § 63.1, § 64 SGB V AOK BW, KV Südwürttemberg 01.10.98 – 30.09.2006 § 63 ff SGB V AOK Thüringen, KV Thüringen 01.04.98 31.03.01, mit Verlängerungsoption § 73a SGB V AOK Niedersachsen, KV Niedersachsen AOK MV, KV MV Seit 02/2002 § 63 SGB V § 63 ff SGB V Seit 01.04 2000 VdAK/AEV, KV Nordrhein, VoP Derzeitige Modellprojekte in der Diabetesversorgung – nur Teile eines qualitätsgesicherten Disease Management verwirklicht Um die Diabetesversorgung in Deutschland zu verbessern, wurden in den letzten Jahren zahlreiche regionale Diabetesvereinbarungen zwischen den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen in Form von Strukturverträgen (§ 73a SGB V) oder Modellvorhaben (§ 63 SGB V) abgeschlossen. Ziel dieser Verträge ist es, durch eine qualitätsgesicherte, interdisziplinäre und integrative Versorgungsverbesserung von Diabetikern die Ziele der St. Vincent Deklaration zukünftig zu erreichen. Die derzeitigen Strukturverträge und Modellprojekte zur Diabetikerversorgung werden von den Vertragspartnern bereits als erfolgreiche Disease Management Programme bezeichnet [Gerst, 2001]. Diese Modellprojekte stellen keine solche Programme nach der anfangs festgelegten Definition eines Disease Management dar. Seite 42 Bisher implementieren diese Modellprojekte nur einzelne Komponenten eines Disease Management Programms. Anhand der drei Generationen von Diabetesverträgen (Tabelle 10) lassen sich die kritischen Bereiche der bisher regional begrenzten Modellprojekte darstellen. Tabelle 10: Drei Generationen von Diabetesverträgen Versorgungsansatz Beispiele 1. Generation Zentralisierte Diabetiker – Versorgung in diabetologischen Schwerpunktpraxen AOK Brandenburg und Sachsen 1993 2. Generation Strukturierte Kooperation in der vertragsärztlichen Versorgung über definierte Versorgungsaufträge für den Hausarzt und der diabetologischen Schwerpunktpraxis AOK Thüringen und Südwürtemberg 1998 BEK im Gebiet Westfalen-Lippe 1998 BKK Nordrhein 1998 3. Generation Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung mit Hilfe sektorenübergreifender Budgets und Entgeltsystematiken AOK Sachsen-Anhalt und Thüringen 2000 [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AOK Bundesverband] Die erste Generation von Diabetesvereinbarungen führte zu einer zentralisierten Diabetikerversorgung in diabetologischen Schwerpunktpraxen. Mit dieser Vorgehensweise konnten die versorgungspolitischen Ziele einer flächendeckenden Qualitätsverbesserung in der Diabetikerversorgung nicht erreicht werden. Ursachen dafür sind: • Fehlende vertragliche Einbindung der Hausärzteschaft • Unzureichende Kooperation zwischen Hausärzten und diabetologischen Schwerpunktpraxen • Einsatz von Diagnose- und Therapiemaßnahmen losgelöst vom individuellen Krankheitsbild des einzelnen Patienten • Fehlende Qualitätssicherung • Rein quantitative und keine qualitätsgekoppelten Vergütungsanreize • Die angestrebte Versorgungsverbesserung sollte durch die Definition von Schnittstellen und Überweisungsroutinen erreicht werden ohne gezielte Implementierung einer evidenzbasierten Therapie in der Regelversorgung Seite 43 Patienten wurden unter diesen Vereinbarungen von ihren Hausärzten vermehrt unter Umgehung der Schwerpunktpraxis in Krankenhäuser eingewiesen, um Abwanderungen der Patienten zu den Schwerpunktpraxen zu verhindern. Vorhandene Versorgungsdefizite verfestigten sich dadurch, dass Therapiemaßnahmen nicht systematisch und individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt erfolgten. Die Verträge der ersten Generationen führten schließlich zu einer dauerhaften Konzentration einer hochwertig versorgten aber sehr geringen Patientenzahl in der Schwerpunktpraxis [AOK Bundesverband]. In den Diabetesverträgen der 2. Generation wird über definierte Versorgungsaufträge für den Hausarzt und die Schwerpunktpraxis eine strukturierte Kooperation in der vertragsärztlichen Versorgung angestrebt. Für Diabetes bezogene medizinische Parameter werden Behandlungskorridore definiert, die Überweisungen vom Hausarzt zur Schwerpunktpraxis sowie die Rücküberweisung zum Hausarzt vertraglich festlegen. Eine regelmäßige vollständige standardisierte Dokumentation ist mit der Honorierung des Arztes verbunden. Erste Evaluationen dieser Modellprojekte ergaben jedoch: • Vorgeschriebene Überweisungen an andere Versorgungsebenen wurden ohne Angabe von Gründen nicht durchgeführt • Wichtige medizinische Zielwerte, wie z.B. die Zielblutdruckwerte wurden häufig nicht erreicht • Eine regelmäßige Dokumentation bezüglich des Diabetes fand nur bei einer Minderheit der Patienten statt Aus diesen Gründen sollten die derzeitigen Modellprojekte bei einer Weiterführung als Disease Management Programme daher entsprechend den Empfehlungen des Gutachtens ergänzt bzw. neu strukturiert werden: 1. Standardisierung durch evidenzbasierte Leitlinien Ziel des Disease Management ist es, evidenzbasierte Therapieinhalte flächendeckend einzuführen und eine systematische Verbreitung und Anwendung evidenzbasierter medizinischer Leitlinien zu erreichen. In den Modellprojekten zur Diabetesversorgung findet der vertraglich festgelegte Einsatz von evidenzbasierten Leitlinien nicht statt. Leitlinien werden von den Vertrags- Seite 44 partnern nicht zur Verfügung gestellt. Ebensowenig werden Patientenleitlinien und individuellen Patiententherapieempfehlungen verwendet. Vielmehr steht das "opinion-based" - Management des einzelnen Patienten durch den Arzt im Vordergrund. 2. Regelmäßige Evaluation Für die Strukturverträge nach § 73a SGB V ist keine Evaluation vorgeschrieben. Ohne eine Evaluation der Prozess- und Ergebnisqualität kann keine systematische Qualitätsverbesserung der Versorgung erzielt werden, denn Problembereiche und Fehlentwicklungen werden nicht frühzeitig erkannt, so dass im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses rechtzeitig steuernd eingegriffen werden könnte. Für ein Disease Management Programm sollte bereits für eine Akkreditierung ein Evaluationskonzepte für eine spätere Evaluierung des Programms vorgelegt werden. 3. Transparenz durch Benchmarking Der größte Anreiz zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung geht von der Veröffentlichung der Programmergebnisse aus [HEDIS; http://www.ncqa.org]. Bei den Strukturverträgen und Modellvorhaben ist ein derartiges Benchmarking nicht vorgesehen. Der Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen bemängelt, dass derartige Modellprojekte häufig nur zur Profilierung einzelner Kassen dienen und aus Wettbewerbsgründen die von den einzelnen regionalen Vertragspartnern gewonnenen Erkenntnisse zur Versorgungsverbesserung entweder überhaupt nicht oder nur verzögert bzw. partiell transparent gemacht werden [SachverständigenratGutachten 2000/2001, Band III]. 4. Definition von Implementierungsstrategien Durch gezielte Implementierungsstrategien lässt sich die Anwendung von Leitlinienempfehlungen deutlich verbessern. Dazu gehören beispielsweise der systematische Einsatz von spezifischen Remindern und gezielten Patienten- und Ärzteinformationen, interaktive Fortbildungen, Entscheidungsunterstützung (siehe auch Kapitel 3 bis 9). In den Strukturverträgen bzw. Modellvorhaben ist eine systematische Anwendung von Implementierungsstrategien nicht vorgesehen. Seite 45 5. Dokumentation mit Rückmeldung der Ergebnisse Grundlage für ein Disease Management ist die Möglichkeit einer unverschlüsselten, d.h. patienten- und arztbezogenen Dokumentation und Datenweiterleitung von krankheitsspezifischen Prozess- und Ergebnisindikatoren an eine zentrale Koordinierungsstelle, wie z.B. dem Programmanbieter. Nur wenn patientenspezifische Daten zur Verfügung stehen, kann systematisch und zielgerichtet individuell unterstützend und steuernd in den Versorgungsprozess eingegriffen werden und entsprechende Reminder und gezielte Informationen zur Verfügung gestellt werden. In den Modellprojekten erfolgt die Dokumentation und Datenweitergabe an die Kostenträger weiterhin pseudonymisiert. Damit ist keine strukturierte und patientenindividuelle Unterstützung zur systematischen Qualitätsverbesserung der chronisch Kranken möglich. In den derzeitigen Modellprojekten fehlen wesentliche Komponenten eines qualitätsgesicherten Disease Management. Daher besteht bei ihnen die Gefahr eines „Schein“- Disease Management, mit dem die bestehende defizitäre Versorgung bei chronischen Erkrankungen, die durch ein Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung geprägt ist, eher intensiviert und um bislang nicht erstattungsfähige wirkungslose Leistungen ergänzt wird. Eine systematische flächendeckende Qualitätsverbesserung in den Kernbereichen der Versorgung chronisch Kranker kann von den derzeitigen regional begrenzten Modellprojekten nicht erwartet werden. 1.5.2 Private Krankenversicherung In der Privaten Krankenversicherung hat das Thema Disease Management seit kurzer Zeit eine wichtige strategische Dimension. Immer mehr private Krankenversicherungsträger räumen dem Disease Management oberste Priorität ein. Durch die Einführung von Disease Management Programmen für ihre Vollversicherten möchte man möglichst als "early adopter" Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Konkurrenten aufbauen. Begünstigt und beschleunigt wird diese Entwicklung auf dem Markt für Privatversicherte dadurch, dass der Markt im Grunde genommen von der Gesetzgebungsentwicklung zur Einführung von Disease Management Programmen unabhängig ist. Die z.Zt. intensiv in der Gesetzlichen Krankenversicherung geführten aktuellen gesundheitspolitischen Diskussionen und die damit verbundenen Unsicherheiten berühren die Private Krankenversicherung weit weniger. Auch gibt es nicht das Prob- Seite 46 lem der negativen Risikoselektion, d.h., dass Private Krankenversicherer mit guten Programmen für chronisch Kranke kein Wettbewerbsnachteil durch die Attrahierung weiterer chronisch Kranker haben. Im Gegensatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung kann eine private Krankenversicherung bereits chronisch Erkrankte als Versicherte ablehnen oder risikoäquivalente Prämien verlangen. So kann sich die Private Krankenversicherung auf die strategische Bedeutung des Disease Management für die eigene Unternehmensentwicklung konzentrieren. Eigene Abteilungen für Gesundheitsmanagement haben daher mittlerweile fast alle privaten Krankenversicherungsunternehmen geschaffen. Trotzdem steht auch in der Privaten Krankenversicherung die Einführung von Disease Management Programmen noch am Anfang. Von den 52 Privatversicherungsunternehmen in Deutschland bieten nach den Erkenntnissen der Autoren bisher nur fünf Versicherungen Disease Management an (Stand Juli 01). Einen Überblick gibt Tabelle 11. An erster Stelle stehen auch hier Programme für Diabetes und Asthma. Die meisten der Krankenversicherer haben jedoch bereits einzelne Komponenten eines Disease Management wie z.B. sogenannte Telefonberatungen in Form von Hotlines oder Telemanagement implementiert, die jeweils in Kooperation mit kommerziellen Gesundheits- dienstleistern durchgeführt werden. Da es sich auch in der Privaten Krankenversicherung bei den derzeit angebotenen Disease Management Programmen meist noch um Pilotversuche handelt, liegen Evaluationsdaten bisher nicht vor. Tabelle 11: Angebote von Disease Management Programmen in der Privaten Kran kenversicherung in Deutschland Krankenversicherer Disease Management Programm Vereinte Krankenversicherung Diabetes, Asthma, Innovacare GmbH, Universität München Mannheimer Krankenversicherung Diabetes n. b. Hanse Merkur Diabetes GesundheitScout24 Winterthur Krankenversicherung Diabetes, Asthma Medvantis GmbH DKV Diabetes n. b. Deutscher Ring Krankenversicherung Diabetes n. b. [Quelle: Eigene Darstellung] Kooperationspartner Seite 47 Die Vereinte Krankenversicherung spielte eine Vorreiterrolle in der Privaten Krankenversicherung bei der Einführung von Disease Management Programmen. 1997 legte sie als erste Private Krankenversicherung ein Programm für Asthmakranke auf, welches anfänglich als regionales Projekt in Bayern startete, aufgrund der Ergebnisse und des Erfolges aber seit 1999 bundesweit angeboten wird. Die Vereinte führte das Programm in Kooperation mit dem Gesundheitsdienstleister Innovacare (München) durch, die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch die Universität München. 300 Patienten wurden in das Programm aufgenommen. Ziel war es, Asthmaanfälle frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu behandeln, die Schwere und Häufigkeit von Atemnotzuständen und Hustenattacken zu reduzieren, die Hilfsmittel Compliance sowie die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. In den Inhalten des Programms setzte man v.a. auf individuelle persönliche Betreuung der Patienten. Eine gebührenfreie europaweite Hotline mit asthmageschulten Mitarbeitern wurde eingerichtet. Der behandelnde Arzt wurde im aktiven Dialog mit einbezogen, die Behandlung mit ihm abgestimmt. Als Ergebnis konnten Asthmaanfälle mit akuter Atemnot um 58 %, asthmabedingte Arbeitsunterbrechungen um 30 % reduziert werden. Kurzfristige Krankenhausaufenthalte (unter 20 Tagen) gingen um 80 %, längere und kürzere Krankenhausaufenthalte zusammen um 62 % zurück, während sie in der Vergleichsgruppe sogar angestiegen sind [O.V., Ärzte Zeitung - Online vom 26.02.2001]. Basierend auf einer Patientenbefragung der Programmteilnehmer stieg die Lebensqualität um 10 % an. Ebenfalls konnte die Hilfsmittel - Compliance der Patienten erhöht werden. So besasen (basierend auf Teilnehmerbefragungen) zu Beginn an die Hälfte der Patienten ein Peak- Flow- Meter, aber nur jeder zweite von diesen benutzte es auch. Am Ende maßen ca. 75 % der Teilnehmer regelmäßig ihren Peak– Flow Wert. Genauso wurde ein Asthmatagebuch anfänglich nur von 8 % der Teilnehmer geführt, am Ende führten es ca. 85 % [Schaumburg et al., 1999]. Im Sommer 2000 startete die Vereinte Krankenversicherung basierend auf dem PROSIT - Projekt in Bayern ein zunächst für zwei Jahre geplantes Diabetes - Modellprojekt zur integrierten Versorgung [http://www.prosit.de]. Ziel ist es, neben der Kostenwirksamkeit die Optimierung der Diabetesbehandlung und die Lebensqualität der Diabetespatienten zu verbessern, aber auch die Eigenverantwortung der Patienten zu stärken. Dabei steht in diesem Modellprojekt die integrierte Versorgung mit Seite 48 dem Zusammenbringen aller im Behandlungsprozess Beteiligten im Vordergrund. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Universität München. Inhalte des Programms sind ein Qualitätsmanagement, wie regelmäßige Qualitätszirkel, Fallkonferenzen und Quartalsauswertungen für den Arzt, um den Stand der Therapie für ihn transparent zu machen. Schulungsmaterial und Hilfsmittel, wie Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, der Gesundheitspass Diabetes der Deutschen Diabetes Gesellschaft und ein Erinnerungsservice wurden dem Patienten zur Verfügung gestellt sowie eine Hotline eingerichtet. Der Arzt erhält einen finanziellen Ausgleich für den Dokumentationsaufwand. Die Mannheimer Krankenversicherung bietet ihren, im Durchschnitt jungen, Vollversicherten seit 01.07.99 ein Disease Management Programm für Diabetes an. Ziel ist auch hier, die Behandlung erkrankter Diabetiker zu optimieren, der Krankheit vorzubeugen und Krankheitszeichen frühzeitig zu erkennen sowie Kosten zu senken. Die Versicherten der Mannheimer werden durch Anschreiben über das Programm informiert. Die Einschreibung erfolgt dann anhand verschiedener Parameter (z.B. Alter, Vorerkrankungen). Inhalte sind einheitliche Behandlungsleitlinien, festgelegte Zeitintervalle für routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen, Überwachung von wichtigen Laborparametern, regelmäßige Fußinspektionen und Augenhintergrunduntersuchungen. Informationen, Aufklärung, Schulungen, Prävention, Fortbildungen und Qualitätssicherung sind weitere Komponenten des Programms. Die HanseMerkur Krankenversicherung bietet seit Juli 2001 ihren Versicherten ein Disease Management Programm Diabetes an. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister GesundheitScout24 durchgeführt. Die Ziele des Programms sind eine adäquate medizinische Versorgung der Betroffenen, die Vermeidung von Über- und Unterversorgung sowie die Reduktion von Komplikationen und Folgeerkrankungen. Damit sollen schließlich Kosteneinsparungen erreicht werden. Einschreiben können sich vollversicherte Patienten mit Typ 2 Diabetes im Alter von 40 - 75 Jahren. Eingesetzt werden evidenzbasierte Leitlinien, schriftliche und telefonische Kontakte, Informationen und Vorträge. Eine wissenschaftliche Begleitung findet nicht statt. Eine Evaluation wird intern in Qualitätszirkeln durchgeführt. Seite 49 1.5.3 Kommerzielle Gesundheitsdienstleister: Kommerzielle Serviceanbieter im deutschen Gesundheitsmarkt erhoffen sich vom Disease Management große Zukunftspotenziale. In den letzten fünf Jahren ist eine rasante Entwicklung im Servicebereich auf dem deutschen Gesundheitsmarkt zu beobachten gewesen, in der zahlreiche Neugründungen von Dienstleistern stattfanden. Dabei bieten momentan Serviceanbieter vor allem mit dem Betreiben von Call- Centern und im sogenannte e-Health Bereich (online Gesundheitsservices) mit webbasierten Gesundheitsportalen ihre Dienste an. Hier konzentriert sich derzeit noch der Markt. Endkunden sind in der Regel die Kostenträger, d.h. die Krankenversicherungen, in deren Auftrag Serviceanbieter agieren, indem sie ihnen die operative Durchführung ihrer Gesundheits- Telefonservices oder eService - Portale übertragen. Aber auch Leistungserbringer und Patienten selbst werden als Kunden angesprochen. Zur Zeit findet in der Branche eine strategische Neupositionierung dieser Unternehmen statt. Man kommt zu der Erkenntnis, dass man allein mit dem Betreiben von Call- Centern und online - Gesundheitsportalen zukünftig nicht ausreichend positioniert ist. Stärkere inhaltliche Aufrüstungen des Angebotes sind unerlässlich. Nach Einschätzungen von Branchenteilnehmern wird hier ein Konzentrationsprozess in dem derzeit unübersichtlichen Markt einsetzen. Aufgaben, die von einem Gesundheitsdienstleister als Kooperationspartner im Rahmen eines Disease Management übernommen werden können, sind: • Aufklärung und Information von Patienten und Ärzten über das Disease Management Programm • Bereitstellung von krankheits- wie auch nicht krankheitsspezifischen Informationen für Patienten wie Professionen (z.B. Online- Datenbanken) • Die Entwicklung von Prozessabläufen für die am Disease Management Programm Beteiligten • Mithilfe bei Aufbereitung und Verteilung von Leitlinien an beteiligte Ärzte und Patienten (auf CD ROM, im Internet etc.) • Unterstützung beim Aufbau und der Vernetzung von Datenbanken der am Disease Management Beteiligten • Entwicklung und Implementierung von Patienten- und Ärzteinformationssystemen und Reminder - Systemen • Durchführung von Remindern Seite 50 • Bereitstellung von Produkten zur Stärkung der Compliance der im Programm eingeschriebenen Patienten (Newsletter, Gesundheits- Tipps, Angebote für telefonische Rückfragemöglichkeiten etc.) • Betreuung von Patienten und Ärzten über Call- Center, E- Mail Anfragemöglichkeiten o. ä. bei auftretenden Rückfragen oder Schwierigkeiten • Datenmanagement (unter Einhalt des vorgeschriebenen Datenschutzes) von Disease Management Programmen Im Disease Management können diese Leistungen nur eine Unterstützung der Aufgaben der Ärzte und Krankenkassen sein, diese jedoch nicht im Ansatz ersetzen. Die Entwicklung der Inhalte des Disease Management ist eine ärztliche Aufgabe. Die Entwicklung geeigneter Umsetzungsstrategien wie z.B. Patientenschulungen, Fortbildungen und Erinnerungsschreiben setzt hohe medizinische Kompetenzen voraus. Die Krankenkasse können bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben durch kommerzielle Anbieter nur unterstützt und entlastet werden. Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 51 2 Disease Management Komponenten bei ausgewählten Erkrankungen im internationalen Bereich Disease Management Programme in den USA setzen zunehmend auf eine sektorenübergreifende, evidenzbasierte Routineversorgung chronisch Kranker. Um eine systematische Versorgungsverbeserung zu erreichen, werden die traditionellen Versorgungsabläufe häufig neu strukturiert. Im Folgenden werden ausgewählte Programme beschrieben, denen ein systematischen Ansatz zur Verbesserung der Versorgungsqualität zugrunde liegt. Die Generalisierbarkeit der beschriebenen Ergebnisse wird durch die folgenden Überlegungen eingeschränkt: • Der Einfluss einzelner Komponenten auf das medizinische Outcome und die Kosten-Effektivität ist in der Regel nicht evaluierbar, da die Programme Kombinationen von Komponenten einsetzen. Einzelne Interventionen wie Schulungsprogramme für Patienten, ärztliche Fortbildung oder der Einsatz von Patient Care Pathways (Clinical Pathways) im Krankenhaus sind zwischenzeitlich gut untersucht und es liegt Evidenz für die Effektivität dieser Interventionen vor, sofern sie definierte Kriterien erfüllen [Dougherty et al., 2000; Lob et al., 2000; Cantillon, 1999]. Andere Interventionen wie beispielsweise die meisten Maßnahmen des Organisationsmanagements sind fast ausschließlich in Kombination mit anderen Komponenten evaluiert und es fehlen randomisierte und kontrollierte Studien. • Die Programme arbeiten teilweise mit kleinen Patientenpopulationen und kurzen Beobachtungszeiträumen • Die Programme sind in der Mehrzahl in den USA im Managed Care Umfeld implementiert. Zunehmend werden diese allerdings auch in den USA mit Leistungserbringern in Einzelleistungsvergütung umgesetzt. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Allerdings fehlen die Evaluationen großer Studien, da sie zur Zeit noch nicht abgeschlossen sind. Dennoch ergeben sich Anhalte dafür, dass bei der Umsetzung von Disease Management mit einzelnen Leistungserbringern in Einzelleistungsvergütung die Vorteile des Disease Management, Verbesserung der Versorgungsqualität und Kostenstabilisierung der Versorgung, erreicht werden können [McCulloch et al., 2000]. 51 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 52 2.1 Beispiel 1: Leitlinienimplementierung und Organisationsmanagement Ein Beispiel für ein Programm zur Versorgungsverbesserung von Diabetikern, dem ein systematischer, strukturierter und populationsbezogener Ansatz zugrunde liegt, ist das Diabetes Roadmap Programm von Group Health Cooperative of Puget Sound [McCulloch et al., 1998 und 2000]. Es integriert die Implementierung evidenzbasierter Therapieprinzipien in die Praxis mit strukturellen und organisatorischen Änderungen im Ablauf der Patientenversorgung. Zur Sicherstellung einer evidenzbasierten Therapie in der Praxis wurden evidenzbasierte Therapieleitlinien sowie sechs verschiedene Implementierungsstrategien zur Unterstützung der behandelnden Ärzte erarbeitet (Tabelle 4). Ein systematischer, patientenindividueller Ansatz wird durch ein elektronisches Diabetesregister und Reminder-System gewährleistet. Das ReminderSystem unterstützt zusätzlich zusammen mit einer ambulanten Diabeteskrankenschwester (Tabelle 2) die Koordination von Therapie und Selbstmanagementmaßnahmen. Programmübersicht: Programmname: Diabetes Roadmap. Rahmen: Health Maintenance Organisation. Zielerkrankung: Diabetes Mellitus. Anzahl Patienten: 15 000 Diabetiker. Patientenidentifikation: Arzneimittelverordnungen, Laboranforderungen, Krankenhausentlassungsdiagnosen (ICD-9). Interventionszeitraum: Bis zum Bericht 5 Jahre. Das Projekt läuft noch. Ziele des Programms: Die allgemeine Zielsetzung ist die Verbesserung des Gesundheitszustandes, des klinischen Status, der Patientenzufriedenheit und die Senkung der Kosten für alle Diabetiker der Health Maintenance Organisation. Zu den spezifischen intermediären Zielen gehören: Erhöhung der Rate von Diabetikern, die ein regelmäßiges Retinopathiescreening, regelmäßige Fußinspektion und spezifisch zugeschnittene Informationen bzw. Schulungen erhalten. Regelmäßige Kontrollen von HbA1c und Mikroalbuminuriesc52 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 53 reening, eine Senkung der HbA1c-Werte in den Normbereich und eine erhöhte Patientenzufriedenheit. Programmstruktur: Es handelt sich um einen systematischen, strukturierten und populationsbezogenen Ansatz in der primärärztlichen Versorgung, an der über 200 Hausarztpraxen teilnahmen. Komponenten: Diabetesregister (Tabelle 1). Vernetzte Computerarbeitsplätze. Remindersystem Reorganisation des Praxisablaufs und Entscheidungsunterstüzung durch: Chronic Care Clinic (Spezielle Diabetessprechstunde) und Unterstützung durch ein mobiles Expertenteam bestehend aus Diabetologen und spezieller Krankenschwester mit diabetologischer Weiterbildung (Diabeteskoordinator) (Tabelle 2). Evidenzbasierte Leitlinien (Tabelle 3). Implementierungsstrategien für evidenzbasierte Leitlinien (Tabelle 4). Unterstützung des Patientenselbstmanagements durch Arbeitsmaterialien, Informationsbriefe etc. Evaluationsstrategie für medizinische, ökonomische und psychosoziale Variablen. Ergebnisse: Zunahme der HbA1c-Kontrolle auf über 90% aller Diabetiker. Zunahme der Augenhintergrunduntersuchungen von 46% auf ca. 67%. Mittlerer HbA1c für alle Diabetiker 7,58%. Zunahme der Fußinspektionen von < 20% auf >50% (Abbildung 2). Zunahme des Screenings auf Mikroalbuminurie (Abbildung 3). Senkung der Raucherrate von 14% auf 10%. Hohe Patientenzufriedenheit. Ökonomische Ergebnisse (Tabelle 5): 53 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 54 Sinken der Krankenhauseinweisungen von Diabetikern um 17%. Verringerung der Gesamtaufenthaltstage im Krankenhaus von Diabetikern um 25%. Verringerung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer bei Krankenhauseinweisung um 10%. Verringerung der Besuche beim Hausarzt um 6,6%. Verringerung der Überweisungsraten zu Spezialisten um 23% (Im Durchschnitt wurde jeder Diabetiker einmal weniger pro Jahr zum Spezialisten überwiesen). Zunahme der Medikamentenkosten um $11,20 aufgrund des verstärkten Einsatzes von Metformin. Trotz dieser Zunahme der Arzneimittelkosten wurden pro Mitglied pro Monat Einsparungen von $62 realisiert. Kritik: Es handelt sich nicht um eine kontrollierte oder randomisierte Studie. Der Einfluss von Faktoren, wie z.B. die Veröffentlichung von Programmergebnissen im Rahmen des HEDIS-Benchmarkingprojektes kann nicht abgeschätzt werden. Ebensowenig kann der Einfluss der einzelnen Faktoren (Organisationsmanagement, Leitlinienimplementierung, etc.) auf die Ergebnisse abgeschätzt werden. Das Programm wurde in einer Managed Care Umgebung implementiert, so dass auf Arzneimittelverschreibungsdaten, Labordaten und Patientendaten einfach zugegriffen werden konnte. Würde das Programm z.B. im Rahmen des deutschen Systems implementiert, so müssten die Voraussetzungen für eine Vernetzung geschaffen werden oder durch entsprechende per fax / Post zu versendende Alternativen ersetzt werden. Erste derartige Versuche sind im Rahmen des Programms bereits in den USA mit Leistungserbringern in Einzelleistungsvergütung erfolgreich durchgeführt worden. Die Autoren führen den Erfolg des Programms im Wesentlichen auf drei Faktoren zurück: 54 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 55 (1) Systematische, koordinierte und evidenzbasierte Versorgung durch Implementierung von Maßnahmen zur Versorgungsverbesserung, Koordination und Management der Versorgung (z.B. Leitlinien, Entscheidungsunterstützung). (2) Stetige Zunahme der Kompetenz im niedergelassenen Bereich durch das Programm. (3) Ein Remindersystem in unterschiedlichen Ausprägungen. Verbesserungspotenzial sehen die Autoren noch in der Unterstützung der Patienten im Selbstmanagement zur noch besseren Blutzuckereinstellung (ein Drittel der Patienten hat noch HbA1c-Werte > 8,0%) sowie im Management des Fußulkus. Hier wurde trotz erhöhter Fußinspektionsrate noch keine signifikante Reduktion in der Prävalenz von Fußulzera oder Amputationen erreicht. Allerdings ist die Laufzeit des Programms mit 5 Jahren auch noch zu kurz um Aussagen zur Verringerung von Spätschäden zu erlauben. Komponenten: Diabetesregister (Tabelle 1). Das Diabetesregister wurde im ersten Jahr als Hardcopy geführt, indem die Daten per Fax oder Brief übermittelt wurden. Auch das Feedback wurde per Brief oder Fax quartalsweise übermittelt. Es spezifizierte pro Arzt die Namen der Patienten mit Diabetes Mellitus im Programm, den letzten Arzt / Patienten- Kontakt sowie die Ergebnisse von Untersuchungen wie Spiegelung des Augenhintergrundes, HbA1c-Wert, etc. nach ca. 1 Jahr Laufzeit des Programms wurden alle Hausarztpraxen mit einem PC ausgestattet, über den ein Online- Register eingerichtet wurde, das die Einspeisung von Laborwerten und Remindern jederzeit erlaubt und täglich aktualisiert wird. Mit Hilfe des Programms kann vor jedem Patientenkontakt eine zweiseitige Zusammenfassung der Therapie, Untersuchungsergebnisse und Therapieempfehlungen ausgedruckt werden, die als Gedächtnisstütze bei der Konsultation verwendet werden kann. 55 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 56 Tabelle 1: Diabetesregister Kategorie Datenelement demographische Daten Patientenstammdaten Vitalparameter Kardiale Daten Nierenwerte Augenhintergrundspiegelung Fußpflege Quelle Datenbank zur Verwaltung der Patientendaten Größe, Gewicht, Blutdruck, Oberflächenmaske zur Raucherstatus Dateneingabe Medikamentöse Therapie: Aspirin, Labor und Daten zur Laborwerte: Cholesterinspiegel, Pharmakotherapie LDL Cholesterin, HDL Cholesterin und Triglyzeride ACE-Hemmer, Serum Kreatinin, Labor und Daten zur Verhältnis von Pharmakotherapie Microalbumin/Kreatinin Ergebnisse und Daten der letzten Datenbank zur Verwaltung der Augenhintergrundspiegelung Patientendaten und Maske zum Eingeben der ophthalmologischen Daten Ergebnisse und Daten der letzten Maske zur Dateneingabe der Fußuntersuchungen Ergebnisse der Fußinspektion Blutzuckerkontrolle Laborwerte: HBA1c (%); Labor und Daten zur Medikamentöse Therapie: orale Pharmakotherapie Antidiabetika oder Insulintherapie Patientenschulung Initiierungsdatum einzelner Maske der Datenbank der Elemente des Patientenschulung Selbstmanagements wie z.B. Schulungen Servicenutzung ambulante Behandlung, Datenbank zur Verwaltung der Krankenhausaufenthalte, Patientendaten telefonische Kontakte [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an McCulloch et al., 1998] 56 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 57 Abbildung 1: Remindersystem Group Health Cooperative of Puget Sound Datum: 01.10.97 Patientennummer : 00000188 Patientenstammdaten Name des Patienten: Brown, Betty Alter: 65 Hausarzt: Payne, Thomas Klinische Vorgehensweise: Diabetes, Sekundärprevention kardialer Risikofaktoren Patientenspezifische Risikofaktoren und Reminder: Kardiovaskuläre Reminder Informationspaket erhalten? Aspirin? LDL Ausgangswert bei Aufnahme (Erfassung des LDL Ausgangswertes (nüchtern, ohne Medikation). Um einen idealen Ausgangswert zu erhalten, wird eine zweimalige Messung empfohlen. Das Programm wird Werte von (LDL < 100)oder (LDL < 130 und das Verhältnis von TC/HDL <4) als Ziele der Therapie vorschlagen. Eine Reduktion um 30 % unterhalb des Ausgangswertes wird als Therapieziel ignoriert, solange kein LDL-Ausgangswert eingetragen ist.) Der Patient hat bisher nicht die Lipidwerte erreicht, die für die Sekundärpräventions gemäß Leitlinie vorgegeben werden. Daher wird eine Dosiserhöhung bzw. eine Umstellung der Medikation empfohlen, um niedrigere LDL Werte zu erreichen. Ziele der Therapie: Eine 30% Reduktion des LDL Ausgangswertes oder LDL <130 und TC/HDL Ratio <4 Nephropathierisiko >50mcg, wird gemäß Microalbuminuria Leitlinie eine ACE- Hemmer-Therapie unter Beachtung von Kontraindikationen vo Kreatin >1,5 Retinopathiescreening Überweisung zum Augenarzt sollte bis ........ erfolgen Netzhautveränderungen vorhanden: Status des rechten Auges: Status des linken Auges: Fußstatus Bei hohem Ulkusrisiko wird die Initiierung eines prophylaktischen Interventionsprogramms gemäß der diabetischen Fußscreening Leitlinie sowie eine Empfehlung regelmäßig zur Fußpflege zu gehen, vorgeschlagen Blutzuckerkontrolle Bei HbA1C C >8.0 1 wird ein Vorgehen gemäß der Leitlinie zur Blutzuckerkontrolle vorgeschlagen BMI > 27.0? [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an McCulloch et al., 1998] In der üblichen Praxisroutine, in der der Arzt- Patienten- Kontakt ca. 5 bis 10 Minuten dauert, kann auf die spezifischen Erfordernisse von chronisch Kranken nicht adäquat eingegangen werden. Aus diesem Grund werden im Organisationsmanagement Neustrukturierungen von Praxisabläufen und Versorgungsprozessen vorgenommen. Im Diabetes Roadmap Programm wurden drei Interventionen implementiert (Tabelle 2), die von Ärzten und Patienten positiv aufgenommen wurden. 57 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 58 Tabelle 2: Praxisreorganisation /Entscheidungsunterstützung Komponente Diabetes-Sprechstunde Beschreibung Für die Diabetikersprechstunde wird ein halber Tag im Praxisablauf für die Betreuung von 6 bis 10 Patienten reserviert. Jeder Patient erhält eine systematische Evaluation (Anamnese, körperliche Untersuchung, Medikamentenanamnese und ggf. Korrektur), Unterstützung des Selbstmanagements durch Krankheitskoordinator (Diabetesschwester), ein ärztliches Gespräch zur Besprechung von Therapieplan und Untersuchungsergebnissen sowie eine Gruppensitzung mit anderen Diabetikern, in der definierte Themen und von der Gruppe vorgeschlagene Probleme diskutiert werden können. Vorbereitung des Praxisteams auf die Sprechstunde ist essentiell! EntscheidungsunterEin Team bestehend aus einem Diabetologen und einer Krankenschwester stützung durch Experten mit Zusatzausbildung besucht die Praxen nach einem vereinbarten Zeitplan in regelmäßigen Abständen und nimmt mit dem Hausarzt zusammen die Sprechstunde wahr. Das Team kann ggf. auch von einer Hausarztpraxis angefordert werden. Für jeden Patienten sind ca. 30 bis 40 Minuten Sprechzeit vorgesehen. Ambulante Unterstützt das ambulante Diabetes Team und die Hausärzte in der DiabeteskrankenPatientenschulung, Schulung und Nachkontrolle von SelbstmanagementSchwester Techniken und organisatorischen Fragen. (Krankheitskoordinator) [Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an McCulloch et al., 1998] Evidenzbasierte Leitlinien (Tabelle 3) sind eine Voraussetzung für die Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie. Es besteht jedoch Evidenz dafür, dass die alleinige Dissemination von Leitlinien z.B. in gedruckter Form nicht ausreicht, um eine Änderung im Therapie- und Verschreibungsverhalten von Ärzten bzw. im Selbstmanagementverhalten von Patienten auszulösen [Cabana et al., 1999; Klazinga et al., 1994]. Das Diabetes Roadmap Programm setzt daher sechs unterschiedliche Implementierungsstrategien ein (Tabelle 4). Tabelle 3: Evidenzbasierte Leitlinien im Diabetes Roadmap Programm Leitlinie Retinopathiescreening Beschreibung Jährliche Spiegelung des Augenhintergrundes vom Zeitpunkt der Diagnosestellung an (Typ 2 Diabetiker), bzw. 5 Jahre nach Diagnosestellung (Typ 1 Diabetiker) Fußinspektion Jährliche Inspektion der Füße ab Diagnosestellung (Typ 2) bzw. ab 5 Jahre nach Diagnosestellung (Typ 1). Schulung von Patienten mit erhöhtem Risiko für die Entwicklung eines Ulcus. Mikroalbuminuriescreening Jährliches Screening aller Diabetiker (12 bis 70 Jahre), die nicht bereits einen ACE-Hemmer erhalten Aufklärung der Patienten über kardiologische Risikofaktoren und deren Verringerung, über HbA1c-Messung und Raucherprävention. Blutzuckermanagement Die Leitlinie spezifiziert die Therapie (Sport, diätetische Therapie, orale Antidiabetika, Insulin) und enthält zusätszlich ausführliches Material zur Unterstüzung des Selbstmanagements wie z.B. Patientenarbeitsblätter. [Quelle: McCulloch et al., 1998] 58 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 59 Tabelle 4: Implementierungsstrategien für evidenzbasierte Leitlinien Intervention Klassische Fortbildung (Continuing Medical Education) Beschreibung Vorträge und Workshops zur Retinopathie, Fußambulanz, Mikroalbumionuriescreening und Blutzuckermanagement Regelmäßige Arbeitsmittagessen für Praxen Fortbildung in Kleingruppen und individuelle Fortbildung Feedback Der Patientenstatus ist jederzeit online abrufbar, zusätzlich werden vierteljährliche patientenindividuelle Berichte an den Hausarzt verschickt, die ein Benchmarking der einzelnen Praxis enthalten Diabetes Expertenteam bietet Entscheidungsunterstützung in der Praxis an Evidenzbasierte Leitlinien sind in gedruckter Form und online abrufbar Spezifisch auf Stadien und Komplikationen zugeschnittene Materialien zur Unterstützung des Selbstmanagements Coaching durch Experten Entscheidungsunterstützungssysteme Patientenunterstützung [Quelle: McCulloch et al., 1998] Die Ergebnisse des Diabetes Roadmap Programms zeigen eine deutliche Verbesserung der Prozessqualität. Insbesondere Abbildung 3 veranschaulicht den Zusammenhang mit der Einführung von Leitlinien. Abbildung 2: Zunahme der regelmäßigen Fußinspektionen nach Leitlinienimplementierung 60 Population in % 50 40 30 20 10 0 Mai 96 Jun 96 Jul 96 Aug Sep 96 96 Okt 96 Nov Dez Jan 96 96 97 Feb 97 Mrz 97 Apr 97 Mai 97 Jun 97 M onat und Jahr Durchschnittliche Prozentzahl der Diabetes- Patienten bei denen eine Fußuntersuchung vorgenommen wurde [Quelle: McCulloch et al., 1998] 59 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 60 Abbildung 3: Zunahme des Mikroalbuminuriescreenings nach Leitlinienimplementierung 1000 800 600 400 200 0 Implementierung der Mikroalbuminuria Leitlinie Eigenes Labor verfügbar Ja n 9 M 4 rz 9 M 4 ai 94 Ju l9 Se 4 p 9 N 4 ov 9 Ja 4 n 9 M 5 rz 9 M 5 ai 95 Ju l9 Se 5 p 9 N 5 ov 9 Ja 5 n 9 M 6 rz 9 M 6 ai 96 Ju l9 Se 6 p 9 N 6 ov 96 Durchgeführte Tests,n Monatliche Anzahl der durchgeführten Tests bei DiabetesPatienten seit 1994 Monat und Jahr [Quelle: McCulloch et al., 1998] Tabelle 5: Ökonomische Evaluation stationäre Aufwendungen/1000 stationärer Aufenthalt in Tagen/1000 durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen Primäre Arztbesuche Spezialistenbesuche Notfallaufnahmen Gesamtkosten pro Patient und Monat davon Arzneimittelkosten [nach McCulloch et al., 2000] 1995 289,9 1311 4,52 6,40 3,92 0,18 $566 $70,16 1996 259,3 1175 4,53 5,91 3,09 0,20 $541 - 1997 240,6 978 4,07 5,98 3,01 0,17 $504 $81,36 Veränderung -17% -25,9% -10% -6,6% -23% Keine -11% +16% 2.2 Beispiel 2: Organisationsentwicklung, Einsatz von Informationstechnologie Das Lovelace Health Systems Episodes of Care Programm [Friedman 1996 und Friedman et al., 1998] ist ein systematisches, populationsbezogenes Programm zur Verbesserung von Qualität und Effektivität der Versorgung von Typ 2 Diabetikern. Dazu werden spezifische Interventionen eingesetzt, die auf Leistungserbringer und Patienten zugeschnitten sind. Arztbezogene Interventionen des Programms umfassen den Einsatz evidenzbasierter Leitlinien, die Bereitstellung eines Informationstechnologie-basierten Entscheidungsunterstützungssystems, in das die Patientendatenverwaltung integriert ist, sowie ein quartalsweise erstellter, individueller Bericht für den einzelnen Leistungserbringer. Zu den patientenbezogenen Interventionen gehö60 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 61 ren Schulungen, Reminder-Systeme, spezielle Diabetessprechstunden und organisierte Diabetes-Tage. Zur Entwicklung eines populationsbezogenen Ansatzes wurde folgendes Vorgehen gewählt: • Stratifizierung der Patienten in Risikogruppen, um Hochrisiko- Patienten bzw. Patienten mit dem Potenzial zur Entwicklung zu Hochrisiko- Patienten zu identifizieren. • Organisation von Maßnahmen der Sekundärprävention auf einem kosteneffektiven Niveau, um die Funktionalität der Patienten zu erhalten und zu verbessern. • Organisation der Patientenversorgung auf einem qualitativ hochwertigen und gleichzeitig kosteneffektiven Niveau. • Implementierung eines Versorgungssystems (Netzes), das eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige und kosteneffektive Versorgung auch in ländlichen Gegenden sicherstellt. Programmübersicht: Programmname: Lovelace Health Systems‘ EPISODES OF CARE Program. Rahmen: Managed Care Organisation. Zielerkrankung: Diabetes Mellitus Typ 2. Anzahl Patienten: nicht bekannt (zweitgrößte Managed Care Organisation in New Mexico). Interventionszeitraum: Bis zum Bericht über 3 Jahre; Das Projekt läuft noch. Ziele des Programms: Die allgemeine Zielsetzung ist der Anspruch, dass alle Diabetiker im Lovelace System in die Lage versetzt werden, ihren Diabetes so weit möglich eigenverantwortlich zu managen. Die Diabetikerversorgung sollte sich von professioneller Seite durch hohe Qualität und KostenEffektivität auszeichnen. Durch eine verbesserte Blutzuckereinstellung sollten akute Komplikationen und Spätkomplikationen vermieden werden. Programmstruktur: Es handelt sich um einen systematischen, strukturierten und populationsbezogenen Ansatz in der primärärztlichen Versorgung. Dazu wurde unter der Leitung eines Hausarz61 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 62 tes und eines Endokrinologen ein Team aus Diabetes Schulungspersonal, Diätberaterinnen, einem Apotheker, einem Qualitätsmanagementbeauftragten, einem Case Manager, Verwaltungsmitarbeitern und Patienten gebildet. Das Team trifft sich zweimal monatlich um das Programm und seine Ergebnisse zu evaluieren, Verbesserungsvorschläge umzusetzen und neue Ideen zu entwickeln. Komponenten: Evidenzbasierte Leitlinien (Tabelle 6) und Implementierung durch spezielle Fortbildungsangebote für Ärzte. Informationstechnologieunterstützungssystem basiertes mit Entscheidungs- Patientendatenverwaltung (Tabelle 7). Quartalsweiser Bericht an Leistungserbringer (Abbildung 4). Organisationsmanagement (Reorganisation des Praxisablaufs und Entscheidungsunterstützung). Reminder- System. Patientenschulung (Tabelle 10). Evaluation. Ergebnisse: Senkung der durchschnittlichen HbA1c-Werte der eingeschriebenen Diabetiker von 12.2% (1994) auf 10.4% (1996). Zunahme der Augenhintergrunduntersuchungen von 47,3% (1994) auf ca. 53,2% (1996). Zunahme der Schulungen pro Patient von 52% auf 78%. Kritik: Der Einfluss einzelner Komponenten auf die Ergebnisse kann nicht evaluiert werden. Ebenso wenig kann der Einfluss von Faktoren, wie z.B. die Veröffentlichung von Programmergebnissen im Rahmen des HEDIS- Benchmarkingprojektes abgeschätzt werden. Das Programm wurde in einer Managed Care Umgebung implementiert, so dass auf Arzneimittelverschreibungsdaten, Labordaten und Patientendaten einfach zugegriffen werden konnte. 62 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 63 Würde das Programm z.B. im Rahmen des deutschen Systems implementiert, so müssten die Voraussetzungen für eine Vernetzung geschaffen werden oder durch entsprechende per fax / Post zu versendende Alternativen ersetzt werden. Komponenten: Zur Vorbereitung der Leitlinien wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Auf dem Boden dieser Recherche wurden evidenzbasierte Leitlinien an die Gegebenheiten von Lovelace Health Systems angepasst. Die Leitlinien sollten klar, knapp und praxisrelevant sein. Folgende Themen wurden berücksichtigt: Tabelle 6: Inhalte der evidenzbasierten Leitlinien Inhalte der evidenzbasierten Leitlinien Diagnose und Beginn der Therapie bei Diabetes Mellitus Typ 2 Management des Typ 2 Diabetes ohne Insulin Management des Typ 2 Diabetes mit Insulin Screening und Therapie der diabetischen Nephropathie Einsatz von ACE-Hemmern bei Proteinurie Screening und Weiterbehandlung der diabetischen Retinopathie Neuropathiescreening Therapie der diabetesbedingten Impotenz [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Friedman et al. 1998] Die elektronischen Entscheidungsunterstützungssysteme speichern Informationen zu den Patientenstammdaten, Anamnese, Radiologischen Untersuchungen, Laborergebnissen und diktierten Arztbriefen bzw. Zusammenfassungen zur Sprechstunde und zur Therapieplanung. Das System wurde ursprünglich als Entscheidungsunterstützungssystem für Ärzte geplant. Zunehmend wird es jedoch auch zur Strukturierung von Arzt- Patienten- Gesprächen und zur Patienteninformation durch den Arzt eingesetzt. 63 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 64 Tabelle 7: Entscheidungsunterstützungs- und Patietendatenmanagement-System (Diabetes Patient Profile Screen) Komponenten Therapieplan (treatment summary) Inhalte Übersicht über den Therapieplan (Tabelle 8) mit Laborergebnissen, Anforderungen und erbrachten Leistungen im Programmablauf (Untersuchung des Augenhintergrundes, durchgeführte oder noch durchzuführende Schulungen, Reminder für den Einsatz von ACE-Hemmern bei diagnostizierter Mikroalbuminurie, etc.) Leitlinienübersicht Darstellung der wichtigsten Inhalte von Leitlinien, die in der Diabetikersprechstunde besprochen werden sollten, Zielbereiche für Laborwerte wie HbA1c, Screeninghinweise für Retinopathie, Nephropathie, Hyperlipidämie und Hypertonie. Fußinspektion Zusammenfassung der Vorgehensweise, die bei der Fußinspektion eingehalten werden sollte, mit der Empfehlung alle 3 Monate eine Fußinspektion durchzuführen und einen jährlichen Gefäß- und Nervenstatus zu erheben. [Quelle: Friedman et al. 1998] Der Patiententherapieplan (Tabelle 8) ist eine Übersicht über die nach Maßgabe der evidenzbasierten Leitlinien durchzuführenden Therapie- und Untersuchungs- maßnahmen und die Frequenz ihrer Durchführung. Es werden Ergebnisse durchgeführter Untersuchungen und Reminder bei nicht durchgeführten Maßnahmen bzw. bei Überschreitung von Grenzwerten angezeigt. Tabelle 8: Therapieplan Diabetiker-Versorgung: h dl b i h MicroHbA1c albumin Fällig 13.03.96 9,6 Min. 32 hoch 23.09.95 9,4 Int. 24.08.95 14.09.94 Augenuntersuchung Schulung Chol HDL LDL TRG X X X 150 185 X X Chol = Cholersterin; HDL = high-density lipoprotein Cholesterin; LDL = low-density lipoprotein h l= Intensiviertes i Int. Ziel d. Blutzuckerwertes; Min. = Minimalziel d. Blutzuckerwertes; TRG= Triglyceride [Quelle: Friedman et al., 1998] Den Leistungserbringern geht vierteljährlich der Quartalsbericht zu. Er fasst die angeordneten Laborleistungen, Untersuchungen und Schulungen einer Periode zusammen und zeigt den Vergleich der Therapieergebnisse, Screenings- und Überweisungsraten mit den Ergebnissen von Peers. Patienten, bei denen Untersuchungen nicht durchgeführt wurden oder deren Ergebnisse außerhalb des Zielbereichs liegen, werden am Ende des Berichts namentlich aufgeführt. Die Berichte dienen dem Patientenmanagement und der Qualitätssicherung und sind in keiner Weise mit Vergütungsstrukturen verbunden. 64 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 65 Abbildung 4: Bericht für Leistungserbringer im Diabetes Disease Management Episodes of Care – Provider-Bericht Diabetes Mellitus Name: Susan Cure Kriterien Schulung Augenuntersuchung Glipizid Glyburid HbA1c HbA1c untersucht Datum: 09.01.96 Standard DiabetesPatienten total Patienten getestet total Anzahl innerhalb des Standards Alle 2 Jahre Jedes Jahr nach Bedarf nach Bedarf <10,5 % 1/Jahr 22 22 1 0 22 22 22 15 1 0 20 20 22 15 1 0 9 20 Innerhalb des Standards prozentual 100,00 68,18 100,00 0,00 45,00 90,91 1/Jahr 22 10 10 45,45 Zweimal jährlich 22 0 0 0,00 Microalbumin untersucht Teststreifen Patienten außerhalb des festgelegten Standards Name MRN Schulung Augenuntersuchung John Doe XXXX Jane Doe XXXX Juan Diaz XXXX N Maria Diaz XXXX N Bill Jones XXXX N Betsy Smith XXXX MRN = Registriernummer (medical record number) N = Normal Glipizid Glyburide HbA1c Wert Angeordnet 13,2 13,8 10,6 Microalbumin untersucht N N N N Teststreifen N N N N N N [Quelle: Friedman, et al., 1998] Im Rahmen von Disease Management Programmen wird häufig eine Reorganisation des Praxisablaufs durchgeführt, um Organisations- und Ablaufstrukturen auf die Bedürfnisse chronisch Kranker zuzuschneiden. Im Lovelace Programm wurden eine spezielle Diabetessprechstunde (Focused Diabetes Clinic Visits) und Diabetes Tage in der Klinik (Diabetes Days) eingerichtet. In der speziellen Diabetessprechstunde werden nur diabetesrelevante Themen erörtert. Diabetes Tage werden zweimal pro Quartal angeboten. Dazu werden gezielt Diabetiker eingeladen, die Untersuchungstermine nicht wahrgenommen haben oder deren Werte außerhalb des Zielbereichs liegen. In einem 2,5 Stunden dauernden Programm werden ein individueller Arztbesuch, Labortests, Augenhintergrundspiegelung, Schulungen und (Selbsthilfe)Gruppensitzungen durchgeführt. 65 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 66 Tabelle 9: Diabetessprechstunde (Focused Diabetes Clinic Visits) Inhalte der Diabetessprechstunde Diätberatung Insulintherapie Therapie mit oralen Antidiabetika Körperliche Bewegung Schulung Blutzuckerselbstmessung und Interpretation der Ergebnisse Screening auf Komplikationen Insulinnebenwirkungen und Unterzuckerungen Therapiebarrieren Therapieplan [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Friedman et al., 1998] Eine Säule des Selbstmanagements ist die Vermittlung von Informationen und Techniken im Rahmen von Schulungen. Im Lovelace Programm wurden folgende Schwerpunkte gesetzt: Tabelle 10: Komponenten der Diabetikerschulung Komponenten Diabetes-Verständnis Inhalte Beschreibung des normalen Blutzuckerstoffwechsels, die Rolle des Insulins, Anzeichen und Symptome des Insulinmangels Psychologische Erörterung der normalen psychologischen Reaktionen auf die Diagnose Anpassungsreaktionen „Diabetes Mellitus“ Selbstkontrolle Blut- und Harnzuckerselbstmessung sowie Messung von Ketonkörpern im Urin Ernährung Individuelle Zusammenstellung eines Ernährungsplans durch eine Diätberaterin Insulintherapie und Insulintypen, Dosierung, Injektionstechniken, Nebenwirkungen Dosisanpassung Orale Antidiabetika Medikamententypen, Dosierung, Nebenwirkungen Insulinreaktionen Video Notfälle Handlungsempfehlungen bei Insulinüberdosierung oder vergessener Insulindosis Körperliche Bewegung Ein individuell angepasstes Übungsprogramm einschließlich der idealen Frequenz, Intensität und bewegungsinduzierten Hypoglykämien [Quelle: Friedman et al., 1998] Die Schulungen wurden von speziellem Schulungspersonal von Lovelace Health Systems in den Arztpraxen durchgeführt. Um die Compliance zu verbessern wurden die Patienten zusätzlich mittels Brief oder Telefonanruf an noch ausstehende Untersuchungen (z.B. Augenhintergrundspiegelung) erinnert (Remindersystem). 66 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 67 2.3 Beispiel 3: Evaluationsstrategien: Entwicklung von Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität Das australische WESTCOP Programm [Scott et al., 2000] beschreibt die Implementierung eines Programms für ein bevölkerungsbezogenes Disease Management Programm in Queensland. Der Kreis hat 180 000 Einwohner, die durch 4 Internisten, 150 Allgemeinärzte und 2 Krankenhäuser versorgt werden. Im Rahmen des Programms wurden Leitlinien für die Versorgung, Rehabilitation und Sekundärprävention des Herzinfarktes entwickelt und implementiert. Zur Qualitätssicherung wurden Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität für die stationäre und ambulante Betreuung entwickelt sowie eine Datenbasis in der Schlüsselparameter der Prozess- und Ergebnisqualität gespeichert werden. Der Einfluss von Reminder-Systemen auf die Versorgungsqualität soll getestet werden. Programmübersicht: Programmname: WESTCOP (West Moreton Coronary Outcomes Program): A disease management approach to coronary artery disease. Rahmen: Kreis in Neuseeland mit 180 000 Einwohnern, die von 4 niedergelassenen Internisten, 150 Allgemeinmedizinern und 2 Krankenhäusern versorgt werden. Zielerkrankung: Koronare Herzerkrankung. Anzahl Patienten: nicht bekannt. Patientenidentifikation: nicht sicher bekannt, wahrscheinlich über niedergelassene Ärzte und bei Krankenhauseinweisungsdiagnose Herzinfarkt. Interventionszeitraum: Bis zum Bericht 3 Jahre; Projekt wird fortgesetzt. Ziele des Programms: Verbesserung der Qualität und der medizinischen Ergeb- nisse der Gesundheitsversorgung bei einer Erkrankung, die durch hohe Prävalenz, das Vorhandensein von evidenzbasierten Therapieleitlinien, hohe Variation in der Therapie und einem Potenzial zur Versorgungsverbesserung durch Verzahnung der stationären und ambulanten Therapie gekennzeichnet ist . 67 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Programmstruktur: Seite 68 Es handelt sich um einen systematischen, strukturierten, populations- und bevölkerungsbezogenen sowie sektorenübergreifenden Ansatz in der Versorgung von Patienten mit Koronarer Herzerkrankung. Komponenten: Evidenzbasierte Leitlinien (Tabelle 12). Feedback-System. Entwicklung von Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität (Tabelle 13). Evaluation. Ergebnisse: Senkung der Mortalität im Krankenhaus. Verringerung der stationären Aufenthaltsdauer. Erhöhung der Verschreibungsrate von Lipidsenkern. Verkürztes Zeitintervall bis zur Lyse. Höhere Teilnahmeraten an Koronarsportprogrammen Höhere Compliance mit Ernährungsempfehlungen. Komponenten: Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Krankenhausärzten, Ärzten des öffentlichen Gesundheitswesens und niedergelassenen Ärzten erarbeitete einen populationsbezogenen Ansatz zur Verbesserung der Versorgungsqualität und der Ergebnisse für definierte Erkrankungen. Die Ziele des Programms für koronare Herzerkrankung sind im Folgendem aufgeführt ( Tabelle 11): Tabelle 11: Programmziele Ziel 1 Spezifizierung Entwicklung eines Modells zur sektorenübergreifenden Koordination der Akutversorgung, Rehabilitation und (Sekundär-)Prävention bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom 2 Planung und Implementierung einer Datenbank zur Erfassung von Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität 3 Identifizierung von evidenzbasierten Leitlinien und Anpassung an die lokalen Verhältnisse 4 Entwicklung von Qualitätsindikatoren für Evaluation und Feedback unter Berücksichtigung von Über-, Unter- und Fehlversorgung 5 Evaluation des Einflusses von Leitlinien und Feedback auf die Versorgungsverbesserung 6 Sammeln von Informationen zur Abschätzung der Krankheitslast 7 Entwicklung und Implementierung eines Modells zur Akutversorgung und Rehabilitation bei Koronarer Herzerkrankung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte [Quelle: Scott et al., 2000] 68 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 69 Die Entwicklung und Implementierung evidenzbasierter Leitlinien sollte die Spanne zwischen evidenzbasierter Therapie und tatsächlich durchgeführter Therapie verringern und so die klinische Versorgung verbessern. Aus diesem Grund wurden spezielle evidenzbasierte Leitlinien für das stationäre und poststationäre Management von akutem Herzinfarkt und instabiler Angina pectoris entwickelt. Als Grundlage wurden die Leitlinien der American Heart Association und des American College of Cardiology herangezogen, die an regionale Anforderungen angepasst wurden (Tabelle 12). Tabelle 12: Evidenzbasierte Leitlinien Leitlinie Entwicklung von Leitlinien für die stationäre und poststationäre Versorgung von Patienten mit akutem Myokardinfarkt und instabiler Angina Pectoris unter Berücksichtigung der Leitlinien des American College of Cardiology und der American Heart Association Implementierung Adaption amerikanischer Leitlinien an lokale Verhältnisse Evaluation der Leitlinien durch Anwender im stationären und ambulanten Bereich bezüglich Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit, Verständlichkeit. Dissemination und Implementierung der Leitlinien in gedruckter Form, durch Workshops und den Einsatz von Meinungsführern Ziel Verbesserung der Versorgungsqualität und Definition von Versorgungszielen Entwicklung von Qualitätsindikatoren auf dem Boden der evidenzbasierten Leitlinien zur Überprüfung, ob die Versorgungsziele erreicht wurden [Quelle: Scott et al., 2000] Indikatoren zur Qualitätskontrolle wurden auf dem Boden evidenzbasierter Leitlinien entwickelt. Die evidenzbasierten Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität sollten direkt oder indirekt die Qualität der Versorgung für die Zielpopulation widerspiegeln (Tabelle 13). Solche Indikatoren werden im Krankenhausbereich seit einigen Jahren erfolgreich angewendet (Tabelle 14). Im ambulanten Bereich werden sie in der Regel erst jetzt verstärkt gefordert (Tabelle 16). Tabelle 13: Kriterien für die Entwicklung von Qualitätsindikatoren Medizinischer Befund und Patientenfragebögen werden als Ausgangsdokumente genutzt [LambertHuber et al., 1994] Sensitivität zum Erkennen von suboptimaler Versorgung in Sinne der Leitlinienempfehlung Gültigkeit, Relevanz und Umsetzungsmöglichkeit aus der Sicht des praktizierenden Arztes Durchführbarkeit trotz Zusatzkosten für Patienten, Ärzte und Programmanbieter bei der Sammlung der benötigten Daten Stabilitiät der Daten innerhalb der Ausgangsdokumente gegenüber Verzerrung und Verfälschungseffekten Fähigkeit und Möglichkeit zu Veränderungen in der Praxis, die aus dem Feedback der beteiligten Gruppen oder Schulungen resultieren [Quelle: Scott et al., 2000] 69 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 70 Tabelle 14: Indikatoren der Prozessqualität für den stationären Bereich Indikator 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 2 indikativer 1 Grenzwert Thrombolyse Einschlusskriterie : alle vorhandenen AMI-Patienten mit Brustschmerzen >20 Min. und keine Veränderungen der STAusschlusskriterie : späte Aufnahme (>12h nach Auftreten der Symptome), kürzliche ischämische Attacke/Apoplex, kürzliches Trauma oder Herz-Wiederbelubung, oder gleichzeitige Antikoagulations-Therapie, aktives peptisches Ulkus, Bluthochdruck Beta-Blocker 70 % Einschlusskriterie : AMI-Patienten Ausschlusskriterie : kardiogener Schock, vorhandene Herzinsuffizienz, Asthma oder Bronchitis, Bradiarrhythmie mit Aspirin 94 % Einschlusskriterie : AMI-Patienten Ausschlusskriterie : aktive gastrointestestinale Blutung oder gleichzeitige Therapi ACE-Hemmer 63 % Einschlusskriterie : AMI-Patienten + früheres oder aktuelles Auftreten einer oder Anzeichen einer linksseitigen ventrikularen Dysfunktion oder früherer Ausschlusskriterie : keine Lipidsenker 64 % Einschlusskriterie : AMI-Patienten + vorhandene Cholesterinwerte 5,5 mmol oder Ausschlusskriterie : keine Aufnahme in kardiologische Rehabilitationsmaßnahme keine Einschlusskriterie : AMI-Patienten Ausschlusskriterie : hohes Alter (>85 Jahre), Altersschwäche, unkontrollierte oder instabile Angina – nicht evaluiert aber abgeleitet aus Studien, die annähernd Patienten Stress- EKG keine Einschlusskriterie : AMI-Patienten Ausschlusskriterie : fortgeschrittenes Alter, gestörte Kommunikationsfähigkeit, interpretierbares EKG - nicht evaluiert aber abgeleitet aus Studien, die annähernd Patienten Koronare Angiographie keine Einschlusskriterie : AMI-Patienten + früherer Reinfarkt, Postinfarkt Angina oder BelastungsAusschlusskriterie : keine qualitativer 2 Grenzwert keine 60% 85 % 55 % 55 % 70 % 70 % 40 % indikativer Grenzwert: Anzahl der Patienten, die für die durchzuführende Messmethode in Frage kommen qulatitativer Grenzwert: indikativer Grenzwert –10% (aufgerundet) [Quelle: Scott et al., 2000] Tabelle 15: Indikatoren der Ergebnisqualität für den stationären Bereich Indikator qualitativer Grenzwert < 10 % 1. stationäre Todesfälle 2. stationäre Komplikationen • Re-Infarkt • offenkundige Herzinsuffizienz • Post-Infarkt Angina 3. Stationäre Aufenthaltsdauer <4% nicht def. nicht def. < 6 Tage [Quelle: Scott et al., 2000] Tabelle 16: Qualitätsindikatoren für den ambulanten Bereich Indikator 85% der Patienten, die ihren Hausarzt in den vergangenen 3 Monaten aufgesucht haben, sollten Screening und Beratung/ Therapie bezüglich ihrer Risikofaktoren erhalten haben. Evidenzbasierte Pharmakotherapie wurde analog der Indikatoren für die stationäre Pharmakotherapie bewertet [Quelle: Scott et al., 2000] 70 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 71 2.4 Beispiel 4: Patientenschulung, individuelle Therapieleitlinien und Patienten- Selbstmanagementtechniken Litzelman et al. implementierten ein Programm zur Reduktion von Fußläsionen und ihren Folgen wie z.B. Ulzera und Amputation bei Diabetikern [Litzelmann et al., 1993]. Die randomisierte und kontrollierte Studie wurde in einer universitären Einrichtung durchgeführt. Insgesamt nahmen an der zwölf Monate dauernden Intervention 352 Patienten erfolgreich teil. Die Intervention bestand aus der Gabe von speziellem Informationsmaterial an die Patienten verbunden mit der Schließung eines „Patientenselbstvertrags“: Jeder Patient schloss mit sich selbst einen Vertrag ab, in dem er die wichtigsten Ziele und Methoden zur Erlangung dieser Ziele spezifizierte. Beispielsweise die tägliche Inspektion der Füße und das Abtrocknen der Zehenzwischenräume nach dem Duschen oder Baden. Das Selbstmanagement- Verhalten der Patienten wurde durch telefonische und postalische Reminder unterstützt. Die betreuenden Ärzte erhielten aufbereitete Leitlinien, Flussdiagramme mit Darstellung von Risikofaktoren und Interventionen. In die Patientenakte wurde ein Blatt eingelegt, dass den Arzt bei jedem Kontakt in der Sprechstunde aufforderte, die Füße des Patienten zu untersuchen. Der Patient wurde von der Sprechstundenhilfe gebeten, im Sprechzimmer Schuhe und Strümpfe zu entfernen. Durch die Kombination der Interventionen konnte sowohl das Selbstmanagement der Patienten als auch das Fußinspektionsverhalten und die nachfolgende Therapie von bereits bestehenden Läsionen positiv beeinflusst werden. Die Prävalenz an Läsionen und Ulzera der unteren Extremität bei Diabetikern der Interventionsgruppe ist signifikant gesunken. Der Aufbau des Präventionsprogramms basierte auf den beiden Prämissen, dass erstens einfache Interventionen von Seiten des Arztes und des Patienten das Risiko einer Amputation senken können [Litzelman et al., 1993] und zweitens, dass diese einfachen und kosteneffektiven Interventionen von Ärzten und Patienten häufig nicht systematisch angewendet werden [Litzelman et al., 1993]. Zudem werden die Läsionen an Füßen von Diabetikern häufig nicht adäquat klassifiziert und nachfolgend nicht systematisch und evidenzbasiert therapiert. 71 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 72 Programmübersicht: Programmname: Reduction of Lower Extremity Clinical Abnormalities in Patients with Non-Insulin-Dependen Diabetes Mellitus. Rahmen: Ambulanz eines Universitätsklinikums. Zielerkrankung: Diabetes Mellitus (Fußläsionen). Anzahl Patienten: 352 Diabetiker. Patientenidentifikation: Arzneimittelverordnungen, Laboranforderungen, Krankenhausentlassungsdiagnosen (ICD-9). Interventionszeitraum: 2 Jahre; Randomisierte, kontrollierte Studie. Ziele des Programms: Das Programm zielte auf eine Verringerung der Risikofaktoren, die zu Fußulzera und Fußamputationen bei Diabetikern führen. Dazu wurden Interventionen auf der Patientenebene (Stärkung des Selbstmanagements), der Ärzteebene und der organisatorischen Ebene durchgeführt. Programmstruktur: Es handelt sich um einen systematischen Ansatz, der unterschiedliche Ansätze integriert. Der Ansatz wurde in der Ambulanz eines Universitätsklinikums mit 4 unterschiedlichen Ambulanzteams implementiert. Komponenten: Patientenuntersuchung und Anamnese (Tabelle 17). Patientenvertrag (Tabelle 19). Patientenschulung (Tabelle 18). Remindersystem für Patienten (Telefonisch und per Postkarte). Individuelle Therapieleitlinien. Algorithmus für Ärzte (leitlinienbasiert). Vordruck- und Reminder (Druckformat) für Ärzte zur Feststellung und Dokumentation von Risikofaktoren und zur Erinnerung an notwendige Maßnahmen. Ergebnisse: Patienten der Interventionsgruppe hatten weniger Fußläsionen oder andere dermatologische Risikofaktoren (z.B. Fußpilz, trockene und rissige Haut, eingewachsene Zehennägel) für die Entstehung eines Ulkus. Sie führten häufiger Selbstmanagementtechniken (z.B. Fußinspektion, Vermeidung von Heizkissen) durch, erhielten häufiger In72 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 73 spektionen der Füße mit Überprüfung der Fußpulse und Klassifizierung der Läsionen. Bei Patienten der Interventionsgruppe wurde in 68% aller Arztbesuche eine Fußinspektion durchgeführt (Kontrollgruppe 28%; p<0,001). Patienten der Interventionsgruppe erhielten häufiger Schulungen über richtige Fußpflege (42% vs. 18%; p< 0,001). Patienten der Interventionsgruppe wurden häufiger in die Fußsprechstunde überwiesen (10,6% vs. 5%; p=0.04). Patienten der Interventionsgruppe hatten eine niedrigere Prävalenz an Läsionen und Ulzera der Füße (p=0,05). Kritik: Durch die Intervention wurden nicht alle Aspekte des Fußpflegeverhaltens angesprochen, da die Formulierungen zum Teil zu unspezifisch waren. Bei Aspekten des Fußpflegeverhaltens, die detailliert im Patientenvertrag erklärt wurden, konnte eine Verbesserung nachgewiesen werden. Wurden allgemeine Formulierungen verwendet, wie beispielsweise „Schutz der Füße vor Verletzungen“, so resultierte daraus keine Veränderung des Selbstmanagements. Die Überweisungsrate in die Fußambulanz/ Fußsprechstunde blieb unbefriedigend. Durch die Kürze der Studiendauer und die geringen Patientenzahlen konnte kein Einfluss auf die Amputationsrate untersucht werden. Durch die Integration verschiedener Komponenten kann der Einfluss einzelner Interventionen nicht beurteilt werden. Komponenten: Ein hoher Stellenwert im Programm kommt der eingehenden klinischen Untersuchung und Anamnese zu (Tabelle 17). Im Rahmen der Sprechstunde wurden von einer speziell geschulten Diabetesschwester eine Beurteilung der Risikofaktoren für Läsionen und nachfolgende Amputation vorgenommen. Dazu gehörte neben der In73 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 74 spektion die Anamnese des Selbstmanagements- Verhaltens des Patienten, die Demonstration der Fußinspektion und des Fußpflegeverhaltens durch den Patienten, die Klassifizierung vorhandener Läsionen nach Schweregrad sowie die Suche nach dermatologischen und orthopädischen Erkrankungen (z.B. Fußpilz, Halux valgus) und die Beurteilung ob eine Neuropathie bzw. eine periphere arterielle Verschlusskrankheit vorliegt. Tabelle 17: Patienten Anamnese und Untersuchung Inhalte der Anamnese Diabetesdauer, Therapie, Ulzera, etc. Inhalte der Untersuchung Laboruntersuchungen (Blutzucker; HbA1c, High Density Lipoproteine) Durchgeführtes Fußpflegeverhalten Demonstration der Fußinspektion durch Patienten, ggf. Hilfestellung durch Team Fußinspektion durch Arzt / Schwester inklusive Fußpulsstatus (periphere arterielle Verschlusskrankheit), Beurteilung von neurologischen (Neuropathie?), dermatologischen (z.B. Klassifikation von Läsionen, Fußpilzbefall?) und orthopädischen Risikofaktoren (z.B. Fußdeformitäten?) [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Litzelman et al. 1993] Die Patientenschulung wird von einer speziell weitergebildeten Diabeteskrankenschwester durchgeführt. In der Regel handelt es sich um Gruppenschulungen mit bis zu 4 Patienten pro Sitzung. Zwei Wochen nach jeder Schulung wurde ein telefonisches Follow-up durchgeführt. Im Rahmen des Follow-up wurden Fragen beantwortet und der Patient an die selbstgesetzten Ziele und Verhaltensmaßnahmen erinnert. 1 und 3 Monate nach der Schulung wurden Postkarten verschickt, die die Patienten an die Inhalte des Patientenvertrags erinnerten. Tabelle 18: Patientenschulung Schulungsmaterialien Schulungsinhalte Kleingruppenunterricht Fußpflegeverhalten Einsatz audiovisueller Medien Schuhwerk [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Litzelman et al. 1993] Der Patientenvertrag ist ein wichtiger Bestandteil des Programms, da er selbstgesetzte Patientenziele spezifiziert. Zudem dient er als Grundlage für das ReminderSystem (Tabelle 19). 74 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 75 Tabelle 19: Patientenvertrag Schriftliche Fixierung von SelbstmanagementInhalten, die der Patient durchführt Regelmäßige Inspektion der Füße Detaillierte Angaben zur Fußpflege wie z.B. Vermeidung von Verletzungen, Vermeiden von Barfußlaufen, Vermeiden von Heizkisse, Wärmflaschen, etc. Prüfung der Wassertemperatur beim Baden Trockene Zehenzwischenräume ... [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Litzelman et al. 1993] 2.5 Beispiel 5: Organisationsmanagement (Algorithmusanwendung im Krankenhaus / Clinical Pathway, Spezialsprechstunde, Ambulante Betreuung), individuelle Therapieempfehlungen und Patientenschulung Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung mit hoher Morbidität und Mortalität in den fortgeschrittenen Stadien. Insbesondere stationäre Aufenthalte sind für die große ökonomische Bedeutung dieser häufig auf dem Boden einer Koronaren Herzkrankheit sich entwickelnden Erkrankung verantwortlich. Die Wiederaufnahmeraten innerhalb der ersten drei Monate nach Krankenhausentlassung sind hoch. Herzinsuffizienz Disease Management Programme versuchen daher die Funktionalität dieser Patienten zu verbessern und Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Eine große Bedeutung kommt auch bei dieser chronischen Erkrankung dem Selbstmanagement zu. Viele Programme investieren daher in eine Steigerung der Compliance des Ernährungsverhaltens und trainieren das Erkennen von Warnsymptomen für eine beginnende Zustandsverschlechterung („Patientenfrühwarnsystem“) wie beispielsweise die Gewichtszunahme oder beginnende Kurzatmigkeit. Evanston Northwestern Healthcare entwickelte ein Programm für eine sektorenübergreifende und kontinuierliche, individuelle Betreuung und Unterstützung von Herzinsuffizienzpatienten [Knox et al., 1999]. Dazu gehören ein Therapie- und Betreuungsalgorithmus im stationären Bereich mit einem Nachbetreuungskonzept für den ambulanten Bereich , ggf die Wie- 75 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 76 dereinbestellung in Spezialsprechstunden, eine ambulante Betreuung durch einen Herzinsuffizienzkoordinator und ein Compliance-Monitoring mittels Telemangement. Programmübersicht: Programmname: Evanston Northwestern Healthcare (ENH) Congestive Heart Failure Program. Rahmen: Lehrkrankenhaus der Northwestern University, bestehend aus zwei Standorten mit je 400 bzw 200 Betten und 500 respektive 300 Einweisungen aufgrund von Herzinsuffizienz pro Jahr. Zielerkrankung: Herzinsuffizienz. Anzahl Patienten: nicht berichtet. Patientenidentifikation: nicht berichtet. Interventionszeitraum: nicht berichtet. Ziele des Programms: Ziele des Programms sind Verbesserung der stationären Versorgungsergebnisse, Verringerung der Rate an Krankenhauseinweisungen und akuten Wiederaufnahmen innerhalb von drei Monaten nach Krankenhausentlassung. Nach einer Analyse des Status Quo sollten folgende Bereich gezielt verbessert werden: Dokumentation der linksventrikulären Funktion bei allen Herzinsuffizienzpatienten nach vorgegebenem Algorithmus; Sicherstellung der Nachbetreuung nach Entlassung; Tägliches Wiegen und Gewichtsdokumentation bei allen Herzinsuffizienzpatienten; Einführung eines „Frühwarnsystems“, um Veränderungen im klinischen Status bei Herzinsuffizienzpatienten zu dokumentieren und entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung möglichst schon ambulant einzuleiten; Organisation der Sozialen Unterstützung; Verbesserung von Patientenschulung und Information; Identifikation von Patienten mit niedriger Compliance und hohem Risiko einer schnellen Wiederdekompensation und Wiederaufnahme. 76 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Programmstruktur: Seite 77 Es handelt sich um einen systematischen Ansatz, der unterschiedliche Interventionen integriert. Die Programmbestandteile wurden im stationären Ablauf und in der ambulanten Nachbetreuung implementiert. Komponenten: Algorithmus / Leitlinie für stationären Aufenthalt (Clinical Pathway). Individualisierte Patientenschulung (Tabelle 21). Spezialsprechstunde (Abbildung 5). Ambulante Betreuung (Tabelle 22). Compliance Monitoring / Telemanagement (CHF TelAssuranceTM)(Tabelle 21). Ergebnisse: Aufgrund der Implementierung des Patientenalgorithmus konnten die direkten Kosten um 50% gesenkt werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Klinik konnte um 2.2 Tage von 6.2 auf 4.0 Tage gesenkt werden. Nach Einführung des Algorithmus verbesserten sich die Parameter der Prozessqualität wie tägliches Wiegen, Frequenz der Diätberatung, Dokumentation der linksventrikulären Funktion, Verschreibung der indizierten Medikamente, Planung der ambulanten Weiterbetreuung. Senkung der Gesamtkosten durch die Implementierung von ambulanter Betreuung zu Hause. Ca. 10% aller Herzinsuffizienzpatienten nahmen eine ambulante Betreuung zu Hause in Anspruch. Die Kosten für die ambulante Betreuung sind wesentlich niedriger als die Kosten für eine Krankenhauseinweisung über die Notaufnahme. Die durchschnittliche Compliance der Patienten mit täglich telefonisch Gewicht und definierte Symptome zu berichten betrug 89,5%. Kritik: Der Implementierung von Algorithmen in der stationären Therapie wird oft erheblicher Widerstand mit dem Vorwurf der Standardisierung der Therapie entgegengesetzt. Insbesondere mangelnde Mitarbeit von Ärzten, ungenügende Dokumentation, keine zeitnahe Bereitstellung von Daten 77 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 78 und ungenügend ausdifferenzierte Algorithmen, die keine Anpassung an unterschiedliche Schweregrade der Erkrankung zulassen sind Barrieren bei der Implementierung von klinischen Algorithmen. Komponenten: Ein Algorithmus für die stationäre Versorgung entspricht einer angewandten Leitlinien, welche die effiziente, zeitnahe und qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten mit spezifischen Erkrankungen unterstützt. Zur Entwicklung und Implementierung eines klinischen Algorithmus sollte ein interdisziplinäres Team die aktuellen Therapieregime auf dem Boden evidenzbasierter Daten evaluieren. Zusätzlich müssen klinische Daten wie Aufenthaltsdauer, Wiederaufnahmeraten und direkte Kosten gesammelt und evaluiert werden. Daraus kann dann ein Algorithmus entwickelt und an lokale Gegebenheiten in unterschiedlichen Krankenhäusern angepasst werden. 78 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 79 Tabelle 20: Klinischer Patientenalgorithmus (Clinical Pathway) Ergebnisse: Erläuterungen der VarianzKodierung befinden sich in der evidenzbasierten Leitlinie. Wichtige Tagesergebnisse sind mit einem Pfeilsymbol (→) gekennzeichnet. Veränderungen der mit Pfeil gekennzeichneten Ergebnisse müssen Dokumentiert werden. Klinik Abnahme der Dyspnoe (Kurzatmigkeit) seit Aufnahme Vermehrte körperliche Aktivität seit Aufnahme möglich → Ohne positiv inotrope- Substanzen i.v.(ab Tag 4) → keine i.v. Diuretika mehr (ab Tag 4); Umstellung auf orale Medikation Stabile Nierenfunktion (Kreatininspiegel nicht erhöht) Ohne Sauerstofftherapie Normalgewicht erreicht Untersuchung und Dokumentation der linksventrikulären Funktion Schulung →Vorführung des KHK Videos ( am dritten Tag) Patient kann Risikofaktoren identifizieren und einen Plan entwickeln, um sie zu kontrollieren Patient lkann die Diagnose KHK und die dazugehörigen Anzeichen und Symptome erläutern Patient kann kochsalzarme Diät beschreiben Patient demonstriert Verständnis für Konzepte bezüglich der: täglichen Routine, Aktivitäten, Einschränkungen, körperlichen Aktivität und der Streßreduktion; Nach Entlassung aus Klinik tägliche Gewichtsmessung durch Patienten Patient erläutert Medikation und Nahrungsmittel/Arzneimittel Interaktionen Festsetzung der Indikatoren zur Arztkonsultation Einverständnis des Patienten zur Zusammenarbeit mit Hausarzt in einer Woche Medikation Patient wurde über folgende Arzneimittel informiert und mit den folgenden Arzneimitteln entlassen: Aspirin Digoxin Diuretika ACE- Hemmer Angiotensin Rezeptor Blocker Carvedilol Hydralazin Orale Antikoagulanzien Statin [Quelle: Knox et al., 1999] Datum: Patientenbedarf VarianzKodierung: Inititale: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Patientenschulung ist eine wichtige Komponente von Disease Management Programmen. Im Evanston Northwestern Healthcare Herzinsuffizienz Programm wurde die Patientenschulung während des stationären Aufenthaltes initiiert und nahtlos 79 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 80 während der ambulanten Betreuung weitergeführt. Drei Prioritäten wurden dabei patientenspezifisch berücksichtigt (Tabelle 21): Tabelle 21: Prinzipien der Individualisierten Patientenschulung Evaluation der Ursachen für mangelnde Compliance In welchen Bereichen ist mangelende Compliance mit einer direkten Verschlechterung des Krankheitsbilds verbunden? (z.B. keine Medikamenteneinnahme, Nicht-Einhaltung von Diätempfehlungen, mangelnde soziale Unterstützung) Identifikation der Gründe für mangelnde Compliance (Schulbildung, sozioökonomischer Status, Religion, soziales Umfeld, physische Einschränkungen wie Blindheit, ungenügendes Wissen über die Erkrankung) Unterstützung eines effektiven Schulungen im stationären und ambulanten Bereich sowie Selbstmanagements persönliche Informationsgespräche mit einer Herzinsuffizienz Schwester (Krankheitskoordinator) Geheftetes Informationsmaterial Tabelle zur Eintragung des täglichen Gewichts Empfehlungen zur körperlichen Bewegung und Ernährung Ein Programm Handbuch Videos Evaluation des häuslichen Umfeldes Medikamentenzählung und Therapieadjustierung Gesundheitsförderung „Empowerment-Seminar“, zu dem auch Familienangehörige eingeladen werden. Neben den üblichen Schulungsinhalten werden beispielsweise Restaurantempfehlungen gegeben [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Knox et al. 1999] Um eine optimale Compliance durch den Lernprozess zu fördern, stehen audiovisuelle Medien, gedruckte Medien und die Schulung zur Verfügung. Während des Klinikaufenthaltes wird das Wissen des individuellen Patienten über seine Erkrankung und mögliche Therapiemaßnahmen sowie mögliche Barrieren für eine gute Compliance evaluiert. Der Schulungsprozess wird initiiert und Schwerpunkte festgelegt. Die Spezialsprechstunde für Herzinsuffizienzpatienten wurde aufgrund von Wiederaufnahmeraten von 35% nach Entlassung innerhalb von 6 Monaten im Rahmen einer Krankenhausambulanz eingerichtet. Patienten wurden ca. 7 bis 10 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus einbestellt. Ein Schwerpunkt der Spezialsprechstunde waren Medikamentenanamnese und Dosisanpassung. Ca. 41% aller Herzinsuffizienzpatienten verringern selbständig die Dosierung oder setzen Medikament aufgrund von Nebenwirkungen vollständig ab. Für Patienten, die zu Sprechstunden zur Medikamentenanamnese und Dosisanpassung einbestellt sind, wird daher eine Stunde eingeplant. In dieser Zeit werden außer einer ausführlichen Anamnese und Erhebung der Vitalparameter die Informationsvermittlung im Arzt-Patienten-Gespräch durchgeführt. Das medikamentöse Therapieregime der Patienten wird daher in re80 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 81 gelmäßigen Abständen auf Nebenwirkungen und Interaktionen zwischen den einzelnen Medikamenten überprüft. In der Spezialsprechstunde wird die Patientenstratifizierung durchgeführt und ein langfristiger Therapieplan unter Berücksichtigung der Ätiologie aufgestellt. Der Therapieplan enthält Empfehlungen zur medikamentösen Therapie, zur körperlichen Aktivität, zu Ernährung und zur regelmäßigen Überwachung durch den Hausarzt. Diese patientenindividuellen Empfehlungen werden dem Hausarzt zugeschickt. Die klinische Risikostratifizierung berücksichtigt die linksventrikuläre Funktion, das Vorliegen einer Koronaren Herzerkrankung und / oder Rhythmusstörungen sowie die soziale Situation. Abbildung 5: Spezialsprechstunde und ihre Vernetzung Spezialsprechstunde Klinik (Ambulanz) Langfristiges Therapiekonzept nach Risikostratifizierung Empfehlungen zur Pharmakotherapie, körperlicher Bewegung und Ernährung, Titrationssprechstunde für Medikamente Kritik Betreuung, Therapieumsetzung Hausarzt Therapieumsetzung Betreuung Patient [Quelle: Eigene Darstellung] An die Entlassung aus dem Krankenhaus schließt sich die Betreuung durch den Herzinsuffizienzkoordinator/in an. Sie/Er ist eine speziell weitergebildete Krankenschwester /pfleger, die/der - falls notwendig - den Patienten innerhalb von 24 Stunden nach Entlassung aufsucht. Basisdaten wie Gewicht, Medikation und Laborwerte werden von dem Herzinsuffizienzkoordinator an die Spezialsprechstunde weiter geleitet. Die in der Klinik begonnene Schulung wird fortgeführt. Falls sich der klinische Zustand des Patienten verschlechtert, stehen dem Herzinsuffizienzkoordinator folgende Interventionen zur Verfügung, um den Patienten zu stabilisieren und eine Krankenhauseinweisung zu vermeiden (Tabelle 22): 81 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 82 Tabelle 22: Ambulante Maßnahnmen, die durch den Herzinsuffizienzkoordinator veranlasst werden können, um eine stationäre Einweisung zu verhindern Mögliche Interventionen 24-Stunden Krankenpflege i.v.-Gabe von Medikamenten Medikamentenanpassung nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt Anordnung von Laboruntersuchungen nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt Vorstellung in Spezialsprechstunde [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Knox et al. 1999] Das Complicance- Monitoring soll die Schulungsinhalte wiederholen, Frühwarnsymptome identifizieren und die Wahrscheinlichkeit einer stationären Einweisung senken. Die Hauptursache für die häufigen Wiedereinweisungen von Herzinsuffizienzpatienten innerhalb kurzer Zeit nach Entlassung sind die mangelnde Compliance mit der Einnahme der Medikation, den Ernährungsempfehlungen sowie dem täglichen Wiegen. Unter Umständen wiegt sich der Patient zwar täglich, benachrichtigt bei Gewichtszunahme aber nicht den Arzt. Das CHF Tel- Assurance TM Programm ist ein telefonbasiertes Monitoring- System, durch das täglich das Gewicht erfasst wird und kritische Symptome abgefragt werden (Tabelle 23). Tabelle 23: Compliancemonitoring durch Telemanagement Ziele Inhalte Steigerung der Compliance Senkung der Wiederaufnahmerate Tägliches Gewicht und Symptome*: Atemnot? Müdigkeit? Ödeme? Schlafstörungen aufgrund von Atemnot? Appetit? Körperliche Belastbarkeit? Brustschmerzen? Schwindel? Allgemeinzustand? Abweichungsanalyse Patient hat nicht angerufen Alarmsymptome Gewichtsveränderung *Die Fragen sind zur Vereinfachung abgekürzt und nicht patientenadaptiert widergegeben [Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Knox et al., 1999] 82 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 83 2.6 Beispiel 6: Reminder und Feedback für Ärzte und Patienten, patientenindividuelle Empfehlungen für den behandelnden Arzt John Deere Health Care versichert ca. 20 000 Diabetiker in 5 Staaten. Die direkten Kosten für Versicherte mit Diabetes Mellitus sind in der Regel dreifach höher als die Kosten für Versicherte ohne Diabetes Mellitus. Aus diesem Grund hat sich John Deere Healthcare entschlossen, ein Disease Management für Diabetiker einzurichten. Bestandteile des Programms sind ein Remindersystem per Telefon und Brief für asymptomatische Diabetiker, spezielle Betreuungsstrategien (Case Management) für Diabetiker mit Komplikationen oder Risikofaktoren sowie quartalsweise patientenindividuelle Berichte für die Leistungserbringer. Die Gesamtkosten für Diabetiker konnten mit diesen Maßnahmen um schätzungsweise 12% pro Diabetiker reduziert werden, obwohl Zusatzkosten für Verträge mit zusätzlichen Leistungserbringern (z.B. für das Remindersystem und Case Management) geschlossen werden mussten, Zusatzkosten für Ärztefortbildungen und Patientenschulungen anfielen und die Arzneimittelkosten aufgrund des Einsatzes von Metformin geringfügig angestiegen sind [Steffens, 2000]. Programmübersicht: Programmname: Living Healthy with Diabetes. Rahmen: John Deere Health Care: Health Maintenance Organisation in 5 Staaten (Iowa, Wisconsin, Tennessee, Illinois, Virginia). Zielerkrankung: Diabetes Mellitus. Anzahl Patienten: 10 000 Diabetiker in Programm eingeschrieben. Patientenidentifikation: nicht spezifiziert. Interventionszeitraum: Zum Evaluationszeitpunkt 1 Jahr, Projekt läuft noch. Ziele des Programms: Primäres Ziel des Programms ist die Senkung der HbA1cWerte von Diabetikern. Dazu wurden verschiedene Interventionen implementiert und die Messung durch den Arzt und Patienten (Blutzucker) unterstützt. 83 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Programmstruktur: Seite 84 Es handelt sich um einen systematischen, strukturierten und populationsbezogenen Ansatz in der primärärztlichen Versorgung, an der Hausarztpraxen in 5 Staaten der USA teilnahmen. Komponenten: Vertragsgestaltung mit Kostenübernahme für Materialien zur Blutzuckerselbstmessung für alle Diabetiker (nicht nur Typ 1) und erweiterte Abrechenbarkeit von Schulungen. Remindersystem für Ärzte und Patienten (Tabelle 24). Newsletter für Ärzte und Patienten (vierteljährlich). Benchmarking (Tabelle 25). Patientenindividuelle Empfehlungen für den behandelnden Arzt (Reminder, Screening-Kalender, spezifische Patientenergebnisse und darauf abgestimmte Informationen). Ergebnisse: Deutliche Verbesserung in der Rate der Messung von HbA1c, Blutfetten und Microalbuminurie-Screening. Die durchschnittlichen HbA1c-Werte sanken von 8,2% auf 7,7% (alle Diabetiker des Programms). Eine Senkung konnte in den Krankenhauseinweisungen, in der Krankenhausaufenthaltsdauer und in den monatlichen Kosten pro Mitglied erreicht werden (Tabelle 26). Die durchschnittlichen Gesamtkosten sanken von $471 pro Mitglied pro Monat auf durchschnittlich $411 pro Mitglied pro Monat. In die Kosten wurden nicht nur diabetesbedingte Kosten, sondern alle Kosten (z.B. auch die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Hüftfraktur mit TEP) eingerechnet. Kritik: Es ist unklar, nach welchen Kriterien die 10 000 Diabetiker in das Programm eingeschrieben wurden. Der Einfluss der einzelnen Komponenten kann nicht eruiert werden. Die Gesamtkosten des Programms werden nicht aufgeführt. 84 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 85 Tabelle 24: Reminder-System für Ärzte und Patienten Ärzte Patientenindividuelle Reminder, Screening-Kalender und Informationen werden automatisch zugeschickt Patienten Telemanagement und Zusendung von Informationsmaterial per Post nach Risikostratifizierung: Es wurden 4 Risikogruppen gebildet, denen entsprechende Interventionsintensitäten zugeordnet wurden. Die Interventionen orientierten sich zudem an Komplikationen und aktuellem Gesundheitszustand. Beispielsweise wurde ein Diabetiker, der einen Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Ketoacidose hatte nach Entlassung bis zur Stabilisierung engmaschiger durch Telemanagement unterstützt. Patienten, die zusätzlich eine Koronare Herzkrankheit aufwiesen, bekamen beispielsweise Informationen und Reminder zum Thema Lipidsenkung, Ernährung, Bewegung. [Quelle: Steffens, 2000] Tabelle 25: Benchmarking Best Practice Best Practice Information wird jedem Arzt quartalsweise zur Verfügung gestellt. Sie enthält die individuellen Werte seiner Patienten, Überweisungsund Screeningraten, sowie aktuelle Informationen über Diabetes Mellitus und das Programm selbst. [Quelle: Steffens, 2000] 85 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 86 Abbildung 6: Diabetiker-Patientenakte des John Deere Health Care´s Versorgungsstandards Care Manager: Telefon: Fax: Hausarzt: Telefon: Fax: ID – Nummer: Patientenname: Geburtsdatum: Mitgliedsnummer: HMO Code: Gewicht: Vitalwerte Datum: Gewicht [kg]: Blutdruck: systolisch/diastolisch Fußuntersuchung: (j oder n) Viertel-/Halbjährliche Tests Datum: HbA1c: *IR-alle 3 Monate **NIR-alle 6 Monate Jährliche Untersuchungen Serum Kreatinin: Lipid-Profil: Gesamt Cholesterin HDL LDL Triglyizeride Microalbuminurie: Micral-II Zufällig 24-Stunden Andere Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Einheit Datum Einheit Datum Einheit Datum Einheit Datum Datum Datum Datum Datum Fußinspektion: Erweiterte Augenuntersuchung: Prävention Grippeimpfung:(jährlich) PneumokokkenImpfung Datum Datum Datum Dokumentation Schulung: Beratung: Dokumentation Rauchen: Aufgehört: *IR = insulinpflichtig **NIR = nicht insulinpflichtig [Quelle: Steffens, 2000] 86 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 87 Tabelle 26: Ökonomische Evaluation Untersuchungshäufigkeiten HbA1c-Wert +19% Lipid-Wert +20% Microalbumin-Wert +78% Augenuntersuchung + 6% Medizinische und ökonomische Entwicklung HbA1c-Werte -0,5% (absolut) von 8,2% zu 7,7% Stationäre Einweisungsrate -22% Stationäre Aufenthaltsdauer -34% Gesamte PMPM*-Kosten 9 Monate -12% nach Programmeinführung *PMPM = pro Mitglied pro Monat Quelle: Steffens, 2000. 2.7 Beispiel 7: Installation eines Elektronischen Monitoring-Systems und Gruppensprechstunden für Diabetiker Ziel diese Programms, das in einer Landpraxis implementiert wurde, war es, die Blutzuckereinstellung von Diabetikern zu verbessern. Dazu wurde ein Datenmanagementsystem mit Reminder und Feedback eingesetzt. Patienten mit einem HbA1c >8% wurden wie folgt identifiziert: Bei jedem Praxisbesuch wurde für den Arzt ein Patientenbericht ausgedruckt, der einen generellen Überblick über den Patientenstatus gibt. Dazu gehören Anzahl der besuchten Schulungen, Fußinspektionen, Laborwerte (u.a. HbA1c), aktuelle Medikation, wichtige Daten aus der Anamnese. Zusätzlich wurde vom System alle 6 Wochen unabhängig von Praxisbesuchen eine Liste mit den Namen der Patienten generiert, deren HbA1c > 8% lag. Zusätzlich wurden Gruppensprechstunden für Patienten mit einem HbA1c > 8% eingerichtet und die individuelle Beratung während der regulären Sprechstunde verstärkt [Stoner et al., 2001]. 87 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 88 Programmübersicht: Programmname: Improve Glycemic Control für Patients with Diabetes in a Rural Fee-for-Service Practice. Rahmen: Arztpraxis. Zielerkrankung: Diabetes Mellitus. Anzahl Patienten: 182 Diabetiker. Patientenidentifikation: Patienten mit den ICD-9 Diagnosen 250.0-259.9 aufgrund von Abrechnungsdaten. Interventionszeitraum: 2 Jahre. Ziele des Programms: Testung der Übertragbarkeit von erfolgreichen Interventionen aus einer Managed Care Umgebung auf eine Praxis mit Einzelleistungsabrechung. Evaluation aufgrund der Veränderung der HbA1c-Werte. Komponenten: Installation eines Intelligenztechnologie-Systems zum elektronischen Datenmanagement, Datenüberwachung und Feedback. Gruppensprechstunden Ergebnisse: Der Median der HbA1c-Werte sank von 8,7% (März 1998) auf 7,5% im März 1999 und konnte auf diesem Niveau stabilisiert werden (März 2000). Kritik: Der Einfluss einzelner Interventionen kann nicht abgeschätzt werden. Zusätzlich zu den beschriebenen Interventionen kann ein positiver Effekt vom direkten Feedback von Laborergebnisse an Patienten erwartet werden. In der Praxis wurde dazu ein Latex Immunagglutinations-Test eingesetzt. So konnten die Patienten noch während der Sprechstunde die Ergebnisse ihres HbA1c-Wertes mit dem Arzt bzw. einer diabetologisch weitergebildeten Sprechstundenhilfe besprechen. Komponenten: Zur Implementierung des Datenmanagementsystems wurde ein bereits bestehendes System einer Managed Care Organisation an die Bedürfnisse einer Landpraxis angepasst. Die wichtigsten Schritte zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle für Pati88 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 89 enten mit Diabetes Mellitus in einer Landpraxis mit Einzelleistungsvergütung zeigt Tabelle 27. Tabelle 27: Vorgehen zur Implementierung eines Datenmanagementsystems 1. Erfassung aller Patienten mit der Diagnose Diabetes mellitus 2. Zusammenfassung aller benötigten medizinischen Patienteninformationen zur Bewertung der medizinischen Versorgung 3. Installation des Diabetes Care Monitoring System (DCMS), (computergestütztes System) Eingabe der aus den Patientenakten gesammelten Informationen in das DCMS-Programm Ausdruck einer einseitigen Zusammenfassung des gegenwärtigen Status für jeden Patienten Diese Zusammenfassung jeder Patientenakte zufügen 4. Gebrauch des DCMS-Behandlungsstands bei jeder Patientenvisite Identifikation und Zuteilung von anstehenden Tests/Untersuchungen Aktualisierung des DCMS Datensatzes Patientenaufklärung über den persönlichen Status 5. Gebrauch der DCMS-Daten zur Festlegung eines Versorgungsmusters für die Gesamtheit der Patienten Identifikation von Bereichen, in denen Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgungsstruktur bestehen 6. Entwicklung und Implementierung von Handlungsstrategien zur Versorgungsverbesserung Bestimmung von schon erfolgreichen Interventionen Übernahme der Intervention in die lokale Anwendung (siehe detaillierte Beschreibung) 7. Bewertung der Effektivität dieser Handlungsstrategien DCMS-Akten erlauben häufige zwischenzeitliche Evaluationen Modifikation der Verbesserungsstrategie im Sinne des festgesetzten Zieles 8. Mitteilung der Ergebnisse an alle relevanten Gruppen Den Mitarbeitern den Nutzen für den Patienten durch die eigene Anstrengung aufzeigen Veröffentlichung der Ergebnisse, damit andere Versorgungseinrichtungen erfolgreiche Strategien übernehmen können [Quelle: Stoner et al., 2001] 2.8 Beispiel 8: Schulung und Unterstützung des Krankheitsselbstmanagements Jaarsma et al. führten eine randomisierte Studie zur Verbesserung der Versorgungsqualität und des Selbstmanagements von Patienten mit Herzinsuffizienz NYHAKlassifizierung III-IV in Maastricht durch [Jaarsma et al., 1999]. Die Intervention, an der 179 Patienten teilnahmen, bestand aus intensiver, systematischer und geplanter Schulung der Patienten durch eine weitergebildete Krankenschwester und die Unterstützung des Patientenselbstmanagements durch die Krankenschwester. Die Intervention wurde im Krankenhaus begonnen und bis eine Woche nach Krankenhausentlassung weitergeführt. Das Selbstmanagement der Patienten mit Herzinsuffizienz verbesserte sich durch die Intervention signifikant und blieb auch acht Monate nach Entlassung aus dem Krankenhaus statistisch signifikant. 89 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 90 Programmübersicht: Programmname: Effects of education and support of self-care and resource utilization in patients with heart failure. Rahmen: Universitätsklinik Maastricht, Niederlande. Zielerkrankung: Herzinsuffizienz. Anzahl Patienten: 179 Patienten. Patientenidentifikation: Bestätigte Einweisungsdiagnose. Interventionszeitraum: 3 Jahre. Ziele des Programms: Verbesserung des Selbstmanagements und Verringerung der Ressourcen-in-Anspruchnahme von Patienten mit Herzinsuffizinz durch intensive Schulung und Unterstützung des Selbstmanagements. Programmstruktur: Radomisierte klinische Studie, von der Einweisung bis 10 Tage nach Entlassung. Komponenten: Schulung. Unterstützung des Selbstmanagements durch ambulante Nachbetreuung nach Entlassung (einmalig). Ergebnisse: Signifikante Verbesserung des Selbstmanagements in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Veränderungen hielten über den Nachuntersuchungszeitraum von 8 Monaten an. Kritik: Obwohl die Patienten der Interventionsgruppe gegenüber einer Verschlechterung ihrer Symptome sensibilisiert wurden und aufgefordert wurden, ihren Hausarzt oder die Notfallambulanz aufzusuchen, wurde kein erhöhter Ressourcenverbrauch beobachtet. Allerdings sind in dieser europäischen Studie die stationären Wiederaufnahmeraten der Interventionsgruppe nicht signifikant gesunken. Die Autoren erklären dies mit einer per se niedrigeren Wiederaufnahme bei Herzinsuffizienzpatienten im Vergleich zu amerikanischen Studien und durch das Fehlen eines adäquaten Nachbetreuungssystems, beispielsweise durch den Hausarzt. Patienten dieser Studie konnten zwar die Ver90 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 91 schlechterung ihrer Symptome einschätzen, oft gelang es aber nicht, rechtzeitig auch einen Termin beim Hausarzt zu bekommen, so dass eine weitere Verschlechterung des Zustandes eintrat, die zu einer Krankenhauseinweisung führte. 2.9 Beispiel 9: Organisationsmanagement In dieser prospektiven Studie von Hershberger et al. wurden Leitlinien, Telemanagement, gezielte Krankenhauseinweisung von Patienten, die sich kontinuierlich verschlechterten, sektorenübergreifende Betreuung poststationär, psychosoziale Betreuung und Schulung eingesetzt [Hershberger et al., 2001]. Speziell weitergebildete Krankenschwestern waren 24 Stunden pro Tag für die Patienten erreichbar, um die Kontinuität der Betreuung zu sichern. Bei Klinikeinweisung wurde eine intensive Anamnese und klinische Untersuchung durchgeführt. Die Patientenschulung begann in der Klinik und wurde im ambulanten Bereich fortgeführt. Ein langfristiger Therapieplan wurde mit dem Patienten besprochen und von einem Herzinsuffizienzkoordinator (Krankenschwester oder Pfleger) vom stationären in den ambulanten Bereich koordiniert. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus wurde der Patient durch den Koordinator je nach Risikostratifizierung und klinischem Zustandsbild wöchentlich, zweiwöchentlich oder sechswöchentlich kontaktiert. Im Rahmen der Betreuung durch den Koordinator wurden je nach Risikostratifizierung Symptome und Laborwerte abgefragt und eine Medikamentenanamnese durchgeführt. Wurde ein Patient in der Notfallambulanz vorgestellt, so wurde die Betreuung intensiviert. Im Rahmen des Schulungsprogramms wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Rolle der Kochsalzrestriktion, die medikamentöse Therapie, Warnsymptome einer beginnenden Verschlechterung sowie detaillierte Anweisungen, wann der Koordinator bzw. der Arzt kontaktiert werden sollte, zu klären. 91 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 92 Programmübersicht: Programmname: Outpatient Heart Failure Management Program. Rahmen: Universitäres Herzinsuffizienzmanagement-Programm zur ambulanten Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz in Portland, Oregon, USA. Zielerkrankung: Herzinsuffizienz. Anzahl Patienten: 108 Patienten mit Herzinsuffizienz. Patientenidentifikation: Freiwilliges Überweisungsprogramm. Diagnosesicherung durch klinische Evaluation, Röntgenaufnahme des Thorax, Angiographie. Interventionszeitraum: 18 Monate und 6 Monate Nachuntersuchungszeitraum. Ziele des Programms: Verbesserung der ambulanten Versorgung mit Verringerung der Wiederaufnahmerate von Patienten mit Herzinsuffizienz durch Telemanagement (Telefonbasierte Reminder, Zustandsabfrage und Initiierung weiterer Interventionen nach Ergebnis), geplante und betreute Krankenhausaufenthalte bei dekompensierten und dekompensierenden Patienten, Betreuung und Planung von Krankenhausentlassung und Aufstellung individueller Therapieempfehlungen auf dem Boden evidenzbasierter Konsensus-Leitlinien, individuelle Schulungen stationär und ambulant, gezielte Gabe von Informationsbroschüren nach Krankheits- und Wissensstand, 24-Stunden-Erreichbarkeit eines Herzinsuffizienzkoordinators (Telemanagement- Koordinator). Programmstruktur: Prospektive Studie. Komponenten: Telemanagement (Abbildung 7). Herzinsuffizienz-Koordinator-Leitlinien. Individuelle Therapieempfehlungen. Schulungen und gezielte Informationsgabe. 24-Stunden-Erreichbarkeit des Koordinators und ggf. eines Arztes. Geplante und betreute Krankenhausaufenthalte, Entlassung und ambulante Weiterbetreuung. 92 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Ergebnisse: Seite 93 In den Bereichen Wissen und Selbstmanagement zeigten sich signifikante Verbesserungen. In den Bereichen Erkennen von Gewichtszunahme als potenzielles Symptom einer Zustandsverschlechterung, die Notwendigkeit des täglichen Wiegens, sowie die Kochsalzrestriktion in der Ernährung wurden auch in der Nachbeobachtungsphase signifikante Verbesserungen beobachtet. Im medikamentösen Bereich konnte ein signifikanter Anstieg der Verordnung von ACE- Hemmern, sowie eine bessere Versorgung mit beta- Blockern beobachtet werden. Die Untersuchung der Lebensqualität der Patienten ergab signifikante Verbesserungen in der Interventionsgruppe (Tabelle 29). Ökonomische Ergebnisse: Die Einsparungen durch das Programm wurden auf $516890 geschätzt. Das Telemanagement wurde mit 20 bis 30 Minuten pro Patient und Monat in den ersten 3 Monaten angesetzt, für die folgenden Monate wurden 5 bis 10 Minuten pro Patient gerechnet. Die Zahl der ambulanten Besuche durch die Koordinatoren betrug durchschnittlich 3.3 pro Patient während der 6-monatigen Nachbeobachtungszeit. Die Gesamtkosten des Koordinators pro Patient wurden mit $66,8 angesetzt. Kritik: Es handelt sich nicht um eine kontrollierte oder randomisierte Studie, es gab entsprechend keine Kontrollgruppe. Der Effekt einzelner Interventionen kann nicht eruiert werden. Dies war allerdings auch nicht die Absicht des Programms. Aufgrund der kleinen Zahlen und der kurzen Nachbeobachtungszeit kann die Studie nicht als repräsentativ gelten. 93 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 94 Komponenten: Tabelle 28: Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen 6 Monate vor und 6 Monate nach Überweisung der Studien-Patienten (n = 108) Ressource Stationäre Einweisung aufgrund kardiovaskulärer Ursachen total Standardabweichung schon vorherige stationärer Aufenthalt, Anzahl Hospitalisierungsrate (%) mittlere Verweildauer Verweildauer insgesamt Notaufnahmen aufgrund kardiovaskulärer Ursachen total schon vorheriger Notaufnahme, Anzahl Notfälle (%) Gesamtkosten stationär Stationäre Kosten pro Patient 6 Monate vor Programmstart 6 Monate nach Programmstart 94 0,85 +/-1,15 64 56,1 4,0 (1-25) 470,6 Tage 39 0,53 +/-0,93 36 27,2 6,0 (1-21) 321 83 59 19 16 53,6 $883.412,00 $7.361,00 14,5 $366.522,00 $3.054,00 [Quelle: Hershberger et al., 2001] Tabelle 29: Veränderung der Lebensqualität und des funktionellen Status Variable Anzahl % Abweichung Lebensqualität Verbesserung nach 3 Monaten 55 69,6 <0,001 Verbesserung nach 6 Monaten 61 68,6 <0,001 NYHA-Klassifizierung 2 0,002 verbessert 34 31,5 unverändert 55 50,9 verschlechtert 19 17,6 Müdigkeit und Dyspnoe Verbesserung nach 3 Monaten 43 54,4 0,27 Verbesserung nach 6 Monaten 50 56,2 0,12 Gesamteinschätzung des Patienten 55 69,6 Verbesserung des Ausgangszustandes nach 3 Monaten 3 Verbesserung von 3 bis nach 6 Monaten 45 50,6 1 Analyse basierend auf 89 Patientenbefragungen, welche sowohl an der Baseline, 3-Monatigen und 6Monatigen Befragung teilgenommen haben 2 Basierend auf Befragung von 108 Patienten nach 6 Monaten zu Veränderungen innerhalb der NYHA-Einteilung (New York Heart Association- classes) 3 Zehn Patienten beantworteten den Fragebogen nach 3 Monaten nicht [Quelle: Hershberger et al, 2001] 94 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 95 Abbildung 7: Telemanagement Erstbesuch Telemanagement Routinearztbesuche Krankenhauseinweisung aus versch. Ursachen Dekompensation Pat.-Anruf bei Arzt/Koodinator Verschlechterung Laborwerte verstärktes Telemanagement kürzere Abstände Routinearztbesuch je nach klinischem Zustand Preemptive Hospitilization Anamese klinischer Status Therapieplan mit diagnostischer und therapeutischer Intervention auf Basis evidenzbasierter Leitlinien individualisierte Schulung durch Koordinator Schulung Therapieanpassung klinische Evaluation diagn. / therap. Intervention nach Leitlinien Zustandsverschlechterung bei Routinearztbesuch verstärktes Telemanage-ment + Leitlinien-Intervention nach Bedarf Planung und Betreuung während des Krankenhausaufenthaltes durch Programmpersonal Quelle: Hershberger et al., 2000. 95 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Seite 96 2.10Beispiel 10: Leitlinieneinsatz, Feedback, Ärztefortbildung In der Primär- und Sekundärprävention der Koronaren Herzerkrankung spielt das Screening und die Therapie der Hyperlipidämie eine wichtige Rolle. In 27 Health Maintenance Organisationen der USA wurde daher ein 3-Stufen-Programm zum Management der Hyperlipidämie bei Patienten mit einer Koronaren Herzerkrankung bzw. den Risikofaktoren zur Entwicklung einer Koronaren Herzerkrankung eingeführt [Patel et al., 2001]. Auf der ersten Stufe werden die üblichen Therapieschemata und das übliche klinische Management der Hyperlipidämie sowie die Therapieergebnisse untersucht. Ziel dieser Stufe ist es, dass jeder Patient die Zielwerte mit dem kosteneffektivsten Statin erreicht. Dazu werden patientenindividuelle Risiken bestimmt und die Patienten in Risikoklassen eingeteilt. Dies geschieht auf der Grundlage von ca. 300 zufällig ausgewählten Patientenakten, die von Experten beurteilt werden. Zu den aus der Akte erhobenen Daten gehören soziodemographische Daten, Risikofaktoren für die Koronare Herzerkrankung, kardiale Ereignisse, Komorbiditäten und Begleitmedikation, die aktuelle Statintherapie mit Nebenwirkungen, Laborwerten und der Frage ob der Zielbereich erreicht wurde. Auf der zweiten Stufe werden auf dem Boden der Ergebnisse von Stufe 1 Interventionen entwickelt. Dazu gehören Ärztefortbildungen, Therapiealgorithmen, Feedback an die Ärzte mittels Rundbriefen und persönliche Beratung von Ärzten auf dem Boden ihrer eigenen Patientendaten. In Stufe 3 werden nach 6 Monaten die Patientenakten nochmals durchgesehen und die Ergebnisse evaluiert. Programmübersicht: Programmname: Hyperlipidemia Outcomes Management Program. Rahmen: Health Maintenance Organisation. Zielerkrankung: Primär- bzw. Sekundärprävention der Koronaren Herzkrankheit (Hyperlipidämie). Anzahl Patienten: 7 619 Patienten mit Hyperlipidämie, von denen bei 3 018 eine Koronare Herzkrankheit diagnostiziert war. Patientenidentifikation: Aktendurchsicht. 96 Disease Management in Deutschland – Komponenten / Erkrankungen Ziele des Programms: Seite 97 Sekundärprävention bei Patienten mit Hyperlipidämie nach eingetretenem Herzinfarkt. Primärprävention bei Patienten mit diagnostizierter Hyperlipidämie und weiteren Risikofaktoren für eine KHK. Komponenten: Identifikation von Diskrepanzen zwischen aktuellen Therapieschemata und Empfehlungen von Leitlinien durch Aktendurchsicht. Ärztefortbildung: Inhalt der Fortbildungsveranstaltungen sind Feedback bezüglich der Ergebnisse des eigenen Programms. Behandlungsalgorithmen: Spezielle Behandlungsempfehlungen für unterschiedliche Risikoklassen von Patienten. Briefe: Sie dienen hauptsächlich dem Feedback und der Fortbildung der Ärzte und haben ähnliche Inhalte wie die Fortbildungsveranstaltungen. Individuelle Ärzteberatung: Für Ärzte, die die Programmziele nicht erreichen, stehen individuelle Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, in denen auch ausführliche Primär- und Sekundärliteratur diskutiert wird. Evaluation. Ergebnisse: 87% aller Patienten mit einem Zielwerte von LDL <160 mg/dl erreichten diesen, 65% der Patienten mit einem Zielwerte von < 130 mg/dl erreichten diesen Wert, 44% der Patienten mit einem Zielwert < 100 mg/dl erreichten den Zielwert. Es wurde häufig nicht das kosteneffektivste Statin eingesetzt. Häufig waren auch Dosisanpassungen notwendig. Kritik: Es handelt sich um eine Intervention zur Primär- und Sekundärprävention der Koronaren Herzkrankheit. Je strenger die Zielwerte gesetzt wurden, um so geringer wurde die Anzahl der Patienten, die diese erreichten. Es wurde keine ökonomische Evaluation durchgeführt. 97 Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 98 Entwicklung der Komponenten von Disease Management 3 Evidenzbasierte Leitlinien Evidenzbasierte Leitlinien für Ärzte und Patienten (Experten-, Anwender- und Patientenversion) 3.1 Einleitung Evidenzbasierte, medizinische Leitlinien gelten heute in den meisten industrialisierten Ländern als Standard der medizinischen Versorgung. Die historische Entwicklung nahm im angloamerikanischen Sprachraum ihren Anfang. In Deutschland forderte der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen schon 1994 den verstärkten Einsatz evidenzbasierter Leitlinien in allen Bereichen der Patientenversorgung. In der Anfangsphase der Leitlinienentwicklung, die durch einen relativen Aktionismus in der Produktion von Leitlinien geprägt wurde, folgte die Suche nach einer angemessenen Methodik, um die Entwicklung qualitativ hochwertiger Leitlinien zu fördern. Inzwischen sind in Deutschland erfolgreiche praxiswirksame Implementierungstrategien umgesetzt worden und es bestehen weitere Bemühungen, diese noch zu komplettieren [Ollenschläger und Thomeczek, 1996; Gerlach et al., 1999; Ollenschläger et al., 2001]. Ihr hohes medizinisches und ökonomisches Nutzenpotential haben Leitlinien in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen [Roberts, 1998; Thomas et al., 1998; Durieux et al., 2000]. Jedoch ist das Umfeld, in dem Leitlinien implementiert werden müssen, sehr komplex. Daher sind neben einem standardisierten Vorgehen Individuallösungen mit lokaler Adaption anzustreben, um die Praktikabilität und Akzeptanz der Leitlinien zu gewährleisten. Dann können Leitlinien ihrer Bedeutung in der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der medizinischen Versorgung gerecht werden. Im Rahmen von Disease Management Programmen gehören evidenzbasierte Leitlinien zusammen mit der Unterstützung des Patientenselbstmanagements durch Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 99 Schulungen, Organisationsmanagement (Neustrukturierung von Versorgungsprozessen), Entscheidungsunterstützung und Informations- bzw. Datenbanksystemen zu den essentiellen Komponenten (Abbildung 1): Abbildung 1: Leitlinien im Disease Management Evidenzbasierte Leitlinien Evidenzbasierte, systematische Versorgung Organisationsmanagement Unterstützung des Selbstmanagements Neustrukturierung von Prozessen und Abläufen Selbstmanagement Verhaltensänderung Patientenverantwortung Psychosoziale Unterstützung Entscheidungsunterstützung Ärzte-Fortbildung Coaching Gemeinsame Sprechstunden Leitlinien Information Reminder Ergebnisse Feedback Therapieplanung Benchmarking [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wagner et al., 1996] So sind evidenzbasierte Leitlinien beispielsweise die Grundlage für Versorgungsalgorithmen (Patient Care Pathways) im Krankenhaus, für Reminder- und Feedbacksysteme, für Entscheidungsunterstützung jeglicher Art und für Schulungsinhalte. Sie dienen der Umsetzung einer evidenzbasierten und kosteneffektiven Therapie in der Regelversorgung chronisch kranker Patienten sowie im weitesten Sinne der Qualitätssicherung. 3.2 Definition Das Institute of Medicine (IOM) in den USA formulierte die international anerkannte Definition, dass es sich bei Leitlinien in der Medizin um „systematisch entwickelte Entscheidungshilfen für Ärzte und Patienten“ handelt, die eine individuell angemessene gesundheitliche Versorgung ermöglichen sollen [Field und Lohr, 1990]. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 100 Dieser Definition liegt das Verständnis der Evidence based Medicine (EbM) zugrunde. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist D. L. Sackett. Er definierte EbM folgendermaßen [Sackett, 1992]: „Evidenzbasierte Medizin ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der evidenzbasierten Medizin bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer Forschung.“ Hieraus ergeben sich drei Grundprinzipien der evidenzbasierten Medizin, die auch die wesentlichen Kennzeichen einer evidenzbasierten Leitlinie darstellen: • evidence (wissenschaftliche Beweisführung), • clinical judgement (Erfahrung, Intuition, Expertise), • Patientenpräferenzen in der konkreten Situation und „informed consent“ Diese Grundprinzipien geben den evidenzbasierten Leitlinien die höchste wissenschaftliche und politische Legitimation. Ein Schwachpunkt ergibt sich jedoch dann, wenn keine randomisierten, kontrollierten Studien für eine Intervention vorliegen. Dann muss Evidenz auf einer anderen Ebene, wie z.B. der Expertenkonsens, für die Evidenz aus randomisierten, kontrollierten Studien substituiert werden. Eine evidenzbasierte Leitlinie ist also nicht mit einer systematischen Übersichtsarbeit (systematic review) oder einer Metaanalyse vergleichbar. 3.3 Qualitätsmerkmale von Leitlinien Evidenzbasierte Leitlinien sind systematisch nach einer wissenschaftlichen Methodik erstellte Entscheidungshilfen für Akteure des Gesundheitswesens, die sich mit der Versorgung eines definierten Krankheitsbildes beschäftigen. Sie geben Handlungsempfehlungen für Prävention, Diagnostik und Therapie, gelegentlich auch für Prophylaxe oder Rehabilitation einer Erkrankung. Damit die Qualität der Handlungsempfehlungen auf hohem Niveau und immer gleichbleibend erhalten werden kann, wurden Qualitätskriterien aufgestellt. Diese Kriterien wurden erstmals in den USA vom Institute of Medicine (IOM) und der Agen- Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 101 cy for Health Care Policy and Research (AHCPR) formuliert und sind international weitgehend anerkannt. Zu den Qualitätskriterien, die evidenzbasierte Leitlinien erfüllen sollten, gehören: • Validität • Reliabilität/Reproduzierbarkeit • Klinische Flexibilität • Klarheit • Multidisziplinarität • Planmäßige Überarbeitung/Aktualisierung • Dokumentation [Field und Lohr, 1992] Diese Qualitätskriterien werden durch ein repräsentatives Leitliniengremium, eine evidenzbasierte Medizin-Strategie und einen formalisierten Konsens gewährleistet. Eine solche evidenzbasierte Konsensus-Leitlinie weist eine hohe wissenschaftliche und politische Legitimation auf [Ollenschläger et al., 2000]. Die Mehrzahl der in Deutschland existierenden Leitlinien sind „Experten-Leitlinien“ oder „KonsensusLeitlinien“ [Ollenschläger et al., 2000]. Sie werden häufig wegen ihrer methodischen Vorgehensweise kritisiert. Sie sind nicht geschützt gegen den Einfluß des Zufalls wissenschaftlich bzw. fachlich tradierter Vorurteile und anderer systematischer Fehler (bias) oder Störvariablen (confounding). Daher ist ihre wissenschaftliche und politische Legitimation als gering einzuschätzen. In Tabelle 1 sind Leitlinien-Typen und ihre Charakteristika sowie ihre wissenschaftliche und politische Legitimation aufgeführt. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 102 Tabelle 1: Charakterisierung von Leitlinientypen Leitlinien-Typ Experten-Leitlinie Evidenzbasierte Experten-Leitlinie Konsensus-Leitlinie Evidenzbasierte Konsensus-Leitlinie Charakteristika der Leitlinienentwicklung Wissenschaftliche Legitimation Politische Legitimation LL-Gremium nicht repräsentativ Formalisierter Konsens nicht belegt EbM-Strategie nicht belegt Gering Hoch Hoch Gering Gering Hoch Hoch Hoch LL-Gremium nicht repräsentativ Formalisierter Konsens nicht belegt EbM-Strategie belegt LL-Gremium repräsentativ Formalisierter Konsens belegt EbM-Strategie nicht belegt LL-Gremium repräsentativ Formalisierter Konsens belegt EbM-Strategie belegt LL = Leitlinien EbM = Evidenzbasierte Medizin [Quelle: Ollenschläger et al., 2000] Die abgegebenen Handlungsempfehlungen sind entsprechend ihrer klinischen Bedeutung nach Härtegraden gewichtet(siehe Kapitel Methodik, Dissemination, Implementierung und Evaluierung von Leitlinien). Dabei ist die klinische Relevanz und/ oder die Evidenzklasse der Literatur entscheidend. Neben Expertenversionen sollten praktikable Anwenderversionen, die für die Ausarbeitung von individuellen Patientenbehandlungsplänen die Grundlage bilden sowie Patientenversionen von Leitlinien entwickelt werden. 3.4 Methodik, Dissemination, Implementierung und Evaluierung von Leitlinien Über die einzelnen Schritte einer evidenzbasierten Leitlinie soll hier nicht in aller Ausführlichkeit berichtet werden. Es wird auf die entsprechende Literatur verwiesen. Lediglich alle für die Disease Management Programme relevanten Informationen werden an dieser Stelle kurz geschildert und es sei auch auf Teil 2 des Gutachtens verwiesen, in dem einige Aspekte noch einmal ausführlicher dargelegt werden. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 103 3.4.1 Methodik Die Zieldefinition ist maßgeblich für das Ausmaß und den Umfang einer evidenbasierten Leitlinie. In der Regel ist die Kernaufgabe, die systematische sektorenübergreifende Regelversorgung zu standardisieren. Dazu müssen im Vorfeld der Leitlinienentwicklung Bereiche mit Über-, Unter- und Fehlversorgung einer Erkrankung definiert werden. Die identifizierten Versorgungsdefizite sollen durch die evidenzbasierte Leitlinie gezielt und systematisch verbessert werden. Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsreserven werden mobilisiert und Leitlinien lassen sich als flexible und vielseitige Steuerungsinstrumente des medizinischen Leistungsgeschehens mit teils überlappenden, teils komplementären Zielen und Funktionen einsetzen [Browman et al., 1995; Yoos et al., 1997]. Die praktische Entwicklung erfolgt durch ein multidisziplinäres Team aus Experten für die definierte Erkrankung und aus Experten benachbarter Fachdisziplinen sowie einem Methodiker - Team . Zu dem Methodiker - Team gehören in der Bewertung von Studien versierte Ärzte, Biometriker, Epidemiologen und (Gesundheits-) Ökonomen. Nach vorab definierten standardisierten Suchstrategien werden in Datenbanken entsprechende Publikationen mit den relevanten Daten und Informationen zusammengetragen. Diese werden entsprechend ausgewertet und nach einer allgemein anerkannten Evidenz – Klassifikation bewertet (Tabelle 2). Tabelle 2: Bewertung der publizierten Literatur gemäss ihrer wissenschaftlichen Aussagekraft nach Evidenzklassen Evidenzklasse (EK) Ia Evidenz aufgrund von Metaanalysen von randomisierten, kontrollierten Studien Ib Evidenz aufgrund mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie Iia Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisation Iib Evidenz aufgrund mindestens einer anderen Art von gut angelegter, nicht-randomisierter und nicht-kontrollierter klinischer Studie z. B. Kohortenstudie III Evidenz aufgrund gutangelegter, nicht-experimenteller, deskriptiver Studien, wie z. B. Vergleichsstudien, Korrelationsstudien und Fall-Kontroll-Studien Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung IV Seite 104 Evidenz aufgrund von Berichten der Experten-Ausschüsse oder Expertenmeinungen und/oder klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten [Quelle: SIGN, 1996; AHCPR, 1992] Nach der Evaluierung der Studien entsprechend ihrer Aussagekraft schließt sich die Gewichtung der Handlungsempfehlungen an. Diese kann beispielsweise entsprechend der vom Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie der Universität zu Köln entwickelten Einteilung der Härtegrade in Anlehnung an die Veterans Health Administration und der SIGN vorgenommen werden. Die Empfehlung orientiert sich an der Aussagekraft der Studie und an der klinischen Relevanz. Härtegrad A erhält eine Empfehlung, wenn sie auf der Basis von Studien mit den Evidenzklassen Ia oder Ib ausgesprochen wird und aus klinischer Sicht als erstrangig einzustufen ist. Bei Empfehlungen basierend auf Studien mit den Evidenzklassen IIa, IIb, III oder aus klinischer Sicht als zweitrangig einzustufenden Studien wird der Härtegrad B ausgesprochen. Härtegrad C erhalten alle Empfehlungen, die aus klinischer Sicht als drittrangig anzusehen sind bzw. deren Basis Studien mit der Evidenzklasse IV bilden. In Tabelle 3 ist die Einteilung der Härtegrade nach den entsprechenden Evidenzklassen bzw. den entsprechenden klinischen Bedeutungen dargestellt. Tabelle 3: Härtegrad-Empfehlung Grade Empfehlung A Ergibt sich aus den Evidenzklassen Ia und Ib Oder Ist aus klinischer Sicht als erstrangig einzustufen B Ergibt sich aus den Evidenzklassen IIa, IIb und III Oder Ist aus klinischer Sicht als zweitrangig einzustufen C Ergibt sich aus den Evidenzklassen IV Oder Ist aus klinischer Sicht als drittrangig einzustufen [Quelle: Eigene Darstellung] Diese Härtegrad - Zuteilung, die in vielen Leitlinien noch fehlt, ist von elementarer Bedeutung. Sie überbrückt die durch die entsprechenden Studiendesigns bedingten Defizite mit klaren Handlungsempfehlungen und verhindert so Lücken in der Versorgung. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 105 Alle Handlungsempfehlungen sollen in regelmäßigen Abständen, vorzugsweise spätestens nach zwei Jahren, auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Bei neuen relevanten Ergebnissen sind Änderungen der Empfehlungen auch vor der nächsten Überprüfung zu disseminieren. Die Entwicklung von Leitlinien sollte zur Vermeidung von sich widersprechenden Empfehlungen national einheitlich erfolgen. Die Leitlinien können dann mit Hilfe von Leitlinien - Experten an lokale Gegebenheiten adaptiert werden. International vorhandene Leitlinien können, sofern sie qualitativ den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin gerecht werden, als Grundlage für nationale Leitlinien dienen. Häufig jedoch müssen sie aufgrund nicht vorhandener GesundheitssystemStrukturen an nationale Verhältnisse angepaßt oder neu konfiguriert werden. 3.4.2 Dissemination Die Verbreitung von evidenzbasierten Leitlinien folgt in Disease Management Programmen auf zwei Ebenen: • Makroebene (Gesundheitspolitik, Sozialsystem): Entwicklung der Disease Management Programme auf Basis evidenzbasierter Leitlinien • Mikroebene (Medizinische Professionen, Patienten): Evidenzbasierte Leitlinien als Anwendungs- und Entscheidungsunterstützung für medizinische Professionen und Patienten. Anwenderversionen oder Patientenversionen sind auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Wie das Format einer evidenzbasierten Leitlinie gestaltet werden soll, eruierten Wolff und Mitarbeiter [Wolff et al.,1998] auf dem Boden von Erfahrungen von Hausärzten mit Leitlinien. Die höchste Praktikabilität und Anwenderfreundlichkeit wurde einer Kombination aus Algorithmen, Zusammenfassungen, Tabellen und Volltext attestiert. Die Beliebtheit der einzelnen Elemente sind Tabelle 4 zu entnehmen. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 106 Tabelle 4: Bausteine des Formats von Leitlinien Algorhythmen 47% Zusammenfassungen (Abtract) 38% Tabellen 26% Volltext 16% Kombination 55% Maximale Anwenderversionslänge 2 Seiten [Quelle: In Anlehnung an Wolff et al., 1998]: Die Disseminierung und Implementierung von Leitlinien ist im Disease Management entscheidend, da hier die größten Barrieren für die mangelnde Anwendung von Leitlinien durch Ärzte liegen können [Klazinga et al., 1994; Cabana et al., 1999]. 3.4.3 Implementierung Evidenzbasierte Leitlinien stellen im Disease Management den Rahmen für die Umsetzung einer evidenzbasierten Regelversorgung dar. Bei der Entwicklung, Dissemination, Implementierung und Evaluation von Leitlinien im Disease Management ist daher größtmögliche Sorgfalt zu verwenden (siehe auch Teil II des Gutachtens). Ggf. können internationale evidenzbasierte Leitlinien der Entwicklung zugrunde gelegt und an die Verhältnisse in Deutschland angepasst werden. 3.4.4 Evaluation Die Effektivität von Leitlinien wurde hinlänglich bewiesen. Grimshaw und Mitarbeiter begutachteten 1993 neunundfünfzig Studien aus den Jahren 1976 bis 1992. Diese Arbeiten hatten durchweg Leitlinienempfehlungen gegen übliche Standards verglichen. Die Ergebnisse wurden unter den Aspekten Prozess- und Ergebnisqualität zusammengefaßt [Grimshaw und Russell, 1993]. Dabei wurden alle Studien auf die Prozessqualität und nur elf auf die Ergebnisqualität hin überprüft. Ein positiver Effekt im Hinblick auf den Prozess stellte sich bei 86% aller Studien ein und von den elf auf das Ergebnis hin betrachteten Arbeiten waren immerhin 82% erfolgreich.(Tabelle 5) Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 107 Tabelle 5: Auswertung von Studien, die die Effektivität von Leitlinien bzw. ihrer Empfehlungen gemessen haben 59 Studien Von 1976 – 1992 (24 klinische Empfehlungen, 27 präventive Empfehlungen, 8 Verfahrensauswahlen) 59 (=100 %) 51 (= 86 %) Messung der Prozessqualität positiver Effekt 11 (= 19 %) 09 (= 15 %) Messung der Ergebnisqualität positiver Effekt [Quelle: Grimshaw und Russell, 1993] 1995 überprüften Grimshaw und Mitarbeiter erneut Leitlinien auf ihre Effektivität hin [Grimshaw et al., 1995]. Dieses Mal wurde die Verbesserung der Prozess- bzw. Ergebnisqualität gemessen. Es wurden einundneunzig Studien aus den Jahren 1976 bis 1994 berücksichtigt. Bei 87 Arbeiten wurde die Prozessqualität gemessen. Von den 87 Studien wiesen 89 % eine Verbesserung auf. In den siebzehn Arbeiten, in denen die Ergebnisqualität gemessen wurde, waren 64,7 % durch eine Verbesserung des Ergebnisses gekennzeichnet.(Tabelle 6) Tabelle 6: Auswertung von Studien, die die Effektivität von Leitlinien bzw. ihrer Empfehlungen gemessen haben 91 Studien von 1976-1994 (35 Klinische Empfehlungen, 34 Präventive Empfehlungen, 22 Verfahrensauswahl) 87 (= 96%) Messung der Prozessqualität 81 (= 89%) Verbesserung (um 0-9% bei >39% der Studien) 17 (= 19%) Messung der Ergebnisqualität 11 (= 13%) Verbesserung (um 0-9% bei >39% der Studien) [Quelle: Grimshaw et al., 1995] Die Ergebnismessungen sind generell in Form von: • Gesundheitseffekten (erfolgreiche Behandlungsfälle und gewonnene Lebensjahre) • ökonomischem Nutzen (direkte und indirekte Kosten sowie intangibler Nutzen) • Nutzwerten (qualitätsadjustierten Lebensjahren) aufgeführt. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 108 Wie die Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten zeigen, wird die Effektivität von Leitlinien vor allem durch Messungen im Bereich der Kosten überprüft.(Tabelle 7) Tabelle 7: Evaluierung von Ergebnismessungen durch Leitlinien - Einsatz Ergebnisse In % der Fälle Kosten – Sicherung bzw. Reduzierung 76% Patientenergebnisse (Mortalität, Mortalität) 65% Patientenzufriedenheit 47% Anderes (zunehmender Nutzen) 6% [Quelle: modifiziert nach Fang et al., 1996] Fazit: Evidenzbasierte Leitlinien im Disease Management dienen der Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie in der Regelversorgung, der Qualitätssicherung und der Sicherung der Kosten-Effektivität der Versorgung. Relativ zeitnah durch Leitlinien zu realisierende ökonomische Effekte sind durch die Anwendung von Leitlinien in dem Bereich der Arzneimittelausgaben zu erwarten. Medizinische Erfolge könnten durch ein zeitliches Auseinanderdriften von Kosten und Nutzen der durchgeführten Interventionen anfangs eingeschränkt sein. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 109 4 Patientenschulung Die Patientenschulung stellt in Disease Management Programmen eine tragende Säule in der evidenzbasierten Versorgung dar. Sie soll zur Förderung des Selbstmanagements des Patienten dienen. Jedoch ist nicht jede Form der Schulung effektiv. So haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass insbesondere Schulungen im Frontalunterricht zwar das Wissen der Patienten über ihre Erkrankung nachweislich steigern, sie führen aber nicht zu einer Verhaltensänderung oder beispielsweise zu einer verbesserten Stoffwechseleinstellung [Bloomgarden et al., 1987] Daher wurden in den letzten Jahren vermehrt Schulungsansätze propagiert, die auf unterschiedlichen Interventionen wie z.B. Veränderung von Kognitionen beruhen, um eine Verhaltensänderung sowie eine langfristige Stabilisierung des veränderten Verhaltens zu erreichen [Petermann et al., 1995; Buhk et al., 2001]. Im Zuge der Neustrukturierung der Schulungen wurde auch die Rolle des Patienten neu definiert. Schulungen sollen das „Empowerment“ des Patienten fördern und in erster Linie zu einem erfolgreichen Selbstmanagement der Erkrankung beitragen. Aus dieser Entwicklung resultieren die zur Zeit zu beobachtenden Bestrebungen, für den Laien wertneutrale Begriffe einzuführen, wie beispielsweise „Edukationsprogramme“ [Berger et al., 2001]. Mangelnde Erfolge von Schulungsprogrammen liegen u.a. in der großen Varianz der Persönlichkeitsstrukturen bei Patienten und Schulungsleitern gleichermaßen. In erfolgreichen Schulungsprogrammen kommen daher in der Regel unterschiedliche Interventionen wie Gruppenschulung, Verwendung von speziell auf ältere Patienten zugeschnittene Informationsmaterialien, individualisierte Informationen, Hausbesuche, Einsatz von telefonischen und postalischen Remindern u.a.m. zum Einsatz [Grol et al., 1991; Kerse et al., 1999]. Bei der Planung von Schulungsinhalten und Konzepten sollten insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt werden: • Motivation und Erwartungshaltung der Patienten • Bildungsniveau und Lernfähigkeit • Alter (z.B. mehr Abbildungen und große Schrift für ältere Patienten) • Psychosoziale Faktoren (z.B. Einbindung von Angehörigen) • Somatische Faktoren (z.B. Patient versorgt sich selbst oder wird von der Ehefrau/ Krankenschwester versorgt) Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung • Selbstmanagementfähigkeiten • Sozialer Status Seite 110 Die Komplexität der möglichen Einflussfaktoren zeigt sehr deutlich, dass standardisierte, starre Schulungsmethoden nicht zu langfristigen, erfolgversprechenden Verhaltensveränderungen führen können. 4.1 Formen der Wissensvermittlung „Wissenstransfer“ sollte bedarfsorientiert erfolgen. Unabhängig von den Inhalten sollten bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein: • Schulungsraum (Gruppengröße entsprechend, adäquate Ausstattung) • Erfolgversprechend sind sowohl geschlossene, homogene Gruppen (Alter, Bildung, Sozialstatus, Risikostratifizierung) als auch gemischte Gruppen, wenn dies didaktisch-methodisch berücksichtigt wird • Kontinuität (zeitlich und inhaltlich und besonders auch sektorenübergreifend) • Struktur • Organisation (stationär und ambulant) • Schulungen im stationären und ambulanten Bereich sollten sich an diesen Rahmenbedingungen orientieren. Einzelschulung Einzelschulungen sind personal- und zeitintensiv. Sie haben jedoch einen großen Effekt auf die Betroffenen [Campbell et al., 1996]. Besonders effektiv sind Einzelschulungen vor allem dann, wenn sie durch in Schulungen versierte Ärzte oder anderes medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden und in Kombination mit anderen Schulungsmethoden eingesetzt werden [Campbell et al., 1996; Grol et al., 1991; Kerse et al., 1999]. Solche Einzelschulungen durch den Arzt können beispielsweise im Rahmen von speziellen Diabetessprechstunden oder Diabetestagen durchgeführt werden. Allerdings ist dazu in der Regel eine Umstrukturierung von Praxisroutinen notwendig (siehe Kapitel Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung). Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 111 Gruppenschulung Die Problematik in der Gruppenschulung lag bisher in der unreflektierten Zusammensetzung des Lernstoffs und der Patienten. Somit konnte ein effektiver Erfolg der Schulung nicht gewährleistet werden [Campbell et al., 1996]. Weiterhin bestanden bisher nur wenige Möglichkeiten, auf die individuellen Probleme der Patienten einzugehen. Dessen ungeachtet haben sich Gruppenschulungen besonders dann als wertvoll erwiesen, wenn Betroffene von Gleichbetroffenen lernen können [Haisch et al., 1996]. Dazu muss allerdings von dem traditionellen Konzept der Frontalschulung abgewichen werden. Dem Schulenden kommt vielmehr die Rolle eines Moderators der Patientengruppe zu, ohne dass dabei die gezielte Wissensvermittlung vernachlässigt wird. Die Aufgabe der Wissensvermittlung erfüllt die Gruppenschulung immer dann, wenn • spezifische Inhalte der Risikostratifizierung • verschiedene Elemente der Vermittlung • praktische Umsetzungen • nachträgliche Einzelschulungen kombiniert werden. Zusätzlich sollten die schon erwähnten Aspekte der Didaktik berücksichtigt werden. Zusätzlich zu Gruppenschulungen oder im Anschluss kann die individuelle Problematik des Patienten in Einzelschulungen, z. B. durch den Arzt oder den Koordinator, aufgegriffen werden. Sonderform: Selbsthilfe–Gruppe Die Selbsthilfe–Gruppen weisen einen großen Effekt auf die Änderung des Verhaltens sowie die Stabilisierung der Verhaltensänderung der Patienten auf [Severson et al., 2000; Gray et al., 2000; Stotzner, 2001]. Der Austausch von Informationen – auch über alltägliche Probleme – mit Gleichbetroffenen führt zu einer höheren Akzeptanz von angestrebten Verhaltensweisen. Neben den theoretischen Aspekten werden auch praktische Hilfen angeboten. Selbsthilfe– Gruppen sollten unverzichtbarer Bestandteil eines jeden Schulungsprogramms sein. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 112 4.2 Strukturierte Behandlungs- und Schulungsprogramme Den Kern von strukturierten Behandlungs- und Schulungsprogrammen bilden Gruppenschulungen. Sie sind im Allgemeinen strukturell und inhaltlich auf ein bestimmtes Patientengut abgestimmt. Eine größere Individualität ist in der Regel nicht gegeben, da keine individuelle Nach- oder Mitbetreuung mit Ausnahme von z.B. Einzeldiätberatungen erfolgt. Biopsychosoziales Schulungsmodell Sie betrachtet den Patienten mit seinen psychischen, sozialen und somatischen Faktoren als Einheit. Entsprechend versucht sie Information auf allen drei Ebenen zu berücksichtigen, indem sie die Inhalte herkömmlicher Schulungen unter Berücksichtigung individueller Attributionsprozesse vermittelt [Haisch et al., 1995; Haisch et al., 1996 a + b; Stock et al., 1995]. Eine Risikostratifizierung wird in der Regel nicht angestrebt, da die Heterogenität der Gruppe für den Lernerfolg erwünscht ist. 4.3 Materialien der Wissensvermittlung Wie bereits erwähnt, setzen erfolgreiche Schulungsprogramme unterschiedliche Bestandteile zur Wissensvermittlung und Verhaltensänderung ein. Im Folgenden werden unterschiedliche Bestandteile vorgestellt, die später im Kontext ausführlicher erläutert werden. Schriftliche Materialien Schriftliche Informationen sollten speziell auf Risikogruppen, Altersgruppen sowie soziale Gruppen abgestimmt werden. Studien belegen wiederholt, dass gezielte und individualisierte Informationen einen weitaus größeren Effekt haben als ungezielte Informationen [Campbell et al. 1994; Skinner et al. 1994; von Stackelberg und Kraus, 2000]. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 113 Audiovisuelle Materialien Audiovisuelle Materialien können unterstützend insbesondere zur Wiederholung und Erinnerung des Gelernten eingesetzt werden. Die Wissensvermittlung über verschieden Kanäle unterstützt das Verständnis komplexer Sachverhalte. Die Merkfähigkeit ist über audiovisuelle Systeme größer als über ein Schriftbild vermittelte Information. Computergestützte Lernsysteme Diese Art der Wissensvermittlung kann insbesondere für jüngere Patienten eine spielerische Form des Wissenstransfers sein. Den älteren Generationen ist diese Form häufig noch nicht geläufig. Jedoch zeigt die stetig wachsende Zahl der Anmeldungen von Senioren an Computer- bzw. Internetkursen in Volkshochschulen ein steigendes Interesse am Umgang mit dem Medium. Häufig werden computergestützte Informationssysteme auch von pflegenden Angehörigen zur Informationsbeschaffung benutzt. Durch Datenträger vermittelte Schulungsformen, wie z.B. Internet oder CD, können ebenfalls eingesetzt werden, wenn der Zugang zu anderen Informationsquellen erschwert ist (z.B. in ländlicher Umgebung). 4.4 Empfohlenes Gesamtkonzept für die Patientenschulung im Disease Management Beispielhaft soll im folgenden ein modifiziertes Konzept zur Schulungsthematik und ihrer Qualitätskriterien anhand der von der „Arbeitsgemeinschaft Strukturierte Diabetestherapie“ für Diabetiker – Schulungen geforderte Qualitätsmaßstäbe geschildert werden. 4.4.1 Anforderungen an schulende Institutionen „Train the trainer“– Konzept In Anlehnung an die von der „Arbeitsgemeinschaft Strukturierte Diabetestherapie“ entworfenen Katalog an Qualitätskriterien für Schulungseinrichtungen ergeben sich folgende Eckpunkte, die Schulungsleiter in regelmäßigen Abständen in Form einer Hospitation an einer Diabetes – Einrichtung abfragen sollten: Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 114 Lernzielkatalog und Umsetzung: • Curriculum • Medien • Materialien • Strukturierter Unterricht • Praktische Übungen (Selbstkontrolle, Büffett, Restaurant, Sport, Fußpflege, Kochen, Dosisanpassung, Hypoversuch) • Entscheidungsfreiheit Teaminteraktion: • Teambesprechung • Gruppendynamik • Informationsaustausch über Patienten • Konsens • Umgang miteinander • Partnerschaftliche Mitentscheidung • Kritikfähigkeit (aktiv– passiv; nach innen–nach außen) • Arztkontrolle • Rolle des Teams im Hause Hospitationsakzeptanz: • Freundliche, offene Aufnahme • Information • „In die Karten schauen lassen“ • Begründung für eventuelle Begrenzungen/ Ausschluss an der Teilnahme 4.4.2 Anforderungen an die Schulungsleiter • Alle 2 Jahre: Hospitation eines kompletten strukturierten Behandlungsprogrammes für intensivierte Insulintherapie (mindestens fünf Tage) durch kompetente Mitglieder einer anderen Behandlungseinrichtung • Alle 3 Jahre: persönliche Nachuntersuchung einer Stichprobe von mindestens 50 Patienten mit Typ 1 Diabetes 12–15 Monate nach einer Teilnahme am strukturierten Behandlungsprogramm Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung • Seite 115 Öffentliche Vorstellung und Diskussion des Hospitationsberichtes und der Evaluationsergebnisse der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 4.4.3 Anforderungen an das Schulungsprogramm Entsprechend den Anforderungen an die Lehrenden bestehen auch Anforderungen an das Schulungsprogramm, die mit der nachfolgenden Checkliste überprüft werden können: Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 116 Checkliste zur Patientenschulung: Prozess: (1) Involvierung von Patienten während des gesamten Entwicklungsprozesses (2) Involvierung eines multidisziplinären Teams (3) Konkretisierung des Informationsinhaltes und der Zielgruppe (4) Berücksichtigung von Informationen auch für Minderheiten (5) Berücksichtigung von Evidenzen und, wenn vorhanden, von Metaanalysen (6) Übernahme von Elementen aus Entscheidungsunterstützungen (7) Kosten-Nutzen-Analysen (8) Entwicklung einer Implementierungsstrategie (9) Evaluierungskonzept eingesetzter Elemente (10) Periodische Evaluierung und Erneuerung (11) Veröffentlichung der Evaluierungsdaten Inhalt: (1) Ausrichtung an Patientenfragen (2) Klärung von gemeinsamen Zielen und Ausräumung von Missverständnissen (3) Informationen basieren auf evidenzbasierten Leitlinien (4) Einschließlich eindeutiger Informationen über Verbesserungen und Risiken (5) Einschließlich individueller Informationen (patientenbezogen) (6) Einschließlich anderer Quellen für weiterführende Informationen (7) Einschließlich Fragen und Checklisten zur Arztkonsultation (8) Inhalt und Form weisen keinen bestrafenden oder autoritären Charakter auf (9) Strukturierung und Konzipierung mit verständlichen Illustrationen (10) Angaben über Autorenschaft und „Interessenskonflikte“ (Sponsoring) (11) Einschließlich Quellenangabe und wissenschaftliche Bedeutung (12) Einschließlich des Datums der Publikation Quelle: [modifiziert nach Coulter et al.,1999] Nachfolgend wird beispielhaft für den Diabetes Mellitus ein Schulungsmodell vorgestellt (siehe Anhang). Zunächst sollten die Patienten mittels eines standardisierten Fragebogens auf mögliche Einflussfaktoren überprüft werden. Das ermöglicht es, frühzeitig mögliche Barrieren in der Compliance zu identifizieren und legt Schulungsstrategien fest. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 117 Anschließend werden die Patienten in geeignete Kleingruppen eingeteilt. Je nach Schulungskonzept können dabei heterogene oder homogene Gruppen gebildet werden. In Versorgungsgebieten, in denen das Patientenkollektiv für Gruppenbildungen nicht ausreicht, ist die Durchführung von Einzelschulungen sinnvoll. Ein Patientenkollektiv wird in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung in Form eines maximal 20 Minuten dauernden Frontalvortrages in die Thematik eingeführt. Anschließend sollten sich die vorab zusammengestellten Kleingruppen nach einer Pause zur ersten Schulungsrunde mit ihrem Moderator zusammenfinden. Findet diese erste Runde nicht im Anschluss an der Einführungsveranstaltung statt, so ist mit einer Minderung der Compliance um 50% zu rechnen. Durch den sofortigen Einsatz der Kleingruppen erscheint aus Sicht der Patienten die Beachtung der Individualität gegeben. Die nächsten Treffen sind zeitnah anzusetzen. Die Kleingruppen bleiben erhalten und werden nun unter Berücksichtigung von nachfolgenden Schulungskriterien mit ihrer Krankheit im Alltag und dem entsprechenden Verhalten vertraut gemacht: • Klare Zielvorgaben • Motivationsarbeit vor und während der Schulung • Kurze Lernsequenzen mit längeren Pausen • Aufwärmphasen / Lockerungsübungen in den Pausen • Kontinuierliche Würdigung von Lernbemühungen • Einsatz von Arbeitsblättern zur Vor- und Nachbereitung • Möglichst Tadel vermeiden, um Angst und Unsicherheit zu reduzieren • Soviel Theorie wie nötig, soviel Praxis wie möglich • Beschränkung auf alltagsrelevantes Wissen (kein Detailwissen) • Eingehen auf die persönlichen Erfahrungen der Patienten • Häufiger Medienwechsel (Vortrag, Diskussion, Gruppenspiele, praktisches Üben) • Ausreichend Zeit • Einfache und verständliche Formulierungen • Übersichtliche Gestaltung des Lernmaterials (Visualisierung) • Reduzierung der Informationsmenge pro Zeiteinheit • Minimierung von Ablenkungen, Konzentration auf eine Lernaufgabe pro Zeiteinheit • Häufiges Wiederholen der wesentlichen Inhalte in verschiedenen Kontexten Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung • Seite 118 Kleine Gruppengrößen. [in Anlehnung an Buhk und Lotz-Rambaldi, 2001] Neben diesen Kriterien sollten folgende pädagogische Aspekte berücksichtigt werden: • Technische Aspekte (Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, Fremdwörter, Erklärungen) • Psychologische Aspekte • Gespür für Ängste/ Wünsche • „Wohlfühlatmosphäre“ • Zulassen von Problemen • Ehrlichkeit/ Transparenz • Patientenselbständigkeit/ Entscheidungsfreiheit Weiterhin sollten inhaltliche Kriterien erfüllt sein, die anhand einer nachfolgenden Auflistung überprüft werden können: Patienten benötigen: • Informationen über ihre Erkrankung • Informationen über ihre Prognose • Informationen über Beratungsstellen • Aufklärung über Tests, deren Ergebnisse und mögliche Therapieoptionen • Hilfestellung bei der Selbstversorgung • Informationen über Pflegedienste • Informationen über Selbsthilfe – Gruppen • Beruhigung und Hilfe für die Patienten und ihr soziales Umfeld zur Krankheitsbewältigung • Informationen über Komplikations- und Folgekrankheiten [In Anlehnung an Coulter et al., 1999] Ergänzt werden diese Kleingruppenunterrichte noch durch Einzelschulungen. Hier ist die Anzahl und der Umfang der jeweiligen Einheiten individuell verschieden. Patient und Koordinator, der gegebenenfalls die Einzelunterrichte führt, können gemeinsam entscheiden. Disease Management in Deutschland – Leitlinien und Patientenschulung Seite 119 Der zusätzliche Einsatz von Selbsthilfe- Gruppen ist wünschenswert. Die Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte und Studien belegen dies auch, dass sie den größten Effekt auf Verhaltensänderungen aufweisen [Severson et al., 2000; Gray et al., 2000; Stotzner, 2001]. Zur Unterstützung von Schulungen sind auch die folgenden Disease Management Komponenten geeignet: • Einsatz von Remindersystemen (telefonisch und postalisch): Sie können beispielsweise gezielt an Schulungsinhalte oder Inhalte von Patientenselbstverträgen erinnern • Einsatz von Informationssystemen: Informationssysteme können ergänzende Informationen bereitstellen. Sie sind unabhängig von Schulungszeiten jederzeit verfügbar und nutzbar • Einsatz eines Krankheitskoordinators: Der Koordinator kann Schulungen sektorenübergreifend koordinieren, im Rahmen der ambulanten Nachbetreuung nach Krankenhausaufenthalten Einzel- oder Gruppenschulungen durchführen, zusätzliches, spezifisches Informationsmaterial zur Verfügung stellen sowie das Remindersystem steuern • Einsatz von Selbsthilfe - Gruppen • Gezielte Fortbildungen für Ärzte und andere Schulende: Verschiedene Studien im Rahmen von Disease Mangement zeigen verbesserte Patientenergebnisse, wenn der Arzt und das Schulungsteam durch gezielte Fortbildungen unterstützt werden. Dies trifft auch zu, wenn der Arzt nicht primär zum Schulungsteam gehört. Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass Schulungen eine gewisse temporäre Kontinuität aufweisen müssen. Daher ist zu empfehlen, unabhängig von der Erstschulung bzw. den individuellen Einzelschulungen, dass bei der Management– Gruppe 1 eine Schulungsintensität von einer Schulung pro Jahr, bei der Management– Gruppe 2 von zwei Schulungen pro Jahr und bei der Management– Gruppe 3 vier Schulungen pro Jahr durchgeführt werden(zur Einteilung der Management - Gruppen siehe Kapitel Vorschlag zum Aufbau eines Disease Management in Deutschland). Es wird deutlich, dass die Schulung multidisziplinär und vielschichtig entwickelt und durchgeführt werden muss. Der Erfolg des Disease Management Programms ist maßgeblich von der Qualität der Schulungen abhängig. Sie beeinflussen die Compliance der Patienten entscheidend mit. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 120 5 Erinnerungssysteme im Disease Management Erinnerungs- oder Remindersysteme sollen Arzt und Patient in Form eines Feedbacks mit Informationen zu definierten Indikatoren der Prozess - und Ergebnisqualität im Rahmen medizinischer Behandlungen unterstützen [Murrey et al, 1992]. Sie gehören zu den maßgeblichen Implementierungsinstrumenten eines Disease Management Programms. Im Gutachten wird mit folgender Definition von Erinnerungssystemen gearbeitet: Definition: Unter Erinnerungssystemen bzw. Remindern werden alle Arten von Feedback – Mechanismen verstanden, mit denen Arzt und Patient Informationen zu Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität vermittelt werden können. Sie umfassen beispielsweise postalische, telefonische und computergestützte Systeme. Remindersysteme unterstützen in der Gesundheitsversorgung die Qualitätssicherung bzw. tragen zu dieser bei [Strom, 2001]. Im Einzelnen sollen Erinnerungssysteme Arzt und Patient an durchzuführende Untersuchungen und/oder Kontrollmessungen erinnern, über Untersuchungs- bzw. Laborergebnisse oberhalb bestimmter Zielwerte informieren oder vereinbarte Selbstmanagementverhaltensformen einleiten. Das Feedback kann zugleich mit Empfehlungen für bestimmte Handlungsmaßnahmen für Arzt und Patient verknüpft werden, wie z.B. bisher nicht erfolgte Untersuchungen noch durchzuführen oder Werte durch erneute Kontrollmessungen zu überwachen. Auch Empfehlungen zu verhaltensändernden Maßnahmen zur Reduzierung von kardiovaskulären Risikofaktoren können gegeben werden. Der Einsatz der Erinnerungssysteme kann durch einen Disease Management Koordinator oder durch die Krankenkasse gesteuert werden. Voraussetzung ist eine vollständige, valide und standardisierte Dokumentation für jeden Patienten sowie eine zentrale Speicherung aller Daten bei der Kasse bzw. die Speicherung relevanter Daten bei einem Krankheitskoordinator (z.B. Call Center). Dies kann z.B. in Form des Benchmarkingdatensatzes erfolgen (siehe Kapitel Datenmanagement, Dokumentation und Datenbanken Disease Management). im Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 121 Der Einsatz von Reminder ist unabdingbar an die gewonnen Daten gebunden, deren Erhebung durch entsprechende datenschutzrechtliche Vorgaben geregelt ist. 5.1 Bedeutung und Funktion von Erinnerungssystemen im Disease Management Insbesondere in drei medizinischen Versorgungsbereichen wurden in der Vergangenheit Reminder erfolgreich eingesetzt: Zur Verbesserung der Inanspruchnahme und Durchführung kardiovaskulärer ambulanter Präventionsleistungen, Impfungen und Screeningmaßnahmen im Rahmen der Krebsvorsorge [McPhee et al., 1989; Ornstein et al., 1991; Shea et al., 1996]. Aber auch im Rahmen von Disease Management Programmen liegt zunehmend Evidenz für einen effektiven Einsatz von Remindersystemen vor [Knox et al., 1999]. Erinnerungssysteme können sowohl für den Arzt wie auch für den Patienten eingesetzt werden. Für beide Zielgruppen erfüllen sie unterschiedliche Funktionen. 5.1.1 Funktion von Remindern für den Arzt Ziel des Disease Management ist es u.a. mit Hilfe evidenzbasierter medizinischer Leitlinien eine qualitätsgesicherte und eine auf Evidenz basierende Standardisierung in der Behandlung chronischer Erkrankungen zu erreichen, um die zum Teil große Varianz in der Behandlung zu verringern. Disease Management soll dazu beitragen, dass evidenzbasierte Therapieempfehlungen flächendeckend umgesetzt werden. Nationale wie internationale evidenzbasierte Leitlinien liegen in der Regel zu allen chronischen Erkrankungen vor. Trotzdem werden sie von Ärzten häufig nicht angewandt [Klazinga et al., 1994; Cabana et al., 1999]. Oft werden einfache evidenzgesicherte Untersuchungen in der Behandlung chronisch Kranker durch den Arzt nicht durchgeführt, obwohl die Leitlinie diese Untersuchungen klar fordert [Brechner et al., 1993; Litzelman et al., 1993]. Mit diesen einfachen Untersuchungen, wie z.B. die regelmäßige Fußinspektion bei Diabetikern, könnten Folgekomplikationen frühzeitig erkannt und Spätkomplikationen verringert werden. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 122 Dass Ärzte vorhandene evidenzbasierte Leitlinien nicht anwenden, kann u.a. an folgenden Punkten liegen [Harris et al, 1990; Jaques et al, 1991; Tunis et al., 1994]: • Leitlinien sind den Ärzten nicht bekannt , • Leitlinien sind den Ärzten zwar bekannt, werden aber von ihnen nicht angewendet. Ursache kann sein: • Dass Leitlinien von Ärzten als nicht bedeutend empfunden werden oder • Dass Leitlinien von Ärzten nicht akzeptiert werden. Hier setzt eine wesentliche Funktion von Remindern für den Arzt an. Durch die Verwendung von Erinnerungssystemen im Disease Management soll der Arzt Feedback bezüglich seiner therapeutischen Vorgehensweise und seiner „Erfolgsquote“ bei der Umsetzung der Leitlinien erhalten. Damit können Arzt – Reminder im Disease Management dazu beitragen, dass evidenzbasierte Leitlinien den Ärzten stärker bewußt werden, deren Einsatz für eine qualitätsgesicherte Versorgung im verstärkten Maße gefördert werden und eine verbesserte Leitlinienumsetzung in der Behandlung chronisch Kranker in der Praxis unterstützt wird [Tierney et al., 1986; Chambers et al., 1989; Weingarten et al., 1994; Lobach et al., 1994; Lobach, 1996; Legorreta et al., 1997]. Reminder können Ärzten eine Rückmeldung zu den von ihnen durchgeführten bzw. veranlassten Fremduntersuchungen geben. Der Arzt kann daran erinnert werden, entsprechend der Leitlinien vorgesehene Untersuchungen durchzuführen und zu dokumentieren [Nilasena et al., 1995]. Er kann sofort informiert werden, wenn bestimmte Untersuchungen nicht erfolgten. Des weiteren können Reminder den Arzt über spezifische medizinische Werte eines Patienten informieren und ihn erinnern, dass sie oberhalb des erwünschten Zielwertes liegen (z.B. der Blutdruck oder der Cholesterinwert). Es können ihm dann Empfehlungen zu weitergehenden Interventionen gegeben werden, beispielsweise eine erneute Kontrolluntersuchung beim nächsten Patientenbesuch durchzuführen [Barnett et al., 1983; Gorman et al., 2000]. Über den Einsatz von Remindern kann der Arzt durch gezielte und zeitnahe Informationen in seiner Therapie unterstützt werden. So können u. a. akute Notfallsituationen bei chronischen Erkrankungen, wie z.B. akute Hypo- bzw. Hyperglykämien bei Diabetikern, verringert und sonst notwendige Krankenhauseinweisungen reduziert werden [Gorman et al., 2000; Shah et al., 1998]. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 123 In Tabelle 1 sind die Funktionen von Remindern für Ärzte zusammengefaßt. Tabelle 1: Arztreminder im Disease Management Funktion von Arzt-Remindern im Disease Management Unterstützung bei der Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien in die Regelversorgung Feedback zu durchgeführten bzw. Erinnerung an nicht durchgeführte Untersuchungen entsprechend evidenzbasierter Leitlinien Feedback zu untersuchten medizinischen Parametern des Patienten, die oberhalb des Zielwertes liegen Unterstützung ärztlicher Verhaltensänderungen in der Behandlung chronischer Erkrankungen Verbesserung der Dokumentation durchgeführter Maßnahmen und Untersuchungsergebnisse Rechtzeitiges Erkennen akuter Notfallsituationen bzw. Komplikationsund / oder Begleiterkrankungen chronischer Erkrankungen und damit Verringerung nicht notwendiger Krankenhauseinweisungen Verstärkung ambulanter Präventionsmaßnahmen in der Behandlung von Risikofaktoren chronischer Erkrankungen [Quelle: Eigene Darstellung] 5.1.2 Funktion von Remindern für den Patienten Im Disease Management kommt dem Patienten eine aktive Rolle in der Behandlung seiner Erkrankung zu (Empowerment - Ansatz). U.a. soll er im Selbstmanagement seiner Erkrankung unterstützt und gefördert werden. Dazu tragen Patienten – Reminder bei. Zum Beispiel können mit Hilfe von Remindern Patienten systematisch an ihre regelmäßigen Untersuchungs- bzw. Kontrolltermine beim Arzt erinnert werden [Ornstein et al., 1991; McDonald J. et al., 2000; Khanna et al., 2001; Mayer et al., 2000; McBride et al., 1999]. Um den Patienten im Disease Management in die gewünschte aktive Rolle versetzen zu können, werden auch ihm evidenzbasierte Leitlinien in Form laienverständlich aufbereiteter Patientenversionen zur Verfügung gestellt (siehe Kapitel Evidenzbasierte Leitlinien). Die Einhaltung der Patientenleitlinien kann mit dem systematischen und gezielten Einsatz von Remindern unterstützt werden [Halbert et al., 1999; Wagner 1998]. So kann ihm u.a. Rückmeldung über häuslich durchzuführende Selbstmessungen, wie z.B. entsprechend der Patientenleitlinie empfohlenen Blutzuckerselbstmessungen oder Blutdruckkontrollen, gegeben werden Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 124 [McDowell et al., 1989; Ahring et al., 1992; Piette, 1999]. Durch systematisches Feedback wird der Patient bei der regelmäßigen Dokumentation seiner Selbstmessungen und bei der Weitergabe seiner Werte an den Disease Management Koordinator unterstützt. Zusätzlich können entsprechende Empfehlungen gegeben werden, zu welchem Zeitpunkt z.B. der Arzt zu kontaktieren ist, wenn bestimmte Werte nicht in gewünschten Bereichen liegen, oder ob beim nächsten Arztbesuch der Arzt gezielt auf diese Werte hinzuweisen ist. Reminder fördern auch Empfehlungen zu verhaltensändernden Maßnahmen. Die Verringerung seiner Risikofaktoren können dem Patienten beispielsweise als Ratschläge zur Ernährung, zur Gewichtsreduktion oder zur Raucherentwöhnung mitgeteilt werden. Ebenso dienen sie zur Erinnerung an selbstgesteckte Therapieziele [Borland et al., 2001; McBride et al., 1999; Revere et al., 2001]. Schließlich kann Patienten mit systematischer Rückmeldung durch Reminder auch das Gefühl vermittelt werden, dass der Patient sich als chronisch Kranker mit spezifischen Belangen im Disease Management Programm auf hohem Qualitätsniveau aktiv und kontinuierlich gut versorgt fühlt. Mit der „Erinnerungsunterstützung“ und dem Feedback zu medizinischen Parametern über Reminder erfolgt kein Eingriff in die Autonomie des Arztes. Der Patient wird ausschließlich im Rahmen der Behandlung über seine medizinischen Werte und seine Risiken informiert. Tabelle 2 fasst die Bedeutung von Remindern für Patienten im Disease Management noch einmal zusammen. Tabelle 2: Patienten-Reminder im Disease Management Funktion von Patienten-Remindern im Disease Management • Verbesserung der Einhaltung von ärztlichen Untersuchungs- bzw. Kontrollterminen • Unterstreichung der Wichtigkeit von einzuhaltenden Selbstkontrollmessungen • Stärkung des Verantwortungsbewußtseins und des Selbstmanagements des Patienten für seine Erkrankung und Unterstützung seiner Rolle als gleichberechtigter aktiver Partner im Disease Management Programm (Empowerment - Ansatz) • Verstärkung positiver Verhaltensänderungen hinsichtlich der Vorbeugung bzw. Ausschaltung von Risikofaktoren • Verbesserung der Patientendokumentation von häuslich durchzuführenden Kontrollmessungen • Steigerung der Aufmerksamkeit der spezifischen Belange chronisch Kranker [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 125 Tabelle 3 gibt einen Überblick über Studien, die den Einsatz von Remindersystemen bei Arzt und Patient in der Gesundheitsversorgung und die damit erzielten Ergebnisse untersucht haben. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 126 Tabelle 3: Auswahl von Studien zum Einsatz von Erinnerungssystemen Autor Methodik Barnett et al., Computergenerierter Reminder zur Bluthochdruckbehandlung für 1983 Hausärzte. Die Reminder wurden basierend auf einer zenralen Datenbank mit EDV - Gestützten automatisierten Patientenakten in einem medizinischen Zentrum automatisch erstellt und dem Hausarzt zugeschickt. Zu aktuellen erhöhten Blutdruckwerten wurden Empfehlungen zur Wiedereinbestellung und Kontrolle des Patienten gegeben Borland et Telefonreminder zur Raucherentwöhung : Telefonberatung und –kontakte al., 2001 für Patienten während der Raucherentwöhnungsperiode Buntinx et al., 1993 Eccles et al., 2001 Halbert, 1999 Ergebnisse Regelmäßige Blutdruckkontrollen erfolgten bei 85% der Patienten, zu denen der Arzt den Reminder erhielt im Vergleich zu 25% Blutdruckkontrollen bei Patienten zu denen der Arzt keinen Reminder erhielt. Therapieziel (diastolischer Blutdruck < 100 mmHg) konnte mit Reminder in 51 % der Fälle erreicht werden, ohne Reminder in 33%. Aus der Kontrollgruppe (kein Reminder) hörten13 % mit dem Rauchen auf im Vergleich zu 24 % in der Gruppe, die Reminder und Telefonberatung erhielten; eine Steigerung der Erfolgsrate um 84%. Review über 26 Studien zum Einsatz von Remindern und anderen Insbesonders bei Präventions- bzw. Vorsorgemaßnahmen konnten Feedbackmethoden. Reminder erfolgreich eingesetzt werden. Die Zahl diagnostischer Tests konnte über Feedbackmechanismen reduziert und die Einhaltung von Leitlinien verbessert werden. Einsatz von „educational reminders“ für Hausärzte in England zur Routine – Röntgenuntersuchungen der Wirbelsäule und des Knies Verringerung nicht indizierter Überweisungen ihrer Patienten zu durch Hausärzte konnte durch den Remindereinsatz um 20 % Röntgenuntersuchungen der Wirbelsäule und des Knies. Den Hausärzten verringert werden. wurde per Post anwenderaufbereitete Leitlinien zur Indikation von Röntgenuntersuchungen zugeschickt. Bei jedem Röntgenbericht für den Hausarzt wurden Hinweise bzw. Erinnerungen zur Leitlinie mit beigefügt, z.B. „Routine-Röntgen ist bei erwachsenen Patienten mit Kniebeschwerden ohne schwere äußere Knieveränderungen bzw. ohne Bewegungsenschränkung nicht indiziert“. Diabetespatienten einer HMO erhielten alle neben Schulungsmaterial Mit Beginn der Reminderaktion stieg der Prozentsatz der Reminderbriefe zur regelmäßigen Augenuntersuchung. Die Augenuntersuchungen in beiden Remindergruppen signifikant an im behandelnden Ärzte erhielten eine Liste ihrer Patienten mit dem Vergleich zu vorher (ohne Reminder). jeweiligen Status zu Augenuntersuchungen, zusätzlich Guidelines zu Prozentsatz von Augenuntersuchungen bei Diabetikern, die mehrere Augenuntersuchungen bei Diabetikern. Untersucht wurden der Einsatz Reminder (vier Briefe) erhielten war (schwach) signifikant höher als mehrerer Reminderbriefe (vier Briefe) im Vergleich zu nur einem bei Patienten mit nur einem Reminder. Nach 6 Monaten nahm der Reminderbrief für Patienten Effekt wieder ab. Effekte des 3. und 4. zusätzlichen Reminders waren gering. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 127 Khoury et al., Arztreminder zur Untersuchung und Einstellung von LDL 2001 Cholosteinwerten bei Patienten einer HMO mit koronarer Herzkrankheit. Verwendet wurden EDV-generierte standardisierte Informationsblätter für den Arzt zu jedem Patienten mit Informationen zu bisherigen LDL Messungen und Erinnerung an ausstehende Messungen. Litzelman et Vergleich von EDV-generierten Routine-Reminder für Ärzte zur al., 1993 Durchführung von Krebsvorsorgeuntersuchungen, die eine Rückantwort vom Arzt verlangten in der Art, dass auf dem Reminderzettel angekreuzt werden musste: Test durchgeführt /Test heute angeordnet /Test kann für Patienten nicht verwendet werden /Patient verweigerte /Durchführung beim nächsten Besuch. Lobach, E-mail Reminder für Ärzte zur Einhaltung von Leitlinien in der 1996 Diabetesbehandlung: Ärzte an einer Klinik behandelten Patienten mit Unterstützung eines computerassistierten Management- Protokolls (CAMP; siehe auch Lobach et al., 1994) und elektronischen Patientenakten. Zweimal pro Woche erhielten sie via E-mail einen computergenerierten Bericht über ihre Einhaltung der auf den Leitlinien basierenden Behandlungsempfehlungen. Lobach et al., Einsatz eines computer-gestützten Management Protokolls (CAMP) für 1994 Ärzte zur Behandlung von Diabetespatienten in einer Klinik (Patientendaten wurden in der Klinik alle elektronisch erfasst). Das CAMP basiert auf Standards der American Diabetes Association. Untersucht wurde die Einhaltung der Standards in der Diabetesversorgung durch Ärzte, die über CAMP daran erinnert wurden im Vergleich zu Ärzten ohne Reminder. Mayer et al., Patientenreminderbriefe zur Verbesserung der Teilnahme an jährlicher 2000 Vorsorge – Mammographie in der Brustkrebsvorsorge bei Frauen im Alter von 50-74 Jahren in den USA McBride et Literatur- Review über 74 randomisierte Studien zum Einsatz des al., 1998 Telefons als Reminder bzw. Informationssystem. Untersucht wurden unterschiedliche Telefoneinsatzmöglichkeiten (reaktiver Einsatz, z.B. Hotlines oder proaktiver Einsatz, d.h. der Patient wurde angerufen) bzgl. i) Förderung von Verhaltensänderungen, ii) Verbesserung der Effektivität von Gesundheitsleistungen und iii) der Erweiterung und Verbesserung der Reichweite angebotener Gesundheitsleistungen. Das Telefon wurde für alle Bereiche der Gesundheitsversorgung verwendet (chronische Erkrankungen, Sucht, Präventionsmaßnahmen, Krebsvorsorge usw.). Zahl der Patienten, bei denen bisher nicht systematisch die LDL Werte dokumentiert wurden, reduzierte sich in einem Jahr von 30 % auf 18%. Zahl der Patienten, die ihren LDL Zielwert erreichten stieg von 10 % auf 27%. Compliance bezüglich der Einhaltung von Leitlinienempfehlungen wurde bei Ärzten, die einen Reminder erhielten, der eine Rückantwort vom Arzt verlangte, um 21 % verbessert im Vergleich zu den Ärzten, die den Reminder erhielten ohne eine Rückantwort geben zu müssen. Ärzte, die über E-mail eine Erinnerung bzw. eine Zusammenfassung ihrer bisherigen Befolgung von Leitlinienstandards in ihrer Therapie erhielten zeigten eine signifikante Verbesserung in der Einhaltung von Leitlininen im Vergleich zu Ärzten, die keinen E-Mail Reminder erhielten. Reminder über das computer-gestützte Management- Protokoll für Ärzte bewirkten eine signifikante Verbesserung in der Einhaltung von Standards und Leitlinie durch im Vergleich zu den Ärzten ohne Reminderunterstützung. 68% mehr Frauen, die Reminderbriefe erhielten, erschienen im folgenden Jahr zur erneuten Mammographieuntersuchung wieder. Ein proaktiver Telefoneinsatz zur Beratung und Erinnerung zeigte bessere Erfolge, gewünschte Zielgruppen und Verhaltensänderungen zu erreichen als ein reaktiver Einsatz, bei denen der Patient selbst aktiv das Angebot z.B. einer Hotline bzw. Helpline annehmen muss. Bessere Erfolge konnten erzielt werden, wenn der Telefoneinsatz mit anderen Informationssystemen kombiniert wurde als eine alleinige Telefonanwendung. Krankheitsspezifische Notfallsituationen und Krankenhauseinweisungen konnten signifikant durch einen systematischen Telefoneinsatz in der Betreuung Kranker reduziert werden. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme McDowell et al., 1989 Ornstein et al., 1991 Shea et al., 1996 Wagner, 1998 Seite 128 Die Compliance der Patienten bezüglich Kontrolle ihrer Risikofaktoren sowie ihrer Medikamenteneinnahme konnte durch den Telefoneinsatz signifikant verbessert werden. Remindereinsatz zur Blutdruckkontrolle in der primärärztlichen Blutdruckkontrolle (Remindercompliancerate) erfolgte bei EDVVersorgung; verglichen wurde der Effekt von a) EDV- generierter generierten Arztreminder bei 30,7 % (+ 10%) der Patienten, bei Erinnerungsnotiz für Arzt (passiver Reminder) zu den Patienten, die Telefonreminder durch Schwester bei 24 % (+ 5%) und bei gerade zum Praxisbesuch kamen, b) Telefonreminder für Patienten durch Reminderbrief bei 36% (+ 15%). Remindereffekte waren statistisch Krankenschwester bzw. c) Reminderbrief für Patienten siginifikant, aber moderat; empfohlen wurde eine Kombination von Routine – Arztreminder und ggf anschließend für Patienten mit Nichtcompliance ein zusätzlicher Reminderbrief. Einsatz computergenerierter Reminder für Patienten und Ärzte zur U.a.: Cholesterinwertbestimmungen bei Patienten stiegen um 95 %. Inanspruchnahme ambulanten Präventionsleistungen. Für jeden einbestellten Patienten wurde vom Computer eine Nacht zuvor ein Informationsblatt mit einer Zusammenstellung wichtigster Werte bzw. noch durchzuführender Untersuchungen für den Arzt ausgedruckt und von der Sprechstundenhilfe an die Patientenakte vorne angeheftet. Patienten erhielten einen computergenerierten Erinnerungsbrief mit Erklärungen zu den für sie anstehenden Untersuchungen Metaanalyse von 16 randomisiert kontrollierten Studien zum Einsatz Durch Remindereinsatz wurden insgesamt über alle untersuchten computergenerierter Remindersysteme für Ärzte und/oder für Patienten Bereiche i) – iv) 77 % mehr präventive Vorsorgemaßnahmen in der präventiven Primärversorgung bei: i)Impfungen; ii)Krebsvorsorge: durchgeführt bzw. in Anspruch genommen. Brustkrebs (Mammogaphiesrceening), Gebärmutterkrebs (Abstrich), Darmkrebs (Hämoccult); iii)kardiovaskulärer Risikoreduktion (Blutdruck-, Cholesterinkontrollen, Raucherentwöhnung, Ernährungsberatung); iv) andere: Zahnvorsorge, Glaukomscreening, Schulungen in Selbstuntersuchungstechniken für Haut-, Hoden- und Brustkebs. Metaanalyse über 16 randomisiert kontrollierte Studien im Zeitraum von Frauen, die Reminder erhielten, erschienen zu etwa 20 % häufiger zur 1985-1996; untersucht wurden mit der Post verschickte Reminder (Brief, Vorsorgemammographie im Vergleich zu Frauen ohne Reminder. Postkarte) für Patientinnen zur Erinnerung an anstehende Frauen mit individuell personenbezogenen Reminderbriefen Mammographievorsorge;. Verglichen wurden: i)Reminderbrief versus erschienen zu etwa 50% häufiger zur Vorsorge im Vergleich zu keinen Reminder und ii) individuell Patientinnen bezogener Reminder Frauen, die einen standardisierten allgemeinen Reminderbrief versus standardisierter allgemeiner Reminderbrief erhielten. [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 129 Es kann durchaus vorkommen, dass Ärzte und / oder Patienten auf Reminder nicht reagieren und gegebene Empfehlungen nicht beachten. Gründe dafür könnten beim Arzt z.B. darin liegen, dass [Litzelman et al., 1996]: • Der Arzt zu sehr beschäftigt war • Die angemahnte Untersuchung von ihm nicht sofort, sondern erst bei einem späteren Besuch des Patienten durchgeführt wird • Der Patient z.B. zu krank war, um die empfohlene Untersuchung durchführen zu können • Der Patient die empfohlenen Maßnahmen ablehnte, oder • Der Reminder vergessen wurde. Educational Reminder, d.h. Reminder, die zum Feedback des "Senders" eine Rückmeldung vom "Empfänger" verlangen, können dem Vergessen bzw. der Nichtbeachtung von Remindern entgegenwirken. Dies kann so aussehen, dass der Arzt bzw. Patient auf den Reminder antworten sollte, ob die empfohlenen Maßnahmen durchgeführt wurden. Wenn dies nicht erfolgte bzw. erfolgen konnte, sollte eine Begründung abgeben werden. Reminder, die eine Rückantwort verlangen, konnten bessere Ergebnisse bezüglich der Einhaltung von Empfehlungen erzielen als Remindern, die keine derartige Rückantwort bzw. Begründung vom Empfänger verlangten [Litzelman et al., 1993]. Der Disease Management Koordinator erhält somit ein Feedback und kann verstehen, warum seine Reminder nicht beachtet wurden. Dies kann er bei zukünftigen Empfehlungen berücksichtigen. Erinnerungssysteme im Disease Management haben mit ihrem Feedback- und Informationscharakter durchaus Steuerungswirkungen. Ihr Einsatz sollte systematisch und gezielt erfolgen. Dies bedingt, dass ihre Verwendung bereits bei der Entwicklung von Disease Management Programmen berücksichtigt, geplant und definiert werden sollte. Der systematische und genau definierte Einsatz von Erinnerungssystemen im Disease Management kann dazu beitragen, Bereiche insbesondere von Unter – und Fehlversorgung in der Behandlung chronischer Erkrankungen abzubauen und so zu einer Verbesserung der medizinischen wie auch ökonomischen Ergebnissen des Programms beitragen. Näheres zur Art und Weise des Einsatzes von Erinnerungssystemen behandelt der nächste Abschnitt. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 130 5.2 Der Einsatz von Erinnerungssystemen im Disease Management Programm Erinnerungssysteme dienen der Implementierung des Disease Management Programms. Ihr Einsatz sollte • Systematisch • Zeitnah • Krankheits- bzw. problemspezifisch gezielt und • Individuell patienten – bzw. arztbezogen erfolgen. Dafür müssen entsprechende Remindersysteme und ihre Verwendung im Disease Management Programm geplant, entwickelt, implementiert und kontinuierlich evaluiert werden. Beim Einsatz der Erinnerungssyteme ergeben sich folgende Fragestellungen: 1. Wann soll der Einsatz von Remindern erfolgen? Dies bedeutet • in welchen Phasen bzw. auf welchen Ebenen im Disease Management Programm sollten sie eingesetzt werden und • ab welchen Zielwertüberschreitungen sollten sie eingesetzt werden? 2. Welche Art von Remindern soll verwendet werden, d.h. wie und unter Einsatz welcher Systeme sollten Patienten und Arzt ein Feedback erhalten? 3. Wer steuert bzw. führt den Einsatz der Reminder durch? 5.2.1 Wann sollen Reminder eingesetzt werden? In welchen Phasen des Disease Management Programms, d.h. in welchen Modulen sollten Erinnerungssysteme verwendet werden? Allgemeine Module des in diesem Gutachten erarbeiteten Disease Managements sind ein Einschreibemodul, ein Basismodul sowie spezifische Ergänzungsmodule (siehe Kapitel Vorschlag zum Aufbau eines Disease Management in Deutschland). Im Rahmen des allgemeinen Basismoduls können standardisierte Reminder und entsprechende personenbezogene spezifische Reminder für die individuelle Therapie nach Risikostratifizierung eingesetzt werden. Dies können Erinnerungen bzw. Feedbacks Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 131 • Zu durchzuführenden bzw. zu besuchenden Patientenschulungen • Zur Einhaltung evidenzbasierter Therapieempfehlungen durch Ärzte • Zur Einhaltung der Patientenleitlinien • Zur Einhaltung regelmäßiger Kontrolluntersuchungen des Patienten • Zur Durchführung entsprechender Kontrolluntersuchungen durch den Arzt • Zum Feedback vorliegender Untersuchungsergebnisse wie z.B. Laborwerte sein. Zu definieren ist auch, wie häufig Reminder in den entsprechenden Modulen verwendet werden sollten. Z.B. kann der Remindereinsatz im Basismodul als standardidisierte Erinnerung an bevorstehende Schulungs-, Screening- und Follow-upTermine für jeden Patienten gleichermaßen erfolgen. Es könnte z.B. festgelegt werden, dass innerhalb des Basismoduls jeder Patient einen Tag vor einer stattfindenden Patientenschulung benachrichtigt wird, entweder über Telefon, Fax oder per Brief. Im Rahmen der individualisierten Basistherapie wie auch in den spezifischen Ergänzungsmodulen sollte zum einen die Intensität der Anwendung von Reminder in Abhängigkeit vom jeweiligen Patientenzustand bzw. von den bisher erzielten Behandlungserfolgen gestaltet werden. Es hat sich gezeigt, das ein mehrfacher, sich wiederholender Remindereinsatz zu besseren Ergebnissen, auch bezüglich der Compliance der Empfehlungen führt als eine einmalige Verwendung [Halbert et al., 1999]. Zum anderen sollte sich der Inhalt des Feedbacks gezielt nach dem Patientenprofil richten. Mit Hilfe einer gezielt abgestimmten systematischen Erinnerung durch jede Art von Reminder wird das individuelle Patientenmanagement in den Behandlungsmodulen unterstützt. Eine Rückmeldung zu Patientenlaborwerten, die oberhalb erwünschter Zielwerte liegen, kann in den Basis- und Ergänzungsmodulen durch spezifische Reminder für Arzt und Patient erfolgen. Die jeweilige Rückmeldung kann sowohl zu Indikatoren der Prozessqualität erfolgen, (z.B. ob oder wie häufig eine Untersuchung durchgeführt wurde) sowie zu Indikatoren der Ergebnisqualität in Form des Erreichens von Surrogatparametern gegeben werden (z.B. ob bestimmte Zielwerte, wie Blutdruck, Cholesterinwert überschritten wurden). Dies setzt voraus, dass entsprechende Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität sowie entsprechende Zielwerte, bei deren Überschreitung ein Remindereinsatz erfolgen soll, definiert sind. Sie sollten daher für jeden Patienten entsprechend seiner Risikogruppe festgelegt und regelmäßig erhoben werden. Dies kann in Form des Benchmarkindatensatzes erfolgen. Mit dem Bench- Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 132 markingdatensatz sind in diesem Gutachten evidenzbasierte Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität sowie Zielwerte entsprechend der Risikostratifizierung erarbeitet worden (siehe Kapitel Datenmanagement, Dokumentation und Datenbanken im Disease Management). Der Benchmarkingdatensatz eines jeden Patienten kann daher als Datengrundlage für die individuelle Steuerung der Reminder in den Behandlungsmodulen verwendet werden. 5.2.2 Welche Arten von Reminder können verwendet werden? Bezüglich des „Hardwaredesign“ und Inhalte können Erinnerungssysteme vielfältig ausgestaltet werden. Sie können in automatisierte und nicht - automatisierte sowie in aktive und passive Systeme eingeteilt werden [McDonald, 1989]. Aktive Reminder sind alle Erinnerungssysteme, die ein aktives Handeln des Disease Management Koordinators als Sender eines Reminders bedürfen. Passive Reminder sind Erinnerungssysteme, die kein aktives Handeln eines Senders bedürfen. Beispiele unterschiedlicher Arten von Erinnerungssystemen sind in Tabelle 4 aufgeführt. Tabelle 4: Arten von Erinnerungssystemen Aktive Reminder Automatisierte Reminder E-Mail, web-basierte Reminder, Nicht – automatisierte Reminder Briefe, Postkarten, Fax, Telefon (Call Center) Computergestützte Reminder z.B. Post its oder Sticker auf (pop - up Fenster, "watch Patientenakten dogs", web - basierte Reminder (Internet) [Quelle: Eigene Darstellung] Passive Reminder Aktive Reminder für Patienten können z.B. verwendet werden, um diejenigen Patienten zu erreichen, die nicht regelmäßig ihren Arzt aufsuchen. Im Gegensatz dazu erinnern passive Reminder den Arzt nur an jeweils denjenigen Patienten, der ihn gerade aufsucht bzw. dessen Akte er gerade vor sich hat [McDonald et al., 1989]. Zusätzlich können Reminder bezüglich ihres Inhaltes und der Spezifität des gegebenen Feedbacks in unterschiedlichen Qualitätsausprägungen verwendet werden (Tabelle 5). Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 133 Tabelle 5: Mögliche Qualitätsausprägungsstufen von Remindern (Niveau I = unterste Stufe, Niveau III = höchste Stufe) Qualitätsniveau III Interaktive individuelle computergestützte Reminder Qualitätsniveau II Spezifische Reminder unter Berücksichtigung des jeweiligen Patientenprofils Qualitätsniveau I Unspezifische Reminder [Quelle: Eigene Darstellung] Unspezifische Reminder sind Reminder der untersten Qualitätsausprägung. Sie geben allgemeine, nicht auf das individuelle Risiko bezogene Informationen und Feedback, z.B. zum allgemeinen Programmablauf im Rahmen der Behandlung. Dies können z.B. standardisierte Erinnerungsanrufe oder -briefe sein, die für alle Patienten gleich sind, um anstehende Schulungen bzw. Untersuchungen anzukündigen. In der nächst höheren Qualitätsausprägung geben spezifische Reminder gezielte Rückmeldungen zu gemessenen Werten, wie z.B. Laborwerten und berücksichtigen dabei das individuelle Patientenprofil. Computergestützte Reminder, die auch interaktive Möglichkeiten und individuelle auf den jeweiligen Empfänger bezogene spezifische Informationen übermitteln, stellen die höchste Qualitätsausprägung eines Erinnerungssystems dar. Damit der Einsatz von Remindern zu Ergebnisverbesserungen führt, sollten Informationen und Feedback systematisch und zeitnah zum Entscheidungsprozess [Tierney et al., 1986] sowie krankheitsspezifisch, individualisiert, patienten- bzw. arztbezogen erfolgen. Diesbezüglich haben sich vor allem automatisierte, interaktive computergestützte Erinnerungssysteme als erfolgreich erwiesen [Nilasena, 1995, McDonald, 1976 und 1984, Ornstein, 1991, Tape, 1993]. Die Qualitätsausprägung der für ein Programm verwendeten Reminder (Tabelle 5) geht bei der Akkreditierung und der Qualitätssicherung der Programme in die Berechnung des programmspezifischen Qualitätsscores ein (siehe Kapitel Qualitätssicherung). Die Verwendung von Remindern einer hohen Qualitätsausprägung kann den zu erreichenden Qualitätsscore des Gesamtprogrammes verbessern. Welche Reminder der Disease Management Anbieter in seinem Programm einsetzt, sollte ihm überlassen bleiben. Der Erfolg und die Akzeptanz des verwendeten Mediums sollte kontinuierlich evaluiert werden, um die eingesetzten Erinnerungssysteme bestmöglich auf spezifische Anforderungen und den Nutzen der Empfänger abzu- Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 134 stimmen und anpassen zu können. Für die Wahl des Systems muss berücksichtigt werden, ob die technischen Voraussetzungen für den Einsatz eines Reminders gegeben sind bzw. wie sie ausgebaut werden sollten. In der Wahl der Implementierung von Erinnerungssystemen bietet sich eine Möglichkeit des Wettbewerbs unterschiedlicher Programme. Beispiel für computergestützte Reminder: Beispiel für ein computergestütztes Informations- und Remindersystem ist DEMS (diabetes electronic management system), ein elektronisches Managementsystem zur Führung und Behandlung von Diabetikern [Gorman et al., 2000]. Dieses elektronische Computersystem steht allen, die in der Versorgung von Diabetikern involviert sind, wie Ärzten, Krankenschwestern, Diätassistenten, Schulungspersonal etc. zur Verfügung. DEMS unterstützt die Professionen in einer individuellen Patientenversorgung. Es können unterschiedlichste Arten automatisierter Patientenberichte erstellt werden, es werden Hilfen zur Anwendung medizinischer Leitlinien angeboten, Warnhinweise, Empfehlungen, Erinnerungen, Prompts zur Behandlung am Bildschirm ausgegeben. Dem Arzt wird u.a. eine Liste mit den wichtigsten Ergebnissen und patientenspezifischen Problembereichen bzw. Komplikationen als Erinnerungshilfe zur Verfügung gestellt. Durch ein interaktives Arbeiten mit dem System kann der Anwender gezielt relevante Informationen aufrufen bzw. durch Dateneingaben Problembereiche des Patienten identifizieren. 5.2.3 Wer soll den Remindereinsatz steuern? Der Einsatz der Erinnerungssysteme sollte vom Programmanbieter koordiniert werden. Das bedeutet, die Krankenkasse kann z.B. von ihren Geschäftsstellen aus den Remindereinsatz für ihre eingeschriebenen Patienten und beteiligten Ärzte durchführen. Dies bietet sich an, da bei der Kasse der standardisierte Dokumentationsbogen für das Disease Management, der Benchmarkingdatensatz, zentral erfasst wird (siehe Kapitel Datenmanagement, Dokumantation, und Datenbanken im Disease Managment). Damit besitzt sie die Datenbasis für den Einsatz von Remindern. Dabei sollte es möglich sein, dass z.B. bei Telefonremindern, immer eine gleiche Kontaktperson für den Patienten zur Verfügung steht. Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 135 Eine andere Möglichkeit bietet sich durch eine Kooperation mit externen Dienstleistern, wie z.B. Call Center Unternehmen, an. Diese können im Auftrag der Kasse die operationale Durchführung des Remindereinsatzes übernehmen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass der behandelnde Arzt um den Verlust seiner Autonomie fürchtet. Rechtliche Grauzonen wurden in jüngster Zeit durch Einbringung von Gesetzesänderugen ausgeräumt. Mit der Durchführung von Remindern im Disease Management wird der Disease Management Koordinator bzw. ein externer Dienstleister nicht therapeutisch tätig, er gibt auch keine Therapieempfehlungen ab. Über die Reminder werden lediglich Feedback bzw. Informationen dem Patienten und Arzt übermittelt, die ihn hinweisen bzw. erinnern, dass bestimmte Werte überschritten bzw. bestimmte Untersuchungen nicht durchgeführt wurden. Gefahren, die generell bei der Durchführung von Remindern zu beachten und wirksam vermieden werden sollten, sind: • Die Schnittstellen Hausarzt/Facharzt/Krankenhaus/Patient werden fehlerhaft oder unkoordiniert mit Remindern unterschiedlicher Informationsinhalte bedient • Der Datenschutz wird nicht in allen Bereichen eingehalten • Zur Steuerung und Auslösung von Reminder werden keine standardisierten, evidenzbasierten Definitionen von Zielwerten bzw. keine spezifischen Indikatoren der Prozess - und Ergebnisqualität verwendet • Die technische Ausstattung bei Sender und Empfänger erweist sich als störanfällig bzw. ist nicht kompatibel • Durch falsche, unvollständige und / oder nicht valide Daten wird über das Reminder - System "falscher Alarm" angezeigt oder ausgelöst und damit Fehlentscheidungen getroffen [Hogan et al., 1995]. Zusammenfassend kann ein systematischer Einsatz von Erinnerungssystemen für den Arzt dazu beitragen, daß er die Anwendung evidenzbasierter Therapieleitlinien im Disease Management konsequent und kontinuierlich durchführt. Damit können vor allem Bereiche von Unter- und Fehlversorgung in der Behandlung und insbesondere auch in der Prävention von Risikofaktoren chronischer Erkrankungen abgebaut werden. Für den Patienten kann ein auf das individuelle Patientenmanagement abgestimmter, gezielter und systematischer Remindereinsatz seine aktive Rolle im verstärkten Disease Management in Deutschland – Erinnerungssysteme Seite 136 Selbstmanagement seiner Erkrankung unterstützen. Reminder sind integraler Bestandteil eines jeden Disease Management Programms. Deren Einsatz sollte bei der Akkreditierung, Reakkreditierung sowie beim Benchmarking der Programme berücksichtigt und ihr Einsatz daher im Benchmarkingdatensatz dokumentiert werden. Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite137 6 Arzt- und Patienteninformationssysteme im Disease Management Information ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg einer Qualitätsverbesserung in der Gesundheitsversorgung [Strom, 2001]. Daher sollten im Disease Management über Informationssysteme Patient und Arzt systematisch und gezielt mit relevanten und spezifischen Informationen versorgt werden. Ein im Disease Management bestens informierter Arzt und Patient kann aus Sicht der Programmanbieter als „strategisches Aktivum“ für sein Programm betrachtet werden und wird maßgeblich den medizinischen wie wirtschaftlichen Erfolg des Disease Management Programms bestimmen. Möglichkeiten der Informationsübermittlung im Disease Management sind in Tabelle 1 aufgeführt. Gleichwohl, ob Informationen für den Arzt oder für den Patienten bereitgestellt werden, wird von Arzt- bzw. Patienteninformationssystemen gesprochen. Tabelle 1: Mögliche Formen von Informationssystemen für Disease Management Programme Unpersönliche Kommunikationsformen Persönliche Kommunikationsformen Elektronische Systeme Internet (World Wide Web, E-Mail) Intranet CD-ROM Videobänder Computer – Programme Printsysteme Informationsbroschüren Journale Newsletter Hotlines, Call- Center Telefonsysteme Persönliche Kontakte Gemeinsame Sprechstunden von Hausarzt und Experte, Coaching, Beratung Selbsthilfegruppen Schulungen, Fortbildungen [Quelle: Eigene Darstellung] Informationssysteme können dazu beitragen [AHIMA Position Statement, 1994; Clayton et al., 1995; Bates et al., 1999; Bental et al., 1999; Effective Health Care, 2000]: • Die evidenzbasierte Therapieinhalte zu vermitteln und an diese zu erinnern • Die Qualität der Versorgung chronisch Kranker durch gezielte Informationsvermittlung zu verbessern und effizienter zu gestalten Disease Management in Deutschland – Informationssysteme • Seite138 Das Selbstmanagement des chronisch kranken Patienten mit Hilfe individueller Informationen zu unterstützen • Die Motivation von Patienten und Leistungserbringer zu fördern • Die Leistungserbringer und Patienten in der Integration aller wichtigen Informationen in dem Behandlungs- und Entscheidungsprozess zu unterstützen Die Vorteile elektronischer Informationssysteme für den Einsatz im Disease Management sind zu sehen in der: • leichten Zugänglichkeit zu evidenzbasierten Leitlinien für Ärzte und Patienten • zeitnahen Bereitstellung therapie- und entscheidungsrelevanter Daten • leichten Zugriffsmöglichkeit auf elektronische Datenbanken • leichten Aktualisierbarkeit • orts- und zeitunabhängigen Verfügbarkeit jeglicher Art von Informationen • Möglichkeit der gezielten und schnellen Suchabfrage • dem Zugang zu computergestützten Schulungs- und Fortbildungsprogrammen • Versendung computergestützter Reminder • Möglichkeiten der Vernetzung. Somit finden Informationssysteme neben der Vermittlung allgemeiner Informationen zum Programm vor allem Verwendung bei der Unterstützung des Arztes und des Patienten in der Behandlungs- und Therapieplanung, beim Einsatz von Remindern und zur Unterstützung im Rahmen von Patientenschulungen bzw. Arztfortbildungen (Tabelle 2). In all diesen Bereichen haben sich besonders computergestützte Systeme als erfolgreich erwiesen [Balas et al., 1996]. Tabelle 2: Einsatzmöglichkeiten für Informationssysteme im Disease Management • • • • Allgemeine und krankheitsspezifische Programminformationen Ärzte- und Patienten-Reminder Unterstützung in der individuellen Behandlungs- und Therapieplanung Patientenschulungen und Ärztefortbildungen [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite139 Generell wird zwischen ungezielten und gezielten Informationen unterschieden [Campbell et al., 1994, Skinner et al., 1994]. Während ungezielte Informationen allgemeine Inhalte vermitteln (z.B. zu Krankheitsbildern und Behandlungsregimen), werden mit gezielten Informationen spezifische, individuelle, d.h. patienten- und arztbezogene Informationen zur Verfügung gestellt (Tabelle 3). Mit gezielten Informationen für Ärzte und Patienten können bessere Ergebnisse erreicht werden als mit ungezielter Informationsvermittlung [Anderson et al., 1995; Berger und Mühlhauser, 1999; Strecher et al., 1999; Brug et al., 1999]. Tabelle 3: Ungezielte und gezielte Informationen im Disease Management Ungezielte Informationen Krankheitsspezifische allgemeine, nicht patientenbezogene Informationen Gezielte Informationen Krankheitsspezifische individuelle patienten- und arztbezogene Informationen entsprechend dem Patientenprofil [Quelle: Eigene Darstellung] Diesbezüglich können Patienten- und Arztinformationssysteme im Disease Management z.B. in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen eingesetzt werden. Informationssysteme der untersten Qualitätsausprägung stellen nur ungezielte Informationen bereit. In einer nächst höheren Stufe vermitteln sie gezielte krankheitsspezifische anwenderbezogene Informationen entsprechend dem Patientenprofil. In der höchsten Qualitätsausprägung versorgen sie Arzt und Patient mit krankheitsspezifischen gezielten, individuell auf das Patientenprofil bezogenen Informationen und bieten darüber hinaus Möglichkeiten eines Feedback an. Dies kann z.B. in Form von computergestützten Decision Support Systemen oder in Form von Möglichkeiten einer persönlichen Kontaktaufnahme, z.B. über Telefon (z.B. Hotline, Call- Center) erfolgen. Aber auch durch direkte persönliche Kontakte mit akzeptierten Experten im Rahmen von gemeinsamen Sprechstunden von Hausarzt und Experte (siehe hierzu Kapitel Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung) können Rückmeldungen in Form von unterstützenden Feedback angeboten werden. Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite140 Tabelle 4: Stufen möglicher Qualitätsausprägungen von Informationssystemen (Niveau = I niedrigste Stufe, Niveau III = höchste Stufe) Qualitätsniveau III Informationssysteme, die gezielte, d.h. arzt– und patientenindividuelle Informationen anbieten und ein Feedback ermöglichen (z.B. Decision Support, Rückfragemöglichkeit über Telefonkontakt, Vernetzungen, persönliches Gespräch o.ä.) Qualitätsniveau II Informationssysteme, die gezielte Informationen für Arzt und Patient bereitstellen, aber keine Feedback Methoden enthalten Qualitätsniveau I Informationssysteme, die ungezielte, allgemeine, aber krankheitsspezifische Informationen für Ärzte und Patienten bereitstellen [Quelle: Eigene Darstellung] Die Implementierung der Informationssysteme sollte dem Programmanbieter überlassen bleiben. Bei der Akkreditierung des Programms und der Berechnung des programmspezifischen Qualitätsscores werden Informationssysteme als Komponenten eines Disease Management Programms in diesem Gutachten nicht berücksichtigt (siehe Kapitel Qualitätssicherung). Ihr Einsatz und die Wahl des Qualitätsniveaus der verwendeten Systeme wird für die zu erreichenden Ergebnisse in den Programmen aber von Bedeutung sein. Nicht zu vernachlässigen ist auch ein Marketing- und Imageeffekt für das Disease Management Programm, der vom Einsatz attraktiver und für die Beteiligten als besonders nützlich erachteter Informationssysteme ausgehen kann. Die Verwendung attraktiver und auf den spezifischen "Kundennutzen" ausgerichteter Informationssysteme kann mit dazu beitragen, die Compliance und Motivation eingeschriebener Patienten und beteiligter Ärzte an der Programmteilnahme zu stärken. Neben der Verbesserung medizinischer Outcomes können Informationssysteme daher auch als Instrumente der „Kundenbindung“ im Disease Management ihre Bedeutung gewinnen. Der medizinische Alltag zeigt, dass ein Bedarf an gezielter Information mit den Möglichkeiten gezielter und spezifischer Rückfragen und dem Angebot von Entscheidungsunterstützungen bei Behandlungsabläufen bei den medizinischen Professionen vorhanden ist. Auch bei Patienten besteht großer Bedarf an Möglichkeiten, systematisch gezielte Informationen zu bekommen und Fragen zu ihrer Erkrankung, Therapie und Medikation und zu Problemen, die sie spezifisch betreffen, stellen zu können. Die bisherigen Möglichkeiten, diesen Informations- und Unterstützungsbedarf zu be- Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite141 friedigen, erfolgen auf eher unsystematische Art und Weise. Unter Ärzten wird dies in der Regel über kollegiale Gespräche oder Bücher versucht. Patienten stehen z.B. allgemeine Informationsbroschüren, Bücher, Gespräche und der Austausch mit anderen Betroffenen zur Verfügung. Im Gegensatz dazu verfolgt Disease Management einen strukturierten und systematischen Ansatz. Durch die systematische Bereitstellung von individuellen und gezielten Informationen für Arzt und Patient können bessere Ergebnisse in der Behandlung chronisch Kranker erzielt werden, als mit einer unsystematische Informationsversorgung [Brug et al., 1999; Johnston et al., 1994; Strom, 2001]. Nur mit einem solchen systematischen Ansatz wird eine wesentliche Qualitätsverbesserung in der Versorgung chronisch Kranker erreicht werden können. Ein systematischer Ansatz in der Informationsversorgung beinhaltet, dass bei der Verwendung von Informationssystemen im Programmablauf zuvor definiert werden sollte: • wann Informationssysteme für Arzt und Patient eingesetzt werden • wann eine Entscheidungsunterstützung für den Arzt vorgesehen ist • welche Arten von Informationssysteme für den Arzt und Patienten verwendet werden • durch wen der Einsatz der Informationssysteme erfolgen wird und • welche Informationen welcher Patientengruppe bzw. welchem Arzt zur Verfügung gestellt werden können. Im Folgenden wird speziell auf Einsatzmöglichkeiten von Informationssystemen bei Patienten und Ärzten eingegangen. 6.1 Patienteninformationssysteme Ziel des Disease Management ist es u.a., einen "informierten" mündigen und damit aktiv im Behandlungsprozess partizipierenden Patienten als Partner des Arztes zu bekommen. Patienteninformationssysteme können dafür u.a. zur Information, zur Schulung und für den Einsatz von Patienten- Remindern verwendet werden. Damit können sie dazu beitragen, den Patienten zu einer aktiven Rolle in Entscheidungsprozessen im Rahmen seiner Behandlung zu befähigen. Ihr Einsatz bzw. ihre Verwendung sollte, wie oben erwähnt, im Programmablauf zuvor bereits festgelegt sein, um eine systematische Versorgung des Patienten mit Informationen sicherzustellen. Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite142 Mit der Einschreibung in das Programm sollten dem Patienten allgemeine Informationen zu seinem Disease Management Programm, zu allgemeinen und patientenspezifischen Versorgungszielen, zur Vorgehensweise und Ablauf der Behandlung im Rahmen von Disease Management, zu Kontaktpersonen usw. zur Verfügung gestellt werden. Nach erfolgter Risikostratifizierung und Einteilung des Patienten in die entsprechende Disease Management Gruppe sollten ihm nun in systematischer Form im Basismodul sowie in den Ergänzungsmodulen entsprechend seinem Risikoprofil gezielte und spezifische auf das individuelle Patientenprofil abgestimmte Informationen zur Verfügung gestellt werden. Diese können u. a. Folgendes beinhalten: • individuelle Patientenleitlinien • individuelle Patientenbehandlungspläne • krankheitsspezifische Informationen in Abhängigkeit des klinischen Zustands und Risikoprofils • "Erinnerungen" in Form von Patientenreminder • Informationen zu Kontaktpersonen, Selbsthilfegruppen etc. • spezifisches patientenbezogenes Schulungsmaterial • Empfehlungen zu den Lebensstil ändernden Verhaltensmaßnahmen, um Risikofaktoren zu reduzieren. Beispiele interaktiver Patienteninformationssysteme: Vor allem für die Versorgung von Diabetikern sind bereits zahlreiche computergestützte und interaktive Methoden entwickelt worden, um Patienten zu informieren, zu schulen und zur Behandlung zu motivieren [Meneghini et al., 1998; Krishna et al., 1997; Riva et al., 1997; Vaughan et al., 1996; Hunt et al., 1998; Biermann, 1994; Lehmann et al., 1998 und 1994; Gorman et al., 2000]. Ein Beispiel hierfür ist AIDA [Lehmann et al., 1994, 1998 und 1999]. AIDA ist ein interaktives computergestütztes Diabetesschulungs– Simulationsmodell, welches Glukose– Interaktionen in einem insulinabhängigen Diabetespatienten (z.B. Typ 1 Diabetiker) simuliert. Seit 1996 wird es Patienten kostenfrei auch im Internet durch die britische Diabetesgesellschaft zur Verfügung gestellt (http://www.diabetic.org.uk/aida.htm). Der Anwender kann typische Problemszenarien möglicher Komplikationen in der Diabetes–, Insulin– und Ernährungstherapie am Modell simulieren (z.B. morgendliche Insulingabe aber kein Frühstück zu sich genommen oder Patient hat gefrühstückt, aber seine Insulingabe vergessen, usw.). Auch durch Eingabe seiner selbst gemessenen Blutzuckerwerte in Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite143 das Modell kann er mögliche Komplikationsverläufe bei Änderung seiner Insulintherapie oder Umstellung seiner Ernährung simulieren. Somit können dem Patienten Komplikationen am Modell erklärt werden. AIDA ist nur für Schulungs- und Demonstrationszwecke im Rahmen der Diabetesbehandlung gedacht, nicht zur Therapieplanung oder – einstellung durch den Arzt. Mit derartigen interaktiven Simulationsmodellen kann das Selbstmanagement in der Blutzuckerkontrolle der Patienten verbessert und unterstützt werden, indem das Verständnis für den Einfluss und das Zusammenspiel von Insulindosierungen, Ernährung und Lebensstiländerungen anschaulich und spielerisch vermittelt wird. Ein weiteres Beispiel für ein elektronisches Informationssystem zur Verbesserung des Selbstmanagement von Diabetespatienten ist der Einsatz eines sogenannten elektronischen Case Managers (ECM) [Meneghini et al., 1998]. Über ein interaktives (touch- tone) Telefonsystem kann der Patient sich mit einem Passwort bzw. einer PIN in einen „Diabetes- Server", der in einem Diabeteszentrum aufgestellt ist und von dort betreut wird, zu seinen Daten einwählen. Auf dem Server werden alle übermittelten Daten gespeichert. Über ein sprachautomatisiertes Telefonsystem gibt der Patient die Werte seiner täglichen Blutzuckerselbstkontrollen sowie ggf. Zeichen möglicher Hypoglykämiesymptome und seine aktuell eingenommene Medikation ein. Das System steht dem Patienten 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Aus den eingespielten Patientendaten werden kontinuierlich automatische elektronische Berichte zu ihrem Profil erstellt und den Ärzten im Diabeteszentrum zur Verfügung gestellt. Diese können sich sofort mit dem Patienten in Verbindung setzen, wenn die Daten entsprechende problematische Entwicklungen aufzeigen. Eine 24 Stunden- Online- Hilfe in Person eines Arztes zur Einstellung der täglichen Insulin- oder Tablettentherapie steht dem Patient zusätzlich zur Verfügung. Mit diesem elektronischen Case Manager konnte im Vergleich zu Diabetikern in einer Kontrollgruppe, die eine Standardversorgung ohne den elektronischen Case Manager erhielten, die Rate der Diabetes bedingten Notfallsituationen wie Hyper- und Hypoglykämien signifikant verringert werden. Auch der HbA1c Wert der Patienten verringerte sich nach sechs Monaten um 0,8 % im Vergleich zur Kontrollgruppe. Dies zeigt, dass durch den systematischen Einsatzes interaktiver Patienteninformationssysteme in der Aufklärung, Schulung und Führung von Patienten das Verständnis und das Wissen um die Erkrankung und um Therapiemöglichkeiten und damit die medizinischen Ergebnisse verbessert werden können. Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite144 Patienteninformation im Disease Management Eine systematische Versorgung des Patienten mit gezielten Informationen spielt im Disease Management eine zentrale Rolle. Die sonst übliche Bestimmung und Bedeutung von Information für den Patienten verändert sich im Disease Management. Bisher wird Patienteninformation vor allem eingesetzt [Coulter, 1998]: • Zur Gesundheitsförderung • Zur Förderung der Compliance bei Präventionsmaßnahmen, insbesondere bei Vorsorgeuntersuchungen und Verhaltensänderungen, wie z.B. Lebensstiländerungen zur Modifikation von Risikofaktoren • Zur allgemeinen Patientenschulung, wie z.B. für Hinweise zur korrekten Einnahme von Medikamenten oder zur korrekten Handhabung von Messgeräten (Blutzuckermessgeräte etc.) Die Art bisher üblicher Patienteninformationen zeichnet sich durch einen eher unwissenschaftlichen, stark belehrenden und erzieherischen Charakter aus [Coulter, 1998]. Im Disease Management steht der chronisch Kranke als mündiger Patient im Mittelpunkt. Durch einen systematischen Einsatz von Patienteninformationen werden im Disease Management neben der allgemeinen Aufklärung des Patienten primär andere Ziele verfolgt [Deyo, 2001; Effective Health Care, 2000; Coulter, 1998]. Im Disease Management soll Patienteninformation: • den chronisch Kranken bei der Entscheidung bzw. Wahl von Therapiemöglichkeiten unterstützen und ihn befähigen, selbst Entscheidungen zur Verbesserung seiner persönlichen Krankheitssituation treffen zu können • Dem Patienten in leicht verständlicher Weise eine Teilnahme am aktiven Management seiner Erkrankung sowie an Therapieentscheidungen ermöglichen Ziel ist der "informierte Patient", der eigenverantwortlich auf Basis systematischer, gezielter Informationsgabe Entscheidungen im Rahmen seiner Behandlung treffen kann. Patienteninformation im Disease Management sollte keinen erzieherischen und lehrhaften Charakter haben, sondern sachlich objektive Entscheidungsunterstützung für den Patienten liefern. Um dies zu erreichen, sollten auch Informationen für Patienten evidenzbasiert sein [Coulter, 1998; Mühlhauser et al., 2000]. Sie sollten wissenschaftlich basierte Daten zu den Erkrankungen enthalten. Informationen sollten in geeigneter, gut verständlicher und in für den Patienten nützlicher Form dargeboten werden. Informationen Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite145 können auch durch Schulungen vermittelt werden. Dabei sollten Erkenntnisse entsprechender psychologischer und pädagogischer Lernmethoden berücksichtigt werden (siehe Kapitel Patientenschulung im Disease Manangement). Z. B. kann durch Informationsvermittlung in Form von reinen Frontalvorträgen zwar eine Verbesserung des Wissens um die Erkrankung erfolgen, aber keine Verbesserung von Therapieergebnissen erzielt werden [Berger et al., 2001; Haisch et al., 2000; Wisniewski, 1994; Gorman et al., 2000]. Allgemein gehaltenes Informationsmaterial wird vom Patienten nicht so stark aufgenommen wie speziell auf das Patientenprofil abgestimmtes Informationsmaterial. Auch bei der Art der Präsentation des Materials sollte auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten geachtet werden [Coulter et al., 1999]. So sollte z.B. für ältere Patienten eine größere Schrift und viele Abbildungen verwendet werden. Für sehschwache Patienten, wie z.B. Patienten mit einer diabetischen Retinopathie, könnten vorzugsweise Audio-Informationssysteme eingesetzt werden. Zu beachten ist besonders, dass Patienteninformationen und der Einsatz von Patienteninformationssystemen keine kommerziellen Interessen verfolgen. Ihr Einsatz sollte interessensneutral und qualitätsgesichert erfolgen. Tabelle 5 fasst die Empfehlungen noch einmal zusammen. Methoden zur Beurteilung der Qualität dargebotener Informationen sind vorhanden und sollten zur Evaluation verwendeter Materialien genutzt werden [Coulter et al., 1999; Charnock et al., 1999]. Tabelle 5: Merkmale von Patienteninformation im Disease Management Patienteninformation im Disease Management sollte: • Evidenzbasiert sein • Quantitative Aussagen zu Effektivität von Therapien und Risikowahrscheinlichkeiten enthalten • Auf die jeweilige Risikogruppe zugeschnitten sein • Leicht verständlich aufbereitet und unter Berücksichtigung psychologischer und pädagogischer Lernmethoden präsentiert werden • Interessensneutral und qualitätsgesichert sein [Quelle: Eigene Darstellung] Patienteninformationssysteme können und sollen nicht das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient ersetzen. Das persönlichen Gespräch nimmt auch im Disease Management die zentrale Rolle bei der Aufklärung und Information des Patien- Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite146 ten ein. In der Praxis ist die Zeit für persönliche Gespräche zwischen Arzt und Patient aber oft nur sehr knapp vorhanden und stark begrenzt. Hier können Patienteninformationssysteme zusätzlich unterstützend wirken. Sie sind nicht als „technisches Substitut“ für das persönliche Gespräch zu sehen, sondern als Ergänzung im Rahmen eines systematischen Ansatzes einer gezielten Informationsgabe. Dem Inhalt von Patienteninformationen kommt eine große Bedeutung zu. Sie bilden auch die Grundlage für Patientenschulungen. Für das Disease Management müssen für den Patienten Informationssysteme entwickelt werden, die evidenzbasierte Inhalte vermitteln. Dies kann nur durch die Zusammenarbeit mit den entsprechende Fachexperten erfolgen. Auch Patienten selbst sollten mit in die Entwicklung derartiger Informationssysteme eingebunden werden können. Falsch oder fehlerhaft dargestellte und dem Patienten vermittelte Informationen • können beim Patienten eine zu optimistische Vorstellung von der Behandlung seiner Erkrankung hervorrufen • können zu einer unangemessenen Anspruchshaltung des Patienten führen • können zu verstärkter Unzufriedenheit des Patienten führen, wenn sich aufgrund unwissenschaftlicher Information die erhofften Erwartungen an den Arzt und die Behandlung nicht erfüllen • können daher zu zusätzlichen Kosten führen [Coulter, 1998]. Heutiges Patienteninformationsmaterial ignoriert oft relevante und evidenzbasierte Daten zu Erkrankungen und gibt keine ausgewogenen und objektiven Informationen über die Effektivität verschiedener Therapiemöglichkeiten. Unsicherheiten bei Behandlungsmethoden werden verharmlost und nicht genügend dargestellt [Coulter et al., 1999]. Beispiele patientenrelevanter Themen und Fragen, sind in Tabelle 6 zusammengestellt. Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite147 Tabelle 6: Patientenrelevante Themen im Disease Management Im Disease Management sollten chronisch kranke Patienten mit Hilfe von Informationen : • ein Verständnis für ihre chronische Erkrankung bekommen • eine realistische Vorstellung von der Prognose für ihre Erkrankung bekommen • den Erkrankungsprozess verstehen können • wahrscheinliche Ergebnisse möglicher Untersuchungstests und Behandlungen verstehen können • die zur Verfügung stehenden und bereits angebotenen Hilfen zu ihrer Erkrankung kennen lernen • lernen, wie sie zukünftige Erkrankungen bzw. Komplikationen verhindern können • lernen, wie sie an zusätzliche Informationen zu ihrer Erkrankung kommen können und wie sie ggf. Kontakt zu Selbsthilfegruppen knüpfen können • die Möglichkeit bekommen, die „besten“ Experten für ihre Krankheit identifizieren zu können. [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Coulter et al., 1999] Patienteninformationssysteme sollten somit folgende Inhalte berücksichtigen, die dem Patienten in einer für ihn angemessenen Sprache vermittelt und präsentiert werden ohne einen objektiven, neutralen und wissenschaftlichen Charakter zu verlieren: • Patientenrelevante Themen zu den programmspezifischen Erkrankungen wie sie in Tabelle 6 aufgeführt sind • Informationen über die Effektivität von Behandlungsmethoden. Es sollten keine mißverständlichen und den Patienten irreführenden Statements zu möglichen Therapien gemacht werden. Die bisher am häufigsten auftretenden Fehler sind eine zu optimistische Darstellung möglicher Behandlungserfolge und das Herunterspielen möglicher Risiken, Komplikationen bzw. Nebenwirkungen. Es sollte eine objektive und auf Basis von Evidenz abgewogene und ehrliche Einschätzung der Vor- und Nachteile möglicher Behandlungsregime aufgezeigt werden • Quantitative Angaben zu Erfolgs- und Risikowahrscheinlichkeiten und Angaben über Behandlungs- und Rehabilitationszeiten. Quantitative Angaben im Rahmen evidenzbasierter Patienteninformationen können dem Patienten nicht vorenthalten werden. Sie sollten verständlich und mit der korrekten Aussagekraft für ihn aufbereitet und vermittelt werden Disease Management in Deutschland – Informationssysteme • Seite148 Angaben von Referenzen und Quellen, auf die sich die vermittelten evidenzbasierten Informationen stützen Entscheidend für das Disease Management ist ein systematischer und strukturierter Einsatz von Informationssystemen für den Patienten, um somit eine systematische Qualitätsverbesserung seiner Versorgung erreichen zu können. Auf die Bedeutung und Möglichkeiten des Internets als ein mögliches Patienteninformationssystem im Rahmen des Disease Managements wird weiter unten eingegangen. 6.2 Arztinformationssysteme Arztinformationssysteme sollen den im Disease Management Programm beteiligten Arzt mit evidenzbasierten programm- und krankheitsspezifischen Informationen versorgen. Besonders hier können die Möglichkeiten der Telemedizin in Zukunft an Bedeutung gewinnen [Mease, A., 2000; Lauterbach, K, 2000, Slater et al, 2001; Shultz et al.,2001; Wootton, 2001]. Funktionen von Arztinformationssystemen sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Tabelle 7: Funktion von Arztinformationssystemen im Disease Management Arztinformationssysteme im Rahmen des Disease Management sollten dazu beitragen: • Die Akzeptanz und die Anwendung evidenzbasierter Leitlinien im Disease Management Programm durch den Arzt zu verbessern und zu erleichtern • Die Qualität der medizinische Versorgung chronisch Kranker flächendeckend und systematisch zu verbessern und die Varianz in der Behandlung zu verringern • Die Entscheidungsunterstützungen im Rahmen von Feedback– Mechanismen zu ermöglichen (computergestützte Decision Support Systeme, persönliche Rücksprachemöglichkeiten bei akzeptierten Personen im Sinne von „Expertenberatungen“, etc.) • Die Interventionen, die nicht kosteneffektiv sind zu vermeiden und durch kosteneffektive Interventionen mit gesichertem Nutzen zu ersetzen • Den Zugriff bzw. die Bereitstellung allgemeiner, für den Arzt interessanter und nützlicher medizinischer Informationen zu ermöglichen • Die ärztliche Fort- und Weiterbildung zu unterstützen • Die Transparenz in der Fülle täglich neuer Informationen auf dem Gebiet der Medizin für den Arzt zu schaffen und ihn bei der Informationssuche und bei der Trennung und Auswahl der evidenzbasierten von nicht evidenzbasierten Informationen zu unterstützen [Quelle: Eigene Darstellung] Die Implementierung von Arztinformationssystemen sollte dem Programmanbieter überlassen bleiben. Der Erfolg und die Qualität des Programms wird sicherlich we- Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite149 sentlich mit dem Informationsstand der beteiligten Ärzte korrelieren. Für den Arzt in seinem Praxisalltag wird es entscheidend sein, unkompliziert, schnell und einfach zielgerichtet wichtige und aktuelle Informationen erhalten zu können. Dafür bieten sich besonders elektronische Informationssysteme an. Auf die Bedeutung und die Rolle des Internets als Arztinformationssystem wird später näher eingegangen (s.u.). Informationssysteme in Form von EDV- gestützten Entscheidungsunterstützungssystemen für den Arzt (Decision Support- Systeme) können die Qualität und Effizienz der Patientenversorgung verbessern [Johnston et al., 1994; Bates et al., 1999; Elson et al., 1997; Hunt et al., 1998]. Mit ihrer Hilfe können dem Arzt systematisch in Entscheidungssituationen zeitnah gezielte Informationen mit gezielten Rückmeldungen zu seiner Behandlungsstrategie gegeben werden und ihn in der Therapie seiner Patienten unterstützen. Durch systematische Bereitstellung von gezielten Informationen zu Kosten bestimmter Handlungsstrategien, insbesondere Kosten zu verordneten Medikamenten und diagnostischen Untersuchungsverfahren, kann der Ressourceneinsatz des Arztes effizienter und effektiver gestaltet werden [Hunt et al., 1998; Beilby et al., 1997]. Besonders bei der Durchführung von diagnostischen Untersuchungen finden sich noch große Wirtschaftlichkeitsreserven. So waren z.B. nach einer Untersuchung in den USA bis zu 50 % der in einem Krankenhaus durchgeführten Tests im Rahmen der Diagnostik nicht indiziert gewesen [Bates et al., 1999]. Ein systematischer Einsatz von Arztinformationssystemen im Disease Management kann daher mit dazu beitragen, dass [Balas, 2001; Bates et al., 1999 und 2001] • nicht indizierte Laboruntersuchungen reduziert werden • Doppeluntersuchungen verringert werden • das Verschreibungsverhalten des Arztes verändert wird • Arzneimittelkosten reduziert und Arzneimittelreaktionen bei Patienten reduziert werden könnten. Arzneimittelreaktionen verursachen insbesondere im Krankenhausbereich einen Großteil vermeidbarer Kosten [Bates et al., 1997; Classen et al., 1997] • Medizinische Behandlungsfehler reduziert werden • Krankenhauswiedereinweisungen reduziert werden • die Varianz in der Behandlung chronisch Kranker verringert wird Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite150 Gerade im Arzneimittelbereich könnte durch den systematischen und gezielten Einsatz von Informationssystemen ein effizienteres Verschreibungsverhalten bei Ärzten bewirkt werden (Tabelle 8). Tabelle 8: Verwendungsmöglichkeiten von Arztinformationssystemen für die Arzneimittelversorgung im Disease Manangement Im Rahmen der Arzneimittelversorgung im Disease Management können mit Hilfe von Arztinformationssystemen • dem Arzt EDV- gestützte Dosierungsalgorithmen zur Verfügung gestellt werden und damit das Verschreibungsverhalten verbessert werden • patientenindividuelle Vorschläge zur Dosierung, Häufigkeit der Einnahme sowie Informationen zu Arzneimittelunverträglichkeiten für den Arzt ermittelt und angeboten werden • Vorschläge zu patientenspezifischen Alternativmedikationen angeboten werden [Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Bates et al., 1999] Zu betonen ist noch einmal der systematische Ansatz im Disease Management, mit dem Informationen gezielt und strukturiert dem Arzt zur Verfügung gestellt werden sollten. Bereits während der Entwicklung und Konzeption der Disease Management Programme sollte daher ihr Einsatz für den am Programm teilnehmenden Arzt geplant und festgelegt werden. 6.3 Internet und Disease Management Auch den Gesundheitssektor hat das Internet entscheidend verändert [PriceWaterhouseCooper, 1999]. Es eröffnet neue und effiziente Möglichkeiten der Kommunikation und der Gesundheitsversorgung. Die Rolle des Internets im Disease Management wird unterschiedlich beurteilt [Bulger et al., 2000; Glasgow et al., 2001; Lenz et al., 2001]. Nach Ansicht der Autoren wird für die Einführung wie für die Durchführung von Disease Management Programmen in Deutschland das Internet zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine zentrale Rolle spielen. Die Bedeutung, die dem Internet im Disease Management in Deutschland zur jetzigen Zeit zufallen kann, ist eine Unterstützungsfunktion in der Informationsversorgung der beteiligten Patienten und Ärzte. Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite151 Erfahrungen in den USA zeigen, dass reine webbasierte Disease Management Programme nicht zu den erhofften Erfolgen führten. Beispielsweise konnten über webbasierte Programme in den USA Patienten der entsprechenden Zielgruppen für eine Einschreibung nicht gewonnen werden. In den USA findet Disease Management auf drei Ebenen statt (Tabelle 9). Auf der untersten Ebene finden sich reine Internet– Disease Management Programme. Auf der nächst höheren Ebene finden sich Programme, die auf Basis von Call- Centern und Telefonkontakten und ggf. anschließend mit Besuchen von Krankenschwestern beim Patienten arbeiten Die dritte Ebene schließlich kennzeichnet den Einsatz und die Versorgung eingeschriebener Patienten mit interaktiven computergestützten Systemen. Die Computersysteme stellt der Programmanbieter den Patienten zur Verfügung. Über diese Systeme erfolgt die Erfassung, Weiterleitung und Auswertung vom Patienten selbst erhobener Untersuchungsdaten, wie z.B. Blutzuckerselbstmessungen bei Diabetikern. Die Daten können direkt vom Patienten zum Programmanbieter bzw. zu den behandelnden Ärzten mit Hilfe des Einsatzes interaktiver Informationstechnologien übertragen werden. Tabelle 9: Ebenen von Disease Management in den US (Level I = unterste Stufe, Level III = höchste Stufe) Level III Disease Management unter Einsatz interaktiver computergestützten Informationssysteme mit Vernetzungen zu Professionen Level II Disease Management unter Verwendung von Telefonkontakten, in der Regel über Call- Center mit Hausbesuchen von Krankenschwestern abhängig vom Krankheitszustand Level I E-Healthcare: Reine web-basierte Disease Management Programme [Quelle: eigene Darstellung] Ein Disease Management Ansatz, der vorrangig auf dem Internet basiert, wird nicht zu der gewünschten systematischen Qualitätsverbesserung und einer verbesserten Kosteneffektivität der Versorgung chronisch Kranker führen. Allein durch das Internet erfolgt keine Implementierung und Umsetzung von evidenzbasierten Leitlinien, das Arzt– und Patientenverhalten wird nicht wesentlich geändert werden. Nach einer repräsentativen Umfrage zur Internetnutzung unter Ärzten in Deutschland (Leseranalyse medizinischer Fachmedien: http:// www.lamed.de, 2001) geben nur 1,2 % der Befragten an, das Internet täglich für die Suche nach Fachinformationen zu nutzen. 12 Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite152 % gehen mindestens einmal die Woche ins "Netz". Durch den Einsatz des Internets kann sich zwar das Wissen über Erkrankungen und Therapien verbessern, verbesserte Therapieergebnisse werden aber nicht erreicht. Das bedeutet aber nicht, dass dem Medium Internet als solches im Disease Management eine Absage erteilt wird. Z. B. kann für die am Disease Management beteiligten Ärzte das Internet als Informationsmedium vor allem in Form sogenannter Professional-Portale zunehmend an Bedeutung gewinnen, wie in nachfolgender Tabelle beschrieben. Tabelle 10: Professional– Portale im Disease Management Mit Hilfe von Professional-Portalen im Disease Management könnten den Ärzten: • evidenzbasierte Leitlinien bereitgestellt werden • kostenloser Zugang zu elektronischen medizinische Datenbanken (z.B. Medline) ermöglicht werden • aktuelle Informationen aus der Medizin, neueste Studienergebnisse, Kongressberichte etc. systematisch aufbereitet und bereitgestellt werden • Zugriff auf elektronische Versionen medizinischer Fachjournale ermöglicht werden • die neuesten Benchmarking- bzw. Qualitätsinformationen zu den einzelnen Programmen veröffentlicht werden • spezifische Informationen zu seinen Patienten (unter Beachtung des Datenschutzes) zur Verfügung gestellt werden • Reminder verschickt werden • ein persönliches Benchmarking für den Arzt ermöglicht werden, z.B. in Form einer Abfragemöglickeit der ausgewerteten Daten seiner Benchmarkingdatensätze und ein auf dieser Grundlage erstellter Vergleich mit anderen Ärzten (Datenschutzbelange und Vertraulichkeit müssen selbstverständlich gewährleistet sein) • Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zum Programmanbieter über E-Mail zur Verfügung gestellt werden • Schulungs- und Informationsmaterialien für ihre Patienten zum herunterladen bereitgestellt werden • interaktive Risikoberechnungsmodule, z.B. zur Errechnung des kardiovaskulären Risikos ihrer Patienten, zur Verfügung gestellt werden [Quelle: Eigene Darstellung] Für den Patienten wird das Internet aufgrund des Alters der Zielgruppe der Disease Management Programme ebenso wohl keine zentrale Rolle spielen. Nicht vernachlässigt werden können aber deren Angehörige, wie z.B. ihre Kinder. Diese können von den Möglichkeiten des Internets sicherlich im verstärkten Maße Gebrauch machen, um sich über die Programme, in denen ihre Angehörigen Disease Management in Deutschland – Informationssysteme Seite153 eingeschrieben sind, zu informieren. Von daher sollte auch auf der Seite der Patienten das Internet als Kommunikationsmedium nicht vernachlässigt werden. Das Internet kann damit als ein „Werkzeug“ zur Disseminierung und Implementierung von Disease Management Programmen gesehen werden. Langfristige technische und politische Entwicklungen werden zeigen, ob das Internet seinen Stellenwert als bedeutsames Instrument in der Versorgung chronisch Kranker erlangen wird. Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 154 7 Datenmanagement, Dokumentation und Datenbanken im Disease Management 7.1 Funktion und Stellenwert von Daten im Disease Management Disease Management ist ein informations- und datengetriebener Ansatz zur systematischen Verbesserung der Versorgungsqualität chronisch Kranker. Für den Erfolg eines Disease Management Programms ist es von entscheidender Bedeutung, dass relevante Daten zeitnah zur Verfügung gestellt werden, auf deren Basis ein effektiver und effizienter Ressourceneinsatz in der Behandlung chronisch Kranker erfolgen kann. Für das Disease Management können Daten daher als “strategisches Gut” betrachtet werden [Espinosa, 1998]. Auf Grundlage einer systematischen und standardisierten Dokumentation ermöglicht ein effektives und effizientes Datenmanagement Bereiche von Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Versorgung chronisch Kranker, insbesondere auch im Arzneimittelbereich, zu identifizieren und abzubauen. Ein Disease Management bei hoher Qualität und Kosteneffektivität ist aber nur möglich, wenn durch eine standardisierte und systematische Dokumentation der entsprechenden Daten i) die Kriterien für die Einschreibung in die Programme nachvollziehbar und überprüfbar sind, um Manipulationen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern und ii) Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität erfasst und damit die Qualität der Programme im Zeitverlauf bewertet und mit Hilfe eines Benchmarkings übergreifend verglichen werden. Eine regelmäßige Veröffentlichung der Qualitätsvergleiche gewährleistet dabei eine größtmögliche Transparenz und bietet den besten Anreiz zur systematischen Qualitätsverbesserung [HEDIS, www.ncqa.org]. Funktionen der Datenerhebung sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 155 Tabelle 1: Funktionen einer standardisierten und kontinuierlichen Datenerhebung und Dokumentation im Disease Management • Identifizierung von Bereichen der Über-, Unter- und Fehlversorgung • Kontrolle der Einschreibekriterien, um Manipulationen möglichst auszuschließen, • Risikostratifizierung der eingeschriebenen Patienten • Patientenführung und Optimierung der Therapie auf Basis evidenzbasierter Leitlinien • Steuerung des Reminder – Einsatzes • Qualitätssicherung in Form eines Benchmarkings [Quelle: Eigene Darstellung] 7.2 Dokumentation im Disease Management: der Benchmarkingdatensatz Im Disease Management sollten: - Personenbezogene Stammdaten - Daten zur Kontrolle der Einschreibekriterien - Daten zu Kosten medizinischer Leistungsinanspruchnahme - Daten für die Qualitätssicherung und das Benchmarking in Form von Indikatoren der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität systematisch erfasst werden [Armstrong et al., 1996; Alessi et al., 1999]. Dabei sollten gezielt die Parameter erhoben werden, die für die Erreichung der übergeordneten Ziele des Disease Managements aussagekräftig, valide und durch das Disease Management beeinflussbar sind. Die Parameter sollten Evidenz besitzen und von hoher Spezifität und Sensitivität sein [Liang et al., 1997]. Eine systematische und standardisierte krankheitsspezifische Dokumentation kann mit einem einzigen minimalen Datensatz erfolgen. Dieser minimale Datensatz wird im Folgenden Benchmarkingdatensatz genannt, da er auch zum Benchmarking der Programme herangezogen werden kann (siehe Kapitel Qualitätssicherung). Der Benchmarkingdatensatz enthält Daten zu den Einschreibekriterien, zum Patientenmanagement und zur Qualitätssicherung (Tabelle 2). Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 156 Tabelle 2: Inhalte des Benchmarkingdatensatz Der krankheitsspezifische Benchmarkingdatensatz erfasst für jedes Disease Management Programm: Indikatoren der Prozessqualität Krankheitspezifische Zielwerte Indikatoren der Ergebnisqualität [Quelle: Eigene Darstellung] Der Benchmarkingdatensatz ist für jede Erkrankung unterschiedlich, sollte aber innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung für alle Kassen einheitlich festgelegt sein. Dazu sollten sich die Spitzenverbände gemeinsam auf der Basis evidenzbasierter Leitlinien auf die jeweils zu erfassenden krankheitsspezifischen Qualitätsindikatoren und Zielwerte einigen. Damit wird verhindert, dass man vom derzeitigen System ohne jegliche Standards in ein System multipler widersprüchlicher Standards wechselt. Für den Benchmarkingdatensatz wurden im Gutachten evidenzbasierte, aussagekräftige, valide spezifische und sensitive Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität identifiziert, die auf dem Boden der Identifizierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung die Versorgungsziele spezifizieren. Die Daten sollten ohne großen zusätzlichen Aufwand in der Routine erhebbar sein und den Datenschutz berücksichtigen. Ein Vorschlag für einen krankheitsspezifische Benchmarkingdatensätze für ein Diabetes-Programm zeigt Tabelle 3. Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 157 Tabelle 3: Benchmarkingdatensatz für ein Disease Management Programm Diabetes Indikatoren der Prozessqualität: • Wurde der HbA1c erhoben: ja / nein • Wurde der LDL Cholesterinwert erhoben: ja / nein • Fand in diesem Quartal eine Blutdruckkontrolle statt: ja / nein • Erfolgte eine Augenuntersuchung in diesem Quartal: ja / nein • Erfolgte eine Fußinspektion in diesem Quartal: ja / nein • Ist ein Test auf Mikroalbuminurie in diesem Quartal durchgeführt worden: ja / nein • Wurde der BMI des Patienten in diesem Quartal bestimmt: ja / nein • Nahm der Patient an Patientenschulungen entsprechend seiner Risikostratifizierung in diesem Quartal teil: ja / nein • Erfüllten die Patientenschulungen die vorgegebenen Anforderungen: ja / nein • Nahm der Arzt an einer krankheitsspezifische Ärztefortbildung im Rahmen des Programms in diesem Quartal teil: ja / nein • Wurden Reminder für Ärzte eingesetzt: ja / nein • Wurden Reminder für Patienten eingesetzt: ja / nein • Wurden die definierten Schnittstellen eingehalten (Überweisungen zu Fachärzten): ja / nein Zielwerte (Bezug zum zuletzt gemessenen Wert): • Ist der HbA1c Wert im Zielbereich X: ja / nein • Ist der LDL Cholesterinwert im Zielbereich X: ja / nein • Liegt der systolische Blutdruckwert im Zielbereich von X: ja / nein • Liegt der diastolische Blutdruckwert im Zielbereich von X: ja / nein • Liegt der BMI im Zielbereich X: ja / nein Indikatoren der Ergebnisqualität: • Liegt eine diabetische Neuropathie vor: ja / nein • Mußte eine Amputation des Fußes / der Zehe erfolgen: ja / nein • Liegt eine diabetische Nephropathie vor: ja / nein • Wurde der Patient dialysepflichtig: ja / nein • Liegt eine diabetische Retinopathie vor: ja / nein • Wurde der Patient in diesem Quartal aufgrund seines Diabetes in ein Krankenhaus eingewiesen: ja/nein? [Quelle: Eigene Darstellung] Mit den Indikatoren der Prozessqualität wird erfasst ob bestimmte krankheitsspezifische, evidenzbasierte und aussagekräftige Laborwerte regelmäßig erhoben wurden. Außerdem wird nach durchgeführten Schulungen bzw. Fortbildungen sowie zum Einsatz von Remindern gefragt. Die Indikatoren der Ergebnisqualität enthalten Fragen zu krankheitsspezifischen Folgekomplikationen bzw. Endpunkten, die im Rahmen einer systematischen Qualitätsverbesserung der Versorgung chronisch Kranker verringert werden sollten. Die Zielwerte werden entsprechend der Risikostratifizierung des Patienten festgelegt. Die krankheitsspezifischen Zielwerte sollten einheitlich für alle Programme der gesetzlichen Krankenversicherung gelten. Auf diese sollten sich die Spitzenverbände auf Basis evidenzbasierter Leitlinien einigen. Damit soll vermieden werden, dass Versicherte unterschiedlicher Kassen auch unterschiedliche Zielwerte erreichen sollen. Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 158 Auch eine effizientere Arzneimitteltherapie kann über den Benchmarkingdatensatz erreicht werden, indem beispielsweise die Therapie mit sogenannten Reservetherapeutika abgefragt und begründet werden muss. Medikamente, die nicht kosteneffektiv sind, bzw. deren Wirksamkeit nicht gesichert ist, wie z.B. Pseudoinnovationen oder Me-too Präparate, könnten so in der Verordnungshäufigkeit zurückgedrängt werden und der kostenstabilisierende Effekt des Disease Management verstärkt werden. Die Richtigkeit der gemachten Angaben können die Krankenkassen in ihren Arzneimitteldaten untersuchen, die sie auf der Grundlage der Einwilligung der Patienten unter Berücksichtigung des Datenschutzes auswerten dürfen. Bei der Erstellung und Auswertung des Benchmarkingdatensatzes muss berücksichtigt werden, dass Krankenkassen mit vermehrt sozial benachteiligten Versichertengruppen, die möglicherweise mit schlechteren Ausgangswerten in das Programm einsteigen und eine schlechtere Compliance aufweisen als Versicherte aus höheren sozialen Schichten, kein Nachteil entsteht. Die Indikatoren der Prozessqualität sollten daher nicht von der Compliance der Patienten abhängig sein. Daher sollte auch nicht der absolut erreichte Wert eines Indikators zum Benchmark herangezogen werden, sondern die erzielte Verbesserung, die ggf. prozentual zum Vorjahresergebnis ausgedrückt werden kann. Für Kassen, die eine große Anzahl schlecht eingestellter Patienten einschreiben, ergibt sich so ein größeres Potenzial zur Verbesserung. Um eine systematische Dokumentation zu erreichen, sollte der Bechmarkingdatensatz jedes Quartal, also alle 3 Monate, vom Arzt und Patient gemeinsam ausgefüllt, unterschrieben und an die Kasse für eine zentrale Datenerfassung weitergeleitet werden (zum Datenfluss s.u.). Als einheitliches Standardverfahren zur Dokumentation für alle Disease Management Programme in der gesetzlichen Krankenversicherung spielt der Benchmarkingdatensatz daher eine zentrale Rolle, denn er erfüllt gleich mehrere Funktionen (Abbildung 1): • Mit dem Benchmarkingdatensatz wird das Erreichen der Ziele der Programme in regelmäßigen Abständen einheitlich dokumentiert. Damit können erfolglose Programme frühzeitig erfasst werden. Anhand des Benchmarkingdatensatzes kann geprüft werden, ob die definierten Ziele zum Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung auch erfasst und mit dem Programm umgesetzt werden • Mit dem Benchmarkingdatensatz können eingeschriebene Patienten, die nicht mehr am Disease Management teilnehmen (sogenannte "Karteileichen") früh- Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 159 zeitig erfasst werden. Jeder Patient, für den kein Dokumentationsbogen ausgefüllt wird, kann durch die Reakkreditierungsinstitution aus den vom Risikostrukturausgleich finanzierten Programmen herausgenommen werden • Mit dem Benchmarkingdatensatz kann die Kasse aktiv am Disease Management teilnehmen. Sie erhält zeitnah zuverlässige Daten. Da der Benchmarkindatensatz von Arzt und Patient unterschrieben wird, kann die Kasse sich auf diese Daten verlassen • Mit Hilfe des Benchmarkingdatensatzes kann der Patient systematisch und gezielt in seinem Programm geführt und der Arzt in der Therapie unterstützt werden. Weiterhin kann die Kasse gezielt den Reminder-Einsatz steuern • Mit Hilfe des Benchmarkingdatensatzes können die Einschreibekriterien überprüft und Manipulationsmöglichkeiten verringert werden • Der Benchmarkingdatensatz ist Grundlage für die Qualitätssicherung und die Reakkreditierung der Programme durch das Benchmarking. Abbildung 1: Funktionen des minimalen Benchmarkingdatensatzes im Disease Management Qualitätssicherung der Einschreibung Minimaler Benchmarkingdatensatz Qualitätssicherung des kontinuierlichen Monitorings und der Patientenführung Steuerungsgrundlage der Krankenkasse am Disease Management Grundlage für die Reakkreditierung bzw. das Benchmarking [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 160 7.3 Datenbanken der am Disease Management Beteiligten Die mit dem Benchmarkingdatensatz erhobenen Daten im Disease Management sollten von der Krankenkassen zentral erfasst werden. Eine dezentrale Datenerfassung und -sammlung beim Arzt bedingt große Informationsverluste für ein systematisches Disease Management. Dies würde zu einer Verschwendung von Ressourcen, z.B. in Form von wiederholten Doppeluntersuchungen, unnötigen Zeitaufwendungen bei der Suche nach früheren Patientendaten usw., führen. Durch die zentrale Datenerfassung und Datensammlung bei der Krankenkasse als Programmanbieter kann dies vermieden und das Datenmanagement effizienter und effektiver gestaltet werden (Tabelle 4). Tabelle 4: Nachteile einer dezentralen und Vorteile der zentralen Datenerfassung im Disease Management nicht auffindbare Dokumente nicht auffindbare Daten in Dokumenten zeitaufwendige Suche nach früheren Daten und Informationen fehlerhaft eingetragene Daten nicht lesbare handschriftliche Informationen keine Zugriffsmöglichkeit von mehreren Stellen aus großer Platzbedarf zum Archivieren der Daten zeit- und ortsunabhängige Vorteile einer zentralen elektronischen Zugriffsmöglichkeiten auf Daten Datensammlung und –archivierung verbesserter, effizienter Informationsfluss durch die Krankenkasse schnelle und zeitnahe Datenweitergabe an Leistungserbringer möglich kontinuierlicher und sofortiger Abgleich neuer mit historischen Untersuchungsdaten des Patienten ermöglicht Entscheidungsunterstützung (Decision Support) des Arztes Steuerung von Remindern möglich Verbesserung der Qualität medizinischer Entscheidungen und Behandlungen Platzersparnis bei Archivierung von Patientendaten Möglichkeit einer übergreifenden Evaluation [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Selby et al., 1997] Nachteile einer dezentralen Datenarchivierung z.B. beim Arzt in Form von herkömmlichen Patientenakten - Die Dokumentation erfolgt wie zuvor dargestellt auf einfache Weise in Papierformat mit Hilfe des minimale Benchmarkingdatensatz (s.o.). Die so erfassten Parameter werden in Disease Management Datenbanken eingegeben, ausgewertet, gespeichert und gepflegt. Dafür sollten Datenbanken bei den Kostenträgern (Programmanbietern), bei eventuell kooperierenden externen Dienstleistern sowie bei der für die Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 161 Reakkreditierung bzw. das Benchmarking zuständigen Institution (z.B. das Bundesvesicherungsamt) eingerichtet werden. Bestehende Strukturen und Techniken sollten dabei verwendet werden, um schnell und ohne große zusätzliche Kosten die notwendige technische Infrastruktur für den Datentransfer und die Datenarchivierung bereitstellen zu können. Disease Management Datenbanken können dabei in drei möglichen Qualitätsausprägungsstufen verwendet werden (Tabelle 5). Tabelle 5: Mögliche Qualitätsausprägungsstufen für Datenbanken (I: niedrigstes Niveau, III: höchstes Niveau) Qualitätsniveau III Qualitätsniveau II Qualitätsniveau I Datenbanken, die zeitgrecht spezifische Daten zur Verfügung stellen und einen Decision Support ermöglichen (Verknüpfung von Routinedaten des Benchmarkingdatensatzes mit individuellen Therapieempfehlungen) Datenbanken, die zeitgerecht spezifische Daten zur Verfügung stellen; Kompatibilität der Daten; Möglichkeit des Poolens von Daten für Vergleiche; kein Decision Support möglich Datenbanken, die unspezifische Dokumentationen ermöglichen [Quelle: Eigene Darstellung] Der Aufbau zentraler Disease Management Datenbanken bei den Krankenkassen dient daher u.a.: • der Steigerung der Effizienz in der Datenverwaltung durch eine Verbesserung und Erleichterung der Dokumentation sowie einer Reduktion des Dokumentationsaufwandes für den Leistungserbringer • der Kostenreduktion in der Datenverwaltung • dem Aufbau von effizienten Informationswegen • der Verbesserung der Qualitätssicherung in der Datenverwaltung und dokumentation • einer systematischen und zeitnahen, spezifischen Informationsbereitstellung relevanter Daten für den Arzt mit der Möglichkeit der Entscheidungsunterstützung über Decision Support - Systeme • der systematisch Steuerung von Reminder • der Möglichkeit einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle und Qualitätsvergleiche in Form des Benchmarkings • der Sammlung bisher nicht vorhandener relevanter Daten zur Unterstützung der Versorgungsforschung (z.B. Daten zu Krankheits - und Kostenstrukturen, zu sektorenübergreifende Ressourcenverbrauch, etc.). Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 162 7.4 Datenfluss im Disease Management Programm Der Datenfluss beinhaltet die Dokumentation, Weiterleitung und Erfassung des Benchmarkingdatensatzes. Folgende Abbildung zeigt schematisch eine mögliche Vorgehensweise für den Datentransfer im Disease Management. Der Arzt erhebt einmal im Quartal für jeden eingeschriebenen Patienten den entsprechenden Benchmarkingdatensatz. Diesen bekommt er von der Krankenkasse mit Beginn seiner Teilnahme am Disease Management Programm für alle seine eingeschriebenen Patienten per Post, Fax oder auch auf elektronischem Weg (e-mail, Bereitstellung im Internet) zugesandt. Der Benchmarkingdatensatz sollte gemeinsam vom Arzt und Patient, z.B. bei einem Routinebesuch, ausgefüllt und von beiden unterschrieben werden. Damit ist er ein rechtsgültiges Dokument und schließt in der Regel bewußte Manipulationen aus. Die Kasse erhält somit verläßliche Daten. Die ausgefüllten Benchmarkingdatensätze schickt der Arzt, z.B. jeweils am Quartalsende, an die entsprechende Krankenkasse auf regulärem Postweg, per Fax oder auf elektronischem Wege wieder zurück. Die Krankenkasse erfasst alle eingehenden Benchmarkingdatensätze in ihrer Disease Management Datenbank. Diese Daten bilden die Grundlage der Krankenkasse für die aktive Teilnahme und der Steuerung am Disease Management. Für die Reakkreditierung bzw. das Benchmarking schickt die Krankenkasse ausgewählte Indikatoren aus dem Benchmarkingdatensatz an eine zentrale Institution, die für die Reakkreditierung bzw. das Benchmarking zuständig ist (z.B. das Bundesversicherungsamt). Die Indikatoren, die aus dem Benchmarkingdatensatz für das eigentliche Benchmarking verwendet werden, sollten zuvor einheitlich von den Spitzenverbänden definiert worden sein. Die Reakkreditierungs- bzw. Benchmarkinginstitution sammelt und speichert die Reakkreditierungsdaten aller Programme zentral in einer ihrer Disease Management Datenbank. Weitere Einzelheiten der Reakkreditierung und des Benchmarkings finden sich im Kapitel Qualitätssicherung. Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 163 Abbildung 2: Datentransfer im Disease Management Zentrale Reakkreditierungs- und BenchmarkInstitution 3 definierte Benchmarkingkriterien 1 Arzt Benchmarkingdatensatz Krankenkasse 2 1. Die Krankenkasse schickt dem Arzt per Post, Fax oder auf elektronischem Weg das Formular des Benchmarkingdatensatzes zu. 2. Der Arzt füllt gemeinsam mit den Patienten den Benchmarkingdatensatz einmal im Quartal aus und schickt ihn an die Krankenkasse per Post, Fax oder auf elektronischem Weg wieder zurück. Die Daten werden bei der Krankenkasse in ihrer Disease Management Datenbank gesammelt, gespeichert und zeitnah ausgewertet. Auf Basis dieser Daten erfolgt die aktive Teilnahme und Steuerung des Programms durch die Kasse. 3. Die für die Reakkreditierung bzw. das Benchmarking der Programme notwendigen Daten werden von der Krankenkasse an die Reakkreditierungs- und Benchmarkingistitution weitergeleitet und dort zentral gespeichert und ausgewertet. [Quelle: Eigene Darstellung] 7.5 Datenschutz im Disease Management Um im Rahmen des Disease Management den Versorgungsbedarf chronisch Kranker gezielt analysieren und Bereiche von Über-, Unter- und Fehlversorgung identifizieren zu können, muss die bisherige Datentransparenz im Gesundheitswesen verbessert werden. Das vom Gesetzgeber angestrebte Datentransparenzgesetz könnte hierzu ein erster Schritt sein. Ohne die Weitergabe unverschlüsselter, d.h. Versicherten- und Leistungserbringer bezogener Daten an die Krankenkasse kann ein Disease Management nicht funktionieren. Daher ist es besonders wichtig, dass die vom Gesetzgeber vorgegebenen Richtlinien des Datenschutzes auf allen Ebenen und in al- Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 164 len Modulen des Disease Managements eingehalten werden. Auch im Disease Management muss die Privatssphäre des Einzelnen und der Schutz der Vertraulichkeit sensibler medizinischer Daten sichergestellt sein. Für kassenübergreifende Datenauswertungen, wie z.B. für die Reakkreditierung bzw. das Benchmarking, sollten Daten daher nur anonymisiert von den Kassen weitergeleitet und zusammengeführt werden. Datentransparenz und Datenschutz sind durchaus miteinander vereinbar [Scholz, 2001]. Die oft vorgebrachten Befürchtungen eines "gläsernen Patienten", dass durch eine versichertenbezogene Datenweitergabe an die Kassen diese Daten zur Risikoselektion missbraucht werden könnten, scheint eine interessensgesteuerte Interpretation zu sein [Scholz, 2001]. In der stationären Versorgung liegen die Daten den Kassen schon jetzt versichertenbezogen vor. Der Gesetzgeber muss über Richtlinien den Datenschutz und die Datensicherheit im Disease Management gewährleisten und die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für die Speicherung, Zusammenführung und Auswertung von personenbezogenen sensiblen medizinischen Daten formulieren. Grundsätzlich sind hier datenschutzrechtliche Bestimmung auf europäischer, Bundes-, Landes- und Krankenkassenebene zu beachten. Datenschutzrechtliche Fragestellungen im Disease Management ergeben sich u.a. bei: • den Zugriffsrechten auf die einzelnen Disease Management Daten • der Sicherheit des Datentransfers und des Datenaustausches • der Sicherheit der Datenarchivierung • der Verhinderung des Mißbrauchs von Disease Management Daten durch Dritte • der Gewährleistung der Sicherheit der Privatssphäre des Patienten und Arztes trotzt unverschlüsselter Datenweitergabe an die Kasse. Alle am Disease Management Beteiligten sollten sich schriftlich auf den Datenschutz verpflichten müssen. Mit der Einschreibung in das Programm muss der Patient zusätzlich schriftlich seine Einwilligung auf den Zugriff und die Weiterleitung seiner persönlichen Daten erteilen. Damit stimmt er zu, dass seine medizinischen Daten im dafür notwendigen Rahmen des Programms an die Kasse weitergeleitet und dort ausgewertet werden. Ohne diese Einwilligung des Patienten sollte eine Teilnahme an einem Disease Management Programm nicht möglich sein. Dies ist notwendig, da ohne unverschlüsselte Daten die Krankenkasse keine aktive Rolle und Steuerungs- Disease Management in Deutschland - Datenmanagement Seite 165 funktion im Disease Management übernehmen kann. Die Erhebung, Auswertung und Weiterleitung der Daten muss im Rahmen der datenschutzrechtlichen Möglichkeiten erfolgen. Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 166 8 Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung Organisationsmanagement soll durch die Neustrukturierung von Organisationsabläufen und Praxisroutinen eine Zuschneidung organisatorischer Abläufe auf die Bedürfnisse chronisch kranker Patienten ermöglichen. Entscheidungsunterstützung soll dem Arzt therapierelevante Informationen in strukturierter und aufbereiteter Form zur Verfügung stellen, um eine rasche Integration aller wichtigen Informationen in den Entscheidungsfindungsprozess zu gewährleisten. Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung sind wichtige Werkzeuge für die Implementierung einer evidenzbasierten Therapie in die Regelversorgung. Durch das Organisationsmanagement werden die Rahmenbedingungen geschaffen, die es dem Arzt ermöglichen, Entscheidungsunterstützung zu nützen und die Empfehlungen der Leitlinien umzusetzen. Das Gutachten verwendet folgende Arbeitsdefinition für Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung: Definition: Organisationsmanagement umfasst alle Prozesse zur Neustrukturierung von Abläufen der Gesundheitsversorgung, wie z.B. die Umgestaltung von Praxisroutinen mit Einführung spezieller Sprechstunden für chronisch Kranke oder den Einsatz spezieller Krankheitskoordinatoren. Im weiteren Sinne gehört zum Organisationsmanagement auch der Einsatz von Entscheidungsunterstützung soweit sie mit einer Restrukturierung von Versorgungsroutinen verbunden ist. Beispiele sind gemeinsame Sprechstunden von Spezialisten und Hausärzten oder spezielle Diabetestage in Klinik oder Praxis. Durch den gezielten Einsatz von Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung kann im Rahmen von Disease Management Programmen die Versorgungsqualität verbessert werden [McCulloch et al., 2000; Friedman et al., 1998; Wagner et al., 1996; Wagner et al., 1999]. Organisationsmanagement wird im Rahmen von Disease Management Programmen in der Regel zusammen mit anderen Interventionen implementiert. Häufig werden auch unterschiedliche Interventionen des Organisationsmanagements zusammen in einem Programm eingesetzt. Eine Bewertung der einzelnen Intervention hinsichtlich des medizinischen Ergebnisses Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 167 bzw. der ökonomischen Auswirkungen ist daher nicht möglich [Erich, 1999b]. Wie bereits dargestellt, liegt jedoch Evidenz vor, dass die gleichzeitige Implementierung von Organisationsmanagement mit anderen Komponenten des Disease Management zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität und zu Kosteneinsparungen führen kann [McCulloch et al. 2000; Wagner et al., 1999; DeBusk 1999, Rohrbach 1999, Cline 1998]. 8.1 Qualitätsstufen von Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung Organisationsmanagement und Interventionen zur Entscheidungsunterstützung können in unterschiedlicher Qualitätsausprägung im Disease Management eingesetzt werden (Tabelle 1 und Tabelle 2). Tabelle 1: Mögliche Qualitätsausprägungsstufen von Organisationsmanagement (Niveau I unterste Stufe, Niveau III höchste Stufe) Qualitätsniveau III Qualitätsniveau II Qualitätsniveau I [Quelle: Eigene Darstellung] Anpassung von Praxisroutinen, Arbeitsabläufen und Betreuungskonzepten auf die speziellen Bedürfnisse chronisch Kranker Zusätzliche Serviceangebote an chronisch Kranke im Rahmen der üblichen Praxisroutine, Arbeitsabläufe und Betreuungskonzepte Kundenbindung durch gezielte Dienstleistungseffekte Maßnahmen zur Kundenbindung auf Niveau I umfassen beispielsweise das Wartezeitenmanagement, die Freundlichkeit von Praxismitarbeitern und die Ausstattung der Praxis. Solche Maßnahmen kommen allen Patienten gleichermaßen zugute ohne dass ein direkter Einfluss auf die Versorgungsqualität nachweisbar wäre. Zu den Maßnahmen des Qualitätsniveaus II gehören beispielsweise das Anbieten einer Hotline über ein Call- Center für chronisch kranke Patienten oder das Zuschicken von Informationsmaterial durch die Krankenkasse. Diese Maßnahmen unterstützen das Selbstmanagement der chronisch Kranken ohne dass organisatorische Änderungen im Betreuungskonzept bzw. in Arbeitsabläufen vorgenommen werden müssen. Die Maßnahmen werden zusätzlich zur üblichen Regelversorgung angeboten. Das Qualitätsniveau III ist durch organisatorische Änderungen im Praxisablauf und in den Be- Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 168 Betreuungskonzepten gekennzeichnet. Ziel ist die organisatorische Neuausrichtung von Praxisabläufen und Betreuungskonzepten auf die spezifischen Bedürfnisse chronisch Kranker. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz eines Krankheitskoordinators, das Angebot spezieller Sprechstunden mit integrierten, zusätzlichen Betreuungsangeboten wie Gruppensprechstunden (s.u.). Eng mit dem Organisationsmanagement verbunden sind die Interventionen zur Entscheidungsunterstützung, die ebenfalls in unterschiedlichen Qualitätsstufen implementiert werden können (Tabelle 2). Tabelle 2: Mögliche Qualitätsausprägungsstufen von Organisationsmanagement (Niveau I unterste Stufe, Niveau III höchste Stufe) Qualitätsniveau III Qualitätsniveau II Qualitätsniveau I Implementierung von Entscheidungsunterstützung in Praxisroutinen, Arbeitsabläufe und Betreuungskonzepten zur gezielten Information Zusätzliche Serviceangebote an Ärzte im Rahmen der üblichen Praxisroutine und Betreuungskonzepte Zusätzliche Serviceangebote unabhängig von Praxisroutine und Betreuungskonzepten [Quelle: Eigene Darstellung] Interventionen zur Entscheidungsunterstützung auf Qualitätsniveau I umfassen beispielsweise Internetportale, Datenbanken oder die Disseminierung von Leitlinien. Sie sind unspezifisch, für den Arzt jederzeit zugänglich und unabhängig von Praxisabläufen und Betreuungskonzepten. Im Rahmen dieser Qualitätsstufe werden keine Implementierungsstrategien angewendet. Zur Entscheidungsunterstützung auf Qualitätsniveau II gehören z.B. Expertensprechstunden via Telefon oder Internet. Diese Interventionen können im Rahmen der üblichen Praxisroutine implementiert werden und erfordern keine Umstellung organisatorischer Abläufe. Auf Stufe III werden zur Entscheidungsunterstützung organisatorische Änderungen vorgenommen. Beispiele sind gemeinsame Sprechstunden von Hausarzt und Spezialist (s.u.). Die Interventionen der Stufe III sind sehr effektiv [Wagner et al., 1999], da sie zugleich einen Fortbildungseffekt haben. Durch die Fortbildung des Arztes kann eine tatsächliche und dauerhafte Qualitätsverbesserung der Regelversorgung erzielt werden. Im Folgenden werden ausgewählte Interventionen des Organisationsmanagements und der Entscheidungsunterstützung beschrieben und bezüglich ihrer Implementierbarkeit in Disease Management Programme bewertet. Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 169 8.2 Interventionen zum Organisationsmanagement und zur Entscheidungsunterstützung Krankheitsbezogene Spezialsprechstunden in der Praxis: In Abhängigkeit von der Anzahl eingeschriebener Programme pro Praxis kann beispielsweise einmal pro Woche oder einmal pro Monat ein Vormittag für Patienten mit Diabetes Mellitus oder einer anderen chronischen Erkrankung in der Hausarztpraxis reserviert werden. Die Patienten werden entsprechend zu diesen Terminen besonders eingeladen bzw. Routinesprechstundenbesuche werden auf diese Tage gelegt. Im Rahmen dieser speziellen Sprechstunden können beispielsweise längere Sprechzeiten eingeplant werden. Anstelle der üblichen 5 bis 10minütigen Konsultation können je nach Risikostratifizierung 15 bis 30 Minuten angesetzt werden. Die geplante Sprechstunde soll es dem Hausarzt ermöglichen, sich auf diabetesbezogene Themen zu konzentrieren [Friedman et al., 1998]. Beispielsweise können die im Disease Management erforderlichen Untersuchungen, wie z.B. die Fußinspektion oder eine ausführliche Medikamentenanamnese mit Abfragen von Nebenwirkungen und Dosisanpassung durchgeführt werden [Cintron et al., 1983]. Spezifische Fragen des Patienten können beantwortet und der Benchmarkingdatensatz ausgefüllt und unterschrieben werden. Die Delegation von Aufgaben an speziell geschulte Praxismitarbeiter bzw. die Vorbereitung durch die Praxismitarbeiter gehören ebenfalls zum Organisationsmanagement. Beispielsweise kommt es zu einer höheren Rate an regelmäßigen Fußinspektionen, wenn der Patient von der Sprechstundenhilfe aufgefordert wird, Schuhe und Strümpfe im Sprechzimmer auszuziehen [Litzelman et al., 1993]. Eine Demonstration der Fußinspektion durch den Patienten mit Korrektur durch einen Experten kann z.B. zusammen mit einer weitergebildeten Diabeteskoordinatorin durchgeführt werden [Litzelman et al., 1993]. Krankheitsbezogene Sprechtage in der Praxis: Die krankheitsbezogenen Spezialsprechstunden können bei einem entsprechen großen Patientenkollektiv auch als krankheitsbezogene Sprechtage ausgestaltet werden. Zu solchen Sprechtagen werden neben den Routineterminen insbesondere Patienten eingeladen, die Zielwerte nicht erreichen bzw. an Komplikationen leiden, also Patienten der Managementgruppen 2 und 3. Die krankheitsbezogenen Sprechtage Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 170 unterscheiden sich von den krankheitsbezogenen Sprechstunden durch die stärkere Einbindung nicht-ärztlichen Personals [McCulloch et al., 1998]. Beispielsweise kann das Praxisteam an solchen Tagen durch eine Diätberaterin, ein externes Schulungsteam (falls in der Praxis nicht selbst geschult wird) oder einen orthopädischen Schuhmacher ergänzt werden. Möglich sind auch Treffen mit Selbsthilfegruppen oder Gruppensprechstunden, in denen Patienten Fragen stellen können, die z.B. von Arzt und Diätberaterin gemeinsam beantwortet werden. Sowohl krankheitsbezogene Sprechstunden als auch krankheitsbezogene Sprechtage eignen sich sehr gut zur Implementierung in die Praxisroutine. Für Programme mit speziellen krankheitsbezogenen Sprechstunden wird die Versorgungsqualität positiv beeinflusst [McCulloch et al., 1998; McCulloch et al., 2000; Friedman et al., 1998]. Krankheitsbezogene Spezialsprechstunden in der Klinik: Krankheitsbezogene Spezialsprechstunden in der Klinik werden in der Regel zur Nachbetreuung besonders gefährdeter Patienten, wie z. B.: Patienten mit Herzinsuffizienz eingerichtet [Smith et al., 1998; Ekman et al., 1998; Knox et al., 1999]. Die Spezialsprechstunden versorgen den Patienten ähnlich einer Spezialambulanz in sehr enger Kooperation mit dem Hausarzt. In der Klinik werden dabei in der Regel notwendige Untersuchungen zur Risikostratifizierung wie z.B. ein Herzecho durchgeführt und die langfristigen Therapieziele mit dem Patienten abgestimmt. In die Spezialsprechstunden in der Klinik werden in der Regel nur Patienten nach einem stationären Aufenthalt bzw. Patienten mit einem erhöhten Betreuungsbedarf aufgenommen. Bei den krankheitsbezogenen Spezialsprechstunden in der Klinik handelt es sich letztlich um die Einbindung von Spezialambulanzen in Disease Management Programme. Entscheidend für den Erfolg solcher Spezialsprechstunden ist, • Die zeitnahe Weiterleitung von Untersuchungsergebnissen und Therapieempfehlungen an den Hausarzt sowie vom Hausarzt an die Spezialsprechstunde. Die Koordination des Datentransfers kann durch einen Koordinator (z.B. Krankenschwester oder Call- Center) durchgeführt oder überwacht werden. • Die Therapieplanung unter Verwendung derselben evidenzbasierten Therapieempfehlungen in Klinik und Praxis • Die Vermeidung von Brüchen in der Versorgung. Dazu können die Verwendung derselben leitliniengestützten Empfehlungen, gemeinsame Fortbildungsveranstal- Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 171 tungen, der Einsatz eines Koordinators sowie beispielsweise eine abgestimmte medikamentöse Therapie (Verwendung von Generika an Stelle von Originalpräparaten in der Klinik) beitragen Spezialsprechstunden in der Klinik zur Nachbetreuung besonders gefährdeter Patienten haben sich in verschiedenen Disease Management Programmen bewährt [Knox et al., 1999; Cline et al., 1998; Ekman et al., 1998; Fonarow et al., 2001; Cintron et al., 1983; Smith et al., 1998]. Krankheitsbezogene Sprechtage in der Klinik: Krankheitsbezogene Sprechtage in der Klinik können analog den krankheitsbezogenen Sprechtagen in der Praxis ausgestaltet werden. Sie sind vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn mehrere Praxen solche Sprechtage gemeinsam in der Klinik oder in Zusammenarbeit mit einer Spezialsprechstunde durchführen. Gemeinsame Sprechstunden von Hausarzt und Experte: Die gemeinsame Sprechstunde von Hausarzt und Experte kann sowohl in der Praxis als auch in der Klinik durchgeführt werden. In der Praxis besteht die Möglichkeit, dass der Hausarzt je nach Bedarf einen niedergelassenen Experten oder einen Experten aus der Klinik beispielsweise im Rahmen der Spezialsprechstunde hinzuzieht [McCulloch et al., 1998]. Dies kann als Service für Patienten z.B. in ländlicher Umgebung angeboten werden, wenn der nächste Diabetologe schlecht erreichbar ist. Alternativ können in solchen Sprechstunden einmal pro Monat alle Patienten vorgestellt werden, die aufgrund der Definition von Schnittstellen, zum Experten (z.B. Diabetologen) überwiesen werden sollten. Eine solche gemeinsame Lösung bietet die Vorteile eines problemlosen Daten- und Wissenstransfers, sowie Service für den Patienten. Im Rahmen von Disease Management Programmen sind solche gemeinsamen Sprechstunden geeignet, zur Qualitätssicherung beizutragen [McCulloch et al., 1998]. Krankheitskoordinator Der Krankheitskoordinator hat in erster Linie logistische Funktionen. Er kann allerdings in begrenztem Maße auch für die Unterstützung bei der Erfüllung medizinischer Leistungen herangezogen werden. Dies hängt von der Ausprägung des Koordinators Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 172 ab. Grundsätzlich kann der Krankheitskoordinator ein Arzt (sinnvoll z.B. für große universitäre Brustkrebszentren mit hohem Patientenaufkommen), eine speziell weitergebildete Krankenschwester [Hershberger et al., 2001; Albert et al., 2001; Fonarow et al., 2001; Hanumanthu et al., 1997; Ekman et al., 1998] oder ein Call- Center sein. Call- Center können beispielsweise im Rahmen von Telemanagement eingesetzt werden. Evidenz für solche Interventionen liegt beispielsweise für das Disease Management der Herzinsuffizienz vor [Knox et al., 1999]. Durch das Call- Center werden täglich definierte Parameter wie Gewicht oder Atemnot abgefragt und eine Abweichungsanalyse durchgeführt. Bei entsprechenden vorher definierten Schnittstellen wird der betreuende Arzt kontaktiert [Hershberger et al., 2001; Knox et al., 1999]. Ebenso besteht Evidenz, dass die ambulante Nachbetreuung von Risikopatienten nach Krankenhausentlassung durch einen Koordinator zu einer Qualitätsverbesserung in der Versorgung führt [Steffens et al., 2000]. Beispielsweise können in Abhängigkeit von Risikostratifizierung und klinischem Zustand des Patienten Hausbesuche durch einen speziell weitergebildeten Krankheitskoordinator (in der Regel eine Krankenschwester) oder eine Betreuung durch Telemanagement erfolgen. Das Telemangement kann durch ein Call- Center oder durch einen Krankheitskoordinator durchgeführt werden. Beide Interventionsmöglichkeiten sind effektiv. Beispielsweise könnte ein Patient nach Krankenhausaufenthalt aufgrund einer schweren Hypoglykämie durch ein Call- Center betreut werden, indem regelmäßig der Blutzucker abgefragt wird und bei Abweichungen von den Empfehlungen Entscheidungsunterstützung angeboten bzw. eine Konsultation beim Hausarzt veranlasst wird. Die Entlassung und Weiterbetreuung eines Patienten mit mangelnder sozialer Unterstützung aus dem Krankenhaus sollte hingegen von einer Krankenschwester durchgeführt werden, um Wiedereinweisungen aufgrund sozialer Indikationen zu vermeiden. In der Klinik begonnene Schulungen können durch den Krankheitskoordinator im ambulanten Bereich inhaltlich koordiniert oder weitergeführt werden, falls keine ambulante Schulung vom Hausarzt angeboten wird [Knox et al., 1999]. Internationale Erfahrungen mit Krankheitskoordinatoren zeigen verbesserte medizinische Outcomes und können trotz des erhöhten Aufwandes in der Regel Kosteneinsparungen realisieren [Lasater et al., 1996; Rich et al., 1995]. Allerdings liegen keine Untersuchungen der Einzelintervention vor, sondern lediglich Evaluationen von Programmen, die gleichzeitig mehrere Interventionen implementieren [McCulloch et al., 1998; Knox und Disease Management in Deutschland – Organisation und Entscheidung Seite 173 Mischke, 1999; Steffens 2000, Lasater 1996, West et al., 1997; Dennis et al. 1996, Martens and Mellor 1997, Stewart et al., 1999; Roglieri et al., 1997]. Patientenalgorithmen im Krankenhaus: Im Rahmen von Disease Management Programmen werden im stationären Bereich häufig sogenannte Patient Care Pathways zur Verbesserung der Patientenversorgung eingesetzt [Rohrbach, 1999; Knox et al., 1999; Rich et al., 1995]. Sie sind ein systematischer Ansatz zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen von Leitlinien in die Routineversorgung. Im Rahmen von Disease Management Programmen gehen Patientenalgorithmen in der Klinik in die systematische ambulante Weiterbetreuung über. Beispielsweise werden bestimmte Untersuchungen wie ein Herzecho bei Herzinsuffizienzpatienten in der Klinik zur Risikostratifizierung durchgeführt (falls nicht bereits vorhanden) und das Ergebnis für die Risikostratifizierung und Therapieplanung im ambulanten Bereich übernommen. Häufig werden auch Schulungen und gezielte, individuell zugeschnittene Informationsprogramme in der Klinik bei Krankenhausaufnahme begonnen und dann in genau abgestimmten Modulen in der Praxis weitergeführt [Roglieri et al., 1997; Knox et al., 1999]. Dadurch können Doppelinterventionen vermieden werden und ein systematischer Versorgungsansatz sektorenübergreifend gewährleistet werden. Zufällige Schulungsinhalte, die sich überschneiden und wiederholen oder Themen ganz auslassen, werden durch kontinuierliche und systematische Schulungen ersetzt, die durch individuell zugeschnittene Informationsgaben unterstützt werden. Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung sind ein wesentlicher Bestandteil von Disease Management, da sie zur Implementierung evidenzbasierter Therapieinhalte in der Routineversorgung ansetzen. Werden an Stelle von Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung lediglich Schnittstellen und Überweisungsroutinen definiert, so wird die Implementierung einer evidenzbasierten Regelversorgung deutlich erschwert [Wagner et al., 1999]. Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite174 9 Ärztliche Fortbildung im Disease Management Ziel der ärztlichen Fortbildung im Rahmen von Disease Management ist die Unterstützung der Ärzte bei der Umsetzung einer evidenzbasierten und kosteneffektiven Therapie in die Regelversorgung. Da ausreichend Evidenz vorliegt, dass die Dissemination von Leitlinien alleine nicht zu einer Änderung von Therapie- und Verschreibungsverhalten von Ärzten führt (Kapitel 3), werden in Disease Management Programmen verschiedene Implementierungsstrategien gleichzeitig angewendet. Der Effekt einzelner Maßnahmen, wie z.B. der ärztlichen Fortbildung, auf die Verbesserung der Versorgungsqualität und auf die Kosten – Effektivität der Versorgung ist daher schwierig abzuschätzen. Im Folgenden werden allgemeine Entwicklungen in der ärztlichen Fortbildung beschrieben und mögliche Interventionen zur Implementierung im Rahmen von Disease Management Programmen dargestellt. 9.1 Entwicklungstendenzen in der ärztlichen Fortbildung International kann ein Wandel des Begriffs „Fortbildung“ beobachtet werden. Lange Zeit wurde unter ärztlicher Fortbildung die Vermittlung medizinischen Wissens durch Vorträge oder das Selbststudium aus Büchern und Zeitschriften verstanden. Mehr und mehr treten jedoch Aspekte der Weiterentwicklung der Professionalität als Antwort auf die zunehmende Bewertung der ärztlichen Kompetenz durch die Öffentlichkeit in den Vordergrund. Begünstigt wird dieser Trend durch die zunehmende Globalisierung im Gesundheitsbereich, durch die Anforderungen der evidenzbasierten Medizin und durch die Stärkung der Patientensouveränität. Ärztliche Fortbildung geht daher über medizinische Wissensvermittlung bzw. Wissensaneignung deutlich hinaus. Sie kann als kontinuierlicher und systematischer Prozess beschrieben werden, der die Weiterentwicklung der eigenen ärztlichen Professionalität fördert und die Anpassung ärztlichen Therapieverhaltens an den medizinischen Fortschritt unterstützt. Sie ermöglicht Ärzten, Anforderungen an eine evidenzbasierte und kosteneffektive Medizin, an Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite175 Patientenversorgung sowie den Weiterentwicklungen des Gesundheitssystems gerecht zu werden. Dazu dient der ständige, berufsbegleitende Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten bzw. die Vertiefung und Weiterentwicklung vorhandener Fähigkeiten und Kenntnisse unter Berücksichtigung der Entwicklungen des medizinischen und technologischen Fortschritts. Damit ist die ärztliche Fortbildung eine klassische Domäne der Qualitätssicherung [Ollenschläger 1995], die vorrangig von der Profession selbst wahrzunehmen ist. Jedoch gibt es vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten durch Disease Management Anbieter (Krankenkassen), wie z.B. • Bereitstellung von Informationssystemen (Online- Datenbanken, Arztportale), • Implementierung von Experten-Hotlines (telefonisch oder per E-mail) • Implementierung von Entscheidungsunterstützung (z.B. durch Disease Management Zirkel, Experten- Hotlines, gemeinsame Sprechstunden von Hausärzten und Experten) • Unterstützung bei der Identifikation von Fortbildungsbedarf durch zeitnahe Datenauswertung und Bericht an den jeweiligen Leistungserbringer • Ggf. Schaffung von finanziellen Anreizen, Fortbildung wahrzunehmen • Schaffung einer Infrastruktur zur Unterstützung von Fortbildung im Disease Management • Definition von Art und Umfang des Fortbildungsanspruchs im Disease Management zusammen mit Vertretern der ärztlichen Selbstverwaltung. Fortbildung im Disease Management ist kein Garant, sondern ein Instrument zur Unterstützung einer qualitativ hochwertigen, evidenzbasierten und kosteneffektiven Patientenversorgung. 9.1.1 Internationale Entwicklungen In internationalen Veröffentlichungen wird ärztliche Fortbildung mit den Begriffen Continuing Medical Education (CME), Rezertifizierung, Sicherstellung der ärztlichen Professionalität, Weiterentwicklung der ärztlichen Professionalität und mit „Revalidation“ (Rezertifizierung) beschrieben. Trotz der länderspezifischen Ausprägung der ärztlichen Fortbildung, die sich nicht nur in der Wahl unterschiedlicher Begriffe er- Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite176 schöpft, besteht in grundsätzlichen Fragen, wie z.B. der Notwendigkeit der Weiterentwicklung der ärztlichen Professionalität, europaweit Konsens (Tabelle 1). Tabelle 1: Europaweiter Vergleich der Anforderungen an die ärztliche Fortbildung Anforderungen an die ärztliche Fortbildung (ÄF) ÄF ist notwendig ÄF sollte freiwillig sein Träger der ÄF Wiederholung der Facharztprüfung Erneuerung der Zulassung an ÄF gebunden Finanzierung Ergebnisse aus 18 europäischen Ländern* Ja (17) Nein (1) Ja (12) Nein (6) Ärztliche Selbstverwaltung (13) Ärztliche Selbstverwaltung und Staat (4) Andere (1) Nein (18) Ja (1) Nein (15) Eigenverantwortung (2) Arbeitgeber (4) Pharmaindustrie (4) Gemischtes Finanzierungssystem (2) Anreize Zertifikate (2) Bessere Verdienstmöglichkeit (1) Einfluss auf Karriere (2) Keine (9) Sanktionen Möglichkeit zum Entzug der Zulassung (1) Offizieller Verweis (1) Veröffentlichung von Listen mit erfolgreichen Teilnehmern (1) Keine (8) [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peck et al., 2000] *Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Irland, Italien, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz. Unterschiedliche Auffassungen bestehen in Europa über die Trägerschaft der Fortbildungsmaßnahmen, Finanzierung, Anreiz und Sanktionen bei Nichterfüllung der Anforderungen (Tabelle 1). Insbesondere in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien und nachfolgend jetzt auch in Großbritannien hat man sich bemüht, die ärztliche Fortbildung zu optimieren. Ärztliche Fortbildung wird in diesen Ländern zunehmend als die kontinuierliche Weiterentwicklung der ärztlichen Professionalität definiert. Sie umfasst entsprechende Bereiche, wie patientenbezogene Ergebnisse (Outcomes), medizinisches Wissen und Urteilsfähigkeit (medical knowledge and judgement) und Professionalität (professionalism) in den USA [Norcini 1999], bzw. ärztliche Fachkenntnisse und Fähigkeiten sowie persönliche ärztliche Kompetenz in Australien und Neuseeland [Newble et al., 1996]. Alle Ansätze setzen ein Peer Review Verfahren ein, mit dem in kanadischen Studien gute Erfahrungen gemacht wurden [Dauphine 1999]. In dem Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite177 von der US-amerikanischen Fachgesellschaft für Innere Medizin entwickelten Modell, dem kanadischen Modell und dem australischen MOPS Modell werden von dem Arzt, der sich dem Peer Review unterzieht, Fragebögen an Kollegen und Patienten ausgeben [Norcini 1999; Dauphinee 1999; Paget 1996]. Die Kollegen beurteilen die medizinische und persönliche ärztliche Kompetenz des Arztes, die Patienten bewerten Empathie, Integrität und Achtung im persönlichen Umgang (Tabelle 2). Tabelle 2: Kriterien zur Bewertung von Ärzten durch Peers (Physician Assessment) des australischen MOPS Programms Kriterium Kommunikation Praktische Fertigkeiten Diagnosefindung Patientenführung Beispiel Fähigkeit, mit Kollegen, Patienten und Angehörigen zu kommunizieren Technische Fertigkeiten bei der Durchführung von Prozeduren Fähigkeit, Information und Evidenz kritisch zu bewerten, wichtige Information herauszufiltern und rechtzeitig Entscheidungen zu treffen Fähigkeit, die für den jeweiligen Patienten angemessene Therapie auszuwählen und anzupassen Fähigkeit, psychologische Probleme zu erkennen und damit umzugehen Psychologische Aspekte der Patientenführung Management komFähigkeit, Patienten mit komplexen Krankheitsbildern und unterschiedliplexer Fälle chen Problemen angemessen zu versorgen Ambulante VersorFähigkeit, Patienten im niedergelassenen Bereich zu versorgen und Anforgung derungen zu koordinieren Stationäre VersorFähigkeit, Patienten im stationären Bereich zu versorgen und die Therapie gung zu koordinieren Empathie Fähigkeit, auf Patienten und ihre Angehörigen einzugehen Achtung Fähigkeit, die Rechte und Entscheidungen anderer zu respektieren Integrität Missbraucht Vertrauen nicht VerantwortungsgeÜbernimmt Verantwortung für die eigenen Entscheidungen fühl [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Paget 1996] Die Fragebögen können von dem jeweiligen Arzt selbst an Kollegen verteilt werden. Nach bisherigen Forschungserfahrungen werden dadurch die Ergebnisse nicht verzerrt [Ramsey 1989]. In Australien wird neben dem Peer Review mittels Fragebögen ein sog. „Practice Quality Review“ angeboten, das als Kernstück ein Peer Review in der aktuellen Praxissituation enthält [Newble 1996]. Dazu werden vor dem Praxisbesuch mit Hilfe eines Fragebogens Aktivitäten der Qualitätssicherung, Fortbildungsverhalten und das jeweilige Praxisprofil abgefragt. Auf der Grundlage dieses Fragebogens erfolgt ein Besuch von 2 Kollegen auf ehrenamtlicher Basis, von denen einer mit dem Prozess des Practice Quality Review vertraut ist und der andere eine Praxis führt, die dem Praxisprofil des besuchten Arztes in etwa entspricht. Der Besuch an sich enthält die Durchsicht von Patientenakten sowie die Bewertung der Praxisrouti- Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite178 ne einschließlich praktischer Fertigkeiten und wird mit einer ausführlichen Diskussion abgeschlossen. Die Ergebnisse der Diskussion enthalten auch Verbesserungsvorschläge des visitierten Arztes und werden an eine mit der Fortbildung betrauten Institution weitergeleitet. Die Ergebnisse der bisher durchgeführten freiwilligen Tests zeichneten sich durch eine hohe Zufriedenheitsrate bei jedoch großem logistischen Aufwand und Kosten von ca. Aus $ 1500 pro Arzt aus (trotz ehrenamtlicher Visitoren). Im Rahmen von Disease Management werden in der Regel eine Mindestanzahl von Fortbildungen durch den Disease Management Anbieter organisiert. Sie beziehen sich auf organisatorische und medizinische Inhalte der Programme. Die Pflicht zur Teilnahme wird in den Programmen unterschiedlich geregelt. Manche Programme bieten als Ersatz für nicht-wahrgenommene Fortbildungen einen quartalsweisen Informationsbrief für Ärzte an. Die Fortbildungsmethoden im Disease Management umfassen Informationssysteme, Bereitstellung von Leitlinien in gedruckter oder in Online-Version, die Erstellung von Remindersystemen auf der Grundlage von evidenzbasierten Leitlinien, den Einsatz von Meinungsführern, gemeinsame Sprechstunden von Experten und Allgemeinärzten, persönliche Beratung durch Peers oder Meinungsführer, gemeinsame Arbeitsessen von Praxisteam und Experten, u.a.m. (Tabelle 7). 9.1.2 Anforderungen an einen systematischen Fortbildungsansatz im Disease Management Ein systematischer Fortbildungsansatz im Disease Management sollte folgende Bereiche berücksichtigen: • Struktur der Fortbildungsveranstaltungen • Identifizierung des objektiven Fortbildungsbedarfs • Social Marketing • Identifizierung von Fortbildungsbarrieren • Implementierungsstrategien für das in Fortbildungen vermittelte Wissen • Evaluation von Fortbildungskonzepten Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite179 Struktur der Fortbildungsveranstaltungen Der Einfluss der Fortbildungsstruktur auf die Prozessqualität gilt als gesichert [Davis 1998; Davis 1992; Canillon 1999]. Einen Zusammenhang zwischen Fortbildungsstruktur und Ergebnisqualität stellen bisher nur wenige Studien her, hier besteht noch Forschungsbedarf. Schwierigkeiten liegen vor allen Dingen in der Definition geeigneter Indikatoren zur Messung des Patientenoutcomes, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Intervention und Outcome erlauben. Die bei Fortbildungsveranstaltungen eingesetzten Methoden können als unterstützende, befähigende und verstärkende Interventionen klassifiziert werden, wie: Tabelle 3: Klassifizierung von Interventionen zur Fortbildung Klassifizierung Unterstützend Intervention Lehr- und Fortbildungsmaterialien in gedruckter Form, audio- visuelle Materialien und computergestützte Lehrmaterialien Formale Fortbildungsaktivitäten wie Seminare, Besprechungen, Vorträge, Telekonferenzen Nationale Leitlinien ohne Kombination mit weiterer Intervention Befähigend Praxissupervision, Konsile und individuelle Beratungen (z.B. durch Peers) Einsatz von Meinungsführern auf lokaler Ebene Berücksichtigung von Patientenbedürfnissen durch z.B. Schulungen und Informationsmaterial Training praktischer Fähigkeiten Peer Review Verfahren wie z.B. Aktenbesprechung mit Peers, Praxisbeurteilung Verstärkend Erinnerungssysteme Feedback [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Davis 1992] Davis (1998) stellte in randomisierten, kontrollierten Studien bei 2/3 der Interventionen zur Fortbildung einen Einfluss auf die Prozessqualität und bei fast der Hälfte der Studien (48%) einen Einfluss auf die Ergebnisqualität fest. Unterstützende Interventionen haben einen deutlich geringeren Einfluss auf das ärztliche Verhalten als befähigende und verstärkende Interventionen. Verstärkende Interventionen sind erwartungsgemäß in der Kombination mit anderen Interventionen am wirksamsten. Einen Einfluss auf das patientenbezogene Ergebnis (outcome) haben einige wenige Studien gezeigt, die befähigende Interventionen oder eine Kombination von Interventionen einsetzen [Davis, 1992]. Bei unterstützenden Interventionen lässt sich so gut wie kein Einfluss auf das patientenbezogene Ergebnis nachweisen. Am wirksamsten sind demnach Interventionen, die Praxissupervision, Hospitationen, individuelle Beratung, Erinnerungssysteme, Berücksichtigung von Patientenbedürfnissen, Meinungsführereinsatz sowie eine Kombination dieser Methoden einsetzen. Die alleinige Gabe von Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite180 Informationsmaterialien und Audits zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Sie konnten in der Regel ärztliche Handlungsmuster, nicht jedoch das medizinische Ergebnis beeinflussen. Fortbildungsmaßnahmen im traditionellen Stil (Frontalvortrag, Konferenzen und Maßnahmen ohne Praxisbezug) hatten kaum nachweisbaren Einfluss (Tabelle 4). Tabelle 4: Wirksamkeit von Fortbildungen in Abhängigkeit von ihrer Struktur Interventionsmethode Vorträge, Konferenzen Interaktive Fortbildungen Fortbildung mit Praxisbezug Remindersysteme Feedback Lernen in der Peer Group, Qualitätszirkel Lehrmaterial Aktendurchsicht und Besprechung Lokale Konsensusbildung Beurteilung der Wirksamkeit (+) +++ +++ Unspezifisch (+) Spezifisch ++ Unspezifisch (+) Spezifisch ++ +++ Auf Anfrage ++ Zufällig (+) ++ +++ Referenz Cantillon 1999 Cantillon 1999, Roter 1995 Cantillon 1999 Lobach et al. 1996, Litzelman 1993 O’Conell 1999 Winkens et al. 1992 Moran et al. 1996 Kaltwasser 1998 Davis 1998 Davis 1998 Grimshaw & Russel 1993 Computerunterstützte Fortbil++ Johnstone et al. 1994, Grimshaw dung & Russel 1993 Didaktisch aufbereitetes LehrAlleine (+) Davis 1999 (JAMA) material In Kombination ++ Einsatz von Meinungsführern + Lomas et al 1991 Kombination mehrerer Methoden +++ Horder 1986 [Quelle: Eigene Darstellung] Legende: (+) gering wirksam, + wirksam, ++ gut wirksam, +++ sehr gut wirksam Im Disease Management sollten daher die klassischen Fortbildungsmaßnahmen durch Interventionen ersetzt werden, die einen nachgewiesenen Einfluss auf die Veränderung des ärztlichen Verhaltens bzw. auf das medizinische Ergebnis haben. Dazu gehören in erster Linie interaktive Fortbildungen (z.B. Disease Management Zirkel s.u.), der Einsatz von Remindern, Meinungsführern, Feedback, sowie Maßnahmen des Organisationsmanagements. Systematische Identifizierung des objektiven Fortbildungsbedarfs Neben der Fortbildungsstruktur ist die Identifizierung des Fortbildungsbedarfs eine weitere wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit von Fortbildungen [Davis, 1998]. Hier zeigt sich, dass Fortbildungen, die spezifisch auf die Bedürfnisse definierter Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite181 Arztgruppen zugeschnitten sind, wesentlich effektiver sind, als Fortbildungsveranstaltungen ohne vorherige Analyse des Fortbildungsbedarfs ( Tabelle 5). Tabelle 5: Effektivität von Fortbildung in Abhängigkeit von der Analyse des Fortbildungsbedarfs Analyse des Fortbildungsbedarfs Effektivität der Intervention Keine Analyse < 50% Allgemeine klinische Referenz ≥ 50% Bezug zu einer klinischen Leitlinie (nationale Ebe- > 60% ne) Konsensus lokaler Experten < 60% Spezielle Evaluation des Fortbildungsbedarfs 90% [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Davis 1998] Die externe Analyse ist dabei weit wirksamer als die eigene Einschätzung von Ärzten, die immer wieder zu deutlichen Fehleinschätzungen führt und den Fortbildungsbedarf nur innerhalb eines relativ eng umgrenzten Gebietes wahrnimmt, auf dem der Arzt schon viel Wissen besitzt [Tracy et al., 1997]. Wurden Ärzte hingegen verpflichtet, an Fortbildungen außerhalb ihres gewohnten Wissensgebietes teilzunehmen, so verbesserte sich die Qualität der Versorgung signifikant gegenüber der Kontrollgruppe [Violato et al., 1997]. Die systematische Identifizierung des objektiven Fortbildungsbedarfs ist daher schon im Vorfeld von Fortbildungsveranstaltungen sinnvoll. Sie kann über die Evaluation schriftlicher Leistungsnachweise von Fortbildungsveranstaltungen, über die Evaluation von zertifizierten Fortbildungseinheiten in medizinischen Fachzeitschriften und über die Auswertung der Indikatoren zur Prozess- und Ergebnisqualität (Benchmarkingdatensatz) erfolgen. Darauf aufbauend können speziell auf den Fortbildungsbedarf zugeschnittene Fortbildungskonzepte entwickelt werden, die die Inhalte evidenzbasierter Leitlinien sowie die relevanten medizinischen und medizinpädagogischen Forschungsergebnisse berücksichtigen. Social Marketing Unter Social Marketing versteht man, das Zuschneiden von Informationen auf ein definiertes Publikum [Kotler 1984].Um den größtmöglichen Nutzen zu erreichen, sollten Fortbildungsveranstaltungen auf die individuelle Gruppe zugeschnitten sein und nicht nur die Studienergebnisse medizinischer und medizinpädagogischer Studien berücksichtigen. Zur Strategie des Social Marketing gehört die Identifizierung von Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite182 Zielgruppen, das genaue Abstimmen des Informationsbedarfs auf die Zielgruppe und die Identifizierung sowie der Abbau von Barrieren. Im Disease Management besteht durch das Datenmanagement die Chance, Fortbildungsbedarf und Informationen auf einzelne Zielgruppen, wie z.B. Hausärzte oder Diabetologen im Disease Management Diabetes Mellitus, spezifisch zuzuschneiden. Identifizierung von Fortbildungsbarrieren Um eine erfolgreiche Implementierung des Fortbildungsinhaltes zu fördern, ist es wichtig, Barrieren zu identifizieren. So belegen Studien immer wieder, dass zwar durch Fortbildung der nötige Wissenstransfer gelingt, das Verhalten der Ärzte aber davon nicht beeinflusst wird [Lagerlov 2000]. Barrieren in diesem Bereich sind insbesondere Gewohnheiten, Kompetenzzweifel und widersprüchliche Evidenz, Zeitmangel (Tabelle 6), finanzielle Verluste bei Praxisschließung für die Dauer der Fortbildung oder fehlerhafte Selbsteinschätzung des Fortbildungsbedarfs. Tabelle 6: Von Ärzten als aufwendbar und als notwendig angesehene Zeitanteile ihrer Arbeitszeit für Fortbildung Prozentsatz Aufwendbarer Zeitanteil für Fortbildungen 1 bis 5% 6 bis 10% Notwendiger Zeitanteil für Fortbildungen 50% aller Ärzte 36,5% (27,9% der Ärzte in Weiterbildung, 43,1% der Fachärzte mit Stadtpraxis) 35,8% 10% 18% 1 bis 5% [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehung an die Studie der Ärztekammer Niedersachsen, der Gesellschaft für Herzkreislauferkrankungen, des Instituts für Medizinische Informatik Uni Göttingen und des Zentrums für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen der Ärztekammer Niedersachsen (1998)] Evaluation von Fortbildungskonzepten Die Evaluation von Fortbildungskonzepten zur Weiterentwicklung der ärztlichen Professionalität sollte über die Bewertung des Referenten hinausgehen. Jedes Disease Management Programm sollte daher ein Fortbildungskonzept im Rahmen der Programmentwicklung aufstellen. Im Rahmen der regelmäßigen Evaluation durch die Programmanbieter könnten dann Stichprobenartig beispielsweise Parameter der Prozessqualität in einem Peer Review Verfahren evaluiert werden. Um einen systematischen Fortbildungsansatz zu gewährleisten, sollten Struktur, Inhalte und Häufigkeit der Fortbildungsveranstaltungen im Disease Management von Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite183 den Spitzenverbänden einheitlich definiert werden. Die Vorgaben sollten sich an den medizinischen und organisatorischen Inhalten der Disease Management Programme orientieren. Für die medizinischen Inhalte sollten insbesondere Bereiche mit nachgewiesener Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie die Kosteneffektivität von Interventionen, wie z.B. von ausgewählten Arzneimitteln, zugrunde gelegt werden. Bei der Vorgabe der Strukturen ärztlicher Fortbildungen sind die relevanten Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen Fortbildungsstruktur und Prozess- bzw. Ergebnisqualität zu berücksichtigen. Interaktive Fortbildungen wie Disease Management Zirkel, Experten-Hotlines bzw. das persönliche Coaching durch Experten bei auffälligen und wiederkehrenden Abweichungen von den Handlungsempfehlungen der Leitlinien sind hier besonders zu nennen. Dadurch können qualitätskritische Bereiche gezielt angegangen werden. 9.2 Ärztliche Fortbildung im Disease Management: Systematische Weiterentwicklung der ärztlichen Kompetenz Betrachtet man die häufig übliche Fortbildungspraxis in Deutschland, so zeigen sich noch viele Defizite insbesondere in der Struktur und Effektivität der durchgeführten Fortbildungen [Kleine et al. 2000; von Reis et al. 1999; Ollenschläger und Engelbrecht 1993]. Häufig werden Fortbildungen im Vortragsstil noch von Lehrenden und Lernenden gegenüber interaktiven Lernmethoden bevorzugt, obwohl die Effektivität dieser traditionellen Fortbildungsmethoden niedrig ist (Abbildung 1). Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite184 Abbildung 1: Evidenz für die Effektivität von Interventionen zur Fortbildung Evidenz für die Effektivität von Interventionen zur Fortbildung Niedrig Status Quo Hoch Erinnerungssysteme Einsatz von Meinungsführeren Peer Review Verfahren Niedrig Konferenzen Vorträge Hoch Lehrmaterialien Nationale Leitlinien Idealzustand [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Davis 1998] Die Fortbildung im Disease Management soll Defizite der traditionellen Fortbildung gezielt ausgleichen. Sie ist daher im Sinne der beschriebenen Weiterentwicklung der ärztlichen Professionalität ein übergreifender Ansatz, der oft Interventionen beinhaltet, die nicht nur oder nicht in erster Linie der Fortbildung dienen. Dazu gehören beispielsweise Informationssysteme, Remindersysteme auf der Grundlage von evidenzbasierten Leitlinien oder Datenbanksysteme mit Eingabemasken, die bei bestimmten Konstellationen Therapieprompts liefern und auf Leitlinieninhalte verweisen. Tabelle 7 gibt einen Überblick über Interventionen im Disease Management, die zur ärztlichen Fortbildung beitragen. Tabelle 7: Interventionen zu ärztlichen Fortbildung Intervention Dissemination von Leitlinien Implementierungsstrategien für Leitlinien Fortbildung in Kleingruppen Feedback Beschreibung Evidenzbasierte Leitlinien werden in gedruckter oder in OnlineForm zur Verfügung gestellt Klassische Vorträge und Workshops, Coaching durch Experten, Feedback und Benchmarking der Leistungserbringer (individuell) zur Erreichung der Empfehlungen von Leitlinien z.B. regelmäßige „Arbeitsessen“ für Praxen mit Experten Quartalsberichte in denen für den einzelnen Arzt individuell zusammengestellt wird, inwieweit die Empfehlungen der evidenzbasierten Leitlinien erreicht wurden, ggf. mit Informationsmaterial (z.B. Studien zur Evidenz der Therapie mit ACE- Hemmern bei diabetischer Nephropathie). Feedback über Reminder auf der Patientenmaske mit Verweis auf und ggf. Darstellung von Leitlinienempfehlungen Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Coaching durch Experten Newsletter Einsatz von Meinungsführern Disease Management Zirkel Experten-Hotlines Seite185 Der einzelne Arzt kann beispielsweise einzelne problematische Fälle bzw. auffällige Abweichungen von den Empfehlungen der evidenzbasierten Leitlinien mit Experten durchsprechen bzw. im Rahmen einer gemeinsamen Sprechstunde besprechen. Quartalsweise verschickte Briefe, die die Inhalte aller im Quartal angebotenen Fortbildungen zusammenfassen Implementierung von Leitlinien über Meinungsführer (von den Ärzten anerkannte Experten) In den Disease Management Zirkeln sollten ca. 20 bis 30% der eingeschriebenen Patienten eines Arztes pro Jahr vorgestellt und mit Peers bzw. Experten aus dem niedergelassenen Bereich oder der Klinik diskutiert. Die Patienten können z.B. in einer gemeinsamen Sprechstunde von Experte und Hausarzt vorgestellt werden Experten aus der Klinik oder dem niedergelassenen Bereich stehen während einer Telefonsprechstunde oder per e-mail zur Besprechung von Patienten zur Verfügung. Die Patienten können ggf. auch in einer gemeinsamen Sprechstunde von Experte und Hausarzt vorgestellt werden [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management Zirkel Der Erfolg interaktiver Fortbildungskonzepte wie z.B. Gruppenarbeit oder Qualitätszirkel ist in Deutschland und international belegt [Kaltwasser, 1998; Davis 1998]. Von 45% der niedergelassenen Ärzte werden sie aufgrund ihrer Praxisnähe, interkollegialem Austausch und kleingruppenorientierter Didaktik positiv bewertet [Gerlach 1999]. Beispielsweise berichtet Kaltwasser (1998) von einer Reduktion der Wissenslücken um 30% im Vergleich zu Kontrollgruppen durch Qualitätszirkelarbeit im hausärztlichen Bereich. Als systematischer Ansatz zur Fortbildung im Disease Management wird daher die Implementierung sogenannter Disease Management Zirkel vorgeschlagen. Analog den Qualitätszirkeln können sie sich aus niedergelassenen Disease Management Ärzten und einem Experten für das jeweilige Fachgebiet zusammensetzen. In einem Disease Management Programm zum Diabetes kann beispielsweise ein niedergelassener Diabetologe oder ein Diabetologe aus der Klinik (ggf. auch abwechselnd) an dem Disease Management Zirkel teilnehmen. Von jedem am Disease Management teilnehmenden Arzt sollten pro Jahr 20 bis 30% seiner in ein Diabetes Disease Management Programm eingeschriebenen Patienten im Disease Management Zirkel vorgestellt und mit Peers und Experten besprochen werden. Die Auswahl der Patienten bleibt dem Arzt überlassen. Dennoch ist in der Regel davon auszugehen, dass es nicht nur zu einem zufälligen Ausschnitt an Patienten sondern zu einem repräsentativen Querschnitt an Patienten einer Praxis kommen wird. Besonderer Wert sollte bei der Besprechung der Patienten auf die evidenzbasierten Empfehlun- Disease Management in Deutschland – Ärztliche Fortbildung Seite186 gen der Leitlinien gelegt werden. Bei Bedarf können die besprochenen Patienten auch in gemeinsamen Sprechstunden von Experten und Hausärzten vorgestellt werden. Experten- Hotlines Eine weitere Form der interaktiven Fortbildung sind Experten- Hotlines, die als telefonische Beratung durch niedergelassene Experten oder Klinikärzte oder als e-mail Anfrage ausgestaltet werden können. Für die e-mail Konsultation sollte vom Disease Management Anbieter eine Maske zur Verfügung gestellt werden, die die wichtigsten Laborwerte und Untersuchungsergebnisse sowie Daten aus der Anamnese und klinischen Untersuchung abfragt. In der Expertenantwort sollten dann alle von der Maske abgefragten Bereiche kommentiert werden. Ggf. kann auch Literatur zur Verfügung gestellt werden. Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 187 10 Vorschlag zum Aufbau eines Disease Management in Deutschland Im Folgenden wird ein allgemeines Ablaufschema für ein qualitätsgesichertes Disease Management Programm für Deutschland unter Berücksichtigung der Situation in der Gesetzlichen Krankenversicherung entwickelt und vorgestellt. Insbesondere werden Komponenten international erfolgreicher Disease Management Programme beschrieben und ihr möglicher Einsatz in Disease Management Programmen in Deutschland dargestellt. 10.1Aufbau und Ablauf eines Disease Management Programms In Deutschland soll sich die Entwicklung und Implementierung von Disease Management Programmen im Risikostrukturausgleich an den gesetzlichen Vorgaben in § 137 ff SGB V orientieren. Die für eine möglichst kostenneutrale Einführung und die Qualitätssicherung von Disease Management notwendigen Voraussetzungen werden an anderer Stelle diskutiert (siehe Teil II des Gutachtens sowie Kapitel Qualitätssicherung im Disease Management). In der Beschreibung des allgemeinen Aufbaus und Ablaufs eines Disease Managements sollen die Anforderungen des Gesetzgebers an Disease Management Programme berücksichtigt werden. Dazu gehören nach § 137f SGB V: • Die Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien • Durchzuführende Qualitätssicherungsmaßnahmen • Voraussetzungen und Verfahren für die Einschreibung von Versicherten in die Programme • Schulung • Dokumentation • Evaluation Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 188 Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Komponenten werden im vorgestellten Vorschlag spezifiziert. Die folgenden Disease Management Komponenten dienen der Ausgestaltung der gesetzlichen Anforderungen: • Krankheitskoordinator • Benchmarkingdatensatz • Entscheidungsunterstützung • Remindersysteme • Informationssysteme • Fortbildung für Ärzte • Datenbanken 10.1.1 Disease Management Module Zum Aufbau eines Disease Management Programms werden drei spezifische Modultypen vorgeschlagen: Das Einschreibemodul, das Basismodul sowie Ergänzungsmodule zur spezifischen Therapie des Risikoprofils und von Komplikationen/ Folgeerkrankungen (Tabelle 1). Das Zusammenspiel der Module wird in Abbildung 1 dargestellt. Tabelle 1: Modultypen im Disease Management Programm Modultyp Beschreibung Aufgabe Einschreibemodul Das Einschreibemodul spezifiziert die medizinischen Einschreibekriterien auf dem Boden evidenzbasierter Leitlinien. Das Einschreibemodul beinhaltet auch das Einschreibeverfahren mit Einteilung der Patienten in eine von drei Disease Management – Gruppen (nach Risikostratifizierung) Das Basismodul umfasst die Komponenten eines Disease Managements für die Basistherapie einer Erkrankung. Je nach Risikostratifizierung werden diese Komponenten einzeln oder in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt. Qualitätssicherung Sicherung der Kosten-Effektivität Risikostratifizierung der Patienten Basismodul Sicherung von Qualität, Diagnose und Kosteneffektivität der Versorgung durch Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien in die Regelversorgung, Entscheidungsunterstützung, individuelle Therapieempfehlungen und Reminder. Schulung des Patienten und Unterstützung des Selbstmanagements; Datenerhebung Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 189 Ergänzungsmodul Das Ergänzungsmodul, welches das Basismodul spezifiziert, unterteilt sich in "Spezifische Therapie" und "Komplikationstherapie": Spezifische Therapie Zielt auf die Reduktion einzelner Risikofaktoren (Sekundärprävention) Komplikationstherapie Dieses Modul ergänzt die komplikationsspezifische Therapie [Quelle: Eigene Darstellung] Sicherung von Qualität und Kosteneffektivität der Versorgung durch spezifisch auf Risikofaktoren, Folgeerkrankungen und Komplikationen zugeschnittene Interventionen Abbildung 1: Allgemeines Ablaufschema eines qualitätsgesicherten Disease Management Programms Einschreibemodul Einschreibungskriterium erfüllt Status Erhebung Risikostratifizierung und Zuteilung zu der entsprechenden Disease Management – Gruppe Gruppe 1: Zielwerte erreicht Entsprechend der evidenbasierten Leitlinie Basismodul - Gruppe 2: Zielwerte nicht erreicht Entsprechend der evidenbasierten Leitlinie Gruppe 3: Komplikationen / Begleiterkrankungen Entsprechend der evidenbasierten Leitlinie Therapie nach evidenzbasierten Leitlinien (Ärzte und Patientenleitlinien, individuelle Therapieempfehlungen) Screening Follow-up Schulung Krankheitskoordinator Entscheidungsunterstützung Reminder Informationssysteme Benchmarkingdatensatz Selbsthilfegruppen Individuelle Basistherapie Individuelle Basistherapie + + Spezifische Therapie Spezifische Therapie Ergänzungsmodule Individuelle Basistherapie + Komplikationstherapie Klinischer Zustand [Quelle: Eigene Darstellung] Individuelles Patientenmanagement nach Risikostratifizierung Psychosoziale Faktoren Disease Management in Deutschland – Aufbau 10.1.2 Seite 190 Einschreibemodul Das Einschreibemodul dient der Qualitätssicherung, der Diagnosesicherung und der Statuserhebung sowie der Risikostratifizierung. Dazu werden Einschreibekriterien auf dem Boden evidenzbasierter Leitlinien definiert, die so weit wie möglich manipulationssicher, einfach prüfbar und durch den Hausarzt leicht zu erheben sind. Im speziellen Teil werden für das Beispiel Diabetes entsprechende Einschreibekriterien vorgeschlagen (Kapitel Disease Management bei ausgewählten Erkrankungen: Diabetes). Die Einschreibung selbst erfolgt in der Regel durch den Hausarzt. Hat dieser bei einem Patienten eine Diagnose gestellt, die zur Einschreibung berechtigt, füllt er mit dem Einverständnis des Patienten ein von der Krankenversicherung zur Verfügung gestelltes Formular aus und sendet den Bogen zur Krankenkasse. Arzt und Patient erhalten je einen Durchschlag dieses Formulars für ihre Dokumentation. Der Hausarzt agiert in enger Kooperation mit Spezialisten und der Krankenkasse und koordiniert die Versorgung nach den Empfehlungen des Disease Management Programms. Bei ausgewählten Erkrankungen wie z.B. Brustkrebs kann eine solche Kooperation beispielsweise aus einem Zusammenschluss (z. B. Netzwerk) niedergelassener Ärzte (z.B. Gynäkologe, Onkologe, Chirurg, Radiologe, Pathologe) oder aus einem in der Klinik angesiedelten oder in die Klinik integrierten Zentrum bestehen. Bei Erkrankungen, für die ein Zusammenhang zwischen Qualität und Menge der durchgeführten Interventionen nachgewiesen ist, sollte das Zentrum in Abhängigkeit von der Erkrankung eine jährliche Mindestfallzahl an Patienten und eine vorgeschriebene Qualifizierung von Ärzten und unterstützendem Personal nachweisen. Zur Einschreibung gehören die Erhebung der Anamnese und eine körperliche Untersuchung sowie weitere definierte Untersuchungsergebnisse, die ebenfalls im Einschreibebogen dokumentiert werden (Statuserhebung). Die zu erhebenden Parameter sollten auf dem Boden der Analyse von Bereichen der Über-, Unter- und Fehlversorgung der jeweiligen Erkrankung von den Spitzenverbänden einheitlich und verbindlich für Deutschland festgelegt werden. Sie entsprechen im weiteren Verlauf dem vierteljährlich zu erhebenden Benchmarkingdatensatz (siehe Kapitel Datenmanagement, Dokumentation und Datenbanken im Disease Management). Die Prüfung der Einschreibung kann entweder durch das Einholen einer Zweitmeinung (Second Opinion), durch Stichprobenkontrollen durch z.B. den Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder durch den Benchmarkingdatensatz erfolgen. Der Benchmarkingdatensatz wird quartalsweise erhoben und fragt krankheitsspezifische Indikatoren ab. Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 191 Damit würde bei der Einschreibung eines ungeeigneten Patienten ein Betrug vorliegen. 10.1.3 Disease Management Gruppen Aufgrund der gewonnen Daten aus der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und laborchemischen Untersuchungen wird der Patient vom Arzt einer von drei Disease Management Gruppen zugeteilt (Abbildung 2 und Tabelle 2). Abbildung 2: Graphische Darstellung des Einschreibemoduls Diagnosesicherung nach Einschreibekriterien Statuserhebung Disease Management Gruppe 1: Zielwerte erreicht Disease Management Gruppe 2: Mind. ein Zielwert nicht erreicht - Klinik - Labor - Anamnese - Körperliche Untersuchung - Laborchemische Untersuchungen - Ggf. Überweisung zu anderem Facharzt Disease Management Gruppe 3: Komplikationen Risikostratifizierung nach Untersuchungsergebnissen [Quelle: Eigene Darstellung] Tabelle 2: Einteilung in Disease Management Gruppen Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Zielwerte entsprechend den Vorgaben evidenzbasierter Leitlinien erreicht Mindestens ein Zielwert entsprechend den Vorgaben evidenzbasierter Leitlinien nicht erreicht Es bestehen Komplikationen oder Folgeerkrankungen entsprechend der Definition evidenzbasierter Leitlinien [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 192 Die den Disease Management Gruppen zugrundeliegende Systematik ist am Patientenmanagement orientiert und für viele chronische Erkrankungen sinnvoll anwendbar. Die Zielwerte können aus den vorab festgelegten deutschen und/ oder internationalen evidenzbasierten Leitlinien entnommen werden und sollten einheitlich für die Gesetzliche Krankenversicherung definiert werden. Sie dienen sowohl der Risikostratifizierung (z.B. HbA1c oder Blutdruck nicht im Normbereich) als auch als der Therapieplanung (welcher HbA1c oder Blutdruck sollte erreicht werden?). Durch die Einteilung in die Disease Management Gruppen nach Zielwerten erfolgt eine Risikostratifizierung, auf deren Boden das therapeutische Vorgehen, Schnittstellen sowie unterstützende Interventionen definiert und patientenindividuell eingesetzt werden. Wird ein Patient beispielsweise aufgrund des Einschreibemoduls der Gruppe 2 zugeteilt, so findet sich im Basismodul von Gruppe 2 ein Vorschlag für eine evidenzbasierte Therapie (entsprechend den Empfehlungen der von den Spitzenverbänden ausgewählten evidenzbasierten Leitlinien), eine Definition der Schnittstelle (z. B. ab welchem HbA1c an eine diabetologische Schwerpunktpraxis überwiesen werden muss bzw. Entscheidungsunterstützung anderer Art eingesetzt wird) sowie Empfehlungen zu unterstützenden Maßnahmen, wie z.B. Durchführung von Schulungsmaßnahmen oder Einbindung von Selbsthilfegruppen. Die Krankenkasse kann die Initiierung dieser unterstützenden Maßnahmen dem Arzt überlassen oder selbst aktiv werden. So kann sie beispielsweise aufgrund der Einordnung des Arztes weitere Interventionen veranlassen. Dazu gehören der Einsatz eines Krankheitskoordinators, der Einsatz gezielter Information (beispielsweise durch Zusendung von Broschüren, Newslettern, Call- Center) sowie der Einsatz von Remindersystemen. Der Krankheitskoordinator kann ein Arzt, eine weitergebildete Krankenschwester / Krankenpfleger oder ein Call- Center sein. 10.1.4 Basismodul Die Versorgungsstrukturen für die Disease Management Gruppen sind je nach Gruppenzugehörigkeit gestuft. Das Basismodul enthält die Komponenten Therapie nach evidenzbasierten Leitlinien, Screening, Schulung und Follow- Up, die durch weitere Disease Management Komponenten unterstützt und ergänzt werden (Tabelle 3). Diese Komponenten finden in allen drei Management Gruppen Anwendung. Je nach Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 193 Risikostratifizierung werden sie in unterschiedlicher Ausprägung angewendet. Für die Gruppe 2 wird das Basismodul in Abhängigkeit von nicht erreichten Zielwerten um spezifische Therapiemodule ergänzt (Abbildung 1). Dies schließt alle Maßnahmen zur Reduzierung von Risikofaktoren ein, die zu Komplikationen oder Folgeerkrankungen führen können. Für Gruppe 3 kommen zusätzlich zu den spezifischen Therapiemodulen komplikations- bzw. folgeerkrankungsbezogene Module hinzu. Für einen Diabetiker wäre dies beispielsweise das Modul „Diabetisches Fußsyndrom“ oder „Diabetische Nephropathie“ (siehe Kapitel Disease Management bei ausgewählten Erkrankungen: Beispiel Diabetes mellitus). Ein erfolgreiches Management des Patienten sollte neben der klinischen Risikostratifizierung auch den aktuellen klinischen Zustand (beispielsweise: Stabilisierungsphase nach Krankenhausentlassung aufgrund einer schweren Hypoglykämie oder Infektion der Atemwege) und psychosoziale Faktoren berücksichtigen. Zu den psychosozialen Faktoren gehören z.B. das häusliche Umfeld des Patienten und seine Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen. Aufgrund dieser Faktoren kann z. B. eine sorgfältige Planung zu einer gestuften Weiterbetreuung und dem Einsatz eines Call Centers, eines speziellen Krankheitskoordinators oder einer häuslichen Krankenpflege nach einer Krankenhausentlassung führen. Für Patienten mit Herzinsuffizienz und anderen chronischen Erkrankungen führen gestufte Weiterbetreuungskonzepte nach Klinikentlassung zu signifikanten Kosteneinsparungen aufgrund niedrigerer Wiedereinweisungsraten und verbesserter Compliance [Rich, 1999a; Rich, 2001; Rich, 1999 b; Stewart et al., 1999a; Stewart et al., 1999b; Stewart et al., 1998; Roglieri et al., 1997; Hershberger et al., 2001; Jaarsma et al., 1999; Clark, 2001; Blue et al., 2001]. Im Basismodul stehen daher Arzt und Krankenkasse zur Verbesserung von Patientenversorgung und Patientencompliance Komponenten wie Krankheitskoordinator, Schulung, Entscheidungsunterstützung, Remindersysteme, Einbindung von Selbsthilfegruppen oder Erstellung von individuellen Patientenempfehlungen zur Verfügung (Tabelle 3). Disease Management in Deutschland – Aufbau Seite 194 Tabelle 3: Komponenten des Basismoduls Komponente Evidenzbasierte Leitlinien für Ärzte Evidenzbasierte Patientenleitlinien (Gruppen-)schulung für Patienten unter Berücksichtigung lerntheoretischer / psychologischer Methoden und Einbindung von Selbsthilfegruppen Patienten- und Ärzte- Informationssysteme (Videos, Internet, Datenbanken, Hotlines und Call-Center) Remindersysteme (per Post, Telefon, E-mail, Computer-Programme) Individuelle PatientenBehandlungspläne Interaktive Fortbildungen für Ärzte Benchmarkingdatensatz Datenbanken für alle am Disease Management Beteiligten Organisationsmanagement / Entscheidungsunterstützung Krankheitskoordinator (speziell weitergebildete Krankenschwester, Sprechstundenhilfe, Arzt, Call- Center) [Quelle: Eigene Darstellung] Beschreibung Sie vermitteln evidenzbasierte Empfehlungen einer definierten Erkrankung und ihrer Folgeerkrankungen Sie vermitteln evidenzbasierte Empfehlungen einer definierten Erkrankung und ihrer Folgeerkrankungen in einer für Patienten verständlichen Form Sie vermitteln Informationen und unterstützen das Einüben von Techniken des Selbstmanagements in Kleingruppen. Besonders durch die Einbindung von Selbsthilfegruppen können Verhaltensänderungen initiiert und unterstützt werden Literatur Wagner et al., 1996 Sie vermitteln evidenzbasierte und verständliche Informationen. Patienten u/o Ärzte erhalten spezifische Informationen. Wichtige Studien können online abgerufen werden Sie sollen Patienten und Ärzte bei der Ausschöpfung von Vorsorgemaßnahmen, Kontrolluntersuchungen und der Initiierung von Therapieschritten unterstützen Stellen individuell zugeschnittene Therapieempfehlungen mit Berechnung des persönlichen Risikoprofils bereit Knox et al., 1999 Sie vermitteln unabhängige, evidenzbasierte medizinische sowie organisatorische Inhalte von Disease Management Programmen Er ist Grundlage der Evaluation, der internen und externen Qualitätssicherung sowie eines nationalen Benchmarking der Programme Sie gewährleisten die zeitnahe Bereitstellung von Informationen und Daten für alle am Versorgungsprozess Beteiligten. Ggf. stellen sie Decision Support Systeme zur Verfügung Unterstützung bei der Neu-Strukturierung von Behandlungsabläufen und bei der Integration evidenzbasierter Empfehlungen in den Therapieablauf Der Krankheitskoordinator bietet eine abgestufte persönliche Betreuung des Patienten in definierten Situationen an Litzelman et al., 1993 Litzelman et al., 1993; Friedman et al., 1998; Knox et al., 1999 Litzelman et al., 1993; Knox et al., 1999; Serxner at al., 1998; Shah et al., 1998 McCulloch et al., 1998 und 2000; Friedman et al., 1998; Litzelman et al., 1993; Knox et al, 1999 Cantillon,1999; McCulloch et al., 1998 und 2000; The State of Managed Care Quality, 2000 Stoner at al., 2001 McCullcoch et al., 1998 und 2000; Friedman etal., 1998 Rich et al., 1995; West et al., 1997; Lasater at al., 1996; Kornowski et al., 1995 Disease Management in Deutschland Seite 195 Ausserhalb des Basismoduls dienen Patienten- und Ärzteinformationssysteme, Datenbanken und Fortbildungen für Ärzte der Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie in die Regelversorgung. Diese Komponenten können entweder von der Krankenkasse aufgrund der Auswertung des vierteljährlichen Benchmarkingdatensatzes eingesetzt werden (z.B. Zuschicken von Informationsbriefen, telefonische oder postalische Reminder für Untersuchungen) oder vom Arzt bei der Krankenkasse angefordert werden. Hier ist die enge Kooperation zwischen Arzt und Krankenkasse für den Erfolg entscheidend. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Komponenten sowie die Möglichkeiten ihres Einsatzes im Rahmen von Disease Management Programmen wird in den Kapiteln 3 bis 8 ausgeführt und daher in diesem Kapitel nicht weiter erörtert. Das Ergänzungsmodul spezifiziert das Basismodul und wird entsprechend ergänzend zu diesem eingesetzt. Es unterteilt sich in die beiden Module "Spezifische Therapie", welches auf die Reduktion einzelner Risikofaktoren (Sekundärprävention) zielt und "Komplikationstherapie", welches bei der komplikationsspezifischen Therapie zum Einsatz kommt. Im Rahmen der Beschreibung von Disease Management am Beispiel Diabetes werden die Ergänzungsmodule näher dargestellt. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 196 11 Disease Management bei ausgewählten Erkrankungen (Diabetes Mellitus) 11.1Einleitung Die Versorgung von Betroffenen mit Diabetes Mellitus ist eine vielfältige, mehrstufige und multidisziplinäre Herausforderung. Die Patienten sind durch ihre chronische Erkrankung und durch die Behandlung stark belastet. Die zentrale Aufgabe des Disease Management des Diabetes Mellitus ist die Vermeidung von Komplikationen. Dies betrifft sowohl akute Komplikationen in Form von Stoffwechselentgleisungen (Hyper- und Hypoglykämie) als auch chronische Komplikationen in Form von diabetischen Endpunkten (Angiopathie, Kardiopathie, Makulopathie, Nephropathie, Neuropathie, Osteopathie, Retinopathie). Die Manifestationen dieser Komplikationen können u. a. diabetisches Koma, Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenversagen, Erblindung oder Amputation sein. Verbunden sind diese somatischen Beschwerden häufig mit psychosozialen Problemen und Diskriminierungen. Weiterhin sind Einschränkung der Lebenserwartung und Verminderung der Lebensqualität zu beobachten. Die meisten dieser Probleme können im Rahmen eines gezielten Disease Management für Diabetiker deutlich verbessert werden. Gleichzeitig kann durch ein qualitätsgesichertes Disease Management die bestehende Unter-, Über- und Fehlversorgung von Diabetikern, wie sie beispielsweise der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen in seinem Gutachten festgestellt hat, abgebaut werden [SVR Gutachten 2000/ 2001, Band III]. Nicht allein die erfolgreiche Behandlung der Blutzuckereinstellung und die Therapie von Komplikationen ist relevant, vielmehr müssen Begleiterkrankungen des Diabetes, wie z.B. Adipositas, Fettstoffwechselstörungen oder arterielle Hypertonie gezielt beeinflusst werden. Darüber hinaus müssen Risikofaktoren minimiert oder wenn möglich durch (Sekundär-) Prävention beseitigt werden. Maßgeblich für den Versorgungserfolg ist ein evidenzbasiertes Versorgungskonzept. Disease Management ermöglicht die Ausrichtung der evidenzbasierten Therapie an den individuellen Versorgungszielen, die auch die Lebensqualität des Patienten, das Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 197 Alter, den psychosozialen Status, Komorbiditäten, Risikofaktoren und den Schweregrad des Diabetes Mellitus berücksichtigen. Dazu werden die verschiedenen Disease Management Komponenten in einen gemeinsamen Ansatz integriert. Im Folgenden werden diese Komponenten diabetesspezifisch definiert und ihr Zusammenspiel im Gesamtkonzept diskutiert. Die Komponenten sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Entwicklung, Disseminierung, Implementierung und Evaluierung werden im zweiten Teil des Gutachtens allgemeingültig verifiziert. Tabelle 1: Komponenten des Disease Management Einteilung Komponenten Medizinische Dimension Evidenzbasierte Leitlinien Individuelle Patientenbehandlungspläne Wissenschaftlich begründete Patientenleitlinien Einschreibekriterien Patientenschulungen Ökonomische Dimension Kosten- Nutzen- Analysen Infrastruktur Datenbanken Patienten-/ Ärzte- Informationssysteme Fortbildungen der Ärzte Disease Management Zirkel Organisationsmanagement Kunden Anreizsysteme für Patienten Anreizsysteme für Ärzte Evaluierung Evaluierungskonzept [Quelle: Eigene Darstellung] Für die Erkrankung Diabetes Mellitus wird nachfolgend ein Konzept für ein Disease Management Programm mit Zielwerten auf der Grundlage der folgenden Leitlinien vorgestellt: • Leitlinien der American Diabetes Association (ADA) [ADA, 2001] • Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), [Haselbeck et al., 2000; Hasslacher et al., 2000; Standl et al., 2000; Kerner et al., 2000; Hammes et al., 2000; Janka et al., 2000; Haselbeck et al., 2001 im Druck] • International Diabetes Federation (IDF), [European Diabetes Policy Group, 1999 a + b] • Scottish Intercollegiate Guidline Network (SIGN), [SIGN 1999, 2000] Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 198 Die Leitlinien wurden in ihrer jeweils neuesten Fassung angewendet. Fehlen für eine lückenlose Versorgung entsprechende Leitlinien, werden Einzelempfehlungen herangezogen, die aus Metaanalysen bzw. mehreren Randomised Controlled Trials (RCT´s) stammen. Die Wahl der Leitlinie erfolgte auf der Basis folgender Kriterien: • International anerkannte Standards • Nationale Adapatationsfähigkeit Abbildung 1 zeigt eine Übersicht über das Ablaufschema des Disease Management bei manifestem Diabetes Mellitus von der Einschreibung bis zur spezifischen, individuellen Therapie. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 199 Abbildung 1: Ablaufschema eines Disease Management Programms Diabetes Mellitus Einschreibemodul Ablaufschema Disease Management Diabetes Einschreibekriterium erfüllt: Diagnosesicherung: Manifester Diabetes mellitus Status Erhebung Risikostratifizierung und Zuteilung zu einer entsprechenden Gruppe Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Zielwerte erreicht Mindestens ein Zielwert nicht erreicht entsprechend der ev. Leitlinie Komplikationen / Begleiterkrankungen entsprechend der Basismodul evidenzbasierten Leitlinie entsprechend der evidenzbasierten Leitlinie - Diabetes – Koordinator - Screening - Follow-Up - Diabetiker – Schulung - Benchmarkingdatensatz - Entscheidungsunterstützungen (z. B. Disease Management-Zirkel) - Reminder - Evidenzbasierte Leitlinien - Individueller Patientenbehandlungsplan - Selbsthilfe – Gruppen Individuelle Basistherapie Individuelle Basistherapie Ergänzungsmodule + Spezifische Therapie Individuelle Basistherapie + Spezifische Therapie + Komplikationstherapie Klinischer Zustand [Quelle: Eigene Darstellung] Individuelles Patientenmanagement nach Risikostratifizierung Psychosoziale Faktoren Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 200 Eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der Versorgungsqualität und Kosteneffektivität der Versorgung durch Disease Management ist die Identifizierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung. 11.2Über-, Unter- und Fehlversorgung bei Diabetikern Einschätzung der Problemhaushalte In Teilbereichen ist die Einschätzung der Problemhaushalte aufgrund der in Deutschland spärlichen Datenlage nur eingeschränkt möglich. Allerdings lassen sich aufgrund der diabetischen Endpunkte entsprechende Rückschlüsse ziehen. Eine umfassende epidemiologische Datenbasis ist zu fordern. Im Folgenden bedeutet: in [ ] gesetzte Fachrichtungen führen z. Z. genannte Versorgungsbereiche aus Screening [Hausarzt] Screening-Verfahren zur Diabetes-Früherkennung und zur Früherkennung von Begleiterkrankungen sind in Deutschland bisher nicht etabliert, obwohl z.B. seit zwölf Jahren anerkannt ist, dass beispielsweise Früherkennung einer Mikroalbuminurie der Vermeidung einer diabetischen Nephropathie dient [Mogensen et al., 1987]. Für das Jahr 1994 zeigen sich in den Abrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ca. 8.000 Mikroalbuminurie - Bestimmungen bei schätzungsweise 400.000 Diabetikern [Hauner, 1997]. Die Zahlen zeigen das mangelhafte Bewusstsein für erforderliche Screeningsmaßnahmen in der Praxis. Fazit: Unterversorgung Prävention [Hausarzt] Die Prävention wird in der Diabetologie in Deutschland wenig praktiziert. Weder Amputationen noch Erblindungen werden ausreichend vermieden. Die Effizienz regelmäßiger Fußinspektion wird nicht erkannt, und die Kostenübernahme durch die Sozialversicherer beispielsweise für spezielles, schonendes Schuhwerk ist die Ausnahme. Fazit: Unterversorgung Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 201 Risikofaktoren [Hausarzt] Zu den Risikofaktoren für des Diabetes Mellitus zählen vor allem erhöhte Lipid- und Blutdruck-Werte. Bei 77,4% der Diabetiker wurden in den Hausarztpraxen lediglich Gesamtcholesterin- Bestimmungen durchgeführt. Die Differenzierung in LDL- bzw. HDL- Cholesterin wurde nur bei 14,6% bzw. 15,9% der Diabetiker vorgenommen. Triglyzeride wurden mit einer Häufigkeit von 71,3% überprüft [Hauner, 1997]. Fazit: Unterversorgung Bei der Therapie des Bluthochdrucks mit teuren AT1– Rezeptorblocker zeigt sich eine Überversorgung; denn diese werden häufig auch dann verabreicht, wenn keine Unverträglichkeit von ACE- Hemmern besteht. Fazit: Überversorgung Diagnostik und Therapie [Hausarzt] Die Bestimmung des HbA1c dient zur Feststellung der langfristigen Blutzucker- Einstellung des Diabetikers. Dieser Wert ist unerlässlich um eine optimale Einstellung des Diabetikers zu prüfen und Folgeerkrankungen hinaus zu zögern. Nach Auswertung der Abrechnungsunterlagen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen- Lippe kann jedoch lediglich bei 25% der Diabetiker ein HbA1c– Wert bestimmt worden sein [Hauner, 1997]. Eine andere Studie wies eine Häufigkeit von 51,8% HbA1c– Messungen durch Hausärzte auf [Hauner et al., 1997]. Nüchternglukose wurde in 83,5% der diabetischen Patienten und der postprandiale Blutglukose- Wert wurde bei 45,7% der Diabetiker getestet [Hauner et al., 1997]. Fazit: Unterversorgung In einer weiteren Untersuchung zur Behandlung von Typ 2 Diabetikern in allgemeinmedizinischen Praxen wurde ermittelt, dass auf hundert Patienten acht Diabetiker kommen (= 7,8%). Die Schwankungen lagen zwischen einem Minimalwert von 2,8% und einem Maximalwert von 13,4%. Wesentlich größere Schwankungen zeigten sich jedoch in der Durchführung der Therapie. Diätetische Maßnahmen wurden im Mittel mit 41,3% (16,4% Minimalwert / 72,4% Maximalwert), orale Antidiabetika mit 42% (17,4% / 75,4%) und Insulin in 16,7% (2,8% / 32,1%) verordnet [Hasselkus et al., 1996]. Fazit: Fehlversorgung Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 202 Diabetische Begleiterkrankungen (1) Diabetische Mikro- und Makroangiopathie [Hausarzt, ggf. Kardiologe, ggf. Angiologe] Die Versorgungssituation von Diabetikern im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems ist im Vergleich zu den übrigen Versorgungsbereichen trotz der beschriebenen Mängel noch als befriedigend zu bewerten. So wurde bei 47,6% der Diabetiker ein RuheEKG durchgeführt und bei 90,1% der Blutdruck gemessen [Hauner et al., 1997]. Allerdings zeigt sich in der Therapie der koronaren Herzkrankheit neben der häufigen Durchführung nicht begründbarer Angiographien ein zu großer Einsatz von Perkutaner Transluminaler Coronarer Angiographien (PTCA). Fazit: Unterversorgung bzw. Überversorgung (2) Diabetische Retinopathie [Überweisung zum Augenarzt] Durch Überweisungen des Hausarztes zum Ophthalmologen wurde an 45,1% der diabetischen Patienten eine Augenhintergrunduntersuchung durchgeführt [Hauner et al., 1997]. Speziell bei Typ 1 Diabetikern erfolgte die Überweisung zum entsprechenden Facharzt in nur 21,3% der Fälle [Hauner et al., 1996]. Fazit: Unterversorgung (3) Diabetische Neuropathie [Hausarzt, ggf. Neurologe] Die diabetische Neuropathie ist eine der am wenigsten beachteten Begleit- bzw. Folgeerkrankungen des Diabetes Mellitus. Während der sensomotorische Bereich noch bei 18,9% der Diabetiker geprüft wurde [Hauner et al., 1997], sind Daten zur Untersuchungshäufigkeit bezüglich der diabetischen autonomen Neuropathien nur aus großen Zentren zu erhalten. Hausärzte intervenieren weder in diesem Versorgungsbereich, noch überweisen sie zu den entsprechenden Fachärzten wie Kardiologen, Gastroentologen und Urologen. Gleichzeitig werden aber teure Medikamente eingesetzt, deren Wirkung nicht eindeutig belegt ist. Fazit: Unterversorgung bzw. Fehlversorgung Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 203 (4) Diabetische Nephropathie [Hausarzt, ggf. Nephrologe - siehe auch Screening] 59% der Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz, die zur Nierenersatztherapie vorstellig werden, sind Diabetiker [Ritz et al., 1996]. Durch die verbesserte Therapie des Herz- Kreislauf- Systems ist in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass mehr diabetische Patienten eine terminale Niereninsuffizienz erleiden werden. Eine weitreichende Planung diesbezüglich ist nicht in Sicht. Fazit: Unterversorgung (5) Diabetisches Fußsyndrom [Hausarzt, ggf. Chirurg, ggf. Podologe] Neurologische und/ oder angiologische Untersuchungen, die zur Vermeidung eines diabetischen Fußsyndroms unerlässlich sind, werden in hausärztlichen Praxen lediglich bei 18,9% bzw. 13,4% der Diabetiker durchgeführt. 17,5% der Fußinspektionen bei Diabetiker wurden beim Hausarzt vollzogen, obwohl bei 69% dieser Patienten klinische Hinweise auf eine Neuropathie und bei 21,5% auf eine periphere arterielle Durchblutungsstörung vorhanden waren [Hauner et al., 1997]. Fazit: Unterversorgung Versorgungsstrukturen Ein Ost- West- Vergleich zeigt, dass die Behandlungsqualität von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. In der ehemaligen DDR wurden Diabetiker von spezialisierten Ärzten in landesweit verteilten Diabetikerzentren betreut, so dass eine flächendeckende, gleichbleibende Qualität gewährleistet werden konnte [Müller et al., 1993]. Bereits fünf Jahre nach der Wiedervereinigung zeigte eine Erhebung (ZEUVIN- Studie) die Abnahme der „guten“ Diabetes- Einstellung und damit eine Verringerung der Versorgungsqualität [Schiel et al., 1998]. Als Ursache wurde die nunmehr alleinige Versorgung der Diabetiker durch Hausärzte, die wenig Erfahrung mit Diabetikern hatten und die in der Vergangenheit nicht primär am Diabetesmanagement beteiligt waren, diskutiert. Fazit: Unterversorgung Die Versorgung von Diabetikern in stationären Pflegeeinrichtungen war Gegenstand einer Untersuchung im Jahre 1998 im Kreis Heinsberg [Hauner et al., 2000]. Die im Rahmen dieser Studie aus 99,6% aller Heime erhobenen Daten weisen in den Ergebnissen keine leitliniengerechte Versorgungsformen für Diabetiker auf. Die Vertei- Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 204 lung der Behandlungsart und die Häufigkeit der durchgeführten Messungen, wie in Tabelle 2 dargestellt, erklärt auch die in Tabelle 3 wiedergegebenen Komplikationshäufigkeiten in den Pflegeheimen. Fazit: Unterversorgung Tabelle 2: Verteilung nach Behandlungsart und Messungshäufigkeit Ohne Behandlung 3,6% > 1 Messung/ Tag 6,1% Nur Diabeteskost 13,3% > 1 Messung/ Woche 62,7% Orale Antidiabetika 47,0% < 1 Messung/ Woche 28,6% Insulintherapie 37,0% Keine Angaben, unbekannt 0,6% [Quelle: In Anlehnung an Hauner et al., 2000] Tabelle 3: Auswahl der Komplikationen und ihre Häufigkeit bei Diabetikern in Pflegeeinrichtungen Amputation Erblindung Dialysepflichtige Niereninsuffizienz Offener Dekubitus Harninkontinenz Angina pectoris pAVK 3,4% 13,6% 1,0% 4,5% 54,4% 20,5% 27,2% [Quelle: In Anlehnung an Hauner et al., 2000] Internationale Studien geben Hinweise darauf, dass die dargestellten Bereiche mit Über-, Unter- und Fehlversorgung durch ein systematisches, standardisiertes, sektorenübergreifendes und evidenzbasiertes Disease Management verringert werden können [Litzelman et al., 1993; Steffens, 2000; Stoner et al., 2001; Domurat, 1999; Demers et al., 1997]. 11.3Einschreibungsmodul: Die Einschreibekriterien sollten einen größtmöglichen Grad an Manipulationssicherheit aufweisen. Daher sind entsprechend den internationalen evidenzbasierten Diabetes- Leitlinien folgende Kriterien zu empfehlen (Manifester Diabetes Mellitus nach den Empfehlungen der ADA, WHO, IDF, DDG): Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 205 Die Diagnose eines manifesten Diabetes Mellitus ist als alleiniges Einschreibekriterium maßgeblich. Die Formen „Impaired Fasting Glucose“ (Abnorme Nüchternglukose) und „Impaired Glucose Tolerance“ (Abnorme Glukosetoleranz) werden aufgrund der unsicheren Diagnosesicherung nicht akzeptiert. Trotzdem sei darauf hingewiesen, dass Diabetes Mellitus einen progressiven Verlauf aufweist. In Abbildung 2 sind die Diabetes– Typen und der Verlauf der Hyperglykämiemanifestation dargestellt. Abbildung 2: Diabetes- Typen mit Spektrum und Verlauf der Hyperglykämiemanifestation Stadien Normoglykämie Normale Typen Hyperglykämie Gestörte Glukose-Toleranz Diabetes mellitus Blutglukose- Oder Nicht Insulin zur Insulin zum Regulation Gestörte Nüchtern-Glukose Insulinbedürftig guten Einstellung Überleben Typ 1 Typ 2 Andere Typen GestationsDiabetes [Quelle: In Anlehnung an ADA, 1997 und Kerner, 1998] Die im folgenden abgegebenen Empfehlungen dienen zur Sicherung der Diagnose des Diabetes Mellitus. Sie beruhen auf den Vorschlägen der ADA, der WHO sowie der Internationalen Diabetes Föderation (IDF), [ADA, 2000; Alberti et Zimmet, 1998; EDPG, 1999] (siehe auch Tabelle 4): (1) Bei klassischen Symptomen des Diabetes Mellitus (Polyurie, Polydipsie, ungeklärter Gewichtsverlust), bei Glucosurie oder bei Gelegenheitshyperglykämie (zu irgendeiner Tageszeit, ohne Beziehung zu den Mahlzeiten): • Kontrolle der venösen Gelegenheits- Plasmaglukose • ≥ 200 mg/dl (11.0 mmol/l): ein Diabetes ist diagnostiziert • ≥ 100 mg/dl (5,5 mmol/l): weitere Diagnostik nach Schritt 2 (2) Bei einer venösen Gelegenheits- Plasmaglukose oder einer Nüchternglukose im venösen Plasma ≥100 mg/dl (5,5 mmol/l): Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 206 • Kontrolle der Nüchternglukose im venösen Plasma (nüchtern ist definiert durch eine Fastenperiode von mindestens 8 Stunden ) • ≥ 125 mg/dl (7,0 mmol/l): Wiederholung, bei Bestätigung ist Diabetes mellitus diagnostiziert • ≥ 110 mg/dl (6,0 mmol/l): Indikation zum oralen Glukosetoleranztest (OGTT) • ≥ 90 mg/dl (5,0 mmol/l): Jährliche Kontrolle der Risikofaktoren, inklusive der Plasmaglukose, sollte erwogen werden. (3) OGTT (Werte sind für venöse Plasmaglukose angegeben): • 2-h-Wert ≥ 200mg/dl (11 mmol/l): Diabetes ist diagnostiziert • 2-h-Wert < 200mg/dl (11 mmol/l) und ≥ 140 mg/dl (7,8 mmol/l): "Gestörte Glukosetoleranz" (Impaired Glucose Tolerance) liegt vor • Nüchternwert ≥ 110 mg/dl (6 mmol/l) und < 140 mg/dl (7,8 mmol/l): eine "Abnorme Nüchternglukose" (Impaired Fasting Glucose) liegt vor Tabelle 4: Diagnostische Kriterien des Diabetes Mellitus Plasmaglukose Venös Kapillär Vollblutglukose Venös Kapillär mg/dl (mmol/l) mg/dl (mmol/l) mg/dl (mmol/l) mg/dl (mmol/l) Nüchtern Diabetes IFG ≥ 126 (≥ 7,0) > 110 (> 6,0) ≥ 126 (≥ 7,0) > 110 (> 6,0) > 110 (> 6,0) > 100 (> 5,5) > 110 (> 6,0) > 100 (> 5,5) OGTT 2-h Diabetes IGT > 200 (> 11,0) ≥ 140 (≥ 7,8) ≥ 220 (≥ 12,2) > 160 (> 8,9) ≥ 180 (≥ 10,0) ≥ 120 (≥ 6,7) > 200 (> 11,0) ≥ 140 (≥ 7,8) [Quelle: Eigene Darstellung] Durchführung des Oralen Glukose Toleranz-Testes (nach den WHO-Kriterien [WHO, 1985; Alberti et Zimmet, 1998b]): • Durchführung am Morgen (nach 10-16- stündiger Nahrungskarenz) nach einer mindestens 3- tägigen Ernährung mit mehr als 150g Kohlenhydraten/ Tag. Patient in sitzender oder liegender Position. Rauchen vor und während des Tests ist nicht erlaubt. • Zum Zeitpunkt 0 trinkt der Patient 75 g Glukose (oder äquivalente Menge hydrolysierter Stärke) in 250 bis 300 ml Wasser innerhalb von 5 Minuten. Kinder erhalten 1,75 g/kg Körpergewicht (bis maximal 75 g). Blutentnahmen zur Glukosebe- Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 207 stimmung zu den Zeitpunkten 0 und 120 Minuten (der 60 Minuten- Wert ist nicht obligatorisch). Sachgerechte Aufbewahrung der Blutproben bis zur Messung. Anmerkung: Über die Möglichkeit, dass längeres Fasten oder eine Kohlenhydratmangel- Ernährung auch bei Gesunden zur pathologischen Glukosetoleranz führen kann, ist bisher nur wenig bekannt, dennoch ist sie von großer praktischer Bedeutung [Björkman und Eriksson, 1985]. Eine Reihe von Medikamenten, wie z. B. Glukokortikoide, Epinephrin, Phenytoin, Diazoxid und Furosemid können die Glukosetoleranz verschlechtern. Diese Formen der Diagnosesicherung sind für die Versorgung eines neu zu diagnostizierenden Diabetikers vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt können alle bekannten Diabetiker in die Programme eingeschrieben werden. Die Kontrolle der Diagnose kann über die oben genannten Mechanismen zur Diagnosesicherung durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist routinemäßig ein oraler Glukose Toleranz Test ohne Gefährdung des Patienten durchzuführen. Um eine nicht indizierte Ausweitung von oralen Glukose Toleranz Tests zu vermeiden, sei an dieser Stelle auf die Empfehlungen der ADA hingewiesen, denen sich auch die DDG im Jahre 2000 angeschlossen hat (Tabelle 5): Tabelle 5: Diabetes- Sreening beim Gesunden Nüchternblutglukosebestimmungen sollten bei allen Personen, die 45 Jahre oder älter sind, in Betracht gezogen werden. Bei Normalbefunden sollte eine Wiederholung nach drei Jahren erfolgen. Nüchternblutglukosebestimmungen sollten sowohl bei jüngeren Personen durchgeführt werden als auch in kürzeren Intervallen bei allen anderen Patienten, wenn: • Übergewicht vorliegt (BMI ≥ 27 kg/m²) • Ein/e erstgradig Verwandte/r Diabetes Mellitus hat • Eine Frau ein Kind > 4000 g geboren hat oder bei ihr Gestationsdiabetes festgestellt wurde • Eine arterielle Hypertonie vorliegt (Blutdruck ≥ 140/90 mmHg) • Eine Dyslipidämie mit HDL- Cholesterin ≤ 35 mg/dl und/ oder Triglyzeriden ≥ 250 mg/dl vorliegt • Eine frühere Untersuchung eine gestörte Glukosetoleranz oder eine abnorme Nüchternblutglukose ergeben hat Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 208 Zum jetzigen Zeitpunkt wird ein Antikörper- Screening zur Frühdiagnose des Typ 1 Diabetes außerhalb kontrollierter Studien nicht empfohlen, da gesicherte therapeutische Maßnahmen fehlen, mit denen der Ausbruch der Erkrankung verhindert werden kann. [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ADA, 2000 und Kerner, 1998] Im Rahmen der Einschreibung erfolgt die Risikostratifizierung des Patienten. Dazu sollte ein kompletter Status vom Hausarzt erhoben und weiterführende Untersuchungen konsiliarisch bei den spezifischen Fachärzten durchgeführt werden. Im Einzelnen erfordert die standardisierte Statuserhebung zur Risikostratifizierung folgende dokumentationspflichtige Maßnahmen mit entsprechenden Zielwerten [modifiziert nach ADA, 2001; Alberti et al., 1994; European Diabetes Policy Group, 1999]: (1) Ausführliche Anamnese • Aktuelle Problematik, frühere Beschwerden (KHK, pAVK, cAVK, Fußsyndrom, Visusverschlechterung, Nephropathien, Hypertonie?) • Abfrage von Risikofaktoren (Rauchen, Ernährung, Bewegungsstatus?) • Vegetative Anamnese (Stuhlgewohnheiten, Urinverhalten) • Familien- und Sozialanamnese • Medikamentenanamnese • Bei vortherapierten Diabetikern: Anamnese über diabetisches Therapieschema • bei Frauen im gebärfähigen Alter: Erhebung des Menstruationszyklus bzw. Verlauf vorheriger Schwangerschaften und Entbindungen (2) Vollständige körperliche Untersuchung (Inspektion, Palpation, Perkussion): • Hautstatus • Augen (Xanthelasmen, Xanthome, Arcus lipoides?) • Fettverteilungsmuster • Struma • zyanotische Körperregionen • maßgebliche Temperaturunterschiede der einzelnen Extremitäten • Pulsstatus der Extremitäten • Sensibilitätsüberprüfung • Überprüfung der Reflexe und der Motorik Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 209 (3) Apparative Untersuchungen (mit Angabe von Zielwerten, sofern sie von Nichtdiabetikern abweichen bzw. von besonderer Bedeutung sind): • Gewicht: ≤ 25 kg/m2 • Blutdruck (systol. / diastol. mmHg) für Diabetiker ≥ 18 Jahren • Bei Kindern und Jugendlichen gelten als Referenzwerte die des 95 % Percentilbereichs aus speziellen Blutdrucknormogrammen für Kinder und Jugendliche [Rosner et al., 1993]. - Mit essentieller Hypertonie ≤ 140 / ≤ 85 (Bei guter Verträglichkeit eines RR von 140 / 85 mmHg ist später als Zielwert ≤ 130 / ≤ 80 mmHg anzustreben) - Bei bekannter Mikroalbuminerie und / oder manifester Nephropathie ≤ 130 / ≤ 80 mmHg (4) Biochemische Tests: • Blutglukose: Plasma / Serum (venös) Vollblut (kapillär) 90-120 mg / dl 90-120 mg / dl Nüchtern/ präprandial 130-180 mg / dl 1-2h postprandial Vor dem Schlafengehen 110-140 mg / dl • HbA1c im Blutplasma bzw. Serum: < 6,5 % • Bestimmung der Schilddrüsenwerte • Triglyzeride, HDL- Cholesterin und LDL- Cholesterin: Diabetiker ohne makrovaskuläre *Chol ges < 200 mg / dl Erkrankung *LDL-C < 130 mg / dl *HDL-C ≥ 35 mg / dl *NüTG < 150 mg / dl Diabetiker mit makrovaskulärer *Chol ges. < 170 mg / dl Erkrankung *LDL-C <1 00 mg / dl *HDL-C > 40 mg / dl *NüTG < 150 mg / dl 110-140 mg / dl Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 210 Diabetiker mit Triglyzeridwerten Durch Akuttherapie: *TG: < 400 mg / dl > 1000 mg/ dl Unter Dauertherapie: *NüTG < 150 mg / dl *Chol ges : Gesamt- Cholesterin; *LDL-C: Low- density- lipoprotein- Cholesterin; *HDL-C: High- density- lipoprotein- Cholesterin; *NüTG: Nüchtern- Triglyzeride; *TG: Triglyzeride • Kreatinin und Elektrolyte, Urinuntersuchung auf Glukose, Albumin, Ketone und mikroskopische Untersuchung Folgende Methoden werden zum Screening für eine Mikro-/ Makroalbuminiurie empfohlen und nach Tabelle 6 entsprechend interpretiert: • Konzentrationsbestimmung von Albumin im Morgen- oder Spontanurin • Ausscheidungsrate von Albumin im 24- Stunden- Sammelurin oder in einer befristeten Urinsammlung • Albumin- Kreatinin- Quotient im Morgen- oder Spontanurin Tabelle 6: Definition des Mikroalbuminerie- Bereichs bei verschiedenen Urinsammelmethoden bzw. Bezugsgrößen a) befristete Urinsammlung: 20 bis 200 µg/min b) 24- Stunden- Urinsammlung: 30 bis 300 mg/24h c) Bezug auf Urin- Kreatinin: für Frauen: für Männer: d) Konzentrationsmessung: Bei Kindern in bezug auf 1,73 m2 Körperoberfläche 30 bis 300 mg/g U- Krea 3,5 bis 35 mg/mmol U- Krea 20 bis 200 mg/g U- Krea 2,5 bis 25 mg/mmol U- Krea 20 bis 200 mg/l [Quelle: Eigene Darstellung] Unabhängig von den erhobenen Befunden erfolgt zur Statuserhebung eine Überweisung zum Augenarzt sowie zum Zahnarzt; bei Frauen eine Überweisung zum Gynäkologen. Bei suspekten Befunden können nach Indikationsstellung Überweisungen zu den jeweiligen Fachdisziplinen erfolgen. Ziel der Statuserhebung zur Risikostratifizierung ist die Zuordnung des Diabetikers zu einer von drei Disease Management Gruppen. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 211 Abbildung 3: Ablauf und Ziele des Einschreibemodus Verdacht auf Diabetes Mellitus Diagnosesicherung nach Einschreibekriterien - Klinik - Labor - Anamnese - Körperliche Untersuchung - Laborchemische Untersuchungen - Ggf. Überweisung zu anderem Facharzt Statuserhebung Disease Management Gruppe 1: Zielwerte erreicht Disease Management Gruppe 2: Mind. ein Zielwert nicht erreicht Disease Management Gruppe 3: Komplikationen Risikostratifizierung nach Untersuchungsergebnissen [Quelle: Eigene Darstellung] Die Zuordnung zu einer spezifischen Disease Management Gruppe wird der Krankenkasse vom einschreibenden Arzt mitgeteilt. Sollte sich die Gruppenzugehörigkeit im Laufe der Therapie ändern, wird dies der Krankenkasse ebenfalls mitgeteilt. Auf der Grundlage der Gruppenzugehörigkeit werden dann von Arzt und Krankenkasse definierte Disease Management Module initiiert: Gruppe1: Zielwerte erreicht: Status des manifesten Diabetes Mellitus (Basismodul) Gruppe 2: Zielwerte nicht erreicht: Risikofaktoren (Basismodul plus Ergänzungsmodul – Spezifische Therapie) Gruppe 3: Komplikationen: Diabetische Komplikationen bzw. Begleiterkrankungen (Basismodul plus Ergänzungsmodul – Spezifische Therapie plus Ergänzungsmodul – Komplikationstherapie) Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 212 11.4Basismodul Generell gehören zum Basismodul die folgenden Komponenten: • Therapie nach evidenzbasierter Leitlinie • Diabetes- Koordinator nach Bedarf • Screening nach Leitlinie • Follow- Up nach Leitlinie • Schulung nach evidenzbasiertem Schulungskonzept • Entscheidungsunterstützung nach Bedarf • Reminder nach Bedarf • Evidenzbasierte Leitlinien • Individueller Behandlungsplan • Selbsthilfe- Gruppen • Benchmarkingdatensatz Weitere unterstützende Komponenten sind: • Ärztliche Fortbildung • Patienten- und Ärzte- Informationssysteme • Datenbanken • Definition von Schnittstellen zur Überweisung auf eine andere Versorgungsebene (Spezialist, stationäre Einweisung, Vorstellung in Spezialambulanz, ...) Das Basismodul ist für alle Gruppen aus den Versorgungskomponenten (Therapie, Screening, Follow- Up und Schulung), den unterstützenden Komponenten (Evidenzbasierte Leitlinien, Diabetes Koordinator, Entscheidungsunterstützung, Reminder, Individueller Behandlungsplan, Selbsthilfegruppen) und der Datensatzkomponente (Benchmarkingdatensatz) aufgebaut. Folgende zeigt das Ineinandergreifen der Komponenten im Ablauf des Basismoduls. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 213 Abbildung 4: Ablauf und Vernetzung der Basismoduls Screening Evidenzbasierte Leitlinien Entscheidungsunterstützung Reminder Schulung Evidenzbasierte Leitlinien Reminder Selbsthilfegruppen Diabetes Koordinator Informationssysteme Follow-up Evidenzbasierte Leitlinien Reminder Diabetes Koordinator Benchmarking Datensatz Basismodul Therapie Evidenzbasierte Leitlinien Entscheidungsunterstützung Reminder Individ. Behandlungsplan Fortbildung [Quelle: Eigene Darstellung] Therapie Grundsätzlich ist die Therapie bei Typ 1 Diabetikern auf die Insulinsubstitution ausgerichtet. Die Therapieschemata sind der Leitlinie der ADA [ADA, 2001] zu entnehmen. Die entsprechende Leitlinie der DDG ist zur Zeit in Vorbereitung. Bei Typ 2 Diabetikern ist das Therapiemanagement dreistufig ausgerichtet. Zunächst einmal ist die Reduzierung bzw. Vermeidung von Risikofaktoren anzugehen, welches im Folgendem beschrieben wird. Weiterhin ist über diätetische Maßnahmen und Bewegungssteigerung der Versuch einer Blutzuckernormalisierung vorzunehmen. Ist dieses nicht möglich, so sind medikamentöse Interventionen in Form von oralen Antidabetika anzuwenden. Bei weiterhin therapieresistenten Blutzuckerwerten ist letztendlich die Insulintherapie das Mittel der Wahl. Auch hier gilt der Verweis auf die Leitlinien der ADA und DDG. Screening Das Screening als integrativer Bestandteil des Follow- Up soll zur Vermeidung möglicher Komplikationen bzw. Begleiterkrankungen des Diabetes beitragen. Zur frühzei- Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 214 tigen Erkennung einer drohenden Nephropathie sind beispielsweise Albumin im Urin oder Serum- Kreatinin regelmäßig zu bestimmen. Zur Vermeidung eines diabetischen Fußsyndroms wird eine regelmäßige Inspektion des Fußes durchgeführt. Folgende Disease Management Komponenten können zur Unterstützung eines effektiven Screenings eingesetzt werden: • Leitlinien zur Spezifierung von Screeninginhalten und Durchführung • Reminder zur Erinnerung an Screeninguntersuchungen für Arzt und Patient • Diabeteskoordinator (kann durch ein Call- Center übernommen werden). Er kann das Remindersystem steuern, zusätzliche Informationen zu den Screeningmaßnahmen und ihrer Bedeutung für die Therapie geben. Die Diskussion der Ergebnisse des Screenings sollte mit dem Hausarzt bzw. dem das Screening durchführenden Arzt erfolgen. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 215 • Follow- Up Tabelle 7: Disease Management Programm– Follow-Up: Diabetes mellitus Empfehlungen zur Frequenz von Kontrollleistungen, Intervention und Behandlung (modifiziert nach WHO, 1991, VHA, und ADA, 2000) Frequenz der Konsultationen und ihrer Leistungen im Jahr Empfohlene Leistungen1 Hausärztliche Leistungen Ausführliche Erstanamnese und Untersuchung2 Umfassende Anamnese und Untersuchung (inkl. EKG, neurologische Untersuchung)3 Hausarzt - kurze Begegnung5 inkl. RR, Fuß, Gewicht (bei Jugendlichen : Größe & Wachstumsperzentile) y RR Neudiagnostizierte Diabetiker Typ 1 Typ 2 Bekannte Diabetiker Ziel Typ 1 Typ 2 1 1 - - - - 14 1 4 4 4 4 Normal mit essentieller Hypertonie bei guter Verträglichkeit eines RR von 140/85 mm/Hg ≤140/858 mmHg ≤130/80 mm/Hg mit Mikroalbuminurie und/oder manifester Nephropathie ≤130/80 mm/Hg y BMI ≤25 kg/m2 Leistungen von Fachärzten bzw. von diabetologisch versierten Spezialisten Augenuntersuchung (Ophthalmologe) 1 1 1 1 Normal Diätschulung (Diätberater) 2 2 1 1 Schulung zur Selbstkontrolle 3 2 1 1 Gynäkologische Betreuung 1 1 - - Beherrschung des Selbstmanagement Intervention12 Empfohlene Behandlung Neuropathie Beratung zu Lebensgewohnheiten und Fußpflege, Intensivierung der Diabetestherapie, evtl. Überweisung an Neurologen Patientenschulung, Änderung der Lebensgewohnheiten, evtl. medikamentös Netzhautkomplikation HbA1c≥7 HbA1c≥7 Schwangerschaft Laserkoagulation, Vitrektomie Erneute Schulung, evtl. neuer Diätplan Kontrolle der Selbstkontrolle, evtl. erneute Schulung Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 216 Laborleistungen RBZ oder NBZ6 HbA1c Lipidprofil yDiabetiker ohne mikro- bzw. makrovaskuläre Erkrankung 6 5 4 4 1 1 Gesamtcholesterin yDiabetiker mit mikro- bzw. makrovaskulärer Erkrankung yAlle Diabetiker >1000 mg/dl TG LDL-C9 HDL-C10 NüTG11 Gesamtcholesterin LDL-C HDL-C NüTG Triglyzeride Serum-Kreatinin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mikroalbuminurie T4 /Urineiweiß7 4 4 1 2 4 1 <6,5% ≥7% Normnahe BZ-Einstellung >1000mg/dl >1000mg/dl 30-300 mg/24h Durch Akuttherapie Unter Dauertherapie BZ- und RR-Einstellung Ernährungstherapie <200 mg/dl <130 mg/dl ≥35 mg/dl <150 mg/dl <170 mg/dl <100 mg/dl >40 mg/dl <150 mg/dl TG<400 mg/dl NüTG<150 mg/dl 1. Individuelle Abweichungen möglich, z.B. Anstieg der Frequenz bei Komplikationen, bzw. geänderter Situation, bzw. Schwangerschaft. Zusätzliche Konsultationen bei Komplikationen nach Maßgabe des Hausarztes oder entsprechenden Empfehlungen des Facharztes. 2. Siehe Anlage 15b 3. Siehe Anlage 15b 4. Das Screening sollte nach dem 5. Jahr nach Diagnose bzw. bei Kindern mit Einsetzen der Pubertät (>11. Lebensjahr) begonnen werden. 5. Siehe Anlage 15b 6. RBZ = regulärer Blutzucker, NBZ = nüchterner Blutzucker 7. Überprüfung der Albuminausscheidungsrate bei einer Albuminurie 8. Bei Kindern und Jugendlichen gelten die Referenzwerte die des 95% Percentilbereichs aus speziellen Blutdrucknomogrammen für Kinder und Jugendliche 9. LDL-C : Low-density-lipoprotein-Cholesterin 10. HDL-C : High-density-lipoprotein-Cholesterin 11. NüTG : Nüchtern-Triglyzeride 12. Keine Angabe = Intervention wenn der Wert außerhalb der angegebenen Zielwertsetzung lieg Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 217 13. Das Follow- Up ist in Abhängigkeit von der jeweiligen Management– Gruppe verschieden gestaltet und folgt nach entsprechenden Zeitintervallen. • Zeitnahe Folgeuntersuchungen: Schulungsinhalte konsolidieren, Gewicht, Blutdruck und Blutzucker kontrollieren, Befinden und Therapie (bisheriger Verlauf, Maßnahmen, Ziele) besprechen. • Vierteljährlich (Bei schlecht kontrollierten Patienten häufiger): Gewicht, Blutdruck, Blutzucker, HbA1c, Lipide (nur wenn erhöht), Urin auf Albumin und Serum- Kreatinin (nur wenn pathologisch), Schilddrüsenwerte (nur wenn pathologisch) kontrollieren, Fußinspektion durchführen, bei Kindern und Jugendlichen Größe und Wachstumsperzentile vergleichen, Schulungsinhalte vermitteln. • Jährlich: Vollständige körperliche und klinisch chemische Laboruntersuchung wie bei der ersten Statuserhebung beim Hausarzt bzw. Primärarzt, Selbstkontrolltechniken überprüfen, Schulungen, Besuch beim Ernährungsberater, Konsultation von Augenarzt, Zahnarzt, Frauen zusätzlich von Gynäkologen. Zusätzlich können die folgenden Disease Management Komponenten das FollowUp unterstützen: • Schulungen können das Selbstmanagement effektiv unterstützen. • Leitlinien unterstützen eine evidenzbasierte Vorgehensweise. Entsprechend aufbereitete Patientenleitlinien helfen dem Patienten Ursachen und Durchführung von Maßnahmen des Selbstmanagements zu verstehen und in ihrer Bedeutung zu erkennen. • Reminder können Patienten an Zielvereinbarungen, Schulungsinhalte etc. erinnern. • Diabetes- Koordinator. Seine Aufgabe ist vielfältig und hängt u.a. vom klinischen Zustand des Patienten ab. Er kann das Remindersystem steuern, spezifische Informationen geben, Schulungen koordinieren oder durchführen, Fragen über eine Hotline beantworten, je nach Ausprägung (z.B. weitergebildete Krankenschwester) auch einfache medizinisch Maßnahmen wie die Fußinspektion mit dem Patienten zusammen durchführen. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus • Seite 218 Entscheidungsunterstützung im Follow- Up ist in erster Linie für den Arzt interessant und kann auf vielfache Weise eingesetzt werden (siehe Kapitel Organisationsmanagement und Entscheidungsunterstützung). Schulung Die Schulung im traditionellen Frontalvortrag hat sich als ineffektiv erwiesen. Einige Fachrichtungen meiden inzwischen den Begriff der Schulung und sprechen stattdessen z.B. von Edukationsprogrammen [Berger et al. 2001]. Strukturierte Schulung soll das Empowerment des mündigen Patienten fördern und dem Patienten und seinen Angehörigen Informationen vermitteln (Einweisung in die Stoffwechselselbstkontrolle: Harnzuckerselbstkontrolle, Blutzuckerselbstkontrolle; Blutdruckselbstkontrolle, Messung des Körpergewichts, Fußinspektion und Dokumentation), die für eine erfolgreiche Therapie und für das Disease Management unerlässlich sind. Hier sollen neue edukative, didaktische aber auch autodidaktischen Formen der Wissensvermittlung genutzt werden. Zu näheren Einzelheiten sei hier auf den Abschnitt „Komponenten von Disease Management“ verwiesen. Eine in den letzten Jahren aufgekommene zusätzliche Begleitung und Wissensvermittlung durch Selbsthilfegruppen für Betroffene scheint sich zusätzlich zu bewähren. Patienten, vor allem chronisch Kranke wie Diabetiker, scheinen in dieser Umgebung die Bedeutung ihrer Krankheit stärker wahrzunehmen und übernehmen eher Empfehlungen in ihren Alltag. Selbsthilfegruppen sind aus diesem auch ökonomisch bedeutsamen Grund besonders zu fördern (siehe Kapitel Schulung). Zur Unterstützung einer effektiven Schulung können die unten aufgeführten Disease Management Komponenten eingesetzt werden: • Leitlinien. Insbesondere Patientenleitlinien in Form von Arbeitsblättern (s.u.), Algorithmen oder Patientenselbstverträgen mit der Erarbeitung von selbstgesteckten Zielen können hier hilfreich sein. Sie können in der Vor- und Nachbereitung eingesetzt werden und Patienten immer wieder an Ziele und Inhalte von Schulungen erinnern. Eine langfristige Stabilisierung von Schulungseffekten ist dadurch möglich. • Informationssysteme können Schulungen zu jeder Zeit ergänzen (Abbildung 7). Sie vermitteln Patienten über die Schulungsinhalte hinausgehende Informationen bzw. können auch von pflegenden Angehörigen genutzt werden. Sie können zur Auffrischung von Schulungsinhalten dienen oder Aspekte ansprechen, die in Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 219 Schulungen zu kurz kommen, aber für den Alltag und die Lebensqualität wichtig sind, wie z.B. aktuelle Rezepte. • Reminder. Sie können an Schulungsinhalte erinnern und an selbstgesteckte Ziele. Dadurch tragen sie zur Konsolidierung der Schulungsinhalte bei. • Diabeteskoordinator. Er kann beispielsweise die Koordination einer sektorenübergreifenden Schulung übernehmen, ggf. Einzelschulungen in häuslicher Umgebung durchführen, Schulungsinhalte wie die Fußinspektion mit dem Patienten zusammen regelmäßig wiederholen, Ansprechpartner für Fragen sein und spezifische Informationen liefern. • Selbsthilfegruppen können Schulungen wirkungsvoll unterstützen, da Patienten eher von Gleichbetroffenen lernen und sich mit ihnen identifizieren können. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 220 Abbildung 5: Arbeitsblatt zur Diabetesschulung Name: Datum: I.D. Nr. Grundlagen der Diabetes Behandlung Überprüfung der vom Patienten gemessenen Blutzuckerwerte (bei jedem Besuch) Blutdruck (bei jedem Besuch) Zielwert Gewicht (bei jedem Besuch) Zielwert Fußuntersuchung (bei jedem Besuch) HbA 1c (alle drei Monate) Messbereich Zielwert Microalbuminuriescreening (jährlich bei negativem Urineiweiß) Augenärztliche Kontrolle (jährlich) Cholesterol (jährlich)/ Triglyceride (jährlich) Zielwert HDL (jährlich)/ LDL (jährlich) Zielwert Influenza (jährlich)/ Pneumonie-Impfung (wenigstens einmal, siehe CDC- Empfehlung) Bewertung der Daten Selbst-Management Training Einstellung des Rauchens Kontrolle der Blutzuckerwerte Kontrolle der Ernährung und des Gewichts Körperliche Aktivität Krankheitstage/ Arbeitsunfähigkeitstage (AU) Hypo-/ Hyperglykämie Fußpflege Allgemeine Versorgung Periodisch: Anamnese/ körperlicher Befund Mammographie/ Thoraxröntgenbild Stuhlprobe für Hämokult Tuberkulosetest/ Tetanus EKG Einhaltung der Medikation [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 221 Abbildung 6: Selbst- Management für Diabetiker Selbst- Management Mo Di Mi Do Fr Sa So Blutzuckerspiegel messen Untersuchung der Füße Zähne putzen und mit Zahnseide säubern 5 Mahlzeiten mit Gemüse oder Obst essen Medikamente einnehmen Mindestens 20 Minuten Sport treiben [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Abbildung 7: Dokumentationsbogen für Lerninhalte Datum Gezeigte Lehrvideos für Familie oder Patient Kommentare Grundlagen der Krankheit Kontrolle der Krankheit Diabetes verstehen lernen Grundlagen der Ernährung Vorgeschriebene Medikation bei Diabetes Wenn die Kontrolle aus dem Gleichgewicht gerät Bewegungsübungen Diabetes kennen lernen Andere Videos [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Diabetes– Koordinator Aufgrund der sektoralen Gliederung des deutschen Gesundheitssystems kommt es immer wieder zu Unterbrechungen in der Versorgungskette, zu ineffizientem Ressourceneinsatz und Informationsverlusten. Ein Diabetes- Koordinator kann steuernd eingreifen, indem er Schulungen sektorenübergreifend koordiniert, Patienten mittels Telemanagement oder Hausbesuchen betreut und den Daten- und Informationsfluss sicherstellt. Ein Diabetes- Koordinator wird je nach Risikostratifizierung und klinischem Zustand des Patienten eingesetzt. Er kann von Arzt oder Krankenkasse angefordert werden. Beispielsweise könnten die Aufgaben des Diabetes- Koordinators für Patienten aus der Management– Gruppe 1 von einem medizinischen Call– Center wahrgenommen werden. Der Kontakt mit dem Call- Center kann je nach klinischem Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Seite 222 Zustand von mehrmals wöchentlich bis zu einmal innerhalb des Quartals variieren. In der Regel wird ein Kontakt pro Quartal notwendig sein, falls das Call- Center auch zur Datenpflege und Erhebung eingesetzt wird. Für die Disease Management Gruppe 2 könnten die Koordinationsaufgaben von einem medizinischem Call– Center und einer speziell weitergebildeten Krankenschwester wahrgenommen werden. Die Krankenschwester kann dabei primär einem Krankenhaus, einem Arztnetz, der Krankenkasse oder dem Call- Center zugeordnet sein. Für die Patienten in der Disease Management Gruppe 3 jedoch sollte neben einem Call- Center bei Bedarf immer eine speziell weitergebildete Krankenschwester/ Pfleger zur Verfügung stehen. Der Koordinator kann also ein medizinisches Call– Center, ein medizinisch geschulter Ansprechpartner, z. B. aus dem Pflegebereich, oder ein Schulungsteam sein. Es sind auch Kombinationen denkbar. Der mögliche Aufwand eines Koordinators ist in Tabelle 8 dargestellt. Managed Care Organisationen gehen häufig von einem durchschnittlichen Aufwand von fünf Telefonaten pro Quartal pro Mitglied aus [Steffens, 2000]. Hierbei sind die „aktiven“ Interventionen in Form von persönlichen vor Ort Kontakten definiert, während die „passiven“ Kontakte in Form von Telefonaten oder interaktiv via Internet definiert sind. Tabelle 8: Beispiele für den Einsatz eines Diabetes-Koordinators in Abhängigkeit von der Disease Management Gruppe Management– Gruppen Interventionshäufigkeit (Anzahl) Management– Gruppe 1 Aktiv 1x (bei Neudiagnostizierten 2x) und nach Bedarf / Quartal Passiv 1 bis 4x pro Quartal Management– Gruppe 2 Aktiv 1 - 2x und nach Bedarf/ Quartal Passiv 4x – 6x pro Quartal Management– Gruppe 3 Aktiv 1 - 4x und nach Bedarf/ Quartal Passiv 4x – 12x pro Quartal Diabetiker in besonderen Versorgungssituationen Aktiv 4x bzw. nach Bedarf (zusätzlich individuelle Einheiten) Passiv (nach ärztlichem Ermessen) [Quelle: Eigene Darstellung] Der Diabetes- Koordinator kann weitere Disease Management Komponenten einsetzen, wie z.B. • Leitlinien zur Unterstützung der Therapie und des Selbstmanagements Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus • Seite 223 Remindersysteme zur Erinnerung an Screeninguntersuchungen, Schulungsinhalte u.a. • Informationssysteme zur Unterstützung von Compliance und Konsolidierung von Schulungsinhalten Individueller Behandlungsplan Der Individuelle Behandlungsplan fördert das Empowerment des Patienten. Sein Mitspracherecht und das medizinische Fachwissen des Hausarztes und weiterer Fachdisziplinen ermöglichen einen Behandlungsplan, der medizinisch auf die Notwendigkeiten der klinischen Befunde ausgerichtet und auf die psychosozialen Belange des Patienten abgestimmt ist. Gemeinsam werden die Ziele definiert: Vermeidung von Hyper- bzw. Hypoglykämien mit ihren spezifischen symptomatischen Erscheinungsbildern (Abbildung 8, mittlere Spalte). Die tatsächlich eingetretenen Ereignisse (Abbildung 8, rechte Spalte) werden dokumentiert und lassen sich mit den Zielen vergleichen. Nach geraumer Zeit lassen sich so Verläufe nachweisen. Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus Probleme Diabetes Mellitus oder mögliche Ziele Behandlung der Symptome und Anzeichen von Diabetes Mellitus Seite 224 Interventionen Beurteilung / Aufzeichnung / Angaben für den behandelnden Arzt Komplikationen • Hypoglykämie • Hyperglykämie Hyperglykämie [ ] Appetitlosigkeit • und/oder falsche [ ] Übelkeit Hyperglykämie [ ] Appetitlosigkeit Ernährung [ ] errötete, trockene, [ ] Übelkeit • und/oder spannende Hautprobleme Haut (besonders an Beinen [ ] Polydypsie, Polyurie [ ] häufiges Erbrechen und Füßen) • und/oder Sehstörung [ ] Gewichtsreduzierung Hypoglykämie [ ] Verwirrter Geisteszustand [ ] Diaphorese [ ] errötete, trockene, spannende Haut [ ] Polydypsie, Polyurie [ ] häufiges Erbrechen [ ] Gewichtsreduzierung Hypoglykämie [ ] Verwirrter Geisteszustand [ ] Schwindel [ ] Diaphorese [ ] Kopfschmerzen [ ] Schwindel [ ] Hunger [ ] Kopfschmerzen [ ] Reizbarkeit [ ] Hunger [ ] Blässe [ ] Reizbarkeit [ ] erhöhter Puls [ ] Blässe [ ] flache Atmung [ ] erhöhter Puls [ ] innere Unruhe [ ] flache Atmung [ ] Apathie [ ] innere Unruhe [ ] verschwommenes [ ] Apathie Sehvermögen [ ] körperliche Schwäche [ ] verschwommenes Sehvermögen Abbildung 8: Interdisziplinärer Patiententherapieplan für Diabetes Mellitus [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Die Handlungsschemata (Tabelle 9; Tabelle 10; Tabelle 11) sollen für die individuelle Patientenbehandlung als Leitpfaden dienen: • Absprache von Kurz- und Langzeitzielen • Absprache über weitere Hilfen, Verlaufskontrollen und Besprechung des bisherigen Verlaufs Disease Management in Deutschland - Diabetes Mellitus • Seite 225 Individuelle Ernährungsberatung, Anleitung zu einer gesunden Lebensweise (Sport, Nikotinverzicht, mäßiger Alkoholgenuss und andere) und zum Medikamentenmanagement (Insulin, orale Antidiabetika, Antihypertensiva, Lipidsenker, Acetylsalicylsäure, Glukagon und weitere Medikamente) • Besprechung, wann der Arzt bzw. andere medizinische Berufsgruppen aufgesucht werden sollen, falls der Patient ein Problem nicht selber lösen kann oder eine Akutproblematik dies erfordert • Aufklärung über Kontrazeptiva und die Notwendigkeit der optimalen Stoffwechseleinstellung vor der Konzeption und während der Schwangerschaft, Kriterien der optimalen Stoffwechseleinstellung in der Schwangerschaft • Reminder im Zeitintervall wie aus Behandlungsschemata ersichtlich Folgende weiteren Disease Management Komponenten können zur Umsetzung eines individuellen Behandlungsplans eingesetzt werden: • (Patienten-) Leitlinie zur Unterstützung des Selbstmanagements und zum Verständnis von Therapiemaßnahmen und ihrer Bedeutung im Gesamttherapiekonzept • Informationssysteme zur weitergehenden Information über Untersuchungsmaßnahmen und ihre Bedeutung, entsprechend der Patienteninformation (Tabelle 12; Tabelle 13) • Reminder können Arzt und Patient an Untersuchungstermine, Schulungstermine und Schulungsinhalte erinnern. • Diabeteskoordinator: Er kann auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden und insbesondere die Betreuung des Patienten im Alltag verbessern. Beispielsweise können Blutzucker- und Blutdruckwerte abgefragt werden und Abweichungsanalysen durchgeführt werden. Werden definierte Schnittstellenwerte erreicht, so wird die Kontaktierung eines Arztes empfohlen. • Schulungen ergänzen den individuellen Behandlungsplan, indem sie Inhalte der Therapie erläutern und Selbstmanagementtechniken einüben. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 226 Tabelle 9: Diabetes Typ II – Handlungsschema für die stationäre Behandlung Erste Visite Erste Woche Zweite Visite 2. – 3. Woche Dritte Visite 5. – 6. Woche Vierte Visite 3 Monate Vitalwerte, Gewicht, Blutdruck Hautuntersuchung Überprüfung der Tagebucheinträge der vergangenen zwei Wochen heimisches Glukosemonitoring überprüfen Urinprobe (Albumin/ Kreatinin) Schilddrüsenwerte Lipidprofil Weiterführende Diätschulung und Hilfe in der Nahrungsmittelwahl Nachbearbeitung der Themen der ersten Schulung Vitalwerte, Gewicht, Blutdruck Hautuntersuchung Überprüfung der Tagebucheinträge der vergangenen Wochen Vitalwerte, Gewicht, Blutdruck Hautuntersuchung Überprüfung der Tagebucheinträge der vergangenen Wochen heimisches Glukosemonitoring überprüfen Urinprobe (Albumin/ Kreatinin) Schilddrüsenwerte Lipidprofil Dem Patienten die Fuß- und Hautpflege näherbringen Mit dem Patienten einen Bewegungsplan erarbeiten Nachbearbeitung der Themen der ersten Schulung HbA 1c Blutzuckerwerte Urinprobe (Albumin/ Kreatinin) Schilddrüsenwerte Lipidprofil Dem Patienten die Konsequenzen des Rauchens und Alkoholgenusses darlegen Den Patienten auf die Notwendigkeit der regelmäßigen augenärztlichen Kontrolle hinweisen Glykagonspritze – Nebenwirkungen und Medikamentenwechselwirkungen besprechen nicht diabetes-bezogene Medikamente, die Zucker enthalten Glykagonspritze – Nebenwirkungen und Medikamentenwechselwirkungen besprechen nicht diabetes-bezogene Medikamente, die Zucker enthalten Glykagonspritze – Nebenwirkungen und Medikamentenwechsel-wirkungen besprechen nicht diabetes-bezogene Medikamente, die Zucker enthalten Ophthalmologe, Fußspezialist Endokrinologe, Neurologe Datum Anamnese, Vitalwerte, Gewicht Hautuntersuchung Diagnostik und AnamDiätplan nese Familiäre Unterstützung Finanzielle Mittel Heimisches Glukosemonitoring überprüfen Labordiagnostik und Urinprobe (Albumin/ Kreatinin) Behandlung Schilddrüsenwerte Lipidprofil Patienten helfen, seine Diagnose zu akzeptieren Patienten die Bedeutung von Diät, Bewegung, Medikation und Glukosemonitoring erkläPatientenschulung und ren Patienten Kenntnisse über die Behandlung Warnzeichen einer Hypoglykämie vermitteln Patienten die Behandlung einer Hypoglykämie mit zuckerhaltigen Nahrungsmitteln erläutern Glykagonspritze – Nebenwirkungen und Medikamentenwechselwirkungen besprechen Medikation nicht diabetes-bezogene Medikamente, die Zucker enthalten Konsil Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 227 Blutzuckerwert unauffällig Blutzuckerwert unauffällig Minimale Anzeichen und Symptome einer Hypoglykämie Blutzuckerwert unauffällig Das Gewicht nähert sich dem Normwert HbA 1c unauffällig Ergebnisse der Patientenschulung Der Patient kennt die korrekte Definition der Diagnose sowie die Anzeichen und Symptome einer Hypoglykämie Der Patient kennt die Dosierung der Medikament sowie deren Nebenwirkungen Der Patient regelt seinen Diätplan selbständig, beginnt mit dem Bewegungsprogramm und kann mit milden Anfällen von Hypoglykämie umgehen Der Patient und wichtige Personen aus dem Umfeld zeigen das notwendige Verständnis für die Krankheit Psychosoziale Ergebnisse Der Patient versteht die Zusammenhänge zwischen Veränderungen im Diätplan, Veränderungen des Bewegungsprogramms sowie dem Gewicht Physiologische Ergebnisse Ergebnisse der Medikation Kommentare Der Patient und die Familie haben die nötige Sicherheit in der Wahl und Zubereitung der Nahrung Der Patient geht seinem gewohnten Leben mit geringst möglichen Veränderungen nach Der Patient akzeptiert die DoDer Patient akzeptiert die DoDer Patient akzeptiert die DoPatient erkennt vor dem nächssierung sowie die Nebeneffekte sierung sowie die Nebeneffekte sierung sowie die Nebeneffekte ten Arztbesuch, ob ein neues der verschriebenen OAD Medikament notwendig ist der verschriebenen orale Anti- der verschriebenen OAD diabetika (OAD) Patient kennt ggf. die fachgePatient kennt ggf. die fachgerechte Lagerung der Medikarechte Lagerung der Medikamente mente Der Patient sollte daran erinnert werden, sich für den Notfall zu rüsten vor dem Sport eine erhöhte Menge an Kalorien zu sich zu nehmen Der Patient versteht die Zusammenhänge zwischen Veränderungen im Diätplan, Veränderungen des Bewegungsprogramms und dem Gewicht Der Patient steigert sein Wissen über die notwendigen Veränderungen der Lebensgewohnheiten mit Hilfe von Literatur, Seminaren und Selbsthilfegruppen Hat der Patient die notwendigen Kenntnisse zur Fußpflege (Vermeidung von Hornhaut und Infektionen) Initialen/Datum [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 228 Tabelle 10: Diabetes Typ II – Handlungsschema für die ambulante Versorgung Initialkonsultation Zweite Konsultation Nach 1 Monat Dritte Konsultation nach 3 Monaten Vierte Konsultation nach 6 Monate Fünfte Konsultation Nach 9 Monate Hautstatus Herz- und Lungenstatus Pulskontrolle Gewicht Blutdruck Säure-Basen-Status Einschätzung einer möglichen Hypo/Hyperglykämie Fußstatus Blutzucker Hautstatus Herz- und Lungenstatus Pulskontrolle Gewicht Blutdruck Säure-Basen-Status Einschätzung einer möglichen Hypo/Hyperglykämie Fußstatus Blutzucker HbA 1c Lipidprofil MicroalbuminurieScreening Schilddüsenwerte Hautstatus Herz- und Lungenstatus Pulskontrolle Gewicht Blutdruck Säure-Basen-Status Einschätzung einer möglichen Hypo/Hyperglykämie Fußstatus Blutzucker HbA 1c Lipidprofil MicroalbuminurieScreening Schilddüsenwerte Hautstatus Herz- und Lungenstatus Pulskontrolle Gewicht Blutdruck Säure-Basen-Status Einschätzung einer möglichen Hypo/Hyperglykämie Fußstatus Blutzucker HbA 1c Lipidprofil MicroalbuminurieScreening Schilddüsenwerte Entwicklung eines Behandlungsplans Anleitung zur eigenständigen Blutzuckerbestimmung Verhalten bei niedrigem Blutzuckerspiegel Intensität der Blutzuckerkontrollen Evtl. Überarbeitung des Behandlungsplans sowie Besprechung der Therapie Evtl. Nachbesprechung der Schulungsinhalte Analyse der vom Patienten gemessenen Blutzuckerwerte Evtl. Überarbeitung des Behandlungsplans sowie Besprechung der Therapie Evtl. Nachbesprechung der Schulungsinhalte Evtl. Überarbeitung des Behandlungsplans sowie Besprechung der Therapie Evtl. Nachbesprechung der Schulungsinhalte Jährliche Konsultation Datum Anamneseerhebung Komplette körperliche Untersuchung/ Statuserhebung: Gewicht, Körpergröße Anamnese Puls, Blutdruck Säure-Basen-Status Augenärztliche Untersuchung Fußstatus HbA 1c Blutzucker Lipidprofil MicroalbuminurieLabordiagnostik Screening und Behandlung Großes Blutbild SchilddüsenFunktionstest EKG Bedeutung von Diät und Bewegung Fußpflege Pathophysiologie des Diabetes PatientenschuMögliche Langzeitlung und Beratung Komplikationen Häusliche Glukosebestimmung Ernährungsberatung Anamneseerhebung Komplette körperliche Untersuchung / Statuserhebung: Gewicht, Körpergröße Puls, Blutdruck Säure-Basen-Status augenärztliche Untersuchung Fußstatus HbA 1c Blutzucker Lipidprofil Microalbuminuriescreening Großes Blutbild Schilddüsenfunktionstest EKG Evtl. Überarbeitung des Behandlungsplans sowie Besprechung der Therapie Evtl. Nachbesprechung der Schulungsinhalte Überprüfung der Selbstkontrolltechniken Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Evtl. Modifikation der Therapie an veränderte Blutzuckerwerte des Patienten, unter Berücksichtigung des von ihm geführten Blutzuckertagebuchs Evtl. Modifikation der Therapie an veränderte Blutzuckerwerte des Patienten, unter Berücksichtigung des von ihm geführten Blutzuckertagebuchs Evtl. Modifikation der Therapie an veränderte Blutzuckerwerte des Patienten, unter Berücksichtigung des von ihm geführten Blutzuckertagebuchs Diabetologe beim Diabetologe, wenn der Blutzuckerspiegel Auftreten von Komplikationen ≥ 400 Verzicht auf Nikotinkonsum Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe Diabetologe beim Auftreten von Komplikationen Diabetologe beim Auftreten von Komplikationen Keine Symptomatik Keine Symptomatik Blutzuckerkontrolle Keine Symptomatik Blutzuckerkontrolle Keine Symptomatik Blutzuckerkontrolle Diabetologe Bei Bedarf: Ophthalmologe Podologe Neurologe Zahnarzt Bei Frauen: Gynäkologe Keine Symptomatik Blutzuckerkontrolle Patient erweitert sein Wissen und Verständnis über Krankheit, Kontrolle und Behandlung Patient vollzieht notwendige Änderungen der Lebensgewohnheiten Akzeptanz stiegt, mit einer chronischen Krankheit zu leben Patient wird in die Therapie und den Behandlungsplan der Krankheit einbezogen Positive Änderung der Lebensgewohnheiten Patient führt die Therapie nahezu eigenständig – zusätzliche Kontrolle durch den behandelnden Arzt Patient führt die Therapie nahezu eigenständig – zusätzliche Kontrolle durch den behandelnden Arz Patient führt die Therapie nahezu eigenständig – zusätzliche Kontrolle durch den behandelnden Arz Initiation einer oralen Pharmakotherapie, sofern der Diabetes durch Diät nicht mehr adäquat behandelbar ist Medikation Diätkoordinator Physiologische Ergebnisse Psychosoziale Ergebnisse Seite 229 Ernährungsberater Bei Bedarf: Ophthalmologe Podologe Neurologe Zahnarzt Bei Frauen: Gynäkologe Minimale/ Keine Symptome einer Hypoglykämie Erhöhter Blutzuckerwert Basiswissen über die Krankheit und deren Behandlung ist vorhanden Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Patient kennt die Zeichen und Symptome von Hyperund Hypoglykämie Patient ist in der Lage, eine optimale Fußpflege durchzuführen Folgen der Patientenschulung Ergebnisse der Medikation Kommentare Patient demonstriert das fachgerechte Handling des Blutzuckermessgeräts Patient ist über die notwendige Intensität der Blutzuckerkontrollen informiert Seite 230 Sicherer Umgang mit Hypoglykämie Patient ernährt sich richtig Patient weiß, wann medizinische Hilfe aufzusuchen ist Patient versteht, dass Bewegung die Diabeteskontrolle erleichtert Patient hat grundlegende Kenntnisse über die Symptomatik und Anzeichen einer Hyper- und Hypoglykämie Patient zeigt sicheren Umgang mit einer Hypoglykämie Patient ist auf der Basis seines Behandlungsplans in der Lage, sowohl niedrige Blutzuckerwerte zu regeln als auch seinen Diätplan Patient kann mit Abweichungen vom Diätplan, z.B. bei einem Restaurantbesuch, umgehen Patient ist in der Lage, den Behandlungsplan selbständig zu modifizieren Patient zeigt sowohl für die Krankheit als auch für die Behandlung Verständnis Patient ist in der Lage, mit seinem Wissen ein adäquates Selbstmanagement der Erkrankung durchzuführen Evtl. den Gebrauch von OAD anregen Überprüfung der Medikamente Evtl. Änderung der Therapie Überprüfung der Medikamente Evtl. Änderung der Therapie Überprüfung der Medikamente Evtl. Änderung der Therapie Falls sich die orale Medikation als unzulänglich erweist, sollte eine Insulintherapie in Erwägung gezogen werden Ein solcher Krankheitsverlauf würde eine Patientenschulung über eine Insulinbehandlung nach sich ziehen Alle 3 – 6 Monate sind regelmäßige Nachuntersuchungen notwendig Initialen/ Datum [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 231 Tabelle 11: Diabetes Typ II – Handlungsschema an einem konkreten Beispiel Initialkonsultation Zweite Konsultation Nach 3 Tagen Dritte Konsultation Nach 1 Woche Vierte Konsultation nach 3 Wochen Monatliche Konsultation Abhören von Herz und Lunge Puls messen Untersuchung der Füße Entsprechend der Erstuntersuchung verfahren Gewicht Nüchternblutzucker (Glukometer) großes Blutbild Blutdruck Schilddrüsenwerte HbA 1c (alle 3 Monate) Nüchternfette Harnstatus EKG (danach jährlich) Kontrolle des Blutzuckertagebuchs bei jedem Besuch Besprechung über die Kontrolle der Krankheitstage Datum Anamnese Labordiagnostik Patientenschulung Gewicht und Körpergröße sowie Puls messen Untersuchung der Haut, Füße, Augen Untersuchung des Herzens neurologische Untersuchung Psychosoziale Einschätzung Abtasten der Schilddrüse Abhören der Lunge großes Blutbild Blutdruck Nüchternblutzucker Schilddrüsenwerte HbA 1c Nüchternfette Harnstatus Mit dem Patienten sollten Anzeichen und Symptome einer Hypo- und Hyperglykämie mögliche Langzeitkomplikationen; Diät Bewegungsplan Evtl. Gabe von OAD Inzidenz Fettleibigkeit besprochen werden Gewicht Blutdruck Nüchternblutzucker (Glukometer) EKG Gewicht Blutdruck Nüchternblutzucker (Glukometer) Gewicht Blutdruck Nüchternblutzucker (Glukometer) Mit dem Patienten sollten die Resultate der Laboruntersuchung Normwerte des Blutzuckers mögliche Nebenwirkungen der OAD besprochen werden Auffrischen der Kenntnisse, die der Patient durch den Ernährungsberater erhalten hat Aushändigen des Diabetikerpasses Mit dem Patienten sollte Rücksprache bezüglich Diät Fußpflege Blutzucker- Monitoring Gehalten werden Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Medikation / Behandlung Abwarten der Testergebnisse Diätplan und BeweFalls nötig, Korrektur des gungsprogramm einleiten, Behandlungsplans falls nötig mit zusätzlicher Gabe von OAD Falls nötig, Korrektur des Behandlungsplans Ernährungsberater Ophthalmologen Fußspezialist Zahnklinik Kontakt mit einer Therapiegruppe vermitteln P. klagt über Beschwerden von Polyurie, Polydypsie, Polyphagie und Erschöpfung Nüchternblutzucker = 162 mg/dL (Laborwert des vorherigen Besuchs = 179 mg/dL) Harnstatus = 100 mg/dL Glukose restlichen Laborwerte unauffällig P. klagt über gelegentliche Beschwerden von Polyurie und Polydypsie Nüchternblutzucker = 132 mg/dL Blutdruck unauffällig P. bestreitet Beschwerden von Polyurie, Polydypsie oder Erschöpfung Nüchternblutzucker = 109 mg/dL Blutdruck unauffällig Gewicht um 2 kg reduziert P. bestreitet Beschwerden von Polyurie, Polydypsie oder Erschöpfung Nüchternblutzucker = 129 mg/dL Blutdruck unauffällig Patient reduziert sein Gewicht weiterhin Der Patient beginnt die Therapie in seinen Alltag mit einzubeziehen Der Patient führt die Therapie nahezu eigenständig durch – zusätzliche Rücksprachen mit dem Arzt Diätkoordinator Physiologische Ergebnisse Psychosoziale Ergebnisse Patient leicht übergewichtig P. klagt über Beschwerden von Polyurie, Polydypsie, Polyphagie und Erschöpfung Unauffällig sind augenärztlicher Befund Schilddrüse Lunge und 2. Herzton Füße Blutdruck tiefe Sehnenreflexe Puls ist an allen Extremitäten tastbar Glukometer: 200 mg/dl nach 2 Stunden postprandial Seite 232 Der Patient zeigt Verständnis für die Krankheit und das Leben mit der Krankheit Diabetes Falls nötig, Korrektur des Behandlungsplans Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Ergebnisse der Patientenschulung Ergebnisse der Medikation Der Patient ist in der Lage Anzeichen und Symptome von Hypo- und Hyperglykämie mögliche Langzeitkomplikationen der Krankheit Bedeutung der Diät Bedeutung der Gewichtsreduzierung zu verbalisieren. Therapie mit Hilfe von Diät und Bewegung - falls nötig, durch Gabe von OAD unterstützen Seite 233 Der Patient weiß über die Normwerte des Blutzuckers Bescheid Der Patient hat die Bedeutung der kontinuierlichen Diät und der Gewichtsreduzierung erkannt Der Patient hat mit einem leichten Bewegungsprogramm begonnen Der Patient äußert den Wunsch zum Selbstmanagement der Krankheit – einhergehend mit einem zunehmendem Wissen über die Behandlung von Diabetes Der Patient gewinnt fortwährend neue Kenntnisse über die Behandlung Der Patient misst den Blutzuckerspiegel sowohl im Nüchternstatus als auch zwei Stunden nach der täglichen Hauptmahlzeit Therapie mit Hilfe von Diät und Bewegung - falls nötig, durch Gabe von OAD unterstützen Therapie mit Hilfe von Diät und Bewegung - falls nötig, durch Gabe von OAD unterstützen Therapie mit Hilfe von Diät und Bewegung - falls nötig, durch Gabe von OAD unterstützen Therapie mit Hilfe von Diät und Bewegung - falls nötig, durch Gabe von OAD unterstützen Kommentare Initialen / Datum [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 234 Tabelle 12: Patienteninformation für Neudiagnostizierte Diabetiker Typ II durch Symptomatik Initialkonsultation Zweite Konsultation Nach 3 Tagen Dritte Konsultation Nach 1 Woche Vierte Konsultation nach 3 Wochen Monatliche Konsultation Ihr Arzt wird Ihre Lunge und Ihr Herz abhören, Ihren Puls abtasten und Ihre Füße untersuchen. Jeden Monat wird Ihr Arzt eine vollständige körperliche Untersuchung vornehmen. Datum Anamnese Ihr Arzt wird eine vollständige körperliche Untersuchung machen Mittels Blut- und Urinprobe wird Ihr Blutzucker kontrolliert – das muss nüchtern geschehen Auch zu diesem Arztbesuch sollten Sie nüchtern erscheinen Ihr Blutzuckerspiegel wird kontrolliert Mittels eines EKG wird Ihr Herz überprüft Sie sollten vor dem Arzt- Der vierte Besuch entspricht dem dritten. besuch nichts essen, es sei denn, Sie müssen Medikamente einnehmen Eine Blutprobe wird entnommen Der Arzt wird prüfen, wie gut Ihr Behandlungsplan auf Sie abgestimmt ist und wird eventuell Veränderungen vornehmen Sie besprechen mit Ihrem Arzt die Symptome von Diabetes. Sie klären, ob es ähnliche Erkrankungen in Ihrer Familie gibt und ob Übergewicht beim Ausbruch der Krankheit mitgewirkt hat. Ihr Arzt wird mit Ihnen die Testergebnisse besprechen Bei hohen Blutzuckerwerten erhalten Sie einen Diabetes-Pass, den Sie immer bei sich tragen sollten. Ihr Arzt wird mit Ihnen über Ihr Gespräch mit dem Ernährungsberater reden. Ihr Arzt wird Sie auch über die Notwendigkeit eines Bewegungsprogramms informieren. Labordiagnostik und Behandlung Patientenschulung Ihr Arzt wird mit Ihnen über die Bedeutung der regelmäßigen Blutzuckerkontrollen zu Hause sprechen und Ihnen erklären, wo Sie ein Blutzuckermessgerät erhalten können Jeden Monat wird Ihnen eine Blutprobe entnommen Denken Sie daran, Ihre Medikamente einzunehmen Alle drei Monate wird ein großes Blutbild erstellt Einmal jährlich wird eine Blut- und Urinprobe genommen und ein EKG gemacht Ihr Arzt wird mit Ihnen Ihr Blutzuckertagebuch kontrollieren Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, wie Sie sich an Krankheitstagen verhalten sollen Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Medikation Wenn Sie einen hohen Blutzuckerwert haben, wird Ihr Arzt Ihnen ein Rezept für ein Medikament aufschreiben. Zusätzlich wird er Ihnen die möglichen Nebenwirkungen dieses Medikaments erklären Sie werden an einen Ernährungsberater überwiesen – dort besprechen Sie, welche Nahrungsmittel Sie essen dürfen und welche Sie vermeiden sollten Ihr Arzt wird prüfen, ob die Dosierung Ihrer Medikament weiterhin wirksam ist. In Abhängigkeit Ihrer Blutzuckerwerte, wird Ihr Arzt die Dosierung Ihrer Medikamente anpassen. Da Diabetes sowohl die Augen als auch die Füße angreifen kann, werden Sie an einen Augenarzt sowie einen Fußspezialisten überwiesen. Da Diabetes die Zähne und das Zahnfleisch angreifen kann, sollten Sie sich einer zahnärztlichen Untersuchung unterziehen. Ihr Arzt nennt Ihnen Adressen und Telefonnummern der Deutschen Diabetes Gesellschaft Diabetes-Selbsthilfegruppen könnten Ihnen helfen 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. Abhängig von der Blutzuckerspiegel heute und beim nächsten Besuch, werden Sie mit einer Therapie von oral einzunehmenden Medikamenten beginnen Überweisung zu anderen Ärzten Fragen und Notizen Seite 235 [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] In Abhängigkeit Ihrer Blutzuckerwerte, wird Ihr Arzt die Dosierung Ihrer Medikamente anpassen. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 236 Tabelle 13: Patienteninformation für Neudiagnostizierte Diabetiker Typ II im Routine- Screening Initialkonsultation Zweite Konsultation Nach 1 Monat Dritte Konsultation nach 3 Monaten Vierte Konsultation nach 6 Monaten Fünfte Konsultation nach 9 Monaten Sechste Konsultation nach 1 Jahr Es wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt Ihr Blutzuckertagebuch wird kontrolliert Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Zeichen und Symptome einer Unterbzw. Überzuckerung werden bewertet Es wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt Ihr Blutzuckertagebuch wird kontrolliert Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Zeichen und Symptome einer Unterbzw. Überzuckerung werden bewertet Es wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt Ihr Blutzuckertagebuch wird kontrolliert Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Zeichen und Symptome einer Unterbzw. Überzuckerung werden bewertet Einmal pro Jahr wird eine vollständige körperliche Untersuchung durchgeführt Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Ein großes Blutbild wird erstellt Sie müssen Ihren Urin abgeben Ihre Schilddrüsenwerte werden getestet Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Ein großes Blutbild wird erstellt Sie müssen Ihren Urin abgeben Ihre Schilddrüsenwerte werden getestet Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Ein großes Blutbild wird erstellt Sie müssen Ihren Urin abgeben Ihre Schilddrüsenwerte werden getestet Einmal im Jahr werden alle Ihre anfänglichen Untersuchungen wiederholt Datum Anamnese Labordiagnostik und Behandlung Es wird eine vollständige körperliche Untersuchung durchgeführt und dabei besonders auf Haut, Augen, Schilddrüse, Herz, Lunge, Puls und Füße geachtet Gewicht, Größe, Blutdruck, Puls und Atemfrequenz werden gemessen Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Es wird in einer Untersuchung besonders auf Haut, Augen, Schilddrüse, Herz, Lunge, Puls und Füße geachtet Ihr Blutzuckerwert wird bestimmt Ihr Blutzuckerwert Ein paar Blut- und Urintests sollen hel- wird bestimmt fen, die Grundlage für einen Behandlungsplan zu erstellen Ihre Schilddrüsenwerte werden getestet Sie erhalten ein EKG Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Patientenschulung Medikation Ein Ernährungsberater wird Ihnen einen Diätplan erstellen Sie bekommen erklärt, wie Sie mittels der Medikamente und Diät/Bewegung Ihren Diabetes kontrollieren können Sie werden lernen, einen niedrigen Blutzuckerwert zu erkennen und zu behandeln Sie werden die Symptome und Anzeichen einer Überzuckerung kennenlernen Sie bekommen die Krankheit samt möglichen Komplikationen nähergebracht Es wird Ihnen Ihr Blutzuckermessgerät und die Führung eines Blutzuckertagebuchs erklärt Nachdem Ihr Behandlungsplan erstellt wurde, erhalten Sie Ihre Medikamente und die notwendige Dosierung Es werden Ihnen Möglichkeiten zur Blutzuckerkontrolle aufgezeigt Seite 237 Auf der Basis der körperlichen Untersuchung, Ihrer Blutzuckerwerte sowie Ihres Tagebuchs, wird Ihr Behandlungsplan durchgeschaut und eventuell verändert. Sie besprechen mit Ihrem Arzt den Therapieverlauf Sie werden lernen, wann Sie medizinische Hilfe aufsuchen müssen Sie werden bei Bedarf die Schulungsinhalte der vergangenen Arztbesuche nacharbeiten Auf der Basis der körperlichen Untersuchung und Ihres Tagebuchs, wird Ihr Behandlungsplan durchgeschaut und eventuell verändert Sie besprechen mit Ihrem Arzt den Therapieverlauf Sie werden bei Bedarf die Schulungsinhalte der vergangenen Arztbesuche nacharbeiten Auf der Basis der körperlichen Untersuchung und Ihres Tagebuchs, wird Ihr Behandlungsplan durchgeschaut und eventuell verändert Sie besprechen mit Ihrem Arzt den Therapieverlauf Sie werden bei Bedarf die Schulungsinhalte der vergangenen Arztbesuche nacharbeiten Auf der Basis der körperlichen Untersuchung und Ihres Tagebuchs, wird Ihr Behandlungsplan durchgeschaut und eventuell verändert Sie besprechen mit Ihrem Arzt den Therapieverlauf Sie werden bei Bedarf die Schulungsinhalte der vergangenen Arztbesuche nacharbeiten Ihr Arzt wird Ihre Selbstkontrolltechniken überprüfen Eine Patienten mit Diabetes mellitus produzieren körpereigenes Insulin – die orale Medikation arbeitet mit dem körpereigenen Insulin oder mit der Produktion und Verwertung des Zuckers Sie erhalten Ihre Medikation in Abhängigkeit von Ihrem Behandlungsplan Sie erhalten Ihre Medikation in Abhängigkeit von Ihrem Behandlungsplan Sie erhalten Ihre Medikation in Abhängigkeit von Ihrem Behandlungsplan Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Überweisungen zu weiteren Ärzten Mit einem Ernährungsberater stellen Sie Ihren Diätplan auf Bei Bedarf werden an folgende Spezialisten überwiesen: Augenarzt, Fußspezialist, Neurologe, Zahnarzt, bei Frauen: Gynäkologe Treiben Sie drei mal die Woche für 30 min Sport und es wird Ihnen bei der Blutzuckerregulation helfen Falls Sie Raucher sind, wird Ihnen geholfen, das Rauchen zu beenden Falls diabetesbedingte Komplikationen auftreten, werden Sie an einen Spezialisten überwiesen Seite 238 Vielleicht haben Sie das Bedürfnis, mit anderen Betroffenen zu sprechen und wollen eine Selbsthilfegruppe aufsuchen Sie sollten mit Ihrem Falls Sie Schmerzen Sie sollten nun fünf Sport- und Ernähmal die Wochen für in den Extremitäten 30 min Sport treiben rungsplan fortfahren haben, sollten Sie Ihre Aktivitäten redu- Sie sollten auf gutes Schuhwerk und zieren Aktivitäten Socken achten Falls nötig, sollten Sie Ihren Diätplan auf Ihre Aktivitäten abstimmen [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Bei Fragen an den Ernährungsberater wird ein weiterer Beratungstermin arrangiert Sie sollten mit Ihrem Sport- und Ernährungsplan fortfahren Einmal jährlich sollten Sie sich einer augenärztlichen Untersuchung unterziehen Zusätzlich ist ein Besuch beim Fußspezialist, Neurologe, Zahnarzt, bei Frauen: Gynäkologe erforderlich Sie sollten mit Ihrem Sport- und Ernährungsplan fortfahren Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 239 Evidenzbasierte Leitlinien Von den evidenzbasierten Leitlinien existieren idealerweise drei Versionen: Expertenversion, Anwenderversion und Patientenversion. Die Expertenversion dient dem Aufbau eines Disease Management Programms als Rahmenstruktur und unterstützt in spezifischen Fragestellungen gegebenenfalls Disease Management Zirkel. Die Anwenderversion ist eine abgespeckte, für den medizinischen Alltag leicht implementierbare Version, die überwiegend Algorithmen enthält. Die Patientenversion ist inhaltlich eine aus der Experten- und Anwenderversion zusammengeführte Darstellung in einer leicht verständlichen Sprache. Folgende weiteren Disease Management Komponenten können zur Implementierung unterstützend eingesetzt werden: • Informationssysteme, wie z.B. regelmäßige Rundbriefe, die bekannte Inhalte auffrischen oder an Hand von Beispielen erklären; Online- Informationssysteme und bei Veränderungen des klinischen Zustandes gezieltes Informationsmaterial nach Risikostratifizierung; Beispielhaft sind in Tabelle 14 und Tabelle 15 dargestellt, welche Vorsichtsmaßnahmen der Patient gegen Komplikationen ergreifen kann. • Reminder können z.B. an die Inhalte des Selbstvertrags erinnern oder selbstgesteckte Ziele nach Zeitplan abfragen. • Diabeteskoordinator. Er kann zur Implementierung von Leitlinien beitragen indem er Informationsmaterial und Reminder gezielt einsetzt. • Schulung können durch die Verwendung von Arbeitsblättern für Patienten, einen Patientenselbstvertrag und die Einbindung von Familienangehörigen zur Implementierung von Leitlinienempfehlungen beitragen. Tabelle 14: Mögliche Komplikationen von Diabetes Ein hoher Blutzuckerspiegel kann nicht nur die Augen schädigen, sondern auch das Herz, die Gefäße, die Nerven, Füße und Nieren angreifen. Um das Risiko dieser Schädigungen zu minimieren, ist es besonders wichtig, den Blutzuckerspiegel im Normbereich zu halten. Zusätzlich sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden: Komplikationen Vorsichtsmaßnahmen 1. Augen (Retinopathie) • • 2. Nieren (Nepropathie) Jährliche Augenkontrolle durch einen Spezialisten (Ophthalmologe) Blutspiegel im Normbereich halten Proteinspiegel im Urin regelmäßig kontrollieren Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 240 3. Nerven (Neuropathie) Bei Schmerzen oder Taubheit in den Beiden, Füßen oder Händen sofort der Arzt konsultieren 4. Fußprobleme Tägliche Fußpflege nicht vergessen 5. Herz und Blutgefäße (Kardiopathie und Angiopathie) • • • • • 6. Sexualprobleme Gewicht im Normbereich halten Weniger Fett essen, besonders fettiges Fleisch Auf Nikotinkonsum verzichten Blutdruck im Normbereich halten Bei Atembeschwerden sowie bei Schmerzen im Nacken, in der Brust oder in den Armen sofort den Arzt konsultieren Männer Bei Männern mit Diabetes können Erektionsprobleme aufgrund einer durch hohe Blutzuckerwerte bedingte Angio- und/ oder Neuropathie auftreten. Der Verlauf ist schleichend. Frauen Frauen sind weniger von sexuellen Problemen betroffen. Ein hoher Blutzuckerwert kann vaginale Infektionen hervorrufen. Außerdem kann es zu einem verminderten Vaginalsekret kommen. Abhilfe schaffen hier Vaginalcremes. Halten Sie Ihren Blutzuckerwert in dem für Sie bestimmten Zielwert ! [Quelle: Haselbeck et al., 2001] Tabelle 15: Diabetische Neuropathie kann praktisch jeden Bereich des Körpers betreffen Diffuse (periphere) Neuropathie • • • • Beine Füße Arme Hände Diffuse (autonome) Neuropathie • • • • • Herz Verdauungssystem Sexualorgane Urogenitaltrakt Schweißdrüsen Fokale Neuropathie • • • • • • Augen Gesichtsmuskulatur Gehör Becken und Lendenbereich Oberschenkel Abdomen [Quelle: Haselbeck et al., 2001] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 241 Entscheidungsunterstützung Entscheidungsunterstützung kann im Disease Management auf vielfältige Art angeboten werden. Beispiele sind: Evidenzbasierte Leitlinien in gedruckter oder online Version, Fortbildungen, Coaching durch Experten, Computersysteme, usw. Sogenannte Disease Management Zirkel dienen der Entscheidungsunterstützung, Qualitätssicherung und der Implementierung von Leitlinien. Die Leitung sollte einem anerkannten Meinungsführer oder Peer obliegen. Es sollten sowohl Standard- wie auch Problemfälle besprochen werden. Pro Arzt sollten ca. 20– 30% der in Disease Management eingeschriebenen Patienten pro Quartal besprochen werden. Darüber hinaus hat jeder Hausarzt die Gelegenheit über Entscheidungsunterstützungssysteme wie Experten- Hotlines oder Internet Anfragen an Experten zu stellen. Weitere Möglichkeiten der Entscheidungsunterstützung wurden im Allgemeinen Teil bereits erwähnt. Folgende weiteren Disease Management Komponenten können zusätzlich eingesetzt werden: • Leitlinien in gedruckter oder Online- Version können zur Entscheidungsunterstützung für Arzt und Patient beitragen. • Fortbildungen für Ärzte sind ein effektives Mittel zur Entscheidungsunterstützung, wenn dabei einige Grundregeln beachtet werden (siehe Kapitel Ärztliche Fortbildung). Sie können sich auf medizinische und organisatorische Inhalte des Disease Management Programms beziehen. • Informationssysteme können jederzeit und unabhängig von Dritten zur Entscheidungsunterstützung herangezogen werden. Sie erfordern keine Umstellung von Organisations- und Betreuungskonzepten. • Reminder können an Leitlinienempfehlungen erinnern. • Protokolle zur Ergebnisauswertung können regelmäßig (Abbildung 9) bzw. jährlich (Abbildung 11) geführt werden. Beispielhaft ist diese Dokumentationsform in Abbildung 10 und Abbildung 12 dargestellt. Als weiteres kann ein Protokoll z.B. bei Erkrankung gesondert geführt werden (Abbildung 13). Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 242 Abbildung 9: Musterprotokoll für den Arztbesuch zu jeder Untersuchung Hat Ihr behandelnder Arzt folgende Tests gemacht und mit Ihnen zusammen die jeweilig zu erreichenden Ziele gesetzt? (Datum und Ergebnisse jeder Untersuchung in den unten stehenden Feldern notieren) Untersuchungen und Ziele Resultate Datum Blutzucker (mg/dL) (nüchtern/ postprandial) Hämoglobin A 1c: Untersuchungsergebnis Ziel (%) Hämoglobin A 1: Untersuchungsergebnis Ziel (%) Körpergewicht Ziel (Kg) Blutdruck Ziel: ___ / ___ mm HG Mikro-/ Makroalbuminurie Untersuchung der Beine (Inspektion/ Puls) Untersuchung der Füße [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Abbildung 10: Protokoll für den Arztbesuch zu jeder Untersuchung Hat Ihr behandelnder Arzt folgende Tests gemacht und mit Ihnen zusammen die jeweilig zu erreichenden Ziele gesetzt? (Datum und Ergebnisse jeder Untersuchung in den unten stehenden Feldern notieren) Untersuchungen und Ziele Resultate Datum 1.2.00 11.6.00 28.9.00 5.1.01 3.4.01 Blutzucker (mg/dL) (nüchtern/ postprandial) 145 118 180 105 110 9,0 8,0 8,9 8,0 8,4 7,5 --- 8,2 7,5 Hämoglobin A 1c: Untersuchungsergebnis Ziel (%) Hämoglobin A 1: Untersuchungsergebnis Ziel (%) Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Körpergewicht Ziel (Kg) 90 85 87,5 82,5 Seite 243 86 82,5 85 82,5 82,5 80 Blutdruck Ziel: ___ / ___ mm HG 140/90 140/86 138/84 136/82 124/80 Mikro-/ Makroalbuminurie √ √ √ √ √ Untersuchung der Beine (Inspektion/ Puls) √ √ √ √ √ Untersuchung der Füße √ √ √ √ √ [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Abbildung 11: Musterprotokoll für die jährlichen Untersuchungen (mind. einmal pro Jahr durchzuführen) Hat Ihr behandelnder Arzt folgende Tests gemacht und evtl. mit Ihnen zus. einige Ziele gesetzt? (Datum und Ergebnisse jeder Untersuchung in den unten stehenden Feldern notieren) Untersuchungen und Ziele Datum und Resultate Körperliche Untersuchung (einschließlich Körpergröße) Technische Untersuchungen (z.B. Sono o.B., EKG pathol.) Blutkreatinin (mg/dL) Cholesterol (mg/dL) HDL Cholesterol (mg/dL) LDL Cholesterol (mg/dL) Triglyceride (mg/dL) Nikotinkonsum Augenärztliche Untersuchung Periphere/ Autonome Neuropathie [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 244 Abbildung 12: Protokoll für die jährlichen Untersuchungen (mind. einmal pro Jahr durchzuführen) Hat Ihr behandelnder Arzt folgende Tests gemacht und evtl. mit Ihnen zus. einige Ziele gesetzt? (Datum und Ergebnisse jeder Untersuchung in den unten stehenden Feldern notieren) Untersuchungen und Ziele Datum und Resultate Körperliche Untersuchung (einschließlich Körpergröße) 2.10.98 20.10.99 1.11.00 Technische Untersuchungen (z.B. Sono o.B., EKG pathol.) 2.10.98 Sono o.B. 20.10.99 1.11.00 Sono EKG o.B.. pathol Blutkreatinin (mg/dL) 1,0 1,2 1,1 Cholesterol (mg/dL) 190 180 175 HDL Cholesterol (mg/dL) 30 35 40 LDL Cholesterol (mg/dL) 150 140 135 Triglyceride (mg/dL) 338 300 250 Nikotinkonsum 5 Ziga2 Zigaretretten am ten Tag 0 Augenärztliche Untersuchung 8.11.98 1.10.99 20.10.00 Periphere/ Autonome Neuropathie 2.10.98 20.10.99 1.11.00 [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Abbildung 13: Protokoll für Krankheitstage Zeitpunkt Fragestellung Antwort Jeden Tag Gewicht ? ___________ kg Jeden Abend Trinkmenge ? ___________ ml Jeden Morgen und Jeden Abend Temperatur ? Morgens __________ °C Abends __________ °C Alle vier Stunden oder Vor jeder Mahlzeit Medikamentendosis ? Zeitpunkt ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Dosis ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 245 Alle vier Stunden oder Vor jeder Mahlzeit Blutzuckerwert ? Zeitpunkt ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Wert ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Alle vier Stunden oder Vor jedem Urinieren Ketonwert im Urin ? Zeitpunkt ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Wert ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Alle vier bis sechs Stunden Atmung ? Zeitpunkt ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Kondition ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Selbsthilfe- Gruppen Eine vermehrte Einbindung von Selbsthilfegruppen kann hinsichtlich Schulungen und Informationsvermittlung sinnvoll sein, da Patienten von Gleichbetroffenen Informationen eher annehmen und umsetzen. Eine flächendeckende Versorgung besonders in ländlichen Gebieten ist anzuraten. Im übrigen sind diese funktionellen Gruppen ein wichtiger Beitrag für das öffentliche Gesundheitswesen und könnten einen bedeutenden Beitrag im System für Prävention und Rehabilitation darstellen. Folgende weiteren Disease Management Komponenten können zusätzlich eingesetzt werden, um die Effekte der Selbsthilfegruppe zu unterstützen: • Schulung. Die Einbindung von Selbsthilfegruppen in Schulungskonzepte hat sich als sehr effektiv erwiesen (siehe Kapitel Schulung). Reminder Die Reminder– Systeme werden in einem eigenen Kapitel abgehandelt. Sie sollten im Disease Management Diabetes als spezifische Reminder für Ärzte und Patienten zum Einsatz. Patienten können beispielsweise mittels telefonischen oder postalischen Remindern an Untersuchungstermine, Selbstmanagementverhalten wie Fußinspektion u. ä. erinnert werden. Für Ärzte können Reminder Therapieabweichungen, Abweichungen des Therapieergebnisses vom Zielwert (z.B. HbA1c) oder Erinnerun- Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 246 gen an noch durchzuführende Interventionen sein. Zielwertabweichungen können beispielsweise im patientenindividuellen Quartalsbericht aufgeführt werden. Gute Erfahrungen bestehen auch mit dem Ausdruck einer Liste in sechs- wöchigen Intervallen, die alle Patienten, deren HbA1c nicht im Zielbereich liegt, namentlich aufführen. Am wirkungsvollsten sind Reminder, die eine aktive Reaktion des Arztes erfordern. z.B. das Wegklicken eines computergestützten Reminders oder eine schriftliche kurze Stellungnahme bei Anwendung von Second- line Medikamenten. Folgende weitere Disease Management Komponenten können zusätzlich eingesetzt werden, um die Effekte von Remindern zu unterstützen: • Diabetes- Koordinator. Er kann zur Steuerung des Remindersystems eingesetzt werden und zusätzlich spezifische Informationen postalisch oder telefonisch anbieten (Abbildung 14). • Informationssysteme können zur Erklärung von Untersuchungen und ihrer Bedeutung im Therapiekonzept die Compliance mit den Remindern unterstützen. • Fragebögen des Patienten an den Arzt, können die evidenzbasierten Therapieinhalte unterstützen (Abbildung 15). Abbildung 14: Untersuchungen, die mindestens einmal pro Jahr wahrgenommen werden sollten Grippeimpfung (Oktober bis Mitte November) Pneumokokken-Impfung (falls noch keine Impfung vorliegt) Komplette körperliche Untersuchung Technische Untersuchung (z.B. Sono, EKG) augenärztliche Untersuchung Untersuchung bei einem Fußspezialisten (inklusive Kontrolle der Zirkulation und Nerven) Untersuchung der Nieren Albumintest (Urintest) Messung des Blutkreatinin 24h-Urintest (bei Anordnung durch den behandelnden Arzt) Untersuchung der Blutfette Cholesterin HDL = High-density Lipoprotein LDL = Low-density Lipoprotein Triglyceride zahnärztliche Untersuchung (mindestens zwei mal pro Jahr) Besprechung mit dem behandelnden Arzt über den Zustand bei niedrigen Blutzuckerspiegel Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 247 die Behandlung von hohen Blutzuckerwerten den Gebrauch von Tabak (Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Schnupftabak) den emotionalen Umgang mit der Krankheit Diabetes Bei Frauen im gebärfähigen Alter: Schwangerschaftsplanung Sonstiges [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Abbildung 15: Fragebogen Fragen, die Sie Ihrem Arzt über die Blutzuckerkontrolle stellen sollten Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Diabetes-Patienten, die ihren Blutzuckerspiegel so nahe wie möglich am Normwert aufrechterhalten, die Risiken für Schäden an Augen, Nieren und Nerven reduzieren können. Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt, wie Sie Ihre Blutzuckerkontrolle verbessern können. Die Fragen sollten folgende Punkte enthalten: Wie oft und unter welchen Bedingungen sollte ich meinen Blutzuckerspiegel kontrollieren? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Was sollte ich mit den Resultaten machen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Welche Ergebnisse sollte ich erreichen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Wo lag mein Durchschnittswert in den vergangenen 2 bis 3 Monaten (HbA 1c)? _________________________________________________________________________________ Wo hoch ist der Normwert von HbA 1c? _________________________________________________________________________________ Wie bringe ich meinen HbA 1c in den Normbereich? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Sollten Veränderungen in meinem Behandlungsplan vorgenommen werden? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Welche Auswirkungen kann Diabetes auf meine Augen haben? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Wie häufig sollte ich zur augenärztlichen Kontrolle gehen? Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 248 _________________________________________________________________________________ Welche Schäden kann Diabetes bei den Nieren hervorrufen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Habe ich Albumin im Urin, Zeichen einer beginnenden diabetischen Nephropathie (Mikroalbuminurie)? _________________________________________________________________________________ Wie sollte meine Fußpflege aussehen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Wann sollte ich einen Ernährungsberater aufsuchen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Welche Form der körperlichen Betätigung ist für mich persönlich am besten? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Welche Veränderungen in der Ernährung und der Insulingabe sollte ich notwendiger Weise vor dem Sport vornehmen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Was sollte meine Familie / Freunde im Falle einer Unterzuckerung machen? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Gibt es in meiner Umgebung Selbsthilfegruppen zum Thema Diabetes? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Für Frauen im gebärfähigen Alter: Welche Veränderungen in meinem Behandlungsplan müssen im Falle einer Schwangerschaft vorgenommen werden? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Health & Administration Development Group, Aspen, 1999] Benchmarkingdatensatz Der Benchmarkingdatensatz wird im Kapitel Qualitätssicherung beschrieben. Er dient in erster Linie der Koordination, Steuerung des Disease Management sowie der Qualitätssicherung. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 249 Folgende weitere Disease Management Komponente könnte in enger Verzahnung zusätzlich eingesetzt werden: • Datenbanken zur Speicherung und Evaluation der Inhalte des Benchmarkingdatensatzes im Rahmen des Datenschutzes. Die Komponenten des Basismoduls erhält jeder Diabetiker, unabhängig von der Management– Gruppe, nach Bedarf. Die Einordnung in die Management– Gruppe richtet sich nach den klinisch- biochemisch erhobenen Daten. Jeder bekannte Diabetiker, der neu eingeschrieben wird, kann bei Erreichen aller Zielwerte in die Management– Gruppe 1 aufgenommen werden. Das bedeutet, dass seine Blutglukosewerte und sein HbA1c- Wert, seine Lipidwerte sowie seine Retentionswerte im Normbereich liegen und bei der körperlichen Untersuchung kein Hinweis auf diabetische Komplikationen oder Begleiterkrankungen, kein Hinweis auf Hypertonie, kein Hinweis auf Raucherstatus oder ein BMI über ≥ 25 kg / m2 gefunden wurde. Ist nur einer dieser Befunde nicht im Normbereich, so wird der Diabetiker in die Management– Gruppe 2 eingeordnet und erhält entsprechend seinem spezifischen Risiko in Ergänzung zu dem Basismodul das Ergänzungsmodul - Spezifische Therapie. 11.5Ergänzungsmodule Ergänzungsmodul Spezifische Therapie Zu den Ergänzungsmodulen Spezifische Therapie – Risikofaktoren gehören die Module Rauchen, Adipositas/ Lipidstörung und Hypertonie. Den möglichen Einsatz von Komponenten des Disease Management zur Unterstützung einer evidenzbasierten Therapie zeigt Abbildung 16. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 250 Abbildung 16: Unterstützung der Module Spezifische Therapie durch Komponenten des Disease Managements Ergänzungsmodule Spezifische Therapie: Risikofaktoren Risiko Lipidstörung/ Adipositas Risiko Rauchen DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Informationssysteme - Selbsthilfegruppen - Krankheitskoordinator - Remindersysteme - Schulung DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Schulung - Informationssysteme - Evidenzbasierte Leitlinie - Remindersysteme - Krankheitskoordinator Risiko Hypertonie DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Schulung - Evidenzbasierte Leitlinie - Informationssysteme - Remindersysteme - Krankheitskoordinator Legende: *DMP: Disease Management Programm [Quelle: Eigene Darstellung] (1) Risiko: Rauchen Eine wichtige Komponente einer gesunden Lebensweise ist der absolute Nikotinverzicht. Im Disease Management können unterschiedliche Komponenten zur Unterstützung von Patient und Arzt eingesetzt werden (Tabelle 16). Tabelle 16: Komponenten zur Unterstützung von Patient und Arzt im Disease Management Komponente Beispiel Schulung Schulungen vermitteln evidenzbasierte Inhalte, können Leitlinien in Form von Arbeitsblättern und Algorithmen implementieren und einen Patientenselbstvertrag mit selbstgesteckten Zielen benutzen. Informationssysteme Informationssysteme können zur Information des Patienten als audiovisuelle Materialien eingesetzt werden Selbsthilfegruppen Da Patienten von Gleichbetroffenen eher Informationen annehmen und akzeptieren, ist die Anbindung an Selbsthilfegruppen zur Stabilisierung wünschenswert Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinator könnte in diesem Fall ein CallCenter wahrnehmen. Dazu gehören beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung nach Bedarf und telefonische Reminder Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Remindersysteme Seite 251 Postalische oder telefonische Reminder können Patienten an Schulungsinhalte, selbstgesteckte Ziele oder Inhalte des Patientenselbstvertrags erinnern [Quelle: Eigene Darstellung] (2) Risiko: Lipidstörungen (Adipositas) Diagnose der Hyperlipidämien Die nachfolgend genannten, bei der Diagnostik von Fettstoffwechselstörungen zu berücksichtigenden Kriterien, lehnen sich an die Empfehlungen der Amerikanischen Diabetes Gesellschaft [ADA, 2001], European Atherosclerosis Society [Pyöräla et al.,1994; Wood et al., 1998], Nationale Cholesterin- Initiative [Assmann und Cullen, 1995], Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen [1996] und des National Cholesterol Education Program [NCEP, 1993] an: Bei Patienten mit Glukoseintoleranz / Diabetes sollte in 3- bis 6-monatigen Abständen ein Lipidprofil im Nüchternserum erstellt werden, mit den Konzentrationsbestimmungen in mg/dl von: • Gesamtcholesterin (Chol.ges) • HDL-Cholesterin (HDL-C) • Triglyzeriden • LDL-Cholesterin (LDL-C) errechnet sich aus der Formel nach Friedewald: LDL-C (mg/dl) = Chol ges (mg/dl) minus HDL-C (mg/dl) minus TG/5 (mg/dl) Die so errechneten LDL- Werte sind bei TG- Werten bis zu 400 mg/dl zuverlässig. Bei Diagnosestellung einer Hyperlipidämie sind die in Tabelle 17 aufgeführten Zielwerte schnellstmöglich anzustreben. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 252 Tabelle 17: Therapieziele* für Diabetiker mit Fettstoffwechselstörungen unter Berücksichtigung des Globalrisikos für Makroangiopathie Risiko Zielwerte* Diabetiker ohne manifeste makrovaskuläre Erkrankung Chol ges < 200 mg/dl, LDL-C < 130 mg/dl, HDL-C ≥ 35 mg/dl NüTG < 150 mg/dl Diabetiker mit makrovaskulärer Erkrankung Chol ges. < 170 mg/dl, LDL- C < 100 mg/dl, HDL- C > 40 mg/dl, NüTG < 150 mg/dl Diabetiker mit Triglyzeridwerten > 1000 mg/dl Durch Akuttherapie: TG: bis 400 mg/dl Unter Dauertherapie: NüTG < 150 mg/dl Chol ges : LDL-C: HDL-C: NüTG: TG: Gesamt-Cholesterin Low-density-lipoprotein-Cholesterin High-density-lipoprotein-Cholesterin Nüchtern-Triglyzeride Triglyzeride Umrechnungsfaktoren von mmol/l in mg/dl: Cholesterin: mmol/l x 38,67 = mg/dl Triglyzeride: mmol/l x 87,5 = mg/dl [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ADA, 2001; NCEP Adult Treatment Panel II, 1993; Nationale Cardiovaskuläre Initiative [Assmann und Cullen, 1995]] Beispiele zum unterstützenden Einsatz von Disease Management Komponenten sind in Tabelle 18 ausgeführt. Tabelle 18: Unterstützender Einsatz von Disease Management Komponenten Komponente Beispiel Therapie und Leitlinien (evidenzbasiert) Die evidenzbasierte Therapie sollte für Arzt und Patient in eigenen Leitlinien an Hand von strukturierten Algorithmen dargestellt werden und durch Fortbildungen und Reminder unterstützt werden, um erfolgreich zu sein [Patel et al. 2001, Casebeer et al. 1999, Keyserling et al. 1997]. Für den Patienten sollten Ursachen, Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten einfach und verständlich beschrieben werden (siehe Abbildung 17). Informationssysteme Dazu gehören u.a. spezifische Broschüren, regelmäßige Rundbriefe für die Patienten mit neuesten Forschungsergebnissen, Rezepten und Restaurantvorschlägen in der näheren Umgebung oder Online- Informationssysteme Schulung Sie kann eine Ernährungsberatung, einen Patientenselbstvertrag [Schlenk et al., 1998] und Arbeitsmaterialien zur Vertiefung des Gelernten umfassen. Die Schulung sollte für ältere Patienten speziell zugeschnitten werden [Brown 1990 und 1992; Buhk et al., 2001; Hirsch et al., 1992]. Schulungen können beispielsweise auch mit einem telefonischem Follow- up sowie Hausbesuchen kombiniert werden [Estey et al. 1990]. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 253 Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinators könnte in diesem Fall ein CallCenter wahrnehmen. Beispielsweise berichtet Piette über eine Zunahme der Cholesterinuntersuchungen durch die Betreuung mittels Call- Center [Piette et al., 2001; Estey et al. 1990]. Neben telefonischen Remindern kann beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung nach Risikostratifizierung vom Call- Center angeboten werden. Beispielsweise können Patienten an Termine zur Untersuchung der Blutfette erinnert werden, spezielle Informationsmaterialien zugeschickt werden, Kontakte zu geeigneten Sportgruppen können vermittelt werden. Insbesondere eine Kombination von Schulung und individualisiertem Follow- up durch einen Koordinator zeigt gute Erfolge [D’Eramo-Melkus et al. 1992] Remindersysteme Postalische oder telefonische individuell zugeschnittene Reminder können Patienten an Untersuchungstermine, Schulungsinhalte, selbstgesteckte Ziele oder Inhalte des Patientenselbstvertrags erinnern. Beispielsweise werden individuell nach Risikostratifizierung auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Reminder doppelt so häufig ins Bewusstsein aufgenommen und führen häufiger zu einer signifikanten Reduktion des Fettkonsums [Campbell et al. 1994] Selbsthilfegruppen Die Unterstützung durch Gleichbetroffene kann insbesondere zur Gewichtsreduktion beitragen [Wilson et al. 1987] [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 254 Abbildung 17: Flussdiagramm „Adipositasprävention und –therapie“ Folgende Zielbereiche sind anzustreben (WHO): BMI 18.5 – 24.9 kg/m², für Männer: Taillenumfang ≤ 94 cm, für Frauen: Taillenumfang ≤ 80 cm. Grad der Gesundheitsgefährdung Normalgewicht (BMI 18.5-24.9) Normalgewicht (BMI 18.524.9) plus Risikofaktor und/oder Komorbidität Präadipositas (BMI 25-29.9) Präadipositas (BMI 25-29.9) plus Risikofaktor und/oder Komorbidität Adipositas Grad I (BMI 30-34.9) Adipositas Grad I (BMI 3034.9) plus Risikofaktor und/oder Komorbidität Ziel Maßnahmen (unter Berücksichtigung von Kontraindikationen und Einbindung des Patienten in die Therapiewahl) Gewichtsstabilisierung Ggf. Gewichtsmonitoring Gewichtsstabilisierung, bei familiärer Prädisposition Gewichtszunahme >3kg verhindern. RisikofaktorenManagement, z.B. Aufgabe des Rauchens; gesunder Lebensstil Gewichtsmonitoring, RisikofaktorenManagement, Therapie der Komorbidität, Beratung zu gesundem Lebensstil1 Verhinderung einer weiteren Gewichtszunahme, besser noch Gewichtsreduzierung Basisprogramm2 Dauerhafte Gewichtsreduzierung (v.a. bei mäßigem Erfolg des Risikofaktoren-Managements nach 3 Monaten): 5-10% Gewichtsabnahme in 3-6 Mo und nachfolgende Gewichtsstabilisierung Basisprogramm2, RisikofaktorenManagement2, Therapie der Komorbidität2,3 Dauerhafte Gewichtsreduzierung um 5-10% Basisprogramm2, Dauerhafte Gewichtsreduzierung um 5-10% 1) Basisprogramm2, RisikofaktorenManagement2, Therapie d. Komorbidität2,3 2) Wenn kein Erfolg, frühestens nach 12 Wochen zusätzliche medikamenöse Therapie erwägen Adipositas Grad II (BMI 35-39.9) Dauerhafte Gewichtsreduzierung um ≥10% und -stabilisierung Basisprogramm2 Adipositas Grad II (BMI 3539.9) plus Risikofaktor und/oder Komorbidität Dauerhafte Gewichtsreduzierung um 10-20% und -stabilisierung 1) Basisprogramm2, RisikofaktorenManagement2, Therapie der Komorbidität2,3 2) Wenn kein Erfolg, frühestens nach 12 Wochen zusätzliche medikamentöse Therapie erwägen 3) Bei erfolgloser konservativer Therapie chirurgische Maßnahmen erwägen Adipositas Grad III (BMI>40) Dauerhafte Gewichtsreduzierung um 10–30% 1) Basisprogramm2, RisikofaktorenManagement2, Therapie der Komorbidität2,3 2) chirurgische Therapie bei erfolgloser konservativer Therapie erwägen2,3 Wie unter „Methodik“ beschrieben wurden Interventionsstudien evaluiert und mit Evidenzklassen (I bis IV) gemäß ihrer wissenschaftlichen Aussagekraft belegt. Die ausgesprochenen Handlungsemfehlungen der Grade A bis C wurden anhand der Evidenzklassen gewichtet. Für das stufenweise Vorgehen beim Übergewicht und einzelner Grade der Adipositas sowie beim Management von Risikofaktoren dienten Empfehlungen der SIGN (1996), des Royal College of Physicians (1997) und der WHO (1998). 1 ) Gesunder Lebensstil entspricht im wesentlichen dem Basisprogramm 2 ) Detaillierte Erläuterungen siehe nächste Seite 3 ) Ggf. Überweisung an einen Spezialisten (z.B. auf Adipositas spezialisierter Diabetologe oder Chirurg) [Quelle: Hauner et al., 1998: Adipositas- Leitlinie, Version für den behandelnden Arzt] Bewegungsprogramm Das Bewegungsprogramm sollte in das Gewichtsmanagement integriert sein. In Abstimmung mit dem Gesundheitszustand und den Präferenzen des Patienten sollte ein angemessenes Bewegungsprogramm ausgearbeitet werden (z.B. gemäß den Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 255 Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie [1997], der European Society of Cardiology [1994] und der American Heart Association [1996]). Dieses sollte auch nach Erreichen des Zielgewichts zur Erhaltung der Gewichtskonstanz beibehalten werden. Zielwert sollte 5- 6 Stunden Bewegung pro Woche sein. Mögliche Komponenten: • Ein Minimum von 30 min mäßig intensiver Bewegung 3- 4 mal wöchentlich (z.B. Gehen, Radfahren) • Aktivere Lebensweise (z.B. Spazierengehen in Arbeitspausen, Treppensteigen statt Aufzug, Gehen statt Auto-/ Bus-/ Bahnfahren, Gartenarbeit) • Ggf. Teilnahme an ärztlich überwachten Übungsgruppen • Diabetes gerechte lipidsenkende Kost [ADA,1998; Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, 1996; Nationale Cardiovaskuäre Initiative,1995, Lipid-Liga, 1996] Die Ernährungstherapie des Diabetes Mellitus sollte individuell an die Bedürfnisse des Patienten, seine Stoffwechsellage und die diabetesspezifischen Organveränderungen angepasst werden. Empfehlungen zur Nährstoffrelation sollten sich nach den Prinzipien einer gesunden Ernährung orientieren. Diese soll kaloriengerecht sein und individuell zu vereinbarende Therapieziele für Blutzucker, Serumlipide, Blutdruck und Körpergewicht berücksichtigen. Es empfiehlt sich eine Analyse der Ernährungsgewohnheiten des Patienten. Generelle Eckpunkte einer lipidsenkenden Ernährungstherapie sind: • Beschränkung der Gesamtfettmenge • Verringerung des Verzehrs von Fetten mit gesättigten Fettsäuren • Beschränkung des täglich aufgenommenen Nahrungscholesterin • Bei Übergewicht empfiehlt sich eine Reduktion der Gesamtkalorienzahl. Sowohl Übergewicht als auch Hypertriglyzeridämie sprechen gut auf diese Maßnahme an. Unter Umständen ist der Konsum von Alkohol mit seiner unerwünschten VLDL- Synthese bei gleichzeitiger Hemmung der Lipoproteinlipase einzuschränken. Es empfiehlt sich die Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte: • Abschätzen der erforderlichen täglichen Gesamtenergiemenge • Verteilung der abgeschätzten Gesamtenergiemenge auf ca. 6 Mahlzeiten/ d Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus • Seite 256 Ballaststoffreiche Nahrung mit möglichst geringem Verarbeitungsgrad und geringem Anteil rasch resorbierbarer Kohlenhydrate • Anteilige Zusammensetzung der Gesamtenergiemenge: - 25 - 35% als Fett, dabei gesättigte Fette < 10%; bei Patienten mit Übergewicht sollte eine diabetesgerechte Reduktionskost mit vorwiegender Minderung des Gesamtfettgehaltes < 25-35% der Nahrung angeraten werden. - Gesamtcholesteringehalt < 300mg/die, weitere Reduktion auf < 200mg/die könnte eine weitere Absenkung von Cholges und LDL- C ermöglichen - 50 - 60% vorwiegend komplexe Kohlenhydrate mit hohem Anteil löslicher Ballaststoffe - <15% Eiweiß (1,0g/kg KG*) *KG = Körpergewicht - Beschränkung von bzw. Verzicht auf Alkohol und freien Zucker Die Anwendung von Fischöl hat keinen störenden Einfluss auf den Glukosestoffwechsel. Es senkt den Triglyzeridspiegel bis zu 30%. Allerdings geht dieser Effekt mit einem leichten Anstieg des LDL einher [Friedberg et al., 1998]. Gewichtsreduzierung Die Gewichtsreduzierung ist von großer Bedeutung, da nicht zuletzt durch die Nurses‘ Health Study ein Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Entwicklung eines Typ 2- Diabetes eindrucksvoll dokumentiert wurde [Colditz et al., 1990a, 1995]. Die Entwicklung des Typ 2- Diabetes wird vor allem von der stammbetonten Adipositasform gefördert. Speziell die abdominelle Adipositasform wird bei entsprechender genetischer Disposition als pathogenetischer Promotor für die Manifestation des Metabolischen Syndroms angesehen [Ohlson et al., 1985]. Das klinische Vollbild des Metabolischen Syndroms ist durch ein Bündel gemeinsam auftretender Gefäßrisikofaktoren charakterisiert. Diese sind neben Übergewicht mit abdomineller Fettverteilung und pathologischer Glukosetoleranz, Insulinresistenz, Hypertonie und Dyslipoproteinämie mit erniedrigtem HDL- Cholesterin und Hypertriglyzeridämie. Bei vermehrter intraabdomineller Fettmasse ist die Beziehung zwischen Triglyceriderhöhung und HDL- Cholesterinerniedrigung ausgeprägter [Despres, 1991]. Je stammbetonter die Fettverteilung ist, desto niedriger ist das HDL2- Cholesterin, eine HDL- Fraktion mit besonders antiatherogener Wirkung [Ostlund et al., 1990]. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 257 Der günstige Einfluss von Gewichtsmanagementprogrammen auf Fettstoffwechselstörungen ist hinreichend bekannt [Andersen et al., 1999; Lean et al., 1997]. Die Grundlage des Gewichtsmanagements bei Diabetikern entspricht dem Basisprogramm für nichtdiabetische Übergewichtige, dessen Hauptkomponente eine Verhaltensmodifikation mit den Schwerpunkten Ernährungs- und Bewegungstherapie ist. Abbildung 18: Stufenplan lipidsenkender Maßnahmen beim Diabetes Mellitus Kombinationsbehandlung Pharmakologische Monotherapie Optimierung des Glukosestoffwechsels, Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, Steigerung der körperlichen Aktivität [Quelle: In Anlehnung an Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, 1996] Ein entsprechendes Therapieschema hierzu ist im Anhang aufgeführt. (3) Risiko: Hypertonie Definition und Klassifikation Von der WHO/ ISH und der JNC wurde folgende Definition für das Vorliegen eines Bluthochdrucks gegeben: Ein Bluthochdruck besteht bei Erwachsenen (≥18 Jahre), die nicht antihypertensiv vorbehandelt sind, wenn folgende Blutdruckwerte bei mehrfacher Messung an mindestens zwei verschiedenen Tagen vorliegen [Chalmers, 1999; JNC VI, 1997]: Systolischer Blutdruck: ≥ 140 mmHg und / oder diastolischer Blutdruck: ≥ 90 mmHg Die World Health Organisation, die International Society of Hypertension sowie das Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure haben in ihren Definitionen der Hypertonie und ihrer Einteilung in Kategorien den Begriff "hochnormaler Blutdruckbereich" neu eingeführt. Danach gelten Per- Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 258 sonen mit Blutdruckwerten von systolisch 130 ≤ 140 mmHg und diastolisch 85 ≤ 90 mmHg nicht als Hypertoniker, sondern sie haben ein erhöhtes Risiko, eine definitive arterielle Hypertonie mit entsprechenden kardiovaskulären Folgeschäden zu entwickeln und sollten daher fortlaufend kontrolliert werden [Chalmers, 1999; JNC VI, 1997]. Bei Stellung der Diagnose Hypertonie sind schnellstmöglich ohne Beeinträchtigung der Lebensqualität nachfolgende Blutdruckwerte zu erreichen. Tabelle 19: Therapiezielbereiche für den Blutdruck bei Diabetikern Problematik Blutdruck- Zielbereiche Systolisch (mmHg) Diastolisch (mmHg) Diabetiker mit essentieller Hypertonie unter 140 unter 85 Bei guter Verträglichkeit eines RR von 140/85 mmHg unter 130 unter 80 Diabetiker mit Mikroalbuminurie unter 130 unter 80 Und/ oder Manifester Nephropathie besser noch 120 [Quelle: DDG, 2000] Die Vorgehensweise in der Wahl der Therapieoptionen und die Dosierungshöhe hängt maßgeblich von Begleiterkrankungen bzw . Kontraindikationen ab. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 259 Antihypertensive Therapiemöglichkeiten Tabelle 20: Antihypertensive Therapiemöglichkeiten Nichtmedikamentöse Therapie Strukturierte Schulung Änderung der Lebensgewohnheiten Bevorzugte, wissenschaftlich evaluierte Therapiemöglichkeiten: • Diuretika • Beta- Rezeptorenblocker • ACE- Hemmer • Kalziumantagonisten Medikamentöse Therapie Weitere medikamentöse Therapiemöglichkeiten: • Alpha- Rezeptorenblocker • AT1– Rezeptorantagonisten Weitere Substanzen, z. B. Alpha-2- Rezeptoragonisten [Quelle: Eigene Darstellung] In Abhängigkeit von der Risikostratifizierung können zur Unterstützung des Moduls Risiko Hypertonie unterschiedliche Disease Management Komponenten zum Einsatz kommen (Tabelle 21). Tabelle 21: Disease Management Komponenten zur Unterstützung des Moduls Hypertonie Komponente Beispiel Therapie und Leitlinien (evidenzbasiert) Die evidenzbasierte Therapie sollte für Arzt und Patient in eigenen Leitlinien an Hand von Algorithmen dargestellt werden. Für den Patienten sollten Ursachen, Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten einfach und verständlich beschrieben werden. Informationssysteme Dazu gehören u.a. spezifische Broschüren und regelmäßige Rundbriefe für die Patienten Schulung Sie kann eine Ernährungsberatung, einen Patientenselbstvertrag und Arbeitsmaterialien zur Vertiefung des Gelernten umfassen Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 260 Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinators könnte in diesem Fall ein CallCenter wahrnehmen. Dazu gehören beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung nach Risikostratifizierung sowie telefonische Reminder. Beispielsweise könnten Patienten in Abhängigkeit von der Blutdruckeinstellung täglich, wöchentlich oder monatlich nach ihren Blutdruckwerten befragt werden. Aufgrund von Abweichungsanalysen kann dann eine Beratung durch einen Arzt des Call- Centers, die Zusendung von spezifischen Informationsmaterialien oder eine Terminvereinbarung beim Hausarzt vorgenommen werden Remindersysteme Postalische oder telefonische Reminder können Patienten an Untersuchungstermine, Schulungsinhalte, selbstgesteckte Ziele oder Inhalte des Patientenselbstvertrags erinnern [Glanz et al., 1982; Macharia et al., 1992; Stason et al., 1994; Johnston et al., 1994]. Computergestützte Reminder zur Identifizierung von schlecht eingestellten Hypertonikern können Ärzte in der Therapie unterstützen und zu einer besseren Blutdruckeinstellung beitragen [Dickinson et al., 1981] [Quelle: Eigene Darstellung] Patienten, die zum Zeitpunkt der Einschreibung eine diabetische Komplikation und/ oder Begleiterkrankung aufweisen, werden der Management– Gruppe 3 zugewiesen. Im Gegensatz zu den Gruppen 1 und 2 ist eine horizontale Mobilität nicht möglich. Patienten, die einmal in Gruppe 3 zugeordnet wurden, verbleiben in dieser Gruppe. Das Gleiche gilt für Diabetiker, die aus den Gruppen 1 oder 2 in diese Gruppe gewechselt haben. 11.6Ergänzungsmodul - Komplikationstherapie Zu den Ergänzungsmodulen Spezifische Therapie– Komplikationstherapie gehören die diabetische Retinopathie, die diabetische Nephropathie, die diabetische Neuropathie und das diabetische Fußsyndrom. Zur Unterstützung und Umsetzung der evidenzbasierten Therapiemodule werden Disease Management Komponenten eingesetzt. Mögliche Kombinationen zeigt folgende Abbildung: Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 261 Ergänzungsmodule Spezifische Therapie: Komplikationstherapie Diabetische Retinopathie DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Informationssysteme - Remindersysteme - Evidenzbasierte Leitlinien - Ggf. Diabeteskoordinator - Selbsthilfegruppen bei Erblindung Diabetische Nephropathie DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Informationssysteme - Remindersysteme - Evidenzbasierte Leitlinien - Ggf. Diabeteskoordinator - Selbsthilfegruppen bei Erblindung Diabetische Neuropathie DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Informationssysteme - Remindersysteme - Evidenzbasierte Leitlinien - Ggf. Diabeteskoordinator - Selbsthilfegruppen bei Erblindung Diabetisches Fußsyndrom DMP-Komponenten*: - evidenzbasierte Therapie - Informationssysteme - Remindersysteme - Evidenzbasierte Leitlinien - Ggf. Diabeteskoordinator - Selbsthilfegruppen bei Erblindung Abbildung 19: Einsatz von Disease Management Komponenten im Rahmen der Ergänzungsmodule Spezifische Therapie – Komplikationstherapie *DMP: Disease Management Programm [Quelle: Eigene Darstellung] (1) Diabetische Retinopathie/ Makulopathie Die diabetische Retinopathie ist unterteilt in eine nichtproliferative und proliferative Form. In den nachfolgenden Übersichten sind diese Formen dargestellt. Nichtproliferativ Stadium Klinisches Bild Mild Mikroaneurysmen Mäßig Mikroaneurysmen, einzelne intraretinale Blutungen, perlschnurartige Venen Schwer (früher: „präproliferativ“) „4-2-1“- Regel: Zahlreiche Mikroaneurysmen und intraretinale Blutungen in 4 Quadranten Oder perlschnurartige Venen in 2 Quadranten oder intraretinale mikrovaskuläre Anomalien (IRMA) in 1 Quadrant [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 262 Proliferativ Papillenproliferation Papillenferne Proliferation Präretinale Blutung Traktionsbedingte Netzhautablösung [Quelle: Eigene Darstellung] Die Diagnostik ist nur durch den Ophthalmologen möglich, da das Makulaödem nur stereoskopisch erkennbar ist [Moss et al., 1985; Klein et al., 1985]. Fokales Makulaödem Umschriebene Ödemzonen, kombiniert mit intraretinalen Blutungen und harten Exsudaten sind „klinisch signifikant“ (= visusbedrohend), wenn die Veränderungen ganz oder teilweise innerhalb eines Papillendurchmessers von der Foveola entfernt liegen. Ohne adäquate Therapie kann die Prognose trotz guten Ausgangsvisus schlecht sein. Diffuses Makulaödem Ödem und harte Exsudate am gesamten hinteren Augenpol mit massiver Leckage. Der Visus ist meist stark herabgesetzt. Ischämische Makulopathie Ausgedehnter Perfusionsausfall des Kapillarnetzes um die Fovea mit schlechter Visusprognose. Die Diagnose ist nur fluoreszenzangiographisch zu stellen. Mischformen der diabetischen Makulopathie sind möglich. Liegen solche vor oder bestehen Zweifel, kann zur Differenzierung der Makulopathie eine Fluoreszenzangiographie notwendig sein. Folgende Therapien werden empfohlen: Indikationen zur Lasertherapie bei nichtproliferativer diabetischer Retinopathie (NPDR) [ETDRS, 1991]. • NPDR- Stadium Laser- Indikation • Mild: keine Laserkoagulation • Mäßig: keine Laserkoagulation Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus • Seite 263 Schwer: Laserkoagulation zu erwägen, insbesondere bei Risikopatienten mit - mangelnder Compliance - Typ 1- Diabetes - beginnender Katarakt mit erschwertem Funduseinblick - Risiko- Allgemeinerkrankungen, speziell: arterielle Hypertonie - Schwangerschaft Indikationen zur Lasertherapie bei proliferativer diabetischer Retinopathie (PDR) [Diabetic Retinopathy Study Research Group, 1987] • Neovaskularisation an der Papille • Periphere Neovaskularisation > 1/2 Papillendurchmesser • Präretinale Blutung • Rubeosis iridis Tabelle 22: Indikationen zur Lasertherapie bei diabetischer Makulopathie (DMP) Fokale DMP (ETDRS 1991) Gezielte Laserkoagulation bei Vorliegen eines visusbedrohenden klinisch signifikanten Makulaödems: umschriebene Ödemzone(n), kombiniert mit Mikroaneurysmen, intraretinalen Blutungen und harten Exsudaten, die ganz oder teilweise innerhalb eines Papillendurchmessers von der Foveola entfernt liegen; unabhängig vom Visus Diffuse DMP (Vergleiche Lee et Olk 1991 mit Ladas et Theodossiadis 1993) Gitterförmige („grid“-) Laserkoagulation optional, da Studienergebnisse nicht eindeutig sind. Ischämische DMP Keine Laserkoagulation sinnvoll [Quelle: Eigene Darstellung ] Indikationen zur Vitrektomie bei proliferativer diabetischer Retinopathie • Schwere nicht resorbierende Glaskörperblutung (keine Aufhellung innerhalb von drei Monaten bei Patienten mit Typ 1- Diabetes Mellitus, innerhalb von 3- 6 Monaten bei Patienten mit Typ 2- Diabetes Mellitus!). In Einzelfällen bereits früher. • Traktionsbedingte oder kombiniert traktiv/ rhegmatogene Netzhautablösung mit relativ frischer Beteiligung der Makula. Die Unterstützung der Therapie durch Disease Management Komponenten zeigt Tabelle 23. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 264 Tabelle 23: Unterstützung der Therapie durch Disease Management Komponenten Komponente Beispiel Therapie und Leitlinien (evidenzbasiert) Die evidenzbasierte Therapie sollte für Arzt und Patient in eigenen Leitlinien an Hand von Algorithmen dargestellt werden. Für den Patienten sollten Ursachen, Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten einfach und verständlich beschrieben werden [Friedman et al., 1998]. Informationssysteme Dazu gehören u.a. spezifische Broschüren, die in Schrift und Layout an sehbehinderte Patienten angepasst sind Selbsthilfegruppen Sie können einen wichtigen Beitrag zum Coping des Patienten mit seiner Erkrankung leisten Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinators könnte in diesem Fall ein CallCenter wahrnehmen. Dazu gehören beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung nach Risikostratifizierung sowie telefonische Reminder. Beispielsweise können Fragen zur Therapie und Therapiezentren beantwortet und „Warnsymptome“ besprochen werden. Ggf. kann der Kontakt zu Selbsthilfegruppen hergestellt werden oder über die Verwendung von Sehhilfen beraten werden. Remindersysteme Postalische oder telefonische Reminder können Patienten beispielsweise an Untersuchungstermine erinnern [Friedmann et al., 1998]. Insbesondere für multiple Reminder konnte die Effektivität in einer randomisierten Studie nachgewiesen werden [Halbert et al., 1999] [Quelle: Eigene Darstellung] Ein Flussschema zur Diagnostik der diabetischen Retinopathie/ Makulopathie kann dem Anhang entnommen werden. (2) Diabetische Nephropathie Die diabetische Nephropathie läßt sich entsprechend persistierender Mikroalbuminerie festmachen. Siehe Einteilung nach Mogensen (Tabelle 24): Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 265 Tabelle 24: Nepropathie- Stadien nach Mogensen Nephropathie- Stadium Albuminausscheidung Serum- Kreatinin GFR/ RPF I Stadium der Hyperfunktion Erhöht Normal II Stadium der klinischen Latenz Normal Normal III Beginnende Nephropathie Persistierende Mikroalbuminurie Normal Erhöht Normal bis erhöht Normal bis erhöht IV Klinisch- manifeste NephroPathie Makroalbuminurie Im Normbereich ansteigend Abnehmend V Niereninsuffizienz Makroalbuminurie Erhöht Erniedrigt [Quelle: Mogensen, 1983] Folgende Aspekte sind über das Screening zu erwähnen: • Wenn keine Makroproteinurie nachweisbar ist, sollte auf Vorliegen einer Mikroalbuminurie untersucht werden [Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Niere, 2000; ADA, 2000]. • Bei Patienten mit Typ 1- Diabetes sollte das Sreening nach dem 5. Jahr nach Diagnosestellung bzw. bei Kindern mit Einsetzen der Pubertät (> 11. Lebensjahr) begonnen werden [Arbeitsgemeinschaft Diabetische Nephropathie, 1997; ADA, 2000]. • Bei Patienten mit Typ 2- Diabetes sollte das Screening mit der Diagnosestellung begonnen werden [ADA, 2000]. • Zum Screening können Schnelltests eingesetzt werden (Micral-II®; RapitexAlbumin®, Mikrobumin- Test®; [Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Niere, 2000]). • Die Albuminausscheidung kann kurzfristig durch schlecht eingestellte Blutzucker, körperliche Anstrengung, Harnwegsinfekte, unkontrollierte Blutdruckerhöhung, Herzinsuffizienz, eine akute fieberhafte Erkrankung oder operative Eingriffe erhöht sein [Mogensen et al., 1995]. Zur Diagnose einer diabetischen Nephropathie wird der Nachweis von mindestens 2 Albuminausscheidungsraten im Mikroalbuminuriebereich gefordert, die im Abstand von zwei bis vier Wochen gemessen werden sollten (= persistierende Mikroalbuminurie) [Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Niere, 2000]. Bei Vorliegen einer Makroalbuminurie sollten nichtdiabetische Nierenerkrankungen ausgeschlossen werden. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 266 Hinweise auf eine nicht- diabetische Nierenerkrankung sind neben entsprechenden anamnestischen Angaben, ein pathologisches Harnsediment (insbesondere dysmorphe Erythrozyten, Erythrozytenzylinder oder Leukozyten), das Fehlen einer diabetischen Retinopathie, die rasche Zunahme einer Proteinurie, ein rascher Kreatininanstieg, atypische sonographische Veränderungen der Nieren und eine Diabetesdauer von weniger als fünf Jahren bei Typ 1- Diabetes, ggf. ist der Patient einem Nephrologen zur weiteren Diagnostik vorzustellen. Verlaufskontrolle Bei einer Albuminurie sollten je nach Nephropathie- Stadium 2 bis 4mal jährlich folgende Parameter überprüft werden [SIGN, 1997]: • Plasmakonzentrationen für Kreatinin, Harnstoff und Kalium; bei reduzierter Muskelmasse Bestimmung der Kreatinin- Clearance • Albuminausscheidungsrate Bei Patienten mit Nephropathie sollte jährlich der Gesamtcholesterin-, HDL- und LDL- Cholesterinspiegel bestimmt, ein EKG in Ruhe und bei Belastung durchgeführt sowie regelmäßig der Augenhintergrund und der angiologische Status überprüft werden [Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Niere, 2000]. Ebenfalls sollten Blutdruckkontrollen (auch Blutdruckselbstkontrolle, Messung im Sitzen und Stehen) inklusive einer 24- Stunden Blutdruckmessung durchgeführt werden, da ab diesem Stadium der diabetischen Nephropathie der nächtliche Abfall des Blutdruckes abgeschwächt oder aufgehoben ist [Voros et al., 1998]. Ob ein fehlender nächtlicher Blutdruckabfall das Fortschreiten der diabetischen Nephropathie bewirkt, ist nicht belegt. Zur Unterstützung der Therapie können im Modul diabetische Nephropathie folgende Disease Mangement Komponenten eingesetzt werden (Tabelle 25). Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 267 Tabelle 25: Disease Management Komponenten zur Unterstützung des Moduls diabetische Nephropathie Komponente Beispiel Therapie und Leitlinien (evidenzbasiert) Die evidenzbasierte Therapie sollte für Arzt und Patient in eigenen Leitlinien an Hand von Algorithmen dargestellt werden. Für den Patienten sollten Ursachen, Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten und die Bedeutung von Screeningmaßnahmen einfach und verständlich beschrieben werden. Screeningmaßnahmen wie z.B. das Microalbuminuriescreening können durch die Implementierung solcher Leitlinien deutlich verbessert werden [Friedman et al., 1998] Informationssysteme Dazu gehören u.a. spezifische Broschüren, Online- Systeme, für Ärzte und Laien aufbereitete Studienergebnisse Selbsthilfegruppen Sie können einen wichtigen Beitrag zum Coping des Patienten mit seiner Erkrankung leisten. Insbesondere im Fall der Dialysepflichtigkeit. Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinators könnte in diesem Fall ein CallCenter wahrnehmen. Dazu gehören beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung nach Risikostratifizierung sowie telefonische Reminder. Beispielsweise können Fragen zu Untersuchungsergebnissen, Risiken für das Fortschreiten der Erkrankung und im Stadium der Dialyse Fragen zur Ernährung usw. beantwortet werden. Remindersysteme Postalische oder telefonische Reminder können Patienten beispielsweise an Untersuchungstermine erinnern [Quelle: Eigene Darstellung] (3) Diabetische Neuropathie Die Klassifikation der diabetischen Neuropathie teilt sich wie folgt ein [nach Thomas und Tomlinson, 1993]: • Symmetrische Polyneuropathien Sensible oder sensomotorische Polyneuropathie Autonome Neuropathie Symmetrische proximale Neuropathie der unteren Extremitäten • Fokale und multifokale Neuropathien Kraniale Neuropathie Mononeuropathie des Stammes und der Extremitäten Asymmetrische proximale Neuropathie der unteren Extremitäten • Mischformen Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 268 Sensomotorische Neuropathie: Die Diagnose der sensomotorischen diabetischen Neuropathien ist durch den Hausarzt sehr einfach zu erstellen. Sie folgt folgenden neurologischen Untersuchungsmethoden [nach Boulton et al., 1998; Young et al., 1993]: • Schmerzempfindung, z. B. mit Zahnstocher, Einmalnadel oder Neurotip. Es sollte gefragt werden „Ist es schmerzhaft?“ (nicht „Können Sie die Nadel fühlen?“) • Berührungsempfindung (Oberflächensensibilität), z. B. mit Wattebausch • Vibrationsempfindung mit 128- Hz- Stimmgabel (nach Rydel-Seiffer) zunächst am Großzehengrundgelenk medial; falls kein Empfinden besteht, Untersuchung einer proximalen Stelle (Malleolus medialis) Untere Normgrenze am Großzehengrundgelenk für Alter < 30 Jahre 6/8, für ≥ 30 - Jahre 5/8 [Hilz et al., 1998] Untere Normgrenze am Malleolus medialis für Alter ≤ 40 Jahre 6/8, für > 40 Jahre - 5/8 [Claus et al., 1988] • Muskeleigenreflexe (Achilles- und Patellarsehnenreflex) • Temperaturempfindung mit kalter Stimmgabel, eiswassergekühltem Reagenzglas, Tip Therm • Druckempfindung • 10g Monofilament auf der Plantarseite des Metatarsale II im Bereich des Zehenballens Entsprechend der Symptomatik sind eine Reihe von diagnostischen Kriterien aufzustellen. Sie orientieren sich am Verlauf der sensomotorischen Neuropathie. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Kriterien zusammengefasst. Tabelle 26: Diagnostische Kriterien verschiedener Verlaufsformen der sensomotorischen diabetischen Neuropathie Verlaufsformen der Neuropathie Subklinische Neuropathie Diagnosekriterien Pathologische quantitative neurophysiologische Tests (Vibratometrie, quantitative Thermästhesie, Elektroneurographie), weder Beschwerden noch klinische Befunde Chronisch-schmerzhafte Neu- Schmerzhafte Symptomatik in Ruhe (symmetrisch und nachts ropathie (häufig) zunehmend): Brennen, einschießende oder stechende Schmerzen, unangenehmes Kribbeln Sensibilitätsverlust unterschiedlicher Qualität und/ oder beidseits reduzierte Muskeleigenreflexe Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 269 Akut-schmerzhafte Neuropathie (eher selten) Symmetrische Schmerzen an den unteren Extremitäten und eventuell auch im Stammbereich stehen im Vordergrund. Eventuell zusätzlich Hyperästhesie Kann mit Beginn bzw. Intensivierung einer Insulintherapie assoziiert sein ("Insulinneuritis") Geringe Sensibilitätsstörungen an den unteren Extremitäten oder normaler neurologischer Untersuchungsbefund Schmerzlose Neuropathie Fehlende Symptome bzw. Taubheitsgefühl und/oder Parästhesein Reduzierte oder fehlende Sensibilität bei fehlenden Muskeleigenreflexen (insbesondere ASR) Diabetische Amyotrophie Progredienter, zumeist asymmetrischer Befall der proximalen Oberschenkel- und Beckenmuskulatur mit Schmerzen und Paresen Langzeitkomplikationen der distal- symmetrischen Polyneuropathie Neuropathische Fußläsionen, z. B. Fußulzera mit unterschiedlichem Penetrationsgrad Diabetische Osteoarthropathie (Charcot- Fuß) Nicht-traumatische Amputation [Quelle: In Anlehnung an Boulton et al., 1998] Der Score für die Ermittlung des Grads der Neuropathie, der bedeutsam für die Therapieoptionen ist, befindet sich im Anhang. Die Therapieoptionen bei sensomotorischer Neuropathie listet folgende Tabelle auf: Tabelle 27: Differenzierte Therapie der sensomotorischen diabetischen Neuropathien Verlaufsformen der Neuropathie Therapie Für alle Formen und Stadien gilt: Optimierung der Diabeteseinstellung Blutdrucknormalisierung Patientenschulung Änderung der Lebensgewohnheiten Subklinische Neuropathie Prophylaxe von Fußschäden (Fußpflege, Orthopädie- technische Versorgung, insbesondere bei knöchernen Fußdeformitäten mit und ohne periphere Neuropathie) Chronisch-schmerzhafte Neuropathie (Angabe der Medikamente in alphabetischer Reihenfolge) Alpha- Liponsäure2 Antikonvulsiva (Carbamazepin3, Gabapentin1,3) Capsaicin1 Mexiletin1 Selektive Serotonin- Wiederaufnahme- Hemmer1,3 (Citalopram, Paroxetin) Tramadol Trizyklische Antidepressiva (Amitriptylin, Clomipramin, Desipramin1, Imipramin) Physikalische Therapie Akut- schmerzhafte Neuropathie Versuch mit einfachen Analgetika Weitere Therapie wie bei der chronisch- schmerzhaften Neuropathie Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 270 Schmerzlose Neuropathie (hypästethische bzw. anästhetische Form) Fußpflege (Diabetesschulung) Prophylaxe von Fußläsionen (orthopädietechnische Maßnahmen) Krankengymnastik Diabetische Amyotrophie Überweisung zum Neurologen zur diagnostischen Abklärung Physikalische Therapie Weitere Therapie wie bei der schmerzhaften Neuropathie Langzeitkomplikationen der distal- symmetrischen Polyneuropathie Sofortige Überweisung nach individuellem Befund und eigenen ärztlichen Möglichkeiten zu Diabetologen, Neurologen, Chirurgen, spezialisierte Fußambulanz oder Fußklinik, Orthopädietechniker, orthopädischen Schuhmacher 1 nicht zugelassen zur Behandlung neuropathischer Schmerzen pathogenetisch begründbare Therapie 3 einschleichende Dosierung beachten, ggf. Spiegelbestimmung 2 [Quelle: Boulton et al., 1998; Haslbeck, 1996; 1997] Autonome Neuropathie Im Rahmen der autonomen Neuropathie lassen sich eine Reihe wichtiger Befunde nachweisen, die gegebenenfalls mit entsprechenden Diagnostika eruiert werden müssen (Tabelle 28). Tabelle 28: Klinisch wichtige Manifestationen und zugeordnete Diagnostik der autonomen diabetischen Neuropathie Organe und Funktionen Kardiovaskuläres System • Ruhetachykardie • Herzfrequenzstarre • Belastungsintoleranz • Verminderte bzw. fehlende Wahrnehmung von Myokardischämien • Perioperative Instabilität • Posturale Hypotonie • Präkapilläre arteriovenöse Shunts Gastrointestinales System • Dysfunktion: Ösophagus, Magen, Darm, Gallenblase (postprandiale Hypoglykämie, Diarrhoen, Obstipation) • Anorektale Dysfunktion (Stuhlinkontinenz) Urogenitales System • Blasenatonie (Miktionsschwäche, Überlaufblase, Restharn) • Erektile Dysfunktion • Ejakulationsstörungen Untersuchungsmethoden Tests der Herzfrequenzvarianten Orthosthasetest, Kipptischtest Magenentleerung (nuklearmedizinisch, sonographisch) Gastro- colische Transitzeit (röntgenologisch, H2Exhalationstest, nuklearmedizinisch) Gallenblasenkontraktion (sonographisch) Ösophago- gastro- intestinale Manometrie Maxim. Nacht- Morgen- Urinvolumen Sonographie Urologische Funktionstests Standardisierter Fragebogen (Penisplethysmographie) Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus • Seite 271 Sexuelle Funktionsstörungen der Frau Reaktion auf Hypoglykämien • Gestörte Hypoglykämiewahrnehmung und (oder) Fehlen einer hormonellen Gegenregulation Engmaschige Blutglukosekontrollen (insbesondere Selbstkontrollen) besonders auch nachts Visuelles System Miosis • Gestörte Pupillenreflexe • Verminderte Dunkeladaptation Infrarotpupillometrie (Myadriasegeschwindigkeit, Latenzzeit des Pupillenreflexes) Sudomotorik • Dyshidrose (gustatorisches Schwitzen, „trockene Füße“) Schweißtest Trophik • Hyperkeratosen, Rhagaden • Neurotrophisches Ulkus • Osteopathie • Osteoarthropathie (Charcot- Fuß) • Ödem Respiratorisches System • Zentrale Fehlregulation der Atmung mit herabgesetzten Atemantrieb gegenüber Hyperkapnie bzw. Hypoxämie • Schlafapnoe • Atemstillstand Fußinspektion klinisch- neurologische und –angiologische Untersuchung Röntgen, ggf. CT bzw. NMR Pedographie (zur Druckbelastung der Fußsohlen und Qualitätskontrolle orthopädie- schuhtechnischer Maßnahmen ggf. Schlaflabor [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wiefels et Gries, 1988; Haslbeck, 1993; Ziegler, 1997] Die speziellen Therapiemöglichkeiten der diabetischen autonomen Neuropathie wurden in der Vergangenheit in keiner Form ausgearbeitet. So stellt die hier vorliegende Ausrichtung (Tabelle 29) die international erste Leitlinie dar, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 272 Tabelle 29: Spezielle Therapiemöglichkeiten autonomer Diabetesneuropathien Herz-Kreislauf-System • Kardiovaskuläre Neuropathie: Im allgemeinen keine spezielle Behandlung notwendig (wichtig: Diagnose und Therapie von koronarer Herzkrankheit und Herzinsuffizienz) • Orthostasesyndrom: Allgemeine Maßnahmen: liberalisierte Kochsalzzufuhr, körperliches Training, Schlafen mit erhöhtem Kopfteil (Verminderung der Diurese), Kompressionsstrümpfe, Beachtung hypoton wirkender Pharmaka Fludrocortison (beginnend mit niedriger Dosierung bei Beachtung von NW) Blutdrucksteigernd wirksame Medikamente mit kurzer Halbwertszeit (z. B. Midodrin) Gastrointestinales System • Gastroparese: Pharmakotherapie: Metoclopramid, Domperidon, Erythromycin Jejunostomie / Ernährungssonde (nur in Ausnahmefällen) • Diarrhoe: Synthetische Opioide (Loperamid) Clonidin (Alpha- 2- Rezeptor-Agonist) Antibiotika: Doxycyclin, Ampicillin Andere Substanzen (nach spezieller Ätiologie der Diarrhoe): Pankreasenzyme, Colestyramin, Psyllium-Samen, Kaolin und Pektin, Octreotid (Somatostatinanalogon) • Obstipation: Volumenfördernde Maßnahmen: reichlich Flüssigkeit, Ballaststoffe (Psylliumsamen) Bewegung Osmotisch wirksame Laxanzien: Laktulose, Magnesiumsulfat, Natriumsulfat Motilitäts- und sekretionswirksame Laxantien: Bisacodyl, Antrachinone Versuch mit Prokinetika: Metoclopramid, Domperidon • Stuhlinkontinenz: Antidiarrhoika Biofeedback-Techniken Pupillomotorisches System Hinweis für den Patienten auf verminderte Dunkeladaption und Gefährdung bei Nachtblindheit Glaukomgefährung (Kontrolle des Augendrucks) Urogenitales System • Diabetische Zystopathie: Selbstkatheterisation Parasympathikomimetika (zum Beispiel Carbachol, Distigmin) Diagnose und Therapie einer Prostatahyperplasie („bladder- outlet- obstruction“): konservative (zum Beispiel Hyperthermie, Ballondilatation, Alpharezeptorenblocker) oder operative urologische Maßnahmen (Prostataresektion) Gegebenenfalls antbiotische Therapie • Erektile Dysfunktion Vermeidung medikamentöser Nebenwirkungen (bedingt durch Antihypertonika, Tranquilizer, Antidepressiva) Sildenafil (Viagra) Erektionshilfesysteme (Vakuumpumpe) Intraurethrale Applikation von Alprostadil (MUSE) Schwellkörper- Autoinjektionstherapie (SKAT) Schwellkörperimplantat Trophik • Neuropathischer Fuß (neuropathisches Ulkus, Neuroarthropathie und –osteopathie): Fußpflege (Schulung) Druckentlastung (Vorfußentlastungsschuh, orthopädische Einlage und Schuhversorgung) Infektionsbekämpfung (Antibiotika, Desinfektion) Lokale chirurgische Maßnahmen (Abtragen von Nekrosen, Kallus und Granulationsgewebe; Strahlresektion, Endgliedamputation), konservative oder operative Therapie einer AVK. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus • • Seite 273 Neuropathisches Ödem: Saluretika Sudomotorische Dysfunktion (diabetische Anhidrose, gustatorisches Schwitzen): Fetthaltige Externa, Fußpflege Vermeidung starker Hitzeexposition Prophylaxe bei identifizierter Ursache des Schwitzens (Nahrungsbestandteile), Anticholinergika, Clonidin (niedrige Dosis) Endokrines System • Neuroendokrine Dysfunktion: Häufige Blutzuckerkontrollen und ärztliche Kontrollen, Vermeidung von symptomatischen und asymptomatischen (oftmals nächtlichen) Hypoglykämien Therapie mit kurz wirksamen Normalinsulinen oder Insulinanaloga [Quelle: Haslbeck, 1993; Haslbeck et al., 1999] Je nach Ausprägungsart der diabetischen Neuropathie können unterschiedliche Komponenten des Disease Management eingesetzt werden (Tabelle 30). Tabelle 30: Komponenten des Disease Managements Komponente Beispiel Ev. Therapie und Ev. Leitlinien Die evidenzbasierte Therapie sollte für Arzt und Patient in eigenen Leitlinien an Hand von Algorithmen dargestellt werden. Für den Patienten sollten Ursachen, Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten einfach und verständlich beschrieben werden [Friedman et al., 1998]. Informationssysteme Dazu gehören u.a. spezifische Broschüren, Online- Systeme, für Ärzte und Laien aufbereitete Studienergebnisse. Da die Neuropathie in der klinischen Praxis oft vernachlässigt wird, ist hier durch die Informationssysteme ein Defizit aufzuholen Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinators kann je nach Ausprägung durch ein Call-Center oder eine speziell weitergebildete Krankenschwester / Pfleger wahrgenommen werden. Dazu gehören beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung, die Schulung im Fußpflegeverhalten, in der Selbstkatheterisierung u.a. [Quelle: Eigene Darstellung] (4) Diabetisches Fußsyndrom Zur Ermittlung des diabetischen Fußes sind eine Reihe gezielter Fragen und eine sorgfältige Inspektion und Palpation sehr erfolgreich in der Identifizierung dieser diabetischen Komplikation. Dabei ist vor allem die Differenzierung zwischen einer neuropathischen und/ oder angiopathischen Pathogenese für die weitere Therapie von großer Bedeutung. Erschwerend für die Therapie ist eine Infektion oder ein möglicher Charcot- Fuß im Rahmen von diabetischen Osteopathien. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 274 Die Differenzierung der beiden Typen ist in Tabelle 31 aufgelistet. Tabelle 31: Differentialdiagnose bei diabetischem Fuß Neuropathischer Fuß Angiopathischer Fuß Anamnese Langjähriger Diabetes mellitus Schlechter Stoffwechsel (HbA1c > 7,5%) Alkoholkonsum Zusätzliche Risikofaktoren - Fettstoffwechselstörung - KHK, Hypertonie - Nikotinabusus - Claudicatio intermittens Schmerzen Unsicher (wenig bis keine) Missempfindungen (kribbeln) Ruhe- oder Belastungsschmerz (veränderte Fontaine- Stadien beachten) Lokalisierung der Veränderung plantar, selten dorsal Druckstellen und Schwielen Akral Scheuerstellen an Zehen, Ferse Inspektion Fuß warm, rosig, trocken Verstrichene Konturen „Krallenfuß“ voluminöser Fuß Fuß kalt blass livide atrophische Haut Infektzeichen Feuchte, rasche, massive Ausbreitung trockene Gangrän Stanzdefekt ohne Randwall; oder torpides chronisches Ulkus; Wundrand: rund Wundrand: unregelmäßig Fußpulse (ggf. Handy-Doppler) Vorhanden (bei Fußödem schwer zu tasten) nicht vorhanden bzw. abgeschwächt (Cave: Mönckeberg- Sklerose) Sensibilität/ Thermosensibilität Reduziert (oft aufgehoben) Unauffällig Vibrationsempfinden (Stimmgabeltest) Vermindert Altersabhängig < 6/8 Normal altersentsprechend > 6/8 Reflexstatus Reflexe reduziert Reflexe unauffällig Neurologischer Status: Frühzeitige Osteolysen unauffällige Knochenstruktur, Charcot- Fuß (generalisierte Osteooft auch im Nekrosegebiet arthropathie) [Eigene Darstellung in Anlehnung an Fachkommission Diabetes Sachsen, 1998; Enderle et al., 1996]) Röntgen Im Anhang befindet sich die orientierende Darstellung der Behandlungsmöglichkeiten. Vor einer möglichen Therapie ist jedoch bei vorhandener Läsion eine Bewertung vorzunehmen. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 275 Tabelle 32: Bewertung der Läsion vor Therapiebeginn Klassifikation Grad nach Wagner, Tiefe, Lokalisation Ätiologie Mechanische, thermische oder chemische Art Neuropathie Vibrationsempfinden, Gefühlsbestimmung Angiopathie Pulse, ABI, Zehendruck, tcPO2 Infektion Kulturen, Röntgen, CT, MRT Deformitäten Hammerzeh, entzündeter Fußballen, Charcot [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Frykberg, 1997] Für eine komplette und schlüssige Therapieoption liegt bis heute keine evidenzbasierte Leitlinie vor. Daher sind an dieser Stelle die Optionen lediglich aufgezählt. Einzig über die Antibiotische Therapie der infizierten Ulzera besteht Einigkeit. Therapieoptionen: • Lokale Wundbehandlung • Debridement • Topische Agentien • Therapie der Infektionen (nachfolgend differenziert aufgeführt): Tabelle 33: Therapiemöglichkeiten bei Infektionen Grad der Gefährdung Oral Parenteral Oberflächliche bzw. nicht Cephalosporine (2. GeFuß- oder Bein- gefährdende neration) Infektionen Clindamycin Amoxicillin plus Clavulansäure Dicloxacillin Gyrasehemmer Fluorochinolone Tiefe bzw. Fuß- oder Beingefährdende Infektionen Fluorochinolone plus Clindamycin Cephalosporine (3. Generation) plus Clindamycin Ticarcillin+ Clavulansäure Ampillicillin+ Sulbactam Cephalosporine Fluorochinolone+ Clindamycin Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Schwere lebensbedrohende Infektionen Seite 276 Imipenem- Cilastin Vancomycin, Metronidazol, und Aztreonam Ampicillin- Sulbactam und Aminoglykosid Piperacillin+ Tazobactam Ciprofloxacin+ Clindamycin Piperacillin+ Clindamycin Ticarcillin+ Clavulansäure+ Vancomycin+ Fluorochinolone [Quelle: In Anlehnung an Caputo et al., 1994; Caballero et Frykberg, 1998; Seewald, 1999] Ein maßgeblicher Anteil in der Therapie der Füße ist die Prophylaxe. Sie stützt sich dabei auf folgende Maßnahmen: • Regelmäßige Inspektion und Untersuchung der Füße und der Bekleidung und des Schuhwerks • Identifizierung der Hochrisikopatienten • Schulung von Patienten, Angehörigen und Heilberufen • Adäquates Schuhwerk • Behandlung von nicht- ulzerativen Befunden • Was an präventiven Maßnahmen zu leisten ist, kann man aus der im Anhang zu findenden Präventionsliste entnehmen Der zweite Aspekt ist die frühzeitige Erkennung von Hochrisiko-Patienten und damit die Ausschaltung möglicher Risikofaktoren (Risikofaktoren durch Anamnese und klinische Untersuchung eruiert): • Frühere Ulzera/ Amputationen • Fehlen von sozialen Kontakten • Niedriges Bildungsniveau • Verschlechterte Sensibilität • Verschlechtertes Vibrationsempfinden • Fehlender Achillessehnenreflex • Kallusbildung • Fußdeformitäten • Inadäquates Schuhwerk bzw. Kleidung • Fehlender Puls der A. dorsalis pedis bzw. A. tibialis posterior Die Therapie des diabetischen Fußes beschränkt sich nicht auf die Ulzera allein, sondern berücksichtigt auch progressive Faktoren im Verlauf. Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 277 Als Therapieoptionen stehen zur Verfügung: • Fußchirurgische Maßnahmen • Zirkulatorische Maßnahmen • Medikamentöse Maßnahmen • PTCA • Gefäßchirurgische Maßnahmen • Fußentlastung Tabelle 34: Disease Management Komponenten Komponente Beispiel Die evidenzbasierte Therapie sollte für Arzt und Patient in eigenen LeitTherapie und Leitlinien (evidenzbasiert) linien an Hand von Algorithmen dargestellt werden. Für den Patienten sollten Ursachen, Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten und die Bedeutung der regelmäßigen Selbstinspektion und des richtigen Fußpflegeverhaltens einfach, verständlich und detailliert beschrieben werden [Litzelman et al., 1993]. Informationssysteme Dazu gehören u.a. spezifische Broschüren, Online- Systeme, für Ärzte und Laien aufbereitete Studienergebnisse, Adressenlisten von orthopädischen Schuhmachern, Fußpflegezentren u.a. Schulung Sie kann einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Patienten leisten, wie die Fußinspektion und die Fußpflege durchgeführt wird. Sie sollte unterstützende Arbeitsblätter, evtl. einen Patientenselbstvertrag und das Einüben der Selbstinspektion der Füße beinhalten [Litzelman et al., 1993]. Krankheitskoordinator Die Aufgaben des Krankheitskoordinators könnte in diesem Fall ein CallCenter [Piette, 2001]zusammen mit einer speziell weitergebildeten Krankenschwester 7 Pfleger im Rahmen beispielsweise von speziellen Fußsprechstunden wahrnehmen. Dazu gehören beispielsweise telefonische Beratung und Betreuung sowie die regelmäßige Kontrolle, ob der Patient die Fußinspektion und die Fußpflege selbst beherrscht (durch die Krankenschwester). Amputationsraten können dadurch deutlich gesenkt werden [Staer-Johansen, 1996] Remindersysteme Postalische oder telefonische Reminder für Patienten, sowie Chart Reminder für Ärzte können beispielsweise an Untersuchungstermine, die Selbstinspektion, Inhalte des Selbstvertrags u.a. erinnern [Litzelman et al., 1993] [Quelle: Eigene Darstellung] All diese Maßnahmen des Basismoduls kombiniert mit den Ergänzungsmodulen (Spezifische Therapie allein oder kombiniert mit Komplikationstherapie) stellen das Individuelle Patientenmanagement nach Risikostratifizierung dar. Dieses Manage- Disease Management in Deutschland – Diabetes Mellitus Seite 278 ment berücksichtigt gleichzeitig den klinischen Zustand des Patienten, ebenso wie die entsprechenden psychosozialen Faktoren. Das Disease Management Programm Diabetes ist durch seine Einzelkomponenten sehr flexibel und immer individuell anzupassen. Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 279 12 Kosten- Effektivität als Voraussetzung für den Einsatz von Disease Management Programmen 12.1 Einführung Der medizinische Nutzen von Disease Management Programmen ist unbestritten. Der in ein solches Programm eingebundene Patient kann im Durchschnitt eine bessere medizinische Behandlung erwarten als ein Patient, der nicht in ein solches Programm eingebunden ist. Der medizinische Nutzen allein erlaubt jedoch noch keine Aussage darüber, ob es aus gesellschaftlicher und aus Sicht der Krankenkassen auch ökonomisch sinnvoll ist, solche Programme einzuführen. Um diese Aussage treffen zu können, ist es notwendig, die Kosten und den (monetären) Nutzen der Programme zu messen. Das Problem besteht darin, dass je nach eingenommener Sichtweise (beispielsweise Krankenkassen, Patient oder Gesellschaft) die Kosten unterschiedliche Teilbereiche umfassen und generell methodisch unterschiedlich bemessen werden können. Würde der (monetäre) Nutzen der Programme höher liegen als die verursachten Kosten, so läge eine positive Kosten- Effizienz vor und die Einführung der Programme könnte auch unter ökonomischen Gesichtspunkten empfohlen werden. Im umgekehrten Fall lägen die Kosten höher als der Nutzen, was nicht zwangsläufig eine Ablehnung der Disease Management Programme bedeuten muss. Denn beispielsweise könnte aus Sicht der Krankenkassen bei den Disease Management Programmen eine negative Kosten- Effizienz vorliegen, aus Sicht der Patienten jedoch ein klarer Vorteil durch verbesserte medizinische Versorgung. Die Wertschätzung der Beitragszahler könnte so hoch ausfallen, dass diese bereit wären, die Mehrkosten zu tragen, oder durch den Abbau von anderen Leistungen, bevorzugt Über- und Fehlversorgungsleistungen, zu finanzieren. Die Analyse der Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen kann somit, unabhängig vom Ergebnis, nicht unmittelbar zu einer Ablehnung der Programme Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 280 führen, sondern entweder zu einer Verstärkung der medizinischen Vorteile (bei positiver Kosten- Effizienz) oder einer vertieften Diskussion der Präferenzen der Beitragszahler (bei negativer oder unbestimmter Kosten- Effizienz). Es ist erstaunlich, dass Disease Management Programme bisher in Deutschland ungeachtet der intensiven weltweiten Diskussion nur geringe Beachtung gefunden haben. Die Ursache liegt nicht in der zu geringen Wettbewerbsintensität zwischen den Krankenkassen, wie teilweise vermutet, sondern umgekehrt in der verzerrten Wettbewerbssituation. Patienten mit chronischen Erkrankungen, wie sie für Disease Management Programme geeignet sind, haben bisher immer einen erheblichen finanziellen Nachteil für die Krankenkassen dargestellt, denn im Rahmen des Risikostrukturausgleich wurde im wesentlichen nach demografischen Angaben ausgeglichen, nicht jedoch nach der Morbidität. Mit anderen Worten hat ein 40-jähriger ohne chronische Erkrankung die gleichen Ausgleichsbeträge erzielt wie ein 40-jähriger mit Diabetes mellitus oder einer anderen kostenintensiven Erkrankung. Es könnte argumentiert werden, dass es für eine Krankenkasse dennoch attraktiv gewesen wäre, Disease Management Programme einzuführen, wenn diese kosteneffektiv seien. Nicht übersehen werden darf jedoch, dass diese Disease Management Programme eine hohe Wirksamkeit in der medizinischen Versorgung aufweisen. Der medizinische Nutzen allein würde die Krankenkasse bereits attraktiv für andere Patienten mit derselben Erkrankung machen. Paradoxerweise herrscht somit die Situation, dass je besser ein Disease Management Programm eingerichtet wäre, desto mehr teure Versicherte würden zu dieser Krankenkasse wechseln. Die für den Versicherten unerfreuliche Lehre aus diesem Dilemma lautet, dass eine Krankenkasse betriebswirtschaftlich um so rationaler handelte, je schlechter sie chronisch erkrankte Versicherte betreut, und diese somit zu einem Wechsel in andere Krankenkassen animierte. Der bisherige Risikostrukturausgleich hat sich damit nicht neutral (oder gar befürwortend) gegenüber der Versorgungsqualität verhalten, sondern sogar mindernd. Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 281 12.2 Aspekte der Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen Die Kosten von Disease Management Programmen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen [Doxtator, 2000]. Unterschieden werden einmalige und laufende Kosten. Einmalige Kosten: • Einführungskosten • Werbekosten (insbesondere Anschubwerbung zur Bekanntmachung der DiseaseManagement- Programme) • Akkreditierungskosten (wobei diese in regelmäßigen Abständen bei der Reakkreditierung wieder als „regelmäßige Fixkosten“ auftreten) Laufende Kosten: • Verwaltungskosten (inklusive Kosten für erweitertes Datenmanagement) • Schulungskosten für Patienten • Kosten für zusätzliche Behandlungen der Patienten, die über die bisherigen Untersuchungen hinausgehen. (Kosten durch Arzneimittel, Screening, Einsatz von Call- Centern oder Krankenschwestern als Krankheitskoordinatoren) • Kosten der Mehrbehandlung aufgrund der Lebensverlängerung der Patienten in Disease Management Programmen. Dem stehen die durch die evidenzbasierte Medizin vermiedene Kosten gegenüber: • Abbau nicht indizierter Leistungen • Abbau von Überversorgung und Fehlversorgung mit Arzneimitteln • Vermiedene Krankenhauseinweisungen Der Nutzen der Programme sollte bevorzugt in monetären Größen bewertet werden, um eine Vergleichbarkeit und klarere Entscheidungshilfe zu erreichen. Einige Nutzenkomponenten sind jedoch nur schwer in monetäre Größen zu fassen, wie beispielsweise die Lebensqualität oder gewonnene Lebensjahre. Hier wird in der Regel Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 282 der Quotient aus Kosten pro gewonnenem Lebensjahr oder anderen nicht- monetären Größen gebildet. Nutzenkomponenten lassen sich in harte und weiche Faktoren untergliedern: • Vermeidung von Krankenkassenausgaben durch Vermeidung oder Hinauszögern akuter Komplikationen und Folgeerkrankungen bei chronischen Erkrankungen • Vermeidung von Beeinträchtigungen und Lebensqualitätseinbußen bei Patienten durch chronischen Erkrankungen. So ist beispielsweise unbestritten, dass die Reduzierung zu hohen Blutdrucks die Wahrscheinlichkeit von kardiovaskulären Erkrankungen verringert [Joint National Commitee, 1999] • Werbeeffekte für einzelne Krankenkassen durch gute Disease Management Programme • Ansehensgewinne für das Gesundheitssystem durch patientenzentrierte und qualitätsgesicherte Behandlungsmethoden (Durchbrechung der Broken- WindowSpirale) • Abbau der Über-, Unter- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem • Senkung des Verlustes an Arbeitsausfall in Betrieben. So berechnete GuicoPabia, dass ein Arbeitnehmer mit ischämischer Herzerkrankung dem Arbeitgeber Kosten von 4.298 US$ pro Jahr verursacht, im wesentlichen aufgrund des Arbeitsausfalls und erforderlicher Mehrarbeit von Kollegen [Guico- Pabia, 2001]. In allen Studien zur Evaluation der Disease Management Programme besteht das Problem in der nur ungenügenden Datenhaltung bei Krankenkassen. Zudem ist unmittelbar ersichtlich, dass der Nutzen, ebenso wie ein Teil der Kosten, auch außerhalb der Krankenkassen anfällt. Eine Evaluation aus Sicht der Krankenkassen wird daher nicht alle Kostenaspekte berücksichtigen müssen, beziehungsweise diese nachrichtlich ausweisen [Langley, 1996]. 12.3 Evidenz für Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen Die Literatur bietet eine große Auswahl von wissenschaftlichen Studien, welche die Kosten- Effizienz der Disease Management Programme untersuchen. Generell müs- Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 283 sen Studien zur Evaluation der Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen mehrere methodische Hürden bewältigen: • So ist es wichtig, dass das Studiendesign eine möglichst repräsentative Auswahl an Krankheiten, Erhebungsorten (wie Krankenkassenzugehörigkeit, Krankenhäuser, Regionen) und Patienten berücksichtigt • Die Studiendauer sollte so lang gewählt werden, dass sich Effekte ausreichend genau beobachten lassen, also sowohl Kosten als auch Nutzen der Programme stabil abgelesen werden können • Das Studiendesign sollte geeignet sein, Verzerrungen aus der Person der Versicherten gering zu halten, also im optimalen Fall eine randomisierte Zuordnung der Patienten aufweisen • Es sollte sichergestellt sein, dass die Änderung im Gesundheitszustand der Patienten durch das Disease Management Programme verursacht wurde und nicht durch andere Variablen, die in der Studie eventuell gar nicht berücksichtigt wurden, wie beispielsweise einer Änderung der Finanzierungsmodalitäten bei den behandelnden Ärzten [Armour et al., 2001]. Notwendig ist daher zum einen die Erhebung eines Gesundheitszustandes zu Beginn der Studie (Baseline) und eine Kontrollgruppe, die keine Intervention durch das Disease- Management- Programm erfährt. 12.3.1 Mehrkosten von Krankheiten Disease Management Programme sind um so eher kostenneutral einzuführen, wenn sich überhaupt große Kostenvarianzen bei der Behandlung von identischen Erkrankungen über Patienten hinweg ergeben. Treten bei einer Krankheit sowohl bei optimierter, evidenzbasierter als auch bei mangelhafter Therapie keinerlei Kostendifferenzen auf, kann auch ein Disease Management Programm nur schwer ökonomische Vorteile erbringen. Dass hohe Kostendifferenzen resultierend aus unterschiedlichen Behandlungsansätzen in der Praxis tatsächlich vorliegen, zeigen eine Vielzahl von Studien, von denen einige ausgewählte Beispiele in folgender Tabelle gezeigt werden. Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 284 Tabelle 1: Mehrkosten für ausgewählte Erkrankungen Literatur und Krankheitsart Mehrkosten Berry et al, 2001 Review: Prävalenz der CHF von 1 bis 2% in den USA mit steigender Chronische Tendenz, Ausgaben für CHF machen 1 bis 2% der gesamten Herzerkrankung (CHF) Gesundheitsausgaben aus. Schwere Fälle verursachen 8 bis 30 mal höhere Ausgaben als leichte Fälle. Ausgaben für Krankenhausaufenthalte machen den größten Anteil aus. Die Optimierung der medikamentösen Therapie (ACE-Hemmer) verspricht die größte Senkung der Ausgaben und wird als hoch kosteneffektiv eingeschätzt. Für die USA werden 36 Mio. US$ genannt. Selby et al, 1997 Diabetes mellitus Evaluation der Ausgaben von 85.209 Mitgliedern einer Managed Care Organisation in den USA; gematchte Kontrollstudie: Mehrkosten bei Vorliegen eines Diabetes mellitus von 3.494 US$ pro Patient. 2,4-fach höhere Ausgaben für Patienten mit Diabetes, davon 38,5% für Krankenhausaufenthalte und 38% für langfristige Komplikationen des Diabetes mellitus. Giles, 1996 Herzinsuffizienz Review: Prävalenz von 1,9 Mio. Personen in Deutschland, mit einer Mortalität von 7,5% bis 40% pro Jahr je nach Schweregrad. Zwischen 1977 und 1986 stieg die Krankenhaushäufigkeit für die Erkrankung um mehr als das 2-fache. Schädlich & Brecht, 1997 Myokardinfarkt Modellrechnung: Bei den in Studien ermittelten Wirksamkeiten von Aspirin zur Prophylaxe nach erlittenem Myokardinfarkt ergibt sich in einem ZweiJahres-Zeitraum ein Einsparpotential von 5.535 DM pro Patient. Hochgerechnet auf die Bundesrepublik werden für die Krankenkassen Einsparungen bei stationären und ambulanten Behandlungen von rund 100 Mio. DM ermittelt. [Quelle: Eigene Darstellung] Die Auswirkung einer evidenzbasierten Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz untersuchte Giles in einem Review [Giles, 1996]. Anhand großer Studien wie der CONSENSUS, SOLVD, SAVE und dem deutschen Munich Heart Failure Trial wird gezeigt, dass immer eine signifikante Reduzierung der Krankenhaushäufigkeit durch den richtigen Einsatz von ACE- Hemmern erreicht werden kann. Die SOLVD Studie zeigte eine Vermeidung von 50 Todesfällen und 350 Krankenhauseinweisungen bei der Behandlung von 1.000 Patienten mit Herzinsuffizienz. Für die USA wurden hieraus Einsparungen von 2,4 Mrd. US$ pro Jahr berechnet. Zusätzlich werden verringerte Progressionen der Krankheit erreicht. In der SAVE Studie sanken die Krankenhauseinweisungen von 4,9 auf 3,9 pro 100 Patienten und Jahr. Myokardinfarkte reduzierten sich von 170 auf 133, PTCA‘s von 77 auf 56 und Bypassoperationen von 128 auf 103. Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 285 Erstaunlich ist dabei, dass bei weitem nicht alle Ärzte ACE- Hemmer bei den in Frage kommenden Patienten einsetzen. So berichtet Mark, dass nur 53% der Allgemeinmediziner und 75% der Kardiologen ACE- Hemmer bei Patientengruppen mit einer milden Form der Herzinsuffizienz einsetzen, obwohl klare medizinische und ökonomische Gründe dafür sprechen [Mark, 1997]. Die Behandlung mit ACE- Hemmern bei Herzinsuffizienz ist damit ein sehr exponiertes Beispiel dafür, wie optimale Betreuung im Rahmen von Disease- ManagementProgrammen Folgekosten vermeiden hilft. Die Untersuchung von Cleland & Walker macht zudem deutlich, dass es vielfach keine Therapie gibt, die auf alle Patientenpopulationen angewandt werden kann [Cleland et al.,1997]. So stellen sie fest, dass die Kosten- Effektivität der chirurgischen Behandlung von Angina Pectoris gegenüber der konservativen Behandlung bei einigen Patientensubgruppen gegeben ist, bei anderen jedoch nicht. 12.3.2 Beispiele für Evaluationen von Disease Management Programmen Die Studien zur Evaluation von Disease Management Programmen evaluieren teilweise gesamte Programme, teilweise jedoch auch nur Teilbereiche oder Komponenten. Keine Studie versuchte eine Abschätzung, welche Kosteneffekte sich aus Disease- Management- Programmen für eine Volkswirtschaft ergeben. Im folgenden werden Studien aufgeführt, die gesamte Programme unterschiedlicher Krankheitsbilder einbeziehen. • In einer Simulation mit Morbiditätsdaten aus der Schweiz haben Gozzoli et al. die zusätzliche Lebenserwartung und die vermiedenen Kosten aus der Teilnahme an einem Disease- Management- Programm im Bereich Diabetes mellitus berechnet [Gozzoli et al., 2001]. Einbezogen wurden die Folgekosten aus Komplikationen. Die Simulation zeigt, dass Patienten mit einer höheren Lebenserwartung von 0,56 Jahren (nicht diskontiert) rechnen können und gleichzeitig 7.313 SF ( jährlich diskontiert mit 3%) eingespart werden. Die Kosten entsprechen 10,7% der gesamten Behandlungskosten in der Schweiz für die Patientengruppe ohne Teilnahme an einem Disease Management Programm. Indirekte Kosten wurden in der Analyse Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 286 nicht berücksichtigt. Die Studie zeigt, dass trotz der Ausgaben für das eigentliche Disease- Management- Programme Kosten- Effizienz erreicht werden kann. • In einer Studie über 190 Patienten in Schweden wurden in einem 1-JahresZeitraum die Auswirkungen eines Disease- Management- Programms in Form von Patientenschulungen, Beeinflussung von Verhaltenshinweisen und einer Betreuung in einer speziellen niedergelassenen Poliklinik bei Patienten mit Herzinsuffizienz beobachtet [Cline et al., 1998]. Bereits dieses rudimentäre Disease Management Programm konnte in dem kurzen Beobachtungszeitraum die Zeit bis zu einer Wiederaufnahme in ein Krankenhaus von 106 auf 141 Tage verlängern und die jährlichen Kosten der Gesundheitsversorgung von 3.594 US$ auf 1.300 US$ senken. Die Überlebensrate zeigte zwischen den Gruppen, wohl auch aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraumes, keine signifikanten Ergebnisse. • In einem Review über Möglichkeiten zur Verbesserung der Behandlung der Herzinsuffizienz erkannte Giles, dass ein Disease Management Programm in Form einer zusätzlichen Krankenschwester (Krankheitskoordinator), welche die Patienten unterweist, bereits 8.000 US$ pro Jahr einspart und die Krankenhaustage pro Patient und Jahr von 1,8 auf 0,7 senkt [Giles, 1996]. Als Grund wird genannt, dass die intensive Betreuung die Patienten bereits zu einer besseren Compliance (wie Befolgung von Anweisungen) animiert. • Bei 162 Patienten, bei denen Asthma neu diagnostiziert wurde, untersuchten Kauppinnen et al. in einem 3- Jahres Zeitraum die Kosten- Effizienz von intensiver Unterweisung und der Anleitung zum Selbstmanagement der Krankheit [Kauppinnen et al., 1999]. Gegenüber der randomisiert ausgewählten Kontrollgruppe hatte die Interventionsgruppe signifikante Verbesserung der Lungenfunktion. Die Summe aus direkten und indirekten Kosten in beiden Gruppen wies keine signifikanten Unterschiede auf. • Rich et al. untersuchten explizit die ökonomischen Auswirkungen der Behandlung in Disease Management Programmen bei Herzinsuffizienz [Rich et al., 1995]. Über 282 Patienten wurden in einer randomisierten Zuweisung zur „Normalthera pie“ und der „Disease Management Programm- Therapie“ einbezogen. Die Disease Management Programm- Therapie umfasste Beratung durch eine Krankenschwester, Ernähungsinformation durch eine Fachkraft, Arzneimittelüberprüfungen sowie Hausbesuche und Telefonberatungen (Telemanagement) durch Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 287 einen Krankheitskoordinator. 90 Tage nach dem stationären Aufenthalt, der den Studieneintritt begründete, hatten Disease Management Programm- Teilnehmer um 44% geringere Wiedereinweisungen. Die Lebensqualität zeigte ebenfalls Verbesserungen um 80 bis 90% auf den verwendeten Skalen. Die ökonomische Rechnung wies Einsparungen von 1.000 US$ bei der stationären Behandlung auf, denen Mehrkosten für das Disease Management Programm von 216 US$ sowie Mehrkosten der Familie des Patienten in Höhe von 336 US$ entgegengestellt werden müssen. In der Bilanz ergaben sich damit Einsparungen von rund 500 US$ pro Patient bereits nach 90 Tagen. • Abweichende Ergebnisse fand die Gruppe um Weinberger in einer Studie an 9 Krankenhäusern und randomisiert zugeordneten 1.396 Patienten mit Diabetes, chronischer Lungenerkrankung oder Herzinsuffizienz [Weinberger et al., 1996]. Die Intervention umfasste die Betreuung der Patienten durch eine Krankenschwester und einen Arzt von der Entlassung bis zu einem Zeitpunkt von 6 Monaten. Zwar waren die Patienten signifikant zufriedener mit der Betreuung als die Patienten ohne Disease Management Programm, jedoch zeigte sich kein Effekt bei der Länge und Anzahl der stationären Wiederaufnahmen. Als Ursache wurde vermutet, dass die Behandlung in der Kontrollgruppe bereits in sehr guten Zentren stattfand, und daher kaum noch Qualitätsverbesserungen möglich waren. Dies wurde durch die Analyse der Medikamentenverordnungen in der Gruppen bestätigt. • In Schweden wurde in einem schlanken Disease- Management- Programm zur Behandlung des Bluthochdrucks über 508 Patienten ein 3 Jahres Follow- Up über Kosten und Nutzen durchgeführt [Johannesson et al., 1995] Die Intervention umfasste Unterrichtungen der Patienten durch Krankenschwestern, ärztliche Hinweise zum Raucherverhalten, Gruppendiskussionen zur Ernährung und spezielles Übungsmaterial. Die Gesamtkosten für das Disease Management Programm wurden mit 4.903 SK für 3 Jahre pro Patient geschätzt. Das Programm wurde im Vergleich zu anderen medizinischen Interventionen als kosteneffektiv eingeschätzt. • In einer Studie mit insgesamt 60 niederländische Krankenhäuser untersuchten van Bergen et al. [1995] Kosten und Nutzen von langfristiger Behandlung mit Anti- Koagulanzien nach erlittenem akutem Myokardinfarkt [van Bergen et al., 1995] Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 288 Bei 3.404 nicht im Krankenhaus verstorbenen Patienten wurde die Medikation im Vergleich zur Placebogabe über maximal 37 Monate Follow- Up untersucht. Es handelt sich um eine randomisierte doppelblinde Studie. Als Kosten wurden Wiederaufnahmen ins Krankenhaus, die zusätzliche medikamentöse Behandlung über Anti- Koagulanzien und die Kosten der wichtigsten kardiologischen Interventionen berücksichtigt. Ergebnis der Studie ist, dass die Anzahl der Krankenhaustage von 18.830 auf 15.083 verringert werden konnte. Die Kosten für die medizinische Versorgung reduzierten sich von 10.784 FL auf 9.878 FL pro Patient. Indirekte Kosten und Behandlungskosten durch niedergelassenen Ärzte wurden nicht berücksichtigt. • Dass die Schulungen von Ärzten zu geringeren Kosten führen kann, konnten Manheim et al. in einer randomisierten Studie über insgesamt 105 Ärzte nachweisen [Manheim et al., 1995]. In mehrjährigen Schulungen mit jeweils zwei Terminen pro Jahr (mit 6 zweistündigen Sitzungen) wurden Themen wie Diagnoseverkürzung, Verschreibungsverhalten, Verweildauersenkung und Leitliniennutzung besprochen. Hinzu kamen Fallbesprechungen. Die Intervention verringerte die Verweildauer fallschwereadjustiert um 1,05 Tage oder 1.070 US$ pro Patient. • Lediglich die Arzneimittelkosten in Disease Management Programmen untersuchten Munroe et al. Sie stellten fest, dass die Arzneimittelkosten zwischen 144 und 193 US$ pro Patient und Monat sanken. Die Studie fand mit 589 Patienten mit den Diagnosen Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten, Diabetes und Asthma statt [Munroe et al., 1997]. • In einem Disease Management Programme für Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz wurden 1.541 Patienten behandelt [Nissenson et al., 2001] Gegenüber Patienten ohne Teilnahme an dem Programm waren die Überlebenswahrscheinlichkeiten um 19% bis 35% verbessert und die Raten der Krankenhauseinweisungen um 45% bis 54% vermindert. 12.3.3 Vergleich mit betrieblichen Gesundheitsprogrammen Eine ähnliche Diskussion wie bei Disease Management Programmen wurde auch bei betrieblichen Programmen der Gesundheitsförderung geführt. Diese Programme umfassen beispielsweise die Anleitung zur Gewichtsreduktion, Diskussion der Raucher- Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 289 gewohnheiten und die generelle Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen. Auch hier wurden Klagen laut, dass die Investitionen der Arbeitgeber in diese Programme ungewissen ökonomischen Nutzen haben würden. Die Ansatzpunkte beider Programmtypen weisen sogar Überschneidungen auf, indem beide ein kontinuierliche Betreuung, Qualitätssicherung und Evaluation benötigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Arbeitgeber die Kosten- Effizienz von Maßnahmen für ihre Beschäftigten genau evaluieren. Im Jahr 1997 hatten von 1.050 befragten Betrieben 89% bereits ein Gesundheitsförderprogramm eingeführt, wovon 78% auch eine Schulung der Beschäftigten umfasste. Die Arbeitgeber haben die Programme als starkes Argument der Mitarbeitermotivation gesehen [Pelletier, 1999]. Pelletier gibt für einige betriebliche Maßnahmen an, dass diese nach rund 1 Jahr spürbare Verhaltensänderungen bei den Betroffenen bewirken und nach rund 3 bis 5 Jahren eine positive Kosten-Effizienz aufweisen. Hierbei muss beachtet werden, dass die Programme keine strengen Selektionskriterien und Evidenzbasierung aufweisen, wie sie im Rahmen der Einführung von Disease Management Programmen im Risikostrukturausgleich gefordert werden. Vielmehr decken sie eine breite Streuung an Methoden und Mitarbeitern ab. Die Kosten- Effizienz von geprüften Disease Management Programmen, welche sich an Versicherte mit erhöhtem Morbiditätsrisiko wenden, dürfte daher früher erreicht werden. Heany & Goetzel haben im Jahr 1997 einen Review über 47 Studien angefertigt, die insgesamt 35 Gesundheitsprogramme in Betrieben umfassen. Das Ergebnis des Reviews ist, dass insgesamt ein positiver Outcome der Programme als „indiziert bis akzeptabel“ gelten kann [Heaney et al., 1997]. Zu dem gleichen Ergebnis kam O’Donnell, der die finanzielle Seite von betrieblichen Gesundheitsprogrammen untersuchte [O‘ Donnell, 1997]. Einbezogen wurden 36 Studien, von denen zwei Drittel als Methodik einen Gruppenvergleich einsetzen, teilweise mit einer Randomisierung, das heißt der zufallsgesteuerten Zuweisung von Studienteilnehmern in die Interventionsgruppe, die an dem Disease Management Programm teilnimmt und der Kontrollgruppe, die nicht an dem Disease Management Programm teilnimmt. Aldana untersuchte explizit die Kosten für die Arbeitgeber und stellte in einem Review über 72 Studien fest, dass eine Senkung der krankheitsbedingten Abwesenheiten und der Ausgaben für Krankheitsbehandlung nachgewiesen werden konnte [Aldana, 2001]. Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 290 Die amerikanische Citibank konnte 25.931 Mitarbeiter in ein Programm einschließen (54 % aller Mitarbeiter) [Ozminkowski et al., 1999]. Das betriebliche Disease Management Programm umfasste Beratung, Umgang mit chronischen Erkrankungen und Hinweise zur Vermeidung unnötiger oder nicht angemessener Behandlungen. Im Durchschnitt wurden die eingeschlossenen Mitarbeiter über 38 Monate evaluiert. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass auch nach einer Fallschwereadjustierung jeder investierte Dollar zwischen 4,56 US$ und 4,73US$ als Return on Investment (ROI) erbrachte. 12.4 Zusammenfassung und Diskussion Aufgrund der bisher unterentwickelten Beachtung von chronischen Erkrankungen im Risikostrukturausgleich war es für Krankenkassen eher von ökonomischem Nachteil, Disease Management Programme aufzulegen und damit weitere chronisch erkrankte Versicherte anzuwerben. Bestehende Programme wurden kaum beworben. Deutsche Erfahrungen mit Disease Management Programme sind daher auch nur vereinzelt zu finden. Exemplarisch kann der Bericht eines privatwirtschaftlichen Unternehmens sein, das 200 Patienten mit Asthma und Diabetes in Disease Management Programmen betreut [Ärzte- Zeitung Online, 26.02.2001]. Das Programm erstreckte sich über ein Jahr und beinhaltete regelmäßige Informationsgespräche. Asthma- Patienten verursachten innerhalb des Programms 30% weniger Kosten bei stark gestiegener Lebensqualität. Die Kosten für kurzzeitige Krankenhausaufenthalte gingen sogar um 80% zurück. Auch bei Diabetes- Patienten ergab sich eine deutlich verbesserte Compliance. Insgesamt ist die Studienlage der ausländischen Evaluationen zur Bewertung der Kosten- Effizienz von Disease Management Programmen gemischt. Aus gesellschaftlicher Sicht ist anscheinend eine ausreichend hohe Evidenz für vorhandene Kosten- Effizienz ablesbar. Werden hingegen nur die Ausgaben und Einsparungen der Krankenkassen betrachtet, scheint insbesondere die Qualität der Programme entscheidenden Einfluss zu haben. Die enge Orientierung an evidenzbasierter Medi- Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 291 zin, der Einsatz von geschulten Fachkräften und die kontinuierliche Evaluierung der Wirksamkeit sind entscheidende Komponenten. Die Analyse leidet unter der in den Studien oftmals nicht genau spezifizierten Art der Komponenten der Disease- Management- Programme sowie der betrachteten Kostenblöcke [Stone et al., 1999]. Hier sollte weitere Forschung betrieben werden, um die Ursachen für unterschiedliche Wirksamkeit festzustellen. Hinzu kommt, dass die weitaus meisten Studien in den USA durchgeführt wurden, dort jedoch im Rahmen der Managed Care Modelle andere Rahmenbedingungen herrschen. Bei Übertragung auf deutsche Verhältnisse müssen einige Besonderheiten werden: • Die Einschreibung in die Disease- Management- Programme im Risikostrukturausgleich wird wesentlich strengeren Kriterien unterliegen als in den USA, wo im Prinzip keinerlei einheitliche Kontrolle vorlag. Daher wird in Deutschland der durchschnittliche Patient in den Programmen morbider sein, was zu größeren Einsparpotentialen führt. • Die höchsten Kosten fallen durch akutstationäre Einweisungen an. In einer kontrollierten randomisierten Studie untersuchten Linne et al. [2000] in Schweden die direkten Kosten für die Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz nach der ersten Hospitalisierung [Linne et al., 2000]. Die Kosten betrugen 2.564 US$ im 6Monats- Follow up, davon ein knappes Drittel Kosten der akutstationären Behandlung. Medikamente machten beispielsweise nur rund 3% der Kosten aus. Dies macht deutlich, dass die Verringerung der Krankenhauseinweisungen der zentrale Hebel ist, um die Kosten zu senken. In den USA liegen die Einweisungsquoten im internationalen Vergleich bereits sehr niedrig. Deutsche Programme stoßen hier auf weitaus größere Möglichkeiten der Reduktion. Zu fragen ist allerdings, ob die Verminderung der Einweisungen auch durch andere Finanzierungsmechanismen erreicht werden kann, so dass dieser Effekt in Deutschland nicht nur Disease Management Programmen zugeschrieben würde. • Auch die Qualität der Programme selbst unterliegt im Ausland lediglich der freiwilligen Kontrolle. In der Regel werden die Programme in einem nicht akkreditierten Verfahren von Managed Care Organisationen oder Pharmafirmen entwickelt und nicht zwingend an neue Entwicklungen angepasst. Die angestrebte hohe Qualität der deutschen Programme garantiert, dass sowohl der Nutzen als auch die Effektivität der Programme maximiert werden. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 292 Akkreditierungsstandards auf einem hohen Niveau etabliert werden müssen, und somit im Zweifel weniger, dafür jedoch optimierte Programme eingeführt werden. • In Deutschland sind durch die ungenügenden Anreize zur Nutzung preiswerter Arzneimittel (Generika) noch große Kostensenkungspotentiale vorhanden. Diese können im Rahmen von Disease- Management- Programmen systematisch genutzt werden. Auch hier ist der Unterschied zu den USA zu sehen, wo diese Potentiale im Rahmen von Managed Care Ansätzen bereits vorab ausgeschöpft wurden. Wie bei der Verminderung der Krankenhauseinweisungen kann jedoch argumentiert werden, dass die Einsparpotentiale theoretisch auch durch andere gesetzgeberische Aktivitäten gehoben werden könnten. Insgesamt lassen sich gewichtige Argumente finden, die die Kosten- Effizienz der Disease Management Programme belegen. Die wichtigsten Argumente, wie Vermeidung von Krankenhauseinweisungen, Nutzung von Generika, systematische Umsetzung von Empfehlungen evidenzbasierter Leitlinien in die Routineversorgung, die zur Vermeidung akuter Komplikationen und zur Hinauszögerung von Folgeerkrankungen führen und so kurz- und langfristige Einsparpotenziale mobilisieren können. Dennoch kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass jedes Disease Management Programm in Deutschland nach angemessener Zeit einen direkten ökonomischen Nutzen für die Krankenkasse abwirft. Wie bereits oben dargestellt, müssen zum einen auch die nicht monetären Größen, wie Werbeeffekte und Kundenbindung an die Krankenkasse, berücksichtigt werden. Zum anderen muss beachtet werden, dass das Ziel der gesundheitlichen Versorgung die Erbringung höchster Qualität ist, also eine Verminderung von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Im Gutachten des Sachverständigenrates wurde in Band III/ 2001 explizit auf die derzeitig mangelhafte Situation in Deutschland eingegangen. Wenn qualitätsgesicherte Disease- Management- Programme es schaffen, hier eine bessere Situation in Deutschland herzustellen, ist bereits ein großer Schritt nach vorn geschafft. Das Prinzip der Unter- und Überversorgung zum gleichen Zeitpunkt macht deutlich, dass sich sehr wahrscheinlich kostendeckende und nicht kostendeckende Disease Management Programme ergänzen werden. Da einerseits der Abbau von Überversorgung erreicht werden kann, andererseits jedoch Unterversorgung vorherrscht, Disease Management in Deutschland – Kosten- Effektivität Seite 293 wird neben dem Qualitätseffekt der besseren Lebensqualität auch ein Mengeneffekt eintreten, indem die Patienten angemessene Leistungsmengen erhalten. Zwei Schlüsse sollten für die weitere Diskussion festgehalten werden: • Notwendig wäre es aus gesellschaftlicher Sicht, Ziele für die Beseitigung der Über-, Unter- und Fehlversorgung zu setzen, um so den Nutzen der DiseaseManagement- Programme evaluieren und dokumentieren zu können. Ohne eine breit angelegte quantifizierende Messung bleibt die Diskussion immer abhängig von wenig aussagekräftigen Einzelberichten. • Ein entscheidender Faktor für die Entscheidungsfindung auf Ebene der Krankenkassen ist es, ob das eigene Disease Management Programme über alle Kosten- und Nutzeneffekte (also sowohl direkte als auch indirekte Kosten und Nutzen) günstiger abschneidet als die Programme der Konkurrenz. Denn im Rahmen des Risikostrukturausgleich werden Durchschnittbeträge verrechnet, nicht tatsächliche Kosten und auch nicht Einsparungen. Es besteht somit der Anreiz, das eigene Programm neben der in der Literatur als unstrittig angesehenen Qualitätsverbesserung auch noch kostengünstiger als der Durchschnitt der Konkurrenz zu gestalten. Dass hier ein Wettbewerb entsteht, ist unter dem Gesichtspunkt des kompetitiven Gesundheitssystems nur wünschenswert. Die Sieger werden dabei erst nach einigen Jahren der Erfahrungssuche feststehen. Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 294 13 Qualitätssicherung Die übergeordneten Ziele des Disease Managements sind die Sicherung der medizinischen (Ergebnis-) Qualität sowie der Kosteneffektivität der Versorgung. Da aufgrund des Gesetzesentwurfs zur Reform des Risikostrukturausgleichs die Leistungsausgaben von Versicherten, die in Disease Management Programme eingeschrieben sind, im Risikostrukturausgleich besonders berücksichtigt werden sollen, besteht für die Krankenkassen ein starker Anreiz, die größtmögliche Anzahl von Versicherten in Disease Management Programme einzuschreiben. Eine weitgehend unkontrollierte Einschreibung in nicht qualitätsgesicherte Disease Management Programme kann jedoch u.a. zu folgenden Problemen führen: 1. Defizite in der Regelversorgung werden durch die Erbringung zusätzlicher Leistungen in Randbereichen kompensiert. Ein solches Vorgehen würde den Anforderungen am Disease Management nicht gerecht und würde folglich nicht zu den erwarteten Ergebnissen bezüglich der Verbesserung der Versorgungsqualität und der Stabilisierung der Kosten in der Gesetzlichen Krankenversicherung führen, sondern einen Kostenschub in der Versorgung auslösen 2. Es ist zu befürchten, dass es zu einer Ausdehnung von Zusatz- und „Service“– Leistungen in Randbereichen kommt und einer Intensivierung von Über-, Unterund Fehlversorgung in Randbereichen Vorschub geleistet wird, um Ärzte und Patienten zu möglichst hohen Einschreibequoten zu veranlassen. Damit wird eine Leistungsausweitung in Randbereichen an Stelle einer Qualitätsverbesserung im Zentrum der Versorgung unterstützt und es kommt zu einer Förderung von Leistungen, die nicht evidenzbasiert und nicht kosteneffektiv sind. 3. Eine Verbesserung von Qualität und Kosten- Effektivität der Versorgung durch Disease Management Programme in der Gesetzlichen Krankenversicherung kann daher nur durch die Definition von einheitlichen Anforderungen an die Qualitätssicherung und Struktur von Disease Management Programmen durch die Spitzenverbände sowie deren Überprüfung im Rahmen einer Akkreditierung und jährlichen Reakkreditierung gesichert werden. Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 295 13.1 Anforderungen an die Qualitätssicherung von Disease Management Programmen im Risikostrukturausgleich Die Anforderungen an die Qualitätssicherung von Disease Management Programmen im Risikostrukturausgleich sollten dazu beitragen, einheitliche, evidenzbasierte Standards in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu implementieren. Die Qualitätssicherung sollte daher mit der Festlegung geeigneter Erkrankungen und evidenzbasierter Leitlinien beginnen und bis zur Definition eines öffentlichen Benchmarkingverfahrens gehen. Tabelle 1 zeigt dazu ein mögliches Vorgehen. Tabelle 1: Anforderungen an die Qualitätssicherung bei Disease Management Programmen Wahl der Erkrankungen und Leitlinien, Definition von evidenzbasierten Versorgungszielen auf dem Boden von Über-, Unter- und Fehlversorgung Definition von Komponenten und Modulen der Disease Management Programme für chronisch Kranke zur Umsetzung der Versorgungsziele Definition von Indikatoren zur Evaluation der Programme auf dem Boden evidenzbasierter Leitlinien (Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität sowie Zielwerte) Programmentwicklung durch Krankenkassen auf dem Boden der gesetzlichen Vorgaben Monitoring der Programme und Evaluation medizinischer, ökonomischer und psychosozialer Kriterien Akkreditierung und Reakkreditierung durch Benchmarking [Quelle: Eigene Darstellung] 13.1.1 Wahl der Erkrankungen und Leitlinien, Definition von Versorgungszielen und Einschreibungskriterien durch die Spitzenverbände Die Wahl der Erkrankungen, die für die Disease Management Programme in der Gesetzlichen Krankenkasse im Rahmen des Risikostrukturausgleichs eingerichtet werden sollen, ist die Grundlage für eine Versorgungsverbesserung chronisch Kranker. Die Auswahl der Erkrankungen kann sich am Gutachten des Sachverständigenrats zur Über-, Unter- und Fehlversorgung orientieren [SVR Gutachten 2000/2001, Band Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 296 III]. Folgende Kriterien sollten bei der Auswahl der Erkrankungen berücksichtigt werden [Lauterbach et al., 2001]: (1) Hohe Prävalenz der Erkrankung (2) Hohe Morbidität / Mortalität (3) Chronischer Verlauf und definierte Krankheitsstadien (4) Hohe Krankheitskosten (5) Messbarkeit klinischer und ökonomischer Ergebnisse (6) Varianz in der Versorgung (7) Vorhandensein evidenzbasierter Standards für Screening, Therapie und Weiterbetreuung Zur Definition der Versorgungsziele und der zu erreichenden Standards können, beispielsweise in Anlehnung an das Gutachten des Sachverständigenrats [SVR Gutachten 2000 / 2001, Band III] Bereiche mit Über-, Unter- und Fehlversorgung für ausgewählte Erkrankungen identifiziert werden. Später können auch die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses nach § 137e zugrunde gelegt werden. Dann sollten für jede der ausgewählten Erkrankungen drei bis vier evidenzbasierte Leitlinien von den Spitzenverbänden festgelegt werden. Auf dem Boden dieser deutschen und internationalen evidenzbasierten Leitlinien können dann kassenübergreifende, einheitliche und verbindliche Versorgungsziele sowie entsprechende Standards definiert werden. Die Definition kassenindividueller Versorgungsziele und Standards sollte unbedingt vermieden werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich das Problem von derzeit nicht vorhandenen Versorgungszielen und Standards zum Vorhandensein multipler, sich gegenseitig widersprechender Versorgungsziele und Standards verschiebt. Zum größtmöglichen Schutz vor Manipulation sollten von den Spitzenverbänden einheitlich und gemeinsam evidenzbasierte Kriterien definiert werden, anhand derer das Vorliegen der Erkrankung durch den Hausarzt bzw. den einschreibenden Arzt diagnostiziert werden kann. Diese Kriterien können deutschen bzw. internationalen, evidenzbasierten Leitlinien entnommen werden. Zusätzlich kann eine Prüfung der Einschreibung • durch einen zweiten Arzt oder • durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder • anhand des Benchmarkingdatensatzes erfolgen. Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 297 Durch die vierteljährliche Erhebung des Benchmarkingdatensatzes würde eine fortlaufende bewusste Manipulation des Datensatzes erforderlich sein, sollten nicht geeignete Patienten eingeschrieben werden. Davon ist nur in seltenen Fällen auszugehen, die zudem durch Stichprobenkontrollen aufgedeckt werden könnten (siehe zur Funktion des Benchmarkingdatensatzes Kapitel Datenmanagement, Dokumentation und Datenbanken im Disease Management, Abbildung 9). Der Patient erklärt bei der Einschreibung, dass er mit einer den Rahmen des Notwendigen nicht übersteigenden Zusammenführung und Auswertung seiner persönlichen Daten durch die Krankenkasse einverstanden ist. 13.1.2 Definition der Module und Komponenten für Disease Management Programme sowie der Anforderungen an die Module und Komponenten Die zur Erfüllung der Versorgungsziele einzusetzenden Komponenten und Module der Programme sollten von den Spitzenverbänden einheitlich und verbindlich definiert werden. Für die einzusetzenden Komponenten und Module sollte Evidenz vorliegen, dass sie zur Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen. Die Implementierung der Module und Komponenten sollte dagegen den Kassen überlassen bleiben. Dieses Vorgehen vermeidet die Finanzierung von Schein- Disease Management Programmen und erlaubt aber gleichzeitig eine Adaption der Programme an kassenindividuelle und lokale Gegebenheiten. Zu den von den Spitzenverbänden zu definierenden Komponenten gehören insbesondere die Auswahl evidenzbasierter Leitlinien sowie die Definition der Anforderungen an evidenzbasierte Patientenleitlinien, Patientenschulungen, Erinnerungssysteme, Informationssysteme, ärztliche Fortbildung sowie ein Evaluationskonzept (s.u.). Zu den Modulen gehört die Definition der Mindestbestandteile und Standards eines Basismoduls sowie die Definition von Mindestanforderungen und Standards ergänzender Module, deren Einsatz entsprechend Risikostratifizierung erfolgt (siehe Kapitel Vorschlag zum Aufbau eines Disease Management in Deutschland). Durch die Festlegung einheitlicher Module und Komponenten soll verhindert werden, dass Schein- Disease Management Programme nur ein oder zwei Komponenten, wie z.B. die Betreuung durch ein CallCenter, implementieren. Ebenso soll verhindert werden, dass Programme nur ein Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 298 Modul definieren, wie z. B. in einem Diabetes- Programm das Ergänzungsmodul Komplikationstherapie Retinopathie und das gesamte Spektrum an Basistherapie und spezifischer Therapie von Komplikationen nicht implementiert wird. 13.1.3 Definition von Kriterien zur Evaluation der Programme Die Kriterien zur Überwachung der Erfüllung der Versorgungsziele sind für jede einzelne Erkrankung verbindlich festzulegen. Dazu werden ausgewählte Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität (s.u.) definiert. Sie werden zu einem Datensatz zusammengefasst, der die wichtigsten Parameter zur Steuerung der Patientenversorgung als auch für ein periodisches Benchmarking enthält. Die Kriterien können nationalen und internationalen evidenzbasierten Leitlinien entnommen werden. Anhand der Kriterien sollte überprüft werden können, • ob es sich um Schein- Disease Management Programme ohne die notwendigen Komponenten und Module handelt und • ob die Programme die Versorgungsziele erreichen. Die Kriterien sollen dem Arzt einen raschen Überblick über erreichte Therapieziele, Defizite in der Therapie, noch durchzuführende Untersuchungen und ggf. über die medikamentöse Therapie geben und so die Steuerung einer evidenzbasierten Therapie durch den Arzt erleichtern. Eine Auswahl dieser Kriterien kann für die Reakkreditierung und das Benchmarking herangezogen werden (s.u. Reakkreditierung von Disease Management Programmen). Der überwiegende Teil der Kriterien sollte im Rahmen der Routine erhoben werden können und keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedingen. 13.1.4 Programmentwicklung durch geeignete Institutionen, wie z.B. die Krankenkassen, auf dem Boden der gesetzlichen Vorgaben Folgende Punkte sollten von den Krankenkassen bei der Programmentwicklung berücksichtigt werden: (1) Einschreibekriterien der Versicherten auf dem Boden evidenzbasierter Leitlinien zum größtmöglichen Schutz vor Manipulation Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 299 (2) Therapie nach evidenzbasierten Leitlinien zum Abbau von Über-, Unterund Fehlversorgung (3) Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und kosteneffektiven Versorgung (4) Schulungen zur Unterstützung des Patientenselbstmanagements (5) Evaluation der Programme mit Dokumentation der erreichten Ziele der Programme und (6) Anforderungen an die Akkreditierung und Reakkreditierung der Programme. Schon in der Entwicklungsphase sollte ein ständiger Abgleich zwischen Programmentwurf und den Vorgaben erfolgen. Die Festlegung der Rahmenbedingungen soll gewährleisten, dass ein Qualitätswettbewerb um die Erfüllung der Versorgungsziele und nicht um die Definition der Versorgungsziele einsetzt. Empfehlenswert ist es daher, schon in der frühen Planungsphase ein interdisziplinäres Team unter Einbeziehung von Experten aller Bereiche zu bilden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die angestrebten Qualitätsverbesserungen auch tatsächlich erreicht werden. 13.1.5 Monitoring durch eine unabhängige Institution: Das Monitoring der Programme erfolgt auf unterschiedlichen Stufen: (1) Einschreibung: Das Einschreibeverfahren sichert den Zugang zum Disease Management Programm für alle Erkrankten, welche die definierten Einschreibekriterien erfüllen. Gleichzeitig schützt es vor einem Missbrauch des Verfahrens infolge einer Einschreibung ungeeigneter Versicherter. Mögliche Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen des Einschreibeverfahrens umfassen folgende Punkte: • Definition der Einschreibekriterien auf einer evidenzbasierten Grundlage • Überprüfung der Einschreibung durch die Einholung einer zweiten Meinung • Stichprobenprüfung der Einschreibung beispielsweise durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen • Prüfung auf „Karteileichen“ durch den Benchmarkingdatensatz (s.u.). Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung (2) Seite 300 Dokumentation: Die Dokumentation dient der Datensammlung in den Programmen und dem Patientenmanagement. Sie sollte daher die einheitlichen Zielwerte und Behandlungsziele sowie die Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität erfassen. Dokumentiert werden sollten krankheitsspezifische wichtige Untersuchungsergebnisse sowie Fragen zu den durchgeführten Untersuchungen und Schulungen. Da das Monitoring auf Arzt- und Krankenkassenebene erfolgt, sollten auf beiden Ebenen das Datenmaterial zeitnah und in entsprechender Form aufbereitet zur Verfügung stehen. Die Daten sollten (falls keine Vernetzung besteht) quartalsweise von der Arztpraxis an die Krankenkasse übermittelt werden, um so die Steuerung des Remindersystems und eine zentrale Erfassung des Benchmarkingdatensatzes zu gewährleisten. Die Übermittlung könnte beispielsweise anhand von Vordrucken erfolgen, die die Krankenkassen dem Arzt zur Verfügung stellen. Arzt und Patient füllen diese im Rahmen eines Routinepraxisbesuchs gemeinsam aus und unterschreiben gemeinsam. Zugrunde gelegt werden jeweils die zuletzt erhobenen Werte. Da viele Werte in der Regel nur einmal pro Quartal untersucht werden (z.B. der HbA1c), erscheint dies ausreichend. Für die für die Reakkreditierung notwendigen Daten aus dem Benchmarkingdatensatz könnte dann der Wert des letzten Quartals herangezogen werden. Das genaue Vorgehen ist von den Spitzenverbänden zu definieren. Die Übermittlung der Datensätze an die Krankenkasse dient aber nicht nur der Zusammenfassung der für die Reakkreditierung notwendigen Daten. Die Krankenkasse sollte dem Arzt auch über die von ihm erreichten Therapieergebnisse im Vergleich zu Peers Rückkoppelung geben. Die Dokumentation sollte ferner den Anforderungen des Datenschutzes genügen. (3) Benchmarking: Das Benchmarking ist für das Monitoring ein aussagekräftiges und wirkungsvolles Instrument, das international erfolgreich zur Qualitätsverbesserung eingesetzt wird (s.u.). Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 301 13.2 Akkreditierung von Disease Management Programmen Die Akkreditierung eines Disease Management Programms bedeutet: 1. Prüfung der Konformität des Disease Management Programms mit den durch die Spitzenverbände definierten Anforderungen auf dem Boden der gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen 2. Bewertung des Konzeptes des Programms, ob die krankheitsspezifischen Indikatoren erhoben werden und ob aus dem Ergebnis Qualitätssicherungsmaßnahmen abgeleitet werden In der Ausgestaltung von Disease Management Programmen im Risikostrukturausgleich kommt der Akkreditierung und der Reakkreditierung (s.u.) eine zentrale Bedeutung im Rahmen der Qualitätssicherung zu. Durch den Ausgleich der durchschnittlichen Leistungsausgaben für in Disease Management eingeschriebene chronisch Kranke im Risikostrukturausgleich entsteht für die Krankenkassen ein starker Anreiz, möglichst viele ggf. auch ungeeignete Versicherte in die Programme einzuschreiben und dabei die Qualität der Programme zu vernachlässigen. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da amerikanische Erfahrungen gezeigt haben, dass Qualitätsunterschiede in der Prozess- und Ergebnisqualität von Disease Management Programmen in erster Linie mit der Qualität des Programms korrelieren [The State of Managed Care Quality Report, 2000]. Beispielsweise variieren in verschiedenen Programmen, die von denselben Leistungserbringern durchgeführt werden, aber von unterschiedlichen Programmanbietern angeboten werden, jährliche Überweisungsraten von Diabetikern zum Augenarzt von < 10% bis zu > 80%. Die Behandlung mit Beta- Blockern bei koronarer Herzkrankheit variiert bei Programmen unterschiedlicher Anbieter, die von denselben Leistungserbringern durchgeführt werden, von 40% bis ca. 100%. Das Akkreditierungsverfahren im Disease Management sollte daher folgende Funktionen erfüllen: • Prüfung, ob der Aufbau einer Dokumentation der Prozess- und Ergebnisqualität anhand definierter Qualitätskriterien erfolgt • Feststellung, ob eine Überprüfung der Prozess- und Ergebnisqualität aufgrund der Programmstruktur erfolgen kann Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung • Seite 302 Überprüfung, ob durch das Programm eine Bewertungsgrundlage für die Prozess- und Ergebnisqualität mit Identifizierung von Verbesserungspotenzialen und Initiierung eines kontinuierlichen Qualitätsverbesserungsverfahrens gegeben ist. Um die genannten Funktionen erfüllen zu können, muss das Akkreditierungsverfahren definierte Anforderungen erfüllen: Anforderungen an die Dokumentation der Qualität: • Die zu erhebenden Indikatoren sollten mit vertretbarem Aufwand in der Regelversorgung zu erheben sein • Die Indikatoren sollten messbar, valide und evidenzbasiert sein • Die Indikatoren sollten Prozess- und Ergebnisqualität (ggf. auch Surrogatparameter wie Zielwerte) umfassen • Die Dokumentation muss datenschutzrechtlichen Belangen entsprechen • Die zu dokumentierenden Daten sollen zeitnah aufbereitet und die Ergebnisse ggf. nach Zielgruppen getrennt zur Verfügung gestellt werden können Anforderungen an die Prüfung der Qualität: • Die Prüfung der Qualität sollte durch eine unabhängige Institution (z.B. durch das Bundesversicherungsamt) vorgenommen werden • Die Prüfung sollte nach einem veröffentlichten Prüfmanual erfolgen, dessen Kriterien von den Organen der Selbstverwaltung oder ersatzweise durch den Gesetzgeber festgelegt werden • Die Ergebnisse der Prüfung sollten exemplarisch anhand definierter Indikatoren (Benchmarking) veröffentlicht werden Anforderungen an die Bewertung der Qualität: • Grundlage der Bewertung sind die Standards der evidenzbasierten Medizin • Die Bewertung erfolgt an Hand eines verbindlich vorgegebenen Benchmarkingdatensatzes, der von den Programmanbietern (Krankenkassen) erhoben wird • Das Konzept zur Erhebung des Benchmarkingdatensatzes (Evaluation) muss von den Programmanbietern bereits zur (Erst-) Akkreditierung vorgelegt werden • Das Konzept zur Erhebung des Benchmarkingdatensatzes muss bereits Vorschläge zur Initiierung von Qualitätsverbesserungsprozessen beinhalten Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 303 Von dem Aufbau einer programmübergreifenden Dokumentation der Prozess- und Ergebnisqualität konnten international positive Auswirkungen auf die Qualität von Disease Management Programmen nachgewiesen werden [The State of Managed Care Quality, 2000]. Allerdings ist die Dokumentation der Prozess- und der Ergebnisqualität alleine für eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung nicht ausreichend. Um diesen Prozess wirkungsvoll in Gang zu bringen, sollte die Bewertung sowie die Veröffentlichung der Qualitätsergebnisse hinzukommen. Die Dokumentation ermöglicht zwar die Identifizierung von Schwachstellen, nachgewiesene Verbesserungen in den Qualitätsergebnissen können aber erst durch die Veröffentlichung der dokumentierten Ergebnisse erwartet werden. So weisen akkreditierte Programme, deren Ergebnisse veröffentlicht werden, konstant bessere Ergebnisse auf als nichtakkreditierte Programme, die ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen. Weiterhin kann durch die kontinuierliche Dokumentation und Veröffentlichung bei den einzelnen Programmen eine ständige Qualitätsverbesserung im Vergleich zu den Ergebnissen des letzten Jahres festgestellt werden. Beispielsweise besteht zwischen Programmen, die seit Jahren ihre Ergebnisse im HEDIS- Projekt veröffentlichen und Programmen, die zum ersten Mal an HEDIS teilnehmen ein Unterschied im Erfüllungsgrad der Indikatoren von durchschnittlich 25% (www.ncqa.org/pages/communications). Diese Unterschiede werden auch in Bereichen, die nicht durch die veröffentlichten Indikatoren abgedeckt werden, wie z.B. der Prozentsatz der Programmteilnehmer, bei denen ein Cholesterinscreening durchgeführt wurde, nachgewiesen. Das bedeutet, dass für das eigentliche Benchmarking ein Datensatz ausreicht, der nicht alle sondern nur eine definierte Auswahl von im Benchmarkingdatensatz erfassten Indikatoren enthält. Aufgrund des durch den Vergleich einiger weniger Indikatoren initiierten Qualitätsverbesserungsprozesses können auch in den nicht im Benchmarking veröffentlichten Bereichen deutliche Qualitätsverbesserungen verzeichnet werden. So waren Patienten, die in Programme eingeschrieben waren, die unter den Top 25% der HEDIS Ergebnisse lagen, mit ihren Programmen deutlich zufriedener als Patienten in Programmen, deren HEDIS Ergebnisse niedriger lagen (62,6% vs. 55,3%). 13.2.1 Kriterien der Akkreditierung Die Kriterien für die Akkreditierung sollten von den Spitzenverbänden einheitlich und verbindlich festgelegt werden. Sie können beispielsweise zu gleichen Anteilen aus krankheitsspezifischen und aus programmspezifischen Akkreditierungskriterien be- Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 304 stehen. Mit Hilfe der programmspezifischen Akkreditierungskriterien kann zusätzlich ein programmindividueller Qualitätsscore (s.u.) ermittelt werden. Die Akkreditierung kann dann durch eine geeignete Institution anhand eines Leitfadens vorgenommen werden. Dieser Leitfaden beinhaltet zwei Merkmale des Prüfverfahrens: 1. Krankheitsspezifische Akkreditierungskriterien 2. Programmspezifische Akkreditierungskriterien mit Bestimmung eines programmindividuellen Qualitätsscores Krankheitsspezifische Akkreditierungskriterien: Für die krankheitsspezifischen Akkreditierungskriterien werden die ausgewählten Indikatoren des Benchmarkingdatensatzes zugrunde gelegt und mit Hilfe eines Leitfadens bewertet (s.u.). Da die Erstakkreditierung vor der Implementierung der Programme erfolgt, können noch keine Ergebnisse als Bewertungsgrundlage der krankheitsspezifischen Kriterien herangezogen werden, wie z.B. der Prozentsatz der eingeschriebenen Diabetiker, die jährlich zum Augenarzt überwiesen werden. Dies ist erst im Rahmen der Reakkreditierung möglich. Daher sollte für die Erstakkreditierung lediglich die Struktur der Programme sowie das Konzept zur Dokumentation, Auswertung und Entscheidungsunterstützung der krankheitsspezifischen Indikatoren bewertet werden. Tabelle 2 zeigt exemplarisch den Teil des Leitfadens, der die krankheitsspezifischen Akkreditierungskriterien für ein Diabetes- Programm erfasst. Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 305 Tabelle 2: Leitfaden zur Prüfung der krankheitsspezifischen Akkreditierungskriterien am Beispiel eines Diabetes Programms Parameter Ausprägung Indikatoren der Prozessqualität • • • • • • • • • Zielwerte • • • Indikatoren der Ergebnisqualität • • • • Wird der HbA1c nach Risikostratifizierung dokumentiert und ausgewertet? Wird der LDL- Cholesterinwert nach Risikostratifizierung dokumentiert und ausgewertet? Wird die Fußinspektion vierteljährlich dokumentiert und ausgewertet? Wird die jährliche Überweisung zum Augenarzt dokumentiert und ausgewertet? Wird das Screening auf Mikroalbuminurie nach Risikostratifizierung dokumentiert und ausgewertet? Wird die Schulungsteilnahme des Patienten dokumentiert und ausgewertet? Wird die Teilnahme der Ärzte an Fortbildungen dokumentiert und ausgewertet? Werden Reminder eingesetzt und ausgewertet? Werden Schnittstellen definiert und ausgewertet? Werden Zielwerte für HbA1c in Übereinstimmung mit den von den Spitzenverbänden definierten Standards vorgeschlagen und Entscheidungsunterstützung angeboten? Werden Zielwerte für den LDL- Cholesterinwert in Übereinstimmung mit den von den Spitzenverbänden definierten Standards vorgeschlagen und Entscheidungsunterstützung angeboten? Werden Zielwerte für den systolischen/ diastolischen Blutdruck in Übereinstimmung mit den von den Spitzenverbänden definierten Standards vorgeschlagen und Entscheidungsunterstützung angeboten? Wird das Vorliegen einer diabetischen Nephropathie dokumentiert und Entscheidungsunterstützung gewährt? Wird das Vorliegen einer diabetischen Neuropathie dokumentiert und Entscheidungsunterstützung gewährt? Wird das Vorliegen von Fußulzera/ Amputationen dokumentiert und Entscheidungsunterstützung gewährt? Wird das Vorliegen einer diabetischen Retinopathie dokumentiert und Entscheidungsunterstützung gewährt? [Quelle: Eigene Darstellung] Kriterien zur Akkreditierung der Programmstruktur : Für die Akkreditierung der Struktur der Programme werden allgemeine Qualitätsmerkmale herangezogen, mit deren Hilfe die Konformität des Programms mit den durch die Spitzenverbänden definierten Anforderungen überprüft werden kann. Ein möglicher Vorschlag ist in folgender Tabelle zu sehen. In diesem Vorschlag wird für jedes Kriterium eine Minimalanforderung des Ausprägungsgrades definiert, die unbedingt erfüllt werden sollte. Sie ist in der Tabelle grau unterlegt. Um eine tatsächliche Verbesserung der Versorgungsqualität und eine Kostenstabilisierung zu erreichen, sollte allerdings der jeweils höchste Ausprägungsgrad angestrebt werden. Zusätzlich sollten die Kriterien der Einschreibung sowie die Datenbanken der am Di- Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 306 sease Management Programm Beteiligten bei der Akkreditierung berücksichtigt werden. Da diese beiden Kriterien aber nicht bei der Ermittlung des Qualitätsscores (Tabelle 4) berücksichtigt werden, sind sie in der Tabelle nicht weiter aufgeführt. Tabelle 3: Mögliche Qualitätskriterien zur Struktur von Disease Management Programmen im Rahmen der Akkreditierung (I niedrigster Ausprägungsgrad, III höchster Ausprägungsgrad) Medizinische Dimension III evidenzbasierte Leitlinien für Ärzte Individuelle Therapieempfehlungen nach Risikoprofil u. Laborergebnissen + Kriterien II Evidenzbasierte Leitlinen für Patienten Individuelle PatientenTherapieempfehlungen (z.B. auch Internetbasiert) + Kriterien II Evaluation ReminderSysteme Patientenschulungen Fortbildungen für Ärzte Evaluationskonzept Interaktive, individuelle computergestützte Reminder Schulung nach Risikostratifizierung, Einsatz evaluierter didaktischer Methoden, Patientenberatungen, Einbindung von Selbsthilfegruppen, sektorenübergreifende Koordination Interaktive Fortbildung (Disease Management Zirkel) mit Einsatz von Meinungsführern oder Peer Group Review + Kriterien II Randomisierte oder kontrollierte Studien und Rückmeldung der Ergebnisse II gute Verständlichkeit, Evidenzbasierung und Implementierungsstrategien Gute Laienverständlichkeit, Evidenzbasierung und ImplementieRungsstrategien Spezifische Reminder (Laborparameter etc) unter Berücksichtigung des jeweiligen Patientenprofils Spezifische Informationen nach Risikostratifizierung durch Einsatz didaktischer Methoden und Hilfsmittel I Evidenzbasierung Evidenzbasierung Unspezifische Reminder unspezifische Informationen durch Broschüren, Frontalvorträge o.ä.. [Quelle: Eigene Darstellung] Infrastruktur Ziel ist es, langfristige Verhaltensänderungen zu bewirken Fortbildung mit evidenzbasierten Inhalten und Evaluation „Klassische Fortbildung“ mit Frontalvorträgen und evidenzbasierten Inhalten Messung von Ergebnisund Prozessindikatoren auf Grundlage historischer Kontrollen oder im Vgl. zum Gesamtkollektiv und Rückmeldung der Ergebnisse Messung von Prozessindikatoren auf Grundlage historischer Kontrollen und Rückmeldung der Ergebnisse Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 307 Um eine einfache Beurteilung durch das Bundesversicherungsamt zu ermöglichen, kann ein Leitfaden zur Bewertung der Programmstruktur entwickelt werden. Ein möglicher Vorschlag ist Tabelle 4 zu entnehmen. Disease Management in Deutschland - Qualitätssicherung Seite 308 Tabelle 4: Leitfaden zur Beurteilung der Struktur von Disease Management Programmen Komponente Ausprägung Punktzahl / Gesamt Evidenzbasierte Leitlinien für Ärzte Sind individuelle Therapieempfehlungen nach Risikostratifizierung enthalten? Sind die Leitlinien klar und verständlich formuliert? Sind Implementierungsstrategien vorhanden? Sind die Leitlinien evidenzbasiert? 100 100 100 800 1100 Sind individuelle Therapieempfehlungen nach Risikostratifizierung enthalten? Sind die Leitlinien klar und verständlich formuliert? Sind Implementierungsstrategien vorhanden? Sind die Leitlinien evidenzbasiert? 100 100 100 600 900 Sind die Schulungen nach Risikostratifizierung zugeschnitten? Werden evaluierte didaktische Methoden eingesetzt? Sind Selbsthilfegruppen eingebunden? Werden die Schulungen sektorenübergreifend koordiniert? Sind die Schulungsinhalte evidenzbasiert? 100 100 100 100 400 800 100 100 400 600 Werden Disease Management Zirkel eingerichtet? Sind die Fortbildungskonzepte interaktiv? Werden die Fortbildungen evaluiert? Sind die Inhalte der Fortbildungen evidenzbasiert? Werden Mindestanzahl und Inhalte von Ärztefortbildungen spezifiziert? 100 100 200 200 100 700 Werden randomisierte und kontrollierte Studien durchgeführt? Werden die Evaluationsergebnisse an die am Disease Management Beteiligten zurückgemeldet? Werden evidenzbasierte Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität gemessen? 200 300 400 900 Evidenzbasierte Leitlinien für Patienten Patientenschulungen Remindersysteme Werden interaktive Reminder eingesetzt? Werden spezifische Reminder eingesetzt? Werden unspezifische Reminder eingesetzt? Fortbildungen für Ärzte Evaluationskonzept [Quelle: Eigene Darstellung] Seite 309 Dieser Leitfaden (Tabelle 4) kann mit einem Qualitätsscore versehen werden, der sich an den jeweiligen Komponenten orientiert. Zum Zwecke der Illustration könnten z.B. insgesamt 5.000 Punkte erzielt werden. Gefordert wird aus jeder Komponente eine Mindestpunktzahl von 400. Die geforderte Gesamtmindestpunktzahl zur Akkreditierung würde 3.200 betragen. Somit wird ein gesicherter Mindeststandard in der Versorgung garantiert (Dieser Beispielsscore beruht nicht auf einer validierten Gewichtung, da er nur zur Illustration dient). Für die Komponente „Evidenzbasierte Leitlinien für Ärzte“ kann eine Gesamtpunktzahl von 1.100 Punkten erreicht werden, wenn alle Ausprägungen erfüllt sind. Für die jeweiligen Fragen innerhalb der Komponente sind individuelle Punktwertungen zu vergeben. Die jeweilige Höchstzahl ist für den Mindeststandard angegeben. Die Addition aller Werte ergibt die Gesamtpunktzahl der jeweiligen Komponente. Das Programm erhält letztendlich dann die Zulassung, wenn es die definierten Anforderungen an die krankheitsspezifischen und programmspezifischen Akkreditierungskriterien erfüllt. 13.3 Reakkreditierung von Disease Management Programmen Das Reakkreditierungsverfahren im Disease Management sollte folgende Funktionen erfüllen: • Aufbau einer Dokumentation der Prozess- und Ergebnisqualität anhand definierter Qualitätskriterien • Überprüfung der Prozess- und Ergebnisqualität • Schaffung einer Bewertungsgrundlage der Prozess- und Ergebnisqualität mit Identifizierung von Verbesserungspotenzialen und Initiierung eines kontinuierlichen Qualitätsverbesserungsverfahrens Die Qualitätssicherung der Programme sollte neben der Akkreditierung eine jährliche Reakkreditierung durch ein Benchmarkingverfahren umfassen. Internationale Erfahrungen zeigen, dass ein Benchmarkingverfahren mit Veröffentlichung der Ergebnisse ein sehr wirkungsvolles Instrument zur Qualitätssicherung von Disease Management Seite 310 Programmen darstellt. Dem Benchmarkingverfahren liegt der Benchmarkingdatensatz zugrunde, der gleichzeitig mehrere Anforderungen erfüllt : • Er liefert die Daten, die es der Krankenkasse erlauben, aktiv am Disease Management teilzunehmen und Arzt und Patienten mit spezifischen Angeboten (Schulungen, patientenindividuelle Therapieempfehlungen, Reminder etc) zu unterstützen. • Da die Daten von dem Arzt mitgeteilt werden, der das Formular unterschrieben hat, kann die Krankenkasse sich auf die Richtigkeit der Daten in der Regel verlassen. Daten vom Patienten selbst oder auf der Grundlage von Auswertungen elektronischer Datensätze wären zur Zeit noch nicht ausreichend zuverlässig. • Da auch der Patient die Daten unterschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit der Mitteilung „zu guter“ Werte reduziert. Der Patient trägt zum Monitoring der Daten bei. Durch die quartalsweise Erhebung des Benchmarkingdatensatzes stehen Arzt, Patient und Kasse die Daten zeitnah zur Verfügung. Damit ist ein rasches Eingreifen und die frühzeitige Korrektur von Abweichungen möglich. • Die Bögen stellen eine ausgezeichnete Grundlage zum Benchmarking der Programme dar. Durch diese Daten kann ermittelt werden, welchen Programmen es gelingt, die wichtigsten Laborwerte, Untersuchungen und Behandlungen als Parameter der Prozessqualität günstig zu beeinflussen. In den Vereinigten Staaten hat die Dokumentation eines solchen minimalen Benchmarkingdatensatzes im HEDIS Programm wesentlich zur Verbesserung der Qualität der Versorgung beigetragen. • Die Bögen sind ebenfalls eine gute Grundlage für die Prüfung der Programme zum Zwecke der Akkreditierung und Reakkreditierung durch das BVA (s.u.). Auf der Grundlage der Bögen kann das BVA erkennen, ob die Patienten an dem Disease Management überhaupt teilgenommen haben und ob die wichtigsten zum Disease Management gehörenden Leistungen erbracht wurden. Dazu gehören z.B. die vereinbarten Schulungen, Laboruntersuchungen und Behandlungen. Versicherte, für die keine Bögen vorliegen, sollten nach Ablauf einer definierten Frist keine Berücksichtigung im RSA- Ausgleichsverfahren finden. Nur so kann das Mitführen von „Karteileichen“ zur Abrechnungsmanipulation im RSA verhindert werden. Seite 311 • Durch den Datensatz wird vermieden, dass sich das Disease Management, wie oben beschrieben, auf nicht evidenzbasierte Randbereiche konzentriert und zu einer Intensivierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung führt. • Auch eine effizientere Arzneimitteltherapie kann über den Benchmarkingdatensatz erreicht werden, indem beispielsweise die Therapie mit Second- line Drugs abgefragt und begründet werden muss. Medikamente, die nicht kosteneffektiv sind bzw. deren Wirksamkeit nicht gesichert ist, wie z.B. Pseudoinnovationen oder Me- too Präparate, könnten so in der Verordnungshäufigkeit zurückgedrängt werden. Der kostenstabilisierende Effekt des Disease Managements würde verstärkt. Die Richtigkeit der gemachten Angaben können die Krankenkassen in ihren Arzneimitteldaten untersuchen, die sie auf der Grundlage der Einwilligung der Patienten unter Berücksichtigung des Datenschutzes auswerten dürfen. Die entscheidende Größe beim Benchmarking ist die erreichte Verbesserung eines Programms, die ggf. prozentual zum Vorjahresergebnis ausgedrückt werden kann. Damit wird verhindert, dass Programme, die eine hohe Anzahl von Patienten mit schlechten Ausgangswerten einschreiben, benachteiligt werden oder von Kassen überwiegend Patienten mit guten Ausgangswerten eingeschrieben werden. Kassen, die eine große Anzahl schlecht eingestellter Patienten einschreiben, haben so ein großes Potenzial zur Verbesserung. Internationale Erfahrungen, wie z.B. das HEDIS- Projekt in den USA, zeigen, dass ein Datensatz von z.B. 10 bis 15 Qualitätsindikatoren pro Erkrankung ausreichend ist (Tabelle 5), um ein aussagekräftiges Benchmarking durchführen zu können. Tabelle 5: Beispiel eines minimalen Datensatzes für Zuckerkranke des USamerikanischen HEDIS- Projektes Disease Management Programm Krankheitsspezifische Daten Zuckerkrankheit Kontrolle des LDL-Cholesterins LDL-Cholesterin im Normbereich Kontrolle von HbA1c HbA1c außerhalb eines definierten Zielbereichs Screening auf Nierenschäden Jährliche Überweisung zum Augenarzt [Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an HEDIS] Seite 312 Zwar weist der HEDIS- Benchmarkingdatensatz für Diabetes (Tabelle 5) bisher nur sechs Kriterien auf. Es wird aber diskutiert, auch ihn um weitere Indikatoren der Ergebnisqualität und der Patientenzufriedenheit zu erweitern. Für die Reakkreditierung und das Benchmarking der Programme können daher ca. 10-15 Indikatoren des krankheitsspezifischen Benchmarkingdatensatzes ausgewählt, durch die Kasse in einem neuen Datensatz zusammengefasst und an die Institution, die die Reakkreditierung bzw. das Benchmarking durchführt (z.B. das Bundesversicherungsamt), weitergeleitet werden. Die ausgewählten Indikatoren sollten durch die Spitzenverbände einheitlich bestimmt und festgelegt werden. Als Bewertungsgrundlage der krankheitsspezifischen Kriterien könnte dann der Prozentsatz der Erfüllung spezifischer Kriterien herangezogen werden, wie z.B. der Prozentsatz der eingeschriebenen Diabetiker, die jährlich zum Augenarzt überwiesen werden. Tabelle 6 zeigt ein Beispiel für einen derartigen "verkürzten" Benchmarkingdatensatz zur Reakkreditierung für ein Diabetesprogramm. Ein solcher Datensatz kann für alle Disease Management Programme in der Gesetzlichen Krankenversicherung auf dem Boden des zentralen Benchmarkingdatensatzes erstellt werden. Tabelle 6: "Verkürzter" Benchmarkingdatensatz für die Reakkreditierung am Beispiel eines Disease Management Programms für Diabetes Mellitus. Benchmarkingdatensatz Diabetes für die Reakkreditierung - Wurde der HbA1c erhoben: ja / nein - Ist der HbA1c– Zielwert erreicht: ja / nein - Wurde der LDL- Cholesterinwert erhoben: ja / nein - Ist der LDL- Cholesterinzielwert erreicht: ja / nein - Wurde der Blutdruck gemessen: ja / nein - Erfolgte eine Augenuntersuchung in diesem Jahr: ja / nein - Erfolgte eine Fußinspektion in diesem Jahr: ja / nein - Erfolgte ein Test auf Mikroalbuminurie: ja / nein - Nahm der Patient an Patientenschulungen teil : ja / nein - Fand eine Disease Management Programm- Ärztefortbildung statt: ja / nein - Wurden Reminder für Ärzte eingesetzt: ja / nein - Wurden Reminder für Patienten eingesetzt: ja / nein - Wurden die definierten Schnittstellen eingehalten (Überweisungen zu Fachärzten): ja / nein [Quelle: Eigene Darstellung] Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 313 14 Literatur 1. AHIMA. American Health Information Management Association. Position statement. Issue: quality management and improvement in healthcare reform. J Ahima 1994; 65:2d suppl 1-2, following p. 84. 2. Albert NM, Young JB. Heart failure disease management: a team approach. Cleve Clin J Med 2001; 68:53-62; discussion 63-4. 3. Alberti KG, Gries FA, Jervell J, Krans HM. A desktop guide for the manage- ment of non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM): an update. European NIDDM Policy Group. Diabet Med 1994; 11:899-909. 4. Alberti KG, Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mel- litus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med 1998b; 15:539-553. 5. Aldana SG. Financial impact of health promotion programs: a comprehensive review of the literature. Am J Health Promot 2001; 15:296-320. 6. Alessi NE, Huang MP, Quinlan P. The Zachman Framework: An Information System Architecture for DMS. Disease Mnagement 1999; 2:97-101. 7. American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations 1998. Diabetes Care 1998; 21:1-97. 8. American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations 2000. Diabetes Care 2000; 23. 9. American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations 2001. Diabetes Care 2001; 24 Supplement 1:1-127. 10. American Diabetes Association. American Diabetes Association: clinical prac- tice recommendations 1997. Diabetes Care 1997; 20:S1-S70. 11. American Heart Association. Dietary Guidelines for Healthy American Adults. http://www.americanheart.org/Scientific/statements/1996/1001.htm 1996. 12. Andersen RE, Wadden TA, Bartlett SJ, Zemel B, Verde TJ, Franckowiak SC. Effects of lifestyle activity vs structured aerobic exercise in obese women: a randomized trial. JAMA 1999; 281:335-40. 13. Anderson RM, Funnell MM, Butler PM, Arnold MS, Fitzgerald JT, Feste CC. Patient empowerment. Results of a randomized controlled trial. Diabetes Care 1995; 18:943-9. Disease Management in Deutschland - Literatur 14. Seite 314 AOK-Bundesverband. Einführung eines Disease-Managements am Beispiel Diabetes. Bonn, 2001:84. 15. Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Niere der Deutschen Diabetes Gesell- schaft. Entscheidungsbasis für die Behandlung von Patienten mit diabetischer Nephropathie. Diabetes und Stoffwechsel 2000; 9:31-45. 16. Armour BS, Pitts MM, Maclean R, et al. The effect of explicit financial incen- tives on physician behavior. Arch Intern Med 2001; 161:1261-6. 17. Armstrong EP. Monitoring and evaluating disease management: information requirements. Clin Ther 1996; 18:1327-33. 18. Assmann G, Cullen P. Erkennung und Behandlung von Fettstoffwechselstö- rungen. Deutsches Ärzteblatt 1995; 51/52:1-12. 19. Baker SB, Vallbona C, Pavlik V, et al. A diabetes control program in a public health care setting. Public Health Rep 1993; 108:595-605. 20. Balas EA. Information systems can prevent errors and improve quality. J Am Med Inform Assoc 2001; 8:398-9. 21. Balas EA, Austin SM, Mitchell JA, Ewigman BG, Bopp KD, Brown GD. The clinical value of computerized information services. A review of 98 randomized clinical trials. Arch Fam Med 1996; 5:271-8. 22. Bates DW, Pappius E, Kuperman GJ, et al. Using information systems to measure and improve quality. Int J Med Inf 1999; 53:115-24. 23. Bates DW, Spell N, Cullen DJ, et al. The costs of adverse drug events in hos- pitalized patients. Adverse Drug Events Prevention Study Group. Jama 1997; 277:307-11. 24. Beilby JJ, Silagy CA. Trials of providing costing information to general practi- tioners: a systematic review. Med J Aust 1997; 167:89-92. 25. Bental DS, Cawsey A, Jones R. Patient information systems that tailor to the individual. Patient Educ Couns 1999; 36:171-80. 26. Berger M, Jörgens V, Mühlhauser I. Das Düsseldorfer-Genfer strukturierte Therapie- und Edukations-Programm als Evidenz-basierter Standard für die Be- handlung des Typ-1-Diabetes mellitus. 2001. 27. Berger M, Muhlhauser I. Diabetes care and patient-oriented outcomes. Jama 1999; 281:1676-8. 28. Berry C, Murdoch DR, McMurray JJ. Economics of chronic heart failure. Eur J Heart Fail 2001; 3:283-91. Disease Management in Deutschland - Literatur 29. Seite 315 Björkman O, Eriksson LS. Influence of a 60-hour fast on insulin-mediated splanchnic and peripheral glucose metabolism in humans. J Clin Invest 1985; 76:8792. 30. Bloomgarden ZT. The 32nd annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes. Neuropathy, health care, and glycation. Diabetes Care 1997; 20:1037-9. 31. Blue L, Lang E, McMurray JJ, et al. Randomised controlled trial of specialist nurse intervention in heart failure. Bmj 2001; 323:715-8. 32. Boulton AJ. The diabetic foot. Med Clin North Am 1988; 72:p1513-30. 33. Boyko EJ, Ahroni JH, Smith DG, Davignon D. Increased mortality associated with diabetic foot ulcer. Diabet Med 1996; 13:967-72. 34. Brechner RJ, Cowie CC, Howie LJ, Herman WH, Will JC, Harris MI. Ophthal- mic examination among adults with diagnosed diabetes mellitus. JAMA 1993; 270:1714-8. 35. Brook RH. Practice guidelines: to be or not to be. Lancet 1996; 348:1005- 1006. 36. Brook RH, Appel FA. Quality-of-care assessment: choosing a method for peer review. N Engl J Med 1973; 288:1323-9. 37. Browman GP, Levine MN, Mohide EA, et al. The practice guidelines develop- ment cycle: a conceptual tool for practice guidelines development and implementation. J Clin Oncol 1995; 13:502-12. 38. Brug J, Campbell M, van Assema P. The application and impact of computer- generated personalized nutrition education: a review of the literature. Patient Educ Couns 1999; 36:145-56. 39. Buhk H, Lotz-Rambaldi W. Compliance und Patientenschulung bei Diabetes mellitus Typ 2. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 2001; 44:5-13. 40. Bulger DW, Reeves C. Interactive Internet Web Sites. Dis Manage Health Outcomes 2000; 7:67-75. 41. Caballero E, Frykberg RG. Diabetic foot infections. J Foot Ankle Surg 1998; 37:248-55. 42. Cabana MD, Rand CS, Powe NR, et al. Why don't physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement. JAMA 1999; 282:1458-65. 43. Cantillon P, Jones R. Does continuing medical education in general practice Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 316 make a difference? BMJ 1999; 318:1276-9. 44. Caputo GM, Cavanagh PR, Ulbrecht JS, Gibbons GW, Karchmer AW. As- sessment and management of foot disease in patients with diabetes. N Engl J Med 1994; 331:854-60. 45. Carlson A, Rosenqvist U. Diabetes care organization, process, and patient outcomes: effects of a diabetes control program. Diabetes Educ 1991; 17:42-8. 46. Chalmers J, MacMahon S, Mancia G, et al. 1999 World Health Organization- International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. Guidelines sub-committee. Clin Exp Hypertens 1999; 21:1009-60. 47. Chambers CV, Balaban DJ, Carlson BL, Ungemack JA, Grasberger DM. Mi- crocomputer-generated reminders. Improving the compliance of primary care physicians with mammography screening guidelines. J Fam Pract 1989; 29:273-80. 48. Charnock D, Shepperd S, Needham G, Gann R. DISCERN: an instrument for judging the quality of written consumer health information on treatment choices. J Epidemiol Community Health 1999; 53:105-11. 49. Cintron G, Bigas C, Linares E, Aranda JM, Hernandez E. Nurse practitioner role in a chronic congestive heart failure clinic: in-hospital time, costs, and patient satisfaction. Heart Lung 1983; 12:237-40. 50. Claes C, Mahlfeld Y. Disease Management und Pharmaindustrie. Diskussi- onspapier Nr. 21. Hannover: Universität Hannover, 1999:85. 51. Clark J. Preventive home visits to elderly people. Their effectiveness cannot be judged by randomised controlled trials. Bmj 2001; 323:708. 52. Classen DC, Pestotnik SL, Evans RS, Lloyd JF, Burke JP. Adverse drug e- vents in hospitalized patients. Excess length of stay, extra costs, and attributable mortality. Jama 1997; 277:301-6. 53. Claus D, Carvalho VP, Neundorfer B, Blaise JF. Perception of vibration. Nor- mal findings and methodologic aspects. Nervenarzt 1988; 59:138-42. 54. Clayton PD, Hripcsak G. Decision support in healthcare. Int J Biomed Comput 1995; 39:59-66. 55. Cleland JG, Walker A. Is medical treatment for angina the most cost-effective option? Eur Heart J 1997; 18 Suppl B:B35-42. 56. Cline CM, Israelsson BY, Willenheimer RB, Broms K, Erhardt LR. Cost effec- tive management programme for heart failure reduces hospitalisation. Heart 1998; 80:442-6. Disease Management in Deutschland - Literatur 57. Seite 317 Colditz G, Willett W, Rotnitzky A, Manson J. Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women II. Ann Intern Med 1995; 122:481-86. 58. Committee JN. Prevention, detection, evaluation, and treatment of hyperten- sion. The Sixth Report of the Joint National Committee. National Institutes of HealthNational Heart, Lung, and Blood Institute. National High Blood Pressure Education Programme. Indian Heart J 1999; 51:381-96. 59. Coulter A. Evidence based patient information. is important, so there needs to be a national strategy to ensure it. Bmj 1998; 317:225-6. 60. Coulter A, Entwistle V, Gilbert D. Sharing decisions with patients: is the infor- mation good enough? Bmj 1999; 318:318-22. 61. Dauphinee WD. Revalidation of doctors in Canada. Bmj 1999; 319:1188-90. 62. DCCT Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993; 329:977-86. 63. DeBusk RF, West JA, Miller NH, Taylor CB. Chronic disease management: treating the patient with disease(s) vs treating disease(s) in the patient. Arch Intern Med 1999; 159:2739-42. 64. Dennis LI, Blue CL, Stahl SM, Benge ME, Shaw CJ. The relationship between hospital readmissions of medicare beneficiaries with chronic illnesses and home care nursing interventions. Home Healthc Nurse 1996; 14:303-9. 65. Despres JP. Obesity and lipid metabolism: relevance of body fat distribution. Current Opinion in Lipidology 1991; 2:5-15. 66. Deuser J. Disease Management. Perspectives on Managed Care. Vol. 2, 1999:44-5. 67. Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz und Kreislaufforschung. Empfeh- lungen zur umfassenden Risikoverringerung für Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Zeitschrift für Kardiologie 1997; 86:776-777. 68. Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DLLeV. Diagnostik und Therapie von Fettstoffwechselstörungen in der hausärztlichen Praxis. Deutsches Ärzteblatt 1996; 4:Sonderbeilage. 69. Deyo RA. A key medical decision maker: the patient. Bmj 2001; 323:466-7. 70. Diabetic Retinopathy Study Research Group. Indications for photocoagulation treatment of diabetic retinopathy: Diabetic Retinopathy Study Report no. 14. The Di- Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 318 Diabetic Retinopathy Study Research Group. Int Ophthalmol Clin 1987; 27:239-53. 71. Domurat ES. Diabetes managed care and clinical outcomes: the Harbor City, California Kaiser Permanente diabetes care system. Am J Manag Care 1999; 5:1299-307. 72. Dougherty CM, Spertus JA, Dewhurst TA, Nichol WP. Outpatient nursing case management for cardiovascular disease. Nurs Clin North Am 2000; 35:993-1003. 73. Doxtator RF. Documenting the Cost / Benefit and Return on Investment of Di- sease Management Programs: Practical Examples, Tools, and Templates. Disease Management 2000; 3:117-25. 74. Ekman I, Andersson B, Ehnfors M, Matejka G, Persson B, Fagerberg B. Fea- sibility of a nurse-monitored, outpatient-care programme for elderly patients with moderate-to-severe, chronic heart failure. Eur Heart J 1998; 19:1254-60. 75. Elson RB, Faughnan JG, Connelly DP. An industrial process view of informa- tion delivery to support clinical decision making: implications for systems design and process measures. J Am Med Inform Assoc 1997; 4:266-78. 76. Enderle MD, Haring HU, Luft D. Diabetic foot syndrome. Etiology and differen- tial therapy. Dtsch Med Wochenschr 1996; 121:1236-42. 77. Espinosa AL. Availability of health data: requirements and solutions. Int J Med Inf 1998; 49:97-104. 78. EUROASPIRE Study Goup. EUROASPIRE. A European Society of Cardiology survey of secondary prevention of coronary heart disease: principal results. EUROASPIRE Study Group. European Action on Secondary Prevention through Intervention to Reduce Events. Eur Heart J 1997; 18:1569-82. 79. European Diabetes Policy Group. A desktop guide to Type 1 (insulin- dependent) diabetes mellitus. European Diabetes Policy Group 1998. Diabet Med 1999; 16:253-66. 80. European Diabetes Policy Group 1999. A desktop guide to Type 2 diabetes mellitus. European Diabetes Policy Group 1999. Diabet Med 1999; 16:716-30. 81. European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J 1996; 17:354-81. 82. Fachkomission Diabetes Sachsen. Diabetische Komplikation: Fußsyndrom. In: Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 319 Landesärztekammer S, ed, 1998. 83. Fang E, Mittman BS, Weingarten S. Use of clinical practice guidelines in man- aged care physician groups. Arch Fam Med 1996; 5:528-531. 84. Field M, Lohr K. Clinical practice guidelines. Directions for a new program. In: Medicine Io, ed. Washington, D.C.: National Academy Press, 1990. 85. Fonarow GC, Gawlinski A, Moughrabi S, Tillisch JH. Improved treatment of coronary heart disease by implementation of a Cardiac Hospitalization Atherosclerosis Management Program (CHAMP). Am J Cardiol 2001; 87:819-22. 86. Friedberg CE, Janssen MJ, Heine RJ, Grobbee DE. Fish oil and glycemic con- trol in diabetes. A meta-analysis. Diabetes Care 1998; 21:494-500. 87. Friedman N. Diabetes and managed care: the Lovelace Health System's Epi- sode of Care Program. Manag Care Q 1996; 4:43-9. 88. Friedman NM, Gleeson JM, Kent MJ, Foris M, Rodriguez DJ, Cypress M. Management of diabetes mellitus in the Lovelace Health Systems' EPISODES OF CARE program. Eff Clin Pract 1998; 1:5-11. 89. Frykberg RG. Team approach toward lower extremity amputation prevention in diabetes. J Am Podiatr Med Assoc 1997; 87:305-12. 90. Gerlach FM, Beyer M, Berndt M, Szecsenyi J, Abholz HH, Fischer GC. The DEGAM-concept--development, dissemination, implementation and evaluation of guidelines for general practice. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 1999; 93:111-20. 91. Gerst T. Modellprojekt Diabetes-Behandlung. Deutsches Ärzteblatt 2001; 98:1789. 92. Giles T. The cost-effective way forward for the management of the patient with heart failure. Cardiology 1996; 87 Suppl 1:33-9. 93. Glasgow RE, Bull SS. Making a difference with interactive technology: consid- erations in using and evaluating computerized aids for diabetes self-management education. Dia Spectr 2001; 14:99. 94. Glasgow RE, Toobert DJ, Hampson SE. Effects of a brief office-based inter- vention to facilitate diabetes dietary self-management. Diabetes Care 1996; 19:835842. 95. Gorman CA, Zimmerman BR, Smith SA, et al. DEMS - a second generation diabetes electronic management system. Comput Methods Programs Biomed 2000; 62:127-140. 96. Gozzoli V, Palmer AJ, Brandt A, Spinas GA. Economic and clinical impact of Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 320 alternative disease management strategies for secondary prevention in type 2 diabetes in the Swiss setting. Swiss Med Wkly 2001; 131:303-10. 97. Gray RE, Fitch M, Davis C, Phillips C. Challenges of participatory research: reflections on a study with breast cancer self-help groups. Health Expect 2000; 3:243-252. 98. Greenfield S, Rogers W, Mangotich M, Carney MF, Tarlov AR. Outcomes of patients with hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus treated by different systems and specialties. Results from the medical outcomes study. Jama 1995; 274:1436-44. 99. Grey M. Interventions for children with diabetes and their families. Annu Rev Nurs Res 2000; 18:149-70. 100. Grimshaw JM, Russell IT. Effect of clinical guidelines on medical practice: a systematic review of rigorous evaluations. Lancet 1993; 27:1317-22. 101. Guico-Pabia CJ, Murray JF, Teutsch SM, Wertheimer AI, Berger ML. Indirect cost of ischemic heart disease to employers. Am J Manag Care 2001; 7:27-34. 102. Haisch J, Braun S, Böhm B. Optimierung der Blutzuckereinstellung von Typ II Diabetikern durch ein psychologisch fundiertes Motivationstraining: Ein neues Behandlungskonzept. Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 1995; 31:236-241. 103. Haisch J, Braun S, Böhm BO. Optimierung der Blutzuckereinstellung von Typ- II-Diabetikern durch ein psychologisch fundiertes Motivationstraining - Ein neues Behandlungskonzept. PRAXIS der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 1995; 8:236-43. 104. Haisch J, Braun S, Bohm BO, Stock D. Effects of patient education in type II diabetic patients after clinic admission. Results of a 3 month catamnesis after new patient-centered education. Psychother Psychosom Med Psychol 1996; 46:400-4. 105. Haisch J, Lang-Hatzfeld A, Bruckel J, Bohm BO. Development and outcome of motivational support during inpatient education of insulin-dependent diabetic patients--a pilot project. Wien Med Wochenschr 1996; 146:619-23. 106. Haisch J, Remmele W. Effektivität und Effizienz ambulanter Diabetikerschu- lungen. Dtsch. med. Wschr. 2000; 125:171-176. 107. Hanumanthu S, Butler J, Chomsky D, Davis S, Wilson JR. Effect of a heart failure program on hospitalization frequency and exercise tolerance. Circulation 1997; 96:2842-8. Disease Management in Deutschland - Literatur 108. Seite 321 Hasche H, Flinker K, Herbold M, et al. Multizentrische Studie zur Effektivität der diabetologischen: Schwerpunktpraxis Studie der Arbeitsgemeinschaft niedergelassener diabetologisch tätiger Ärzte (AND). Deutsches Ärzteblatt 1997; 94: A-2990 A-2995. 109. Haslbeck M. Therapie der diabetischen Polyneuropathien. Frühbehandlung mit guter Diabeteseinstellung steht im Vordergrund. Therapiewoche 1996; 28:15541562. 110. Haslbeck M. Medikamentöse Behandlung somatischer Neuropathien bei Dia- betes mellitus. Symposiumsbericht der Arbeitsgemeinschaft "Diabetes und Nervensystem" der Deutschen Diabetes-Gesellschaft. Diabetologie Informationen 1997; 3:210-215. 111. Haslbeck M. Autonomic neuropathies in diabetes mellitus: diagnosis--therapy-- risks. Z Gesamte Inn Med 1993; 48:162-176. 112. Haslbeck M, Krob G, Kothny T. Diabetische Polyneuropathie. Der Bay. Inter- nist 1999; 19:398-408. 113. Hasselkus W, Sailer D, Schartel B. Type II diabetic patients in general prac- tice. A regional questionnaire survey--analysis and consequences. Fortschr Med 1996; 114:15-7. 114. Hauner H. Versorgung des Diabetes Mellitus - Stand 1996. Medizinische Klinik 1997; 92:9-12. 115. Hauner H, Kurnaz AA, Groschopp C, Haastert B, Feldhoff KH, Scherbaum WA. Versorgung von Diabetikern in stationären Pflegeeinrichtungen des Kreises Heinsberg. Medizinische Klinik 2000; 95:608-612. 116. Hauner H, Tilenius H, Haastert B, von Ferber L. Versorgung von Diabetikern in hausärztlichen Praxen. Diabetes und Stoffwechsel 1997; 6:139-144. 117. Hauner H, von Ferber H, Köster I. Prevalence and out-patient care of insulin- dependent diabetes mellitus under the age of 40. An analysis of data of the statuatory insurance in the City of Dortmund, Germany. Diabetes und Stoffwechsel 1996; 5:101-106. 118. Heaney CA, Goetzel RZ. A review of health-related outcomes of multi- component worksite health promotion programs. Am J Health Promot 1997; 11:290307. 119. Hershberger RE, Ni H, Nauman DJ, et al. Prospective evaluation of an outpa- tient heart failure management program. J Card Fail 2001; 7:64-74. Disease Management in Deutschland - Literatur 120. Seite 322 Hilz MJ, Axelrod FB, Hermann K, Haertl U, Duetsch M, Neundorfer B. Norma- tive values of vibratory perception in 530 children, juveniles and adults aged 3-79 years. J Neurol Sci 1998; 159:219-25. 121. Hirsch A, Jäckle R, Studtfeldt R. Lernen im Alter: Konzept und Entwicklung einer stationären Schulung für ältere insulinspritzende Typ II Diabetiker. Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis 1992; 24:185-193. 122. Ho M, Marger M, Beart J, Yip I, Shekelle P. Is the quality of diabetes care bet- ter in a diabetes clinic or in a general medicine clinic? Diabetes Care 1997; 20:472-5. 123. Holme I. An analysis of randomized trials evaluating the effect of cholesterol reduction on total mortality and coronary heart disease incidence [published erratum appears in Circulation 1991 Dec;84(6):2610-1] [see comments]. Circulation 1990; 82:1916-24. 124. Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an independ- ent risk factor for cardiovascular disease: a 26- year follow-up of participants in the Framingham Heart Study. Circulation 1983; 67:968-77. 125. Hunt DL, Haynes RB, Hayward RS, Pim MA, Horsman J. Patient-specific evi- dence-based care recommendations for diabetes mellitus: development and initial clinic experience with a computerized decision support system. Int J Med Inf 1998; 51:127-35. 126. Hunter DJ, Fairfield G. Managed Care: Disease management. BMJ 1997; 315:50-3. 127. Jaarsma T, Halfens R, Huijer Abu-Saad H, et al. Effects of education and sup- port on self-care and resource utilization in patients with heart failure. Eur Heart J 1999; 20:673-82. 128. Johannesson M, Agewall S, Hartford M, Hedner T, Fagerberg B. The cost- effectiveness of a cardiovascular multiple-risk-factor intervention programme in treated hypertensive men. J Intern Med 1995; 237:19-26. 129. Johnston ME, Langton KB, Haynes RB, Mathieu A. Effects of computer-based clinical decision support systems on clinician performance and patient outcome. A critical appraisal of research. Ann Intern Med 1994; 120:135-42. 130. Joint National Committee. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Arch Intern Med 1997; 157:2413-2443. 131. Kaltwasser JP, Wollenhaupt J, Dick W, Raven U, Herholz H. Continuing edu- Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 323 cation as an instrument of medical quality management. Z Rheumatol 1998; 57:43741. 132. Kauppinen R, Sintonen H, Vilkka V, Tukiainen H. Long-term (3-year) economic evaluation of intensive patient education for self-management during the first year in new asthmatics. Respir Med 1999; 93:283-9. 133. Kerner W. Klassifikation und Diagnose des Diabetes mellitus. Deutsches Ärz- teblatt 1998; 95:36-40 C-2216 - C-2220. 134. Khanna N, Phillips MD. Adherence to care plan in women with abnormal Pa- panicolaou smears: a review of barriers and interventions. J Am Board Fam Pract 2001; 14:123-30. 135. Klazinga N. Compliance with practice guidelines: clinical autonomy revisited. Health Policy 1994; 28:51-66. 136. Klein R, Klein BE, Neider MW, Hubbard LD, Meuer SM, Brothers RJ. Diabetic retinopathy as detected using ophthalmoscopy, a nonmydriatic camera and a standard fundus camera. Ophthalmology 1985; 92:485-91. 137. Kleine P. Fortbildungswünsche und Fortbildungsverhalten: ÄKN-Unmfrage (2. Teil). Niedersächsisches Ärzteblatt 2000. 138. Kleine P. ÄKN-Umfrage: Fortbildungsangebote in Niedersachsen 1998 und ihre Bewertung. Niedersächsisches Ärzteblatt 2000. 139. Knox D, Mischke L. Implementing a congestive heart failure disease manage- ment program to decrease length of stay and cost. J Cardiovasc Nurs 1999; 14:5574. 140. Kornowski R, Zeeli D, Averbuch M, et al. Intensive home-care surveillance prevents hospitalization and improves morbidity rates among elderly patients with severe congestive heart failure. Am Heart J 1995; 129:762-6. 141. Krishna S, Balas EA, Spencer DC, Griffin JZ, Boren SA. Clinical trials of inter- active computerized patient education: implications for family practice. J Fam Pract 1997; 45:25-33. 142. Krumpaszky HG, Klauss V. Epidemiology of blindness and eye disease. Oph- thalmologica 1996; 210:1-84. 143. Lagerlov P, Loeb M, Andrew M, Hjortdahl P. Improving doctors' prescribing behaviour through reflection on guidelines and prescription feedback: a randomised controlled study. Qual Health Care 2000; 9:159-165. Disease Management in Deutschland - Literatur 144. Seite 324 Langley PC. Assessing the input costs of disease management programs. Clin Ther 1996; 18:1334-40. 145. Lasater M. The effect of a nurse-managed CHF clinic on patient readmission and length of stay. Home Healthc Nurse 1996; 14:351-6. 146. Lauterbach KW, Lubecki P, Oesingmann U, Ollenschlager G, Richard S, Straub C. A concept for a clearing procedure for guidelines in Germany. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 1997; 91:283-8. 147. Lauterbach KW, Stock S. Disease Management wird aktiviert. Dt Ärzteblatt 2001; 98:1935-1937. 148. Lean ME, Han TS, Prvan T, Richmond PR, Avenell A. Weight loss with high and low carbohydrate 1200 kcal diets in free living women. Eur J Clin Nutr 1997; 51:243-8. 149. Legorreta AP, Hasan MM, Peters AL, Pelletier KR, Leung KM. An intervention for enhancing compliance with screening recommendations for diabetic retinopathy. A bicoastal experience. Diabetes Care 1997; 20:520-3. 150. Lehmann ED. AIDA--a computer-based interactive educational diabetes simu- lator. Diabetes Educ 1998; 24:341-6, 348. 151. Lehmann ED. Preliminary experience with the Internet release of AIDA--an interactive educational diabetes simulator. Comput Methods Programs Biomed 1998; 56:109-32. 152. Lehmann ED. Interactive educational diabetes simulators: future possibilities. Diabetes Nutr Metab 1999; 12:380-7. 153. Lehmann ED, Deutsch T, Carson ER, Sonksen PH. AIDA: an interactive dia- betes advisor. Comput Methods Programs Biomed 1994; 41:183-203. 154. Lenz C, Waller T, Bruksch M. Disease Management online. Deutsches Ärzte- blatt 2001; 98:2240-2244. 155. Liang MH, Shadick N. Feasibility and utility of adding disease-specific outcome measures to administrative databases to improve disease management. Ann Intern Med 1997; 127:739-42. 156. Linne AB, Liedholm H, Jendteg S, Israelsson B. Health care costs of heart fai- lure: results from a randomised study of patient education. Eur J Heart Fail 2000; 2:291-7. 157. Litzelman DK, Dittus RS, Miller ME, Tierney WM. Requiring physicians to re- spond to computerized reminders improves their compliance with preventive care Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 325 protocols. J Gen Intern Med 1993; 8:311-7. 158. Litzelman DK, Slemenda CW, Langefeld CD, et al. Reduction of lower extrem- ity clinical abnormalities in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1993; 119:36-41. 159. Lob SH, Kohatsu ND. Case management: a controlled evaluation of persons with diabetes. Clin Perform Qual Health Care 2000; 8:105-11. 160. Lobach DF, Hammond WE. Development and evaluation of a Computer- Assisted Management Protocol (CAMP): improved compliance with care guidelines for diabetes mellitus. Proc Annu Symp Comput Appl Med Care 1994:787-91. 161. Lonsert M. Disease Management. Perspektiven für die deutsche Pharma- Industrie (Teil 1). Pharma-Marketing Journal 1995; 6:222-225. 162. Mark DB. Economics of treating heart failure. Am J Cardiol 1997; 80:33H-38H. 163. Martens KH, Mellor SD. A study of the relationship between home care ser- vices and hospital readmission of patients with congestive heart failure. Home Healthc Nurse 1997; 15:123-9. 164. McAlister FA, Lawson FM, Teo KK, Armstrong PW. A systematic review of randomized trials of disease management programs in heart failure. Am J Med 2001; 110:378-84. 165. McCabe CJ, Stevenson RC, Dolan AM. Evaluation of a diabetic foot screening and protection programme. Diabet Med 1998; 15:80-4. 166. McCulloch DK, Price MJ, Hindmarsh M, Wagner EH. Improvement in Diabetes Care Using an Integrated Population-Based Approach in a Primary Care Setting. Disease Management 2000; 3:75-82. 167. McCulloch DK, Price MJ, Hindmarsh M, Wagner EH. A population-based ap- proach to diabetes management in a primary care setting: early results and lessons learned. Eff Clin Pract 1998; 1:12-22. 168. McGlynn EA. Choosing chronic disease measures for HEDIS: conceptual fra- mework and review of seven clinical areas. Manag Care Q 1996; 4:54-77. 169. McPhee SJ, Bird JA, Jenkins CN, Fordham D. Promoting cancer screening. A randomized, controlled trial of three interventions. Arch Intern Med 1989; 149:186672. 170. Mease A. Telemedicine improved diabetic Management. Military Medicine 2000; 165:579-584. 171. Meneghini LF, Albisser AM, Goldberg RB, Mintz DH. An electronic case man- Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 326 ager for diabetes control. Diabetes Care 1998; 21:591-6. 172. Mogensen CE, Christensen CK, Vittinghus E. The stages in diabetic renal dis- ease. With emphasis on the stage of incipient diabetic nephropathy. Diabetes 1983; 32 Suppl 2:64-78. 173. Moss SE, Klein R, Kessler SD, Richie KA. Comparison between ophthalmo- scopy and fundus photography in determining severity of diabetic retinopathy. Ophthalmology 1985; 92:62-7. 174. Mullen PD, Simons-Morton DG, Ramirez G, Frankowski RF, Green LW, Mains DA. A meta-analysis of trials evaluating patient education and counseling for three groups of preventive health behaviors. Patient Educ Couns 1997; 32:157-73. 175. Munroe WP, Kunz K, Dalmady-Israel C, Potter L, Schonfeld WH. Economic evaluation of pharmacist involvement in disease management in a community pharmacy setting. Clin Ther 1997; 19:113-23. 176. Murrey KO, Gottlieb LK, Schoenbaum SC. Implementing clinical guidelines: a quality management approach to reminder systems. QRB Qual Rev Bull 1992; 18:423-33. 177. Mühlhauser I, Berger M. Evidence-based patient information in diabetes. Dia- bet Med 2000; 17:823-9. 178. Müller UA, Berlet G, Ross IS, Klinger H. Illness-specific knowledge, coping with illness and metabolic control in insulin-injecting diabetic patients in a random city population. Z Gesamte Inn Med 1993; 48:369-75. 179. N.N. Informing,communicating and sharing decisions with people who have cancer. Effective Health Care 2000; 6:1-8. 180. N.N:. Disease-Management soll Patient,Arzt und Kasse nützen. Ärzte Zeitung Online 2001; 26.02.2001. 181. National Cholesterol Education Program (NCEP). Summary of the second re- port of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA 1993; 269:3015-3023. 182. Newble DI, Paget NS. The maintenance of professional standards programme of the Royal Australasian College of Physicians. J R Coll Physicians Lond 1996; 30:252-6. 183. Nissenson AR, Collins AJ, Dickmeyer J, et al. Evaluation of Disease-State Management of Dialysis Patients. Am J Kidney Dis 2001; 37:938-944. Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 327 184. Norcini JJ. Recertification in the United States. Bmj 1999; 319:1183-5. 185. O`Donnell M. Health impact of workplace health promotion programs and me- thological quality of the research literature. Art Health Promot 1997; 1:1-7. 186. Ohlson LO, Larsson B, Svardsudd K. The influence of body fat distribution on the incidence of diabetes mellitus - 13.5 years of follow-up of the participants in the study of men born on 1913. Diabetes 1985; 34:1055-1058. 187. Ollenschläger G, Kirchner H, Fiene M. Leitlinien in der Medizin - scheitern sie an der praktischen Umsetzung? Der Internist 2001; 4:473-483. 188. Ollenschläger G, Thomeczek C. Medical guidelines. Definitions, goals, imple- mentation. Z Arztl Fortbild (Jena) 1996; 90:355-61. 189. Ollenschläger G, Thomeczek C, Kirchner H, Oesingmann U, Kolkmann FW. Guidelines and evidence-based medicine in Germany. Z Gerontol Geriatr 2000; 33:82-9. 190. Ornstein SM, Garr DR, Jenkins RG, Rust PF, Arnon A. Computer-generated physician and patient reminders. Tools to improve population adherence to selected preventive services. J Fam Pract 1991; 32:82-90. 191. Ostlund RE, Jr., Staten M, Kohrt WM, Schultz J, Malley M. The ratio of waist- to-hip circumference, plasma insulin level, and glucose intolerance as independent predictors of the HDL2 cholesterol level in older adults. N Engl J Med 1990; 322:22934. 192. Ozminkowski RJ, Dunn RL, Goetzel RZ, Cantor RI, Murnane J, Harrison M. A return on investment evaluation of the Citibank, N.A., health management program. Am J Health Promot 1999; 14:31-43. 193. Paget N, Saunders N, Newble D, Du J. Physician Assessment Pilot Study for the Royal Australasian College of Physicians. The Journal of Contiinuing Education in the Health Professions 1996; 16:103-111. 194. Palitzsch K-D, Nusser J, Arndt H, et al. Die Prävalenz des Diabetes mellitus wird in Deutschland deutlich unterschätzt - eine bundesweite epidemiologische Studie auf der Basis einer HbA1C-Analyse. Diabetes und Stoffwechsel 1999; 8:189-200. 195. Palmer RH. Process-based measures of quality: the need for detailed clinical data in large health care databases. Ann Intern Med 1997; 127:733-8. 196. Patel B, Perez HE. A means to an end: an overview of a hyperlipidemia out- comes management program. Am J Med 2001; 110 Suppl 6A:12S-16S. 197. Peck C, McCall M, McLaren B, Rotem T. Continuing medical education and Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 328 continuing professional development: international comparisons. Bmj 2000; 320:4325. 198. Pelletier KR. A review and analysis of the clinical and cost-effectiveness stu- dies of comprehensive health promotion and disease management programs at the worksite: 1995-1998 update (IV). Am J Health Promot 1999; 13:333-45, iii. 199. Petermann F, Wendt A. Verhaltensmedizinische Ansätze bei Diabetes melli- tus- eine Übersicht. In: Petermann F, ed. Diabetes mellitus. Sozial- und verhaltensmedizinische Ansätze. Göttingen: Hogrefe, 1995:67-108. 200. Piette JD, Weinberger M, Kraemer FB, McPhee SJ. Impact of automated calls with nurse follow-up on diabetes treatment outcomes in a Department of Veterans Affairs Health Care System: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2001; 24:202-8. 201. Porsche R. Disease Management als Herausforderung und Chance für inno- vative Unternehmen. Pharm Ind 1996; 58:465-72. 202. PricewaterhouseCoopers. Health Cast 2010. Studie 1999. 203. Pyörala K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P, Wood D. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and European Society of Hypertension. Eur Heart J 1994; 15:1300-1331. 204. Ramsey PG, Carline JD, Inui TS, Larson EB, LoGerfo JP, Wenrich MD. Pre- dictive validity of certification by the American Board of Internal Medicine. Ann Intern Med 1989; 110:719-26. 205. Ramsey PG, Wenrich MD, Carline JD, Inui TS, Larson EB, LoGerfo JP. Use of peer ratings to evaluate physician performance. Jama 1993; 269:1655-60. 206. Rich MW. Heart failure disease management: a critical review. J Card Fail 1999; 5:64-75. 207. Rich MW. Multidisciplinary interventions for the management of heart failure: where do we stand? Am Heart J 1999; 138:599-601. 208. Rich MW. Heart failure disease management programs: efficacy and limitati- ons. Am J Med 2001; 110:410-2. 209. Rich MW, Beckham V, Wittenberg C, Leven CL, Freedland KE, Carney RM. A multidisciplinary intervention to prevent the readmission of elderly patients with congestive heart failure. N Engl J Med 1995; 333:1190-5. 210. Rich MW, Vinson JM, Sperry JC, et al. Prevention of readmission in elderly Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 329 patients with congestive heart failure: results of a prospective, randomized pilot study. J Gen Intern Med 1993; 8:585-90. 211. Ritz E, Keller C, Bergis KH. Nephropathy of type II diabetes mellitus. Nephrol Dial Transplant 1996; 11 Suppl 9:38-44. 212. Riva A, Bellazzi R, Stefanelli M. A Web-based system for the intelligent mana- gement of diabetic patients. MD Comput 1997; 14:360-4. 213. Roberts KA. Best practices in the development of clinical practice guidelines. J Healthc Qual 1998; 20:16-20, 32. 214. Roglieri JL, Futterman R, McDonough KL, et al. Disease management inter- ventions to improve outcomes in congestive heart failure. Am J Manag Care 1997; 3:1831-9. 215. Rohrbach JI. Critical pathways as an essential part of a disease management program. J Nurs Care Qual 1999; 14:11-5. 216. Rosner B, Prineas RJ, Loggie JM, Daniels SR. Blood pressure nomograms for children and adolescents, by height, sex, and age, in the United States. J Pediatr 1993; 123:871-86. 217. Sachverständigenrat. Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. 2000/2001; Band III. 218. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 1996; 335:1001-9. 219. Schaumburg D. Asthma Disease Management: Erste Erfahrungen aus einem Modellprojekt. Atemweg - Lungenkrankheiten 1999; 25:618-624. 220. Schädlich PK, Brecht JG. Cost-effectiveness analysis of prevention of reinfarc- tion using low-dose acetylsalicylic acid; model calculation. Soz Praventivmed 1997; 42:114-20. 221. Schiel R, Ulbrich S, Muller UA. Quality of diabetes care, diabetes knowledge and risk of severe hypoglycaemia one and four years after participation in a 5-day structured treatment and teaching programme for intensified insulin therapy. Diabetes Metab 1998; 24:509-14. 222. Scholz H. Datenmanagement im Gesundheitswesen: Transparente Zukunft? Arbeit und Sozialpolitik 2001:22-7. 223. Scott I, Harper C, Clough A, West M. WESTCOP: a disease management ap- proach to coronary artery disease. Aust Health Rev 2000; 23:96-112. Disease Management in Deutschland - Literatur 224. Seite 330 Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of diabetic renal di- sease. 1997; SIGN Publication Number 11. 225. Seewald M. Mikrobiologische Aspekte in der Diagnostik und Therapie des dia- betischen Fußes. Diabetes und Stoffwechsel 1999; 8:16-20. 226. Selby JV, Ray GT, Zhang D, Colby CJ. Excess costs of medical care for pati- ents with diabetes in a managed care population. Diabetes Care 1997; 20:1396-402. 227. Severson HH, Andrews JA, Lichtenstein E, Gordon JS, Barckley M, Akers L. A self-help cessation program for smokeless tobacco users: comparison of two interventions. Nicotine Tob Res 2000; 2:363-70. 228. Shah NB, Der E, Ruggerio C, Heidenreich PA, Massie BM. Prevention of hos- pitalizations for heart failure with an interactive home monitoring program. Am Heart J 1998; 135:373-8. 229. Shea S, DuMouchel W, Bahamonde L. A meta-analysis of 16 randomized controlled trials to evaluate computer- based clinical reminder systems for preventive care in the ambulatory setting. J Am Med Inform Assoc 1996; 3:399-409. 230. Shultz EK, Bauman A, Hayward M, Holzman R. Improved care of patients with diabetes through telecommunications. Ann N Y Acad Sci 1992; 670:141-5. 231. Slater SG, Sorkin HL. Telemedicine. The impact of the Web & e-health mana- gement. Caring 2001; 20:34-7. 232. Smith SA, Murphy ME, Huschka TR, et al. Impact of a diabetes electronic ma- nagement system on the care of patients seen in a subspecialty diabetes clinic. Diabetes Care 1998; 21:972-6. 233. Steffens B. Cost-effective management of type 2 diabetes: providing quality care in a cost-constrained environment. Am J Manag Care 2000; 6:S697-703; discussion S704-9. 234. Stewart S, Marley JE, Horowitz JD. Effects of a multidisciplinary, home-based intervention on unplanned readmissions and survival among patients with chronic congestive heart failure: a randomised controlled study. Lancet 1999; 354:1077-83. 235. Stewart S, Pearson S, Horowitz JD. Effects of a home-based intervention a- mong patients with congestive heart failure discharged from acute hospital care. Arch Intern Med 1998; 158:1067-72. 236. Stewart S, Vandenbroek AJ, Pearson S, Horowitz JD. Prolonged beneficial effects of a home-based intervention on unplanned readmissions and mortality among patients with congestive heart failure. Arch Intern Med 1999; 159:257-61. Disease Management in Deutschland - Literatur 237. Seite 331 Stock D, Haisch J, Braun S. Diabetes- Neuse Schritte zur Bewältigung. Dia- betes- Neue Schritte zur Bewältigung. Heidelberg: Asanger, 1995. 238. Stone RE. Playing Disease Management Numbers Games. Dis Manage Health Outcomes 1999; 6:343-8. 239. Stoner KL, Lasar NJ, Butcher MK, et al. Improving glycemic control: can tech- niques used in a managed care setting be successfully adapted to a rural fee-forservice practice? Am J Med Qual 2001; 16:93-8. 240. Stotzner K. [Patients' involvement in and and their demands on evidence- based medicine]. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2001; 95:131-6. 241. Stotzner K. Patients' involvement in and and their demands on evidence- based medicine. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2001; 95:131-6. 242. Strecher VJ. Computer-tailored smoking cessation materials: a review and discussion. Patient Educ Couns 1999; 36:107-17. 243. Strom KL. Quality improvement interventions: what works? J Healthc Qual 2001; 23:4-14; quiz 14, 24. 244. Thamm M. Blood pressure in Germany--current status and trends. Gesund- heitswesen 1999; 61 Spec No:S90-3. 245. Thomas PK, Tomlinson DR. Diabetic and Hypoglycemic Neuropathy. In: Dyck PJ, al.] e, eds. Peripheral neuropathy. Vol. 2. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1993:1219-1250. 246. Trautner C, Haastert B, Spraul M, Giani G, Berger M. Unchanged incidence of lower-limb amputations in a German City, 1990-1998. Diabetes Care 2001; 24:855-9. 247. Tunis SR, Hayward RS, Wilson MC, et al. Internists' attitudes about clinical practice guidelines. Ann Intern Med 1994; 120:956-63. 248. UKPDS Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998; 352:854-65. 249. van Bergen PF, Jonker JJ, van Hout BA, et al. Costs and effects of long-term oral anticoagulant treatment after myocardial infarction. Jama 1995; 273:925-8. 250. Vaughan CJ, Murphy MB, Buckley BM. Statins do more than just lower cho- lesterol. Lancet 1996; 348:1079-1082. 251. von Stackelberg B, Krause D. Role of self help in the spreading evidence ba- sed on medical information. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2000; 94:469-73. 252. Voros P, Lengyel Z, Nagy V, Nemeth C, Rosivall L, Kammerer L. Diurnal blood Disease Management in Deutschland - Literatur Seite 332 pressure variation and albuminuria in normotensive patients with insulin-dependent diabetes mellitus. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:2257-60. 253. Wagner EH, Austin BT, Von Korff M. Organizing care for patients with chronic illness. Milbank Q 1996; 74:511-44. 254. Wagner EH, Davis C, Schaefer J, Von Korff M, Austin B. A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent with the literature? Manag Care Q 1999; 7:56-66. 255. Weinberger M, Oddone EZ, Henderson WG. Does increased access to prima- ry care reduce hospital readmissions? Veterans Affairs Cooperative Study Group on Primary Care and Hospital Readmission. N Engl J Med 1996; 334:1441-7. 256. Weingarten SR, Riedinger MS, Conner L, et al. Practice guidelines and remin- ders to reduce duration of hospital stay for patients with chest pain. An interventional trial. Ann Intern Med 1994; 120:257-63. 257. Welzel K. Managed Care: Reaktionen der Pharmazeutischen Industrie. Phar- ma- Marketing Journal 1995; 4:132-136. 258. West JA, Miller NH, Parker KM, et al. A comprehensive management system for heart failure improves clinical outcomes and reduces medical resource utilization. Am J Cardiol 1997; 79:58-63. 259. WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetics. Prevalence of small vessel and large vessel disease in diabetic patients from 14 centres. The World Health Organisation Multinational Study of Vascular Disease in Diabetics. Diabetes Drafting Group. Diabetologia 1985; 28 Suppl:615-40. 260. Wiefels K, Gries FA. Diagnosis of diabetic neuropathies. Dtsch Med Wo- chenschr 1988; 113:1067-70. 261. Wisniewski JJ, Childress L. Managed Care College: a continuing education program for primary care clinicians. Med Interface 1994; 7:56-60, 65-7. 262. Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyorala K. Pre- vention of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Atherosclerosis 1998; 140:199-270. 263. Wootton R. Recent advances: Telemedicine. Bmj 2001; 323:557-60. 264. Yoos HL, Malone K, McMullen A, Richards K, Rideout K, Schultz J. Standards and practice guidelines as the foundation for clinical practice. J Nurs Care Qual 1997; 11:48-54. Disease Management in Deutschland - Literatur 265. Seite 333 Young M, Boulton A, Macleod A, Williams D, Sonksen P. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia 1993; 36:150-4. 266. Ziegler D. Diagnostik und Therapie der diabetischen Neuropathie. Hamburger Ärzteblatt 1997; 3:125-30.