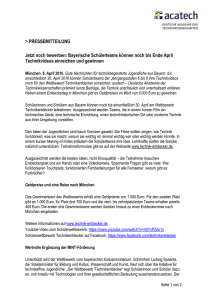WAchStum duRch innovAtive GeSundheitStechnoLoGien
Werbung

acatech Symposium | 26. April 2005 > Wachstum durch innovative GESUNDHEITstechnologien acatech Symposium | 26. April 2005 > Wachstum durch innovative GESUNDHEITstechnologien Inhalt > acatech Symposium 2005 > Wachstum durch innovative Gesundheitstechnologien acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Inhalt. 01 Vorwort > Joachim Milberg 7 02 Einleitung > Günter Spur 13 03 Beiträge > Zum Selbstverständnis der Gesundheitstechnologien Günter Spur > Wissenschaftlicher Fortschritt und klinische Forschung – Welche neuen Strukturen brauchen wir in Deutschland? Detlev Ganten > Innovative Medizintechnik als Schrittmacher für eine Reform der Gesundheitsversorgung Dietrich Grönemeyer > Die Medizintechnik als innovativer Wirtschaftsfaktor der Zukunft Heinrich Kolem > Entwicklungstrends in der Biomaterialforschung und Implantattechnologie Klaus-Peter Schmitz > Sechs Thesen zur Innovation in der Medizintechnik Olaf Dössel >Die Gesundheitskarte – Prozessmanagement im Gesundheitswesen Dieter Spath > Systeminnovationen als Treiber des Gesundheitsmarktes Norbert Klusen > Chancen für den Gesundheitsmarkt durch e-Health Eckhard Nagel/Karl Jähn > Finanzierbarkeit des medizinisch-technischen Fortschritts Klaus-Dirk Henke 19 20 26 34 38 42 48 52 58 64 72 04 Fragen aus der Diskussion > Patrick Illinger 81 82 05 Impressionen vom acatech Symposium 87 06 acatech Portrait 93 07 Teilnehmer 97 08 Autorenportraits 103 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Vorwort. > Joachim Milberg > 01 Vorwort > Vorwort. > Joachim Milberg, Präsident acatech Die Gesundheitsdebatte in jüngster Zeit hatte den Kostenfaktor zum Thema und massive Einsparungen im Fokus. ­Nahezu unberücksichtigt blieb dabei aber die Tatsache, dass das ­ Gesundheitswesen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist – meines Erachtens besonders auch im Hinblick auf die Innovationskraft und die Lebensqualität in unserem Land. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 In Deutschland gibt es zahlreiche Forschungsinstitute und Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik, Biotechnik und Pharma, die über ein enormes Potenzial an Innovationen verfügen. Es muss für uns alle – gerade im Hinblick auf die demographische Entwicklung in unserem Land – von Interesse sein, dieses Innovationspotenzial zu heben und in wirtschaftlichen Erfolg für die hier tätigen Unternehmen und unsere Volkswirtschaft umzumünzen. Genau hierzu will acatech einen Beitrag leisten. acatech steht für die Symbiose von academia und Technik und ist die gemeinsame nationale Stimme der Technikwissenschaften auf der Ebene der Akademien der Wissenschaften in Deutschland. acatech hat den Anspruch, die unabhängige und anerkannte Institution in Deutschland zu werden, die für die Interessen der Technikwissenschaften – auch international – eintritt. acatech bewirbt sich deshalb auch darum, die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften zu werden. Es ist das Bestreben von acatech, die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands so zu fördern, dass sie weiterhin zur Weltspitze zählt. acatech macht es sich deshalb auch zur Aufgabe, eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, um den Forschungs- und Produktionsstandort Deutschland leistungs- und zukunftsfähiger zu machen. Wir lassen uns in die Pflicht nehmen und dies nicht nur innerhalb acatechs, sondern bei verschiedenen Initiativen, wie etwa bei der Initiative „Partner für Innovation“ der Bundesregierung. Uns beschäftigt dabei insbesondere die Frage nach Wegen zur Verbesserung der Innovationsfähigkeit in unserem Land. Denn Deutschland wird langfristig nur durch Innovationen erfolgreich sein, da nur sie nachhaltiges Wachstum schaffen und Impulse für mehr Beschäftigung bieten. Vorwort Innovationen geschehen jedoch nicht in einem luftleeren Raum. Vielmehr gibt es bestimmte Faktoren, die das Innovationsgesche­hen in einem Land beeinflussen – positiv wie negativ. Um das Wechselspiel dieser Faktoren zu beschreiben, möchte ich das Innovationsgeschehen in einem Kreislauf darstellen. Dieser Kreislauf wird von zwei Polen her gesteuert, die sich gegenseitig beeinflussen: Auf der einen Seite stehen die Universitäten und die Wissenschaft, die durch Lehre und Forschung neues Wissen, neue Wissensträger und neue Wissensarbeiter generieren. Diese Seite möchte ich Enabler-Seite nennen, denn hier geht es darum, Inventionen zu schaffen und Kreativität zu fördern. Auf der anderen Seite des Kreislaufes stehen die Unternehmen und der Markt, der letztlich entscheidet, was Innovationen sind. Diese Seite ist die Umsetzungsseite. Hier werden Inventionen, das heißt Forschungsergebnisse, Erfindungen und neue Ideen, in Innovationen umgesetzt. Wie hängen nun diese beiden Pole, Wissenschaft und Markt, wechselseitig miteinander zusammen? 10 Dieser Rahmen ist zum einen durch den Staat bestimmt. Welchen Freiraum lässt der Staat Wissenschaft und Unternehmen zur ­eigenverantwortlichen Gestaltung? Fördert er den produktiven Wettbewerb, oder schränkt er ihn ein? Zum anderen ist der Rahmen des Kreislaufs durch das gesellschaftliche Klima bestimmt. Wie offen ist eine Gesellschaft für neues Wissen, für Inventionen, für Innovationen? Sieht sie in neuen Technologien, Entwicklungen und Produkten eher Chancen oder Gefahren? Vertraut sie ihren Fachleuten, die diese Innovationen entwickeln? Für eine nachhaltige positive Entwicklung des Innovationsgeschehens in Deutschland brauchen wir eine Gesellschaft, die grundsätzlich offen ist für Innovationen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die wachsen will und die willens ist, eine neue Balance zu finden zwischen soziologischen, kulturellen, ökologischen, ökonomischen und technologischen Chancen und Risiken. Während auf der Seite der Wissenschaft Kapital eingesetzt werden muss, um neues Wissen zu generieren, wendet die Marktseite gerade dieses neue Wissen an, um daraus Kapital zu generieren. Die Gewinne auf der Marktseite sind dann wieder die Grundlage für jedwede Investitionstätigkeit auf der Wissenschaftsseite. Wie das eben beschriebene Kreislaufmodell zeigt, ist das Innovationsgeschehen in Deutschland in hohem Maße abhängig von gesamtgesellschaftlichen Faktoren. Denn Unternehmen, die Innovationen schaffen, benötigen einen innovationsfreudigen Markt und eine Gesellschaft und eine Politik, die Innovationen gegenüber aufgeschlossen sind. Das heißt also: Je mehr Ergebnis auf der Marktseite generiert wird, desto mehr Investitionspotenzial existiert für die Wissenschaftsseite. Im Idealzustand bedeutet ein Zuwachs an Wissen jeweils einen Zuwachs an Ergebnis und vice versa. Solch eine positive Rückkoppe­ lung muss unser Ziel sein. Diese positive Rückkoppelung kann gefördert oder behindert werden. Denn beide Seiten, die Enabler-Seite wie die Umsetzungsseite, bewegen sich in einem Rahmen, der das Wechselspiel im Kreislauf positiv wie negativ beeinflussen kann. Um das Innovationsgeschehen, wie eben beschrieben, positiv zu beeinflussen, bedarf es meines Erachtens deshalb auch eines Mentalitätswandels in unserem Land. Wenn wir weiter wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir für Fortschritt – auch technischen Fortschritt – einen breiten gesellschaftlichen Konsens erreichen, also gewissermaßen das Gesellschafts-“mindset“ ändern. Es geht konkret darum, Technikchancen genauso wichtig zu nehmen wie negative Technikfolgen. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Welche Schlussfolgerungen müssen wir aus diesen Überlegungen ziehen? Was ist zu tun? Was wir meines Erachtens brauchen, ist eine Vision, ein Leitbild, das den Willen zu nachhaltigem Wachstum durch Innovationen gesamtgesellschaftlich verankern kann. Solch ein Leitbild kann man nicht verordnen. Vielmehr ist ein Leitbild das Ergebnis einer breiten und offenen gesamtgesellschaftlichen Diskussion. acatech beteiligt sich in verschiedenen Arbeitskreisen an dieser Diskussion. acatech möchte im Sinne einer unabhängigen Stabsstelle für Technikwissenschaften auf der Basis des besten wissenschaftlichen Know-hows Fakten und Sachargumente zusammentragen und eine objektive und kompetente Bewertung der Technologieaspekte vornehmen. Die drei acatech Arbeitskreise ❙ Technikwissenschaften und Innovation ❙ Ingenieurausbildung und ❙ Forschung widmen sich Fragen der Forschung und Ausbildung in den Technikwissenschaften. Die vier acatech Arbeitskreise ❙ Mobilität ❙ Lebenswissenschaften ❙ Energie und Umwelt ❙ Kommunikationstechnik und Wissensmanagement hingegen beschäftigen sich mit Sachthemen der Technikwissenschaften, um Möglichkeiten für innovatives Wachstum in ihren jeweiligen Feldern auszuloten. Die in diesem Band zusammengestellten Beiträge sind aus einem Symposium hervorgegangen, das der Arbeitskreis Technikwissenschaften und Innovation unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Günter Spur am 26. April 2005 in den Räumen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ausgerichtet hat. Unter dem Titel „Wachstum durch innovative Gesundheitstechnologien“ diskutierten dort Mediziner, Gesundheitsökonomen, Medizintechniker, Ingenieure und Krankenkassenvertreter über die ökonomischen Potenziale, aber auch die Potenziale für mehr Lebensqualität, die in der modernen Gesundheitstechnologie stecken. Die Veranstaltung hat deutlich gemacht, dass Deutschland aufgrund seines wissenschaftlichen Know-hows und mit den in dem Gebiet bereits tätigen Unternehmen gute Voraussetzungen hat, dieses Feld maßgeblich mitzugestalten. Allerdings müssen wir die Chancen auch nutzen. Die hier versammelten Beiträge zeigen Wege dazu auf. 11 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Einleitung. > Günter Spur > 02 Einleitung > Einleitung. > Günter Spur, Chairman des Symposiums Die deutsche Wirtschaft braucht Wachstum durch Innovation. Dies ist durch neuerliche Regierungserklärungen auch sichtbar als politisches Ziel der nahen Zukunft erklärt worden. 14 14 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Wachstumsmärkte der global orientierten Wirtschaft dürfen an unserer Volkswirtschaft nicht mehr vorbeigehen. Die Erfahrung mit der Informationstechnik hat uns gezeigt, dass der Eintritt in den Innovationswettbewerb mit den hoch entwickelten Industrienationen nicht früh genug erfolgen kann. Alle Zukunftsprognosen sind sich über die steigende Bedeutung des Innovationspotenzials der Medizintechnik mit ihren komplexen Anwendungsgebieten einig. In Deutschland besteht traditionsgemäß ein äußerst leistungsfähiges Netzwerk in Forschung und Wirtschaft auf diesem auch technologisch expandierenden Wirtschaftsbereich. Angesichts des weltweiten Innovationsbedarfs gibt es auch einen zunehmenden internationalen Wettbewerb um wichtige Schlüsselpositionen für die zukünftige Marktbeherrschung. Das Innovationspotenzial der Medizintechnik beinhaltet jedoch neben der Impulswirkung auf die Wirtschaft auch eine entscheidende Schlüsselfunktion für die zukünftige Entwicklung der von staatlicher Verantwortung getragenen Gesundheitssysteme für die Gesellschaft. Die Kosten hierfür sind das eine Problem, die Effizienz das andere. Eine Umschichtung der Kostenträger wird auf die Dauer keine Lösung bringen. Die Stabilisierung des Gesundheitszustands der Menschen in einer Volkswirtschaft erfordert eine Anpassung an die sozialen Bedürfnisse angesichts einer veränderten demographischen Entwicklung unter Nutzung aller verfügbaren Innovationspotenziale. Hierbei ist in erster Linie nach den verfügbaren Wirkmedien in Wissenschaft und Technik gefragt, die das gesamte Gesundheitssystem modernisieren und dabei gleichzeitig einen nachhaltigen Innovationsdruck auf die Wirtschaft entwickeln, der zu einem allgemeinen Wandel der gesellschaftlichen Grundstimmung führt. Es ist der „Ruck“ auf eine veränderte Zielsetzung technologischer Schwerpunkte, ein Paradigmenwechsel, der auch mit Humanisierung der Technologie beschrieben werden kann: Human Technologies wäre ein Oberbegriff für einen integrativen Innovationsprozess von Technikwissenschaften und Lebenswissenschaften. Eine solche Blickrichtung wendet sich zuerst an die Betroffenen, ist also eine Aufforderung zum Diskurs des jeweiligen Selbstverständnisses der Wissenschaftsdisziplinen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer Fähigkeit zum innovativen Aufbruch, zur Reform der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. 15 Einleitung Die medizinischen Wissenschaftsgebiete erleben eine zunehmende technologische Durchdringung ihrer Instrumentalisierung und Methodik. Dies gilt nicht nur für Diagnose und Therapie, sondern zunehmend für Präventionen und Prophylaxe. Offenbar ist es besonders in Deutschland schwierig, ein rationales Verhältnis des Zeitgeistes zum Fortschritt der Biowissenschaften zu finden. Am Ende überholt uns die Realität. Die gentechnische Industrie entwickelt ihre globale Dominanz mit dem Standort in den USA. Dies sollte uns für die Medizintechnik eine Warnung sein. Ein Aufbruch zur Innovationsoffensive im Bereich der Gesundheits­ technologien ist weltweit erkennbar. Das Wirkungsfeld ist komplex und vielseitig, es greift tief in die Arbeits- und Lebenswelt der Men­ schen ein. Dabei wird die Integration der Informationstechnik eine ähnliche Rolle wie im Bereich der Produktionstechnik spielen: Elektronik und Mikrosystemtechnik verbessern die Präzision medizinischen Handelns, bringen eine Verfeinerung der Sensorik und Akto­rik und damit neue Anwendungsmöglichkeiten in allen Gebieten. Nanotechnologisch aufbereitete Wirkprozesse sind noch längst nicht in ihren vollen Entfaltungsmöglichkeiten erkannt. Die Gesundheitstechnologien werden durch ein volkswirtschaftlich nachhaltig wirksames Wachstum gekennzeichnet sein, das nicht nur die Produktionswirtschaft, sondern sehr arbeitsintensiv auch den Dienstleistungsbereich erfassen wird. 16 Das Informationsbedürfnis wird im Gesundheitswesen in einem Ausmaß steigen, wie die Vernetzung der Systeme zunimmt. Das Wachstumspotenzial wird sich auf die Medizintechnik übertragen. Der Markt ist erkennbar: Die Menschen wollen mehr über ihre Gesundheit wissen. Wir stehen vor der großen volkswirtschaftlichen Aufgabe, einen Strukturwandel der Gesundheitstechnologien sowohl in wissenschaftlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht einzuleiten, der unser Innovationspotenzial in einer so nachhaltigen Weise steigert, dass wir im weltweiten Vergleich nicht nur eine Führungs­rolle spielen, sondern auch zum Schrittmacher des technologischen Fortschritts heranwachsen könnten. Eine erste Prüfung unserer Wettbewerbssituation macht deutlich, dass wir eine gute Ausgangsposition haben. Die Versorgung des Weltmarkts mit medizintechnischen Produkten ist das eine, die Erneuerung der Gesundheitssysteme als Netzwerk zur Stabilisierung gesellschaftlicher Grundbedürfnisse das andere. Aus der Informationsgesellschaft wird eine Gesundheitsgesellschaft. Hier ist auch die Verantwortung des Staates gefordert: Denn es geht nicht nur um Wachstum, es geht um einen Paradigmenwandel des technologischen Fortschritts. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 17 18 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Beitr äge. > Günter Spur > Detlev Ganten > Dietrich Grönemeyer > Heinrich Kolem > Klaus-Peter Schmitz > Olaf Dössel > Dieter Spath > Norbert Klusen > Eckhard Nagel/Karl Jähn > Klaus-Dirk Henke > 03 19 Beiträge: Günter Spur > Zum Selbst verständnis der Gesundheitstechnologien. > Günter Spur Das Selbstverständnis unserer technologisch geprägten Gesellschaft hat hinsichtlich der zu erwartenden Lebensqualität eine höhere Sensibilität und damit zugleich auch eine neue ­Dimension technologischer Verantwortung für eine individuell an­gepasste Lebensführung erfahren. Das Bedürfnis nach einer sicheren Beherrschung dessen, was wir Gesundheit nennen, hat eine zunehmende Aktualität erhalten. Der technologische Fortschritt orientiert sich mehr und mehr an gesellschaftlichen ­Zielsetzungen zur gesicherten Entwicklung natürlicher Lebensprozesse. Die Verbesserung der Lebensqualität ist eine Herausforderung für alle Aktions­ potenziale in Wissenschaft und Wirtschaft, die die Lebensfähigkeit der Mensch­heit beeinflussen und damit auch Verantwortung für die Gesundheit der Gesamtheit wie für das Individuum tragen. 20 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 2) Das Umfeld innovativer Gesundheitstechnologien Das Gesundheitswesen hat höchste Priorität in der Gesellschaft. Deshalb steigt die Bereitschaft, hierfür zu investieren. Die Nachfrage am Gesundheitsmarkt wird nicht nur die bewährte Biomedizintechnik voranbringen, sondern zunehmend auch unsere Gesundheitskultur ganzheitlich verändern. Präventive Vorsorge ist schon jetzt ein umfassendes Thema der Lebensgestaltung geworden. Die Gesundheitswirtschaft ist künftig als Innovationsträger mehr denn je auf eine Aktivierung der Forschung angewiesen (Bild 1). Die Erneuerung unserer Gesundheitskultur ist kein Luxus, sie ist bittere Notwendigkeit zur Sicherung unserer Lebensbedingungen. Diese konzentriert sich als arbeitswirtschaftliche Herausforderung auf das Wachstum unseres Wirtschaftspotenzials. Es gilt, den zukünftigen Innovationsbedarf im Gesundheitswesen zu erkennen. Technik­­ wissen­ schaften Biotechnik Medizintechnik Medizin­ informatik Innovative Gesundheitstechnologien Gesund­ heits­ telematik Kommuni­ kationswis­ senschaften Natur­ wissen­ schaf­ten Lebens­­­wissen­ schaften Medizin­ ethik Gesund­ heits­­öko­­ no­mie Versorgungs­ management Gesundheits­ wissen­­ schaften Gesundheitswissenschaftliche Forschung gefragt Die technologische Weiterentwicklung des Gesundheitswesens ist eine der wichtigsten Aufgaben im zukunftsorientierten Wirtschaftsmanagement. Hierzu gehören alle Maßnahmen, die das kreative Technologiepotenzial zur optimalen Entfaltung bringen. Wichtig ist eine zielgerichtete und intensive Begleitung der Innovationsprozesse durch die medizinische Forschung. Hierbei muss ein anregendes Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wirksam werden (Bild 2). 1) Innovationen verändern den Arbeitsmarkt Technologische Innovationspotenziale der Gesundheitswirtschaft Materielle Innovationen Personelle Innovationen Immaterielle Innovationen Produktionstechnik medizinischer Geräte und Anlagen Diensttechnik für medizinische Versorgung mit technischen Mitteln Informationstechnik in medizintechnischen Netzwerken Gesundheitswissenschaftliche Forschung benötigt Innovationsmotivationen, die von Visionen geleitet Ideen für eine neue Gesundheitstechnologie entfalten. Hierzu ist eine kreative Wechsel­ beziehung zwischen Forschung und Praxis unverzichtbar (Bild 3). Die Gesundheitswissenschaften beziehen sich aus allgemeiner Sicht auf die Erforschung biologischer Organismen, deren Lebens­ prozesse durch Selbstregulation beeinflusst werden. Objekt der Forschung sind dynamische Systeme mit biotischen Prozessen, deren Qualitätszustand durch das Verhalten von Prozessparametern bestimmt wird, die auf einen optimalen Prozesszustand zielen, dessen Normalität durch den Begriff Gesundheit umschrieben wird. Gesundheit ist somit ein angestrebter Zustand der Normalität biotischer Systeme mit möglichst hoher Funktionserfüllung ihrer regulierbaren Prozessparameter im Sinne optimaler Zielerreichung der Gesamtfunktion. Gesundheit entsteht als Ergebnis der Regulierung dynamischer Lebensprozesse. Sie kann aus dem biotischen Generierungspotenzial durch medizinische Behandlung, aber auch durch präventive Überwachung des Gesundheitszustands beeinflusst werden. 21 Beiträge: Günter Spur Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als einen Zu­stand vollständigen körperlichen, seelischen, geistigen und so­zialen Wohlbefindens. Dieser umfasst also mehr als nur die Ab­wesenheit von Krankheit und Gebrechen. Gesundheit wirkt als komplexes System interaktiver Potenzialfaktoren, deren Mo­men­ tanzustand von zahlreichen und sehr unterschiedlichen Einflussgrößen abhängig ist. Aus den Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung hat sich der Mensch ein technologisches Nutzungspotenzial geschaffen, das seine Lebenswelt umgestaltet. Es handelt sich um eine Hilfswelt, die durch Wissen und Kreativität sowohl die Lebensqualität anreichert als auch der Gesundheitsförderung dienen kann. In Anlehnung an Begriffe der Qualitätswissenschaft könnten Be­ griffe der Gesundheitsqualität eingeführt werden. Eine aktive Gesundheitstechnologie ermöglicht es, in den Prozess der Regulierung des Gesundheitszustands einzugreifen. Sie ist also zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung fähig (Bild 4). In der modernen Medizin haben die verschiedensten Methoden für die Diagnose von Krankheiten eine große Bedeutung erlangt. Das eingespielte System einer externen Beauftragung durch ärztliche Entscheidung hat sich sowohl zur Verlaufskontrolle von Behandlungen als auch zur Beobachtung des Gesundheitszustands bewährt. 3) Innovations- und Produktivitätszentren im Wechselspiel Die labordiagnostische Medizintechnik hat weit reichende Fortschritte gemacht, so dass unter Einbeziehung leistungsfähiger Informations- und Kommunikationssysteme neue Modelle der Gesundheitsregulierung angedacht werden können. Die sensorische Erfassung des Prozesszustands biotischer Systeme kann zu einem standardisierten Gesundheitsprofil führen, das als Regulationsbasis für die aktuellen Werte gemessener Gesundheitsparameter dient. Die fortgeschrittene Informationstechnik ermöglicht erhebliche Verbesserungen zur Regulierung durch systemtechnische Kontrolle des Gesundheitszustands. Sie vermittelt neue Medien, Verfahren und Systeme zur Optimierung von Lebensprozessen. Dies bedeutet eine Umorganisation der alltäglichen Lebensführung im Sinne einer erhöhten Aufmerksamkeit für Folgewirkungen bestimmter Handlungsweisen. Hierin sind die Möglichkeiten zur Selbstbildung und Selbsterziehung eingeschlossen. Innere oder äußere Störwirkungen auf die Gesundheit lassen sich durch gezielte Regulation kompensieren. Dabei ist ärztliche Anweisung und Überwachung unverzichtbar. 4) Wirkbereiche innovativer Gesundheitstechnologien Wissenschaftliche Forschung in Innovationszentren Wirtschaftliche Umsetzung in Vernetzungssystemen Innovative Gesundheitstechnologien Innovative Gesundheits­ technologien Produktive Markteinführung Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch technologischen Fortschritt in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation Basis­technologien: Voraussetzung zum Markterfolg 22 Schlüssel­­technolo­gien: Sicherung des Marktzuwachses Schrittmacher­ technologien: Beschleunigung der Marktein­ führung Spitzen­ technologien: Innovative Marktbeherrschung Zukunfts­ technologien: Strategische Sicherung des Markterfolgs acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Gesundheitsprozess als wissenschaftliches System Die Grundfunktion des Systems Gesundheitstechnologie besteht darin, ein Nutzungspotenzial zur Verbesserung der Gesundheitsqualität der Menschen zu entwickeln. Der als gesund definierte Normalzustand biotischer Systeme setzt enge Toleranzgrenzen der Wirkparameter. Dies stellt hohe Anforderungen an die Regulation zur Führung der Prozessparameter. Der Gesundheitsprozess verläuft in einem dynamischen System, das durch materielle, energetische und informationelle Transformationen gekennzeichnet ist. Um im Systembild zu bleiben, geht es beim Bemühen um einen optimalen Gesundheitszustand darum, die Lebensprozesse sensorisch zu erfassen und durch aktorische Hilfsmittel, insbesondere aber durch technologische Regulationssysteme, zu beeinflussen. Bewusstes Gesundheitsmanagement erfordert Datenkenntnisse, um regulativ handeln zu können. Der technologische Fortschritt der medizinischen Gerätetechnik bietet ein breites Sortiment von Möglichkeiten an, die individuelle Gesundheitsüberwachung durch Messdaten zu objektivieren. Hierzu muss ergänzend Aufklärungsarbeit geleistet werden, die alle Arten der medizinischen Versorgungszentren einschließt. Andererseits entsteht zunehmend ein Markt für technologische Hilfsmittel zur Förderung der Gesundheitsüberwachung. Die Informationstechnik wird über verfügbare Netzwerke neue Wege der Gesundheitstechnik öffnen. Die telematische Überwachung des individuellen Gesundheitsprofils zur Förderung der Selbstregulation ist ein interessantes Entwicklungsfeld. Aus diesen Überlegungen kann eine übergeordnete, technologisch orientierte Fachdisziplin abgeleitet werden, die als technologische Wissenschaft die instrumentelle Regulation von Gesundheitsprozessen erforscht und als System von Erkenntnissen und Methoden auf die Erscheinungsformen von Gesundheitsprozessen mit dem Ziel gerichtet ist, diese zu stabilisieren und zu optimieren. Hier liegt ein wachstumsfähiges Innovationspotenzial. Dies richtet sich nicht nur auf die Überwachung von Behandlungen bei Krankheiten, sondern vielmehr auf die Möglichkeiten einer permanenten Kontrolle des Gesundheitszustands (Bild 5). 5) Innovationsorientierung gesundheitstechnologischer ­Forschung Gesundheitstechnolo­ gische Wissenschaften System von Erkenntnissen und Methoden zur Entwicklung von Innovationspotenzialen Erforschung der Erschei­nungs­ formen gesund­heits­techno­lo­gi­ scher Systeme Erforschung von Methoden zur Entwicklung gesundheits­ technologischer Systeme Innovationsfähigkeit ge­ sund­heitstechnologischer Potenziale 23 Beiträge: Günter Spur Innovative Gesundheitstechnologien Die Gesundheitstechnologie verändert die Gesundheitsversorgung unserer Gesellschaft durch einen fortschreitenden Innovationsprozess. Sie zielt auf eine Nutzung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in Verbindung mit erfinderischem Handeln. Ihr Wirkbereich umfasst nicht nur die Diagnose und Therapie, sondern zunehmend auch die Prävention. Im gesamten Gesundheitswesen ist ein Wandel von Wertvorstellungen erkennbar, der zu einem kritischen Bewusstsein geführt hat. Die Politik hat in ihrer normativen Funktion Wissenschaft und Technologie vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere gilt dies für die Gesundheitstechnologie, deren Fortschritt die Ergebnisse medizinischer Forschung mit denen der innovativen Technikwissenschaften integriert. Die Gesundheitstechnologie umfasst die Gesamtheit aller Mittel und Verfahren der Technikwissenschaften zur Nutzbarmachung im Gesundheitswesen. 6) Differenzierung innovativer Gesundheitstechnologien Aufgabenstellungen Grundlagenorientierte Wissensgewinnung Prozessorientierte Optimierung Systemorientierte Gliederung der Disziplinen Verbundorientierte Kooperationen 24 Strukturorientierte Optimierung Praxisorientierte Optimierung Wissenschaftsorientierte Begründung 7) Wirkrichtungen innovativer Gesundheitstechnologien Lebensqualität Informations- undKommunikationsmarkt Innovative Gesundheitstechnologien Medizin- und Gesundheitsmarkt Arbeitsmarkt Angesichts ihrer zunehmenden Komplexität und innovativen Dynamik erwächst das Bemühen um eine Definition dessen, was wir unter Gesundheitstechnologie verstehen wollen. Dabei müssen wir über den konventionellen Wirkungskreis der Medizintechnik hinausgehen und den Dialog auch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen suchen. Es stellt sich auch die Frage nach dem eigenen Standort und nach der Ausrichtung einer integrativ orientierten Leitdisziplin der Gesundheitstechnologien. Der Versuch einer Ein­ teilung macht ein Begriffsgemenge unklarer Abgrenzung deutlich. Klärungsprozesse sind notwendig, die nur schrittweise erfolgen können und einer vertiefenden Diskussion bedürfen (Bild 6). Mit zunehmendem technischen Fortschritt hat sich das Sachpotenzial des Gesundheitswesens geändert. Eine steigende Sensibilisierung der Öffentlichkeit hat zu einem sozioökonomischen Erwartungsdruck gegenüber Forschung und Technologie geführt. Es gelten nicht mehr allein die Zwänge medizinischer Präferenzen, sondern auch zunehmend die der ökonomischen Vernunft. Der Fortschritt in der Gesundheitstechnologie erfordert auch wirtschaftlich verträgliche Versorgungsstrukturen, die den technologischen Innovationsdruck verkraften und verarbeiten können. Die Wirkrichtungen innovativer Gesundheitstechnologien zielen nicht nur auf die Verbesserung der individuellen Lebensqualität, sondern auch auf ein Wachstum der verschiedensten Wirtschaftsbereiche (Bild 7). acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 8) Wachstumsfelder der Gesundheitstechnologien Forschungswirtschaft Produktions­ wirtschaft Innovative Gesundheitstechnologien Versorgungswirtschaft Informations­ wirtschaft Bauwirtschaft Die fortgeschrittenen Gesundheitstechnologien sind anwendungsorientiert ausgerichtet. Sie kommen als soziotechnische Reform des Gesundheitswesens zur Entfaltung, gebunden an die Realität des Gegenwärtigen. Sie benötigen zu ihrer praktischen Akzeptanz den notwendigen Reifegrad für die Anwendung in der medizinischen Versorgung. Der Fortschritt im Gesundheitswesen beruht auf Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung, aber auch auf Erfindungsreichtum im praktischen Gestalten der medizintechnisch orientierten Produktionswirtschaft. Bei der Gesundheitstechnologie handelt es sich um eine medizintechnische Hilfswelt, die funktional orientiert der Befriedigung des Bedarfs im Gesundheitswesen dient. In Verbindung mit der medizinischen Forschung bildet die Gesundheitstechnologie ein Nutzungspotenzial zur Dienstbarmachung des technologischen Fortschritts (Bild 8). Der Innovationsprozess bis zur Markteinführung medizinischer Produkte ist risikobehaftet. Zur Begleitung sind Spezialisten gefragt, von Erfahrung geprägt und verantwortungsbereit für das Neue, aber auch vom Bewusstsein bestimmt, dass das Neue kein Selbstläufer ist. Bewährtes muss im Neuen erhalten bleiben. Zuviel Neues erhöht das Risiko der Funktionalität. Die Weisheit des Entwicklers begründet sich in der Dosierung des Neuen. Gesundheitstechnologie ist zukunftsorientiert, sie verarbeitet das Neue, das sie entdeckt oder erfunden hat. Neue Fragestellungen führen zu neuen Forschungsrichtungen. Sie aktivieren neue Strukturen der medizinischen Forschung. 25 Beiträge: Detlev Ganten > Wissenschaftlicher Fortschrit t und klinische Forschung – Welche neuen Strukturen brauchen wir in Deutschland? > Detlev Ganten Vor etwa 400 Jahren begann der medizinisch wissenschaftliche Fortschritt in Europa mit der Möglichkeit der modernen Analyse des Körpers von Gesunden und Kranken, der Anatomie und der sich daraus entwickelnden wissenschaftlichen Inspektion der Organe des Körpers und der Organpathologie als Grundlage der Medizin. Eine weitere große Etappe ereignete sich um 1850 bis 1900 in Berlin mit Rudolf Virchow und der sich damals entwickelnden Biochemie. Man stellte fest, dass nicht nur die Organe, sondern die kleineren Untereinheiten der Organe, das heißt die ­Zellen, mit Erkenntnissen über Gesundheit und Krankheit verbunden werden konnten. 26 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 So entstanden die Zellularpathologie und fast gleichzeitig die moderne Biochemie. Diese sind seit fast 150 Jahren immer noch wichtige Grundlagen der Medizin, mit denen wir heute noch arbeiten. Dann gab es einen weiteren großen Fortschritt: die Genomforschung. Sie wird von vielen immer noch unterschätzt, von manchen aber auch überschätzt. Wie sollen wir mit der Sorge um und der Chance für den medizinischen Fortschritt umgehen? Dazu einige Basisdaten zum Genom des Menschen: Im Zellkern gibt es 3 Milliarden Bausteine (Basenpaare) auf den 23 doppelten Chromosomen. Darauf liegen die etwa 30.000 Gene, die Funktionseinheiten unseres Erbmaterials, die selbst keine direkte Funktion besitzen, sondern reine Informationsträger sind. Sie müssen erst in Eiweiße übersetzt werden. Dies spielt sich innerhalb einer jeden Zelle ab und was an biologischer Form und Funktion entsteht, wird in den Genen als Information gespeichert. Diese Informationen auf den Genen entscheiden über das, was Goethe „Gestaltwerdung“ genannt hat. Der große Fortschritt der Genomforschung besteht darin, dass wir jetzt beginnen, an diesen Informationsmolekülen ablesen zu können, welche Genstruktur-Veränderungen zu welchen Funktionsänderungen führen. Eine einzelne Änderung der Genstruktur, eine so genannte Punktmutation bei einer Krankheit, wie zum Beispiel der Mukoviszidose, kann darüber entscheiden, ob ein bisher Gesunder zukünftig ein Patient sein wird oder nicht. Man unterscheidet erblich angelegte Veränderungen der Gene von solchen Mutationen, die im Laufe des Lebens erworben werden, zum Beispiel durch Ablesefehler oder Strahlenexposition der Gene. In diesem Fall handelt es sich um so genannte somatische Veränderungen. So kommen wir zu einer Vorstellung von einem „Genotyp“, der in den Genen festgelegt ist, zum Phänotyp, der sich im Erscheinungsbild der Person oder des Patienten ausprägt. Dies führt mit Hilfe von sehr schnellen, physikalisch präzisen Analysen zu neuen Erkenntnissen in der Biologie und Medizin. 27 Beiträge: Detlev Ganten Ein zweiter, vielleicht noch wichtigerer Aspekt der Genomforschung ist das molekulare Verständnis dessen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir können die Evolution des Menschen inzwischen genomisch untersuchen. Es gibt als ursprünglichen Ausgangspunkt der Evolution noch Lebewesen, die zum Teil auch heute in der Natur vorkommen. Fast die gesamte Kette der Evolution des Lebens kann entweder in den Museen oder in der Natur untersucht werden (Bild 1). Grundsätzlich können wir genomisch feststellen, was den Menschen von den Einzellern und unseren evolutionären Ahnen unterscheidet. Eine exemplarische Entdeckung ist eine Punktmutation im so genannten Fox-P2-Gen. Dieses Gen reguliert die Muskulatur im Schlund- und Gesichtsbereich, befähigt den Menschen, schneller zu artikulieren, Mimiken zu entwickeln, von den Urtönen unserer Vorfahren zu einer konsonanten- und vokalgeprägten hochdifferenzierten Sprache zu kommen. Somit sind wir in der Lage, Gedanken äußern zu können, Kommunikation zu entwickeln und dadurch eine soziokulturelle Entwicklung zu ermöglichen, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Diese Fähigkeiten sind erstmals vor etwa 100.000 Jahren aufgetaucht, also vor ganz kurzer Zeit in der Evolution, die ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren begonnen hat. Das bedeutet, dass wir als moderne Menschen in der Zeitskala der Evolution sozusagen vor wenigen Sekunden entstanden sind. Diese neue Entwicklung könnte den Siegeszug des Homo Sapiens in Afrika bewirkt haben, wie wir aus alten Knochenbefunden feststellen konnten, an denen man die GenAnalyse betreiben kann. Von Afrika ausgehend hat schließlich der Homo Sapiens aus dem Mittelmeerraum die Welt bevölkert. 28 Das heißt – in unzulässig verkürzter Form dargestellt – die Genomforschung bringt viel mehr Erkenntnisgewinn als nur ein besseres Verständnis der Informationsmoleküle des Lebens über die Grundlagen von Gesundheit und Krankheit. Das Selbstverständnis des Menschen als evolutionäres Wesen eröffnet sich plötzlich der methodischen Untersuchung. Dies ist einer der Gründe, weshalb viele von uns der Meinung sind, dass die Lebenswissenschaften so etwas sind oder sein könnten, wie das Leitthema der modernen Wissensgesellschaft, auf die wir uns hinbewegen. Die Lebenswissenschaften sind mehr als jede andere Disziplin interdisziplinär und institutionenübergreifend. Es gibt keine Wissenschaft, die nicht essenziell mit der Lebenswissenschaft verbunden ist, und jeder kann am eigenen Leib erfahren, was die Fortschritte in diesen Lebenswissenschaften für ihn persönlich bedeuten. 1) Evolution 3,5 Milliarden Jahre Einzeller 70 Millionen Maus 5 Millionen Schimpanse Hominiden Neandertaler 100.000 Jahre Homo Sapiens Afrikaner Griechen Europäer Weltbevölkerung (6 Milliarden) FOX P2 303 7q- THR 31 ASP GEN 325 ASP SER - P Muskulatur-SchlundGesicht · Selektion · Koordination · Geschwindigkeit · Sprache · Kommunikation acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Ein weiteres Beispiel zum Fortschritt in der praktischen Medizin: Wir wissen bereits, dass die Informationsmoleküle des Lebens den Genotyp festlegen. Aus dem Genotyp entwickelt sich der Phänotyp, das Erscheinungsbild des Menschen. Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von weiteren Schritten. Die Gene müssen aktiviert werden, so entstehen daraus Eiweiße und Peptide. Diese bilden gewissermaßen die Grundelemente der Zellfunktion, der Organfunktion und der körperlichen Gesamtfunktion. In diese Schritte können wir in systematischer Weise eingreifen, viel spezifischer als das früher möglich war. Dieser Eingriff kann beispielsweise bedeuten, dass wir mit einer chemischen Substanz, einem Medikament, einen Krankheitszustand in einen Gesundheitszustand umwandeln, Symptome erleichtern und Schmerz verhindern können; das wären dann die heilsamen Wirkungen der Medikamente. 2) Bei F&E-Kapazitäten haben neben den USA Länder wie ­Großbritannien und Frankreich Deutschland überholt 75,7 F&E-Beschäftig­te in pharmazeuti­schen Unternehmen 2002 [ ’000 Tsd] Anteil F&E-Beschäftigte an ­Beschäftigten in pharma­ zeutischen Unternehmen 29,0 19,1 USA GB 18,7 18,0 1) 1) F JD Länder [%] USA Großbritannien Frankreich Deutschland 27 35 20 19 Daraus entwickeln sich zurzeit eine neue Industrie und ein neuer Wissensbereich. Die Entwicklung und auch die Einschätzung sowie die Vorhersage der Wirkung von Medikamenten können auf Grund der Genanalyse verbessert werden; ein Bereich, den wir auch als Pharmakogenetik bezeichnen. Solche Medikamente werden beispielsweise bei Herz- oder Nierentransplantationen eingesetzt, um zu verhindern, dass Organe danach abgestoßen werden. Wir wissen, dass einige dieser Medikamente langsamer oder schneller ausgeschieden werden. Hierüber entscheiden spezifische Gene. Personen, die eine besondere genetische Disposition haben, scheiden ein Medikament langsam aus, andere schneller. Deshalb würden bei einer Standarddosierung langsam ausscheidende Personen überdosiert und schnell ausscheidende unterdosiert werden. Das kann bei Organtransplantationen über Leben und Tod entscheiden. Die individuelle Vorhersage der Verstoffwechselung im einzelnen Patienten ist ein entscheidender Punkt für Wirkung und Nebenwirkung eines Medikaments. Diese Systematik führt zu einer ganz neuen Form der Therapie, auch der klassischen medikamentösen Therapie. Bisher ist jede Therapie ein echter Therapieversuch und kein Arzt kann Nebenwirkung und Wirkung vorhersagen. Wenn wir aber eine systematische und spezifische Gendiagnostik entwickeln, dann wird langfristig die Vorhersage möglich. So lässt sich eine rationale individualisierte Therapie installieren. Dies sind einige Beispiele für Fortschritte und Entwicklungen aus der Genomforschung, die sich zunächst sehr allgemein, aber dann auch sehr spezifisch am Markt auswirken können. Quelle: PhRMA, EFPIA, 1) = 2001 29 Beiträge: Detlev Ganten Wie sieht es in Deutschland aus, das einmal in diesem Bereich Andererseits bedeutet das nicht, dass weniger Kranke behandelt führend war? Berlin war ein Ort der europäischen und der abendwerden: Es wird jedoch rationalisiert, durch zum Beispiel kürzere ländischen Medizin. Diese Zeiten sind vorbei. Nach dem Kriege Liegezeiten und vieles mehr. Entscheidend ist, dass wir Gesundwaren wir noch für einige Zeit die „Apotheke der Welt“. Inzwischen heit nicht nur als Kostenfaktor, sondern auch strukturell als Wirtsind viele pharmazeutische Unternehmen ganz oder teilweise schaftsfaktor auffassen. Die Gesamtausgaben für Gesundheit in ausgewandert. Kein einziges deutsches Pharmaunternehmen ist der Gesellschaft steigen in allen Bereichen. Gesundheit ist ein heute noch unter den Top 10 der internationalen Pharmaindustrie Boommarkt auch bezüglich der Bereitschaft der Einzelnen, für zu finden (Bild 2). Hinzu kommt, dass die deutsche Biotech-Indust­ Gesundheit mehr Mittel auszugeben. Berechnungen zeigen, dass rie hinsichtlich ihres Reifegrads noch immer um viele Jahre hinter die Deutschen selbst für ihr liebstes Kind, das Auto, weniger ausden USA zurückliegt. Ursächlich für Letzteres ist insbesondere die geben als für Gesundheit. Wenn man im neuen Jahr jemandem Zurückhaltung internationaler Investoren bei Investitionen in die etwas Gutes wünschen will, so ist es „Gesundheit“. Gesundheit deutsche Biotech-Industrie. Ein weiterer entscheidender Punkt hat eben einen hohen Wert, und das müssen wir nutzen. Etwa ist aber auch, dass die Genomforschung und die Gentechnik 10 Prozent des Wirtschaftswachstums und -volumens in Berlin, gesellschaftlich noch immer nicht so anerkannt sind, wie sie es aber auch in der Bundesrepublik insgesamt, betrifft den Gebrauchen, um die entsprechende Förderung zu bekommen. Gesundheitsmarkt sowohl bezüglich des Umsatzes als auch der sundheit wird im Wesentlichen zurzeit als Kostenfaktor diskutiert. Beschäftigtenzahlen (Bild 3). Wenn eine neue Charité oder andere Universitätskliniken aufgebaut oder umstrukturiert werden, geschieht das fast immer unter In den medizinischen Bereichen Biotechnologie und Medizindem Druck der Kosten, der Bindung an die Lohnnebenkosten, technik geht es deutlich aufwärts; hier werden neue ArbeitsDiktat der Kassen und der Fallpauschale des neuen DRGs-Kranplätze geschaffen. Die Innovationen in der Anwendung für den kenhausfinanzierungssystems. Das wird dazu führen, so sind die Menschen kommen natürlich aus den forschenden Bereichen der Vorhersagen einer Untersuchung von Ernst&Young, dass in allen Universitätskliniken, wie zum Beispiel der Charité – UniversitätsBereichen die Kapazitätsentwicklung und die Bettenzahl in den medizin Berlin. Krankenhäusern stark reduziert werden. Die freien gemeinnützigen Krankenhausträger, insbesondere aber die privaten Betreiber, 3) Der Gesundheitsmarkt als ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland werden marktanteilsmäßig zunehmen. Die gesamte Krankenhauslandschaft ist im Gesamtausgaben (Mrd. EUR) Anteil am BIP (%) Ausgaben je Einwohner (EUR) Abbau begriffen. +3,7% p.a. +1,0% p.a. +3,5% p.a. 2.840 10,9 234,2 203,0 218,8 9,9 10,2 10,6 10,6 2.660 10,9 2.480 202,4 180,2 2.210 163,2 92949698 30 2.540 2.020 00 02 92949698 00 02 92949698 00 02 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Das Unternehmen Charité Leuchtturmprojekte Damit aus der Charité ein Leuchtturm der Lebenswissenschaften werden kann, muss sich an der Charité neben viel versprechenden Forschungsaktivitäten auch eine neue Kultur entwickeln: Strukturen, Prozesse und Mentalitäten, welche die Charité prägen, müssen sich neben dem traditionsreichen Universitätsbetrieb auch am Leitbild eines kunden- und marktorientiert handelnden Unternehmens orientieren. Nur dann werden aus den Forschungsaktivitäten auch neue Produkte und damit neue Arbeitsplätze für die Charité und für Berlin entstehen. Mit den Leuchtturmprojekten soll die Idee einer Vernetzung kli­ nischer und wissenschaftlich-akademischer Arbeiten mit den In­ teressen der Wirtschaft verwirklicht werden. Dieses Vorhaben ist eingebunden in die Initiative „Gesundheitsstadt Berlin“, in der nach dem Willen aller politischen Parteien, der Universitäten, der Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft die Kapazitäten ge­ bündelt werden sollen, um den Gesundheitsmarkt weiter zu entwickeln. In diesem Rahmen soll auch eine fruchtbare Entwicklung des großen Bereichs der Lebenswissenschaften stattfinden. In Berlin wird es darauf ankommen, spezifische Projekte gezielt voran­ zubringen. Einige thematische Schwerpunkte sind zum Beispiel: Damit dieser Wandel von der traditionellen Charité mit der Struktur Fakultät/Klinikum zum „Unternehmen Charité“ gelingt, braucht die 15.000 Mitarbeiter umfassende Charité „Unternehmerische Zellen“ – kleine, flexible, privatwirtschaftliche Einheiten, in denen aufeinander abgestimmte strategische Reformprojekte unternehmerisches Denken und Handeln entfachen. 4) Innovationsmotor Universitätsmedizin Erfindungsmeldungen insgesamt* Anzahl Erfindungsmeldungen 300 280 103 250 200 177 150 100 50 0 Gesamt Charité * Angaben bezogen auf die Jahre 2002 und 2003, Quelle: ipal FU, TU, HU, TFH, FHTW ❙ Die Therapieforschung mit dem Ziel, die Effizienz und die Qualität im Gesundheitswesen durch eine regionale Bündelung klinischer und wissenschaftlicher Expertise zu steigern. ❙ Die bildgebenden Verfahren: Imaging – Molekulare Diagnostik. Zukünftige technische Entwicklungen werden es erlauben, komplexe Vorgänge des Körpers sichtbar zu machen und damit neue Methoden der Diagnose und Therapie zu entwickeln. Diesem Bereich muss eine Plattform gegeben werden, von der aus eine erfolgreiche Umsetzung weiterer Entwicklungen gewährleistet werden kann. ❙ Die Entwicklung einer modernen IT-Landschaft für die Medizin im Digitalen Krankenhaus, die einerseits als Rückgrat eines funktionsfähigen Klinikums unerlässlich ist, und andererseits die Grundlage einer Umsetzung der integrierenden, intersektoralen Patientenversorgung durch Minimierung der Schnittstellenproblematik darstellt. ❙ Die Regenerative Medizin basiert auf dem Verständnis, wie einzelne Zellen Gewebe des Körpers regenerieren. Dieses international wachsende Forschungsgebiet ermöglicht einen Paradigmenwechsel in der Medizin hin zur Transplantation und Regeneration funktionsfähiger Zellen sowie der Stimulierung von Gewebereparaturmechanismen erkrankter Organe. Ziel ist die Entwicklung von neuen Therapien durch interdisziplinäre Fokussierung und Integration von Basisforschung und klinischer Anwendung. 31 Beiträge: Detlev Ganten Insgesamt umfassen diese und andere Leuchtturmprojekte der Lebenswissenschaften ein institutionelles und infrastrukturelles Netzwerk verschiedenster Einrichtungen und Partner. Eine zent­ rale Rolle fällt hierbei der „Charité – Universitätsmedizin Berlin“ zu, die heute Europas größtes Universitätsklinikum ist (Bild 4). Integrale Bestandteile sind neben dem Campus Mitte – mit dem Hochhauskomplex als Life Science Tower Berlin, ein sichtbares Symbol des Gesamtprojekts – und den weiteren Standorten der Charité die Universitäten mit Fakultäten der Humboldt Universität, der Biocampus der Freien Universität sowie die Bereiche Medizintechnik und Public Health der Technischen Universität. Eine wichtige Rolle spielen außerdem die Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Institute, der Fraunhofer-Institute und die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Der Erfolg der Initiative beruht neben der inhaltlich-thematischen Exzellenz maßgeblich auf dem wirtschaftlichen Gelingen und den zu erzielenden nachhaltigen Effekten für den Wissenschaftsund Wirtschaftsstandort Berlin. Diese Impulse sind verknüpft mit einem Engagement von Seiten der Privatwirtschaft, zum Beispiel durch Entwicklungspartnerschaften oder andere Geschäftsmodelle der „Public Private Partnership“. Unverzichtbar bedarf es auch einer Unterstützung aus der Politik in Bezug auf eine Schaffung der notwendigen Umfeldbedingungen. 32 Gesundheitsstadt Berlin Das Land Berlin hat die politische Entscheidung getroffen, die Wissenschaften und hier insbesondere die Medizin in ganz besonderer Weise zukunftsfähig zu machen und eine deutliche Priorität in der Weiterentwicklung zu setzen. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben sich auf dieses Ziel verständigt. Die „Gesundheitsstadt Berlin“ wird von allen Parteien und Senatsverwaltungen unterstützt und gefördert. Darüber hinaus haben sich private Initiativen konstituiert, die den gesamten Gesundheitsmarkt und die Wissenschaft in Berlin koordinieren und in besonderer Weise fördern wollen. Dies reicht von der Biotechnologie und der Medizintechnik bis hin zur Reorganisation des Krankenhauswesens sowie der Förderung, Unterstützung und Koordination der Forschung in den Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Die neue Charité – Universitätsmedizin Berlin Der Senat von Berlin hat im Jahre 2003 den Beschluss gefasst, die medizinischen Fakultäten der Freien Universität und der Humboldt Universität zur „Charité – Universitätsmedizin Berlin“ zusammenzufassen. Damit entstand das größte Universitätsklinikum Europas mit einem Jahresetat von über einer Milliarde Euro und rund 15.000 Mitarbeitern. Als einer der größten Arbeitgeber Berlins verfügt die Charité über fast 3.500 Betten an den vier Standorten: Campus Benjamin Franklin, Campus Berlin-Buch, Campus Mitte, Campus Virchow Klinikum (Bild 5). 5) Die Charité vernetzt sich mit Partnern in Wissenschaft und Krankenversorgung – Nukleus eines Netzwerks Die Charité wurde 1710 gegründet und hat eine lange und stolze Tradition. Herausragende Berliner Ärzte und Wissenschaftler haben hier die moderne Medizin geprägt. Hierzu gehören berühmte Namen wie Johannes Müller, Emil Du Bois-Reymond, Hermann von Helmholtz, Rudolf Virchow, Robert Koch, Emil von Behring, Paul Ehrlich, Christoph Hufeland, Albrecht von Graefe und Ferdinand Sauerbruch, um nur einige zu nennen. Vierzehn Nobelpreisträger haben in Bereichen der klinischen Medizin, Physiologie und Chemie enge Verbindungen zur Berliner Medizin. Im Jahre 1910, anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Charité und der Blütezeit des wissenschaftlichen Berlins, kam die internationale Welt der Wissenschaft in die Stadt. Die Charité war ein weltweit anerkanntes Zentrum medizinischen Fortschritts. Die neue Charité – Universitätsmedizin Berlin hat die Vision, im Jahre 2010, dem Jahr der 300-Jahrfeier der Charité und der 200-Jahrfeier der Humboldt Universität zu Berlin, an diese große Tradition der Berliner Wissenschaft anzuschließen. CHARITÉ Leuchtturmprojekte Universitätsklinikum Institutionen T herapieforschung Digitales Krankenhaus Molekulare Diagnostik Regenerative Medizin Grundlagenforschung Klinische Forschung Krankenversorgung Charité Research ­Organisation IT-Management Zentrum für Molekulare Bildgebung Diagnostik & Therapie Center for Regenerative Therapies Public Health Technologie-Transfer Telemedizin IT Charité Gesundheitssystem Public Private Partnership Universitäten HU/FU/TU Forschungseinrichtungen Helmholtz/Max Planck/Fraunhofer Leibniz Lebenswissenschaften Berlin-Brandenburg Gesundheitsstadt Berlin 33 Beiträge: Dietrich H. W. Grönemeyer > Innovative Medizintechnik als Schrit tmacher für eine Reform der Gesundheitsversorgung. > Dietrich Grönemeyer In der Diskussion um die Reform des deutschen Gesundheitssystems wird immer wieder über die Kosten, weniger über die medizinischen Inhalte und schon gar nicht über den gesprochen, den diese Diskussion am meisten angeht: den Patienten. Eine humane und an den Bedürfnissen des kranken Menschen ausgerichtete Medizin sollte daher nicht so sehr die Kosten als vielmehr die Werte, das heißt eine die Lebensqualität für alle erhöhende Medizin in den Blick nehmen. Die Erhaltung be­ ziehunsweise Wiederherstellung der Gesundheit sollte in Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden. 34 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Unser Gesundheitswesen ist nur ein Teil einer viele assoziierte Branchen umfassenden Gesundheitswirtschaft. International gesehen ist die Gesundheitswirtschaft von Wirtschaftswissenschaft­ lern als die Boombranche des 21. Jahrhunderts prognostiziert worden. In Deutschland sind derzeit 4,2 Millionen Menschen in dieser Branche beschäftigt. Tendenz steigend. In manchen Großstädten, wie zum Beispiel Essen, ist diese Branche mittlerweile der größte Arbeitgeber. In den nächsten zehn Jahren wird für das Ruhrgebiet ein Beschäftigungszuwachs von 20 Prozent vorhergesagt. Die neuen bildgebenden Verfahren wie die Computer- und Kernspintomographie dienen nicht nur der leistungsstärkeren Diagnostik, sondern erlauben die präzise Steuerung von Therapieverfahren durch die gleichzeitige Kontrolle der Effekte. Anwendungsfelder sind beispielsweise die Prävention von Herzinfarkten durch die katheterlose Darstellung (ultraschnelle Computertomographie) der Herzkranzgefäße zur Beurteilung von Gefäßeinengungen. So können millimetergroße Verkalkungen in den Gefäßwänden Jahrzehnte vor krankhaften Schädigungen sichtbar gemacht werden. Dies ist eine hervorragende Methode zur Vorbeugung und zum Einsatz gezielter Gesundheitsförderungsprogramme. Bis heute, zehn Jahre seit Einführung des Verfahrens, gibt es jedoch keine Abrechnungsziffern, obwohl in Deutschland jährlich mehr als 90.000 Menschen an einem Herzinfarkt sterben, bevor sie in ein Krankenhaus kommen. Bei bis zu 290.000 Herzinfarktereignissen ist der Infarkt heute noch die häufigste Todesursache in Deutschland. Eine Medizin, die dem kranken Menschen gerecht werden will, muss sowohl den rasanten Wissenszuwachs im technologischen Bereich als auch alternative und nicht rein somatische Aspekte integrieren. Also kann eine zukünftige ganzheitliche Medizin nicht auf innovative Gesundheitstechnologien verzichten. Es muss in diese neuen Technologien investiert werden; sie werden auf einen riesigen Markt treffen und der deutschen Wirtschaft gut tun. Zu den wichtigsten Bereichen, die die technologische Seite der zukünftigen Medizin bestimmen werden, gehören neue 1) Neue Technologien für neue Behandlungsangebote bildgebende Verfahren für eine präzise Diagnostik und Therapie, Robotikverfahren im OP, der biologische Ersatz geschädigter Robotik im OP Bildgebende Verfahren Neue Eingriffe ­werden Präzise Diagnostik und Gewebe (Tissue Engineering), die Telememöglich Therapie dizin, neue Werkstoffe und Medikamente (Drug-Design), die Mikrosystemtechnik und die Nanotechnologie. Zunehmende Bedeutung wird auch die Gesundheitstechnik zum Beispiel in der Präventions- und Gerontomedizin erhalten (Bild 1). Telemedizin Arbeiten in Netzwer­ken, Bündelung von Kompetenz Material-Wissen­schaft & Drug-Design Neue Werkstoffe und Medikamente Tissue Engineering Biologischer Ersatz geschä­­dig­ter Gewebe Mikrosystemtechnik Mikrosensoren für die ­Früherkennung 35 Beiträge: Dietrich H. W. Grönemeyer Zweites Beispiel: Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit, deren Behandlung jährlich mit rund 50 Milliarden € bei den Krankenkassen und der Wirtschaft durch Arbeitsunfähigkeit zu Buche schlägt (Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2002). Aber auch bei 100-maligem Röntgen wird man beispielsweise keinen Bandscheibenvorfall erkennen – obgleich andererseits die modernen bildgebenden Verfahren wie die Computertomographie und Kernspintomographie überzeugende Möglichkeiten zur berührungsfreien Diagnose bieten. Da das konventionelle Röntgen aber gängige Praxis in Deutschland ist, entstehen nicht nur Mehrkosten durch die häufig wiederholte Leistung, sondern auch durch das auf Falschannahmen basierende Therapiekonzept. Zudem wird das Röntgen von den Krankenkassen anstandslos bezahlt, die modernen Verfahren bis heute aber nur zögerlich. Und das gilt grundsätzlich für die meisten Innovationen und leider gerade für die, die in Deutschland entwickelt wurden, wie die Geschichte der Endoskopie, der Mikrotherapie, der Herzkatheterisierung und der Ballondilatation zeigt. Dadurch gehen neue Verfahren für die Patienten verloren und stehen erst nach einem langen und teuren Reimport zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es negative Auswirkungen auf die Forschungslandschaft, das Know-how, auf Arbeitsplätze, Gewinne und Steuereinnahmen. Große Chancen werden einfach vertan! Die Mikrosystemtechnik (MST) bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie das Monitoring chronischer Krankheiten, den Ersatz von Organfunktionen, die Früherkennung von Krankheiten, die Her­ stellung mikrochirurgischer Instrumente und die Labordiagnostik. In der Mikrotherapie werden diagnostische bildgebende Verfahren und interventionelle Verfahren durch sehr kleine Instrumente (unter einem Millimeter Länge, Breite und Tiefe) sowie die Schmerztherapie zusammengeführt. Die Mikrotherapie wird künftig we­ sent­licher Bestandteil aller medizinischen Fachdisziplinen sein. To­mo­graphiegestützte Kleinsteingriffe zur Gewebeentnahme und Schmerztherapie, mikrotherapeutische Bandscheiben-, Gelenksund Tumoroperationen sowie moderne Implantationstechniken wer­den Routineeingriffe in allen Fachdisziplinen. Computer- und schritt­­weise auch Kernspintomographen werden bis heute fast aus­­ schließlich zu rein diagnostischen Zwecken eingesetzt. Aber diese Technologie hat darüber hinaus das Potenzial, die minimal in­­va­siven medizinischen Verfahren entscheidend voranzubringen (Bild 2). 2) Mikrosystemtechnik – Baustein der Medizin von morgen MST zum Monito­ring chronischer Krankheiten MST zum Ersatz von Organfunk­ tionen IOL mit Drucksensor zur Retinaimplantat Glaukomüberwachung Quelle: FhG-IBMT Quelle: FhG-IBMT 36 MST zur Früherken- MST für die nung von KrankLabordiagnostik heiten MST für mikro­ chirurgische Instrumente Laserscanning-Mikroskop Spektrometer für die zur Tumorfrüherkennung Bilirubinmessung Quelle: Delas Projekt Quelle: microparts Mikrogreifer Quelle: FZK acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Das in Umrissen dargelegte hochtechnologische Potenzial bedarf jedoch zu seiner Entwicklung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Das bedeutet, dass die Forschungsergebnisse unserer Hochschulen unternehmerisch umgesetzt werden. Zusammenkommen sollten Forschungsergebnisse und eine entsprechende Unternehmensidee. Dies setzt aber voraus, dass auch die Hochschulen Interesse zeigen an der Verwertbarkeit ihrer Forschungen. Ein Paradebeispiel für Innovationshürden bietet die telemetrische Mikrosystemtechnik (zum Beispiel mobiles EKG, mobile Blutdrucküberwachung, Televisite): In einer Umfrage bei Forschungsinstituten und der herstellenden Industrie stellte sich heraus, dass die Hindernisse im nicht-technischen Bereich verortet werden. Hohe Anschaffungskosten, eine unzureichende Vergütung der Ärzte, Skepsis bei den Anwendern, nicht nachgewiesene Effizienz und rechtliche Bedenken wurden häufig genannt. Eine breitflächige Einführung der telemetrischen Mikrosysteme in der Medizin kann also nur in einer allgemein gesellschaftlichen Anstrengung geleistet werden, wie die gleiche Umfrage bei Forschungsinstituten, Großunternehmen, dem KMU-Bereich und den Start-up-Unternehmen herausfand. Die Voraussetzungen sollten in einer gemeinsamen Anstrengung von Kostenträgern, Industrie und Politik geschaffen werden. Genannt wurden vor allem eine Erhöhung der Akzeptanz bei Kostenträgern und Krankenkassen, eine spezielle Förderung durch die Politik, eine Herstellung von integrierten Mikrosystemlösungen durch die Industrie und die Schaffung von interdisziplinären Entwicklungszentren im universitätsnahen Bereich. Ein kurzer Überblick über den Medizinproduktemarkt zeigt, dass Deutschland bereits jetzt sehr gut im internationalen Rahmen positioniert ist und hervorragende Ausbauchancen hat. Die Gesamtausgaben für Medizinprodukte betrugen in Deutschland im Jahre 2003 im ambulanten Bereich 12 Milliarden €, im stationären Bereich 7 Milliarden €, zusammen also 19 Milliarden €. Damit belegt der nationale Markt Deutschland den 3. Platz hinter den USA (79 Milliarden €) und Japan (Welt: 184 Milliarden €, Europa: 55 Milliarden €). Der Umsatzzuwachs betrug in Deutschland 2002 6,5 Prozent, im Jahre 2003 3,9 Prozent und weltweit in demselben Jahr 7,0 Prozent. In der deutschen MedTech-Industrie waren im gleichen Zeitraum ca. 108.000 Menschen beschäftigt. Trotz dieser recht imponierenden Zahlen und obwohl das Gesundheitswesen jährlich rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf sich vereint, geht es bisher nicht in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes ein (Bild 3). 3) Gesundheitswirtschaft als Wachstumsmotor senkt Lohn­ nebenkosten schafft Lebens­qualität schafft Arbeits­ plätze und Wirtschaftskraft medizinische Innovation Zusammenfassend heißt das: Die Gesundheitsbranche ist international und national einer der wichtigsten Wachstumsmärkte der Zukunft; neue Technologien sind ein wichtiger Schlüssel für die Entwicklung wettbewerbsstarker Produkte; Innovationen haben starken Einfluss auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Patientenversorgung. Die hier skizzierten Pozenziale werden aber nur dann langfristig Wirklichkeit werden, wenn alle in Teamarbeit zusammenarbeiten, das heißt Industrie, Kostenträger, politische Entscheidungsträger sowie medizinische Forscher und Ärzte, und zwar alle für einen in gemeinsamer Fürsorge: den Patienten, den kranken Menschen. Deutschland muss hier Vorbild für die internationale Gemeinschaft werden. Wir haben bereits jetzt das Know-how, die große Qualität und die Leidenschaft, um das Land der Gesundheit zu werden – mit „Med. in Germany“ als Gütesiegel. Wir müssen die Chancen nur nutzen! 37 Beiträge: Heinrich Kolem > Die Medizintechnik als innovativer Wirtschaftsfaktor der Zukunft. > Heinrich Kolem Um einleitend die Perspektive der Medizintechnik-Industrie ­darzustellen, soll das Themenfeld zunächst aus strategischer Sicht betrachtet werden: In stark komprimierter Form ist das strategische Ziel von Siemens Medical Solutions, Effizienz­steigerung im Gesundheitswesen zu erzielen, einerseits durch Steigerung der ­Qualität, andererseits durch gleichzeitige Senkung der dafür notwendigen Kosten. Wir erreichen das im heutigen Wettbewerbsumfeld sicher nur durch hochinnovative Produkte und Lösungen sowie über Prozessoptimierungen. 38 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Auf Grund dieser Basis – Innovation und Prozessoptimierung – hat es in den letzten Jahren einige Entwicklungen in der Medizintechnik gegeben, die in diesem Beitrag kurz dargestellt werden sollen. Resultat dieser erfolgreichen Entwicklungen ist das Wachstum in einem schwierigen Umfeld. Einige der Innovationen sollen hier nur übersichtsartig dargestellt werden; auf ein Thema – Innovation in der Magnet­resonanz – möchte ich jedoch etwas ausführlicher eingehen und auch die Folgewirkungen aufzeigen. Im Gesamtspektrum des Angebots (Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, Bild 1) sind wir ständig bestrebt, neue Konzepte zu entwickeln, die im Sinne der oben genannten Strategie zu einer Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen beitragen können. Dazu gehören beispielsweise: ❙ Durch die intraoperative 3D-Bildgebung mit einem rotierenden C-Bogen ist 3D-Bildgebung im OP ohne Patientenbewegung möglich. Für zahlreiche chirurgische Fragestellungen führt dieses Verfahren zu einer qualitativen Verbesserung mit einer möglichen Verkürzung des Gesamtprozesses. ❙ Eine Integration aller notwendigen Komponenten zur Mammo­ graphie ermöglicht ebenfalls eine schnellere und qualitativ hoch­ wertigere, also somit auch sichere Diagnose durch die Zusam­men­ fassung aller notwendigen Einzelschritte. ❙D ie Einführung der 64-Zeilen-Computertomographie erlaubt eine noch bessere Auflösung und damit die Bearbeitung von klinischen Fragestellungen, die bisher für diese Technik wenig zugänglich waren. Ebenso wird die Gesamtdauer der Einzeluntersuchung reduziert. Dabei ist für die schnelle Verarbeitung und Auswertung der entstehenden großen Datenmengen Sorge zu tragen. ❙ Die Kombination der Verfahren Computertomographie und PET (Positronen-Emissions-Tomographie) erlaubt eine effiziente und präzise anatomische Zuordnung der im PET-Bild dargestellten krankhaften Prozesse. Ebenso wird durch diese Kombination die Gesamtuntersuchungszeit kürzer, da neben innovativer Kristalltechnologie auch die im PET allein erforderliche Abschwächungsmessung entfallen kann. ❙ Die Einführung der magnetischen Steuerung von Kathetern unter Bildkontrolle ermöglicht eine Katheternavigation, wie sie bisher nicht möglich war, und beschleunigt somit zum Beispiel die in der Elektrophysiologie angewandte Ablation von Nervengewebe des Herzens bei Rhythmusstörungen. 1) Siemens Produkt- und Lösungsportfolio Produkte Röntgensysteme Nuklear-Medizin Ultraschall Computertomographie Ma­gnet­­re­so­nanz­ Onkologieto­mo­­gra­phie Systeme Kardiologie­Lösungen Onkologie­Lösungen Women‘s-Health- Digital-Hospital­Lösungen Lösungen Beratung Kundenservice Audiologische Technik Lösungen RadiologieLösungen Dienst­ leis­tun­ gen Bildarchivie­rungs- Klinische und und Kommunika- administrative tionssysteme Software 39 Beiträge: Heinrich Kolem Am Beispiel der Innovationen in der Magnetresonanztomographie soll jetzt etwas ausführlicher auf den Innovationsprozess eingegangen werden. Integraler Bestandteil des Innovationsprozesses ist die enge Zusammenarbeit mit Kunden und führenden Forschungsinstituten. Beispielsweise pflegt das Geschäftsgebiet Magnetresonanz von Siemens Medical Solutions die Zusammenarbeit mit über 200 Instituten weltweit. Somit beginnt eine 2) Ganzkörper-MR mit Total imaging ­ma­trix (Tim)-Technologie – anatomische Abdeckung bis zu 205 cm mit Darstellung von Morphologie und Gefäßen Neuentwicklung zunächst mit den üblichen Marktforschungen und Kundenbefragungen. Aber schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt werden auch intensive Diskussionen mit den Kunden über die optimale Kombination von Kundenanforderungen mit den zukünftigen technischen Möglichkeiten geführt, zum Beispiel im Rahmen von internationalen Fokusgruppen. Auf dieser Basis werden dann innovative Entwicklungen in interdisziplinären Teams durchgeführt, die meist an großen Tafeln konzeptartig im Sinne eines „Brainstormings“ starten. Wenn dann die Entwicklungen auf Basis der Kundenanforderungen und der strategischen Prämisse der Prozessoptimierung zur Kostensenkung beginnen, werden parallel hierzu auch oft enorme technische Fortschritte in der Integration von Komponenten erzielt. So konnte beispielsweise die räumliche Dichte der Elektronik von Empfangskanälen für die Magnetresonanztomographie vervierfacht werden. Ergebnis einer solchen innovativen Entwicklung war zum Beispiel die Tim-Technologie (Bild 2). Tim steht für „Total imaging matrix“ – eine Erhöhung der Anzahl paralleler Empfangskanäle in der Magnetresonanztomographie – integriert in einem patientenoptimierten Antennenkonzept, das erstmalig höchste Bildqualität und Auflösung mit gesamter Körper-Abdeckung kombinieren konnte. Es lassen sich damit sehr effizient Ganzkörperaufnahmen erstellen, die selbst die Bildauflösung der bisherigen optimierten Lokalmessungen übertreffen. Tim ermöglicht damit neue Anwendungen für die Magnetresonanz (MR), zum Beispiel zur Untersuchung von Tumor- oder Gefäßerkrankungen. Die Kombination von hoher Ergebnisqualität und Effizienzsteigerung sowie der Möglichkeit neuer Anwendungen mit Tim führte zu einem durchschlagenden Markterfolg des ersten Systems, das diese Technologie benutzt (Bild 3). So konnten Auftragseingang und Umsatz gesteigert und damit auch die Beschäftigung gesichert werden. Auch die sonst bekannten Effekte von Innovationen am Markt konnten demonstriert werden: Die hohe Akzeptanz im Markt resultiert aus den deutlichen Vorteilen dieser Innovationen für unsere Kunden, so dass sich gegenüber den Konkurrenzprodukten auch ein entsprechend höherer Preis erzielen ließ. Ermöglicht werden hierdurch wiederum Investitionen in weitere Forschung und Entwicklung. 40 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Erfreulich war hierbei auch, dass für diese bahnbrechende Neuentwicklung auf dem Gebiet der MR mehrere Innovationspreise verliehen wurden. An dieser Stelle sei neben der Tim-Technologie noch auf weite­re Neu­erungen in der Magnetresonanz hingewiesen: In der Anwen­ dung von höchsten Grundmagnetfeldern – das heißt 7 Tesla im Vergleich zu heute üblichen 1,5 Tesla in der klinischen Routine beziehungsweise 3 Tesla in der klinischen Forschung – zeigen sich Effekte, die unter Umstän­den eine schnelle und frühe Erkennung von neurologischen Erkrankun­gen möglich machen (Bild 4). Dies stellt bereits heute eine Vorentwicklung in dem Sinne dar, dass die bei Höchstfeldern gesammelten Forschungserkenntnisse zukünftig auch in die klinischen Systeme integriert werden können. Oder es könnte sich zeigen, dass zur Nutzung der Vorteile klinische Geräte mit einer so hohen Feldstärke er­for­derlich sind. Bei derart komplexen Forschungsprojekten ist es zwingend notwendig, dass Forschungsinstitute und Industrie zusammen­arbeiten. Auch wenn die ersten 7-Tesla-Systeme in den USA in Be­­trieb gingen (in 3) MAGNETOM Avanto, das erste MR-System mit ­ Tim-Technologie Minneapolis und Boston), konnte erfreulicherweise auch in Deutschland sehr schnell eine solche Anlage installiert werden. Obwohl es noch offen ist, ob diese Geräte eine klinische Anwendung finden werden, stellen sie sicherlich eine wichtige Grundlage für die Anwendungsforschung und auch für die mögliche Entwicklung von Medikamenten dar. Um die Spitzenstellung der Forschung auch hier in Deutschland zu halten, wären schnelle Entscheidungen sicherlich hilfreich. Insgesamt lassen sich die wesentlichen Inhalte wie folgt zusammenfassen: ❙ Durch die Innovationsführerschaft lässt sich der Geschäftserfolg nachhaltig sichern und damit auch ein positiver Beitrag zum Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. ❙ Innovative Entwicklungen erlauben einen Wettbewerbsvorteil, der eine höhere Preisdurchsetzung erlaubt und somit wieder Investitionen ermöglicht. ❙ Schnelle und fokussierte Entscheidungen können helfen, die Spitzenposition der Medizintechnik in Deutschland zu sichern. 4) Mikroskopische Bildgebung bei 7-Tesla-Magnetfeldstärke – hochaufgelöst zu sehen sind Kerngebiete des Gehirns 41 Beiträge: Klaus-Peter Schmitz > Entwicklungstrends in der Biomaterialforschung und Implantat technologie. > Klaus-Peter Schmitz Bereits seit Jahrhunderten werden in der Medizin körperfremde Materialien dazu verwendet, Gewebe und Organstrukturen des Menschen zu ersetzen und wiederherzustellen. Beispiele hierfür sind die Anwendung von Edelmetallen in der Zahnmedizin oder Glas in der kosmetischen Chirurgie alter Kulturen. Eine entscheidende und bis dahin fehlende medizinische Grundlage für die erfolgreiche invasive Anwendung körperfremder Materialien wurde durch Lister in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Ent­wicklung aseptischer chirurgischer Techniken gelegt. Geleitet von der Suche nach dem idealen Implantatwerkstoff wurde seit dieser Zeit eine Vielzahl von Werkstoffen mit wachsendem Erfolg für die Herstellung der unterschiedlichsten Implantate verwendet. 42 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Innovative Biomaterialien und Implantate – Grundlage für neue Therapiekonzepte Einige der vielen Meilensteine auf diesem Weg sind bis heute etwa die von Charnley 1958 beschriebene zementierte Hüft­­endo­prothese, die künstliche Herzklappe von Starr und ­Edwards aus dem Jahr 1960 oder der 1977 von Grüntzig eingeführte Angio­plastiekatheter (Bild 1). In der Summe haben die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass die Medizin- oder Gesundheitstechnologie innerhalb der Medizin und der Gesellschaft einen hohen Stellenwert mit außer­ ordentlicher politischer und ökonomischer Bedeutung einnimmt. Implantate und ­künstliche Organe tragen heute entscheidend dazu bei, die Vitalität, Mobi­lität und Lebensqualität bei Millionen von Patienten weltweit zu erhöhen. Etablierte Therapiekonzepte zu verbessern und für die Zukunft neue medizinische Applikationen zu erschließen, ist die ­Zielstellung für die Forschung auf diesem Gebiet. Ausgangspunkt für Fortschritt und Innovation sind einerseits innovative Materialien und Technologien, andererseits neue medizinisch wün­schenswerte Diagnose- und Therapiekonzepte. Trends in der Biomaterialforschung Ein Hauptinteresse der Biomaterialforschung gilt derzeit dem Verständnis der zellulären Mechanismen der Interaktionen zwischen Biomaterial und Empfängerorganismus, die sich auf der Oberfläche bzw. der Grenzfläche eines Implantates vollziehen. Basierend auf diesem Wissen soll die Antwort des Empfänger-Organismus auf das Implantat durch die Gestaltung der Architektur, insbesondere der Mikro- und Nanostruktur der Implantatoberfläche optimiert werden. Neben der passiven Funktionalisierung von Implantatoberflächen bietet die Anbindung von Medikamenten an die Implantatoberfläche eine Möglichkeit zur aktiven Steuerung der zellulären Prozesse. So genannte Drug-Delivery-Technologien, die die lokal begrenzte und zeitlich gesteuerte Abgabe von Medikamenten ermöglichen, sind auf Grund ihres modularen Konzepts sehr vielseitig anwendbar und besitzen ein großes Potenzial für unzählige Anwendungen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Nanopartikeln in der Tumortherapie. 1) Implantate aus der klinischen Praxis Herzklappenprothese Koronarstent Hüftgelenks­endoprothese Herzschrittmacher-Generationen Intraokularlinse Cochlea-Implantat Dental­implantat 43 Beiträge: Klaus-Peter Schmitz Eine Strategie zur Therapie von Tumoren ist die Applikation toxischer Substanzen, die die Tumorzellen zerstören sollen. Eine solche Chemotherapie überschwemmt jedoch den gesamten Körper mit dem Zellgift, was zu den bekannten schweren Nebenwirkungen führt. Deshalb wäre eine lokale und gezielte Applikation von Zellgift ­ eine bessere ­ Alternative als die systemische Gabe. Hierzu muss das Gift zunächst in verpacktem Zustand zu den Tumorzellen transportiert und soll dort erst nach der Aufnahme wirksam ­werden. Ermöglicht werden soll diese Therapieform durch Nanopartikel, die – eingebettet in eine Matrix – das Zellgift transportieren. Die Oberfläche der Nanopartikel ist mit tumorspezifischen Liganden versehen, so dass die Nanopartikel gezielt an Tumorzellen andocken, in die Zellen aufgenommen werden und dadurch zum Absterben der Tumorzellen führen. Dieses Beispiel zeigt zugleich zwei weitere Forschungstrends auf: das gezielte Drug-Targeting sowie den Einsatz von Mikro- und Nanotechnologien bei Biomaterialien und Implantaten. Eine grundsätzliche Fragestellung im Zusammenhang mit Biomaterialien und Implantaten ist die Fähigkeit der Implantate zu Wachstum, Regeneration und Adaption. Diese Implantateigenschaften sollen mit dem Ansatz des Tissue Engineering realisiert werden. Das Tissue Engineering zielt auf eine Wiederherstellung von erkrankten Gewebe- und Organstrukturen, beispielsweise von Knochen, Knorpel, Haut, Blutgefäßen und Herzklappen, durch körpereigenes Gewebe ab. Dieses Ziel ist jedoch aus heutiger Sicht nur über Umwege zu erreichen. Zunächst wird die Funktion des erkrankten Gewebes durch ein Implantat wiederhergestellt und danach soll das Implantat nach und nach vom Organismus abgebaut und sukzessive durch neues, körpereigenes Gewebe ersetzt werden. Hierzu muss das Implantat bzw. die Gerüststruktur (Scaffold) biodegradierbar sein, und es muss zur Stimulierung der Regeneration gesunden Gewebes mit Wachstumsfaktoren oder Pharmaka beladen werden. Alternativ dazu können mit körpereigenen Zellen besiedelte Gerüststrukturen im Reagenzglas kultiviert und schließlich als Ersatz für das kranke Gewebe implantiert werden. Die biologische Prozessierung ist dabei in der Regel zeitaufwändig und deshalb für akute Behandlungen schwer zu realisieren. Ein Fernziel bei der Entwicklung von Biomaterialien und Implantaten ist der Aufbau von In-silico-Modellen kompletter Organsysteme, die eine Simulation der Interaktion zwischen einem Implantat und dem Empfänger-Organismus gestatten. Voraussetzung hierfür ist neben der Bewältigung der rechentechnischen Herausforderungen ebenfalls das Verständnis zellulärer und molekularer Mechanismen. Experimentell analysiert werden diese Prozesse in der Genom- und Proteomforschung mit Hilfe von Biochip-Technologien. Diese Techniken ermöglichen es, ein detailliertes Bild des physiologischen Status einer Zelle, bzw. eines Gewebes zu erfassen. Die in solchen Experimenten erarbeiteten Daten können über Datenbanken zugänglich gemacht und für die In-silico-Modellierung, beispielsweise von pharmakabeladenen Nanopartikeln, genutzt werden. Entwicklung innovativer Implantate Derzeit vollzieht sich auf dem Gebiet der Implantattechnologie eine Konvergenz zwischen Medizintechnik, Biowissenschaften, Pharmazie und Informationstechnologie. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend den Fortschritt auf dem Forschungssektor dominieren und in den nächsten Jahren dazu führen wird, dass die Leistungsfähigkeit von Implantaten ständig steigt. Illustriert werden kann diese Tendenz beispielsweise anhand der Entwicklungen auf dem Gebiet der vaskulären Interventionen. Waren die hier zur Behandlung stenosierter Gefäße verwendeten Stents zunächst einfache Drahtgeflechte, so werden bereits heute mit steigender Tendenz bei einem Großteil der jährlich in Deutschland durchgeführten 220.000 Koronarstentimplantationen polymerbeschichtete, pharmakabeladene Drug-Eluting Stents eingesetzt (Bild 2). 2) Weltweite Umsatzentwicklung bei Koronarstents – Trend zu Drug-Eluting Stents in Mrd. E 3.9 DrugEluting Stents 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 2006 2007 2008 2009 2010 3.3 Metallstents 2003 44 4.4 2004 2005 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Weiter fortsetzen wird sich dieser Trend mit der Integration der Bio­ technologie bei der Entwicklung so genannter Stammzell-Stents, deren Oberfläche gezielt für die Adhäsion im Blut zirkulierender Progenitorzellen mit Zell-Ligandstrukturen ausgestattet ist. Einen anderen Entwicklungstrend bilden abbaubare Stents aus metallischen oder polymeren Werkstoffen, die ihre Stützfunktion temporär erfüllen und die eine Gefäßregeneration ohne permanentes Implantat ermöglichen (Bild 3). Aktuell geben erste klinische Erfolge mit einem abbaubaren Stent auf Basis einer Magnesium-Legierung Grund zur Hoffnung auf die Verwirklichung einer regenerativen vaskulären Therapie. Im Gegensatz zu den heute allein in Deutschland etwa 500.000-mal jährlich im Rahmen von Katarakt-Operationen implantierten In­tra­ okularlinsen, bei denen die Patienten auf die Verwendung einer Brille für unterschiedliche Distanzen angewiesen sind, soll die inji­­ zier­bare Linse (Bild 5) eine Akkommodationfähigkeit des Auges im physiologischen Sinne, unter Verwendung von Zonula und Ziliarkörper, ermöglichen. Der durch ein solches Implantat erzielbare enorme Gewinn an Lebensqualität für die Patienten eröffnet den Raum für Visionen und könnte zu einem Innovationsschub in der Augenheilkunde mit vielen Spinoff-Konzepten führen. Der Einfluss der Informationstechnologie auf die Implant­ atentwicklung wird insbesondere deutlich auf dem Gebiet der aktiven Implantate für die Elektrostimulation – implantierbare Cardioverter und Defibrillatoren, physiologische Herzschrittmacher, Neurostimulatoren und Cochlea-Implantate sind allesamt Implantate, deren Leistungsniveau eng mit den Entwicklungen im Bereich der Mikroelektronik, insbesondere der Miniaturisierung, verknüpft ist. Zukünftig ist auch damit zu rechnen, dass die Mechatronik im Zuge der fortschreitenden Miniaturisierung enorm an Stellenwert innerhalb der Prothetik gewinnen wird. Denkbar sind elektromechanische Prothesen, deren Funktion über neuronale Schnittstellen steuerbar ist. 3) Forschungstrend in derKardiologie – abbaubarer Magnesiumstent Sieht man von Ausnahmen ab, gründet sich Innovation auf der Wei­­­­ter­entwicklung von Bewährtem. Welche Bedeutung bewähr­ tes Wissen für zukunftsweisende Implantatinnovationen besitzt, ver­­deutlicht ein gegenwärtiger Entwicklungstrend in der Augen­ heil­kunde. Grundlage für die Entwicklung einer injizierbaren ak­ kom­modationsfähigen Intraokularlinse ist hier die Akkommo­da­ tions­theorie von Hermann von Helmholtz aus dem Jahr 1855 (Bild 4). 8 Wochen Stützwirkung. Mg-Legierung im Minipig. Heublein, et al., MHH 100 Stenose / % Mg-Legierung 80 5 Referenz 5 60 10 10 40 20 0 28d 56d QCA nach Ergebnissen einer tierexperimentellen Studie Forschungsprojekt der: Biotronik GmbH & Co. KG, Berlin-Erlangen-Bülach, Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Medimplant, Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Biomedizinische Technik, Universität Rostock 45 Beiträge: Klaus-Peter Schmitz 4) Akkommodationstheorie nach von Helmholtz Hermann von Helmholtz (1821–1894) Potenzial innovativer Medizinprodukte für invasive Anwendungen Wie in allen Bereichen der Produktentwicklung besteht auch bei Implantaten ständiger Innovationsbedarf sowohl bei der Weiterentwicklung als auch bei der Neuentwicklung von Produkten. Geht es aus medizinischer Sicht darum, den Therapieerfolg durch neue oder verbesserte Implantate und künstliche Organe zu erhöhen und damit einen Gewinn für den Patienten zu erzielen, so ist es das primäre Ziel der Medizinproduktehersteller, sich durch Innovationen am Markt zu behaupten und wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. 5) Wiederherstellung der Akkommodationsfähigkeit mit einer ­in­ji­zierbaren, akkommodationsfähigen Linse – Grundprinzip und Ergebnisse Injektion von Präpolymeren in den gereinigten Kapselsack Konzept von Haefliger-Hettlich-Nishi „Über die Akkommodation des Auges“ 46 Kaninchenauge mit injizierter Polymerlinse, 6 Monate post op. Guthoff, Universitätsaugenklinik Rostock Terwee, AMO Groningen BV acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Für das öffentliche Gesundheitswesen ergeben sich dabei Herausforderungen, die entstehenden wirtschaftlichen und ethischen Probleme zu bewältigen, denn Implantate stellen einen immensen Kostenfaktor dar und sollen trotzdem allen Patienten gleichermaßen zugänglich sein. Verschärft wird die Situation in Deutschland durch die wirtschaftliche Lage und die demographische Entwicklung. Neue Diagnoseverfahren tragen zudem dazu bei, dass der Bedarf an Implantaten steigt. Vor diesem Hintergrund liegen die Chancen neuer Entwicklungen insbesondere auch bei der Erhöhung der Kosteneffizienz von Therapiekonzepten. Die Produktentwicklung bei Implantaten ist im Allgemeinen durch erheblichen Forschungsbedarf, hohe Entwicklungsrisiken und einen langen Weg bis zur Produktzulassung gekennzeichnet. Gerade auf dem Gebiet des Tissue Engineering wird derzeit deutlich, wie schwierig es ist, das Potenzial innovativer Gesundheitstechnologien wirtschaftlich nutzbar zu machen. 47 Beiträge: Olaf Dössel > Sechs Thesen zur Innovation in der Medizintechnik. > Olaf Dössel In Anbetracht verschiedener Kriterien nimmt Deutschland im weltweiten Vergleich den zweiten Rang in der Medizintechnik ein. Diese Position gilt es zu festigen und auszubauen. Denn trotz aller positiven Nachrichten ist der Umsatzanteil deutscher Unternehmen am Weltumsatz von 1991 bis 2001 von 21 Prozent auf 16 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum konnten beispielsweise die USA ihren Anteil von 26 Prozent auf 31 Prozent steigern. Deutschland erfüllt trotzdem alle Randbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft in der Medizintechnik. 48 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 These 1: Medizintechnik ist eine wichtige zukunftsorientier­te Hochtechnologie-Branche, die Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland sichert und gleichzeitig einen Beitrag zur ­Ge­sundheit der Menschen und zur Steigerung der Effizienz im Gesundheitswesen erbringt. Hierzu ein paar Zahlen und Fakten: Im Jahr 2003 wurden in Deutschland Waren im Werte von 14 Mrd. Euro im Bereich Medizintechnik produziert. Davon gingen über 50% in den Export. Die jährliche Steigerung dieses Produktionsvolumens liegt stabil über viele Jahre bei 5,5% und damit deutlich über dem Durchschnitt des verarbeitenden Gewerbes. Und eine konservative Prognose besagt, dass diese Steigerungs­rate mindestens für die nächsten 100 Jahre anhält – es gibt kaum eine Branche mit solch positiven Zukunftsaussichten. Medizintechnik sichert in Deutschland heute ca. 110.000 Arbeitsplätze. Trotz einer vereinzelt bei größeren Unternehmen erkennbaren Auslagerung von Produktionsbereichen und Entwicklungsabteilungen ins Ausland gibt es insgesamt ein positives Beschäftigungssaldo. Mittelständische Unternehmen behaupten sich erfolgreich im Weltmarkt. Zahlreiche Unternehmensgründungen sind erfolgreich. These 2: Drei Motoren müssen bei medizintechnischen Innova­ tionen zusammenspielen: a)Neue technologische, informationstechnische oder naturwissenschaftliche Möglichkeiten müssen entstehen und ihre Potenziale für die Medizin erkannt werden. b)Technische Möglichkeiten müssen zur Anwendung am Menschen in beispielsweise Komponenten, Geräte, Systeme sowie Software übertragen werden. c)Neue medizinische Möglichkeiten müssen erkannt und ausgeschöpft werden. These 3: Medizintechnik ist interdisziplinäre Zusammenarbeit „par ex­cellence“. Nur durch eine reibungslose interdisziplinäre Kooperation können Innovationen entstehen. Trotz vieler guter Beispiele gibt es hier in Deutschland Verbesserungsbedarf: Zu oft wird noch „Abgrenzungspolitik“ zwischen verschiedenen Fachrichtungen oder Berufsgruppen betrieben. Hierzulande gibt es über 20 eigenständige Fachverbände, die sich mit Medizintechnik beschäftigen und nicht immer an einem Strang ziehen. Interdisziplinär angelegte Lehrstühle gehen verloren und DFG-Sonderforschungsbereiche mit medizintechnischen Themen haben es schwer, weil sich beispielsweise keine Interessengruppe mit ihnen identifiziert. Dies gilt es zu überwinden. Interdisziplinäre Teams, die sich gegenseitig verstehen, anerkennen und befruchten, sind der Schlüssel für Innovationen – nicht nur in der Medizintechnik. These 4: Innovationen der Medizintechnik werden in der Regel Kosten im Gesundheitswesen senken und die Behandlungsqualität ver­bessern. Der Nachweis von Kostenreduktion und Qualitätsverbesserung kann aber fast nie in einer frühen Projektphase erbracht werden. Heute ist dieser Nachweis oft Voraussetzung für die Forschungsförderung. Hier sind mehr Spürsinn und visionäres Denken gefragt. Trotz des hohen Kostendrucks im Gesundheitswesen muss es auch in Zukunft möglich sein, Medizintechnik für die reine Qualitätsverbesserung zu erforschen. Meist stellt sich die Kostenreduktion dann in einer späteren Phase ein, wenn die neue Methode verbreitet zum Einsatz kommt. Die Forschungslandschaft in Deutschland ist in allen drei Bereichen stark im internationalen Vergleich – dies ist ein deutlicher Trumpf. Die öffentliche Forschung bewegt sich aber in der perso­ nellen und finanziellen Ausstattung „am Limit“. In der Forschung in Deutschland darf keiner dieser drei Motoren gebremst werden. 49 Beiträge: Olaf Dössel These 5: Nur durch einfache, transparente und nachvollziehbare Strukturen für einen Eintritt neuer Medizintechnik in den geregelten deutschen Markt kann die Stellung der Medizintechnik in Deutschland erhalten werden. Am Ende einer oft sehr langen Phase der technischen Vorentwicklung stehen immer die klinische Studie und danach die Frage nach der Aufnahme der neuen Methode in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. In diesen beiden Bereichen ­wurden in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr Bremsen in den Innovationsprozess eingebaut. Forscher und Entwickler in der Medizintechnik wollen niemals Technik um der Technik willen. Im Vordergrund steht immer der nachgewiesene Nutzen für den Patienten. Aber wenn es am Ende zu viele Hürden gibt, diesen Nachweis zu erbringen, verlaufen medizintechnische Innovationen im Sande. Dringend werden gefordert: ❙ einfach funktionierende und transparente Strukturen für die Erprobung innovativer Methoden in der Medizin sowie ❙ berechenbare, flexible und schnelle Entscheidungsstrukturen zur Abrechenbarkeit von innovativen Leistungen in der Medizin. 1) Intelligente Prothese These 6: Die großen und besonders wichtigen Innovationsfelder der Medizintechnik sind: ❙ Mikrosysteme für aktive Implantate, Neuroengineering, In-vivoDiagnostik, In-vitro-Diagnostik, DNA-Chips, Lab-on-Chip, Drug-Delivery-Systeme, ❙ Medizintechnik für minimalinvasive und bildgeführte Interventionen, ❙ neue bildgebende Verfahren mit Fokus auf Funktionsdiagnostik und biomolekulare Bildgebung, ❙ Medizintechnik für die regenerative Medizin, Gewebezüchtung, Zelltherapie, ❙ computerunterstützte Diagnostik, Therapieplanung und -begleitung, ❙ neue Materialien für die Diagnostik und Therapie, Nanomaterialien, funktionelle Oberflächen, passive Implantate aus neuen Werkstoffen, ❙ e-Health, elektronische Patientenakte, Datennetze, Telemedizin, Workflow-Management und Prozessoptimierung. Auch in den Bereichen Instrumente, Systeme und Materialien für die Zahnmedizin und Ophthalmologie sowie bei der Dialyse hat Deutschland ein großes Produktionsvolumen und eine starke Position im Weltmarkt. 2) Blinde werden wieder sehen können: Retina Implantat Otto Bock, Duderstadt 50 retina implant ag, Reutlingen acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 3) Analytik an Nanoliter-Proben Fazit: In Anbetracht verschiedener Kriterien nimmt Deutschland im weltweiten Vergleich den zweiten Rang in der Medizintechnik ein. Diese Position gilt es zu festigen und auszubauen. Denn trotz aller positiven Nachrichten ist der Umsatzanteil deutscher Unternehmen am Weltumsatz von 1991 bis 2001 von 21 Prozent auf 16 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum konnten beispielsweise die USA ihren Anteil von 26 Prozent auf 31 Prozent steigern. Deutschland erfüllt trotzdem alle Randbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft in der Medizintechnik: Lab-on-Chip von Advalytix AG, Brunnthal 4) Bildgeführte und navigierte Neurochirurgie ❙ Innovative Ärzte, die eine Entwicklung neuer Verfahren an­stoßen und neue Produkte und Methoden einsetzen wollen, ❙ eine hervorragende Grundlagenforschung mit kreativen Wissen­ schaftlern in den Bereichen Medizin, Naturwissenschaften und Technik, ❙ eine stark F&E-geprägte Unternehmenslandschaft, die in der Vergangenheit viele Ideen aus der Grundlagenforschung in innovative, am Weltmarkt erfolgreiche Produkte umsetzen konnte, ❙ ein Gesundheitswesen, das als Erstnutzer den schnellsten Vorteil von Innovationen wahrnehmen kann und als starker Heimatmarkt eine Signalwirkung für den internationalen Absatz von Medizintechnik hat. Brain-SUITE von BrainLAB, Heimstetten Vor dem Hintergrund eines ständig steigenden internationalen Wett­­bewerbs muss allen Beteiligten und Verantwortlichen klar sein, dass sich die gute deutsche Position nur durch eine erfolgreiche und geschlossene Wirkungskette von der Grundlagenforschung über die Entwicklung und Produktion bis zur Anwendung halten lässt. 5) Das bunte Spektrum der Medizintechnik Bedarf & Verbrauch besonderer Einrichtungen Pflaster, OP-Einrichtungen Diagnosesysteme EEG, EKG, Monitoring, Lungendiagnose, Schlafdiagnose Diagnostika & Labor Hämatologie, Immunologie, DNA-Chips, Lab-on-Chip Bildgebende Systeme Röntgen, CT, MRT, Ultraschall, SPECT, PET, molek. Bildgebung Hygiene & Sicherheit Hygiene, Sterilisation, Dosi­ metrie & Strahlenschutz, Sicherheit, Gerätemanagement, Katheter Chirurgie & Intervention Chirurgische Systeme, Anäs­ thesie, minimal-invasive Interventionen e-Health & Software Elektronische Patientenakte, Telemedizin Dienstleistung & Medizintechnik Workflow-Management, ­Disease-Management Medizintechnik für besondere Disziplinen Audiologie, Ophtalmologie, Zahnmedizin, Rettung & Not­fall Therapie-Systeme Beatmung & Inhalation, Dialyse & Apherese, Injektion & Infusion, Ultraschalltherapie, Physiotherapie Implantate Aktive Implantate, passive Implantate Strahlentherapie Gammastrahlen, Kerne Zell- und Gewebetechnik Zelltherapie, Gewebestücke, künstliche Organe Hilfen für Behinderte Prothesen, Rollstühle Rehabilitation 51 Beiträge: Dieter Spath > Die Gesundheitsk arte – Prozessmanagement im Gesundheitswesen. > Dieter Spath Die Potenziale der Gesundheits-Telematik für ein patienten­ orientiertes und zukunftssicheres Gesundheitswesen sind heute allgemein anerkannt. Die Nutzung moderner Informationsund Kommunikationstechnologien ermöglicht überhaupt erst die zeitgemäße diagnostische und therapeutische Praxis. Die Politik hat mit dem ­Modernisierungsgesetz für die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), kurz GMG genannt, den rechtlichen und finanziellen Rahmen geschaffen, um die digitale Unterstützung von Gesundheitsprozessen der Zukunft zu gestalten. Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und die Förderung der integrierten Versorgung sind die ersten Schritte der Umsetzung. 52 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Welche Ziele werden nun mit der Einführung der GesundheitsTelematik in Deutschland verfolgt? Grundsätzlich sollen hochwertige Gesundheitsdienstleistungen kostendeckend angeboten werden. Die Einführung der Gesundheits-Telematik fordert von den Akteuren und Patienten ein hohes Maß an Flexibilität und hinreichenden Veränderungswillen. Ob jedoch allein durch die Einführung der eGK die gewünschten Ziele – Qualität, Transparenz und Wirtschaftlichkeit – erreicht werden, ist fraglich. Durch den Einsatz eines übergreifenden Prozessmanagements kann ein tiefer gehender Effekt erzielt werden, weil notwendige Veränderungen bislang an Partikularinteressen scheiterten. Mit Hilfe eines Verständnisses der „Sektoren-übergreifenden Prozessketten“ können sowohl Einzel- als auch Gesamtleistung im Gesundheitswesen optimiert werden. Letztlich ist die Einbindung des Patienten, seine Motivation, gesund zu bleiben, der Motor für Veränderungen hin zu einer besseren und günstigeren Gesundheitsversorgung. Die eGK ist nur Mittel zum Zweck; und die Einbettung in ein Prozessmanagement ist ein notwendiger Schritt, um die gewünschten Ziele zu erreichen. 1 Gesundheitsausgaben Statistisches Bundesamt Deutschland unter http://www.destatis.de/themen/d/thm_gesundheit.php, zuletzt besucht am 24.06.05. 2 GKV-Zahlen des BMGS 2004 unter http://www.bmgs.bund.de/downloads/ GKVAnlagen.pdf, zuletzt besucht am 24.06.05. Zukunftsmarkt Gesundheitswirtschaft Lohnt sich die Optimierung des Gesundheitswesens überhaupt? Dazu einige Fakten. Der Gesundheitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland nimmt heute mit 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einen der vorderen Plätze unter den Branchen ein und ist im Vergleich sogar größer als der Anteil der Automobilindustrie (9,7 % des BIP). Die aktuellen Gesundheitsausgaben belaufen sich auf ca. 240 Mrd. € p. a. Die Branche bietet zurzeit 4,2 Mio. Menschen Beschäftigung und ist damit „Arbeitgeber Nr. 1“ in der Bundesrepublik Deutschland.1 Hatten noch die Maßnahmen des GMG vor allem durch Einsparungen bei Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln sowie bei Fahrkosten in 2004 zu einem Einnahmenüberschuss der gesetzlichen Krankenkassen von ca. 4 Mrd. € geführt, so stiegen ab diesem Jahr die Ausgaben erneut an. Mit knapp 156 Mio. € wurde im 1. Quartal 2005 ein deutlich niedrigerer Überschuss als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielt (950 Mio. €), was jedoch darauf zurückzuführen ist, dass die Einnahmen weniger stark als die Ausgaben stiegen.2 53 Beiträge: Dieter Spath Optimierungspotenzial im deutschen Gesundheitswesen Notwendige Einsparungen führen zu einem Zielkonflikt: Die ­Erhaltung der Versorgungsqualität steht der Finanzierung und der Ver­teilungsgerechtigkeit gegenüber. Zeitnah können Einsparungen durch die Performance-Steigerung und den Einsatz von IuK-Lösungen erreicht werden. Dafür ist die eGK ein Paradebeispiel. Mittelfristig ist es möglich, durch ein besseres Ineinandergreifen der Ar­beitsabläufe auch über die Sektoren hinweg einen weiteren Nutzen zu erzielen. Die Schaffung von Transparenz kann dabei ein Mittel zu einer höheren Qualität der Behandlung und zur Vermeidung von Fehlversorgung sein. Langfristig besteht die Möglichkeit, nur durch die Steigerung der Patientensouveränität und die Unterstützung von Prävention und gesundheitsförderlichem Verhalten einen po­siti­ven Effekt in relevanter Größenordnung zu erreichen (Bild 1). Anwendungen der eGK Laut GKV-Modernisierungsgesetz § 291 a SGB V (Sozialgesetzbuch) ist die elektronische Gesundheitskarte als Speicherkarte ge­plant. Sie ist geeignet, Informationen zu authentifizieren, zu ver­schlüsseln und eine elektronische Signatur zu ermöglichen. Sie wird Anwendungen in einem Pflichtteil und einem freiwilligen Teil enthalten. Im Pflichtteil werden folgende Informationen gespeichert sein: ❙ administrative Daten des Patienten, vergleichbar mit den Daten, die auch auf der aktuellen KV-Karte gespeichert sind sowie der Zuzahlungsstatus ❙ elektronisches Rezept – auch eRezept genannt (s. Bild 3) ❙ aufgedruckter Sichtvermerk auf der Rückseite der eGK für die Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen innerhalb der EU (E111) 1) Bedingung, Maßnahme, Risiko – Veränderungen im deutschen ­Gesundheitswesen Gesellschaft Deckungsdefizit GKV, steigende Kosten (Innovation, ­Demographie) vs. sinkende Einnahmen (Arbeitsmarkt) Maßnahme Gesetzgebung: neue Entgeltsysteme, neue Versorgungsformen (integrierte Versorgung, DMP) Entlastung der GKV (Fremdleistungen/ Kopfpauschale/Bürgerversicherung) Bedingung Risiko 54 schlechtere Versorgungsqualität Organisation Ressourcenverknappung, sinkende ­Erlöse, steigende Löhne, Wettbewerb um Fachkräfte und Patienten Individuum Leistungsverknappung, geringere ­Vielfalt, höhere Beiträge Durchsatzsteigerung, Fallzahl (+), Verweildauer (–) Risikoselektion, Spezialisierung, ­ambulantes Leistungsangebot (+) Erlösoptimierung (Kodierung, ­Controlling) Reibungsverluste, Fehlsteuerung, Insolvenz Eigenverantwortung, Zusatzversorgung, Wahl alternativer Versorgungsstrukturen, Selbstmedikation, Prävention individuelle Mehraufwände, Krankheit acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Für den freiwilligen Teil der eGK wurde bereits im Gesetzestext eine Vielzahl von sinnvollen Anwendungen genannt. In diesem Teil könnten folgende Informationen gespeichert sein: ❙ Arzneimitteldokumentation, Informationen zu Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten gegenüber Medikamenten und deren Inhaltsstoffen ❙ Notfalldaten, zum Beispiel direkt abrufbare Informationen zu chroni­schen Krank­­heiten, Implantaten, Blutgruppenzugehörigkeit, Un­ver­träg­lich­keiten gegenüber Medikamenten und Inhaltsstoffen sowie Allergien 2) Fehleranfällig, ineffizient – das Papierrezept Patient Arzt Patient Apotheke Papierrezept · verloren · gefälscht · fehlerhaft · unlesbar ApothekenRechen­zentrum Papierrezept ❙ P atientenquittung, das heißt Übersicht über die vom Arzt erbrachten Leistungen, Summe der geleisteten Zuzahlungen ❙ elektronischer Arztbrief – Informationen für den weiterbehandelnden Arzt ❙ Patientenfach, also ein privater Speicherbereich des Patienten, um wesentliche Befunde, wie zum Beispiel Laborwerte oder ein EKG, direkt auf der Karte zu speichern Die eGK enthält in der ersten Ausbaustufe (Pflichtteil) bis auf den Teilaspekt des eRezepts nur eine Schlüsselfunktion für den sicheren Zugang zur Gesundheits-Telematik. Eine Vielzahl von sinnvollen medizinischen Anwendungen findet (noch) keine Verwendung, was die Akzeptanz unter den Akteuren gefährdet. Kosten­träger E · Scannen · Zuordnen · manuelles nach­ bearbeiten Patientenweg Informationsfluss 3) Sicher, schnell und durchgängig – das eRezept Patient eGK Arzt Patient Apotheke Kosten­träger eRezept auf eGK TelematikInfrastruktur Patientenweg E Ab dem Jahr 2006 soll nach jetziger Gesetzeslage zunächst das eRezept als wesentlicher Teil der Pflichtanwendungen der eGK umgesetzt werden. Die bisherige Lösung (Bild 2) ist gegen Fälschung und Missbrauch nahezu ungeschützt, und die vorhandenen Medienbrüche führen zu einem erheblichen Aufwand in der Bearbeitung. Häufig sind Rezepte fehlerhaft ausgefüllt, unleserlich oder gehen verloren. Die Zuordnung der Rezepte und die manuelle Nachbearbeitung im Apotheken-Rechenzentrum sind sehr aufwändig. In Zukunft werden alle wesentlichen Informationen in elektronischer Form zugänglich sein, was eine durchgängige, schnelle und sichere Übertragung ermöglicht (Bild 3). Allein daraus ergibt sich nach vorsichtigen Schätzungen bei rund 700 Mio. Rezepten in der Bundesrepublik ein Einsparpoten­zial von ca. 250 Mio. € pro Jahr3, was etwa 0,18 Prozent der gesamten GKV-Ausgaben des Jahres 2004 entsprochen hätte. Informationsfluss 3 Abschlussbericht Kommunikationsplattform für das Gesundheitswesen Kosten-Nutzen-Analyse für die Neue Versichertenkarte und das Elektronische Rezept, Friedwart Lender, Nürnberg, 29. Juni 2001, unter http://www.debold-lux.com/pdf/abschlussbericht.pdf, zuletzt besucht am 27.06.05. 55 Beiträge: Dieter Spath Sektorenübergreifendes Prozessmanagement Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen Wie kann darüber hinaus durch ein sektorenübergreifendes Prozessmanagement noch weiteres Optimierungspotenzial im Gesundheitswesen realisiert werden? Dazu werden die einrichtungsübergreifenden Prozesse, beispielsweise die dem stationären Aufenthalt vor- und nachgeschalteten Schritte, mit in die Betrachtung einbezogen. Einrichtungen des Gesundheitswesens unterliegen einer Vielzahl von externen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Datenschutz, sozialer Auftrag, Vergütung), den Kundenwünschen und der demographischen Entwicklung. Daneben spielen aber auch innere Einflussfaktoren, beispielsweise die eigene Motivation, die Mitarbeiterorientierung und der eigene Qualitätsanspruch, eine entscheidende Rolle für die Realisierung eines erfolgreichen Prozessmanagements. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, damit ein sektoren­ übergreifendes Prozessmanagement erfolgreich sein kann? Die Prozesse innerhalb einer einzelnen Einrichtung lassen sich durch die Verwendung klassischer Methoden des Managements bereits gut optimieren. Auf dieser Ebene unterstützen Controlling und Methoden der Qualitätssicherung das Management. Sie können auf eine einheitliche, einrichtungsinterne Informations- und Kommunikationsplattform fußen. Sollen die internen Grenzen überwunden und die Beziehungen zu anderen Einrichtungen sowie den Kunden einbezogen werden, sind Qualitätsmanagementmodelle wie ISO, TQM, EFQM oder KTQ hilfreich. Dadurch besteht die Möglichkeit, Prozesse der Führung, Wertschöpfung und Unterstützung mit dem Ziel der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Bislang fehlt diesem Bereich die oben genannte informationstechnische Basis, um in Einrichtungsverbünden, privaten Strukturen, Holdings oder Strukturen der integrierten Versorgung wesentliche Informationen für das sektorenübergreifende Prozessmanagement zusammenzutragen. 56 Ohne stabile rechtliche und ökonomische Randbedingungen – wie in Modellen der integrierten Versorgung – fehlt die notwendige Sicherheit für die zu leistenden Investitionen in Technik, Organisa­ tion und Personal. Dazu müssen der Wille zur Kooperation und ge­meinsame Ziele vorhanden sein. Sehr große Verantwortung obliegt dabei dem Management, der Koordination und dem Controlling. Vor allem muss man Wert auf die Qualitätssicherung und die Kommunikation legen, um beispielsweise zu vermeiden, dass notwendige Einsparungen durch Qualitätsverluste erkauft werden. Ziel ist es, die Akzeptanz aller Beteiligten zu erreichen. Besonders die Wahrung des Datenschutzes und die Unterstützung der Patien­ tensouveränität stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Zusammenfassung Qualität und Wirtschaftlichkeit durch Performance, Eigenverantwortung und Transparenz, so werden die Ziele der Einführung der Telematik-Plattform im Gesundheitswesen zusammengefasst. Die elektronische Gesundheitskarte ist zwar ein Enabler zur Verwirklichung eines sektorenübergreifenden Prozessmanagements, aber sicher noch keine hinreichende Bedingung dafür. Wenn ökonomische Aspekte beim Veränderungsprozess im Vordergrund stehen, beschränkt sich auch die Wirkung der elektronischen Gesundheitskarte auf das primäre Einsparpotenzial. Werden auch Qualität der Versorgung, Transparenz und Stärkung der Patientensouveränität als Ziele verfolgt, müssen diese Anforderungen aufgenommen und auf allen Ebenen einbezogen werden. Die elektronische Gesundheitskarte kann so einen wesentlichen Beitrag für ein funktionierendes Prozessmanagement leisten; sie ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 4) TOP – der Mensch unterstützt von Technik, ­Organisation und Personal Genesung T Nachsorge, Pflege Prävention Prophylaxe Früh­er­ken­nung Imp­fen Erkrankung Lebenswelt Betriebliche Gesundheitsförderung Mensch Fitness Wellness Anti-Aging Reha Prävention, Gesundheitserziehung, Eigenverantwortung OP/ Therapie O Dia­­gnos­tik Arbeitswelt P Ein Ansatz, der dem Rechnung trägt, stellt den Menschen in den Mittelpunkt seiner Lebens- und Arbeitswelt. Das Individuum wird durch Technik, Organisation und Personal darin unterstützt, sich selbständig und eigenverantwortlich um den Prozess der Gesund­ erhaltung und der Gesundung zu kümmern (Bild 4). Akteure und Patienten suchen vor allem Vertrauen in die neue Technologie. Akzeptanz kann dort entstehen, wo die Beteiligten frühzeitig in den Veränderungsprozess einbezogen und die richtigen Anreize gesetzt werden. Den Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Dienstleistung und der Industrie muss mit stabilen Rahmenbedingungen und zuverlässigen Vorgaben die für sie wichtige Investitionssicherheit gegeben werden, um in die Telematik-Plattform zu investieren. Beratung 57 Beiträge: Norbert Klusen > SYSTEMINNOVATIONEN ALS TREIBER DES GESUNDHEITSMARKTES. > Norbert Klusen Welche gesellschaftlichen Trends bestimmen das Gesundheitswesen? Das deutsche Gesundheitswesen rückt seit einigen ­Jahren immer stärker in den Fokus gesellschaftlicher wie poli­ ti­scher Diskurse. Sozial- und gesundheitspolitische ­Konzepte und (Miss-)Erfolge können politische Wahlen entscheiden, gleichzeitig ist das ­Gesundheitswesen Angriffspunkt verschiedenster Interessen. Wirtschaftsverbände und Industrie fordern Leistungskürzungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), deutlich erhöhte finanzielle Eigenbeteiligungen der Patienten und eine (fortgesetzte) Rückführung der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherungen zwecks Entlastung der Arbeitgeber. Viele Unternehmen, zum Beispiel die Pharma-, Medizintechnik- und Hilfsmittel-Branche, sind hingegen um einen möglichst ­ großen Umsatz ihrer Produkte bemüht. Doch größere Umsätze belasten die Finanzen und die Stabilität der GKV, insbesondere wenn die höhere Leistungserbringung zu ­keinem Mehr an Gesundheit und Lebensqualität führt. 58 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Der medizinische und insbesondere der medizintechnische Fortschritt sind keine Faktoren, welche die GKV notwendigerweise belasten, doch in der Praxis bedeuten neue Technologien meist auch zusätzliche Leistungen. Alte Verfahren werden nicht ausgetauscht, sondern beibehalten, die neuen kommen hinzu: Addition statt Substitution. So ist in der Herzchirurgie die Anzahl an Bypass-Operationen in Deutschland nicht zurückgegangen, obwohl parallel und in großem Ausmaß Katheter-Eingriffe (Ballondilatationen) durchgeführt wurden und wir nicht herzkranker sind als vor zehn Jahren. Ähnlich verhält es sich bei den bildgebenden Diagnose-Verfahren: Wir konnten mit der Kernspin-Tomographie und der ComputerTomographie einen enormen technischen Fortschritt verzeichnen, trotzdem ist die Anzahl der Röntgenaufnahmen nicht gesunken.1 1 Moderne, innovative Medizintechnik könnte durchaus dazu bei­ tragen, kommende finanzielle Herausforderungen zu bewältigen. Voraussetzung ist jedoch, dass wir aus medizintechnischen Innovationen auch soziale Innovationen machen, dass wir also neue Verfahren zur Vermehrung des Gemeinwohls einsetzen, anstatt unser Gesundheitswesen zu torpedieren. Denn die sozialen Sicherungssysteme sehen sich künftig verstärktem Handlungsdruck ausgesetzt – insbesondere durch die demograph ische Entwicklung und das eintretende Double-Aging: Die insgesamt steigende Lebenserwartung und der zunehmende Bevölkerungsanteil der älteren Generationen werden die Ausgaben erhöhen und die Einnahmen mindern; das steht fest – auch wenn sich die Wissenschaftler über das Ausmaß nicht einig sind. Letztendlich steigern die künftigen Finanzierungsrisiken, mit denen wir uns ständig befassen, den Optimierungs- und den Legitimationsbedarf eines solidarisch finanzierten Gesundheitswesens. Und je weniger soziale Innovationen uns gelingen, umso stärker wird versucht werden, den Druck auf den Beitragssatz über eine Individualisierung von Krankheitsrisiken aufzufangen. Daran wird der sichtbare und begrüßenswerte Trend zu mehr Citizenship (Bürgerorientierung) und Empowerment (Befähigung) der Versicherten und Patienten nichts ändern. Für viele Unternehmen stellen dann der private Gesundheitsmarkt und Wellness-Bereich die alternativen Geschäftsfelder dar. Hingegen ist die moderne Positronen-Emissions-Tomographie (PET) eine sinnvolle ­Ergänzung, da sie auch raumfordernde krankhafte Prozesse unter 1 cm identifizieren kann und daher eine Früh­ erkennung von Weichteil-Tumoren ermöglicht. 59 Beiträge: Norbert Klusen Aufbruchstimmung und Innovationskultur für das Gesundheitswesen Deutschland hat ein sehr erfolgreiches Gesundheitswesen, das überwiegend solidarisch finanziert ist, eine einzigartige medizinisch-therapeutische Versorgungsdichte aufweist und den gesetzlich Krankenversicherten einen umfassenden Regelleistungskatalog und einen guten Zugang zu den Versorgungsleistungen bietet. Die Versicherten und Patienten genießen relativ hohe Freiheitsgrade, wie zum Beispiel Kassenwahlrecht ohne Risikoselektion und freie Therapeutenwahl. Es gibt jedoch merklich Probleme in der Innovationsbereitschaft; Systemschwächen werden nur unzureichend therapiert und überdauern daher sämtliche Reformen. Das korporatistische System ist verbürokratisiert und nicht mehr in der Lage, angemessene Steuerungsimpulse zu geben. Der Krankenkassenmarkt ist gekennzeichnet von einem ausufernden Finanzausgleich und einer Verbandshaftung, die eine unseriöse Haushaltsführung und bewusste Schuldenpolitik belohnt statt sanktioniert. Daraus resultiert ein Rent-Seeking, das heißt der Einsatz vieler Krankenkassen für immer fortgesetzte und ausgebaute Subventionen, weil dieser häufig lohnenswerter erscheint als Investitionen in effizientere Organisationsformen und eine bessere sowie wirtschaftlichere gesundheitliche Versorgung. 60 Das System der Forschungsfinanzierung ist nicht mehr zeitgemäß. Die GKV darf Forschung allenfalls im Rahmen von Modellvorhaben finanzieren. Mehrkosten der Behandlung in Folge einer Teilnahme von Patienten an Forschungsstudien müssen vollständig über Drittmittel oder staatliche Forschungsfinanzierung abgedeckt werden. Die Einführung neuer medizintechnischer Verfahren ist in Deutschland kompliziert und langwierig. Medizinischer Fortschritt erreicht derzeit erst nach ca. 10 Jahren die reale Versorgung. Einzig mit Modellvorhaben können Krankenkassen diesen Prozess etwas beschleunigen. Doch Forschung und Innovation wird es ohne Investitionen nicht geben. Versäumen wir es, die spürbaren Innovationsbremsen zu beseitigen, wird der Erfolg des deutschen Gesundheitswesens sehr schnell verspielt sein. Grundlegende Veränderungen zum Positiven gibt es bereits auf dem Gebiet der gesundheitsbezogenen Informationen. Das Internet und der medienübergreifende Quoten-Garant Gesundheit sorgen für eine neue Kultur der Gesundheitskommunikation. Nur ein Beispiel: Im Frühjahr 1995 gab es in Deutschland 250.000 Internetnutzer – im Mai 2003 waren es knapp 39 Millionen [1]. Versicherte und Patienten, die aktiv Informationen einfordern, setzen einen Prozess in Gang, der am Ende das gesamte Gesundheitswesen transparenter werden lassen könnte. Und Transparenz ist erforderlich, um Qualität sicht- und vergleichbar zu machen, damit sich die Versicherten, Patienten und auch Vertragspartner für die beste Qualität entscheiden können. Bis zu einer Nutzerorientierung unseres Gesundheitswesens ist es wohl noch ein langer Weg, und er wird für viele Beteiligte einen Kulturschock auslösen. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Dazu ein Beispiel: Arzt-Patient-Beziehungen in Deutschland sind häufig noch immer von einem stark ausgeprägten Paternalismus gekennzeichnet, das heißt Patienten werden vielfach unzureichend bzw. in nicht verständlicher Form informiert. Patientenautonomie beschränkt sich dann darauf, die Therapieentscheidungen des Arztes mitzutragen oder abzulehnen. Bei einer partnerschaftlichen Entscheidungsfindung (Shared Decision-Making), die wir auch in der Techniker Krankenkasse (TK) gezielt unterstützen, werden hingegen die Meinungen, Werte und Präferenzen des Patienten berücksichtigt und einbezogen. Richtig angewendet, führt eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung zu einem besseren Therapieerfolg, zu einer größeren Zufriedenheit sowohl des Patienten als auch des Arztes und häufig sogar zu einer verbesserten Effizienz der Versorgung [2]. Unsere täglichen Kontakte zu den Versicherten bestätigen den Trend: Versicherte und Patienten erwarten und fordern immer stärker Transparenz über die Möglichkeiten (zum Beispiel Versorgungsalternativen), Abläufe (Wege durch den Versorgungs­ dschungel), Rechte (Patientenschutz) sowie Qualität (Strukturen, Prozesse, Ergebnisse) der Versorgung. Zeitgemäße, angemessene Gesundheitskommunikation ist wichtig, eine Kultur, die soziale Innovationen ermöglicht, muss allerdings auch die Vertragsstrukturen einbeziehen. Transparenz und Entscheidungsfreiheiten für alle Akteure geben Impulse für neue, innovative und qualitativ hochwertige Versorgungsstrukturen. So hat die seit 1996 mögliche Freiheit der Kassenwahl zu einem Wettbewerb zwischen den Krankenkassen mit Unternehmergeist, Leistungs- und Serviceorientierung geführt. Gestaltungsmöglichkeiten im Leistungs- und Versorgungsbereich fehlen den Krankenkassen hingegen noch immer; sie werden jedoch benötigt, damit sich die Kassen im Dienste des Versicherten für die beste Versorgungsqualität entscheiden können. Ist das Gesundheitswesen hinreichend transparent und bietet es umfassende Entscheidungsspielräume, so werden sich die guten Dienstleister durchsetzen – sowohl auf der Seite der Leistungserbringer als auch auf der Seite der Kostenträger. Wettbewerb heißt, die Bürger, Versicherten und Patienten stärker als Steuerungsinstanz ins System einzubinden. Dazu wurden erste richtige Schritte im GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) unternommen. Die neu gefasste Integrationsversorgung, die Medizinischen Versorgungszentren und die Elektronische Gesundheitskarte sind viel versprechende Ansätze zur Erhöhung der Innovationsbereitschaft und -fähigkeit. Die im GMG beschlossene verbesserte Transparenz über Angebote, Leistungen, Kosten und Qualität, die Informationsrechte der Versicherten sowie die Entscheidungsund Gestaltungsmöglichkeiten beim Versicherungsumfang und dessen Finanzierung sind nun zügig weiter auszubauen. 61 Beiträge: Norbert Klusen Qualitätsorientierung in der TK Innovationen in der medizinischen Versorgung In der heutigen Situation – die Gesetzliche Krankenversicherung befindet sich in einer ernsten Legitimationskrise – reicht es nicht, den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Die Akteure selbst müssen wichtige Impulse zur Weiterentwicklung des Systems setzen. Die TK versteht sich daher als Innovationsmotor des Gesundheitswesens; dies ist eines der strategischen Ziele unseres Unternehmens. Ausgehend von diesem Anspruch entwickeln wir Management- und Produktinnovationen in drei zentralen Themenfeldern, das sind das Empowerment der Versicherten, Innovationen in der medizinischen Versorgung und die Organisationsentwicklung (Bild 1). Die Spielräume für Krankenkassen, medizinische Innovationen zu för­­­dern, sind sehr begrenzt, weil die gesamte Regelversorgung ein­ heit­­lich und gemeinsam über die gemeinsame Selbstverwaltung der Ärz­­te und Krankenkassen organisiert wird. Damit entziehen sich die Ver­­sorgungsstrukturen und die -qualität in weiten Teilen dem Einfluss der einzelnen Krankenkassen. Im Rahmen der verbleibenden Hand­­lungsmöglichkeiten – das betrifft insbesondere Modellvorhaben, die integrierte Versorgung und medizinische Versorgungszentren – entwickeln wir Konzepte zur Förderung besonders innovativer medizinischer Verfahren. Empowerment der Versicherten Beispielsweise fördern wir seit 2003 den Einsatz medikamentenbeschichteter Stents in der Versorgung von Herzinfarktpatienten und leisten dadurch aktiv einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten sowie auch zur Erhöhung der Versorgungseffizienz. Ein erster Zwischenbericht des evaluierenden Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité bestätigt: Die Investition in die beschichteten Stents führt durch weniger Restenosen, weniger Rehospitalisierungen und ­weniger erneute PTCA-Eingriffe2 zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten (Bild 2). Obwohl deutlich teurer – ca. 2.100 gegenüber 300 Euro, rechnen sich die Stents im Mittel bereits nach sechs Monaten. In der realen Versorgungssituation, das heißt ohne gezielte Förderung, lohnt sich der Einsatz teurerer Stents für die Kran­kenhäuser nicht. Grund sind die Fallpauschalen (Dia­gnosis Related Groups – DRG), die etwaige Mehrkosten durch Einsatz höherwer­tigen Materials grundsätzlich nicht kompensieren. Im Rahmen von Einzelverträgen (selektive Kontrahierung) zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern ließen sich diese Webfehler der Fall­pauschalenfinanzierung hingegen ohne Weiteres korrigieren. Der Gesetzgeber gestattet dies bislang jedoch lediglich im Rahmen der integrierten Versorgung. Empowerment zielt auf einen Zustand, in dem die Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen. Abgeleitet von Antonovskys Konzept der Salutogenese [3] als Erklärungsmodell für Gesundheit sind Empowerment und Selbstkontrolle über das eigene Leben die Grundvoraussetzung für körperliches und seelisches Wohlbefinden. Aktiv unterstützt die TK eine solche „Bemächtigung“ der Versicherten. Stellvertretend seien hier das „TK-Ärztezentrum Medizin und Gesundheit“, die „Versicherteninformation Arzneimittel (TK-ViA)“ sowie unser gegen erhebliche politische Widerstände durchgesetztes Modellvorhaben „Solidarverträglicher Selbstbehalt“ genannt. 1) TK – Qualitätsorientierung durch Innovation Empowerment der ­Ver­sicherten Innovationen in der medizinischen Versorgung Organisationsentwicklung Management- und Produktinnovationen der TK Quelle: TK 2 62 P TCA – Percutane Transluminare Coronare Angioplastie: Aufweitung einer verengten Herzkranzarterie mittels eines aufblasbaren Ballons (Ballon-Dilatation) acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Organisationsentwicklung > Literatur. Zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit unternimmt die TK seit 2002 eine gewaltige Umstrukturierung ihres gesamten Unternehmens. Strukturen und Prozesse werden optimiert, der Kundenservice weiter verbessert sowie die Leistungs- und Verwaltungsausgaben gesenkt. Nach Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2007 werden wir die Produktivität um ca. 20 Prozent erhöht und den Beitragssatz rechnerisch um 0,4 Prozentpunkte gesenkt haben. Mit zahlreichen weiteren Anstrengungen setzen wir uns, wie viele andere Akteure, für eine Verbesserung der Versorgungsqualität und Wirtschaftlichkeit des Systems ein. [1] Glossar.de. ARCHmatic-Glossar und -Lexikon. http://www.glossar.de/glossar/ (Zugriff: 15.04.2005). [2] Härter, M.; Loh, A.: Shared Decision Making. Partizipative Entscheidungsfindung. http://www.patient-als-partner.de (Zugriff: 15.04.2005). [3] Antonovsky, A.: Unraveling the Mystery of Health. San Francisco, Jossey Bass 1987. Innovationen sind allerdings in besonderem Maße auf gesetzliche Rahmenbedingungen angewiesen. Aufgabe der Gesundheitspolitik muss es daher sein, einen fairen, das heißt organisations- und vertragsrechtlich konsistenten Wettbewerb von Kräften und Ideen als Innovationstreiber zu ermöglichen. Transparente Strukturen, Prozesse und Ergebnisse lassen dann für Gruppenegoismen und für ein Rent-Seeking der Akteure wenig Raum. So können soziale Innovationen zu Stützpfeilern eines zukunftssicheren, solidarischen Gesundheitswesens in Deutschland werden. 2) „Vermeidung koronarer Restenosen“ – Modellvorhaben nach §63 SGBV Herkömmliche Stents Initiale Krankenhauskosten 3.600 E Direkte Folgekosten 5.400 E Krankheits-Gesamtkosten 10.700 E Rehospitalisierungsrate 1 von 3 Patienten Schwere kardiologische Ereignisse bei 31% der Patienten Beschichtete Stents 5.400 E 3.700 E 9.700 E 1 von 6 Patienten 16% der Patienten Quelle: TK 63 Beiträge: Eckhard Nagel, Karl Jähn > Chancen für den Gesundheitsmarkt durch e-Health. > Eckhard Nagel, Karl Jähn Binnen weniger Jahre sind die Informations- und Kommunika­ tionstechnologien (IuK-Technologien) ein zentrales DiskussionsEckhard Nagel Karl Jähn thema für die Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung von morgen geworden. Betrachtet man den Gesundheitsmarkt im weiteren Sinne, so ergeben sich neue Perspektiven für medizinassoziierte Dienst­leistungen, die ihrerseits die „klassische“ ärztliche Versorgung maßgeblich beeinflussen werden. 64 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Die bereits heute technologisch möglichen und in zahlreichen Einzelprojekten erfolgreichen Entwicklungen begegnen in der Gesundheitsbranche einem zwar deutlich wachsenden Markt, sind jedoch auch mit oft unterschätzten systemimmanenten Innovationshürden konfrontiert: Die Betrachtung des einzigartigen Stellenwerts der medizinischen Dienstleistung per se, die heterogene Organisation der gegebenen Versorgungsstrukturen und der gesundheitsassoziierten Teilmärkte sowie auch die Partikulärinteressen der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen führen zu der Schlussfolgerung, dass trotz aller Möglichkeiten im Detail nur jene Innovationen erfolgreich sein werden, die sich strikt an den heutigen oder zu erwartenden „urgent needs“ des Patienten (bzw. des Gesundheitsinteressierten) und des praktisch tätigen Gesundheitsdienstleisters orientieren. Die nachfolgende Skizzierung aktueller Sachverhalte und FuE-Trends erfolgt mit der Vorstellung, dass erst und gerade durch das Zusammenspiel der verschiedenen Innovationsansätze ein über die Strukturen des heutigen Gesundheitswesens weit hinausreichernder Gesundheitsmarkt entstehen wird. Telemedizin Trotz des hohen Standards der Gesundheitsversorgung in Deutschland und des herausragenden Stellenwerts von bisherigen – zum Beispiel medizintechnologischen – Entwicklungen wird Deutschland in Bezug auf die mit dem World Wide Web erheblich an Bedeutung gewonnene Telemedizin als Entwicklungsland betrachtet. Als Hauptgründe dafür galten bislang die hohe Dichte der ärztlichen Versorgung und die oft ablehnende Haltung der vergleichsweise hoch qualifizierten Ärzteschaft. Diese Situation könnte sich angesichts der dramatisch zunehmenden Unterversorgung in strukturschwachen Regionen, der zunehmenden fachlichen Anforderungen an den einzelnen Arzt und der gesundheitsökonomischen Herausforderungen an eine sich demographisch wandelnde Gesellschaft alsbald ändern. Home-Monitoring-Projekte beinhalten das Potenzial, Liegezeiten im Krankenhausbereich zu verkürzen oder die Situation in Pflegeheimen bzw. in der häuslichen Pflege zu begünstigen. Parallel finden Themen wie Teleconsulting, Patienteneducation, Patienten­ unterstützung durch Online-Communities oder Virtuelle Therapie in der wissenschaftlichen Literatur zunehmend Beachtung. Die in Bild 1 hervorgehobenen Innovationsfelder beanspruchen für sich, einer regionalen Unterversorgung entgegenwirken zu können. Für die angewandte Praxis sind die entsprechenden Pilotprojekte der kritischen Frage zu unterstellen, ob sie reibungslos in die konkrete Behandlungssituation integrierbar sind sowie den Informations- und Wissenstransfer zwischen Fachexperten, anderen klinisch tätigen Ärzten und Patient evidenzbasiert zu unterstützen vermögen. Erste Studienergebnisse geben Hoffnung zu der These: „Die konsequente Integration von realen und virtuellen Arbeitsfeldern wird eine flächendeckende qualitätsgesicherte Versorgung aufrechterhalten.“ 1) Innovationsfelder telemedizinischer Verfahren Home­Monitoring Hausärzte (e-HealthBegleiter) stationäre Versorgung Telecon­ sulting Fachärzte (ambulant) OnlineCommu­ nities Patient Apotheken Pflege­service Virtuelle Therapie 65 Beiträge: Eckhard Nagel, Karl Jähn IuK-Entwicklungen im Gesundheitswesen Der Rechercheaufwand angesichts der rasanten Zunahme des me­di­zinischen Wissens, die zunehmende Anspruchsleistung des Pa­tienten und der stets ansteigende Dokumentationsaufwand im Interesse einer Qualitätssicherung der medizinisch-pflegerischen Betreuung stellen für die Gesundheitsversorger nicht nur eine fachliche, sondern auch eine erhebliche zeitliche Herausforderung dar. Wissensmanagement ist auch in der Medizin ein zentraler Wirtschaftsfaktor geworden, der durch gesundheitsassoziierte Ent­ wicklungen und Fragestellungen aus Bereichen der Gendiagnostik, der computerunterstützten Therapieplanung und Prognose, der individualisierten Pharmakotherapie, der Medizinethik oder des Medienmarktes noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Die von der EU forcierten Bestrebungen hin zur Wissensgesell­ schaft im Allgemeinen und zur Integration der Telematik im Ge­sundheitswesen im Speziellen erfordern aktuell einen wesentlichen ersten Schritt: Die erfolgreiche Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und des eRezepts. Diese Innovation, die mittelfristig eher als „Schlüssel zu weiteren e-Health-Anwendungen“ denn als reiner „mobiler Datenträger“ zu verstehen ist, stellt eine maßgebende Grundlage für die Einführung und Verbreitung der elektronischen Patientenakte (EPA) bzw. elektronischen Gesundheitsakte (EGA) dar: Während Ersterer eine sektorenübergreifende, integrierte Versorgung ermöglicht, würde Letztere in der Obhut des Patienten auch weit über die medizinische Versorgung hinausreichende e-Health-Anwendungen koordinieren. 66 Der Verbreitung Web-basierter Standards könnte eine Generation von Informationssystemen folgen, bei der nicht mehr zwischen Praxissoftware- und Krankenhausinformationssystemen (KIS) unterschieden wird. Das Lizenzgeschäft würde sich auf Zusatzapplikationen verlagern, wie Internet- und Mobilfunk-basierte Gesundheitsinformation, eLearning-Angebote und entscheidungsunterstützende Systeme (EUS), die sich sowohl an den Experten wie auch an den Laien richten. Die bislang vorherrschende „persönliche Evidenz“ bei der ärztlichen Entscheidungsfindung wird durch Informationssysteme unterstützt, die bereits heute ihre Überlegenheit bei manchen Indikationen unter Beweis stellen konnten und nichtsdestotrotz den Arzt niemals ersetzen werden können. Parallel wird der Patient aktiv und über die reine Gesundheitsversorgung hinaus eingebunden. Während der Ärzteschaft eine vermehrte informationstechnologische Expertise abverlangt werden wird, wäre ein Großteil der Patienten nicht „ermächtigt“ genug, die Hoheit über ihre Daten und die individualisierten Gesundheitsinformationen alleine zu bewerkstelligen bzw. bei dem viel gepriesenen „shared decision making“ auch eine „shared responsibility“ zu tragen. Hier könnte sich eine neue Rolle für den Primär- bzw. Hausarzt entwickeln: Während der „Wald- und Wiesen-Doktor“ zusehends weniger gefragt sein wird, bleibt eine über Jahre wachsende Vertrauenssituation zu einem „Familienarzt“ sinnvoll. Angesichts der bislang vorherrschenden Funktion einer wohnortnahen Koordination der fachmedizinischen Versorgung, ist die hausärztliche dazu prädestiniert, auch die „virtuellen“ Informations- und Versorgungsangebote zu vermitteln (Bild 2). Die sich daraus ergebende These lautet: „Der Primär- bzw. Hausarzt wird vom Lotsen im Gesundheitswesen zum e-Health-Begleiter im Gesundheitsmarkt.“ acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 2) IuK-unterstützte Versorgung („Blended Healthcare“) unter hausärztlicher Koordination Hausärzte (e-HealthBegleiter) StationäreVersorgung Entschei­ dungs­ unterstüt­ zende Sys­teme Apotheken Praxis-/Kran­ken­ haus-Informa­ tionssysteme Patient eGesund­heitskarte (eRezept) ePatientenakte (eGesundheitsakte) Fachärzte (ambulant) Online-/ Mobile-Ge­ sundheitsinforma­ tion Wenn sie zu der im aktuell diskutierten Präventionsgesetz gefor­ derten „4. Säule“ des Gesundheitswesens werden soll, ist vor dem Hintergrund bisheriger Fehlschläge der „Setting-Ansatz“ beson­ders zu beachten: Eine Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit lässt sich nicht mit einer reinen Wissensvermittlung erzielen, sondern erfordert eine auf das Lebensumfeld des Einzelnen abgestimmte Verhaltensvermittlung. Pflege­service Präventive Sensornetzwerke Aktuell zeichnet sich eine Fokussierung auf die medizinisch not­wendige Grundversorgung innerhalb des Versicherungssys­ tems bei Öffnung der Marktstruktur hin zu selbstfinanzierten Leistungen für Patienten und Gesundheitsinteressierte ab. Dieser Trend wird durch die demographische Entwicklung, die Zunahme chronischer Erkrankungen bzw. die begrenzten Möglichkeiten der solidarisch finanzierten Regelversorgung beschleunigt. Neben dem seit Jahren wachsenden Marktvolumen für gesundheitsassoziierte Dienstleister und Wellness-Anbieter ist auch auf Seiten der konventionellen Gesundheitsversorger eine deutliche Zunahme an Angeboten für Selbstzahler zu beobachten, wie zum Beispiel Gesundheits-Screenings. Hier wäre zu fordern, auch die nicht-indikationsgestützten gesundheitsassoziierten Leistungen und Produkte einer umfassenden medizinischen Evaluation zu unterziehen und die Gesundheitsförderung interdisziplinär zu unterstützen: Krankheitsprävention bedeutet mehr als eine Früherkennung möglicher pathologischer Befunde mit bildgebenden Screening-Verfahren. Das anhaltende Monitoring von „Krankheits-“ oder gar noch zu entwickelnden „Gesundheitsparametern“ mit Hilfe so genannter „körpernaher Sensorik“ könnte dem Individuum die positiven Auswirkungen von gesundheitsfördernden Verhaltensänderungen unmittelbar erfahrbar machen – möglicherweise mit Begleitung des Hausarztes durch ein Medizinisches Kommunikationszentrum (Bild 3). Die daraus abzuleitende These lautet: „Die Kombination von körpernahen Sensornetzwerken, Mobilfunk-Technologie und intelligenter Datenverarbeitung auch im häuslichen Umfeld eröffnet die Möglichkeit, wirksame Anreizsysteme für die Gesundheitsförderung zu entwickeln.“ 3) Prävention mit Hilfe von Gesundheitstechnologien und ­Medizininformatik Hausärzte (e-HealthBegleiter) Praxis-/Kran­ken­ haus-Informa­ tionssysteme Gesundheits­asso­ziierte Produktanbieter Entschei­ dungs­ unterstüt­ zende Sys­teme Patient Haustele­matik-Station Körpernahe Sensorik Online-/ Mobile-Ge­ sundheitsinforma­ tion Gesundheits­asso­ziierte Dienstleister ePatientenakte (eGesundheitsakte) Medical Communication Center 67 Beiträge: Eckhard Nagel, Karl Jähn Herausforderungen für die Zukunft Ein bürgerzentriertes Gesundheitswesen von morgen wird all die Chancen nutzen, die sich in kultureller, medizinischer, technologischer sowie gesundheitspolitischer Hinsicht abzeichnen. Die bevorstehenden Trends und Entwicklungen bereiten jedoch erst in ihrer Zusammenwirkung den Boden für einen Innovationsschub, der dem Patienten nachhaltig zugute kommt. In einer eigenen Studie zu Telemedizin-Projekten konnten die dafür notwendige enge Verzahnung von Hochleistungsmedizin, Basisversorgung und Industrie belegt und die maßgeblichen Innovationsfelder definiert werden: ❙ Integration in das Arbeitsumfeld, ❙ Akzeptanz bei Ärzten und ❙ technologische Standardisierung. Auf dem langen Weg von einer Krankheitsversorgung hin zu einer Krankheitsvermeidung ist das Zusammenspiel von Informationsund Gesundheitsmanagement erst noch zu entwickeln. Eine gesundheitsorientierte Sensorik und ein mobiles Gesundheitsmonitoring könnten dabei wesentliche Bausteine sein. Die bislang nur in Einzelaspekten vorhandenen IuK-unterstützten Lösungen werden erst in ihrem Zusammenwirken marktfähig sein können, wofür sie konsequent in das jeweilige Arbeits- und Lebens­ umfeld von Patient und Arzt integrierbar sein müssen, um einen „echten“ Nutzen herbeiführen zu können. Zu finanzieren sind sie erst dann, wenn ein Großteil der Bürger und Leistungserbringer par­tizipieren können. Dann könnte sich ein dynamischer Markt entwickeln, der mehr zu leisten vermag als die Solidargemeinschaft. Aus heutiger Sicht ergibt sich daraus die These: „Die Chancen von e-Health finden erst durch das Zusammenwirken der verschiedenen IuK-Lösungen Einzug in den Gesundheitsmarkt von morgen.“ 4) Dimensionen von e-Health (nach Jähn,K.) Für die medizinischen Versorger ergibt sich schon frühzeitig die Verantwortung, das medizinisch Notwendige zu definieren und es weiterhin in der Regelversorgung zu belassen sowie Handlungsrichtlinien auch für nichtmedizinische Gesundheitsdienstleister zu entwickeln – bis hin zu einer e-Health-Ethik. Sicher erscheint nur, dass dem größten Beschäftigungs- und Wachstumsmarkt binnen einer Generation eine tief greifende Umwandlung bevorsteht. Home­Monitoring StationäreVersorgung Hausärzte (e-HealthBegleiter) Praxis-/Kran­ken­ haus-Informa­ tionssysteme Fachärzte (ambulant) Patient Telecon­ Apotheken Entschei­ sulting dungs­ unterstüt­ zende Sys­teme Haustele­matik-Station Körpernahe Sensorik eGesund­ heitskarte (eRezept) ePatientenakte (eGesundheitsakte) Gesund­­­heits­­asso­­zi­­­ier­te Pro­­­­­­dukt­an­bie­ter Medical Communication Center Virtuelle Therapie 68 Online-/ Mobile-Ge­ sundheitsinforma­ tion Pflege­ service Gesundheits­asso­ziierte Dienstleister OnlineCommu­ nities acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Literatur. Appelrath, H.-J.; Thoben, W.: Beiträge der Informatik für eine Gesundheitsversorgung der Zukunft. Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie (2004) 3, S. 179-187 de Lusignan, S.; Wells, S.; Johnson, P.; Meredith,K.; Leatham, E.: Compliance and effectiveness of 1 years‘s home telemonitor- ­ ing. The report of a pilot study of patients with chronic heart failure. European Journal of Heart Failure (2001) 6, S. 723-730 Demiris, G. (Hrsg.): E-Health: Current Status And Future Trends (Studies in Health Technology and Informatics) Ios Pr Inc 2004 Eysenbach, G.: Internet: its significance in the prevention, delivery of health care and evidence-based medicine. WorkGroup Cybermedicine. DMW (1999) 124, S. 1404-1405 Ferguson, T.; Frydman, G. : The first generation of e-patients. BMJ 328 (2004) S. 1148-1149 Ford, P.: Is the Internet Changing the Relationship Between Consumer and Practitioners? Journal for Healthcare Quality 22 (2000) 5, S. 1-3 Gerber, B. S.; Eiser, A. R.: The Patient-Physician Relationship in the Internet Age: Future Prospects and the Research Agenda. J Med Internet Res 3 (2001) 2, S. e15 Grätzel von Grätz, P. (Hrsg.): Vernetzte Medizin (Telepolis). Heise Verlag, Hannover 2004 Grönemeyer, D.H.W.: Med. in Deutschland. ABW Wissenschaftsverlag 2001 Haux, R.; Ammenwerth, E.; Herzog, W.; Knaup, P.: Health care in the information society. A prognosis for the year 2013. Int J Med Inf. (2002) 66, S. 3-21 Jähn, K.: Who Chats with the E-Patients? Providing Professio­nal Help in Newsgroups (abstract). Eur J Med Res (2002) 7 (Suppl. I), S. 35-36 Jähn, K.; Gärtig-Daugs, A.; Nagel, E.: Electronic Health Records within Integrated Care in Germany. Perspective. Telemed J e-Health 11 (2005) 2, S. 23-27 Jähn, K.; Mayer, J.: e-Patient Relations. Eine Online-Umfrage zu sexualmedizin.de. In: Badenhoop, R.; Ryf, B. (Hrsg.): Patient Relationship Ma- nagement. Cap Gemini Ernst & Young, Betriebswirtschaftli- cher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2001 Jähn, K.; Nagel, E. (Hrsg.): e-Health. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York 2004 Jähn, K.; Reiher, M.: IuK in bayerischen Krankenhäusern: Von Insellösungen bis zu Blended Healthcare. In: Jäckel, A. (Hrsg.): Telemedizinführer 2005, 6. Ausgabe, Minerva KG, Wiesbaden, S. 101-105 Jähn, K.; Reiher, M.; Nagel, E.: All digital? Perspektiven der ICT-Technologien im Krankenhaus. In: Egli, M. (Hrsg.): e-Healthcare Kompendium der Schweiz 2004, Trend Care AG Sursee 2004 69 Beiträge: Eckhard Nagel, Karl Jähn Jähn, K.; Reiher, M.; Stuhl, T.: Telemedical projects in Bavaria – what is the current position and what needs to be done? CARS 2005, Computer Assisted Radiology and Surgery. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2005 Lymberis, A.; Olsson, S.: Intelligent Biomedical Clothing for Personal Health and Disease Management: State of the Art and Future Vision. Telemedicine Journal and e-Health 9 (2003) 4, S. 379-386 Lymberis, A.; de Rossi, D. (Hrsg.): Wearable e-Health Systems For Personalised Health Manage- ment: State Of The Art and Future Challenges (Studies in Health Technology and Informatics) O C S L Press 2004 Mendonca, E. A.; Chen, E. S.; Stetson, P. D.; McKnight, L. K.; Lei, J.; Cimino, J. J.: Approach to mobile information and communication for health care. Int J Med Inf. (2004) 73, S. 631-638 Niederlag, W.: Szenario II: Tele Home Care und Telemonitoring. In: Niederlag, W.; Lemke, H. U.; Bondolfi, A.; Rienhoff, O. (Hrsg.): Health Academy – Ethik & Informationstechnik am Beispiel der Telemedizin, S. 20-26, Dresden, Health Academy, 2003 Podichetty, V.; Penn, D.: The progressive roles of electronic medicine: benefits, and costs. The American journal of the medical sciences (2004) 328, S. 94-99 Rienhoff, O.: Smart cards in health services. ZaeFQ (2001) 95, S. 642-646 70 Scheibler, F.; Janßen, C.; Pfaff, H.: Shared decision making: Ein Übersichtsartikel über die inter- nationale Forschungsliteratur. Soz.-Präventivmed. (2003) 48, S. 11-24 Sicurello F., Nicolosi A.: Telematics and Smart Cards in Integrated Health Information System. Paper presented at the Medical Informatics Europe ‘97, Amsterdam. Stone, A. A.; Shiffman, S.; Schwartz, J. E.; Broderick, J. E.; Hufford, M. R.: Patient compliance with paper and electronic diaries. Controlled Clinical Trials (2003) 24, S. 182-199 Ueckert, F.; Goerz, M.; Ataian, M.; Tessmann, S.; Prokosch, H. U.: Empowerment of patients and communication with health care professionals through an electronic health record. Int J Med Inf. (2003) 70, S. 99-108 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 71 Beiträge: Klaus-Dirk Henke > Finanzierbarkeit deS medizinisch-technischen Fortschrit ts. > Klaus-Dirk Henke Zur Ausgangslage: Fragen der Finanzierung des medizinischen und des medizinisch-technischen Fortschritts werden selten gestellt und dann meist nur am Rande behandelt. Der Fortschritt wird als Finanzierungsgegenstand bisher kaum thematisiert [1]. Dabei zählt der technische Fortschritt neben dem Faktor Arbeit und dem Faktor Kapital zu den wichtigsten Bestimmungsgrößen des Wirtschaftswachstums, das in Deutschland bedauerlicherweise derzeit sehr gering ausfällt. Seine Bestimmungsfaktoren stehen unter Hinweis auf die Inventionen, Innovationen und Imitationen als die drei Stufen des technischen Fortschritts im Mittelpunkt der wachstums­ politischen Auseinandersetzung. 72 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 In aller Regel wird in diesem Ziel-Mittel-Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer öffentlichen Grundlagenforschung (zum Beispiel Universitäten, Forschungsinstitute) hingewiesen. Auch öffentliche Ausgaben für private Forschung und Entwicklung sowie Entwicklungsaufträge für besonders risikoreiche Investitionen durch den Staat in Form einer zeitlich befristeten Anschubfinanzierung sowie Steuervergünstigungen gehören zur finanzpolitischen Förderung des als wünschenswert angesehenen technischen Fortschritts [2]. Günstige Rahmenbedingungen (zum Beispiel Patentschutz) für Erfindungen und Rationalisierungen gehören schließlich zusammen mit branchenübergreifenden finanziellen Anreizen zur indirekten Förderung durch die öffentliche Hand. Dieser bereits im Lager der Gesundheitsökonomen nicht unumstrittenen Position [6] steht gegenüber, dass von den Ingenieuren und Vertretern der Medizinproduktehersteller mit Nachdruck darauf hingewiesen wird, dass die Medizintechnik einen nur sehr kleinen Anteil an den Ausgaben im Gesundheitswesen ausmacht. So betrug etwa der Umsatz der deutschen Medizintechnik im Jahr 2003 12,54 Mrd. € Unter Vernachlässigung des leichten Export­ überschusses der Branche ergab sich 2003 damit ein Anteil der Medizintechnik an den Gesamtausgaben im Gesundheitswesen (€ 239,70 Mrd.) von etwa 5 Prozent [7]. Ganz unabhängig von diesem Hintergrund des notwendigen gesamtwirtschaftlichen Wachstums gilt bei vielen Gesundheitsökonomen der medizinisch-technische Fortschritt als wichtigster Bestimmungsfaktor der Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen. Dieser Fortschritt in Form der Innovationen in der Medizintechnik und bei den Herstellern von Medikalprodukten wird dort weniger im Zusammenhang mit dem Standort Deutschland gesehen und auch nicht als potenzieller Wachstumsmarkt in ­einer Dienstleistungsgesellschaft erkannt, sondern vornehmlich als kritischer Hinweis auf die stets zu hohen Gesundheitsausgaben betrachtet. Im Vergleich zur demographischen Entwicklung wird der medizinisch-technische Fortschritt als der Hauptkostentreiber isoliert [3, 4], ohne überhaupt alle Faktoren in die Ausgabenentwicklung einzubeziehen, die sie bestimmen [5]. 73 Beiträge: Klaus-Dirk Henke Der Finanzierungsgegenstand Wie schwierig eine Aufklärung dieser Ausgangslage ist, zeigt bereits ein Blick auf den Finanzierungsgegenstand. Diejenigen, die das Gesundheitswesen nur als einen Hort der Gesetzlichen Sozialversicherung mit ihren gesundheitsrelevanten Bereichen kurative Behandlung, Rehabilitation, Pflege und Prävention ansehen, erkennen nur in den öffentlichen Gesundheitsausgaben den Finanzierungsgegenstand, der in Deutschland weit überwiegend aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen bezahlt wird. Die im Jahre 1977 eingeführte Beitragssatzstabilität in der Gesetzlichen Krankenversicherung gilt als politischer Preis, der ähnlich wie der Beitragssatz in der Rentenversicherung stabilisiert werden soll. Obwohl es eine schillernde Zielgröße ist, die im Zeitvergleich zumindest um die sich ändernden Abgrenzungen der Gesundheitsleistungen und der Beitragseinnahmen bereinigt werden müsste, steht der Beitragssatz wegen seiner arbeitsmarktpolitischen Bedeutung noch immer im Mittelpunkt der Gesundheitspolitik. Trennt man sich von dieser Perspektive, die in der Krankenversorgung und gesundheitlichen Betreuung der Bevölkerung immer nur einen Kostenfaktor sieht, zu Gunsten einer Betrachtung, die das Gesundheitswesen in einer Dienstleistungsgesellschaft als personalintensive Wachstumsbranche erkennt [8], so öffnet sich das Bild für einen Finanzierungsgegenstand, der nicht auf die bestehenden Gesundheitsausgaben in der Sozialversicherung mit ihrer starken Pfadabhängigkeit fixiert ist. Bild 1 ist das bunte Spektrum der Biomedizintechnik zu ent­ nehmen, das eindrucksvoll zeigt, welche Vielzahl und Vielfalt es allein aus dieser Perspektive gibt. Folgt man darüber hinaus den Kondratieff-Zyklen, so zeigt sich ein gänzlich anderes Bild des Finanzierungsgegenstands. Kondratieff und auch Schumpeter haben als erste die Theorie der langen Wellen thematisiert und neue Basistechnologien und den Prozess ihrer Verbreitung in den Vordergrund gestellt. Kondratieff hat vor knapp 80 Jahren die Überlagerung kurzfristiger und eher konjunktureller Schwankungen durch längerfristige Wellen von 40 bis 70 Jahren erkannt. Durch sie ändern sich die Wertschöpfungsketten, die Strukturwandel, Beschäftigung und Wachstum auslösen [9]. 1) Das bunte Spektrum der Medizintechnik Bedarf & Verbrauch besonderer Einrichtungen Pflaster, OP-Einrichtungen Diagnosesysteme EEG, EKG, Monitoring, Lungendiagnose, Schlafdiagnose Diagnostika & Labor Hämatologie, Immunologie, DNA-Chips, Lab-on-Chip Bildgebende Systeme Röntgen, CT, MRT, Ultraschall, SPECT, PET, molek. Bildgebung Hygiene & Sicherheit Hygiene, Sterilisation, Dosi­ metrie & Strahlenschutz, Sicherheit, Gerätemanagement, Katheter Chirurgie & Intervention Chirurgische Systeme, Anäs­ thesie, minimal-invasive Interventionen e-Health & Software Elektronische Patientenakte, Telemedizin Dienstleistung & Medizintechnik Workflow-Management, ­Disease-Management 74 Medizintechnik für besondere Disziplinen Audiologie, Ophtalmologie, Zahnmedizin, Rettung & Not­fall Therapie-Systeme Beatmung & Inhalation, Dialyse & Apherese, Injektion & Infusion, Ultraschalltherapie, Physiotherapie Implantate Aktive Implantate, passive Implantate Strahlentherapie Gammastrahlen, Kerne Zell- und Gewebetechnik Zelltherapie, Gewebestücke, künstliche Organe Hilfen für Behinderte Prothesen, Rollstühle 2) Gesundheit als sechster Kondratieff-Zyklus [10] Dampf­ maschine Stahl, Eisenbahn Chemie, ­ E-Technik Kunststoffe, Automobil Informa­tions­technik Gesundheit Rehabilitation 1. Zyklus 1800 Textilien Kleidung 2. Zyklus 1850 Transport 3. Zyklus 1900 Massen­ konsum 4. Zyklus 1950 Individuelle Mobilität 5. Zyklus 2000 Umgang mit Wissen 6. Zyklus 2050 Biotechnologie Med.tec., etc. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Dieses Auf und Ab wird durch immer neue Basistechnologien geprägt, die sich nach Nefiodow [10] über die letzten 250 Jahre identifizieren lassen (Bild 2). In dem neuen Zyklus stehen die „Lebenswissenschaften“ im Vordergrund. Dazu gehört auch die Gesundheit. Damit verbunden wird es neue Gesundheitstechnologien geben, also neue Produkte, Verfahren und Dienstleis­tungen, die zur Systemerneuerung durch andersartige und innovative Wertschöpfungsketten führen werden. Angesichts der demogra­ phischen Herausforderung geht es auch um die Wellness- und Fit­ness-Industrie, deren Ausgaben mit der Grundversorgung einer gesetzlich verfügten Krankenversicherung sicherlich nicht abdeckbar sind. Der private Konsum von gesundheitsfördernden Produkten (zum Beispiel Ernährung) und Dienstleistungen (zum Beispiel Fitnesszentren) tritt mehr und mehr in den Vordergrund eines nachhaltigen Strukturwandels, der gleichermaßen von der Nachfrage- und Angebotsseite neuer Märkte induziert wird. Aus Bild 3 sind die konsumnahen Anwendungsfelder zu entnehmen. Dabei stellt sich die Frage, ob es sich um jeweils einen Nachfragesog handelt, oder ob es Technologieanstöße sind, die von der Angebotsseite ausgehen und durch den medizinisch-technischen Fortschritt induziert werden. 3) Beispiele für konsumnahe Anwendungsfelder Das Bild 3 mit den konsumnahen Anwendungsfeldern macht deutlich, dass sich eine immer stärker werdende Trennung des „medizinisch Machbaren“ von dem in einer Pflichtversicherung „nicht mehr Finanzierbaren“ abzeichnet. Durch Forschung und Entwicklung wird es immer neue Gesundheitstechnologien in Form von Produkt-, Prozess- und Systeminnovationen geben. Die insbesondere altersbedingte Nachfrage führt angesichts der „Fortschrittsfalle der Medizin“ zu weiter steigenden Umsätzen. Und die Gesellschaft wird lernen müssen, dass dies eine wünschenswerte und positive Entwicklung ist, die in Deutschland noch immer stark durch die Art der Finanzierung behindert wird. Gesundheitsund Arbeitsmarktpolitik sind über die Lohnnebenkosten zu eng miteinander verbunden. Ein erstes Zwischenfazit zur Finanzierung lautet vor diesem Hintergrund, dass es auf Grund der demographischen Herausforderung und des medizinisch-technischen Fortschritts keine Patentrezepte gibt. Die Gesellschaft braucht angesichts der absehbaren demographischen Entwicklung „mehr Babies“ und damit auch mehr Steuer- und Beitragzahler, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, eine Teilkapitalbildung als demographieresistente Finanzierungsform und höhere Beiträge der älteren Menschen in Zeiten einer Stagnation, die sich hoffentlich nicht durch die älter werdende Bevölkerung noch verstärkt. 4) Zukünftige äußere und innere Finanzierung im bestehenden Umfeld (Freizeit-) Sportmedizinische Diagnostik (Wellness, Fitness) Ästhetische Zahnheilkunde, Prothetik, Implantate Regelmäßige Check-ups, elektronisches (Selbst- und Fremd-) Gesundheitsmonitoring, Online-Erfassung von Vitalparametern „Home Care for the Elderly“ Integrierte Versorgung / Versorgungsnetze auf der Grundlage des § 140 a-e SGB V Plastisch-Ästhetische Chirurgie und Refraktionschirurgie Grundlagenforschung (auch als Nebeneffekt der Wehrtechnik, Rüstungs- und Weltraumforschung) Wagniskapital/Gründerfonds für kleinere Technologieunternehmen Collective risk taking (zeitlich befristete öffentliche Anschub- bzw. Anstoßfinanzierung) Netzbudgets, Leistungskomplexhonorierung und Fallpauschalen in der integrierten Versorgung (nach § 140 a-e SGB V) Medizinische Versorgungszentren In-Vitro-Fertilisation (bei ungewollter Kinderlosigkeit) 75 Beiträge: Klaus-Dirk Henke Zukünftige äussere und innere Finanzierung Lässt man an dieser Stelle einmal die Diskussion über die Bürgerversicherung (richtiger: Bürgersteuer) und die Kopfprämie (richtiger: Bürgerversicherung) beiseite [11, 12] und betrachtet die derzeitige Realität, so ergibt sich die in Bild 4 wiedergegebene Situation, wobei die Möglichkeiten der integrierten Versorgung nach § 140 a-e SGB V auf absehbare Zeit im Vordergrund stehen werden [13]. Dazu gehört die Vernetzung von Herstellern über das Klinikum zum Patienten mit Hilfe der Datenbanken und Internet-Technologie ebenso von Teleportalkliniken als regionale Gesundheitszentren im Rahmen einer gesetzlichen Rundumversorgung. Vielleicht gibt es in dieser Entwicklung so etwas wie eine Effizienzrevolution bzw. Innovationseffizienz, so dass sich der technische Fortschritt selbst finanziert. Mit Hilfe von Bild 5 lässt sich eine solche Perspektive zumindest grafisch und stark vereinfacht an Hand des Wirtschaftlichkeitsprinzips im Gesundheitswesen zeigen. Durch den technischen Fortschritt ergeben sich neue Produktionsfunktionen, die es erlauben, ein gleiches Ergebnis – im Bild idealtypisch als Lebenserwartung bezeichnet – mit weniger Mitteln, zum Beispiel Gesundheitsausgaben, zu verwirklichen. Die freigesetzten Ressourcen können anderweitig verwendet werden. Zumindest bei dieser Betrachtung ergibt sich ein sich selbst finanzierender Fortschritt. Bei der Umsetzung der Innovationen, also des technischen Fortschritts, sind vielleicht Mediziningenieure erforderlich, beispielsweise in den entstehenden Versorgungszentren, um den technologischen Innovationsdruck patientenfreundlich umzusetzen. Dass mehr Marktwirtschaft und mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen in diesem Kontext erforderlich sind, ergibt sich bereits aus der Gesetzeslage des GKV-Modernisierungsgesetzes vom 01.01.2004, das im Rahmen einer partiell großen politischen Koalition parteiübergreifend auf absehbare Zeit als Grundlage der Gesundheitspolitik in Deutschland anzusehen ist. Dazu zählt eine stärker ziel- und ergebnisorientierte Krankheitsbekämpfung. Die Qualität wird dabei zu einem der wichtigsten Parameter des Wettbewerbs. Verbraucheraufklärung, Mündigkeit, Transparenz sowie Wahlmöglichkeiten in der Prävention [14, 15], kurative Behandlung, Rehabilitation und Pflege, also die vier Säulen unseres Gesundheitswesens, sind mehr als nur Schlagworte der sich verändernden Gesundheitswelt. 5) Das Wirtschaftlichkeitsprinzip und medizinisch-technischer Fortschritt Lebenserwartung X2 E C X1 Neue Situation in C und in E (z. B. durch medizinisch-tech­nischen Fortschritt) Ausgangssituation B B F Gesundheitsausgaben 76 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Weitere Voraussetzungen für die Finanzierbarkeit des Fortschritts Ein sich selbst tragendes Wirtschaftswachstum braucht ein Innovationsklima bzw. ein entsprechendes Innovationsmilieu und dazu Schumpetersche Pionierunternehmer im Gesundheitswesen. Die gesundheitswissenschaftliche Forschung und Entwicklung benötigt hierzu Innovationsschübe und Ideen für neue von Visionen geleitete Gesundheitstechnologien. Das in Berlin neu gegründete Zentrum für innovative Gesundheitstechnologie (ZiG) an der TU will zu einem solchen Klima zwischen Forschung und Praxis mit Ingenieuren, Ärzten, Krankenhäusern und Ökonomen in der Gesundheitsmetropole Berlin beitragen. Neben den aus Bild 6 zu entnehmenden „Heimatkompetenzen“ des im Oktober 2004 gegründeten Zentrums bietet es eine Kompetenzplattform für den Wachstumsmarkt Gesundheit nicht nur für den Raum Berlin/Brandenburg [16, 17]. Zu den Heimatkompetenzen kommen derzeit vor allem folgende fünf Querschnittsthemen, die interdisziplinär bearbeitet werden: Das acatech Symposium „Wachstum durch innovative Gesundheitstechnologien“ trägt dazu bei, dass das erforderliche Klima für Innovation und Wachstum in unserer Dienstleistungsgesellschaft gefördert, weiterentwickelt und gepflegt wird. Die äußere und innere Finanzierung folgt dann mehr oder weniger den innovativen Leistungen in Prävention, kurativer Behandlung, Rehabilitation und Pflege. ❙ digitalisierte integrierte bürgernahe Versorgung, ❙ innovatives Gesundheitsmonitoring, ❙ Industrialisierung der Aufbereitung von Medizinprodukten, ❙ digitaler OP und intensivmedizinische Versorgung sowie ❙ Finanzierbarkeit des medizinisch-technischen Fortschritts. 6) Das Zentrum für innovative Gesundheitstechnologie (ZiG) Gesundheits­ wirtschaft Digitales Krankenhaus ZiG e-Health Innova­ tive me­­di­zi­nische Techno­lo­gien Werkstoffe im Zell­ kontakt 77 Beiträge: Klaus-Dirk Henke > Literatur. [1] Gutachten des Bundesministeriums für Bil­dung und ­Forschung (BMBF): Zur Situation der Medizintechnik in Deutschland im internationalen Vergleich. Berlin, 2005 [2] Zimmermann, H.; Henke, K.-D.: Finanzwissenschaft. Eine Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft. 8. Aufl. München 2001, S. 394ff. [3] Wille, E.: Reformoptionen der Beitragsgestaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung. In: Gesundheit und Gesellschaft, G+G Wissenschaft, das Wissenschaftsforum in Gesundheit und Gesellschaft, 2 (2002) 3, S. 7-14 [4] Glied, S.: Health care costs: on the rise again. Journal of Economic Perspectives 17 (2003) 2, S. 125-148 [5] Henke, K.-D.; Schreyögg, J.: Towards sustainable health care systems. Strategies in health insurance schemes in France, Germany, Japan and the Netherlands (2004), S. 29-40 78 [6] Krämer, W.: Hippokrates und Sisyphus. Die moderne Medizin als Opfer ­ihres eigenen Erfolges. In: Kirch, W.; Kliemt, H. (Hrsg.): Rationierung im Gesundheits­- wesen. Regensburg 1996, S. 7-19 [7] Statisches Bundesamt: Gesundheitsberichterstattung, http://www.destatis.de/ basis/d/gesu/gesutab4.php, Abrufdatum 18.06.2005 Industrieverband Spectaris: Branchenbericht 2004, Köln, S. 30 [8] Henke, K.-D; Mackenthun, B.; Schreyögg, J.: Gesundheitswesen als Wachstumsfaktor. In: Forum der Bundesstatistik, Ökonomische Leistungsfähigkeit Deutschlands, Band 44, Statistisches Bundesamt, 2004, S. 114-126 [9] Nienhaus, V.: Strukturpolitik. In: Bender, D.; et al. (Hrsg.): Vahlens Kompendium der Wirt- schaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Bd. 2, 8. Aufl., München 2003, S. 460 f. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 [10] Nefiodow, L. A.: Wirtschaftslokomotive Gesundheit. Conturen (1999) 4, S. 28-35 [11] Henke, K.-D.: Was ist uns die Gesundheit wert? Probleme der nächsten Gesundheitsreformen und ihre Lösungsansätze. In: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Schriften des Vereins für Sozialpolitik 6 (2005)1, S. 95-111 [12] Henke, K.-D.: Plädoyer für die Kopfprämie. In: Universitas – Orientierung in der Wissenschaft59 (2004) 691, S. 23-29 [15] Stuppardt, R.: Von der kurativen zur präventiven Medizin, Neuausrichtung der Gesundheitssicherung. In: Zeitschrift Soziale Sicherheit (2001) 8-9, S. 1-7 [16] „Menschen sind keine Maschinen“. In: Tagesspiegel vom 17. April 2005 [17] „Vivantes lockt Niedergelassene“. In: KMA – Das Magazin für Gesundheitswirtschaft (2005) Ausgabe Juni, S. 34 [13] Henke, K.-D.; Friesdorf, W.; Marsolek, I.: Genossenschaften als Chance für die Entwicklung der integ­ rierten Versorgung im Gesundheitswesen. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (Hrsg.), Berlin 2004 [14] Henke, K.-D.: Kosten, Nutzen, Evaluation und Finanzierung von Prävention: Wirtschaftlicher Nutzen und Evaluationsprobleme eines ­Präventionsgesetzes. Manuskript in Druck (2005) 79 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Fragen aus der Diskussion. > Patrick Illinger > 04 Fragen aus der Diskussion > Fragen aus der Diskussion. > Patrick Illinger Medizintechnik könnte besonders in ­Deutschland in mehrfacher Hinsicht als spannender und nachhaltiger Innovationsmotor dienen. Dass die Forschung und die Industrie in ­diesem Land dieses Technologiefeld für sich ent­­decken, ist aus zwei Gründen sinnvoll: Zum einen sind die Wachstumsraten auf ­ diesem Gebiet ermunternd und das Durchschnittsalter der Menschen steigt. Zum anderen ist die Beschäftigung mit Medi­ zintechnik schlicht und einfach sympathisch. Dieses Thema dürfte allgemein eine höhere Akzeptanz erfahren als beispielsweise die Entwicklung und der Vertrieb von Waffen. Eine wichtige Fest­ stellung aus den Vorträgen des Symposiums war jedoch, dass Deutschland, was die Umsatzzahlen im Bereich der Medizin­technik betrifft, die international üblichen Wachstumsraten noch nicht erreicht hat. 82 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Aus den Vorträgen am Vormittag des Symposiums vom 26. April 2005 hat sich eine Reihe von Fragen ergeben, die in einer Diskussionsrunde mit den Referenten angesprochen werden konnten. Der erste Punkt betrifft die „Bodenhaftung“ der Forscher und Entwickler. Inwieweit sind die Ingenieure von heute verpflichtet, ihre Arbeit in einen gesellschaftlichen Kontext einzubetten? Nach Ansicht von Prof. Spur haben sich der Status und die Arbeitsweise eines modernen Ingenieurs gegenüber dem „Fabrikbeamten“ von einst massiv geändert. Dezentralisierung und flache Hierar­chien hätten zu einem Zustand geführt, in dem die Innovationskraft „aus der Gemeinschaft der Wissenden“ kommt. Hinzu komme, dass die Bevölkerung heute mehr als früher als Kunde verstanden werden muss. Das Verständnis für diese nicht rein technisch gefärbte Interaktion müssten Ingenieure aber noch stärker bereits in der Ausbildung vermittelt bekommen. Prof. Spur prägte in der Diskussion den Begriff der „Soziotechnik“. Nach den Vorträgen von Prof. Grönemeyer und Dr. Kolem kam die Frage auf, ob und inwieweit moderne bildgebende Verfahren nicht den Nachteil haben, eine Virtualität zwischen Arzt und Patient zu schaffen und möglicherweise entfremdend zu wirken. Inwieweit besteht die Gefahr, dass ein Arzt in der künstlichen Bilderwelt den unmittelbaren Blick für den Patienten verliert? Ist das einer der Gründe, warum beispielsweise noch immer meist eine invasive Koloskopie der virtuellen Koloskopie vorgezogen wird? Prof. Grönemeyer erklärte hierzu, dass es gerade in einem hochtechnisierten Umfeld unumgänglich sei, die Arzt-Patienten-Beziehung auf einer Ebene des menschlichen Umgangs zu erhalten und künftig sogar zu stärken. Technik dürfe hierbei nicht nur im Fließbandsystem eingesetzt werden. Wenn es jedoch gelänge, medizintechnische Innovation als heilenden Faktor erkennbar zu machen, könne der Vorteil sanfter Technologie gegenüber invasiven Verfahren mehr Akzeptanz erhalten. Womöglich könne die fortschreitende Technisierung dann sogar dazu beitragen, die unmittelbare Arzt-Patienten-Beziehung zu fördern. Diesen Aussagen stimmt auch Dr. Kolem zu: Der Alltag habe gezeigt, dass Diagnosen oft sogar besser werden, wenn Radiologen die Ergebnisse aus der Hochtechnologie mit den Patienten persönlich besprechen. 83 Fragen aus der Diskussion Der von Prof. Schmitz vorgetragene beeindruckende Fortschritt moderner Implantattechnik wirft die Frage nach den Grenzen des Machbaren auf: Wo ist das Ende? Welche Körperteile wird man nie durch eine Maschine ersetzen können? Schmitz verwies an dieser Stelle darauf, dass Voraussagen zufolge die heute geborenen Menschen gut 100 Jahre alt werden. Das spreche bereits für einen weiterhin steigenden Bedarf moderner Implantattechnik. Grundsätzlich lassen sich allerdings die Physik und die Werkstofftechnik nicht überlisten. Es werde zwar weitere Fortschritte geben, wichtig sei jedoch ein weiterer Punkt: Der Einsatz klassischer Implantattechnik hat noch lange nicht jene Breitenwirkung entfaltet, ab der man von einer Sättigung des Marktes sprechen könne. Im Nachgang zu dem Vortrag von Prof. Dössel ergab sich eine sehr grundsätzliche Frage, nämlich jene, wie es gelingen könnte, in der Bevölkerung eine marktwirtschaftlichere Einstellung zu medizinischen Leistungen zu erzeugen. Ein wenig erinnert die jetzige Situation an die unterschiedlichen Haltungen zu E-Mail und SMS: Für das eine (E-Mail) wäre man nicht bereit zu bezahlen, für das andere gibt man viel Geld aus, obwohl die technische Leistung viel geringer ist (SMS). Dössel erklärte hierzu, dass unmittelbar lebensbedrohende Krankheiten zu den weiterhin zu versichernden Leistungen gehören müssten. Das gelte nicht für jedes Schnupfenmittel, wohl aber für ein krankes Herz beispielsweise. In diesem Fall sei auch in Zukunft Hightech der Spitzenklasse anzuwenden. Er sehe im deutschen Gesundheitssystem zunächst noch ein Sparpotenzial von zirka 30 Prozent. Das solle erst abgeschöpft werden. Danach müsse man über die 50-50-Teilung der Krankenversicherung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern reden. Prof. Grönemeyer fügte an dieser Stelle ein, dass mehr Gespräche zwischen Arzt und Patient die Menschen motivieren könnten, selbst mehr für das eigene Wohlbefinden zu tun, siehe Rückenschmerzen. Er verwies darauf, dass die Deutschen im vergangenen Jahr 32 Milliarden Euro für Wellness-Produkte ausgaben. Wichtig sei das Verständnis dafür, dass Innovation sich nicht gegen den Patienten wendet, sondern ihn unterstützt. 84 Um die Frage der Akzeptanz ging es auch am Nachmittag des Symposiums, nachdem Prof. Spath das Prinzip der Gesundheitskarte erläuterte. Wie kann erreicht werden, dass die Bevölkerung nicht nur versteht, sondern verinnerlicht, dass zwischen einer Chipkarte und einer Papierakte sicherheitstechnisch kein Unterschied besteht? Lässt sich Datensicherheit auf diesem Niveau garantieren? Spath erklärte, das sei genauso technisch lösbar wie es bei Sparkonten, Girokonten und EC-Karten der Fall ist. Die Sicherheit sei kein technisches Problem, sondern nur abhängig von der gesellschaftlichen Willensbildung. Noch immer gebe es jedoch viele Missverständnisse in der Bevölkerung. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind öffentliche Feldversuche geplant. Was die vielfach zitierte Sicherheit der Daten auf der Karte betrifft, betonte Spath, dass die Karte nur als Zugangsschlüssel diene; die eigentlichen Daten befinden sich in einer sicheren technischen Infrastruktur. Wenn die Karte Schaden nimmt, kann man sie einfach austauschen. Prof. Klusen nannte in seinem Vortrag ein Beispiel für eine medizintechnische Innovation, die in der Anschaffung zunächst zwar teurer komme, in einer Gesamtkostenrechnung aber billiger sei. Das lasse sich an einem verbesserten Stent mit medikamentöser Beschichtung verdeutlichen. Der innovative Stent senke die Häufigkeit von Restenosen derart, dass er trotz seines Preises von rund 2.000 Euro gegenüber einem klassischen Stent von 300 Euro letztlich weniger Kosten verursache. Das sei jedoch ein besonders plakatives Beispiel. Insgesamt dürfe es nicht passieren, dass beispielsweise jedes kleine Krankenhaus den aufwändigsten Tomographen anschafft und dann Reihenuntersuchungen anstellt, die medizinisch nicht gerechtfertigt sind, aber Umsätze bringen. Man müsse allerdings auch mal alte Zweige abschneiden, damit neue wachsen. So habe beim Thema Brustkrebs der Einsatz von MRTUntersuchungen die Zahl der Mammografien bereits gesenkt. Die Krankenkassen müssten an dieser Diskussion beteiligt werden, und der Bundesausschuss müsse in manchen Bereichen seine restriktive Haltung lockern. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Nach den Ausführungen von Prof. Nagel kam es zu der Frage, in welchen Bereichen e-Health und Telemedizin besonders sinnvoll sind. Prof. Nagel nannte Schnellschnittuntersuchungen von Gewebe, beispielsweise während einer Operation. In diesem Fall sei es ausreichend, wenn es Zentralen gäbe, die digital übermittelte OP-Präparate aus der Ferne beurteilen. Kreiskrankenhäuser könnten so unmittelbaren Zugriff auf Expertenwissen erhalten. Grundsätzlich seien bildgebende Verfahren besonders geeignet für telemedizinische Anwendungen. Das Thema betreffe jedoch auch Patientendienste im Internet. Dort sei schwer unterscheidbar, wie gut das jeweilige Angebot ist. Selbsthilfegruppen könnten Vorteile haben, aber einige Informationsquellen, beispielsweise Überlebensraten für Krebserkrankungen, seien kritisch zu sehen. Grundsätzlich solle dem Internet in der Patientenunterstützung eine Lotsenfunktion zukommen. Nachdem Prof. Henke die Theorie der Kondratieff-Zyklen erläuterte und die Gesundheit nach dem Automobil und der Computertechnik als Wirtschaftsmotor für die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts einführte, ergab sich ein kritischer Einwand. Während den bisherigen Zyklen jeweils eine so genannte Killerapplikation (Ottomotor, Integrierter Schaltkreis) voranging, ist die Gesundheitstechnologie eher als Zusammenführung existierender Techniken zu sehen. Henke verwies darauf, dass der Wettbewerb künftig stärker in der Art der Leistungserbringung zu sehen sei. Ein befreiter Wettbewerb werde Innovation mehr beflügeln als die regulierten Strukturen von heute. Der von ihm prognostizierte Zyklus beziehe sich auf die gesamte Versorgung, inklusive Wellness und Prävention. Auch die Ökonomie des Alterns sei einzubeziehen. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang auch eine neue Beschäftigungswelle. Der Fortschritt könnte sich dann selbst finanzieren. Ob Medizintechnik in Deutschland letztlich zu einem Innovationsmotor und somit zu einer Stütze für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes werden kann, dürfte wesentlich davon abhängen, wie sich die Gesellschaft in Zukunft dem Thema Gesundheit stellt. Das seit vielen Jahren gelebte und gelernte System, bei dem medizinische Leistung und pharmazeutische Produkte scheinbar in unbegrenzter Fülle zur Verfügung stehen und über einen fixen monatlichen Kassenbeitrag abgegolten sind, wird nicht auf Dauer tragfähig sein. Es muss ein System gefunden werden, bei dem Gesundheit als ein Gut gesehen wird, das in Teilen aus eigener Kraft erlangt und erarbeitet werden muss. Dabei geht es nicht um ein bedingungsloses Zweiklassen-System. Akute, unmittelbar lebensbedrohliche Krankheiten müssen auch in Zukunft behandelt werden, ohne dass der soziale Status des Patienten eine Rolle spielt. Viele Heilmethoden und Pharmaprodukte jedoch, von denen manche die Grenze zum Wellness-Bereich berühren, können auf Dauer nicht von einem Solidarsystem getragen werden. Hier werden Patienten eine gewisse marktwirtschaftliche Dynamik akzeptieren müssen, so wie es beispielsweise beim Kauf von Nahrungsmitteln der Fall ist. Hinzu kommt, dass Ärzte konkret dafür belohnt werden müssen, dass ihre Patienten gesund bleiben, und nicht indirekt für das mitunter mehr Gewinn bringende Gegenteil. So gibt es beispielsweise in den USA Modellversuche, bei denen Ärzte, deren Patienten bestimmte Cholesterinwerte unterschreiten, gesonderte finanzielle Zuwendungen erhalten. Das aktuelle System in Deutschland, bei dem Kassen, Politiker, Ärzte und Patienten pausenlos über die Erstattung von Leistungen streiten, erzeugt jedenfalls kein positives Klima für Innovation. Nur wenn Bewegung in dieses Gefüge kommt, wenn Menschen begreifen, dass Vorbeugung und Heilung von Krankheiten unmittelbar mit dem eigenen Handeln gekoppelt ist, wird Medizintechnik zu einem lebendigen, akzeptierten und – wie gesagt – sympathischen Wirtschaftszweig. 85 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Impressionen vom acatech symposium. > 05 Impressionen 1) 2) 3) 4) Referenten und Moderator: 1) Olaf Dössel 2) Detlev Ganten 3) Dietrich Grönemeyer 4) Klaus-Dirk Henke 5) Patrick Illinger 6) Norbert Klusen 7) Heinrich Kolem 8) Joachim Milberg 9) Eckhard Nagel 10) Klaus-Peter Schmit z 11) Dieter Spath 12) Günter Spur Dietrich Grönemeyer und Peter Deuflhard. 88 5) 6) acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 7) 8) Reinhard Hüttl im Gespräch mit Franz Pischinger, 9) 10) 11) 12) Hermann Scholl, Joachim Milberg, Gerhard Zeidler und Roman Herzog. Günter Pritschow und Philipp Hartl. 89 Impressionen 1) Tagungsteilnehmer: 1) Carsten Schröder im Gespräch mit Ulrich Stottmeister 2) Joachim Hagenauer 3) Oliver Krause und Werner Borrmann 4) Günter Spur und Roman Herzog 5) Fred Robert Heiker im Gespräch mit Günther Wilke und Reinhard Hüttl 6) Bernd Hillemeier und Klaus-Peter Schmitz Günther Wilke und Rainer Seibel. 90 2) 3) acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 4) 5) Chairman Günter Spur mit Detlev Ganten. 6) Hartwig Höcker. 91 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > acatech Portrait. > 06 acatech Portrait > Stimmen Für die TechnikWissenschaften. Das Profil Die Ziele acatech steht für die Symbiose von Akademie und Technik. Der gemeinnützige Verein „acatech – Konvent für Technikwissenschaften der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften“ wurde im Februar 2002 gegründet. Erstmalig sind damit die technikwissenschaftlichen Aktivitäten der sieben – bisher weitgehend regional orientierten – Akademien der Wissenschaften in Deutschland unter einem nationalen Dach vereint. Als länderübergreifende, selbständige und unabhängige Institution vertritt acatech die deutschen Akademien in allen technikwissenschaftlichen Belangen im In- und Ausland. acatech versteht sich als Forum für die unabhängige Beleuchtung technikwissenschaftlicher Fragen vor gesellschaftspolitischem Hintergrund. Zu den Mitgliedern zählen herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Getragen von der Reputation und Unabhängigkeit seiner Mitglieder will acatech seine Leitbildfunktion für den Standort Deutschland wahrnehmen. Technikwissenschaften können in der Zusammenarbeit mit den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften weltweit technische, ökonomische, ökologische und soziale Probleme lösen helfen. Technische Innovationen sind Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum, die hervorragende Ausbildung von Ingenieu­ren ist eine notwendige Bedingung für die Prosperität unserer Volkswirtschaft. Diese Zusammenhänge sind noch immer zu wenig bekannt in der Öffentlichkeit. Die Vision acatech will einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland mit seiner technologischen Leistungsfähigkeit auch weiterhin zur Weltspitze zählt. Technikwissenschaften sollen als Treiber für Innovation und nachhaltiges Wachstum in Deutschland breite Anerkennung finden. Sie sind Schlüsselfaktoren für die Standort- und Zukunftssicherung. Diese gesellschaftspolitische Relevanz der Technikwissenschaften möchten wir im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit verankern. 94 acatech will durch den Dialog über wissenschaftliche und nationale Grenzen hinweg die Bedeutung von zukunftsweisenden Technologien verdeutlichen und eine Brücke schlagen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ziel ist es, Wissen und Vertrauen zu schaffen, um innovatives Wachstum voranzutreiben. acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Die Aufgaben Die Präsenz acatech versteht sich als Arbeitsakademie. Dezentrale Arbeitskreise, die sich aus Mitgliedern und externen Fachwissenschaftlern zusammensetzen, behandeln Schwerpunktthemen ebenso wie die Zukunft technikwissenschaftlicher Ausbildung und Forschung. acatech ist die gemeinsame nationale Stimme der Technik­ wissenschaften auf der Ebene der Akademien der Wissenschaften in Deutschland. acatech hat den Anspruch, die unabhängige und anerkannte Institution zu werden, die für die Interessen der Technikwissenschaften – auch international – eintritt. Mit Symposien, Foren und Workshops schafft acatech Räume für die fachwissenschaftliche Diskussion. Mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen will acatech die Öffentlichkeit informieren und ein Forum für die kritische Erörterung technikwissenschaftlicher Fragen im gesellschaftspolitischen Kontext bieten. Insgesamt arbeiten sieben Arbeitskreise, um Wege zur Verbesserung der Innovationsfähigkeit in Deutschland zu finden. Die drei Arbeitskreise ❚ Technikwissenschaften und Innovation ❚ Ingenieurausbildung und ❚ Forschung widmen sich Fragen der Forschung und Ausbildung in den Technikwissenschaften. Die vier Arbeitskreise ❚ Mobilität ❚ Lebenswissenschaften ❚ Umwelt und Energie und ❚ Kommunikationstechnik und Wissensmanagement beschäftigen sich mit Sachthemen der Technikwissenschaften, um Möglichkeiten für innovatives Wachstum in ihren jeweiligen Feldern auszuloten. acatech bietet ein offenes Forum für die gezielte und kritische Erörterung technikwissenschaftlicher Fragen im gesellschaftspolitischen Kontext. Der Konvent führt interdisziplinäre Projekte zu technikwissenschaftlichen Fragestellungen durch, initiiert und organisiert Veranstaltungen und beteiligt sich an Initiativen, Projekten und Veranstaltungen von Kooperationspartnern. Die Ergebnisse der Arbeit von acatech werden in Tagungsbänden, Projektberichten und Stellungnahmen veröffentlicht. DIE STRUKTUR acatech wird durch drei Organe repräsentiert: ❚ Mitgliederversammlung ❚ Vorstand ❚ Senat acatech zählt aktuell 215 Mitglieder aus den Akademien der Wissenschaften, Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, der Joachim Milberg zum Präsidenten bestimmt hat. Die inhaltliche Ausrichtung wird von einem Senat begleitet, dessen Vorsitz Bundespräsident a. D. Roman Herzog übernommen hat. 95 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > Teilnehmer. > 07 Teilnehmerliste > Teilnehmerliste. Insgesamt kamen 143 Teilnehmer zum acatech Symposium in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Lfd. NrVorname 1 Kathrin Nachname Institution Adlkofer Science Agentur GmbH Charité – Universitätsmedizin 2 Klaus Affeld Berlin Laser- und Medizin- 3 Hansjörg Albrecht Technologie GmbH 4 Jürgen Allinger acatech 5 Rainer Bayer Universität Düsseldorf SPECTARIS e. V. 6 Sven Behrens 7 Peter Berlien 8 Werner A. Borrmann 9 Wilfried Brauer A.T. Kearney 10 Werner A. Bröcker DFG 11 Tilmann Bur HAEMONETICS GmbH 12 Felix Colsman The Boston Consulting Group 13 Peter Deuflhard Konrad Zuse Zentrum für Infor- mationstechnik Berlin 14 Olaf Dössel Universität Karlsruhe 15 Robert Downes geterned Medizin- und Infor- mationstechnik AG 16 Norbert Dubbert acatech 17 Heinz Duddeck TU Braunschweig 18 Karl Joachim Ebeling Universität Ulm 19 Uwe Eckardt InnoMed e. V. – Netzwerk für 98 Norgenta Norddeutsche Life 20 Andreas Eckert Neuromedizintechnik Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG TU Berlin 21 Marco Eisenberg 22 Helmut Ermert Ruhr-Universität Bochum 23 Walter Eversheim RWTH Aachen 24 Klaus Faber 25 Roland Felix Charité – Universitätsmedizin Berlin Fraunhofer Institut (IPK) 26 Yetvart Ficiciyan 27 Wolfgang Förster 28 Wolfgang Friesdorf TU Berlin 29 Detlev Ganten Charité – Universitätsmedizin Berlin BMW Group 30 Richard Gaul acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Lfd. NrVorname Nachname Institution 31 Christine Gernat BBB Management GmbH 32 Dietrich H. W. Grönemeyer Universität Witten/Herdecke 33 K. H. Grote Universität Magdeburg 34 Rudolf F. Guthoff 35 Joachim Hagenauer TU München 36 Peter Hahn VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 37 Philipp Hartl Universität Stuttgart 38 Karl Hartmann Berlin-Brandenburgische Fortbildungsakademie MEDIPAN GmbH 39 Reinhold Hartwig 40 Marion Haß IHK zu Berlin 41 Uwe-Frithjof Haustein Sächsische Akademie der Wissenschaften 42 Bayer Innovation GmbH Fred Robert Heiker 43 Klaus-Dirk Henke TU Berlin 44 Roman Herzog Bundespräsident a. D. 45 Monika Hey 46 Bernd Hillemeier acatech 47 Hartwig Höcker acatech 48 Tobias Hoffmann acatech 49 Thomas Hopfe 50 Jens Hörner 51 Monika Huber TU Berlin 52 Rainer Hupe hp.komm 53 Reinhard Hüttl acatech 54 Patrick Illinger Süddeutsche Zeitung 55 Karl Jähn Universität Bayreuth 56 Rainer Jäkel Bundesministerium für Wirt- schaft und Arbeit 57 Jakobs RWTH Aachen Universität Jena Eva-Maria 58 Werner A. Kaiser 59 Hartmut Keller 60 Meike Keller 61 Heribert Kentenich DRK Kliniken Westend 62 Ulrich Kertzscher Charité – Universitätsmedizin Berlin Heidelberger Druckmaschinen 63 Helmut Kipphan AG 64 Matthias Kleiner Universität Dortmund 65 Norbert Klusen Techniker Krankenkasse 66 Frank Kniep Somatex Medical Technologies GmbH 67 Steffen Koch Fraunhofer Institut (IAO) 68 Heinrich Kolem Siemens AG 69 Reiner Kopp acatech 99 Teilnehmerliste Lfd. NrVorname Nachname Institution 70 Marc Kraft TU Berlin 71 Oliver Krause Fraunhofer IPK 72 Rainer Krause Kastner-Praxisbedarf GmbH 73 Gerhard Krüger Universität Karlsruhe 74 Klaudia Kunze acatech 75 Adelheid Lanz St. Josefshaus Krankenhaus Potsdam 76 Sigrid Lauff VVA Health Marketing GmbH 77 Heinz U. Lemke TU Berlin 78 Hanns-Jürgen Lichtfuß 79 Technologiezentrum Innovationszentrum Berlin Joachim Manz RHÖN-KLINIKUM AG 80 Horst Meier Ruhr-Universität Bochum 81 Frank Meiser Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 82 Walter Michaeli RWTH Aachen 83 Joachim Milberg acatech DaimlerChrysler AG 84 Eckard Minx 85 Andreas Müller 86 Gerhard J. Müller Charité – Universitätsmedizin Berlin 87 Walter Müller Welch Allyn GmbH & Co. KG 88 Eckhard Nagel Universität Bayreuth 89 Peter Noll TU Berlin 90 Reinhold Orglmeister TU Berlin 91 Andreas Ostendorf Laser Zentrum Hannover e. V. 92 Jens Pape acatech 93 Robert Paquet 94 Herbert Partzsch Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 95 Berufsakademie Sachsen Rainer Penzel 96 Peter Pepper TU Berlin 97 Marcus Peter Stiftung Brandenburger Tor 98 Klaus Petermann TU Berlin 99 Franz Pischinger acatech 100 Christa Polze 101 Christoph Polze 102 Günter Pritschow acatech 103 Wolfgang Reith Universitätsklinikum des Saarlandes Universität Göttingen 104 Otto Rienhoff 105 Lutz Robers 106 Hans-Jörg Roesmann 107 Carsten Rolle 108 Horst-Jürgen Rösgen 100 Technologiepark Münster GmbH Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Lfd. NrVorname Nachname Institution 109 Peter Sachsenmeier 110 Markus Saga 111 Susanne Schick ITRI Western Europe Office 112 Anja Schlicht Somatex Medical Technologies 113 Alexandra Schmidt 114 Martin Schmidt TU Berlin GmbH Fraunhofer Institut (IAO) 115 Klaus-Peter Schmitz Universität Rostock 116 Thomas Schmitz-Rode RWTH Aachen 117 Hermann Scholl Robert Bosch GmbH 118 Marten Schönherr TU Berlin 119 Heike Schöning IHK zu Berlin 120 Harald Schottenloher Medi Tech Consult 121 Carsten S. Schröder acatech 122 Thomas Schwab Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur und Technologie 123 Rainer M. M. Seibel Mülheimer Radiologie Institut 124 Dieter Spath acatech 125 Günter Spur acatech 126 Peter Starke Humboldt Universität Berlin 127 Gustav Steinhoff Universität Rostock 128 Ulrich Stottmeister UFZ Umweltforschungszentrum 129 Christoph Tilke acatech 130 Sibille Tröster 131 Jochen Verhasselt Fraunhofer Institut (IPK) 132 Achim Volmer TU Berlin 133 Herwig von Nettelhorst geterned Medizin- und Informa- tionstechnik AG 134 Alexander Vorwerk TU Berlin 135 Torsten Walter BMW Group 136 E. G. Welp Ruhr-Universität Bochum 137 Günther Wilke acatech TU Chemnitz 138 Eugen-Georg Woschni 139 Joachim Zaage 140 Stefan Zachow 141 Thomas Zaengel Philips Med. Systeme GmbH 142 Gerhard Zeidler DEKRA e. V. 143 Hans Heinz Zimmer VDE-Haus 101 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 > AutorenPortraits. > Olaf Dössel > Detlev Ganten > Dietrich Grönemeyer > Klaus-Dirk Henke > Patrick Illinger > Karl Jähn > Norbert Klusen > Heinrich Kolem > Joachim Milberg > Eckhard Nagel > Klaus-Peter Schmitz > Dieter Spath > Günter Spur > 08 Autorenportraits > AutorenportraitS. Olaf Dössel Prof. Dr. rer. nat. Olaf Dössel, geb. 1957 in Lübeck, ist Leiter des Instituts für Biomedizinische Technik der Universität Karlsruhe und unter anderem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE. Er studierte bis 1979 Physik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und wurde anschließend Assistent am Institut für Experimentalphysik der Universität Kiel bei Prof. Dr. Ruprecht Haensel, wo er auch 1982 mit einer Arbeit zum Thema „Lumineszenz fester Edelgase“ zum Dr. rer. nat. promovierte. Danach war er Wissenschaftlicher Assistent am Philips Forschungslaboratorium in Hamburg. Ab 1985 übernahm er dort die Leitung der Forschungsgruppe Messtechnik. 1996 erfolgte der Ruf auf den Lehrstuhl für Medizintechnik an der Universität Karlsruhe. Detlev Ganten Prof. Dr. med. Detlev Ganten, geb. 1941 in Lüneburg, studierte Medizin in Würzburg, Montpellier (Frankreich) und Tübingen und forschte mehrere Jahre am Clinical Research Institute der McGill Universität in Montreal (Kanada), wo er seinen Doctor of Philosophy (Ph.D.) erwarb. 1975 wurde Detlev Ganten an das Pharmakologische Institut der Universität Heidelberg berufen. 1991 wurde Prof. Ganten Gründungsdirektor und Vorstand des Max-DelbrückCentrums für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin-Buch und zugleich Inhaber eines Lehrstuhls für Klinische Pharmakologie am Klinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin. Seit 2004 ist er Vorstandsvorsitzender der Charité – Universitätsmedizin Berlin, die durch die Fusion der medizinischen Fakultäten der Freien Universität Berlin und der Humboldt Universität zu Berlin entstanden ist. Als Bluthochdruckforscher klärte Prof. Ganten grundlegende Mechanismen der Entstehung des Bluthochdrucks auf. Sein Forschungsgebiet umfasst die hormonale Regulation des Blutdrucks, insbesondere das Renin-Angiotensin-System und die molekulare Genetik von Herz-Kreislauferkrankungen. 104 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Dietrich H. W. Grönemeyer Prof. Dr. med. Dietrich H. W. Grönemeyer, geb.1952 in Clausthal-Zellerfeld, studierte Medizin, Sinologie, Physik in Kiel und Bochum. Er ist Ordinarius für Radiologie und Mikrotherapie und Leiter des Grönemeyer-Instituts im Lehrstuhl für Radiologie und MikroTherapie an der Universität Witten-­Herdecke. Professor Grönemeyer ist Arzt, Wissenschaftler und Unternehmer. Seine wesentlichen Werke sind: Interventional Computed Tomography, 1990, Blackwell Science, Berlin; Open Field MRI, 1999, Springer Wissenschaft, Heidelberg; Med. in Deutschland, Standort mit Zukunft, 2. Auflage, 2001, ABW Wissenschaftsverlag; Mensch bleiben, 2003, Herder-Verlag; Mein Rückenbuch, 2004, Sandmann-Verlag; Gesundheitswirtschaft, 2004, ABW-Wissenschaftsverlag. Klaus-Dirk Henke Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke, geb. 1942 in Hannover, studierte von 1963 bis 1970 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln, der London School of Economics and Political Science, London, und der University of Michigan, Ann Arbor, USA. Von 1970 bis 1971 war er Wissenschaftlicher Assistent an der Universität zu Köln und promovierte dort zum Dr. rer. pol. In den Jahren von 1971 bis 1976 arbeitete er als Wissenschaftlicher Assistent und Universitätsdozent an der Philipps-Universität Marburg, wo er 1976 auch habilitierte. Im selben Jahr wurde er daraufhin Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Hannover. 1995 erfolgte seine Berufung zum Universitätsprofessor für Finanzwissenschaft und Gesundheitsökonomie an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin. Prof. Henke war von 1996 bis 2004 Direktor am Europäischen Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis, Berlin, und von 1999 bis 2002 Sprecher des Graduiertenkollegs der DFG „Bedarfsgerechte und kostengünstige Gesundheitsversorgung – Grundlagen einer optimalen Allokation der Ressourcen“. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Finanzwissenschaft, Gesundheitsökonomie und Soziale Sicherungssysteme in Europa. 105 Autorenportraits Patrick Illinger Dr. Patrick Illinger, geb. 1965 in München, ist Leiter der Redaktion Wissen bei der Süddeutschen ­ Zeitung. Er studierte ­ Physik und daneben auch Theaterwissenschaften an der Technischen Universität ­München und an der ­Ludwig-MaximiliansUniversi­tät München. 1994 promovierte er hier zum Dr. rer. nat. im Fach Physik. Dr. Illinger war von 1993 bis 1994 freier Mitarbeiter bei Rundfunk und Presse. 1996 schloss er sein Volontariat beim ­ Bayerischen Rundfunk ab und wurde Redakteur bei Focus (Ressort ­Forschung + Technik). 1997 wechselte er zur Süddeutschen Zeitung (Technik, Computer) und wurde danach Chef­redakteur für Computer & Co (Beilagenmagazin in 30 Zeitungen). Von 2000 bis 2002 war er Chef­redakteur für sueddeutsche.de (Online­angebot der SZ) und seit April 2002 ist Dr. Illinger Ressortleiter Wissen, Süddeutsche Zeitung. Karl Jähn Dr. med. Karl Jähn, geb. 1962 in Göttingen, studierte Human­medizin an der medizinischen Fakultät der Universität ­Hamburg. Seit 2005 arbeitet er in der Lehr- und Gemeinschaftspraxis Dr. G. Kowalski – Dr. K. Jähn und führt Bereitschaftsdienste der KV Berlin durch. Außerdem ist er seit April 2004 externer Leiter der AG e-Health, Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ­Universität Bayreuth. Von April 2001 bis März 2004 war er als Wissenschaftlicher Assistent für den Aufbau der Arbeitsgruppe e-Health und Health Communication, Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. phil. E. Nagel), zuständig. Norbert Klusen Prof. Dr. Norbert Klusen, geb. 1947, ist seit 1996 Vorsitzender des Vorstands der Techniker Krankenkasse. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Soziologie an der RWTH Aachen sowie der TU Berlin und promovierte zum Dr. rer. oec. Umfangreiche Management-Erfahrungen sammelte er in internationalen Unternehmen, zuletzt bis 1993 als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor einer Aktiengesellschaft des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Anschließend wurde Dr. Klusen Geschäftsführer der Techniker Krankenkasse. Seit 1999 ist Dr. Klusen auch als Honorarprofessor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau sowie als Lehrbeauftragter für Strategisches Management an der Universität Hannover tätig. 106 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Heinrich Kolem Dr. rer. nat. Heinrich Kolem, geb.1956 in Recklinghausen, ist seit 1. Januar 2001 Leiter des Geschäftsgebiets Magnet­resonanz, Siemens Medical Solutions. Nach seinem Abitur 1974 studierte er an der Universität Dortmund Physik. Daran schloss sich die Promotion mit dem Thema „Magnet­resonanzUntersuchung an Kristallen“ an. Nach einer wissenschaftlichen Tätigkeit an der University of Utah, Salt Lake City, kam Kolem 1989 zum Siemens-Bereich Medical Solutions. Im Geschäftsgebiet Magnet­resonanz nahm er unterschiedliche Aufgaben wahr, wie zum Beispiel Applikations- und Hardwareentwicklung, Logistik und Marketing. Joachim Milberg Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Dr.-Ing. E. h. mult. Joachim ­Milberg ist ehe­mali­ger Vorstandsvorsitzender der BMW Group, München. Er studierte Produktionstechnologie in Bielefeld und an der Technischen Universität Berlin. Von 1972 bis 1981 arbeitete Milberg für den Werkzeugmaschinenhersteller Gildemeister in Bielefeld, danach war er bis 1993 Professor für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften an der Technischen Universität München, mit den Schwerpunkten Automatisierung und Roboter-Technologie. Von 1993 bis 2002 gehörte Milberg dem BMW Vorstand an, von 1999 an als dessen Vorsitzender. Er ist heute Vorsitzender des Aufsichtsrates von BMW und sitzt in den Kontrollgremien der Firmen Allianz Versicherung, Festo, MAN, John Deere, Leipziger Messe und Bertelsmann sowie im Senat der Max-Planck-Gesellschaft. Joachim Milberg ist Präsident von acatech. 107 Autorenportraits Eckhard Nagel Prof. Dr. med. Dr. phil. Eckhard Nagel, geb. 1960 in Hannover, ist Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften und der Forschungsstelle für Sozialrecht und Gesundheitsökonomie der Universität Bayreuth und außerdem Leiter des Bereichs Allgemeiner Viszeral- und Transplantationschirurgie im Klinikum Augsburg. ­ Eckhard Nagel studierte Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, an der University of Vermont (USA), an der Dumfries Royal Infirmary (England), an der Université de Grenoble (Frankreich) und an der Dartmouth Medical School, New Hampshire (USA). 1986 erhielt er seine Approbation als Arzt und 1987 promovierte er. Danach nahm er eine Tätigkeit als wissen­ schaftlicher Mitarbeiter und später als Oberarzt in der Klinik für Abdominalchirurgie- und Transplantations­ chirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover auf und machte hier die Facharztausbildung in der Abteilung von Rudolf Pichlmayr. 1998 habilitierte Eckhard Nagel zum Thema „Modelle für die klinische Forschung am Beispiel der Analyse und Bewertung der Nieren- und Lebertransplantation“. Außerdem studierte er Philosophie und Geschichte an der Universität Hannover und promovierte zum Dr. phil. 1999 erhielt er den Ruf auf den Lehrstuhl für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth. Er ist Chirurg mit einem Schwerpunkt auf Leberchirurgie und Organtransplantationen, Hochschullehrer in Bayreuth und seit 2001 stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Ethikrates. Klaus-Peter Schmitz Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Schmitz, geb. 1946, ist seit 1995 Direktor des Instituts für Biomedizinische Technik (IBMT) der Universität Rostock. Er studierte von 1964 bis 1969 Angewandte Mechanik an der Universität Rostock und promovierte hier 1972 zum Dr.-Ing. Seine Habilitation erfolgte 1980. Er arbeitete von 1972 bis 1984 als Ent­ wicklungsingenieur am Institut für Schiffbau Rostock. Von 1984 bis 1990 war er Bereichsleiter/WB-Leiter „Assistierte Zirkulation und Künstliches Herz“, Klinik für Innere Medizin der Universität Rostock. In den Jahren von 1990 bis 1992 leitete Dr. Schmitz die Abteilung „Biomechanik und Medizinische Werkstoffe“, Zentrum für Bioengineering der Universität Rostock an der Klinik für Innere Medizin. Im Jahre 1992 erfolgte die Überleitung zum HRG-Professor entsprechend dem Hochschulerneuerungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern und die Übernahme zum Universitätsprofessor, Berufungsgebiet Biomedizinische Technik. Von 1992 bis 1995 war er Leiter der Abteilung Biomedizinische Technik des Instituts für Biomedizinische Technik und Medizinische Informatik der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock. 108 acatech SYMPOSIUM | 26. April 2005 Dieter Spath Prof. Dr.-Ing. Dieter Spath, geb. 1952 in Lichtenau, Kreis Ansbach, ist seit 2002 Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT), Universität Stuttgart. Er studierte von 1971 bis 1975 Maschinenbau, Fachrichtung Betriebs- und Fertigungstechnik an der Technischen Universität München. Bis 1981 war er Wissenschaftlicher Assistent und Akademischer Rat am gleichen Institut. 1981 promovierte er zum Dr.-Ing. und trat anschließend in die KASTO-Firmengruppe ein, wo er 1985 Prokurist und 1988 Geschäftsführer wurde. Seine Ernennung zum ordentlichen Professor an der Universität Karlsruhe, Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik, erfolgte 1992. Er war von 1996 bis 1998 Dekan der Fakultät Maschinenbau, Universität Karlsruhe (TH). Im Jahre 1999 wurde er als Nachfolger von Professor Milberg an die Technische Universität München, Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb), berufen. Günter Spur Prof. Dr. h. c. mult. Dr.-Ing. Günter Spur, geb. 1928 in Braunschweig, ist emeritierter Professor der Technischen Universität Berlin. Über Jahrzehnte leitete er das Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin sowie das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. In der Zeit von 1991 bis 1996 war er Gründungsrektor der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Prof. Spur hat bedeutende Beiträge zur Produktionswissenschaft geleistet – vor allem auf den Gebieten der Werkzeugmaschinen und der Fertigungstechnik, des Fabrikbetriebes sowie der rechnerintegrierten Produktion. Über 900 Zeitschriften- und Buchveröffentlichungen sowie zahlreiche Vorträge im In- und Ausland sind Bestandteil seiner Forschungsarbeiten. Günter Spur ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen und Akademien. Seine Verdienste als Wissenschaftler und Hochschullehrer wurden auch international durch hohe Auszeichnungen und Ehrungen gewürdigt. 109 > Impressum Herausgeber: acatech – Konvent für Technikwissenschaften der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. Residenz München Hofgartenstraße 2 80539 München T + 49 (0) 89/5 20 30 90 F + 49 (0) 89/5 20 30 99 E-Mail: [email protected] Internet: www.acatech.de Verantwortlich: Dr.-Ing. Carsten S. Schröder Koordination: Jens Pape Redaktion: Yetvart Ficiciyan Gestaltung und Produktion: klink, liedig werbeagentur gmbh Die Erstellung dieses Tagungsbandes erfolgte mit freundlicher Unterstützung der klink, liedig werbe­agentur gmbh, Stievestr. 9, 80638 München. Der Tagungsband ist auch online unter www.acatech.de verfügbar.