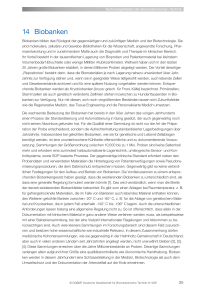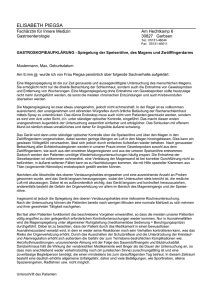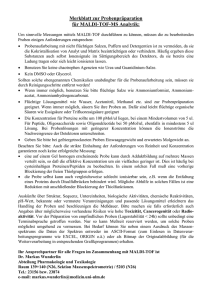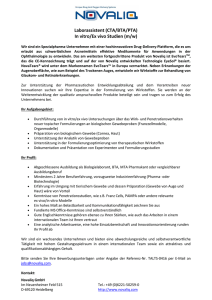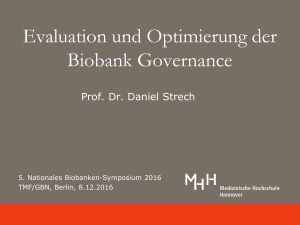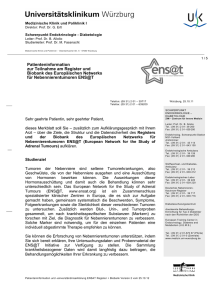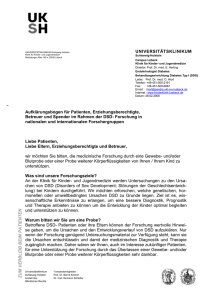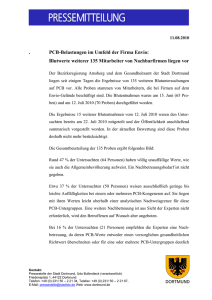Jeder Patient ein Spender
Werbung
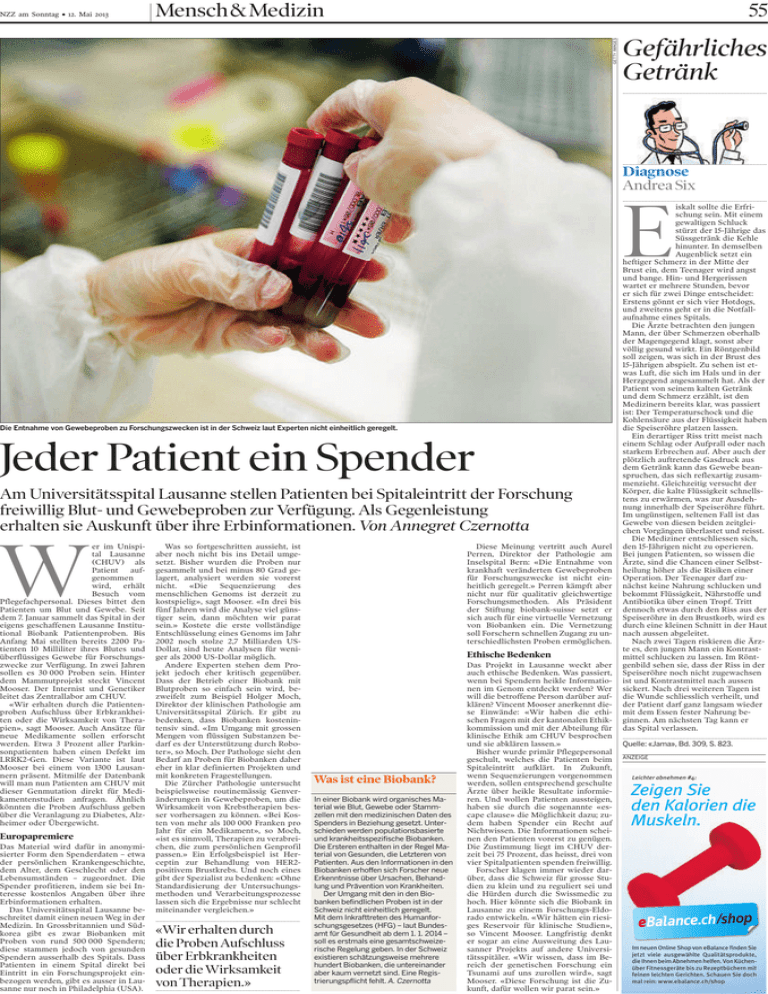
V 12. Mai 2013 Mensch&Medizin 55 GETTY IMAGES NZZ am Sonntag .................................................................................. .................................................................................. Diagnose Andrea Six E .................................................................................. Die Entnahme von Gewebeproben zu Forschungszwecken ist in der Schweiz laut Experten nicht einheitlich geregelt. Jeder Patient ein Spender Am Universitätsspital Lausanne stellen Patienten bei Spitaleintritt der Forschung freiwillig Blut- und Gewebeproben zur Verfügung. Als Gegenleistung erhalten sie Auskunft über ihre Erbinformationen. Von Annegret Czernotta W er im Unispital Lausanne (CHUV) als Patient aufgenommen wird, erhält Besuch vom Pflegefachpersonal. Dieses bittet den Patienten um Blut und Gewebe. Seit dem 7. Januar sammelt das Spital in der eigens geschaffenen Lausanne Institutional Biobank Patientenproben. Bis Anfang Mai stellten bereits 2200 Patienten 10 Milliliter ihres Blutes und überflüssiges Gewebe für Forschungszwecke zur Verfügung. In zwei Jahren sollen es 30 000 Proben sein. Hinter dem Mammutprojekt steckt Vincent Mooser. Der Internist und Genetiker leitet das Zentrallabor am CHUV. «Wir erhalten durch die Patientenproben Aufschluss über Erbkrankheiten oder die Wirksamkeit von Therapien», sagt Mooser. Auch Ansätze für neue Medikamente sollen erforscht werden. Etwa 3 Prozent aller Parkinsonpatienten haben einen Defekt im LRRK2-Gen. Diese Variante ist laut Mooser bei einem von 1300 Lausannern präsent. Mitmilfe der Datenbank will man nun Patienten am CHUV mit dieser Genmutation direkt für Medikamentenstudien anfragen. Ähnlich könnten die Proben Aufschluss geben über die Veranlagung zu Diabetes, Alzheimer oder Übergewicht. Europapremiere Das Material wird dafür in anonymisierter Form den Spenderdaten – etwa der persönlichen Krankengeschichte, dem Alter, dem Geschlecht oder den Lebensumständen – zugeordnet. Die Spender profitieren, indem sie bei Interesse kostenlos Angaben über ihre Erbinformationen erhalten. Das Universitätsspital Lausanne beschreitet damit einen neuen Weg in der Medizin. In Grossbritannien und Südkorea gibt es zwar Biobanken mit Proben von rund 500 000 Spendern; diese stammen jedoch von gesunden Spendern ausserhalb des Spitals. Dass Patienten in einem Spital direkt bei Eintritt in ein Forschungsprojekt einbezogen werden, gibt es ausser in Lausanne nur noch in Philadelphia (USA). Gefährliches Getränk Was so fortgeschritten aussieht, ist aber noch nicht bis ins Detail umgesetzt. Bisher wurden die Proben nur gesammelt und bei minus 80 Grad gelagert, analysiert werden sie vorerst nicht. «Die Sequenzierung des menschlichen Genoms ist derzeit zu kostspielig», sagt Mooser. «In drei bis fünf Jahren wird die Analyse viel günstiger sein, dann möchten wir parat sein.» Kostete die erste vollständige Entschlüsselung eines Genoms im Jahr 2002 noch stolze 2,7 Milliarden USDollar, sind heute Analysen für weniger als 2000 US-Dollar möglich. Andere Experten stehen dem Projekt jedoch eher kritisch gegenüber. Dass der Betrieb einer Biobank mit Blutproben so einfach sein wird, bezweifelt zum Beispiel Holger Moch, Direktor der klinischen Pathologie am Universitätsspital Zürich. Er gibt zu bedenken, dass Biobanken kostenintensiv sind. «Im Umgang mit grossen Mengen von flüssigen Substanzen bedarf es der Unterstützung durch Roboter», so Moch. Der Pathologe sieht den Bedarf an Proben für Biobanken daher eher in klar definierten Projekten und mit konkreten Fragestellungen. Die Zürcher Pathologie untersucht beispielsweise routinemässig Genveränderungen in Gewebeproben, um die Wirksamkeit von Krebstherapien besser vorhersagen zu können. «Bei Kosten von mehr als 100 000 Franken pro Jahr für ein Medikament», so Moch, «ist es sinnvoll, Therapien zu verabreichen, die zum persönlichen Genprofil passen.» Ein Erfolgsbeispiel ist Herceptin zur Behandlung von HER2positivem Brustkrebs. Und noch eines gibt der Spezialist zu bedenken: «Ohne Standardisierung der Untersuchungsmethoden und Verarbeitungsprozesse lassen sich die Ergebnisse nur schlecht miteinander vergleichen.» .................................................................................. «Wir erhalten durch die Proben Aufschluss über Erbkrankheiten oder die Wirksamkeit von Therapien.» .................................................................................. Diese Meinung vertritt auch Aurel Perren, Direktor der Pathologie am Inselspital Bern: «Die Entnahme von krankhaft veränderten Gewebeproben für Forschungszwecke ist nicht einheitlich geregelt.» Perren kämpft aber nicht nur für qualitativ gleichwertige Forschungsmethoden. Als Präsident der Stiftung biobank-suisse setzt er sich auch für eine virtuelle Vernetzung von Biobanken ein. Die Vernetzung soll Forschern schnellen Zugang zu unterschiedlichsten Proben ermöglichen. Ethische Bedenken Was ist eine Biobank? In einer Biobank wird organisches Material wie Blut, Gewebe oder Stammzellen mit den medizinischen Daten des Spenders in Beziehung gesetzt. Unterschieden werden populationsbasierte und krankheitsspezifische Biobanken. Die Ersteren enthalten in der Regel Material von Gesunden, die Letzteren von Patienten. Aus den Informationen in den Biobanken erhoffen sich Forscher neue Erkenntnisse über Ursachen, Behandlung und Prävention von Krankheiten. Der Umgang mit den in den Biobanken befindlichen Proben ist in der Schweiz nicht einheitlich geregelt. Mit dem Inkrafttreten des Humanforschungsgesetzes (HFG) – laut Bundesamt für Gesundheit ab dem 1. 1. 2014 – soll es erstmals eine gesamtschweizerische Regelung geben. In der Schweiz existieren schätzungsweise mehrere hundert Biobanken, die untereinander aber kaum vernetzt sind. Eine Registrierungspflicht fehlt. A. Czernotta Das Projekt in Lausanne weckt aber auch ethische Bedenken. Was passiert, wenn bei Spendern heikle Informationen im Genom entdeckt werden? Wer will die betroffene Person darüber aufklären? Vincent Mooser anerkennt diese Einwände: «Wir haben die ethischen Fragen mit der kantonalen Ethikkommission und mit der Abteilung für klinische Ethik am CHUV besprochen und sie abklären lassen.» Bisher wurde primär Pflegepersonal geschult, welches die Patienten beim Spitaleintritt aufklärt. In Zukunft, wenn Sequenzierungen vorgenommen werden, sollen entsprechend geschulte Ärzte über heikle Resultate informieren. Und wollen Patienten aussteigen, haben sie durch die sogenannte «escape clause» die Möglichkeit dazu; zudem haben Spender ein Recht auf Nichtwissen. Die Informationen scheinen den Patienten vorerst zu genügen. Die Zustimmung liegt im CHUV derzeit bei 75 Prozent, das heisst, drei von vier Spitalpatienten spenden freiwillig. Forscher klagen immer wieder darüber, dass die Schweiz für grosse Studien zu klein und zu reguliert sei und die Hürden durch die Swissmedic zu hoch. Hier könnte sich die Biobank in Lausanne zu einem Forschungs-Eldorado entwickeln. «Wir hätten ein riesiges Reservoir für klinische Studien», so Vincent Mooser. Langfristig denkt er sogar an eine Ausweitung des Lausanner Projekts auf andere Universitätsspitäler. «Wir wissen, dass im Bereich der genetischen Forschung ein Tsunami auf uns zurollen wird», sagt Mooser. «Diese Forschung ist die Zukunft, dafür wollen wir parat sein.» iskalt sollte die Erfrischung sein. Mit einem gewaltigen Schluck stürzt der 15-Jährige das Süssgetränk die Kehle hinunter. In demselben Augenblick setzt ein heftiger Schmerz in der Mitte der Brust ein, dem Teenager wird angst und bange. Hin- und Hergerissen wartet er mehrere Stunden, bevor er sich für zwei Dinge entscheidet: Erstens gönnt er sich vier Hotdogs, und zweitens geht er in die Notfallaufnahme eines Spitals. Die Ärzte betrachten den jungen Mann, der über Schmerzen oberhalb der Magengegend klagt, sonst aber völlig gesund wirkt. Ein Röntgenbild soll zeigen, was sich in der Brust des 15-Jährigen abspielt. Zu sehen ist etwas Luft, die sich im Hals und in der Herzgegend angesammelt hat. Als der Patient von seinem kalten Getränk und dem Schmerz erzählt, ist den Medizinern bereits klar, was passiert ist: Der Temperaturschock und die Kohlensäure aus der Flüssigkeit haben die Speiseröhre platzen lassen. Ein derartiger Riss tritt meist nach einem Schlag oder Aufprall oder nach starkem Erbrechen auf. Aber auch der plötzlich auftretende Gasdruck aus dem Getränk kann das Gewebe beanspruchen, das sich reflexartig zusammenzieht. Gleichzeitig versucht der Körper, die kalte Flüssigkeit schnellstens zu erwärmen, was zur Ausdehnung innerhalb der Speiseröhre führt. Im ungünstigen, seltenen Fall ist das Gewebe von diesen beiden zeitgleichen Vorgängen überlastet und reisst. Die Mediziner entschliessen sich, den 15-Jährigen nicht zu operieren. Bei jungen Patienten, so wissen die Ärzte, sind die Chancen einer Selbstheilung höher als die Risiken einer Operation. Der Teenager darf zunächst keine Nahrung schlucken und bekommt Flüssigkeit, Nährstoffe und Antibiotika über einen Tropf. Tritt dennoch etwas durch den Riss aus der Speiseröhre in den Brustkorb, wird es durch eine kleinen Schnitt in der Haut nach aussen abgeleitet. Nach zwei Tagen riskieren die Ärzte es, den jungen Mann ein Kontrastmittel schlucken zu lassen. Im Röntgenbild sehen sie, dass der Riss in der Speiseröhre noch nicht zugewachsen ist und Kontrastmittel nach aussen sickert. Nach drei weiteren Tagen ist die Wunde schliesslich verheilt, und der Patient darf ganz langsam wieder mit dem Essen fester Nahrung beginnen. Am nächsten Tag kann er das Spital verlassen. .................................................................................. Quelle: «Jama», Bd. 309, S. 823. ANZEIGE Leichter abnehmen #4: Zeigen Sie den Kalorien die Muskeln. Im neuen Online Shop von eBalance finden Sie jetzt viele ausgewählte Qualitätsprodukte, die Ihnen beim Abnehmen helfen. Von Küchenüber Fitnessgeräte bis zu Rezeptbüchern mit feinen leichten Gerichten. Schauen Sie doch mal rein: www.ebalance.ch/shop