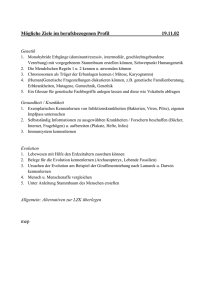EmstMayr Evolution und die VieHalt
Werbung

EmstMayr Evolution und die VieHalt des Lebens Ubersetzt von Karin de Sousa Ferreira Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1979 Professor Dr. ERNST MAYR Museum of Comparative Zoology, The Agassiz Museum Harvard University, Cambridge, Mass. 02138, USA Ubersetzer: KARIN DE SOUSA FERREIRA, Lissabon, Portugal Mit 12 Abbildungen ISBN-13: 978-3-540-09068-7 DOl: 10.1007/978-3-642-67110-4 e-ISBN-13: 978-3-642-6711 0-4 CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek. Mayr, Ernst: [Sammlung <dt.>J. Evolution und die Vielfalt des Lebens 1 Ernst Mayr. Ubers. von Karin de Sousa Ferreira. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1978. Einheitssacht.: Evolution and the diversity oflife < dt. >. Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Bei der Vervielfliltigung fUr gewerbliche Zwecke ist gemaB § 54 UrhG eine Vergiitung an den Verlag zu zahIen, deren Hohe mit dem Verlag zu vereinbaren ist. © by Springer-Verlag Berlin· Heidelberg 1979 Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden diirften. Umschlaggestaltung: W. Eisenschink 2131/3130-543210 Vorwort Die deutsche Ausgabe meiner Aufsatze begrli~e ich mit besonderer Freude, da die Anfange meiner Gedankengange oft bis zu den Zeiten zurlickreichen, als ich noch in Berlin am Zoologischen Museum der Universitat tatig war. Die Probleme, mit denen ich mich in dieser Sammlung auseinandersetze, werden nicht nur in der wissenschaftlichen, sondern auch in der philosophischen Literatur eifrigst erortert. Besonders wichtig fUr die Behandlung dieser Probleme ist das Auftauchen v611ig neuer Denkrichtungen in der modernen Evolutionsbiologie. In der Wissenschaftsphilosophie, und besonders bei den Positivisten, war die Uberzeugung weit verbreitet, alle Probleme der Biologie konnten letzten Endes auf die Gesetze der Physik und Chemie zurlickgeflihrt werden. Wer widersprach, dem wurde vorgeworfen, Vitalist oder Mystiker zu sein. Da~ jedoch diese Auffassung der Positivisten falsch ist, wird in einigen meiner Aufsatze nachgewiesen. Bei der Zusammenstellung dieses Bandes habe ich mich von dem Prinzip leiten lassen, so1che Aufsatze zu wahlen, die sich mit neuen Entwicklungen in der Gedankenwelt der Biologen beschiiftigen. Ais besonders wichtige Themen erschienen mir die Wirksamkeit der natUrlichen Auslese, der Populationsgedanke, das Prinzip der Teleonomie, die Rolle des genetischen Programms und andere gedankliche Entwicklungen der modernen Biologie, mit denen nicht nur Wissenschaftler und Philosophen, sondern auch jeder gebildete Laie vertraut sein soUte, denn ohne dieses Verstandnis ist eine moderne Weltanschauung eigentlich undenkbar. Oft wird, und leider zu Recht, auf die gedankliche Kluft zwischen Wissenschaftlern und Humanisten hingewiesen. Eine krasse wissenschaftliche Unbildung sei angeblich entschuldbar, weil die Wissenschaft zu schwer verstandlich ist. Das ist aber nicht richtig. Sicherlich gibt es einige Fachgebiete wie die Atomphysik oder die chemische Theorie der Molekularkrafte, fUr die dies zutrifft. Aber gerade fUr die Wissenschaftsbereiche, die jeder ganz unmittelbar als Grundlage fUr eine eigene Weltanschauung braucht, wie die EvoluV tionsbiologie und die Verhaltensforschung, gilt diese Entschuldigung nicht. Die Ergebnisse dieser Wissenschaften sind leichter zu verstehen als etwa Hamlet oder die Divina Commedia. Es ist also nicht die Schwierigkeit der Materie, die so viele Laien zu wissenschaftlichen Analphabeten macht, sondern einfach Mangel an Interesse. Und so merken sie gar nicht, wie viel sie dabei verlieren und wie anachronistisch viele ihrer Auffassungen tiber die Natur sind. Wer aber die ehrliche Absicht hat, sich mit dem Denken des heutigen Evolutionsbiologen vertraut zu machen, der wird, das hoffe ich, in diesen Aufsatzen vieles finden, das ihn zu weiterem Denken anregt. Elf Aufsatze sind der englischen Ausgabe (Evolution and the Diversity of Life, Harvard University Press, 1976) entnommen, ein Aufsatz wurde erst kiirzlich publiziert, und ein weiterer ist noch unveroffentlicht . . Besonderen Dank mochte ich Frau Ferreira fiir ihre vorzugliche Obersetzung aussprechen. Cambridge (Mass.), Sommer 1978 VI Ernst Mayr Inhaltsverzeichnis 1. Die Evolution lebender Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Verschiedene Arten lebender Systeme ................. Die Pflege des Nachwuchses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 9 2. Zufall oder Planmiij3igkeit: Das Paradoxon der Evolution. .. 14 Planung ......................................... Zufall .......................................... Die Mutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gen und Merkmal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Die natiirliche Auslese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Evolutionare Zufalle und genetische Information. . . . . .. Einwande gegen eine selektionistische Auffassung der Adaptation .................................. Anpassung und Zweckmaf~igkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 16 20 22 23 26 27 31 33 3. Typologisches Denken kontra Populationsdenken ........ 34 Der Begriff der Rasse ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Die natiirliche Auslese .............................. 38 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 4. Selektion und die gerichtete Evolution . ................ 40 Gerichtete Evolution .............................. Die Wirkungsweise der gerichteten Evolution . . . . . . . . . . . . Was sind die Folgerungen dieser Befunde? .............. Evolutionistische Tendenzen ...................... Polyphyletische Parallelerscheinungen ................. Stagnierung und Bliiteperioden ....................... Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 47 52 52 53 55 57 57 VII 5. Geschlechtliche und natiirliche Auslese . . . . . . . . . . . . . . .. Welche Merkmale sind das Ergebnis der sexuellen Auslese? Schmuck und Lockmittel der Mannchen ............ Wahl durch das Weibchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vorbedingungen fOr das Funktionieren der sexuellen Auslese Mannchen-Vberschu~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Der Kampf unter den Mannchen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Geschlechtliche oder natOrliche Auslese? .............. Epigamische Selektion ......................... , Isolationsmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Unterschiedliche Nischenausnutzung ............... NatOrliche Fitness und Fortpflanzungsvorteil . . . . . . . . . .. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. Die Unterschiede zwischen kosmischer und organischer Evolu tion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 62 63 64 67 67 68 70 71 73 74 75 77 78 80 Die Frage des Fortschritts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82 Typen von Evolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 Sprunghafte Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 Echte teleologische Vorgange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84 Fortwahrende Anpassung durch Vererbung erworbener Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 Teleonomische Vorgange ........................ 86 Die aus teleomatischen Vorgangen bestehende kosmische Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 Evolution durch Selektion ....................... 88 Die Auslegung der biologischen Evolution seitens der Physiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91 Obereinstimmungen und Unterschiede von kosmischer und biologischer Evolution .......................... 92 Gemeinsamkeiten der kosmischen und der biologischen Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Unterschiede zwischen kosmischer und biologischer Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 1st es sinnvoll, von einer "Reduktion" der biologischen Evolution auf die Gesetze der Physik zu sprechen? ... 101 Schlu~bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102 VIII Z Umweltveriinderung und Speziation . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 Der evolutive Genflu~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Die Struktur der Arten . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Okotypische Variation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Typostrophische" Variation ..................... Die Rolle des Genflusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Die genetische Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Das koadaptierte System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Veranderungen der genetischen Umwelt . . . . . . . . . . . . . .. Die Rolle der physikalischen und biotischen Umwelt . . . .. Das Aufspalten des kontinuierlichen Verbreitungsgebietes einer Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Genetische Variabilitat ............................ Randpopulationen und Makroevolution ............... Evolutionsraten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Phylogenetische Saltationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Okologische Umstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 108 108 110 110 114 116 119 123 124 126 129 129 131 133 133 134 8. Das Wesen der Darwinschen Revolution . .............. 136 Die Macht der retardierenden Konzepte . . . . . . . . . . . . . .. Naturtheologie und Schopfungsglaube ................ Der Schopfungsglaube und die Fortschritte der Geologie .. Der Essentialismus und eine statische Welt . . . . . . . . . . . .. Lyells Artbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lyell und der Uniformitarianismus . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Erfolglose Widerlegungen der Evolutionstheorie aufgrund falsch gewahlter Alternativen ..................... Keine Unterscheidung distinkter Phanomene ........... Der Einflu~ des Origin of Species . ................... Besondere Aspekte der Darwinschen Revolution .. . . . . .. Das Wesen der Darwinschen Revolution . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139 141 142 144 146 147 152 155 155 156 160 161 9. Darwin und die natiirliche Auslese ................... 164 Wie Darwin seine hochst unkonventionelle Theorie entdeckt haben konnte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 164 Der Kampf urns Dasein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170 IX Kampf der Arten oder der Individuen? ................ Einzigartigkeit des Individuums ..................... Natiirliche Aus1ese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wievie1 verdankte Darwin nun eigentlich Ma1thus? . . . . . .. Darwins geistige Vorbereitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174 175 178 180 181 183 10. Ursache und Wirkung in der Biologie ................ 185 Funktiona1e Biologie und Evolutionsbiologie . . . . . . . . . .. Kausalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Te1eo1ogie ...................................... Das Problem der Voraussage ........................ Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 189 191 192 196 197 11. Teleologisch und teleonomisch: eine neue Analyse. . . . .. 198 Traditionelle Einwande gegen eine teleo1ogische Ausdrucksweise ........................................ 200 Die Heterogenitat teleologischer Phanomene . . . . . . . . . .. 202 Gerichtete Evolutionsreihen (Progressionismus, Orthogenese)203 Scheinbar oder wirklich zie1gerichtete Vorgange ......... 205 Te1eomatische Vorgange in der unbelebten Natur ...... 206 Teleonomische Vorgange in der belebten Natur ....... 207 Ineinanderiibergehen von teleomatischen und teleonomischen Vorgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 216 Teleologische Systeme ............................ 216 Der heuristische Wert der teleonomischen Sprache ....... 220 Aristote1es und die Teleo1ogie ....................... 223 Kant und die Te1eo1ogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226 Literatur ....................................... 228 12. Die biologische Bedeutung der Art . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230 Der typo1ogische oder "essentialistische" Artbegriff . . . . .. Der nominalistische Artbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Der biologische Artbegriff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diskontinuitat ................................. Die Vervielfaltigung der Arten .................... Die Genetik der Art ............................ x 231 232 234 236 238 239 Die Rolle der Art in der Evolution . . . . . . . . . . . . . . . .. Arten und Okosysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Arten und Artenreichtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Schlu~bemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240 241 242 244 245 13. Verhaltensprogramme und evolutioniire Strategien ...... 246 Geschlossene und offene Programme ................. Einteilung des Verhaltens .......................... Intraspezifisches Verhalten ....................... Interspezifisches Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nicht-kommunikatives Verhalten .................. Makroevolutionare Folgen ......................... Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 257 259 261 262 264 268 Sachverzeichnis . ................................... 271 XI 1 Die Evolution lebender Systeme 1 Oberwaltigend groB ist die Anzahl der lebenden Systeme, die Mannigfaltigkeit ihrer Arten und Gestalten, und jedes dieser Systeme ist auf seine besondere Weise einzigartig. So verschieden sind in der Tat die Organisationstypen, daB es vergebene LiebesmUhe ware, wollte man die Evolution in ihrer Gesamtheit zu verstehen suchen, indem man die Entwicklung von Viren und Fungi, Walen und Mammutbaumen oder Elefanten und Kolibris beschriebe. Vielleicht konnen wir durch ein relativ unorthodoxes Herangehen an unsere Aufgabe zu giiltigen Verallgemeinerungen gelangen. Die lebenden Systeme evoluieren, urn der "Herausforderung" der Umwelt gewachsen zu sein. Wir konnen also fragen, welches die Anforderungen sind, denen ein Organismus genUgen muB. Die erste Anforderung ist die, es mit einer sich unablassig wandelnden und ungeheuer vielgestaltigen Umwelt aufnehmen zu konnen, deren Ressourcen allerdings nicht unerschopflich sind. Das Mittel, urn mit der Vielfalt der Umwelt in Raum und Zeit fertigzuwerden, ist unbestritten die Mutation, die Erzeugung genetischer Variation. Gehen wir bis zu den Anfangen des Lebens zurUck: Ein urzeitlicher Organismus, der sich von einem speziellen komplexen, in der sogenannten "Ursuppe" vorhandenen Molekiil ernahrte, erzielte einen besonderen Vorteil, wenn er sich so veranderte, daB er nach Verbrauch dieser Ressource in seiner Umwelt in der Lage war, das benotigte Molekiil aus den reichlich vorhandenen einfacheren Molekiilen zu synthetisieren. Einfache Lebewesen wie Bakterien oder Viren, bei denen alle 10 oder 20 Minuten eine neue Generation heranwachst und deren gewaltige Populationen aus Millionen und Milliarden von Individuen bestehen, konnen durchaus in der Lage sein, sich lediglich mittels Mutation an die Diversitat wie auch an die Veranderungen der Umwelt anzupassen. In der Tat ist die Fahigkeit zur Mutation vielleicht das wichtigste evolutive Entnommen aus: The evolution of living systems. Proc. Nat. Acad. Sci. 51, No.5, 934-941 (1964). 1 Merkmal der einfachsten Organismen. Dariiber hinaus ist ihr System der phanotypischen Adaptation bemerkenswert plastisch, es erlaubt daher eine rasche Anpassung an Umweltveranderungen. FUr komplexere Lebewesen, d.h. so1che mit sehr viel gr6~eren GenerationsHingen, viel kleinerer Populationsgr6~e und vor allem einem sorgfaltig ausbalancierten koadaptierten Genotypus, ware es riskant, wollten sie sich so weitgehend auf Mutationen verlassen, urn Veranderungen in der Umwelt nachzukommen. Die Wahrscheinlichkeit, da~ die richtige Mutation zur richtigen Zeit eintreten wUrde, so da~ die Mutation allein die angemessene genetische Variabilitat fUr pl6tzliche Veranderungen in der Umwelt so1cher Organismen liefern k6nnte, ist praktisch gleich null. Welches also ist die Voraussetzung fUr das Auftreten komplexerer lebender Systeme? Es ist die Fahigkeit der verschieden veranlagten Organismen, untereinander "genetische Information" auszutauschen, der Vorgang, den der Genetiker Rekombination nennt - allgemein besser bekannt unter dem Namen "Sex". Der selektive Vorteil der Sexualitat ist so direkt und so gro~, da~ wir annehmen k6nnen, Mechanismen fUr Genaustausch sind bereits in einem sehr fruhen Stadium der Geschichte des Lebens entstanden. Wir wollen diesen Vorteil anhand eines einfachen Beispiels eriautern: Ein primitiver Organismus, der die Aminosaure A synthetisieren, aber die Aminosaure B nur aus der Ursuppe beziehen kann, und ein anderer Organismus, der Aminosaure B synthetisieren kann, aber hinsichtlich Aminosaure A von der Ursuppe abhangig ist, k6nnten durch genetische Rekombination Nachkommen produzieren mit der Fahigkeit, beide Aminosauren zu synthetisieren und somit in einer an beiden Sauren armen Umwelt zu leben. Die genetische Umkombination kann den evolutiven Wandel beschleunigen und zur Emanzipation von der Umwelt beitragen. 1m Laufe der Zeit entwickelten sich zahlreiche Mechanismen, urn die Rekombination in jeder Beziehung zunehmend praziser werden zu lassen. Das Resultat war die Herausbildung komplizierter Chromosomenstrukturen, die Entstehung der Diploidie infolge des Erwerbs zweier homologer Chromosomensatze, von denen der eine vom Vater, der andere von der Mutter abstammt, sowie die Evolution eines verwickelten Meioseprozesses, in dessen Verlauf homologe Chromosomen untereinander Stucke austauschen, so da~ die Chromo so men von Vater und Mutter den Enkeln nicht intakt, sondern in neuer Zusammensetzung und mit einer neuen Genmischung ubermittelt werden. Diese Mechanismen regulieren die Neu2 kombination von Genen unter den Individuen, die die bei weitem bedeutendste QueUe der genotypischen Variabilitat bei hoheren Lebewesen ist. Das Ausma~ der genetischen Vielfalt innerhalb einer einzelnen sich fortpflanzenden Population wird durch ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Mechanismen geregelt, die entweder die Inzucht oder eine Kreuzung mit entfemt verwandten Individuen ("outbreeding") fordem. Extreme in dieser Hinsicht sind bei Pflanzen und niederen Tieren Mufiger als bei hoheren Tieren. Extreme Inzucht (Selbstbefruchtung) und extreme Kreuzung zwischen entfemt verwandten Populationen (regulare Bastardierung mit anderen Arten) sind bei hoheren Tieren selten. Inzucht und "outbreeding" sind grundverschiedene Lebenssysteme, bei denen jeweils zahlreiche Anpassungen auf harmonische Weise korreliert sind. Die Sexualitat hat zur Folge, da~ in jeder Generation immer wieder neue Genkombinationen von der Umwelt getestet werden konnen. Welch ein gewaltiges Potential dem bei der geschlechtlichen Fortpflanzung auftretenden Vorgang der genetischen Rekombination innewohnt, wird deutlich, wenn wir uns vergegenwartigen, da~ bei sich geschlechtlich fortpflanzenden Arten nie zwei Individuen genetisch identisch sind. Wir miissen zugeben: Sex ist etwas Wundervolles! Doch auch die Sexualitat hat ihre Nachteile. Urn dies deutlich zu machen, wollen wir das Modell eines Universums konstruieren, welches ausschlie~lich aus genetisch verschiedenen Lebewesen besteht, die nicht in Arten organisiert sind. In diesem Modell kann jedes Individuum mit jedem anderen Gene austauschen und umkombinieren. Gelegentlich fiihrt dies durch Zufall zum Zusammenbau neuer Genkomplexe mit einzigartigen adaptiven Vorteilen. Doch da in diesem speziellen Fortpflanzungssystem keinerlei Garantie besteht, da~ ein solches au~ergewohnliches Individuum nur mit Individuen eines ahnlich adaptiven Genotypus Gene austauscht und neukombiniert, wird dieser au~erst vorteilhafte Genotypus schlie~lich durch die Rekombination bei der Fortpflanzung unvermeidlich wieder zerstort werden. Wie la~t sich ein solches Mi~geschick vermeiden? Es gibt zwei mogliche Losungen, und die Natur versucht sie beide. Die eine Moglichkeit besteht darin, die geschlechtliche Fortpflanzung aufzugeben. Tatsachlich finden wir im gesamten Tierreich und sogar noch haufiger bei den Pflanzen eine Tendenz, voriibergehend oder fiir immer auf die Sexualitat zu verzichten, urn einem erfolgreichen 3 Genotypus Gelegenheit zu geben, sich Generation urn Generation unverandert zu replizieren und den Vorteil seiner einzigartigen Dberlegenheit zu genieBen. Die Geschichte der organischen Welt HiBt jedoch keinen Zweifel daran, daB ein solcher evolutiver Opportunist frillier oder spater scheitert. Die erste beste plotzliche Veranderung der Umwelt wird seinen genetischen Vorteil zu einem Nachteil werden lassen. Da er nicht die Fahigkeit besitzt, mit Hilfe der Rekombination neue genetische Variabilitat hervorzubringen, ist er unweigerlich zum Aussterben verurteilt. Die andere LOsung ist die ,,Erfindung" - man moge mir die Verwendung dieses anthropromorphischen Ausdrucks verzeihen der biologischen Art. Die Art ist eine Schutzeinrichtung; sie bietet die Gewahr, daB sich nur soIche Individuen miteinander fortpflanzen und untereinander Gene austauschen, die im groBen und ganzen den gleichen Genotypus besitzen. Innerhalb dieses Systems besteht nicht die Gefahr, daB die genetische Rekombination zu einer volligen Zerstorung von Genotypen fiihrt, da alle im Genpool einer Art vorhandenen Gene zuvor im Verlauf vieler Generationen auf ihre Fahigkeit der harmonischen Rekombination hin erprobt wurden. Dies schlieBt allerdings nicht aus, daB innerhalb einer Spezies betrachtliche Variabilitat herrscht. In der Tat lassen alle unsere Forschungen uns in zunehmendem MaBe erkennen, wie gewaltig die genetische Veranderlichkeit selbst innerhalb relativ einheitlicher Arten ist. Dennoch sind die grundlegenden Entwicklungs- und Homoostasesysteme bei allen Angehorigen einer Art im Prinzip dieselben. Dadurch, daB ich einfach die biologische Bedeutung des Begriffes Spezies erlautert habe, bin ich bewuBt der verdrieBlichen Frage nach der Definition dieses Begriffes ausgewichen. Ich mochte noch hinzufiigen, daB die Art ihre Funktion, gut aufeinander abgestimmte, harmonische Genotypen zu schiitzen, nur erfiillen kann, weil sie einige Mechanismen (sogenannte "Isolationsmechanismen") besitzt, weIche die Kreuzung mit Individuen anderer Arten verhindern. Bei unserem Entwurf eines perfekten Lebewesens sind wir nunmehr zu einem System gelangt, das mit der Mannigfaltigkeit seiner Umwelt fertigwerden kann und seinen koadaptierten, harmonischen Genotypus zu schiitzen imstande ist. Un serer Beschreibung nach scheint dieses wohlausgewogene System so konservativ zu sein, daB es keine Moglichkeit der Entstehung zusatzlicher neuer Systeme laBt. Ware diese SchluBfolgerung richtig, so wiirde sie uns in einen 4 echten Konflikt mit der Geschichte der Lebewelt stiirzen. Wie wir von den PaUiontologen erfahren, sind im Verlauf der geologischen Zeit fortwahrend neue Arten entstanden und mufl die Vervielfaltigung der Arten, urn das Aussterben von Arten auszugleichen, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit stattfinden. Wenn eine Spezies wirklich so vorziiglich angepaflt. so gut geschiitzt und so sinnreich ist, wie wir sie dargestellt haben, wie kann sie dann in zwei Tochterarten geteilt werden? Dieses schwierige Problem bereitete schon Darwin viel Kopfzerbrechen, und die Evolutionsforscher haben sich mehr als hundert Jahre lang damit auseinandergesetzt. Schliefllich zeigte sich, dafl es zwei mogliche Losungen gibt, oder vielleicht sollte ich besser sagen: dafl man gewohnlich zwei Losungen vorfindet. Die erstere kommt sehr haufig bei Pflanzen vor, ist aber im Tierreich selten. Sie besteht in der Verdoppelung des Chromosomensatzes, so dafl das neue Individuum nicht mehr ein dipioides Individuum mit zwei homologen Chromosomensatzen ist, sondern ein, nehmen wir einmal an, tetraploider Organismus mit vier Chromosomensatzen oder, wenn der Prozefl weitergeht, ein noch starker polyploides Lebewesen mit einer sogar noch hoheren Chromosomenzahl. Die Erzeugung eines polyploiden Organismus bedeutet sofortige Speziation; sie fiihrt mit einem einzigen Schritt zu einer Inkompatibilitat von Eltern- und Tochterspezies. Der andere Artbildungsmodus ist die Einfachheit selbst. Bisher haben wir die Spezies als etwas Starres, Einheitliches und Monolithisches dargestellt. Tatsachlich aber bestehen die natiirlichen Art en , vor aHem so lche , die weitverbreitet sind, ebenso wie die menschliche Spezies aus zahlreichen lokalen Populationen und Rassen, die sich in ihrer genetischen Zusammensetzung aHe mehr oder weniger unterscheiden. Einige dieser Populationen, insbesondere jene an den Grenzen des Verbreitungsgebietes der Art, sind voneinander und von der Stammspezies vollig isoliert. Nehmen wir einmal an, eine dieser Populationen wiirde lange Zeit hindurch am Genaustausch mit dem Rest der Art gehindert, da die isolierende Schranke - sei es nun ein Gebirgszug, eine Wiiste oder ein Wasserlauf - unpassierbar ist. Der Genpool der isolierten Population wird aHein durch die normalen Vorgange der Mutation, Rekombination und Selektion zunehmend starker von dem des Restes der Art abweichen und schliefllich einen Grad an Verschiedenartigkeit erreichen, wie er gewohnlich fiir eine eigene Spezies kennzeichnend ist. Dieser Vorgang, der als "geographische Speziation" bezeichnet wird, ist bei weitem der verbreitetste Artbildungsmodus im Tier5 reich und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch bei den Pflanzen. Ehe eine soIche im Werden befindliche Art sich als echte neue Art qualifizieren kann, mu~ sie im Verlauf der Neukonstruktion ihres Gengefiiges zwei Eigenschaften erworben haben. Erstens mu~ sie Isolationsmechanismen herausgebildet haben, die eine Kreuzung mit der Ausgangspezies verhindern, wenn die beiden wieder miteinander in Beriihrung kommen. Zweitens mu~ sie sich in ihren Anforderungen an die Umwelt - in ihrer Nischenausnutzung, wie der Okologe sagen wiirde - ebenfalls so weitgehend geandert haben, da~ sie Seite an Seite mit Mutter- und Schwesternarten leben kann, ohne der Konkurrenz zu erliegen. Verschiedene Arten lebender Systeme Bei unserer Erorterung der Evolution lebender Systeme habe ich mich bisher auf gewisse typische Vorgange oder Erscheinungen konzentriert, die fiir die Mannigfaltigkeit der Lebewelt verantwortlich sind, beispielsweise auf die Rolle der Mutation, der genetischen Rekombination und der Sexualitat, der biologischen Arten und des Artbildungsprozesses. Diese Vorgange liefern die Mechanismen, weIche die Vieigestaltigkeit der lebenden Welt moglich machen, sie bieten aber keine Erklarung dafiir, warum es iiberhaupt eine derart gewaltige Vielfalt des Lebens auf der Erde gibt. Es leben sicherlich mehr als drei Millionen Tier- und Pflanzenarten auf dieser Erde, vielleicht sogar mehr als fUnf Millionen. Welches Prinzip ermoglicht die Koexistenz einer soIchen Fiille verschiedener Arten? Diese Frage bereitete schon Darwin Kopfzerbrechen, und er fand eine Antwort darauf, die seither nichts von ihrer Giiltigkeit eingebOOt hat. Urn koexistieren zu konnen, miissen sich zwei Arten bei ihrer Ausnutzung der Umweltgegebenheiten geniigend unterscheiden, urn eine gefahrliche Konkurrenz zu verhindern. Wahrend der Speziation steht also eine hohe selektive Belohnung auf jedem Anderswerden gegeniiber den bereits bestehenden Arten, auf jedem Anderswerden im Ausprobieren neuer okologischer Nischen. Dieses Experimentieren mit neuen Anpassungen und neuen Spezialisierungen ist die wesentlichste Bedeutung des Artbildungsprozesses fiir die Evolution. Immer wieder einmal findet eine dieser neuen 6 Arten den Eingang zu einem ganz neuen adaptiven Lebensraum. Eine so1che Art war beispielsweise der ursprUngliche Ahnherr der erfolgreichsten aller Gruppen von Organismen, der Insekten, die heute mehr als eine Million Arten zahlen. Vogel, Knochenfische, Bliitenpflanzen sowie aIle anderen Tier-und Pflanzengruppen stammen letztlich von einer einzigen Ausgangsspezies abo Hat eine Art einmal eine leere adaptive Zone entdeckt und erschlossen, so kommt es zu einer regen Artbildung und zu adaptiver Radiation, bis diese Zone mit ihren Nachkommen ausgefiillt ist. Zur Vermeidung der Konkurrenz konnen die Organismen auf vielerlei Weise voneinander abweichen, zum Beispiel in der Gro~e. Obwohl in der Evolution generell ein Trend zu gro~erer Korpergro~e herrscht, haben sich einige Arten und Gattungen - haufig in denselben Gruppen, die gro~e Arten und Gattungen erzeugt haben - zu immer kleinerer Korpergro~e entwickelt. Geringe Korpergro~e ist keineswegs immer ein primitives Merkmal. Vielleicht der haufigste evolutionistische Trend ist die Spezialisierung auf eine sehr schmale Nische. Dies ist zum Beispiel die charakteristische Methode der Parasiten. Buchstablich Tausende von Parasiten sind auf einen einzigen Wirt, ja nur auf einen kleinen Teil des Wirtskorpers beschrankt. Zum Beispiel gibt es drei Milbenarten, die auf verschiedenen Teilen der Honigbiene leben. Eine derart extreme Spezialisierung ist bei den hoheren Pflanzen selten, wenn nicht vollig unbekannt, aber sie ist bezeichnend ffir die Insekten und erklart die enorme Geschwindigkeit, mit der diese neue Arten bilden. Die Tiefsee, dunkle Hohlen und das Liickensystem des Sandes entlang der Meereskiisten sind andere Biotope, die ebenfalls zur Spezialisierung fiihren. Das Gegenstiick des Spezialisten ist der "Generalist". Individuen solcher Arten besitzen eine betrachtliche Toleranz gegeniiber den verschiedenartigsten Veranderungen in Klima, Biotop .und Nahrung. Es sieht so aus, als sei es schwierig, ein erfolgreicher Nichtspezialist (Generalist) zu werden; die sehr wenigen Arten aber, die als so1che eingestuft werden konnen, sind weitverbreitet und individuenreich. Der Mensch mit seiner Fahigkeit, in allen Breiten und in jeder Hohenlage, in Wiisten und Waldern, von der reinen Fleischkost der Eskimos oder fast ganzlich vegetarisch zu leben, ist der Nichtspezialist par excellence. Einige Anzeichen lassen darauf schlie~en, da~ Nichtspezialisten iiber ungewohnlich reiche Genpools verfiigen und infolgedessen durch genetische Rekombination eine recht hohe Zahl minderwertiger Genotypen hervorbringen. Bei 7 weitverbreiteten und erfolgreichen Drosophila-Arten scheint die Quote der Letalgene groBer zu sein als bei seltenen Arten oder solchen mit engem Verbreitungsgebiet. Es ist nicht sicher, ob diese Beobachtung auch auf den Menschen anwendbar ist, aber so viel steht auBer Zweifel: die menschlichen Bevolkerungen weisen eine grol'e genetische Vielfalt auf. Beim Menschen haben wir nicht die krassen Unterschiede zwischen Morphotypen, wie sie bei vielen polymorphen Tier- und Pflanzenpopulationen an der Tagesordnung sind. Stattdessen finden wir ein relativ liickenloses Ineinanderiibergehen geistiger, kiinstlerischer, manueller und physischer Fahigkeiten (bzw. des Fehlens solcher Fahigkeiten). Doch ob nun kontinuierlich oder diskontinuierlich, seit langem schon ist die genetische Variation als eine niitzliche Einrichtung bekannt, mit deren Hilfe eine Art ihren Toleranzbereich erweitern und ihre Nische vergroBern kann. DaB dies auch fUr den Menschen gilt, wird oft verg~ssen. In der Erziehung beispielsweise hat man viel zu lange dazu tendiert, die erblich bedingte Verschiedenartigkeit der Menschen zu ignorieren, und hochst unterschiedlichen Begabungen identische Erziehungsprogramme aufzuzwingen versucht. Erst in jiingster Zeit sind wir zu der Erkenntnis vorgedrungen, daB Chancengleichheit Unterschiede in der Ausbildung verlangt. Individuen mit unterschiedlichen genetischen Anlagen haben keine gleichen Chancen, solange die Umwelt nicht unterschiedlich gestaltet wird. 1m Verlauf der Geschichte der Welt hat jede Zunahme in der Mannigfaltigkeit der Umwelt eine wahre Explosion von Speziationen zur Folge gehabt. Dies laBt sich besonders leicht fUr Veranderungen in der biotischen Umwelt nachweisen. Dem Entstehen der Wirbeltiere folgte eine spektakulare Entwicklung von SaugwUrmern, Bandwiirmern und anderen Wirbeltierparasiten. Die Insekten, deren Geschichte bis zum Palaozoikum, also fast 400 Millionen Jahre zuriickreicht, waren keineswegs besonders erfo19reich, bis sich vor ungefahr 150 Millionen Jahren die Bliitenpflanzen (Angiospermen) herausbildeten. Diese Pflanzen lieferten eine solche Fiille neuer adaptiver Zonen und Nischen, daB die Evolution der Insekten in eine wahrhaft explosive Phase eintrat. Ais eine Folge davon sind jetzt Dreiviertel der bekannten Tierarten Insekten. Die Gesamtzahl der Insektenspezies (einschlieBlich der noch unentdeckten Arten) wird auf nicht weniger als zwei oder drei Millionen geschatzt, von denen die meisten auf Bliitenpflanzen oder auf andere Insekten angepaBt sind. 8 Die Pflege des Nachwuchses Wenden wir uns nur noch einem weiteren Aspekt der Vielfalt der lebenden Systeme zu, der Sorge fiir den Nachwuchs. Hier stellen die Austern, die iiberhaupt gar nichts fUr ihre Nachkommen tun, das eine Extrem dar. Sie gie~en im wahrsten Sinne des Wortes Million en von Eiern und mannlichen Gameten ins Meer und schaffen somit die Moglichkeit der Befruchtung der Eier. Einige der daraus entstehenden Larven setzen sich an einem gUnstigen art fest und erzeugen neue Austern. Die statistische Wahrscheinlichkeit, da~ dies geschieht, ist infolge der Unwirtlichkeit der Umwelt au~erst gering, und obwohl eine einzige voll ausgewachsene Auster pro Fortpflanzungsperiode mehr als 100 Millionen Eier produzieren diirfte, hat sie im Durchschnitt nicht mehr als zwei Nachkommen. Der Umstand, da~ zahlreiche Arten mariner Organismen, von denen viele ungeheuer abundant sind und viele sogar eine Stammesgeschichte von mehreren hundert Millionen Jahren aufzuweisen haben, sich auf diese Weise fortpflanzen, zeigt, wie erstaunlich erfolgreich das In-die-Welt-setzen von Nachkommen vermittels dieser "Schrotflinten"-Methode sein kann. Wie anders ist die Fortpflanzung bei Arten, die Brutpflege betreiben! Hier ist stets eine drastische Verminderung der Nachkommenzahl erforderlich, und gewohnlich bedeutet die Fortpflanzung bei diesen Arten gewaltig vergro~erte dotterreiche Eier, die Entwicklung von Bruttaschen, Nestern oder sogar von inneren Plazenten und Mufig die Bildung einer Paarbindung, urn die Beteiligung des Mannchens an der Aufzucht der Jungen zu gewahrleisten. Die au~erste Entwicklung in dieser Richtung der Spezialisierung ist offensichtlich der Mensch mit seiner enorm verlangerten Kindheit. Verhaltensanpassungen sind ein wichtiger Bestandteil der Brutpflege, und unsere Behandlung der Evolution lebender Systeme ware unvollstandig, wiirden wir es unterlassen, uns kurz dem Verhalten und dem Zentralnervensystem zuzuwenden. Das Keimplasma eines befruchteten Eis enthalt in seiner DNS den Code eines genetischen Programms, welches die Entwicklung des jungen Organismus sowie seine Reaktionen auf die Umwelt steuert. Hinsichtlich der Genauigkeit der ererbten Information und des Ausma~es, in dem ein Individuum Erfahrungen verwerten kann, bestehen jedoch starke Unterschiede zwischen den Arten. Bei einigen Arten werden die J ungen allem Anschein nach mit einem geneti9 schen Programm geboren, das einen fast kompletten Satz gebrauchsfertiger, voraussagbarer Reaktionen auf Umweltreize enthalt. Von einem so1chen Organismus sagen wir, da~ sein Verhalten angeboren, instinktiv, nicht erlernt, da~ sein Verhaltensprogramm geschlossen ist. Das andere Extrem bilden Lebewesen, die weitgehend die Fahigkeit besitzen, sich Erfahrungen zunutze zu machen, zu lernen, wie sie auf die Umwelt reagieren miissen, Organismen, die in der Lage sind, ihrem Verhaltensprogramm weitere "Information" hinzuzufiigen, das folglich ein offenes Programm ist. Betrachten wir die offenen und geschlossenen Programme und ihr evolutionares Potential noch ein wenig genauer. Wir aIle kennen die Geschichte von den jungen Gansen, die Konrad Lorenz auf sich selbst pragte. Junge Ganse oder Entchen, die gerade erst aus dem Ei geschliipft sind, nehmenjedes sich bewegende Objekt (vorzugsweise jedoch eins, das geeignete Laute ausst5~t) als Elter an. Sind sie in einem Brutapparat ausgebriitet worden, so werden sie gew5hnlich ihrem Pfleger folgen und nicht nur diesen als ihren EIter, sondern auch sich selbst als Angeh5rige der menschlichen Spezies ansehen. Es kann dann vorkommen, da~ sie nach Erreichen der Geschlechtsreife dazu neigen, nicht eine andere Gans oder Ente, sondern stattdessen einen Menschen anzubalzen und zu umwerben. Der Grund fUr dieses scheinbar absurde Verhalten liegt darin, da~ das ausschliipfende Kiiken keine angeborene Kenntnis von der Gestalt seines Elterntieres besitzt; das einzige, was es besitzt, ist eine Bereitschaft, diese Gestalt in sein Verhaltensprogramm aufzunehmen. Sein genetisch gespeichertes Programm sieht eine Bereitschaft vor, das erste nach dem Ausschliipfen erblickte, sich bewegende Objekt als Elter anzunehmen. In der Natur ist dies natUrlich immer und ausnahmslos der Elter. SteIlen wir dieses offene Programm dem v511ig geschlossenen Programm eines anderen Vogels, des parasitaren Kuckucks, gegeniiber. Das Kuckucksweibchen legt seine Eier in die Nester verschiedener Singv5gel, z.B. des Wiesenpiepers, des Rohrslingers oder des Rotkehlchens, und kiimmert sich dann iiberhaupt nicht mehr urn sie. Der junge Kuckuck wird von seinen Pflegeeltern gro~gezogen, und doch trennt er sich von ihnen, sob aId er fliigge geworden ist, und fiihrt das typische Leben eines Kuckucks. FUr den Rest seines Lebens schlie~t er sich den Angeh5rigen seiner eigenen Art an. Die Gestalt seiner eigenen Art ist in dem genetischen Programm, mit dem der Kuckuck von Anfang an ausgestattet ist, unerschiitterlich verankert. Es ist - zumindest was das Erkennen der Artgenossen 10