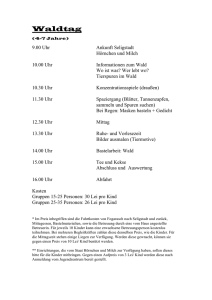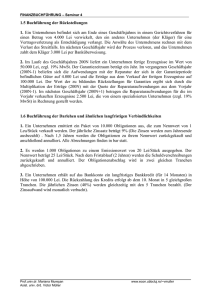Ethisch fragwürdige» Dollar-Deals
Werbung

3 Tages-Anzeiger – Donnerstag, 14. April 2016 Schweiz «Ethisch fragwürdige» Dollar-Deals Das Zürcher Bezirksgericht geisselt Ex-Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand wegen umstrittener Devisengeschäfte. Schuldig spricht es aber jene, welche die Deals publik gemacht haben. Im Fall Hildebrand ist das Bankgeheimnis verletzt worden: Das Bezirksgericht Zürich hat Ex-Bank-Sarasin-Mitarbeiter Reto T., der die Affäre um den obersten Schweizer Notenbanker ins Rollen gebracht hatte, sowie den Thurgauer SVPKantonsrat und Anwalt Hermann Lei für schuldig befunden. Es spricht – wie von der Staatsanwaltschaft beantragt – bedingte Strafen aus. Im Strafmass bleibt Einzelrichter ­Sebastian Aeppli aber unter dem Antrag der Anklagebehörde – bei T. sogar deutlich: Der ehemalige Bankangestellte erhält statt einer Freiheitsstrafe von einem Jahr eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 30 Franken. Lei müsste eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 340 Franken entrichten, sollte er bald erneut in ähnlicher Weise straffällig werden. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn 150 Tagessätze gefordert. Vom Ehrgeiz getrieben Hildebrand wird entschädigt Hildebrand war im Januar 2012 unter grossem öffentlichem Druck von seinem Amt zurückgetreten. Er hat 24 000 Franken Entschädigung für Verfahrenskosten beantragt, solidarisch getragen von Lei und T. Das Gericht sprach ihm fast Basler mit Rückenwind Unter den reichsten Ländern der Welt sind wir das reichste. Das geht im Alltag manchmal vergessen (das Wetter, die unpünktlichen Züge, wässriger Kaffee, irgendwas ist immer). Zum Glück, kann man da nur sagen, gibt es die Basler Verwaltung. Die kündigte gestern an, ihr erfolgreiches Projekt mit den kostenlos ausleihbaren Lastenvelos auch in diesem Sommer anzubieten. Diese «Kistenvelos» (man google «Bakfiets») sind mit einem E-Motor ausgestattet: «Die Teilnehmenden sind nicht nur leise und umweltfreundlich, sondern auch mit ‹Rückenwind› unterwegs», heisst es in der Mitteilung an der Grenze zur Euphorie. Und weil diese Velos eine «sinnvolle Alternative» zum Auto seien (und dabei nicht eben günstig) und weil der ­Kanton Basel-Stadt im Moment ­t atsächlich keine Geldsorgen hat, unterstützt er den Kauf eines solchen Velos zudem mit bis zu 1000 Franken. «S het, solang s het», heisst es in der Mitteilung. Ganz ernsthaft. (los) Thomas Knellwolf Die mildere Strafe für T. begründete der Einzelrichter damit, dass dieser nur ideelle Motive gehabt habe. Das Verschulden sei «sehr leicht». Lei habe sich hingegen zusätzlich auch «einen Sprung in seiner politischen Karriere erhofft». Richter Aeppli sprach Lei ideelle Motive ab. Dem Anwalt sei es einzig darum gegangen, Hildebrand zu stürzen. Aber auch das Bezirksgericht hält die Dollar-Deals des Notenbankers, auf welche die Verurteilten aufmerksam gemacht hatten, für «zumindest ethisch fragwürdig». Trotzdem sei es nicht gerechtfertigt gewesen, jene Wege zu beschreiten, die Lei und T. gewählt hatten. T. hat sich dabei laut mündlicher Urteilsbegründung von gestern mehrfach der Verletzung des Bank- und Geschäftsgeheimnisses schuldig gemacht, Lei der Gehilfenschaft zur Bankgeheimnisverletzung und der versuchten Verleitung dazu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Lei und T. hatten Ende 2011 den SVPChefstrategen Christoph Blocher über Devisendeals des Nationalbank-Präsidenten informiert. Blocher schaltete Bundespräsidentin Micheline CalmyRey ein, und er tauschte sich in jenen Tagen intensiv mit «Weltwoche»-Chef Roger Köppel aus. Schliesslich schnipselte Lei Dokumente, die T. bei der Bank Sarasin kopiert hatte, neu zusammen und schickte sie der «Weltwoche». Umstritten blieb in der Strafuntersuchung, wer in der Sache genau welche Rolle gespielt hatte. Das Verfahren gegen Blocher wurde eingestellt. Kreuz und verquer Bis zu 300 Franken Busse für Littering Der Thurgauer Kantonsrat Hermann Lei (l.) und Anwalt Valentin Landmann auf dem Weg zur Urteilseröffnung. Foto: Keystone 11 000 Franken zu. Hildebrand kann nun auswählen, von wem er wie viel davon beansprucht. Mit dem erstinstanzlichen Urteil dürfte die juristische Aufarbeitung der schlagzeilenträchtigsten Schweizer Affäre dieses Jahrzehnts noch nicht abgeschlossen sein. Der Verteidiger von Reto T., Viktor Györffy, bezeichnet den Schuldspruch seines Mandanten als «mit der Aktenlage nicht vereinbar». Lei sprach von einem «politischen Urteil». Sowohl Györffy als auch Leis Verteidiger Valentin Landmann prüfen einen Weiterzug ans Obergericht. Unzureichende Regeln geändert Zufrieden mit den Verurteilungen zeigte sich die Staatsanwaltschaft. Wegen des Strafmasses, das bei T. deutlich unter ihrem Antrag liegt, wird auch die Anklagebehörde die ausführlichere Begründung des Gerichts prüfen. Hildebrand geht straffrei aus. Devisentransaktionen von Nationalbank-Mitgliedern waren während seiner Amtszeit nicht ausdrücklich verboten. Das hat sich nun – auch dank den Verurteilten – geändert. Kommentar Von Thomas Knellwolf Ein Denkmal haben sie verdient, keine Strafe Ein Gericht hat Menschen verurteilt, weil sie etwas Gutes getan haben. Es sind zwar nur geringe Geldstrafen, bedingt ausgesprochen. Und doch sind es schmerzhafte Schuldsprüche für zwei Männer, die das Leben bereits genug bestraft hat. Reto T. hat nicht nur seine Bankstelle verloren, er ist auch gesundheitlich angeschlagen. Das über vier Jahre dauernde Strafverfahren hat ihn stark belastet – stärker noch als SVP-Lokalpolitiker Hermann Lei, dessen Anwaltstätigkeit zeitweise massiv eingeschränkt wurde. Die Thurgauer Kindergartenkollegen von einst werden bestraft, weil sie etwas Wichtiges getan haben: Ende 2011 war T. mit dicker Post in Leis Anwaltskanzlei spaziert. Er hatte an seinem Sarasin-Arbeitsplatz Unterlagen zu Deals des obersten Schweizer Notenbankers kopiert. Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand hatte es zugelassen, dass auf seinem Konto mit Devisen spekuliert wurde, was jetzt auch das Zürcher Bezirksgericht als «zumindest ethisch fragwürdig» bezeichnet. Trotzdem hat es T. und Lei schuldig gesprochen – und nicht Hildebrand. Aus einem einfachen Grund: Eine Verletzung des Bankgeheimnisses wird in der Schweiz bestraft, selbst wenn das Gesetz fragwürdiges Verhalten schützt. Hildebrands Deals wurden nicht einmal strafrechtlich untersucht. In den einschlägigen Bestimmungen war eine Selbstverständlichkeit nicht erwähnt worden: dass Währungsgeschäfte für Währungshüter tabu sind. Die versäumte Aufführung wurde mittlerweile nachgeholt – und das ist das Verdienst der Verurteilten. Statt einer Strafe hätten sie ein Denkmal verdient. Der Sockel müsste nicht allzu hoch sein, denn zu strahlenden Helden taugt das längst verfeindete Duo nicht. Die Ausfälle und Drohungen von T. gegen Staatsanwälte und andere Involvierte sind durch nichts zu entschuldigen, auch nicht durch grosse Verzweiflung. Und Hermann Leis Verrat an seinem Ex-Klienten T. ebenso wenig. Errichtet werden müsste ein Denkmal, das nicht heroisiert, sondern zum Denken anregt. Zum Beispiel zur Frage, weshalb in der Schweiz Insiderhandlungen kaum je geahndet werden, während Whistleblower praktisch immer verurteilt werden. Wer Abfall im öffentlichen Raum achtlos liegen lässt, statt ihn im Abfalleimer zu entsorgen, soll in Zukunft in der ganzen Schweiz mit einer Busse von bis zu 300 Franken bestraft werden. Der Bundesrat unterstützt die geplante Änderung des Umweltschutzgesetzes. Die Verschmutzung des öffentlichen Raumes durch Littering habe «ein bedenkliches Niveau erreicht», schreibt die Regierung in ihrer gestern publizierten Stellungnahme. Obwohl schon heute verschiedene Kantone das sogenannte Littering unter Strafe stellen, erachtet die Regierung eine landesweit einheitliche Busse als sinnvoll. Das Littering soll im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden, wenn der Täter auf frischer Tat ertappt wird. Das gilt aber nur für kleine Abfallmengen. Illegales Entsorgen grösserer Mengen Abfälle wird immer im ordentlichen Verfahren bestraft. Die geplante Gesetzesrevision geht zurück auf eine parlamentarische Initiative von Bauernverband-Direktor und Nationalrat Jacques Bourgeois. Der freisinnige Parlamentarier aus dem Kanton Freiburg hatte damit ein Anliegen der Bauern aufgenommen, die sich gegen die Verschmutzung ihrer Wiesen und Felder wehren und die Politik zum Handeln auffordern. Die nationalrätliche Umweltkommission (Urek) hatte daraufhin die nun vorliegende Gesetzesänderung ausgearbeitet. Zu dieser hat der Bundesrat jetzt Stellung genommen. Der Nationalrat wird voraussichtlich in der Sommersession über die Gesetzesänderung entscheiden, danach geht die Vorlage in den Ständerat. (SDA) Staatliche Auftragnehmer des Bundes dürfen nicht zu günstig offerieren Der Bund muss eine Analyse des SRG-Angebots neu vergeben. So will es das Bundesverwaltungsgericht. Die Universität Zürich soll zu tief offeriert haben. Iwan Städler St. Gallen Es kommt äusserst selten vor, dass das Bundesverwaltungsgericht einen Fall ­öffentlich berät. Gestern fand eine dieser raren Beratungen vor Publikum statt. Die Richter unterstrichen damit die grosse Tragweite, die sie ihrem Entscheid beimessen. Es ging um die Frage, ob das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) einen Auftrag zur Analyse des SRG-Onlineangebots korrekt vergeben hat. Oder ob die Universität Zürich, die den Zuschlag erhalten hat, die Arbeiten ungerechtfertigt mit Steuergeldern subventioniert. Dies ist auch weit über den konkreten Fall hinaus «von grundsätzli- cher Bedeutung», wie das Gericht festhält. Denn die Auftragsforschung ist für Schweizer Hochschulen eine wichtige Einnahmequelle. Gleichzeitig sind die Universitäten staatlich finanziert, was im Wettbewerb mit privaten Anbietern zu Verzerrungen führen kann. Auch bei anderen staatlichen Anbietern stellt sich diese Problematik. Im konkreten Fall hatte das Bakom die Analysen der SRG-Onlineangebote für die Jahre 2015 bis 2018 öffentlich ausgeschrieben. Mit ihnen soll überprüft werden, ob sich die SRG an die rechtlichen Vorgaben hält. Längere Texte darf das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen nämlich nur dann online stellen, wenn die Texte einen zeitlichen und thematischen Bezug zu einer Radiooder Fernsehsendung haben. So möchte der Bund verhindern, dass die SRG im Internet ein vollwertiges Newsportal betreibt und derart die privaten Verleger konkurrenziert. Den Auftrag für die Untersuchung vergab das Bakom ans Institut für Publizistikwissenschaft und Medienfor- schung (IPMZ) der Uni Zürich. Dieses hatte bereits in früheren Jahren ähnliche Analysen durchgeführt. Das Nachsehen hatte das private Medienforschungsunternehmen Publicom, das dagegen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einreichte. Günstiger als ein Malerlehrling Publicom ist überzeugt, dass das IPMZ ein sogenanntes Unterangebot eingereicht hat. Der offerierte Preis von rund 700 000 Franken sei nicht kostendeckend und nur möglich, weil die Zürcher Steuerzahler das Projekt über die Universität quersubventionieren würden. So habe das IPMZ zum Beispiel einen Stundenansatz von nicht einmal 60 Franken veranschlagt. Dies unterschreite sogar den Ansatz für einen Malerlehrling im 3. Lehrjahr. Auch habe es für die Arbeit des Projektleiters, Professor Michael Latzer, nichts verrechnet. Dieses Unterangebot, so Publicom, stehe im Widerspruch zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und zum Finanzreglement der Uni Zü- rich, das für solche Aufträge kostendeckende Entschädigungen verlange. Hätte sich das IMPZ an die Vorgaben gehalten, hätte es laut Publicom rund 70 Prozent höher offerieren müssen. Die Universität selber kann kein Unteran­ gebot erkennen. Das IPMZ habe reglementskonform offeriert und den Arbeitsaufwand korrekt berechnet. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun aber den Zuschlag ans IPMZ aufgehoben und das Geschäft ans Bakom zurückgewiesen. Dieses muss prüfen, ob von einem quersubventionierten Unterangebot ausgegangen werden muss. Ein solches sei nicht erlaubt, fanden drei der fünf Richter. Sie sprachen von einem «Lehrbuchbeispiel». Es gehe zu weit, wenn ein öffentlich-rechtliches Institut ganze Kostenpositionen gratis anbiete. Zwei der Richter vertraten dagegen die Ansicht, es sei nicht am Bakom, die Offerten auf ein allfälliges Unterangebot zu untersuchen. Wenn die Uni Zürich unter Kosten offeriere und Studien mit Steuergeldern quersubventioniere, sei dies ein Problem des Kantons Zürich. Das Gesetz sehe denn auch kein Verbot solcher Unterangebote vor. Letzteres räumten auch die obsiegenden Richter ein, beriefen sich aber aufs Wirtschaftsverfassungsrecht. Dieses wolle einen fairen Wettbewerb und gleich lange Spiesse für private und staatliche Anbieter. Einigung möglich Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus. Liegt sie vor, kann das Bakom den Entscheid vor Bundesgericht anfechten. Da die Analyse zeitlich dringlich ist, hat das Bundesverwaltungsgericht die Untersuchung für das Jahr 2015 durch das IPMZ schon erlaubt. Gestritten wird jetzt noch über die Jahre 2016 bis 2018. Ob ein definitives Urteil rechtzeitig vorliegt, ist unklar. Möglicherweise finden sich das Bakom und Publicom aussergerichtlich. Der privaten Medienforschungsfirma geht es um den Grundsatzentscheid: «Es kann doch nicht sein, dass wir mit unseren Steuern unsere Konkurrenz subventionieren», ärgert sich Geschäftsleitungsmitglied Stefan Thommen.