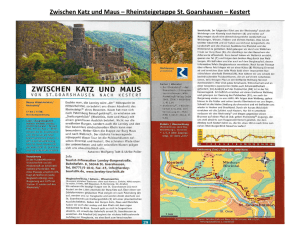bücher - BIOspektrum
Werbung

180_246_BIOsp_0210.qxd 04.03.2010 11:43 Uhr Seite 239 · BÜCH E R óóóóó Wörterbuch Labor/Laboratory Dictionary Deutsch-Englisch/EnglishGerman Theodor C. H. Cole XV, 453 S., Springer Verlag, Heidelberg, 2. Aufl., 2009. Geb., 49,95 O. ISBN: 978-3-540-88579-5 ó In den Lebenswissenschaften ist es heute selbstverständlich, wissenschaftliche Ergebnisse in englischer Sprache zu publizieren und zu kommunizieren. Dabei ist nicht nur die schriftliche Kommunikation internationalisiert, sondern auch die tägliche Kommunikation in den Laboren, in denen Forscher unterschiedlicher Nationalität gemeinsam arbeiten. Englisch und insbesondere das Verstehen moderner (englischer) Fachbegriffe ist daher eine unabdingbare Voraussetzung für das Arbeiten im Forschungslabor. Dies beginnt bei der Bezeichnung von Geräten, Chemikalien und anderen Labormaterialien und setzt sich fort bei der Beschreibung experimenteller Methoden. Viele dieser Begriffe lassen sich jedoch nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ableiten, insbesondere wenn ähnlich klingende Begriffe nicht die gleiche Bedeutung haben. Dies kann im Laboralltag, beim Verstehen wissenschaftlicher Texte und bei der richtigen Beschreibung der eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse zu Missverständnissen führen. Das Wörterbuch Labor bietet eine ausgezeichnete Hilfe, richtige Bedeutungen wichtiger Begriffe aus dem naturwissenschaftlichen Alltag und für die wissenschaftliche Kommunikation zu finden. Es BIOspektrum | 02.10 | 16. Jahrgang ist sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Wissenschaftler geeignet. Mithilfe des Wörterbuchs Labor kann man auch sein eigenes Fachwissen überprüfen und die Bedeutung selbst bekannter Fachausdrücke reflektieren. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn diese in der täglichen Kommunikation ohne genaue Übersetzung einfach ins „Labordeutsch“ übernommen werden, was zu Missverständnissen führen und die Verständlichkeit stark beeinträchtigen kann. Das Wörterbuch Labor bietet für viele Begriffe ausgezeichnete Erklärungen an, die eine Verbesserung der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse in Deutsch und Englisch ermöglichen. Es sollte daher in jedem Labor zur Grundausstattung gehören. ó Stefan Wölfl, Heidelberg óóóóó Lerntafel Biologie: Biochemie im Überblick Birgit Jarosch 6 S., 45 Abb., Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1. Aufl., 2009. Laminiert, 4,95 O. ISBN: 978-3-8274-2134-0 ó Biochemie im Überblick verschafft auf sechs abwaschbaren Falttafeln einen Überblick über die zentralen Gebiete der klassischen Biochemie. Die Falttafel beginnt mit der Struktur von Aminosäuren sowie der Listung der Strukturformeln der 20 proteinogenen Aminosäuren, der Bildung der Peptidbindung und einem Überblick über die Prinzipien der Proteinstruktur. Es schließt sich eine sehr detaillierte Übersicht zu der Funktion, dem Mechanismus, der Regulation und der Inhibition von Enzymen an. Auf Seite 3 werden der Aufbau von und der Transport durch Membranen beschrieben. Neben den Lipiden werden auch Glykolipide und integrale Membranproteine erwähnt, die Mechanismen des aktiven und passiven Transports werden ausgeführt. Die Seiten 4 bis 6 werden den Grundlagen des Glukose-, Glykogen- und Fettsäurestoffwechsels gewidmet. Die Struktur der wesentlichen Kohlenhydrate des Stoffwechsels wird dargestellt und die Hauptstoffwechselwege wie Glykolyse, Citratzyklus, oxidative Phosphorylierung, Glykogen- sowie Fettsäureauf- und -abbau werden illustrativ und teilweise auf Formelniveau erläutert. Kurz erwähnt wird die Bedeutung der Aminosäuresynthese und der Pentosephosphatzyklus. Biochemie im Überblick ersetzt kein Lehrbuch, kann aber eingesetzt werden, um sich zur Prüfungsvorbereitung die wesentlichen Begriffe einzuprägen. Zur Einarbeitung in ein Fachgebiet und zum Verständnis der Zusammenhänge ist es aufgrund der Knappheit der Information nicht geeignet. Die Tafeln sind aufwendig hergestellt und die klare Farbcodierung hilft, schnell die wesentlichen Elemente zu erfassen. Die Themenauswahl repräsentiert die wesentlichen Strukturen und Funktionen der Biomoleküle, wobei leider die Nukleinsäuren fehlen. Deren Vorkommen, Struktur und Bedeutung sollten zumindest erwähnt werden, gegebenenfalls auf Kosten des sehr umfangreichen Abschnitts zur Enzyminhibition. ó Annette Beck-Sickinger, Leipzig 239 ó ó ó ó óó Chemische Experimente in Schlössern, Klöstern und Museen Georg Schwedt XVI, 260 S., Wiley-VCH, Weinheim, 2. überarb. Aufl., 2009. Kart., 29,90 O. ISBN: 978-3-527-32718-8 ó Je eindrücklicher Wissen vermittelt werden kann, desto besser verstehen und behalten es die Zuhörer oder Leser. Dies gilt auch für chemisches Alltagswissen, das der Autor in einer historischen Umgebung, unterstützt mithilfe anschaulicher Experimente, plastisch erklärt. An 30 historischen Orten (Schlösser, Burgen, Klöster) in der gesamten Bundesrepublik organisierte er 50 Experimentalvorträge zu 28 chemischen Themen. Die Orte, an denen die Experimente durchgeführt wurden, sind knapp, aber für den Sinn des Buches ausreichend detailliert und illustriert beschrieben. Das Buch ist in 14 Kapitel mit unterschiedlichen Themen gegliedert: von Erz- und Salzgewinnung über Küchenchemie, chemische Belustigungen, Chemie in Flammen bis zum Zauberlabor von Harry Potter. Jedes Kapitel beginnt mit einer Erläuterung, die beispielsweise die Entdeckung von Erzen oder Farben beschreibt. Diese aus natürlichen Quellen gefundenen Rohstoffe veranlassten die Naturforscher der damaligen Zeit zu Experimenten und führten zu wichtigen Entdeckungen wie etwa die Gewinnung von Edelmetall durch Abscheidung. Die Durchführung dieser Versuche sowie das Hintergrundwissen werden erläutert, unterstützt durch historische Darstellungen von chemi- 180_246_BIOsp_0210.qxd 240 04.03.2010 11:43 Uhr Seite 240 K A R R I E R E , KÖ P F E & KO N Z E P T E · B Ü CH E R schen Küchen, Pflanzen und vorindustriellen Produktionsstätten. Das Buch ist ein origineller Reiseführer für Chemieinteressierte. Es lädt ein, die historischen Orte der Experimentalvorträge zu besuchen. Darüber hinaus bietet es Chemielehrern und -dozenten, die ihre Unterrichtsstunden attraktiv gestalten möchten, Versuche in einem neuen Kontext sowie Anregungen für Ausflüge. Studierende und Interessierte werden gerne darin schmökern und bislang unbekannte Details finden. ó Andreas Seiffert-Störiko, Frankfurt a. M. óóóóó Immunologie Michael Martin und Klaus Resch tation mit einem Keim schildert. Entsprechend ist der Aufbau dieses Lehrbuches logisch und gut nachvollziehbar und damit auch einprägsam. Sehr gut ist ebenso, dass trotz des beschränkten Platzes, den ein Taschenbuch nun mal bietet, alles Wesentliche enthalten ist und mit guten Grafiken illustriert wird. Natürlich ist bei so einem Format nicht immer alles wie gewünscht. So hätte ich es gerne gesehen, wenn beispielsweise die Komplementkaskaden mit den wichtigen Inhibitoren in einem zusammenfassenden Schema illustriert worden wären, da sie für die Studierenden schwierig zu begreifen sind. Auch liest sich die Sprache gelegentlich etwas umständlich – überwiegend wohl aufgrund der krampfhaften Vermeidung von englischen Fachbegriffen, was in diesem Fach eigentlich nicht möglich ist. Trotzdem ist das Buch verständlich geschrieben und durch die Merksätze am Rand zum Lernen sehr geeignet. So lässt sich zusammenfassend nur ausrufen: sehr empfehlenswert, und das bei dem Preis! ó Victoria Kolb-Bachofen, Düsseldorf 320 S., 101 Abb., 26 Tab., UTB Verlag, Stuttgart, 1. Aufl., 2009. Kart., 29,90 O. ISBN: 978-3-8252-3174-3 ó Endlich ist ein empfehlenswertes Immunologie-Lehrbuch im Taschenbuch-Format zu einem bezahlbaren Preis erschienen! Als Lehrende stand ich bisher vor dem Problem, dass ich den Studierenden nur ein wirklich gutes und lesbares Lehrbuch empfehlen konnte, das zwar ausgezeichnet ist, aber zu einem stolzen Preis und viel umfangreicher, als es ein Student zunächst benötigt. Nun ist also ein Taschenbuch erschienen, das die Immunologie nicht – wie so viele Autoren das machen – vom Schwanz her aufzäumt und bei den Antikörpern als einem Endprodukt der Immunreaktion anfängt, sondern die Reaktionskette des Immunsystems entlang der Ereignisse nach Konfron- ó ó ó ó óó Pavlov’s Dogs and Schrödinger’s Cat Rom Harré XIII, 322 S., 17 Abb., Oxford University Press, Oxford, 2009. Geb., 16,99 £. ISBN: 978-0-19-923856-9 ó Epistemologie ist die Lehre, wie Wissenschaft mental und apparativ betrieben wird, somit auch, wie wissenschaftliche Erkenntnis zustande kommt. Sie ist also mehr als Wissens- oder Wissenschaftsgeschichte, sondern befasst sich mit den Wechselwirkungen von Kenntnisgewinn und den Mitteln dazu. Der englische Mathematiker, Chemiker und Psychologe Rom Harré ist ein Senior der Methodologie der Wissenschaft und dadurch zur Betrachtung der Philosophiegeschichte des chemischen und biologischen Experiments gekommen. Dazu hat er die Gabe, seine Gedanken anregend und sehr lesenswert zu formulieren. In seinem neuen Buch stellt er dar, dass Versuchsergebnisse nicht bloß mit physikalischen Apparaten und chemischen Analysen im Laboratorium oder Observatorium erhalten werden, sondern dass es auch „lebende Laboratorien“ als Einzelwesen und Umwelten oder „virtuelle Laboratorien“ in Hirnwindungen und Kulturzellen gibt. Professor Harré überschaut in gedrängten Skizzen das vergangene Halbjahrtausend, in dem die Beobachtung und Nutzung von Pflanzen, Tieren und Menschen aus und in ihrer Umwelt zu Erkenntnis und Misserkenntnis beigetragen haben – betrübenden, erheiternden und erschreckenden. Dabei leitet ihn, neben dem Vergnügen, eine satte Geschichte zu erzählen, der Grundton, zum Verständnis beizutragen, wie die Umwelt erforscht, Vorstellungen geprüft und die Wirklichkeit modelliert werden kann. Pavlovs konditionierte Hunde und Schrödingers imaginierte Katze sind nur Grenzmetaphern für die vielerlei Wege, auf denen sich in organismischen Laboratorien Wissenschaft betreiben lässt. Dazu kommen Unterschiede und Traditionen im Forschungsstil. Dass der Autor auch ethische und moralische Fragen des Experimentierens mit lebenden Wesen mindestens zur abwägenden Andeutung kommen lässt, ist zusätzlicher Gewinn. ó Lothar Jaenicke, Köln óóóóó A Life Decoded J. Craig Venter 400 S., Penguin Books Ltd., London, 1. Aufl., 2008. Kart., 9,99 £. ISBN: 978-0-14-311418-5 ó Craig Venter ist einer der bekanntesten und kontroversesten Forscher unserer Zeit. Kaum ein Wissenschaftler stand so sehr im Rampenlicht der Medien, hat so viele Bewunderer, die seine Forschung für bahnbrechend halten, und so viele Gegner, die seine Methoden kritisieren und seine Ergebnisse infrage stellen. Aber seine zentrale Rolle bei einer der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte – der Entstehung der Genomforschung – steht außer Frage. In seiner Autobiografie beschreibt Venter sein ereignisreiches Leben. Es reicht von seiner nicht sehr vielversprechenden Jugend in Kalifornien über seine Stationierung in einem Militärlazarett während des Vietnamkrieges bis hin zu seiner Karriere als Forscher, dessen Team als erstes die Genome eines frei lebenden Organismus (Haemophilus influenzae, 1995), der Taufliege Drosophila (2000) und schließlich des Menschen (2001) sequenziert hat. Das alleine macht Venters Autobiografie zu einer spannenden Lektüre. Zudem ist das Buch sehr verständlich geschrieben. Dadurch liest es sich immer leicht, auch wenn Venter die unkonventionellen Methoden erklärt, die es ihm erlaubten, Genome schneller zu sequenzieren als seine Konkurrenten. Erfreulich ist auch, dass Venter nicht davor zurückschreckt, die vielfältigen politi- BIOspektrum | 02.10 | 16. Jahrgang 180_246_BIOsp_0210.qxd 04.03.2010 11:43 Uhr Seite 241 241 schen Intrigen und wirtschaftlichen Zwänge zu beschreiben, denen er über die Jahre ausgesetzt war. Damit gibt er Einblicke in eine Welt, die häufig verborgen bleibt. Natürlich ist eine Autobiografie kein objektives historisches Werk. Venter stellt seine Sicht der Dinge dar und entsprechend kritisch muss diese auch gesehen werden. Aber nachdem viel über ihn geschrieben wurde, ist es interessant, nun diese Seite der Geschichte zu lesen. Im September 2009 ist das Buch auch in deutscher Übersetzung erschienen (Entschlüsselt: Mein Genom, mein Leben, Fischer Verlag). ó Ralf Dahm, Padua óóóóó Nanobiotechnologien Philosophische, anthropologische und ethische Fragen Kristian Köchy et al. (Hrsg.) 372 S., Verlag Karl Alber, Freiburg, 2008. Kart., 29,00 O. ISBN: 978-3-495-48347-5 ó Die Vorsilbe „nano“ ist mit anderen Begriffen aus dem technisch-täglichen Leben zu einem offenbar so sorgenbehafteten Gewebe vertwisted, dass sich die Lebens- und Technikwissenschaften in einem multivarianten Netz mit den Geisteswissenschaften wiederfinden. Die Philosophen der Universität Kassel und die Bioethiker der Evangelischen Akademie Hofgeismar haben vor zwei Jahren die Initiative zu einer nanotechnologischen Begleitdiskussion ergriffen und gestandene Kollegen und Kolleginnen der diversen (neuen) Ethiken, Juridiken, Epistemien BIOspektrum | 02.10 | 16. Jahrgang zu einer Reihe interdisziplinärer Veranstaltungen eingeladen, um mit ihnen die Entwicklung zu begleiten. Der vorliegende Band lässt nun ein breiteres Publikum an dieser Diskussion teilnehmen. Was dem Leser als Erstes auffällt, ist die mit anglosaxophonen Wortkombinationen gespickte futurologische Sprache, die selbstgesättigt sein mag, aber hungrig nach Feststoff lässt. Muss das so sein? Es erinnert an die Blasensprache unserer Finanzjongleure. Alles, was im Feuilleton unterzubringen ist und eine Aura des Beschwingten gibt, findet sich – und macht misstrauisch. Man weiß: Alles ist vom besten Willen beseelt und durch Internetnews belegt. Jedoch ist alle Zukunftsbeschau eine Extrapolation. Mit der Nanotechnologie sollen die Grenze zwischen Belebtem und Unbelebtem überbrückt, neuer diagnostisch-therapeutischer Freiraum geschaffen, gezielt in den molekularen Nanobereich sondiert und manipuliert werden. Dabei zeigen sich in der Diskussion die kulturellen und nationalen Überlieferungsgrenzen, die vage Gewissensscheide zwischen Vision und Virtualität, die pygmalioneske Definition von „Modell“. Wenn Ethik von einem Absolutum des (wie definierten?) Menschenwerts gelöst zu einem Potenzialparameter der Nützlichkeit gemacht wird, brauchen wir bestimmt keine Diskussion und auch keine Philosophen oder Anthroposoziologen, die sich an ihr üben. Insofern ist das ein nützliches Buch. ó Lothar Jaenicke, Köln óóóóó Alien Ocean Anthropological Voyages in Microbial Seas Stefan Helmreich 464 S., 29 Abb., University of California Press, Berkeley, 2009. Kart., 24,95 $. ISBN: 978-0-5202-5062-8 ó Stefan Helmreich begleitete als Anthropologe über mehrere Jahre die Arbeit mariner Mikrobiologen in den USA. In sieben Kapiteln gelingt ihm das Kunststück, als teilnehmender und zugleich distanzierter Beobachter die Fragen, Methoden und Motivationen der Wissenschaftler zu beschreiben und in einen wissenschaftsgeschichtlichen und kulturellen Kontext zu betten. Er geht dabei der Frage nach, wie die Erkenntnisse und Fortschritte im Bereich der marinen Mikrobiologie unseren Blick auf den Ozean verändern. Die Rolle mariner Mikroorganismen für globale Nährstoffkreisläufe, Nahrungsnetze und die Klimageschichte der Erde, die Entdeckung mikrobieller Extrem-Habitate und die Spekulationen über die Entstehung des Lebens im Ozean – Stefan Helmreich skizziert sehr bildhaft, wie der Ozean als mikrobielles Meer und als „Gen-Pool“ neu entdeckt wird. Er beschreibt die biotechnologische Wertschöpfung dieses Wissens und die daraus entstehenden Konfliktlinien zwischen Kapital-, Wis- 180_246_BIOsp_0210.qxd 242 04.03.2010 11:43 Uhr Seite 242 K A R R I E R E , KÖ P F E & KO N Z E P T E · B Ü CH E R senschafts- und Regierungsinteressen. Der Anspruch des Buches ist es offenkundig nicht, einen wissenschaftlichen Überblick über die marine Mikrobiologie zu geben. Aber als Naturwissenschaftler empfand ich Helmreichs anthropologische Perspektive als sehr anregend, da sie die aktuelle Forschung in einem erweiterten Kontext betrachtet, der die Wechselwirkungen zwischen Forschungsgegenstand, Mensch und Kultur berücksichtigt. Auch wer sich als Wissenschaftler einmal aus der Distanz betrachten möchte, dem sei das Buch empfohlen. Die Sprache ist beschreibend und sehr bildhaft mit vielleicht etwas zu vielen feinsinnigen Bemerkungen. Über einige Anspielungen auf die anthropologische Fachliteratur lässt sich dagegen getrost hinweglesen. ó Moritz Holtappels, Bremen ó ó ó ó óó Chemical Biology Learning through Case Studies Herbert Waldmann und Petra Janning (Hrsg.) XXXIII, 271 S., Abb., Wiley-VCH, Weinheim, 1. Aufl., 2009. Kart., 39,90 O. ISBN: 978-3-527-32330-2 ó Die beiden Herausgeber vom Dortmunder MPI für Molekularphysiologie haben vor fünf Jahren unter dem gleichen Titel einen „Praktischen Kurs“ herausgebracht, der genau das vorhatte, nämlich Studierende der Molekularbiologie bei ihren chemischen Wurzeln zu halten, von denen zu trennen sie sich leicht verlocken lassen, weil die Methodik so hin- ter Screen und Plotter versteckt ist. Das vorliegende Buch möchte die Chemie der Biologie zurückbringen. Eine Anzahl von jungen aktiven Fachgenossen berichtet über Herangehensweisen an die Wechselwirkungen zwischen codierenden und/oder codierten Biomakromolekülen durch HefeGenomik und Mikroarray-Techniken, durch gezielten Proteinabbau oder reversible Nucleosomen-Dekompaktierung, durch native Peptid-Ligation oder -Konjugation, durch posttranslationale Modifizierung, Prenylierung, Glycosylierung von Schlüsselproteinen, DNA-Modifizierung durch Polyamid-Interferenz oder Quadruplexbildung. Schon diese Menükarte zeigt die Viersterne der vielen Köche. Allerdings müssen achteinhalb enge Seiten von Abkürzungen, das sind etwa 450 Tripelcodes (es gibt sogar die gleichen in Groß- und Kleinschrift) „geknackt“ werden, um durch das Ganze hindurchzufinden, wenn man tatsächlich das Ganze will. Der Index ist mancherorts ziemlich konfus. Dabei haben die Herausgeber sonst sehr systematisch gedacht und auch gehandelt, sowohl in der Wahl der Beiträger wie in der Binnenordnung der Beiträge: Einführung – Problematik – Vorgehensweise – Beispiele – Diskussion – Bewertung. Die Lektüre kann nicht leicht sein, aber man hat sich Mühe gegeben. Auch ist der Druck von Text und Formeln, Figuren und Legenden klar, die Ausstattung, auch der Preis vernünftig. Eine solche Monografie hat keinen Ewigkeitswert. Sie ist, was sie sein soll, ein sehr nützlicher Zustandsbegleiter bis zur nächsten Wegstrecke der chemischen Biologie struktureller und funktioneller Zellmoleküle.ó Lothar Jaenicke, Köln óóóóó Molekulare Onkologie Christoph Wagener und Oliver Müller 424 S., 360 Abb., 95 Tab., Thieme Verlag, Stuttgart, 3. Aufl., 2009. Geb., 99,95 O. ISBN: 978-3-1310-3513-4 ó Die Molekulare Onkologie hat sich seit ihrem Erscheinen zu einem Standardwerk für alle entwickelt, die sich aus beruflichen Gründen oder auch nur interessehalber mit den modernen Entwicklungen der Krebsforschung auseinandersetzen wollen. In der dritten, komplett überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe ist es den Autoren gelungen, unter Einbeziehung neuester Ergebnisse aus Grundlagenforschung und Klinik alle relevanten Aspekte der molekularen Onkologie, das heißt die komplexen Wege von der initialen Zellschädigung über die Tumorentwicklung und -progression bis hin zur Metastasierung, sowie die neuen Entwicklungen in Diagnostik und Therapie umfassend und doch anschaulich zu vermitteln. Die schon in den vorhergehenden Ausgaben hervorragende Didaktik wurde weiter ausgefeilt: Komplizierte Inhalte werden leicht verständlich dargestellt, komplexe Zusammenhänge anhand instruktiver Grafiken veranschaulicht. Besonders wichtige Kaskadenabläufe wurden animiert und können über www.onkoview.com abgerufen werden. Die Inhalte sind klar strukturiert, wichtige Kernaussagen werden hervorgehoben, der schnellen Orientierung dienen prägnante Zusammenfassungen sowie die Kennzeichnung klinischer und tierexperimenteller Aspekte. Die Molekulare Onkologie ist nicht nur ein Muss für alle Studierenden, die sich eingehender mit der Onkologie auseinandersetzen wollen: Wegen der zunehmenden Bedeutung molekularer Ansätze in der onkologischen Diagnostik und Therapie sollte sich auch jeder klinisch tätige Mediziner Grundkenntnisse auf diesem Gebiet aneignen. Aber auch forschende Onkologen können sich über angrenzende oder weiter entfernte Themen ihres Fachgebiets nirgendwo so schnell und so einfach informieren wie in diesem Buch. ó Wolfgang Deppert, Hamburg óóóóó Karrierechancen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie Toby Freedman 526 S., 47 Abb., Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2010. Kart., 39,95 O. ISBN: 978-3-8274-2116-6 ó Dieses Buch richtet sich an Biologen, Chemiker und andere Naturwissenschaftler sowie an Absolventen der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften oder des Marketingbereichs, die eine Karriere in der Biotechnologie- oder Pharmaindustrie anstreben. Es stellt die vielfältigen Berufsmöglichkeiten – von der industriellen Grundlagenforschung über das Projektmanagement bis hin zu Leitungsfunktionen und Personalbeschaffung – vor und beschreibt die Bedeutung der einzelnen Arbeitsfelder mit Aufgaben, KompetenBIOspektrum | 02.10 | 16. Jahrgang 180_246_BIOsp_0210.qxd 04.03.2010 11:43 Uhr Seite 243 · ST E L L E N M A R KT zen, Herausforderungen und Karrieremöglichkeiten überaus präzise. Anhand der Listung eines typischen Arbeitsalltags sowie der Darstellung positiver und negativer Aspekte der Tätigkeit werden dem Leser tief gehende Einblicke in die einzelnen Berufe ermöglicht. Charaktereigenschaften, die ein Bewerber für die Position keinesfalls haben sollte, finden sich in einem Kasten – so genügt ein Blick für die Entscheidungsfindung. Auch die erforderlichen bzw. erwünschten Qualifikationen für die Beschäftigungsmöglichkeiten geben gute Anhaltspunkte. Zusätzlich gibt das Buch nützliche Hinweise, wie ein Interessent seine Chancen verbessert, seine Lieblingsposition auch zu bekommen. Die Kapitel werden durch Angaben zu Schulungen, Berufsverbänden und Literatur- oder Internetempfehlungen sinnvoll er- BIOspektrum | 02.10 | 16. Jahrgang gänzt. In der deutschen Übersetzung sind wichtige deutsche Quellen hinzugefügt. Obwohl in Teilen sehr auf die Verhältnisse in den USA zugeschnitten – im Kapitel Behördenangelegenheiten könnte in einer zweiten Auflage eine Ergänzung zur Situation in Europa ein Gewinn sein – ist Karrierechancen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie ein wertvoller Ratgeber und Informationsquelle für all diejenigen, die in die Biotechnologieoder Pharmabranche wechseln oder dort ihre Karriere starten wollen. ó Gunvor Pohl-Apel, Frankfurt a. M. óóóóó óóóóó óóóóó óóóóó óóóóó = hervorragend = sehr gut = gut = mittelmäßig = schwach 243