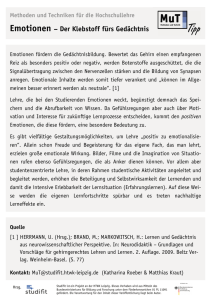Kognitive und affektive Einflüsse auf Einstellungen in
Werbung

National Centre of Competence in Research (NCCR) Challenges to Democracy in the 21st Century Working Paper No. 21 Kognitive und affektive Einflüsse auf Einstellungen in direktdemokratischen Kampagnen Christian Schemer, Werner Wirth, Jörg Matthes June 2008 Institute of Mass Communication and Media Research (IPMZ) University of Zurich Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich Kognitive und affektive Einflüsse auf Einstellungen in direktdemokratischen Kampagnen1 Christian Schemer, Werner Wirth und Jörg Matthes 1 Einleitung In neuerer Zeit beschäftigt sich eine Reihe von Studien mit dem Einfluss von Affekten, Emotionen oder Stimmungen auf politische Entscheidungen. Ein Grossteil der Forschung stammt dabei aus den USA und fokussiert dementsprechend auf Präsidentschaftswahlen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist das Forschungsinteresse in Europa an dieser Frage weniger stark ausgeprägt. Vereinzelt finden sich Studien, die den Emotionseinfluss auf politische Einstellungen oder politisches Verhalten untersuchen (Montada/Schmidt 1989; Opp 1986; Schoen 2006). Die Bedeutung von Emotionen, Affekte oder Stimmungen bei der Entscheidungsbildung über politische Sachfragen in Abstimmungen wurde bislang kaum untersucht. Dieser Frage widmet sich die vorliegende Untersuchung. In einem ersten Schritt wird auf die Befundlage bisheriger Studien zum Affekteinfluss auf Einstellungen und Präferenzen bei Wahlen eingegangen. Anschließend wird der Unterschied zwischen politischen Entscheidungen bei Wahlen bzw. bei Abstimmungen herausgearbeitet. Darauf baut die empirische Studie auf, die den Einfluss von Affekten im Zusammenhang mit einer Abstimmung über die Asylgesetzverschärfung in der Schweiz im September 2006 untersucht. 2 Der Einfluss von Affekten auf politische Entscheidungen Die erste systematische Untersuchung zum Einfluss von Affekten auf politische Einstellungen zu Präsidentschaftskandidaten stammt von Abelson und Kollegen (1982). In dieser und auch in den nachfolgenden Studien wird Affekt als Überbegriff für Emotionen, Stimmungen oder Gefühle gegenüber politischen Kandidaten oder anderen Einstellungsobjekten verstanden. Dabei ist vor allem die Valenzdimension von Emotionen gemeint. Mit anderen Worten es wird unterschieden, inwiefern Wählerinnen 1 Kontakt: Christian Schemer, IPMZ – Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, [email protected] und Wähler negative Emotionen, wie Angst oder Ärger bzw. positive Emotionen, wie Freude oder Hoffnung, gegenüber politischen Kandidaten empfinden. Für diese Studien spielen aber differenzielle Emotionen in der Regel keine bedeutsame Rolle (vgl. aber Conover/Feldman 1986; Montada/Schmidt 1989). Weiter wird davon ausgegangen, dass Affekte unabhängig von Charakterbewertungen oder kognitiven Einschätzungen sind, z.B. der Kompetenz und Problemlösungsfähigkeit von politischen Kandidaten. Beispielsweise haben Abelson und Kollegen (1982) in zwei Studien Wählerinnen und Wähler befragt, in wiefern sie gegenüber unterschiedlichen Präsidentschaftskandidaten positive und negative Emotionen empfinden. Gleichzeitig wurde nach Charakterbewertungen zu diesen Politikern gefragt, z.B. mutig, voreingenommen oder ehrlich. Schließlich wurden die Befragten gebeten, ihre Kandidatenpräferenz mittels eines Feeling-Thermometers anzugeben. In der Analyse wurde dann diese Kandidatenpräferenz auf positive und negative Affekte sowie auf positive und negative Charakterbewertungen regrediert und dabei die Parteiidentifikation kontrolliert. Im Ergebnis zeigt sich erstens, dass positive und negative Affekte (ebenso wie die Charakterbewertungen) gegenüber politischen Kandidaten unabhängige Affektdimensionen sind. Zweitens können die Autoren belegen, dass bei manchen Kandidaten (z.B. Kennedy) sowohl positiver als auch negativer Affekt gleichermaßen signifikante Prädiktoren für die Präferenz sind. Gleichzeitig sind affektive Bewertungen wichtiger für die Kandidatenpräferenz als Charakterbewertungen gegenüber Kennedy. Bei Reagan waren positive Charakterbewertungen am wichtigsten, negativer Affekt hatte ebenfalls einen Einfluss auf die Kandidatenpräferenz, positiver Affekt hingegen nicht (Abelson u.a. 1982). In der Folge wurde eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die ähnlich vorgingen und den Einfluss von positivem und negativem Affekt unter anderem auf Kandidateneinstellungen (Granberg/Brown 1989; Marcus/MacKuen 1993; Ottati 1997), Einstellungen gegenüber Minderheiten (Haddock/Zanna, 1993; Kuklinski u.a. 1991; Stan- gor/Sullivan/Ford 1991), gegenüber Umweltrisiken (Karger/Wiedemann 1998), der Todesstrafe (Haddock/Zanna 1998), der Abtreibung ungeborenen Lebens (Breckler/Wiggins, 1989) oder der wirtschaftlichen Entwicklung (Conover/Feldman 1986) untersucht haben. Die meisten Studien wurden dabei im US-amerikanischen Raum durchgeführt. Nur vereinzelt finden sich Studien im europäischen oder deutschsprachigen Raum. Opp (1986) zeigt etwa, dass Angst ein bedeutsamer Prädiktor für die Bereitschaft ist, sich an der Antikernkraftbewegung zu beteiligen. Montada und Schneider (1989) belegen, dass z.B. Ärger über das Unrecht gegenüber sozial Benachteiligten bedeutsam für prosoziales Verhalten ist. In einer neueren Studie untersucht Schoen (2006) den Einfluss von Angst auf politische Einstellungen. Dabei zeigt sich, dass Angst im Zusammenhang mit dem Golfkrieg Anfang der 90er Jahre dazu führt, dass ein deutscher Truppeneinsatz in der Golfregion abgelehnt wird. Gleichzeitig führt Angst zu einer schlechteren Bewertung der damaligen Regierung, während sich die Bewertung der Opposition unter dem Angsteinfluss verbesserte. Insgesamt kommt man auf Basis der bisherigen Studien zu dem Schluss, dass Emotionen einen bedeutsamen Einfluss auf politische Einstellungen haben. Allerdings weist die Durchsicht früherer Studien auch auf einige Desiderate hin: Erstens ist die Forschung – von Ausnahmen abgesehen – auf den US-amerikanischen Sprachraum beschränkt. Zweitens sind die meisten Studien Querschnittstudien und können daher keine Aussage über die Veränderung des Affekteinfluss im Laufe einer Kampagne treffen. Drittens liegt der Schwerpunkt der empirischen Studien bis anhin auf der Untersuchung von affektiven Einflüssen auf Kandidaten- und Parteipräferenzen. D.h. der Affekteinfluss auf Urteile und Einstellungen im Zusammenhang mit Sachfragen in Themenkampagnen wurde weitaus seltener untersucht. Zur Bedeutung von Emotionen bei direktdemokratischen Entscheiden liegen also keine empirischen Befunde vor. Man kann aber annehmen, dass die Entscheidungssituation bei Wahlen bzw. Abstimmungen im Rahmen von direktdemokratischen Verfahren sich unterscheiden und daher auch Unterschiede im Affekteinfluss auf Einstellungen auftreten können. 3 Der Einfluss von Affekten bei Wahlen vs. Abstimmungen Obwohl Wahlen und Abstimmungen einige Gemeinsamkeiten aufweisen, gibt es eine Reihe von Unterschieden, die zu der Annahme führen, dass Emotionen bei Abstimmungen weniger bedeutsam sind als bei politischen Wahlen. Zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Wahlen wie auch Abstimmungen sind politische Akte der Entscheidung durch das Stimmvolk, die politische Akteure zur Ausübung von Macht legitimieren (vgl. hierzu etwa Jenkins/Mendelsohn 2001; LeDuc 2002; Mittendorf 2002). Der Einfachheit halber wird im Weiteren nicht weiter zwischen unterschiedlichen Formen von Abstimmungen unterschieden (vgl. hierzu Kriesi 2005). Beide Legitimationsvorgänge stellen Kommunikationsereignisse dar, die mehr oder weniger stark von Kampagnen begleitet werden, die sowohl auf Aufmerksamkeit als auch Unterstützung durch das Stimmvolk zielen (Jenkins/Mendelsohn 2001; Mittendorf, 2002). Bei genauerer Betrachtung finden wir jedoch einige Unterschiede zwischen Wahlen und Abstimmungen, die für die vorliegende Frage – Emotionseinfluss auf politische Entscheidungen des Elektorats – relevant sind: Durch Wahlen erhalten politische Akteure „generalisierte Handlungsmacht, die auf unverbindlicher Einhaltung von Versprechungen beruht“ (Mittendorf 2002: 281). Bei Abstimmungen hingegen geht es primär um konkrete Problemlösungsvorschläge. D.h. das Wahl- oder Stimmvolk hat bei Abstimmungen konkrete Erwartungshaltungen in Bezug auf ein zu lösendes Problem, bei Wahlen ist die Erwartungshaltung sehr unspezifisch, weil sie sich kaum auf konkrete Maßnahmen richtet. Ein weiterer Unterschied ist der kognitive Anspruch an den Souverän. Bei Wahlen ist der kognitive Anspruch geringer, weil kaum über konkrete Sachfragen entschieden wird, sondern über das politische Personal. Bei Abstimmungen hingegen ist ein Mindestmass an kognitivem Aufwand notwendig, ansonsten können die zur Abstimmung stehenden konkreten politischen Alternativen nicht beurteilt werden (Jenkins/Mendelsohn 2001; Mittendorf, 2002). Der für die vorliegende Fragestellung wichtigste Unterschied bezieht sich auf die Kampagnen die Wahlen bzw. Abstimmungen begleiten. In Wahlen spielen die politischen Kandidaten und Kommunikationsstrategen eine zentrale Rolle in der Kampagne. Bei Abstimmungen kann zwar auch eine zunehmende Personalisierung der Kampagne attestiert werden (vgl. etwa de Vreese/Semetko 2004; Marcinkowski 2007). Allerdings agieren bei Abstimmungen aber neben dem politischen Personal und Parteien auch Interessenverbände unterschiedlichster Couleur in der Kampagne. Mittendorf (2002; vgl. auch Jenkins/Mendelsohn 2001; Kriesi 2005: 12) vermutet denn auch, dass bei Abstimmungen die Kommunikation von konkreten Maßnahmen im Mittelpunkt stehen, während bei Wahlen die personenbezogene Kommunikation zentral ist. Diese Unterscheidung kann man auch als Image- vs. Issue-Orientierung bezeichnen (vgl. etwa Kaid 2004). Wahlen sind stärker image-orientiert, d.h. die Wahlkampfkommunikation dreht sich vermehrt um das Image des politischen Personals bzw. der Parteinen als Akteur. Abstimmungen sind eher issue-orientiert, weil die Kommunikation stärker auf die Vermittlung von Sachthemen gerichtet ist, über die abgestimmt wird (vgl. Mittendorf 2002). Eine Reihe von experimentellen Studien zeigt, dass etwa politische Werbung oder Botschaften bei Wahlen, die das Image von Kandidaten auf Kosten politischer Standpunkte zu einem Thema in den Vordergrund stellen, Rezipienten stärker emotional ansprechen (Dalto/Ossoff/Pollack 1994; Kaid 2004). In der Studie von Dalto und Kollegen (1994) zeigt sich beispielsweise, dass eine Rede von Präsident Bush positivere Emotionen hervorruft, wenn sie image-orientiert ist, also wenn die Persönlichkeit des Präsidenten im Fokus steht, und nicht so sehr die politische Substanz des Themas. Mit der Unterscheidung zwischen Image- und Issue-Orientierung ist jedoch nicht gemeint, dass Abstimmungskampagnen per se issue-orientiert und Wahlen per se image-orientiert sind. Es handelt sich dabei um graduelle Unterschiede, die auch davon abhängen, welche Themen in Wahl- oder Abstimmungskämpfen behandelt werden. Bei manchen Themen, die zur Abstimmung kommen, mögen Emotionen eine geringere Rolle spielen, bei anderen Themen wiederum eine größere (vgl. hierzu etwa LeDuc 2002). Beispielsweise eignen sich Themen wie Ausländerpolitik oder Innere Sicherheit oder Terrorbekämpfung sehr gut für emotionalisierende Kampagnen, sei es bei Wahlen oder bei Abstimmungen. D.h. letztlich bleibt es eine empirische Frage, welchen Einfluss Emotionen für Urteilsbildung bei Abstimmungen haben. 4 Forschungsfragen und Methode Aufbauend auf diesen Überlegungen und in Anlehnung an frühere Studien zur Rolle von Affekten bei Wahlen, wurde eine Panelbefragung durchgeführt. Die Befragung fand im Rahmen einer Kampagne im Jahr 2006 in der Schweiz statt, bei der es um die Abstimmung über die Verschärfung des Asylgesetzes ging. Genauer gesagt, sah ein Gesetzesvorschlag eine Verschärfung des Asylgesetzes vor, gegen den die Gegner insbesondere aus der politischen Linken das Referendum ergriffen (vgl. zur Koalitionsbildung im Detail Kriesi/Bernhard/Hänggli 2008). Dabei umfasste die Gegnerschaft der Asylgesetzverschärfung sowohl die politische Linke (SP, Grüne), Kirchen, Menschenrechtsorganisationen als auch Intellektuelle aus Kunst und Literatur. Die bürgerlichen und konservativen Parteien (CVP, SVP, FDP) waren mehrheitlich für eine Verschärfung des Asylgesetzes. Um die Bedeutsamkeit des Emotionseinflusses bemessen zu können, ist ein Vergleich zu anderen Einflussgrößen notwendig. In den Studien von Abelson und Kollegen (1982) oder auch Nachfolgestudien wird in der Regel getestet wie stark der Emotionseinfluss im Vergleich zu kognitiven Bewertungen, z.B. Kompetenzbewertungen bei Kandidaten oder die Zustimmung zu Argumenten bei Themeneinstellungen .In der vorliegenden Studie wird daher die Forschungsfrage untersucht, welchen Einfluss affektive im Unterschied zu kognitiven Faktoren auf die Einstellung zum Asylgesetz haben. Da bei Abstimmungskampagnen konkrete Problemlösungsstrategien im Mittelpunkt stehen, sind Gegner und Befürworter in der Kampagne darum bemüht, Pround Contra-Argumente zu vermitteln, um das Stimmvolk zu überzeugen. Argumente sollen Stimmbürgerinnen und –bürger kognitiv ansprechen und überzeugen. Daher kann man die für die Kampagne wichtigen Argumente als kognitive Aspekte oder Bewertungen verstehen, die im Unterschied zu affektiven Faktoren, die Einstellung beeinflussen sollten. Außerdem wurde in einer zweiten Forschungsfrage untersucht, wie sich diese Einflüsse im Verlauf der Kampagne ändern. 4.1 Stichprobe und Durchführung der Befragung Die Abstimmung über das Asylgesetz fand am 24. September 2006 statt. Die Asylgesetzverschärfung wurde von 67,8% der Stimmbürgerinnen und –bürger gutgeheißen. Die erste von drei Wellen der Panelbefragung dauerte von 4. bis zum 20. Juli 2006, die zweite vom 28. August bis 2. September 2006, und die letzte Welle folgte direkt im Anschluss an die Abstimmung (d.h. vom 25. bis 30. September 2006). Die zweite Befragungswelle wurde kurz vor den Zeitpunkt gelegt, zu dem die Abstimmungsunterlagen verschickt wurden. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Befragten nicht schon per Briefpost abgestimmt haben. Die Stichprobe umfasste in der Schweiz Stimmberechtigte und ist repräsentativ für die deutsch- und französischsprachige Schweiz. Die erste Welle umfasste 1725 realisierte Interviews, die zweite 1415 und die dritte 1094. Die vorliegende Analyse basiert auf den Daten von Befragten, die zu allen drei Zeitpunkten befragt werden konnten. Aufgrund von fehlenden Werten bei einigen Fragen reduzierte sich das Sample auf letztlich 1037. 4.2 Messung Um den Emotionseinfluss für die Einstellungsbildung zu erheben, wurden positive und negative Emotionen gegenüber Asylbewerbern abgefragt. Als negative Emotionen gegenüber Asylbewerbern wurden drei Items gewählt: Angst, Ärger und Unbehagen (Cronbachs α = .73 in Welle 1, .76 in Welle 2 und .78 in Welle 3). Als positive Emotionen wurden ebenfall drei Items abgefragt: Freude, Hoffnung und Stolz (Cronbachs α = .72 in Welle 1, .78 in Welle 2 und .79 in Welle 3). Eine konfirmatorische Faktoranalyse belegte die Zweidimensionalität des Konstruktes. Analog wurden kognitive Bewertungen im Zusammenhang mit der Asylgesetzverschärfung erhoben. Die kognitiven Bewertungen umfassten die in der Kampagne wichtigen Argumente. Diese wurden aus dem Kampagnenmaterial von Gegnern und Befürwortern sowie aus ersten Medienberichten zum Thema extrahiert und in einer ersten Studie (repräsentative Befragung in der Deutschschweiz, Juni 2006, N = 500) getestet. Als positive Kognitionen werden die wichtigsten Argumente der Gegner der Asylgesetzverschärfung bezeichnet. Diese drehten sich um Menschenrechtsschutz für Asylbewerber und die Wahrung der humanitären Tradition der Schweiz. Die positiven Kognitionen wurden mit drei Items gemessen (z.B. „Die Grundrechte der Asylbewerber müssen geschützt werden“, Cronbachs α = .61 in Welle 1, .65 in Welle 2 und .68 in Welle 3). Negative Kognitionen bezogen sich auf die Argumente der Befürworter einer Verschärfung. Dabei argumentierten die Befürworter mit einer Effizienzsteigerung bzw. Missbrauchsbekämpfung. Zur Messung wurden drei Items abgefragt (z.B. „In der Asylpolitik braucht es einen effizienteren Vollzug“, Cronbachs α = .73 in Welle 1, .77 in Welle 2 und .82 in Welle 3). Auch hier bestätigt eine konfirmatorische Faktoranalyse die Zweidimensionalität des Konstrukts. Die Items zu affektiven und kognitiven Einflussgrößen wurden auf fünfstufigen Ratingskalen abgefragt (1 „stimme voll und ganz zu bis 5 „stimme überhaupt nicht zu“). Als Kontrollvariablen wurden erhoben: Geschlecht (52% weiblich), Alter (M = 48.18, SD = 17.11), Bildung (höchster Bildungsabschluss, 68% keine (Fach-)Hochschulreife), Links-Rechts-Selbsteinschätzung (zehnstufige Skala von 1 „links“ bis 10 „rechts) und allgemeines politisches Interesse („Wie interessiert sind Sie eigentlich im Allgemeinen an der Politik?“ 1 „überhaupt nicht interessiert“ bis 4 „sehr interessiert“). Als zentrale abhängige Variable wurde die Einstellung zum Asylgesetz mit einem Item erhoben („Ich bin für eine Verschärfung der Asylpolitik in der Schweiz“, 1 „stimme überhaupt nicht zu“ bis 10 „stimme voll und ganz zu“). Die Kontrollvariablen wurde nur zum ersten Messzeitpunkt erhoben, alle anderen Variablen zu allen drei Wellen. 5 Ergebnisse der Panelstudie Um den affektiven im Unterschied zum kognitiven Einfluss auf die Einstellung zum Asylgesetz zu analysieren, wurde für alle drei Befragungswellen separat eine schrittweise Regression gerechnet. In einem ersten Schritt wurde die Einstellung auf die Kontrollvariablen regrediert, dann auf die kognitiven Bewertungen und schließlich auf die affektiven Faktoren. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt (Tabelle 1). Erstens zeigt sich, dass die Kontrollvariablen über alle Befragungswellen einen Erklärungsanteil von 26% an der Varianz der Einstellung haben. Bildung und LinksRechtsselbsteinschätzung sind signifikante Prädiktoren der Einstellung zum Asylgesetz. D.h. Befragte mit niedrigeren Bildungsgraden und solche, die sich weiter rechts im politischen Spektrum einordnen, sind für eine Verschärfung des Asylgesetzes. Die weiteren Kontrollvariablen sind nicht signifikant mit der Einstellung zum Asylgesetz assoziiert. Tabelle 1 Einfluss von Emotionen, Kognitionen und Kontrollvariablen auf die Einstellung zum Asylgesetz (schrittweise Regression, unstandardisierte Regressionskoeffizienten, Standardfehler in Klammern) Einstellung zur Asylgesetzverschärfung Welle 1 Welle 2 Welle 3 -.06 (.12) .02 (.13) .10 (.13) .00 (.01) .00 (.01) -.00 (.01) -.10** (.02) -.11** (.02) -.09** (.02) Links-Rechts-Selbstein- schätzung.22** (.03) .25** (.04) .23** (.03) -.05 (.01) .02 (.09) .05 (.09) .26** .26** .26** Negative Kognitionen 1.39** (.08) 1.25** (.08) 1.35** (.08) Positive Kognitionen -.58** (.08) -.54** (.09) -.58** (.09) .29** .25** .27** Negative Emotionen .44** (.07) .32** (.07) .35** (.07) Positive Emotionen -.22** (.05) -.21** (.08) -.14** (.08) .02** .01** .01** .57 .52 .54 Einflussfaktoren Block 1: Kontrollvariablen Geschlecht Alter Bildung Politisches Interesse ∆R2 Block 2: Kognitionen ∆R2 Block 3: Affekte ∆R2 Korr. R2 N= Der zweite wichtige Befund bezieht sich auf den Einfluss von positiven und negativen Kognitionen, d.h. die Zustimmung zu Pro- und Contra-Argumenten. Positive und negative Kognitionen zusammen machen einen ähnlich großen Erklärungsanteil aus wie die Kontrollvariablen. Je grösser die Zustimmung zu Argumenten der Verschärfungsbefürworter (negative Kognitionen), desto eher sind die Befragten für die Asylgesetzverschärfung. Umgekehrt führt die Zustimmung zu den Argumenten der Verschärfungsgegner (positive Kognitionen) zu einer Ablehnung der Asylgesetzverschärfung. Im Vergleich zeigt sich, dass negative Kognitionen die Einstellung zum Asylgesetz stärker beeinflussen als positive. Über alle Wellen hinweg ist der Erklärungsanteil der negativen Kognitionen mehr als doppelt so groß verglichen mit dem Erklärungsanteil der positiven Kognitionen. Hier zeigt sich ein allgemeiner Negativity Bias (z.B. Baumeister u.a. 2001), d.h. negative Aspekte wiegen schwerer als positive. Im dritten Block wurde die Einstellung auf positive und negative Emotionen regrediert. Im Ergebnis wird ein signifikanter Affekteinfluss auf die Einstellung zum Asylgesetz deutlich. D.h. affektive Einflüsse leisten einen Erklärungsbeitrag von 1 bis 2% an der Varianz der Einstellung zum Asylgesetz. Dieser Erklärungsbeitrag ist dabei unabhängig vom Einfluss von Kognitionen und Kontrollvariablen. Betrachtet man die Affekteinflüsse genauer, wird deutlich, dass negative Emotionen gegenüber Asylbewerbern die Präferenz für eine Asylgesetzverschärfung verstärken. Umgekehrt schwächen positive Emotionen die Präferenz für eine Asylgesetzverschärfung ab. Dabei fällt wiederum auf, dass der negative Effekt stärker ist als der positive. D.h. über alle Befragungswellen sind negative affektive Einflüsse auf die Einstellung deutlich stärker als positive affektive Einflüsse. Zunächst könnte man nun annehmen, dass dieser zwar signifikante, aber geringe Einfluss von Emotionen auf die Einstellung zum Asylgesetz vernachlässigbar sei. Allerdings handelt es sich bei dieser Analyse um einen sehr konservativen Test, da nur der Affekteinfluss auf die Einstellung ausgewiesen wird, der unabhängig von Kontrollvariablen und kognitiven Einflüssen ist. Vernachlässigt wird dabei also der Affekteinfluss, der im Zusammenspiel mit kognitiven Faktoren auf die Einstellung wirkt. Rechnet man dieselbe Regression wie zuvor und bezieht die affektiven Einflüsse als zweiten Block ein und die kognitiven im dritten Block, zeigt sich ein etwas anderes Bild (siehe Tabelle 2). Der Emotionseinfluss, der nach Kontrolle von demographischen Variablen nachweisbar ist, ist erheblich grösser und beläuft sich auf 12 bis 16% erklärte Varianz an der Varianz der Einstellung zum Asylgesetz. D.h. es gibt affektive Einflüsse, die sich indirekt im Zusammenspiel mit kognitiven Einflüssen auf die Einstellung zum Asylgesetz auswirken und durch die erste Analyse aber verdeckt und damit unterschätzt wurden. Betrachtet man zusätzlich die Veränderung der affektiven und kognitiven Einflüsse über die drei Befragungswellen, fällt Folgendes auf: Von der ersten zur zweiten Welle geht der Einfluss von negativen Kognitionen wie auch von negativen Affekten auf die Einstellung zurück. Bei den negativen Affekten gegenüber Asylanten bleibt dann der Einfluss auf die Einstellung auf dem Niveau der zweiten Welle, während der Einfluss von negativen Kognitionen von der zweiten zur dritten Welle wieder auf das Ausgangsniveau steigt. Bei positiven Emotionen wie Kognitionen zeigen sich weniger deutliche Veränderungen. Da die vorliegende Analyse lediglich statischen Charakter hat, wurde mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells überprüft, inwiefern sich die Einflüsse von Kognitionen und Emotionen auf die Einstellung über die Zeit verändern.2 In dieser Analyse stellt sich heraus, dass negative Kognitionen sich in ihrer Erklärungskraft in Bezug auf die Einstellung von der ersten zur zweiten Welle abschwächen, dann in der dritten Welle stabil bleiben. 2 Die Modellierung beschränkte sich dabei auf negative Kognitionen und Emotionen ohne Berücksichtigung von positiven Emotionen und Kognitionen. Erstens liefern positive Emotionen und Kognitionen einen geringeren Erklärungsbeitrag für die Einstellung. Zweitens finden sich kaum bedeutsame Änderungen positiver Emotionen und Kognitionen im Zeitverlauf. Daher wurde auch aus modellökonomischen Gründen bei der Strukturgleichungsmodellierung (autoregressives fixedeffects Modell) darauf verzichtet. Gleichwohl wurden dieselben Kovariaten als zeitinvariante Prädiktoren einbezogen. Tabelle 2 Einfluss von Emotionen, Kognitionen und Kontrollvariablen auf die Einstellung zum Asylgesetz (schrittweise Regression, unstandardisierte Regressionskoeffizienten, Standardfehler in Klammern) Einstellung zur Asylgesetzverschärfung Welle 1 Welle 2 Welle 3 Geschlecht -.06 (.12) .02 (.13) .10 (.13) Alter .00 (.01) .00 (.01) -.00 (.01) Bildung -.10** (.02) -.11** (.02) -.09** (.02) Links-Rechts-Selbsteinschätzung .22** (.03) .25** (.04) .23** (.03) Politisches Interesse -.05 (.01) .02 (.09) .05 (.09) .26** .26** .26** Negative Emotionen .44** (.07) .33** (.07) .35** (.07) Positive Emotionen -.22** (.05) -.21** (.08) -.14** (.08) .16** .12** .13** Negative Kognitionen 1.39** (.08) 1.26** (.08) 1.35** (.08) Positive Kognitionen -.58** (.08) -.54** (.09) -.58** (.09) .15** .14** .15** .57 .52 .54 Einflussfaktoren Block 1: Kontrollvariablen ∆R2 Block 2: Affekt ∆R2 Block 3: Kognitionen ∆R2 Korr. R2 N= Die negativen Emotionen verändern sich im Zeitverlauf jedoch nur tendenziell in ihrem Einfluss auf die Einstellung. Diese Veränderungen insbesondere des kognitiven Einflusses kann man mit Blick auf den Kampagnenverlauf in der Medienberichterstattung interpretieren. Die dreiwellige Befragungsstudie wurde begleitet von einer Inhaltsanalyse der Kampagnenberichterstattung sowie einer Befragung von politischen Akteuren, die für die Kampagnen der jeweiligen Lager verantwortlich waren (vgl. hierzu Kriesi/Bernhard/Hänggli 2008). Insbesondere die Inhaltsanalyse macht deutlich, dass zu Beginn der Kampagne, d.h. zwischen den ersten beiden Befragungswellen, die Gegner der Asylgesetzverschärfung die Kampagne dominierten. Obwohl die Befragten bei der ersten Befragungswelle noch kaum wussten, dass sie im September über die Asylgesetzverschärfung abzustimmen hatten, war der Grossteil der Bevölkerung sehr stark für eine Verschärfung. Diese Präferenz wurde jedoch durch das Ausmaß der Kampagne der Verschärfungsgegner abgemildert. Der Kampagneneinfluss scheint also die Zustimmung zu den Argumenten, die für die Verschärfung sprechen und zumindest auch in der Tendenz die negativen Emotionen gegenüber Asylbewerbern abgeschwächt zu haben. In der zweiten Phase der Kampagne traten dann auch vermehrt die Befürworter der Asylgesetzverschärfung auf den Plan. D.h. in dieser Situation war das Stimmvolk nicht mehr primär den Argumenten der Gegner ausgesetzt, sondern einen zweiseitigen Kommunikation. Die Hauptargumente der Gegner der Verschärfung bezogen sich auf den Menschenrechtsschutz für Asylbewerber sowie die Wahrung der humanitären Tradition der Schweiz. Die Hauptargumente der Befürworter waren zunächst auf Effizienzsteigerung und Missbrauchsbekämpfung im Asylwesen fokussiert. Allerdings zeigt die Inhaltsanalyse auch, dass die Befürworter im Verlauf der Kampagne die Argumentation der Gegner aushebelten. Dies geschah insbesondere dadurch, dass sie in ihrer Argumentation versicherten, die Asylgesetzverschärfung stehe im Einklang mit den Menschenrechten und der humanitären Tradition. Während also in der ersten Phase der Asylgesetzkampagne die Stimmbürgerinnen und –bürger unter dem Kampagneneinfluss der Gegner ein „schlechtes Gewissen“ haben mussten angesichts ihrer anfänglich ausgeprägten Präferenz für eine Verschärfung, wurde ihr Gewissen durch diese Argumentation der Verschärfungsbefürworter in der zweiten Phase entlastet. D.h. die Befürworter lieferten das Argument, dass es dem Stimmvolk erlaubte, zu seiner ursprünglichen Befürwortung der Verschärfung zu stehen. Ob dies nun tatsächlich diejenigen Einflüsse waren, die für das Muster der vorliegenden Ergebnisse ursächlich waren, kann an dieser Stelle jedoch nicht abschließend belegt werden. Dazu sind weiterführende Medienwirkungsanalysen notwendig. 6 Diskussion Die vorliegende Studie belegt erstmals den Einfluss von Emotionen auf politische Einstellungen in Abstimmungskampagnen. Sie ist darüber hinaus eine der wenigen Studien, die Affekteinflüsse über den Verlauf einer Kampagne analysiert. Zusammenfassend zeigt sich, dass positive wie negative Affekte die Einstellung zum Asylgesetz beeinflussen. Der um Einflüsse aus Kontrollvariablen und Kognitionen bereinigte affektive Einfluss ist dabei eher gering. Nun könnte man diesen geringen Einfluss darauf zurückführen, dass Argumente oder Issues die Währung von Abstimmungen sind und affektive Aspekte oder Image-Aspekte bei Wahlen. Diese Annahme greift jedoch aus zwei Gründen zu kurz: Erstens zeigt eine Reihe von Studien ebenfalls nur geringe Emotionseinflüsse selbst wenn es um Wahlen und damit Personalentscheidungen geht. Zum Beispiel ist der Anteil erklärter Varianz an der Kandidatenpräferenz bei Marcus und MacKuen (1993) mit 2% ähnlich gering. Bei Abelson und Kollegen (1982) findet man ebenfalls geringe Erklärungsanteile von affektiven Bewertungen bei einigen Kandidaten. Der geringe Erklärungsanteil von Emotionen an politischen Einstellungen scheint also kein Spezifikum zu sein, das nur bei Wahlen Gültigkeit hat. Wichtig ist aber zu beachten, dass bei der vorliegenden Studie nur Emotionen gegenüber Asylbewerbern berücksichtigt wurden. In dieser Kampagne mag es aber weitere Auslöser für emotionale Reaktionen gegeben haben, z.B. Empörung darüber, wie die Proponenten der Asylgesetzverschärfung Asylbewerber behandeln, Ärger über die gegnerische Kampagne oder Frustration über den Schlagabtausch der Kontrahenten in der Kampagne. Diese Emotionseinflüsse treten vermutlich ebenfalls auf und wirken sich auf die Einstellung zum Thema aus. Diese affektiven Einflüsse konnten jedoch nicht berücksichtigt werden. Es gibt jedoch einen zweiten Grund für die geringe Erklärungskraft von emotionalen Einflüssen auf die Einstellung zum Asylgesetz. In der zweiten Analyse, in der affektive Einflüsse vor den kognitiven zur Vorhersage der Einstellung berücksichtigt wurden, zeigte sich, dass beide Faktoren sich zum Teil überlagern. D.h. affektive und kognitive Anteile sagen zu einem gewissen Teil denselben Anteil der Varianz der Einstellung zum Asylgesetz. Dies deutet darauf hin, dass Affekte und Kognitionen zwar analytisch trennbar sind, empirisch aber Korrelationen auftreten, die dafür verantwortlich sind, dass Affekte und Kognition denselben Anteil erklärter Varianz an der Einstellung von Stimmbürgerinnen und –bürgern aufweisen. Dieser Befund kann zweierlei bedeuten: Einerseits ist es wahrscheinlich, dass die Befragten auf bestimmte Argumente auf eine bestimmte Weise emotional reagieren. Andererseits dürften bei Befragten spezifische Argumente salient werden, wenn diese bestimmte emotionale Reaktionen gegenüber Asylbewerbern verspüren. Beide Effekte sind aus der experimentellen Forschung zu Affekteinflüssen auf politische Urteile bekannt. Beispielsweise zeigt eine Reihe von Studien, dass bei Personen, die negative Emotionen gegenüber Ausländern verspüren, auch eher negative Kognitionen mental verfügbar und abrufbar sind, wenn sie ihre Einstellung kundtun (Forgas 1995). Umgekehrt lässt sich zeigen, dass bei der Konfrontation mit bestimmten Argumentationsmustern bestimmte Emotionen auftreten. Werden beispielsweise im Verlaufe einer Kampagne Ausländer als Kriminelle dargestellt, die missbräuchlich Asyl erhalten haben, dürfte dies die Entstehung negativer Emotionen, wie Angst oder Ärger befördern (vgl. für ähnliche Befunde Gross/d’Ambrosio 2004; Igartua u.a. 2007; Montada/Schneider 1989). Die Befunde der vorliegenden Untersuchung lassen solche Annahmen plausibel erscheinen, allerdings unter anderem Vorzeichen. Die Kampagne der Gegner stellte Asylbewerber als Schutzbedürftige dar und löste vermutlich mit ihrer Kampagne eher Mitleid aus. Die Empfindung von Mitleid mit den Asylbewerbern dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Einfluss negativer Emotion und Kognitionen auf die Einstellung von der ersten zur zweiten Befragungswelle zurückgegangen ist. Darüber hinaus geben die längsschnittlichen Befunde Hinweise auf Kampagnenwirkungen, die in vertiefenden Medienwirkungsanalysen überprüft werden könnten. Es zeigt sich, dass die kognitiven und affektiven Einflüsse auf die Einstellung zum Asylgesetz im Laufe der Kampagne in ihrer Stärke schwanken. Dies deutet auf die Wirkung der Kampagnenkommunikation der Befürworter wie auch der Gegner der Asylgesetzverschärfung hin. Dabei ist die vorliegende Analyse auf Einflüsse auf Einstellungen der Befragten im Aggregat beschränkt. Unberücksichtigt bleiben etwa individuelle Kampagneneinflüsse bei anfänglichen Befürwortern bzw. Gegnern der Abstimmungsvorlage, die sich bei der Analyse von aggregierten Daten gegenseitig aufheben. Diese Einflüsse könnten ebenfalls in entsprechenden Analysen untersucht werden. Letztlich belegt die vorliegende Studie, dass affektive Einflüsse für politische Einstellungen und Präferenzen auch in direktdemokratischen Kampagnen bedeutsam sind. Oft werden diese Emotionseinflüsse aber auch als wenig wünschenswert, erratisch oder irrational abgetan (vgl. hierzu etwa Marcus 2002). Dies kann man als die dysfunktionale Perspektive auf die Rolle von Emotionen bei der politischen Urteilsbildung verstehen. Im Unterschied dazu geht eine funktionale Perspektive hingegen davon aus, dass emotionale Reaktionen bei politischen Entscheidungen wichtige Funktionen für das Individuum erfüllen: Emotionale Reaktionen im Zusammenhang mit einem spezifischen politischen Thema können das Individuum zum einen darüber informieren, ob eine bestimmte Situation oder ein Einstellungsobjekt positiv oder negativ für das Individuum ist. Darüber hinaus haben Emotionen eine motivationale und handlungsvorbereitende Funktion (vgl. hierzu Keltner & Haidt 1999). Ob eine solche Handlung allerdings ausgeführt wird, hängt vom Ausmaß der kognitiven Kontrolle von Individuen ab. Dementsprechend sind affektive Reaktionen nicht einfach „irrationale“ Reaktionen von Individuen, die wenig über das Thema wissen und sich durch emotionale Appelle in der Kampagne lenken lassen. Erstens erweisen sich affektive Einflüsse als weniger volatil als kognitive und sind damit vermutlich doch nicht so leicht durch eine Kampagne zu beeinflussen. Zweitens, wie Zusatzauswertungen zur vorliegenden Studie nahe legen, ist der Affekteinfluss auf die Einstellung keine Funktion des Wissens über die Kampagne, der Bildung oder der Parteineigung. Drittens deuten die Korrelationen zwischen Affekten und Kognitionen darauf hin, dass aus beiden Reaktionen gleichgerichtete Einflüsse auf Einstellungen resultieren. Herrscht allerdings Inkonsistenz zwischen kognitiven und affektiven Bewertungen im Hinblick auf ein Einstellungsobjekt, dann dürfte der affektive Einfluss in seiner Bedeutung steigen. Dies haben beispielsweise Kepplinger und Maurer (2005) im Zusammenhang mit der Präferenz für Schröder nachgewiesen. 7 Literatur Abelson, Robert P./Kinder, Donald R./Peters, Mark D./Fiske, Susan T. (1982): Affective and semantic components in political person perception. In: Journal of Personality and Social Psychology 42, 619-630. Baumeister, Roy F./Bratsavsky, Ellen/Finkenauer, Catrin/Vohs, Kathleen D. (2001): Bad is stronger than good. In: Review of General Psychology 5, 323-370. Conover, Pamela J./Feldman, Stanley (1986): Emotional reactions to the economy: I’m mad as hell and I’m not going to take it anymore. In: American Political Science Review 30, 50-78. Dalto, Carol A./Ossoff, Elizabeth P./Pollak, Richard D. (1994): Processes underlying reactions to a campaign speech: Cognition, affect, and voter concern. In: Journal of Social Behavior and Personality 9, 701-713. Breckler, Stephen J./Wiggins,Elizabeth. C. (1989): Affect versus evaluation in the structure of attitudes. Journal of Experimental Social Psychology 25, 253-271. Forgas, Joseph P. (1995): Mood and judgment: The affect infusion model (AIM). In: Psychological Bulletin 117, 39-66. Granberg, Donald/Brown, Thad A. (1989): On affect and cognition in politics. In: Social Psychology Quarterly 52, 171-182. Gross, Kimberly/D'Aambrosio, Lisa (2004): Framing emotional response. In: Political Psychology 25, 1-29. Haddock, Geoffrey/Zanna, Mark P. (1998): Assessing the impact of affective and cognitive information in predicting attitudes toward capital punishment. In: Law and Human Behavior 22, 325-339. Haddock, Geoffrey/Zanna, Mark P. (1993): Predicting prejudicial attitudes: The importance of affect, cognition, and the feeling-belief dimension. In: Advances in Consumer Research, 20, 315-318. Igartua, Juan J./Otero, José/Muñiz, Carlos/Cheng, Lifen/Gómez, José (2007): Efectos cognitivos y afectivos de los encuadres noticiosos de la immigración. In: Igartua, Juan J./Muñiz, Carlos (Hrsg.): Medios de comunicación, inmigración y sociedad. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 197-232. Jenkins, Richard/Mendelsohn, Matthew (2001): The news media and referendums. In: Mendelsohn, Matthew/Parkin, Andrew (Hrsg.): Referendum democracy: Citizens, elites and deliberation in referendum campaigns. Houndmills: Palgrave, 211-230. Kaid, Lynda L. (2004): Political advertising. In: Kaid, Lynda L. (Hrsg.): Handbook of politicalcommunication research. Mahwah: Erlbaum, 155-202. Karger, Cornelia R./Wiedemann, Peter M. (1998): Kognitive und affektive Komponenten der Bewertung von Umweltrisiken. In: Zeitschrift für Experimentelle Psychologie 45, 334344. Keltner, Dacher/Haidt, Jonathan (1999): Social functions of emotions at four levels of analysis. In: Cognition and Emotion 13, 505-521. Kepplinger, Hans M./Maurer, Marcus (2005): Abschied vom rationalen Wähler. Warum Wahlen im Fernsehen entschieden werden. Freiburg: Verlag Karl Alber. Kriesi, Hanspeter (2005): Direct democratic choice: The Swiss experience. Lanham: Lexington. Kriesi, Hanspeter/Bernhard, Laurent/Hänggli, Regula (2008): Coalition formation in direct-democratic campaigns: a case study of the vote on the Swiss asylum law. NCCR Working Paper No. 12 (abrufbar unter http://www.nccrdemocracy.uzh.ch/nccr/publications). Kuklinski, James H./Riggle, Ellen/Ottati, Victor C./Schwarz, Norbert/Wyer Jr., Robert S. (1991): The cognitive and affective bases of political tolerance judgments. In: American Journal of Political Science 35, 1-27. LeDuc, Lawrence (2002): Referendums and elections. How do campaigns differ? In: Farrell, David M./Schmitt-Beck, Rüdiger (Hrsg.): Do political campaigns matter? Campaign effects in elections and referendums. London: Routledge, 145-162. Marcinkowski, Frank (2007): Media system and political communication. In: Klöti, Ulrich/Knoepfel, Peter/Kriesi, Hanspeter/Linder, Wolf/Papadopoulos, Yannis/Sciarini, Pascal (Hrsg.): Handbook of Swiss politics. 2nd Edition. Zürich: NZZ Publishing, 381-402. Marcus, George E. (2002). The sentimental citizen. Emotion in democratic politics. University Park: Pennsylvania State University Press. Marcus, George E./MacKuen, Michael B. (1993): Anxiety, enthusiasm, and the vote: The emotional underpinnings of learning and involvement during presidential campaigns. American Political Science Review 87, 672-685. Mittendorf, Volker (2002): Qualitative Unterschiede in der Wahl- und Abstimmungskampfkommunikation. In: Schiller, Theo/Mittendorf, Volker (Hrsg.): Direkte Demokratie. Forschung und Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 276-287. Montada, Leo/Schneider, Angela (1989): Justice and emotional reactions to the disadvantaged. In: Social Justice Research, 3(4), 313-344. Opp, Klaus.-Dieter (1986): Soft incentives and collective action: Participation in the antinuclear movement. In: British Journal of Political Science, 16, 87-112. Ottati, Victor (1997): When the survey question directs the retrieval: Implications for assessing cognitive and affective predictors of global evaluation. In: European Journal of Social Psychology 27, 1-21. Schoen, Harald (2006): Beeinflusst Angst politische Einstellungen? Eine Analyse der öffentlichen Meinung während des Golfkriegs 1991. In: Politische Vierteljahresschrift 47, 441-464. Stangor, Charles/Sullivan, Linda A./Ford, Thomas E. (1991): Affective and cognitive determinants of prejudice. In: Social Cognition 9, 359-380. de Vreese, Claes H./Semetko, Holli A. (2004): Political campaigning in referendums: Framing the referendum issue. London: Routledge.